Zeitschrift Flugsport: Jahrgang 1913 als digitaler VolltextDie Zeitschrift „Flugsport“ war die illustrierte, flugtechnische Zeitschrift für das gesamte Flugwesen und wurde im Zeitraum von 1909 bis 1944 von Oskar Ursinus herausgegeben. Über alles, was die zivile und militärische Luftfahrt betraf, wurde im Abstand von 14 Tagen ausführlich berichtet. Jedes Heft widmete sich auch den Themen Modellflug, Literatur, Bücher, Patente, Luftwaffe, Flugzeugtechnik sowie Luftverkehr im Inland und Ausland, etc. Auf dieser Seite werden alle Hefte aus dem Jahrgang 1913 in Textform dargestellt. Die Heftinhalte wurden in den Jahren 2019 bis 2020 neu retrodigitalisiert und mittels elektronischer Texterkennung in ein internetfähiges Leseformat umgewandelt. Obwohl es bei der Digitalisierung und automatischen Konvertierung mit der maschinellen Text- und Bilderkennung zwangsläufig zu Text-, Format- und Rechtschreibfehlern gekommen ist, weil Abbildungen, Textpassagen oder Tabellen leider nicht immer korrekt dargestellt werden, ist damit dennoch der kostenlose und barrierefreie Zugang zur Geschichte der Luftfahrt für das Jahr 1913 gewährleistet.
Volltext oder PDF Dokumente Die genannten Text-, Format- und Rechtschreibfehlern sind in den ursprünglichen Digitalisaten der Originalzeitschrift selbstverständlich nicht enthalten. Diese Digitalisate der Originalzeitschrift stehen zusätzlich als PDF Dokumente in hoher Auflösung zum Herunterladen zur Verfügung. Die PDF Dokumente beinhalten alle Einzelhefte eines Jahresganges und können ausgedruckt werden, komfortabel vergrößert werden oder in eigene Publikationen hereinkopiert werden. Jeder Jahrgang von 1909 bis 1944 ist für eine Download-Gebühr in Höhe von 30,00 Euro jederzeit im „Dokumenten-Online-Shop“ der Firma Digital River GmbH erhältlich. Wer also nur einmal „Herumstöbern“ und Nachlesen möchte, was über die zivile und militärische Luftfahrt berichtet wurde, kann dies nachstehend kostenlos tun. Wer hingegen alle Einzelhefte mit tausenden von Tabellen, Fotos und Abbildungen als hochauflösendes PDF Dokument erhalten möchte, um damit wissenschaftlich zu arbeiten, um die Fotos und Abbildungen auszuschneiden oder um Textpassagen ordentlich zu zitieren, kann dies für einen fairen Preis via „Sofort-Download“ machen. Download der Zeitschrift als PDF Dokument
» Dokumenten-Online-Shop « Natürlich gibt es immer wieder Geizhälse, die alles kostenlos und für umsonst erwarten. Jene Zeitgenossen mögen bitte einmal den Kopier- und Gebührenaufwand berücksichtigen, der entstehen würde, wenn sie selbst in deutschen Bibliotheks- und Universitätsarchiven alle Ausgaben der Zeitschrift Flugsport für nur einen Jahrgang als Duplikat bestellen würden. Die Jahresbände, die als PDF Dokumente erhältlich sind, beinhalten meist über 1.000 Seiten, so dass der Kopieraufwand mehrere tausend Euro betragen würde. Insofern gibt es an der mehr als fairen Download-Gebühr nichts zu kritisieren. Bei der Firma Digital River GmbH handelt es sich übrigens nicht um einen ostasiatischen „Fake-Shop“, sondern um einen absolut seriösen Spezialanbieter, der das Herunterladen digitaler Dokumente via „Pay per Download“ ermöglicht. Die Zahlung erfolgt beispielsweise über Kreditkarte, PayPal oder über viele andere Zahlungsdienste. Dies hat den Vorteil, dass die Dokumente innerhalb weniger Sekunden nach der Online-Bestellung als Download-Link via E-Mail versendet werden. Weil der alte Spruch „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ gilt, gibt es natürlich Leseproben. Wer nicht die sprichwörtliche „Katze im Sack“ kaufen und sich vorher über die Qualität der PDF Dokumente informieren möchte, dem stehen die drei Leseproben von Heft 22/1919, von Heft 23/1933 und von Heft 4/1944 kostenlos zur Verfügung.
Anmerkungen zum Kopierschutz Sowohl der breiten Öffentlichkeit als auch dem Fachpublikum steht mit den Inhalten dieser Internetseite ein reichhaltiges, kostenloses und barrierefreies Archiv zur deutschen, europäischen und internationalen Luftfahrtgeschichte zur Verfügung. Um jedoch dem „digitalen Wildwuchs“ und dem Bilderklau im Internet vorzubeugen, sind Fotos mit einem Rautenmuster (Raster) kopiergeschützt. Wer Fotos aus der Zeitschrift Flugsport verwenden möchte, kann hierzu die qualitativ hochwertigen PDF Dokumente erwerben, die keinerlei Wasserzeichen oder Kopierschutzmuster enthalten. Nachstehend sind alle Verweise zu den einzelnen Jahrgängen aufgeführt, die im „Dokumenten-Online-Shop“ zum „Sofort-Download“ zur Verfügung stehen. Mit Mausklick auf den jeweiligen Jahrgang öffnet sich die Angebotsseite des Online-Shops.
PDF 1909 | PDF 1910 | PDF 1911 | PDF 1912 | PDF 1913 | PDF 1914 | PDF 1915 | PDF 1916 | PDF 1917 | PDF 1918 PDF 1919 | PDF 1920 | PDF 1921 | PDF 1922 | PDF 1923 | PDF 1924 | PDF 1925 | PDF 1926 | PDF 1927 PDF 1928 | PDF 1929 | PDF 1930 | PDF 1931 | PDF 1932 | PDF 1933 | PDF 1934 | PDF 1935 | PDF 1936 | PDF 1937 PDF 1938 | PDF 1939 | PDF 1940 | PDF 1941 | PDF 1942 | PDF 1943 | PDF 1944  technische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef. 4557 Amt I. Oskar UrslnUS, Civilingenieur. Tel.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig Wtägig. ■■ . = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ■ ■ ■ . 1,1 ϖ ■■ = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 22. Januar. Ausblick. Nationalflugspende. Im Jahre 1913 dürfte sich auf dem Gebiete des Flugwesens der Einfluß der Nationalflugspende bemerkbar machen. Die 7,5 Millionen Mark in der besten "Weise zu verwenden, ist Aufgabe des Komitees für die Spende. Die Aufgabe ist nicht leicht und die Verantwortung sehr groß. Man scheint aber den richtigen "Weg gefunden zu haben. Die gesammelten Beträge, welche mit der ausdrücklichen Bestimmung zur Beschaffung von Flugmaschinen eingegangen sind, müssen hierfür verwendet werden. Und dieser Teil ist beträchtlich. Er wird vorläufig dem dringendsten Bedürfnis abhelfen. Ein weiterer Teil wird zum Ausbau der Versuchsanstalt in Adlershof verwendet werden. Für den übrig bleibenden Teil, ca. 5 Millionen, scheint man den allerbesten Zweck gefunden zu haben, das ist die Ausbildung von Civil-Fliegern. Hiermit wird der Traum vieler seit Jahren für das Flugwesen Begeisterten, selbst zu fliegen, in Erfüllung gehen können. Selbstverständlich gestaltet sich das Fliegen in der Praxis weit anders, als es sich der Einzelne in seiner Fantasie vorstellt. Es hat sich jedoch gezeigt — und wir könnten viele Fälle davon anführen — daß aus manchem für die Fliegerei begeisterten Schwärmer zum Ende, nachdem er die Flugschule absolviert hatte, ein solider, nüchterner und vorsichtiger Flieger geworden ist. Deren gibt es viele. Selbstverständlich werden, wenn beispielsweise 600 Flieger ausgebildet werden, von diesen ein großer Teil ausscheiden. Am Ende werden dann 100 wirklich brauchbare besonders befähigte Flieger aus der Ausbildung hervorgehen. Und das ist, was wir brauchen. Wenn wir bedenken, daß von 350 auagebildeten Fliegern, welche Deutschland besitzt, in Wirklichkeit nur noch 50 fliegen, so genügt dieser Prozentsatz bei weitem nicht, um den großen Anforderungen, die die weitere Entwicklungsmöglichkeit des Flugwesens verlangt, gerecht zu werden. Was nützen uns die Flugmaschinen, unsoro hochentwickelte Industrie, wenn wir nicht genügend Flieger besitzen? Die Enlwicklungsmöglichkeiten der Flugmaschine im Jahre 1913 werden hauptsächlich mehr in der Verfeinerung der Konstruktion und vor allen Dingen in der Vergrößerung unserer Flugmaschinentypen zu suchen sein. Militärmaschinen unter 100 PS werden wohl in Zukunft kaum noch gekauft werden. Auch auf den Flugveranstaltungen dürften in der Hauptsache starke Maschinen sich zeigen. Während noch vor 1 — 2 Jahren für 50 PS Motoren, selbst gebrauchte Motoren, 5000 Mark bezahlt wurden, sind dieselben jetzt regulär für 1800 Mark erhältlich. Das Angebot überschreitet hierbei die Nachfrage. Anders bei den großen 100 PS Motoren. Hier muß man mit Lieferfristen von V« Jahr und mehr rechnen. Das Besultat der Kaiserpreis- Motorenprüfung wird nicht ohne Einfluß auf die oben erwähnten großen Maschinen sein. Es ist wohl kaum anzunehmen, daß ohne den Kaiserpreis die Motoreuindustrie so intensiv gearbeitet hätte. Die Zeit wird auch nicht mehr fern sein, wo man sich daran wagt, Riesenmaschinen mit mehreren Motoren zu bauen. Ein Versuch wurde ja bereits von Loutzkoy gemacht. Auch die Engländer glauben jetzt, durch große Maschinen mit großem Aktionsradius die Verwendungsmöglichkeiten der Flugmaschinen zu vergrößern. In mehreren englichen Werkstätten ist man zur Zeit mit der Konstruktion von derartigen Maschinen beschäftigt. Die englische Militär-Verwaltung scheint jetzt zur Einsicht gekommen zu sein und will den grolien Eückstand hinter anderen Ländern mit Gewaltmitteln ausgleichen. Ob es ihr gelingen wird, ist eine zweite Frage, Man kann nicht wissen, ob durch diese gewaltigen Anstrengungen die englische Industrie die deutsche überflügeln wird. — Eine der wichtigsten Aufgaben der Konstrukteure ist der Bau von Wasserflugmaschinen. Neben großen seetüchtigen Wassermaschinen wird auch ein Bedürfnis für kleine handliche Wassermaschinen, unter Umständen mit vom Führersitz zusammenlegbaren Flügeln, vorhanden sein.  MX. Der neue Henry Farman-Doppeldecker (Hierzu Tafel I.) weicht von der alten Bauart erheblich ab. Die Tragdecken weisen eine nach außen zunehmende Verjüngung auf und erwecken den günstigen Eindruck technisch verfeinerter Formgebung und Werkstattarbeit. Die 3 m langen Ausleger des Oberdecks sind nicht wie früher mittels Stahlrohr oder Holzstreben abgestützt, sondern infolge Anwendung einer Spannsäule e von oben und unten her verspannt und können durch Ablösen der oberen Verspannung leicht heruntergeklappt werden. Die an den Auslegern befindlichen Klappen für die Schräglagensteuerung sind zwangläufig mittelst Seilzügen verbunden. Das Fahrgestell ist breitspurig und hat zwei in Gummiringen aufgehängte Räderpaare. Die sonst vom Motorrahmen schräg nach den Kufen gehenden Streben  Farman-tA ilitärtyp, Oben rechts: der Apparat im Flage. sind fortgefallen. Dafür ist, wie aus der Seitenansicht zu ersehen, die sonst vorhandene Diagonalverspannung' durch eine dritte Strebe ersetzt worden, sodaß ein vollständiger spanndrahtloser Dreiecksverband erreicht worden ist. Der Motorrumpf enthält drei Sitze und zeigt in seinem torpedoartig zugespitzten Vorderteil ein Maschinengewehr a aufmontiert. Unterhalb der Gondel befindet sich der von dem Ilöhensteuerhebel schwenkbare kScheinwerfer b, der für Nachtfahrten bestimmt ist. Hinter den Sitzen befindet sich das elyptisch gestaltete Benzin- und Oelreservoir c. Der Benzin verrat beträgt 68 1, der Oelvorrat 32 1. Am hinteren Ende des Rumpfes ist ein 80 PS Gnom angebracht. Kr treibt eine Druckschraube von '2,5 m Durchmesser und 1,9 m Steigung an. Bei 1200 Umdrehungen in voller Fahrt erreicht dieser Doppeldecker eine maximale Geschwindigkeit von 110 km/Std. Das Gewicht der betriebsfertigen Maschine mit Flieger und vollständigem Betriebsvorrat von Benzin und Oel aber ohne Fluggäste beträgt 335 kg. Die beiden Haupttragflächen haben 36 qm Flächeninhalt. Die tragende Schwanzfläche hat 3 qm, die Höhensteuerklappen 1,6 qm und das Seitensteuer 1,1 qm Flächeninhalt. Die Schwanztragfläche und ihre Aggregate sind durch zwei ein wenig sich verjüngende Gitterträger verbunden. Dieselben laufen, wie aus dem Grundriss der Tafel I zu ersehen ist, in der Seitensteuerachse zusammen. Die Schwanztragfläche ist oben aufgelegt und durch die Klötzchen d in den entsprechenden Elevationswinkel gebracht. Ferner ist noch zu bemerken, daß die Schwanztragfläche in ähnlicher Weise wie die Ausleger von oben und unten her unter Vermeidung von Abstützungen verspannt ist. Aus der Ecke von Adlorshof hört man noch immer das gleichmäßige Knattern der Versuchsmotoren, die für den Kaiserpreis ihre Stunden abzubrummen haben. Die Prüfungen^dürften'bald beendet sein, Aus dem Johannistlialer Fliegerlager.  \  -W4 1 V  Der Fokker-Eindedter im Fluge. Interessant sind die verschiedenen Lagen der Maschine in den Kurven. Rechts oben sieht man den Führer mit hochgehobenen Händen. In der Mitte: Fokker. Gegen Ende des Jahres 1912 wurde wenig geflogen. Hier und dort öffneten sich die jSchuppen, um neue Maschinentypen auszuprobieren. Die Werkstätten sind überfüllt mit JVlen Resultaten der 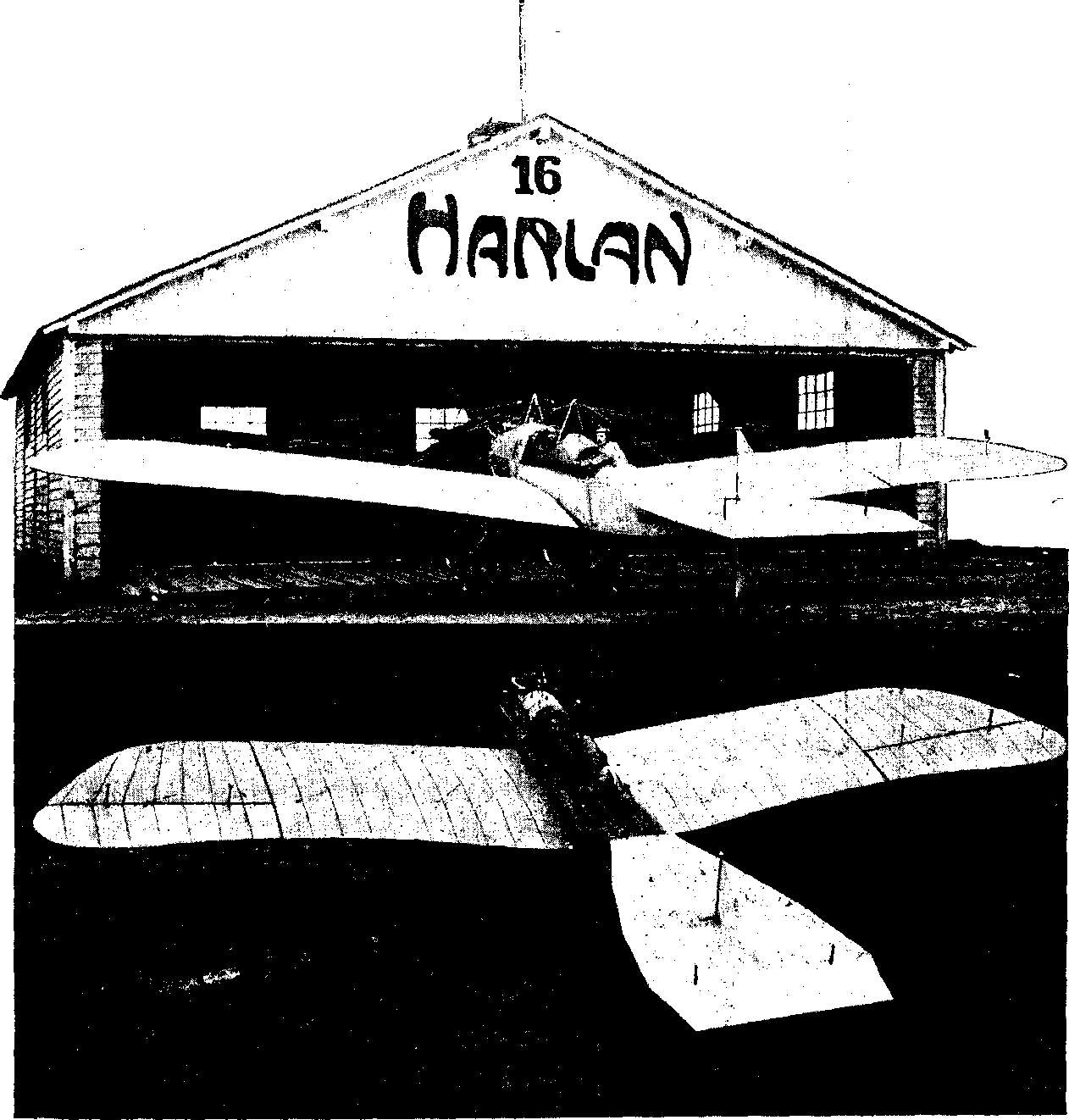 Militär-Einde&er Harlan. Winterarbeit. Die Maschinen gehen ihrer Vollendung entgegen. Die Formgebung der Maschinen läßt erkennen, daß man überall bestrebt war, den Luftwiderstand zu verringern. Dunetz probierte einen neuen [Harlan-Eindecker und erfüllte die militärischen Abnahmebedingungen in „guter'Form. Ernst Rtöffler erlangte am 21. Dez. sein Flugmaschinen-Fiihrer-zeugnis. Stoff ler ist bei der Luft-Verkehrs-Gesellschaft in Dienst getreten. Am gleichen Tage abends 10 Uhr vollführte Han uschke einen Nachtflug. Er umkreiste 15 Minuten lang in 250 m Höhe den Flugplatz und landete dann glatt dicht in der Nähe des zur Erleuchtung des Fluplatzes angezündeten Feuers. Am 3. Januar bestand der Flieger Lt. Mayer vom 139. Inf.-Eegt. auf Fokker-Eindecker die Flugmaschinen-Führerprüfung. Die Fokker-Aeroplanwerke erhielten vor einigen Tagen Auftrag auf 2 Militär-Maschinen. In den Werkstätten von Fokker ist auch eine Wasserflugmaschine im Bau.  Etridi-Eindedter Militärtyp II. 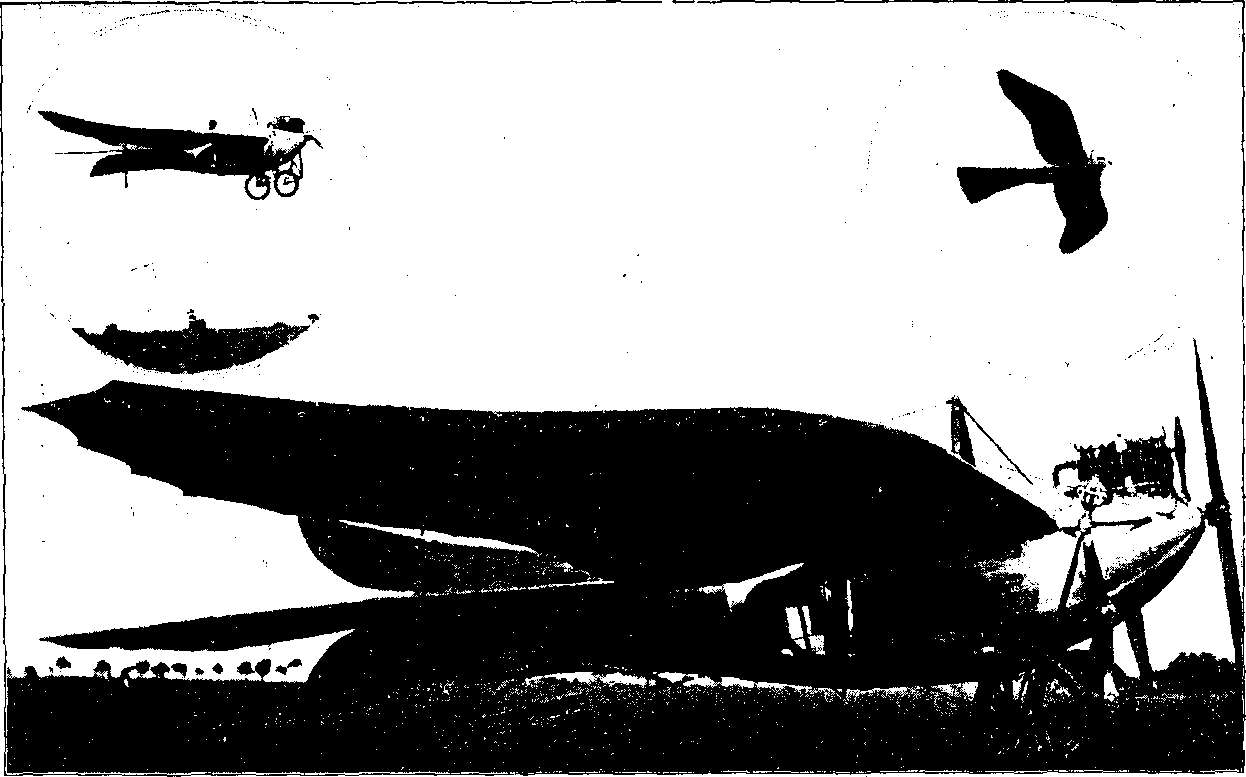 Etrich-Eindedter mit Stahlrohrflügeln. Oben : Der Apparat im Fluge. In den Schuppen der Sport-Flieger G. m. b. H. sieht man einige sehr schöne neue. Typen, u. a. eine Stahltaube, bei welcher der Führer- und Beobachtersitz nebeneinander angeordnet sind. Großbetrieb herrscht bei den Albatroswerkon , wo Vü Dutzend Doppelstahl-Tauben mit Sechszylinder-Motoren sowie x/2 Dutzend Stahldoppeldecker, über die hier nicht gesprochen werden kann, soeben die "Werkstätten verlassen. Durch die mit Beginn dieses Jahres zu den verschiedenen Fliegerschulen kommandierten Offiziere wird jetzt regerer Flugbetrieb einsetzen. Flieger im Balkankrieg. Der heroische Tod des Militärpiloten Topraktchieff. Topraktchieff hatte den Auftrag erhalten, über Adrianopel einen Erkundigungsflug auszuführen. Er versuchte Gewißheit zu erlangen, ob die Türkon einen Ausfall vorbereiten. Der unerschrockene Flieger flog mit großer Schnelligkeit in Schleifen über Adrianopel und ging bis 60 m herab. Bei seiner Rückkehr bemerkte man, daß die Flügel des Apparates von 8 Geschossen und die Schutzhaube des Motors von 5 Geschossen getroffen waren. Topraktchieff teilte seine Erkundungen mit und flog ein zweites Mal fort. Aber diesesmal wurde er von einem heftigen Gewehrfeuer empfangen. Plötzlich sah man eine große Flamme von dem Apparat aufsteigen und eine Rauchwolke hüllte denselben ein. Entschlossen, sein Leben so teuer wie möglich zu verkaufen, lenkte der Flieger seine Maschine auf eine Gruppe türkischer Kavallerie, von der er mehrere tötete. Als man den Körper des Fliegers aus den Trümmern der herabgestürzten Maschine herauszog, hielt er noch den Revolver umklammert. Er hatte sich selbst den Tod gegeben, ehe er die Erde berührte, um nicht lebend in die Hände der Feinde zu fallen. Leistung des Leutnant Montoussis. Leutnant Montoussis hat, wie aus Preveza berichtet wird, auf seinem Farman-Gnom Janina in 1100 m Höhe überflogen. Sein Apparat wurde von 10 Kugeln durchbohrt, jedoch ohne Schaden zu nehmen. Am 28. Dez. 1912 setzte Montoussis seine Flüge auf Maurice Farman, Type Militär mit 70 PS Renault und Henri Farman mit 80 PS Gnom fort. Die Landungsplätze dort sind sehr selten und außerordentlich schlecht, da das Land sehr gebirgig ist. Aas den französischen Wasserflug-Werkstätten. In Frankreich rüstet man sich etwas eifriger als in früheren Jahren für die 1913 stattfindenden Wasserflug-Wettbewerbe. Das von Farman herausgebrachte fliegende Boot (s. Flugsport No. 25 1912) ist inzwischen auch flügge geworden und hat einige Flüge ausgeführt. (S. umstehende Abb.) Allerdings ist das Fahrgestell nicht hochziehbar eingerichtetet. Auch dürfte Farman mit seinem etwas zu stark kiel-förmig ausgeführten Boot manche Schwierigkeiten zu überwinden haben. 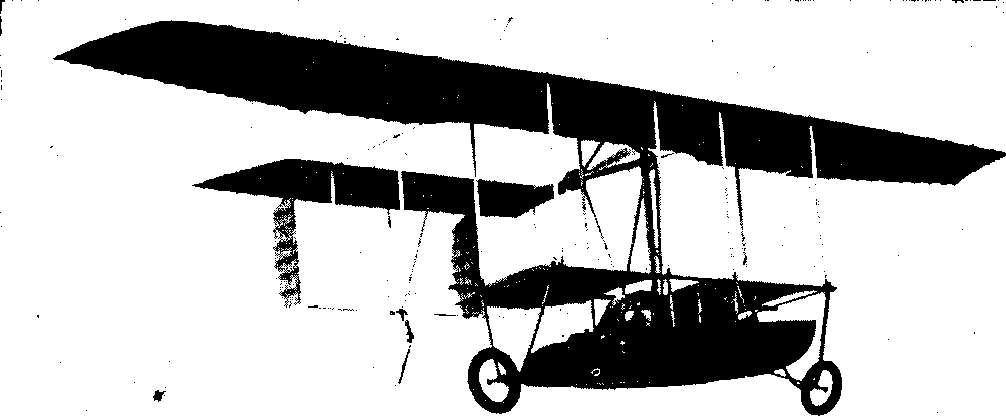 Wasserflugmaschine Farman. Savaiy hat seinen Zweidecker gleichfalls auf Schwimmer gesetzt und in eine Wasserflugmaschine umgebildet. Die Spannweite dieser Maschine beträgt 15 m, die Länge 10 m und das Tragfläehenareal 60 qm. Die  Wassermaschine Savary. Oben : Seitenansicht, unten : der Apparat von hinten beim Start. Schwimmer haben eine Gesamtlänge von 3 m. Das Fahrgestell ist hochziehbar eingerichtet- Die beiden Schrauben werden durch einen 70 PS Labor-Motor angetrieben. Zur Unterstützung des Schwanzes dient ein besonderer Hilfsschwimmer. Besonders eifrig wird in den Spezialwerkstätten für "Wasserflug-niaschinen von Paulhan-Curtiss gearbeitet. Das neue Paulhan-Curtiss Flugboot von 11,3 m Spannweite und 517 kg Gewicht hat sich sehr gut bewährt. Die Trag- 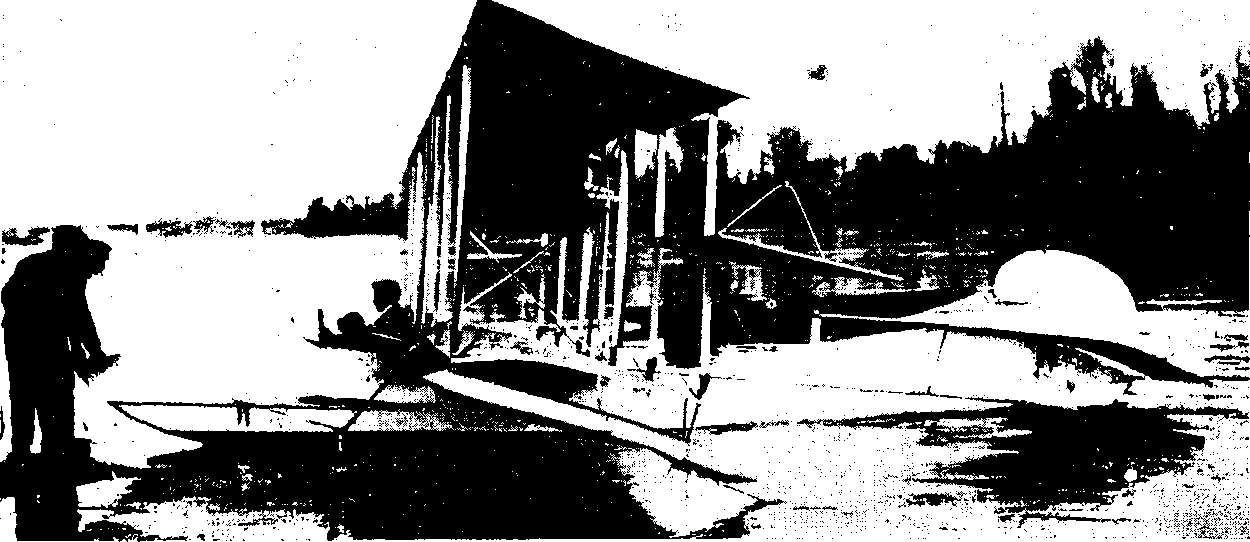 Paulhan-Curtiss Wasserdoppeldecker. Seitenansicht.  Paulhan-Curtiss Wasserdoppeldecker. Ansicht von vorn. deckentiefe beträgt in der Mitte 1,73 m und an den Seiten 1,52 m. Das Flugboot entwickelt mit dem 80 PS Gurtiss-Motor eine Stundengeschwindigkeit von 100 km. Curtiss hat jetzt mit seinen früheren Grundsätzen gebrochen und hat auch eine Stufe angeordnet. In den "Werkstätten von Donnet-Leveque wird emsig gearbeitet. Sie haben in einem Monat für Oesterreich vier "Wasserflugmaschinen bauen und liefern können: zwei 80 PS und zwei 50 PS. 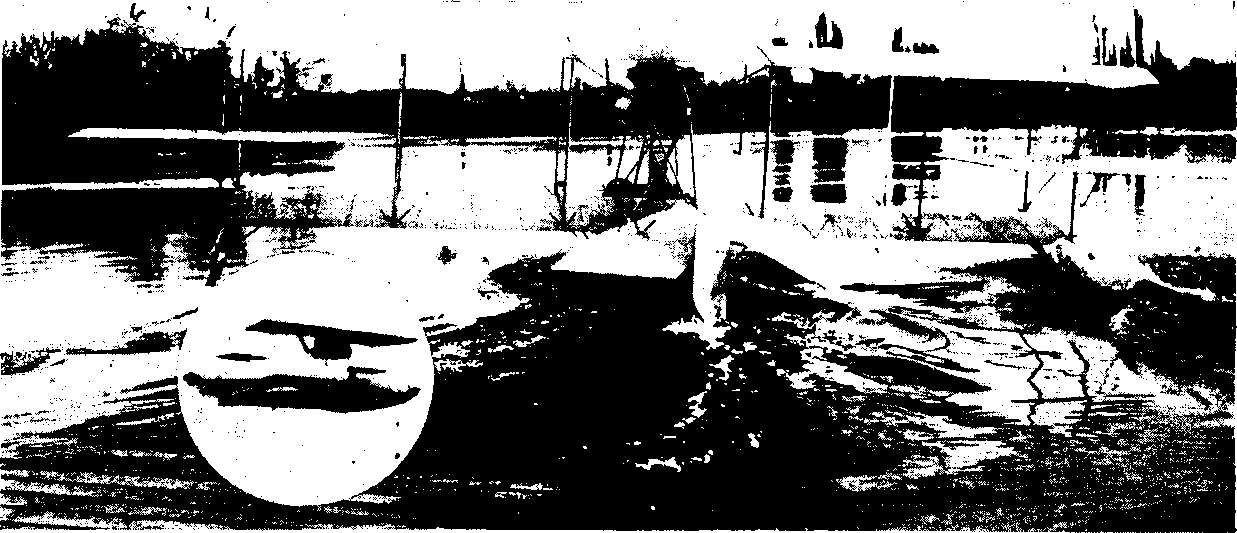 Paulhan-Curtiss Wasserdoppeldedser. Oben: Ansicht von hinten. Links unten: der Apparat im Fluge. Oesterreich besitzt 5 Wasserflugmaschinen Donnet - Leveque. Augenblicklich arbeitet man eine andere Wasserflugmaschine für die Werkstätten Whitehead in Fiume aus. Enten-Type Bleriot. Bleriot hat sich in Frankreich, wohl verärgert durch verschiedene Vorgänge, von der Oeffentlichkeit etwas zurückgezogen und arbeitet unentwegt in seinen Werkstätten an verschiedenen neuen Konstruktionen. Außer dem bekannten im „Salon" ausgestellten Torpedo-Eindecker hat Bleriot schon vor einigen Wochen einen neuen Typ herausgebracht. Dieser Eindecker nach dem Typ der Ente, basierend auf dem Prinzip der Neigungswinkeldifferenz, besitzt einen torpedoartig geformten Gitterrumpf. Vorn ist ein rohrartiger Teil angeordnet, an welchem die Dämpfungsfläche und das Höhensteuer befestigt sind. Der Führersitz befindet sich an der Vorderkante der Tragdecke. Oberhalb der Tragdecke sieht man auf der nebenstehenden Abbildung eine Dämpfungsfläche und das Seitensteuer. Unter dem Rumpf ist eine vertikale Dämpfungsfläche angeordnet. Die Schräglagensteuerung wird durch Verwinden der Tragdecken betätigt. Das Fahrgestell ist das normale von Bleriot, nur daß bei vorliegender Konstruktion eine besondere Stoßkufe, in der Mittte angeordnet, vorgesehen ist. Zum Betriebe dient ein hinter den Trag-deeken montierter 70 PS Gnom-Motor. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Eine traditionelle Sitte will, daß man beim Abschluß eines Jahres gewissermaßen ein Prognostikon für das begonnene Jahr aufstellt. Der Blick in die Zukunft ist freilich nicht jedermanns Gewerbe, und das Prophezeien ist bekanntlich eine heikle Sache, besonders wenn man nicht das Richtige trifft. Indessen haben wir bei wiederholten Gelegenheiten auf die schwierige Lage der französischen Flugzeugindustrie hingewiesen und erst gelegentlich der Betrachtung der kommerziellen Resultate des letzten Pariser Salons haben wir die berechtigte Enttäuschung in kurzen Worten skizziert. In der Tat, die Signatur des beginnenden Jahres ist eine unverkennbare Krisis in der französischen Flugzeugindustrie, wie sie für jeden aufmerksamen Beobachter schon seit langem erkennbar war. Zwei der bekanntesten Flugzeugkonstrukteure räumen das Feld: Robert Esnault-Pelterie und Roger Sommer. Ersterer, dessen rotflügelige Eindecker-bekannt genug sind, ist einer der Pioniere des Flugwesens, dem er sich von dessen Beginn an gewidmet hat. Er hat sein Vermögen dabei verloren und nun ist er im Be- 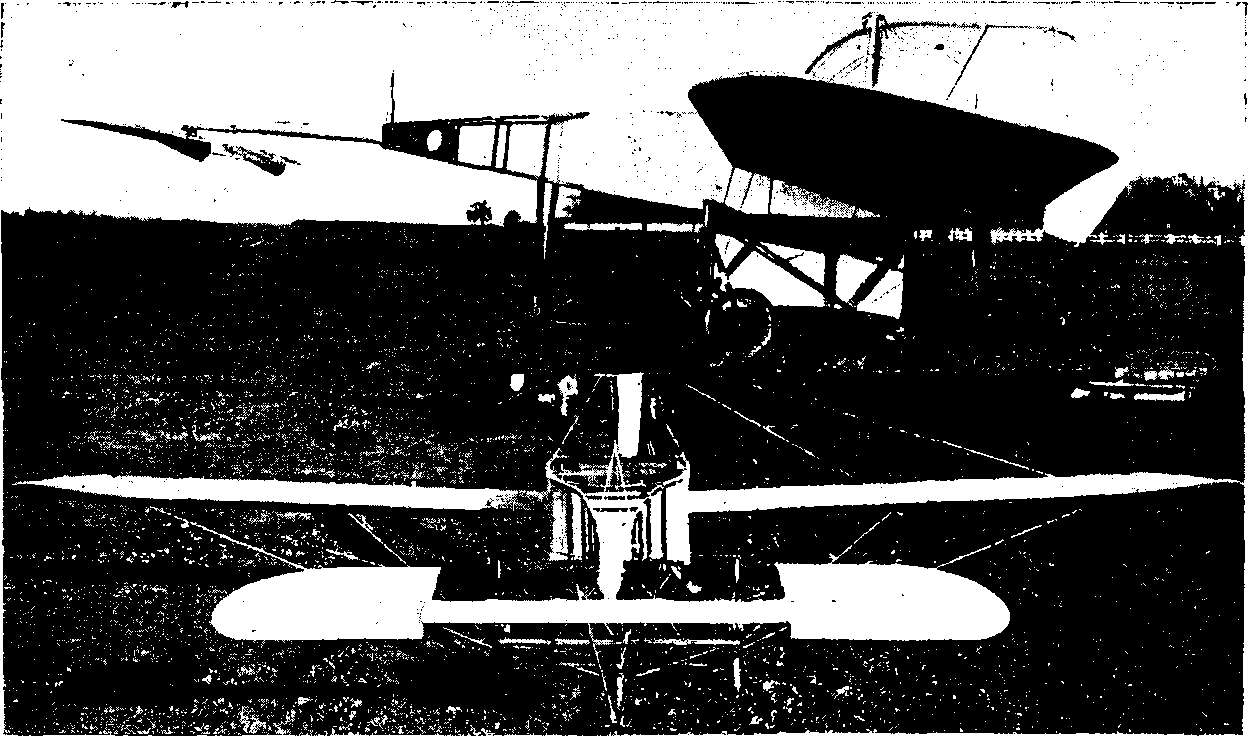 Ententype Ble'riot. Oben: Seitenansicht, unten: Vorderansicht. griff, seinen Betrieb in Billancourt, der als musterhaft galt, aufzulösen. Allerdings sind einflußreiche Personen am Werke, die Verhältnisse zu sanieren, sodaß es nicht unmöglich erscheint, daß die Fabrik ihren Betrieb fortsetzt. Endgiltig dagegen ist der Rücktritt Roger Sommers. Sommer war nicht vom Geschick begünstigt; auch er hat sich dem modernen Flugwesen von Anfang an gewidmet, ohne aber in Frankreich so recht durchdringen zu können, obgleich  Enten-Type Bleriot. Bleriot hat sich in Frankreich, wohl verärgert durch verschiedene Vorgänge, von der Oef'fentlichkeit etwas zurückgezogen und arbeitet unentwegt in seinen Werkstätten an verschiedenen neuen Konstruktionen. Außer dem bekannten im „Salon" ausgestellten Torpedo-Eindecker hat Bleriot schon vor einigen Wochen einen neuen Typ herausgebracht. Dieser Eindecker nach dem Typ der Ente, basierend auf dem Prinzip der Neigungswinkeldifferenz, besitzt einen torpedoartig geformten Gitterrumpf. Vorn ist ein rohrartiger Teil angeordnet, an welchem die Dämpfungsfläche und das Höhensteuer befestigt sind. Der Führersitz befindet sich an der Vorderkante der Tragdecke. Oberhalb der Tragdecke sieht man auf der nebenstehenden Abbildung eine Dämpfungsfläche und das Seitensteuer. Unter dem Rumpf ist eine vertikale Dämpfungsfläche angeordnet. Die Schräg-lao-p.nstenei-iincr wird durch Verwinden der Trnader-L-pn lTotiitin-f. gewissermaßen ein Prognostikon für das begonnene Jahr aufstellt. Der Blick in die Zukunft ist freilich nicht jedermanns Gewerbe, und das Prophezeien ist bekanntlich eine heikle Sache, besonders wenn man nicht das .Richtige trifft. Indessen haben wir bei wiederholten Gelegenheiten auf die schwierige Lage der französischen Flugzeugindustrie hingewiesen und erst gelegentlich der Betrachtung der kommerziellen Resultate des letzten Pariser Salons haben wir die berechtigte Enttäuschung in kurzen Worten skizziert. In der Tat, die Signatur des beginnenden Jahres ist eine unverkennbare Krisis in der französischen Flugzeugindustrie, wie sie für jeden aufmerksamen Beobachter schon seit langem erkennbar war. Zwei der bekanntesten Flugzeugkonstrukteure räumen das Feld: Robert Esnault-Pelterie und Roger Sommer. Ersterer, dessen rotflügelige Eindecker bekannt genug sind, ist einer der Pioniere des Flugwesens, dem er sich von dessen Beginn an gewidmet hat. Er hat sein Vermögen dabei verloren und nun ist er im Be- 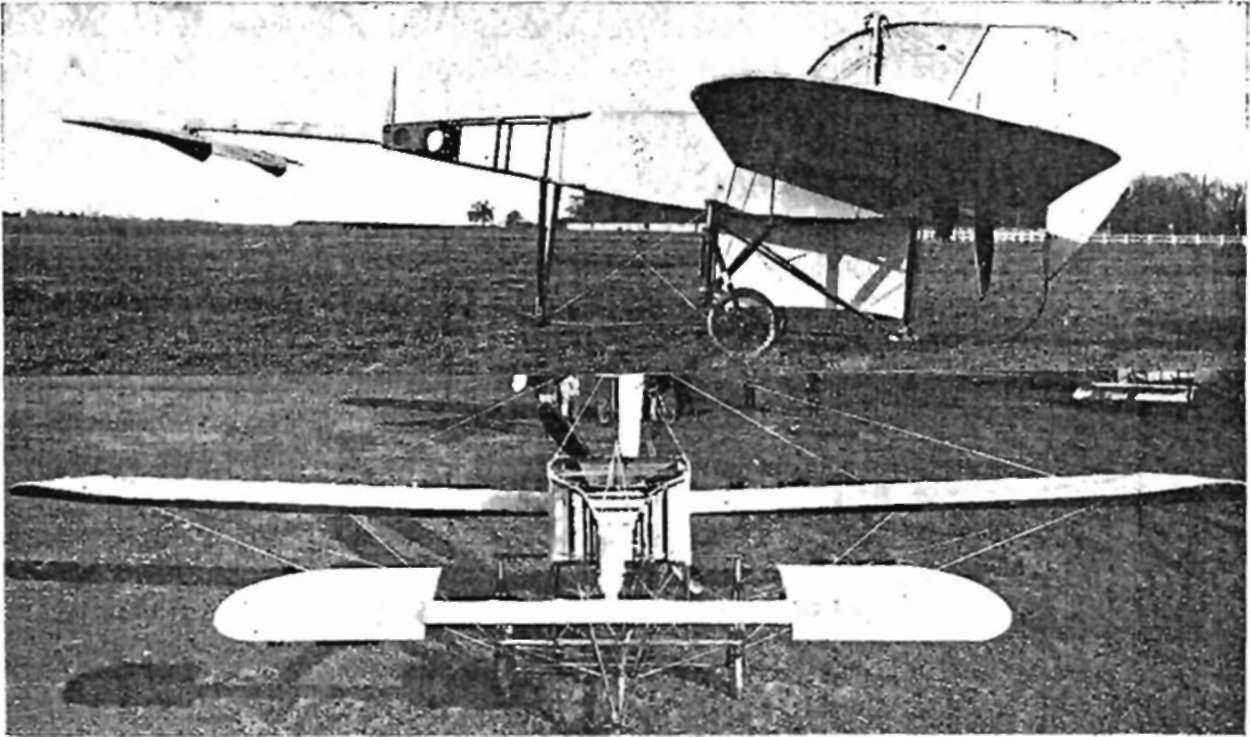 Ententype Bleriot. Oben: Seitenansicht, unten: Vorderansicht. Flieger wie Lindpaintner, Molla, Frey, Tetard, Paillette, Kimmerling und Simon durch ihre sensationellen Flugleistungen die Aufmerksamkeit der interessierten Kreise auf sich gelenkt haben. Der Todessturz seines Freundes Kimmerling im vergangenen Sommer hat den bekannten Konstrukteur aufs schwerste betroffen, und nachdem nun auch die französische Militärverwaltung seinen neuen Stabilisator verworfen hat, ist Roger Sommer zu dem Entschluß gekommen, der Flugzeugkonstruktion Valet zu sagen und sich nunmehr ausschließlich seiner Filzfabrikation, die er in Mouzon betreibt, zu widmen. Ks ist leicht begreiflich, daß diese beiden Ereignisse in französischen industriellen Kreisen lebhaftes Interesse hervorrufen, umsomehr, als erst kürzlich wieder das moderne Flugwesen einige große Triumphe zu feiern imstande war. Zunächst ist es die sensationelle Flugleistung von Garros, der in der Tat seinen Flug von Tunis nach Rom zuwege gebracht hat. Auf seinem Morane-Eindecker flog er von Tunis ab und gelangte am ersten Tage nach Trapani, auf der Insel Sizilien, nachdem er 320 km über das Mittelländische Meer hin zurückgelegt hatte. Es war dies bereits der längste Uebermeerflug, der bis heute ausgeführt wurde, denn, abgesehen von den Kanalüber-querungen, bei denen es sich nur um eine Distanz von 40 km handelte, waren die größten Meerflugleistungen: Loraine von England nach Irland (110 km), Mac Curdy von Kaywest nach Havannah (145 km), Leutnant Bague von Nizza nach Gorgona (204 km), Fels von Buenos Aires nach Montevideo (160 km). In Trapani hat Garros seinen Flug unterbrechen müssen, weil sein Apparat bei der Landung einige Beschädigungen erlitten hatte. Nach zweitägiger Rast aber setzte er seinen Flug fort und gelangte von Trapani, indem er von dort die Nordküste Siziliens entlang über Palermo und Messina flog, nach Italien wo er in San Kuphemia in Kalabrien landete, nachdem er aufs neue nahezu 400 km über Meer zurückgelegt hatte. Am Tage darauf legte er dann den Rest der Strecke zurück; er flog von San Euphemia über Neapel nach Rom, wo er unter dem enthusiastischen Jubel der Bevölkerung anlangte. Diese dritte Etappe stellt eine Distanz von 438 km dar, sodaß die Gesamtentfernung, welche Garros von Tunis nach Rom hinter sich gebracht hat, 1158 km beträgt, die er in 13 Stunden 30 Minuten zurückgelegt hat. Eine andere bemerkenswerte Flugleistung war der Wassermaschinenflug Venedig—Triest—Venedig über das Adriatische Meer den Chemet auf einem Borel-Zweidecker vollbracht hat. Die hierbei zurückgelegte Distanz beträgt 256 km. Am vorletzten Tage des abgelaufenen Jahres hat Eugene Gilbert, der soeben seinen Militärdienst beendet hat, in dem er gleichfalls in dem Fliegerkorps beschäftigt war, auf dem Flugfelde von Etampes neue Geschwindigkeits-Weltrekords von 350 bis 600 km aufgestellt, indem er 350 km in 3:26:16 (bish. Rekord 400 „ „ 3:55:27 „ 450 „ „ 4:24:44 „ 500 „ „ 4:54:OB „ 600 „ „ 5:52:38 „ Pierre Marie 4: 17 : 26) n 4:54:06—4) 5:30:35—3) 6 : 07 : 07—4) M. Fourny 8:07:00) zurücklegte. Die mittlere Geschwindigkeit der 600 km betrug 102 Kilometer die Stunde. Noch einige andere interessante Leistungen sind zu berichten: Gobe vollführte zu Pau auf einem zweisitzigen Nieuport, 60 PS Clerget-Rotativ-Motor, mit 280 kg Nutzbelastung vor der Militärkommission einen Flug von 2 Stunden 5 Minuten Dauer. Besonders interessant war ein Flug, den Poumet am Sylvesterabend über Paris mit einer lichtstrahlenden Flugmaschine unternahm. Die zahllosen Spaziergänger auf den Pariser Großen Boulevards waren nicht wenig erstaunt, als sie plötzlich am dunklen Horizonte ein in vielfarbigen Lichtern erglänzendes Flugzeug sich gespenstisch fortbewegen sahen, das sich wie ein erleuchtetes Schiff in dem unendlichen Luftozean ausnahm. Poumet, der seinen Borel-Eindecker mit Hilfe einiger Akkumulatoren durch viele hunderte über den ganzen Apparat und über die Flügel verteilte elektrische Lampen erleuchtet hat, flog von Issy ab, gelangte in geringer Höhe bis zum Eiffelturm, folgte von dort dem Seinelauf bis zur Place de la Concorde und flog dann die Eue de la Paix entlang bis zur Großen Oper, die er umkreiste, um sich schließlich nach Issy zurückzubegeben. Dagegen ereignete sich zu Villacoublay ein schwerer Unfall, der durch den Zusammenstoß zweier Flugzeuge verursacht wurde. Es befanden sich zur Zeit des Unfalls 7 Flug-maschinen in der Luft. Ein von Collardeau gesteuerter Zweidecker mit dem Sohne des Marineministers an Bord wurde bei einer Kurve von dem durch den siamesischen Offizier Nai Thip gesteuerten Eindecker in etwa 30 m Höhe angefahren. Ein furchtbarer Krach, und beide Flugzeuge mit ihren Insassen stürzten zur Erde. Aus den unentwirrbaren Trümmern der Maschinen zog man die drei Verunglückten hervor, von denen der junge Delcasse am schwersten verletzt war, während Collardeau und der Siamese mit leichteren Verletzungen davongekommen waren. Ein von Maurice Farman an das Aviations-Zentrum von Verdun zu liefernder Zweidecker hat die Reise von Buc nach Verdun in 2 Stunden 25 Minuten zurückgelegt, und zwar mit zwei Passagieren an Bord. Besonders feierlich gestaltete sich die Empfangnahme zweier Luftzeuge seitens des Militärflugwesens, nämlich des Zweideckers „General Faidherbe" in Lille, sowie des durch Subskriptionen der Franzosen in Madagaskar angeschafften Zweideckers Henri Farman, welch letzterer bei der Uebergabe trotz eines 60 km Stundenwindes mit 300 kg Nutzbelastung in 8 Minuten auf 450 m Höhe gestiegen ist. Einige interessante Vorgänge sind auch vom Flugwesen in den Kolonien zu berichten. Das Luftgeschwader von Biskra vollführte dieser Tage eine beachtenswerte Rekognoszierung. Zwei Apparate, von den Leutnants Reimbert und Glien tili gesteuert, beide mit je einem Pas- sagier an Bord, flogen von Biskra zunächst zusammen ab, um bis Tuggurt zu gelangen. Unterwegs mußte Reimbert landen, weil sein Oelreservoir undicht wurde; Cheutin gelangte nach zweistündigem Fluge nach Tuggurt, eine Distanz von 220 km. Noch charakteristischer ist die Flugleistung des bekannten Fliegers, des anamitischen Leutnants Do Hu. Eine französische Kolonne war seit einigen Tagen auf einem vorgeschobenen Posten von den Mai okkanern eingeschlossen und befand sich ohne Lebensmittel und Munition in gefährlicher Lage. General ßrulard organisierte sofort eine Hilfsexpedition, die aber auf den schwierigen Wegen erst in 5 bis 6 Tagen zum Entsatz herankommen konnte. Inzwischen wollte man den Bedrängten die Nachricht zukommen lassen, daß Hilfe unterwegs sei und daß sie mutig aushalten sollten. Do Hu erbot sich, mit seinem Eindecker den Belagerten diese Nachricht zu überbringen. Es gelang ihm in der Tat, über die Feinde hinweg, von denen er lebhaft beschossen wurde, zu den Belagerten zu gelangen, die schon der Verzweiflung nahe waren. Die Nachricht gab ihnen neuen Mut und sie hielten wirklich aus, bis sie von der inzwischen herbeieilenden Ersatzkolonne aus ihrer gefährlichen Lage befreit wurden. Das neue Jahr hat hier einige bemerkenswerte Veränderungen gebracht. Zunächst die Ernennung des Obersten Hirschauer, des Leiters des französischen Militärflugwesens, zum General. Ferner hat die Akademie der Wissenschaften zwei namhafte Geldpreise an Forest, einen Pionier unserer heutigen Explosionsmotoren, und an Fabre, den eigentlichen Schöpfer der Wasserflugmaschine, zugeteilt. Bleriot hat zum neuen Jahre die Grundsteinlegung eines neuen Gebäudes in Buc vornehmen lassen, das später ein veritables Klubhaus werden und allen modernen Komfort aufweisen soll, wie es bisher angeblich noch auf keinem Flugplatze zu finden ist. Die Flieger werden in diesem Möcbll-Fliegerhaus geräumige yereinigungssäle, Bibliotheken, Sport- und Fechtsäle zur Verfügung haben. Große Garagen für Automobile sind vorgesehen und von einer riesigen Terrasse aus wird man einen freien Blick über das ganze Flugfeld haben. Mit dem 31. Dezember sind bekanntlich eine Beihe namhafter Bewerbe abgelaufen und die endgiltige Zuteilung derselben ist in diesen Tagen zu erwarten Aber schon für das neue Jahr weist die vorläufige Bewerbsliste zahlreiche und gut dotierte Bewerbe auf, von denen zu nennen ist der „Michelin-Zielscheibenpreis" (75 0O0 Francs), der „Michelin Pokal" (40.000 Francs), der „Pommery - Pokal" (15.000 Francs), das „Kriterium des Aero-Club" (10.000 Francs), „Von Paris zum Meere" (50.000 Francs), der „Gordon Bennett-Pokal" (100.000 Frs.), das „Meeting von Monako" (30.000 Francs). Hierzu kommt noch ein neuer 50000 Francs-Preis des Marineministers für Marineflugzeuge, der in einem Bewerb auf hoher See vom 20. August dieses Jahres ab zur Bestreitung gelangt. Außerdem hat sich der Minister verpflichtet, die beiden erstklassierten Apparate für 60000 bezw. 50 000 Francs zu erwerben. Das Reglement des Bewerbs soll vom Aero-Club ausgearbeitet werden. Ferner ist ein Internationaler Pokal für Marineflugzeuge (25000 Francs) zu erwähnen, der von J. Schneider gestiftet wurde. JR1. Der Caudron-Doppeldecker ist einer der leichtesten und einfachsten Konstruktionen seiner Bauart. Bei einer Gesamttragfläche von 26 qm benötigt er zum Betriebe nur einen 35 PS Anzani-Motor. Die gleiche Flugmaschinenkonstruktion wird auf Wunsch mit einem 45 PS und 60 PS Anzani, oder mit einem 50 PS Gnom geliefert. Die französische Militärverwaltung hat mehrere Doppeldecker obiger Bauart mit den stärkeren Motoren ausgerüstet im Betriebe. Charakteristisch für diesen Zweidecker ist die 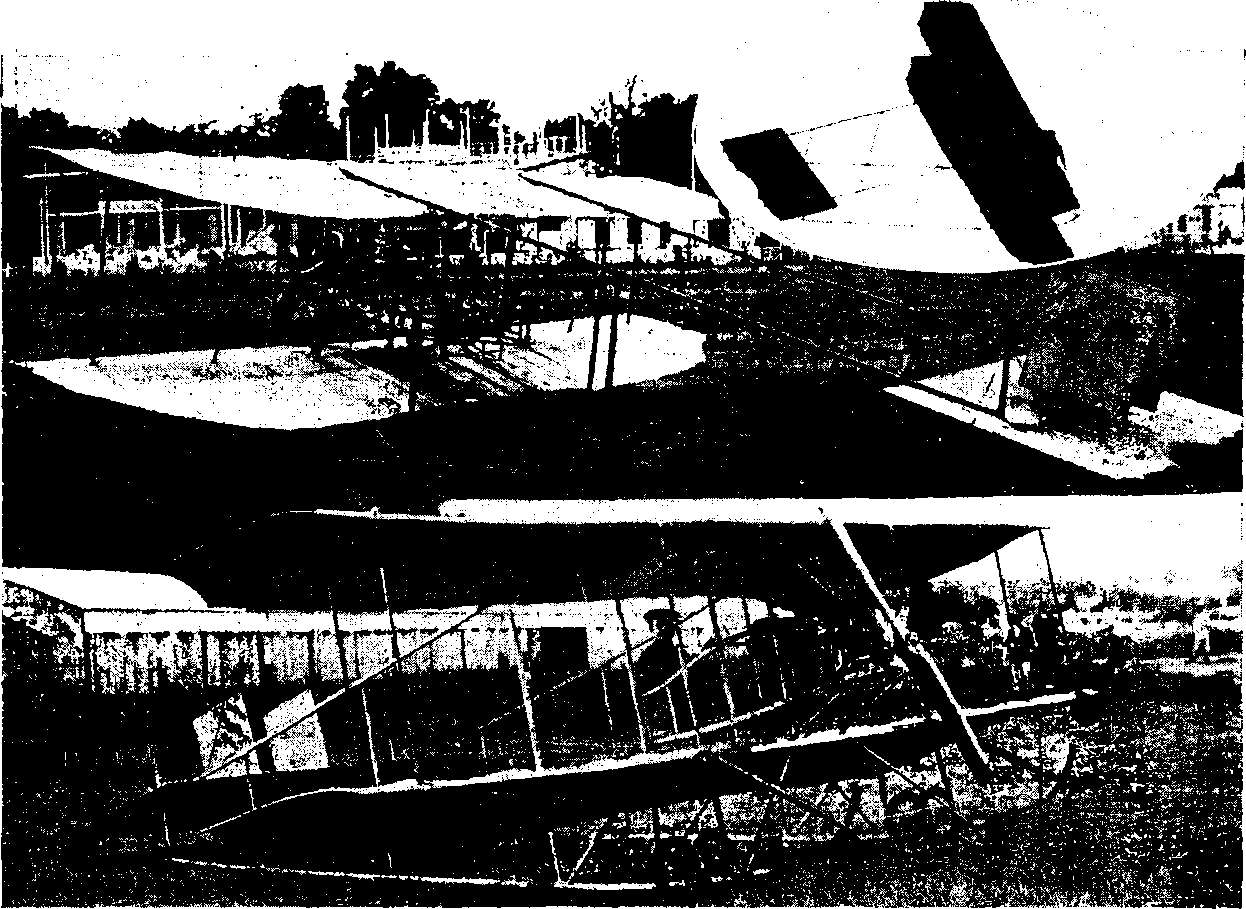 Caudron-Doppeldecker. Oben: Ansicht von hinten, unten: Ansicht schräg von vorn, oben rechts: der Apparat im Fluge. große Geschwindigkeit im Verhältnis zu seiner schwachen Motorleistung, die einfache und solide Bauart und seine Zerlegbarkeit für den Transport. Die Tragflächen. sind, wie aus Tafel II ersichtlich, anderthalbdeckerartig übereinander angeordn et und habsn sehr geringe Flächentiefe im Verhältnis zu ihrer Spannweite. Das obere Tragdeok enthält 12 qm, das darunterliegende 9 qm und die Schwanzfläche 5 qm. Die Rippen sitzen ziemlich dicht beieinander und sind auf ihrem freitragenden Ende elastisch, wodurch ein gutes Abfließen der Luft gewährleistet wird. Vielleicht erklärt sich dadurch die große Geschwindigkeit im Verhältnis zu der geringen Motorstärke. Die Form der Tragdeckrippen ist in einer Detailskizze auf der Tafel dargestellt. Die Schräglagensteuerung wird durch Verwindung der hinteren äußeren Tragdeckenholme, ähnlich wie bei den Wrights, bewirkt. Die Verwindungskabel führen über an den Strebenschuhen anmontierte Rollen r. Die Gleichgewichtslage in der Längsrichtung wird durch Verwindung der Schwanzfläche h korrigiert, während die Seitensteuer s durch Fußhebel eingestellt werden. Die Steuerbetätigungseinrichtung für Schräglage- und Höhensteuerung ist in einer Detailskizze auf der Tafel wiedergegeben. Durch Abdrücken und Rückwärtsziehen des Hebels a wird das Höhensteuer eingestellt, durch Seitwärtsneigen des auf der Achse 1 sitzenden Hebels a die Verwindung betätigt. Die beiden Verwindungs-kabel sind auf zwei Verwindungshebel b und c und an einer Klemmschraube d befestigt. An dem oberen Ende des Steuerhebels a befindet sich ein Kontaktknopf e, welcher es ermöglicht, ohne den Hebel loszulassen, die Zündnng kurzzuschließen. Durch den Gesamtaufbau des Apparates zeigt das Fahrgestell sehr einfache Formen. Die Fahrgestellkufen dienen in ihrer rückwärtigen Verlängerung gleichzeitig als Schwanzträger. Der gitter-förmig ausgebildete Schwanzträger kann durch Lösen einiger Schrauben zwecks Demontage an den Stellen, g und i gelöst werden. Die Befestigung ist in einer besonderen Skizze k dargestellt. Die Räderpaare sind in bekannter Weise an Gummiringen aufgehängt. Der Rumpf nimmt vorn die Motoranlage und hinten die Insassensitze auf. Die so gebildete Gondel ist ein einheitliches Ganzes und kann bequem aus der Zelle herausgenommen werden. Die Schraubenachse liegt ungefähr in der Mitte zwischen den beiden Tragdecken. Zum Betriebe dient meistenteils ein 45 PS Anzani-Motor, avif dessen Welle eine Zugschraube von 2,4 m Durchmesser sitzt. Die Versuchsanlage für den Wettbewerb um den Kaiserpreis für den besten deutschen Flugmotor. Von Dr.-Ing. F. Bendemann. (Schluß.) Diese Wägung ergibt aber zunächst den gesamten Luftwiderstand der umlaufenden Teile, also einschließlich des Ventilationswiderstandes. Um diesen abzusondern, bedarf es, wie bamerkt, noch einer selbständigen Antriebsmaschine für die Schraube. Deshalb sehen die Bestimmungen vor, daß die Arbeitsaufnahme der Schraube mittels einer als Motor laufenden Bremsdynamo nachgeprüft werden kann. .Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel I. 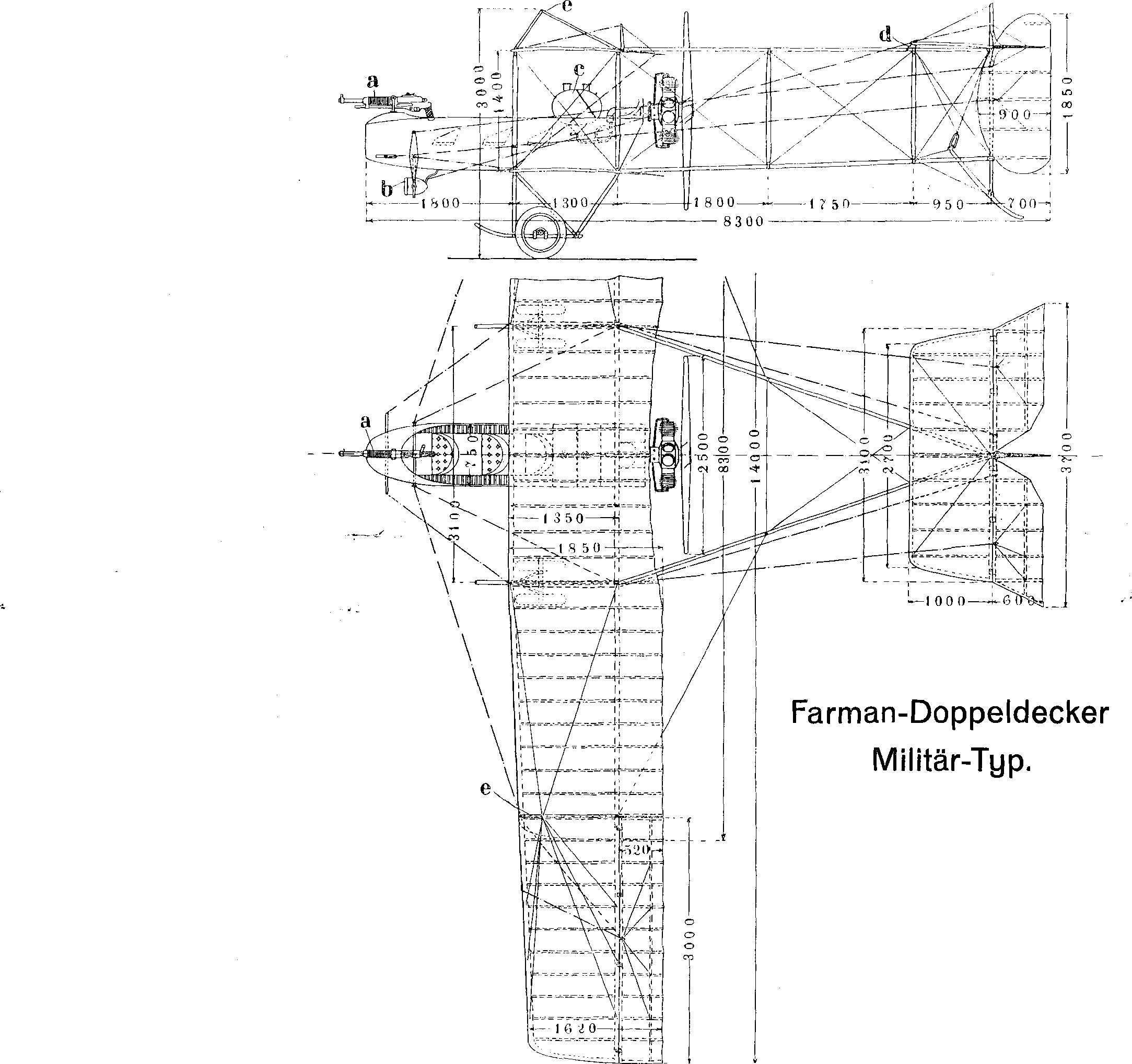 Ferner ist der Motor in Schräglagen zu prüfen, wie sie beim Steigen und Niedergehen des Flugzeuges entstehen : um 10" aufwärts und um 15° abwärts. Dadurch können Vergasung, Schmierung, Zündung usw. gestört werden. Der Motor muß außerdem, besonders beim Niedergehen im Gleitflug, auch stark gedrosselt, langsam laufen und dann schnell wieder in vollen Gang gebracht werden können.' Anderseits soll die Regelbarkeit des Motors auch bis zur zulässigen Höchstgtenze der Drehzahl untersucht werden. Um die luftgekühlten Motoren keinesfalls zu benachteiligen, ist ferner die Anwendung eines zusätzlichen Luftstromes vorgeschrieben, welcher den von der eigenen Schraube erzeugten Luftzug noch steigert, so daß eine Strömung von mindestens 20 m/sec. in der Umgebung des Motors entsteht. So ist dem etwaigen Einwand, daß die Kühlwirkung der Luft bei der Prüfung derjenigen des freien Fluges nicht gleich käme, der Boden entzogen. Freilich bedingt diese Vorschrift die Anwendung noch einer weiteren, von dem zu prüfenden Motor unabhängigen Kraftmaschine. Wir haben einen „Kontroll-Elektromotor" (Bremsdynamo) zur Nachprüfung der Schraubenleistung und einen „Hilfselektromotor" zum Antrieb des Zusatzgebläses. In den erwähnten Punkten enthalten die Bestimmungen verschiedene Kompromisse, die gewiß nicht in jeder Hinsicht voll befriedigend sein können. Versuche auf festem Prüfstand können eben die Verhältnisse des freien Fluges niemals ganz nachahmen, so wenig wie beim Automobil die Verhältnisse der wirklichen Fahrt. Der Flugzeugmotor und seine Kühlvorrichtung steht mit der Schraube und dem ganzen Flugzeug in so vielfacher Wechselwirkung, daß man ihn in letzter Linie überhaupt nicht unabhängig von einem bestimmten Flugzeug prüfen und bewerten kann, wenn man alle Kompromisse scheut. Ein heikler Punkt liegt neben den Luftwiderstandsfragen besonders auch in dem Einfluß der Erschütterungen und Schwingungsvorgänge sowohl auf die Motor- und Schraubenleistung, als auch auf die Betriebssicherheit insbesondere der Wasserkühler. Es liegt auf der Hand, daß man diesen Einfluß auf keiner Prüfeinrichtung nachahmen kann, da er ganz von dem Aufbau des einzelnen Flugzeuges abhängt. Auf einem fahrbaren Prüfstand könnte man wenigstens die Luftwiderstandsverhältnisse besser dem freien Fluge gemäß herstellen, als auf dem festen. Aber bei den großen in Betracht kommenden Geschwindigkeiten erfordert das weitläufige und kostspielige Einrichtungen, die vorderhand nicht zur Verfügung stehen. Sie würden sich auch für Dauerprüfungen von Motoren auf Zuverlässigkeit wenig eignen. Der naheliegende Gedanke, dafür eine große Rundlauf Vorrichtung anzuwenden, wobei der Motor mit der Schraube und dem mehr oder weniger vollständigen Flugzeug am Ende eines langen Armes angebracht, im Kreise herumfährt war nach vielen Erfahrungen zu verwerfen. Es hat sich immer wieder gezeigt, daß man die gradlinige Bewegung durch die Luft auch nicht annähernd richtig durch Kreisbewegung um einen festen Mittelpunkt ersetzen kann. Wer sich näher mit der experimentellen Aerodynamik befaßt hat, weiß, daß ihre Geschichte geradezu eine Kette von fehlgeschlagenen Rundlaufversuchen ist. Immer wieder haben sich tüchtige Forscher und namhafte Ingenieure Uber die großen Fehler dieses Verfahrens getäuscht und viele vergebliche Kosten und Mühe damit vertan. Den Grund sieht man leicht ein, wenn man sich einmal den entsprechenden Vorgang im Wasser vorstellt: Man könnte das Verfahren ja ebenso gut auch für schiffbautechnische Versuche über Schiffswiderstände, Triebschraubenwirkung usw. anwenden, statt der bekannten kostspieligen Modell-Schlcppkanäle. Aber im Schiffbau denkt man gar nicht an das Rundlaufverfahren. Denn jedermann kennt dieStrudelschleppe, die ein Dampfschiff kilometerweit hinter sich herzieht, und das legt die Anschauung von den Vorgängen nahe, die entstehen müssen, wenn ein Versuchskörper im Wasser um einen festen- Punkt kreist. Der Körper fährt beständig in seinem eigenen Kielwasser oder gar in dem kreisenden Strudel, den der Dreharm erzeugt. Im Wasser könnte man diesen noch vermeiden, indem man den Arm über den Spiegel legt. In der Luft kann man nicht einmal das. Deshalb nutzt es auch nichts, den Kreis im Verhältnis zum Versuchskörper recht groß zu machen. Mit der Armlänge wächst auch der luftverdrängende Umriß des Armes gewaltig. Aber in der Luft sieht man nichts von den Vorgängen und nur so erklärt es sich, warum man hier so oft denselben Fehlgriff gemacht hat. Die Versuchsanlage. Für die wichtigste Meßvorrichtung, den zur Messung der Drehmomente vorgeschriebenen Peudelrahmen fehlte es, wie erwähnt, an geeigneten Vorbildern. Von den verschiedenen bekannten Arten hätte in erster Linie die in Abb. 1 und 2 schematisch dargestellte Anordnung in Betracht kommen können, die in vorzüglicher Durchbildung in den Werken des Zeppelin-Luftschiffbau, Friedriciishafen, zur Prüfung der Maybach-Motoren benutzt witd. Sie kennzeichnet sich dadurch, daß die kraftabgebende Motorwelle durch den hohlen Lagerzapfen des Pendelrahmens hindurchgeht; Motorwelle und Pendelrahmenlagerung liegen nämlich in gleicher Achse. Das ist die klarste und 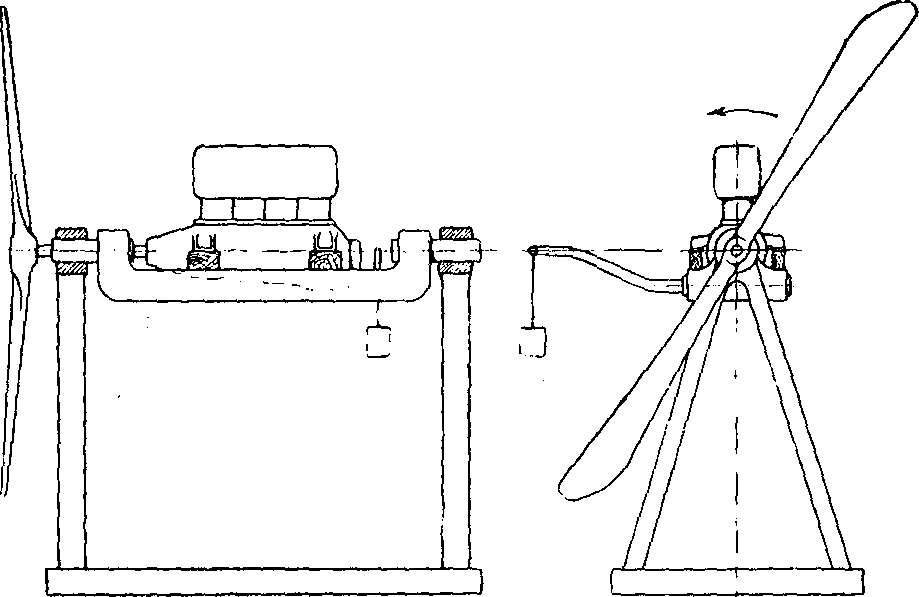 Abb. 1 und 2. Pendelrahmen mit gleichachsig gelagerter Schraubenwelle. (Schema.) allgemein richtige Anordnung. Aber die Motorwelle muß eine genügend freie Länge haben, und das ist bei den Flugzeugmotoren in der Regel nicht der Fall. Vielmehr rückt man die fliegend auf der Welle sitzende Luftschraube natürlich immer möglichst nahe an das Wellenlager heran. Man mußte die Motorwelle also eigens für die Prüfungsversuche verlängern, und das bedeutet einen nicht unerheblichen Eingriff in die Konstruktion Es entsteht die Gefahr von Drehungsschwingungen und Wellenbrüche, zu deren Vermeidung der Motorfabrikant nicht mit Unrecht den Einbau eines sonst nicht nötigen Schwungrades verlangen kann. Vermutlich wäre dann auch noch ein Außenlager nötig, und so wird das anzurechnende Eigengewicht des Motors unsicher. Das mußte unbedingt vermieden und die Einrichtung so getroffen werden, daß man die Motoren ohne jede Aenderung genau so mit ihrer Schraube auf den Prüfstand setzen konnte, wie sie ins Flugzeug eingebaut werden. Um das zu ermöglichen, hilft man sich vielfach mit der in Abb. 3 und 4 dargestellten Anordnung, bei welcher der Motor hoch genug über den Pendellagern liegt, um die Schraubenwelle frei darüber hinweggehen zu lassen. Aber dadurch kann die Messung u. U. fehlerhaft werden, wenn nämlich, wie es leicht sein kann, die Schraubenflügel im oberen und unteren Teil ihres Umganges nicht den gleichen Luftwiderstand finden. Dann wirkt eine zusätzliche Kraft mit dem Hebelarm h auf den Pendelrahmen, welche die Messung fälscht. Der Einfluß dieser Fehlerquelle ist praktisch schwer festzustellen. Deshalb war auch diese Anordnung unbefriedigend, die in verschiedenen Ausführungen im Gebrauch ist, u. a. auch im Laboratorium des Automobilklub von Frankreich, wo sie bei den verschiedenen dort veranstalteten Flugzeugmotor-Wettbewerben benutzt wurde. Die Lösung fand sich durch grundsätzliche Beibehaltung der gleichachsigen Anordnung, wie bei Abb. 1, doch wurde die Pendellagerung durch eine Aufhängung ersetzt, welche die Umgebung der Drehachse vollständig frei lallt, und dem Pendelrahmen doch keine andere Bewegung als die Drehung um diese Achse gestattet. Das System ist in Abb. 5 und 6 schematisch gezeichnet und dadurch leicht zu übersehen. Der den Motor aufnehmende Rahmen hängt mittels zweier Stangenpaare gelenkig an zwei hoch darüber liegenden, unter sich fest verbundenen gleicharmigen Hebeln, von denen der vordere (der Schraube zunächst 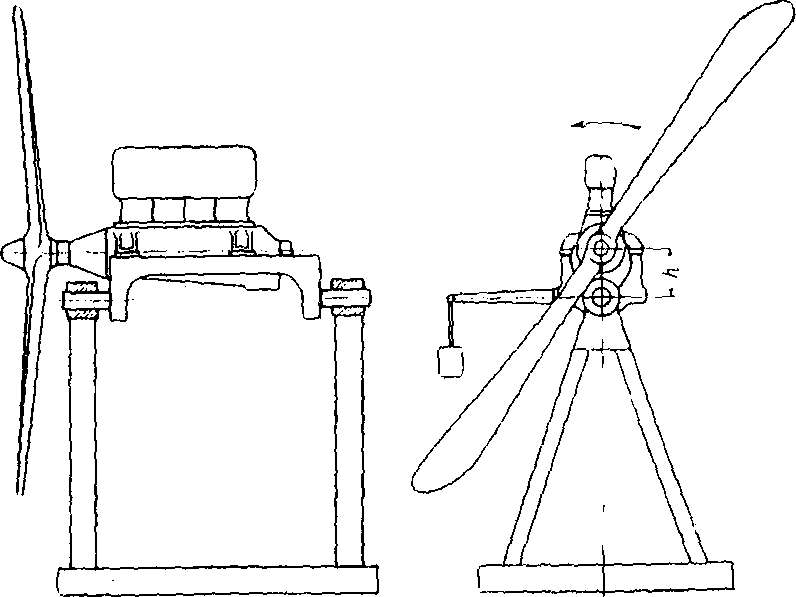 Abb. 3 it. 4. Pendelrahmen mit außerachsig gelagerter Schraubenwelle. (Schema.) 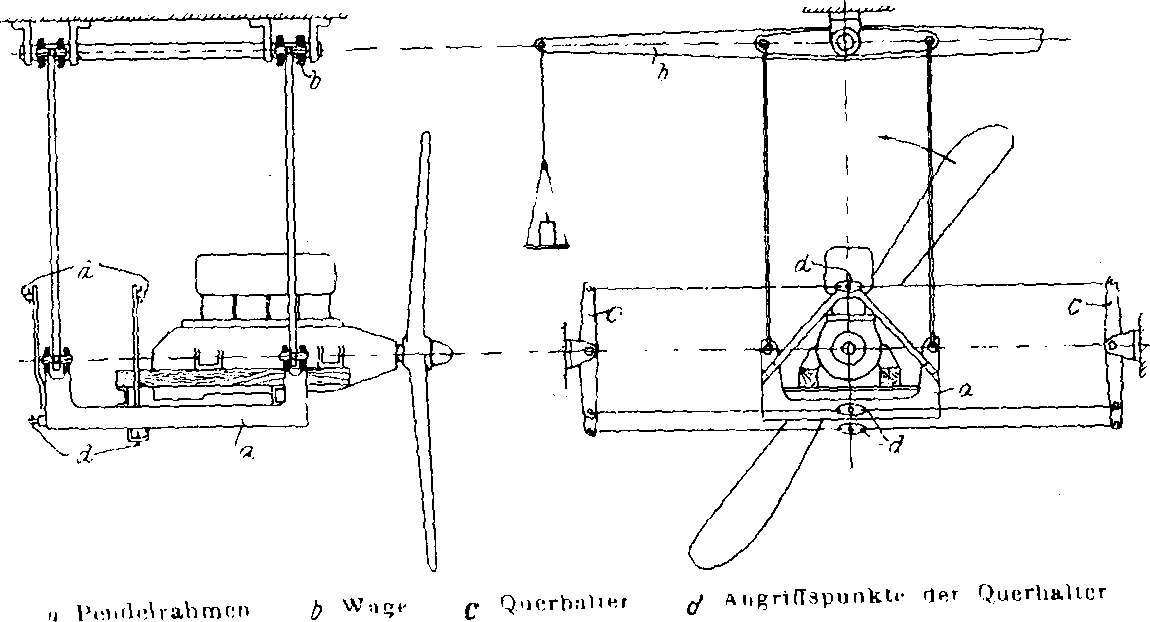 Abb. 5 u. 6. Pendeliahmen mit gleichachsiger aber frei gelegter Lagerung der Schraubenwellen. liegende) als Wage ausgebildet ist. Auf den Rahmen wirkende Drehkräfte übertragen sich, wenn sein Mittelpunkt festgehalten wird, auf die Wage. Die Aufhängung läßt außer der Drehung um diesen Punkt aber zunächst noch seitliche Pendelausschläge zu, wobei sich der Mittelpunkt auf einem Kreisbogen um den oberen Lagerpunkt bewegt. Diese Seitenbewegungen werden durch „Querhalter" verhindert, d. i. durch seitlich gelagerte, doppelarmige Hebel und Zugverbindungen, welche ebenso wie der Wagebalken mit den Hängestangen die Ralimenmitte auf einem Kreisbogen festhalten, der den ersteren schneidet. Somit bleibt dem Rahmen nur die Drehung um seine Achse frei. Die Querhalter sind in verschiedenen Querebenen zur Motorachse und je paarweise ausgeführt, der Symmetrie wegen und vor allem um nur mit Zugverbindungen durch den vom Schraubenstrahl bestrichenen Raum hindurch auszukommen. Nahe dem vorderen Rahmen- ende, wo der Motor steht, lassen sich Angriffspunkte für die Querhai er schwer finden; um sicher zu gehen, sind dafür hinten in einigem axialen Abstände zwei Paare vorgesehen, so daß die Rahmenachse gegen seitliches Abweichen festgehalten ist. Da die Kreiselkräfte der Schraube ohnehin einem seitlichen Ausschwingen entgegenwirken, so wäre wahrscheinlich schon ein einziges Querhalterpaar hinten genügend.*) Zu aller Sicherheit sind aber sogar vorn noch Hebel vorgesehen, von denen aus man von Fall zu Fall, je nach der Form des Motors, 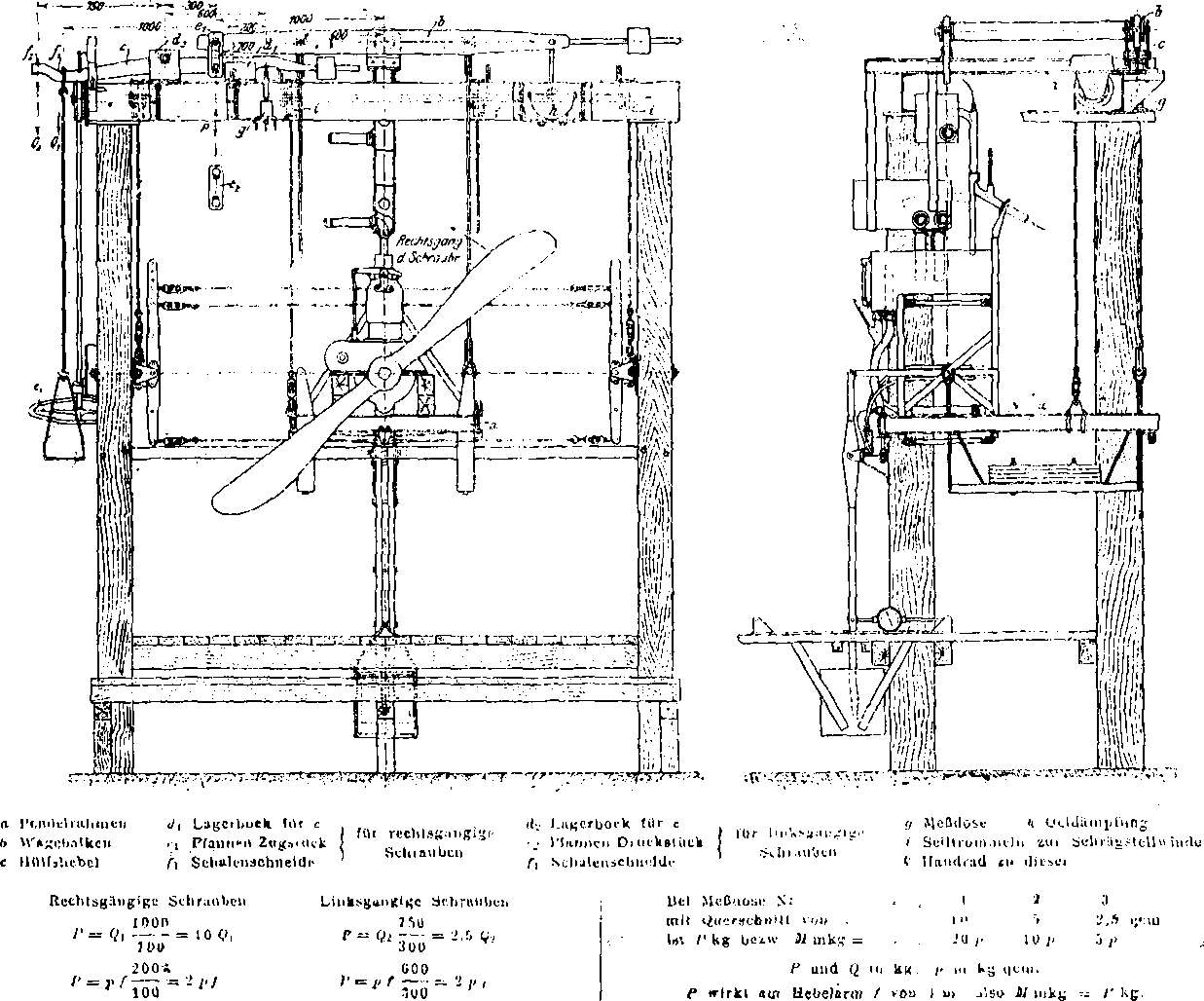 Abb. 7 u. 8. auch hier noch einen Querhalter herstellen kann. Die Querhalter haben, wie leicht ersichtlich, stets nur geringe Kräfte aufzunehmen. Deshalb kann die Reibung in ihren Gelenken nicht viel ausmachen. Uebrigens ist bei den starken Erschütterungen im Betrieb von Reibungseinfliissen überhaupt nicht viel zu befürchten. Die Gelenke der Hängestangen sind als Kreuzgelenke ausgebildet (Abb. 7 und 8), so daß der Rahmen auch in axialer Richtung Freiheit hat und man die Schubkraft der Schraube bzw., wenn diese unabhängig angetrieben wird, den Luftwiderstand des Motors beobachten kann. Dazu dient der aus Abb.. 8 links ersichtliche senkrechte Hebel, welcher unten in ein Dämpfungsgefäß taucht, über dem Fußboden mit einem Zugmesser und oben in Richtung der Pendelachse durch Kugelgelenk mit einem Bügel verbunden ist, der seinerseits durch zwei wagerechte Drehzapfen in der Verbindungslinie der hinteren Aufhängungspunkte an den Rahmen bzw. den auf diesem befindlichen Aufbau angelenkt ist. Der Bügel bleibt also in seiner wagerechten Lage, auch wenn man den Rahmen um die hintere Aufhängungslinie herum auf- oder abwärts schwenken läßt. Das geschieht nämlich, um den Motor in die verlangten Schrägstellungen *) Das hat sich bei den Vorversuchen sofort bestätigt. Es wird tatsächlich nur ein einziges Querhalterpaar benutzt. No. 1 „FLUGSPORT". Seite 21 zu bringen. Man entfernt dazu das vordere Hängestangenpaar und hängt den Rahmen, wie in Abb. 7 linksseitig und in Abb. 8 gezeichnet, vorn an Seilen auf, die von zwei oben liegenden Rollen herabkommen. Diese Rollen sitzen auf einer oben quer durchgehendenWelle; man kann sie mittels Schneckentrieb durch das in Abb. 7 links sichtbare Handrad drehen und so den Rahmen auf und ab schwenken, sogar während der Motor läuft. Dieser etwas kühne Versuch ist mit einem schweren 120 pferdigen Motor in vollem Gange anstandslos gelungen. Er wird im Wettbewerb bei allen Motoren durchgeführt. Die Querhalter müssen die Schwenkbewegung natürlich mitmachen. Deshalb sind ihre Lager an Trägern befestigt, die sich ihrerseits um in der Schwenkachse liegende Zapfen drehen können und vorn ebenso wie der Pendelrahmen an Seilen und Rollen hängen. Die pendelnde Aufhängung an leichten Stangen bezw. Seilen hat vor der festen Aufstellung auf einem soliden Bock o dgl. noch insofern einen großen Vorzug, als man über die Erschütterungsfreiheit und die Mängel des Massenausgleiches nach dem bloßen Augenschein ein sehr zutreffendes Bild erhält. Die Anordnung der Drehkraftwage ist aus Abb. 7 ersichtlich. Um nicht mit zu großen Gewichten hantieren zu müssen, ferner um bei rechts- und linksläufigen Motoren von derselben Seite des Prüfstandes her beobachten zu können, schließlich, um die Wägung in beiden Fällen durch ein und dieselbe Druckmeßdose selbsttätig auszeichnen zu lassen, ist noch ein Zwischenhebel angeordnet, welcher auf einfache Weise durch Umsetzen seiner Drehpunktpfannen und durch Umtauschen seines Druck- und Zuggehänges bewirkt, daß die Kräfte an ihm stets im gleichen Sinne und in bezug auf die Meßdose auch stets im gleichen Verhältnis wirken. Die Gewichtsschale wird beim Umwechseln auf die etwas weiter außerhalb in Abb. 7 sichtbare Schneide gehärgt; der Maßstab ändert sich dabei um das Vierfache, so daß Irrtümer ausgeschlossen sind. Die Wage ruht auf kräftigen, eisernen Trägern, die quer über starke, fest im Boden verankerte Holzpfosten gelegt sind. Als Anschlag zur Begrenzung der Rahmendrehungen und zugleich als Lagerbett für die Benzin- und Oelzuleitungen u. dgl. dient ein hinter dem Rahmen quer an den Pfosten befestigter I-Träger. Einstellbare Muttern auf kräftigen, am Rahmen befestigten Bolzen geben diesem beliebige Bewegungsfreiheit Zum Einbau des Motors und zu den Vorversuchen wird an den vorderen Pfosten ein ähnlicher Träger befestigt und der Rahmen auch vorn festgelegt. Der Aufbau des Pendelrahmens trägt ein Blechgefäß mit Wasserstandszeiger, aus dem das Kühlwasser der Pumpe des Motors zufließt. Bestimmungsgemäß ist der Spiegel darin '/'. m über Wellenniitte zu hallen. Durch das eine der beiden von oben eintauchenden Rohre wird ihm das Wasser stets im Ueberschuß 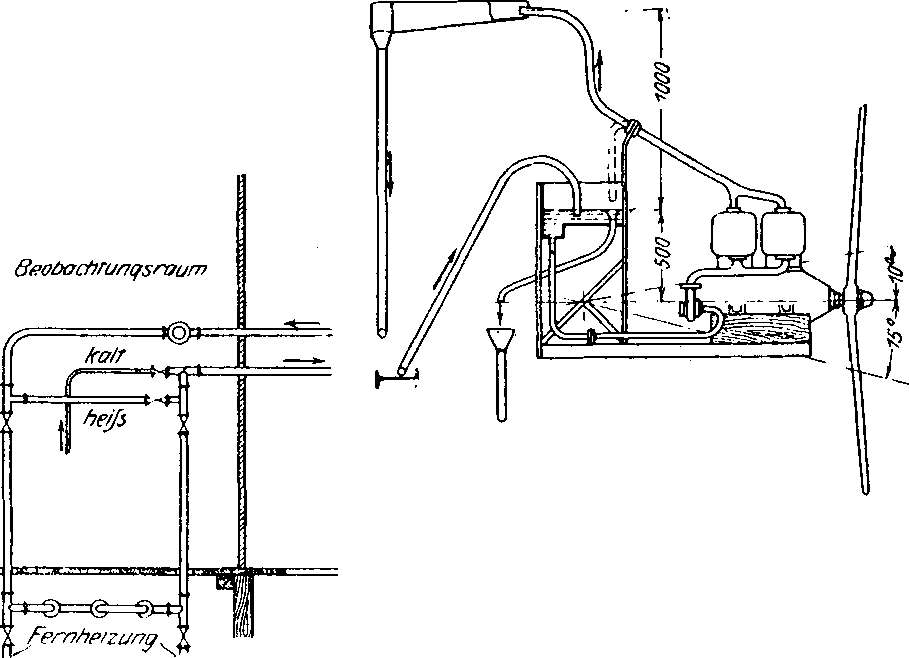 Abb. 9—10 Kühlwasserkreislauf. Seile 22 .FLUGSPÜRT' No. I zugeführt; ein von unten hineinragendes Ueberlmifrohr entfernt den Ueberschiili. Das mit Thermometer versehene Rohr führt zum Motor.*) Weiter oberhalb sieht man zwei Gefäße, die nicht auf dem Pendelrahmen, sondern an dem festen Gerüst befestigt sind. In eines von diesen ergießt sich das vom Motor kommende erwärmte Kühlwasser. Die Ausgußrohre ragen frei beweglich hinein. Da sie in der Ebene der Pendelachse liegen, hat der Rückdruck des Strahles keinen Einfluß auf die Drehkraftmessung. Das oberste Gefäß dient für die Dauerversuche mit vollem Betrieb; dabei ist die Ueberwindung einer Druckhöhe von 1 m vorgeschrieben. Bei stark verminderter Drehzahl können die kleinen Kreiselpumpen diese Druckhöhe manchmal nicht mehr Uberwinden. Deshalb ist noch das mittlere Gefäß vorgesehen, in welches das gestrichelt gezeichnete Ausgußrohr hineinragt, welches man an Stelle des nach oben gehenden ansetzen kann. Dies Gefäß ist lang genug, um die vorgeschriebenen Schräg-stellungsgrade des Pendelrahmens zuzulassen. Das Wasser kann aus ihm unmittelbar in das Ansaugegefäß abgelassen oder auch, wie aus dem oberen durch ein quer zum Pendelrahmen seitwärts austretendes Rohr in den Kühlwasserkreislauf abgeleitet werden Dieser ist etwas vereinfacht in Abb. 9 und 10 dargestellt. Das oben ausfließende Wasser geht durch ein Fallrohr nach dem seitlich belegenen Beobachtungsraum, in dem möglichst alle Meßinstrumente angeordnet sind. Das Wasser passiert einen Wassermesser und kann dann entweder durch ein unter diesem Raum verlegtes Rippenrohr gehen oder unmittelbar nach dem Ansaugebehälter zurückfließen, wobei es aber ein T-Stück passiert, in dem beständig etwas frisches, kaltes Wasser zugesetzt wird. Durch Regeln der Ventile in den mit „heiß" und „kalt" bezeichneten Leitungen kann man die vorgeschriebene Temperatur von 70" in dem Ansaugebehälter leicht herstellen und aufrecht erhalten. Zugleich wird die Abwärme zur Heiz'ing des Beobachterraumes ausgenutzt, die man im Hinblick auf die vielstündigen Dauerversuche in den kältesten Wintermonaten unbedingt vorsehen mußte. Die Heizkörper können anderseits auch von einer Fernheizanlage her mit heißem Wasser versorgt werden, wenn ein luftgekühlter Motor läuft oder kein Motor in Gang ist. Von da aus wird auch schon vor Versuchsbeginn das Ansaugegefäß mit heißem Wasser gefüllt, so daß man schnell den Beharrungszustand erreicht. Um Feuergefahr von dem hölzernen Versuchsschuppen möglichst fern zu halten, liegt der Benzinvorrat, von dem der Motor gespeist wird, draußen auf freiem Felde. Die Fässer ausreichenden Inhalts für einen ganzen Dauerversuch (ca. 400 kg) stehen etwas Uberdacht auf Brückenwagen mjtten zwischen den Schuppen; ein elektrisches Signal zeigt im Beobachtungsraum an, wann die Wage einspielt. Die Gewichte sind 500 g-weise unterteilt. Man nimmt nach jedem Einspielen ein Stück fort und erhält so die Zeitabschnitte für je 5 kg, die ein 100 pferdiger JWotor in etwa 10 Minuten verbraucht. Das Benzin wird dem Vergaser durch ein Filtergetäß mit einem nach Wunsch einstellbaren Gefälle von bis zu 2 m zugeführt, Dazu muß es um rd. 4 m gehoben werden, da der Motor etwa 2 m über dem Boden steht. Deshalb stehen die Benzinfässer mit einer Stickstoffleitung in Verbindung, die aus einer Flasche durch ein selbsttätiges, einstellbares Druckminderventil gespeist wird und durch ein Quecksilberstandglas gegen unzulässige Drucksteigerung geschützr ist. Damit man die Benzinzufuhr im Beobachtungsraum unmittelbar vor Augen hat und auch ganz kurze Stichproben machen kann, ist über dem Filtergefäß noch ein Glaskolben 1 I Inhalt angebracht, der oben durch einen Hahn und ein gläsernes Standrohr mit der Atmosphäre in Verbindung gesetzt werden kann, nterhalb dieses Hahnes mündet ein Nebenanschluß von der Stickstoffkitung her, welcher ein erweitertes Steigerohr bildet, das mit Benzin gefüllt bleibt, worin aber das Gas emporsteigen kann, wenn es die Flüssigkeit um die unten gebildete kleine Sperrhöhe hinabgedrückt hat. Das tritt ein, wenn der Hahn in der Hauptleitung und auch der obere Lufthahn geschlossen ist während der *) Beim Wettbewerb wird dieses Gefäß nicht benutzt, um jede Möglichkeit auszuschließen, daß der Wasserzufluß einmal nicht schnell genug folgen und die Motorkühlung gefährdet werden könnte. Statt dessen ist ein größeres, seitlich fest aufgestelltes Gefäß vorgesehen, und das Wasssr geht zum Motor durch ein in der Pendelachse liegendes Schlauchstück. Die oberen Ausgußgefäße haben nach den Vorversuchen eine etwas längere Form bekommen, weil das Wasser etwas herausspritzte. ,LFL U G SPORTE_____ Seite^? Motor läuft, das Gas scheidet sich dann in der oberen Erweiterung des Steigrohres ab, und in dem Glaskolben wird bald der sinkende Benzinspiegel sichtbar, dessen Durchgang durch die oben und u ten vorhandenen Marken man beobachtet. Danach öffnet man den Hahn in der Hauptleitung wieder; das Benzin steigt dann wieder in das Stichprobegefäß auf bis zum Niveauausgleich mit dem Steigrohr und wenn man noch den Lufthahn oben öffnet, so entweicht das Gas, und das Benzin kann bis zu seinem freien Spiegel aufsteigen, den man also ständig beobachten kann. Das Schmieröl fließt dem Motor oder dessen Pumpe aus einem seitlich auf einer Wage Uber dem Beobachterraum stehenden Behälter zu; die Gewichtsschale dieser Wage hängt in den Beobachterraum hinein neben dem Tisch des Schriftführers. An Meßinstrumenten gehören noch folgende zu dem eigentlichen Prüfstand : Eine Meßdose (geschliffener Kolben in Druckölzylinder), verbunden mit selbstaufzeichnendem Manometer, wodurch das Auswägen der Drehmomente selbsttätig bewirkt wird. Die Leitung kann durch Hähne jederzeit entleert oder gefüllt werden. Durch Entleeren kann man augenblcklich die Meßdose ausschalten, so daß die Gewichtsschale benutzbar ist, womit man die manometrische Wägung nachprüft. Dann kann man wieder Drucköl in die Meßdose geben und die Registrierung fortsetzen. Zum Verzeichnen der Umlaufgeschwindigkeit der Motoren dienen „Fahrtschreiber" einer neuen, sehr bemerkenswerten Konstruktion von Professer Lynen (München), die dieser in fünf Exemplaren unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Er wird vom Motor durch ein Gelenkwellengetriebe mit eingeschalteter Kegelradübersetzung angetrieben. Die Räder sind derart austauschbar, daß die sehr verschiedenen Uebetsetzurigsverhältnisse ausgeglichen werden, welche in den No. 1 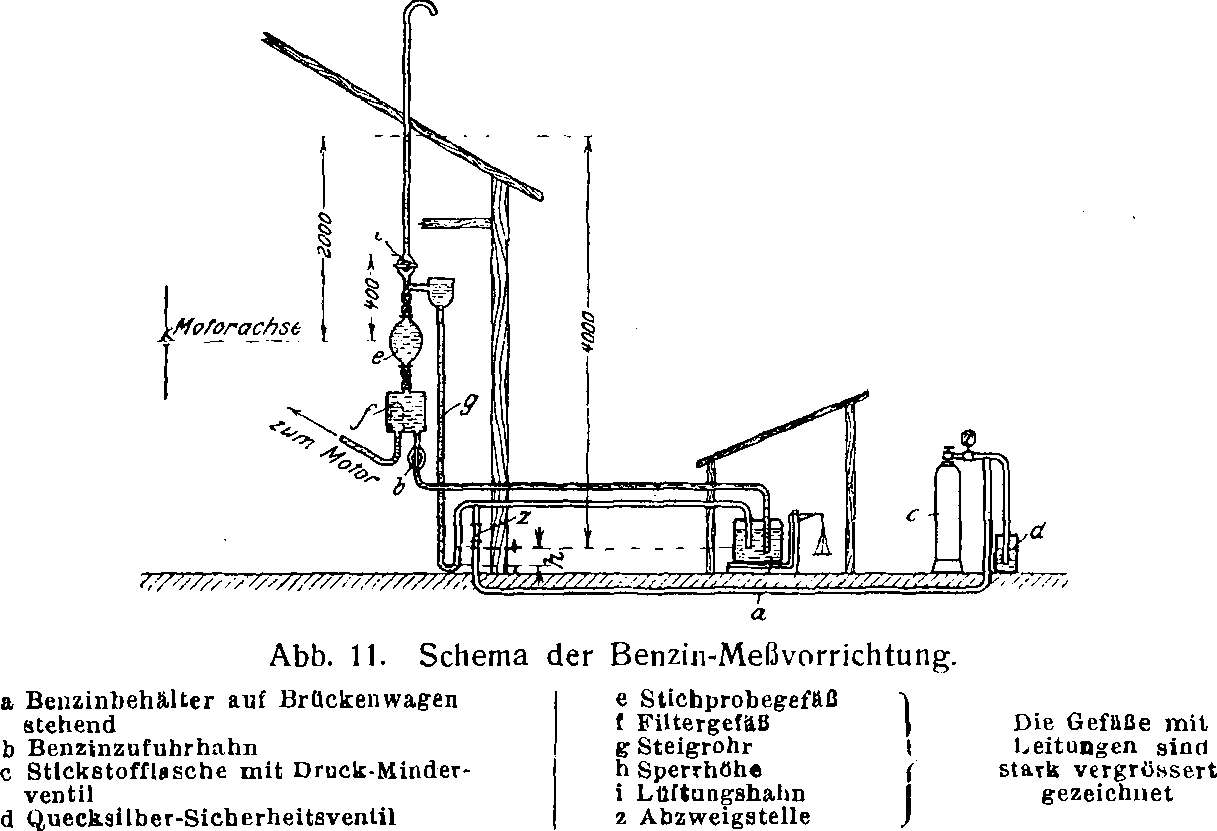 Motoren vor dem Tachometerantrieb enthalten zu sein pflegen. Das ist schon deshalb notwendig, weil man sonst vielfach außerhalb des Meßbereiches sein würde, welches der Fahrtschreiber zuläßt. Zugleich werden Irrtümer vermieden. Der Apparat verzeichnet immer die halbe Drehzahl der Motorwelle. Außerdem treibt die Gelenkwelle durch ein kleines Schneckengetriebe noch ein gewöhnliches Tachometer und ferner einen Umdrehungszähler, welcher die gesamten Umdrehungen während des ganzen Versuches summiert. Er zählt allerdings nur eine Drehung auf hundert der Motorwelle, was aber, da der Motor in den sieben Stunden rd. 500000 Drehungen macht, reichliche Genauigkeit gibt, um die mittlere Drehzahl einwandfrei M berechnen. Zur Bestimmung der Kühlwasserwärme dient, wie erwähnt, ein Flügelradwassermesser; dazu zwei schreibende Quecksilber-Fernthermometer für Zufluß und Abfluß, Glasthermometer zum Nachprüfen derselben befinden sich unmittelbar an den Meßstellen. Schließlich sind einfache Federwagen zum Abwiegen der Axialschübe am Pendelrahmen vorhanden ; eine stärkere für den Schraubendruck; eine schwache zur Luftwiderstandsbestimmung des Motors ohne Schraube Weiter gehören zu der Anlage infolge der besprochenen Bedingungen noch zwei selbständige Antriebsmaschinen, die eine zur Bestimmung des Drehwiderstandes der Schraube allein, ohne Verbindung mit dem zu prüfenden Motor. Es ist eine „Bremsdynamo" mit drehbar gelagerten Magnetgestell, die als Motor läuft und das wirksame Drehmoment ganz ebenso wie der Pendelrahmen an einer ruhenden Wägevorrichtung angibt Diese Maschinengattung hat sich für solche Prüfungen vortrefflich bewährt. In der erforderlichen Größe (bis zu 150 PS) ist sie in Deutschland allerdings bisher nur einmal zur Ausführung gekommen. Wie die Uebersichtszeichnung der Versuchsanlage und des Schuppens (Abb. 12 bis 14) zeigt, ist die Bremsdynamo oder, wie sie der Verständlichkeit wegen genannt wird, der „Kontroll-Elektromotor" dem Prüfstand gegenüber an der entgegengesetzten Seite des Schuppens so aufgestellt, daß man die vom Versuchsmotor gelöste Schraube unter geringer axialer Verschiebung auf den Konus aufsetzen kann, der sich am 'Ende der etwa 3 m langen Zwischenwelle befindet, welche sich durch eine elastische Kuppelung an den Kontroll-Elektromotor anschließt. Die Schraube läuft also praktisch genau in der gleichen Lage 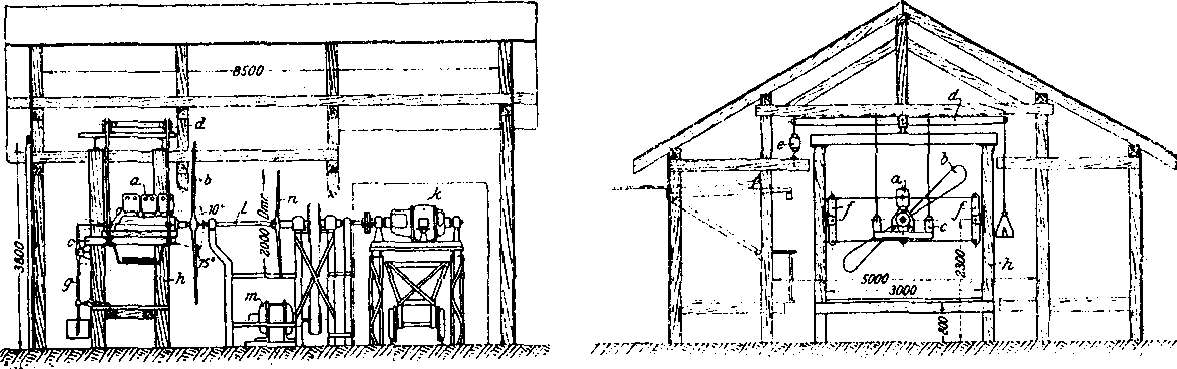 Abb. 12-14. Versuchsschuppen m. Molorprüfanlage. a Zu prüfender Flugzeugmotor b De3fen Luftschraube c. Pendelrahmen d'iWägevorrichtung zu diesem e Dämpfung der Wage f Querhalter g'Schubmeßvorrichlung h Isoliertes Gestell i Verschiebungswand (nur im Grundriß eingetragen) k Kontrollelektromotor 1 Dessen Welle m Hilfselektromotor n Von diesem durch Rifmen getriebene HilfslufIschraube (Zusat2gebläse) auf Hohlwelle wie beim eigentlichen Motorversuch, womit den oben erwähnten Forderungen Genüge getan ist, sofern es sich um einen stehenden Versuchsmotor handelt. Bei Umlaufmotoren muß noch dieser unabhängig in Drehung versetzt weiden. Leerlauf mit eigener Kraft ist bei diesen Motoren meist nicht sicher möglich. Auch zum Antrieb fehlt eine Gelegenheit. Deshalb wird er zu diesem Versuch durcti eine Nachbildung ersetzt, welche seine äußere Form so weit erforderlich nachahmt und durch einen dahinter auf 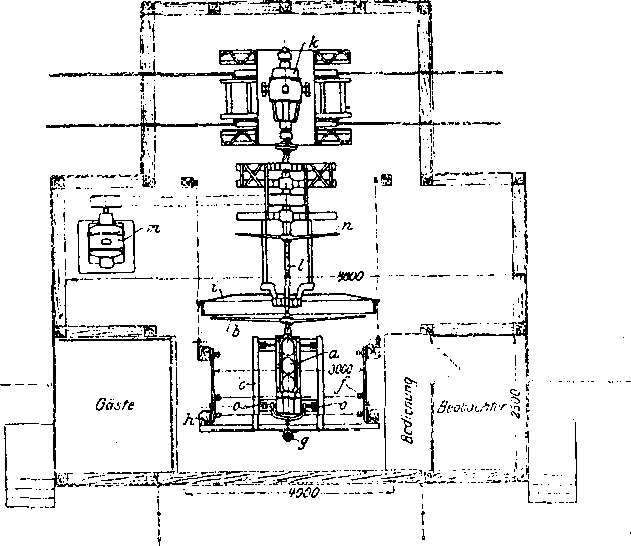 dem Pendelrahmen aufgestellten Elektromotor in Drehung versetzt wird. Nach gewöhnlichen Schätzungen soll der Luftwiderstand dieser Motoren 10 oder mehr vom Hundert seiner Leistung beanspruchen. Demnach muß dieser Elektromotor immerhin einige 10 bis 20 PS leisten. Es wird dafür ein der sogleich zu erwähnenden „Hilfs-Elektromotoren" von 23 PS benutzt. Bei manchen Umlauf motoren ist aber die Schraube nicht vor, sondern hinter dem Motor an dessen Gehäuse befestigt, wovon man sich mit gutem Grund bessere Kraftausnutzung verspricht, weil der Motor im schwächeren Luftstrom auf der Saugseite der Schraube weniger Stirnwiderstand verursacht. In solchen Fällen wird der Motor bezw. dessen Nachbildung auf die hohle Welle des Zusatzgebläses gesetzt, welches, wie erwähnt, zugunsten der luftgekühlten Motoren in den Bestimmungen vorgeschrieben war. Statt eines gewöhnlichen Gebläses, das kaum unterzubringen war, ist eine Luftschraube benutzt, welche gleichachsig mit der Schraubt des Versuchsmotors auf hohler Welle sitzt. Die lange Welle des Kontroll-Elektromotors geht durch diese frei hindurch. Sie wird durch Riemen von einem seitlich stehenden „Hilfs-Elektromotor" angetrieben und sendet einen Luftstrom von etwa 20 m-Sek. gegen den Versuchsmotor. 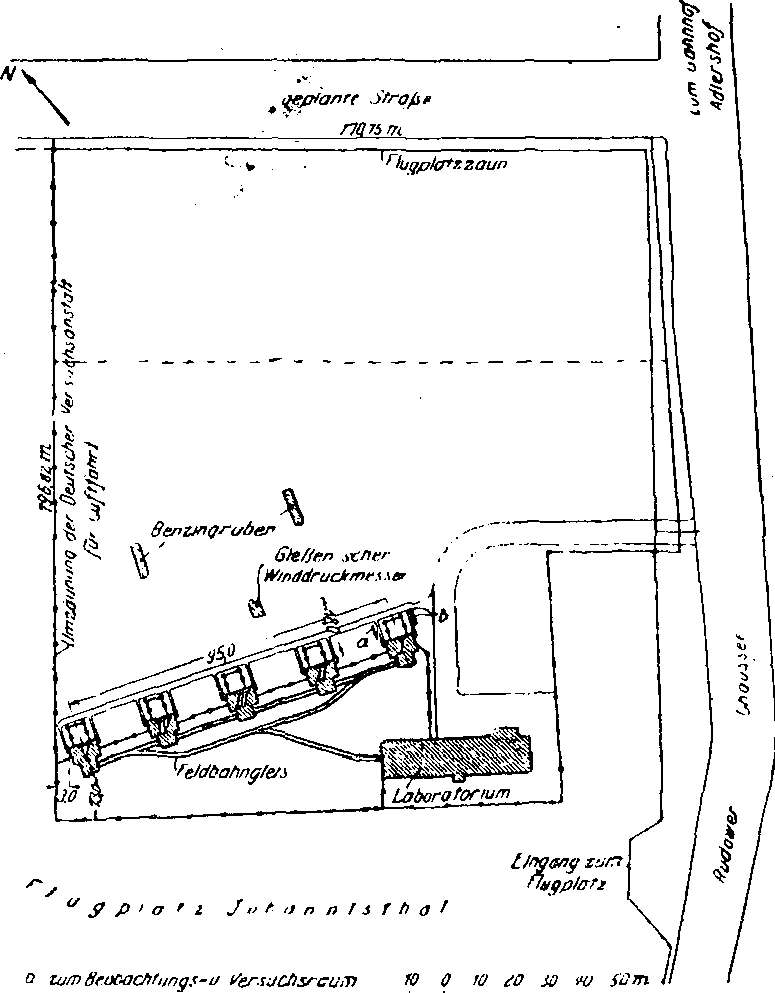 h zum Raum Jur Gaste Abb. 15. Lageplan. An Stelle dieser Hilfsschraube wird also zur Nachprüfung der Einzeldrehkräfte bei den erwähnten Umlaufmotoren, deren Nachbildung aufgesetzt und vom Hilfs-Elektromotor gedreht, während die Schraube des betreffenden Versuchsmotor dicht dahinter auf der Kontroll-Elektroinotorwelle läuft. Das bedingt allerdings eine größere axiale Verschiebung aus der Stellung des Hauptversuches. Der Einfluß wird aber nicht erheblich sein, da die Raumverhältnisse doch noch sehr ähnlich bleiben. Die getroffene Anordnung erlaubt offenbar ohne weiteres auch die unmittelbare Kuppelung des zu prüfenden Flugzeugmitors mit der Bremsdynamo' Seite 26 FLUGSPOET f ( No. 1 Man kann diese also auch als solche benutzen, wenn noch eine weitere Nachprüfung der Motorleistung erwünscht sein sollte. Wie man sieht, waren ungewöhnlich große und verwickelte Einrichtungen nötig, um den gestellten Bedingungen in allem zu genügen. Die Anlage erschien fast ungeheuerlich, als es sich herausstellte, daß, um mit der großen Anzahl gemeldeter Motoren rechtzeitig fertig zu werden, mindestens fünf solcher Versuchsstände nötig waren. Die kostspieligste Versuchsmaschine, der Kontroll-Elektromotor, konnte schlechterdings nur in einer Ausführung beschafft werden. Um ihn rasch wechselnd in jedem der fünf Schuppen benutzen zu können, ist ein Verschiebungsgleise gelegt, das geradlinig durch die fünf Schuppen hindurchführt, wie aus dem Lageplan, Abb. 15, zu ersehen. Zum Verfahren dient ein kräftiger Wagen mit entsprechendem Aufbau, von dem man durch Nachlassen einfacher Druckschrauben den Motor auf die Böcke setzen kann, die in jedem Schuppen für ihn vorhanden sind und zwischen welche der Wagen hineinfährt, wie es Abb. 14 zeigt. Der Kontroll-Elektromotor bedingt ferner eine umfangreiche Umformeranlage, die in dem Laboratorium untergebracht ist, das auch im Laufe der vier Monate errichtet wurde. Die Bremsdynamo beansprucht, um. als Motor die erforderliche Leistung und Drehzahl zu erreichen, etwa 100 Kilowatt Gleichstrom von 440 Volt. Die Berliner Elektrizitätswerke führen zunächst hochgespannten Drehstrom mit 6000 Volt in das Laboratorium, wo er in besonderem Raum auf 220 Volt transformiert wird. Als solcher treibt er einen Drehstrommotor von 250 PS und dieser arbeitet durch Riemen auf drei einzelne Gleichstromdynamo zu je etwa 50 KW und 220 Volt. Zwei von diesen werden in Reihe geschaltet und liefern die erforderlichen 100 KW bei 440 Volt. Die dritte Dynamo gibt Gleichstrom von 220 Volt zum Betriebe der Hilfselektromotoren. Große Vorkehrungen bedingte ferner die Rücksicht auf das Personal, das während der kältesten Wintermonate tagelang in den vom Schraubenwind mächtig durchspülten Schuppen arbeiten u. a. die siebenstündigen Dauerversuche aushalten 9ollen. Es mußte ein wenigstens etwas heizbarer Aufenthaltsraum unbedingt geschaffen werden. Dazu wird von der Niederdruckdampfheizung des Laboratoriums durch einen Wärmeaustauscher heißes Wasser geliefert, welches eine Pumpe durch Heizkörper treibt, welche unter dem Fußhoden des kleinen, allseitig verschalten Beobachtungsraumes liegen, in dem die hauptsächlichsten Meßinstrumente vereinigt sind und von dem aus man durch Fenster den Motor beobachten kann. Eine Tür führt auf den unmittelbar davorliegenden Bedienungsstand. Anderseits führt eine Tür unmittelbar ins Freie. Unmittelbare Heizung der Schuppen verbot sich im Hinblick auf Feuersgefahr und die Nähe der großen Benzinmengen; sie wäre baupolizeilich nicht genehmigt worden. Die Fernheizung ermöglicht es zugleich, die Motoren schon vor Beginn des Versuches mit warmem Kühlwasser zu versorgen und so die Arbeiten zu beschleunigen. Das alles mußte innerhalb weniger Monate entstehen. Die Anstalt hat den zahlreichen Firmen, welche bei dem Bau mitgewirkt haben, für besonders rasche Lieferungen und vielfach ungewöhnlich weites Entgegenkommen zu danken. Er wähnt sei in dieser Hinsicht besonders die Miiwirkug der Allgemeinen Elektri zitäts-Gesellschaft, welche das große Umformerwerk in überraschend kurzer Zeit leihw.ise zu liefern vermochte. Endgültig würde der erwähnte Riemenbetrieb dreier Dynamos durch einen großen Motor natürlich unzweckmäßig sein. Seitens der Versuchsanstalt haben beim Entwurf und Bau der Anlage vor allem die Herren Dipl.-lng. Seppeier und Steinitz zum Teil aufopfernd mitgewirkt.  Inland. Flug führ er-Zeugnisse haben erhalten: No. 339. Trautwein, Max, Mechaniker, Mainz, geb. am 1. März 1893 zu Freiburg i. B., für Eindecker (Goedecker), Flugplatz Großer Sand, am 9. Dez. 1912. No. 340. von Eickstedt, Vollrad, Oberleutnand, 5. Garde.-Regt., Spandau, geb. am 23. März 1882 zu Köslin, für Eindecker (Rumplertaube), Flugplatz Johannisthal, am 16. Dezember 1912. No. 341. Schäfer, Ludwig, Oberleutnant, Inf.Regt. 99, Zabern i. Eis., geb. am 8. Dez. 18S1 zu Marburg i. H., für Eindecker (Rumplertaube), Flugplatz Johannisthal, am 16 Dezember 1912. No. 342. von Helldorf, Sittig, Oberleutnant, 4. Drag.-Rgt, Lüben i. Schles., geb. am 28 August 1879 zu Wiesbaden, für Eindecker (Rumplertaube), Flugplatz Gandau bei Breslau, am 16. Dezember 1912. No. 343. Freiherr von Hadeln, Leutnant, Feld-Art.-Rgt 61, z. Zt. Schutztruppe für Südwestafrika, geb. am 14. Mai 1885 zu Weimar, für Zweidecker, (L. V. G.), Flugplatz Johannisthal, am 16. Dezember 1912. Von den Flugplätzen. Flugplatz München-Oberwiesenf eld. In den letzten Tagen herrschte wieder reger Flugbetrieb. Trotz des schlechten nebeligen Wetters konnten zwei Offiziersflieger ihre Fliegerprüfung ablegen. Am Samstag den 21. Dezember erfüllte Lt. Schroff auf einem  Ein Hocfiseitsjlug. Von links nach rechts: Gustav Otto, Frau Otto, Baierlein. Deutschland-Doppeldecker mit 70 PS Mercedes-Motor die Bedingungen für die Erlangung des Fliegerzeugnisses. Am nächsten Tage bestand Lt. Demmel dieselbe Prüfung auf einem Otto-Doppeidecker mit 100 PS Argus-Motor. Er legte die vorgeschriebenen 10 Achten in der guten Zeit von 23 bezw. 20 Minuten in einer Durchschnitthöhe von 120 m zurück. Lt. Demmel hat seine Ausbildung von dem bewährten Ottoflieger Baierlein erhalten. Fast täglich fanden Passagierflüge statt und Baierlein vollführte kühne Kurvenflüge, welche zeigten, daß er seine Maschine ganz sicher beherrscht. Erwähnenswert ist noch der Hochzeitsflug des Flugmaschinenkonstrukteurs Gustav Otto mit seiner Gattin, welcher die Neuvermählten unter der sicheren Führung Baierleins über München hinweg nach Freising und zurück nach Oberwiesenfeld führte. Sicher eine schneidige Frau und Gattin. Auf dem Flugplatz Habsheim ging es in den letzten Tagen recht lebhaft zu und zwar rückte man den Welt-Rekords energisch auf den Leib. Am 3. Januar schuf Faller auf Aviatik-Doppel-decker einen neuen Weltrekord mit 5 Fluggästen, indem er 1 Stunde 6 Minuten flog. Die Gesamtbelastung betrug hierbei 405 kg. Am 4. Januar flog Faller mit 6 Fluggästen bei einer Gesamtbelastung von 471 kg und stellte mit 20 Minuten 30 Sekunden einen neuen deutschen Rekord auf. Endlich schuf Faller an diesem Tage mit dem gleichen Zweidecker von 16,8 m Spannweite einen Weltrekord mit 7 Pluggästen von 6 Minuten 49 Sekunden und einer Belastung von 532 kg. Vom vorigen Monat ist noch nachzutragen, daß L t. L i n c k e am 8. Dez. seine Feldfliegerprüfung ablegte. Er erreichte 1300 m Höhe und flog 1 Stunde 15 Minuten. In 800 m Höhe stellte er den Motor ab und landete im Gleitfluge. Sergeant Cippa, der am 18. Dez. seine Feldfliegerprüfung ablegen und zu deren Erfüllung von Habsheim nach Straßburg fliegen wollte, verirrte sich hinter Mülhausen. Statt nach rechts abzuschwenken nach dem Rheintal zu flog er nach links und landete nach 21/, stündigem Fluge 150 km von der Grenze mitten in Frankreich zwischen Besancon und Dijon. Von den französischen Behörden wurde Cippa sehr coulant behandelt. Der Apparat wurde später nach Habsheim zurück transportiert. Im ganzen sind am 1. Dez. 6 Unteroffiziere in die Aviatik-Schule kommandiert worden, die bis zur Ablegung der Feldfliegerprüfung ausgebildet werden sollen. Die theoretische Unterweisung im Fluge und Motorwesen leitet der Ingenieur-Flieger Schlegel. Der praktische Unterricht wird von den Fliegern Schmidt und Faller erteilt. Im vorigen Monat wurde auch ein Pfeil-Doppeldecker mit vorn liegendem Motor von Ingold versucht. Der neue Apparat hat sich bei seinen ersten Versuchen sehr gut bewährt. Vom Goedecker-Flugplats in Gonsenheim. Im Dezember wurden insgesamt 55 Aufstiege ausgeführt. Es machten im ganzen de Waal 22 Aufstiege 2 Stunden 59 Min. Tratitwein 8 „ 2 „ 15 „ Schroeder 12 „ 2 „ 9 „ Roth 8 „ <l „ 3 „ Geiss 2 „ — „ l(i „ Hess 3 „ — „ 20 „ Bemerkenswert waren die ausgezeichneten Flüge der Herren Trautwein, Schroeder und Roth am 1. und 3. Weihnachtsfeiertage über Mainz und Umgebung. Auf dem Flugplatz Lindenthal erwarb am 22. Dezember 1912 der Unteroffizier Steindorf vom 4. Garde-Feldart.-Reg. Potsdam und Unteroffizier Müller vom Kaiser Alexander-Reg. auf einem Mars-Doppeldecker der Deutschen Flugzeugwerke in Lindenthal bei Leipzig das Feldfliegerzeugnis. Steindorf stieg um '/*9 Uhr vorm. auf dem Lindenthaler Flugplatz bei Leipzig auf und nahm in etwa 800 Meter Höhe den Kurs nach Halle. Nachdem Halle in etwa 1000 Meter Höhe passiert war, flog er ohne Zwischenlandung weiter nach Delitzsch und von dort nach Lindenthal, wo er aus 700 Meter Höhe mit abgestelltem Motor nach einem Gesamtflug von 1 Stunde 12 Min. glatt landete. Auf dem Flugplatz Gelsen/circhen-Essen-Botthausen wurden im Laufe des Monats Dezember an 8 Tagen von 12 Fliegern und Flugschülern 87 Aufstiege unternommen. An den übrigen Tagen verhinderte Regen und Wind jeglichen Flugbetrieb. Am 21. Dezember wurde das zweite Flugzeug der Kondorwerke zum erstenmal aus dem Schuppen gebracht. Der Apparat, der durch sein elegantes Aeußere noch mehr anspricht wie der erste, ist mit verschiedenen Verbesserungen versehen. Suwelack stieg nach nur einigen Versuchen sofort in eine Höhe von 200 m und Uberflog Rotthausen, Gelsenkirchen, Heßler und landete nach einem Fluge von 23 Minuten in steilem Gleitfluge aus 300 m auf dem Flugplatz. Am selben Tage vollführte Suwelack noch verschiedene größere Flüge, wobei sich der Apparat als vollständig automatisch stabil erwies und selbst bei starken Böen durch einen leichten Steuerdruck gerade zu richten war. Während des Fluges konnte Suwelack die Steuerung loslassen, ohne daß der Apparat aus dem Gleichgewicht kam. Wie immer übte die Fliegerschule Mürau fleißig. Basser, ein Zögling dieser Schule, bestand am 20. bezw, am 21. seine Fliegerprüfung. Obgleich der Motor häufig zu streiken drohte, richtete der junge Flieger die Maschine immer wieder auf, sodaß ihm die Erfüllung der Bedingungen gelang. Mürau selbst unternahm mit seinem Mehrsitzer mehrere längere Passagierflüge. Bei diesen war meistens die Schülerin Fräulein Horn seine Begleiterin, um sich allmählich an den Aufenthalt in höheren Luftschichten zu gewöhnen. Im Monat Dezember wurden in den auf dem Flugplatz befindlichen Fabriken fortgesetzt neue Maschinen fertiggestellt. Abgesehen von den außerordentlich beschäftigten Kondorwerken, legte Josef Schlatter ein neues Wasserflugzeug auf Stapel und Albers & Strathmann verkauften wiederum eine Alstra-Taube nach auswärts. Zum Schluß noch eine kleine Neujahrsüberraschung. Der Aviatik-Eindecker, eins der von der Firma Krupp dem Flugplatz Gelsenkirchen-Essen-Rotthausen geschenkten beiden Flugzeuge, ist auf dem Flugplatz angekommen und wurde in eirem Schuppen der Kondorwerke untergestellt. Der zweite Apparat, ein Oertz-Eindecker steht abnahmebereit auf dem Flugplatz in Schneverdingen bei Hamburg und wird binnen Kurzem ebenfalls auf unserm Flugplatz eintreffen. Die beiden Apparate werden alsdann der Besichtigung durch das Publikum zugängig gemacht werden. Auf dem Flugplatz Winnie-Herten erfüllte auf einem Grade-Eindecker der Rheinisch-westfälischen Fliegerschule Bramhoff die Bedingungen zur Erlangung des Flugmaschinenführer-Zeugnisses. Seite 30 No. 1 Militärische Flüge. Oberlt. Keller von der Metzer Fliegerstation machte am 17. Dezember 1912 einen Uebnngsflug, bei dessen Beendigung er sehr hart landete und den Apparat zerbrach. Oberlt. Keller erlitt hierbei einen Oberschenkelbruch. Major Siegert der Fliegertruppe Metz machte am 20. und 21. Dezember auf einem Aviatik-Doppeldecker, der von Lt. Geyer gesteuert wurde, einen Erkundungsflug am Oberrhein. Der Flug begann in Straßburg und führte zunächst nach Neubreisach, wo eine Landung vorgenommen wurde. Noch am gleichen Tage wurde die Weiterfahrt angetreten und Freiburg am Abend erreicht. Am folgenden Morgen erfolgte der Ruckflug der mit einer militärischen Freiballon=Verfolgung verbunden war. Trotz einer Stunde Vorsprung wurde der Ballon bald von der Flugmaschine eingeholt und wäre in Höhe von 7—800 m eine sichere Beute der Flieger geworden, da Feuerwaffen im Ballon nicht zu gebrauchen sind. Das zwischen Freihurg und dem Kaiserstuhl zusammengeströmte Publikum beobachtete mit lebhaftem Interesse das interessante Luftmanöver. Nach zweistündigem Flug über dem Schwarzwald wurde die Rundfahrt glatt in Straßburg geschlossen. Landung französischer Flieger auf deutschem Boden. Eine Landung französischer Flieger auf deutschem Boden fand am 24. Dezember nachmittags bei Avricourt statt. Die beiden Offiziersflieger, Führer Lt. Gleize von der Fliegertruppe in Nancy und Beobachter Lt. Pelloux vom 6. Art.-Regt., hatten die Orientierung verloren. Major Siegert, der Leiter der Metzer Fliegerstation, begab sich noch in der Nacht nach der Landungstelle. Da die Untersuchung keine belastenden Momente ergab, wurden die beiden Flieger sofort frei gelassen- Die in Putzig stationierten Wasserflugmaschinen werden während der Wintermonate auf der Jahde bei Wilhelmshaven versucht. Sobald Putzig wieder eisfrei wird, werden die Maschinen nach dort zurückgebracht. Eine Fliegerkaserne wird in Döberitz errichtet. Sie besteht aus: einem Mannschaftshaus, zwei Familienhäusern, eine Wirtschaftsbaracke, eine Offizierspeiseanstalt, ein Offiziershaus, eine Waffenmeisterei, ein Kraftfahrschuppen, ein Wasserwerk, ;ein Pferdestall sowie die erforderlichen Nebenanlagen. In dem Offiziershaus soll für 32 Offiziere lagermäßige Unterkunft geschaffen werden. Ursprünglich war für die gesamte Fliegertruppe nur eine lagermäßige Unterkunft vorgesehen. Es hat sich aber herausgestellt, daß für das etatsmäßige Personal der Fliegertruppe garnisonmäßige Unterkunft geschaffen werden mußte, weshalb man sich zum Kasernenbau entschlossen hat. Ausland. Die Entwicklung des Wasserflugwesens in Amerika. In Amerika scheint sich das Wasserflugwesen ganz besonders zu entwickeln. Zur Zeit existieren in den Vereinigten Staaten ca. 15 Fliegerschulen, in denen ungefähr 200 Schüler ausgebildet werden. Die Begeisterung für die Wasserflugmaschinen ist besonders groß. In der Curtißschule in San Diego haben von 22 Schülern 11 auf Wasserflugzeugen, 5 auf Landmaschinen und 6 auf beiden Arten ihr Fliegerzeugnis erworben. Der Flieger Antony Jannus hat auf seinem Wasser-Zweidecker Benoist mit 75 PS Motor eine größere Reise gemacht. Am 6. November verließ Jannus die am Missouri gelegene Stadt Omaha. An Saint-Joseph, Kansas-City und Jefferson-City vorbei flog er den Fluß stromabwärts bis nach Saint-Lonis am Missisippi, dort blieb er acht Tage. Dann flog er längs des Missisippi. In weniger als drei Wochen an Cairo, Memphis, Arkansas-City, Vickburg, Natchez vorbei erreichte er Neu-Orleans am 16. Dezember. Der Apparat wasserte im Hafen, empfangen von einer begeisterten Menge. Die zurückgelegte Strecke an diesen zwei ungeheuren Strömen beträgt 1973 Meilen. 741 Meilen davon wurden von dem Flieger allein und 1 232 Meilen davon wurden mit Passagieren zurückgelegt. Die Totalzeit des Fluges betrug 31 Stunden und 43 Minuten, das ist eine mittlere Geschwindigkeit von 95 bis 100 Kilom. in der Stunde. Zwischendurch hatte Jannus 42 Schauflüge im Publikum gehalten. Das Militärflugwesen in Belgien ist neu organisiert worden. Es besteht aus 6 Abteilungen, die Abteilung aus je 4 schnellen Zweideckern (80 PS) mit Begleitautos und Werkstätten. Ferner gehören zu einer Abteilung 8 Offiziere, 1 Unteroffizier, 1 Korporal, 15 Mannschaften und 6 Reservisten. Von den Abteilungen sind zwei in Lüttich und Namur stationiert. Die anderen sind über das Land verteilt und werden bei Uebungen zusammengezogen. Die Ausbildung der Offiziersflieger geschieht in der Schule von Brasschaet. Die Schule besitzt eigene Lehrmaschinen und Personal, bestehend aus 4 Offizieren, 4 Unteroffizieren, 2 Korporalen, 10 Soldaten und 3 Reservisten. In der Wasserflugschule Paulhan in Bezon wurde von dem österreichischen Offizier Klobuca eine Maschine abgenommen, welche nach dem Adriatischen Meer geht. Die Militärflugstation Epinal wurde durch 3 Borel-Maschinen verstärkt. Die Maschinen wurden am 31. Dezember von der Borel-Schule in Chateaufort nach Epinal geflogen. 1 Million Lstr. für eine englische Luftflotte sollen aufgebracht werden. Die treibende Kraft ist das Britische Royal Flying Corps, welches verlangt, daß eine Flotte von 800 bewaffneten und unbewaffneten Flugmaschinen, unter denen sich 500 Wasser- und 300 Landmaschinen befinden, geschaffen wird Man beabsichtigt, Riesenflugmaschinen, die in der Lage sein sollen 30 bis 40 Personen zu befördern und sich mindestens 36 i tunden in der Luft halten sollen, zu bauen. Ferner sollen Flugzeug-Abwehrgeschütze, Bombenwurfeinrichtungen, Flugzeugcentren für Heer und Marine geschaffen werden Obschon diese Nachricht etwas fantastisch klingt und wohl kaum die oben genannte hohe Summe aufgebracht werden wird, so wird doch diese Agitation ernst zu nehmen sein und ihren Zweck nicht verfehlen. Patentwesen. Verfahren zur Herstellung von hohlen, leichten, widerstandsfähigen Metallpropellern.*) Es sind schon Versuche gemacht worden, um Flügelschrauben aus Metall herzustellen, doch haben dieselben zu keinem günstigen Resultat geführt, weil die Schaufeln mit Querarmen vermittels Bolzen, Schrauben, Niete und dergl. verbunden worden sind Diese Verbindungen widerstehen der kombinierten Beanspruchung durch die Zentrifugalkraft, die Durchbiegung der Schaufeln und die Erschütterungen des Motors nicht. Das vorliegende Verfahren betrifft die Herstellung von hohlen und leichten Flügelschrauben aus Metall für äronaiitisclie und nautische Zwecke. *) D. R. P. 251309. Pierre Jacomy in Asnieres und Francois Jahan in Courbevoie, Frankreich. Das Verfahren besteht in der Herstellung von hohlen Fliigelschrauben aus einem einzigen Stück Metall und mit verdünnten Enden. Diese Verdiinnung kann durch Treiben, Walzen, Strecken oder dergl. erzielt werden. Die Schraube wird hergestellt mittels eines Bleches, dessen einander genäherte Kanten miteinander verschweißt werden oder mittels eines nahtlosen Rohres. Abb. 1 Abb. 2 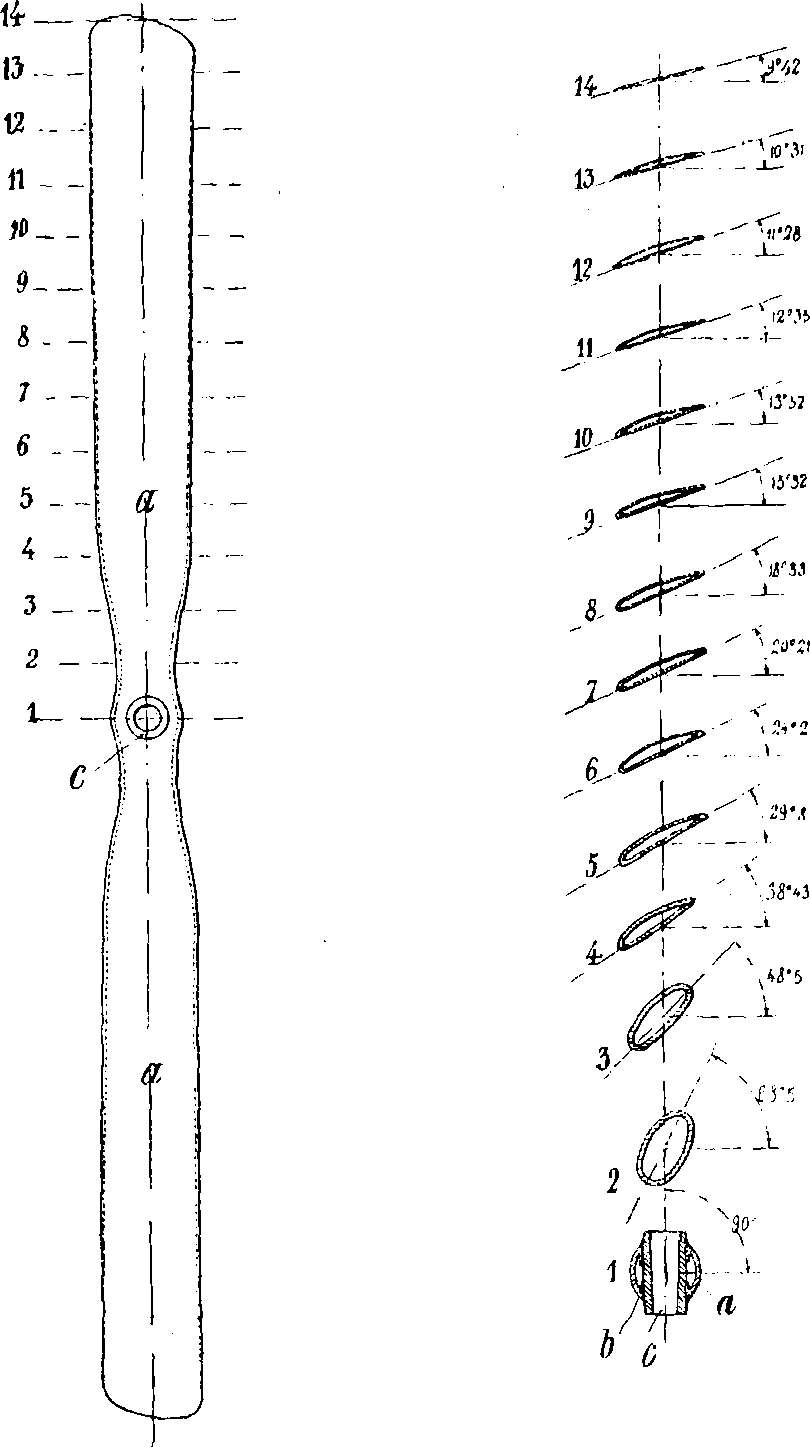 Auf der Zeichnung ist eine Ausführungsform einer hohlen Flügelschraube aus Metall gemäß der Erfindung dargestellt, und zwar zeigt Abb. 1 eine Ansicht der Flügelschraube, während in Abb. 2 verschiedene Querschnitte nach den Linien 1 — 1 bis 14 — 14 der Abb. 1 dargestellt sind. Bei dieser Ausführungsform des Verfahrens wird ein nahtloses Metallrohr von bestimmtem Durchmesser und bestimmter Stärke genommen. Nachdem dasselbe vorgerichtet worden ist, wird es auf der Drehbatik oder in sonst irgend einer Weise so bearbeitet, daß die beiden Enden allmählich von einem bestimmten Punkt des Rohres an abnehmen Die allmähliche Abnahme wird nach einem bestimmten Gesetz ausgeführt, das von der Gestalt der Flügelschraube und der Widerstandsfähigkeit, welche die verschiedenen Teile derselben aufweisen muß, von dem Mittelpunkt bis zu dem Umfang abhängt. Tn der .Vitte wird das so bearbeitete Rohr durchstoßen, ohne daß jedoch Material von demselben entfernt würde. Die Flügelschraube besitzt auf diese Weise zwei einander diametral gegenüber liegende Oeffnungen, deren Ränder nach einwärts gebogen sind. Auf diese Weise wird der Flügelschraube eine sehr große Widerstandsfähigkeit in ihrem Mittelpunkt verliehen. Durch die so gebildeten Oeffnungen wird eine Büchse c geführt, welche durch autogene Schweißung oder in irgend einer anderen Weise mit den Rändern der üeffnung verbunden wird. Diese Büchse bildet die eigentliche Nabe der Fliigelschraube und wird kegelförmig, polygonal oder zylindrisch ausgefräst, je nach dem Querschnitt der Welle, auf welcher die Flügelschraube angebracht werden soll. Zu beiden Seiten der Nabe b wird das Rohr a durch Pressen oder auf einem Dorn derart umgestaltet, daß die beiden Teile des Rohres die schraubenförmige und gekrümmte Gestalt annehmen, welche man ihnen zu geben wünscht, je nach der Steigung und dem angenommenen Durchmesser. Die Kanten des Rohres, welche die Enden der Schaufeln bilden, werden dann zusammengeschweißt und die Gesamtflügelschraube wird poliert. Eine auf diese Weise hergestellte Fliigelschraube bildet ein ununterbrochenes Ganzes ohne irgendwelche Verbindungsstellen und bietet infolgedessen der Beanspruchung durch die Zentrifugalkraft, den Widerstand des Fluidums, in welchem die Schraube arbeitet, sowie durch die Erschütterungen des Motors den größtmöglichsten Widerstand. Dieselbe ist so leicht wie eine Flügelschraube aus Holz und besitzt gegenüber dieser den Vorteil, daß ihre Teile widerstandsfähiger bei gleichen Abmessungen gegen Stoßwirkungen sind. Dieselben hohlen und leichten Flügelschrauben aus Metall können in einem Stück gleichfalls hergestellt werden mittels eines Stahlbleches oder eines Bleches aus einem anderen geeigneten Material, dessen veränderliche Stärke von einer bestimmten mittleren Linie nach auswärts abnimmt. Die Abnahme der Stärke des Bleches kann erzielt werden, durch Walzen oder in irgend einer anderen Weise. Wenn nun das Blech nach einander in geeignete Formen gebracht wird, kann demselben allmählig die endgültige Form der Flügelschraube mitgeteilt werden. Wenn die Flügelschraube aus einem solchen Blech hergestellt wird, so werden die aneinander liegenden Kanten miteinander verschweißt, und zwar werden diese Kanten vorteilhaft in der Weise angeordnet, daß sie die Hinterkanten der Schaufeln bilden. Obschon auf diese für die Herstellung ähnlicher Gegenstände übliche Weise gleichfalls hohle und leichte Metallflügelschrauben gemäß der Erfindung hergestellt werden können, ist es doch vorteilhaft, zur Herstellung ein nahtloses Rohr zu verwenden, wie oben angedeutet. Patent-Ansprüche: 1. Verfahren zur Herstellung von hohlen leichten, widerstandsfähigen Metallpropellern, dadurch gekennzeichnet, daß ein in der Mitte rohrförmiger und starkwandiger Hohlkörper, der in seinem die Schraubenflügel bildenden Teile eine nach außen zu allmählich abnehmende Wandstärke besitzt, durch Stanzen, Pressen oder dergl. derart ausgebildet wird, daß der mittlere rohrförmige Teil eine Nabe aufnehmen oder diese selbst bilden kann, während die Außenteile Schraubenflügel von allmählich abnehmender Stärke bilden, 2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß als Ausgangsprodukt zur Herstellung des Propellers ein nahtloses Rohr dient, dessen Wandstärke nach den Enden zu allmählich abnimmt. Flugvorrichtung mit vorn unter der Tragfläche angebrachten, vorn scharf zulaufenden und hinten stumpf abschließendem Hohlkörper.") Es sind Flugzeuge bekannt bei denen unter der flügelartigen Tragdecke ein Rumpf in Kegel- oder Fischbauchform angeordnet ist, oder der Vorderrand der Tragfläche nach rückwärts abgebogen ist' *) D. R. P. Nr. 251 (,74, Gustav Voigt in Stettin. Nach vorliegender Erfindung, die die selbsttätige Aufrechterhaltung des Gleichgewichts eines Flugzeuges und die geradlinige, wellenlose Flugbahn bezweckt, wird ein neuer Rumpfkörper benutzt. Die beistehende Zeichnung stellt eine Ausführungsform dar, in Abb. 1 die Seitenansicht, Abb. 2 die Vorderansicht, Abb. 3 die Aufsicht, Abb. 4 Schnitt c--b durch die obere Tragdecke und in Abb. 5 den Querschnitt des Hohlkörpers. Dieser Rumpf- oder Hohlkörper wird durch die längere Haupttragfläche a-b-c selbst und durch eine gegen die Haupttragfläche geneigte, ebene oder im Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 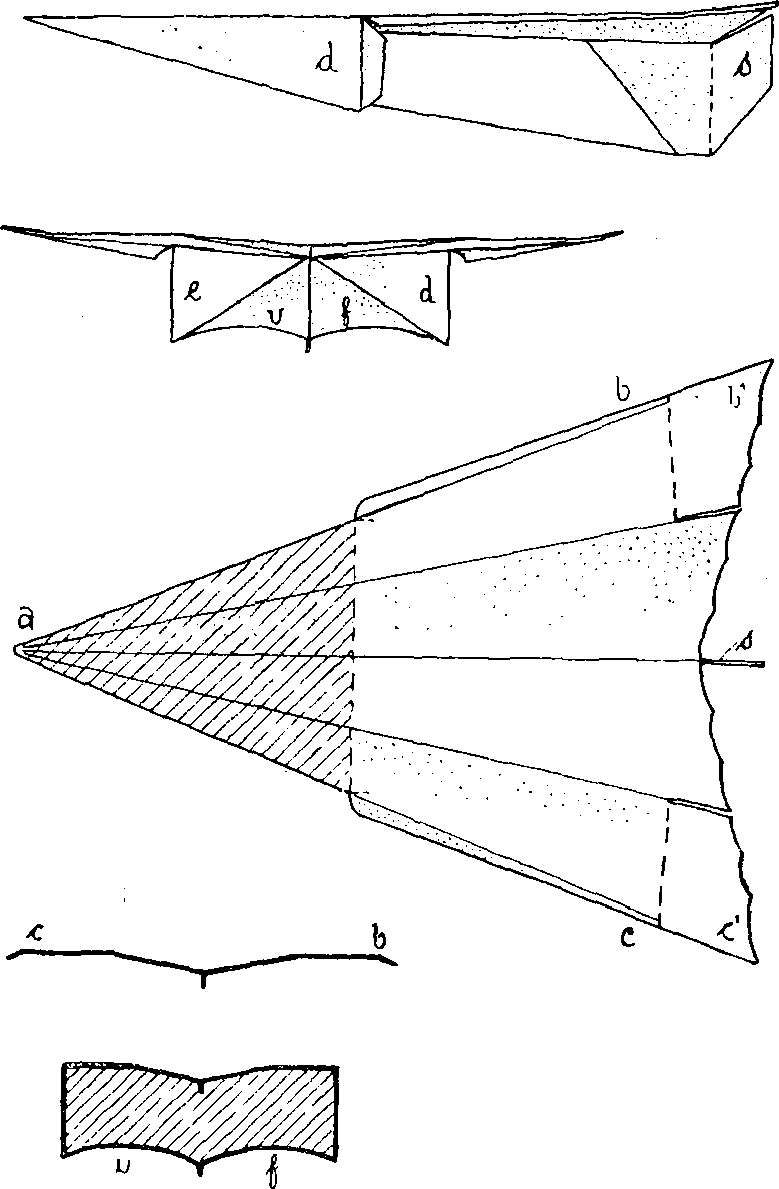 Querschnitt nach oben gewölbte, kürzere Fläche u-f gebildet, welche die Haupttragfläche a-b-c vorn schneidet und mit ihr durch senkrechte, beid : Flächen begrenzende Seitenwände d und e verbunden ist. Die durch diese Ausbildung der Tragfläche hervorgerufenen eigenartigen Luftströmungen wirken gleichgewichtserhaltend auf das Flugzeug ein. Diese Tragfläche kann für G eitflieger und auch für mit Motoren ausgestattete Drachenflieger Vcrwendu g finden. Sie hat dnich ihre radial verlaufenden Flächenkanten des weiteren den praktischen Vorteil, daß sie leicht zLisanmienklapp- und aufspannbar eingerichtet werden kann. Patent-Anspruch. Flugvorrichtung mit vom unter der Tragfläche angebrachtem, vorn scharf zulaufendem und hinten stumpf abschließendem Hohlkörper, dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlkörper oder Raum gebildet wird durch die längere Haupttragfläche selbst und durch eine gegen die Haupttragfläche geneigte ebene oder im Querschnitt nach oben gewölbte, kürzere Fläche, welche die Haupttragfläche vorn schneidet und mit ihr durch senkrechte, beide Flächen begrenzende Seitenwände verbunden ist. Verschiedenes. Der Mannheimer Flugsportklub hat seinen Namen umgeändert in: „Verein für Flugwesen Mannheim E. V." Flugveranstaltungen in Indien. Im vergangenen Jahre sind in Bagalore Schauflüge unternommen worden. Interessant ist das anläßlich dieser Veranstaltung angefertigte Plakat, das wir in nebenstehender Abbildung verkleinert wiedergeben. Gerade dadurch, daß die Indier alles was fliegt, als Symbol der Heiligkeit ansehen, wird die Flugmaschine mit einer gewissen Scheu betrachtet. Hierbei wird man sich auch an den heiligen indischen Spruch erinnern, welcher sagt: Das Ende aller weltlichen Dinge wird 1000 Jahre nachdem der erste Mensch geflogen ist, kommen. 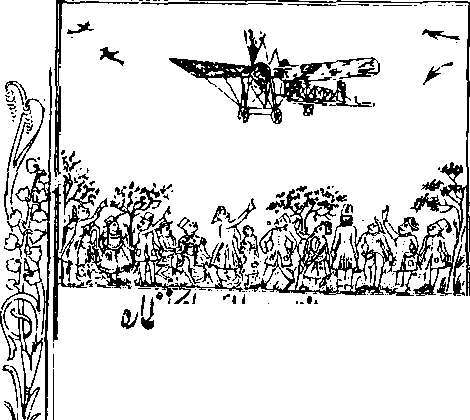 Einzelheiten von der Pforzheimer Flugzeugmodell Ausstellung. Wir haben in der Nummer 25, 1912 schon einen kurzen Rückblick über die Ausstellung gegeben und können uns heute darauf beschränken, bemerkenswerte Einzelheiten und Ausführungsformen hervorzuheben. So viel tüchtige Arbeit im allgemeinen geleistet worden war, so hielten sich doch fast alle Modelle ans Hergebrachte, neue Gedanken waren wonig vorhanden. Auch in der Form war wenig vom Herkömmlichen abweichendes zu sehen, nur ein sehr schön ausgeführter Ente-Eindecker von Heer, und zwei Fokker-PIindecker von Abrecht und Blutharsch, brachten etwa,s Abwechslung in die äußeren Formen. Doppeldecker waren in der Minderzahl, auch hatten di e Schwierigkeiten des Baues den jungen Konstrukteuren meist viel zu schaffen gemacht. Von Einzelteilen sind bei vielen Modellen die Fahrgestelle, die ja auch bei vielen großen Maschinen auf Kosten der Sicherheit zur Erlangung größerer Geschwindigkeiten etwas vernachlässigt sind, zu schwach ausgebildet. Das Fahrgestell ist der am meisten beanspruchte Teil eines Modelles, und sollte schon auf eine zweckmäßige und kräftige Ausbildung Wert gelegt werden. Die beliebten Ausführungen ä la Bleriot, mit Gummifederungen usw. und ähnliche Komplikationen sind viel zu verwickelt und taugen nicht viel, obwohl sie schwerer sind als die einfachen und kräftigen Bauarten. Die Verwendung von nur zwei aus gehärtetem Stahldraht gebogenen Trägern, an denen zugleich die Räder befestigt sind, gibt einem sonst gut ausgeführten Modell zu sehr das Aussehen eines gebrechlichen Spielzeuges. Bei aller Leichtigkeit sollten Modelle immer eine gewisse Aehnlichkeit mit großen Maschinen bewahren Als vorbildlich für leichte Modelle mag hier ein Fahrgestell von Heer beschrieben sein. Das Anlaufgestell Abb. 1 u. 2 ist aus vier Millim. starkem Aluminium gebogen, die untere Stütze a aus hartem Stahldraht, der am Aluminium befestigt ist. Die Radachse b ist in Gummiringen c frei in der Gabel des Fahrgestells aufgehängt. Die Scheiben d, die ein Verschieben nach rechts und links verhindern sollen, können wegfallen, Abb. 1 Abb. 2 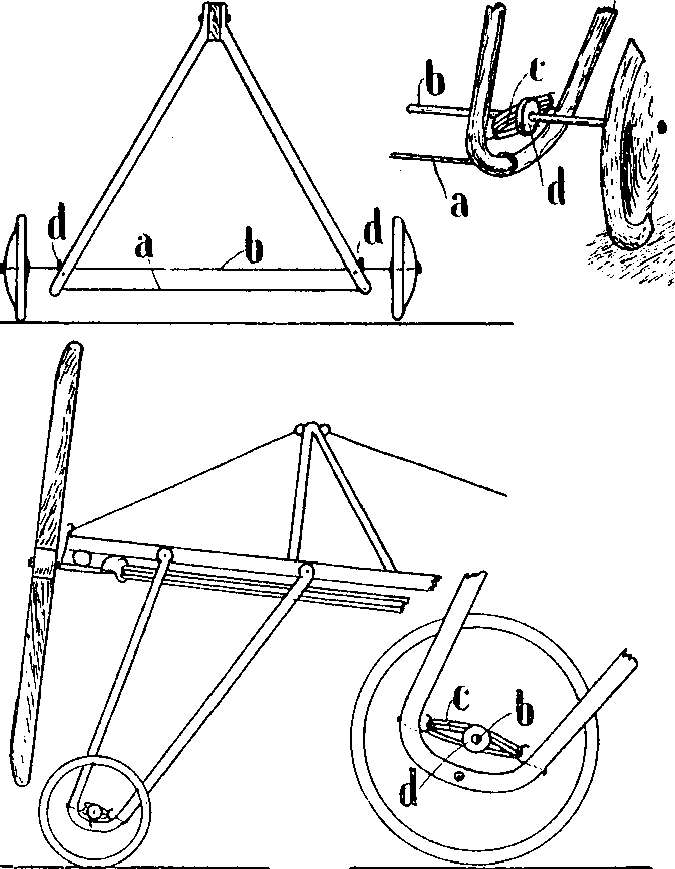 und die Achse mittels Zwirn an den Gumm ringen befestigt werden. Das ganze Fahrgestell wiegt nur 12 Gramm und ist trozdem fast unverwüstlich. Für schwere Modelle zeigt derselbe Erbauer ein Fahrgestell nach Farman. Eine eigene Ueberlegung ist ein Fahrgestell von Abrecht und Blutharseh, das in seinen Einzelheiten aus den Skizzen Seite 37 Abb. 4 ersichtlich ist. Das ganze ist aus gespaltenem oder gefeiltem Tokinrohr zusammengestellt, wird sich aber auch in jeder andern Ausführung leicht machen lassen. Statt der durchlaufenden Verspannungsäule würde vielleicht ein aufgesetzter Verspannungsmast anzuraten sein, obwohl sieh auch diese Ausführung sehr gut bewährt hat. Die Verbindung der einzelnen Streben geschieht durch die käuflichen Hülsen, besser noch durch Durchstecken eines Nagels und festes Binden mit haltbarem Zwirn. Beim Aufziehen des Gummi-motors auf eine hohe Umdrehungszahl tritt häufig ein Reißen der Gummistränge an den fast immer verwendeten scharfen Haken ein. Zur Behebung dieses Uebelstandes zeigt ein Modell eine fünfteilige Scheibe, vom Aussehen eines kleinen Rotationsmotors, aus weichem Holz gesägt und gefeilt, aus untenstehender Abb. 3 ist die Anordnung der schwarz gezeichneten Gummistränge klar zu sehen. In allen Fällen ist diese Scheibe nicht anzuraten, sicher aber bei schwereren Maschinen, mit vielen Gummisträngen, bei welcher eine rasche Umdrehung des Propellers erwünscht ist. Die von der üblichen Anordnung abweichende Form der Propelleranlage ist aus den verschiedenen Zeichnungen gut ersichtlich, ebenso die Verbindung der beiden nicht Abb. 3 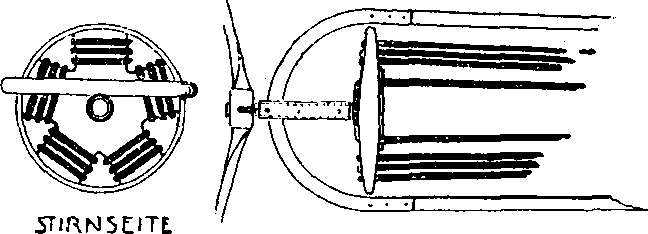 VON OBEN verspannten Längsträger durch eine Metallröhre. Vom Bau eines Rumpfes nach Art großer Maschinen ist bei Modellen, die zum Fluge bestimmt sind — und das ist doch die Bestimmung aller richtig ge- Abb. 4
bauten Modelle — abzuraten, ebenso sollten Spielereien wie Schein-motore, Führersitze, Steuersäulen u. s. w. unterbleiben, da sie ja meist nur über andere Mängel hinwegtäuschen sollen. Eine Röhre aus Holzfournier (beim Modell von Schwöhrer angewendet) ist sicher sehr zweckmäßig, erweist sich aber beim Reißen eines Gummifadens als sehr hinderlich. Gewöhnliche Haken am Ende der Spanndrähte zum Einhängen in eingenähte Oesen erleichtern das Nachspannen der Flügel. Vorrichtungen zum gleichzeitigen Nachspannen aller Fäden Seite 38 sind zu verwerfen, da ein Schlaf!werden aller Fäden kaum gleichzeitig eintritt. Schwimmer, wenn sie nur Nachbildungen großer Vorbilder darstellen, und nur als Schaustücke dienen, sollten besser wegbleiben, im übrigen bietet das Wassorflugzeugmodell eine dankbare Aufgabe für die späteren "Wettbewerbe. Alles in allem zeugte die Ausstellung von fleißiger Arbeit, wenn auch zu wünschen bleibt, daß im nächsten Jahre der Erfindergeist noch mehr in seine Rechte tritt Es genügt nicht, Gelesenes, Unverdautes und Nichtverstandenes zu verwerten und das Produkt „Rennmaschine" zu nennen. Auch zum Modellbau gehört Kenntnis der Grundgesetze, ernste Arbeit und Erfahrung, die den meisten eben vorläufig noch fehlt. (Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.) Das Auftragen des Emaillit muß in einem warmen Raum, möglichst nicht unter 15° R, geschehen. Die weißen Flecken werden dann sofort wegfallen. Der französische Militär-Wettbewerb 1911 ist in „Flugsport" Nr. 23 1911 ausführlich beschrieben. Hierüber ist in keiner anderen Zeitschrift, selbst nicht in französischen, so ausführlich berichtet wie im „Flugsport". Eine Denkschrift hierüber ist uns nicht bekannt. Das Gewicht der Flugmaschine läßt sich, wenn man keine Hängewage zur Verfügung hat, am genauesten in folgender Weise bestimmen: Man stellt die Maschine mit dem Fahrgestell auf eine Dezimalwage. Die Kufe des Schwanzes wird gleichfalls auf eine Dezimalwage gestellt und die beiden Gewichte werden dann addiert. Luftschrauben. Leitfaden für den Bau und die Behandlung von Propellern von Paul Bejeuhr. Verlag von Franz Benjamin Auffahrth, Frankfurt a. M. und Leipzig. Preis in Leinw. geb. Mk. 4.—. 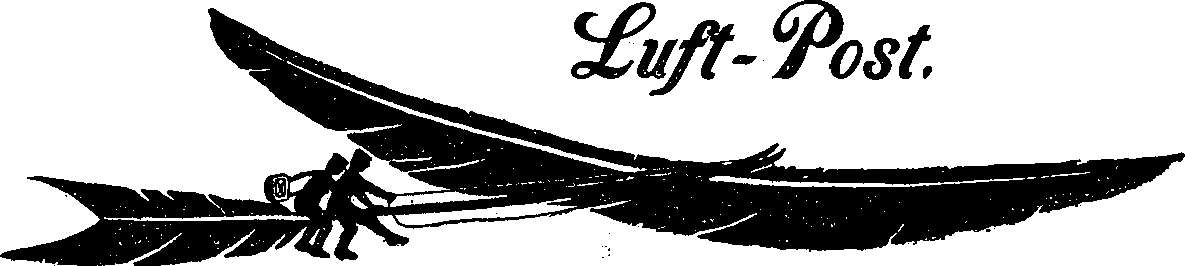 Literatur. 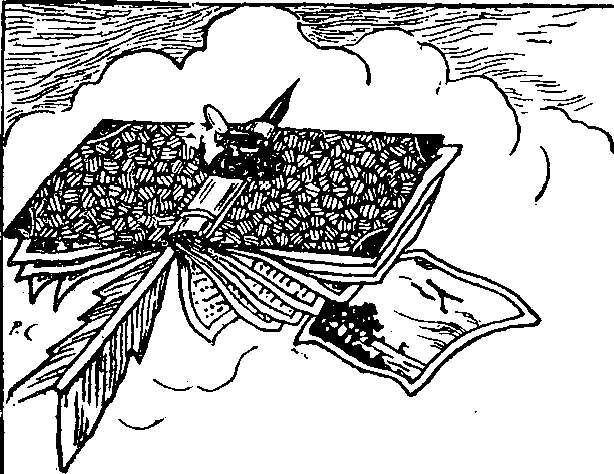 Apprecier un Aeroplane von Duchene, Capitän der Genie-Truppen. Preis frs. 1 50 Librairie Aeronautique, Paris, 40, Rue de Seine. Die Broschüre gibt in gedrängter aber doch gut übersichtlicher Form die notwendigsten Aufschlüsse über die Berechnung eines Aeroplans und seiner Aggregate etc. an, und erläutert dies an Hand von Rechnungsbeispielen und Diagrammen. Infolge der einfachen und klaren Abfassung des immerhin recht schwierigen und umfangreichen Themas kann dievorliegendeBroschüre jedem Laien und Fachmann zur eingehenden Beachtung bestens empfohlen werden. Katalog der historischen Abteilung der 1. Internationalen LuftschiffahrtsAusstellung zu Frankfurt a. M. von Dr Liebmann und Dr. Wahl II. Teil. Verlag Wüsten & Co., Frankfurt a. M. Preis Mk. 30.- in Leinw. geb. Mk. 33.—. Soeben ist der zweite Teil dieses für die geschichtliche Entwicklung des Flugwesens bedeutsamen Werkes erschienen. Anläßlich der in Frankfurt a. M. stattgefundenen Sitzung der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Flugtechnik wurde Sr. Hoheit dem Prinzen Heinrich von Preußen ein Exemplar dieses Werkes überreicht. Die bedeutendsten historischen Ze chnungen und Abbildungen sind in diesem Werk reproduziert und zwar sind hier zu nennen die Flugmaschinen von Degn, Berblinger, Blanchard. Hendson etc. Die allegorische und legendarische Abteilung zeigen, daß bereits in den frühesten Zeiten die Lösung des Flugproblems den Geist der Menschen beschäftigte. Es würde hier zu weil führen, auf Einzelheiten des umfangreichen Werkes einzugehen und können wir Liebhabern das Studium nu bestens empfehlen. Ein gut erhaltener Doppeldecker neu bespannt, mit 50 PS Argus-Motor, kaum gebraucht, ist umständehalber zu verkaufen. Als Lehrapparat sehr ge-eignet. Off, u. 859 an die Exp. erbeten. Sergeant, längere Zeit im elektr. Fache tätig, der bereits mehrere Flug-Modelle ausarbeitete, genügend Mittel nicht zur Hand hat, möchte sich als 1,858 Beruf s-Aviatiker ausbilden lassen. Off. beliebe man unt. Nr. 1788 an RudMosse, Trier zu senden. Ein neues solides (Eschenholz) Flugzeug aut. stabil mit 30 PS Motor sowie dazu geh. Schuppen und Werkzeug äußerst billig zu verkaufen. Anfragen an W. DEITERT, Ueberruhr. <852 Flugschüler überzeugt Euch bei der Wahl der Piloten - Schule von dem Erfolg. Die Flieger-Schule Strack, Duisburg ist die erste und einzigste Schule Westdeutschlands, in welcher vier Schüler nacheinander ihre Zeugnisse machten. (838) ohne (Motor) von Ingenieur konstruiert! Diverses Zubehör sowie Flugsport alle Jahrgänge 855) spottbillig. Mathy, Berlin=Südende, Potsdamerstr. 22.  (856) 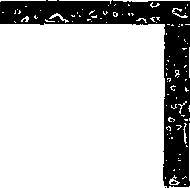 ßerictiflidie Versteigerung. Am 13. Januar 1912, Vormittags 10 Uhr, werde ich auf dem Lager der Speditions- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft zu Cöln, Maybachstraße 149 einen neuen noinfiono-SiUDseuomolor mif 3ü6eüör (Leistung von 60 — 70 PS bei 1300 Umdrehungen in der Minute) ■ gegen einen anderwärts wohnenden Schuldner versteigern. 1 I </"»Irf OtüW OtTK* Gerichtsvollzieher in Cöln I L/li/IllCllU"Ig :: Schillingstrasse 39a. ::  technische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telet. 4557 Amt I. Oskar UrsinUS, CivilingenieUP. Tel.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag'„Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 5. Februar. Industrie. In Frankreich sieht es nicht gerade rosig aus. Die Flugzeugkonstrukteure sehen mit Bangen in die Zukunft. Robert Esnault-Pelterie, ßatmanoff und Sommer haben zugemacht. Wer die Begeisterung; der vorgenannten Anhänger kennt, kann sich vorstellen, was es sie für Ueberwindung gekostet haben mag, an dem Flugwesen nicht mehr mitarbeiten zu können. Es scheint, als ob in Frankreich sich jetzt die Wirkung der seinerzeit geradezu fanatisch zum Ausdruck gebrachten Begeisterung bemerkbar mache. Daß sich das Flugwesen, wie man es sich vor einem Jahre dachte, nicht in dem von den Franzosen angedeuteten Sinne entwickeln würde, war vorauszusehen. Gott sei dank machte man in Deutschland den Taumel nicht in dem Maße mit. Allerdings haben die vielen Flugveranstaltungen, die natürlicherweise an den Kapitalien der Industriellen nagten, mit dazu beigetragen, die französische Industrie mürbe zu machen. Diese unwiderlegbare Tatsache mag uns in Deutschland als Warnung dienen Es ist immer von flugsportlichen Veranstaltungen und von Flugsport die Rede. Einen Flugsport im Sinne des Wortes gibt, es in Deutschland überhaupt nicht. Die Sporti'lieger, von denen fortgesetzt die Rede ist, sind Berufsflieger und die sogenannte Sport- fliegerei wird auf Kosten der Industriellen betrieben. Die Industrie, die außerdem noch am Hungertuche nagt, maß sie bezahlen. Es muß hier einmal ausgesprochen werden. Die Flugveranstaltungen in Deutschland müssen sorgfältig ausgewählt werden, wie sie der Industrie am dienlichsten sind. Die Flugveranstaltungen dürfen nicht von Privatleuten, denen die Sache als Sprungbrett zu dienen geeignet erscheint, ausgenutzt werden Vielleicht nimmt man in Deutschland hier etwas zu viel Rücksicht. Jede Mitarbeit ist erwünscht; aber die Arbeit muß an der richtigen Stelle verwendet werden. Andererseits hätte man denjenigen Sportfliegern — es gibt deren einige — die seiner Zeit Maschinen kauften und das Fliegerzeugnis erwarben, etwas mehr Anerkennung zollen sollen. Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, daß diese Herren mit großem Eifer ihre Sache weitergeführt hätten, wenn sie gesehen hätten, daß man ihre Bemühungen, schätzt. Dies ist auch ein Hauptgrund, warum unsere Sportfliegerei nicht in die richtigen Bahnen gelenkt wurde. Aus dem Johannisthaler Fliegerlager. Berliner Korrespondenz des „Flugsport." Die Stiftung des russischen Jubiläumspreises von 216 000 Mark für den russischen Flieger, der die Strecke Petersburg—Moskau— Petersburg als erster in einem Tag zurücklegt, bildet gegenwärtig den Hauptgesprächsstoff bei den Johannisthaler Fliegern, besonders bei den hier ausgebildeten russischen Piloten, denen bei eventueller Beteiligung ein Preis winkt, dessen Ertrag nicht zu verachten ist. Ja, aber was nützen all die vielen Redereien ! Wir haben in Deutschland sehr wenige Maschinen, die für ein solches Rennen geschaffen sind, wir müssen vorläufig nach den Wünschen der Heeresverwaltung bauen, die keine „Rennmaschinen" haben will. Einen großen Vorteil hat dies allerdings für die Industrie, die nach wie vor ihre Typen baut und 'dadurch vor unerquicklichen Nebenausgaben für Versuche bewahrt bleibt. Aber es muß und wird auch der Tag kommen, wo deutsche Apparate — und zwar Müitärmaschinen — mit der Minimalgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde und ausgerüstet mit dem leichten und betriebssicheren deutschen Rotationsmotor den Äther durchfliegen und dank ihrer konstruktiven Durchbildung dem westlichen Nachbar Anlaß zum Staunen geben. Gewiß, wir besitzen schon ausgezeichnete Apparate, die deutsche Flugtechnik schreitet auch vorwärts, mit ihr die Leistungen und das Können der Flieger, aber dem Ganzen fehlt — wenn man so sagen darf — in einer Hinsicht der sportliche und in der anderen der militärische Anstrich........ Nun, was gibt es Neues in Johannisthal? Zunächst sind die großen Betriebe vollauf beschäftigt. Bei Albatros werden unter Leitung von Hirth, Tholcn und Büchner acht Offiziere im Fliegen unterrichtet. In den letzten Tagen ist auch zum ersten Mal der neue AIbatro s-Ei ucl e c ker unter Führung von Hirth geflogen. Der Apparat gleicht im wesentlichen einer Taube, besitzt jedoch ein sehr einfaches und solides Fahrgestell und ist mit einem 100 PS Mercedes ausgerüstet. Die ersten Probeflüge zeigten schon eine sehr hohe Geschwindigkeit und gelangen zur vollen Zufriedenheit. Ebenfalls acht Offiziere sind zur Ausbildung an die Firma E. Rump 1 er kommandiert. Die Flieger Rosenstein und "W ieting 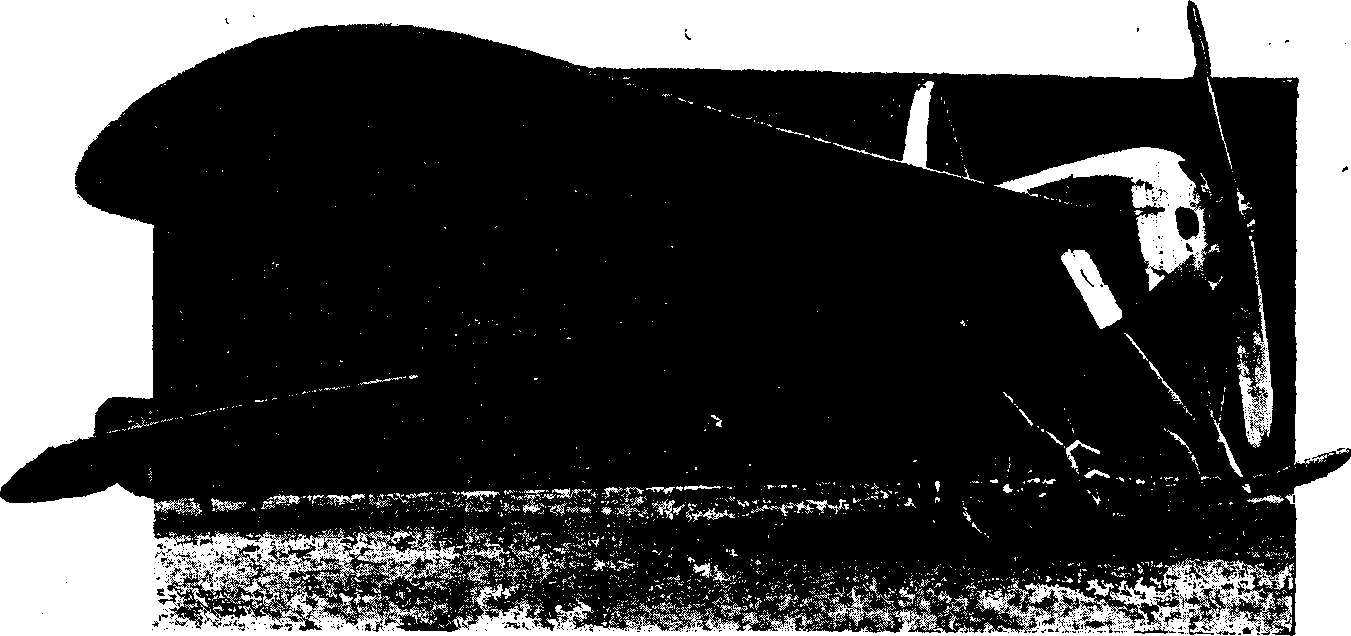 L. V. G.-Eindecker mit 100 PS Gnom. Geschwindigkeit 135 km pro Stande. üben hier das Amt des Fluglehrers aus. Die neuen Tauben mit 100 PS-Mercedes haben unter Führung von Fridolin Keidel sehr gute Resultate ergeben. Dem Probeflug einer Rumpler-Taube mit dem neuen Sechszylinder 80 PS Mercedes mit Stahlzylindern sieht man mit Interesse entgegen.  Dunetz, der in letzter Zeit die Abnahmeflüge für verschiedene Harlan-Eindecker ausführte. Mit der Führung des L. V. G .-Eindeckers hat sich der alte Zweidecker-Kämpe Felix Laitsch nun auch vertraut gemacht und steuert den schnellen Apparat mit gleicher Sicherheit wie die Doppeldecker. Für die Steuerung des neuen Zweideckers hat die L. V. G. den früheren Albatrosflieger Rupp gewonnen. Ernst Stoeffler, ein Schüler von Hauptmann Jucker und Bruder des Siegers im Nordmarkenflug, tritt am 1. Februar in die Dienste der A. G. 0. und wird die schnellen Otto-Doppeldecker führen. Auch für die Steuerung der A. G. 0 -Wasserflugmaschinen ist Stoeffler in Aussicht genommen. Eine neue Stahltaube von E. Jeannin, die mit dem Sechszylinder - Stoewer-Flugmotor, System Loutzkoy ausgerüstet wird, dürfte dank ihrer hohen Pferdestärke von 150 PS sehr große Geschwindigkeiten entwickeln. Die Ausbildung der Schüler leiten Jeannin und Sti pl o sc heck, während wir in der Flugschule Melli Beese den unermüdlichen Charles Boutard finden, der seine Jünger in die Kunst des Fliegens einweiht. Ist es wirklich noch Kunst, muß man eigentlich fragen? Die Antwort möge dem Leser überlassen bleiben. Eine große Neuigkeit sollen wir in diesem Monat noch erfahren und zwar den Sieger im Motorenwettbewerb um den Kaiserpreis. Wer wird es sein? fragen alle, man hört hier schon einen Outsider nennen. Das Motorengeräusch, das wochenlang den Flugplatz mit seinen monotonen Weisen übertönte, ist verstummt, in Adlershof sitzen jetzt die Ingenieure, bemannt mit Rechenschieber und Bleistift, prüfen und wägen, um dann am 27. Januar mit dem von allen mit Spannung erwarteten Resultat vor die Oeffentlichkeit zu treten und zu sagen: Der ist es . . . . . er Wenskus-Eindecker. Mit Beginn dieses Jahres wurde auf dem Flugplatz Johannisthal der neueste Typ des Wenskus Eindeckers eingeflogen. Die Maschine, welche in allen ihren Teilen recht einfache Formen zeigte, bewies trotz des nur 35 PS Motors eine sehr gute Steigfähigkeit. Der Konstrukteur war bemüht, um ökonomisch zu arbeiten, das Gewicht der Maschine möglichst gering zu halten, ohne daß dabei die Festigkeit und hiermit die Sicherheit derselben beeinträchtigt wurde. Der Apparat wiegt complett rund 200 kg, wovon ca. 72 kg auf den Motor entfallen. Der fertige Flugapparat, ohne Motor, aber mit Benzin, Oeltank und allem Zubehör, besitzt also nur das geringe Gewicht von 125 kg und dies bei ca. fünffacher Sicherheit. Der Rumpf ist fischförmig, besitzt also den für das Abstreichen der Luft günstigen Querschnitt. Er ist aus Stahl und Holz konstruiert und zeigt im Schnitt ein Dreieck. Seine größte Ausdehnung erreicht er etwa am hinteren Teile der Tragdecken, dort wo sich Führer- und Gastsitz befinden. Nach vorn nimmt diese Ausdehnung nur wenig ab, während sich der Körper nach hinten stark verjüngt. Die ßord-spieren bestehen aus leichtem Holz und vereinigen sich mit den in der Quersehnittebene des Rumpfes liegenden Stahlrohrdreiecken zu einem starren Ganzen von hoher Festigkeit. Diese Festigkeit wird durch geeignete Diagonalverspannung der einzelnen Felder noch bedeutend erhöht. Die Tragdecken setzen sich zu beiden Seiten des Rumpfes, in Höhe der oberen Bordspieren an, sodaß F'ührer und Gast in der mittleren Längsachse Wenskus-Eindecker. 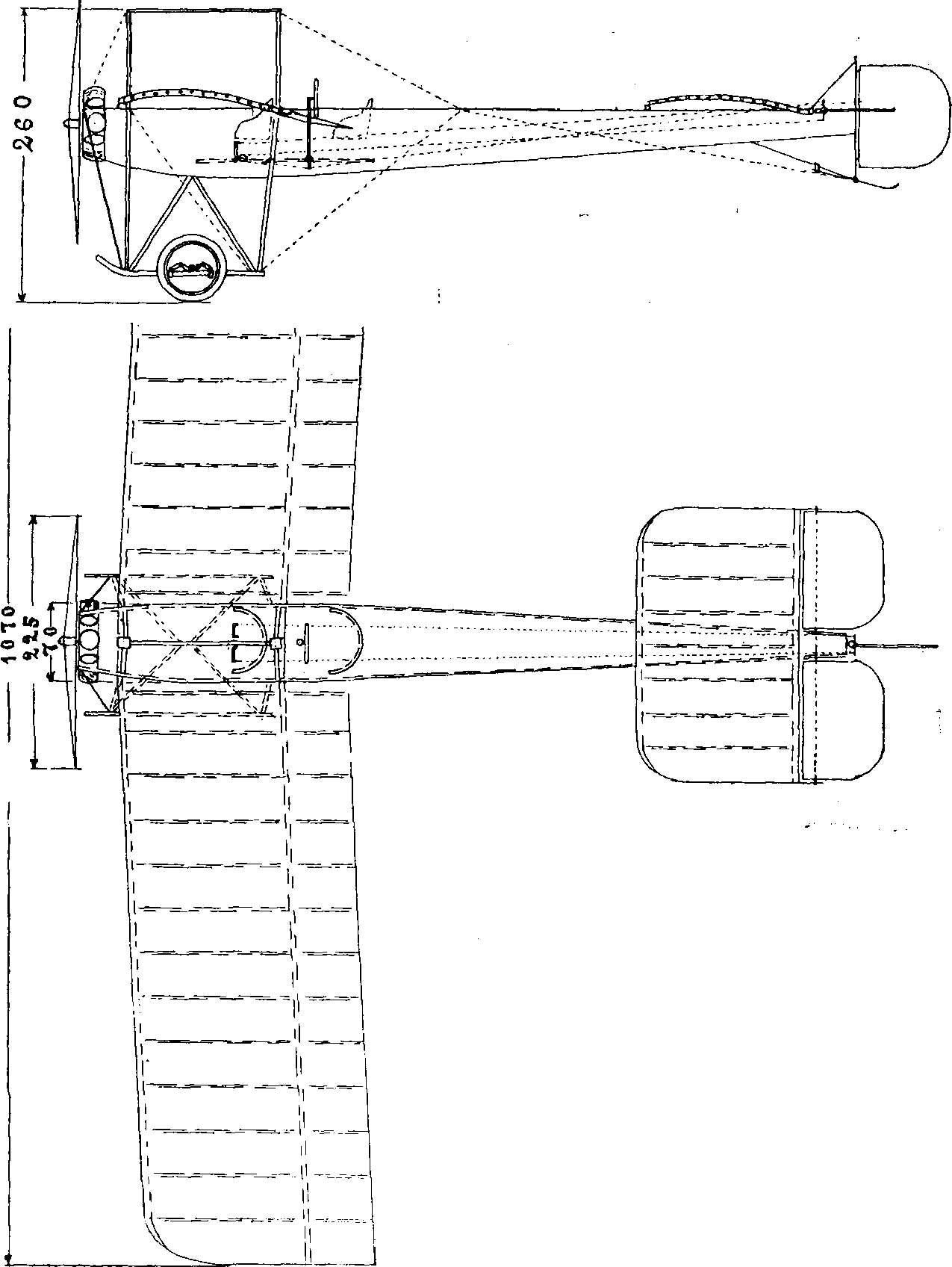 des Flugzeuges sitzen. Von hier haben sie einen guten Ueberblick über den Apparat, und auch einen guten Ausblick für die Orientierung. Die gut profilierten Tragdecken sind sehr leicht gehalten, werden aber durch genügende Verspannung starr mit dem Körper verbunden. Eigenartig ist auch der Bau des Fahrgestells, das sich, aus acht Holzstützen von eliptischem Querschnitt bestehend, an den Rumpf anfügt. Die Achse, die an jedem Ende ein 24" Rad trägt, ist in Gummiringen derart federnd angebracht, daß sie frei nach allen Seiten schwingen kann Sie wird also auch bei seitlicher Landung nachgeben und den Stoß an die Gummiringe weitergeben. Die am Schwanzende des Apparates befindliche Dämpfungsfläche von ungewöhnlicher Größe ist in der Kurve der Tragdecks gewölbt. Hinter dieser Dämpfungsfläche sind Höhen- und Seitensteuer angeordnet. Infolge der großen Dimensionen der Steuerorgane ist der Apparat sehr wendig, auch bei langsamem Tempo. Dies ist für die Bewegung des Apparates an der Erde, also für ein sicheres Starten und Landen, vorteilhaft. Deshalb fühlte sich auch der Konstrukteur veranlaßt, eine möglichst große Fläche zu verwinden. Die Verwindung ist als Flächenverwindung ausgearbeitet, und zwar werden die halben Tragdecken verwunden. Der Motor ist vor den Tragdecken eingebaut und ruht in einem leichten Rahmen aus Stahlrohr, in den er sich schnell ein- und ausmontieren läßt. Seine Achse liegt genau in der Mittelachse des Rumpfes. Der „Volt"-Motor (Siehe die nebenstehende Abb.) ist ebenfalls eine eigene Konstruktion von Wenskus. Es ist ein luftgekühlter, feststehender 7 Zylinder Sternmotor von ca. 35/40 PS Leistung. Sein complettes Betriebsgewicht beträgt ca. 75 kg. Infolge seiner 7 Zylinder besitzt er eine ausgezeichnete Kühlfläche, sodaß eine Ueberhitzung, selbst bei Dauerbetrieb, ausgeschlossen ist. Dabei ist der Benzin- und Oelverbrauch nur sehr minimal. Direkt auf die Motorachse setzt sich der Propeller, der den Zylindern in ausreichendem Maße Kühlluft zuführt. Die Handhabung des Apparates ist äußerst einfach, da sämtliche Organe zur Betätigung der Steuerung in durchaus sinnfälliger Weise bedient werden. Im Fluge haben Konstrukteur und Flugapparat die besten Beweise ihres Könnens abgelegt. Der Apparat erreicht bei ruhigem Wetter eine Stundengeschwindigkeit von 110—120 km und hat seinen Führer spielend in Höhen von 2000 m getragen. Auch bei stürmischem Wetter hat sich das Flugzeug bewährt. Bei 16—20 m/Sekundenwind hat er tapfer Stand gehalten und jederzeit dem Steuer gehorcht. Von großem Vorteil, besonders für Anfänger, ist es. daß der Apparat bei ausgeschaltetem Motor selbsttätig in den Gleitflug übergeht. Dies trägt, im Verein mit dem geringen Gewicht, viel dazu bei, daß Stürze nie so heftig werden wie bei schweren Apparaten. Der Apparat hat dies bereits bei Stürzen aus 10—25 m Höhe bewiesen. Die Fallgeschwindigkeit ist infolge des geringen Gewichts ziemlich gering. Daher wird die Wucht des Aufpralls fast vollständig durch den Bruch des Fahrgestells aufgenommen. 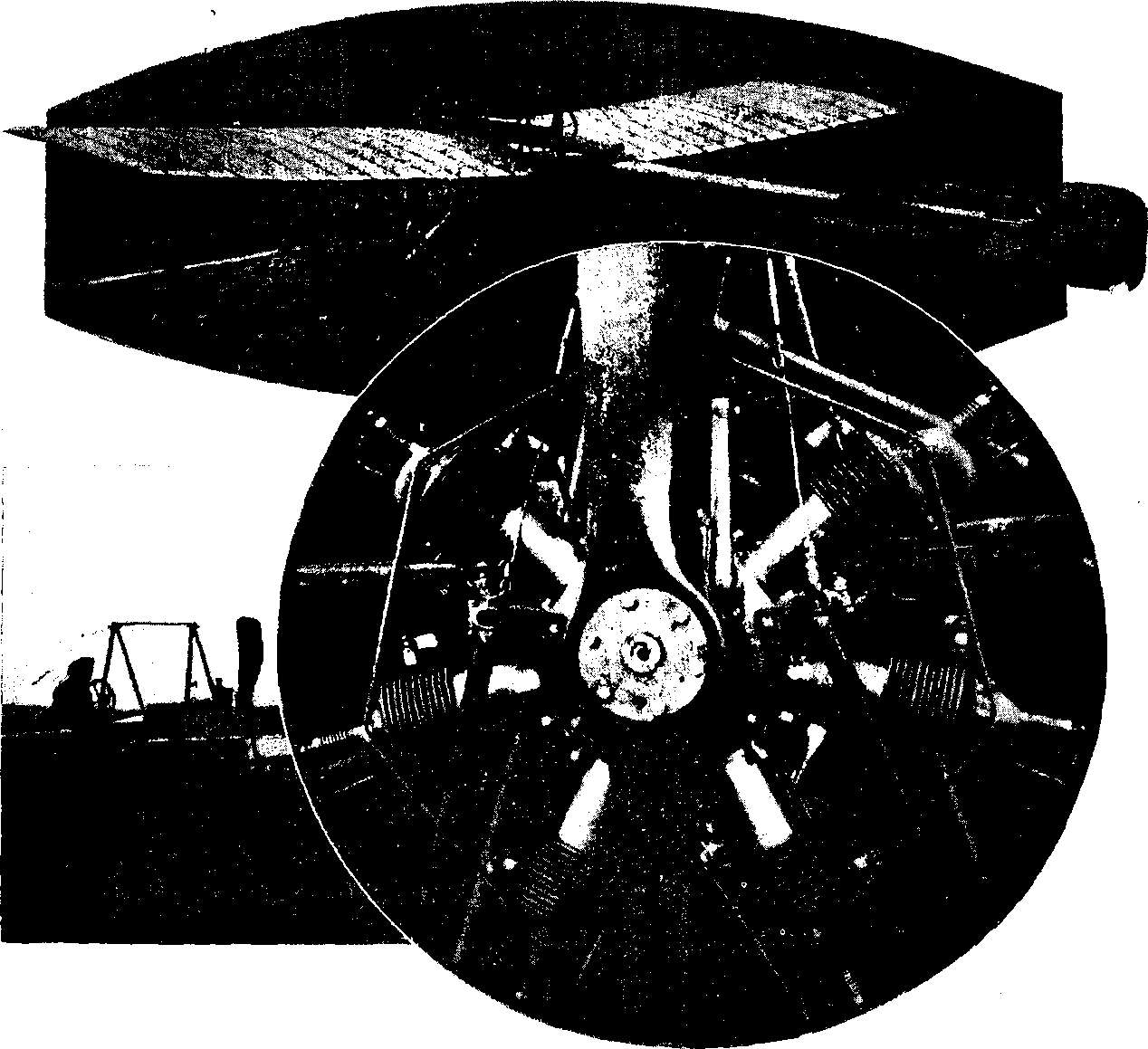 Wenskus-Eindecker Der luftgekühlte Stern-Motor ist besonders für diesen Apparat konstruiert. Die Jeannin-Taube. Die hohen Anforderungen, welche die Militär-Verwaltung bei der Abnahme ihrer Flugmaschinen stellt, haben die deutschen Flng-maschinen- Konstrukteure gezwungen, solide und äußerst kräftige Maschinen zu bauen. Auch die Erfahrungen im bulgarisch-türkischen Krieg, in welchem die Maschinen zeitweise ohne Schutz im Freien bleiben mußten und den Witterungseinfliissen preisgegeben waren, zeigten, daß verschiedentlich der Stahlkonstruktion der Vorzug zu geben ist. Diesen Anforderungen entsprechend hat Jeannin auf Grund jahrelanger Erfahrungen und kostspieliger Versuche einen neuen Typ, die Jeannin-Taube, herausgebracht. Bei diesem Eindecker sind alle Teile bis auf die Tragdecken aus Stahl konstruiert. Alle Abmessungen sind derartig kräftig gehalten, daß grobe Landungen und rücksichtsloses Transportieren kaum einen Defekt zur Folge haben dürften. Der Rumpf der Maschine zeigt in der Längsrichtung die bewährte Fischform, die sich als überaus günstig erwiesen hat. Der Querschnitt ist rechteckig in der Gestalt eines Brückenträgers aus autogen geschweißten Stahlrohren, diagonal verspannt. Der Sitz des Fliegers sowohl wie der des Gastes liegen tief im Rumpf und schützen die Insassen vollständig gegen Regen, Wind etc. Das vordere Viertel des Rumpfes ist mit Aluminiumblech, das übrige mit imprägniertem Stoff verkleidet. Der Kühler ist unter dem Rumpf, zwischen dem Fahrgestell derartig geschützt montiert, daß er bei Transporten oder bei Arbeiten an dem Apparat vor Beschädigungen geschützt und doch der Zugluft höchst intensiv ausgesetzt ist. Die Oel und Benzinbehälter liegen im Rumpf und haben ein Fassungsvermögen für die Betriebsdauer von 5 Stunden. Der Fluggast sitzt direkt hinter der Motoranlage, der Führer hinter dem Passagier rückwärts. Für die entsprechende vertikale Beobachtung sind in den Flügeln rechts und links Fenster offen gelassen. Das Fahr- und Landungsgestell ist ein Resultat langer Versuche und derart vervollkommnet, daß bei Landungen im Sturzacker mit 250 kg Nutzlast, ebenso beim Anfahren und Aufsteigen des Apparates alles hochgespannten Ansprüchen genügte. Die Federungen sind 4 starke Druckfedern, die Felgen doppelt und ebenso die Bereifung. Jeder Spanndraht und Kabel ist unnötig und ist das Fahrgestell als Fundament der Maschine auch für die Flügelaufhängung keinerlei kleinen Defekten, die sich oft zu g.oßen Deformationen erweitern, ausgesetzt. Höhenstf uer, hintere Tragfläche, Stabilisierungsfläche, ebenso Seitensteuer sind samt und sonders aus ovalem Stahlrohr gefertigt. Die Tragtlächen haben Zanonia-Form und sind mit höchster Präzision ausgeführt. Alle Beschläge und Laschen sind entsprechend verstärkt im Gegensatz zur allgemeinen Taubenkonstruktion. Die Bespannung ist eine segeltuchähnliche Leinewand, mit wasserunempfindlichem Emaillit imprägniert und von allerhöchster Reißfestigkeit. Die Brücke und ebenso die auf den Rumpf montierten Spanntürme sind aus ovalem Stahlrohr, durch Scharniere zusammenlegbar mit der Brücke oder dem Rumpf konstruiert. Es ist demnach nicht nötig, Brücke oder Spanntürme bei dem Versand zu demontieren, es werden nur die Spanndrähte an der Seite gelöst und die Stützen umgelegt, bei der Montage diese aufgerichtet und die gelösten Drähte angezogen. Seitliche und rückwärtige Verspannung bleibt hierbei unberührt. Alle starken zum Öpannturm oder zum Untergestell laufenden Drähte und Kabel vereinigen sich oben in zwei starke Haken, die am Spannturm eingehakt werden, unten insgesamt in 4 Spannschlösser. Durch die umlegbare Brücke und Spanntürme ist eine schnelle Montierbarkeit in etwa 15 Minuten möglich, was sehr ins Gewicht fällt, da vorher einige Stunden dazu nötig waren. Die Steuerung ist die von der Militärverwaltung verlangte Normalsteuerung und werden für das Fußsteuer Hebel sowohl wie Pedale nach Wunsch eingesetzt. 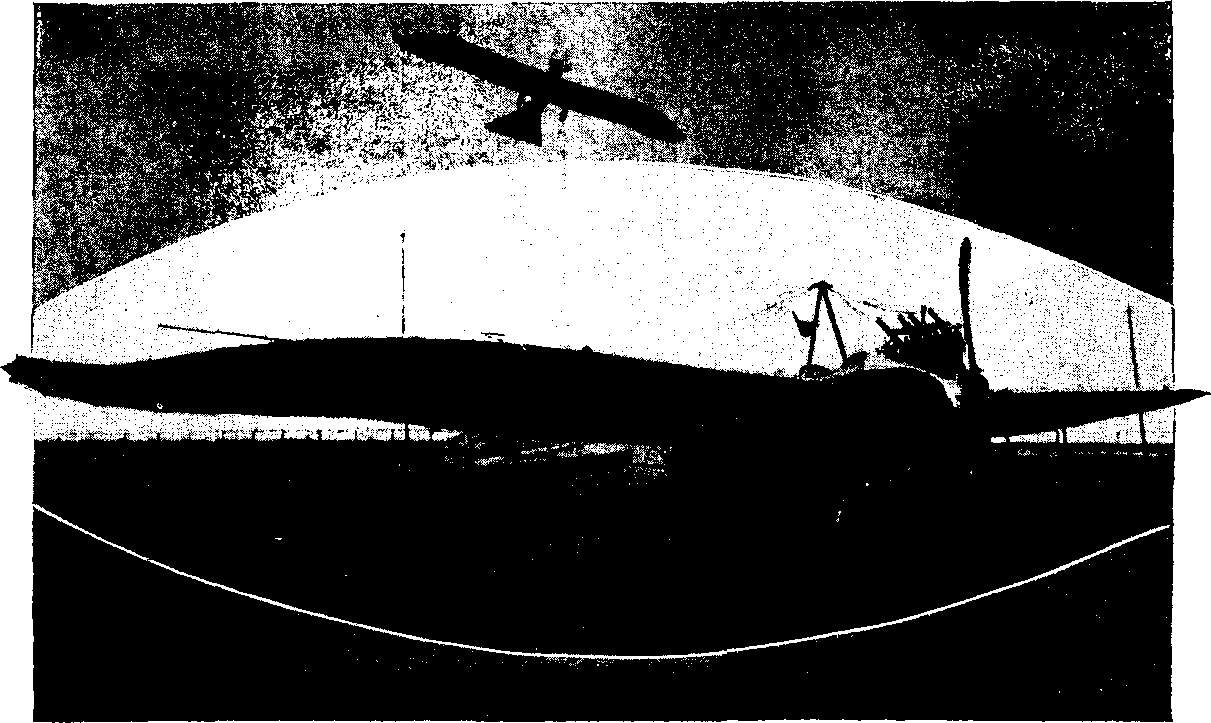 Jeannin- Taube. Zum Antrieb dient vorzugsweise ein 100 PS 4 Cyl., 150 PS 4 Cyl., ferner 6 Cyl. 120 PS und 6 Cyl. 150 PS Argus-Motor. Indessen wird auf Wunsch auch jede andere Motortype eingebaut. Die Länge des Apparates ist etwa 9 m, die Spannweite etwa 13 m. Die Geschwindigkeit ist mit 100 PS Argus-Motor auf 108 bis 110 km pro Stunde festgestellt. Es werden auch Tauben-li,ennmaschinen gebaut, deren Tragflächen-Durchschnittsprofile einer Geschwindigkeit von 140 km pro Stunde entsprechen. Oberrheinflug 1913 — Prinz Heinrich-Flug. In der Zeit vom 10.—17. Mai findet der 3. deutsche Zuverlässig-keitsflng am Oberrhein statt, der mit Genehmigung Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen den Namen „Prinz Heinrich-Flug 1913" führt. Seine Königl. Hoheit Prinz Heinrich von Preußen wird selbst den Flug leiten. Der Start ist in Wiesbaden. Von dort geht es über Gießen- -Cassel - Coblonz nach Karlsruhe. Zwischen Karlsruhe und Straßburg finden an den letzten beiden Tagen militärische Aufklärungsübungen statt, für welche der Chef des Generalstabs der Armee selbst die Aufgaben stellen wird. Ks ist eine taktische und eine strategische Auf-klärungsübung in Aussicht genommen. Der Flug soll von Offiziersund Civilfliegern gemeinsam bestritten werden. Für die ersteren sind Ehrenpreise, für die letzteren Geldpreise und Tagesentschädigungen ausgesetzt. Verschiedene Städte haben schon Ehrenpreise und Geldunterstützungen bewilligt, z. B. Wiesbaden 20000 Mk , Cassel 100U0 Mk. und Coblenz 7500 Mk. Seine Majestät der Kaiser hat einen Preis in Aussicht gestellt, der für die beste Gesamtleistung vergeben wird. Ferner wird wieder ein Prinz Heinrich-Preis der Lüfte ausgeschrieben, voraussichtlich für die beste Aufklärung. Die drei ersten Etappen werden als Zuverlässigkeitsflüge ausgeschrieben und nach der Gesamtflugdauer bewertet, doch wird zum erstenmale der Versuch gemacht, die verschieden starken Motoren gegeneinander auszugleichen, indem die Flugdauer schwächerer Maschinen prozentual verringert wird. Gleichzeitig wird die Minimalnutzlast je nach den Pferdestärken verschieden festgesetzt. Dieser erste Versuch ist von größtem Interesse und wird voraussichtlich vorbildlich für spätere Ueberlandflüge werden. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Ein bekanntes Pariser Blatt hat es unternommen, durch umständliche Operationen festzustellen, welches die gesamte Flugdistanz gewesen ist, die die französischen Militär- und Zivilflieger in der für den Maschinenflug ungünstigsten Periode des Jahres, nämlich in der Woche vom ]5. bis 22. Dezember, vollbracht haben. Nach den statistischen Zahlen, die bei dieser Enquete herausgekommen sind, betrug die in jener einen Woche zurückgelegte Flugdistanz 35460 km, wobei allerdings der bekannte Fing Garros von Tunis nach Rom als die größte Flugleistung mit in Einrechnung kommt. Jedenfalls ist diese Zahl schon deshalb interessant, weil sie zeigt, daß die französischen Flieger in der Tat außerordentlich emsig am Werke sind, und namentlich die Militärflieger führen unausgesetzt an der Ost- und Nordgrenze zahlreiche und weite Erkundungsflüge aus, für welche die in jenen Grenzgegenden so überaus sorgfältig verteilten Flugzentren als Basis zu dienen haben. Uebri-gens ist zu Neujahr der seinerzeit wegen seiner öffentlichen Zeitungspolemik gegen die innere Organisation des französischen Militärflugwesens viel genannte gemaßregelto Hauptmann Clavenad wieder dem Flugwesen zugeteilt worden, und zwar ist er zum Kommandanten dos neu installierten Flugzentvnms von Mezirres ernannt worden. Ein militärischer Wasser-mascliinenunfall ereignete sich am letzten Sonnabend zu Tonion. In der dortigen Rhede unternahm der Kreuzer „Foudre", der bekanntlich mit Spezialeinrichtungen für Abflug und Landung von Flugzeugen ausgestattet worden ist, in Gemeinschaft mit einer Anzahl von Unterseebooten eine Uebung, bei welcher Marineleutnant Cayla auf einem Voisin-Canard-Flugzeug beteiligt war. Plötzlich stürzte Cayla ins Meer, wo seine Maschine von den Wellen umgeschlagen und in die Tiefe gerissen wurde. Zum Glück war es dem Offizier gelungen, sich rechtzeitig frei zu machen und sich schwimmend über Wasser zu halten, bis eine vom Kreuzer „Foudre" zur Hdfe gesandte Schaluppe den Verunglückten, der keine Verletzungen davongetragen hat, aufnahm. Noch einige interessante Vorgänge im französischen Flugwesen sind zu berichten: Eugene Gilbert, der erst vor kurzem durch seine neuen Geschwindigkeitsrekords für 350 bis 600 km die Aufmerksamkeit auf sich lenkte, hat neuerdings eine schöne Flugleistung vollbracht. Als Gilbert den siegreichen Morane-Eindecker von Etampes nach Issy zurückbrachte, legte er diese Strecke in 22 Minuten zurück, sodaß er dieselbe, allerdings von einem starken Rückenwinde begünstigt, mit 170 km Stundengeschwindigkeit hinter sich brachte. Chevillard stellte am 10. Januar zu Buc auf einem Zweidecker Henry Farman einen neuen Höhen-Weltrekord zu vieren auf, indem er, mit drei Passagieren an Bord seines Apparats, auf 1500 Meter Flughöhe gelangte. Der Farman-Apparat war mit einem 80 PS Gnom-Motor ausgestattet. Die Welt-Höhenrekorde stehen demnach jetzt wie folgt: Flieger allein: Garros 5 600 Meter Flieger und 1 Passagier: Lt. Blaschke 4360 Meter Flieger und 2 Passagiere: Lt. Blaschke 3580 Meter Flieger und 3 Passagiere: Chevillard 1500 Meter Eine hübsche Leistung vollbrachte auch Servies, welcher vor einigen Tagen für die wertvollen Dienste, die er in Marokko in der Aufklärung leistete, zum Ritter der Ehrenlegion ernannt worden ist. General Drude wollte am letzten Dienstag dem genannten Flieger unter großer Zeremonie, im Beisein der Truppen, das rote Band an die Brust heften und hatte Servies aufgefordert, sich zu dem Zwecke auf dem Manöverfelde von Oran einzufinden, wo eine große Truppen-Revue zur Feier des Vorgangs abgehalten wurde. Trotz strömenden Regens erschien Servies mit seinem Flugzeug auf dem Felde, umkreiste während der ganzen Dauer der Parade die Truppen, landete schließlich glatt vor der Front und empfing von dem General die Dekoration mit dem üblichen Glückwunschkuß. Auch Vedrines, wenn man seinen Worten Glauben schenken will, hat wieder „große Sachen" vor. Augenblicklich reist er noch immer im Lande umher und veranstaltet Vorträge, in denen er seine bisherigen und zukünftigen Leistungen bespricht. So hat er dieser Tage in Boulogne zu kund und wissen getan, daß er sich in kurzem nach Algier und Tunis begeben und dort sensationelle Leistungen vollbringen werde. Nach seiner Rückkehr will er dann den jetzigen Geschwindigkeitsrekord spielend sehlagen, denn für ihn und seinen Apparat ist dies eine Kleinigkeit. Ernster ist der Versuch zu nehmen, den Bielovucie in diesem Augenblick unternimmt; er will nämlich auf's neue eine Ueberquerung der Alpen ausführen und zwar genau die Flugstrecke über den Symplon, wie sie der verunglückte Chavez gewählt hatte, nämlich von dem schweizerischen Orte ßrieg nach der italienischen Ortschaft Domodossola, innehalten. Seit mehreren Tagen befindet sich der Chilene in Brieg, wohin aus allen Ecken des Landes und auch aus dem Auslande viele Tausende Menschen zusammengeströmt sind. Bisher aber ist ihm der Flug noch nicht gelungen, weil meist ungünstiges Wetter, Kälte und Schneesturm herrscht. Am letzten Mittwoch hatte sich Bielo-vucie, als vom Simplon her die Meldung eintraf, daß das Wetter ruhiger und milder geworden sei, in der Tat an den Abflug gemacht, indessen vermochte er sich nicht in die erforderliche Höhe zu erheben, sodaß er unverrichteterweise wieder landete. In Domodossola, wo man ihn auf die Nachricht vom Abfluge bereits erwartete, hatte man zu seiner Ankunft die Kirchenglocken läuten lassen. Der Apparat, mit dem Bielovucie den Flug wagen will, ist ein neues von Andrieu erfundenes und gebautes Modell, das bisher noch keine praktische Flugleistung aufzuweisen hat. Ein anderes interessantes Projekt ist die von Helen geplante Ueberquerung des Mittelländischen Meeres, die er auf einem Nieuport-Eindecker unternehmen will. Er will dieser Tage von dem Flugfelde in Montpellier abfliegen, die Küste von Frankreich und Spanien entlang bis nach Gibraltar gelangen, die dortige Meerenge überfliegen, in Melilla eine Zwischenlandung vornehmen und dann, wiederum die Küste entlang, nach Algier zu gelangen suchen. Der Eindecket' ist mit einem 100 PS Motor versehen worden. Zu den aben eueriichen Projekten gehört das vom Kapitän Bartlett, von der Peary-Expedition, in einem Vortrage vor dem Aero-Club in New England entwickelte Projekt eines Fluges nach dem Nordpol in dem Bartlett erklärte, daß die Flugmaschine das einzige Mittel sei, mit dem man den Nordpol erreichen könne. Ein Apparat könne zu Lande bis nach dem Kap Jesus befördert werden, das 381 Meilen (613,117 km) vom Nordpol entfernt sei, sodaß diese Strecke von einer Flugmaschine in einigen Stunden zurückzulegen wäre. Ein eigenartiger Vorfall ereignete sich dieser Tage, indem eine Flugmaschine in der Luft Feuer fing. Die Bewohner der Ortschaft Etrechy, 8 km von Etampes, betrachteten am Sonnabend einen Apparat, der über ihrem Orte dahinsegelte, als sie plötzlich sahen, wie die Maschine von hellen Flammen umgeben war, worauf der Apparat jäh zur Erde stürzte. Man eilte zur Unfallstelle und fand den Leutnant Delvert, der von Beaune-la-Ro-lande kommend sich nach Buc begeben wollte. Er erzählte, daß in 600 Meter Höhe ein Benzinrohr platzte und daß alsbald die Flammen den Apjaarat einhüllten. Ohne die Geistesgegenwart zu verlieren, stellte der Flieger die Zündung ab und gelangte so zur Erde. Leutnant Delvert hat keine Verletzungen erlitten. Eine ansehnliche Flugleistung, die in den Vereinigten Staaten dieser Tage vollbracht worden ist. wird hier viel besprochen. Dort hat der Flieger Antony Jannns an Bord eines Wasserflugzeugs die Reise von Omaha nach New-Orleans, eine Distanz von 3817 km zu Wege gebracht, indem er von Omaha, im Staate Nebraska, mit einem Kinematographenoperateur an Bord, dem Laufe des Missouri und des Missisippi folgend, über Chester, Theben, Columbus, New Madrid, Memphis, Arkansas City und Greenville nach New-Orleans gelangte. Er war am 6. November abgeflogen und hat am 14. Dezember das Ziel seiner Reise erreicht. Das französische Flugwesen hat in dem Ableben des Präsidenten des Aero-Club, Cailletet einen schweren Verlust erlitten. Cailletet, der ein Alter von 80 Jahren erreicht hat, hat sich um die wissenschaftliche Förderung der modernen Flugbestrebungen große Verdienste erworben. Natürlich wird seine Nachfolge lebhaft diskutiert und es werden mehrere Kandidaten für das wichtige Amt des Präsidenten des Aero-Clubs genannt: Prinz Roland Bonaparte, Jacques Balsan, Deutsch delaMeurthe, Graf de la Vaulx, Eiffel, Barthou. Die meisten Aussichten scheint Deutsch de la Meurthe zu haben. Am 28. dieses Monats wird zu Paris eine Außerordentliche Sitzung der Internationalen Aeronaut. Föderation stattfinden, deren Tagesordnung einige interessante Punkte aufweist; 1. Schaffung eines besonderen Patents für Wasserflugzeug-Führer; 2. Schaffung einer aeronautischen Triptyk; 3. Der aeronautische Kalender 1913; 4. Einspruch des französischen aeronautischen Clubs gegen das Klassement von Eugene Renaux im Wasserflugzeug-Meeting auf der Thamise; 5. Aufstellung des Reglements für' den Internationalen Pokal für Marine-Flugzeuge. Zwei neue Fliegerehrungen haben hier große Befriedigung hervorgerufen: es handelt sich um die Ernennung von Robert Savary und Emile Dubonnet zu Rittern der Ehrenlegion, die beide sich als Konstrukteure bezw. Flieger hervorgetan haben. Erwähnt sei noch eine große Flugzeugbestellung die der französischen Industrie wieder zu tun gibt: die russische Regierung hat 116 Farman-Zweidecker in Auftrag gegeben, von denen 70 in Moskau, 30 in Sankt Petersburg gebaut werden sollen. Weitere 16 Apparate werden nach dem neuesten Modell Henri Farmans mit Mitrailleusen ausgestattet sein. Von einem neuen Apparat wird jetzt hier gesprochen, den ein Ingenieur in Dijon, namens Bourgoin, gebaut hat, und der nächstens seine ersten offiziellen Versuche unternehmen soll. Die Maschine besteht aus einem Kranz, der eine große Tragfläche ergibt. Dieser Kranz kann, indem er um eine durch seine Mitte gehende Achse, schwingt, jede vom Flieger gewünschte Neigung annehmen. Eine zur Achse senkrechte Welle, die nach dem äußeren Kranze hingeht, trägt die Schraube. Eine andere senkrechte Welle geht bis zur Mitte und unterhalb der Tragfläche angebrachten Gondel herab. Ein durch ein Handrad gesteuerter Mechanismus gestattet, der aus dem Kranz gebildeten Fläche die entsprechende Neigung für Auftrieb und Abstieg zu geben. Da der Mechanismus selbstsperrend ist, hält sich die Fläche in der Lage, die ihr der Flieger gegeben hat. Ein anderes Handrad, welches ein -vertikales, am anderen Ende des Durchmessers placiertes Steuer manövriert, sichert die Flugrichtung. Wie es heißt, sollen die ersten Versuche mit diesem Apparat erstaunliche Resultate ergeben haben. (Hoffentlich hat der Erfinder die bekannte Johannisthaler Plutkrempe, die im Modell sehr schön flog, nicht kopiert. Die Red.). Ferner ist noch ein interessanter Fallschirmversuch zu erwähnen, der vor einigen Tagen zu Rouen im Beisein mehrerer Offizieller Persönlichkeiten, sowie einer nach Tausenden zählenden Menschenmenge stattgefunden und ein beachtenswertes Ergebnis gehabt hat. Es handelt sich dabei um das Fallschirm-System Lomatzsch-Kotsehnikoff, das unter folgenden Umständen erprobt wurde. Der Apparat wurde, nachdem er mit einer Puppe im G-e-wichte von 62 kg belastet war, von der großen Drehbrücke bei Rouen in die Tiefe lanciert. Trotz der verhältnismäßig geringen Höhe (etwa 53 Meter) funktionierte der Apparat ausgezeichnet. Nach 34 Meter Fall entfaltete sich das System ohne jede Störung vollständig und die folgenden 19 Meter wurden in 123/5 Sekunden, also mit der freilich sehr reduzierten Fallgeschwindigkeit von 1,507 Meter in der Sekunde, von dem Apparat zurückgelegt, was einer mittleren Fallgeschwindigkeit von insgesamt 3,95 Metern entspricht. Dieses auf eine Distanz von nur 13 Metern erreichte Resultat muß als ein ansehnliches betrachtet werden. Der Aero-Club de France hatte offizielle Vertreter zu dem Experiment nach Rouen entsandt und diese berechneten, daß, wenn die Fallhöhe 180 Meter gewesen wäre, die mittlere Fallgeschwindigkeit pro Sekunde 1,47 Meter betragen hätte!1 Wie es heißt, hat der Aero-Club de France, der sich auf den von seinen Kommissaren abgefaßten Bericht für die Erfindung interessiert, Vorkehrungen getroffen, daß neue Versuche mit dem interessanten System demnächst in Paris und in größerem Maßstabe vorgenommen werden sollen. Rl. ____XiJX_ Das Flugwesen im Brüsseler Salon. Auch Belgien will es Frankreich gleichtun und seinen Salon haben. Allerdings reicht das belgische Flugwesen bei weitem nicht aus, um einen solchen Salon zu füllen. Neben Automobilen und Fahrrädern zeigt der diesjährige Brüsseler Salon auch einige Flugmaschinen. Die französischen Häuser Deper-dussin, ßorel, Hanriot, die ihre Maschinen in Belgien verkaufen wollen, zeigen ihre modernsten Typen. Die Ausstellungsobjekte belgischen Ursprungs sind indessen recht dürftig. Aus den Werkstätten hat man einige Versuchsmaschinen, manchmal recht zweifelhaften Charakters, herausgeholt und als Ausstellungsobjekte aufgeputzt, Objekte wie man sie kaum in dem ersten Pariser Salon gesehen hat. Die ausgestellten Maschinen belgischen Ursprungs sollten wirklich jetzt die in Belgien führenden Kreise erschrecken und aufmuntern,  Vom Brüsseler Salon. Gesamtansicht, in der Mitte hängender Deperdussm-Renneindecker. 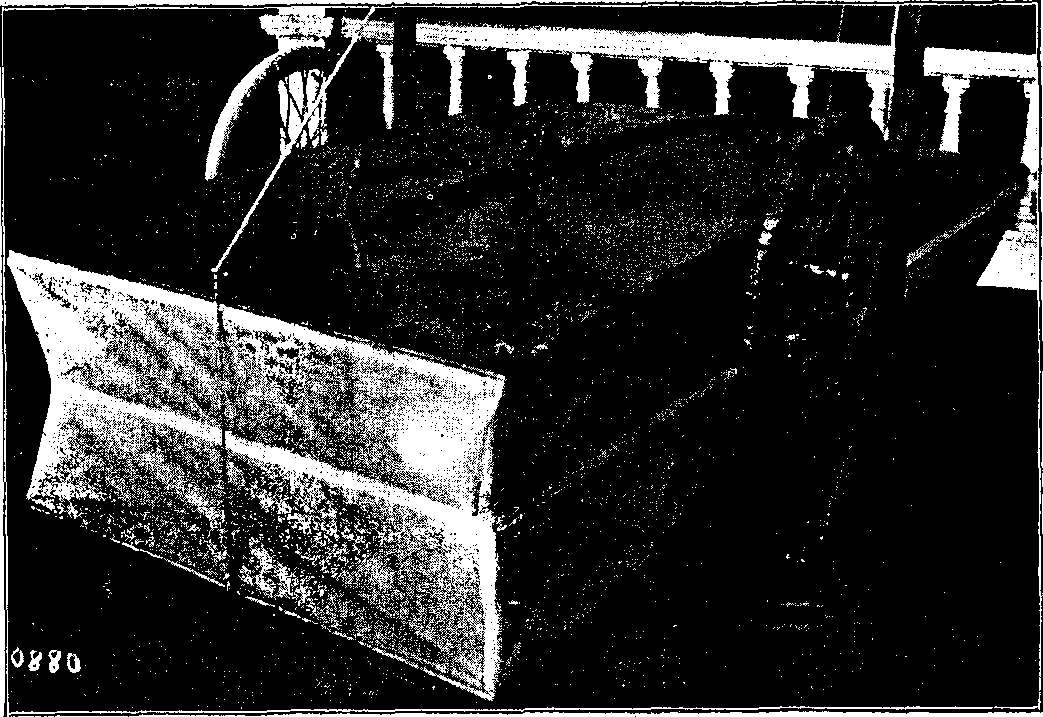 Vom Brüsseler Salon. Zusammenklappbares Gleitboot Solomons. etwas für die Unterstützung des Flugwesens in Belgien zu tun. Man braucht sich nicht zu wundern, wenn sich alte Kämpen, wie Baron de Caters zurückgezogen haben. Von den Ausstellungsobjekten sei zu erwähnen ein eigenartiges Gleitboot Salomons, von der Avia gebaut. Dieses Gleitboot kann, wie die beistehende Abb. erkennen läßt, wie ein Blasbalg zusammengedrückt werden. Durch eine vom Motor betätigte Luftpumpe wird dieser pneumatische Schwimmer aufgepumpt. Unaufgepumpt wird der untere Teil des Schwimmers mittels einer Leine nach oben gezogen und die Räder berühren den Boden. 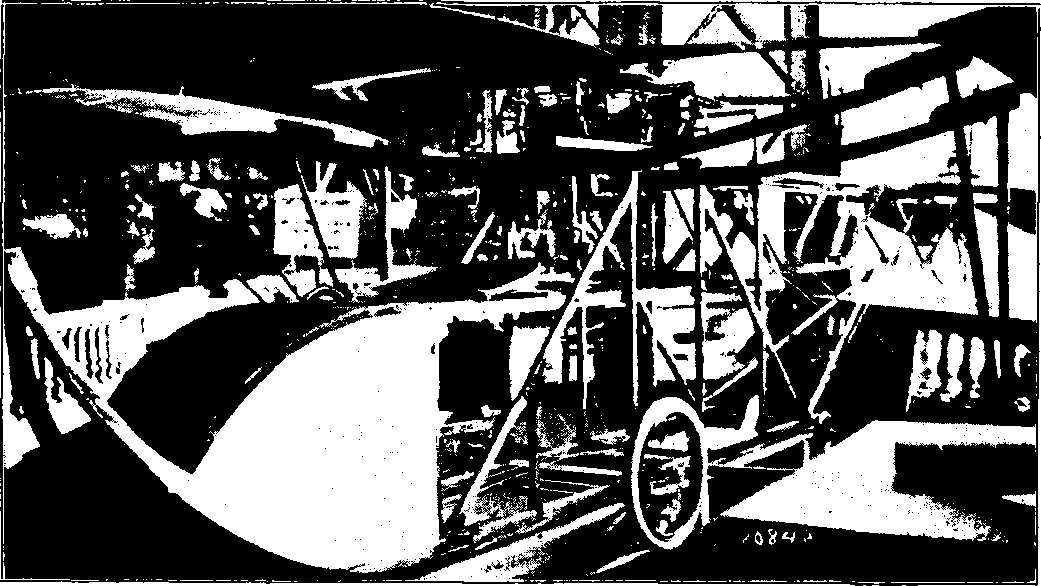 Vom Brüsseler Salon. Kombinierte Schrauben- und Gleitflugmaschine Villard. Ferner sehen wir einen kombinierten Schrauben- und Gleitflieger Villard gleichfalls gebaut von der Avia, mit 100 pferdigem Anzanimotor, welcher eine vierflügelige Schraube von 3,3 m antreibt. Die Maschine, 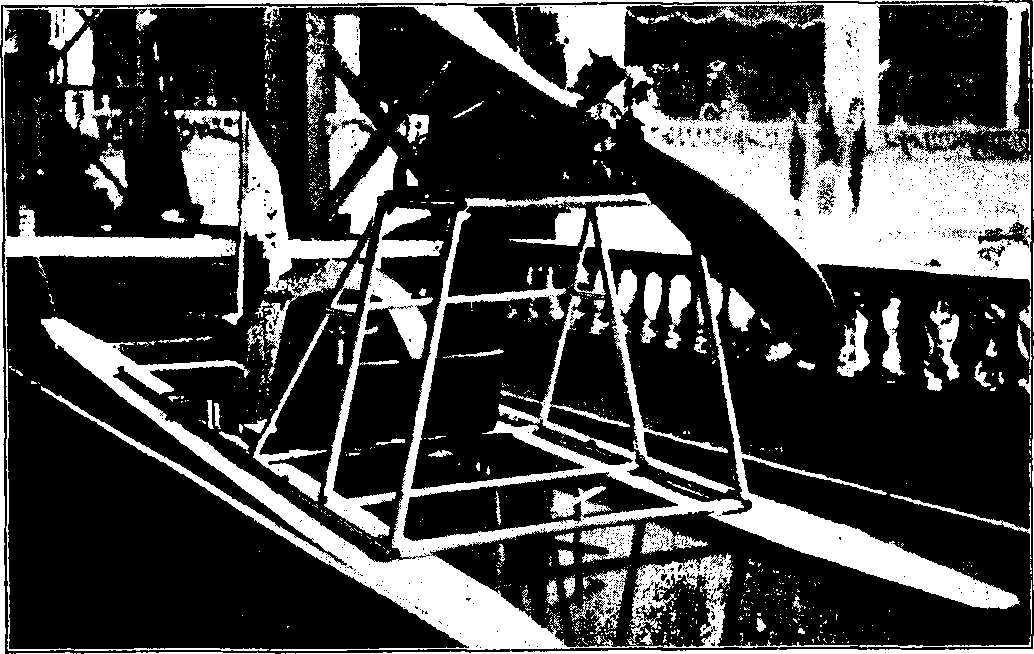 Vom Brüsseler Salon. Gleitboot Tips. besitzt 12 m Spannweite, eine Gesamtlänge von 10 m, das Gewicht beträgt 500 kg. Auf dem Stand von Tips ist ein Gleitboot mit zwei Schwimmern und einem Rotationsmotor Tips, auf dem die Schraube verkehrt aufmontiert ist, ausgestellt. Die Motoren werden in drei Größen gebaut: 25-30 PS 55 kg 50-60 PS 75 kg 70-80 PS 78 kg Die Tourenzahl beträgt 1200. Die Sicherheit des Maschinenflages nimmt von Tag zn Tag zn. Eine englische Fachzeitschrift hat eine interessante Statistik aufgestellt, aus der klar ersichtlich ist, in welchem rapiden Maße die Sicherheit in der Flugmaschine mit jedem Tage zunimmt. In der Tat wird das Fliegen bei der ständig fortschreitenden Flugzeugtechnik immer weniger gefährlich, und"'wenn naturgemäß die bedauerlichen Unglücksfälle, die in diesem Sport, wie in jedem anderen Fortbewegungssport, vorkommen, die große Menge abzuschrecken geeignet sein können, so muß doch, auf Grund der sorgfältig zusammengestellten Zahlen, mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß im Jahre 1912 1 tötlicher Unfall auf je 172.163 km Flugdistanz vorgekommen ist! Der Unfall-Durchschnitt hat sich seit dem Jahre 1908 wesentlich verringert, wie nachstehende Aufstellung klar zeigt, in welcher für die einzelnen Jahre neben der Anzahl von Fliegern die Zahl der dnrch-flogenen Kilometer und die Zahl der dabei vorgekommenen tötlichen Unfälle angegeben ist: Anzahl d. Flieger: Zurückgel. Kilometer: Tötl. Unfälle- 1908 5 1.609 1 1909 50 45.052 4 1910 500 965.400 30 1911 1500 3.700.700 77 1912 5800 19.308.000 112 Die Zahlen für 1912 reichen nur bis 22. November, aber es ergibt sich nach vorstehendem das Resultat, daß an tötlichen Unfällen zu verzeichnen war: 1908 1 auf je 1.600 Flug-Kilometer 1909 1 auf (e 11.2C3 Flug-Kilometer 1910 1 auf 'je 32.180 Flug-Kilometer 1911 1 auf je 48.270 Flng-Kilometer 1912 1 auf je 172.103 Flug-Kilometer oder es haben ihr Leben eingebüßt: 1908 1 von je 5 Fliegern 1909 1 von je 12 Fliegern 1910 1 von 'je 17 Fliegern 19.11 1 von jje 2(1 Fliegern 1912 1 von je 51 Fliegern Interessant ist auch die Feststellung mit Bezug auf die verschiedenen an den Unfällen beteiligten Nationen: es hatten
sodaß sich also für jedes der angeführten Länder folgendes proportio-nelle Verhältnis an tötlichen Unfällen ergibt : Vereinigte Staaten 1 auf je 7 Flieger Rußland 1 auf je 17 Flieger England 1 auf je 18 Flieger Italien 1 auf je 20 Flieger Oesterreich 1 auf je 20 Flieger Belgien 1 auf je 25 Flieger Deutschland 1 auf je 28 Flieger Frankreich 1 auf je 41 Flieger Diese Statistik ist außerordentlich lehrreich. Sie zeigt, wie die Sicherheit des künstlichen Fluges in rapider "Weise zunimmt, und wie die Zahl der Unfälle mit der Vervollkommnung der Technik und dem organisatorischen Ausbau des Flugwesens gewaltig zurückgeht. In denjenigen beiden Ländern, in denen die Flugzeugkonstruktion am weitesten fortgeschritten ist, stellt sich das Verhältnis natürlich am günstigsten, nämlich in Deutschland und in Frankreich. Rl. Wissenschaftliche Gesellschaft für Fingtechnik. Die.Sitzung am 26. November 1912 in Frankfurt a. M. (Fortsetzung von No. 26 1912.) Diskussion. August Euler: Durch die allen Diskussionsrednern für ihren Vortrag zur Verfügung gestellte Zeit von 5 Minuten bin ich zu meinem Bedauern nicht in der Lage, das alles auszuführen, was ich für diese Diskussion zurechtgelegt hatte, und ich will versuchen, meine Meinung über die zur Diskussion stehenden Punkte: Luftlöcher, Böen und Wirbel, zusammenzufassen, daß ich meinen Vortrag in möglichst dieser Zeit beende. Ich habe drei Jahre lang auf einem großen Flugplatze, dem Darmstädter Sande gestanden und hier während der Zeit/ während welcher ich nicht fliegen konnte, sehr viel Gelegenheit gehabt, Wirbel, Böen und wechselnden Wind sehen zu können und zwar dadurch, daß auf dem tiefen Sande an heißen Sommertagen manchmal die kleinsten Windstöße den feinen trocknen Sand bewegten, und man somit Wirbel, Böen und Windstöße in ihrer Stärke an dem durch dieselben bewegten feinen Sande beobachten konnte, und besonders aber, wie groß die Dimensionen solch auftretender Wirbel, Böen und Windhosen sind. Ich habe mich nach vielen Ueberlegungen und Beobachtungen fragen müssen, ob denn solchen verhältnismäßig kleinen Veränderungen in der Windrichtung: Luftstöße, Wirbel und Böen bezüglich der durch sie auf eine Flugmaschine auszuübenden Kraft eine solche Wirkung beizumessen sei, wie dies allgemein geschieht. Ich habe mir diese Frage schließlich immer wieder mit „nein" beantworten müssen und dann, wie wir Praktiker dies oft tun, wenn man lange nicht zu einem einigermaßen sicheren Resultate kommt, mir alle Fragen bezügl. der Böen ii. s. w. umgekehrt gestellt und mich gefragt: Sollten hier nicht vorhandene größere Kräfte plötzlich verschwinden und das Unstabilwerden der Aeroplane bezw. die Wirkung ''er sogenannten Luftlöcher usw. hervorrufen können ? Denn es müssen größere Kräfte sein, welche auf den Aeroplan wirken, als die, welche wir mit dem Auge wie oben erläutert oder an unserem Gesicht oder als Widerstand an unserm Körper fühlen. Ich bin schließlich nach Zusammenfassung aller Erfahrungen, die ich in der Luft gemacht habe, darauf gekommen, daß alle für den Flieger gefährlich werdenden Momente mit diesen verhältnismäßig kleinen Luftbewegungen: Wirbel, Böen als Zusatzbeanspruchung oder zusätzliche Kraft, wohl nichts zu tun haben. Denn einer Geschwindigkeit von 100 km gegenüber können diese Kräfte, zusätzlich ins Auge gefaßt, keine so sehr störende Wirkung haben, wie man allgemein vermutet. Ich e:kläre mir den Vorgang der auftretenden Strömungen gefährlicher Stöße, Luftlöcher usw. folgendermaßen: Ein Luftloch im Sinne der alltäglichen Auffassung existiert nicht. I. Beispiel: Da tatsächlich die Führer besonders schwerer und schneller Aeroplane immer wieder behaupten, daß sie plötzlich wie in ein Luftloch senkrecht heruntergefallen se en, so ist diese Wirkung jedenfalls da, und die Ursache dieser Wirkung erkläre ich mir folgendermaßen: Ein Aeroplan, welcher eine Eigengeschwindigkeit von 100 km hat, fliegt bei einem Winde, bei welchem heute wohl alltäglich geflogen wird, sagen wir etwa 14 Sekundenmeter. Es entspricht dies ungefähr einer' Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km pro Stunde. Der Aeroplan wird innerhalb dieser Luftströmung um 50 km langsamer fliegen, wenn man seine Geschwindigkeit von einem Punkte der Erde aus beurteilt. Unter der Tragfläche beträgt jedoch die Geschwindigkeit der Luft ebenso viel wie die Eigengeschwindigkeit des Aeroplans, das ist wie oben gesagt 100 km. Würde nun dieser Aeroplan, wenn in 800 m Höhe dieser Gegenwind vorhanden ist, herunterfliegen und auf 600—650 m plötzlich eine entgegengesetzte Luftströmung von genau deiselben Stärke, 14 Sekundenmeter, also ca. 50 km pro Stunde, finden, so ist die nunmehr unter der Tragfläche herrschende Situation am besten wiederum von einem festen Punkte der Erde aus zu beurteilen. Im Moment vor diesem Wechsel der Windströmung hat der Aeroplan zu dem betreffenden Punkte der Erde eine Geschwindigkeit von 50 km; er bekommt nun Rückenwind bezw. in einen Luftstrom welcher eben-— — r*- — ■*- falls mit 50 km Geschwindigkeit in derselben Richtung geht, wie der Aeroplan fliegt, und dann ist die Geschwindigkeit des Luftstromes unter der Tragfläche gleich Null und der Aeroplan muß senkrecht herunterfallen. Ich wähle dieses Beispiel lediglich, um die Sache leicht und kurz verständlich zu machen. II. Beispiel: Fliegt ein Aeroplan nicht herunter, sondern in horizontaler Richtung aus einer Luftströmung in die entgegengesetzte, so treten dieselben Verhältnisse wie oben erklärt ein. III. Beispiel. Fliegt ein schwerer Aeroplan, welcher 100 km Eigengeschwindigkeit hat, gegen einen Luftstrom von 50 km und der Führer will plötzlich umkehren, (eine gerade Linie vom Beginn bis zu Beendigung des Halbkreises hat vielleicht eine Länge von 300 m) so bekommt er in demselben Luftstrom plötzlich einen Rückenwind von einer Geschwindigkeit von 50 km, und dann ist die Geschwindigkeit des Luftstromes unter der Tragfläche im ersten Moment gleich Null, oder je nach der während der Kurve erhaltenen Beschleunigung der Geschwindigkeit des Aeroplanes etwas größer. Es kann unter diesen Umständen sogar der Fall eintreten, dal.), wenn die Flugmaschine in der Kurve noch langsamer geworden ist, als sie vorher zu einein bestimmten Punkte der Erde gesehen war, daß die Geschwindigkeit des Windes größer ist im ersten Moment des hineinkomniens in diesen, als die Geschwindigkeit der Flugmaschine selbst, da die Flugmaschine im ersten Moment nicht einmal mit diesem Luftstrom sondern sogar langsamer als dieser fliegt. Ein Aero-p'an muß in dieser Situation herunterfallen. Für den Piloten muß das Gefühl entstehen, als wenn er in ein Loch fiele. Aehnliches trifft mehr oder weniger ein, wenn man schräg im Winde auf einen bestimmten Punkt zufliegt und plötzlich eine andere Windrichtung findet. Ae^nlich verhält es sich mit Boen und Wirbeln, welche entweder die ganze Flugmaschine oder wie in den 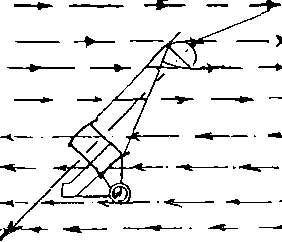 meisten Fällen nur einen Teil derselben treffen. Böen und besonders Wirbel und kleine Windhosen, welche ich beobachten konnte, haben manchmal nur einen Durchmesser von 20 bis 30 oder 40 m in horizontaler Richtung. Fliegt eine Flugmaschine durch eine solche Böe oder einen Wirhel und durchschneidet sie dieselben nur mit einem Flügel, so wird dieser Wirbel wenn der Aeroplan beispielsweise im allgemeinen mit Gegenwind fliegt, eine verhältnismäßig große Verringerung der unter der Tragfläche vorhandenen Luftgeschwindigkeit hervorrufen und die Tragkraft der Fläche entsprechend heruntersetzen. Fliegt man im Sommer morgens durch viele solcher Böen, Wirbel und Luftwellen, so Iritt durch die Geschwindigkeitsverminderung oder Vermehrung unter der Tragfläche ein Schaukeln, Stoßen und Unsicherfliegen ein. Ich glaube, daß fast alle Böen, Wirbel sich in diesem Sinne unter der Tragfläche zur Geltung bringen. Man kann auch bei Wirbeln auf großen trockenen Sanden beobachten, daß die Bewegungen dieser Wirbel bezw. Windhosen aus Kreisbewegungen aus horizontaler Richtung bestehen. Der Sand wird in die Höhe getragen, manchmal bis zu 50, 80 und 100 m, aber er wird von 20 bis 30 m Höhe so dünn, daß man die Bewegungen nach oben nicht mehr sieht. Auch sind diese so sehr langsam, daß man unbedingt sagen muß, daß der Stabilität des Aeroplans diese Bewegung nach oben nichts anhaben kann, sondern es kommt nur die horizontal drehende Bewegung in Betracht, welche von hinten oder vorn eine Verminderung oder Vermehrung der Luflgeschwindigkeit unter der Tragfläche hervorruft. Auch Luftwellen, welche als Wellen m vertikaler Richtung sich bewegen, würden fast dieselbe oder eine ähnliche Einwirkung auf d e Verringerung oder Vermehrung der Geschwindigkeit unter einem Teile der Fläche zur Folge haben. In schweren Flugmaschinen wird sich natürlich die Folge solcher Verminderung der Luftgeschwindigkeit unter der Tragfläche mehr fühlbar machen, und wenn eine Beschleunigung der größeren Gewichte nach unten stattgefunden hat, wird der Aeroplan um so schwerer sich wieder fangen. Solche Luftlöcher heben sich allmählich wieder dadurch auf, daß der Aeroplan durch den Motor und die Schraube langsam innerhalb der neu eingetretenen Situation wieder beschleunigt, steuerbar und stabil, wird. Wenn der Aeroplan sich oben in den zuerst gesagten Verhältnissen erst wieder vollständig beschleunigt hat, dann beträgt seine Geschwindigkeit zu einem bestimmten Punkte der Erde gesehen 150 km. Unter der Tragfläche ist die Geschwindigkeit des Aeroplans gleich, das ist wie angenommen 100 km. Ich möchte besonders darauf hinweisen, daß die Geschwindigkeitsverändernngen unter der Tragfläche, welche zusätzlich größer werdend auftreten, die Stabilität und den Flug der Maschine nicht so sehr stören, wie solche Geschwindigkeitsverändernngen, welche abzüglich auftreten, weil im ersten Falle das Gewicht der ganzen Maschine dieser zusätzlichen Kraft entgegensteht, während im anderen Falle bei geringer werdender Geschwindigkeit unter der Tragfläche das Gewicht der Maschine bezw. der auf den Teil der Tragfläche entfallende Teil des Gewichts herunterzieht, bezw. dann auch die Massenbeschleunigung ins Auge zu fassen ist. Ich bin fest überzeugt, wenn man registrie, ende Meßinstrumente so dicht unter der Tragfläche angebracht zur Feststellung dieser Geschwindigkeitsverhältnisse unter der Tragfläche verwenden würde, so wird sich meine Theorie sicher beweisen. Man wird nun von diesen neuen Gesichtspunkten aus sich zu fragen haben: Wie verhält sich unter diesen Verhältnissen eine schnelle Flugmaschine gegenüber einer langsamen (schnell und langsam im Maßstabe der heutigen Verhältnisse gesehen), und ferner eine schnelle Flugmaschine, welche vielleicht so außerordentlich schnell ist, daß in ihrer Schnelligkeit ein sehr großes Plus gegenüber den auftretenden Windströmungen enthalten ist? Es wird die Frage zu stellen sein : Wie verhalten sich unter diesen neuen Gesichtspunkten flache Flächen gegenüber sehr stark gewölbten Flachen? Wie verhält sich eine große Steigung gegenüber einer kleinen Steigung? Von der Wetterkunde möchte ich erbitten, daß in Zukunft mit Rücksicht auf die gemachten Ausführungen außer der Windstärke in 50t), 600, 800 und 1000 m Höhe auch die Windrichtung in diesen verschiedenen Höhen dem Flieger vor dem Start dazu gesagt werden kann. Dann wird der Flieger bei einem Ueberlandflug z. B. von Frankfurt bis Freiburg ungefähr sagen können, in der und der Höhe fliege ich nicht, weil ich da in die vermeintliche Luftlöchcrsit.iation kommen kann." Hellmuth Hirth äußerte sich hierzu folgendermaßen: Ich habe vom Flugzeug aus verschiedenartige Luftströmungen beobachten können, und erkläre ich mir die Entstehung der einzelnen Störungen wie folgt: Das Flugzeug steigt bei starkem gleichmäßigen Winde auf, und machen sich, außer Verlangsamung der Geschwindigkeit zur Erde bei Gegenwind, Vergrößerung bei Rückenwind und der entsprechenden Folgen bei Seitenwind keine unangenehmen Störungen geltend Das Flugzeug erreicht eine gewisse Höhe und bei einem Geplänkel, ich möchte sagen Präludien, zu euer kommenden Höhe, findet man leichte Schwankungen und Stöße, die sich steigern, um daraufhin wieder abzunehmen. Das Flugzeug klettert weiter 50—500 Meter, und es machen sich zwischen 20 und 100 Meter immer wieder derartige Störungen bemerkbar. Der beobachtende Flugzeugführer weiß, daß er von einer bestimmten Windrichtung in eine anders gerichtete Luftströmung übergegangen ist, die Böen die entstehen, tragen keinen bösartigen Charakter. Dies zur Turbulenz. Windstöße konnte ich hauptsächlich in der Nähe der Erdoberfläche bedingt durch Bodenunebenheiten, feststellen, sowie sehr heftige Böen bei Gewitterstörungen, in größerer Höhe je nach der Windstärke der Erd-lündernisse. bis 800 m Höhe bemerkbar, von dort ab keine Böen durch Windstöße mehr. Fallböen oder Luftlöcher entstehen erstens durch Erdhindernisse immer auf der dem einfallenden Winde entgegengesetzten Seite, und zwar sind diese die unangenehmsten, besonders wenn das Flugzeug gegen den Wind fliegt. Ein Beweis hierfür ist mir in einer derartigen Fallböe die Wirkungslosigkeit der Steuer, bis das Flugzeug wieder seine Normalgeschwindigkeit übernommen hat. Luftlöcher und Fallböen heftiger Art entstehen auch bei Sonnenstrahlung, erstens mal durch aufströmende warme Luft und aber auch durch Wasserdampf, der anscheinend nicht gleichmäßig aufsteigt, sondern sich zu einem Kamine ansammelt. Als Beispiel lühre ich an, den Waldkomplex in der Nähe des Wannsee, den ich häufig überflogen habe. Immer bei verschiedener Windrichtung, immer ungefähr an derselben Stelle, die dem Mittelpunkt des Waldes entsprach, nur von dem herrschenden Winde mitgenommen, konnte ich jedesmal auf eine Böe rechnen, die eigentümlicher Weise in einer Höhe von 800 Meter stärker wirkte, als in einer Höhe von 400 Meter. In dieser Höhe hatte ich den Eindruck, als ob der Kamin erst in der Bildung begriffen sei. Die Beobachtungen wurden bei sehr wenigem Wind, nicht über 2 Sek/Met. gemacht. Von Luftströmungen, die schräg zur Erde gehen und anscheinend in derselben verschwinden sollen, habe ich nie etwas verspürt. Im Gegenteil, ich fand in der Nähe des Bodens al!e Böen schon zerbrochen, so daß ich mir die Wirbel am Boden vorstelle, wie die Brandung der Meereswellen am Ufer. Nur eine Art der Böen wo die S euerung wirkungslos wird, kann, wenn das Flugzeug sich in niedriger Höhe befindet, ein Durchfallen bis auf den Boden hervorrufen." Geheimrat Prof. Aßmann (Lindenberg) berichtete über Vors:hläge zum Studium der atmosphärischen Vorgänge im Interesse der Flugtechnik. Als Ergebnis der ausgiebigen Debatte über seinen Vortrag stellte Dr. Linke in seinem Schlußwort folgende endgültige Definition der Luftlöcher fest: 1. Windsprünge, 2. thermische Fallböen, hervorgerufen durch ungleichmäßige Erwärmung der Erdoberfläche, 3. Gebirgsböen, die durch die Zerklüftung der Erdoberfläche entstehen. Die Windsprünge können innerhalb von fünf Sekunden Geschwindigkeitsänderuugen von zehn Meter in der Sekunde erreichen. Nach einem Vortrag von Diplomingenieur Willi. Hoff über Versuche an Doppeldeckern zur Bestimmung ihrer Eigengeschwindigkeit und ihres Flugwinkels spracli Prof. Friedländer (Hohe Mark) Uber „Die Physiologie und Pathologie der Luftfahrt". Es folgten noch Demonstrationen von Instrumenten, die durch einen Vortrag von Dr. Bruger über den von der Frankfurter Firma Hartmann & Braun als Ersatz des Kompasses hergestellten Kreisel eingeleitet wurde. 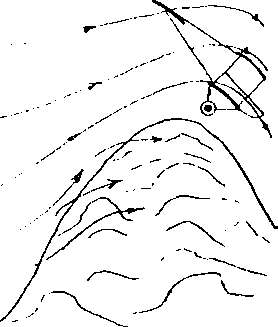 Hirth: Die Kreiselwirkung eines rotierenden Flugzeugmotors macht sich nur in der Rechtskurve unangenehm bemerkbar, wenn der Motor so angeordnet ist, daß er sich, vom Führersitz aus gesehen, nach rechts dreht. Ich flog eine Rumpler-Taube mit 70 PS Molor, gewarnt durch Gerüchte die aus Frankreich kamen, versuchte ich vorsichtig in großer Höhe Erstlingskurven, die ohne irgend welche Störung bis 55 Grad Schräglage ausgeführt wurden Weniger gern legte sich das Flugzeug nach rechts, und da kam es vor, daß einmal früher, einmal später ein plötzliches Kippen nach rechts eintrat, das mich unangenehm überraschte. Zu der Ausführung der Berechnung des Hängewerks eines Flugzeugs führe ich folgendes Be spiel an : Als junger Flieger unternahm ich aus Sensationslust einen sehr steilen Gleitflug, der so steil war, daß ich mich mit der linken Hand nach vorn abstutzen mußte, um nicht von meinem Sitz zu rutschen. In 80 Meter Höhe wollte ich den Gleitflug flacher gestalten, doch nur mit der ganzen Aufbietung der mir zur Verfügung stehenden Körperkraft gelang es mir, das Höhensteuer an mich zu ziehen. Die Bewegung des Höhensteuers war ein kurzer starker Ruck, so daß ich fürchtete es sei ein Draht gerissen. Auf diesen Ruck richtete sich das Flugzeug zur Horizontallage auf, setzte aber seinen Fall fort, bis auf ca. 20 Meter vom Boden, um mit einem glatten flachen Gleitfluge zu landen. Ich möchte hier anführen, daß ein Flugzeug durch die Massenbeschleunigung die einmal angenommene Richtung beibehält, bis seine erhöhte Geschwindigkeit abgebremst ist. Aus guter französischer Quelle habe ich erfahren, daß Versuche, bei denen Dynamometer zwischen die Aufhängegabeln eines Eindeckers gehängt wurden, bei sehr starken Böen die neunfache Ueberlastung ergeben hüben. Eine zehnfache Sicherheit der Flügel, sowie deren Aufhängung bei Eindeckern erscheint mir deshalb nicht genügend Zu den Diskussionen über Rechts- und Linkskurven möchte ich ausfuhren, daß es für den Flieger ganz gleichgültig ist, wenn er mit einem stehenden Motor Rechts- oder Linkskurven fliegt. Es wird bei den Flugzeugen auf den Flugplätzen fast ausschließlich links herumgeflogen und mag manchem die Rechtskurve ungewohnter und deshalb schwieriger erscheinen. Betreffs Kompressions-Kabel oder Doppeldrähte stimme ich für Kabel, da dieselben selten plötzlich reißen, sondern im Verbrauch sich fast immer durch Struppligwerden, d. h. Loslösen verschiedener Drähtchen bemerkbar machen. Ein Draht kann einen Walz- oder Ziehfehler haben, der von außen nicht bemerkt wird. Ich ziehe ein entsprechend starkes Kabel 2 Drähten vor. Ueber gdie Streitfrage der Oesen stimme ich, wenn Drähte verwendet werden, für einen etwas stärkeren Draht und Oesen, der Einfachheit bei der Montage halber, sowie des geringen Gewichtes wegen." Auf Veranlassung des Prinzen Heinrich sandte man ein Telegramm an den Kaiser, dem die Versammlung den Dank für seine Förderung der Luftschiffahrt ausdrückte. Dann brachten Automobile die Teilnehmer nach den Eulerwerken bei Niederrad. Dort unternahm Lt. v Hiddessen trotz heftigen Windes zwei längere Flüge, auf denen er von Lt. Koch und Referendar v. Rottenburg begleitet wurde. Auch Placzikowsky führte einen Flug aus. August Euler zeigte seine neuesten Erzeugnisse, darunter einen Luftschiffzerstörer, ferner eine Flugmaschine, die nur 239 Kilo wiegt. Am abend wurden die Teilnehmer von der Stadt Frankfurt zu einem Bankett nach dem Römer eingeladen, welches glänzend verlief. Bestimmungen über Flugplätze und Flugfelder. 1. Alle Filmveranstaltungen dürfen nur auf solchen Plälzen oder Geländen stattfinden, die vom Deutschen Luftfahrer-Verbande begutachtet und als technisch geeignet befunden worden sind. 2. Ueber die technische Eignung befindet die Flugzeugabteilung des D. L. V. Die Eignung kann dauernd gültig oder von Fall zu Fall für die einzelnen Veranstaltungen ausgesprochen werden. 3. Demnach werden der Beschaffenheit nach unterschieden: a) Anlagen für dauernden Flugbetrieb: Flugplätze und Flugfelder b) Gelände für gelegentlichen Flugbetrieb: Fluggelände. 4. Flugplätze sind Anlagen mit fester ringsumlaufender Umzäunung oder ausreichender natürlicher Begrenzung, innerhalb welcher der eigentliche Flugkern durch eine Schranke von den Zuschauerplätzen getrennt ist. Der Flugkern muß eine Ausdehnung von durchschnittlich mindestens 300X700 Metern haben, seine Bodenfläche hindernisfrei und eben sein. Dauernde Unterkunftsräume für mindestens 3 Flugzeuge mit Werkstätten müssen vorhanden sein. 5. Flugfelder sind solche Plätze, die nicht oder nur teilweise fest abgegrenzt sind, eine bei Veranstaltungen gegen das Publikum absperrbare ebene Anlauf- und Landungsbahn von mindestens 30X200 Metern und im übrigen angrenzend freies, landungsfähiges Gelände von durchschnittlich mindestens 300 X 700 Metern Ausdehnung haben. Dauernde Einrichtungen zur Unterbringung von Flugzeugen müssen wie bei Flugplätzen vorhanden sein. 6. Fluggelände. Für ihre techn:sche Eignung ist die Art der jeweiligen Veranstaltung maßgebend. 7. Der Antrag auf Begutachtung eines Flugplatzes oder Feldes ist durch den in dem betreffenden Gebiet zuständigen Heimatsverein bezw. Gebietsausschuß einzureichen. Der Antrag auf Begutachtung eines Geländes für eine einzelne Verbandsveranstaltung (siehe Ziffer 12 der Fiugbestitnmungen) ist von dem oder den veranstaltenden oder verantwortlichen Luftfahrtvereinen dem Verbände einzureichen. Die Begutachtung eines Geländes für eine einze'ne Vereinsveranstaltting (siehe Ziffer 11 der Flugbestimmungen) erfolgt dtirch den oder die veranstaltenden oder verantwortlichen Luftfahrtvereine, doch steht der Flugzeugabteilung ein Einspruchsrecht zu. Dem Antrag sind Karte, Lageplan und ausführliche Beschreibung beizufügen. 8. Flugplätze und Felder, die vom Verband als geeignet befunden sind, erlangen damit die Eigenschaft als Verbandsflugplatz oder Feld, d. h. sie sind für alle Veranstaltungen freigegeben. 9. Die Anerkennung als Verbandsflugplatz oder Feld kann wieder entzogen werden, wenn die Voraussetzung, unter welcher die Anerkennung stattgefunden hat, nicht mehr vorhanden ist, oder bei Nichterfüllung der Verbandsvorschriften. 10. Auf allen Verbands-Flugplätzen und Feldern darf solchen Flugzeugführern, denen das Flugführerzeugnis entzogen ist, die Ausübung des Fliegens nicht gestattet werden. 11. Flugplätzen kann außer der Anerkennung als Verbandsflugplatz zur Sicherung ihrer Aufwendungen, welche die Erfüllung der an sie gestellten besonderen Anforderungen notwendig machen, noch ein Schutzrecht vom Verband verliehen werden, derart, daß innerhalb eines bestimmten, ihnen zugesprochenen Interessengebietes alle Veranstaltungen mit Uber 4 Fliegern nur auf diesen Plätzen stattfinden dürfen. 12. Die besonderen Anforderungen sind: ein Flugkern von mindestens 600X1000 Meter Ausdehnung mit hindernisfreier und ebener Bodenfläche. Vorhandensein eines die Flugkernschranke umfassenden Schutzstreifens von 10 Meter Breite, der durch eine zweite Schranke gegen die Zuschauerplätze abgesperrt ist, Flugzeugschuppen für mindestens 12 Flugzeuge mit Werkstätten, Sanitätsräume, sowie bestimmte Plätze für Zuschauer. Diese Flugplätze müssen grundsätzlich Flugzwecken dienen. Ausnahmen sind dem D. L. V. mitzuteilen, dem ein Einspruchsrecht zusteht, falls die Interessen der Luftfahrt durch solche Ausnahmen bcinträchtigt werden. Die dauernde Bc- nutzung dieser Flugplätze darf nicht einem oder einzelnen Unternehmen vorbehalten bleiben. 13 Die Verleihung des Schutzrechtes und die Festsetzung des zugehörigen Interessengebietes (nicht gleichbedeutend mit Heimatsgebiet, § 5 des Gg.) erfolgt auf Antrag der Flugzeugabteilung durch den Verbandsvorstand nach Anhörung des zuständigen Heimatsvereins bezw. Gebietsausschusses. 14. Das Schutzrecht kann auch für projektierte Flugplätze zugesprochen werden, sofern die für die Erfüllung der in Ziffer 12 genannten Bedingungen festgesetzte Frist innegehalten wird. 15. Geschützte Flugplätze müssen, falls nicht zwingende Gegengründc vorliegen, für alle Verbandsveranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet die Flugzeugabteilung endgültig. 16. Geschütz en Flugplätzen kann das Schutzrecht vom Verbandsvorstand entzogen werden, wenn die Voraussetzungen, unter denen dasselbe verliehen wurde, nicht mehr vorhanden sind, und innerhalb einer vom Verbandsvorstande festgesetzten Frist keine Abhilfe getroffen ist, oder wenn sich die Flugplatzleitung einen groben Verstoß gegen die Verbandsvorschriften zu Schulden kommen läßt. 17. Gegen die Entscheidung des Verbandsvorstandes über Verleihung, Ablehnung und Entziehung des Schutzrechtes steht allen Beteiligten Berufung an den Vorstandsrat zu. Dieser entscheidet endgültig. Flugtechnische 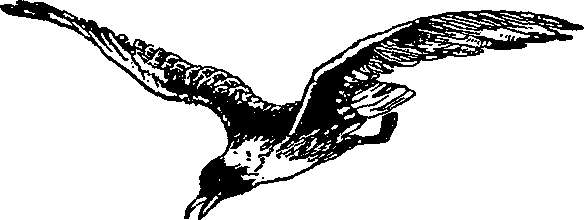 Rundschau. Inland. Mugführer-Zeugnisse haben erhalten. No. 344. Charlett, Willi, Cottbus, geb. am 2. Juni 1892 zu Cottbus, für Eindecker (Schulze), Flugfeld Madel bei Burg, am 30. Dezember 1912. No. 345. Scherff, Mauricio, Johannisthal, geb. am 7. März 1890 zu Buenos Aires, für Eindecker (Harlan), Flugplatz Johannisthal, am 31. Dez. 1912. Von den Flugplätzen. Flugplatz Münc/ien-OberwiesenfeM. Am 7. Januar erfüllte wieder ein Schüler der Fliegerschule Otto, Georg Schöner, die Bedingungen zur Erlangung des internationalen Flugzeugführerzeugnisses. Schöner flog die vorgeschriebenen 10 Achten auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor in der kurzen Zeit von 16'/2 bezw. 15 Minuten in einer durchschnittlichen Höhe von 120 m und landete dann mit 5 bezw. 12 m Abstand vom Ziele entfernt. Die höchste, während der Prüfung erreichte Höhe betrug laut Höhenmesser 180 m Schöner hat somit seine Pilotenprüfung in tadelloser Weise erfüllt. Als Sportzeugen waren Major Stahl und Oberleutnant Petri von der Sportkommission des bnyr. Aeroklub erschienen. Am Dienstag, den 7. Januar 1913, dem Geburtstag Sr. Kgl. Hoheit des Prinz-Regenten, führten die Flieger der Flugwcrkc Deutschland Ci in. b. H., München-Milbertshofen, Ingenieur Dick und Hans S c h i rr m e i st er einen Flug über München aus. Die beiden Flieger stiegen auf Zweideckern der Flugwerke Deutschland auf dem Flugplatz Milbertshofen auf, flogen über die Stadt und beschrieben während der Kirchenparade in 800 bis 1200 Meter Höhe Kreise über die Residenz. Beide Flieger setzten sodann gleichzeitig zu Gleitflügen an und landeten wieder glatt vor dem Fliegerschuppen der Flugwerke Deutschland. Auf dem Flugplatz Cfelsenkirchen-JSssen-Botthausen herrscht, seitdem die „Kondor"-Flugzeug-Werke mit ihren Maschinen herausgekommen sind, reges Fliegerleben. Neuerdings hat Suwelack seinen zweiten „Kondor"-Apparat versucht. Die Maschine flog sofort, ohne daß ein Draht nachgespannt oder irgend eine andere Umänderung getroffen werden mußte. Am 3. Januar führte Suwelack mehrere Höhenflüge aus, u. a. flog er über das Häuser-.;-** \ meer von Gelsenkirchen und Essen in einer Höhe ϖ\ von 1300 m. Der Ueberlandflug führte weiter i", über Werden nach Steele, von Steele nach Schalke ■\ und Horst und von da zurück zum Flugplatz. Der Apparat bewies sich — es herrschte ein * Wind von 10-12 m — äußerst stabil. Er t/Z. gehorchte den Steuerbewegungen sehr gut und lag ruhig und träge in der Luft. Die Verwindung wurde bei dem Apparat überhaupt nicht benutzt. Suwelack flog jeden Tag 1V, Stunde und fand, daß auch in den stärksten Kurven die Maschine sich äußerst stabil zeigte. Am 7. d. Mts. führte er zwei weitere Flüge von 40 Minuten Dauer in 12-1400 m Höhe über Essen aus. Hiernach flog er noch dreimal über Gelsenkirchen. Nachdem die Steigfähigkeit der Maschine genügend erprobt war, wurden mehrere Passagierflüge \ ausgeführt. Es zeigte sich, daß die Maschine mit Passagiermit 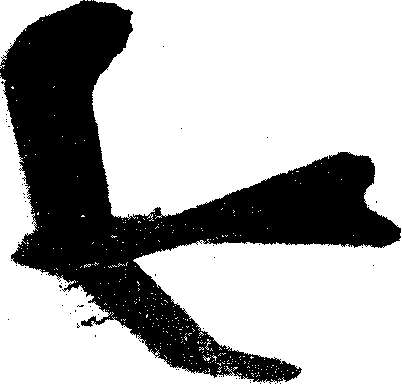 Höhenflug Suwelack auf Kondor. kam und dieselbe Steigfähigkeit wie ohne Passagier bewies, ging bis zu 600 m Höhe und dauerte 22 Minuten. dem gleichen Anlauf vom Boden weg-Der erste Flug Gleich darauf bestieg Oberlt. zur See Bertram die Maschine und führte sofort einen^wunderbaren Flug in 300 —400 m Höhe über Rotthausen und Schalke aus und landete in elegantem Kurvengleitflug auf dem Flugplatz. Er war mit der Maschine aufs höchste zufrieden und bezeichnete sie als sehr stabil. Oberlt. Bertram führt in nächster Zeit noch mehrere Flüge auf dem „Kondor" aus. Die Maschine hat nach einem Gleitflug mit abgestelltem Motor einen Auslauf von nur 50 m. Am 13. Januar nahm Suwelack den Flieger Lichte als Gast mit. Suwelack stellte in ca. 300 m Höhe den Motor ab und ging im Gleitflug zu Boden. 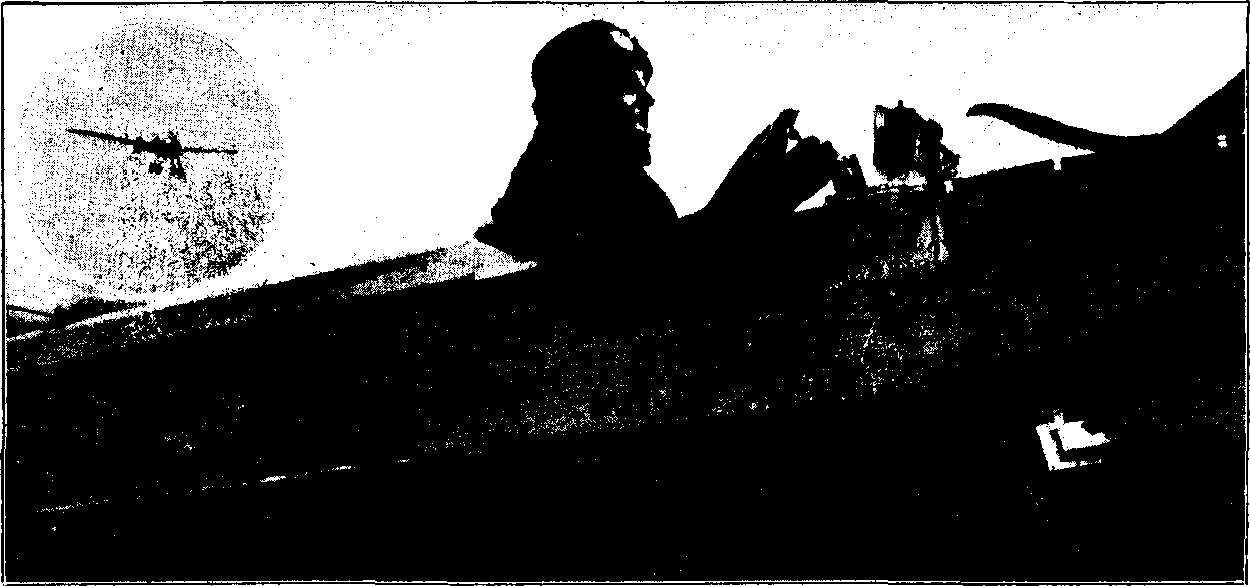 Siwelack auj seinem Kondor, Oben links: der Eindecker während des Gleitflages. Während dieses Gleitfluges ließ er die Hände vom Steuer, um den Fluggast von der automatischen Stabilität des Apparates zu überzeugen. Den Flugvorführungen wohnte Se. Exzellenz Generalleutnant von der Goltz bei. Hiernach fand eine Besichtigung der Fabrik der „Kondor" Flugzeug-Werke statt. Die „Kondor" Flugzeug-Werke machen sehr große Anstrengungen, um sich für die diesjährige Flugsaison vorzubereiten. Es ist auch eine Wasserflugmaschine im Bau, die demnächst versucht werden soll. Vom Flugplatz „Aviatik" Habsheim (Elsass). Im Dezember vorigen Jahres wurden an 25 Tagen Flüge von 11 Fliegern ausgeführt. Außerdem machten zwei Schüler Flugversuche. Es flogen die Flieger S chmid, Fall er, Ing. Schlegel, Ingold.die Leutnants v. Mirbach, v. Osterroth, Linke, Jerrmann, Geyer, Oberlt. Donnevert und Unteroff. Cipa. Die Feldpilotenprüfung legten Lt. Linke und Unteroff. C i p a ab. Ueberlandflüge wurden ausgeführt: Lt. Linke Freiburg-Habsheim, Lt. G e y e r Straßburg-Habsheim-Straßburg, Unteroff. Cipa Habsheim-Besancon auf Aviatikdoppeldecker, Oberlt. Donnevert mit Rumplertaube Straßburg-Habsheim-Straßburg, Schlegel und Ingold auf Aviatikeindecker Habsheim-Mülhausen und zurück. Im Jahre 1912 erhielten auf Aviatik-Ein- und Doppeldecker 18 Flieger das Fiihrerpatent. Vom Goedecker-Flugplatz. in den letzten Tagen machte der Lehrflieger der Goedecker-Werke de Waal mit einem neu hergestellten Goedecker-Flugzeug verschiedene Aufstiege. Es gelang ihm trotz 30-40 cm hohem Schnee mit Fluggast und HO I Benzin bei einem Anlauf von 100 m glatt vom Boden abzukommen. Wegen des nebligen und böigen Wetters flog de Waal nur in geringer Höhe. Die Flugzeit betrug jeweils ca. 15 Min. Als Fluggast flogen mit die neuen Goedecker-Schüler stud. ing. Carl Schümm aus Aachen und Burggraf aus Freiburg i. B. Flugleistungen auf dem Flugplatz Johannisthal im Jahre 1912. Es wurde geflogen an 317 Tagen. Gesam'zahl der Flüge 17651. Gesamtdauer der Flüge 1996 Stunden 2 Min. Die Bedingungen für das Fiihrer-zeugnis erfüllten 98 Flieger. Neue Wright - Militärmaschine. Die Flugmaschine-Wright-G. m. b. H. Berlin hat auf Veranlassung der Militärverwaltung einen neuen Doppeldecker herausgebracht, der, mit einem 100 PS Argus-Motor ausgerüstet, Plätze für 5 Personen aufweist. Die Sitze sind mit einer wenig Luftwiderstand bietenden Karrosserie umgeben, die, obgleich sie die Insassen vollkommen vor den Unbilden der Witterung schützt, doch ein gutes Uebersehen des Landungsterrains und 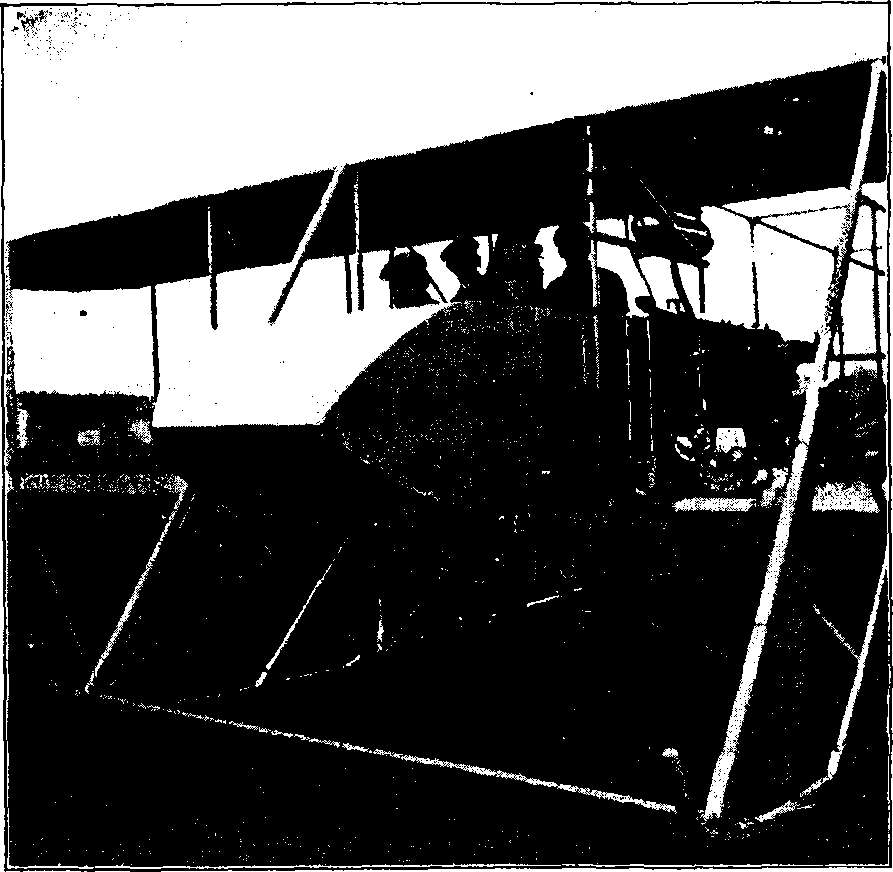 Neue Wright-Militär-Maschine. beste Orientierung in der Luft ermöglicht. Sie ist an den Seiten mit kleinen Türen versehen, worein man mittels kleiner Trittleitern gelangt (auf der Abbildung noch nicht angebracht). Neben der Karrosserie ist der 100 PS Motor montiert, dessen Kühlung durch den schräg angebrachten Windhoff-Kühler ermöglicht wird. Vor den beiden ersten Plätzen befinden sich die Steuerorgane; bei dem einen die auch früher gebräuchlichen Hebel, vor dem andern ein Rad. Als Antriebsmittel für die beiden Eta-Propeller dient, ebenso wie bei der Maschine, mit welcher Abramowitsch den Fernflug Berlin-Petersburg zu Stande brachte, eine einzige durchlaufende Kette. Stiele und Brücke sind bei dieser Maschine nus Stahl. Der Apparat wird von Hartmann (auf der Abb. vom links) eingeflogcn. Eindecker von Focke und Kolthoff, Bremen. Der beistehend abgebildete Eindecker ist von den Bremern Focke und Kolthoff mit eigenen Mitteln gebaut worden. Ersterer ist ein Bruder des Kunstmalers Wilhelm Focke, der im Herbst 1909 zusammen mit Dr. Alberti in den Werkstätten von E. Rumpier einen Eindecker nach seinen Angaben bauen ließ, welcher die Form des jetzt so erfolgreichen „Canards" von Voisin besaß und als erster Apparat dieses Systems in Deutschland auf dem Bornstedter Felde bei Potsdam geflogen ist. (Vgl. „Flugsport", No. 24, Jahrgang 1909). Die Spannweite des Apparates beträgt 13 m, die Länge über alles 7 m. Die Beseglung mißt ca. 29 qm. Die Haupttragflächen schließen sich der Gestalt nach der bekannten Taubenform an. Der dreieckige Rumpf ist ganz mit Stoff bekleidet und hat geringeren Luftwiderstand. Die Steuerflächen im Schwanz 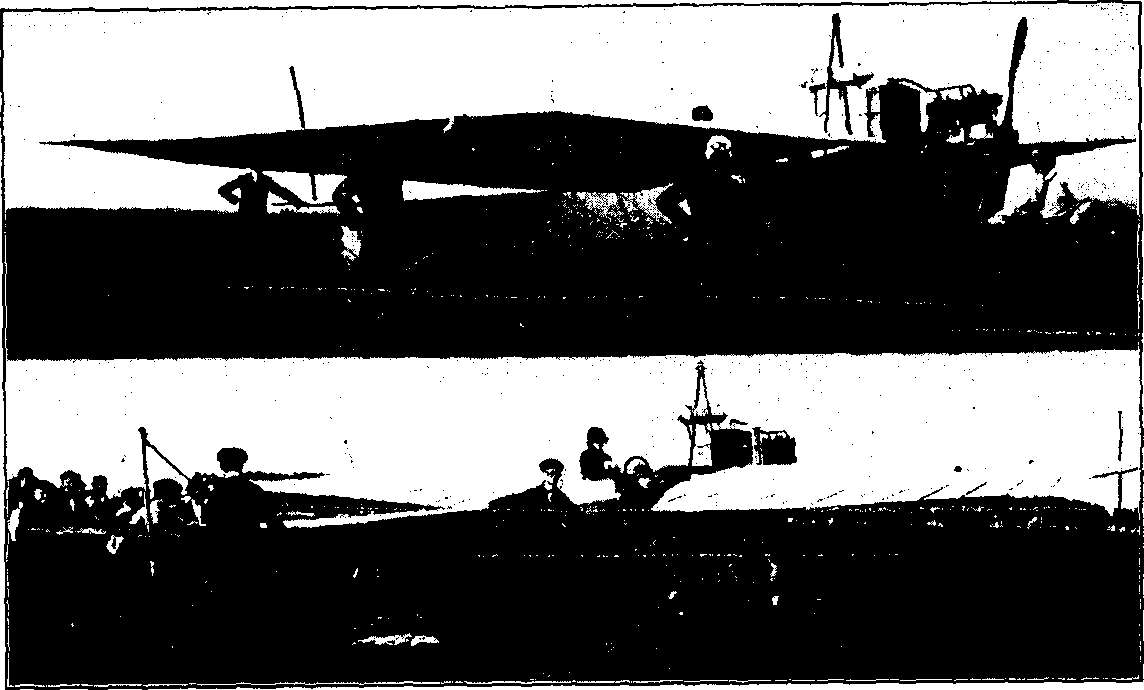 Kplthoff-Focke-Eindecker, Bremen. sind nicht mit Scharnieren versehen, sondern biegsam und werden ebenso wie die Verwindung "durch Handrad und Pedal betätigt. An den Kufen des einfachen und kräftigen Fahrgestells sind je zwei abgefederte Räder angebracht. Zum Betriebe dient ein 50 PS Argus-Motor. Das Totalgewicht des Apparates einschließlich Führer, 30 1 Benzin, Oel und Kühlwasser beläuft sich auf ca. 480 kg. Bei den Versuchen auf einem (Jebungsfelde bei Bremen gelang es Focke sowie Kolthoff, den Platz in ca. 10 m Höhe mehrmals zu umkreisen und stets glatte Landungen herbeizuführen. Die Militärflugzeugübung bei Magdeburg hat begonnen. Am 16. Januar nachmittags landeten in Geüthin. aus Berlin kommend 2 Rumpler-Tauben und ein Doppeldecker mit je zwei Offizieren glatt in der Nähe der Wandererarbeitsstätte. Am 17. Januar landeten in Burg die Flugzeuge B, 77, B 78 und B 17, B 17 landete an der Grabauer Chaussee in der Nähe von Schrebergarten und wurde beschädigt Am 20. Januar herschte auf dem Krakauer Anger bei Magdeburg lebhaftes Treiben. Mannschaftsautomobile, Benzin- und Reparaturautos, Offizierswagen trafen zum „Krieg im Freden" ein. Ein transportables Riesenzelt wurde errichtet. Dann landeten in kurzen Abständen: Rumpier-Taube No. A. 36. Beim Landen zerbrach Propeller und Fahrgestell. Bristol No. A. 27 kam auch nicht ganz ohne „Kleinholz" auf dem Boden an, ebenso erging es der folgenden Rumpler-Taube No. A. II. Alsdann landeten : 48 „Taube" A. 35 glatt; 12:06 „Taube" A. 39, welcher kurz darauf „Taube" A, 28 Leipzig I in tadellosem Gleitfluge 12:08 folgte. Jeder der 6 Maschinen entstiegen wohlbehalten 2 Offiziere. — — — Deutsche Plugmaschinen für die österreichische Militärverwaltung. Vor kurzem ist in Fischamend ein Mars-Eindecker der Deutschen Flugzeug-Werke in Leipzig-Lindenthal durch Oberlt. Bier vorgeführt worden. Ebenso machten Oberstlt. (Jzelak und andere österreichische Offiziere mit der Maschine Probeflüge. Der Eindecker bewies ein Steigvermögen von 100 m in 50 Sekunden. Die Maschine ist von der österreichischen Heeresverwaltung angekauft worden. 37 Wrightmaschinen hat die russische Regierung bei der Flugmaschine Wright G m. b. H. in Auftrag gegeben. Die Wright-Gesellschaft erhielt den Auftrag infolge der guten Leistungen ihres Apparates anläßlich der Flüge von A b r a m o w i t s c h in St. Petersburg Ausland. Militärflugwesen im Ausland. Französische Fliegerstation Mezieres (Ardennen). Stationiert wird eine Escadrille. Die Kosten, 1,8 Millonen Francs, werden von der französischen Nationalflugspende bestritten; General Hirschauer richtet zur Zeit die Station ein. Militärflugzentrum Verdun. Die französische Fliegerstation Verdun wird erheblich verstärkt. Die bisherigen Hilfsmannschaften, 50 Sappeure, werden verdoppelt. Ferner wird die Station eine Verstärkung zunächst von 8 Henry Farman-Apparaten erhalten. Die Fliegeroffiziere der Station sollen insbesondere im Bombenwerfen ausgebildet werden. Zu diesem Zweck sind besondere Ziele in 100 bis 300 m Größe aufgestellt. Französische Flugstation von La Brayelle. Diese neuerdings ausgebaute Station bei Douay wurde vor kurzem von Hirschauer inspiziert. Nach neueren Nachrichten soll die Station noch weitere Verstärkungen erfahren. Zwei Wasserflugmaschinen Nieuport für die französische Marine. Bei Nieuport sind von der französischen Marine 2 Wasserflugmaschinen gekauft worden, deren Abnahmeflüge Charles Nieuport selbst vor dem Fregattenkapitain Fatou, dem Obersten Kommandanten der Marineaviation, ausführte. Diese waren sehr schwer und bestanden in einer Reihe von Abflügen vom Land und vom Wasser, Höhenflügen, Schnelligkeits- und Dauerflügen von ungefähr vier Stunden. Der Erfolg war befriedigend. Die Wasserflugmaschine Nieuport soll ganz den Bedürfnissen der Marine entsprochen haben. Alle Abnahmeflüge wurden mit 110 km Geschwindigkeit in der Stunde geflogen, und verschiedene bei heftigem Wind und hohem Seegang-Aus der französischen Marinestation Toulon. Seit dem 10. Januar befindet sich der Kreuzer La Foudre im Hafen von Vignettes, wo interessante Versuche von Flugmaschinen und Unterseeboten gemacht werden sollen. Dekoration französischer Flieger. Anläßlich der Truppeninspektion am 1. Januar auf dein Platze des Hotel des Invalides wurden folgende Ordensdekorationen infolge verdienstvoller Leistungen ai f dem Gebiete der Aviatik verliehen: Maurice Tabuteau, Ritterkreuz der Ehrenlegion; Seguin, der Kon- strukteur der Gnom-Motore, die Militärmedaille. Ferner erhielt die französische Militärmedaille: der verunglückte Quartiermeister Emmery, die ihm auf dem Krankenbett von General Hirschauer überreicht wurde. Oesterreichische Marine-Station Seehafen von Pola. Vier Donnet-Leveque Wasserflugmaschinen wurden in Betrieb genommen. Die Apparate wurden von Marineoffizieren gesteuert und zwar von den Lts. Klobucar, Wosecek, Penfield und Ingfried. Die Maschinen sind mit 80 PS Gnom-Motoren ausgerüstet und flogen mit Passagieren über das Adriatische Meer nach dem Hafen von Fiume, 130 km Entfernung. Das Militärflugwesen in Schweden wird zur Zeit immer mehr ausgebaut. Vorhanden sind 2 Offizierschulen, die Offizierschule Cederström in Malmslatt bei Stockholm und die reine Militärschule in Axwall, welche vom Kapitän Hamilton geleitet wird. Daselbst sind bereits 7 Offiziere ausgebildet und zwar: Olof Dahlbeck, Hugo Sundstedt, Werner, Bjornborg, Silow und Junger. Flugpreise. Einen russischen Jubiläumspreis stiftete der bekannte Millionär Abamelek-Lasareff zur Erinnerung an das 300 jährige Bestehen des russischen Herrscherhauses Romanoff. Der Preis beträgt 100000 Rubel gleich 216000 Mark und ist für den russischen Flieger bestimmt, der die Strecke Petersburg—Moskau-Petersburg, eine Strecke von 1300 km in einem Tage als erster mit einer Flug-maschine, die, wie der Motor, ausländisches Fabrikat sein darf, zurücklegt. Während die Regierungsfeierlkhkeiten bereits im März stattfinden, soll der Flug im Monat Juli ausgeführt werden. Die Organisation liegt in Händen des Aero-Club von Rußland. Eine derartige Ausschreibung mit 216000 Mark als Preis für den Ersten ist wirklich geeignet ein Rennen in's Leben zu rufen, das in sportlicher Hinsicht, was die Zurücklegung der Strecke in der Zeit von einem Tag anbelangt, einzig und allein dasteht. Es entsteht die Frage, wer kommt für die Veranstaltung als Teilnehmer in Betracht und welche Maschinen sindimstande, erfolgreich teilzunehmen ? Zu den besten russischen Fliegern gehören in der Mehrzahl Offiziere, die nun wieder meistens französische Maschinen, speziell Nieuport-Eindecker steuern. Da das Rennen nun lediglich eine Geschwindigkeitssache ist, können nur solche Apparate an den Start gehen, die in puncto Tempo an erster Stelle stehen. Daß eine schnelle Maschine bei schlechten Witterungsverhältnissen größere Chancen hat ist auch selbstverständlich, es sei denn, daß ähnliche Umstände eintreten, wie im französischen Rundflug von Angers. Qui vivra, verra! . . er. Patentwesen. Patentanmeldungen. 77h. W. 30 880. Steuerung für Flugzeuge mit verwindbaren Tragflächen. Orville Wright, Dayton, Ohio, V. St. A. ; Vertr.: H. Springmann, Th. Stört und E. Herse, Pat-Anwälte, Berlin SW. 61. 12. 11. 08 Priorität aus der Anmeldung in Frankreich vom 18, 11. 07. anerkannt. 77h. F. 33055. Vorrichtung zur Erleichterung des Niedergehens von Flugzeugen auf Schiffe. Francesco Filiasi, Neapel; Vertr.: Dipl.-Ing. K. Wentzel, Pat.-Anw., Frankfurt a. M. 1. 15. 9. 11. 77h. L. 32 806. Aufblasbarer Schwimmkörper für Flugzeuge. Wilhelm Leißner, Mülhausen-Burzweiler. 24. 7. 11. 77h W. 36101. Flugzeuge mit verwindbaren, durch senkrechte Stützen gelenkig verbundenen Tragflächenrahmen. Orville Wright, Dayton (V. St. A.); Vertr.: H. Springmann, Th.Stoit, E. Herse, Pat.-Anwälte, Berlin SW.61. 12.11.08 Priorität aus der Anmeldung in Frankreich vom 18. 11. 07. anerkannt. 77h. Sch. 36 680. Selbsttätiger Schalter für Stabilisierungsvorrichtungen von Flugzeugen u. dgl Otto Schmidt, Nordhausen, Bahnhofstr. 27. 6. 11. 77h. M. 45 180. Zielvorrichtung für das Werfen von Geschossen aus Luft-Luftschiffen. Robert Mischke, Kiel. 18. 7. 11. 77h. H. 53 650. Neigungsmesser für Luftfahrzeuge. Alexander Hübbe, Hamburg, Gluckstr. 33. 17. 3. 11. Patenterteilungen. 77h. 255845. Lösbare Befestigung für Schraubenflügel auf ihrer Nabe. Lucien Chauviere, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen, A. Büttner und E. Meißner, Pat.-Anwälte, Berlin bW. 61. 4. 2. 12. C. 21 563. 77h. 252936. Bremsvorrichtung für Flugzeuge mit durch den Fahrtwind aufklappbaren Luftfangflächen. Iwan Imbert, Ramonchamp, Vosges, Frankreich; Vertr.: A. Elliot, Pat.-Anw., Berlin SW. 48. 22. 12. 10. I. 13 234. 77h. 256017. Luftschraube mit verstellbaren Flügeln; Zus. z. Pat. 255471. Gustav Mees, Charlottenburg, Schlüterstr. 81. 16. 12. 11. M. 46 504. Gebrauchsmuster. 77h. 534865. Flugmaschine. Jesse James Dillon, Council Bluffs, V.St.A. Vertr.: F. A. Hoppen, Pat.-Anw., Berlin SW. 68. 14. 3. 12. D. 22166. 77h. 534875. Propellerschutzhülle. Garuda Flugzeug- und Propellerbau G. m. b. H., Neukölln. 23. 8. 12. G. 31 244. 77h. 534878. Sicherheitsschutzreifen für Flugmaschinen August Euler, Frankfurt a. M., Forsthausstr. 105a. 1. 10. 12. E. 17 960. 77h. 535029. Fahrgestell für Flugzeuge. Joseph Berthaud, Villeurbanne. Rhone, Frankr.; Vertr ; A. Elliot, Pat.-Anw., Berlin SW. 48. 30. 1. 12. B. 56621. 77h. 535 052. Seitensteuerung für Flugzeuge. Hans Hermann u. K. Eik-mann, Limritz, N. M. 23. 11. 12. H. 58 537. 77h. 535074. Flanschenrohr, insbesondere für Flugzeuge. E. Rumpier, Luftfahrzeugbau G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg. 5. 12. 12. R. 34527. 77h. 535 238. Verwindungsklappe. Deutsche Flugzeug-Werke G. m. b. H., Lindenthal bei Leipzig. 4. 12. 12. D. 23957. 77h. 535246. Zentrales Anschlußstück für Drahtkabel bei Flugzeugen. E. Rumpier Luftfahrzeugbau G.m.b.H., Berlin-Lichtenberg 5. 12. 12. R. 34 528. 77h. 535746. Endstück für Verspannungsdrähte bei Luftfahrzeugen. Deutsche Bristol-Werke Flugzeug-Gesellschaft m. b. H., Halberstadt. 22. 6. 12. D. 22762. 77h. 535 763. Selbsttätig stabiles Flugzeug. Paul M. Pellichoff. Berlin-Borsigwalde. 2. 12. 12. P. 22602. 77h. 536 212. Abschlußmaschine für Sprengbomben aus Flugfahrzeugen unter Parallelisierung des Auftriebes. Hugold Freiherr von Schleinitz, Neustrelitz. 14. 12. 12. Sch. 46392. 77h. 536 244. Antriebsmechanismus für Flugzeuge mit Vor- und Auftriebsschraube. Eduard Wuttig, Liegnitz, Jauerstr. 88. 21. 9. 12. W. 37892. 77h. 536295 Doppel-Seitensteuerung für Flugzeuge. E. Rumpier, Luftfahrzeugbau G. m. b. H., Berlin=Lichtenberg. 14. 12 12. R. 34628. 77h. 536682. Flugzeug-Untergestell, welches das Aufsteigen und Niedergehen des Fluges sowohl auf festem Lande als auch auf einer Wasserfläche ermöglicht. Ago Fluggesellschaft in. b. H., Johannisthal bei Berlin. 27. 8. 12. A. 19088. 77h. 536702. Bremsflügel für Flugzeuge. Hans Herrmann u. K. Eikmann, Limmritz, N.-M. 9. 12. 12. H. 58 698. 77h. 536892. Doppel-Seitensteuerung für Flugzeuge. F.. Rumpier, Luftfahrzeugbau G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg. 14. 12. 12, R. 34 629. 77h. 537194. Meßvorrichtung für den Abdrängungseinfluß des Windes auf die Fahrtrichtung von Luftfahrzeugen. Pfadfinder für Aviatik G. m. b. H., Bremen. 19. 12. 12. P. 22719. Steuerhebelanordnung an Flugzeugen zur Ausbildung von Fingschülern.*) Um Flugschülern den Gebrauch der Hebel und Steuerräder, mit welchen man auf die Höhen- und Seitensteuer sowie auf die Stabilisierungsorgane eines Flugzeuges einwirkt, zu lehren, ist es unbedingt notwendig, ihnen Hebel oder ähnliche Steuerräder, wie sie der Fluglehrer besitzt, in die Hand zu geben, so daß sie allen seinen Bewegungen folgen können. Man hat schon versucht, auf derselben Achse zwei Hebel, einen für den Lehrer und einen für den Schüler fest aufzukeilen. Es ist aber auch erforderlich, daß falsche Bewegungen, welche die Schüler ausführen, nicht in schädlicher Weise auf die Handgriffe des Fluglehrers einwirken, damit das Gleichgewicht des Apparates nicht gesiört wird und Unglücksfälle vermieden werden. Diese Uebelstände zeigten sich insbesondere bei 3er oben erwähnten Einrichtung, bei welcher die beiden Hebel fest auf dieselbe Achse gekeilt sind. Zu diesem Zweck ist gemäß vorliegender Erfindung eine Einrichtung getroffen, nach welcher die Hebel und Steuerräder der Flugschüler Bewegungen in demselben Sinne und mit demselben Ausschlag wie diejenigen des Lehrers ausführen können, daß sie aber, wenn ihrer Verstellung Widerstand entgegengesetzt wird, infolge einer Auslösungsvorrichtung nachgeben. Die Zeichnung stellt in Abb. 1 eine erste Ausführungsform der Einrichtung, in Abb. 2 eine zweite Ausführungsform dar. Die Abb. 3, 4, 5 und 6 zeigen in größerem Maßstabe die Auslösungsvorrichtungen. Bei den beiden in Abb. 1 und 2 dargestellten Anordnungen ist auf einer Achse a der Hebel A aufgekeilt, so daß er erstere in den beiden Richtungen des eingezeichneten Pfeiles drehen kann zur Beeinflussung der Seitensteuerung. Auf der Achse ist ein Hebel A1 lose gelagert, welcher durch eine federnde Kupplung B, die die Auslösungsvorrichtung bildet, mitgenommen wird Die Kupp'ung besteht, wie man aus Abb. 4 ersieht, aus einer Platte b, die auf der Achse a verschiebbar, aber nicht verdrehbar gelagert ist und zwei oder mehrere Aussparungen c besitzt, in welche entsprechende Vorsprünge f einer auf der Hülse h des Hebels A1 befestigten Platte g eingreifen. Damit der Hebel A1 durch die Scheibe b mitgenommen wird, ist letztere auf einem Vierkant der Achse a oder mittels eines Keiles befestigt, so daß sie in dem Drehungssinn der Achse mitschwingt. Die Platte b steht unter dem Druck einer Schraubenfeder i, deren Spannung geregelt werden kann, und welche gegen eine Scheibe j drückt, die mittels Muttern k verstellt werden kann. Der Hebel für Stabilisierung und Höhensteuerung C ist mittels eines Bügels I an der Achse m befestigt, um der letzteren die Drehbewegung und zu gleicher Zeit ir der Längsrichtung eine Schwingbewegung zu erteilen. Dieser Hebel ist durch eine Kupplungsstange n mit dem Arm D verbunden. Die Kupplungsstange steht durch eine Stange o mit dem Höhensteuer oder dem beweglichen h nteren Schwanz in Verbindung. Der Arm D ist nach oben durch einen Hebel C für den Flugschüler verlängert. Die Verlängerung erfolgt durch eine Kugelkupplung (Abb. 3). Der Hebel D endet in einer Kugel p, die von einem hohlkugelförmigen Gehäuse q am Hebel C1 umschlossen ist. Die auslösbare Verbindung zwischen dem Hebel D und dem Hebel C geschieht durch eine Kugel r, die in dem Gehäuse der' Kugel p durch eine Pfanne s gehalten wird, die unter dem Druck einer Schraubenfeder t steht und aus der Pfanne hinaustritt, wenn der Hebel in einer beliebigen, von der Bewegungsrichtung des Handhebels abweichenden Rchtung bewegt wird. Bei der Ausführungsform nach Abb. 2 ist die Einrichtung für die Seitensteuerung A, a B, A1 dieselbe, aber die Auslösungsvorrichtung für den Hebel C1, welche dem Hebel D gestattet, nach allen Richtungen hin zu schwingen, ist durch eine Kupplung mit Auslösung F ersetzt, die der Kupplungsvorrichtung B gleicht. Der Hebel D ist auf einer Muffe befestigt, die auf der Achse m schwingen kann. Andererseits ist die Verbindung zwischen dem Hebel C und dem Hebel D durch eine Auslösungsvorrichtung vermittelt, die ein Nachgeben des Hebels gestattet, wenn er einen zu großen Stoß in der Ebene der Achse m erfährt. Wie in den Abb 5 und 6 dargestellt, ist der Hebel C an eine Achse x des Bügels u des Hebels D angelenkt und besitzt zwei Blattfedern v, welche in entsprechende Aussparungen des Bügels eingreifen. Die Ränder der Aussparungen sind etwas D. R, P. No. 251 308 Robert Esnault-Pelterie in Billancotirt (Frankr.) erweitert, so daß bei einem zu starken Stoß des Schülers nach vorn oder nach hinten auf den Hebel C1 der Hebel sich auf dieser Ache drehen kann. Die dargestellten Ausführungsformen der Kupplung mit Auslösung können durch gleichwertige andere Mittel ersetzt werden und können auch bei Steuer rädern Verwertung finden Patent-Ansprüche: 1. Steuerhebelanordnung an Flugzeugen zur Ausbildung von Flugschülern, bei der die Hebel des Schülers ihre Bewegungen in demselben Sinne und mit 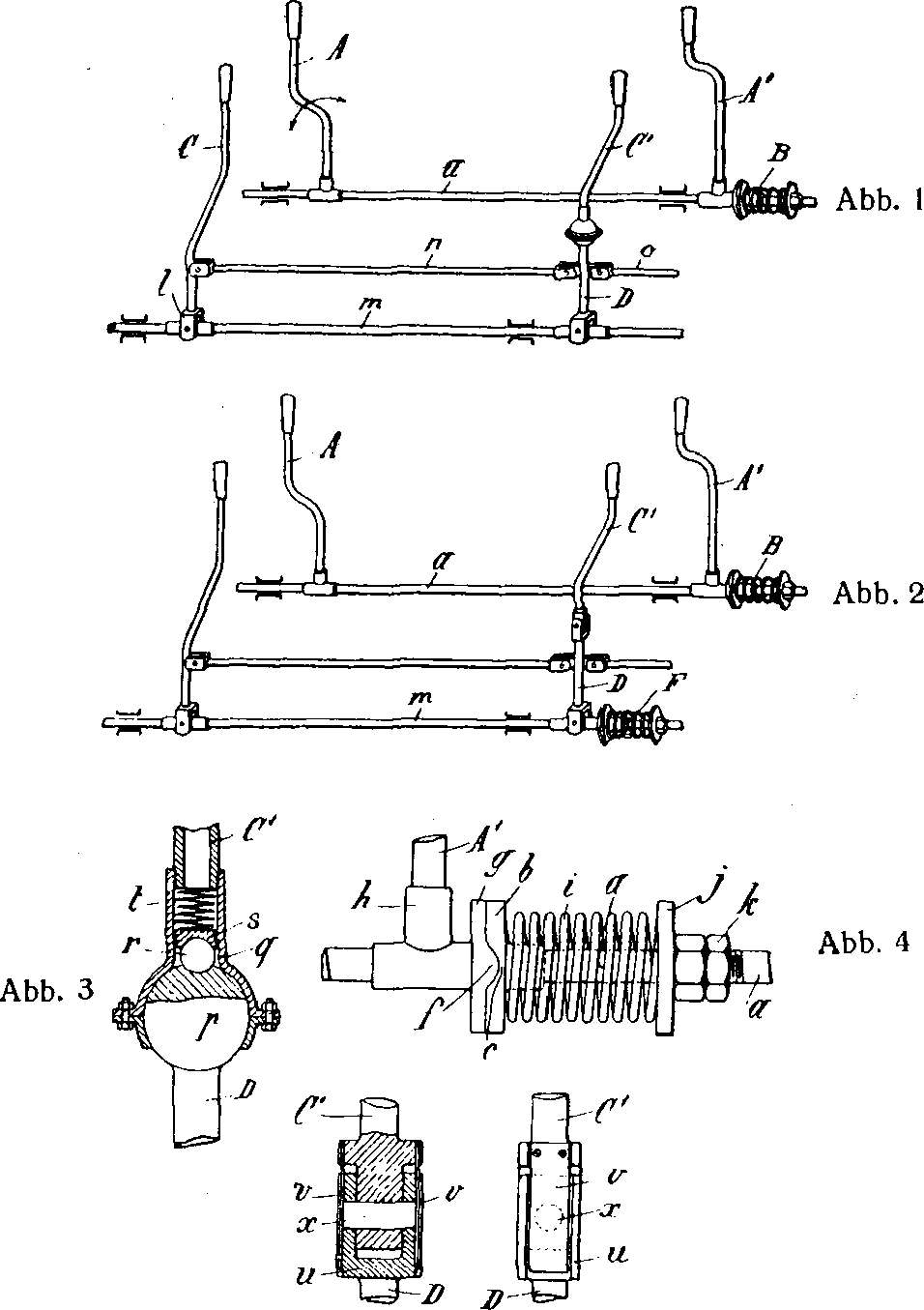 Abb. 5 Abb. 6 demselben Ausschlag ausführen können wie die Hebel des Lehrers, dadurch gekennzeichnet, daß die Hebel des Schülers mit den Hebeln des Lehrers durch Kupplungen verbunden sind, die bei einem der Hebelbewegung entgegengesetzten Widerstand sich selbsttätig auslösen. 2. Steuerhebelanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplung der Hebel des Lehrers und des Schülers durch eine Scheibe b erfolgt, die die Drehung der Achse a mitmacht und durch Federdrtick gegen eine Scheibe g an dem Hebel des Schülers gepreßt wird. 3. Steuerhebelanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Steuerhebel des Schülers aus zwei Teilen D, C besteht, von denen der untere D in gleichartiger Weise wie der Hebel des Lehrers auf der Welle befestigte an seinem oberen Ende in eine Kugel p ausläuft, die von einem am unteren Ende des Oberteils befestigten Hohlkugelgehäuse q umschlossen wird, wobei die nachgiebige Kupplung beider Teile durch eine im Innern des Gehäuses angeordnete kleinere Kugel r erfolgt, die durch eine unter Federdruck stehende Pfanne s in eine Aussparung der größeren Kugel p eingedruckt wird. 4. Steuerhebelanordnung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß der Hebel des Schülers aus zwei Teilen D, C besteht, wobei der obere Teil C um eine Achse x des unteren D drehbar ist und mit Blattfedern v in Aussparungen des unteren Teiles eingreift. Abfing- und Landevorrichtung für Flugzeuge.*) Es sind bereits Flugzeuge bekannt, deren verstellbare Tragflächen die Stützen und Halter für die Laufräder tragen, so daß eine Bewegung der Radstützen gleichzeitig mit den Tragflächen erfolgt. Des weiteren sind noch verstellbare Kufen bekannt. Diesen Vorrichtungen gegenüber bietet die vorliegende Erfindung durch Verbindung der an ihrem hinteren Ende ein Laufrad tragenden Kufen mit den 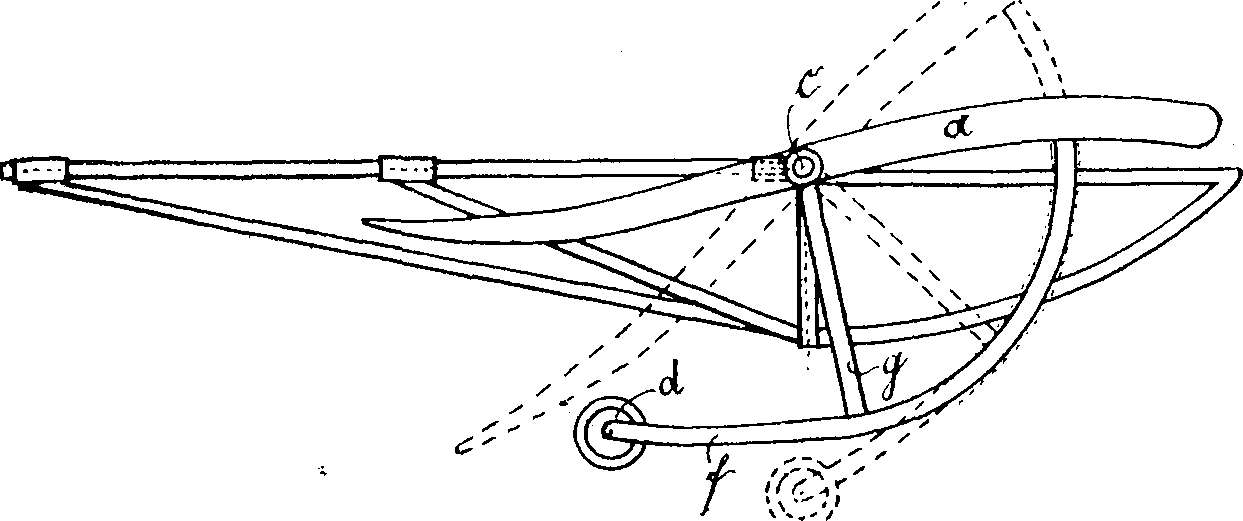 verstellbaren Tragflächen den Vorteil, daß beim Landen, wobei die Tragfläche" im letzten Augenblick steil eingestellt werden sollen, das Flugzeug zunächst m1' den Rädern den Boden berührt, so daß ein Ueberschlagen infolge zu schnelle" Abbremsens mittels der Kufen vermieden wird. Beim allmählichen Flachstellen der Tragflächen kommen dann die Kufen zur Wirkung, wenn eine Gefahr des Lieberschlagens nicht mehr besteht. In der Zeichnung ist die Erfindung veranschaulicht. Die Tragfläche a ist um die Querachse c drehbar. Unterhalb der Tragfläche a sind Kufen f angebracht und mittels der Streben g mit derselben fest verbunden, so daß die Kufen sämtliche Drehbewegungen der Tragfläche um ihre Querachse c mit ausführen. Jede Kufe trägt an ihrem hinteren Ende ein Rad d. Die besondere Kurvenform der Kufen bildet nicht den Gegenstand der Erfindung. Patent- Anspruch. Abflug- und Landevorrichtung für Flugzeuge, gekennzeichnet durch eine um eine Querachse des Flugzeuges mitsamt den Tragflächen verstellbare Kufe, welche an ihrem hinteren Ende ein Rad trägt. D. R. P. No. 249396. Johannes Behrbohm in Berlin-Schöneberg. Fahrgestell für Fingzeuge.*) Gegenstand der Erfindung bildet ein Fahrgestell für Flugzeuge, welches aus einem die Fi rm eines starren rechtwinkligen Dreiecks aufweisenden Hebel besteht, welcher an einer Hypotenusenecke an das Fahrzeuggestell angelenkt ist, an der anderen das Rad trägt und mit der der Hypotenuse gegenüber liegenden Ecke auf eine auf einem Kreisbogen geführte Feder einwirkt. Der Radius des Kreisbogens ist gleich der einen (oberen) Kathete, so daß die andere, den Radtragpunkt und den Federbefestigungspunkt verbindende Kathete in jeder Lage des Dreieckshebels tangential zur Führungsbahn der Feder liegt. Dadurch werden Horizontaldrücke von dem Fahrgestell ferngehalten. Außerdem läßt sich dasselbe niedrig ausführen, wodurch, von der dabei erzielten Materialersparnis abgesehen, eine erhöhte Stabilität des Flugzeugs verbürgt wird. Ein derartiges Fahrgestell ist in der beistehenden Abbildung schematisch dargestellt. Hierbei sind mit a die Dreieckhebel bezeichnet, die von Rohr- oder Profileisenrahmen oder Blechvollstücken gebildet werden können und an der Hypotenusenecke b an das Flugzeuggestell c angelenkt sind. Die andere Hypotenusenecke d trägt das Rad e, die der Hypotenuse gegenüberliegende Ecke f wirkt 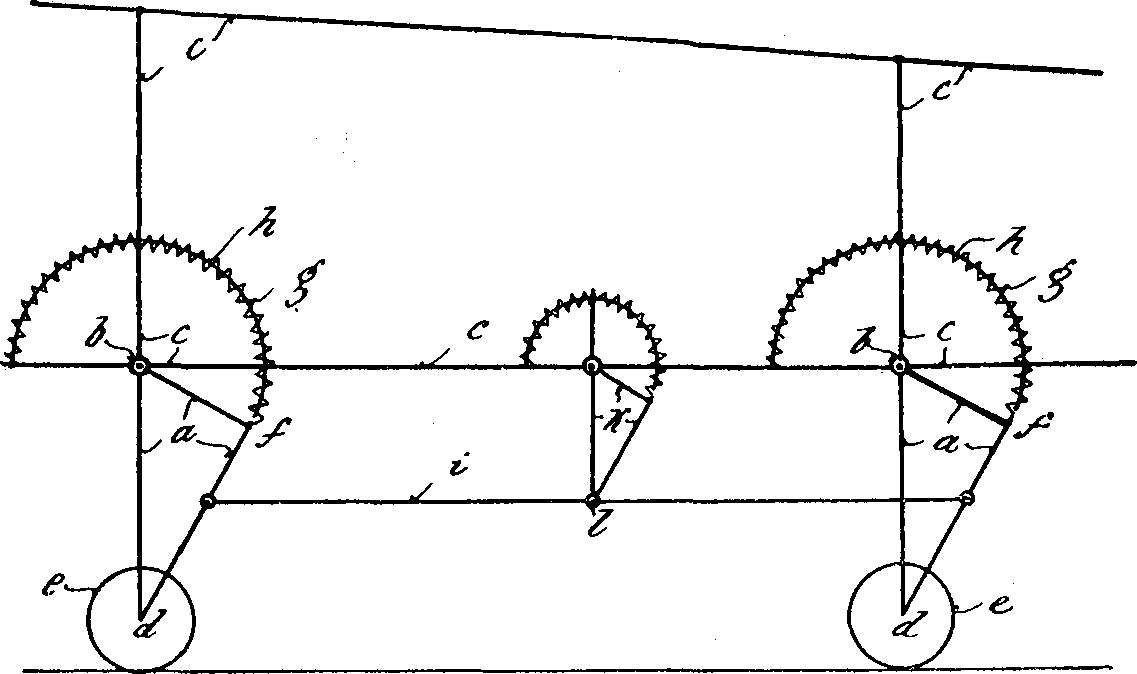 auf eine auf einem Kreisbogen h geführte Feder g ein. Der Radius des Kreisbogens ist gleich der Kathete b-f, so daß die den Radtragpunkt d und Federbefestigungspunkt f verbindende Kathete d-f in jeder Lage des Dreieckhebels tangential zur Führungsbahn der Feder liegt. Um einen Ausgleich der durch die Dreieckhebel auf die Federn g ausgeübten Beanspruchungen herbeizuführen, können dieselben paarweise durch Ge-lenkstangen i miteinander verbunden werden. Mit diesen Lenkstangen können ähnlich den Dreieckhebeln a gebaute Stoßdämpfungshebel k, die bei I an das Flugzeuggestell angelenkt sind, verbunden und deren Bewegung ebenfalls mittels auf Kreisbogen geführter Schraubenfedern abgefedert werden. Die Zahl und Anordnung der Dreieckhebel kann beliebig sein, ebenso die zu deren Vereinigung vorgesehenen Gelenkverbindungen, so daß auch beim seitlichen Landen von Aeroplanen ebenfalls Abfederwirkungen in Kraft treten. Patent-Anspruch. Fahrgestell für Flugzeuge, gekennzeichnet durch einen die Form eines starren rechtwinkligen Dreiecks aufweisenden Hebel a, welcher an einer Hypotenusenecke b an das Flugzeuggestell angelenkt ist, an der anderen d das Rad trägt und mit der der Hypotenuse gegenüber liegenden Ecke f auf eine Feder einwirkt, die auf einem Kreisbogen geführt ist, dessen Radius gleich der einen Kathete b-f ist. D. R. P. 254 789. Dr. Eugen Albert in München. 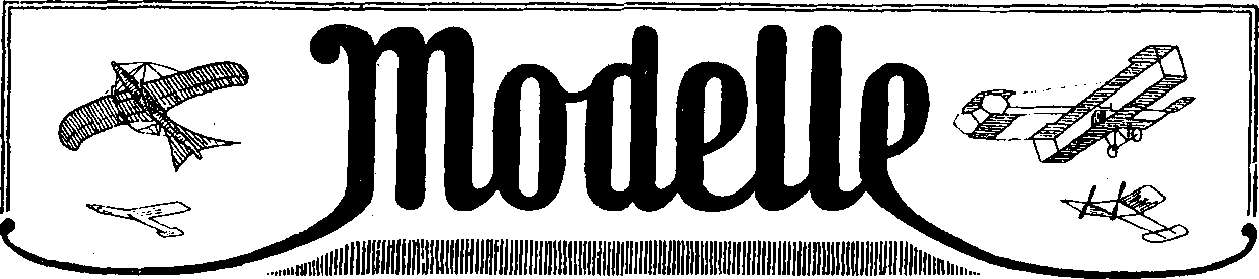 Modell-Eindecker Heer „Enten-Type". (Hierzu Tafel III.). Anläßlich des Pforzheimer Modellwettfliegens bewies der Eindecker _ von Heer nach dem sogenannten Enten-Typ eine außerordentliche automatische Stabilität und vorzügliche Flugfähigkeit. Die kleine Maschine flog bei denkbar schlechtestem Wetter und heftigen Schneeböen verschiedenemale 23/4—3 geschlossene Kreise von ungefähr 20 m Durchmesser, während andere Modelle wegen des starken Windes überhaupt nicht zum Fliegen gebracht werden konnten oder bereits nach 20 m abstürzten. Das Modell erreichte während des Wettfliegens einen größten Flug von 122 m, bei einem späteren Flugversuch 146 m. Der Heer-Eindecker mit vorn liegendem Höhensteuer, welches einen größeren Neigungswinkel als die Tragfläche besitzt und dadurch in der Längsrichtung automatisch stabil ist, ist in Tafel III dargestellt. Die Haupttragflächen sind, im Grundriß gesehen, V-förmig nach hinten und, von vorn gesehen, leicht V-förmig nach oben gestellt. Der Rumpf wird aus einer Holzstange a (Pappel) mit aufgenagelten und aufgeleimten Querstäben b gebildet, die mittels Zwirnfäden s verspannt sind. Die durch die Gummischnüre auftretenden Spannungen werden durch einen kleinen Unterzug gebildet aus den Streben c und den Spannfäden s (s. Seitenansicht links oben und Perspektiv-Skizzen rechts oben) aufgenommen. Die Druckschraube von 30 cm Durchmesser befindet sich direkt hinter der Haupttragfläche. Zum Antrieb dient ein Gummimotor von 10 — 12 m Gesamtlänge (von 1,25—1,50 mm Durchmesser). Der Gummi liegt über der Trägerstange. Deshalb muß das eben beschriebene Spannwerk unterhalb angeordnet sein. Um eine Verdrehung des Rumpfes bei aufgezogenem Gummimotor zu verhindern, sind die Spannschnüre d angeordnet. Wenn die Schraube bezw. der Gummi 350 mal umgedreht aufgezogen ist, so fliegt das Maschinchen 20—25 Sek., entsprechend einer Länge von ca. 150 m. Das Gerippe der pfeilförmig nach hinten gestellten Tragdecken besteht aus zwei Längsträgern e aus Pappelholz von je 4 mal 4 mm Querschnitt. Die mit Zwirnfäden befestigten Rippen r sind aus dünnen Bambusstreifen hergestellt. Die Rippen werden mit dem Längsträger wie folgt verbunden: Die Längsträger aus Pappel werden mit einem scharfen Messer aufgeschlitzt und die Deckrippen in die entstandenen Schlitze eingeschoben und verleimt. Auf den hinteren Längsträger sind die Rippen oben aufgebunden. Zur Bespannung verwendet Heer dünnes Pauspapier, das allen Ansprüchen vollauf genügt hat und in der Hauptsache auch den Vorteil der Billigkeit besitzt. Das vorliegende Maschinchen fliegt nach dem Prinzip der Neigungswinkeldifferenz automatisch stabil. Infolgedessen muß das vorn liegende Höhensteuer h einen stärkeren Anstellwinkel besitzen als die Tragdecken. Das Höhensteuer h, welches in einer besonderen Skizze auf Tafel III unten perspektivisch dargestellt ist, besteht aus einem Aluminiumdraht f, der in einem kleinen Lager g sich dreht. Die Rippen i sind aus dünnen Bambusstreifen hergestellt und, wie in der Abbildung ersichtlich, auf dem Aluminiumdraht befestigt. Der Höhensteuerhebel k ist gleichfalls auf dem Aluminiumdraht f befestigt. Am hinteren Ende des Höhensteuerhebels k greift ein kleiner Gummizug 1 an, während an dem oberen Ende des Steuerhebels k ein Steuerdraht m angreift, welcher mit einigen kleinen Nägeln n (s. Seitenansicht) befestigt ist und so das Höhensteuer in die gewünschte Stellung eingestellt werden kann. Das Seitensteuer o ist gleichfalls einstellbar und befindet sich vorn über dem Höhensteuer. Unter der Haupttragfläche ist ferner eine vertikale Dämpfungsfläche w angebracht, deren Form vorläufig noch beliebig den Ideen der Konstrukteure überlassen werden kann. Unbedingt erforderlich bei dem Flugmodell ist die Dämpfungsfläche nicht. Das Fahrgestell besteht aus zwei unter den Haupttragflächen angeordneten Laufrädem und einem unter dem Höhensteuer befindlichen Hilfslaufrad. Die Fahrgestellstreben sind aus 3 mm starkem Aluminiumdraht hergestellt und mittels kleiner Sehrauben am Körper befestigt. Ferner sind die Streben des Hauptfahrgestells durch eine dünne Stahlachse, auf der die Räder sitzen, auseinandergehalten. Zur Verspannung dienen einige Zwirnfäden. Damit das Modell beim Landen nach Möglichkeit nicht beschädigt wird, sind vorn zwei Stoßfänger t und u vorgesehen. Die vorliegende Enten-Type hat den großen Vorteil, daß sie mit sehr geringer Kraft fliegt. Die Maschine geht spielend vom Boden weg. Das Gewicht beträgt 150 g. Ein derartig gebautes Modell wird jeden Modellbauer befriedigen und ihm große Freude machen und er wird sicher, wenn er die Anleitungen einigermaßen gut befolgt, in 10 m Höhe in schönem gleichmäßigen Fluge das Modell seine Kreise ziehen sehen. Schraubenantrieb mit zwei Gummischnüren durch Zahnradübersetzunr. Der in beistehender Abb. dargestellte Schraubenantrieb hat vor dem im „Flugsport" Nr. 18 dargestellten den Vorzug, daß zwei Gummimotoren auf die Schraube h wirken, b und b sind aus Radspeichen gebogene Achsen, a und a aus Blech gebogene Lager, c ist ein in den Holzträger i eingeführtes Röhrchen, in dem die Schraubenachse d läuft, f, f und g sind Zahnräder, von denen f und f etwa im Verhältnis von 1 :3 bis 1 :4 stehen. Der doppelte Gummimotor hat rWI 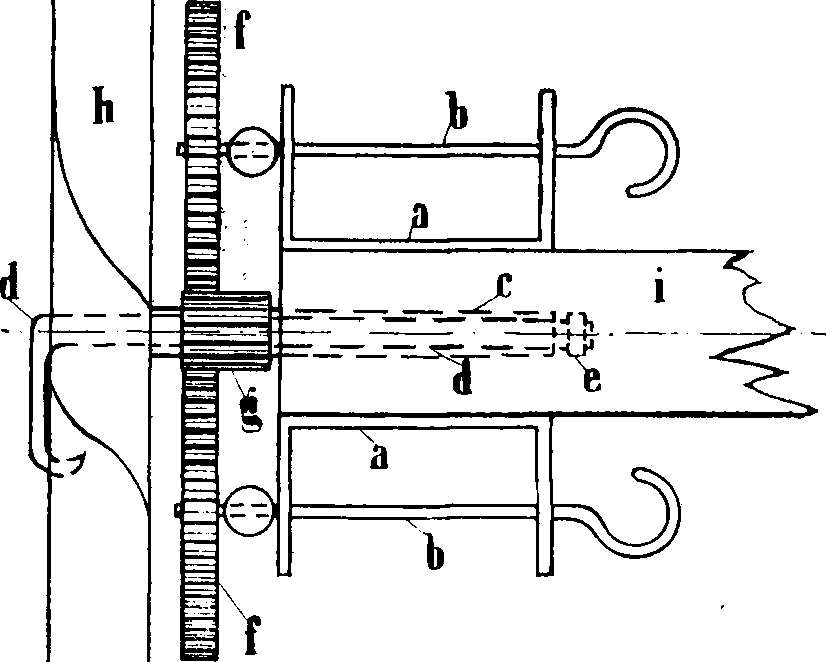 v außer der größeren Kraftentwicklung noch den Vorteil, daß der Gummiträger i nicht einseitig beansprucht wird, e ist ein aufgelötetes Ringchen, welches verhindert, daß die Achse d aus dem Röhrchen c herausspringt. Bartels. Ueber Wertung von Modellflugleistungen. Bei Modellwettfliegen, wie sie dieses Jahr in Berlin und Frankfurt veranstaltet wurden, teilte man die Apparate in Klassen ein nach dem Gummigewicht oder nach dem Flächeninhalt. Als Bestleistung wurde die Höchstzahl der in Luftlinie gemessenen Meter anerkannt. Diese Methode hat verschiedene Nachteile. Um möglichst lange Gummimotoren verwenden zu können, wurden die Modelle außerordentlich leicht, natürlich auf Kosten des Aussehens und der Stabilität, gebaut. Ein Modell soll aber kein Motor mit einer Fläche sein; es muß ein Fahrgestell haben und Spieren ebenso wie eine solide Verspannung. {Vergl. Olympia- und Matadorapparate.) Um aber auch die Sorgfalt, die auf genaue Ausführung verwendet wurde, anzurechnen, sei hier eine andere Methode vorgeschlagen. Die Modelle werden nach dem Flächeninhalt eingeteilt; die Flugleistungen nach der Formel gewertet: Leergewicht x Meterzah, Gummigewicht Werden z. B. Flugleistungen zweier Modelle verglichen, die gleiche Flugweite (50 m) erreicht haben, so ist dasjenige höher zu bewerten, das mit dem Leergewicht Bruch -~-s-(Wirtschaftlichkeitsfaktor) multipliziert, die höchste Zahl Gummigewicht ergibt Modell I. Leergewicht 30 Gramm Gummigewicht 25 „ Fluglänge 50 m Punktzahl: 60 Modell II Leergewicht 70 Gramm Gummigewicht 30 „ Fluglänge 50 m Punktzahl: 116 Denn auch der Modellflugzeugsport soll keine Spielerei sei, sondern die Resultate sollen Schlüsse auf große Apparate ergeben. Die Hauptbedingung eines Flugzeuges ist aber die Wirtschaftlichkeit. F. T. 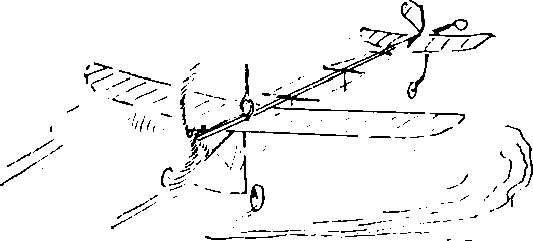 Verschiedenes. Aus Frankreich kommt die Nachricht, daß in Deutschland ein neues Ministerium, genannt das Ministerium der Luftangelegenheiten, angegliedert an das Ministerium des Innern, gegründet werden soll. Die Leitung soll einem Techniker in der Aviatik mit dem Rang eines Unterstaatssekretärs übertragen werden. Die Ursache zu dieser Maßnahme war die Notwendigkeit, die aviatischen Fragen zu centralisieren. Die Franzosen scheinen mehr zu wissen, wie wir in Deutschland! Ausbildung von Civilfliegern aus der Nationalflugspende. Infolge der vielen in letzter Zeit an uns gerichteten Anfragen, bitten wir die Interessenten ihre Eingaben an das Kuratorium der National-Flugspende Geschäftsstelle Berlin N W 6. Luisenstraße 33-34 zu richten, auch nicht an den Präsidenten oder die einzelnen Kuratoriums-Mitglieder. Letzteres ist nur geeignet Verzögerungen herbeizuführen. Versuchsanstalten für Flugtechnik. Im neuen preußischen Kultusetat sind 107 000 Mark ausgeworfen, die zur Herstellung einer Einrichtung zur Untersuchung von Flugzeugmotoren an der Technischen Hochschule Berlin dienen sollen. Für wissenschaftliche Erforschung der Flugzeugmotoren wird beabsichtigt in Tegel in der Nähe des 1912 eingerichteten Laboratoriums für Flugwesen eine Einrichtung zu schaffen, durch die eine den natürlichen Verhältnissen möglichst angepaßte Untersuchung der Flugzeugmotoren ermöglicht wird. Zu dem Zwecke soll ein Drehkran gebaut werden, an dessen Arme das vollständige Flugzeug aufgehängt wird. Weiter ist bei der Technischen Hochschule Danzig zur Förderung des Unterrichts und der Forschung auf dem Gebiete des Flugwesens die Einrichtung einer Aerodynamischen Versuchsanstalt in bereits vorhandenen Räumen geplant. Die Kosten für ihre Errichtung sind mit 46 600 M. in den Etat eingestellt. Verbot des Ueberfliegens der russischen Grenze. Den Führern von Flugzeugen, ist für die Zeit vom 14. Januar bis 14. Juli 1913 das Ueberfliegen der russischen Grenze verboten. Ueberfliegt ein Luftfahrzeug ohne Verschulden des Führers die Grenze, so ist einer durch besondere Signale (tags mit roter Flagge, nachts mit roter Laterne) erfolgenden Aufforderung zur Landung auf die schnellste mögliche Weise nachzukommen. Bei Zuwiderhandlungen kann das Führerzeugnis auf Zeit oder dauernd entzogen werden. Russische Fluemaschinen in Oesterreich. Nachts wurden in letzter Zeit wiederholt russische Flugmaschinen über der ^alizischen Grenzgarnison Jaroslau gesichtet, welche mittels Scheinwerfer das Gelände erforschten. Am 17. Januar stürzte eine Flugmaschine ab, deren Insasse, ein russischer Stabsoffizier, getötet wurde. Da hierdurch der Verdacht der Spionage bestätigt wurde, ordnete die Oesterreichische Militärbehörde die scharfe Beschießung der nächtlichen Luftfahrzeuge an. Personalien. General Freiherr von Lyncker, General-Inspekteur des Militär-Luft- und Kraftfahrwesens, ist zur Disposition gestellt. Ausstellungswesen. Flugzeug-Ausstellung in Turin. Jüngst wurde die Nachricht verbreitet, daß in Turin in diesem Jahre eine „Internationale Flugzeug-Ausstellung" stattfinden wird. Wie die „Ständige Ausstellungskommission für die Deutsche Industrie" hierzu erfährt, soll von der Turiner „Societä d'Aviazione" die Veranstaltung einer solchen Ausstellung für das Frühjahr zwar ins Auge gefaßt sein, jedoch liegt ein greifbares Projekt noch nicht vor. Literatur. Curt von Franckenbergs Luftfahrt-Wandkalender 1913. Preis Mk. 1.50. Verlag von Klasing & Co., Berlin. Curt von Franckenbergs Wandabreißkalender hat in Luftfahrerkreisen gute Aufnahme gefunden. Der für das Jahr 1913 in hübscher Aufmachung erschienene Kalender enthält wieder, entsprechend den Tagen, die wichtigsten Ereignisse auf dem Gebiete der Luftfahrt in Wort und Bild. Bei allen denjenigen, welche die Entwicklung der Aviatik mitgemacht haben, wird der Kalender dazu beitragen, manches Ereignis wieder ins Gedächtnis zurückzurufen >;nd daher für diese besonders interessant sein. Les Hydroaeroplanes, von Pierre Riviere, Ingenieur, mit einer Vorrede von A. Tellier. Preis 3 Frcs. Librairie AeYonautique, 40 rue de Seine, Paris. In vorliegender Broschüre sind an Hand von Abbildungen, die unseren Lesern zum Teil aus dem4„Flugsport" bekannt sind, die wichtigsten französischen und amerikanischen Wasserflugmaschinentypen beschrieben. Ausgehend von den ersten Wasserflugmaschinen von Bleriot bespricht der Verfasser die Maschinen von Fabre, Caudron, Borel, Nieuport, Curtiss, Astra, Bedelia, Beson, Artois bis zum letzten Pariser Salon. Junger Zeichner mit guten Zeugnissen für größere Flugmaschinenfabrik Mitteldeutschlands gesucht. Offert, u. 866 an die Exped. Eindecker-Pilot Maschinen-Ingenieur, sucht Stellung als Flieger. Off. u. 872 an die Exp. erb. Gesucht ein kapitalkräftiger Interessent für neuartige Flugmaschine. Suchender hat einen flugfähigen Apparat nach Art des Schraubenflieger-Systems hergestellt, welcher ohne Anlauf hochgehen und ebenso leicht landen kann. Zur Weiterfabrikation wird obige Hilfe gesucht Nach Abschluß eines Vertrages ist der Apparat zu besichtigen. Reflektanten belieben ihre frdl. Offerte sub-P. P. 1, Hauptpostlagernd Düsseldorf zu richten. (868) Bei etwaigen Neuanschaffungen bitten wir die Inserenten dieser Zeitschrift berücksichtigen zu wollen. .Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Modell-Eindecker Heer „Enten-Type". 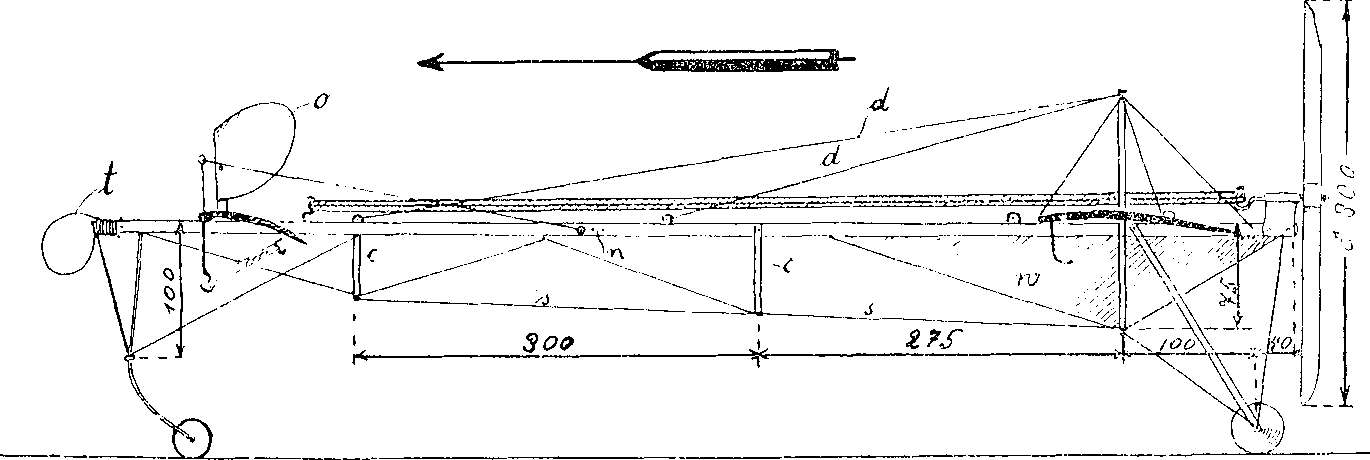
 technische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef.4557 Amt I. Oskar ÜrsltlUS, Civilingenieur. Tel.-fidr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „FJugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 19. Februar. Der Kaiserpreis für den besten deutschen Flugmotor. „Auf den .Bericht vom 21. Januar 1913 verleihe Ich den durch Meinen Erlaß vom 27. Januar 1912 für den besten deutschen Flugzeugmotor gestifteten Preis von 50000 M. der Firma Benz & Co. in Mannheim. Auch genehmige Ich, daß die weiter zur Verfügung stehenden Preise wie folgt verteilt werden: der Preis des Eeichskanzlers in Höhe von 30 000 M.: an die Daimler Motoren-Gesellschaft in Stuttgart Untertürkheim; der Preis des Kriegsministers in Höhe von 25000 M : an die Neue Automobil-Gesellschaft, Berlin-Oberschöneweide; der Preis des Staatssekretärs des Eeichsmarineamts in Höhe von 10000 M.: an die Daimler Motoren-Gesellschaft in Stuttgart-Untertürkheim; der Preis des Staatssekretärs des Inneren in Höhe von 10000 M.: an die Argus-Motoren-Gesellschaft in Eeinickendorf bei Berlin. Zugleich bestimme Ich, daß alsbald ein zweiter Flugzeug-Motoren-Wettbewerb ausgeschrieben und die Prüfung der Motoren der „Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt in Adlershof" übertragen wird, und daß die erforderlichen Mittel und Preise der Nationalflugspende gemäß dem Beschluß ihres Kuratoriums vom 20. Dezember 1912 entnommen werden. Die Stiftung eines Ehrenpreises halte Ich Mir vor. Die Preisverteilung soll am 27. Januar 1915 erfolgen. Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen. Berlin, den 27. Januar 1913. Wilhelm. Delbrück. An den Reichskanzler (Reichsamt des Inneren). * Die Diplome wurden am 27. Januar durch den Staatssekretär des Inneren, Staatsminister Dr. Delbrück an die Direktoren der preisgekrönten Firmen, Baurat Nallinger (Benz & Co., Mannheim), Daimler (Daimler-Motoren-G-es., Stuttgart-Untertürkheim), Wolff (N.-A.-G., Berlin) und Rathjen (Argus-Motoren-Ges., Berlin) überreicht. Ferner wurde in Anerkennung seiner Leistungen Dr. Ing Bendemann, der Leiter der Versuchsanstalt für Luftfahrt, zum Professor ernannt. * Das Resultat hat in Fachkreisen sehr überrascht. Im ganzen waren 44 Mqtorentypen mit 24 Ersatzmotoren von 26 Bewerbern gemeldet. Hiervon schieden 3 Konkurrenten, welche den Zulassungsbedingungen nicht genügten, aus. Die Prüfungsbedingungen sind den Lesern des „Flugsport" aus No. 11, Jahrgang 1912 bekannt, ebenso die Versuchseinrichtungen in Adlershof, weiche in Nr. 26 Jahrgang 1912, Nr. 1, 1913 beschrieben wurden. Bereits nach den Vorprüfungen lichteten sich die Reihen der Konkurrenten erheblich. Nur 19 Motoren kamen in den Dauerversuch. Die Gewichte der siegenden Motoren waren folgende: Einheitsgewicht 1. Benz 4 Zyl. 100 PS.....3,55 2.1 Daimler 6 Zyl. 80 PS .... 3,70 3. N. A. G. 4 Zyl. 100 PS . . . . 4,02 4. Daimler 4 Zyl. 70 PS .... 4,06 5. Argus 4 Zyl. 100 PS .... 4,07 Die Aufstellung läßt erkennen, daß man nach den Gewichten mit klassifizierte. Wie man die Betriebsstörungen bewertet hat, kann man noch nicht genau beurteilen, da die offiziellen Berichte noch fehlen. Von den Rotationsmotoren ist nur einer, und zwar außer Konkurrenz, durch die Dauerprüfung gekommen. Dieses Resultat mag einigermaßen befremden. Wir unterlassen es, auf die Einzelheiten, bevor die offiziellen Berichte erschienen sind, einzugehen. \ * Vom Staatsminister Dr. Delbrück wurde ein neuer Flugmotoren-Wettbewerb, welcher in 2 Jahren stattfinden soll, angekündigt. Der Kaiser wird hierfür einen kostbaren Ehrenpreis stiften. Dioscr neue Preis wird dazu beitragen, die Flugmotoren-Fabriken zu einem scharfen Wertkampf herauszufordern. Die Sieger. Der mit dem Kaiserpreis, 50000 Mark, ausgezeichnete 100 PS Benz-Motor ist, wie die untenstehende Abbildung zeigt, ein wassergekühlter Vierzylinder-Motor von 130 mm Bohrung und 180 Hub. Der Motor leistete bei 1250/1300 Touren 100 PS. Die Tourenzahl konnte bis auf 1380 gesteigert werden. Bei der Dauerbremsung in Adlershof um den Kaiserpreis leistete der Motor bei 1290 Touren 103 PS. Die empfindlichsten Teile des Motors, deren Versagen denselben außer Betrieb setzen können, sind doppelt ausgeführt. Zwei Magnet-Apparate mit getrennten Antriebsrädern arbeiten auf je zwei Zündkerzenserien. Frischöl- und Oelumlaufpumpe werden von zwei Stellen angetrieben und zwar sind für die Oelpumpe getrennte Rohrleitungen vorhanden. Um etwaigen Defekten durch Ventilfederbruch zu begegnen, besitzt jedes Ventil zwei um die gleiche Achse angeordnete Federn, die die Ventile auf den Sitz drücken, so daß, wenn eine. Feder bricht, der Motor doch anstandslos weiterläuft. Die Zylinder 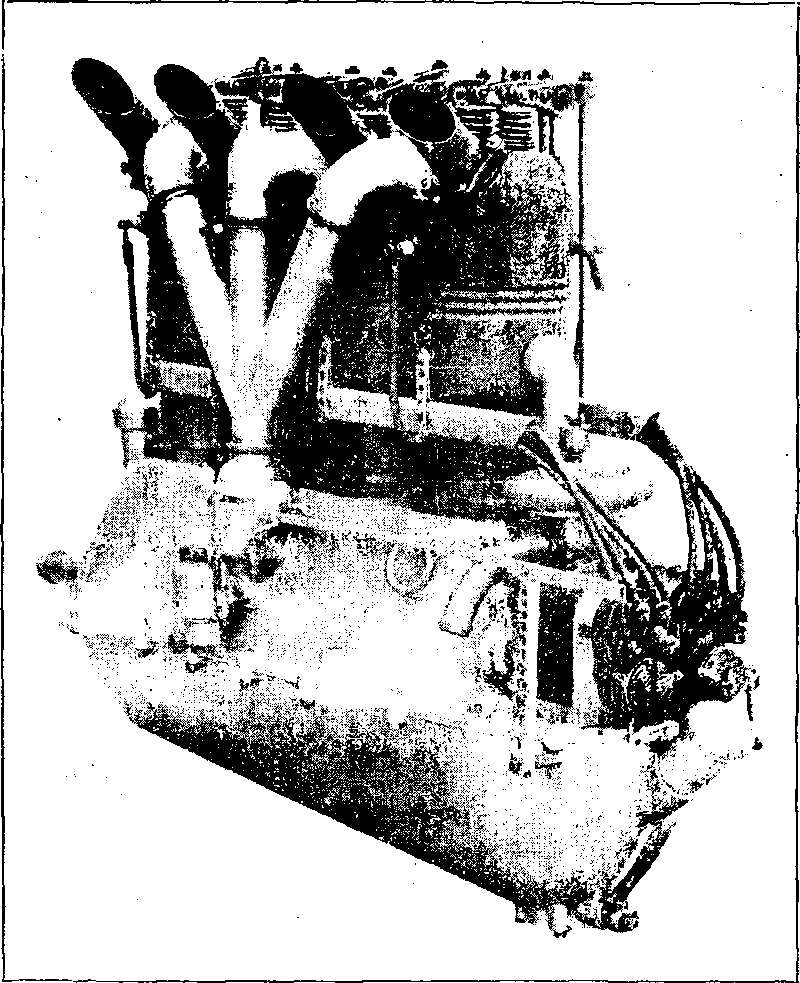 WO PS Benz-Motor. des Motors sind ans Granguß hergestellt und besitzen autogen aufgesehweißte Stahlblechmäntel. Besonders hoher Wert wurde auf eine gleichmäßige Gasvertoilung gelegt. Der Vergaser ist in das Kurbelgehäuse eingelassen, so daß er gleichzeitig zur Kühlung dient und überflüssige Wärme dem Knrlielgelian.se entzieht. Besonders vorteil- Seite 82 „FLUGSPORT". No. 3 haft erscheint die Anordnung der Gaszuführungsrohre zu den Zylindern. Bei der Dauerbremsung ergab sich ein sehr geringer Benzinverbrauch von 210 gr pro PS und Stunde. Der Motor wiegt incl. Rohrleitung, Magnetapparate, zwei Zündkerzensätzen mit Kabel 153 kg. Den Preis des Reichskanzlers, 30000 Mark, erhielt der 75—85 PS Daimler Sechszylinder-Motor von 105 mm Zylinder-Durchmesser und 140 Hub. Der Motor leistet bei 1350 Umdrehungen 85 PS und wiegt einschließlich zwei Magnetapparaten, Kühlwasserpumpe, Schmierölpumpe sowie der zum Betrieb nötigen Rohrleitungen 142 kg. Von den ß Stahlzylindern sind je 2 zu einem Block zusammengeschweißt und 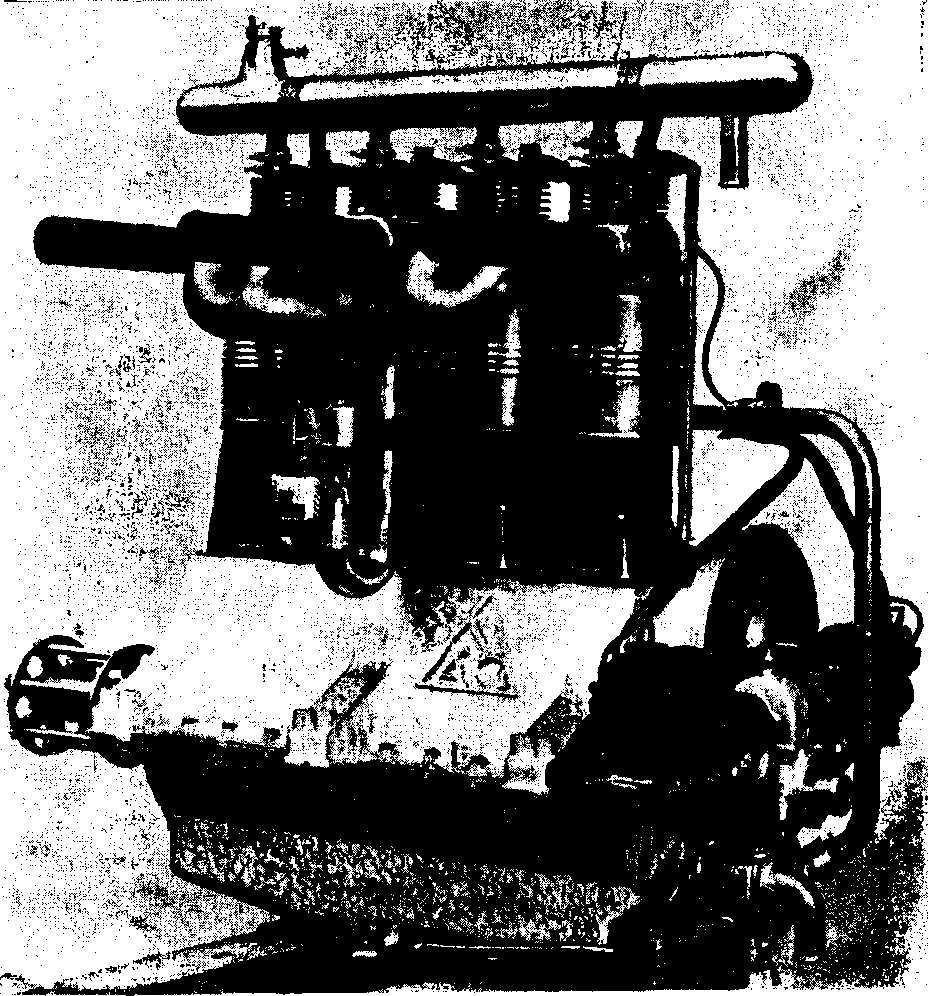 700 PS N. A. O.-Motor. mit einem gemeinsamen Stahlblech-Kühlmantel umgeben. Die schräg zu der Zylinderachse angeordneten Ein- und Auslaßventile sitzen am Kolbenboden und werden dui ch eine über den Zylindern liegende gemeinsame in ein Gehäuse eingekapselte Steuerwelle betätigt. Die Steuerwelle wird durch Kegelräderpaare von der Kurbelwelle aus angetrieben. Der Benzinverbrauch pro PS und Stunde betrug 240 gr, der Oelverbrauch 15 gr. Preis des Kriegsministers, 25000 Mark, 100 PS N. A G. Vierzylinder-Motor. Der 100 pferdige Motor, welcher mit 95 PS gemeldet war, ergab bei der Dauerprobe 97 PS und hatte einen Benzinverbrauch pro PS und Stunde von 214 gr. Der Motor hat 135 mm Bohrung und 160 Hub. Die einzelstehenden Zylinder sind bis zum Kopf vollständig bearbeitet, wodurch genaue Wandstärke erzielt und zu starke Spannungen. vermieden werden. Die Kühlblechmäntel sind nach einem besonderen Verfahren verfertigt. Um eine genügende Abkühlung der Ventilfedern zu erzielen, sind deren Windungen möglichst groß gewählt. Die Kurbelwelle ist 5 mal gelagert, so daß jedes Pleuellager von dem rechts bezw. links neben ihm befindlichen Kurbelwellenlager Oel durch Oelschleuderringe erhält. Das Kurbelgehäuse ist geteilt und im Unterteil als Oelbehälter ausgebildet und faßt den gesamten Oelvorrat für 5 Stunden, so daß ein besonderer Oelbehälter fortfällt. Diese Anordnung hat den Vorteil, daß das Oel nie eingefrieren kann und immer vorgewärmt ist. Die zirkulierende Oelmenge ist sehr groß und die Kühlung der zu schmierenden Teile infolgedessen sehr weit getrieben. Wie die Abbildung erkennen läßt, ist der Motor mit Doppelzündung und zwei Zündkerzenserien ausgerüstet. Preis des Staatssekretärs des Reichsmarineamts, 10000 Mark, 70 PS Daimler Vierzylinder-Motor. Dieser Motor besitzt 120 mm Bohrung und 140 Hub. Er leistet bei 1400 Touren 70 PS. Das Motorgewicht beträgt einschließlich Magnetapparat, Kühlwasserpumpe, Schmierölpumpe 142 kg, der Benzinverbrauch pro PS und Stunde 240 gr, der Schmierölverbrauch 15 gr. Die Ventile dieses Motors werden durch eine gemeinsame Steuerwelle unter Vermittlung von Hubstangen und Schwingen hebeln betätigt. Preis des Staatssekretärs des Innern, 10000 Mark, 100 PS Argns. Dieser Motor leistete während des Dauerbetriebes maximal 102 PS. Es ist dies der normale Serienmotor von 140 mm Bohrung und 140 Hub, wie er sich bisher in der Praxis sehr gut bewährt hat und unseren Lesern zur Genüge bekannt ist. Aus dem Johannisthaler Fliegerlager. Berliner Korrespondenz des „Flugsport". Im Kaiserpreis-Motorenwettbewerb sind die Würfel gefallen. Was man vor Wochen schon wußte, hat sich bestätigt. Benz gewinnt den Kaiserpreis und zwar, wie der Kaiserliche Erlaß im Reichsanzeiger vom 27. Januar besagt, für den besten deutschen Flugzeugmotor. Somit sind die 50000 Mark doch an einen Outsider in der gegenwärtigen deutschen Flugmotoren-Industrie gefallen. Der Firma Benz muß man für den errungenen Sieg gratulieren. (Siehe Kaiserpreismotoren). Die Bedeutung dieses Wettbewerbes liegt klar auf der Hand, wenn man in Zukunft die Prüfungen noch vielleicht etwas schärfer ausarbeiten muß. Nun darüber werden sich die Fachleute noch einig werden . . . . Auf dem Flugplatz Johannisthal sind die Firmen Albatros und Eumpler eifrig mit der Ausbildung der ihnen zugeteilten Offiziere beschäftigt, aber noch eifriger mit dem Bau von Militärmaschinen. "Wenn ein französischer Flugmaschinenfabrikant einen Blick in die Fabrikräume werfen dürfte, er würde staunen. Zu Fokker ist der holländische Fliegeroffizier Lt. von Hey st, der bereits Farmanflieger ist, kommandiert, um flugtechnische Studien an dem automatisch stabilen Eindecker anzustellen. Der Offizier flog auf Anhieb und hat bis jetzt schon ca. 30 Flüge ausgeführt. Major Rothe, der neue Kommandeur von Döberitz, besichtigte vor einiger Zeit die Werkstätten und flog mit Fokker bei sehr 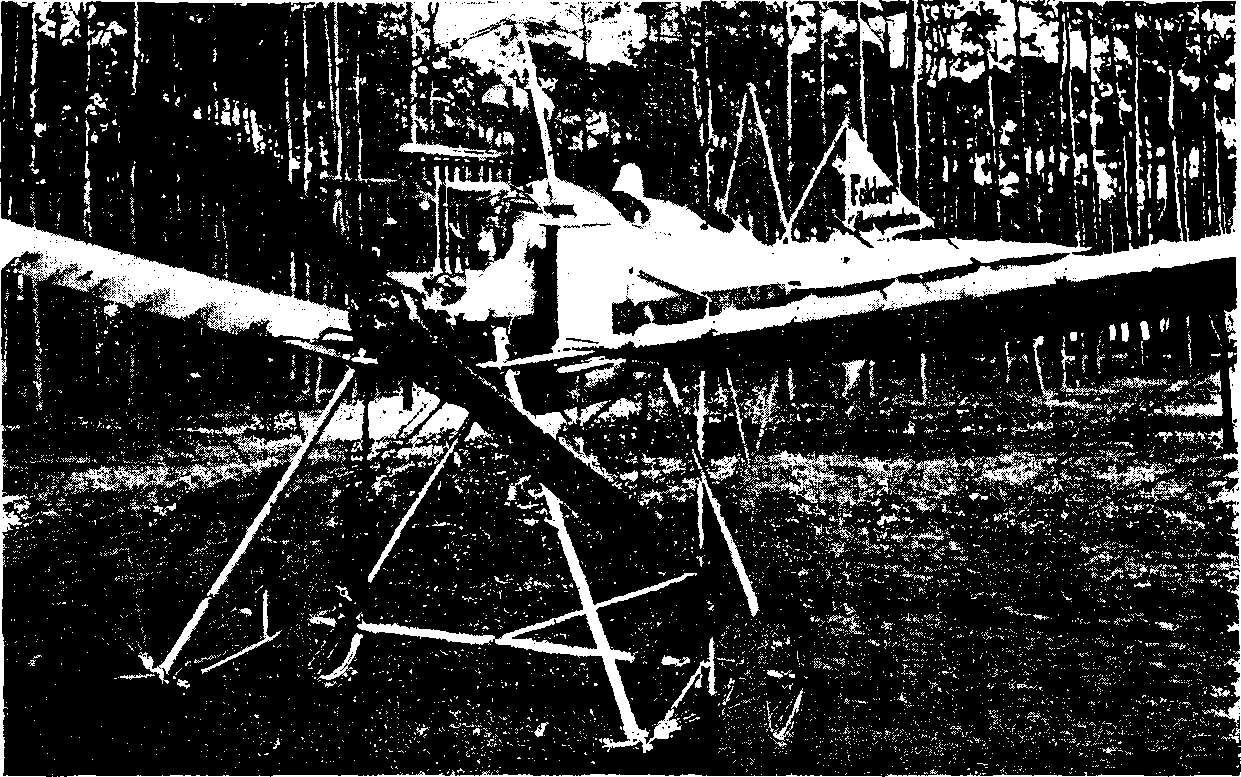 Fokker-Eindecker mit 100 PS Argus-Motor und Oaruda-Schraube (schlechtem Wetter mehrere Runden, worauf er dem Konstrukteur seine vollste Zufriedenheit über die Leistung des Apparates aussprach. Die neue Wasserflugmaschine, ein Doppeldecker mit 70 PS Renault und Centraischwimmer wurde jetzt nach dem Müggelsee transportiert, wo Fokker demnächst seine ersten Start- und Flugversuche ausführen wird. In den Werkstätten der L u i't-Verke Ii rs-Gesellschaft sieht ein neuer Doppeldecker mit vorn liegendem Mercedes-Sechszylinder-Motor von 100 PS seiner Vollendung entgegen. Auch bei Spnrtf Hoger stellen zwei nene Maschinen, die sich erlieblich von den üblichen Ausführungen von Ktrich unterscheiden, startbereit, um bei besserem Wetter, das von allen mit Schmerzen erwartet wird, zu debütieren. Die Werkstätten, wie die Schuppen der Firma Flugschule Melli Beese, deren Leiterin jetzt mit dem bekannten Flieger Charles Boutard in den heiligen Stand der Ehe getreten ist, wozu wir noch herzlich gratulieren, wurden am 23. Januar durch den Fürsten von Stollberg-Werningerode besichtigt, der fast zwei Stunden bei der Firma weilte und sich mit großem Interesse die M.-B.-Tauben, von denen die Firma 3 Apparate im Bau hat, in allen Einzelheiten erklären ließ. Unter anderen wurde die Klappbrücke, ein Ersatz für die bisherige Brückenkonstruktion, vorgeführt. Die Neuerung ist der Firma patentiert und soll sich sehr gut bewähren. Die Firma E. J e a n ni n läßt gegenwärtig große Werkstätten am Sportplatz errichten, um die Herstellung der Stahltauben in großem Stiel zu betreiben. . er. Die Wasserflugmaschine Jcare (Hierzu Tafel IV) wurde auf Veranlassung von Deutsch de la Meurthe im Atelier Voisin für Marinezwecke erbaut und zeichnet sich besonders durch ihre wuchtigen Dimensionen aus. Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß große Leistungen nur unter Anwendung von großen Motorenkräften zu erreichen sind und wir deshalb in Zukunft auch Riesenmaschinen bauen müssen. Noch bis vor kurzem glaubte man, insbesondere bei Wasserflugzeugen oder kombinierten Systemen von Wasser- und Landflugzeugen, mit 100 PS, die Höchstgrenze der anzuwendenden Motorleistung erreicht zu haben. Bereits im „Flugsport" No. 25 Jahrgang 1912 brachten wir einige bildliche Darstellungen von dem 200 PS Vorläufer, der in Tafel IV dargestellten, von Ing. Colliex konstruierten Maschine. Das Gleitboot, welches sich unter den beiden Haupttragflächen befindet, weist keine Stufe auf und ist mit Spritzblechen für hohen Seegang zum Schutze seiner Insassen versehen. Der Schwerpunkt ist, um eine gute Schwimmstabilität zu erzielen, sehr tief gelegt. Im Innern des Gleitbootes befindet sich vorn der Fliegersitz, etwas zurück 6 weitere Gastsitze. Eechts und links sind 2 Maschinenkanonen a und b auf Pivot-Lafetten mit großem Schuß winkel angeordnet, neben welchen sich unter den Sitzpolstern die Munitionskästen befinden. Ein aoht-zelliger Bombenkäfig c kann in der Mitte angebracht werden, dessen Inhalt durch die Luken d ausgeworfen wird. Zum Betriebe dient ein 200 PS Clerget - Motor. Der Schraubenantrieb erfolgt mittels Kenaultkette, die, wie bei Wright, in Rohrloitnngen geführt wird Das auf der Sohraubenwelle sitzende Kettenrad ist zur Verringerung des Luftwiderstandes mit einer Doppelkegelblechhaube umkleidet. Am hinteren Wellenstumpf sitzt eine 4 flügelige Chauviere-schraube von 3,0 m Durchmesser und 3,5 m Steigung, die 550 kg zieht. Sic macht pro Min. 000 Umdrehungen. Der Rauminhalt des Bootes gestattet bis zu 10 Personen aufnehmen zu können; außerdem besitzt Seite 80 „FLUGSPORT' No. 3 dasselbe an seinem stumpfen Ende ein Steuerruder, welches eine bessere Manöverierfähigkeit auf dem "Wasser ermöglicht. Wie schon erwähnt, befindet sich die Haupttragfläche über dem Gleitboot. Sie ist nicht, wie üblich, mit federnden Kippen, welche über den hinteren Holm hinausragen versehen, sondern das. Tragdeck wird durch eine komplette Stahlrohrumrahmung begrenzt Das obere Tragdeck hat eine Spannweite von 22 m, wovon die überragenden Enden des Oberdecks von 3 m Länge beim Transport heruntergeklappt werden können. Das untere Tragdeck hat eine Länge von 16 m und trägt an seinen Außenenden torpedoartig gestaltete Hilfsschwimmer e. Die Schwanztragfläche ist mit der Haupttragfläche durch zwei in der Steuerruderachse dreieck-förmig zusammenlaufende Gitterträger verbunden. Diese Schwanzfläche, an welcher sich das Höhensteuer anschließt, ist ferner schräg von unten her abgestützt. Darunter befindet sich das Seitensteuer. Um ein Eintauchen des Schwanzes bei hochgehender See zu verhindern, ist ein Hilfsschwimmer f vorgesehen. Zum Bau der ganzen Maschine ist Stahlrohr als hauptsächlichstes Konstruktionsmaterial für Streben und Gitterträger verwendet worden. Die Gesamttragflächen der Maschine betragen 65,25 qm Geschwindigkeit 90 km/Std. Leergewicht 900 kg. Transportfähige Nutzlast 700 kg. Gesamtgewicht im Fluge 1600 kg. Die Benzin- und Oelbehälter sind für einen Betriebsstoffverbrauch von 5 Stunden eingerichtet. Gleich bei seinen ersten Versuchen zeigte der Apparat eine außerordentliche Seetüchtigkeit, welche wahrscheinlich nicht zum geringen Teile auf die Konzentrierung der Massengewichte im Gleitboot zurückzuführen ist. Colliex baut neuerdings eine noch größere Maschine mit zwei Chenue-Motoren von je 200 PS. Der Pippart - Noll - Eindecker. Das Charakteristische dieser Eindecker-Konstruktion sind längs des Rumpfes angeordnete vertikale und horizontale Dämpfungsflächen. Durch diese neuartige Anordnung soll eine besonders hohe Stabilität erreicht werden. Die Tragdecken sind V-förmig nach hinten und nach oben gestellt Der tropfenförmig ausgebildete Rumpf besteht aus zwei Hälften. Die untere Hälfte, die alle Beanspruchungen aufnimmt, ist gitterförmig durchgebildet, während der obere als Karosseric ausgebildete Teil abgenommen werden kann. Der Rumpf ist mit einem Spezial-Fibre, das nach einein besonderen eigenen Verfahren präpariert wurde, überzogen. Dieser Uober/Ug ist gegen Stöße und Schläge fast unempfindlich, beult sich nicht ein und ermöglicht durch die glatte Oberfläche ein gutes Abströmen der Luft. Der vorn gelagerte auf einem Unterbau aus Eschenholz ruhende Motor ist durch eine Aluminiumhaube eingekapselt. Hinter dein 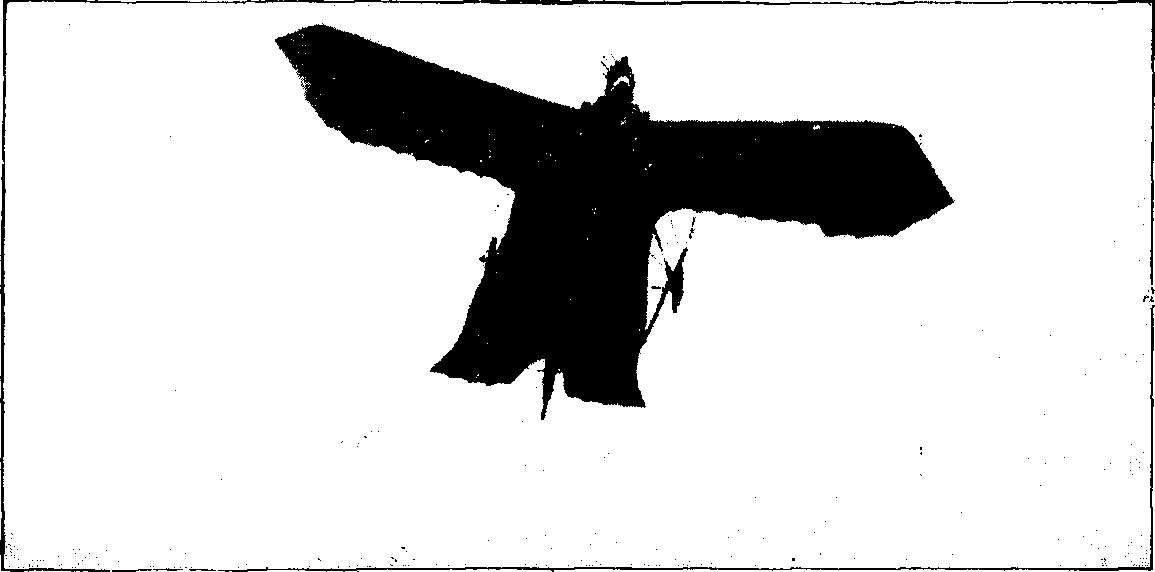 Der Pippart - Noll - Einde&er Motor sind Gast- und Führersitze angeordnet. Der Benzinbehälter liegt zwischen Gast- und Führersitz und ist mit Schauglas zur Kontrolle des Benzinstandes versehen. Das Fahrgestell besteht aus zwei kurzen stark gekrümmten Kufen aus Escheuholz, die durch je 2 Streben mit dem Rumpf mittels Stahlblechschuhen verbunden sind. Die Räder sind in bekannter Weise an Gummi-  Der Pippart - Noll - Eindecker ringen an den Kufen aufgehängt. Bei größeren Gewichten wird an Stelle der Guininiringabfcderung Blattfederung vorgesehen Am Fahrgestell ist ferner eine Bremse angeordnet, die vom Führersitz aus bedient werden kann. Zur Unterstützung des Sehwanzteiles dient eine abgelederte Schleife. Die Hauptträger der Tragdecken bestehen aus auseinander geschnittenen und versetzt zusammen geleimten Eschenholzträgern. Die Spieren sind in kurzen Abständen angeordnet Die Zwischenklötze sind geleimt und mit den Spieren verschraubt. 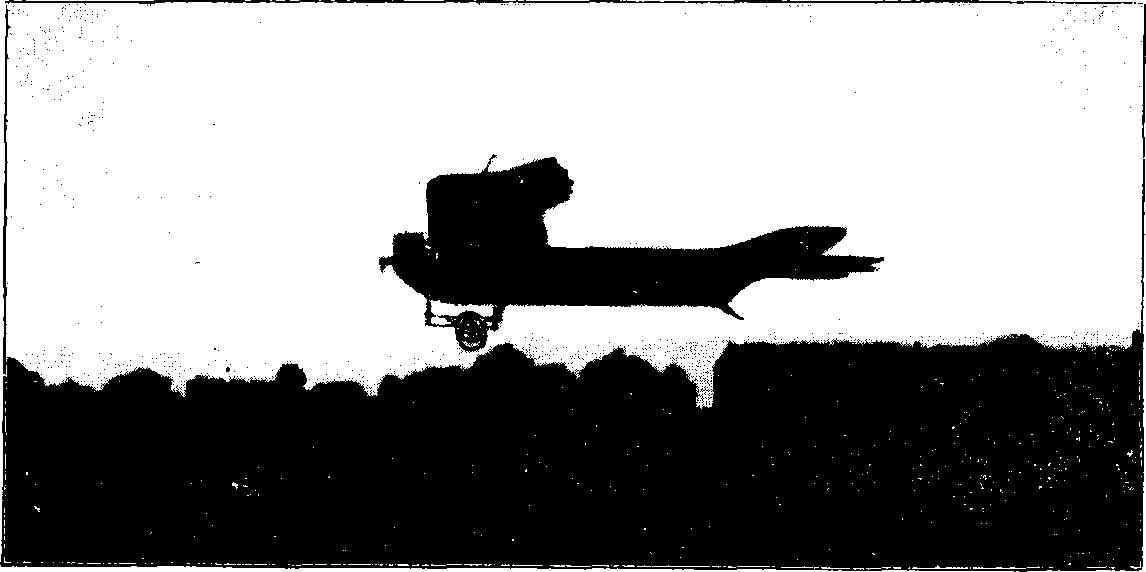 Der Pippart - Noll - Eindecker Alles Holzwerk ist gegen Feuchtigkeit mittels Speziallack, wie solcher beim Schütte-Lanz verwendet wurde, präpariert, wodurch ein Verziehen des Holzes ausgeschlossen ist. Die Flügelenden sind verwindbar eingerichtet. Die Verspannung der Flügel geschieht durch starke Stahlseile. Die Betätigung des hinten befindlichen Höhensteuers geschieht dirroh An- oder Abdrücken eines Schwingenhebels, die Seitensteuerung durch Pedale. Für die Steuerbetätigungseinrichtungen sind durchweg 3 tum starke Stahlkabel verwendet. Die Verwindung wird durch das auf dem Schwingenhebel befindliche Steuerrad in bekannter "Weise betätigt. Zum Betriebe dient ein 70 PS Argus-Motor. Der Jatho-Eindecker. Die hohen Anforderungen, welche die Heeres-Verwaltung bei der Abnahme ihrer Flugzeuge stellt, haben die deutschen Flugzeugkonstrukteure gezwungen, solide und sehr kräftige Maschinen zu bauen. Auch die Erfahrungen in den letzten Kriegen, in welchen Flugzeuge zeitweise ohne Schutz unter freiem Himmel bleiben mußten und den Witterungsehl Hussen preisgegeben waren, zeigten, daß fast immer die Stahlkonstrnktion große Vorzüge der 1 lnlzkonstruktion gegenüber hat. Diesen Anforderungen entsprechend, hat Jatlio auf Grund jahrelanger Erfahrungen und kostspieliger Versuche einen neuen Typ heraus- gebracht. Bei diesem Eindecker sind alle Teile bis auf die Tragdecken aus Stahl konstruiert und bei diesen bestehen auch nur die Rippen aus Holz, dagegen sind die Hauptträger ebenfalls aus Stahlrohren hergestellt. Der Konstrukteur war bemüht, das Gewicht des Eindeckers möglichst gering zu halten, ohne daß dabei die Festigkeit und hiermit die Sicherheit desselben beeinträchtigt wurde. Alle Abmessungen sind derartig kräftig gehalten, daß harte Landungen auch auf sehr schlechtem Gelände kaum einen Defekt zur Folge haben dürften. Der Rumpf des Eindeckers zeigt die bewährte Vogelrumpf form, die sich als äußerst günstig und vorteilhaft gezeigt hat. Der Querschnitt ist rechteckig und ist aus autogen geschweißten nahtlosen Stahlrohren hergestellt. Sowohl der Sitz des Fliegers, als auch der des Gastes liegen tief im Rumpf,, sodaß die Tnsassen gegen Regen und Wind völlig geschützt sind. Das vordere Fünftel des Rumpfes, in welchem sich der Motor  Der Jatho-Eindecker mit Kühler befindet, ist mit Magnaliumblech, das übrige mit gummiertem Stoff verkleidet. Der Kühler ist hinter dem Motor derartig geschützt montiert, daß er bei Transporten oder bei Arbeiten an dem Eindecker vor Beschädigungen vollständig geschützt und doch der Zugluft reichlich ausgesetzt ist. Die Oel- und Benziiibehälter, welche unter Druck stehen, liegen tief im Rumpf und fassen Betriebsstoff für eine Dauer von 6 Stunden. Hinter dem Kühler sitzt der Fluggast und hinter diesem der Führer. Für die vertikale Beobachtung sind in den Flügeln rechts und links Oeffnungen gelassen. Die Räder des Fahrgestells haben einen Durchmesser von 65 cm und sitzen auf einor an Gummiringen aufgehängten Achse. Die Tragflächen haben Zanoniaform. Die Hauptholme bestehen aus Mannesmann-Stahlrohren, dagegen die Rippen aus Eschenholz. Sämtliche zum Spannturm und zum Untergestell laufenden, verzinnten Stahldrähte und Kabel vereinigen sich oben in zwei starken Stahllaschen die am Spannturm eingehakt werden, unten in zwei exzentrische Carabiner-haken. Hierdurch ist eine äußerst schnelle Montierbarkeit in etwa 6 Minuten möglich. Die Steuerung ist die von der Heeres-Verwaltung verlangte Normalsteuerung. Zum Antrieb dient ein 100 PS N. A. G. oder auch Argus-Motor. Es wird auf Wunsch auch jeder andere Motor eingebaut. Die Länge des Eindeckers ist 9,6 m und die Spannweite 15 m. Die Geschwindigkeit ist auf 120—130 km pro Stunde festgestellt. Das Gewicht des Eindeckers beträgt je nach Art des Motors 450—500 kg. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Das Wort Ludwig XIV.: „Es gibt keine Pyrenäen mehr!" ist allbekannt, ebenso wie der Anlaß dazu. Aber sicherlich hat der „Sonnenkönig" sich damals nicht träumen lassen, wie dieser sein Ausspruch sich drei Jahrhunderte später verwirklichen werde. Ein junger schweizerischer Flieger, namens Bider, bisher völlig unbekannt, hat am vergangenen Sonnabend ohne jede Reklame und mit einer für hiesige Gewohnheiten herzerfreuenden Bescheidenheit eine grandiose Flugleistung zu Wege gebracht, indem er, von Pau nach Madrid, über die Pyrenäen, eine Entfernung von 500 km in 5 Stunden 11 Minuten zurücklegte. Ein erstes Mal sind die Pyrenäen überflogen worden zu Anfang des Jahres 1911, gelegentlich des Fernfluges Paris - Madrid. Seit jener Zeit wurde die Ueberquerung dieses Gebirges als eine äußerst schwierige Flugleistung angesehen, an die sich auch die „Matadoren" nicht heranmachten. Oskar Bider, der erst im Dezember sein Flugführerzeugnis erworben hat, also erst seit einem Monat selbständig fliegt, flog auf einem Belriot-Eindecker vom Flugplatze Pont Long ab; das Wetter war prächtig. Mit einem einzigen Fluge gelangte der junge Flieger bis nach Guadalajara, 50 km von Madrid, wo er zwecks Ergänzung seines Benzinvorrats landen mußte, um, nach nur kurzem Aufenthalt, den Flug nach der spanischen Hauptstadt fortzusetzen, wo er mit großem Jubel empfangen worden ist. Die Reise ging glatt vonstatten, obgleich Bider oberhalb der Pyrenäen von einem heftigen Winde arg gerüttelt wurde. Nach den Pyrenäen die Alpen. Es ist noch in Fjrinnerniig, wie bei dem ersten Versuche der Alpenüberqnerung der unglückliche Chavez seinen Tod fand. Der bekannte peruanische Flieger Bielovucie hatte nun, wie wir berichtet haben, den Plan gefaßt, die lieberquerung der Alpen von neuem zu versuchen, und zwar auf demselben Wege, den seinerzeit Chavez gewählt hatte. Seit zwei Wochen hielt sich Bielovucie mit seinem Hanriot-Eindecker (80 PS Gnom) in dem schweizerischen Orte Brieg auf, zu wiederholten Malen versuchte er, sein Vorhaben auszuführen, immer aber mußte er wieder der Unbill der Witterung weichen. Am letzten Sonntag nun lauteten die vom Simplon-Hospiz herabgesandten Wetternachrichten günstiger und Bielovucie entschloß sich, den Flug zu unternehmen. In der vorhergegangenen Nacht war starker Schneefall eingetreten, sodaß zunächst 60 Leute requiriert werden mußten, welche nach Forträumung von 300 Kubikmeter Schnee ein Abflugterrain herstellten. Um 12 Uhr mittags war alles zum Abflug bereit und der kleine Eindecker nahm schnell und  Bie/ovucie's Flug über den Simplon auf Hanriot-Eindecker. glatt seinen Start. Nachdem der Peruaner zwei schöne Spiralen über den Gletschern beschrieben hatte, war er in 17 Minuten auf 1200 Meter Flughöhe gelangt. Aber plötzlich blieb der Motor stehen; Bielovucie hatte aus Versehen die Benzinnadel angestoßen. Ohne die Geistesgegenwart zu verlieren, führte der Flieger die erforderlichen Manöver aus und bald ließ sich wieder das Knattern des Motors vernehmen. Unten hatte die Menge den beängstigenden Vorgang bemerkt und atemlos schaute man der unvermeidlich scheinenden Katastrophe entgegen. Aber Bielovucie setzte nun seinen Aufstieg fort und schnell erreichte er 2500 und 3200 m Höhe, indem er über Monscera dahinsegelte. Als er sich über dem Simplon befand, verspürte er heftige Windwirbel, so daß es ihm, wie er selbst berichtet, schien als ob die Alpen zusammenstürzen. Erst als er über Gaby und Weißmieß dahinging, hörte diese grauenhafte Vision auf. Alsbald bemerkte Bielovucie in der Ferne Domodossola, das Ziel seines Fluges, und er begann, langsam im Schwebefluge sich herabzusenken. Die Atmosphäre war so hell, daß der Peruaner deutlich die Fahne bemerken konnte, welche an der Zielstelle flatterte. Als er sich der Erde näherte und nur noch 100 m von ihr entfernt war, verspürte er aufs neue heftige Windstöße und unwillkürlich kam ihm das Schicksal und das Bild seines unglücklichen Freundes Chavez vor Augen. Aber die Landung ging glatt vonstatten, genau an der Stelle, an der sich der Denkstein für Chavez erhebt. Man kann sich denken, mit welchem Enthusiasmus der wagemutige Flieger in Italien geehrt wurde und auch hier, wo er inzwischen eingetroffen ist, bereitet man ihm mannigfache Ehrungen. Aber damit erschöpft sich die Serie beachtenswerter Flugleistungen nicht, die zu melden ist. Legagneux unternahm an Bord eines Morane-Eindeckers, mit der bekannten Miß Da vi es als Passagierin, zu Issy einen Angriff auf den bisherigen Passagier-Höhenrekord. Nachdem er eine Flughöhe von 3670 m erreicht hatte, landete er nach nahezu zweistündigem Fluge in Villacoublay. Legagneux hat damit den bisherigen französichen Rekord (Maurice Prevost, 2. Dezember 1911: 2700 m) geschlagen, dagegen verbleibt der Weltrekord dem Leutnant Blaschke mit 4360 m (28. Juni 1912). Eine andere Rekordleistung muß hier erwähnt werden, die noch dadurch an Interesse gewinnt, daß sie in Italien, und zum ersten Male auf einem Apparat italienischer Konstruktion, zu Wege gebracht worden ist. In Vizzola Ticino hat der Flieger Slaworossoff auf einem Eindecker Caproni, 80 PS Gnom-Motor, am 25. Januar die Passagier-Weltrekords über 200 und 250 km geschlagen, indem er auf einer Rundstrecke von 5 km die 100 km in 0:57:45 (Rekord verbleibt Legagneux mit 0:44:50) 200 km in 1:56:30 (bisher. Rekord: Leutn. Bier mit 2 : 03: 49) 25u km in 2:24:30 (bisher. Rekord: Leutn. Bier mit 2:39:37) zurücklegte. Gleichzeitig hat Slaworossoff sämtliche bisherigen italienischen Passag'errekords, die Cobioni inne hatte, geschlagen. Dagegen scheint das große Projekt Helens, der Flug von Paris nach Tanger nicht recht in Gang kommen zu wollen. Alle Vorbereitungen dazu sind getroffen; die ganze Küste entlang sind Verproviantierungs-stationen installiert. Dagegen hat der ursprüngliche Plan, da in Tortosa ein geeignetes Landungsterrain nicht zu finden war, dahin abgeändert werden müssen, daß dafür in Amposta eine Landung vorgesehen wird. Die von Helen einzuschlagende Flugstrecke ist demnach folgende: Paris, Montpellier, Perpignan, Barzelona, Amposta. Valencia, Alicante, Almeria, Malaga, Algeciras, Gibraltar nnd Tanger. Bekanntlich will Helen denselben Weg auch zurück machen. Zwischen Almeria und Malaga wird der Flieger infolge der Gebirgsmassen eine Höhe von 3000 m aufzusuchen haben. Der Rüekflug wird wahrscheinlich übei Madrid, Pau und Bayonne erfolgen Helen hofft nicht mehr als 4 Tage für Hin- und Rüekflug zu gebrauchen, sodaß er täglich 800 bis 1000 km zurückzulegen gedenkt. Er will einen zweisitzigen Nieuport-Eindecker, 100 PS Gnom, zu diesem Fluge benutzen und seinen Mechaniker an Bord nehmen. Stark beeinflußt wird dieses Projekt wohl durch den dieser Tage stattgehabten bedauerlichen Unglücksfall, dem Charles Nieuport und sein Mechaniker Guillot zum Opfer fielen. Nieuport flog von Issy nach Etampes, um dort der Uebernahme einiger Militär-Apparate beizuwohnen, die von Espanet und Gobe vorgeführt wurden. Nieuport entschloß sich plötzlich, eines der Flugzeuge vor der Kommission selbst zu steuern und, mit seinem Chef-Mechaniker an Bord, erhob er sich schnell in die Luft. Plötzlich sah man, wie der Apparat sich auf die Seite neigte, einige kurze Spiralen beschrieb und dann mit furchtbarem Aufprall auf die Erde stürzte. Beide Insassen hatten ihren sofortigen Tod gefunden. Dieser Unglücksfall, so bedauerlich er ist, überrascht niemanden hier. Man war seit langem über die zeitweilig unerklärliche Verwegenheit Charles Nieuports erstaunt, der offenbar den Tod seines gleichfalls verunglückten Bruders Edouard nicht zu verwinden vermochte und häufig genug geäußert hat, daß er den gleichen Tod finden möchte, wie sein Bruder. Natürlich hat der Tod Nieuports in hiesigen Flieger- und Industriellenkreisen lebhaftes Bedauern erweckt, zumal die Firma Nieuport in ihm nun auch ihren kommerziellen Leiter verliert, der persönlich sich großer Beliebtheit erfreute. Der Betrieb, an dem ein sehr bekannter und vielgenannter hiesiger Sportmann finanziell beteiligt ist, wird aller Wahrscheinlichkeit nach unverändert fortgesetzt werden, zumal die Militärverwaltung der Firma beträchtliche Aufträge erteilt hat. Uebrigens bereiten sich allem Ansehein nach im französischen Militärflugwesen gewisse Ueberraschungen vor, die wir heute anzudeuten in der Lage sind. Angesichts der überlegenen deutschen Lenkballonkonstruktionen, die man freilich durch Schaffung einiger gleichwertiger Einheiten zu erreichen sucht, hat sich hier das Bestreben gezeigt, die Flugzeugkonstruktionen als Waffe gegen jene Lenkschiff-Einheiten auszubauen. Es wurden zahlreiche Versuche gemacht, die bisher ein befriedigendes Resultat nicht ergeben hatten. Jetzt scheint aber das Ziel erreicht zu sein: der „Luft-Destroyer" wird in Kürze herauskommen. Ein französischer Artilleriehauptmann hat in Verbindung mit einem bekannten Flugzeugkonstrukteur eine neue Flugzeugtype entworfen welche schon im Entwurf das lebhafteste Interesse der zuständigen Instanzen erregt hat und von diesen zur Ausführung angenommen worden ist. Es handelt sich um einen immensen metallischen Zweidecker, dessen Vordergestell mit Nickelstahlplatten abgepanzert ist, sodaß Motor, Flieger und Zieloffizier vollständig geschützt sind. Diese Platten haben eine Stärke, die es möglich macht, sich auf weniger als 400 Meter einem Lenkballon und dessen Mitrailleusenfeuer zu nähern. Der Zieloffizier vermag mit seinem Feuer nach oben, nach unten und nach vorn den ganzen Horizont zu bestreichen. Die Vorrichtung hierzu entspricht etwa dem Panzerturm unserer modernen Kriegsschiffe, welcher vom Flieger in Drehung versetzt werden kann. Das Ganze hat ein Gewicht, wie es von Flugzeugen schon bisher getragen worden ist. Die Geschosse, welche dieser „Destroyer" schleudert, enthalten 180 Gramm Melinit, also genug, um einen Lenkballon von den größten jetzt bekannten Dimensionen in Atome zu reißen. Das Flugzeug wird für Infanteriefeuer, selbst aus ganz geringer Höhe, absolut unverletzlich sein Das erste Flugzeug dieser Art wird noch vor den Manövern fertiggestellt sein. Ferner laufen hier Gerüchte um, wonach die brüske Verabschiedung des Generals Hirschauer als Chef des Flugwesens bevorstehen soll Die hierfür angegebenen Gründe sind widersprechend. Bald heißt es, die unzulängliche Stärke des französischen Flugwesens, bald, die schlechte Verwendung der bewilligten Kredite seien die Ursache. Sicher ist, daß eingeweihte Kreise hier der Meinung sind, daß das französische Flugwesen bei weitem nicht das ist, was man nach all den Opfern und nach all den Anstrengungen von ihm erwarten konnte. Es ist wohl nicht Zufall, daß dieser Tage der Oberst Etienne in Lyon im dortigen Cercle Militaire vor Offizieren einen Vortrag hielt, über den ganz eigenartige Meldungen durchsickern. Etienne verwarnte, auf das französische Flugwesen, „wie es heute ist", allzu große Hoffnungen zu setzen. Ein derartiger falscher Enthusiasmus könne Frankreich ebenso verhängnisvoll werden, wie der bekannte Enthusiasmus von 1870 für die Mitrailleusen es gewesen ist. Man müsse sich daran gewöhnen, wie es andere Staaten tun, geräuschlos, ernst und zielbewußt zu arbeiten. Uebrigens hat General Hirschauer soeben die für 1913 giltigen neuen Bestimmungen zur Erlangung des Militär-Fliegerpatents erlassen. Danach zerfallen die erforderlichen Prüfungen in zweierlei Bewerbe: A. Praktische Bewerbe: 1. ein 200 km-Flug im Dreieck auf ein und demselben Apparat, in höchstens 48 Stunden, mit zwei vorher angegebenen obligatorischen Zwischenlandungen. Die kürzeste Seite des Flugdreiecks darf nicht weniger als 20 km betragen 2. ein Flug von mindestens 150 km in gerader Linie, mit vorher angegebener Flugstrecke, ohne Zwischenlandung; 3. ein an einem Tage, mit ein und demselben Apparat auszuführender Flug von mindestens 150 km in gerader Linie, auf vorher anzugebender Strecke, mit einer fakultativen Landung. Im Laufe dieses Bewerbes muß der Flieger mindestens 45 Minuten in einer nahezu konstanten Flughöhe von mindestens 800 Metern sich gehalten haben. Wenn die atmosphären Verhältnisse diese Höhenleistung während der vorbezeichneten Bewerbe unmöglich machen, so kann der verlangte Höhenflug auch gesondert ausgeführt werden. B. Theoretische Bewerbe: 1. Kartenlesen, Grundsätze der barometrischen Drucks, der Temperatur, der Wolken, des Windes, Lesen meteorologischer Karten, Gesetze über den Luftwiderstand ; 2. die Gesetze des Luftwiderstandes auf den Kunstflug angewendet. Konstruktion und Regulierung eines Flugzeugs; 3 Explosionsmotoren, mechanischer Nutzungsgrad, Vergasung, Nebenorgane, Regulierung der Motoren an Bord eines Flugzeugs. 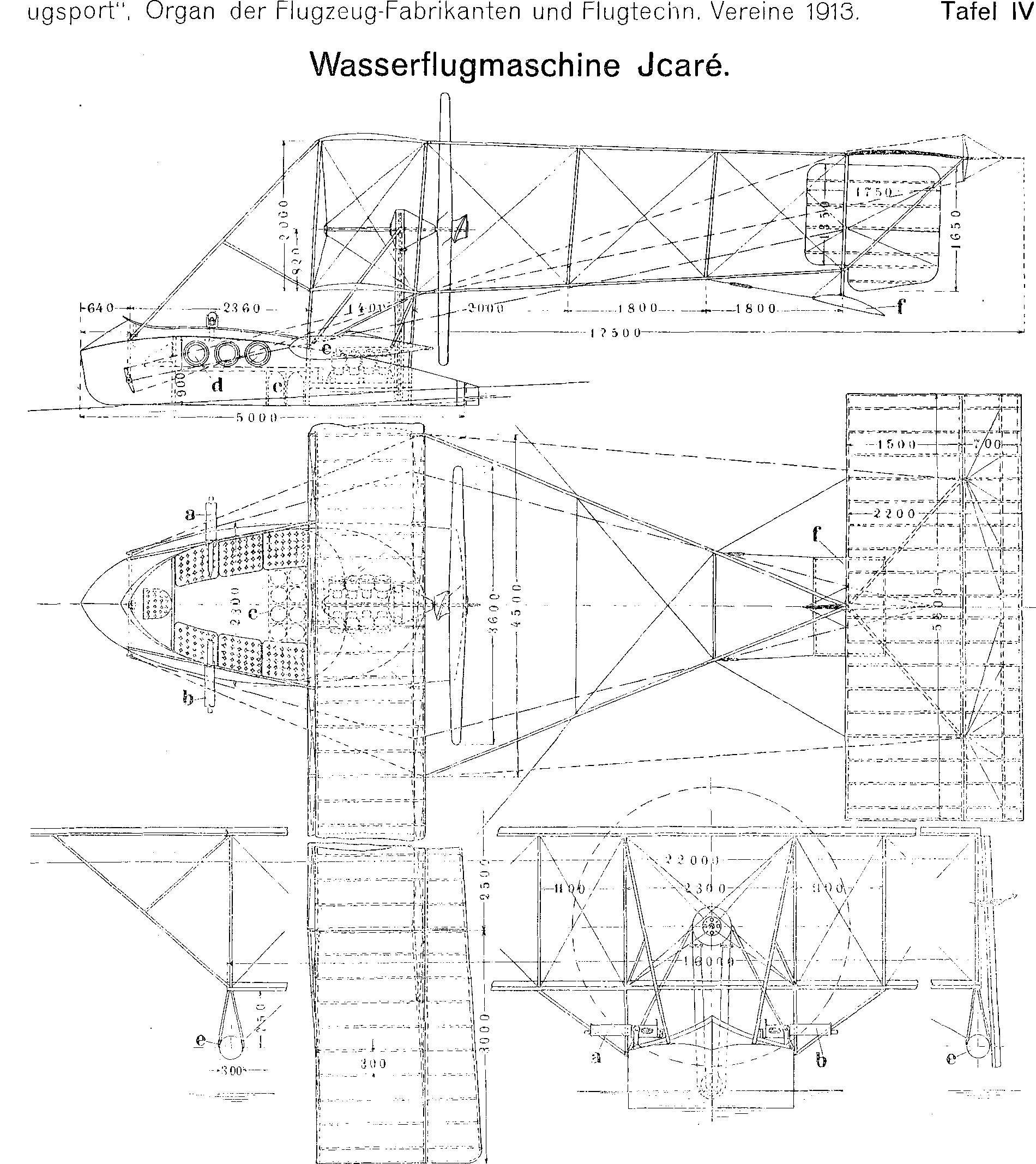 Nachbildung verboten. Schließlich sei noch gemeldet, daß das Comite der „Union für die Sicherheit des Maschinenfluges" nunmehr über jene Summen zu verfügen beschlossen hat, welche bestimmt sind, die besten Erfindungen zu belohnen. Es soll ein erster Preis von 400.000 Francs für die beste Sicherheitsvorrichtung bestimmt werden, die entweder einen Teil des Flugzeugs ausmacht oder von diesem unabhängig sein kann: außerdem sind Prämien von je 20.000 Francs für die nächstbesten Erfindungen bestimmt. Die Jury wird sich aus 15 Mitgliedern zusammensetzen, darunter Vertreter fast aller Ministerien. Die Flugzeuge, auf denen die Vorrichtungen geprüft werden, müssen mit 100 km Geschwindigkeit die Stunde fliegen. Rl. Ein Interview mit dem türkischen Instrukteur für Militär-Fingwesen Adolf Reutzel. „Viel darf ich Ihnen nicht erzählen", sagte mir Adolf Rentzel, der frühere erfolgreiche Otto-Doppeldecker-Flieger, bei seinem kürzlichen Besuch in Johannisthal, „denn die Regierung hat mich dazu verpflichtet." „Gut, dann erzählen Sie mir nur nach Belieben", erwiderte ich dem immer freundlichen Rentzel. „Wo sind denn alle die französischen Flieger geblieben, die in den Balkankrieg gezogen sind?" „Einige von ihnen sind gar nicht an die Front gekommen und verschiedene haben sich einfach „gedrückt" oder das dauernde schlechte Wetter als Ausrede zum Nichtfliegen gebraucht." „Welche Apparate waren denn meistens vertreten?" „Wir verfügten über Bleriot, Nieuport, Harlan und Deperdussin-Eindecker, von denen wir die beiden Harlan-Apparate, damit sie nicht in die Hände des Feindes geraten sollten, kurz vor dem Rückzug mit Petroleum übergössen und dem Feuer preisgaben." „Sind Sie der Ansicht, daß die Flugzeuge für militärische Zwecke gepanzert sein müssen?" „Auf jeden Fall. Die kriegsmäßige Höhe von 1100 m reicht ja vollständig aus, aber in geringeren Höhen ist man zu leicht den Geschossen ausgesetzt. Mein Harlan-Apparat wurde oft von Kugeln durchbohrt, so konnte ich z. B. eine Kugel in 800 Meter Höhe aus der 3 Millimeter gepanzerten Karosserie herausziehen. Die Insassen, die  Adolf Rentzel, der türkische Instrukteur für Militärflugwesen. Seite 96 „FLUGSP ORT". Botriebsstoffbehälter und der Motor müssen gepanzert sein und dafür eignet sich Chromnickelstahlblech von 3 Millimeter sehr gut." „Wie lange bleiben Sie in Deutsehland ?"  Nurey Bey, bekannter tärkisdier Kriegsflieger auf Ble'riot. „Momentan bin ich auf Urlaub und fahre in drei Wochen wieder nach der Türkei, wo es wieder sehr viel zu tun gibt." „Also auf Wiedersehen!" -er Geländebeleuchtung durch Fallschirm-Scheinwerfer bei Nachtflügen. Bei der Bedeutung, welche die Nachtkämpfe bei Heer und Marine erlangt haben, wird es als ein Bedürfnis empfunden werden, auch die Flugmasohine als Aufklärer während des Nachtdienstes verwenden zu können. Der Flugmaschine werden hier ganz neue Aufgaben zufallen. Bei den Nachtkämpfen spielt bekanntlich, um 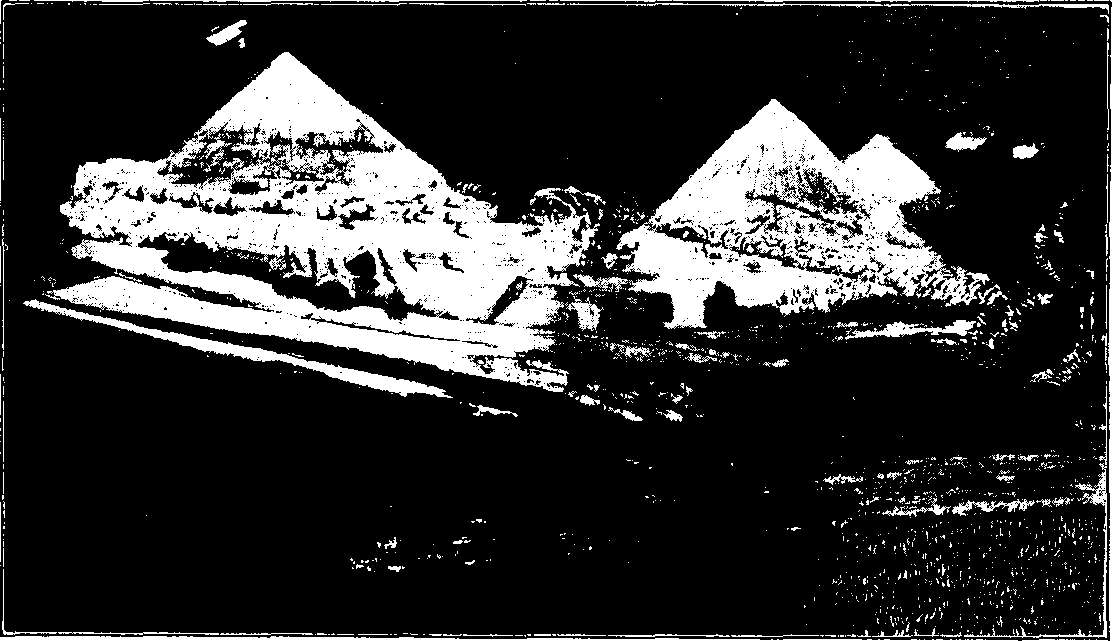 Abb. 1. Geländebeleuchtung durch Fatlsdürmsdieinwerfer aus der Flugmasdüne. Die Flugmasdüne hat die feindlichen Stellungen überflogen. einigermaßen Uebersicht zu haben und gegenseitige Beschieljung der eigenen Trappen zu vermeiden, die, wenn auch nur vorübergehende zur Orientierung erforderliche Beleuchtung des Vorgeländes eine große Rolle. Dieses ist jedoch durch die bereits eingeführten transportablen elektrischen Scheinwerfer nur in gewissen Grenzen möglich.
Abb. 2. Abfeuern der Fallschirmleuchtrakete mittels Pistole. Es ist unmöglich, die hierfür erforderlichen schweren Apparatewagen überall zur Hand zu haben und besonders rechtzeitig zur Front zu bringen. Außerdem haben die Scheinwerfer den Nachteil, daß sie in bewaldetem Terrain nicht verwendet werden können. Ferner wird durch 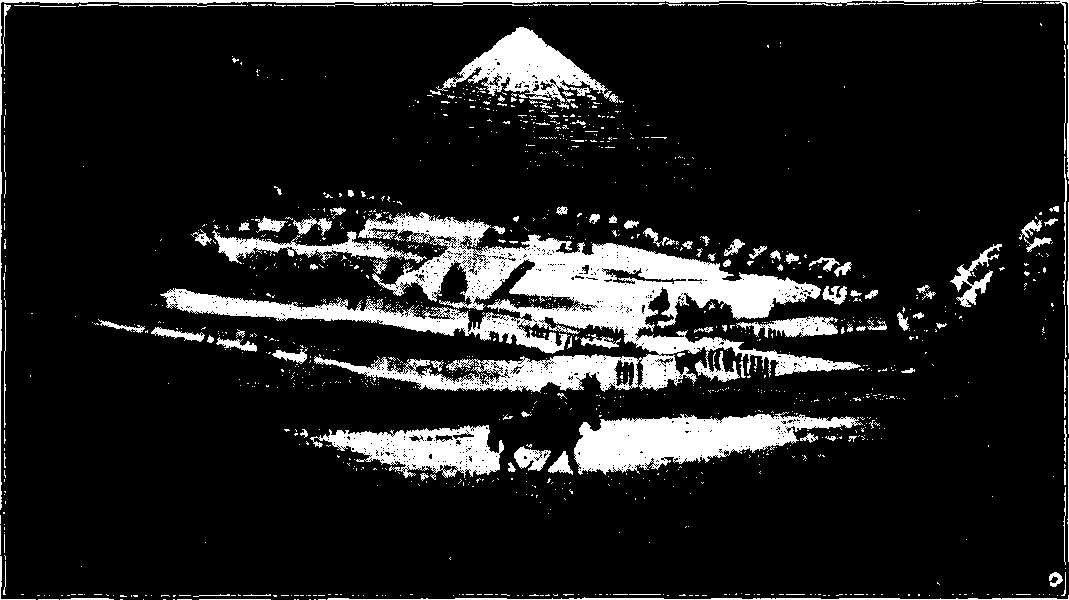 Abb. 3. Die mittels Pistole abgefeuerte Fallsdiirmleachtrakete in Tätigkeit. Hindernisse, Baumgruppen etc. der von vorn kommende Lichtschein abgeblendet, so daß weiter dahinterliegende Objekte, welche gerade gesehen werden sollten, nicht beachtet werden können. Zu vorübergehender Beleuchtung verwendet man bereits die gewöhnlichen mit langen Holzstäben versehenen Raketen, die jedoch verschiedene Nachteile besitzen. Neuerdings ist von der Firma Aloys Müllers Söhne in Konstanz (Baden) neben sogenannten Militär-Fallschirmleuchtraketen ein in der Luft schwebender Fallschirm-Scheinwerfer konstruiert worden, welchen der Flieger aus der Maschine über dem zu beleuchtenden Terrain fallen läßt. Nebenstehende Abbildung 1 zeigt eineFlugmasohine, welche von einem Truppenkörper, der im Bild rechts oben Stellung genommen hat, mit dem Müller'schen Beleuchtungsapparat behufs Rekognoszierung des feindliohen Terrains abgesandt worden ist und bereits wieder im Begriff ist, zu seiner Abteilung zurückzufliegen. Während seines ca. 2 km langen Fluges ließ der Flieger durch jeweiliges Drücken auf einen Kontaktknopf in gewissen Intervallen drei Fallschirm-Scheinwerfer fallen, welche das ganze Terrain derart beleuchteten, daß die auf dem Hügel (rechts im Bilde) Stellung genommene Artillerie günstige Gelegenheit gefunden hatte, den beleuchteten Feind wirksam zu beschießen, ohne daß die betreffenden Batterien dem Feind, in anbetracht der dunklen Stellung, gefährlich werden konnten. Die B.eleuchtungsart hat ferner den großen Vorteil für den Flieger, welcher bei nächtlichen Flügen gezwungen ist, eine Notlandung vorzunehmen, im gleichen Moment schnell einen Fallschirm-Scheinwerfer fallen zu lassen, um das Gelände tageshell zu beleuchten. Die Scheinwerfer haben ferner den Vorteil, daß sie, wie eine Rakete, da das Licht durch den Fallschirm nach unten reflektiert wird, nicht blenden. Die Scheinwerfer haben eine Brenndauer von ca. 40 Sekunden und beleuchten einen Kreis von 500 m Durchmesser so hell, daß man Geschriebenes lesen kann. Ein weiteres Hilfsmittel, um dem in der Nacht umherirrenden Flieger den, Flugplatz zu zeigen, bieten die mittels Pistole abgeschossenen Fallschirm-Leuchtraketen. Die Raketen können an jedem Ort und in jeder Lage von den Schützen abgefeuert werden. (S. Abb. 2 und 3.) Das Gewicht einer Militär-Fallschirm-Leuchtrakete beträgt 160 gr und das der Pistole 1,5 und 2,5 kg. Jedenfalls sollte in Zukunft bei keinem größeren Ueberlandflug dieses Orientierungsmittel unversucht bleiben. Insbesondere sollten dem Ueberlandflieger für den Notfall derartige Raketen mitgegeben werden. Kapok zum Ausfüttern der Schwimmkörper bei Wasserflugzeugen. Die Schwimmkörper bei Wasserflugmaschinen sind beim Wassern unter Umständen sehr großen Beanspruchungen unterworfen. Ebenso können die Schwimmer beim Starten vom Land aus durch springende oder vorstehende Steine verletzt und undicht werden. Es ist selbstverständlich, daß die Schwimmkörper durch Schotten unterteilt werden. Die Schotten müssen so unterteilt sein, daß beim Vollaufen der vorderen oder hinteren Schotten kein Kentern nach vorn oder hinten stattfinden kann. Um ein Kentern durch Vollaufen der vorn oder seitlich gelegenen Schwimmer zu vermeiden, empfiehlt es sich, diese Schotten mit Kapok-Faser, wie sie von den Deutschen Kolonial-Kapok-Werken in Rathenow i. d. Mark geliefert wird, auszufüllen. Diese Kapok-Faser ist außerordentlich leicht. So besitzt z. B. ein Ballen in Umfang und Größe eines ausgewachsenen Mannes ein Gewicht von 12 % kg. Auch kann man bei kleinen Schwimmkörpern ein Reservedeplacement durch Ausfütterung des Führersitzes anordnen. Die hierdurch entstehende vorzügliche Polsterung hat noch den Vorteil, daß sie bei etwaigen Abstürzen den Flieger vor Verletzungen schützt. Durch Verwendung von Kapok im Flugzeugbau ist dem Kapok, ein Produkt unserer deutschen Kolonien, eine große neue Verwendungsmöglichkeit in Aussicht gestellt. Die außerordentliche Konferenz der Internationalen Aeronautischen Föderation. (Von unserem Pariser Korrespondenten.) Die außerordentliche Tagung, zu welcher die Internationale Aeronautische Föderation die ihr zugehörigen Vereinigungen nach Paris zusammenberufen hatte, hat am Mittwoch und Donnerstag voriger Woche zu Paris in den Räumen des Aero-Club de France stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit waren vertreten : Deutschland durch die Herren Chatel, de la Croix und Kober; Oesterreich durch Baron Economo; Ungarn durch die Herren Wilhelm von Hevesy, Ernst von Massany; Italien durch die Herren Professor Carlo Montu, Cavaliere Dott, Luigi Mina, Arturo Carina, Cavaliere Pesci, Ingenieur August Vogel, Marchese Camillo Soragna, Ingenieur Roberto Prato Previde, Ingenieur Carlo Bonini; Belgien durch die Herren Fernand Jacobs, Graf de la Hault, Major Mercier, L. de Brouckere, Graf Robiano, Baron van Zuylen, Demoor; Dänemark durch Leutnant P. Ramm: Aegypten durch Graf Castilon de Saint Victor; Spanien durch X Vereinigte Staaten durch Campel Wood, Weymann; Frankreich durch Leon Barthou, Bleriot. Ed. Chaix, Henri Deutsch de la Meurthe, Dr. Grouzon. Emile Dubonnet, Major Ferrus, Rene Gasnier, Henri Kapferer, Graf de la Valette, Graf de la Vaulx, Alfred Leblanc, Barbotte Mallet, Rene Quinton, Paul Rousseau, Andre Scheicher, R. Soreau, Edouard Surcouf, Paul Tissandier, Graf de Vogue, Ernest Zens; Grosbritannien durch Roger W. Wallace, Griffith, Brewer, Harold, Perris; Niederlande durch Jonkheer van den Berch, van Heem-stede; Rußland durch Kawraiski; Argentinien durch Graf Castillon de Saint Victor; Schweden durch Kapitän Amundsen; die Schweiz durch Oberst Audeoud. Die Kommission zur Feststellung des Reglements für den diesjährigen Gordon Bennett-Pokal setzt sich zusammen aus folgenden Herren: Deutschland: Chatel; Oesterreich: Baron Economo; Belgien: Baron van Zuylen ; Dänemark: Leutnant Ramm; Vereinigte Staaten: Weymann; Frankreich: Soreau; Italien: Prof. Carlo Montu; Niederlande: Jonkheer van den Berch; Rußland: Kawraiski; Schweden: Kapitän Amundsen; Schweiz: Oberst Audeoud. Wie bereits gemeldet, war die Tagesordnung dieser Konferenz eine inhaltlich bedeutende und man sah deshalb dem Verlauf der Verhandlungen und den zu fassenden Beschlüssen in den in Betracht kommenden Kreisen mit lebhaftem Interesse entgegen. Es handelte sich dabei um die Aufgabe, all jene Fragen endgiltig zu lösen, welche gelegentlich des letzten Kongresses von Wien unerledigt geblieben waren und die Vollversammlung vorzubereiten, die im Juli dieses Jahres zu Haag abgehalten werden wird. Juan hatte sich deshalb entschieden, die Verhandlungen auf zwei Tage zu verteilen und die oben angeführte Unterkoinmission mit der Beratung und Ausarbeitung der reglementarischen Bestimmungen für den Gordon Bennett-Pokal zu betrauen. Als erste Frage kam auf die Tagesordnung die Reklamation von Eugene Renaux (vom Aero-Club de France vor dem Kongreß gebracht) gegen das Klassement im Wasserflugmaschinen-Meeting von Tamise. Die Gründe, mit denen dieses Klassement angefochten wird, sind zahlreiche; sie stützen sich namentlich darauf, daß das Bewerbsreglement in einer für Renaux nachteiligen Weise ausgelegt worden sei. Edouard Surcouf vertrat den Standpunkt der Reklamation, während ein belgischer Rechtsbeistand des Aero-Club von Belgien dessen Maßnahmen als rechtsgiltig verteidigte. Die Diskussion über diese Frage war eine außerordentlich animierte und zeitweilig heftige; sie währte länger als drei Stunden. Schließlich erklärte der Kongreß in seiner Mehrheit die Reklamation Renaux's als berechtigt und infolge dieser Entscheidung wird nunmehr ein neues Klassement für das inredestehende Meeting, sowie eine Neuverteilung der Preise („Pokal des Königs der Belgier", „Pokal des Ministers der Kolonien" u. s. w.) zu erfolgen haben. Das wird durch das Bureau der Internationalen Föderation geschehen. Zweiter Gegenstand der Tagesordnung war der Antrag auf Schaffung eines Spezial-Führerzeugnisses für Wasserflugmaschinen. Auch diese Frage entfesselte eine lebhafte Aussprache, denn ein Teil der Kongreßmitglieder waren gegen diese Neueinrichtung, indem sie erklärten, daß ein einziges Flugführerzeugnis, wie es gegenwärtig existierte, für beide Gattungen von Flugzeugen völlig ausreiche, vorausgesetzt natürlich, daß der Prüfungsbewerb auf beiden Gattungen von Flugzeugen, zu Lande und zu Wasser, vor sich gehe. Diese Ansicht blieb in der Minorität und es wurde folgender Beschluß gefaßt: „Diejenige Sportinstanz, welche in jedem der Internationalen Aeronautischen Föderation zugehörigen Lande das Flugwesen zu regeln hat, ist allein berechtigt, das Wasserflugzeug-Führerzeugnis zu erteilen an solche Bewerber, welche mindestens 18 Jahre alt sind und dieser Sportinstanz unterstehen, also 1. an die eigenen Staatsangehörigen; 2. an solche Ausländer, welche einem Staat zugehören, der nicht an die Internationale Föderation angeschlossen ist; 3. an Ausländer, die einem Lande zugehören, welches in der Internationalen Föderation vertreten ist. Aber in diesem letzteren Falle kann das Zeugnis nur mit Genehmigung der Sportinstanz des Heimatlandes des Bewerbers erteilt werden. Die Bewerber haben folgende drei Prüfungen abzulegen: a) Zwei Distanzbewerbe, deren jeder darin besteht, ohne Kontakt mit dem Wasser zu nehmen, eine geschlossene Rundstrecke zurückzulegen, welche eine Mindestlänge von 5 km aufweist (wie nachstehend angegeben zu messen); b) Einen Höhenbewerb, wobei der Bewerber eine Flughöhe von wenigstens 50 Meter über dem Wasser zu erreichen hat; c) Der unter b) angeführte Höhenbewerb kann mit einem der beiden unter a) angeführten Bewerbe verschmolzen werden. „Die Bahn, auf welcher der Bewerber die beiden Rundstrecken zurückzulegen hat, wird durch zwei Bojen markiert, welche nicht weiter als 500 Meter von einander entfernt sein dürfen. Nach jeder Wendung um eine dieser Bojen hat der Bewerber auf die andere Seite hinüberzuhalten, um dann um die andere Boje zu wenden. Der Rundflug besteht demnach aus einer ununterbrochenen Reihe von Achten. Als für den Flug zu zählende Distanz kommt die Entfernung zwischen den beiden Bojen in Berechnung. Bei jedem der Bewerbe muß Abflug, Landung und definitives Niederlassen auf dem Wasser zwischen den beiden Bojen erfolgen. Das Niederlassen auf dem Wasser muß in durchaus normaler Weise erfolgen und die Kommissare werden in ihrem Berichte anzugeben haben, unter welchen Bedingungen das geschehen ist. Die verantwortlichen Kommissare müssen auf einerListe, welche dieSportinstanz jedesLandesaufstellt,gewählt werden". Die Sitzung des zweiten Tages war zunächst dem von Jacques Schneider gestifteten „Pokal des Marine-Flugwesens" gewidmet, dessen Reglement einstimmig zur Annahm3 gelangte. Darnach Ubernimmt die Internationale Föderation den Pokal, einen Wertgegenstand im Werte von 25.000 Francs, um ihn als Her-ausforderungs-Preis zwischen den einzelnen Klubs bestreiten zu lassen, und zwar für Flugzeuge aller Gattungen. Der Pokal wird in einem Geschwindigkeitsbewerb ausgefochten werden, dessen vorher festgesetzte Flugstrecke entweder in gerader oder in geb'ochener Linie oder in geschlossenem Kreise bestimmt werden wird. Die Länge der Flugstrecke wird mindestens 150 Seemeilen, also 277.800 km, betragen müssen. Jeder der Föderation angehörige Klub hat das Recht, denjenigen Klub, welcher jeweilig die Trophäe besitzt, herauszufordern und ihm den Pokal streitig zu machen. Dagegen hat sich jeder Klub zu verpflichten, im Falle, daß ihm die Trophäe zufällt, für die Organisation des nächsten Bewerbs Sorge zu tragen. Derjenige Klub, welcher einem anderen die Trophäe streitig machen will, hat dies vor dem 1. März in eingeschriebenem Briefe dem Klub mitzuteilen, unter Angabe der Anzahl von Mitgliedern, die sich an dem Bewerb beteiligen werden, Diese Mitteilung gilt als Verpflichtung, und es müssen ihr für jeden angemeldeten Bewerber 500 Francs als Nennungsgeld beigefügt werden. Von dieser Summe werden nach Beendigung des Bewerbs so viel mal 500 Francs zurückerstattet, als Bewerber gestartet sind. Jeder Klub kann in jedem Jahre höchstens 3 Bewerber anmelden, für jeden Bewerber kann ein Ersatzmann bezeichnet werden. Die Bewerbe können alljährlich zwischen dem 1. April und 15. November stattfinden, und zwar im Lande desjenigen Klubs, welcher zur Zeit jm Besitze der Trophäe ist. Die Sportinstanz des organisierenden Landes hat den Bewerb zu homologieren. Die von den Aero-Klubs von Frankreich und Italien angeregte Schaffung einer aeronautischen Grenzkarte wird von der Konferenz beifäll g aufgenommen und wird in der nächsten statutarischen Versammlung der Föderation weiter verfolgt werden. Auch der letzte Gegenstand der Konferenz, bei dem es sich um den diesjährigen Gordon BennettPokal handelte, rief eine lange und eingehende Diskussion hervor. Die Kommission gab der Ansicht Ausdruck, daß es bei dem gegenwärtigen Stande der aeronautischen Konstruktion unmöglich sei, eine Mindestgeschwindigkeit zu bestimmen, welche für ein Kriterium der Geschwindigkeit genügen könne. Dieser Ansicht trat die Konferenz einstimmig bei und dem-gemätt wird das Reglement, wie es für den Gordon-Bennett dieses Jahres ausgearbeitet ist, wie folgt angenommen: Der Gordon_ Bennett-Pokui 1913 wird über eine Distanz von 200 km auf einer geschlossenen Rundstrecke von wenigstens 5 km ausgetragen werden. Zwischenlandungen sind gestattet. Gewinner des Bewerbs wird derjenige Konkurrent sein, der die 200 km in reglenientsmäßigem Fluge in der kürzesten Zeit vollbracht haben wird; eine Minimalflugzeit wird nicht festgesetzt. Der Start wird innerhalb eines Zeitraums von sieben Stunden zugelassen werden, also bis l'/s Stunden vor Sonnenuntergang. Am Vortage des Bewerbs werden demnach die Kommissare, je nach der Anzahl der Bewerber, bestimmen, zu welcher Stunde der erste Start zu erfolgen hat und in welchen Zeitabständen die Abflüge vor sich gehen müssen. Beim Abflug werden sich immer je ein Bewerber jeder Nation, in einer durch das Loos gegebenen Reihenfolge, ablösen, doch wird der Vertreter einer Nation das Recht haben, seinen Abflug an einen erst in der zweiten oder dritten Serie an die Reihe kommenden anderen Vertreter seines Landes abzutreten bezw. mit ihm zu tauschen. Wenn ein Abflug von den Kommissaren gegeben ist, so wird als Startzeitpunkt der Moment gelten, wo der Bewerber in vollem Fluge die Startlinie passieren wird. Wenn es ihm aber innerhalb zehn Minuten von dem Augenblick, wo er den Start bekommen hat, nicht gelingt, diese Startlinie in vollem Fluge zu passieren, so gilt sein Start als erfolgt, und zwar zu dem Augenblick, wo ihm das Startzeichen gegeben worden ist, zuzüglich jener zehn Minuten. Dieses Reglement fand einstimmige Annahme der Konferenz. Auf Veranlassung der Kommission für das Gordon Bennett-Rennen wurde dann noch folgender Antrag angenommen: „Es wird beantragt, daß auf die Tagesordnung der statutenmäßigen Vollversammlung von 1913 eine Aussprache gesetzt werde über die Bedingungen, unter denen es vom Gesichtspunkte der Sicherheit der Flugteilnehmer wiinchenswert wäre, daß in Zukunft der Gordon Bennett-PoUal der Aviation zum Austrag gelangen soll." Die Konferenz nahm hierauf bezüglich folgenden Antrag an: „Jeder Klub wird ersucht, die in vorstehender Anregung aufgeworfene Frage zu studieren und einen Bericht abzufassen, welcher vor dem 1. April an das Sekretariat der Internationalen Aeronautischen Föderation einzusenden ist, und der dann sämtlichen anderen Ländern mitgeteilt wird. Jeder Klub wird einen Delegierten in die Kommission bestimmen, welcher den Rapport vor der Vollversammlung der Internationalen Föderation zu vertreten haben wird. Diese Kommission wird im Monat Mai zu Brüssel zusammenkommen." Hiermit ist die Tagesordnung der Konferenz erschöpft, die demgemäß durch den Prinzen Roland Bonaparte geschlossen wird. Am Abend hatte ein vom Aero-Cluh de France im Carlton Hotel veranstaltetes Bankett die Teilnehmer am Kongreß noch einmal vereinigt; auch dieser letzte inoffizielle Akt nahm einen allgemein befriedigenden Verlauf, und man trennte sich mit dem Wunsche des Wiedersehens im Haag. Rl. Bedingungen des Reichsmarineamtes für den Ban von Wasserfingmaschinen. Unbedingt wird gefordert: eine Tragfähigkeit, die dem Flieger die Mitnahme eines Passagiers gestattet (Gesamtgewicht beider Insassen 180 kg), außerdem der erforderlichen Ausrüstung und Betriebsstoffe für mindestens 4 Stunden ; eine Geschwindigkeit von 100 km in der Stunde. In bezug auf die Seefähigkeit wird gefordert: Das Flugzeug muß mit der vorgeschriebenen Belastung imstande sein : 1. bei einem Seegang, der der Wirkung von mindestens 7 s/m Wind in offener See entspricht, niederzugehen, eine Munde mit abgestelltem Motor sicher zu liegen und wieder hochzugehen, 2. bei Windstille vom Wasser aufzusteigen. In bezug auf Betriebssicherheit wird verlangt, daß das Flugzeug einen Dauerflug von 3 Stunden ohne Störung am Motor machen muß. Es müssen 2 Sitze vorhanden sein: von beiden muß freier Ausblick auch direkt nach unten sein, von beiden muß die Steuerung betätigt werden können. Die Steuerung soll den von der Armee aufgestellten Forderungen entsprechen. Der Motor muß von dem Führer oder Passagier angeworfen werden können. Motor und Führersitz müssen gegen Spritzwasser geschützt sein. Für Vermeidung von Kurzschluß durch Feuchtigkeit ist zu sorgen. Die Magnetapparate sind spritzwasserdicht zu kapseln. Der Propeller muß durch Anordnung oder Apparatteile vor dem Eintauchen in das Wasser geschützt und gegen Beschädigung durch die See sicher sein. Es müssen Vorrichtungen zum Heißen des Flugzeuges an Bord von Schiffen vorhanden sein. Zwei seitliche Propeller sind unerwünscht. Aluminiumlegierungen für bewegliche Teile sind verboten. An der Ausrüstung wird gefordert: ein Tachometer, ein Kompaß, ein Kartenkasten, ein Treibanker und Grundanker von ca. 7 kg Gewicht mit 30 m Leine und 2 Schwimmwesten. Ferner müssen ein Winkelmeßinstrument, ein Doppelglas, sowie etwas Proviant und Wasser untergebracht werden können. Erwünscht ist: eine Steigerung der Tragfähigkeit, Geschwindigkeit, Seefähigkeit und Betriebssicherheit über die obengenannten Zahlen hinaus, besonders Erreichung einer Seefähigkeit bei stärkerem Winde als dem angegebenen; möglichst hohe Steiggeschwindigkeit; möglichst kurzer Anlauf auf Wasser und Land; Vermeiden des Eintauchens der Flügelenden beim Liegen auf See; möglichst feste Bauart; möglichst große Unempfindlichkeit der verwendeten Baustoffe und ihrer Verbindungen (Leimstellen) gegen Seewasser. In konstruktiver Hinsicht wird gewünscht: möglichst geringe Spannweite. Ferner: leichte Demontierbarkeit, namentlich der über den Mittelteil vorstehenden Tragflächen, oder eine vom Flugzeug selbst aus zu betätigende Klappbarkeit der Tragflächen nach hinten; wasserdichte Unterteilung der Schwimmer (oder wasserdichte Einsätze) und möglichst hohes Reservedeplacement unter Fürsorge für Erhaltung der seitlichen Schwimmstabilität in leckem Zustand; die Möglichkeit, auch in See, von den Sitzen zum Propeller, zum Motor und zum Schwimmkörper zu gelangen, ohne die Schwimmstabilität zu gefährden; die Möglickeit, bei einem Umschlagen des Apparates beide Sitze leicht zu verlassen; Beschränkungen der Drahtverspannungen soweit als möglich; gute Verständigkeitsmöglichkeit zwischen Flieger und Passagier; Möglichkeit des Festmachens an einer Boje; ein klappbares Radgestell zur Ermöglichung einer Notlandung auf festem Boden. Ueber die Verwendung der Nationalflugspende. Am 25. Januar hielt das Kuratorium eine Sitzung ab, in welcher zunächst die Ausbildung der Flieger besprochen wurde. Es ergab sich nach eingehenderAussprache die Unmöglichkeit, die Ausbildung von Fliegern seitens des Kuratoriums der National-Flugspende selbst in die Hand zu nehmen. Die Anforderungen an den Flugzeugführer sind sowohl hinsichtlich seiner technischen Ausbildung als auch insbesondere bezüglich seiner persönlichen Eigenschaften so mannigfaltige und große, daß sich ein sicherer Maßstab für die Geeignetheit der sich meldenden Personen nicht aufstellen läßt. Die Auswahl durch die National-Flugspende würde daher die Gefahr begründen, daß ungeeignete Persönlichkeiten ausgebildet würden, die während der Ausbildungszeit wieder ausgeschieden werden müßten. Dazu würden bei einer durch die National-Flug-spende selbst bewirkten Fliegerausbildung eine Reihe anderer Schwierigkeiten treten, so z. B. die Unmöglichkeit der Berücksichtigung der bereits vorhandenen Flugzeugführer, der Wegfall eines auf die Gesamtheit der vorhandenen und der noch auszubildenden Flieger wirkenden Anreizes u. a. m. Aus diesen Erwägungen ergab sich, daß das für Zuwendungen aus der National-Flugspende entscheidende Moment der Nachweis einer Leistung sein müsse und daß dieser Grundsatz auch auf die Ausbildung von Fliegern unbedingt anzuwenden sei. Die Zuwendung des für die Ausbildung aufzuwendenden Durchschnittsatzes in Höhe bis zu rund 8000 Mark soll daher erst erfolgen, wenn die Ausbildung beendet und der ausgebildete Flieger oder die ihn ausbildende Fabrik den Nachweis erbringt, daß der Flieger den an ihn zu stellenden Anforderungen, die im wesentlichen den Anforderungen des Feldpiloten-Examens in praktischer und theoretischer Hinsicht entsprechen sollen, gewachsen ist. Der Kreis der Fabriken, denen die Ausbildung von Fliegern ' für die National-Flugspende überlassen werden kann, wird nicht auf die für die Militär-und Marine-Verwaltung liefernden Fabriken beschränkt, sondern durch eine besondere Zulassung auf Grund allgemeiner Normativ-Bestimmungen festgesetzt werden. Für die Ausbildung soll ein ins einzelne auszuarbeitender Plan zugrunde gelegt werden, dessen Befolgung durch eingehendePrüfung des ausgebildeten Fliegers sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht festgestellt wird? Erst nach Bestehen der Prüfung werden die Ausbildungskosten in der vorerwähnten Höhe und zwar unter Wahrung der Interessen der ausbildenden Fabriken und der Flieger erstattet werden. Dabei wird auf eine umfassende Mitarbeit der Vereine bezüglich der Abhaltung der Prüfung gerechnet. Bei sachgemäßer Organisation und entsprechender Normierung der allgemeinen Bedingungen wird die Verauslagung der für die Ausbildung erforderlichen Mittel nicht auf Schwierigkeiten stoßen. In konsequenter Durchführung des Grundgedankens, daß einer Zuwendung aus der National-Flugspende eine positive Leistung gegenüberstehen muß, soll das Prämiensystem ferner derart erweitert werden, daß unter noch festzulegenden Bedingungen eine bestimmte Grundprämie von etwa 1000 Mark durch Ableistung eines Einstundenfluges erflogen werden kann. Diese Prämie wird ferner bei einem Dauerfluge für jede vollendete weitere Stunde um etwa 1000 Mark erhöht. Für die höchste Gesamtstundenleistung eines Jahres wird außerdem ein besonderer Preis sowohl für den Flieger als auch für das Fabrikat vorgesehen. Die Prämie für den Einstundenflug wird im Jahre 1913 naturgemäß nur den schon vorhandenen Fliegern, in den nächsten Jahren jedoch auch denen zugute kommen, die inzwischen auf Grund der Ausbildungsprämie ihr Feldpilotenexamen bestanden haben. , Die Durchführung dieses auf einen großen allgemeinen Impuls berechneten Systems macht eine baldige Lösung der Versicherungsfrage wünschenswert Zur Sicherung der Flieger und Erhöhung ihrer Leistungen müssen ferner nach einheitlichem Plan über das ganze Reich verteilte Flugstützpunkte angelegt werden. An ihrer Errichtung wird sich die National-Flugspende nach Möglichkeit mit Zuschüssen beteiligen, doch muß bei der Beschränktheit der zur Verfügung stehenden Mittel die Aufbringung der Kosten für Flugstützpunkte in der Hauptsache den in Betracht kommenden Städten überlassen bleiben. Das in Vorschlag gebrachte System der Gewährung von Prämien für die Ausbildung von Fliegern in Höhe der Ausbildungskosten sowie der Prämienflüge hat den vorteil, daß dadurch die National-Flugspende mittelbar den aviatischen Unternehmungen, insbesondere der Industrie, und den Flugplätzen zugute kommt. Den Flugzeugfabriken wird es ermöglicht, Flugschüler zu erhalten, da die Höhe der Prämien nicht nur die aufgewendeten Kosten einschließlich des Risikos für ungeeignete Flugschüler decken, sondern auch noch einen ansehnlichen Verdienst ermöglichen wird. Die Stunden-Flug-Prämien aber werden es den Flugplatz-Verwaltungen rein industrieller wie allgemeiner Art ermöglichen, die voraussichtlich häufigen Bewerbungen um derartige Preise der National-Flugspende zu Veranstaltungen auszugestalten, und dadurch das dauernde Interesse der Vereine und des Publikums an ihrem Flugplatze und am Flugwesen im allgemeinen zu No. 3 erhöhen. Dagegen'können Bnrgeldunlerstützungen weder in der Form von Darlehen noch in der von reinen Geschenken oder von Beteiligung gemacht werden. Es würden derartige Maßnahmen stets zu Ungerechtigkeiten führen. Eine Unterstützung schwacher, nicht lebensfähiger Unternehmungen mit Mitteln der Allgemeinheit würde die schließlich doch notwendig werdende Liquidation nur hinausschieben, eine Unterstützung in sich lebensfähiger Unternehmen aber würde deren Wettbewerb zum Nachteil derer erleichtern ,die keine Unterstützung erhalten. Deshalb soll auch hier von den allgemein auch bei staatlicher Industrieförderung geltenden Grundsatz nicht abgewichen werden, die Industrie niemals durch unmittelbare Subvention zu kräftigen, sondern nur dadurch, daß man ihr die Lebensbedingungen erleichtert. Eine solche Erleichterung der Arbeitbedingung wird sich jedoch im Rahmen der vom Kuratorium festgelegten Grundsätze dadurch ermöglichen lassen, daß — zunächst versuchsweise — eine Zentralstelle für die Nachprüfung neuer Erfindungen auf ihre praktische Brauchbarkeit geschaffen wird. Das Kuratorium der National-Flugspende wird demgemäß jede Erfindung, um deren Förderung sie ersucht wird, durch anerkannte Sachverständige unter dankenswerter Mitarbeit der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Flugtechnik daraufhin prüfen lassen, ob sie bei dem gegenwärtigen Stande der Technik durchführbar ist und einen Fortschritt auf dem Gebiete der Flugtechnik erhoffen läßt. Bei günstigem Ausfall dieser Prüfung wird der Verwaltungsausschuß im einzelnen Falle beschließen, wie die praktische Erprobung zu ermöglichen sein wird. Der vorstehende Arbeitsplan ist vom Verwaltungsausschuß grundsätzlich genehmigt und festgesetzt worden. Sämtliche Beschlüsse wurden einstimmig gefaßt. Die Mittel der Nationalfugspende sollen in den nächsten 3—5 Jahren zur Verwendung gelangen.  Flugtechnische Z?®^* Rundschau. Inland. Mug/ührer-Zeugnisse haben erhalten: No. 346. König, Martin. Mechaniker, Johannisthal, geb. am 6. November 1887 zu Untermenzing bei München, für Eindecker (eigene Konstruktion), Flugplatz Johannisthal, am 7. Januar 1913. No. 347. Köhler, Erich, Breslau, geb. am 30. Januar 1893 zu Breslau, für Eindecker (Rumpier), Flugplatz Gandau bei Breslau, am 10. Januar 1913. Von den Flugplätzen. Vom Flugplatz Habsheim. Einen neuen Weltrekord im Dauerflug mit drei Fluggästen stellte der Flieger Faller auf 100 PS Aviatik-Argus-Doppeldecker am Nachmittag des 30. Januar in Habsheim auf, indem er mit drei Fluggästen 2 Stunden und 3 Minuten in der Luft blieb und in großen Bogen den Flugplatz umkreiste. Das Gesamtgewicht der 3 Fluggäste und des Fliegers betrug 285 Kilogramm, Betriebsstoff nicht eingerechnet. Fall er hat damit den seit 25. Januar 1912 stehenden Weltrekord von Dipl.-Ing. Grulich (Harlan-Eindecker) geschlagen, der 1 Stunde 35 Minuten betrug. Flieger Hild ist am 27. Januar auf dem Aachener Flugplatz auf einem Eindecker von Professor Reißner, dem bekannten Enten-Eindecker, tödlich ab- gestürzt. Nach Ausführungen eines Augenzeugen gestaltete sich der Unfall folgendermaßen: Hild startete vom Schuppen an bergan mit leichtem Rückenwind. Quer zur Stadtrichtung läuft auf 600 Meter Entfernung eine Telegraphenleitung. Hild hat nun versucht, erst langsam, dann, als die Telegraphenleitung näher kam, plötzlich hochzugehen, dabei hat er die Maschine übersteuert. Der Eindecker schwankte kurz und kam erst mit der rechten Flügelspitze, dann mit dem Entenschnabel auf den Boden. Der vordere Rumpf wurde dabei sehr mitgenommen und nun senkte sich der Eindecker, dessen Motor sich ja hinten befindet, nach rückwärts. Dabei ist Hild herausgestürzt und ist zuerst mit dem Kopf aufgeschlagen. Hild hatte noch vorher Sturzhelm sowie Befestigung mit einem elastischen Band abgelehnt. Durch kurze Sprünge, die Hild an den vorhergehenden Tagen gemacht hatte, war festgestellt, daß die Verspannung richtig war, auch war der Motor bestens in Ordnung. Nach meiner Ansicht hätte Hild, als er merkte, er kommt mit der Maschine beim Start bergan und noch dazu mit Rückenwind nicht recht hoch, noch landen können. Der Apparat lag etwa 30 Meter vor der erwähnten Telegraphenleitung. Eindecker von Dr. Huth. Der vollständig aus Stahl hergestellte Eindecker ist unseren Lesern von der „Ala" bekannt. Mit diesem Apparat wurden vor einiger Zeit in Breslau die ersten Flugversuche gemacht.  Einde&er von Dr. Huth. Vom QoedecTcer-Flugplatz. Anläßlich des Geburtstages Seiner Majestät startete der Flieger de Waal auf einem Goedecker-Eindecker zu einem Flug über Mainz und Umgegend. Er überflog Mainz in etwa 700 m Höhe und kehrte nach 30 Minuten Flugdauer wieder nach dem großen Sand zurück. Kurz darauf unternahm der Goedeckerflieger Trautwein einen schönen Flug Uber die in Mainz stattfindende Parade. Er umkreiste den Mainzer Dom und die Christuskirche, flog dann den Rhein entlang nach Biebrich, Schierstein, Niederwalluf und kehrte Uber Budenheim nach dem Flugplatz zurück. Die Flugdauer betrug etwa 40 Minuten. Am Nachmittag des gleichen Tages legte Reinhard Schroeder aus Freiburg i. B, seine Fliegerprüfung vor der Sportkommission in bester Weise ab. Ferner erfüllte am 1. Februar der stud. phil. Willy Roth die Prüfung zur Erlangung des Fliegerzeugnisses in guter Form auf Goedecker-Eindecker. Vom Flugplatz der Kondor- Werke. In den Tagen vom 29. Januar bis zum 1. Februar führte der Flieger Suwelack an jedem Tage, wo das Wetter einigermaßen günstig war, auf seinen Kondor-Apparaten Flüge von längerer Dauer aus. Er überflog die Nachbarstädte mehrere mal in beträchtlicher Höhe. Besonders bemerkenswert sind die Flüge, die er am 27. Januar ausführte. Er flog die engsten Kurven von 120 Durchmesser; dabei ließ er das Steuer los und streckte die Arme hoch in die Luft. Mit Begeisterung sah das zahlreiche Publikum diesen Flügen zu. Am 26. Januar hatten die Kondor-Werke die hohe Ehre, Seine Excellenz Herrn Krupp von Bohlen und Halbach nebst Gemahlin bei sich begrüßen zu 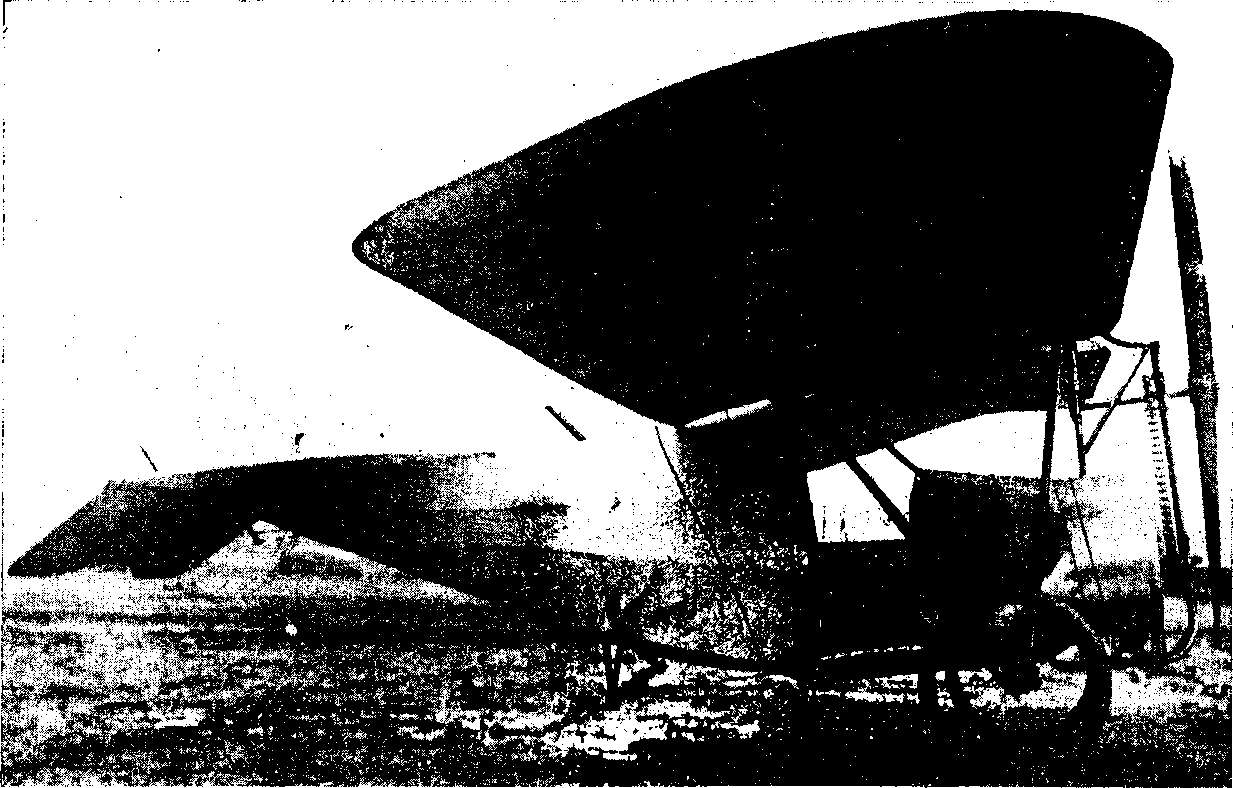 Eindecker ton Lt. Lelievre. können. Die Herrschaften sahen den Flügen von Suwelack interessiert zu und besichtigten darauf die Kondor-Werke. Wie bereits berichtet, überflog Suwelack am 3. Januar zum ersten Male das Häusermeer von Essen. Aus dieser Veranlassung ließ ihm die Stadt Essen am 30. Januar eine besondere Ehrung zuteil werden, indem sie ihm durch die Verwaltung einen silbernen Ehrenbecher überreichen ließ. Im Anfang der nächsten Woche wird Suwelack der Aufforderung der Militärbehörde nachkommen und seinen Apparat in Döberitz vorfliegen. Flugplatz München-Oberwiesenfeld. Am 27. Januar, dem Geburtstag des Kaisers, führte Ingenieur Dick auf einem Deutschland-Doppeldecker einen Flug über München aus, und umkreiste in einer Höhe von etwa 800 m mehreremale die preußische Gesandtschaft. Nach einem Fluge von 35 Minuten Dauer landete er wieder glatt vor dem Schuppen in Milbertshofen. In der letzten Woche lieferten die Flugmaschinenwerke Gustav Otto wieder zwei Maschinen an die bayrische Militärverwaltung ab. Baierlein flog mit Fluggast mit jeder der beiden Maschinen über eine Stunde in einer durchschnittlichen Höhe von 500 m und landete dann in tadellosem Gleitfluge. Die Maschinen erreichten 650 m in 5 Min, 15 Sek., bezw. 850 m in 7 Min. 10 Sek.; bewiesen also die außerordentliche Steigfähigkeit von 100 m in 50 Sekunden. Die Abnahmebedingungen sind somit glänzend erfüllt worden. Militärflugzeugübung bei Magdeburg. Am Dienstag den 21. Januar ging bei einem Startversuch der vom Leutnant Kellner geführte Apparat fast vollständig in Trümmer. Am Nachmittag desselben Tages führte Eindecker A. 28 mehrere tadellose Flüge um den „Anger" aus und verließ dann, nachdem er nochmals gelandet war, in südöstlicher Richtung Magdeburg. Zu derselben Zeit standen auch noch A. 11 und A. 59 startbereit, flogen aber wegen des anhaltenden Regen- und Schneewetters nicht ab. Leider wurden auch hier wieder einige Opfer gefordert, denn am Donnerstag den 23. Jan. morgens rutschte zwischen Burg bei Magdeburg und den Schulzeschen Flugplatz Madel der vom Leutnant von Scheele geführte Mars-Doppeldecker B. 78 in einer Linkskurve ab. Leutn. Alexander von Scheele, Pilotenzeugnis 169 am 14. März 1912 auf Albatros, wurde schwerverletzt in besinnungslosem Zustande ins Lazarett eingeliefert; sein Gast Leutnant Schlegel war sofort tot. Der Doppeldecker ist total zertrümmert. Am selben Tage unternahmen die Eindecker A. 39 und A. 59 mehrere Flüge über den Anger, diese gelangen sämtlich tadellos und ohne jeden Bruch. Da in den letzten Tagen die anderen Flieger abgerückt und von der Abteilung l nur die beiden obengenannten Flugzeuge, welche auch bei gun-Militär-Eindecker von Lt. Lelievre. stiger Witterung sofort ab- Ansitht der Motoranlage. fliegen, übriggeblieben sind, wurde der große Zeltschuppen demontiert, und auf die Lastautomobile verladen. Ausland. Militär-Eindecker von Lt. Lelievre. Der Konstrukteur war bemüht, bei diesem Apparat den Schwerpunkt möglichst tief zu legen. Der 50 PS Gnom-Motor, der unter Vermittlung einer Gallschen Kette eine zweiflügelige Chauviere-Schraube antreibt, befindet sich vor dem Führersitz. Der Eindecker besitzt bei 9,5 m Spannweite eine Gesatnttragfläche von 22 qm. Die Gesamtlänge betragt 7,7 m und das Gewicht 380 kg. 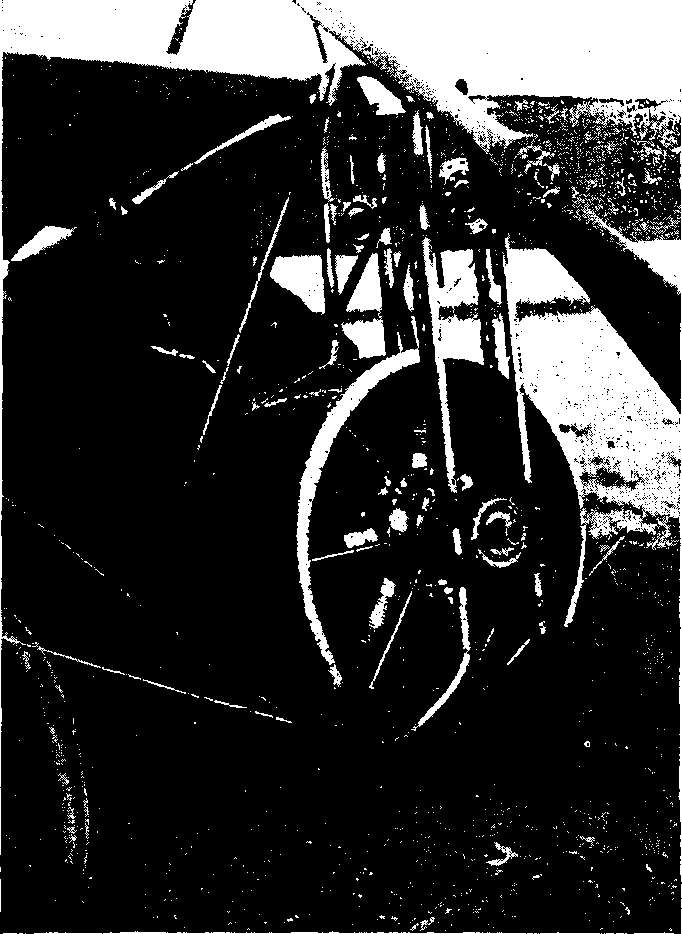 Patentwesen. Patentanmeldungen. 77h. R. 32041. Aus federartigen Einzeltragflächen zusammengesetzte Tragfläche für Flugzeuge Max Richter, Berlin, Friedrichstr. 122/123. 26. 11. 10. 77h. S. 32581. Flugzeug mit in ihrer Größe mittels Gelenkgitter verstellbaren Trag- und Steuerflächen. Richard Sehrke, Berlin, Marienburgerstr. 16. 15.11.10. 77h. R. 33695. Steuerung für Flugzeuge. E. Rumpier Luftfahrzeugbau G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg. 27. 7. 11. 77h. W. 36100. Flugzeug mit beiderseits von der Maschinenmitte bezüglich ihres Neigungswinkels gegen den Wind verschieden einstellbaren Tragflächen. Orville Wright, Dayton, V. St. A.; Vertr.: H. Springmann, Th. Stört u. E. Herse, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 61. 12. 11. 08. Priorität aus der Anmeldung in Frankreich vom 18. 11. 07. anerkannt. 77h. M. 43271. Schwingenflugzeug. Max Munter, Königsberg i. Pr., 3. Fließstr. 27. 28. 12. 10. 77h. B. 66225. Boot für Flugzeuge. Johann Burkard, Hamburg, Heinestr.22. 31. 5. 11. Patenterteilungen. 77h. 256555. Flugzeugfahrgestell mit freihängender, seitwärts und aufwärts verschiebbarer Achse. Julius Kohlscheen, Kiel, Hansastr. 80. 30. 12.10. K. 46651. 77h. 256 556. Propeller zur Erzeugung einer fortschreitenden und zugleich aufsteigenden Bewegung. Max Reymond, Payerne, Schweiz; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr. R. Wirth, Dipl.-Ing. C. Weihe, Dr. H. Weil, Frankfurt a. M. 1, u. W. Dame, Berlin SW. 68. 10.9.10. R. 31552. 77h. 256557. Schraubenflieger. Jacob Christian Hansen-Ellehammer u. Niels Waltersen Aasen, Kopenhagen; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr. R. Wirth, Dipl.-Ing. C. Weihe, Dr. H. Weil, Frankfurt a. M. 1, u. W. Dame, Berlin SW. 68. 2. 3. 12. H. 57067. 77h. 256610. Flugzeug mit einziehbarem Anlaufgestell. E. Rumpier Luftfahrzeugbau G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg. 7. 5. 11. R 33145. 77h. 256611. Flugzeug mit um seine Längsachse beweglicher Tragfläche. Georg Plaisant, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr. R. Wirth, Dipl-Ing. C. Weihe, Dr. H. Weil, Frankfurt a. M. 1, u. W. Dame, Berlin SW. 68. 22. 6. 09. P. 23 281. 77h. 256787. Wendeflügelrad für Flugzeuge, dessen Flügel ihre Wende-, bewegung von der Radwelle durch ein Uebersetzungsgetriebe von 2:1 ableiten. Johann Hugo Axien, Hamburg, Flachsland 31. 24. 11. 10. A. 19744. Verschiedenes. Auszeichnung von Fliegeroffizieren. Acht Fliegeroffizieren, die in letzter Zeitsich durch besondereUeberlandflügehervorgetan haben, ist der Kronenorden 4. Klasse verliehen worden. Es sind die Leutnants v. Begülin, Graf v. Bau-dissin, Siber, Lau, Schwarzkopf, Weyer, Geyer und Kastner. Ferner ist eine Anzahl Fliegeroffiziere, die sich um die Entwicklung des Flugwesens besondere Verdienste erworben haben, durch Vorpatentierung ausgezeichnet worden. Dies sind die Oberleutn v. Dewall, Barends, Mackenthun, Solmitz, und die Leutn. Carganico und Frhr. v. Thüna. Abzeichen für Feldpiloten. Aus Anlaß des Geburtstages des Kaisers wurde den Fliegeroffizieren eine besondere Ehrung zuteil. Der Kaiser stiftete für diejenigen Fliegeroffiziere, die das Feldpilotenexamen bestanden und die militärische Prüfung auf einer Fliegerstation mit Erfolg erfüllt haben, ein besonderes Abzeichen. Dieses Abzeichen besteht aus einem silbernen Medaillon mit einem Flugzeug in der Mitte, das von einem Lorbeerkranz umgeben und mit der Kaiserkrone gekrönt ist. Dieses Fliegerabzeichen wird nach Art der Flügeladjutantenabzeichen an der linken B ust beim Waffenrock, Ueberrock und bei der Litewka getragen. Das Abzeichen wird denjenigen Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften verliehen, die nach Ablegung der beiden vorgeschriebenen Prüfungen für Flugzeugführer und nach Vollendung der Ausbildung auf der Militärfliegerstation das Befähigungszeugnis als Militärflugzeugführer erworben haben. Von dem Beliehenen ist das Abzeichen so lange zu tragen, als er zum Flugzeugführer im Felde geeignet ist. Die nicht bei der Fliegertruppe befindlichen Inhaber des Abzeichens müssen durch regelmäßig wiederholte Dienstleistung bei der Fliegertruppe — grundsätzlich mindestens zweimal jährlich je 4 Wochen — die Befähigung zum Führer erneut nachweisen. Zeigt sich, daß der Kommandierte die Eigenschaft als Militärflugzeugführer nicht mehr besitzt, so wird er von der Liste gestrichen und muß das Abzeichen mit Besitzzeugnis sogleich nach Empfang der Mitteilung abliefern. Das Abzeichen ist jedoch, wie verlautet, nicht für die Marineflieger bestimmt. In dem im Armeeverordnungsblatt veröffentlichten Erlaß ist von der Generalinspektion des Militärverkehrswesens die Rede, und aus den Uebungen, die abzuleisten sind, geht hervor, daß das Fliegerab^eichen zunächst keine Geltung für die Flieger der Marine haben soll. Es ist jedoch zu erwarten, daß Bestimmungen entsprechender Art auch für die Flieger, die Angehörige der Marine sind, erscheinen werden, oder daß verordnet wird, daß das neue Fliegerabzeichen auch für diese zur Ausgabe gelangt. 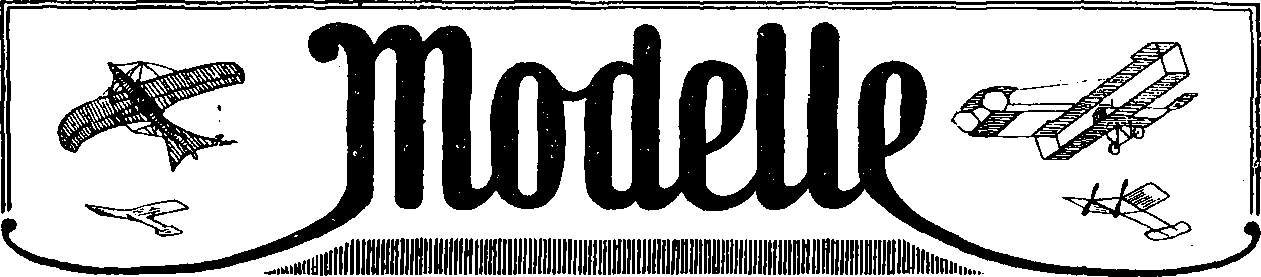 Rückblick auf den Flugmodell-Wettb&werb vom 1. Dezember 1912. (Vortrag von Herrn W. Rühl, gehalten in der Vereinigung von Freunden des Modellflugsports in Frankfurt am Main.) Nachdruck verboten. Meine Herren! Die kleine Ausstellung von Flugzeugmodellen im Verein, sowie die umfangreichere öffentliche im Hippodrom haben offenbar werden lassen, daß die Herstellung solcher Apparate schon von viel weiteren Kreisen gepflegt wird, als man wohl annehmen mag. Es ist mit Sicherheit dem Gedanken Ausdruck zu geben, daß noch eine viel größere Zahl von Liebhabern des Modellflugsports vorhanden ist und daß nur Unkenntnis der Veranstaltung vom 1. Dez. oder sonstige Gründe die Veranlassung waren, daß die Ausstellung nicht eine noch größere gewesen ist. Auf jeden Fall ist über das Aeußere'der gezeigten Modelle, von einigen Ansnahmen abgesehen, nur Lobenswertes zu sagen. Es ist sehr viel Fleiß und Geschicklichkeit auf die Behandlung des Materials verwandt worden. Etwas grundlegend Neues, das den Modellbau um ein größeres Stück vorwärts gebracht hätte, war allerdings nicht zu sehen. Was nunden Hauptzweck der Apparate, „das Fliegen" betrifft, so ist hierüber nur weniger Günstiges zu berichten. Selbst wenn man einige Apparate, die wohl eher Ausstellungs- als Flugmodelle waren, ausscheidet, so bleibt eine verhältnismäßig große Zahl übrig, die den zu stellenden Ansprüchen nicht genügten. Es sind eigentlich nur 4 bis 5 Modelle gewesen, die den weniger eingeweihten Zuschauer zu befriedigen vermochten. Um nun bei einem etwaigen späteren Wettbewerb hinsichtlich der Flugfähigkeit besser abzuschneiden, bleibt nichts anderes übrig, als die Gründe zu beleuchten, die das Versagen vieler Apparate herbeigeführt haben. Da sind es hauptsächlich 4 Punkte, nämlich: 1. der zu schwache oder schlecht arbeitende Antrieb, 2. der zu große oder zu kleine Luftwiderstand, 3. die mangelnde Stabilität und 4. die leichte Zerbrechlichkeit der Apparate. Zu 1 muß unbedingt darauf Bedacht genommen werden, den Anlrieb dem Gewicht des Apparates anzupassen. Ein Modell von 250 g braucht selbstverständlich mehr Kraft wie ein solches von 150 g; ebenso wäre es ein Fehler, den größeren Kraftbedarf eines größeren Apparates nur einfach durch Verrechnung der Gummifäden herbeizuführen, ohne auch den Querschnitt der einzelnen Fäden zu vergrößern. Dann ist darauf zu achten, daß die Reibung in den Lagerstellen auf das geringste Maß herabgesetzt wird. Das geschieht einmal durch Verwendung von Metall, z. B. von Stahlwellen in Messinglagern, dann auch durch das Zwischenschieben von Metall- oder Glasperlen, die den vom Motor ausgeübten Druck auf die Welle aufnehmen. Die Verwendung von Messingröhrchen als Lagerhülse ist nicht zu empfehlen, weil eine Verbiegung der Welle Reibung im Innern dieses Röhrchens verursacht. Eine möglichst auseinander gerückte Doppellagerung ist von Vorteil für den ruhigen Lauf der Schraube. Zu 2 ist eine Behinderung der Fluggeschwindigkeit oder der Flugweite darin zu entdecken, daß der Luftwiderstand nicht genügend berücksichtigt worden ist. Jeder unnötig große Querschnitt einze'ner Bauteile, jede fehlende Ab-rundung, jede überflüssige Verspannung ist in dieser Hinsicht von Uebel. Der bei den großen Flugmaschinen übliche eliptische Querschnitt der Streben usw. ist mehr zur Anwendung zu bringen. Ein zu geringer Luftwiderstand und zwar ein zu geringer nützlicher Widerstand ergibt sich bei der Benutzung stark poröser Stoffe zur Flächenbespannung. Weitmaschig gewebte Gaze, Batist usw. bleiben bezüglich der Tragfähigkeit im Nachteil gegenüber engmaschigen oder gar lackierten oder gummierten Stoffen. Zu 3 wird es jedem Beobachter aufgefallen sein, daß die Flugbahn der meisten Apparate alles andere als eine gerade Linie bildete. Wenn auch unsichtbare Luftströmungen die Ursache einer Ablenkung sein können, so bleiben doch einige Mängel zu erwähnen übrig, deren Beseitigung bessere Erfolge für die Zukunft verheißt. Als wichtigsten möchte ich das Fehlen eines Seitensteuers oder die zu geringe Größe desselben bei verschiedenen Apparaten bezeichnen. Auf Grund meiner Versuche möchte ich behaupten, daß zur Erzielung eines geraden Fluges bei sonst günstigen Umständen zwei Seitensteuer oder besser gesagt „Richtungsflächen" von angemessener Ausdehnung nötig sind. Die eine ist über oder unter dem Tragdeck, die andere am Schwanzende anzubringen. Der hinteren Richtungsfläche ist nur dann Verstellbarkeit zu verleihen, wenn von vornherein beabsichtigt wird, den Apparat auch Kurven- oder Kreisflüge beschreiben zu lassen. Des weiteren ist zu bemerken, daß den Tragdecks unbedingt eine größere Faltenlosigkeit und Steifigkeit zu geben ist. Ein Deck gibt um so größeren Nutzeffekt, je glatter es bezogen ist; ein Deck, das mangelhaft verspannt ist, wird leicht Flatterbewegungen ausführen. Sind diese auch nur wenige mm stark, so genügt es doch vollkommen, sie bei der Kleinheit der Modelle zum Anlaß von Kurvenflügen werden zu lassen Als 3. Ursache bliebe das Vorhandensein eines Uebergewichts auf der einen oder anderen Seite des Apparates zu erwähnen. Läßt sich dieser Fehler nicht durch Verlegung des Schwerpunktes beseitigen, so gleicht man das Uebergewicht der einen Seite durch stärkere Wölbung des Tragdecks dieser Seite aus. Zu 4 wirkt es ohne Zweitel sehr unangenehm, wenn durch eintretende Beschädigungen einzelner Teile das Modell außer Gefecht gesetzt wird. Abgesehen von unglücklichen Zufällen trägt meist schwache oder unpraktische Bauart die Schuld. Vor allem ist es das Fahrgestell, das unbedingt kräftiger gehalten werden muß, als es fast allgemein geschieht. Die paar Gramm Mehrgewicht dürfen hiervon nicht abschrecken. Dann ist auf die Bauart der Längsträger des Tragdecks hinzuweisen. Man wird bemerkt haben, daß bei fast sämtlichen Modellen der gleiche Querschnitt angewandt worden ist. Das ist nicht richtig. Es gilt sonst überall der Grundsatz, daß der Querschnitt der Träger immer nach dem Grad der Beanspruchung bemessen wird. In unserem Falle wird der Längsträger umsomehr beansprucht, je näher sich ein Punkt dem Apparatenkörper befindet. Man wird also, um den Biegungskräften genügend begegnen zu können, zu einer Art <]-Konstruktion kommen, ähnlich, wie sie bei Kranen, Brücken und dergl. benutzt wird. Die Verstärkung der Längsträger kann natürlich sowohl in wagrechter, als auch in senkrechter Richtung oder in beiden Richtungen erfolgen Vorzuziehen ist die wagrechte, weil hiermit weniger Luftwiderstand verknüpft ist. Wir kommen nun zu einem Gegenstand, welcher der Bruchgefahr besonders ausgesetzt ist. Das ist die Schraube. Auch hier muß die große Flugmaschine mehr als Vorbild dienen. Wir sehen die Kufen oder andere Apparateteile, die zu dem Zweck weit vorgebaut sind, die teure und empfindliche Schraube gegen Beschädigung durch Anprall zu schützen. Hiermit wäre das Gebiet der Erinnerungen zum letzten Wettbewerb so ziemlich erschöpft. Es ließe sich höchstens noch die allgemeine Bemerkung daran knüpfen, daß, wie schon eingangs erwähnt, etwas grundlegend Neues nicht anzutreffen war. Namentlich trifft dies auf den Kraftantrieb zu. Die Verwendung von Uebersetzungsgetrieben, von Multiplikatoren der verschiedensten Form, von anderen Kraftspendern als Gummi u. s. f. bildet ein Feld, auf dem der Erfindungsgeist des Einzelnen noch Erfolge erringen kann. Die Herstellung einfacher Luftschrauben für Flugmodelle. Die kleinen Luftschrauben sind im Verhältnis zum Materialwert sehr teuer. Dazu kommt, daß dasselbe Stück auch nur für eine gewisse Größe des Modells vorteilhaft verwandt werden kann Der eifrige Liebhaber wird sich jedoch nicht auf eine Größe der Apparate beschränken. Er ist also gezwungen, sich verschiedene Schrauben zu verschaffen. Eine n cht sehr schwierige und — wenn die Werkzeuge vorhanden sind, sehr billige Herstellungsart ist nachfolgend beschrieben. An Werkzeugen u. s. w. sind erforderlich 1 scharfes Messer, mehrere Schraubenzwingen, 1 Laubsäge, 1 Bohrapparat, 1 grobe und 1 feine ^ (halbrund-) Feile, (Anstelle der groben Feile kann man einen Schlicht-< raspel verwenden), grobes und feines Glaspapier, gekochtes Leinöl, etwas Schellackpolitur und Leim, am besten Syndetikon. A s ungefähre Größe nehme man 's der Decklänge. Als Schaufelbreite wähle man bei 16 cm Durchmesser der Schraube ca. 16 m/m, bei 25 cm Durchmesser ca. 20 m/m, bei 32 cm Durchmesser ca. 25 m/m u. s. f. Die mittlere Steigung (Punkt a bei Abbildung 1 — gleich der Hälfte des Halbmessers —) betrage etwa 25°, bei schwächerer Motorkraft weniger. Dies entspricht einer Entfernung des Punktes a vom unteren Rand beider 16cm-Schrau-be von 8 m/m, bei der 25 cm-Schraube von 9l/a m/m, bei der 32 cm-Schraube von 12 m/m. Dem Punkt b (an der Peripherie) gebe man die Hälfte dieser Höhe, dem Punkt c (Vi des Halbmessers) die doppelte Höhe. Die beiden Punkte a und b verbinde man durch eine gerade Linie, während man zwischen a und c einen Bogen derart zieht, daß der ganze Strich eine schwache Kurve zeigt. Die Entfernung des Punktes c vom unteren Rand gibt die Mindesthöhe des Blattes an, welches zur Herstellung der Schraube dient Das Brett kann aus einem Stück sowohl, als auch aus mehreren unter Druck verleimten Leistchen (z. B. von Ogarrerfkist-chen) bestehen. Die Ansicht der Schraube senkrecht zur Welle zeigt Abbildung 2. Diese Form wurde der leichten Herstellung 'wegen so entworfen. Vier Querschnittsprofile geben ein Bild der Schaufelform an den näher bezeichneten Stellen. Die Beseitigung des überflüssigen Holzes geschieht zuerst mit dem Messer, worauf die Bearbeitung der konkaven (hohlen) Fläche und darnach die Zurichtung der konvexen Fläche erfolgt. Mittels Feile und Glaspapier erfährt das Holz eine genügende Glättung. Mehrmaliges Durchtränken mit gekochtem Leinöl mit folgendem Trocknen und schließliches Polieren verleihen der Schraube gutes Aussehen, größere Härte und Widerstandsfähigkeit. Vor Anwendung der Politur ist das Abrunden der Ecken und ein Ausbalanzieren vorzunehmen. Bezüglich des Nutzeffektes steht eine wie vorstehend hergestellte und präzis gearbeitete Schraube einer käuflichen nicht nach. 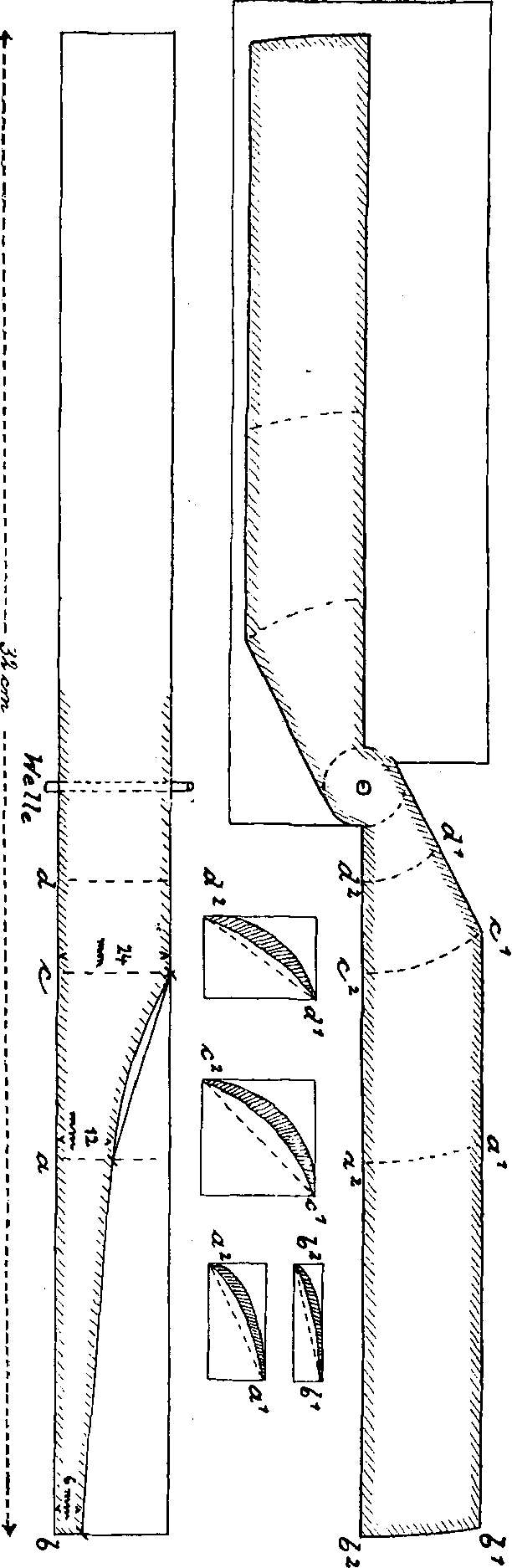 Abb. 2 Abb. 1 Eine Mahnung an Erbauer von Flugmodellen. Die meisten Modelle, die jetzt gebaut werden, sind sogenannte „Fliegen". Ohne Verspannung, Flächenwölbung und gutem Fahrgestell sind sie gebaut. Ein solches Modell kann vom Wind getrieben werden und abstürzen. Ist die Entfernung dann etwas groß, so heißt das Modell ein gutes. Aber bei einem Modell muß alles so sein, wie bei großen Apparaten. Wenn es nicht fliegen kann, muß es herunterstürzen und unter Umständen in Stücke gehen und bei schlechter Landung muß das Fahrgestell brechen. Dem muß man entgegenarbeiten, indem man beim Bau alles in Berechnung zieht und durch Abstürze des Modells lernt was unangebracht ist. Lehmann. Ausstellungswesen. Die „Internationale Automobil- und Plugzeug-Ausstellung:" in Turin, deren Zustandekommen ein Zeitlang in Frage war, wird, wie die „Ständige Aus-stellungskommiss. f. d. dtsch. Industrie" bekanntgibt, laut Mitteilung des Turiner Automobil-Clubs nun doch und zwar vom 26. April bis 11. Mai 1913 im „Palazzo Stabile al Valentino" stattfinden. Anmeldungen werden vom 6. bis 28. Februar d. Js. von dem genannten Club entgegengenommen. Die von der „Societä d'aviazione di Torino" geplanle „F1 ugze ug-Aus-stellung" soll, an die obige Ausstellung anschließend, vom 17. Mai bis 1. Juni d. J. und zwar gleichfalls im Palazzo Stabile al Valentio stattfinden. Alle Anfragen bezüglich beider Veranstaltungen sind zu lichten an den „Automobile Club di Torino".  » Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.) Person. Ihre Anfrage ist bereits in No. 13, Seite 527, Jahrgang" 1912~be-züglich des Tragvermögens beantwortet. Es wäre noch hinzuzufügen, daß der Stirnwiderstand infolge des seitlichen Abgleitens der Luft sich nicht vermehrt, was in den ausgeführten Taubenschwänzen moderner Flugmaschinen seine praktische Bestätigung findet. Alles nähere ist aus der in oben erwähnter Nummer angeführten Notiz zu ersehen. Jkaros. Auf ihre Anfrage über die aerodynamisch günstigste Tragflächenform und deren Stellung zum Rumpf können wir Ihnen nur empfehlen, bei Ihrer Flügelkonstruktion der beigefügten Vogelskizze (Abb. I) Rechnung zu tragen, bei welcher der Idealzustand des aerodynamischen Wirkungsgrades durch Anwendung V-förmig nach rückwärts und oben gestellten Tragflächen in Verbindung mit Profilverringerung erreicht wird (s. Wellner Seite 14 Abb. 8). In der Praxis werden sie wegen der aus sicherheitstechnischen Gründen e'forderlichen Verwindung oder Klappenbetäigung zu ausgelappten Flügelspitzen wie beim Kondor- und Rumplerflug-Abb. 1 zeug kommen. Fuchs. In Erwiderung Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, daß Sie alles Wissenwerte bezügl. der Orientierung der Flieger in einem in Flugsport No. 3 Jahrgang 1912 erschienenen Aufsatz, finden können. 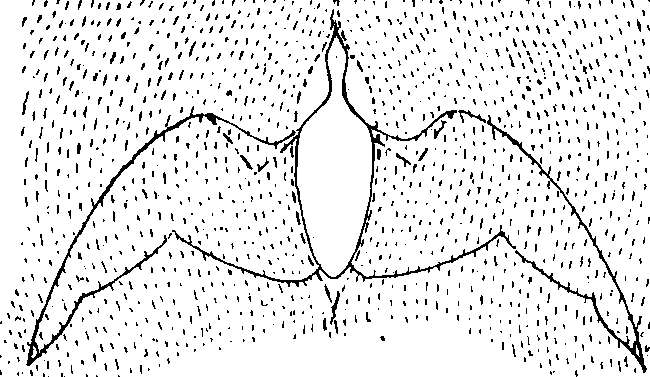 Mars. Auf Ihre gefl. Anfrage nach.-einer Drahtseilbefestigung ohne die sonst übliche Drahtseilklemme teilen wir Ihnen mit, daß bereits im Hebezeugbau nebenstehend abgebildete Verbindung (Abb 2) bekannt ist. Sie besteht aus einem hohlkonisch gestalteten Fassonstück von Stahl, dessen Innenseite vor dem Gebrauch aufgerauht wird. Alsdann dreht man das verwendete Drahtseil an seinem Ende büschelartig auf und verzinnt die Einzeldrähte. Dieselben werden nun widerhakenartig umgebogen worauf man das Ganze in den Konus zieht und denselben mit Blei oder Zinn ausgießt. Abb. 2 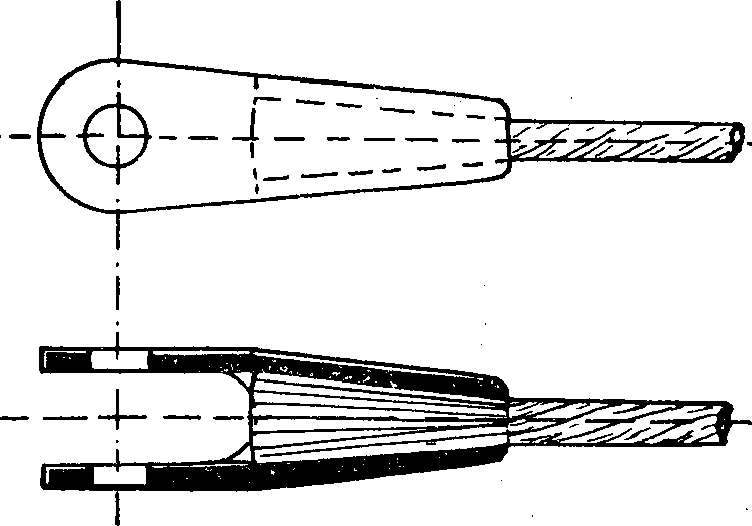 Literatur. Augen auf oder Beutel auf von August Finold, Verlag von Alfred Metzner. Berlin SW. 61. Preis M. 3.50. Unter diesem Titel ist ein sehr nützliches Buch erschienen zur außergerichtlichen Eintreibung von Außenständen. Es ist übersichtlich und für jeden Laien leicht faßlich geschrieben. Ganz besonders übersichtlich hat die Anordnung der zu dem neuen Verfahren erforderlichen Formulare stattgefunden. Schon bei deren Durchsicht wird dem Leser der einzuschlagende Weg ganz klar. Von den benötigten Formularen sind dem Buche je 20 Exemplare beigegeben. Das Buch kann jedem im praktischen Leben Stehenden warm empfohlen werden. Welcher edeldenkende Herr od. ebensolche Firma würde strebs. j. Mann m. Fachschulbild , w. bereits über 2 J. in d. Flugtechnik besch. u. sowohl theoret. wie prakt. selbst, zu arb. gewöhnt ist, zum Piloten ausbilden? Rückz. od. sp Gewinnanteil nach Uebereinkunft. Off. u. S. C. 883 an die Exped. erbeten._ Energischer junger Mann, 19 Jahre alt, sucht Kapital zur Erwerbung des Fliegerzeugnisses. Freundl. Angebote u. 886 an d. Exp. erb.  Akademisch gebildet, mit gründlichen Kenntnissen im Flugzeug- und Flugmotorenbau, sucht passende Stellung per sofort od. 1. März 1913 in Flugzeugoder Flugmotorenfabrik. Gefl. Off. u. 889 an die Exp. des „Flugsport erbet. Flu c mo tor (Anzani) 3Zyl. 35 PS mit Doppelzündung, fast ungebraucht, 2 Orig.-Chauviere-Schrauben, Oel-u. Benzin-Behälter nebst vielem Zubehör wegen Aufgabe des Projektes für Mk. 1200.— gegen Kasse sofort abzugeb. Anfragen u. 884 an die Expedition des Bl. Zur Erbauung späterer Massenlieferung eines sternförmigen Vierzylinder-Verbrennungsmotors (kein Flugzeugmotor) Motorenfabrik gesucht. Offerten unter H. 888 an die Exped. erb. 2 Hydroplan Schwimmer 5 mal 1 m, Trapezform, billig verkäuflich. Off. u. 882 an die Expedition erbeten. FLUG-MOTOR wassergekühlt, 28/34 PS, 4 Zyl. mit Kühler und Propeller, tadellos erhalten (881) 1200 Mark Oassa zu verkaufen. Werntgens Flugunternehmen m. b. H., Bonn-Hangelar._ Gesucht geg. Casse gebr. luftgek. Flugmotor zw. 20 u. 40 PS. Beschreibung m. äuß. Preisangabe u. K. A. F. 890 an d. Expedition.  technische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef. 4557 Amt 1. Oskar UrsinUS, Civilingenieur. Tel.-Adr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14 tägig. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 5. März. Die Olympia Aero-Ausstellung 1913. Von unserem Londoner Korrespondenten. In der großen Halle von Olympia hat der Royal-Aero-Club eine Ausstellung zusammen gerufen, um dem englischen Volke die Fortschritte der modernen Aviatik vorzuführen und die Fabrikanten zu veranlassen, ihr ganzes Können zu zeigen. Man darf die Ausstellung ruhig international nennen, wenn auch die französischen Flugzeuge von den englischen Filialen dieser Firmen hier als „durchunddurch" englisch angesehen werden Außerdem waren die deutschen Garuda-Propellerwerke würdig vertreten und Mercedes, Benz und die N. A. G. hatten auch ihre Motore ausgestellt. Eine Berliner Firma, die Modellflugzeugbestandteile herstellt, hatte eine ganze Reihe flugfähiger und nicht fliegender Modelle hierher gebracht, unter denen besonders ein recht sauber gearbeitetes Modell der "Wrightmaschine auffiel, sowie das Modell einer Rumpler-Taube, die als das deutsche Kriegsflugzeug bezeichnet war. Der König kam mit dem Auto vom ßuckingham-Palast und wurde vom Präsidenten des Royal-Aero-Olub, Sir Charles Rose und den Herren Harod Perrin, Roger Wallace und E. Manville, welche die ganze Ausstellung organisiert hatten, empfangen. Zuerst brachte der König sein Interesse dem in der Mitte der Halle aufgehängten englischen „Lenkbaren" dar und wandte sich dann an Grahame White, von welchem er sich den ausgestellten Ein- und Zweidecker erklären ließ. Holt Thomas von der Aircraft Comp, soll der König gefragt haben, ob es sicher sei, daß man jetzt in England ebenso gute Flugzeuge bauen könne wie in Frankreich. Der Aero-Club hatte auch in ziemlich großen Wasserbassins einige Wasserflugmaschinenmodelle ausgestellt, die dem König besonders gute gefallen haben sollen. Für jeden anwesenden Konstrukteur hatte der König ein paar freundliche Worte und länger unterhielt er sich mit den Fliegern, welche größere Leistungen im Laufe des vergangenen Jahres vollbracht hatten, besonders mit dem bekannten Cody alias Bufalo Bill, dem der König schon öfters bei seinen früheren Experimenten zugeschaut hatte als er noch Prince of Wales war. Für das Publikum wurde die Ausstellung erst nachdem der König dieselbe gegen 4 Uhr verlassen hatte, um 51/2 Uhr eröffnet. Der Eindruck, den man beim Betreten der Olympiahalle gewinnt, ist ein ganz guter, die verschiedenen Apparate sind gut aufgestellt, sodaß man nicht nur immer direkt die großen Leinwanrlflächen sieht. Die meisten Maschinen sehen nicht zu sehr ausstellungsmäßig aus, sind aber fast alle schön und sauber gearbeitet. Man hat doch den Eindruck, daß die Dinger auch zum wirklichen Fliegen gemacht sind. Am ersten Ausstellungstag, Freitag, war der Besuch recht mäßig. Am Sonnabend gab es an den vier Eingängen recht unangenehmes Drängen und Schieben. Konstruktive Einzelheiten von der Olympia-Ausstellung in London. Die Ausstellungsobjekte in der Halle der Olympia repräsentieren sich viel wirkungsvoller als im letzten Pariser Salon. Man war vernünftig genug, die erdrückenden umfangreichen Riesendekorationen, wie man sie beim Pariser Salon für nötig hielt, wegfallen zu lassen. Das Auge wird von den wirkungsvollen Ausstellungsobjekten durch übermäßige Dekorationen abgelenkt und die Ausstellungsobjekte werden in ihrer Wirkungsweise stark beeinträchtigt. Der Fachmann sieht zunächst wieder eine große Anzahl von altbekannten Gewohnheitsausstellern vom letzten Salon von Paris wie: Bleriot mit seinem neuen Stahleindecker und Torpedorumpf, Borel mit seiner Wasserflugmaschine Typ Tamise, Nieuport-Wasserflugmaschine, wie sie von der französischen Marine angekauft wurde und verschiedene andere bekannte französische Konstruktionen Hier und da sieht man auch ein Ausstellungsobjekt, welches den Namen einer englischen Firma trägt, dessen Aussehen und Arbeit seine Herkunft nicht verleugnen kann. Indessen lassen mehrere englische Flugmaschinenkonstruktionen erkennen, daß die englischen Firmen mit größter Anstrengung gearbeitet haben. Man sieht sehr gute Formen, sehr gute Details und vor allen Dingen auch gute Werkstattarbeit. Diese Leistungen sind umso höher einzuschätzen, als in England die Flugzeugindustrie nicht gerade auf Rosen gebettet ist und seitens der Regierung keineswegs die Unterstützung erfahren hat; die sie verdient. Einige Firmen waren gezwungen, um ihre Betriebe aufrecht erhalten zu können, sich im Ausland ein Absatzgebiet zu sichern. So hat z. B. die Bristol Company, wie dem Leserkreis des „Flugsport" bekannt ist, recht erhebliche Geschäfte im Ausland gemacht. Andererseits muß man sich wundern, daß das Blair Atholl Aeroplane Syndicate Ltd. in der Olympia-Schau nicht in entsprechender Weise vertreten ist. Die Gesellschaft hat bekanntlich die Patente des Leutnant Dünne erworben Neuerdings ist diese Maschine in Frankreich in Villacoublay (s. die untenstehende Abbildung des Dunne-Eindeckers) versucht worden. Es scheint, daß man daselbst eine 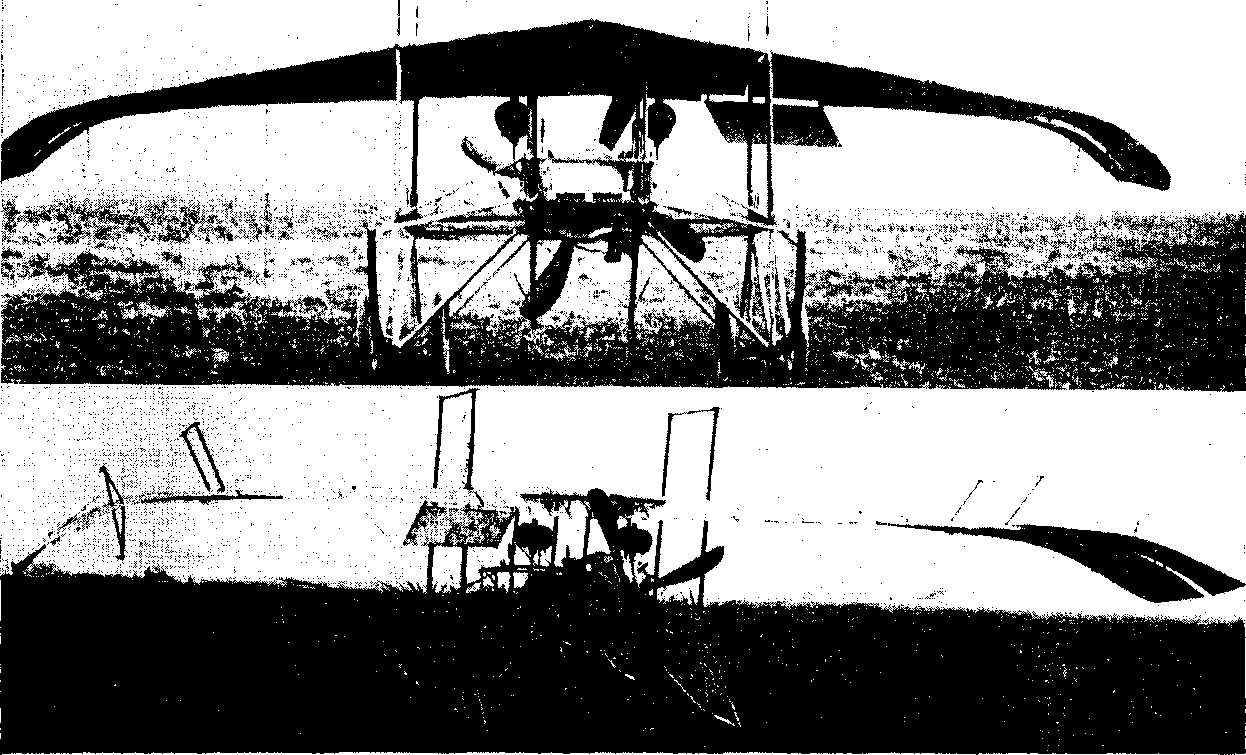 Der schwanzlose Dunne-Eindecker, oben: Vorderansicht, unten: Rückansicht. Man beachte den großen Neigungswinkel an der Vorderseite and die negativ aufgebogenen f lägelenden. französische Gesellschaft gründen will, um diese Maschinen in Frankreich einzuführen. Der Prophet gilt eben nichts in seinem Vaterlande! Es sind auch einige sehr interessante englische Wasserflugmaschinen vertreten wie: Grahame White-Doppeldecker, Samuel Wh ite-Doppeldecker S op w it h-Doppeldecker und Short-Doppel-decker, auf die wir noch ausführlich zurückkommen werden. Weiter sehen wir wassergekühlte Motoren, 60, 80 und 120 PS luftgekühlte Wolseley-Motoren, einen 1C0 PS wassergekühlten Sechszylinder Green-Motor. Auf die einzelnen ausgestellten Zubehörteile werden wir gleichfalls in den nächsten Nummern zurückkommen. Der „BE 2"-DoppeIdecker die englische Militärtype, erinnert in seiner äußeren Formgobung, ab- gesehen von Fahrgestell und Schwanz, etwas an den Breguet-Doppeldecker. Die Maschine, der Royal Aircraft Factory gehörend, hält den englischen von G. de Havilland mit Major Sykes als Fluggast am 12, August vor. .1s. aufgestellten Höhenrekord von 3200 m. Der „BE 2" ist in nebenstehender Abb. in Seitenansicht und Grundriß dargestellt. Die Spannweite des Oberdecks beträgt 12,8 m, die des Unterdecks 11,8 m, die Gesamttragfläche 34 qm, die Gesamtlänge 10 m. Zum Betriebe dient ein 70 PS luftgekühlter Renault-Motor, welcher durch eine Blechhaube verkleidet ist. Das Benzinreservoir ist unter dem Passagier-, vor dem Führersitz angeordnet. Einen vertrauenerweckenden Eindruck macht der Wasserzweidecker von Sopwith. Dieser Zweidecker von 12,5 m Spannweite besitzt ein als Stufenboot ausgebildetes Gleitboot Der Bug ist kielförmig ausgebildet. Ueber dem Bug befindet sich eine 2,4 m breite feststehende Wasserleitfläche. Führer- und Gastsitze sind im Gleitboot angeordnet. Das etwas primitive nicht abgefederte Fahrgestell kann vermittelst eines innerhalb des Bootes befindlichen Hebels hochgeklappt werden. Die gesamte Formgebung des Gleitbootes läßt erkennen, daß Bootskonstrukteure hier mitgearbeitet haben. Das Rahmenwerk des Bootes ist, wie bei Rennbooten, mit Cedernholz verkleidet. Der Kiel des Vorderteils des Bootes verflacht sich nach der Stufe zu. Der rückwärtige Teil ist wieder kielförmig ausgebildet. Zur Sicherung der Schwimmstabilität in seitlicher Richtung dienen zwei an dem Schwimmkörper befestigte zylindrische Hilfsschwimmer. Die Streben sind, um eine größere Festigkeit bei geringstem Luftwiderstand zu erzielen, im Querschnitt tropfenförmig hergestellt und zwar sind die Streben, um an Gewicht zu sparen und eine größere Festigkeit zu erzielen, aus drei Teilen verleimt. (S. die Zeichnung auf S.eite 121 rechts unten.) Höhen- und Seitensteuer sind in bekannter Weise in den Schwanz verlegt. Zum Betriebe dient ein 100 PS Sechszylinder Green-Motor. Sehr gute Formen zeigt der Grahame White-Militärdoppeldecker, (s. die Abbildung auf Seite 120) welcher mit einem 90 PS Vierzylinder Austro-Daimlermotoi' ausgerüstet ist. An dem Vorderteil des boots-förmig als Gitterträger ausgebildeten Rumpfes ist der Motor montiert, der unter Vermittlung einer Welle und Gelenkkette eine Chauviere-Schraube von 3 m Durchmesser antreibt. Der Flieger sitzt direkt hinter dem Motor, so daß er den Gang desselben genauestens beobachten kann. Dahinter befindet sich ein großes Benzintank für Betriebsstoff für 6 Stunden. Das obere Tragdeck hat eine Spannweite von 14,2 m und das untere von 10 m. Die Gesamttragfläche beträgt 40 qm und die Gesamtlänge 11,1 m. Sehr widerstandsfähig ist das Fahrgestell ausgebildet, welches aus 2 Kufen von 250 mm Breite besteht, in deren Mitte in einer Aussparung die Doppelräder an Gummiringen in bekannter Weise aufgehängt sind. Die Kufen werden gegen den Rumpf durch 10 hohle Sprucestreben versteift. Die Verbindung mit dem Schwanz ist wie beim österreichischen de Pischoff-Apparat durchgeführt. Die Schraube läuft auf dem oberen Längsträger. Höhen- und Seitensteuer sind in den Schwanz verlegt. Das Gesamtgewicht der Maschine beträgt 1000 kg, die Nutzlast 340 kg. An der Spitze des Rumpfes ist oben ein kleines Schnellfeuergewehr montiert. Ferner zeigt Grahams White einen kleinen Wasser-Doppeldecker mit vorn liegendem Motor und hinten liegendem Höhen- und Seitensteuer. Zum Betriebe dient ein 60 PS luftgekühlter Anzani-Motor. Gast- und Führersitz sind B E 2 Militärdoppeldecker. 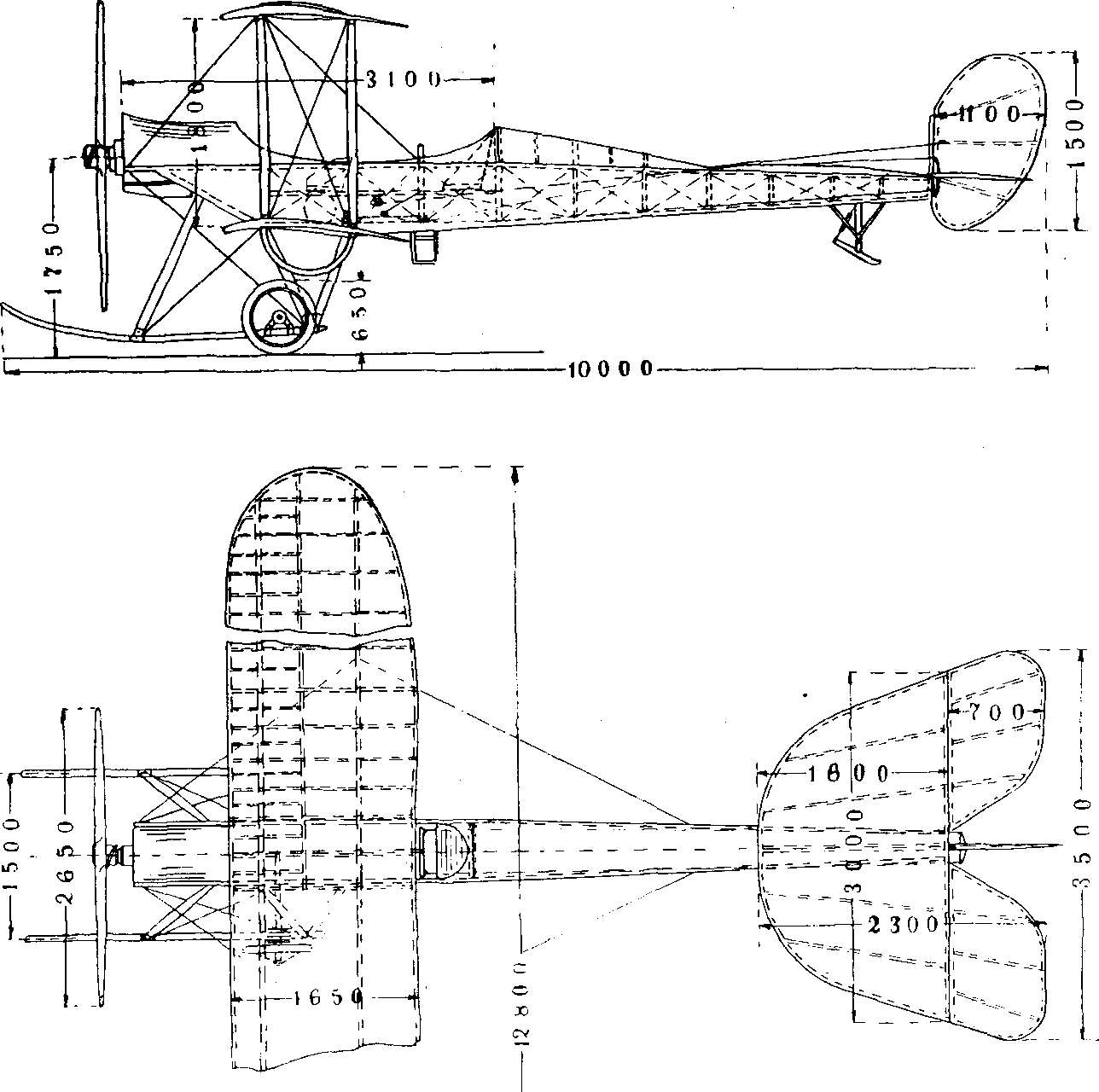 Von der Olympia-Ausstellung. hinter dem Motor, geschützt durch eine Haube, untergebracht. Das Benzinreservoir, das für 4 Stunden Benzin und Oel faßt, liegt hinter dem Gastsitz. Das obere Tragdeck hat eine Spannweite von 14,2 m 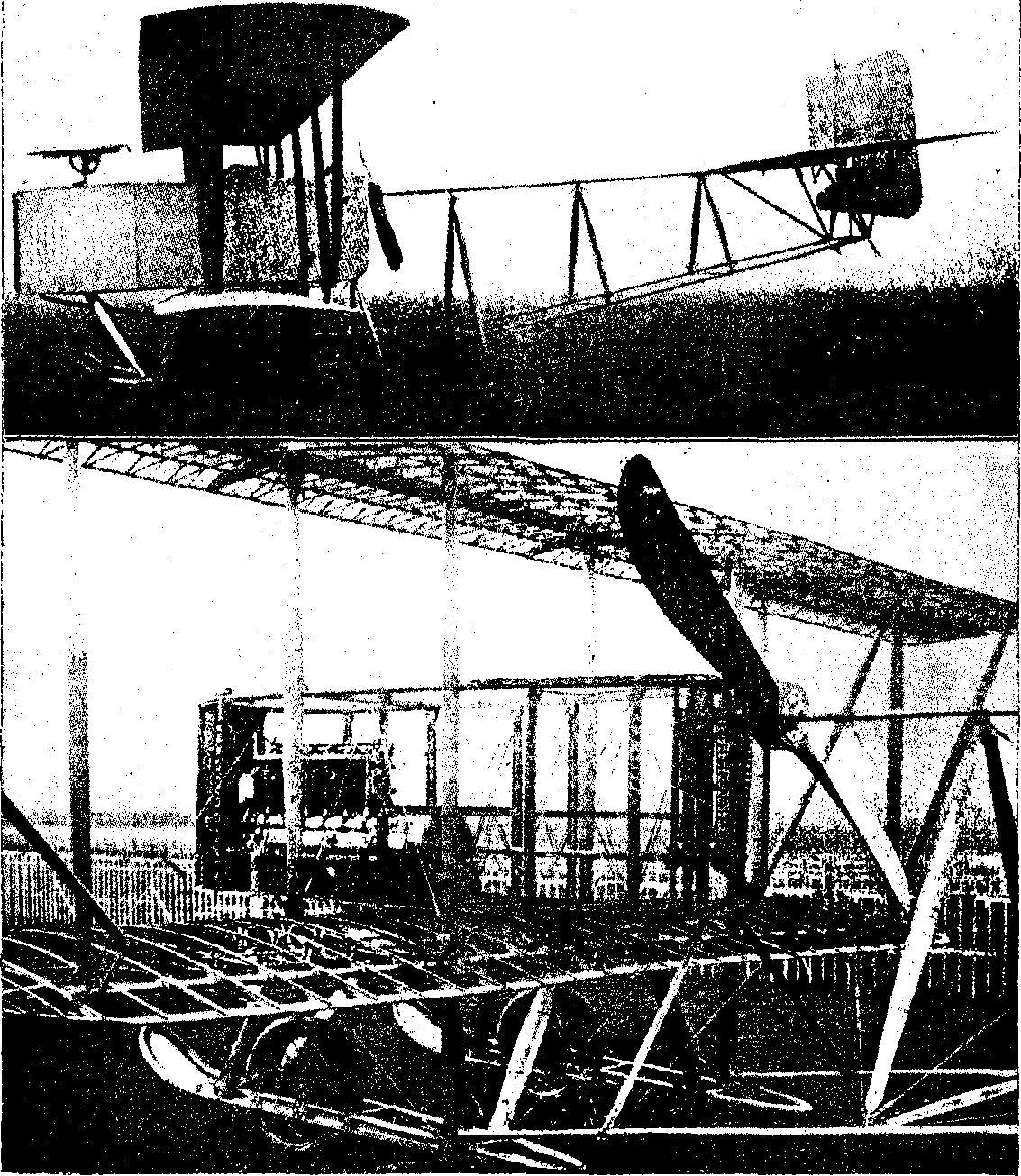 Von der Olympia-Aus Stellung. Grahame White Militär-Doppeldecker. und das untere von 8 m. Die Gesamttragfläche beträgt 30 qm, die Gesamtlänge 8,3 m. Die Maschine wird durch 2 Schwimmer, von denen jeder 3,5 m lang und 45 cm tief ist, getragen. Der vordere Teil des Schwimmers ist, wie die nebenstehende Abbildung zeigt, flach und hinter der Stufe konkav ausgebildet. (S. Schnitt a-b.) Hinter der Stufe führen zwei Rohre nach der Oberseite des Schwimmers, die durch 2 Windhauben verdeckt sind. Durch diese Rohre wird ein (Fortsetzung des Artikels auf Seite 124.) 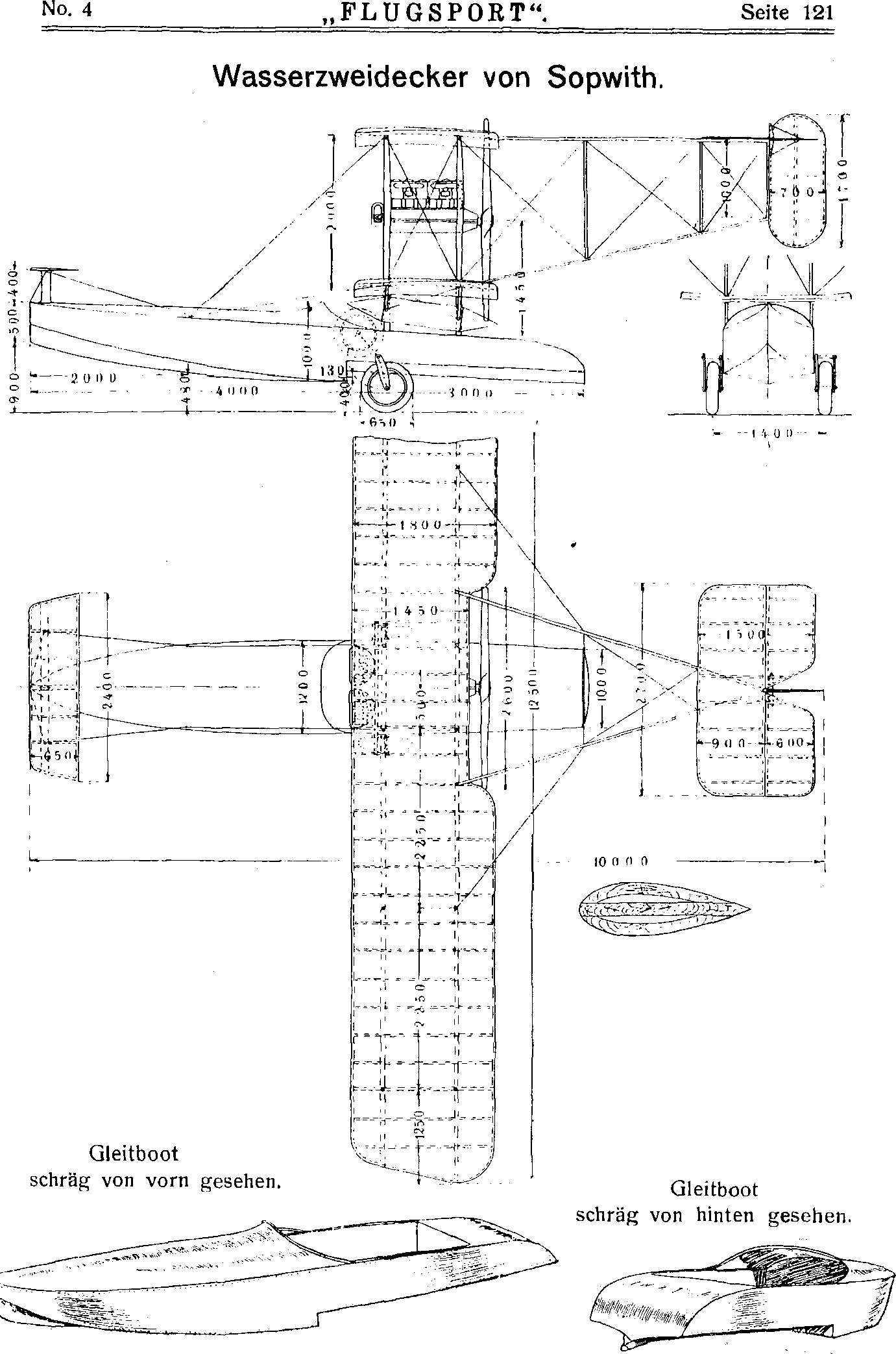 Von der Olympia- Ausstellung. Die Flugmaschinen in der Abmessungen der Tragdacks Ober Unter Fläch.-Inhalt qin l »2 Tlü« Gewicht d Ma schine kB Nutzlast kg 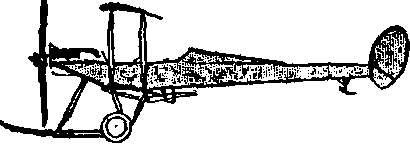 B. E. 2 Doppeldecker 70PSRenault-M 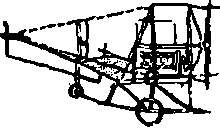 Cody Doppeldecker 120 PS Oester. Daimler 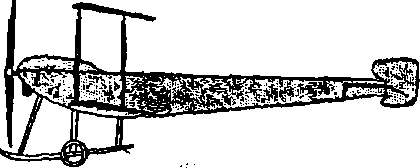 Avio Doppeldecker 50 PS Gnom 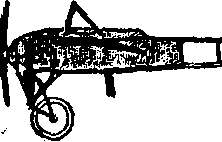 Bleriot Eindecker 80 PS Gnom 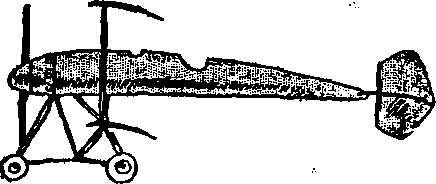 Breguet Doppeldecker 85 P5 Canton Unne 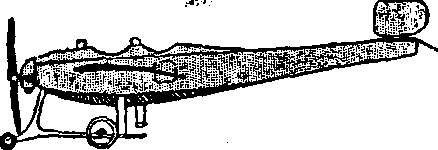 Bristol Eindecker 80 PS Gnom 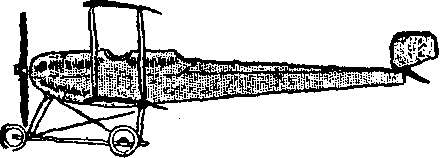 Bristol Doppeldecker 70 PS Renault 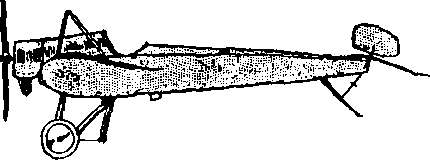 Caudron Eindecker 45 PS Anzani 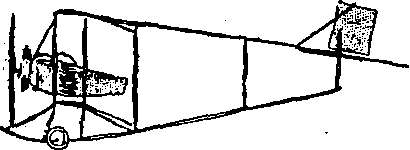 Caudron Doppeldecker 35 PS Anzani 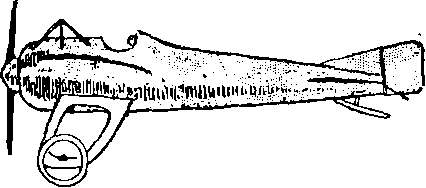 Deperdussin Monocoque 80 PS Gnom 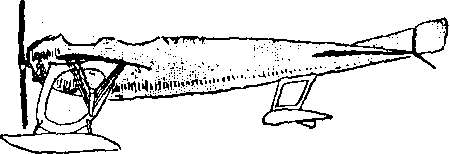 Deperdussin Wasser mono 110 PS Anzani Farman, H, Doppeldecker 80 PS Gnom 10 12,7 9,7 12,7 9,3 9,2 7,0 7,7 12,8 14,3 12 10,3 11,8 14,3 44 \2 15 13 14,3 12,7 8,3 11,6 11,3 8,5 14 12,7 32,7 30,6 22,6 40 9,5 7,0 18,6 20 26,5 34 125 100 125 107 113,5 100 136 77 105,5 112 104 935 490 440 415 700 515 465 323 29J 323 356 430 227 227 430 127 137 275 520 840 330 275 Olympia-Ausstellung, London. Abmessungen der Tragdscks Ober Unter m 11) m qm Fläch.-Inhalt Gewicht d. Nutzlast kg Maschine kr 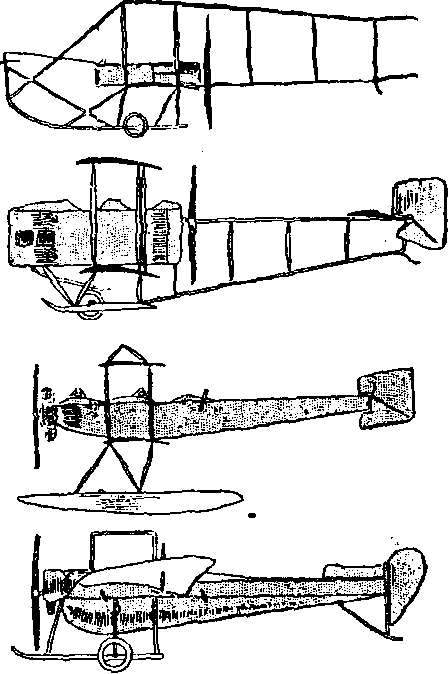 fFarman, M. Doppeldecker 70 PS Renault Grahame- White Doppeldecker 120 PS Oester. Daimler Grahame- White Wasser-Doppeldecker 60 PS Anzani Handley-Page Eindecker 50 PS Gnom 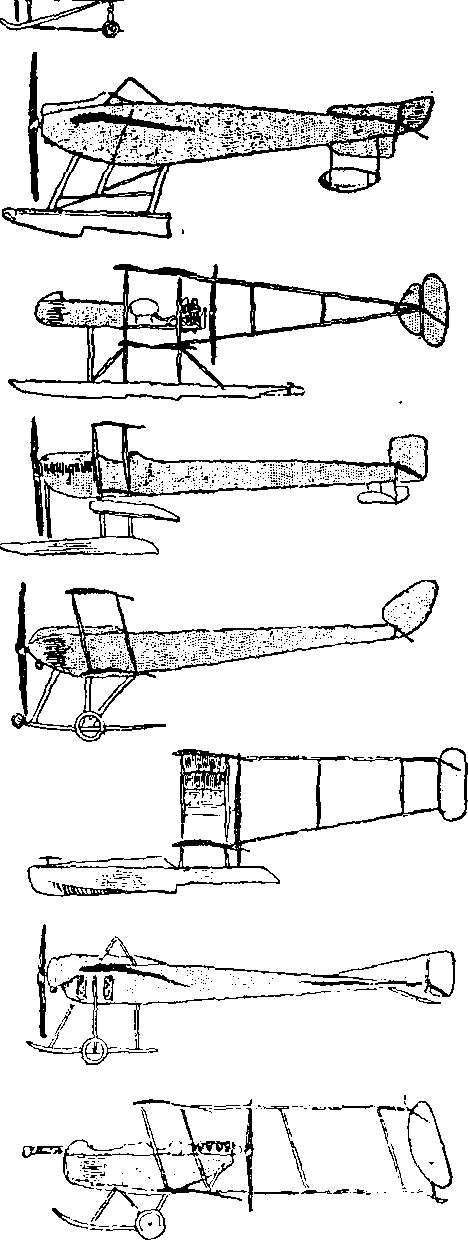 Martinsyde Eindecker » PS Laviator Nieuport Wasser-Eindecker 100 PS Gnom Samuel -White Wasser-Doppel decker 160 PS Gnom Short(P.Grace) Wasser-Doppeldecker 80 PS Gnom Sopwith Wasser-Doppel decker 90 PS Oester. Daimler Sopwith Doppeldecker 80 PS Gnom 13 1,1 8,3 9,3 IM 9,6 17 12,3 14,2 14,2 14 14,2 13,3 10 47 40 112 1000 10 11,6 10 14,6 9,6 Vickers Eindecker 70 PS Gnom Vickers Doppeldecker 80 PS Wolseley 13,6 13,3 30 8S 21,8 26 112 22 104 45 112 10 13,6 35,5 104 13,1 11,6 13,6 13,1 38 104 32 112 10 10 100 35 580 275 340 840 200 385 225 560 615 545 545 200 135 275 300 350 225 455 340 entstehendes Vakuum hinter der Stufe ausgeglichen und ein Kleben der Schwimmer vermieden. Das Gerippe ist aus Spruce und mit Spruce 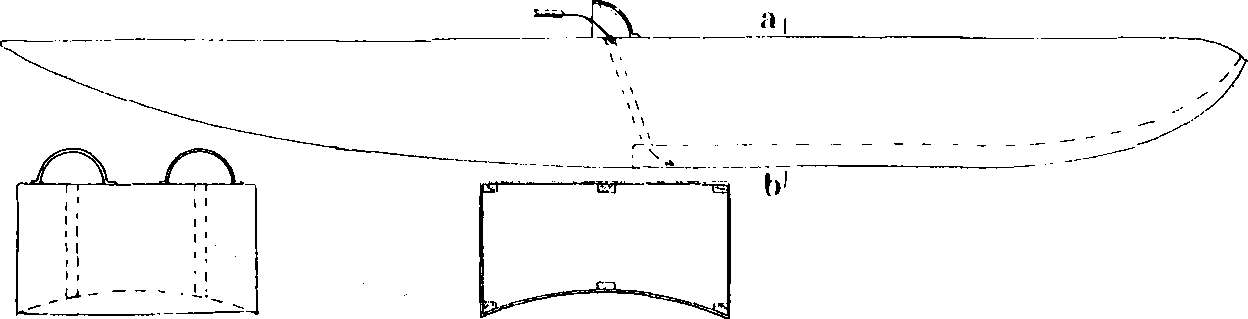 Vorderansicht Schnitt a-b Schwimmer vom Orahame White Doppeldecker. gefüttertem Stahlrohr versteift. Das Gewicht der Schwimmer beträgt insgesamt 50 kg Oberst Cody hat seinen großen, den Lesern des „Flugsport" bekannten Doppeldecker, der den 100 000 Mk. Preis in der Militärflugzeugprüfung auf dem 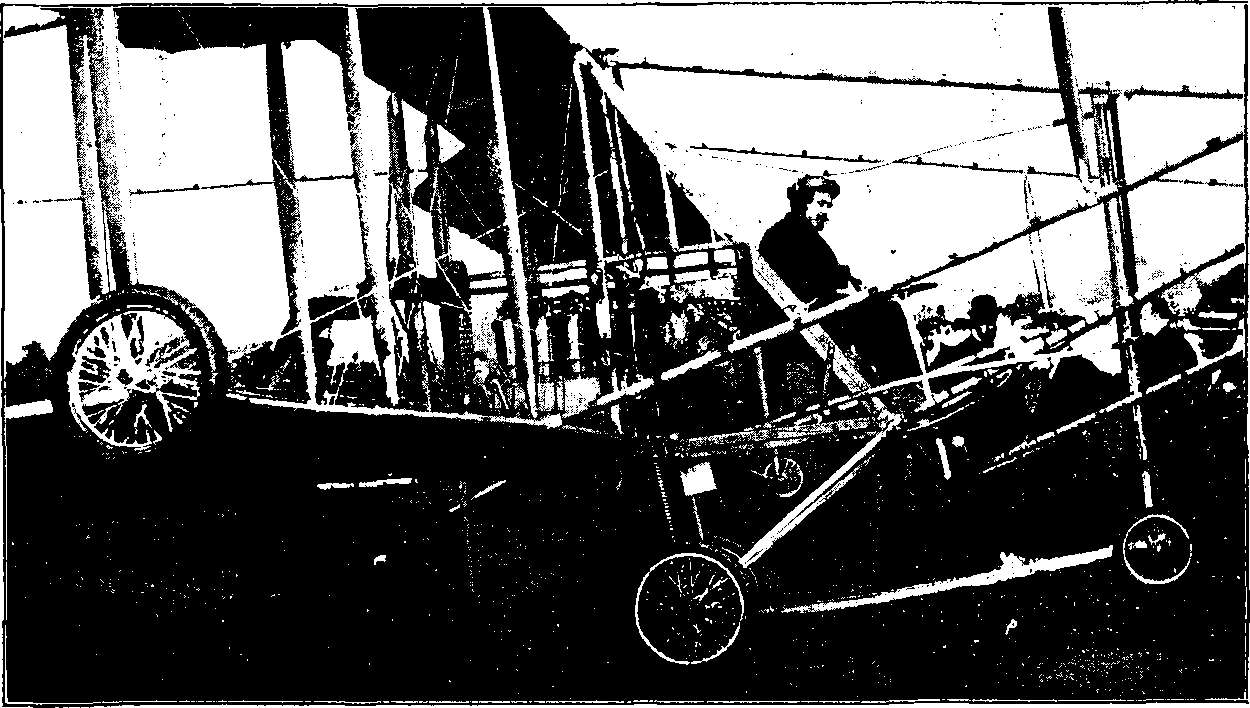 Von der Olympia-Ausstellung. Cody-Doppeldecker. Flugplatz von Salisbury gewann, ausgestellt. Der Cody-Doppeldecker ist mit einem 120 PS Austro-Üaimlermotor ausgerüstet. (Fortsetzung folgt.) ___i>£>>______  Ans dem Johannisthaler Fliegerlager. Berliner Korrespondenz des „Flugsport". Nach dem "Wasserflugmaschinen-Wettbewerb von Heiligendamm sind mit einigen Ausnahmen die meisten Fabriken von dem weiteren Ausbau der Wasserflugmaschinen wieder abgekommen und haben sich mehr der Vervollkommnung der Landflugmaschinen zugewandt. Warum eigentlich? Die im vorigen Jahre gebauten Maschinen waren nichts weiter als abnorme Landmaschinen mit eingesetzten Schwimm Vorrichtungen und haben denn auch nie die Resultate ergeben, die die Konstrukteure von ihnen erhofften. Es war allerdings nicht die gleiche Sache wie in Monaco, wo die Franzosen mit ihren Farman auf dem Meer erschienen, und dank der sehr günstigen Witterungsverhältnisse die Bedingungen mit Leichtigkeit erfüllten. Darüber mußte man sich klar sein, daß eine derartige Wasserflugmaschine — lediglich ein mixtum compositum — niemals in der Lage sein wird, die Bedingungen zu erfüllen, die man von einer wirklich brauchbaren Wasserflugmaschine verlangen muß. Zunächst darf man nicht mehr die Meinung vertreten, daß ein derartiges Fahrzeug mit. einem Fahrgestell ausgerüstet sein muß, um auch ein Starten und Landen auf dem Boden zu ermöglichen. Eine Wasserflugmaschine gehört in das Wasser und eine Landflugmaschine auf das Land. Einen Typ zu bauen, der für beides bestimmt sein soll, gibt in konstruktiver Beziehung ein technisches Wirrwarr und ist auf keinen Fall gut zu heißen. Ich bin mir wohl sicher, daß diese Ansicht nicht von allen geteilt wird, ich stütze mich aber auf die Erfahrungen und Erfolge, die in Frankreich, Amerika und England im Wasserflugmaschinenwesen bis jetzt errungen worden sind..... Es ist deshalb mit Freuden zu begrüßen, wenn wir in Deutschland Konstrukteure haben, die nach dem Vorbild der besten bisherigen Wasserflugmaschinen den Bau von derartigen Flugzeugen aufnehmen. Während in Süddeutschland auf dem Bodensee schon längere Zeit der Wasserdoppeldecker von Kober unter der Führung von Gsell ganz hervorragende Leistungen vollbracht hat, ist in Norddeutschland nicht all zu großes geboten worden. Seit längerer Zeit war es hier schon bekannt, daß Fokker mit dem Bau einer Wasserflugmaschine beschäftigt ist, aber über die Konstruktion hüllte sich der Konstrukteur in Schweigen und beantwortete alle Fragen mit seinem bekannten Lächeln. Er wußte aber warum! Nachdem nun die ersten Versuche geglückt sind, hat auch Fokker den Schleier der Verschwiegenheit gelüftet und einige Daten an die Oeffentlichkeit dringen lassen. Wie die beistehende Abbildung erkennen läßt, handelt es sich um einen Typ, der in seinem Aeußeren nur streng konstruktive Linien zeigt und von allem flugtechnischen Geplänkel verschont ist. Wenn man bedenkt, daß am 2. Januar dieses Jahres mit dem Bau der Maschine begonnen wurde und bereits am 9. Februar der erste freie Flug gelang, dann muß man dem tüchtigen Konstrukteur sein Kompliment inachen. Das ist wirklich eine Arbeit, die so schnell noch kein anderer Wasserflugmaschinen-Konstrukteur geleistet hat. Der Apparat besitzt einen durchgehenden Zentralschwimmer mit verstellbarer Stufe, die es ermöglicht, je nach den Umständen einen Einfluß auf das Fahren und Starten auszuüben. Diese Einrichtung, sowie die untere Form des Bootes sind von Fokker zum Patent angemeldet. Im vorderen Teil des Schwimmers sind die Sitze für Flieger und Fluggast angeordnet und daran anschließend folgt der Aufbau der beiden Tragflächen Die untere legt sich direkt auf die Oberkante des Bootes, trägt an jedem Ende einen Fühlschwimmer und besitzt eine Spannweite von 7 Metern. Auf starken Stahlrohren baut sich nun ein durch Spanndrähte versteiftes Gerüst auf, das oben zwei kräftige Holme besitzt und zum Anschluß der oberen Tragfläche und Einbau der Maschinenanlage dient. Man kann eigentlich sagen, daß die obere Tragfläche den normalen Fokker-Eindecker darstellt. Wir finden hier die pfeil- und V-förmige Anordnung und das Fehlen jeglicher mechanischer Einrichtung zur Erhaltung der Querstabilität. Fokker ist auch bei seiner neusten Maschine seinem bewährten Grundsatz treu geblieben und hat mit diesem Apparat die erste automatisch stabile Wasserflugmaschine geschaffen. Die Tragflächen sind untereinander gut verspannt und stellen in sich ein festes geschlossenes System dar. Am hinteren Teil des Bootes finden wir die beiden zweiteiligen Seitensteuer und das zwischen den beiden schwenkbare Höhensteuer, Die Maschinen-Anlage besteht aus einem Achtzylinder-Renault-Motor von 70 PS, der einen zweiflügeligen Integral-Druckpropeller indirekt antreibt. Vom Passagiersitz aus kann der Motor mit Hilfe einer sehr einfachen von Fokker konstruierten Anlaßvorrichtung angeworfen werden. Am 9. Februar war der Apparat fertig montiert. Mit einem Passagier und ca. 60 kg Ballast erfolgte nach vollständig unfreiwilligem Start von ca. 150 Metern der erste Flug, wobei sich die Maschine sehr leicht abhob und im Verhältnis zur verfügbaren Motorenstärke eine ganz erhebliche Eigengeschwindigkeit entwickelte. Fokker wird bei günstiger Witterung seine Versuche wieder aufnehmen und hoffentlich recht bald seine erste Wasserflugmaschine den Johannisthaler Fliegern in den Lüften mit gewohnter Schneidigkeit vorfliegen. Viel besprochen werden hier die neuen Bedingungen der Heeresverwaltung für die Abnahme von Kriegsflugmaschinen (Siehe diese an anderer Stelle) und zwar gelten die Vorschriften für das Jahr 1913. Zu wundern braucht man sich nicht, denn für wirkliche .Kriegsflugmaschinen müssen solche Bedingungen gelten, aber auch eingehalten werden. Die Steigfähigkeit wird aber manchem Abnahme-flieger noch Kopfschmerzen bereiten. Es ist vielleicht nicht uninteressant einmal einige Zahlen zu erwähnen, die ein Hanriot-Emdecker im englichen Militärwettbewerb ergeben hat. Der Apparat mit 25 qm Fläche und Gnom-Motor von 100 PS, der an der Bremse 84 PS ergeben hat, stieg mit 405 kg Nutzlast in 4 Min. 32 Sek. auf 500 m Höhe. Diese Leistung ist sicher die beste, die unter allen ähnlichen jemals erzielt worden ist. Das ist ein herrliches Beispiel für eine zukünftige Kriegsflugmaschine..... Das Abliefern von Militärmaschinen erfolgt jetzt nicht mehr einzeln, sondern direkt scrienartig. -Gemeinsame Ueberlandflüge sind es, die gegenwärtig von den Rum pler-F1 iegern vollbracht werden. Am 6. Februar flogen direkt hintereinander Lt. J oly, Fri d o Iin .Keidel und Wieting auf Rumpler-Tauben nach Döberitz, am 11. wieder Lt. Joly, Keidel und Willy Rosenstein, der hier als Ueberlandflieger erfolgreich debütierte. Der frühere Gradeflieger vonStoephasius ist seit 1. Februar bei E. Rumpier und erlernt das Fliegen auf Rumpler-Taube, um mehr als Abnahmeflieger tätig zu sein und an den großen Konkurrenzen teilzunehmen. Am 12 bestand Neumann auf Rumpler-Taube seine Fliegerprüfung in sehr gutem Stil. Bei Albatros sind in den letzten Tagen auch wieder verschiedene Doppeldecker zur Ablieferung gelangt. Ein neuer Zweidecker, 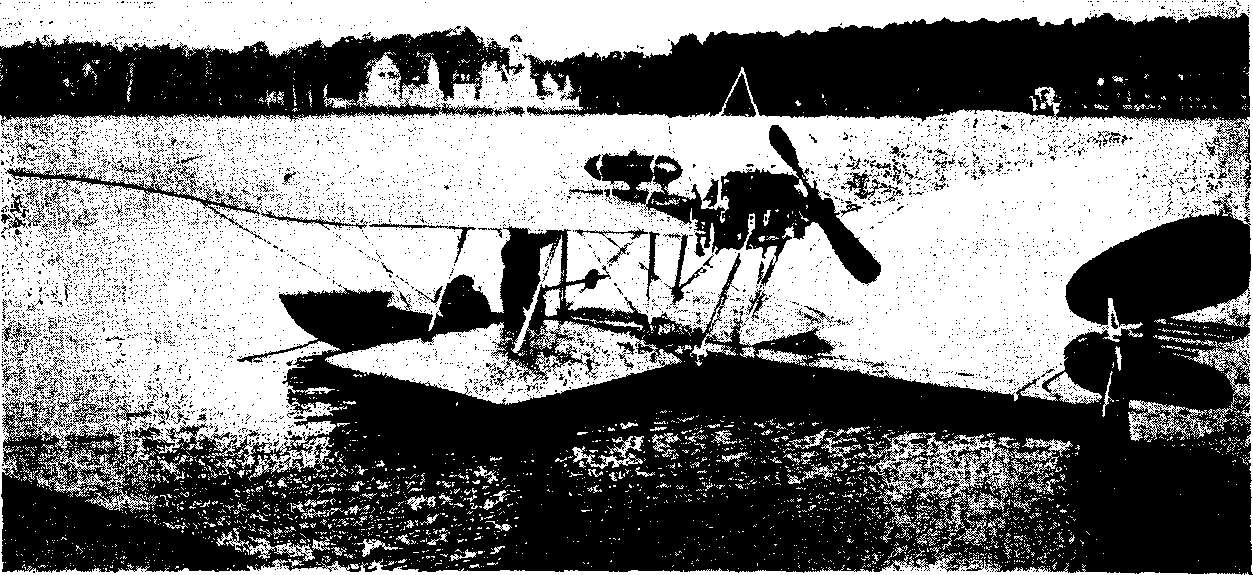 Die neue Fokker-Wasserflugmaschine. Im Boote sitzend Fokker. dessen Tragflächenkonstrnktion etwas an Breguet erinnert und auch die Lappenverwindung besitzt, sonst aber die Formen der bekannten Doppeltauben aufweist, hat unter Führung von Thelen sehr gute Resultate ergeben und eine erhebliche Schnelligkeit und Steigfähigkeit erwiesen. Die Ausbildung der Offiziere unter Leitung von Ernst Stoeffler und König schreitet gut vorwärts. In der F okkerf Ii egers ch ule, wo ständig 6 Maschinen zum Schulen bereit stehen, hat Graf von Arnim sein Fliegerzeugnis erflogen. Eine beachtenswerte Leistung vollbrachte der Monteur Kuntner, der in drei Flugtagen die Fliegerprüfung ablegte. Am vergangenen Sonnabend unternahm der Chefpilot Crem er 83 Schulflüge und hätte bald den Johannisthaler Rekord von 100 Schulflügen, die Rupp an einem Tag unternahm, berührt. Vor einiger Zeit ereignete sich auch wieder ein schwerer Sturz, der aber glücklicherweise gut verlief. Ingenieur Sablatnig war mit Oberlt. z. S. Bertram auf dem neuen A. E. G.-Doppeldecker, mit dem er in Döberitz die Abnahmebedingungen erfüllt hatte, aufgestiegen und hatte die Absicht, trotz des sehr heftigen Windes nach dem A. E. G.-Flugplatz bei Hennigsdorf zurückzufliegen. Das Flugzeug folgte dem Lauf der Havel und befand sich in einer Höhe von ca. 560 Metern, als über Heiligensee ein Defekt am linken Flügel — wie es heißt, ist die Verwindungsklappe zerbrochen — Sablatnig zum sofortigen Niedergehen zwang. Der große Doppeldecker legte sich schief, Oberleutnant Bertram kletterte auf den rechten Flügel, um ihn durch sein Gewicht wieder aufzurichten; Sablatnig stellte den 100 PS N.-A.-G.-Motor ab und ging in steilem Sturzfluge nieder, wobei er, da ihm ein Sturz unvermeidlich schien, Richtung auf die mit einer starken Eisdecke überzogene Havel nahm. Etwa 80 Meter über dem Boden schaltete der Flieger, um über die Häuser hinwegzukommen, den Motor wieder ein, riß den stürzenden Apparat knapp über die Dächer hinweg und warf ihn 2 Meter vom Ufer entfernt ins Wasser, Bertram flog ins Wasser und wurde von dem Oesterreicher, der selbst an Kopf, Brust und Knie verletzt bis an die Brust im Wasser steckte, vom Ertrinkungstode gerettet. Der Doppeldecker war total zertrümmert. Hier hat sich wieder Sablatnig als hervorragender Flieger, vielleicht besser gesagt, Flugkünstler, gezeigt und hat zwei Menschenleben gerettet. Der bekannte Flieger Karl Krieger ist seit einiger Zeit als technischer Leiter des Prinzen Siegismund vonPreußen engagiert und leitet den Bau der prinzlichen Flugmaschinenfabrik, deren Chefpilot er auch ist. Am 11. Februar flog Krieger mit dem verbesserten Eindecker in über 100 m Höhe über das Bornstedter Feld und hat einige Tage später einen längeren Flug über Potsdam und Umgebung ausgeführt. Zur Bestreitung der diesjährigen Konkurrenzen wird Krieger einen Stahl-Renneindecker mit Sechszylinder-Mercedes-Motor von 100 PS verwenden. Bei Jeannin ist vor einigen Tagen die neue Stahltaube mit Sechszylinder 100 PS Argus erfolgreich versucht worden und hat unter Führung von Stiploschek mit 350 kg Nutzlast 500 Meter in 5 Minuten 40 See. erreicht. In eine andere Stahltaube wird der neue Stoewer-Motor von 150 PS eingebaut. Die Fabrikanlagen am neuen Startplatz gehen ihrer Vollendung entgegen und dürften bald bezogen werden. Auch die Neuanlagen der AGO sind jetzt fertiggestellt. Die Firma hat Dipl.-Ing. Skolnik als Konstrukteur gewonnen, der unter der techn. Leitung von H. Fremmery die Konstruktion von neuen Apparaten aufgenommen hat, während von Gorrissen die Fliegerschule und den techn. Betrieb auf dem Flugplatz leitet. -er Fliegendes Boot von Curtiss. (Hierzu Tafel V.) Die Entwicklung der Wasserflugmaschine von Curtiss ist den Lesern des „Flugsport" durch die ausführlichen Berichte in den früheren Nummern zur Genüge bekannt. Curtiss hat, wie bereits im „Flugsport" No. 24 Jahrgang 1912 auf Seite 905 berichtet wurde, mit seinem allerneuesten Typ, dem sogenannten fliegenden Boot, hervorragende Erfolge erzielt. Anschließend an diese Voröffentlichungen wird es interessant sein, etwas Näheres über die Konstruktion dieser neuen Maschine zu erfahren. Der Hauptschwimmkörper, welcher an einer Zelle von 11,5 m Spannweite aufgehängt ist, ist als Stufenboot mit flacher sich nach hinten verjüngender Unterseite (die genauen Formen gehen aus der Zeichnung auf Tafel V deutlich hervor) ausgebildet. In dem vorderen Teile sind die Führer- und Gastsitze untergebracht. An dem hinteren Teil sind die Höhen- und Seitensteuer befestigt. Der Motor ist hingegen noch, wie bei den früheren Curtiss-Maschinen, zwischen den Tragdecken, 2/5 Tragdeckenabstand von der oberen Tragdecke, angeordnet. Der Achtzylinder-Motor hat 101 m/m Zylinderdurchmesser, 127 Hub und leistet normal 75 PS. Das Gewicht beträgt 179 kg, das Tragflächenareal der Maschine 28 qm. Zur Erhaltung der seitlichen Stabilität dienen zwei an der Oberseite der Tragdecken befindliche Hilfssteuerflächen, die in der bei Curtiss üblichen Weise durch Seile mit der Rückenlehne des Führersitzes verbunden sind. Das Höhensteuer wird durch Vorwärtsneigen der Steuersäule und das Seitensteuer durch Drehen des auf der Steuersäule befindlichen Handrades eingestellt. Um die seitliche Gleichgewichtslage auf dem Wasser zu sichern, sind links und rechts an den unteren Tragdecken zwei kleine Hilfsschwimmer, an deren rückwärtigen Enden kleine Wasserfühl- oder Tastbrettchen angebracht sind, vorgesehen. Diese Tast- oder Fühlschwimmer haben sich in der Praxis außerordentlich bewährt. Curtiss verwendet bei seinen Verspannungen seit langer Zeit ein eigentümliches Spannschloß, das im Detail auf der Tafel rechts dargestellt ist. Dieses Spannschloß besteht aus einem gebogenen Stahlblech a, dessen beide Enden bei b durchbohrt sind und unter die Strebenschraube c gesteckt werden, d ist ein Fahrradnippel in denselben Dimensionen, wie sie bei Automobil-Drahtspeichenrädern verwendet werden, i, die eigentliche Spannschraube, ist gleichfalls aus einer Drahtspeiche angefertigt. Die Oese wird durch Biegen, wie aus der Zeichnung ersichtlich, hergestellt. Damit sich der Nippel d nicht lösen kann, ist an der Seite eine Sicherungsfeder f, die man von der flachen Stelle in Richtung des Pfeiles g abziehen und um den Punkt h nach der Seite drehen kann, vorgesehen. Die vorliegende Curtiss-Maschine wiegt mit Betriebsstoff für 2 Stunden, eingerichtet für Passagier, 733 kg und soll eine Geschwindigkeit von 100 km in der Stunde erreichen. Urs. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Die milde Witterung, der wir uns hier seit einigen Wochen erfreuen, hat eher, als ursprünglich beabsichtigt war, neues pulsierendes Leben in das Flugwesen gebracht und in dem blaßgoldigen Scheine einer zaghaft scheuen Vorfrühlingssonne spiegeln sich bereits fast täglich auf den zahlreichen Flugfeldern die glitzernden Linien der Riesenvögel, die nach langem Winterschlaf wohlig ihre Leiber zu strecken scheinen. Es beginnt sich allenthalben zu regen und einige markante Leistungen der letzten Tage scheinen zu zeigen, daß wir uns in einer Periode der Reko; dkämpfe befinden. Zunächst war es der junge Flieger Guggenheim, welcher sich schon früher mehrfach hervorgetan hat und gegenwärtig Chefpilot bei Henri Farman in Etampes ist und mit einer Flughöhe von 752 Meiern einui neuen Welt-Höhenrekord zu fünfen aufstellte. Der Flug dauerte 55 Minuten. Der bisherige Welt-Höhenrekord für Flieger und vier Passagiere gehörte mit 590 Metern dem Belgier Verschaewe. Dieser neue Rekord sollte indessen keinen langen Bestand haben, denn schon am ll. Februar unternahm derselbe Flieger einen Angriff auf seine eigene Leistung, die ihn offenbar nicht völlig befriedigt hatte. Wiederum auf dem Flugfelde von Etampes war es, als Guggenheim sich mit seinem Zweidecker, auf dem vier Passagiere Platz genommen hatten, in die Luft erhob. Es war 3/44 Uhr nachmittags. Der Apparat wog 1000 kg, er hatte 70 kg Oel und Benzin an Bord. Die Maschine stieg in leichten Spiralen immer höher und höher und als endlich die Dämmerung nahte, landete der Flieger um 5 Uhr 5 Minuten in schönem Schwebefluge, welcher allein acht Minuten dauerte! Bei diesem Fluge hat Guggenheim eine Flughöhe von 1120 Metern mit 4 Passagieren erreicht und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der Apparat ist ein 17 Meter-Militärzweidecker mit 80 PS Gnom-Motor gewesen. Schon der folgende Tag brachte eine neue Ueberraschung: Guilleaux, welcher sich namentlich durch seine häufigen Luftpromenaden über Paris einen Namen gemacht hat und der erst vor einigen Tagen, am Faschingsdienstag, die großen Boulevards entlang flog und sich tapfer an der Konfettischlacht beteiligte, vollbrachte am 12. Februar eine Flugleistung, mit welcher er alle Welt-Geschwindigkeits- und Distanzrekorde mit Passagier schlug, indem er mit seinem Metalleindecker Clement-Bayard, mit einem Passagier an Bord, 4 Stunden 6 Minuten in der Luft blieb und 410 km zurücklegte. Guilleaux vollbrachte diese prächtige Leistung auf dem Flugfelde von Villesauvage, wo er erst am Tage vorher von Issy eingetroffen war. Die Flugbahn betrug genau 10 km und ist durch sechs Pfosten sport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Fliegendes Boot von Curtiss. Tafel V. 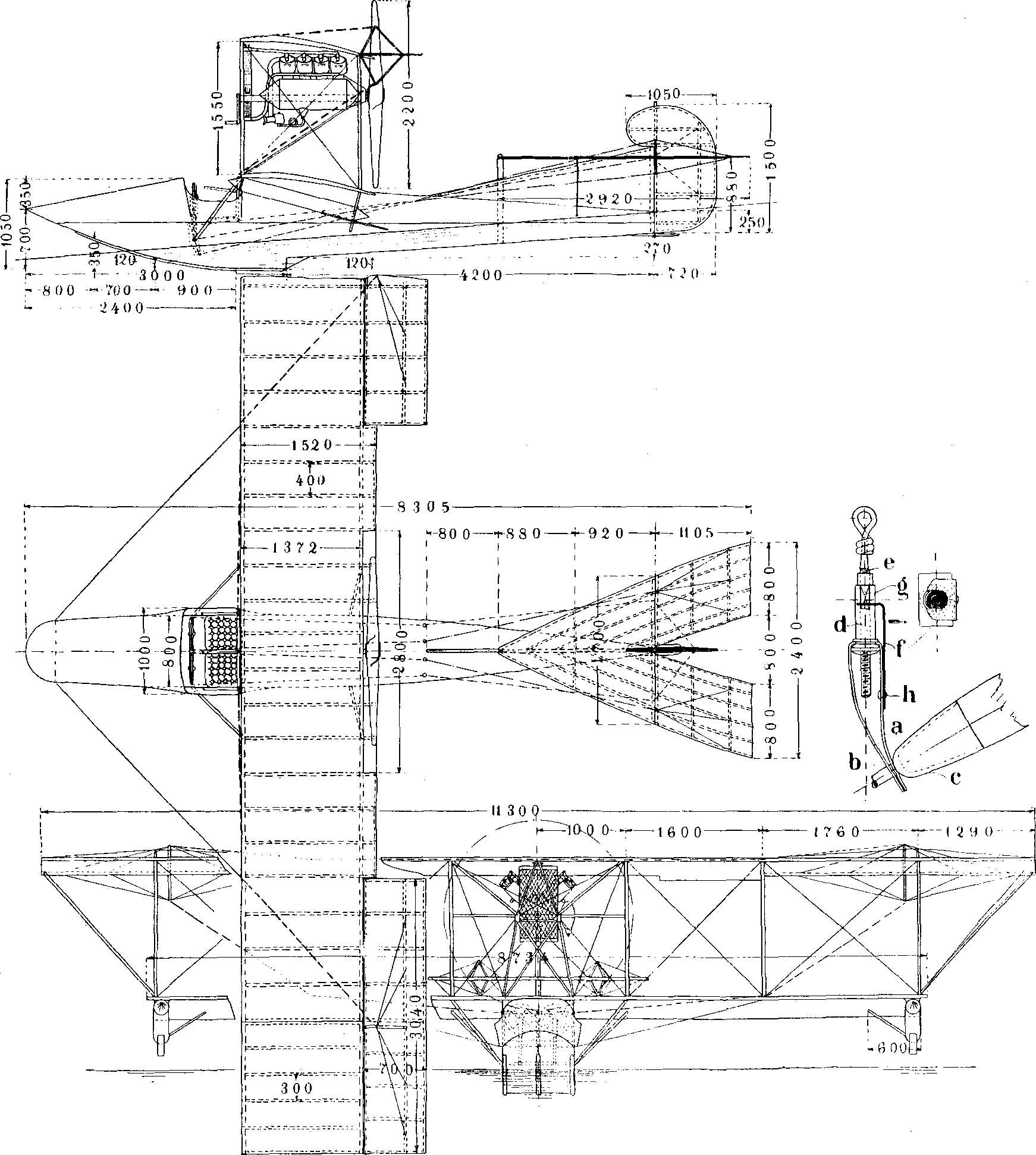 Nachbildung verboten zwischen Villesauvage und Mondesir abgesteckt. Nachfolgend die Zeiten vom 100. km ab: 100 km in 1:02:10 350 km in 3:34:46 200 km in 2:04:27 400 km in 4:04:04 250 km in 2:34:48 410 km in 4:10:46 300 km in 3:04:05 sodaß sich Guilleaux außer dem Passagier-Distanzrekord auch noch die Rekorde von 2 Stunden mit 191,900 km 3 Stunden mit 291,900 km 4 Stunden mit 391,900 km angeeignet hat. Am folgenden Tage, dem 13. Februar, brachte Maurice Ghevillard zu Etampes einen Flug zustande, bei dem er, mit drei Passagieren an Bord seines Zweideckers Henri Farman, 80 PS Gnom, mit 1350 Metern einen neuen Welt-Höhenrekord zu vieren schuf, der seit dem letzten September mit 1100 Metern dem deutschen Flieger Hirth gehörte. Daß bei einem so regen Wiederbeginn des Flugwesens hier und da auch einige kleine Unfälle vorgekommen sind, wird nicht verwunderlich erscheinen können. Der Militärflieger Leconte flog vom Flugfelde Varangevüle ab, um über Saint Nicolas-du-Port zu kreisen. Plötzlich versagte der Motor und Leconte entschloß sich, zu landen. Als er sich etwa sechs Meter vom Boden befand, gewahrte er eine Baumgruppe, der er ausweichen wollte. Dabei senkte sich der Apparat zu stark auf die Seite und stürzte um. Leconte erlitt ziemlich bedeutende Verletzungen, die Maschine wurde zertrümmert. In Reims stürzte der Hauptmann Bocquet bei einem Studienfluge ab und erlitt mehrfache Verletzungen. Am letzten Sonnabend wollte Graf Lambert mit einer Wasserflugmaschine die Seine entlang fliegen. Als er von Billancourt aus bis an den Viadukt von Auteuil gekommen war, dessen Höhe er anscheinend nicht richtig abgeschätzt hatte, verwickelte er sich mit der Maschine in den Telegraphendrähten und stürzte ab. Zum Glück kam Graf Lambert mit nur geringen Verletzungen davon ; das Flugzeug ist völlig zerstört. Innerhalb des französischen Militärflugwesens ist. die Aufregung eine große. Die von uns in dem vorigen Berichte angedeutete Bewegung nimmt immer ernstere und eigentümlichere Formen an und wir werden in der nächsten Nummer auf die „Dessous" der Sache näher einzugehen in der Lage sein. Ferner sind in letzter Zeit wiederholt geheimnisvolle, nächtliche Angriffe auf die Fliegerschuppen von Nancy unternommen worden, wobei jedesmal ein ziemlich lebhafter Kampf zwischen den Angreifern und den Wachtposten stattgefunden hat. Man hat eine Verdoppelung sämtlicher Posten auf dem Militär-Aviationspark vorgenommen und eine eingehende Untersuchung eingeleitet, die bisher keine Resultate ergeben hat. Mit großem Eifer befaßt man sich mit der Installierung des bereits an dieser Stelle erwähnten neuen Militär-Flugzentrums in Toul und ein Teil der für dieses Zentrum bestimmten Einheiten ist bereits an Ort und Stelle eingetroffen. Man erwartet nun noch das Eintreffen zweier nach Toul kommandierten Flugoffiziere mit ihren Apparaten, um sofort mit einer Reihe von Rekognoszierungsflügen an der äußersten Ostgrenze zu beginnen Mit besonderem Interesse verfolgt man hier natürlich die in letzter Zeit gemeldeten vorzüglichen Fliegerleistungen auf dem Schlachtfelde, namentlich das Bravourstück des griechischen Fliegers Montussis, welcher mit einer Wasserflugmaschine, mit einem Marineoffizier an Bord, einen kühnen Erkundungsflug über die Dardanellen ausführte, um die türkische Flotte zu entdecken. Er flog von Mudros ab und wandte sich, nachdem er eine Flughöhe von 1000 m erreicht hatte, nach den Dardanellen. Als er über dem Arsenal von Nagara angekommen war, ließ er vier Bomben herabfallen, die angeblich eine furchtbare Wirkung ausgeübt haben. Von den Türken beschossen, ließ sich der Flieger auf dem Meere, dicht neben dem Torpedoboot „Velos", nieder, welches dem Wasserflugzeug bis auf 7 km vor dem Eingang der Dardanellen gefolgt war. Der Apparat hat in zwei Stunden 180 km durchmessen. Auch die Türken bereiten jetzt die Indienststellung einer Luftflottille vor; Mahmud Chefket Pascha hat dieser Tage das Geschwader im Flugpark von San Stefano besichtigt. Aber geradezu belustigend sind die inaktiven Kriegsabenteucr Vedrines, der immer grotesker wird und jetzt durch seine „hochpolitischen" Tiraden das Gelächter aller verständigen Leute auslöst. Vedrines hat eine Reise nach dem Balkan unternommen, wobei er allerdings klugerweise außerhalb des Bereichs der Schußwaffen geblieben ist. Er hatte gehofft, daß man ihn in Serbien als den Retter des Landes empfangen und gleich dort behalten werde, scheint sich aber doch geirrt zu haben; sogar die Serben haben wohl erkannt, daß sie es mit einem pathologisch zu behandelnden Maulhelden zu tun haben und haben ihn wieder nach Hause geschickt. Und hier hat nun der „große Jules" einen schreibwütigen Journalisten „empfangen", dem er eine seiner bekannten Tiraden losgelassen hat. „Die Serben sind die treuen Freunde unseres Landes, nachdem wir ihnen die Ueber-legenheit des französischen Geschützes gezeigt haben. Ich bin nun nach Belgrad gegangen, um den Leuten unsere Suprematie in Flugangelegenheiten vor Augen zu führen. Ich habe dem serbischen Kriegsminister wertvolle Ratschläge gegeben. Peinlich berührt hat mich die Haltung Oesterreichs, das, während ich in Belgrad war, die Stadt bombardieren ließ. . Oesterreichische Flugzeuge kreuzten unaufhörlich über Belgrad: das ist das brutale Recht des Stärkeren, und öerbien muß diese Behandlung erdulden, bis es für die Revanche reif ist. Ich will aus diesem sympathischen Volk ein starkes Volk machen. Ich werde bald nach Serbien zurückkehren und dort wichtige Arbeit tun. . . ." Wäre es nicht Zeit, daß man Jules Vedrines zum König des sympatischen Serbenvolkes ausruft oder wenigstens ihn zu seinem Chef und Gönner in eine Kaltwasser-Heilanstalt schickt ? Wir nähern uns nunmehr der Saison der Meetings, an deren Veranstaltung sich sämtliche flugsportliche Vereinigungen mit großem Eifer beteiligen. Namentlich scheint der Aero-Club de France, der sich in Henri Deutsch de la Meurthe einen neuen Präsidenten erwählt hat, mit besonderer Intensität wieder den flugsportlichen Manifestationen widmen zu wollen. Heute findet in Juvisy ein Flug-Meeting zugunsten der Witwe Andre Freys statt, das interessant zu werden verspricht. Auch für das große Wasserflugzeug-Meeting des „Aero" zeigt sich großes. Interesse und es haben sich hierfür bereits Ch emet (Borel), Bonnier (Hanriot), Rousselet (Rousselet), Bielovucie (Clement), Bregi (Breguet), Leblanc(Bleriot), D u bonnet (Bleriot), Simon (Chazal) Bellot (Chazal) u. a. vormerken lassen. Bleriot, Moräne,' Borel, Deperdussin, Paulhan, Astra, Nieuport, Hanriot, Caudron, Breguet stehen bereits auf der Nennungsliste. Die Ansscheidungsbewerbe (vom 4. bis 11. April; umfassen: Ingangsetzung der Maschine lediglich mit den an Bord befindlichen Mitteln (den Deutschen nachgemacht); Höhe von 500 m, die zu erreichen ist, indem sich der Bewerber vom Wasser erhebt und 30 Minuten nach dem Start sich wieder auf dem Wasser niederläßt; Schwebeflug aus einer Höhe von 100 m; Einhissen vermittelst eines Lademastes; Zurücklegung einer Strecke, ohne sich aus dem Wasser zu erheben, von 6,250 km. Der eigentliche Grand Prix von Monako wird an zwei Tagen bestritten: 1. Grand Prix von Monako (12. April): Kreuzfahrt Monako, San Remo, Monte Carlo, Beaulieu, Monako (Zwischenlandung in San Remo und Beaulieu), 80 km; 2. Grand Prix von Monako (14. April): Rennen in der Bai von Monako, um ein Polygon von ungefähr 500 km, mit Zwischenlandungen an vorbe-stimmten Punkten, ohne Verproviantierung. Sehr groß ist naturgemäß das Interesse, das sich auf den diesjährigen Gordon Bennett-Pokal richtet, der bekanntlich diesmal in Frankreich zur Bestreitung gelangt, und zwar als Teil eines großen Flugmeetings, das, wie nunmehr beschlossen worden ist, auf dem Flugfelde von Reims vor sich gehen soll. Dieses Flugmeeting der Champagne wird drei Tage umfassen, den 26., 27. und 28. September. Eine Reihe großer und interessanter Bewerbe, für welche bereits eine Summe von 300000 Frs. zur Verfügung steht, wird bei dieser Gelegenheit, außer dem eigentlichen Gordon Bennett, vor sich gehen. Dieser Tage sind folgende offizielle Homologierungen vorgenommen worden : Kriterium des Aero-Club de France: Fourny, ununterbr. Flug von 1010,800 km. Pokal Archdeaeon: Henri Farm an. Geschwindigkeit: Geschl. Rundstrecke, ohne Zwischenlandung, Flieger allein: 250 km in 2:01 :53-3. Zeit: Geschl. Rundstr., ohne Zwischenldg,, Flieger allein; in 2 Std. 246,937 km. Diese beiden Rekords sind von Vedrines am 9. Jan. 1913 zu Etampes aufgestellt. Höhe; Flieger und 1 Passagier: Legagneux, 27. Januar 1913: 3670 Meter. Wenn nicht alle Anzeichen täuschen, scheinen die Bestrebungen auf Sicherung des Maschinenfluges endlich von einem großen und entscheidenden Erfolge begleitet zu sein? denn nach den Erklärungen von offizieller Stelle ist die automatische Stabilität der Flugmaschine gefunden! Gelegentlich eines großen Festes zu Ehren des neu erwählten Präsidenten der französischen Republik im Lycee Louis le Grand am letzten Freitag, bei welcher Gelegenheit der bekannte Gelehrte und Parlamentarier Painleve" eine Konferenz über die heutige Aviation hielt, erhob sich ganz unerwartet Herr Rene Qinton, der Präsident der Ligue Nationale Aerienne, und machte vor dem Präsidenten Poincarö und der zahlreichen Versammlung folgende sensationelle Erklärung: „Ich habe Ihnen eine große Neuigkeit mitzuteilen. Die automatische Stabilisierung der Flugmaschine kann als gefunden angesehen werden] Es handelt sich um den Apparat Moreau, dessen Flugexperimente nunmehr wochenlang durch den vom General Hirschauer delegierten Leutnant Saulnier aufs eingehendste verfolgt worden sind. Moreau ist mit einem Passagier während 35 Minuten geflogen, ohne die Steuerungen zu berühren, außer um zu steigen oder sich herabzulassen. An dem Tage, wo dieses Experiment ausgeführt wurde, erreichte der "Wind die Geschwindigkeit von 7 m per Sekunde. Die Vorrichtung, die nach übereinstimmendem Urteil aller Techniker die beste ist, welche man bisher gefunden hat, besteht aus einem Pendel. Die „Gondel" befindet sich unterhalb der Flügel und der Apparat wirkt wie eine Wiegeschale. Was aber mit das interessanteste an dem System ist, das ist die automatische Blockierung des Pendels, sobald infolge von Windwirbeln oder Luftzugwirkung die Schwingungen zu starke werden. General Hirschauer hat seit Monaten die Arbeit des Erfinders in allen ihren Einzelheiten verfolgt. Es geschah alles ohne Geräusch, damit nicht die Aufmerksamkeit des Auslandes auf diesen Apparat gelenkt werde, welcher bestimmt ist, die wesentlichsten Dienste der Armee zu leisten. General Hirschauer hofft, auf Grund eingeleiteter Verhandlungen in Kürze die vollständige Cession dieser Erfindung an den französischen Staat erreichen zu können. (Der Apparat war im letzten Salon ausgestellt und ist im Flugsport Nr. 17 S. (i4rl Jahrg. 1912 beschrieben woiden. D. Red.) KL „FLUGSPORT'*. Seite 135  DU J'Ii/gmascäine im Balkan-Kjicg. Von oben nach unten: 1. Start eines Fliegers mit Bomben, weiche über Adrianopel abge- worfen wurden. 2. Das bulgarische fliege rlager, Bleriot-tzindeeker, bei Adrianopel. 3. Voision-Doppeldeckcr vor dem Start bei Adrianopel. 4. Durch unsachgetnässe Behandlung untauglich gewordene Bleriot- Eindevker. Die Flugmaschine im Balkankrieg. Verschiedentlich bringen die Tageszeitungen Berichte über ein Fiasko des Flugwesens im Balkankrieg. Diese Artikel sind geeignet, bei dem Laien den Anschein zu erwecken, daß der Mißerfolg auf das Konto der Flugmaschinen zu schreiben ist. Dem ist nicht so. Die Hauptschuld liegt an dem völlig ungeschulten Personal und den schlechten Unterkunftzelten. Sämtliche Bleriot-Apparate waren durch den lang andauernden Regen vernichtet worden. Das Holz des Rumpfes und der Flügel hatte sich vollständig verzogen Sämtliche Metallteile waren total verrostet. Transportgelegenheiten für Flugmaschinen gab es überhaupt nicht. Die Maschinen wurden große Strecken einfach auf ihren Fahrgestellen gefahren. Hierbei sanken die Räder fortwährend bis an die Achsen in den Morast. Reparatur-Werkzeuge und Werkstätten waren nicht vorhanden, so daß Apparate, die in einer Stunde hätten repariert werden können, einfach auf freiem Felde stehen blieben. Ebenso konnten viele Apparate nicht montiert werden, da keinerlei Personal vorhanden war. Ersatzteile fehlten ganz oder hatten sich nach irgend einer anderen Lagerstelle verirrt. Am besten schnitten noch die deutschen Apparate ab. Die von Rußland bezogenen Bleriot- und Nieuport-Eindecker, ebenso die russischen Farman-Doppeldecker blieben unbenutzt. Man muß sich wundern, daß die Flieger, beispielsweise der verunglückte Topratscheff, die ganz allein auf sich angewiesen waren, noch so hervorragende Resultate erzielten. Pneumatische Startvorrichtungen für Wasserflugmaschinen. Kapitän Chambers in Amerika hat eine katapultartige Startvorrichtung erfunden, die der Wright'schen im Prinzip sehr ähnlich ist. T)er Erfinder bringt die Startschienen a auf dem Panzerturm des Kriegsschiffes an. Auf diesen läuft ein Wurfwagen b. Derselbe wird mittels Seilflaschenzug c in Bewegung gesetzt, wobei der Lastweg mit dem Kraftweg vertauscht wird, wodurch eine TJeber-setzung ins Mehrfache des Kraftweges erreicht wird. Der Flaschenzug c wird von einem Preßluftkolben d angetrieben. Der Kolbenweg beträgt 1050 mm. Dicht neben dem Panzerturm liegt ein Preßluftreservoir e, wie es zum Auffüllen der Torpedos gebraucht wird. Dasselbe ist mit einer biegsamen Metallschlauchleitung f an den Preßluftzylinder angeschlossen und kann jeder Schwenkung des Panzerturms folgen. Der Start mittels dieser katapultartigen Einrichtung geht folgendermaßen vor sich: Der Motor wird angeworfen und auf ein Zeichen des Fliegers tritt der Preßluftflaschenzug c in Tätigkeit. Der Wurfwagen b eilt vorwärts und löst am Ende der Startschienen mittels eines Anschlages g eine Seilsicherung aus, welche einen Frühstart verhindern soll. Nach Lösung der Seilsichernng hat der Apparat bereits eine Geschwindigkeit von ca 80 km/Std. erreicht. Er beginnt sofort zu steigen, während der Wurfwagen b ins Wasser fällt und mittels Fangleine an Bord gehißt wird. Der ganze Vorgang dauert nur l'/s Sekunden nnrl bedingt bei seiner Kürze eine beträchtliche Inanspruchnahme des Fliegers No. 4 „FLUGSPORT". Seite 137 und der Maschine. Auf dem Kriegsschiff „Washington" wurde diese »Startvorrichtung zum ersten Male ausprobiert. Der Versuchsapparat, eine Curtiß-Wasserflugmaschine, wurde von Lt. Ellyson gesteuert. Nach erfolgtem Start flog der Apparat schräg abwärts und kam dem 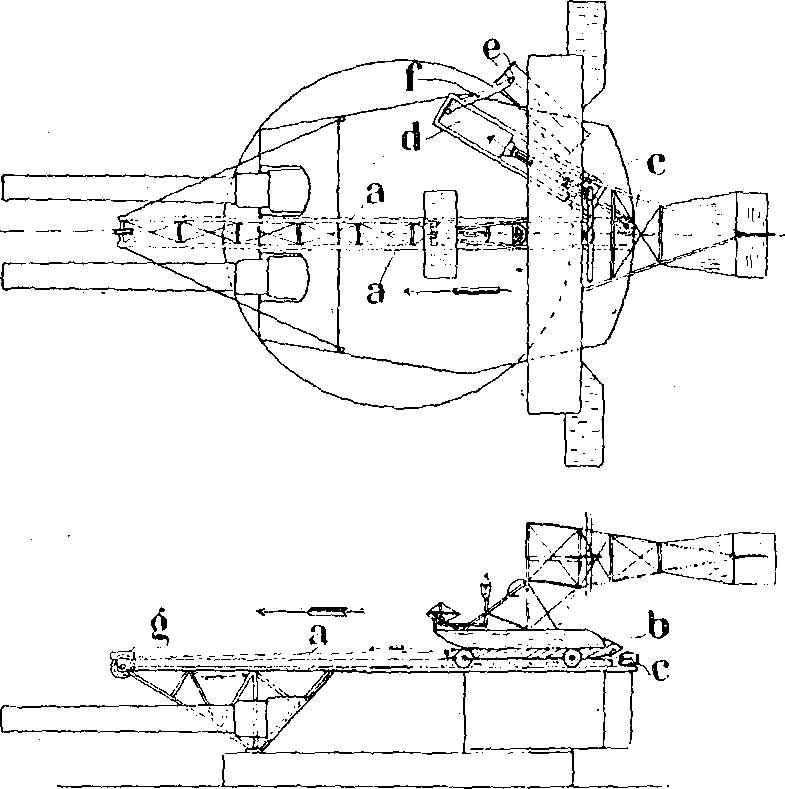 Pneumatische StartvorriMung an Bord von Kriegssdiißen für Wasserflugmasdiinen. Wasserspiegel bis auf 60 cm nahe. Es ist seitens der amerikanischen Marineverwaltung geplant, jedes Kriegsschiff mit einer Startvorrichtug System „Chambers" und einer Wasserflugmaschine auszurüsten. Ausbildung von Fliegern aus der National-Flugspende. Die Schwierigkeiten der Ausbildung von Fliegern aus der National-Flugspende durften überwunden sein. Es wird voraussichtlich den Fabriken überlassen werden, geeignete Persönlichkeiten auszuwählen und zum Flugführer auszubilden und dann einer offiziellen Prüfungskommission vorzuschlagen. Für diejenigen Kandidaten, welche dann die Prüfung vor dieser Kommission bestanden haben, wird dann an die Fabriken, welche die Ausbildung übernommen haben, ein entsprechender Betrag gezahlt. Eine direkte Verrechnung aus der National-Flugspende mit den Schülern wird somit unterbleiben. Das Risiko der Ausbildung wird demnach von den Firmen getragen. Ein Lebensunterhalt kann den Bewerbern aru der National-Flugspende während des Kursus nicht bewilligt werden. Es werden daher in der Hauptsache von den Fabriken nur solche Personen vorgesehlagen werden, die in ihrem Beruf Ingenieur, Mechaniker, Techniker u. s. w. sind und welche nach Erlangung des Piloten-Zeugnisses in ihren Beruf zurücktreten können, bezw. welchen die Ausbildung zum Flugzeugführer im wirklichen Berufe nicht von Nachteil sein kann. Die formellen Bedingungen, welche die National-Flugspende nebenbei stellt und die somit seitens der Fabrik vor Beginn des Kursus ebenfalls aufzustellen wären, sind: 1) Beibringung des Zeugnisses von einem Kreisarzt mit Dienststempel, daß der Reflektant diensttauglich ist, bezw. Aussicht besteht, daß er zum Militärdienst eingezogen wird, oder falls er bereits seiner Militärpflicht genügt hat, daß er noch diensttauglich und zum Fliegen geeignet ist, speziell schnelle Höhenunterschiede verträgt 2) Beibringung eines Leumundszeugnisses seitens der Ortspolizeibehörde, aus welchem ersichtlich ist, daß der Reflektant unbescholten ist. Die Firmen werden demnach' gezwungen sein, nur solche Schüler anzunehmen, welche einigermaßen Garantie dafür bieten, daß der Kursus mit Erfolg zu Ende geführt wird und welche ferner eine Bargarantie, Bürgschaft von anderer Seite aufbringen können, daß sie 1) nicht vorzeitig den Kursus abbrechen und 2) für Bruchschäden aufkommen. Es müssen demnach zwischen den Schülern und den Firmen besondere Lehrverträge abgeschlossen werden. Die Bewerber müssen das Lehrgeld sozusagen vorher deponieren. Nach Erfüllung ihrer Prüfung wird ihnen dann über die Fabrik aus der National-Flugspende der Betrag zurückgezahlt. Die neuen Bedingungen für Kriegsflugzeuge der Heeresverwaltung. Die Inspektion des Militär-Luft- und Kraftfahrwesens hat für die Konstruktion von Kriegsflugzeugen neue Bedingungen bekanntgegeben, welche den im Jahre 1913 für Heereszwecke anzukaufenden Flugzeugen zugrunde gelegt werden sollen. Die Bedingungen sind die folgenden: 1. Die Flugzeuge sollen grundsätzlich in allen Teilen aus deutschem Material hergestellt und deutschen Fabrikats sein. 2. Für Führer und Beobachter muß guter Sitz vorhanden sein, ferner ist notwendig leichte Verständigungsmöglichkeit für beide Flieger. Steuerorgane brauchen nur für den Führer vorhanden zu sein. 3. Für die Besatzung wird möglichst großer Windschutz und völlige Armfreiheit verlangt. Die Karosserie muß genügend Raum zum Einbau einer Abwurfvorrichtung und zur Unterbringung von Abwnrfbomben, sowie zum ungehinderten Photographieren besitzen. 4. Auf möglichst große automatische Stabilität und mühelose Betätigung der Steuerorgane wird besonderer Wert gelegt. 5. Abweichungen von der Militärsteuerung bedürfen besonderer Abmachung. 6. Es ist für übersichtliche Anordnung der Instrumente (Barometer, Barograph, Kompaß, Tourenzähler, Stoppuhr) Sorge zu tragen. Prüfungsmöglichkeit für den Benzin- und Oelstand durch den Führer im Fluge muß vorhanden sein. 7. Die Eigengeschwindigkeit muß mindestens 90 Kilometer in der Stunde betragen. Bei dieser Geschwindigkeit oder bei größerer muß ihre Herabsetzung während des Fluges bis auf 75 Kilometer möglich sein, ohne die Flugfähigkeit, d. h. die Möglichkeit, in wagerechter Linie geradeaus fliegen zu können, zu beeinträchtigen. 8. Die Qrößenmaße sind, mit Rücksicht auf die Unterbringung, folgendermaßen vorgeschrieben: größte Breite 14,5 Meter, größte Länge 12 Meter, größte Höhe 3,50 Meter. 9. Die Flugzeuge müssen Betriebsstoffe für 4 Stunden mit sich führen können. 10. Die Motorenstärke soll 100 Pferdekräfte nicht übersteigen. Abweichungen unterliegen der Genehmigung der Heeresverwaltung. Bei gleichwertigen Leistungen werden Flugzeuge mit schwächeren Motoren bevorzugt. 11. Die Betriebsstoffe müssen sicher und gefahrlos untergebracht werden können. Betriebsstoffbehälter Uber oder hinter der Besatzung sind ausgeschlossen. 12. Es muß eine Atilaßvorrichtung bezw Andrehvorrichtung vorhanden sein. 13. Der Spielraum für dje-^ropellerspitze darf nicht unter 45 Zentimeter vom Erdboden betragen. 14. Jedes Flugzeug hat eine Steigfähigkeit von 800 Metern in 15 Minuten nachzuweisen. 15. Die Anlaufstrecke'-d-arf auf ebenem Boden höchstens 100 Meter betragen (Startmannschaften sind gestattet), die Auslaufstrecke höchstens 70 Meter. Es muß eine Vorrichtung zum Wenden auf dem Boden vorhanden sein. 16. Abflugmöglichkeit und Landen ist auf dem militätischen Flugfeld in Döberitz (bei Typenabnahme) nachzuweisen. 17. Die Nutzlast soll mindestens 200 Kilogramm betragen können. Führer und Beobachter sind eingerechnet, nicht aber Betriebsstoffe, Instrumente und Werkzeuge. 18. Bei der Typenabnahme ist ein Gleitflug aus 500 m Höhe (mit Rechtsund Linkskurven) bei abgestellter Zündung auszuführen. 19 Schnelles Zusammensetzen und Zerlegen (als Norm gilt Montage mit 5 Mann in 2 Stunden, Demontage in 1 Stunde) wird gefordert; leichte Verlade-fähigkeit auf Eisenbahnwagen und Landfahrzeugen; Profilfreiheit für Eisenbahn und Straßentransport. 20. Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse. 21. Leichte Auswechselbarkeit einzelner Teile (z. B. des Fahrgestells). 22. Eine Einrichtung zur vorübergehenden Dämpfung des Motorgeräusches. Diese Bedingungen sind wesentlich schärfer als die bisher gültigen; aber unsere Flugzeugindustrie wird auch mit ihnen fertig werden. Sehr wichtig erscheinen die Bestimmungen über die Größenverhältnisse der Flugzeuge und über die Motorenstärken. Sie verhindern das Entstehen von „Ueberdreadnoughts" der Lüfte. Auf sehr große Schnelligkeit wird, wie bisher, auch in den neuen Bestimmungen nur geringer Wert gelegt. Man begnügt sich mit 90 km in der Stunde. Wesentlich verschärft hat man die Anforderungen an die Steigfähigkeit. Bei der alten Abnahmeprüfung mußte in 15 Minuten nur 500 in Höhe erreicht werden, während die Maschinen jetzt in der gleichen Zeit auf 800 Meter klettern müssen, um Gnade vor den Augen der Abnahmekommission zu finden. Die offiziell anerkannten Kartelle im D. L V. Vom Deutschen Luftfahrerverband wurden folgende 8 Kartelle anerkannt: 1. Bay eris ch e s Kartell 1036 Mitglieder, bestehend aus Königlich bayerischem Automobil-Club, Bayerischem Aeio-Club, Münchener Verein für Luftschiffahrt. 2. Mitteldeutsche Vereinigung 2353 Mitglieder, bestehend aus Anhaltischer Verein für Luftschiffahrt, Bitterfelder Verein für Luftschiffahrt, Erfurter Verein für Luftschiffahrt, Magdeburger Verein für Luitschiffahrt, Niedersächsischer Verein für Luftschiffahrt, Sächsich-Thüringerscher Verein für Luftschiffahrt, Verein für Luftverkehr, Weimar 3. Interessengemeinschaft sächsischer Vereine für Luftfahrt 2652 Mitglieder, bestehend aus Königlich sächsischem Verein für Luftfahrt, Leipziger Verein für Luftschiffahrt, Zwickauer Verein für Lufschiffahrt, Voigtländer Verein für Luftschiffahrt, Verein für Luftschiffahrt, Limbach i. Sa , Obererzgebirgischer Verein für Luftfahrt, Chemnitzer Verein für Luftfahrt. 4. Nordwestgruppe des D. L. V. 2830 Mitglieder, bestehend aus Braunschweigischer Verein für Luftfahrt, Bremer Verein für Luftfahrt, Hamburger Verein für Luftfahrt, Hannoverscher Verein für Luftfahrt, Lübecker Verein für Luftfahrt, Luftschiffahrt Verein Münster, Osnabrücker Verein für Luftfahrt, Schles-wig-Holsteinischer Flieger-Club, £eeoffizier-Luftkhib, Westfälisch-Lippischer Luftfahrtverein. 5. Ortsgruppe des D. L. V. 2276 Mitglieder, bestehend aus Brom-berger Verein für Luftfahrt, Ostdeutscher Verein für Luftfahrt, Ostpreußischer Verein für Luftfahrt, Posener Verein für Luftfahrt, Schlesischer Aero-Club, Schlesischer Verein für Luftfahrt, Verein für Luftfahrt Colmar in Posen, Westpreußischer Verein für Luftfahrt. 6. Süddeutsche Gruppe des D. L V. 1938 Mitglieder, bestehend aus Augsburger Verein für Luftfahrt, Oberschwäbischer Verein für Luftfahrt, Verein für Luftfahrt und Flugtechnik, Nürnberg-Fürth, Württembergischer Flugsport-Club, wHirttembergischer Verein für Luftfahrt. 7. Sudwestgruppe des D. L. V. 2807 Mitglieder, bestehend aus Breisgau-Verein für Luftfahrt, Frankfurter Verein für Luftfahrt, Kurhessischer Verein für Luftfahrt, Karlsruher Luftfahrt-Verein, Verein für Luftfahrt in Mainz, Luftfahrer-Verein Gießen, Mannheimer Verein für Luftfahrt, Mannheimer Flugsport-Club, Mittelrheinischer Verein für Luftfahrt, Oberrheinischer Verein für Luftfahrt, Verein für Luftfahrt am Bodensee, Verein für Luftfahrt in Darmstadt. 8. Westgruppe des D. L. V. 1209 Mitglieder, bestehend aus Düsseldorfer Flugsport-Club, Trierer Club für Luftfahrt, Hagener Verein für Luftfahrt, Kölner Club für Luftschiffahrt. No. 34S. Linnekogel, Otto, Johannisthal, geb. am 20. Februar 1891 zu Spandau, für Eindecker (Rumpier), Flugplatz Johannisthal, am 17. Januar 1913. No. 349. Schöner, Georg, Chauffeur, München, geb. am 16. April 1881 zu München für Zweidecker (Otto), Flugfeld Oberwiesenfeld, am 18 Januar 1913. No. 350. Demmel, Martin, Leutnant, lnf.-Regt. 13, München, geb. am 2. Mai 1886 zu Wunsiedel, für Zweidecker (Otto), Flugfeld Oberwiesetifeld, am 18. Januar 1913 Flugtechnische 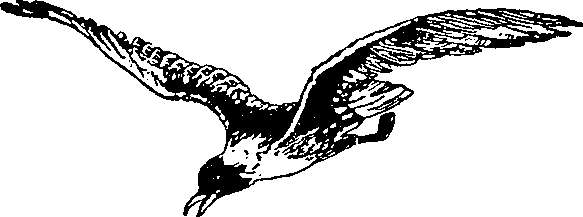 Rundschau. Inland. A'luffführer-Zeugnisse haben erhalten No. 351. Lichte, Carl, Gelsenkirchen, geb. am 10. Februar 1894 zu Gelsenkirchen, für Eindecker (Grade), Flugplatz Gelsenkirchen, am 18. Januar 1913. No. 352. Beck, Otto, Monteur, Johannisthal, geb. am 7. Juli 1890 zu Kornwestheim, für Eindecker (Rumplertaube), Flugplatz Johannisthal, am 20. Januar 1913. No. 353. Stüber, Joachim, Leutnant d. R., Berlin, geb. am 15. August 1885 zu Klötze (Sa), für Zweidecker (Wright), Flugplatz Johannisthal, am 24. Januar 1813. No. 355 Basser, Gustav, Techniker, Duisburg, geb. am 28 März 1894 zu Kiel, für Eindecker (Grade), Flugplatz Gelsenkirchen, am 24. Januar 1913. No. 355. Freiherr von Freyberg-Eisenberg - Allmendingen, Egloff, Leutnant 3. Garde-Reg. z. F., Berlin, geb. am 3. Oktober 1883 zu Allmendingen (Württ.), für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 24. Januar 1913. No. 356. von Gersdorff, Ernst, Oberleutnant Maschinengewehr-Abt. Nr. 11, geb am 25. Mai 1878 zu Straßburg (Eis.), für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 24. Januar 1913. No. 357. Ludewig, Fritz, Oberleutnant Inf.-Regt. 150, Alienstein, geb. am 6. Juli .1881 zu Oppeln, für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 30. Januar 1913. Von den Plugplätzen. Au) dem Flugplatz Habsheim herrschte in den letzten Wochen wieder lebhafter Flugbetrieb. Der Flieger Fall e r ist den bestehenden Weltrekords energisch zu Leibe gegangen und hat eine große Anzahl an sich gerissen. U. a. flog er am 9. Febr. mit 5 Fluggästen (6 Personen) im Gesamtgewicht von 409 kg ohne Betriebsstoff 1 St. 10. Min. 17 Sek. Am 13. Febr. stellte er wieder einen neuen Weltrekord auf, indem er mit 2 Fluggästen (3 Insassen) 3 St. 15 Min 30 Sek. in der Luft blieb. Die Feldpilotenprüfung erfüllten am 12. Febr. Oberleutnant Jerrmann und Leutnant v. Mirbach in einwandfreier Weise auf Aviatik-Doppeldecker-Der Flieger Ingold machte auf dem neuen Pfeil-Doppeldecker der Aviatik einen Höhenflug. Flugplatz München-Oberwiesenfeld. In der bayrischen Fliegerschule herrschte in letzter Zeit wieder reges Leben. So erfüllte Lt. Fritz Moosmeier auf einem Militär-Otto-Doppeldecker mit 70 PS Gnom die Bedingungen für das Feldpilotenzeugnis durch einen 1 stündigen Ueberlandflug nach Freising und zurück. Am Freitag den 7. Februar unternahmen die Fliegeroffiziere Lt. Freiherr von Hai ler als Führer und Lt. Sager er als Fluggast auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argusmotor einen Ueberlandflug nach Augsburg zwecks Ueberbringung einer militärischen Meldung. Nachdem die Flieger wohlbehalten auf dem großen Exerzierplatze in Augsburg gelandet waren, erfolgte nachmittags 4 Uhr die Rückfahrt nacli Oberwiesenfeld, wo die Offiziere nach nur 30 Minuten Flugdauer wieder glücklich eintrafen. Auch in der Fliegerschule Otto wurde fleißig geflogen. Die Flieger 5 ch ö n er und Janis ch vollführten zahlreiche kleinere Flüge über die Umgebung Münchens. Am Donnerstag den 6. Februar überführte trotz böigen Wetters Schöner den Otto-Zweidecker No. 57 mit 100 PS Argus-Motor nach Puchheim Nachdem Schöner längere Zeit in etwa 600 m Höhe über Pasing gekreuzt hatte, setzte infolge Oelmangels plötzlich der IVotor aus, geschickt jedoch brachte Schöner in tadellosem Gleitflug den Apparat ohne jede Beschädigung zur Erde. Nach Einnahme von Oel und Benzin stieg der Flieger wieder auf und landete bald darauf glatt in Puchheim. Flugplatz Gelsenkirchen-Essen-Rotthausen. Bei den Kondor-Flugzeugwerken wurde das dritte Flugzeug nach Vereinbarung mit der Heeresverwaltung am 1. Februar fertiggestellt. Bei dem schlechten Wetter Anfang Februar konnte der Apparat nicht geflogen werden. Am 5. Febr. wurde der Apparat aus dem Schuppen gezogen und stieg mit kurzem Anlauf sofort unter Führung seines Konstrukteurs in eine Höhe von 600 m, wobei Essen, Gelsenkirclien und die umliegenden Städte überflogen wurden. Der Apparat wurde abmontiert und nach Döberitz verladen. Am 1?. Februar vollführte Suwelack eine ganze Reihe von Passagierflügen, die durchschnittlich 15 Min. dauerten. — Die Wasserflugmaschine geht ihrer Vollendung entgegen und wird nach Fertigstellung sofort am Rheine ausprobiert. Auf dem Flugplatz Leipzig-Lindenthal bestand die Feldpilotenprüfung Lt. d. R. Krey auf Mars-Doppeldecker mit 100 PS Mercedes-Motor. Lt. Krey erreichte in 7 Minuten 500 m Höhe und flog über Delitzsch nach Halle und zurück. Ferner erfüllten bei den Deutschen Flugzeug-Werken die Feldpilotenprüfung Lt. Zwickau vom Westfälischen Pionier-Batl. 10 und Unteroffizier Kramm. Am 16. Febr. stürzte der Telegraphen-Assistent Lenk, welcher im Herbst das Fliegerzeugnis auf Mars-Doppeldecker erworben hatte, tödlich ab. Der Flieger, der vorher gewarnt worden war nicht zu hoch zu gehen, drosselte in 800 m Höhe stark den Motor. Die Maschine fiel schnell auf 200 m, wo der Flieger noch mehr Tiefensteuer gab. Sie überschlug sich und der Flieger stürzte aus dem Apparat. Eine Revision der abgestürzten Maschine, die kaum beschädigt war, ergab, daß dieselbe in allen Teilen vollständig intakt war. Wenn der Flieger festgeschnallt gewesen wäre, hätte der Unfall vermieden werden können. Vom Flugplatz Schulze Burg bei Magdeburg. Auf dem S ch ul ze-Ei n de ck e r haben bisher 11 Schüler die Fliegerprüfung bestanden. Die meisten lernten ohne jeglichen Bruchschaden fliegen. Die Apparate sind jetzt mit Militärstsuerung ausgerüstet. !Vm 28. Januar flog G.Schulze auf seinem Zweisitzer 35/40 PS Motor luftgekühlt mit Fluggast nach Burg, umkreiste ein dort niedergegangenes Militärflugzeug, landete auf weichem Ackerboden und flog kurz darauf ohne Schwierigkeiten wieder nach dem Flugplatze. Kurze Zeit darauf startete er nochmals mit Gast zu einem Ueberlandflug nach Burg, Uberflog die Kaserne und wandte sich dem Flugplatz wieder zu, wo' er nach 12 Minuten glatt landete. Am 5. Februar bestand der Schüler Heller die Fliegerprüfung trotz böigen Windes, ebenso wird Schüler Koch Siek die Prüfung in Kürze ablegen. Zu Lehrzwecken stehen z. Zt. zwei Ein- sowie zwei Zweisitzer bereit, weitere Maschinen sind im Bau. Auf dem Flugplatz der Casseler Fliegerschule Carl Abelman, Waldau-Cassel, beginnt jetzt wieder reges Arbeiten der Flugschüler. Der Flieger Abel mann selbst vollführte mehrere gut gelungene Flüge, darunter einen Ueberlandflug Bergliausen-Crumbach-Ochshausen-Betten-hausen-Aue-Cassel, der mit einem Gleitflug aus 800 m Höhe bis dicht vor die Fkighalle endete. Vom Flugplatz Jf anne-Herten. Die meisten Flüge und längste Flugdauer hatte der Gradeflieger Br am ho ff von der I. Rheinisch-Westfälischen Fliegerschule (Bosenius) zu verzeichnen. Für die nächste Zeit ist mit einem regen Flugbetrieb zu rechnen und steht zu erwarten, daß die vorhandenen Schuppen bald nicht mehr ausreichen werden. Ingenieur Schumacher wird dem Publikum öfters Gelegenheit geben, seinen Ein- decker zu besichtigen. Die Doppeldecker der Firma Dieck, Essen,' sind soweit fertiggestellt, daß bei günstiger Witterung die ersten Flüge mit ihnen unternommen werden können. Wie uns ferner mitgeteilt wird, will die Chauffeurschule Dieck auch mit einem Bleriot-Eindecker in die Oeffentlichkeit treten. Es stehen dem jungen Unternehmen also momentan schon 3 Flugzeuge zur Verfügung. Die Deutschen Aristoplanwerke haben einen Aristoplaneindecker mit 100 PS Argus-Motor bereits flugfertig stehen. Sobald das Wetter einigermaßen günstig ist, werden die ersten Flugversuche mit dem neuen Apparat unternommen. An dem zweiten Eindecker, welcher voraussichtlich in allernächster Zeit fertiggestellt ist, wird fleißig gearbeitet. Die erste Rheinisch-Westfäliche Fliegerschule hat augenblicklich 2 Flugzeuge in Betrieb. Die Schule erfreut sich eines regen Besuches. Von den Flugschülern werden einige in den nächsten Tagen ihr Fliegerexamen machen. /Militärische Flüge. In den letzten Wochen sind von unseren Offiziersfliegern recht beachtenswerte Leistungen vollbracht worden. So wurden beispielsweise von Offizieren der Metzer Flregerstation die Etappen Metz—Saarburgr^Straßburg—Speyer—Frankfurt-Kaiserslautern — Saarbrücken—Metz, eine Strecke von 640 km, in 8 Tagen programmmäßig durchflogen. An diesem UeberJandfluge nahmen teil: Lt. Schulz, P.-B. 16 als Führer und Oberlt. Kolbe J.-R. 97, Beobachter auf Albatros-Doppeldecker 100 PS Argus-Motor und Lt. Schneider, 8. Sachs. Fußart.-Reg. als Fuhrer mit Lt. Fricke F.-Art. 70 als Beobachter auf L. V. G.-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor. Beide Apparate sind bis Kaiserslautern stets mit 5-10 Minuten Abstand gestartet bezw. gelandet. Apparat Lt. Schneider wurde infolge der Dunkelheit nach Saargemünd orientiert, wo bei der Landung durch Anstoßen an einen Apfelbaum eine geringe Beschädigung entstand, die aber bald ausgebessert war, so daß der Apparat nach Metz zurückfliegen konnte. Im übrigen haben die Motore tadellos funktioniert und bis auf die erwähnte Beschädigung sind sämtliche erforderlichen Arbeiten nur durch die Offiziere ohne Monteure ausgeführt worden. Die Flieger-Offiziere der Darmstädter Station führten in den letzten Tagen größere Ueberlandflüge aus, und zwar flogen Leutnant Reinhardt, der bekannte Flieger, mit Oberleutnant von Blumenbach als Beobachter und Leutnant v. Mirbach mit Leutnanl van Beers als Passagier auf ihren Euler-Doppeldeckern von Frankfurt nach Heidelberg. Reinhardt nahm seinen Weg über Darmstadt in 1600 m Höhe, Leutnant von Mirbach Uber Mannheim. Leutnant Sommer mit Hauptmann von Dewall, dem Führer der Darmstädter Station, als Passagier flog von Darmstadt über Mannheim nach Heidelberg, wo die drei Flugmaschinen in Abständen von wenigen Minuten ankamen. Die Offiziere wurden von den städtischen Behörden begrüßt und waren Abends Gäste der Stadt. Die genauen Zeiten am 10. Februar 1913 waren folgende: Reinhardt mit Oberlt. von Blumenbach 2: 19 Start in Frankfurt, 3: Ol Landung Darmstadt, 4: 18 Start Darmstadt, 5: Oö Landung Heidelberg. Sommer mit Hauptmann von Dewall 3:17 Start in Darmstadt, 4:02 Landung Mannheim, 4:50 Start in Mannheim. 5:03 Landung in Heidelberg. v. Mirbach mit Leutnant van Beers 2 : 35 Start in Frankfurt, 3:30 Landung in Mannheim, 4:32 Start in Mannheim, 4:50 Landung in Heidelberg. Am nächsten Tage ging der Fing nach Karlsruhe weiter, wo die Flieger das üroßherzogliche Schloß umflogen, um dem hohen Brautpaare ihre Huldigung darzubringen. Es flogen am 11. Februar 1913 Reinhardt mit Oberleutnant von Blumenbach 9:03 Start in Heidelberg, 9:44 Landung in Karlsruhe (mit Zeppelin zusammen über dem Schloß in dem der Kaiser und das jungverlobte Paar war), 3:06 Start Heidelberg, 4:23 Landung Gernsheim. (Undichter Benzinbehälter. Wenig Benzin.) Sommer mit Hauptmann von Dewall 3 : 30 Start Heidelberg, 4 : 00 Landung Karlsruhe (Ehrenrunde über Schloß). v. Mirbach mit Leutnant van Beers 9:10 Start in Heidelberg. 10:00 Landung in Karlsruhe (Ehren - A ch t in 300 m über dem Schloß), 2 : 50 Start Karlsruhe. 3:30 Landung Heidelberg: Am 12. Februar 1913. Reinhardt mit Oberleutnant von Blumenbach !): 17 Start in Gernsheim 10:06 Landung Heidelberg. Sommer mit Hauptmann von Dewall 4:00 Start Karlsruhe, 4: 45 Landung Heidelberg. Am 13. Februar 1913. Reinhardt mit Oberlt. von Blumenbach 2:37, Start Heidelberg, 3:35 Landung Darmstadt. Sommer mit Hauptmann von Dewall 3:30 Start Heidelberg, 4:24 Landung Darmstadt. v. Mirbach mit Leutnant van Beers 3:30 Start Heidelberg, 4:26 Landung Darmstadt. Flug Metz—Berlin. Am 5. Februar flog Leutnant Carganico mit Major Siegert als Beobachter auf L. V. G.-Doppeldecker mit 100 PS N. A. G.-Motor von der Fliegerstation Metz in 2 Stunden 20 Minuten ohne Zwischenlandung nach der Fliegerstation Darmstadt. Die durchschnittliche Höhe betrug 1300 Meter. Zweck des Fluges war die Besichtigung der Station Darmstadt durch den Kommandeur der Stationen des Westens Major Siegert. — Am 6. Februar setzte Leutnant Carganico seinen Flug von Darmstadt bis nach Berlin mit einer Zwischenlandung fort. Sein Beobachter war Leutnant Friedrich (G.-R. 79). Er legte 170 km in 1 Stunde 45 Minuten zurück. Ueberlandflüge der Straßburger Station. Leutnant Geyer flog yon Straßburg über Metz und landete am Sonnabend, den 8. Februar in Frankfurt. Am 9. Februar flog er in Frankfurt wieder ab und erreichte Gotha nadi einer Zwischenlandung in Eisenach, da ihm das Benzin ausgegangen war. Am 15. Februar flog er in Gotha wieder ab nach Cassel, wo er in Gegenwart des Fürsten Carl von Waldeck landete. Sommer-Flugzeug Frankfurt. Mit dem von Robert Sommer konstruierten Zweidecker wurden in letzter Zeit mehrere sehr gelungene Flüge ausgeführt. U. a. flog der Flieger Bernard de Waal am Sonnabend den 15. Febr. 5 Runder, in 80 m Höhe. Die Maschine kam sehr leicht vom Boden weg und führte vor der Landung einen auffallend gestreckten Gleitflug aus. Der Einein-halbdecker besitzt, wie die nebenstehende Abbildung erkennen läßt, ein sehr einfaches Fahrgestell. Höhen- und Seitensteuer befinden sich hinten Zum Betriebe dient ein 70 PS Rotationsmotor, eine vollständig deutsche Konstruktion des Ingenieur Hoff mann in Frankfurt.  Der neue Sommer-Eineinhalbdecker mit 70 PS Hojfmann-Rptations-Motor im Fluge über dem Frankfurter Flugplatz. 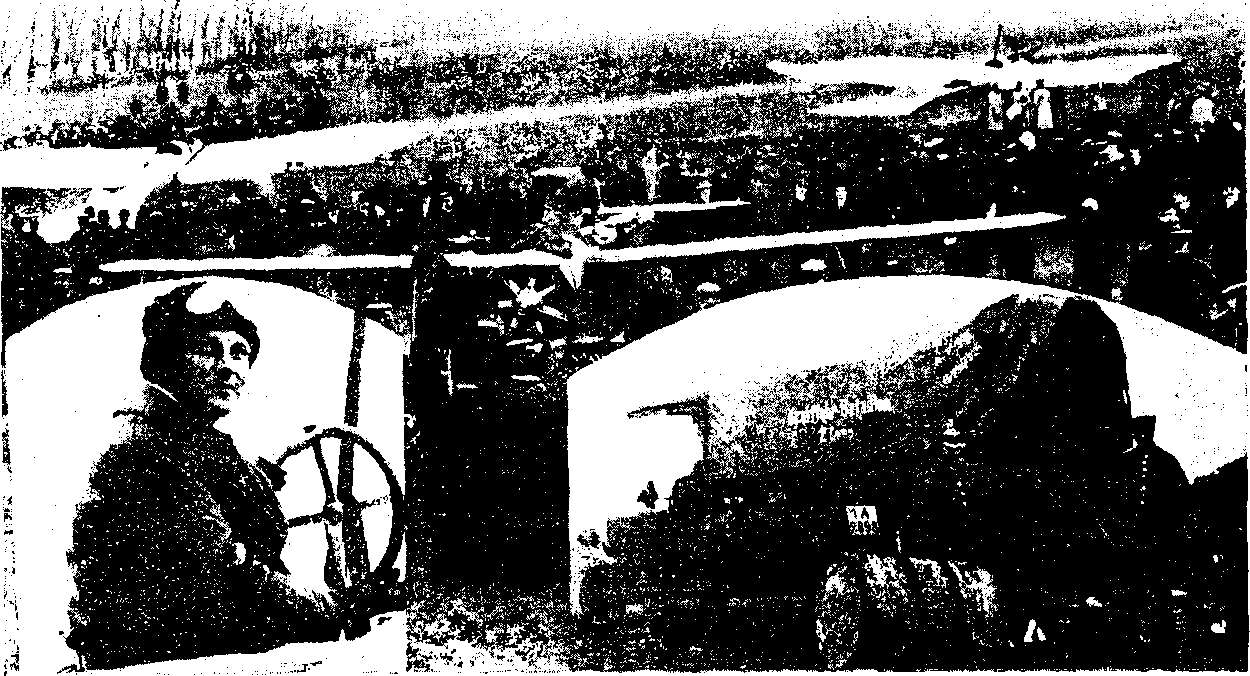 Militärflugzeugübung bei Magdeburg. (Vergt. Flugsport No. 3). Oben: 2 Riimplzr -Tauben vor dem Start, in der Mitte ein Bristol-Eindecker in Reparatur. Links unten: der tödlich abgestürzte Lt. Schlegel. Reclits unten: Reparatur- und Ersatzteile-Automobil des /(raftfahr -Bataillons. Erfolge mit dem Koberschen Wasserflugzeug auf dem Bodensee. Innerhalb drei Tagen legte der Flieger der Flugzeugbau Friedrichshafen G. m. b. H., Robert Gsell, mit dem Koberschen Wasserflugzeug 600 Kilometer in zusammen 7 Stunden zurück. Die Landungen waren zumeist Gleitflüge aus größeren Höhen (bis zu 560 m) auf dem Seespiegel. Dabei führte er 300 Kilo Nutzlast mit, gemäß den Vorschriften für militärische Brauchbarkeit. Als Fluggast beteiligte sich der Kaiserliche Marinebaumeister Pietzker aus Kiel an den Flügen. — Ingenieur Kober hat nun auch einen Wasser-Eindecker als Sportflugzeug konstruiert, das demnächst seine Flugversuche beginnen wird. Kapitänleutnant Janetzky und Obertnaschinistenmaat Di eck m a n n, die am 7. Febr vormittags 10 Uhr in Putzig zu einem Ueberlandflug nach Stolp aufgestiegen waren, mußten wegen widriger Winde bei Neustadt umkehren und in Danzig landen. Sie stiegen um 4 Uhr wieder zur Rückfahrt nach Putzig auf. Ueber dem Meere, bei Zoppot, brach plötzlich ein Flügel des Flugzeugs, das aus 150 m Höhe in die Ostsee stürzte. Beide Flieger fanden den Tod in den Wellen. Kapitänleutnant Walter J an e t zky, geboren zu Minden am 4. Juli 1882, gehörte dem Seekadettenjahrgang 1900 an, war seit dem 25. April 1912 Kapitänleutnant und zu der Marineflugstation Putzig kommandiert. Ausland. Grahame White hat in St. Moritz während der Winlermonate Flüge ausgeführt. Er benutzte hierzu einen Farman-Doppeldecker Militärtyp mit 80 PS Gnom-Motor. Der Apparat ist im „Flugsport" Nr. 1 ausführlich beschrieben. 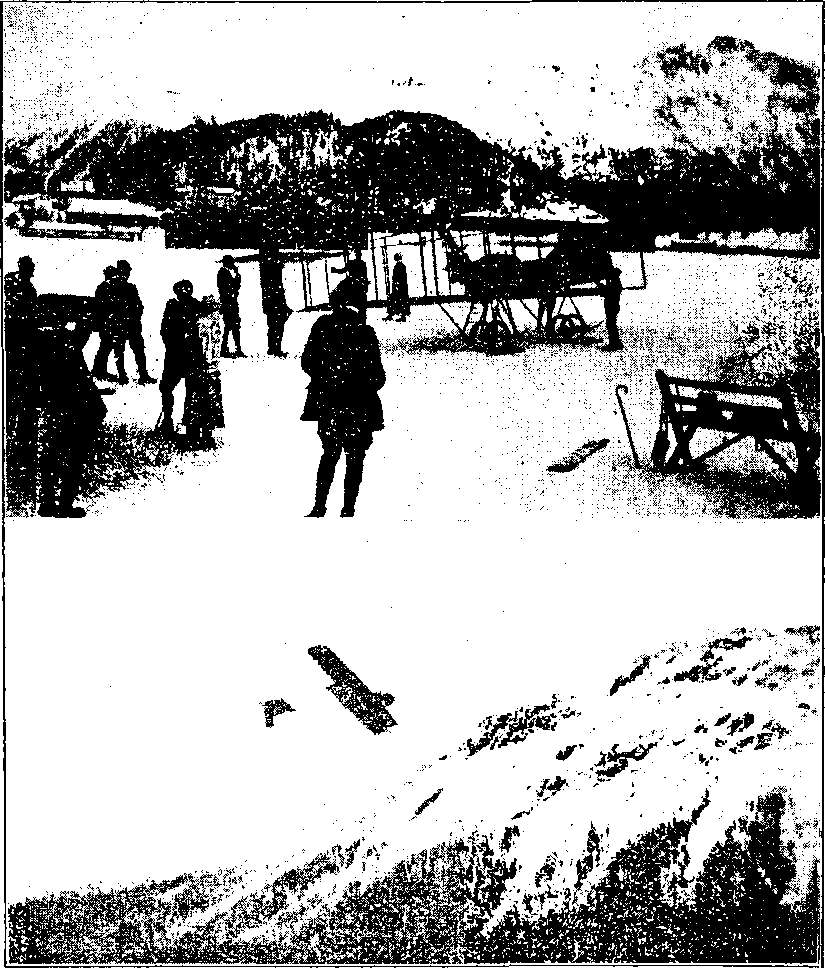 Grahame White auf Farman-Doppe/decker in St. Moritz. Patentwesen. Patentanmeldungen. 77h. N. 12 649. Lufttorpedo mit Tragflächen, Stabilisierungsflächen und Schraubenpropeller. Carl Nittinger, Breslau, Michaelisstr. 4. 12. 8. 11. 77h. C. 21389. Flugzeug mit einer durch gelenkig angeordnete Arme ausbreitbaren Stabilisierungsfläche. Willard Barlett Clements, West Union, Jowa, V. St. A ; Vertr.: Dipl.-Ing. S. F. Fels, Pat.-Anw., Berlin SW. 61 18. 12. 11. 77h. S. 36891. Schraubenpropeller mit an einem Ring befestigten Flügeln und federnder Verbindung mit der Nabe. Friedrich Sasse, Berlin, Glogauer-straße 24 1. 8. 12. . 77h. Sch. 40115. Propeller, dessen Flügel aus mit Stoff überspannten Rahmen bestehen. Theodor Schober, Zürich, Schweiz; Vertr.: Dr. B. Alexander-Katz und Dipl.-Ing. G. Benjamin, Pat-Anwälte, Berlin SW. 48. 27. 12. 09. Patenterteilungen. 77h. 257453. Antriebsvorrichtung für Luftfahrzeuge mittels eines auf dem Erdboden aufgestellten Motors durch eine Transmission. Lucien Brianne, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr. G. Döllner, M. Seiler, E. Maemecke und Dipl.-Ing. W. Hildebrandt, Pat-Anwälte, Berlin SW. 61. 26. 4. 10. B. 58429. Gebrauchsmuster. 77h. 537 251. Aeroplanrumpf. Ernst Rover, Haus Neindorf, Harz. 19. 11. 12 R. 34405. 77h. 537299. Stahlträger mit Holzeinlage. Dr. Walter Lissauer, Johannisthal. 24. 12. 12. L. 30834. 77h. 537 695. Stiel für Luftfahrzeuge aus Furnierrohr mit Hohlkern. Johannes Grunewald, Hannover, Am Schiffgraben 52. 30. 12. 12. G. 32206. 77h. 538043. Fachwerkträger für Luftfahrzeuge mit Diagonalverspannung aus Drähten ohne Spannschloß. Allgemeine Elektrizitäls-Gesellschaft. Berlin. 30. II. 12. A. 19615. 77h. 538 062. Käfiganordnung für Flugzeuge zum Anschließen von Gehängen. E. Rumpier LuftFahrzeugbau G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg. 21. 12. 12. R. 34707. 77h. 538 061. Käfiganordnung für Flugzeuge zum Anschließen von Gehängen. E. Rumpier Luftfahrzeugbau G. m. b H., Berlin-Lichtenberg. 21. 12. 12. R. 34 708. 77h. 538 1 94. Klemmvorrichtung für Drähte und Seile. Dipl.-Ing. Alfred Marcel Joachimczyk, Kurfürstenstr. 46, Dipl.-Ing. Dr. Victor Quittner, Rosen-heimerstr. 27, und Ansbert Vorreiter, Bülowstr. 73, Berlin. 22. 10. 12. V. 10637. 77h 538195. Befestigungsschelle. Dipl.-Ing. Alfred Marcel Joachimczyk, Kurfürstenstr. 46, Dipl.-Ing. Dr. Victor Quittner, Rosenheimerstr. 27, u. Ansbert Vorreiter, Bülowstr. 73, Berlin. 22. 10. 12. V. 10 638. 77h. 538 196. Spannschloß für Seile und Drähte. Dipl.-Ing. Alfred Marcel Joachimcyk, Kurfürstenstr. 46, Dipl.-Ing. Dr. Victor Quittner, Rosenheimerstr 27, u Ansbert Vorreiter, Bülowstr. 73, Berlin. 22. 10. 12. V. 10639. 77h. 538 350. Untergestell für als Aero-bezw. Hydroplane zu verwendende Flugzeuge. Ago Fluggesellschaft m. b. H., Johannisthal b. Berlin. 6. 9. 12 A 19135. 77h 538356. Selbststabilisierung für Flugmaschinen. Heinrich Schuchardt u. Julius Kastner, Offenbach a. M., Waldstr. 136 . 27. 11. 12. Sch. 46.21. 77h. 538 558. Fluganlage für Schauzwecke. Gustav Koeber, Johannisthal b. Berlin, Parkstr. 18 3. 1. 13. K. 56 264. 77h. 538 599. Nie kippendes Fluggestell, dessen Tragflächenträger unten ein Fußgestell bildet. Alfred Faber, Hamburg, Eppendorferweg 167. 11. 12 12. F. 28 277. 77h. 539 882. Eindecker in Pfeilform. Paul Miketta, Rybnik. 15. 1. 13. M 44 829. 77h. 540167. Luftschraube für Luft- und Wasserfahrzeuge, hinter deren Einschiebkante der Länge nach eine Hohlkehle angeordnet ist. Franz Reschke, vorm. Julius Metzer, G. m. b. H, Berlin. 28. 11. 12. R. 34430. 77h. 540 358. Befestigungs-Vorrichtung von Tachometern an Flugzeugen. Deuta-Werke vorm. Deutsche Tachometerwerke G m. b. H, Berlin. 21. 1. 13. D. 24225. 77h. 540458. Flugzeug mit selbsttätig in ihrer Längsachse sich einstellenden Flügeln aus einzelnen je nach ihrer Lage im Flügel gebogenen und geformten Federn. Georg Sandt. Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 35" 23. 1. 13. S. 29288. Fahrgestell für Flugzeuge.*) Gegenstand der Erfindung ist ein Fahrgestell für Flugzeuge, bestehend aus seitlichen abgefederten Rädern und einer mittleren abgefederten Landungskufe. Das wesentliche Merkmal der Erfindung besteht darin, daß jedes der Räder an einer besonderen, an der Kufe angelenkten Halbachse angeordnet ist und durch eine gelenkig an der Radachse und doppelt gelenkig am Flugzeuggestell angebrachte, elastisch in einer Röhre verschiebbare Seitenstütze abgefedert wird. Dadurch können nämlich die Räder sich so verschieben, daß die Kufe allein den Stoß bei der Landung aufnimmt und dämpft. Es sind zwar bereits Fahrgestelle bekannt, bei denen neben den Rädern elastische Kufen Anwendung finden; jedoch vermochten die Räder hierbei nicht genügend auszuweichen, so daß sie einen beträchtlichen Teil des Landungsstoßes ganz aufnehmen mußten und leicht zerbrachen. Die Zeichnung zeigt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, und zwar in Abb. 1 eine seitliche Ansicht, Abb. 2 eine Queransicht nach X-X der Abb. 1 und Abb. 3 eine Ansicht von oben. Das Gestell besitzt in der Mitte zwischen den Rädern eine Kufe A, die auf ihrer einen Seite eine Hülse B, an die sie im Punkte a angelenkt, auf der andern Seite dagegen durch einen hydropneumatischen Puffer mit dem Gestell verbunden ist. Die auf der Gestellstange b verschiebbare Hülse B wird durch eine Schraubenfeder c gegen den Wulst C gelagert und dient zur Abfederung des Apparates beim Landen. Denselben Zweck verfolgt der hydropneumatische Puffer, der aus einem bei d an die Kufe angelenkten Kolben D besteht. Dieser Kolben bewegt sich im Innern eines im Apparat angebrachten Bremszylinders E. Eine Schraubenfeder F stützt sich auf der einen Seite auf einen im Kolben D angeb achten Flansche, auf der anderen Seite dagegen gegen eine Feder f im Zylinder E. Diese Schraubenfeder führt nach dem Abfangen des Stoßes den Kolben D und damit zugleich die Kufe wieder in die normale Lage zurück. Auf der Kufe A sind zu beiden Seiten bei g und h die Halbachsen G und H angelenkt. Auf diesen Achsen sind die Räder J und J1 montiert. Die Achsen tragen zwei Muffen i und j, an denen die Stangen K und L angelenkt sind. Diese sind in zwei Röhren k und 1 beweglich angebracht, in denen sich die Federn M und N befinden, die durch die Stangen K und L auf Druck beansprucht werden. An den Röhren k und 1 sind im rechten Winkel zwei Arme m und n angebracht, die sich in den zwei Muffen O und P drehen können. Diese Muffen und die Röhren k und 1 werden von den Muttern o und p zusammengehalten. Die Muffen O und P sind bei q und r am A parat angelenkt Außerdem ist noch jedes Rad dieses Apparates mit einer Bremse versehen. Die Wirkungsweise dieser Vorrichtung ist folgende: Beim Landen kommen zunächst die Räder mit dem Boden in Berührung. Wenn der Führer die Bremse in Tätigkeit setzt, wird die Bewegung der Räder gehemmt, doch werden diese nicht vollständig festgehalten wegen der zwischengelagerten Schraubenfeder U. Die Stangen K und L werden dabei in die Röhren M und N hineingeschoben, und die Gelenkverbindungen g und q auf der einen Seite und h, j und r auf der anderen Seite treten in Tätigkeit und ermöglichen einesteils eine Drehung des Systems um die Achse q oder r, auf der anderen Seite eine Drehung der Röhren M und N in den Muffen O und P. Im weiteren Verlauf kommt die Gleitschiene mit dem Boden in Berührung und der hydropneumatische Puffer fängt den Stoß auf. *) D. R. P. Nr. 252 701, Robert Esnault Pelterie in Billancourt, Frankreich. Die Erfindung kann auch in der Weise ausgeführt werden, daß nur ein Rad vorhanden ist, das alsdann mitten unter dem Apparat an dem hydropneumatischen Puffer angebracht wird, und daß die Kufen seitlich gelagert und mit dem Appa- Abb. 1 Abb. 2 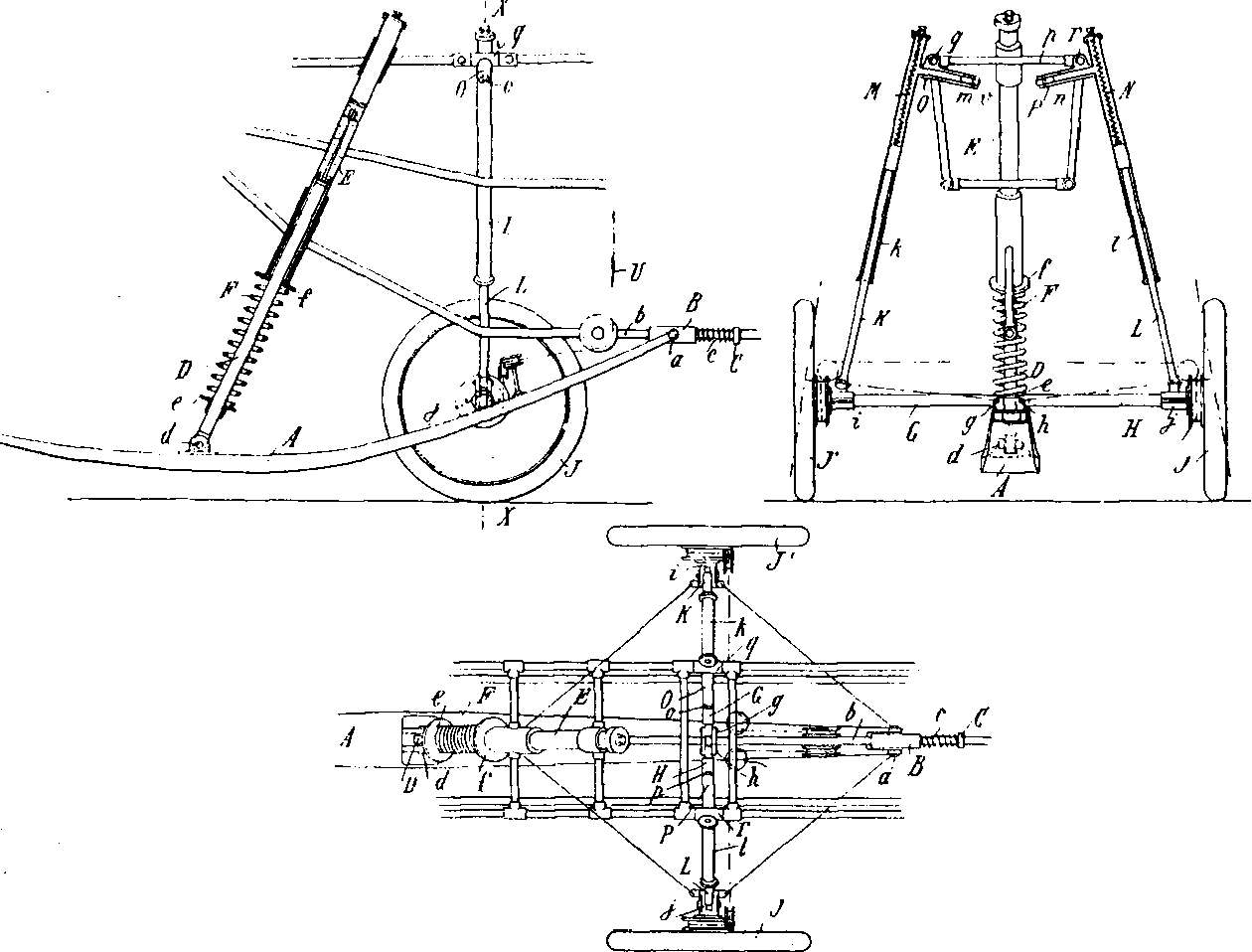 Abb. 3 ratgestell oder den Tragflächen durch die nachgiebige Vorrichtung verbunden werden. Patent-Anspruch: Fahrgestell für Flugzeuge, bestehend aus seitlichen abgefederten Rädern und einer mittleren, abgefederten Landungskufe, dadurch gekennzeichnet, daß jedes der Räder auf einer besonderen, an der Kufe angelenkten Halbachse angeordnet ist und durch eine gelenkig an der Radachse und doppelt gelenkig am Flugzeuggestell angebrachte, elastisch in einer Röhre verschiebbare Seitenstütze abgefedert wird. Verschiedenes. Verordnung zur Regelung: des Verkehrs mit Flugzeugen. 1. Die Führer von Flugzeugen sind gehalten, das Ueberfliegen größerer Ortschaften, sofern nicht ein besonderes Interesse oder Veranlassung dafür vorliegt, nach Möglichkeit zu vermeiden. 2. Den Führern von Flugzeugen ist verboten: das Ueberfliegen von Sprengstoff-Fabriken, Petroleumlagern, Gasanstalten und ähnlichen feuergefährlichen Anlagen, von Grundstücken die von elektrischen Hochspannungsleitungen netzartig überzogen sind, fürstlichen Schlössern, einschließlich der dazu gehörigen Gartenanlagen, sowie Befestigungen, falls hierzu nicht eine schriftliche Erlaubnis der zuständigen militärischen Behörde (Gouvernement, Kommandantur usw.) erteilt ist; diese Erlaubnis ist durch den Deutschen Luftfahrer-Verband nachzusuchen. Ebenso ist verboten das Ueberfliegen größerer Menschenansammlungen bei Schaustellungen und Veranstaltungen jeder Art, wie z. B. Paraden, Rennen, auf öffentlichen Märkten, Badeplätzen, in Volksgärten usw. 3. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen kann das Flugführerzeugnis bis zur Dauer von 6 Monaten, bei Zuwiderhandlungen im Wiederholungsfalle dauernd entzogen werden. 4. Die vorstehende Verordnung tritt mit dem 1. Februar 1913 in Kraft. Der Präsident des Deutschen Luftfahrer-Verbandes. Freiherr von der Goltz. Krupp'sches Schnellfeuergeschütz zur Bekämpfung von Wasserflugmaschinen. Kaum daß die Wasserflugmaschinen auf dem Plan erschienen sind, beginnt man bereits Mittel zu ersinnen, um sie zu bekämpfen. Die Firma Krupp hat ein neues Geschütz konstruiert, welches an Bord von Unterseebooten genommen wird. Das Geschütz von 75 cm Kaliber ist so angebracht, daß es im Moment des Untertauchens von der Plattform zurückgezogen und nach allen Richtungen bewegt werden kann. Gothaer Plugzeugfabrik. Die Gothaer Waggonfabrik hat sich entschlossen, die Herstellung von Flugzeugen in ihren Betrieb aufzunehmen. Es sollen Eindecker und Doppeldecker febaut werden, die auf em Gelände des Gothaer Luftschiffhafens montiert und ausprobiert werden sollen. '■ Es sind hierzu die Flieger Caspar, Büchner, sowie die Brüder Lan g'verpflichtet worden. Der Betrieb wird in allernächster Zeit aufgenommen werden. China und die Luftfahrt. Auch in das Reich der Mitte soll jetzt die Aviatik ihren Einzug halten. Die chinesische Re-Qesdiütz zur Bekämpfung von Wasserflugmaschinen gierung beauftragte einen auf einem Unterseeboot. französ. Militärflieger mit der Einrichtung des Flugwesens in der chinesischen Armee. In das diesjährige Militärbudget Chinas wurden zur Anschaffung von 270 Flugzeugen die erforderlichen Kredite eingestellt. Für die Jahre 1914, 1915 und 1916 wird der Ankauf von insgesamt 720 Flugzeugen vorgesehen. Die!»Dresdener Flugplatzfrage ist gesichert. In der Sladtverotdneten-sitzung wurde einstimmig die Errichtung des Flugplatzes auf einem],Terrain bei der Vorstadt Kadiz beschlossen. Es wurden dreieinhalb Millionen Mark bewilligt. 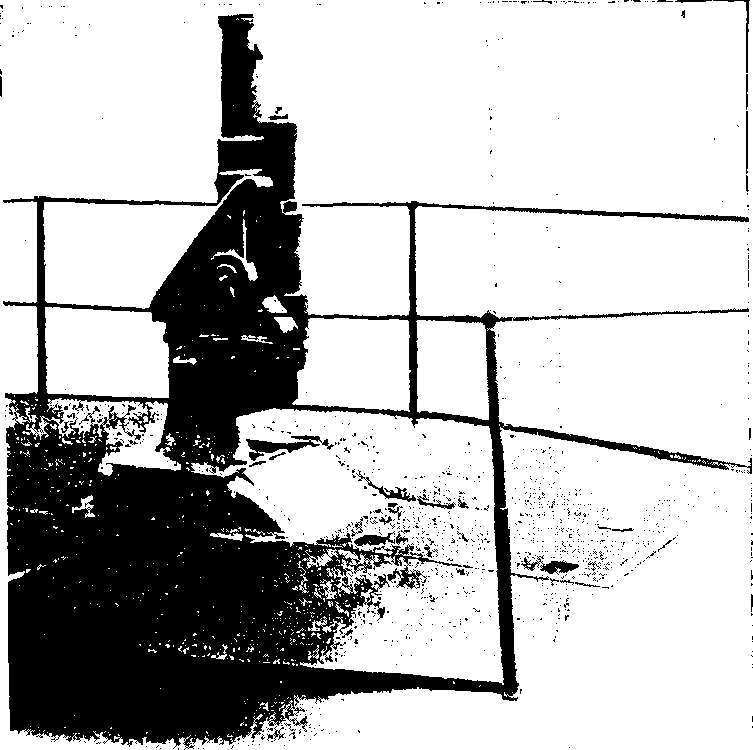 Fahrgestell und Radkonstruktion für Modelle. Das Fahrgestell (Abb. 1) eignet sich besonders für einen A (dreieckigen) Rumpf und ist sehr widerstandsfähig. Dasselbe ist mit Federung vorgesehen, welche aus einer gewöhnlichen Uhrfeder besteht. Dieselbe kann sehr schwach sein; sie wird, wie Abb. 1 zeigt, in das Stäbchen a und b hineingesteckt und das ganze noch mit Zwirn umwickelt. Alles andere ist aus Abb. 1 deutlich zu ersehen. Abb. 2 zeigt die Seitenansicht. Um den Rädern ein mögl'chst naturgetreues Aussehen zu verschaffen, macht, man sie wie Abb. 3 zeigt. Man sägt sich zuerst die beiden Bügel c—c aus und achte darauf, daß der Durchmesser d genau so groß ist, wie die Felge, da dieselbe in die Bügel eingespannt werden muß. In die Flanschen e bohrt man ein Loch, durch welches man eine Mutterschraube steckt. (Schraube f. Fahrradketten.) Nun sägt man sich die Radfelge aus (Abb. 4) Zuvor zeichnet man sich die Stellen f an, wo die Felge in die Bügel zu liegen kommt, da sonst die Nabe nicht genau in die Mitte der Felge kommen würde Die ausgesägte Felge feilt 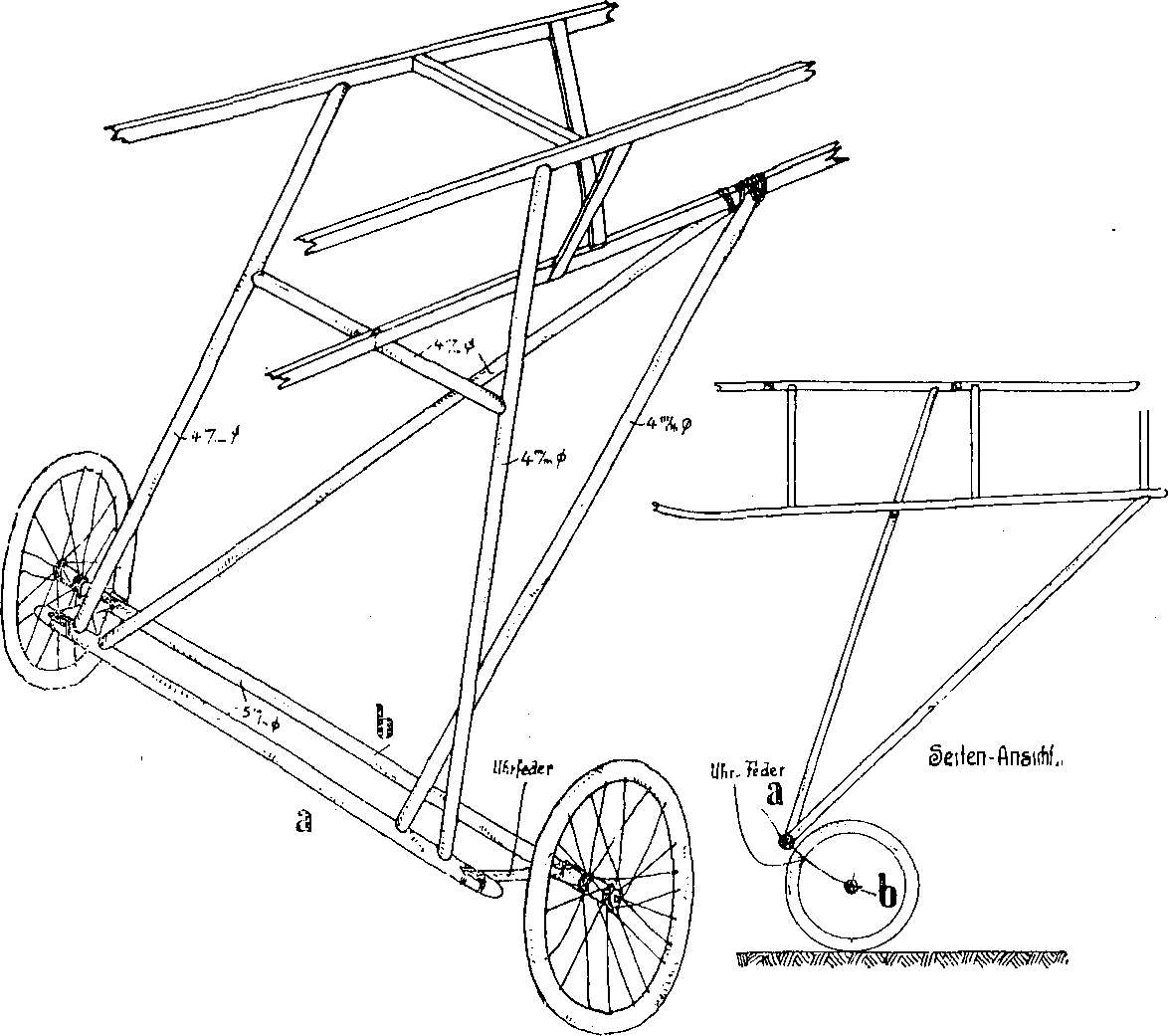 Abb. 1 Abb. 2 man schön rund und bohrt in gleichmäßigen Abständen kle'ne Löcher, wo nachher die Drähte durchgezogen werden, dann spannt man die Felge in den Rahmen 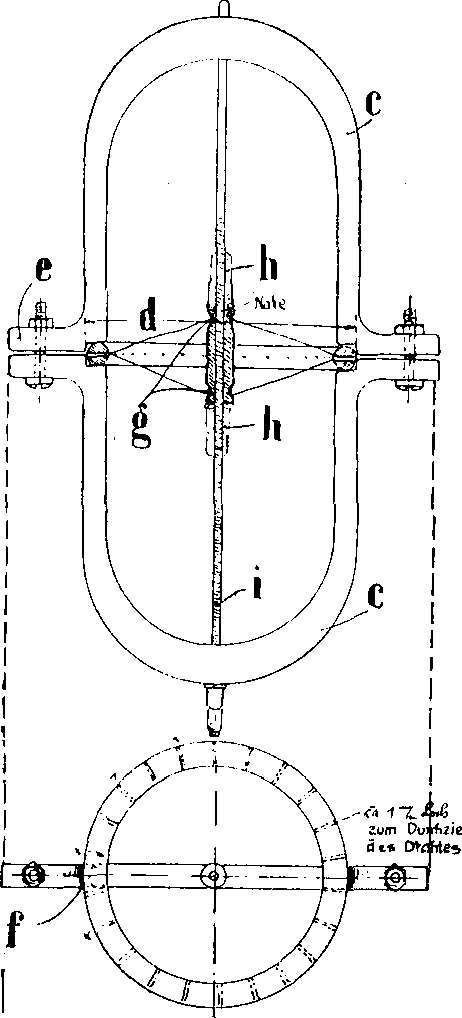 Abb. 3 u. 4 c - c gut ein. Durch die Mitte der Bügel c, c steckt man eine Radspeiche i, aufweiche die Nabe gesteckt wird. Als Nabe nehme man ein kleines Röhrchen und feile zwei Hohlkehlen g ein, um welche die Drähte gewickelt werden. Die Nabe kann aber auch aus Holz gemacht werden, nur muß sie dann etwas stärker gehalten sein. Damit die Nabe beim Bespannen nicht hin und her rutscht, lasse man sich das Gewinde der Radspeiche noch erweitern, steckt die Nabe darüber und schraubt zwei Muttern h, h dagegen, welche aber auch aus Holz sein können. Nun kann man mit dem Bespannen beginnen ; hierzu verwende man Telefondraht, in welchem bekanntlich ca. 25 kleine Drähte von 0.25 m/m Durchmesser^enthalten sind, und der sich gut zu diesem Zwecke e'gnet. Beim Bespannen der e'nen Seite überschlage man immer ein Loch; genau so verfahre man beim Bespannen der anderen Seite. Beim Abziehen von der Radspeiche schiebe man das fertige Rad vorsichtig herunter, indem man nicht die Felge anfaßt, sondern die Nabe. Ich hoffe, daß der Leser nach dieser Beschreibung arbeiten kann. Gr un d man n. ^uft-%st.  Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.)?. Eitner. D i e Mi Ii t ä rs t e u e r u n g ist folgende: Die Höhensteuerung erfolgt durch Vor- und Rückwärtsschwenken der Steuersäule. Beim Anziehen der Steuersäule muß der Apparat, nach oben und beim'Abdrücken sich nach abwärts bewegen. ■ϖ- Die Seitensteuerung wird mit einem horizontal schwenkbaren Fußhebel betätigt. Wenn der Apparat nach rechts gehen soll, wird ider rechte Fuß in Bewegung gesetzt. Wenn der Apparat nach links gehen soll, der linke Die Verwindung erfolgt mittels Handrad, welches am Kopf der Steuersäule befestigt ist. Dreht man das Steuerrad nach rechts, so wird ein Windstoß, der den rechten Flügel trifft, abgewehrt; und umgekehrt. Zu beachten ist hierbei das Uebersetzungsverhältnis vom Handrad auf die Verwindungsseile. Für Klappenbetätigung genügt das Uebersetzungsverhältnis 1:3 bis 1:6, für Verwindung 1 :10 bis 1 : 18. mehrere Flieger für Schauflugveranstaltungen werden g-f-ucht. Nur gerau spezifizierte Offerten werden herückeiclitigt. Jeder Flug von 15 Miuuten Dauer wird mit 2 bis 300 Maik bewertet. Ausführliche Offerten unter „Schaufliegen 1913" an die Expedition erbeten. Bis 500 ni freifliegendes Gleit - im (721 Flugzeug-Modell 1912 M.5.— Größte 0,3:1,0:1,0 ni. Alum -Propeller, verstellbare Trag- und Steuerflächen, Balancierer, ZündscbnurauslÖsuog für Startvorrichtuog. Flugtechniker R F. Schedes, Hamburg 23. Als Studienapparat unübertroffen.  technische Zeitschrift und Anzeiger _ für das gesamte „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Teief.4557ftmti. Oskar Ursinus, Civilingenieur. Tei.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14 tägig. = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 19. März. Aus dem Johannisthaler Fliegerlager. Berliner Korrespondenz des „Flugsport". Endlich ist das Kuratorium der National-Flugspende mit den Bedingungen herausgekommen, die für die Erringung der „Zuverlässigkeitspreise der National-Flugspende" aufgestellt worden sind. Zuverlässigkeitspreise der National-Flugspende. I. Die National-Flugspende zahlt deutschen Flugzeugführern, die in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 1913 auf in Deutschland helgestellten, mit deutschen oder ausländischen Motoren versehenen Flugzeugen außerhalb sonstiger Konkurrenzen eine Stunde ohne Zwischenlandung fliegen, einen Preis von 1000 Mk. und für jede weitere ohne Zwischenlandung geflogene Stunde einen Zusatzpreis von je lOOOMk. II. Wird der Flug mit Passagier — gegebenenfalls unter Ergänzung des Passagiergewichts durch Ballast auf 65 kg — oder mit Ballast von 65 kg ausgeführt, so wird zu obigen Preisen ein Zusatzpreis von 500 Mk. für jede Stunde gezahlt, sofern folgende weitere Bedingungen erfüllt werden : 1. Bei einem Einstundenfluge muß der Flug vom Aufstiegplatz bis zu einem mindestens 30 km entfernten Punkte und zurück führen und dabei muß innerhalb 15 Minuten nach Aufstieg eine Höhe von mindestens 500 m erreicht und während des Fluges 15 Minuten lang eine Mindesthöhe von 500 m beibehalten werden. '2. Bei einem Zweistundenfluge muß der Flug vom Aufstiegplatz bis zu einem mindestens 30 km entfernten Punkte und zurück und sodann abermals zu einem mindestens 30 km vom Auf-stiegplatz und mindestens 10 km seitlich vom ersten Wendepunkt entfernten Punkte fuhren und dabei muß innerhalb 15 Minuten nach Aufstieg eine Höhe von mindestens 500 m erreicht und während des Fluges 30 Minuten lang eine Mindesthöhe von 500 m beibehalten werden. 3. Bei einem in gleicher Weise ausgeführten Drei- und Vier-stundenfluge muß außer den bisherigen Erfordernissen während der Flugzeit eine Höhe von 800 m erreicht und 30 Minuten lang beibehalten werden. Die sämtlichen Wendepunkte müssen voneinander stets mindestens 10 km entfernt sein. Bei einem Fünf- und Mehrstundenfluge muß außer den bisherigen Erfordernissen eine Höhe von 1 000 m erreicht und 15 Minuten lang beibehalten werden. III. Derjenige Flugzeugführer, der bei Bewerbung um vorstehende Preise jeweilig die längste Zeit, mindestens aber 6 Stunden, ununterbrochen geflogen hat, erhält aus der National-Flugspende solange eine monatliche Rente von 2 000 Mk bis zum Gesamtbetrage von 10000 Mk. bis ein anderer (auch ein Militärflugzeugführer) seine .Flugzeit übertrifft. Die Rente wird am Ende jeden Monats für die Zeit gezahlt, während der ein Flugzeugführer den Rekord hält, Der erste Tag wird voll, der letzte nicht gerechnet. IV. Die Beteiligung am Einstundenfluge ist nur für solche Flagzeugführer offen, für deren Ausbildung aus der National-Flugspende keine Prämie gezahlt worden ist. V. Ferner ist Voraussetzung für die Bewerbung um Geldpreise, daß der Bewerber bei Ausführung eines Prämienfluges auf Grund der durch die National-Flugspende vermittelten Versicherungspolice versichert war, sofern er nicht nachweist, daß er vor dem 1. März 1913 anderweit sich in gleicher Höhe versichert hatte. VI. Die Kontrolle der Flugleistungen erfolgt durch einen Fliegeroffizier oder zwei vom deutschen Luftfahrerverband anerkannte Sportzeugen nach dessen allgemeinen Vorschriften. Angestellte der gleichen Firma dürfen weder untereinander noch für den. Inhaber und dieser nicht für seine Angestellten Sportzengen sein. VII. Für sämtliche aus dieser Auslobung hervorgehende Streitigkeiten wird unter Ausschluß des Rechtsweges ein Schiedsgericht gebildet, dessen Vorsitzender der geschäftsführende Kurator der National-Flugspende oder ein von diesem bestellter Vertreter ist, und in das vom Verwaltungsausschuß der National-Flugspende je ein Beisitzer 1. aus dem Lnftfahrerverband, 2. ans dem Verein „Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt", 3. aus den deutschen Flugzeugfahvikant.cn, 4. ans den deutschen Flugzeugführern gewählt wird. Von der erflogenen Prämie behält die National-Flugspende, falls der Flugzeugführer den Versicherungsbetrag für das laufende Jahr noch nicht voll bezahlt hat, einen Betrag bis zu 135 dt. zur Bezahlung der laufenden Versicherungsprämie zurück. VITT. Die Annahme einer Prämie verpflichtet den Empfänger, sich für den Kriegsfall unbeschränkt, im Frieden während des folgenden, mit dem Empfange der Prämie beginnenden .Jahres für eine besondere 3 wöchige Uebung der Heeresverwaltung zur Verfügung zu stellen. IX. Deutsche Flugzeugführerinnen erhalten bei gleichen Leistungen gleiche Prämien ohne Uebernahme der unter VII genannter Verpflichtungen. X. Militärflieger erhalten an Stelle der Geldpreise besondere Ehrenpreise. XI. Jeder Bewerber erhält vorstehende Preise und Zusatzpreise nur einmal, die Rente beliebig oft. National-Flugpreis. Derjenige deutsche Flugzeugführer, der in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 1913 auf einem in Deutschland hergestellten, mit deutschem oder ausländischem Motor versehenen Flugzeug außerhalb sonstiger Konkurrenzen mit Passagier oder mit Ballast gemäß den Bestimmungen unter Ziffer II der Zu verlas ngkeitspreise innerhalb '^4 Stunden vom Aufstieg an die in der Luftlinie zwischen Aufstieg und Landungsplatz gemesss ne längste Entfernung über Land durchfliegt, erhält als Prämie so lange eine monatliche Rente von 3000 Ji. bis zum Höchstbetrage von 15000 Jl, bis ein anderer deutscher Flugzeugführer (auch Militärflugzeugführer) diese Flugleistung überbietet. Die Rente wird am Ende jedes Monats für die Zeit ausgezahlt, in welcher der Flugzeugführer den Rekord hält. Der erste Tag wird voll, der letzte Tag nicht gerechnet. Als Mindestleistung wird eine Gesamtstrecke von 500 km erfordert. Die Kontrolle der Flugleistung erfolgt in der Weise, wie es für die Zuverlässigkeitspreise vorgeschrieben ist; außerdem aber können Offiziere, Reserveoffiziere, Amts- und Gemeindevorsteher hinsichtlich des Ortes und der Zeit der Landung als Sportzeugen dienen. Bei eventuellen Streitigkeiten hat das gleiche Schiedsgericht zu entscheiden, das für die Zuverlässigkeitspreise vorgesehen ist. Für Militärflieger werden Ehrenpreise ausgesetzt. Wegen Versicherung vergl. oben unter V. und VII. Abs. 2. Versicherung. Da die Versicherung in der oben unter No. V angegebenen Weise Voraussetzung für Bewerbung um Geldpreise ist, so empfiehlt es sich, mit der geschäftsführende Versicherungsgesellschaft Victoria zu Berlin auf Grund der von der National-Flugspende vermittelten Police einen Versicherungsvertrag sobald wie möglich abzuschließen. Bei Abschluß des Vertrages muß der Flieger die erste Viertel jahrs-rate in Höhe von 45 M zahlen, worauf seitens der National-Flugspende der von ilir übernommen« Anteil der Jalirr>s|irämio in Höhe von 200 M an die Victoria gezahlt wird. Für die weiteren Vierteljahrszahlungen von je 45 M bleibt der Flieger allein rechtlich verpflichtet. Falls der Flieger einen Geldpreis für eine Flugleistung erhält, so wird aus diesem der noch nicht gezahlte Rest der .lahres-versicherungsprämie seitens der National-Flugspende zurückbehalten und an die Victoria abgeführt. — — — Die Leistungen der Versicherung bestehen im Falle einer durch Fliegerunfall herbeigeführten Arbeitsunfähigkeit in einem täglichen Krankengeld bis zu 5 M und im Falle der Invalidität in einer jährlichen Rente bis zu 1600 M. Es macht sich hier eine gewisse Hast unter den Fliegern bemerkbar, denn jeder hofft sein Teil zu erlangen und das Einbauen von Riesen-Benzintanks dürfte in den nächsten Tagen einen chronischen Charakter annehmen. Die Bedingungen sind ja auch sehr leicht erfüllbar und nicht mit großen Unkosten verknüpft. Man kann deshalb auf große Dauerflüge für die kommende Zeit rechnen, denn besonders die Auszahlung der Rente hat eine starke Anziehungskraft. Auch die Bestreitung um den National-Flugpreis ist nicht mit allzu hohen Anstrengungen verbunden. Die Ablieferung von Militärmaschinen war im vergangenen Monat sehr groß. Vor einigen Tagen flogen gleichzeitig vier Rumpier-Tauben, gesteuert von Lt. Joly, Keidel, Linnekogel und Wieting nach Döberitz, wobei letzterer aus 2000 m Höhe einen Spiralengleitflug ausführte. Die Ausbildung der Offiziere macht gute Fortschritte, sodaß bald einige neue Flieger in die Liste der Militärflieger eingetragen werden können. Von morgens bis abends sind die Fliegerschulen in Tätigkeit Ujid das Amt des Fluglehrers ist keineswegs ein leichtes. So hat z. B. Rosenstein im vergangenen Monat 253 Aufstiege unternommen, wobei nicht zu vergessen ist, daß an verschiedenen Tagen, wegen schlechter Witterungsverhältnisse, nicht geflogen werden konnte. Die Albatroswerke sind gegenwärtig wieder mit der Vergrößerung ihrer Fabrik beschäftigt, um die Lieferung von Militärapparaten zu beschleunigen. Mit den neuen Albatros-Eindeckern werden demnächst die ersten Abnahmeflüge ausgeführt werden. Der durch seinen Pfeildoppeldecker bekannte Konstrukteur Bomhard hat eine neue Gesellschaft, die „Union-Flugzeugwerke G. m. b. II.", gegründet, die. den Bau der Bomhard-Üoppeldecker aufgenommen hat. Sablatnig ist der Fluglehrer und Leiter des Außenbetriebes, während Direktor O. Goldbeck die Leitung des Werkes inne hat. In nächster Zeit werden die ersten Union-Apparate auf dem Plan erscheinen. Fokker hat vor einigen Tagen seine erste Militärmaschine abgeliefert und sehr gute Resultate erzielt. Der mit einem 100 PS Argus ausgerüstete Apparat stieg unter Führung von Fokker mit 200 kg Nutzlast und Betriebsstoff für 3 Stunden, in 9 Minuten auf die vorgeschriebene Höhe von 600 Metern. Zum Anlauf benötigt die Maschine 80 m. Lt. Mühlig-IIoffmann, der erste militärische Fokker-Flieger, flog den Apparat nach Döberitz und wild jetzt größere [Jeber-landflüge unternehmen. Bei der Luftverkehrs-Gesellschaft hat der Flieger Hann s die Bedingungen zur Erlangung des Fliegerzeugnisses erworben. Unter der Leitung von Kupp bereitet sich der bekannte Lenkballonführer Reg. Baumeister Hackstetter für die Fliegerprüfung vor. Rupp hat vor einigen Tagen zum ersten Mal den L.-V.-G.-Eindecker versucht und konnte sofort einige Runden fliegen, wobei der Apparat wieder seine sehr leichte Steuerung glänzend erwies .... Jeder Flugplatz hat seine „Kanonen", die bei dem Publikum an erster Stelle stehen und deren Flüge gern gesehen werden. Daß eine Flugmaschine fliegen kann weiß man, daß sie stundenlang in der Luft ihre Kreise ziehen kann ist auch bekannt, daß man aber mit Absicht direkt gefährlich aussehende Kunsstücke ausführen kann, hat wohl — bei uns in Deutschland wenigstens — die Mehrzahl nicht geglaubt. 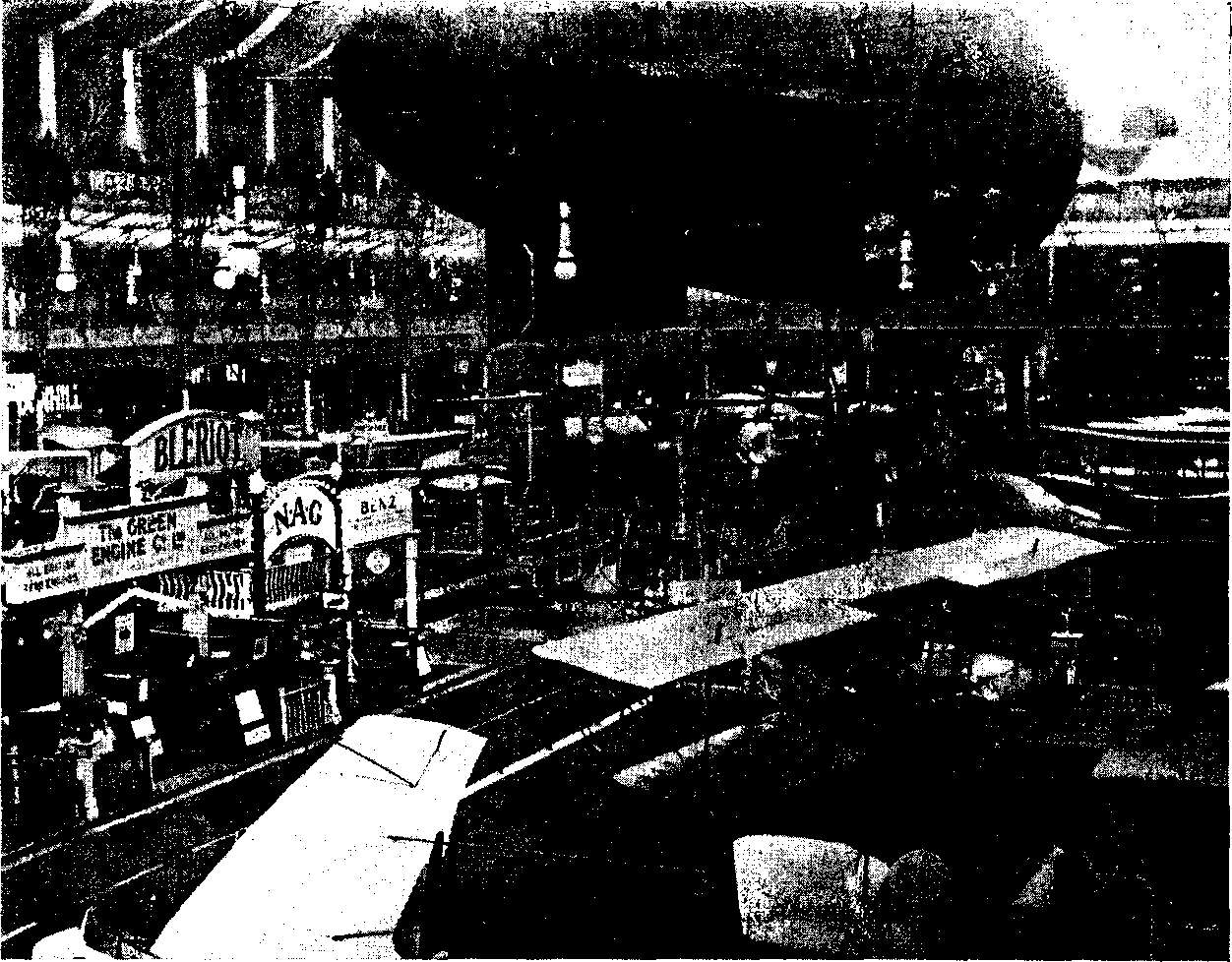 Oesamtansicht der Olympia-Ausstellung London. Otto Linnekogel — ein Schüler Rosensteins — ging vor einiger Zeit mit einer Rumpler-Taube nach Madrid und beteiligte sich dort mit Erfolg an einem Flugmeeting. Daß man mit einer Rumpler-Taube fliegen kann, hatten die anderen Flieger — unter ihnen der bekannte Deperdussin-Flieger Prevost — nicht geglaubt. Sie fanden sie alle, im Vergleich zu den französischen Maschinen, für viel zu schwer. Aber Linnekogel vollführte auf dem Madrider Flugplatz Onatros Vientos Flüge, die sich seine Konkurrenten überhaupt nicht träumen ließen. Sie kommen mit ihrer Maschine nicht höher, als '200 Meter, hatte man ihm gesagt, und Linnekogel stellt mit seiner Rumpler-Taube den spanischen Höhenrekord mit Ü800 Meter auf, dabei ist zu bedenken, daß der Flugplatz 750 Meter über dem Meere liegt. Als er dann noch seine gefährlichen Kurven, bei denen die Flügel des Apparates fast senkrecht standen, zeigte, hatte er seine Ueberlegenheit über die Konkurrenten bewiesen. Sogar der Infant von Spanien unternahm einen Flug mit Linnekogel, wobei eine Höhe von 1000 Meter erreicht wurde. Diese kühnen Kurven hat er nun nach seiner Rückkehr von Madrid auch hier vorgeführt. Man ist hier schon an enge und steile Kurven gewöhnt, was aber Linnekogel vorführte, ist eine ganz ungewöhnliche Leistung. Beim Anblick — wenn man überhaupt noch hinzu sehen kann — denkt man dauernd an ein Herausfallen des Fliegers und an das üeberschlagen des Apparates auf den Rücken. Aber Linnekogel und seine Rumpler-Taube vollführen alles mit größter Leichtigkeit. Den Clou stellte der kühne Flieger vor einigen Tagen auf. In '250 Meter Höhe stieg er aus seinem Sitz, stellte auf das linke und rechte Tragdeck seine Füße und hielt sich am Spannturm fest, ohne dabei das Steuerrad zu berühren. Der Apparat flog vollständig stabil — und Linnekogel war um eine Sensation reicher .... -er Die Olympia Aero-Ausstellung 1913. Von unserem Londoner Korrespondeiilcn. (Fortsetzung von Nr. 4.) Der Handley Page-Eindecker, (Hierzu Tafel VI.) eine geschmackvoll ausgeführte Maschine, hat seine Leistungsfähigkeit auf den englischen Militärflugfeldorn insbesondere auf Hendon und Aldershot bewiesen. . Die Tragflächen zeigen zanoniaähnliche Formen mit ausgelappten Flügelendon, die wie beim Antoinette-Apparat verspannt sind. Der Flächeninhalt beträgt '20 qm, während die fischförmig ausgebildete Schwanzfläche incl. Höhensteuerklappen 4% qm Flächeninhalt besitzen. Der Rumpf hat wie bei REP fünfeckigen Querschnitt. Der Führersitz befindet sich vor dem Gastsitz. Zum Antrieb dient ein 50 PS Gnom-Motor mit einer Luftschraube von 2,4 m. Zum Schutze derselben ist das Fahrgestell mit einer nieuportartigen Kufe versehen, woran sich eine geteilte Achse anschließt, die nach oben mit zwei telcskopartig ineinander gesteckten Rohren abgefangen ist. Zur Abfederung dient die an den Rohren a und b (siehe Detailzeichnung rechts oben) festgeklemmte umsponnene Kautschukschnwr c, wie sie meist Rleriot verwendet, die bei Stößen sich zusammen staucht. Die Steuerung ist die bei uns übliche Militärsteuerung. Mittels Handrad wird die Verwindung betätigt, mittels Fußhebel das Seitensteuer und durch Vor- und Rückwärtschwenken der Steuersäule das Höhensteuer. Die Fluggeschwindigkeit mit ÖQ PS Gnom soll 100 km|Std betragen. Der Apparat wurde von Handley Page konstruiert und stellt in seinen gediegenen Ausführungen einen englischen Typ dar. Der Short-Wasserzweidecker fiel auf der Olympia-Ausstellung durch seine gedrungene Form auf. Die Tragflächen ähneln in der Ausführung denen von Maurice Farman. Die an den Auslegern des Oberdecks befindlichen Klappen zur Erhaltung der Querstabilität sind zwangläufig miteinander verbunden. Zwischen den mittelsten Streben ist der bootsartig ausgeführte Motor- 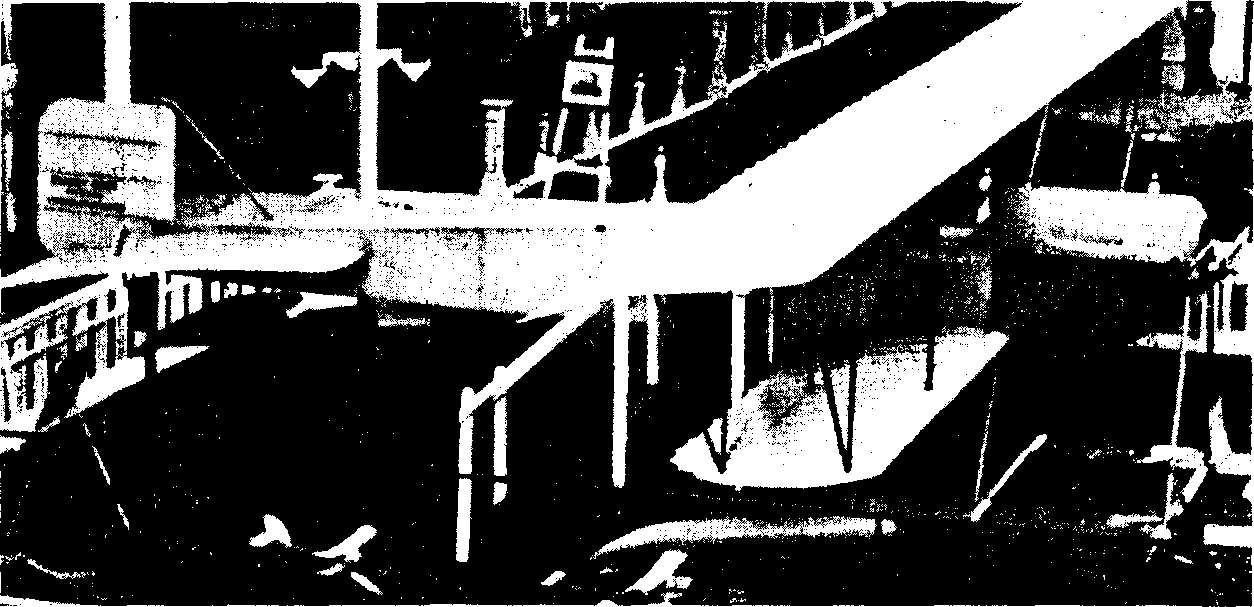 Kon der Olympia-Ausstellung London. Short Wasser-Zweidecker. rümpf eingebaut, an dessen Spitze sich ein 80 PS Gnom-Motor befindet. Der Motor ist mit einer Aluminiumliaube verkleidet, deren Verlängerung den Benzin- und Oelbehälter umschließt und sich zu einem Windschirm erweitert. Dahinter befinden sich Gast- und Führersitze. Am hinteren Ende des Rumpfes ist eine fischförmig ausgeführte Schwanzfläche angebracht. Zur Unterstützung des Schwanzes dient ein flacher Schwimmer, der mit zwei Kufen versehen ist, um das Leckwerden zu verhindern. Zwischen ihm und dem Rumpf-hinterteil ist noch ein Wassersteuerruder angebracht, um die Lenkfähigkeit auf dem Wasser zu erhöhen Unter dem Vorderteil der Maschine befindet sich ein katamaranartiges Doppelschw'mmersystem, dessen Profil stark an die Aus-fülirungsform des alten Curtiss-Seh wiminers erinnert. Die an den Enden der Tragdecken befindlichen torpedo-zylindrischen Hilfsschwimmer sind mit breiten Tastbrettchen versehen. Die Gesamttragfläche des Apparates betlägt :>.">,5 ipn. Der Apparat entwickelt in voller Fahrt eine Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde. No. 5 Stufenschwimmer von Samuel White. Zu den originellsten Schwhnmerausführungen in der Olympia-Ausstellung gehört der Stui'enschwimmer von Samuel White (siehe Abb.) Er ist auf der Unterseite dreistufig ausgeführt und trägt in seiner vorderen und hinteren Verjüngung den Charakter eines Kiel- Stufenscnwimmer von Samuel White. bootes. Die Oberseite ist eliptisoh gewölbt und mit einer Aluminium-blechbekleidung versehen. Am hinteren Ende befindet sich zur.Unter-stützung des Seitensteuers ein Wassersteuerruder. Sein Gewicht soll 45 kg betragen. Vickers-Zweidecker. Der Viekers Zweidecker erinnert in seinem Aufbau wesentlich an die Konstruktion des Henry Farman-Zweideeker. Die Tragdecken sind anderthalbdeekerartig angeordnet. Die Vertikalstreben bestehen aus torpedo-eliptisohem Stahlrohr. An Stelle der Klappen zur Erhaltung der Querstäbilität tritt eine Abart der Wrightschen Verwindung. Die Seilzüge zu ihrer Betätigung bestehen aus starkem verzinntem Stahlkabel. 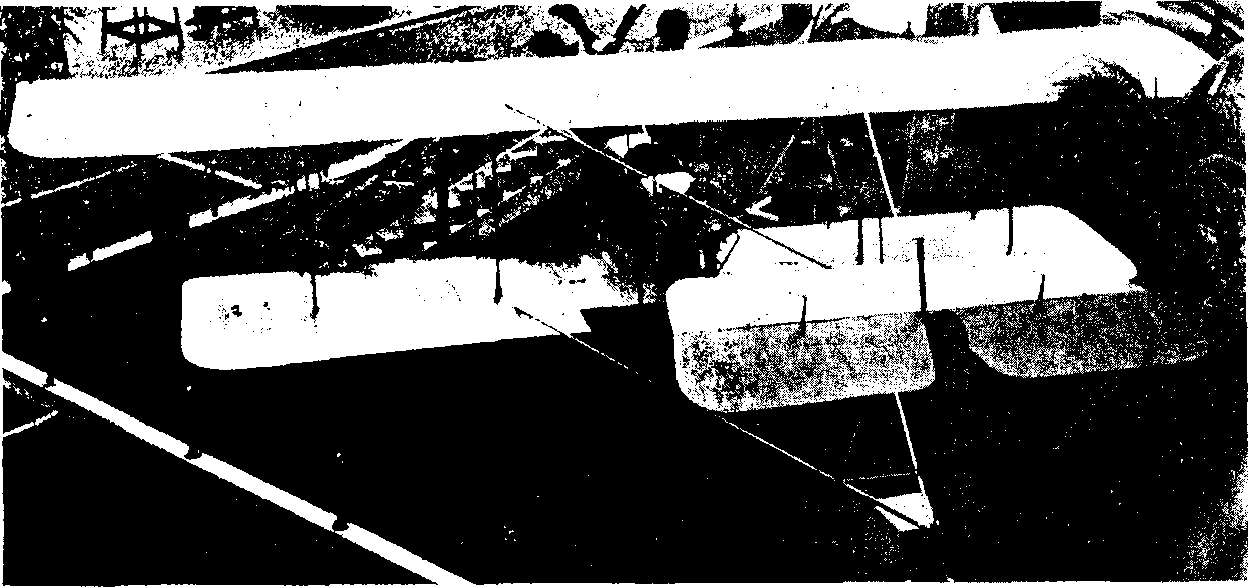 Von der Olympia-Ausstellung London. Vickers-Zweidecker. Das Fahrgestell ist ziemlich breitspurig und hat zwei in Gummiringen aufgehängte Räder. Die Kufen desselben sind mit dem Motorrahmen durch 3 im Dreiecksverbande gestellte Streben verbunden. Der Motorrumpf ist zweisitzig torpedoartig ausgeführt und mit Duraluminiumblech bekleidet. Vorn ist ein Maschinengewehr eingebaut. Hinter dem Führersitz befinden sich der Gastsitz, ferner Benzingefäß mit Betriebsstoffvorrat für 3 % Stunden und der 80 PS Wolseley-Motor. Schwanztragfläche und Haupttragfläche sind durch zwei Gitterträger verbunden, die sich in der Seitensteuerachse zu einem Dreieck vereinigen. Der Gesamttragflächeninhalt beträgt 35 qm. Mit 80 PS Motor soll die Maschine 110 km Stundengeschwindigkeit erreichen. Der ausgestellte Deperdussin-Wassereindecker mit 100 PS Anzani-Motor wurde von der britischen Marine angekauft. Anstelle der Verspannung sind unter den Tragdecken, wie es bei den Tauben üblich ist, Gitterträger angeordnet. Die 1 m voneinander entfernten Streben der Gitterträger besitzen tropfenförmigen Querschnitt und sind durch 8 mm starke Drahtseile verspannt. Der Rumpf ist ähnlich wie beim Gordon-Bennett-Typ durchgebildet. Die Steuereinrichtung und die Ausbildung der Steuer ist die bei Deperdussin übliche. Zur Unterstützung des Schwanzes dient ein drehbar angeordneter tropfenförmig ausgebildeter Hilfsschwimmer, der wie das Seitensteuer, im Wasser zur Steuerung benutzt wird. 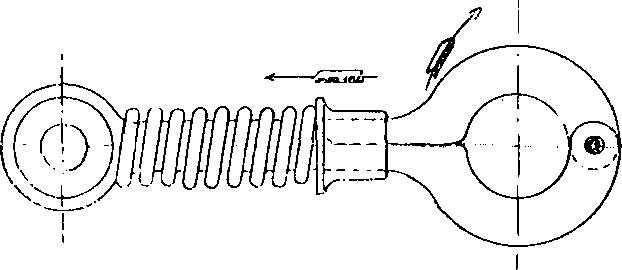 „Festhalter von Bleriot" untern Schwanz befestigt, dient zum Festhatten beim Ausprobieren des Motors. 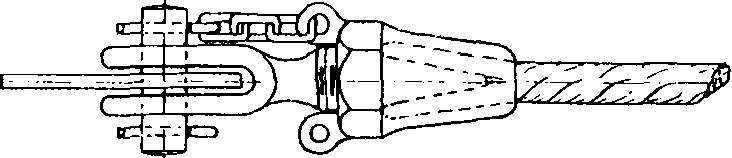 Stahlseilbefestigung von Bleriot mit Sicherheitskettdien. MililililiTiTf ' i ^ 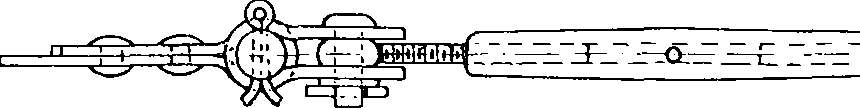 Befestigungssdielle für doppelte Spanndrähte von Borel. Die französischen Apparate zeigten im Detail wenig Neuerungen. Der Bleriot-Eindecker fällt auf durch seine saubere Arbeit. Einige neuere Einzelheiten sind in obenstehenden Skizzen wiedergegeben. Die britische Marine hat verschiedene Apparate, die selbstverständlich noch einer besonderen Prüfung sich unterziehen müssen, angekauft und zwar außer dem oben erwähnten Deperdussin einen Short-Wasserdoppoldecker mit 80 PS Gnom-Motor, einen Bristol-Eindecker mit 80 PS Gnom-Motor, einen Vickers-Doppeldecker mit 80 PS Wolseley-Motor, 1 Borel-Eindecker mit 80 PS Gnom-Motor, 1 Caudron-Eindecker mit 45 PS Anzani-Motor und 1 Farman-Doppeldecker mit 80 PS Gnom-Motor. Von Motoren waren autoer den von den bekannten Firmen wie Gnom vertreten: Clerget aus Paris mit Rotationsmotoren mit gesteuerten Ein- und Auslaßventilen, die unseren Lesern zur Genüge bekannt sind, sowie die bekannten Modelle von Anzani, l'aimler und der Kaiserpreis-Motor von Benz. WolseJey zeigt drei sehr sauber ausgeführte 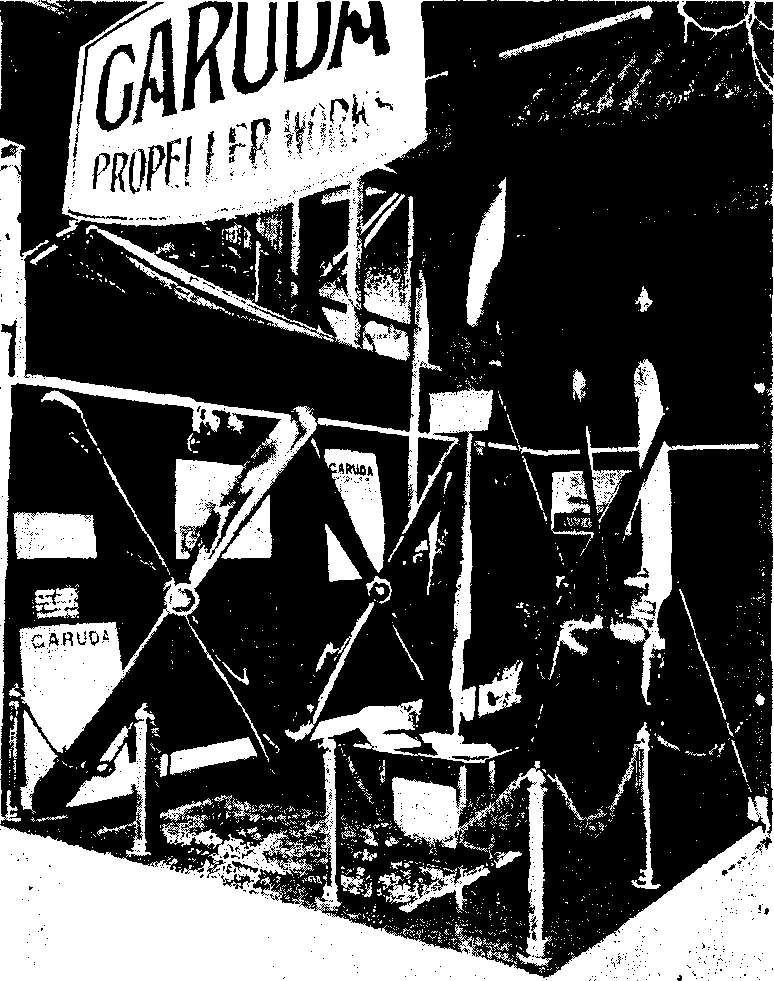 Von der Olympia-Ausstellung London. Stand der Garuda-Propeller-Bau. Maschinen, von denen der 80 PS 8 Zylinder luftgekühlte Motor einen besonders vertrauenerweckenden Eindruck macht. DieGreen-Motoren-Gese 11 schaft zeigt auf ihrem Stand eine Serie der verschiedensten Typen von b'O—250 PS. Von Schraubenfabriken sehen wir neben der bekannten franz. Firma Chauviere die deutsche Finna Garuda Propeller-Bau mit einem schön arrangierten Stande. Der Besuch der Ausstellung war bis zum Schluß ein sehr reger, "Wie wir erfahren, sind verschiede Firmen mit dem Erfolg der Ausstellung sehr zufrieden. No. 5 „FLUGSPORT" Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Das lebhafte Interesse, welches die an anderer Stelle besprochenen Vorgänge innerhalb des französischen Militärflugwesens naturgemäß auf sich lenken, hat nicht zu verhindern vermocht, daß trotzdem nebenher die Flieger sich mit praktischen Flügen befaßt haben, die teilweise zu recht beachtenswerten Resultaten führten. Zunächst war es wieder Guillaux, welcher bekanntlich schon oft durch seine originellen Einfälle von sich reden gemacht hat, und der am letzten Dienstag, dem Tage des Amtsantritts des neuen Präsidenten der Republik, eines seiner jährlichen Bravourstückchen vollbrachte. Als sich die beiden Präsidenten, der ausscheidende und der neuerkorene, in feierlichem Zuge, von zahlreichen hervorragenden Persönlichkeiten begleitet, nach dem Rathause begaben, erschien plötzlich zu Häupten der unzähligen Menge am Horizonte ein kleiner weißer Vogel, welcher dem Zuge die ganze Rivolistraße entlang das Geleit gab. Vom Elysee ab bis zum Rathause hielt sich Guillaux über dem Wagenzuge, auf diese Weise den neuen Präsidenten begrüßend, indem er viele Blumensträuße, mit Schleifen in den französischen Farben, herabwarf. Natürlich steuerte Guillaux auch bei dieser Gelegenheit einen 70 PS Clement-Bayard-Eindecker. Zwei prächtige Leistungen vollbrachte der Sappeur Frantz, der bekannte Flieger, welcher gegenwärtig seiner Dienstpflicht obliegt. Er befand sich dieser Tage auf Urlaub zu Chartres und unternahm dort auf einem Savary-Eindecker eine Reihe von Flügen, bei denen er nene Rekords aufzustellen vermochte. Am 27. Februar erhob ersieh, mit 6 Passagieren an Bord, in einer Viertelstunde auf 620 m und stellte damit einen neuen Sechspassagier-Welthöhenrekord auf. Am 1. März unternahm Frantz, wiederum auf einem Savary-Zweidecker, 110 PS Salmson-Motor, einen Angriff auf den bisherigen Dauer-Weltrekord mit acht Passagieren, wobei er acht Personen an Bord nahm, Frantz und seine Begleiter repräsentierten ein Gewicht von 601 kg, und das Gesamtgewicht, einschließlich Oel und Benzin, betrug 651 kg. Trotzdem vermochte Frantz eine mittlere Flughöhe von 60 bis 80 m zu erreichen und sieh während 11 Minuten 28 Sekunden in der Luft zu halten. Besonders interessant war der Fernflug Brindejonc des Moulinais Paris—London—Ostende—Brüssel—Paris, den der bekannte Flieger auf einem Morane-Eindecker, Motor Gnom, glücklich vollbrachte. Am vergangenen Dienstag verließ Brindejonc das Flugfeld von Villacoublay und wandte sich mit großer Geschwindigkeit nach der Richtung des Kanals. Er wurde in Calais und in Dover gesichtet, wo der graziöse Vogel in majestätischem Fluge dahinging, bis er schließlich ohne Zwischenfall zu Flendon, auf dem bekannten Flugplatze in der Nähe Londons, landete. Der Abflug in Villacoublay war um \) Uhr 15 erfolgt, die Landung in Fiuchley (bei ITendon) um 1 Uhr 50, die Landung in Hendon selbst. wohin er sieh erst begab, nachdem ein plötzlich eingetretener Nebel sich ein wenig verzogen hatte, um 1 Uhr 55. Wenn man den gleichfalls durch Nebel verursachten einstündigen Aufenthalt in Calais in Abzug bringt, dann hat Brindejonc die 386 km in 3 Std. 5 Min. zurückgelegt. Am Donnerstag Nachmittag 1 Uhr verließ Brindejonc Hendon, um sich nach Brüssel zu begeben. Etwas vor 3 Uhr wurde er im Norden Londons gesichtet, wie er sich in der Richtung auf den Kanal entfernte. Um 1 Uhr 30 landete er in Dover. Nach seinem Abfluge von dort verirrte sich der Flieger, indem er Nebelstreifen für Land ansah, und erst nach vielem Hin- und Herirren landete er südlich von Calais, wo er von Schiffern die Richtung nach Calais erfragte, und um 3 Uhr 12 Min. landete. Am Tage darauf flog Brindejonc um 8 Uhr 15 von den Baraques bei Calais ab, trotzdem der Wind ziemlich stark ging; er landete um 10 Uhr 10 glücklich auf dem Flugfelde von Berchem-Brüssel, von wo er, nachdem er sich neu verproviantiert hatte, sofort wieder nach Paris weiterflog. In der Nähe der französischen Grenze wurde der Flieger von heftigen Windwirbeln arg geschüttelt, sodaß er sich gezwungen sah, auf dem Flugplatze von Corbeaulieu, in der Nähe von Compiegne zu landen, wo er seinen Freund Legagneux begrüßte. Nach kurzem Aufenthalte setzte er seinen Flug fort und landete um 3 Uhr 50 Min. wohlbehalten in Villacoublay. Die Leistung Brinde-joncs stellt sich demnach in ihren einzelnen Etappen folgendermaßen dar: 25. Februar: Villacoublay—Calais, 250 km in 1:47:00, mittlere Geschw. 140 km; Calais—Hendon, 160 km in 1:13:00, mittl. Geschw. 135 km; 27. „ Hendon-Dover, 120 km in 0:55:00, mittl. Geschw. 131 km; Dover—Calais, 50 km in 0:45:00, mittl. Geschw. 67 km; 28. „ Calais—Brüssel, 185 km in 1:50:00, mittl. Geschw. 100 km; Brüssel—Villacoublay, 275 km in 2:00:00, mittlere Geschw. 137 km. Auch aus dem französischen Militärflugwesen sind einige nennenswerte Vorgänge zu berichten. Leutnant Mauger vollbrachte eine Flugreise, die in militärischer Hinsicht von großer Bedeutung ist. Am 22. Februar erhielt er die Ordre, sobald es die Witterung zuläßt, sich nach Saint-Cyr zu begeben. Trotz eines Windes von 22 m in der Sekunde bestieg Mauger seinen Maurice Farman-Zweidecker, 70 PS Renault-Motor und begab sich auf die Reise. Sofort nach Abflug suchte der Flieger beträchtliche Höhen auf, sudaß er seinen Flug in einer mittleren Höhe von 2500 m vollbrachte. Er legte so die Strecke Verdun-Saint Cyr, eine Distanz von 260 km, mit seinem Mechaniker an Bord, in 2 Stunden 5 Minuten zurück. Im Lager von Avor ereignete sich dagegen ein bedauernswerter Unfall, indem der Leutnant Porteau, welcher sich in der Richtung nach Savigny entfernt hatte, infolge plötzlichen Stehenbleibens des Motors in 600 Meter Höhe abstürzte und auf der Stelle getötet wurde. Eine schöne Flugleistung wird aus den französischen Kolonien berichtet: Ein Geschwader von vier Apparaten, von den Leutnants Reimbert, Cheutin, Jollin und dem Unteroffizier Hurard gesteuert, flog von Biskra über die Saharah, landete in Gabes, in Sfax, in Tunis, von dort zurück über Bole und Constantine. Insgesamt haben die vier Flieger, die sich während des ganzen Tages zusammenhielten, 1800 km in der Wüste zurückgelegt. Ein Unfall betraf den bekannten Flieger König-Siebrandt, welcher am letzten Dienstag mit einem Wasserflugzeug über der Seine einen Flugversuch unternahm. Bei einer brüsken Landung auf den Feldern von Gennevilliers stürzte die Maschine um und der Flieger erlitt schwere Verletzungen. Allmählich beginnt man auch, den bevorstehenden großen Bewerben die gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die offizielle Nennungsliste für den Gordon Bennett-Pokal ist am Freitag geschlossen worden; es sind 1 deutscher, 1 belgischer, 3 französische, 3 englische, 1 italienischer und 2 amerikanische Apparate, im ganzen 11, angemeldet worden. Inzwischen hat auch das Komitee der Internationalen Aeronautischen Föderation das Reglement für den diesjährigen Gordon Bennett festgesetzt, der bekanntlich zu Reims am 27. September zum Austrag gelangt. Darnach wird der Pokal über eine Distanz von 200 km auf einer geschlossenen Rundstrecke von wenigstens 5 km bestritten werden. Zwischenlandungen sind gestattet, das Auswechseln der Apparate aber untersagt. Sieger wird derjenige Bewerber sein, welcher die Strecke in reglementmäßiger Weise in der kürzesten Zeit zurückgelegt haben wird. Eine Zeit für Vollbringung des Fluges wird nicht festgesetzt. Wie verlautet, hat die Aviationskommission des Aero Club de France dieser Tage sich auch mit dem Reglement für das Kriterium des Aero-Club beschäftigt und es heißt, daß die Bestimmungen in diesem Jahre besonders rigorose sein werden. Es werden zunächst 1000 km Ueber-landflug in gerader Linie von 500 km hin und zurück verlangt werden, und dann werden die Bewerber den Flug auf geschlossener Rundstrecke fortzusetzen haben. Auch das Reglement für den Pokal des französischen Marineministers unterliegt gegenwärtig der Ausarbeitung und es heißt, daß die Wasserflugzeuge in zwei Klassen eingeteilt werden sollen : Küstenflugzeuge und Bordflugzeuge. Beide Kategorien werden Geschwindigkeits-, Distanz- und Seefähigkeitsbewerbe durchzumachen haben. Der Distanzbewerb wird über 250 Seemeilen, der Geschwindigkeitsbewerb über 100 Seemeilen führen. Der Bewerb wird mehrere Tage dauern und zwar sollen die einzelnen Bewerbe bei ruhiger und bei stürmischer See stattfinden. Vor allem aber sei erwähnt, daß gegenwärtig die Vorberatungen für einen militärischen Flugzeugbewerb 1913 stattfinden, dessen wesentliche Idee wir bereits heute angeben können. Es wird von den Konstrukteuren verlangt werden, Apparate nach Seite 166 rLUQSPORT den ihnen von der Militärverwaltung zu gebenden Bedingungen herzustellen, die am besten den Erfordernissen des Militärflugwesens entsprechen. Eine vom Kriegsminister zu ernennende Kommission wird unter den konkurrierenden Apparaten diejenigen auszuwählen haben, welche als die interessantesten erscheinen und sich den gestellten Bedingungen am meisten nähern. Nachdem diese Ausscheidung vorgenommen, wird der Staat Erwerbungen zu ziemlich hohen Preisen vornehmen, aber die ausgewählten Apparate werden dann wahrscheinlich von der Militärverwaltung später selbst konstruiert werden, während den betreffenden Konstrukteuren eine Lizenz gewährt werden wird. Das hieße also nichts weniger als die Militarisierung der Flugzeug-Konstruktion, die wohl keineswegs im Sinne der französischen Konstrukteure sein wird. Es ist zu erwarten, daß eine lebhafte Bewegung dagegen einsetzen wird ; jedenfalls bedeutete diese Neuerung den Gnadenstoß für die französischen Konstrukteure. Es sieht also hier nicht allzu rosig aus und mancher Konstrukteur mag mit Bangen an die Zukunft denken. Vorläufig freilich sind das Projekte, deren Verwirklichung noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Ein interessantes Unternehmen hat die Compagnie Generale Transaerienne ins Leben gerufen, indem sie einen regelmäßigen Passagier-Wasserflugzeug-Verkehr an der Riviera installiert hat. Die Flugzeuge verkehren zwischen Monte Carlo, Nizza, Beaulieu. Als Passagierpreis für die ganze Strecke Monte Carlo—Nizza sind 250 Frs., hin und zurück 300 Frs., für eine Promenade von 10 Minuten auf der Ehede von Monte Carlo 200 Frs. festgesetzt worden. Es wird auch interessieren, daß die Fliegerin Helene Dulrieu mit der Ehrenlegion ausgezeichnet worden ist. Viel beachtet wurde hier auch der Fernflug Mailand—Rom, der am letzten Mittwoch um den Pokal Ponti stattfand. Der russische Flieger Slavorosoff. der Fluglehrer der italienischen Fliegerschule von Caproni, flog vom Flugplatze von Taliedo um 7 Uhr 10 in der Richtung nach Pavia ab. Er übersetzte in beträchtlicher 11öhe die Vorgebirge der Appenninen und überquerte Genua, von wo er den Flug nach Pisa fortsetzte, bis er in San Rossore, in der Nähe von Pisa, um 10 Uhr 2 landete. Von dort flog er um 2 Uhr 11 wieder ab und erhob sich sofort auf 400 m Flughöhe. Um 2 Uhr 30 erreichte er Livorno, wo den Flieger ein Unfall betraf. Der Motor setzte wiederholt aus, so daß Slavorosoff sich entschloß zu landen. Er kam bei Poggio Mirtelo auf einem Ackerfelde nieder, wobei der Apparat beschädigt wurde, so daß der Flug dicht vor dem Ziel eine Unterbrechung erfuhr. Immerhin ist es dem Russen dabei noch besser ergangen als seinem Landsmann Kostin, der in bulgarischen Diensten an dem Balkanfeldzuge teilnahm und infolge eines Motorendefekts bei Adrianopel innerhalb der türkischen Linien landen mußte. Die Türken haben, wie offiziell bestätigt wird, den Flieger standrechtlich erschossen, was die hiesigen Fliegerkreise zu einem lebhaften Protest veranlaßt hat. weil man der Ansicht ist, daß dieses Verfahren dem Völkerrechte widerspricht. Mit mehr Erfolg operierte ein griechischer Flieger, namens Montussis, welcher dieser Tage die Dardanellen überfing und durch ausgeworfene Bomben einen türkischen Torpedobootzerstörer zum Sinken gebracht hat. Mit großem Interesse sieht man hier auch dem großen russischen Militärbewerb entgegen, dessen Organisation das russische Kriegsministerium dieser Tage beschlossen hat, und zwar handelt es sich dabei um das Auswerfen von Bomben. Ausländische Konstrukteure können an dem Bewerb teilnehmen, aber die russische Regierung behält sich das Recht vor, den prämiierten Apparat zu erwerben und auszubeuten. Rl. Das fliegende Boot von Cnrtiss. Curtiss hat mit seinem neuesten Typ, dem sogenannten fliegenden Boot, ganz hervorragende Resultate erzielt. Die Tragdeckenbreite der normalen Passagiermaschine beträgt 11,65 m, der Abstand der Tragdecken 1.60 m, die Gesamtlänge 7.20 m Das Gewicht der Maschine 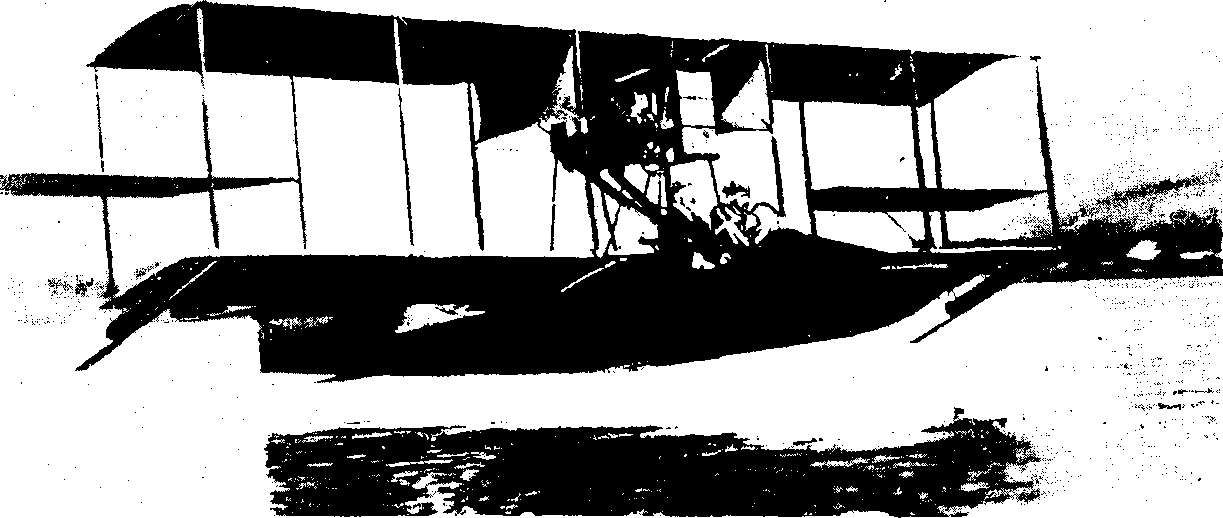 Normales Curtiss-Flugbool nach dem Abfluge vom Wasser, 525 kg. Das Wasserflugzeug entwickelt mit einem 80 PS Cnrtiss-Motor eine Geschwindigkeit von 95 km per Stunde und eine Steiggeschwindigkeit von 65 m pro Minute. Curtiss hat in letzter Zeit sein fliegendes Boot besonders für Marinezwecke vervollkommnet. Um das Tragvermögen zu vergrößern, sind die oberen Tragdecken verlängert Ferner hat er an den beiden finden statt der zylindrischen Schwimmer, versuchsweise, um den Luftwiderstand zu verringern, sich dein Tragdeckenprofil anpassende Schwimmer vorgesehen. Diese Schwimmer eignen sich jedoch nur für suhr glattes Wasser. Rci 8co.ga.ng taucht, das Tragdeckenendo zu weit ein nnd unterschneidet, so daß sich die Maschine sehr leicht überschlagen kann. Für die hohe See empfehlen sich daher zylindrische Schwimmer mit einem entsprechenden Abstand von den Tragdecken. 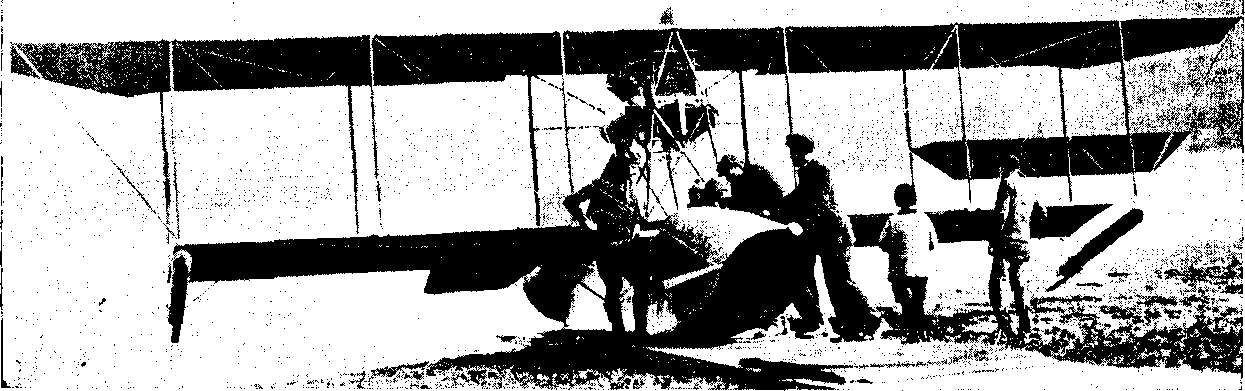 Curtiss-F-lugboot für Marinezwecke. 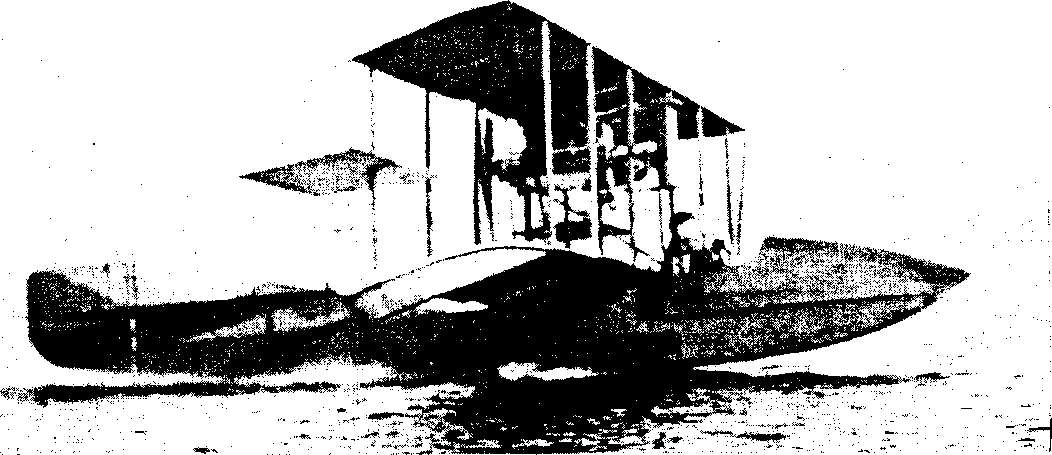 Curtiss-Flugboot mit veränderten Seitenstntzsdiwimmern. Bekanntlich hat Curtiss, der den Distanzrekord für Wasserflugmaschinen hält, anläßlich seines Fluges von San Pedro nach San Francisco, eine Strecke von 644 km, ohne Unfall in 3 Tagen zurückgelegt. Um auf dem Lande niedergehen zu können, ist ein besonderes hochklappbares Fahrgestell vorgesehen. Was geht in Frankreich vor? Die Wahrheit über das französische Militär-Flugwesen. (Von unserem Pariser Korrespondenten.) In den regelmäßigen Pariser Berichten ist bereits mitgeteilt worden, daß innerhalb des französischen Militär-Flugwesens „etwas nicht zu klappen" scheint. Es ist von einer Bewegung gesprochen worden, die vorerst lange unter der Oberfläche glimmte und jetzt öffentlich zum Ausbruch gekommen ist, und von gewissen Seiten hat eine Kampagne gegen den gegenwärtigen Leiter des 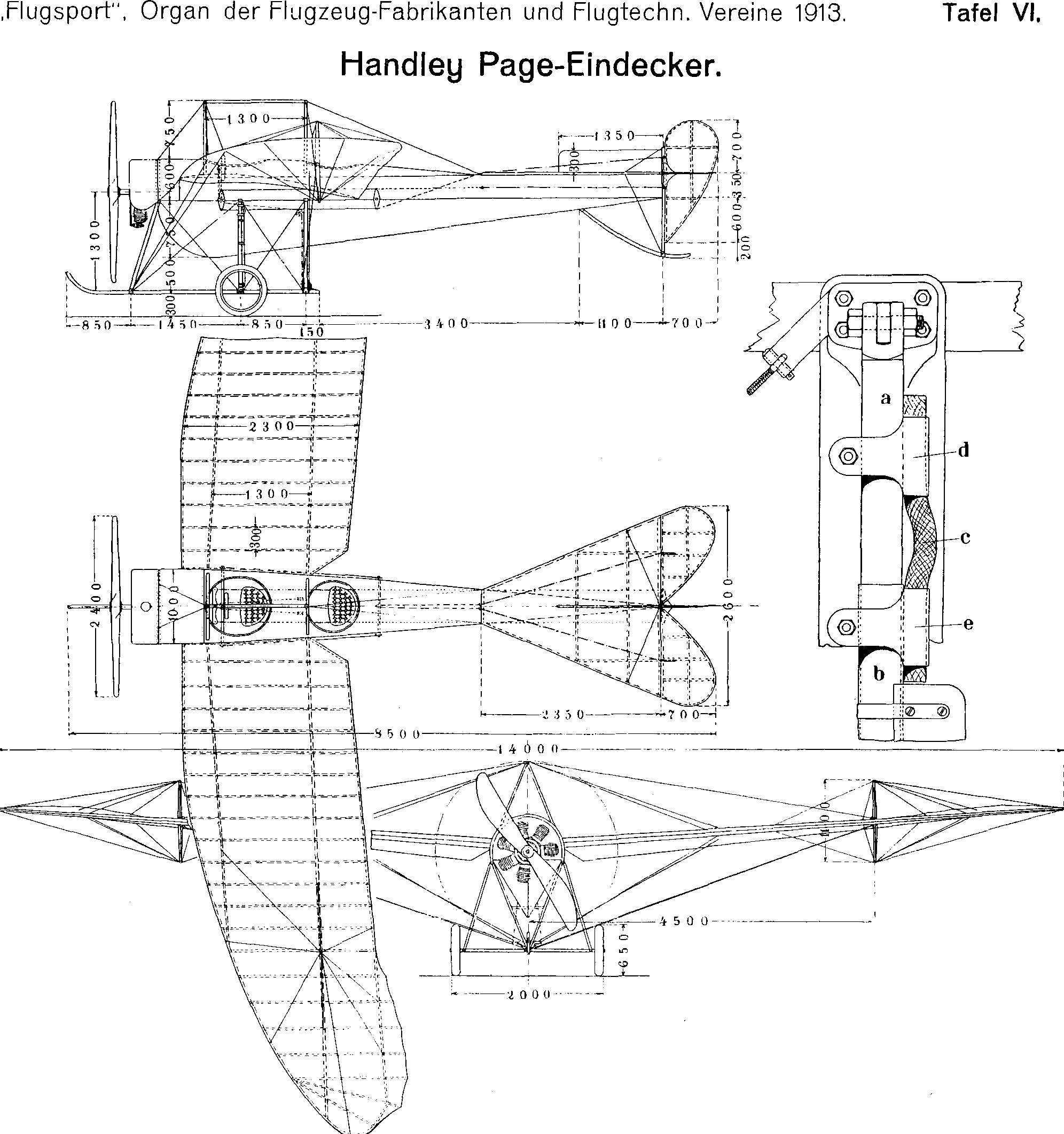 Nachbildung verboten. französischen Militär-Flugwesens, den General Hirschauer, eingesetzt, dessen mehr oder weniger freiwilliger Rücktritt sogar als unmittelbar bevorstehend signalisiert wurde. Man ruft „Skandal!" und in immer größerem Umfange stimmt die Oeffentlichkeit in den allgemeinen Chorus ein, ohne so recht eigentlich zu wissen, warum, jene Oeffentlichkeit, die in Frankreich, mehr noch als in irgend einem anderen Lande, so überaus wandelbar und in ihren Sympathien und in ihrem Hasse so unberechenbar ist. Ein veritables Fieber hat die inredestehenden Kreise ergriffen und man hat schließlich eine parlamentarische Kommission ernannt, welche die einzelnen Flugzentren kontrollieren und den tatsächlichen Sachverhalt prüfen, sowie die erforderlichen Maßnahmen vorschlagen soll. Angesichts dieses umfangreichen und gewissermaßen mysteriösen Apparats ist die Frage durchaus berechtigt: Was geht vor? Hier muß zuerst zum besseren Verständnis der Gesamtsituation darauf hingewiesen werden, wie in Frankreich nahezu alle Dinge, namentlich aber alles, was mit der nationalen Verteidigung zusammenhängt, nach dem Maßstab der Entwicklung gemessen wird, welche mit Bezug auf die gleiche Materie in Deutschland zu sehen ist. Es ist noch in lebhafter Erinnerung, wie seinerzeit dem inzwischen verstorbenen Kriegsminister, General Brun, mit den in Frankreich üblichen Uebertreibungen von der Presse der Vorwurf gemacht worden ist, daß die Militärverwaltung gegenüber den rapiden Fortschritten, welche die Militär-Aeronautik in Deutschland mache, untätig zur Seite stehe und daß sie unschlüssig und energielos zusehe, wie die westlichen Nachbarn sich die moderne Errungenschaft in einem Maße zunutzen machen, der eine drohende Gefahr für die Zukunft der Republik bedeute. Daß der damalige Kriegsminister sich Uber die heftigen und maßlosen Angriffe der Presse, die in ihm einen „Landesverräter", einen „in Solde fremder Staaten stehenden Minister" sahen, nicht sonderlich aufregte, wird den Kenner hiesiger Verhältnisse nicht verwundern. Damals suchte der genannte General sich durch eine Erklärung in der französischen Deputiertenkammer aus der Situation zu ziehen, in welcher er ankündigte, daß er den „angeblichen Fortschritten" des militärischen Flugwesens in Deutschland mit großer Gleichgiltigkeit gegenüberstehe und daß die französische Militärverwaltung auf dem Gebiete des Flugwesens „Ueberraschungen vorbereite, welche für die nächste Zukunft bevorstehen und welche die Suprematie Frankreichs auf diesem Gebiete ein für alle Male befestigen werde." Natürlich hat die Oeffentlichkeit auf die Einlösung dieses für die nahe Zukunft ausgestellten Wechsels sehnsüchtig gewartet, zumal inzwischen ein neuer Appell an das Land ergangen war, in welchem neue Opfer gefordert wurden, die vom Lande in unerschütterlichem Vertrauen auf die fünfte Waffe, auf die Hoffnung Frankreichs, willig und reichlich dargebracht worden sind. Die französische Militärverwaltung ist denn auch nach einem bestimmten Programm systematisch vorgegangen. Sie hat zahlreiche Offiziere sämtlicher Waffengattungen nach den verschiedenen Flugzentren abkommandiert und die Regierung hat kein Mittel unversucht gelassen, die allgemeine Begeisterung durch Ehrungen und materielle Zuwendungen aller Art zu schüren und wach zu erhalten. Zahlreiche Flug-Detachements wurden geschaffen, eine immer steigende Anzahl von Flugapparaten wurde angeschafft und eine besondere Organisation sollte aus dem Flugwesen das machen, was die Nation von ihm erwartete. Diese Erwartung schien sich in vollem Maße erfüllen zu sollen. Die glänzenden Leistungen der Flieger während der Manöver der letzten Jahre, die häufigen und gelungenen Rekognoszierungsflüge an der deutschen Ostgrenze zeigten die gewaltige Entwicklung, welche das französische Militärflugwesen nach und nach genommen hat. Mit stolzer Emphase verkündeten es alle Blätter daß Frankreich sich „den ihm zustehenden ersten Platz" im internationalen Flugwesen gesichert habe und daß der Vorsprung, den es genommen, von seinen Rivalen niemals mehr eingeholt werden kann. Natürlich blickte man dabei in erster Reihe nach Deutschland, dessen geräuschloses und zielbewußtes Arbeiten hier überhaupt bei der großen Masse kein Verständnis findet und finden kann, weil diese große Masse durch die großsprecherischen Ueberhebungen der Presse in einem Dünkel erhalten wird, der jede klare Urteilsfähigkeit ausschließt. Wenn hier und da warnende Stimmen auftauchten, welche auf die zweifellose Ueber-legenheit Deutschlands mit Bezug auf die Lenkluftschiffahrt hinwiesen, so wurden diese Stimmen sehr bald durch den Einwand erstickt, daß Frankreich auf dem unendlich wichtigeren Gebiete der „Schwerer-als-die-Luft" die unbestrittene Hegemonie besäße. Da kamen die deutschen Manöver von 1912, welche den Beobachtern plötzlich zeigten, daß die östlichen Nachbarn, ohne Ruhmredigkeit und ohne Tamtam in aller Stille mit unermüdlichem Eifer und mit unvergleichlicher Sachkenntnis ihre Arbeit, trotz der anfänglichen Mißerfolge, fortgesetzt, daß auch sie eine Organisation geschaffen haben, welche ihnen in ihrem Flugwesen eine furchtbare Gegenwaffe bietet. Militärische Kenner begannen, in den Spalten großer Zeitungen darauf hinzuweisen, wie man in Frankreich in unverantwortlicher Selbstüberhebung verabsäumt habe, die Fortschritte zu verfolgen, welche jenseits des Rheins in den letzten Jahren durch stille zähe Arbeit erzielt worden sind, es entstanden erst dunkle Gerüchte, die immer greifbarere Gestalt annahmen und sich zu lebhaften Klagen verdichteten, und alles deutete darauf hin, daß die französische Organisation des Militärflugwesens, in der innen „etwas faul" ist, an allen Ecken und Enden zu bersten beginnt. Jetzt regnete es Vorwürfe: „Unsere Armee besitzt die ersten Flieger der Welt. Unsere Konstrukteure haben uns so wunderbare Maschinen geschaffen, daß alle Armeen der Welt sie kaufen oder sie kopieren. Das Parlament, die öffentliche Generosität, durch den einmütigen patriotischen Appell der Presse geweckt, haben Millionen und Millionen freudig hergegeben. Und dennoch sind wir heute in der furchtbaren Lage, uns fragen zu müssen, ob mit all dem wir wirklich ein Flugwesen haben, das dem unserer Nachbarn standhält. Unsere Militärflieger und unsere Beobachteroffiziere bleiben ohne einheitliche Direktion, und manchmal ohne erforderliche Aktionsmittel, unsere Konstrukteure sind entmutigt, das kostbare Material wird vergeudet, die ungeheuren Summen und die unendlichen Werte verflüchtigen sich infolge der nachlässigen und unordentlichen Leitung," so schrieb vor wenigen 7Tagen eine der angesehensten Zeitungen der französischen Hauptstadt, und diese Worte waren das Signal zu der gewaltigen Bewegung, die jetzt eingesetzt hat ϖ und Aufklärung und Rechenschaft fordert. Wie gesagt, die beiden ständigen Kommissionen der französischen Deputiertenkammer, die Budgetkommission und die Militärkommission, haben aus ihrer Mitte eine besondere „Enquete-Kommission" ernannt, welcher hervorragende Parlamentarier angehören und welche die Aufgabe hat, den Dingen auf den Grund zu gehen. Es sollen „die Verantwortlichkeiten klargelegt und, sofern ein Verschulden vorliegt, die betreffenden Stellen zur Rechenschaft gezogen werden." Wie man sieht, nehmen die Dinge also einen ziemlich ernsten Charakter an, und man ist mit gutem Grunde auf den Ausgang dieser Untersuchung gespannt. Aber diese Vorgänge haben auch für Fernstehende ein außerordentliches Interesse, denn man wird aus den in Frankreich begangenen Fehlern anderswo lernen können und auf diese Weise Enttäuschungen und Entmutigungen ersparen. Es wird deshalb, unbeschadet der Ergebnisse der Enquete, angezeigt erscheinen, zu-untersuchen, in welcher Weise sich die Dinge bei unseren Nachbarn entwickelt haben und wie man auf den, heute so stark angegriffenen Punkt angelangt ist. Die ganze Organisation des französischen Militärflugwesens untersteht bekanntlich der permanenten Inspektion des Luftschiffahrtswesens, deren Chef der General Hirschauer ist. So wenigstens lautet es in den betreffenden Bestimmungen. In Wirklichkeit ist es aber nicht die Organisation selbst, sondern nur deren Vorbereitung, die dem Leiter des französischen Militärflugwesens zufällt. General Hirschauer schlägt vor, die Bureaus des Kriegsministeriums verfügen. Alle Fragen, welche das Kriegsflugwesen betreffen, werden von der Generalinspektion erwogen, welche ihre Berichte der aeronautischen Abteilung im Kriegsministerium unterbreitet, welch letztere sich aus drei Generalstabsoffizieren zusammensetzt. In Wirklichkeit sind zahlreiche Vorschläge des Generalinspekteurs unberücksichtigt geblieben. Namentlich zwei Projekte, auf deren Durchführung die maßgebende Stelle einen sehr hohen Wert legt, seien hier angeführt: eine große Anzahl durch den Aero-Club diplomierter Flieger, welche gegenwärt g ihre Dienstzeit absolvieren, sind trotz wiederholter und dringender Vorstellungen des Generalinspekteurs noch nicht einer der aeronautischen Gruppen der Armee zugeteilt worden. Selbstverständlich haben alle die Leute, wie es die militärischen Bestimmungen erheischen, sofort bei ihrem Eintritt in die Armee einen dementsprechenden Antrag gestellt. Die zweite Frage, von ungleich höherer Wichtigkeit und deren Lösung von der leitenden Stelle des Flugwesens als außerordentlich dringend angesehen wird, ist diejenige der Schaffung eines Zivilflieger-Korps. Zahlreiche Projekte sind in dieser Hinsicht auf die Tagesordnung gebracht worden und aus den Kreisen der Flieger selbst ist seit nahezu einem Jahre angeregt worden, daß den Zivilfliegern eine gewisse Entschädigung gewährt wird dafür, daß sie in Kriegszeiten eine außerordentlich wertvolle Reserve darstellen werden. Der französische Staat zahlt den Konstrukteuren für die Ausbildung jeden Militärfliegers eine Summe von 4.500 Francs; diese Summe spart er bei den Zivilfliegern, die ja doch sämtlich das Fliegerzeugnis des Aero-Clubs besitzen, schon von vornherein. General Hirschauer hatte nun mit Bezug auf die Zivilflieger folgendes Projekt entworfen: nur diejenigen Zivilflieger, welche das militärische Flugführerzeugnis besitzen, sollen in die Flieger-Reserve eingereiht werden. Diese Flieger sollen in zwei Kategorien geteilt werden: in solche, welche einen eigenen Apparat besitzen, und solche die keinen eigenen Apparat haben. Nütürlich sollen erstere eine höhere Entschädigung erhalten als die anderen. Beide Kategorien werden laufend Bescheinigungen beizubringen haben, aus denen hervorgeht, daß sie alle 3 oder alle 6 Monate eine Serie von vorgeschriebenen Flügen vollbracht haben, und ferner werden beide Kategorien jährlich eine Uebungsperiöde mitzumachen haben, deren Dauer auf ungefähr einen Monat angenommen ist. Dieses Projekt ist vor zwei Monaten dem Kriegsministerium unterbreitet worden, bisher aber noch nicht weiter vorangekommen. Wir werden später darauf zurückkommen, in welcher Weise die eingesetzte Enquete-Kommission diese Frage zu lösen geneigt ist. ^ IEs muß ferner auf eine andere, delikate Frage hingewiesen werden: es hat sich herausgestellt, tlaß die Flieger, auch die Militärflieger, infolge ihres unterschiedlichen moralischen Wertes und infolge ihres beweglichen, oftmals abenteuerlichen Charakters, schwer zu dirigieren und noch schwerer zufriedenzustellen sind. Die Leitung des Flugwesen hat demnach mit mannigfachen Faktoren moralicher Art zu rechnen, die ihre Aufgabe beträchtlich erschweren. Hier kann nur die Zeit allmählich ausgleichend wirken, indem sie die zahlreichen Divergenzen mit einander versöhnt. Der angedeutete Zwiespalt zwischen den koordinierten Instanzen im französischen Militärflugwesen hat in der Tat eine Reihe von Unzuträglichkeiten geschaffen, deren kurze Betrachtung von allgemeinem Interesse sein muß: Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das französische Flugwesen im Augenblick eine schwere Krisis durchmacht. Die Einsetzung der Enquete-Kommission hat wie ein Donnerschlag gewirkt und alles hofft auf die reinigende Wirkung des Unwetters. Von allen Seiten erhebt man jetzt Vorwürfe und die eingeweihten Kreise stimmen darin überein, daß im Mil tärflugwesen eine nahezu sträfliche Vergeudung v< n Material und von Energien geübt worden ist. Wir wollen hier auf die Anklagen ge;en den General Hirschauer, dessen persönliche Ehrenhaftigkeit wohl außer Zweifel steht, den man aber für die Mißstände verantwortlich hält, nicht eingehen; das sind Personenfragen, die ||uns nicht interessieren. Das Uebel kommt in erster Reihe nicht von dem Leiter, sondern von der Organisation her. Diese, an der Oberfläche eine sorgfältige und fast mustergiltige, ist in Wirklichkeit eines der frappantesten una abschreckendsten Beispiele des modernen Bürokratismus. Das System ist es, welches das französische Flugwesen immer weiter hat zurückgehen machen, sodaß es heute, das wird hier von allen Sachkennern rückhaltlos anerkannt, von anderen Staaten, namentlich von Deutschland, überflügelt ist. Nehmen wir zunächst die Abschlüsse, die zwischen der Militärverwaltung ur.d den Konstrukteuren geschlossen werden. Gewiß, die Konstrukteure erkennen an, daß der Staat nicht gezwungen ist, ihnen Aufträge zu erleilen. Aber andererseits, wenn man entschlossen ist, sich eine Luftflotte zu schaffen, muß sich der Staat an die Konstrukteure wenden. Auch daß für die Bestellungen der Armeeverwaltung in Chalais-Meudon ganze Bände von „Bedingungen" der '■ Lieferungsdetails ausgearbeitet werden, wird man sich gefallen lassen müssen die Armee zahlt, sie hat deshalb das Recht, ihre Bedingungen zu st Den. Aber diese von der Verwaltung ausgearbeiteten und nach langen Verhandlungen von den Konstrukteuren angenommenen Abschlüsse ruhen, ehe sie definitive Giltigkeit erlangen, monatelang in den Akten der Büros. Nun passiert gewöhnlich folgendes: Entweder der Konstrukteur, im Vertrauen darauf, was ihm offiziell gesagt worden ist, beginnt zu arbeiten und bereitet die Apparate v or, die ihm durch jene Verträge, von denen er Kenntnis hat, zur Anfertigung übertragen sind, die aber noch nicht in seinen Händen sind. Er weiß, daß er der Militärverwaltung kreditieren kann Er kann also dann die Apparate liefern, so als ob er die Verträge zu rechter Zeit bekommen hätte, aber er läuft dabei ein großes Risiko. Oder aber der Konstrukteur will dieses Risiko nicht eingehen, dann wartet er die offiziellen Schriftstücke ab. Da ihm sonst hinreichende Arbeit fehlt, ist er gezwungen, einen Teil seiner Arbeiter zu entlassen, und wenn er dann schließlich die Aufträge bekommt, muß das Atelier in fieberhafter Eile arbeiten, denn es muß alsdann in sechs Monaten geschafft werden, was normalerweise erst in einem Jahre zu leisten war. Für die Konstrukteure ergibt sich aus diesem System eine sehr schwierige Lage, der einige, wie wir wissen, nicht gewachsen waren und bereits dahingegangen sind, während bei anderen die Verhältnisse nichts weniger als günstig liegen. Ungefähr das gleiche System hat man auch auf die Reparaturen anzuwenden begonnen: bisher konnte der Chef des betreffenden Zentrums direkt beim Konstrukteur die an einem Apparat der betreffenden Marke erforderlich gewordenen Reparaturen bestellen. Auf diese Weise konnte so eine Reparatur in etwa zwei Wochen erfolgt sein; das war offenbar zu einfach. Nach einer neuen Bestimmung hat der Leiter des Flugzentrums wegen einer notwendigen Reparatur dem Chef des Depots zu berichten; dieser erstattet dem Minister Bericht; der Minister wendet sich an den Konstrukteur; dieser antwortet direkt dem Minister; der Minister gibt die Sache nach Chalais-Meudon weiter; von dort werden die Akten dem Chef des Depots zugesandt; und dieser teilt sie dem Leiter des Flugzentrums mit.....und in der Zwischenzeit geht der Flieger spazieren und kann in Ermangelung seines Apparats nichts tun. Nun hat man in manchen Fällen diesen umständlichen Apparat dadurch zu umgehen gesucht, daß man die Reparaturen von einem Sappeur ausführen ließ Nun weiß aber zunächst der Sappeur häufig nicht allzuviel von der Fiugtechnik, dann aber ist ihm die Sache auch viel zu gleichgiltig, zumal er gewärtig ist, wie es häufig geschieht, obendrein noch wegen Ausführung der Arbeit, die ihm von Rechtswegen nicht zusteht, bestraft zu werden. Die Episoden, die sich aus einem solchen „System" ergeben, sind geradezu unglaubliche: so ist es vorgekommen, daß ein Offizier, welcher einen der Bewerbe um das Militärflieger-Zeugnis unternahm, und der infolge eines Motorendefekts in Tours gelandet ist, seinen Apparat drei Wochen lang allen Unbilden der Witterung ausgesetzt lassen mußte, b s endlich der Bescheid eintraf, daß er mit seinem „notleitenden" Flugzeug zunächst einmal zurückkehren solle; man würde dann weiter sehen. Gegen seinen Willen bestieg also der Offizier den Zweidecker und zum Glück gelang es ihm, wirklich die Abflugstelle zu erreichen. Was aber, wenn der Flieger abgestürzt wäre? Dann hätte man ein Opfer mehr zu verzeichnen gehabt, das natürlich auf das Conto des Flugwesens, und nicht auf dasjenige eines derartigen unglaublichen Systems gestellt worden wäre. Derartiger Fälle wären eine ganze Menge anzuführen, aber der eine genügt. Auch über die Flugfelder ist ein Wort zu sagen. Bevor neuerdings die drei großen Flugzentren von Versailles, Reims und Lyon geschaffen worden sind, war manches noch recht mangelhaft. Aber seitdem ist es noch weit schlechter geworden. Die auf dem Papier sorgsam entworfenen Cadres der neuen Organisation erfordern natürlich zahlreiche Offiziere aller Grade, von den Leutnants bis zu den Obersten. Wenn nun die Effektivbestände des französischen Flugwesens an jungen Offizieren, bis zum Huuptmann, ziemlich stark sind, so fehlen dagegen die höheren Offiziere vollständig. Abgesehen von den Chefs der großen aeronautischen Etablissements besteht ,ein empfindlicher Mangel an höheren Offizieren, welche auch nur die geringste praktische Erfahrung im Flugwesen besitzen. Man hat deshalb Luftschiffer heranziehen müssen, die aber außer dem guten Willen keine verwendbare Kenntnis der Materie besitzen. Andererseits steht es auch heute noch nicht fest, wem die Verantwortlichkeit für die Vorgänge in den Flugzentren zufällt. Ist es der Chef des Zentrums, der Chef des Depots oder der Chef der Region? In Wirklichkeit gibt es heute eine Verantwortlichkeit überhaupt nicht. Die Folgen eines solchen Zustandes haben nicht auf sich warten lassen. Es gibt Militär-Flugplätze, wo man hier Zweidecker, dort Eindecker, die haufenweise unter ihren tchuppen schlummern, faulen sehen kann. Es handelt sich nicht etwa um einige Ausnahmefälle, sondern deren 20 und 40 sind stellenweise zu finden. Woran liegt das? Die Apparate kommen nie aus dem Schuppen heraus, kein Mensch kümmert sich um sie. Weder Sappeure, noch Arbeiter, noch Flieger. Denn es muß bei dieser Gelegenheit ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß die Heeresverwaltung bei weitem nicht über die notwendigen Fliegerbestände verfügt. Auf einem anderen Flugplatze, einem ausschließlich militärischen, sehen wir Mortoren sich zu altem Eisen verwandeln, weil sie dem Unwetter schutzlos ausgesetzt sind und verrosten Freilich befinden sie sich unter Schuppen, aber nachdem die Leinwand dieser Schuppen nach und nach in Fetzen gegangen war, hat man sie mit Teer bestrichen, und nun rieselt der Regen tropfenweise auf die Motoren hernieder, deren Anschaffungswert je 12 bis 15.000 Francs beträgt. (Schluß folgt.) Rl. „FLUGSPORT" Mein Flug zur Nordsee. Suwelack schreibt uns über seinen Nordseeflug am 26. Februar folgendes: „Das schöne klare Wetter des gestrigen Tages, sowie der aus Süd-Ost kommende Wind veranlaßten mich, meinen lang gehegten Plan, von Essen nach London zu fliegen, gestern in die Tat umzusetzen. Kurz entschlossen telefonierte ich zum Werk, auf dem Flugplatz Gelsenkirchen-Essen-Rotthausen und gab nieinen Leuten die Anweisung, einen Apparat bereit zu machen und mit Betriebsstoff für 6 Stunden zu versehen. Als ich im Auto um 'lt8 Uhr ankam, lag noch dichter Nebel, während in den Hallen der Kondor-Werke meine Leute eifrig damit beschäftigt waren, den Eindecker einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen und flugfertig zu machen Mittlerweile war es \Q geworden, aber der dichte Nebel verhinderte absolut einen Start. Als Orientierungsmittel hatte ich einen Kompaß sowie einen Höhenmesser mitgenommen; eine Landkarte wollte ich zu meinem Fluge nicht benutzen. Gegen 9 Uhr, da die Luft sich etwas geklärt hatte, :-tieg ich auf, als ich in 200 m Höhe war, mußte ich wegen der absoluten Undurchsichtigkeit nach diesem ersten Probeflug wieder landen. Ich nahm noch einigen Proviant mit und stieg um 9,32, als die Sonne sichtbar wurde und sich das Wetter hier aufklärte, auf und erreichte in ganz kurzer Zeit eine Höhe von 1800 m. Sehr bald mußte ich den Blicken meiner Leute entschwunden sein, denn ich sah nur noch einmal als ganz winziges Pünktchen unter mir die Halle und dieses war der letzte Blick, mit dem ich bis zu meiner Landung die Erde sah. Ich flog jetzt in der Richtung auf England^los. Dort, wo ich das Häusermeer von Essen glaubte, erhoben sich mächtige Wolkenberge, die sich in riesigen Ballen auftürmten. Es war ein derartig herrlicher Anblick über diese endlose, glatte weiße Wolkendecke hinweg zu fliegen, daß ich mich beinahe immer veranlaßt fühlte, aus meinem Apparat auszusteigen, um hier oben auf dieser unendlichen, wunderschönen Fläche, wo es kein lebendes Wesen außer mir gab, ganz abgeschieden von allen einherzugehen. Sehr bald mußte ich zu meinem Aerger bemerken, daß der Kompaß, den ich mitführte, nicht einwandfrei funktionierte, da er durch die Schwungmassen des Motors abgelenkt wurde. Kurz entschlossen nahm ich die Sonne, mein einziger Zuschauer in dieser großen Einsamkeit, als Orientierungsmittel und steuerte mit der Sonne im Rücken in fröhlichster Laune meinem Ziele zu. Lange schon flog ich in dieser Unendlichkeit weiter und nur die fernen Wolkenberge, die eine wunderbare, rosenrote Färbung und eine eigenartig blaue Schattenbildung zeigten, boten in ihrer verschiedenartigen Gestalt Abwechslung. Mein Motor arbeitete mit einer wunderbaren Gleichmäßigkeit und es kam mir nicht mal der Gedanke, daß dieser aussetzen könnte. Ich sehnte mich nach Abwechslung, der Ausblick, den der Kondor nach allen Seiten bietet, veranlaßte mich, den Schatten des Apparates auf der glatten weißen Wolkendecke zu suchen, aber da bot sich mir ein Anblick, der sich mir derarlig eingeprägt hat, daß ich ihn nie in meinem Leben vergessen werde. Unten über die Wolken zog ein wunderbares Farbenspiel. Der Schatten des Kondor wurde in seiner ganzen schönen Form auf der Wolkendecke wiedergegeben und um ihn herum legten sich in den herrlichsten Regenbogenfarben Kreise, die ihn wie ein Glorienschein umgaben. Der Anblick war derartig schön, daß ich mich ganz darin vertiefte und darüber vergaß, daß ich mich in einem von Menschenhand gemachten Flugzeug hier oben abgeschieden und ungesehen von aller Welt bewegte. Ich dachte an die Menschen, Städte und Flüsse, die tief unter mir waren und ich war vollständig ergriffen von der Erhabenheit und Schönheit dieses Augenblicks. In der Ferne tauchte jetzt in schönen Farben ein schmaler Streifen auf, dieses mußte nach meiner Meinung das Meer sein. Vor mir und hinter mir sah ich nichts und ich steuerte auf das entfernte Meer los. Plötzlich sah ich zu meiner Rechten auf einem hohen Wolkenberg, der in seiner Gestalt einem wunderbaren Gebirgszuge glich, anscheinend eine Wolkenöffnung. Ich wähnte durch diese Oeffnung die Erde zu sehen und glaubte ganz deutlich Land zu erkennen. Ich steuerte mich rechts wendend darauf los, bemerkte aber sehr bald, daß ich mich getäuscht hatte Das Wolkenmeer nahm kein Ende und immer neue Wolkenberge türmten sich unter mir auf. Mein Barograph zeigte eine Höhe von 2160 ni an. Jetzt trat mir der Gedanke nah, ob ich wohl auch auf dem richtigen Wege se', zumal ich doch auch damit rechnen mußte, daß ich durch den Wind etwas seitlich abgetrieben wurde; ich beschloß, kurzer Hand zu landen, um mich vor Ueber-fliegen der Nordsee nochmal zu vergewissern. In 400 m Höhe tauchte ich in den Wolken unter und es wurde immer dunkler und schwärzer und der einzige, der mich jetzt nicht im Stich lassen durfte, war mein Höhenmesser. Noch war ich 40 m hoch über der Erde und nichts war von dieser zu sehen. Der Nebel war hier so dicht, daß selbst die Flügelspitzen meines Apparates in unklaren Umrissen zu sehen waren Ganz vorsichtig fühlend näherte ich mich dem Erdboden, da ich mit der Gefahr rechnen mußte, Gebäude, Türme oder Bäume anzustoßen, da ich mich ja gerade so gut mitten in einer Stadt, als auch auf dem Lande befinden konnte. Beides trat nicht ein, denn zu meinem Staunen war unter mir alles Wasser. Ich bemerkte einen kurzen Ruck in meinem Apparat; Wasserspritzer prasselten gegen die Tragdecken und trotz des Lärmens des Motors dröhnte das Wasser gegen die straff bespannten Flächen meines Kondors. Sofort gab ich meinem Motor 1300 Touren und ich hatte das Glück, daß der Propeller nicht in das Wasser einget ucht war, sonst wäre er bei der hohen Tourenzahl zersplittert und jede Möglichkeit, das Festland wiederzugewinnen, würde mir genommen sein. Rasch stieg ich bis zu 900 m Höhe und tauchte aus dem dunklen Nebel zur lichten Sonne wieder empor. Dieser flog ich jetzt entgegen, denn im Süden mußte ja das Festland sein. Ich flog jetzt ca. 3/, bis 1 Stunde lang in dieser Höhe nach Süden, um dann abermals zur Landung zu schreiten. Wiederum traf ich, als ich zum zweitenmal durch die Wolkenschicht stieß, immer dickere Nebelschwaden; noch vorsichtiger wie das erstemal, ging ich unter zu Hülfenahme meines Höhenmessers vorsichtig immer niedriger. Jetzt war ich nur noch 20 m hoch und schon wähnte ich noch auf dem Meere zu sein, als plötzlich zwei Bauernhäuser dem scharfen Auge eben erkennbar an mir vorbeihuschten. Vor mir stand wie eine hohe Mauer eine Pappelallee und im letzten Moment, Dank meinem gehorsamen Apparat überflog ich diese und ging dann kurz entschlossen zu meinem großen Glück auf einer schönen ebenen Wiesenfläche nieder. Die Gefahr war überstanden und ich befand mich wieder auf der grauen Erde. Durch das Geräusch des Motors waren die Bewohner der Gegend auf mich aufmerksam gemacht und nach einigem Suchen entdeckten sie meinen Apparat, aus dem ich bereits ausgestiegen war auf einer Wiese Kaum 50 m von den beiden Bauernhäusern stand der brave Kondor. Aengstlich und zögernd kamen die Leute näher und ich stellte alsbald fest, daß ich in der Nähe von Devente bei Zwolle in Holland mich befand. Ich war also in meiner Richtung zu weit nach links geflogen und hätte bei einer Fortsetzung meines Fluges mein Ziel England verfehlt. Leider war mir durch den dichten Nebel jeder Start unmöglich gemacht und tief betrübt mußte ich mein Vorhaben, London zu erreichen, aufgeben, ob-schon ich noch für 4 Stunden Betriebsstoff in meinem Benzi ibehälter hatte. Aus demselben Grunde war mir ein Rückflug nach Essen zur Unmöglichkeit geworden. Von den Bewohnern der Gegend wurde ich sehr freundlich aufgenommen und ich übertrug die Ueberwachung meines Apparates einem Bauernburschen und fuhr mit der Bahn nach Essen zurück. Mein Flug nach London werde ich im Mai ds. Jrs., wenn die Nebel an der Nordsee-Küste und im Kanal nachlassen, zur Duchfiihrung bringen und zwar mit einer neuen Maschine, die ich sofort in Angriff genommen habe, mit der es mir möglich ist, sowohl auf dem Lande als auch dem Wasser zu landen. Es ist dann die große Gefahr bei dichtem Nebel mit einem schweren Apparat auf dem Wasser, von keinem Menschen gesehen, untergehen zu müssen, verringert. Glänzend bewährt auf dem ganzen Fluge hat sich mein Kondor, der, dem geringsten Steuerdruck gehorchend, mir es, namentlich in den unteren Schichten bei dem unruhigen dichten Nebel treibend, ermöglichte, alle Hindernisse noch im letzten Augenblicke zu überfliegen. No. 358. Stagge, Walter, Monteur, Berlin ü., geh am 19. Dezember 1887 zu Magdeburg, für Zweidecker (Wright), Flugfeld Teltow, am 31. Januar 1913.  Rundschau. Inland. Flug/tthrer-Zeugnisse haben erhalten : No. 359. Stoeffler, Ernst Philipp, Johannisthal, geb. am 17. Juni 1887 zu Straßburg i. Eis., für Zweidecker (Luftverkehr), Flugplatz Johannisthal, am 31. Januar 1913. No. 360. Bramhoff, Wilhelm, Flugplatz Wanne, geb. am 16. November 1889 zu Osterfeld, Kreis Recklinghausen, für Eindecker (Grade), Flugplatz Wanne, am 12. Februar 1913. No. 361. Heller, Otto, Techniker, Grünau, geb . am 2. März 1893 zu Grünau, für Eindecker (Schulze), Flugplatz Madel b. Burg, am 13. Februar 1913. Die Flugzeugbau Friedrichshafen G. m. b. H, die sich seit langer Zeit mit dem Bau von Wasserflugmaschinen beschäftigen, haben seit einiger Zeit einen größeren Typ mit 100 PS Motor herausgebracht. Dieses Flugzeug besitzt einen Hauptschwimmer und zur Unterstützung des Schwanzes sowie zur Erhaltung der Wasserflügmaschine der Flugzeugbau Friedrichshofen G. m. b. ü. seitlichen Stabilität kleine Hilfsschwimmer. Die Flächen zur Erhaltung der seitlichen Stabilität in der Luft sind, wie bei Curtiss, zwischen den Tragdecken angeordnet. Um die Tragkraft zu vergrößern, ist das Oberdeck verlängert worden. Mit dem vorliegenden Typ wurden in letzter Zeit ganz vorzügliche Resultate erzielt. Am 14. v. Mts. schlug der Ingenieur-Flieger Robert Gsell auf einem F. F. Doppeldecker-Wasserflugzeug in Gegenwart des Schweizer Sportkommissars C. Steiger aus Zürich über dem Bodensee bei Rorschach die beiden Schweizer Dauer-Rekorde mit 1 Stunde 7 Min. ohne und 48 Min. mit Fluggast, indem er mit einem Fluggast 2 Stunden 32 Min. 30 Sek. andauernd in der Luft in einer Höhe von 100—150 m sich hielt. Der Flug hätte trotz zeitweisen Schnetens noch gut '/j Stunde fortgesetzt werden können, doch hatte Gsell die Rückfahrt nach Manzell im Auge, für die er noch Benzin benötigte. Wie wir ferner erfahren, eröffnet die Flugzeugbau Friedrichshafen dieser Tage eine Flugschule in Manzell bei Friedrichshafen zur Erlangung der Fliegerprüfung auf Wasserflugzeugen. Von den Flugplätzen. Von der WasserflugStation Friedrichshafen. 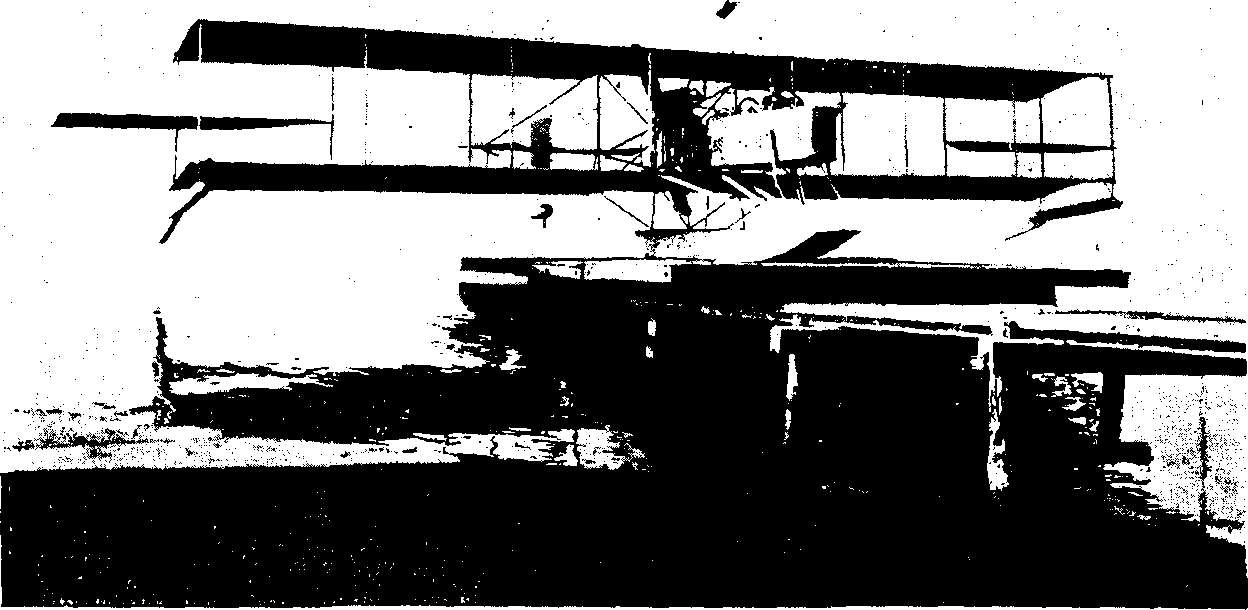 Vom Gothaer Flugplatz. Durch die Gründung des neuen Gothaer Flugzeug-Unternehmens durch Kommerzienrat Kandt dürfte dem Flugwesen in Gotha ein neuer kräftiger Impuls gegeben worden sein. Dieses Flugzeugunternehmen wird an die Gothaer Waggonfabrik, welche Uber 1200 Arbeiter verfügt, vorzügliche Montagehallen und Fabrikräume besitzt, angegliedert. Es ist daher zu erwarten, daß das Werk sehr leistungsfähig sein wird. Das genannte Unternehmen wird ferner die Herzog Carl Eduard-Fliegerschule weiter unterhalten und für Ausbildung von Privat- und Offiziersfliegern sorgen. Als Flugplatz wird der Rennplatz, auf welchem im vergangenen Jahre das Aeroplanturnier abgehalten wurde, weiter ausgebaut und Unterkunftsräume für Flieger und Flugmaschinen errichtet. Ferner haben sich die in Gotha an dem Flugwesen interessierten Kreise, die bisher durch einen Bezirksverein an den Reichsflugverein angekettet waren, selbständig gemacht und einen eignen Verein, an dessen Spitze der rührige Leiter Kommerzienrat Kandt steht, gegründet. Der Verein hat in seiner Sitzung vor einigen Tagen beschlossen, einen der eifrigsten und ältesten Förderer des deutschen Flugwesens, den Prinzen Albert von Schleswig-Holstein-Glücksburg, zum Ehrenpräsidenten zu ernennen. Unter dem Präsidium Seiner Hoheit des Prinzen Albert von Schleswig-Holstein-Glücksburg ist bekanntlich in Deutschland der allererste Ueberlandflug von Frankfurt nach Mannheim durchgeführt worden. 5E3E  Neuester Typ der Wasserflugzeugbau Friedrichshafen Q. m. b. H., gesteuert von Robert Osell. Vom Flugplatz Wanne-Herten. In der Rheinisch-westfälischen Fliegerschule Bosenius erfüllte der Flugschüler Niehaus auf Grade-Eindecker die Fliegerprüfung. Tom Flugplatz München-Milbertshofen. Die beistehende Abbildung zeigt eine interessante fotografische Aufnahme, welche im Fluge aufgenommen ist und den Flieger Schirrmeister in einem Doppeldecker der Flugwerke Deutschland darstellt in dem Moment, wie er, ohne die Steuerung zu berühren, eine Runde um den Flugplatz fliegt. Die Aufnahme wurde von Baron von Zastrow gemacht, der als Fluggast mitflog und den Momentverschluß des fotographischen Apparates durch eine Schnur betätigte. Am 27. Februar wurde viel geflogen. In aller Frühe bestanden vor Dr. Rabe und Dr. Steinmetz vom Bayerischen Aeroklub als Sportzeugen die Flieger Ing. Dick und S chi rr m eis t e r offiziell ihre Feldfliegerprüfung. Dick flog in 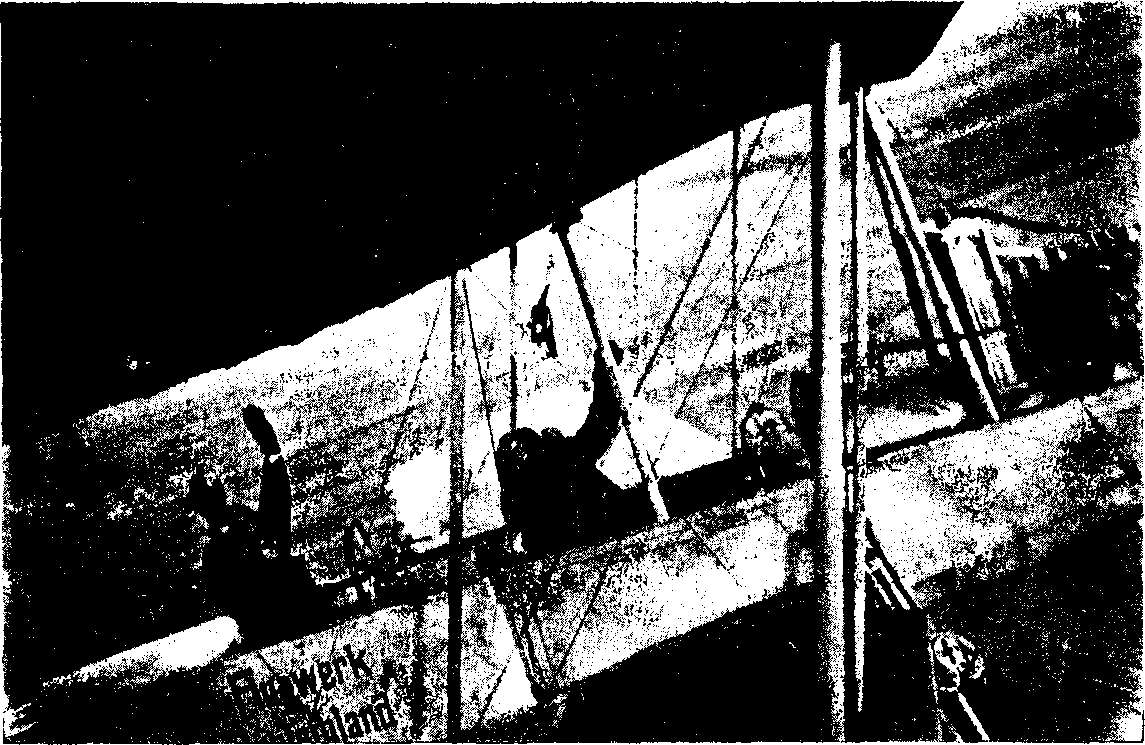 Schirrmeister auf Pleildoppeldecker der Flugwerke Deutschland fliegt eine Hunde ohne die Steuerung zu betätigen. die weitere Umgebung Münchens, nach dem Starnbergersee und Ammersee, wobe er eine Höhe von 800 m erreichte, und landete nach 1 Stunde 15 Min. aus 500 m im Gleitflug mit abgestelltem Motor wieder auf dem Flugplatze. Als Gast flog cand. ing. Otto Hoffmann mit. Schirrmeister flog den neuesten Pfeildoppeldecker mit Leutnant in der Stroth als Gast in 22 Minuten rund um München. Er erreichte 600 m Höhe und landete im Spiralgleitflug auf dem Flugplatze. Während dieser Zeit machte der junge Taubenflieger Langer auf dem Doppeldecker des Flugwerk Deutschland München-Milbertshofen seine Fliegerprüfung in guter Form. lyiilitärische Flüge. Ueberlandflüge der bayerischen Fliegerkompagnie in Oberschleißheim. Eine schöne Flugleistung vollbrachte letzte Woche Lt. Freiherr von Ha 11 er des Infanterie-Leib-Regiments. Er flog mit Oberlt. Stabl, Bataillons-Adjutant im 6. Infanterie-Regiment auf einem Otto - Doppeldecker mit 100 PS Argus von München über Jngolstadt, wo eine Meldung abgeworfen wurde, nach Regensburg. Nach kurzem Aufenthalt auf dem dortigen Exerzierplatz stiegen die Flieger wieder auf und trafen nach nur 50 Minuten Flugdauer wieder glücklich in München ein. Die gesamte, ca. 300 km lange Strecke wurde ohne jeden Defekt in der kurzen Zeit von 2 Stunden 50 Minuten zurückgelegt. Am Montag, den 24. Februar, flog der im Herbst vorigen Jahres in der „Bayerischen Fliegerschule" ausgebildete Infanterist Weingärtner mit Obeilt. Sirg als Fluggast, auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argus nach Augs- bürg, wo die Flieger vormittags 9 Uhr 43 Minuten ankamen. Nachmittags V,2 setzten sie ihren Weg nach Lager Lechfeld fort und trafen abends 5 Uhr wieder wohlbehalten in Oberschleißheim ein. Am 25. Februar flog Oberlt. Höpker auf Militärdoppeldecker „B 9" um 8 Uhr 30 von dem Casseler Flugplatz ab nach dem Sennelager bei Paderborn. Ferner flog Lt. Kastner auf einer Rumpler-Taube von Metz über Coblenz nach Cöln. Die Gesamtflugzeit betrug 3 Stunden 15 Minuten. Lt. Weyer von der Metzer Fliegerstation versuchte vor einigen Tagen von Metz nach Straßburg zu fliegen. Der Nebel war so stark, daß der Flieger kaum noch die Tragdeckenenden sehen konnte. Lt. Weyer mit Major Siegert von der Metzer Station als Begleiter, suchten daher eine Höhe von 2587 m auf. Diese Höhe dürfte bisher noch von keinem Offiziersflieger mit Begleiter erreicht worden sein. Infolge Benzinmangels mußten die Flieger niedergehen und gelang es, trotzdem die Erde erst von 4 m aus zu erkennen war, die Landung gut auszuführen. Am 22. Februar wurden von der Fliegerstation Metz von den Lts. Schulz, Canganico und Weyer mehrere nächtliche Ueberlandflüge bis nach Courcelles ausgeführt, die zum Teil gut gelangen. Vom Marine-Flugwesen. Am 1. März besichtigte anläßlich des Stapellaufs des Linienschiffs „König" der Kaiser die Marinestation Wilhelmshafen. Die unseren Lesern bekannten Flieger Oberlt. zur See Schroeter und Langfeld führten mit Doppeldeckern sehr schöne Flüge, die von Kapitän Gygas geleitet wurden, aus. Die Marinestation in Wilhelmshafen erhält zwei weitere Versuchsapparate, ein fliegendes Boot von Curtiss (s. dieses in der heutigen Nummer). Der Apparat ist von Oberlt. Langfeld bereits ausprobiert worden. Ferner ist in Aussicht genommen ein Euler-Dreidecker mit 70 PS Gnom. Ab 1. April dieses Jahres werden die zur Fliegertruppe kommandierten Seeoffiziere durch Marine-Ingenieure verstärkt, so daß dem Detachement dann insgesamt 3 Stabsoffiziere, vier Kapitänleutnants, 10 Oberleutnants zur See, 4 Leutnants zur See, 1 Stabsingenieur, I Oberingenieur und 5 Marineingenieure angehören werden Davon sind zum Dezernat des Luftschiff- und Flugwesens beim Reichs - Marineamt kommandiert: 2 Stabsoffiziere, 3 Kapitänleutnants, 6 Oberleutnants zur See, 4 Leutnants zur See, 1 Oberingenieur und 5 Ingenieure. Gleichzeitig mit dieser Vermehrung dürfte auch die Verteilung der Flieger-Kommandos auf Nord- und Ostsee-Station erfolgen Ferner sind im Kaiserl. Marineamt infolge der Frühjahrsstellenbesetzung Aenderungen eingetreten. An Stelle des Kapitän zur See Lübbert, des bisherigen Dezernenten für Luftschiffahrt und Flugwesen im Reichsmarineamt, wird Fregattenkapitän Most treten. Bekanntlich untersteht dieses dem Werftdepartement des Reichsmarineamts, dem Viceadmiral Dick vorsteht. Kapitän zur See Lübbert wird zur Verfügung des Chets der Marinestation der Ostsee gestellt. Bruno Werntgen ist am 21. Februar in Bonn tätlich abgestürzt. Werntgen, der jüngste deutsche Flieger, war am 17. März 1892 geboren, erwarb bei Dorrier am 13 Dezember 1910 das Fliegerzeugnis No. 40 und ist unsern Lesern von den Oberrheinflügen sowie seinen vielen anderen Flügen her sehr bekannt. Werntgen hatte in Gemeinschaft mit seiner Mutter im März 1912 in Bonn eine Fliegerschule errichtet und den Bau von Eindeckern mit vorn liegendem Motor (siehe die Abbildung auf Seite 838 in „Flugsport" No. 22 1912) begonnen. Er hat mit diesem neuen Apparat viele erfolgreiche Flüge ausgeführt. Am 21. Februar wollte er seinen neuesten für militärische Zwecke bestimmten Apparat, der in Döberitz vorgeführt werden sollte, ausprobieren. Hierbei zeigte sich, daß der Apparat etwas vorderlastig war. Die Vorderlastigkeit hatte er durch ein Gewicht im Schwanz ausgeglichen und in dieser Weise auch mehrere Flüge, auch, mit Passagier ausgeführt. Werntgen ließ nun bei einem weiteren Flug dieses Gewicht entfernen, sodaß der Apparat wieder stark vorderlastig wurde. Nachdem er dreiviertel Runden geflogen war, neigte sich der Apparat plötzlich nach vorn und ging aus 40 m Höhe im Sturzfluge zur Erde. Zur näheren Information wird uns von Bonn aus mitgeteilt, daß von ärztlicher Seite festgestellt worden ist, Werntgen sei während des Fluges von einem Herzschlag betroffen worden. Infolgedessen kam die Vorderlastigkeit des Apparates, die Werntgen durch den Einfluß des Höhensteuers während der Fahrt ausglich, zum Durchbruch, wodurch der jähe Absturz unvermeidlich wurde. In Werntgen verlieren wir einen der populärsten und beliebtesten Flieger. Aufs tiefste ist es zu bedauern, daß der Laufbahn dieses eifrigen Fliegers ein so schnelles Ziel gesetzt wurde. 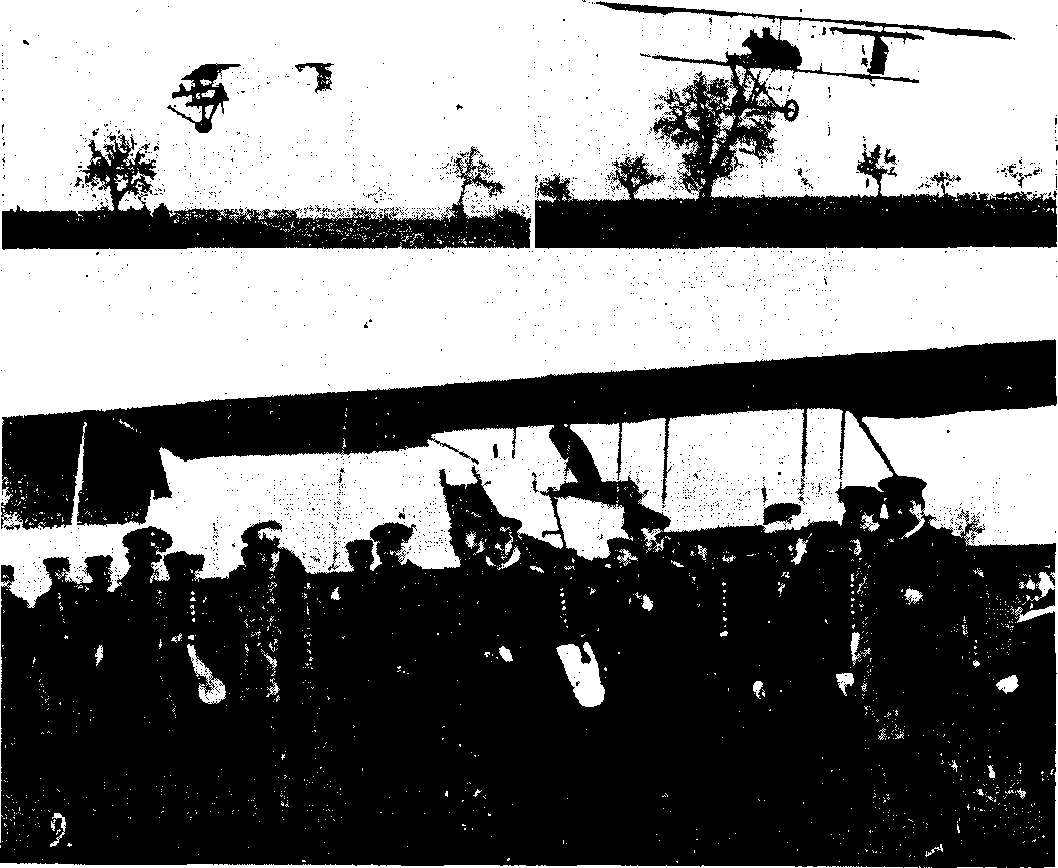 Die Flieger-Offiziere der Darmstädter Station. Oben links: Euler-Apparat im Gleitfluge auf dem Flugplatz Heidelberg landend. Oben rechts: Euler-Apparat landet in einer Kurve auf dem Flugplatz Heidelberg. Unten: Nach der Landung in Heidelberg. Von links nach rechts: Lt Reinhardt*), Hauptmann von Dewall, Lt. von Mirbach*), Lt. Sommer*) Lt. van Beers, dahinter Oberlt. Blumenbach. (Siehe Bericht in „Flugsport" Nr. 4, Seite 143.) Selbstfahrende Flugzeuge. Im Mai dieses Jahres soll in Döberitz vom Preußischen Kriegsministerium ein Wettbewerb veranstaltet werden. Die Flugzeugfabriken haben die Aufforderung erhalten, bis zum 1. Mai den Bedingungen entsprechende Maschinen anzumelden. Es soll ein Universal-Flugzeiig geschaffen *) Führer. werden, welches sich mit eigener Kraft auf der Straße fortbewegen, in 2 Stunden flugfertig montiert und in 1 Stunde demontiert werden kann. Diese Bedingungen werden selbstverständlich, da die Flugmaschinen zunächst noch in flugtechnischer Hinsicht erhebliche Verbesserungen bedürfen, an unsere Flugzeugfabriken sehr hohe Anforderungen stellen. Ausland. Wilhelm Kress f. Am 24. Februar ist Wilhelm Kress, welcher in Oesterreich auf dem Gebiete des Flugwesens viel von sich reden machte, gestorben. Wilhelm Kress, geboren am 29. Juni 1836, war einer der wenigen, welche auf die Entwicklung des Flugwesens und vor allem auf die Möglichkeit des Fluges seit langen Jahren hingewiesen hat. Durch sein Ableben ist jetzt der große und unerquickliche Prioritätsstreit, auf den wir hier nicht eingehen möchten, erledigt worden. Wennschon Kress sich verschiedentlich nicht genau an den Buchstaben gehalten hat, so hat ihm die Nachwelt in Oesterreich doch viel zu verdanken. Man denke nur zuiück an die Zeit, als die Begeisterung für das Ballonwesen hochging und das Häuflein derer, die zuversichtlich an die Möglichkeit der Entwicklung der Schwerer- als Luft-Maschinen glaubten, sich durch den Spott gewisser Kreise nicht von ihrem Vorhaben abbringen ließen. Der österreichische Flieger Oberlt. Nittner ist auf einem Lohner-Pfeil-Doppeldecker am 17. Februar tödlich abgestürzt. Wettbewerbe. Ausschreibung des Prinz-Heinrich-FIuges 1913. 3. Zuverlässigkeilsflug am Oberrhein. § i. Die Südwestgruppe des Deutschen Luftfahrer - Verbandes veranstaltet im Mai 1913 einen Wettbewerb, der am 10. Mai in Wiesbaden beginnt, sich aus einer Vorprüfung, drei Tagesflügen (Zuverlässigkeits - Etappen), bei denen die Gesamtflugdaur bewertet wird, und einer zweitägigen Aufklärungsübung zusammensetzt, und der in Straßburg endet. § 2 Der Wettbewerb ist eine nationale, beschränkte Veranstaltung (§ 3) und führt den Namen „Prinz-Heinrich-Flug 1913". Der Wettbewerb findet nach den internationalen Bestimmungen der F. A.I. und den nationalen des Deutschen Luftfahrer-Verbandes statt. § 3. Der Wettbewerb ist offen für: a) Deutsche Offiziere auf Flugzeugen einer deutschen Heeresverwaltung oder der Marineverwaltu-g; b) Flugzeugführer deutscher Reichsangehörigkeit, die aktive Offiziere oder Offiziere des Beurlaubtenstandes sind oder einem der Vereine der Südwestgruppe des D. L. V. angehören und vom Vorstand dieses Vereins vorgeschlagen werden. Wettbewerber im Sinne der Flug-bestimmun gen §26 b ist bei dieser Kategorie der Besitzer des Flugzeuges. Alle teilnehmden Flugzeugführer müssen einen ununterbrochenen Flug von einer Stunde Dauer und mindestens 10 Flüge mit Passagier ausgeführt haben, wobei sie wenigstens einmal die Höhe von 800 m erreicht haben müssen; ferner müssen sie Uebung im Gleitflug besitzen. Zum Nachweis dieser Vorbedingungen genügt eine schriftliche verantwortliche Erklärung des Flugzeugführers, die bei der Nennung oder bis zum Antritt des Fluges abgegeben sein muß. Wegen Vertretung für einen gemeldeten Flieger s. § 17. § 4. Leistungen. Sonnabend, den 10. Mai. Vorprüfung der nicht der Heeresverwaltung gehörigen Flugzeuge. Pfingstsonntag, den 11. Mai. Zuverlässigkeitsflug Wiesbaden Cassel mit einer Zwischenlandung in Gießen. (Entfernung Wiesbaden Gießen ca. 65 km, Gießen—Cassel ca. 100 km) Die Dauer des Aufenthalts in Gießen wird beim Start in Wiesbaden durch die Oberleitung festgesetzt. Pfingstmontag, den 12. Mai. Zuverlässigkeitsflug von Cassel nach Coblenz ca. 170 km. Dienstag,, den 13. Mai. Ruhetag in Coblenz. Mittwoch, den 14. Mai. Coblenz — Karlsruhe. Die ca. 200 km lange Flugstrecke Coblenz—Karlsruhe kann durch die Bestimmung der Oberleitung, gewisse Kontrollstellen zu überfliegen, auf 300 km verlängert werden. | Eine dieser Kontrollstellen wird nach "Neustadt a. H. gelegt. Donnerstag, den 15. Mai. Ruhetag in Karlsruhe. Freitag, den 16. Mai. Flug Karlsruhe—Straßburg mit einer Aufklärungsübung bei Stuttgart. Flug Straßburg—Freiburg — Straßburg mit einer Aufklärungsübung südlich dieser Orte. Die Oberleitung behält sich vor, Verschiebungen jeder Art dieses Programmes vorzunehmen, auch neue Ruhetage einzulegen und solche ausfallen zu lassen. Die Aufklärungsübungen können auch Wettbewerber bestreiten, die am Ziiverlässigkeitsfhig nicht teilgenommen haben; außerdem können auch Luftschiffe teilnehmen. § 5. Passagiere. Die Mitnahme eines Passagiers, der aktiver Offizier, in Uniform verabschiedeter Offizier oder Offizier des Beurlaubtenstandes sein muß, ist vorgeschrieben. Die Person des Passagiers kann von Etappe zu Etappe wechseln. Die Zuteilung der Passagiere erfolgt durch die Oberleitung unter tunlichster Berücksichtigung der Wünsche der Flugzeugführer. § 6. Bewertung. Bewertet wird bei den 3 Zuverlässigkeitsetappen die Leistung nach der Gesamtflugdauer. Die Gesamtflugdauer setzt sich zusammen aus der gemäß § 8 gewerteten reinen Flugzeit und aus der für Notlandungen nach dem Barogramm und den schriftlichen Angaben des Passagiers gebrauchten Zeit, unter Hinzurechnung der zur Beseitigung solcher sichtbaren Schäden gebrauchten Zeit, die beim Landen in Gießen oder auf einem Etappenort nach Zurücklegen einer der Zuverlässigkeitsetappen entstanden sind. Bei Berechnung der reinen Flugzeit und bei der Belastung erhalten die schwächeren Motoren ein Vorgabe (s. §§ 7—10). Startet ein Führer an dem vorgeschriebenen Tage nicht, sondern erst am nächsten Tage, so wird die Flugzeit für diese Etappe mit 50"/0 Aufschlag in die Bewertung gezogen. Legt er die Etappe auch an diesem Tage nicht zurück, so hat er auf einen Zuverlässigkeitspreis keinen Anspruch mehr. Bei den Aufklärungsübungen stellt der Chef des Generalstabes der Armee die Aufgaben. Die Bewertung geschieht lediglich nach militärischen Rücksichten. Auch bei den Aufklärungsübungen wird mit der Belastung nach § 9 geflogen. §7. Die Bewertung der reinen Flugzeit sowie die Bestimmung der Normalbc-lastdng erfolgt auf Grund einer Abschätzung der Motorstärke. Difise 1. Tag: 2. Tag: 3. Tag: 4. Tag: 5. Tag: 6. Tag: 7. Tag: 8. Tag: Abschätzung berücksichtigt nur die Größe des Zylindervolumens sowie die Gattung des Motors, und zwar in folgender Weise: Bedeutet V das Hubvolumen sämtlicher Zylinder des Motors, ausgedrückt in Litern (cbdcm), so wird als Zahl der Pferdestärken angesehen: 1. Für den Viertaktmotor mit ruhenden Zylindern und mit Wasserkühlung ................ 10 V; 11. Für den Viertaktmotor mit umlaufenden Zylindern ohne Wasserkühlung................. 6,5 V; III. Für den Zweitaktmotor mit ruhenden Zylindern ohne Wasserkühlung................. 10,5 V ; Beispiel: Es habe ein Motor der Kategorie II sieben Zylinder von 130 mm Bohrung und 120 mm Hub. Das Hubvolumen beträgt: V = 7X1,2X1,3X1,3X -=11,15 Ltr. 4 Daher wird als Leistung angesehen: 6,5 X 11,15 = 72,5 PS. Wird ein Motor gemeldet, der keiner der genannten drei Kategorien angehört, so stellt der Arbeitsausschuß vor Annahme der Nennung im Einvernehmen mit dem Wettbewerber die entsprechende Formel fest. § 8. Die reine Flugzeit wird derart in Rechnung gestellt, daß die wirklich durchflogene Zeit mit einer, von der Motorstärke abhängigen Wertziffer multipliziert wird Die Wertziffer erhält man. indem man die 3 Wurzel aus dem 100sten Teil der nach § 7 ermittelten PS-Zahl bildet. Beispiel: Es habe das Flugzeug mit dem in § 7 erwähnten Motor zur Durchfliegung der drei Zuverlässigkeitsetappen rein 7 Std. 20 Min., d. h. 440 Minuten gebraucht. Die Wertziffer ist 3. Wurzel aus 0,725, d. i. 0,898. — Es wird daher in Rechnung gestellt: 0,898 X 440 = 395,12 Minuten. § 9- Für jedes Flugzeug wird entsprechend seiner Molorstärke eine Normalbelastung berechnet. Sie beträgt für den 100 PS-Motor 200 kg, für jeden anderen 200 mal dem Quadrat der im § 8 bestimmten Wertziffer. Wenn das Gewicht des Flugzeugführers und seines Passagiers (§ 6) zusammen geringer ist, als die berechnete Normalbelastung, so muß die Ergänzung in Form von Ballast mitgefjjhrt werden. Beispiel: Für den oben angeführten Motor war die Wertziffer 0,898, somit ist die Normalbelastung 200 X 0,898 X 0,898 = 161,3 kg. Wiegen die beiden Personen zusammen 136 kg, so ist Ballast von 25 kg mitzunehmen. § 10. Die folgende Tabelle gibt eine Uebersicht über die Wertzifiern und Normalbelastungen für verschiedene Hubvolumen von Motoren der drei Kategorien.
§ 11. Die Flugzeuge müssen in Deutschland hergestellt sein, doch sind Molorc beliebiger Herkunft zugelassen. Die Zuverlässigkeitsetappen einerseits und die beiden Aufklärungsübungen anderseits müssen mit demselben Flugzeug zurückgelegt werden. Sämtliche Reparaturen sind erlaubt, ausgenommen das Auswechseln des Motors, des Rumpfes, der Tragdecke oder der Flügel. Weiterhin müssen die Bewerber um den Ehrenpreis Sr Majestät des Kaisers (s. § 13) die Zuverlässigkeitsetappen und die Aufklärungsübungen auf ein und demselben Flugzeug zurückgelegt haben. § 12. Vorprüfung. Die nicht der Heere&verwaltung gehörigen, für die Zuxerlässigkeitsetappen genannten Flugzeuge müssen in einer Vo r p ruf un g den Beweis erbringen, dal.5 sie die von der Heeresverwaltung geforderten Eigenschaften besitzen. Die Vorprüfung wird in Wiesbaden durch die sportliche Oberleitung abgehalten (s. § 4) Hierbei sind folgende Bedingungen zu erfüllen: a) Steigen auf 500 m in höchstens 15 Minuten mit der nach § 9 fest- fesetzten Belastung, nlauf beim Hochgehen und Auslauf beim Landen nach den Bedingungen, die die Heeesverwaltung für die vor dem 1 Januar 1913 bestellten Flugzeuge erlassen hat. c) Landen auf einem von der sportlichen Leitung hierzu ermieteten und eingerichteten feldmäßigen Gelände. § 13. Preise und Geldentschädigungen. a) Preise: Die Preise sind Ehrenpreise, sie zerfallen in : 1. Ehrenpreis Seiner Majestät des Kaisers für den Wettbewerber, der bei den Zuverlässigkeitsetappen die, nach § 6 berechnete, geringste Gesamtflugdauer erzielte und die Aurklärungsübungen mit Erfolg erledigte. 2 Ehrenpreis Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen „Prinz-Heinrich-Preis der Lüfte" für die beste Leistung der Aufklärungsübung 3. Weitere Zuverlässifkeitspreise. 4. Aufklärungspreise. Beim Zuverlässigkeitswettbeweib steht für jeden Flugzeugführer, der die drei Zuverlässigkeitsetappen zurückgelegt hat, ein Preis zur Verfügung. Auch die übrigen Wettbewerber und alle Passagiere erhalten Erinnerungsgaben. Beim Aufklärungswettbewerb steht für je zwei Flugzeugführer ein Ehrenpreis zur Verfügung. Die beobachtenden Passagiere erhalten gleichwertige Preise wie die Führer b) Geldentschädigungen. Es stehen M. 70 000 für Geldentschädigungen zur Verfügung. Die Wettbewerber der Kategorie § 3b erhalten Geldentschädigungen, die gezahlt werden, wenn ihre Flugzeuge die betreffenden Tagesetappen an den dafür bestimmten oder am darauffolgenden Tage erledigt haben. Diese Geld-entschädigungen betragen: Für die Wettbewerber, deren Flugzeuge die erste Etappenstrecke, Wiesbaden—Cassel, durchflogen haben, außer dem zurückbezahlten Betrag von M. 500 des Nenngeldes: je weitere M. 500. Für die Wettbewerber, deren Flugzeuge die erste und auch die zweite Etappenstrecke, Cassel Coblenz, durchflogen haben, je weitere M. 1000. Für die Wettbewerber, deren Flugzeuge die beiden ersten und auch die dritte eventuell verlängerte Etappenstrecke, Coblenz—Karlsruhe, vorschriftsmäßig durchflogen haben, je weitero M. 2500. Für die Wettbewerber, deren Flugzeuge die drei Zuverlässigkeitsetappen und die Aufklärungsübung erledigt haben, je weitere M. 2000. Für Wettbewerber, die nur zu den Aufklarungswettbewerben genannt, und deren Flugzeuge diese Uebungen erledigt haben, je M. 1500. Außerdem wird nach dem Start zur ersten Aufklärungs-übung diesen Wettbewerbern das Nenngeld zurückbezahlt. (§ 15.) Außer diesen Geldentschädigungen stehen für die Wettbewerber der Kategorie b, mit der auf den drei Zuverlässigkeitsetappen erzielten und nach § ß zu berechnenden, kürzesten Gesamtflugdauer drei weitere Entschändigungen von M. 5000, 3000 und M. 2000 zur Verfügung. § 14 Die Höchstzahl der Teilnehmer für den Zuverlässigkeitsflug wird für die unter § 3 a bezeichneten Wettbewerber auf 12, für die unter 3 e bezeichneten auf 9, für die nur zur Aufklärungsübung nennenden Wettbewerber der Kategorie § 3 b auf 4 festgesetzt. Wenn mehr Meldungen eingehen, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Wenn insgesamt weniger als 10 ordnungsmäßige Anmeldungen eingehen, entscheidet der Arbeitsausschuß innerhalb einer Woche nach Nennungsschluß, ob der Flug stattfindet oder ausfällt. Nennung. § 15. Für die Bewerber der Kategorie a wird kein Nenngeld erhoben. Für die Wettbewerber der Kategorie b beträgt das Nenngeld M. 500, sowohl für solche, die zum ganzen Flug, wie für solche, die nur zur Aufklärungsübung nennen. Das Nenngeld wird im Falle des Startes und außerdem in den Fällen Flug-bestimmung § 20 g voll zurückbezahlt (siehe auch § 13b). Im Falle des Nichtstartens werden einbehaltene Nenngelder den Geldentschädigungen für die drei besten Leistungen auf den Zuverlässigkeitsetappen zugeschlagen. § 16. Die Nennungsstelle ist der Arbeitsausschuß des Prinz-Heinrich-Fluges 1913 Straßburg i. Eis., Blauwolkengasse 21. Südwestgruppe des Deutschen Luftfahrer-Verbandes. Nennungsbeginn 1. April 1913. Nennungsschluß für den Zuverlässigkeitsflug 25. April, 8 Uhr abends. Für die Aufklärungsiibungen können Teilnehmer der Kategorie a bis zum 14. Mai, mittags 12 Uhr, im Geschäftszimmer der Oberleitung in Karlsruhe nach-nennen, Wettbewerber der Kategorie b bis 5. Mai, 8 Uhr abends, an der oben genannten Nennungsstelle. Die Nennung erfolgt durch Einsenden der Verpflichtungen in der durch Flugbestimmung § 26 a und c vorgeschriebenen Weise mit eingeschriebenem Brief. Für die Verpflichtungen sind die beifolgenden Anmeldungsformulare zu benutzen. § 17. Nennender ist in der Kategorie a die betreffende Heeres- oder Marineverwaltung, in der Kategorie b der Besitzer des Flugzeuges. Dieser hat den mit der Führung des Flugzeuges beauftragten Führer spätestens bis zum 1. Mai 1913 anzugeben, ebenso dessen Lizenznummer; der nennende Flugzeugbesitzer hat außerdem die Bescheinigung beizubringen, daß der mit der Führung des Flugzeuges beauftragte Führer Mitglied eines Vereins der Südwestgruppe ist und vom Vorstand dieses Vereins vorgeschlagen wird. (§ 3.) Das Flugzeug muß während des Zuverlässigkeitsfluges von ein und demselben Führer geführt werden; es kann aber bei der Nennung für jeden gemeldeten Flieger ein Vertreter namhaft gemacht werden, der an Stelle eines behinderten Fliegers für die ganze Dauer des Zuverlässigkeitsfluges eintritt. § 18. In der Verpflichtung geben die Nennenden an: die Gattung ihres Motors (ob Zweitakt oder Viertakt, Wasser- oder Luftkühlung, ruhende oder umlaufende Zylinder), ferner Anzahl, Hub und Bohrung ihrer Zylinder. Zugleich mit der Annahme der Nennung teilen die Veranstalter mit, welche Motorstärke, welche Wertziffer für die Flugzeit und welche Normalbelastnng aus den Angaben der Verpflichtung berechnet werden. Die Zahlen gelten vorbehaltlich einer bei der Abnahme der Flugzeuge vorzunehmenden Kontrolle. § 19. Abnahme und Unterbringung der Flugzeuge. Die Flugzeuge der Heeres- und Marineverwaltung bedürfen keiner Abnahme. Die ührigen Flugzeuge werden am 9. Mai, von nachmittags 3 Uhr ab, der Oberleitung auf dem Flugplatz Rennbahn Wiesbaden vorgeführt, abgenommen. plombiert und gestempelt. Ueber die Abnahme zu spät eintreffender Flugzeuge entscheidet die Oberleitung. Vom 7. Mai ab können die Flugzeuge auf dem Flugplatz Wiesbaden untergebracht werden. Mit der Eisenbahn abgesandte Flugzeuge gehen am besten an Speditionsgeschäft Rettenmeyer, Wiesbaden, Nikolasstr. 5, Fernsprech-nnmniern 12 und 2376. Flugzeuge, die nach Ansicht der Oberleitung den Anforderungen an Sicherheit für Flieger und Passagiere nicht entsprechen, können zurückgewiesen werden, ohne daß den Meldenden irgend welche Entschädigungen zustehen. Auf allen Etappenorten erfolgt die Unterbringung der Flugzeuge in Zelten, deren Bewachung gewährleistet wird, juristische Haftung ist jedoch ausgeschlossen. Die Abnahme der nicht der Heeres- und Marineverwaltung gehörigen, nur für die Aufklärungsübungen bestimmten Flugzeuge findet am 15. Mai, 4 Uhr nachmittags, in Karlsruhe statt. § 20. Start. Bei den beiden ersten Zuverlässigkeitsetappen wird mit stehendem Start (Flugbest. No. 35), bei der dritten Zuverlässigkeitsetappe mit fliegendem Start gestartet. Die Startzeit und der Startort werden abends vorher bekannt gegeben. Die Flieger starten in der Reihenfolge der abgemeldeten Flugbereitschaft, Bei gleichzeitiger Anmeldung entsc eidet das Los. Die Starterlaubnis gilt nur für 5 Minuten, darnach ist Neuanmeldung erforderlich, wenn andere Meldungen vorliegen und die Apparate nicht nebeneinander starten können. Beim stehenden Start wird aber immer, auch bei Mißlingen des ersten Startes, der Augenblick als Abflug gezeitet, in dem das Flugzeug zum erstenmal offiziell Starterlaubnis erhielt. Wenn beim fliegenden Start der Flieger wieder landet oder auf den Flugplatz zurückkehrt, gilt doch der Zeitpunkt des ersten Ueberfliegens der Startlinie für Berechnung der Flugzeit. § 21. Kontrolle. Die Flugzeuge müssen mit vom Wettbewerber gelieferten Barographen ausgestattet sein; der Oberleitung steht deren Prüfung zu. Die Barogramme sind nach jeder Landung auf einer Etappe sofort an die sportliche Etappenleitung abzugeben. Die Zeitnahme erfolgt genau nach § 20 der Flugbestimmungen. Die Passagiere haben die von der Leitung angegebenen Bordbücher genau zu führen und nach Beendigung des Fluges der Oberleitung persönlich abzugeben. Für die dritte Zuverlässigkeitsstrecke wird mündlich bekannt gegeben, welche Kontrollstationen zu überfliegen sind. Die Kontrollstellen sind nur so hoch zu üb.rfliegen, daß Konirolle auf photographischem Wege möglich ist, keinesfalls höher als 150 m. Die Flugzeuge werden durch von den Veranstaltern gelieferte Nummern kenntlich gemacht. § 22. Landung. Als Landung gilt der Augenblick, in dem das Flugzeug innerhalb des abgegrenzten Landungsplatzes den Boden berührt. Erfolgt die Ankunft am Tagesziel voraussichtlich nach 9 Uhr abends, so muß bis spätestens 10 Uhr ein Telegramm in den Händen der sportlichen Etappenleitung sein, bis wann die Landung voraussichtlich erfolgt. Anderenfalls wird, wenn die Landung in der Nacht erfolgt, als Landungszeit 4'/« Uhr morgens des nächsten Tages angesehen Wiederholung des Fluges nach erfolgter ordnungsmäßiger Zurücklegung der Etappe ist nicht statthaft. § 23. Die Namen der sportlichen Leiter werden in den Programmen veröffentlicht. § -4. Obmann des Schiedsgerichts ist Herr Geh. Reg,-Rat Prof. ür. Hergesell, Straßburg. § 25. Monteure. Für jedes Flugzeug können 2 Monteure mitgenommen werden, für deren Beförderung und Unterbringung vom Eintreffen des Flugzeuges in Wiesbaden an bis Abtransport des Flugzeuges in Straßburg die Veranstalter sorgen. Außerdem zahlen die Veranstalter für jeden Zivil- und Militär-Monteur Geldentschädigungen, deren Höhe nach Annahme der Nennung mit den Nennenden verabredet wird. § 26. Ersatz- und Reparaturteile, Hilfeleistung bei Notlandungen, Auskunftstelle pp. Das Nachführen von Ersatz- und Reparaturteilen, sowie die Hilfeleistung bei Notlandungen geschieht auf Kosten der Veranstalter durch sogenannte Unparteiische, die von der Oberleitung angestellt werden. Es ist nicht gestattet, auf eigenen Automobilen Monteure, Ersatz- oder Reparaturteile nachzuführen. Flugzeugführer und Wettbewerber erhalten nach der Nennung ein Druckheft, aus dem die Organisation des Nachführens und der Hilfeleistung sowie die Menge des nachzuführenden Materials zu ersehen ist. In dem Druckheft finden sich auch Nachrichten über die Geschäftsstellen und deren Fernsprechnummern sowie über die Auskunftsstelle für ankommendes Personal. § 27. Das nach Flugbestimmungen Nr. 43 zusammengesetzte Preisgericht erhält über die Bewertung der Ergebnisse der Aufklärungsübungen die notwendigen Angaben von einer Kommission, die aus Offizieren des großen Ge-ncrnlstabes und einem Mitglied der Oberleitung besteht. § 28. Benzin und Oel. Benzin und Oel bestimmter Provenienz steht den Fliegern an den Tagesstationen und an bestimmten Zwischenstationen unentgeltlich gegen Bons zur Verfügung, die von den Veranstaltern ausgegeben werden. Falls andere Qualitäten gewünscht werden, können solche auf Kosten des betreffenden Fliegers beschafft werden. Wünche sind bei der Nennung zu äußern. § 29. Karten. Für jedes Flugzeug wird je ein Satz Karten für Flieger und Passagier kostenlos geliefert. § 30. Dje Veranstalter lehnen für sich und ih e Organe jede Haftplicht für Schäden* irgend welcher Art ab, welche den Teilnehmern, ihren Angestellten, Flugzeugen oder ihrem sonstigen Eigentum, Mitfahrern o er anderen Personen und deren Eigentum, sei es durch eigene Schuld, die Schuld Dritter oder höherer Gewalt, widerfahren und zwar sowohl während des Fluges als auch nach erfolgter Landung. Vielmehr ist jeder Flieger für den von ihm angerichteten Schaden allein verantwortlich. Das Ueberfliegen von großen Ortschaften und Menschenansammlungen ist tunlichst zu vermeiden. § 31. Vor dem Ueberfliegen von Festungen wird die sportliche Leitung der vorhergehenden Etappe feststellen, daß keinerlei photographische Apparate von den Fliegern oder Passagieren mitgenommen werden. § 32. Die Unterbringung der Flugzeugführer, Passagiere und Unparteiischen an den Etappenorten wird von den Veranstaltern auf ihre Rechnung übernommen § 33. Ueber alle den Flug betreffenden Fragen, soweit sie in dieser Ausschreibung oder in den Flugbestimmungen des D L. V. nicht berührt sein sollten, entscheiden entgültig und unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsprozesses die sportlichen Leiter bezw. das Schiedsgericht hezw. als höchste Instanz die Flugzeugkonimission. Auch gegen die Entscheidung des Preisgerichts ist der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen. § 34. An einzelnen Etappenorten finden gleichzeitig mit dem Ueberlandflug lokale Wettbewerbe statt. An diesen dürfen die Flugzeugführer, die den Prinz-Heinrich-Flug bestreiten, nicht teilnehmen, oder sie müssen vorher aus dem Ueberlandflug-Wettbewerb ausscheiden Eine Flugveranstaltung in Dreden vom 30. April bis 4. Mai wird vom Sächsischen Verein für Luftfahrt abgehalten. Obiger Verein beabsichtigt ferner, in Dresden und Bautzen selbständig einige Flugstützpunkte zu errichten. Der Vierländerflug Deutschland—Dänemark—Schweden—Norwegen ist, nachdem die schwedische aeronautische Gesellschaft ihre Beteiligung zurückgezogen hat, verschoben worden. Patentwesen. Patentanmeldungen. 77h. O. 8147. Flugzeug-Fahrgestell, dessen Streben in der Mittelebene des Rumpfes angreifen. Max Oertz, Neuhof b. Hamburg. 4. 9. 11. 77h. N. 12 924. Flugzeug mit schwenkbarer Tragfläche. Sheila O'Neill, London; Vertr.: E W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin SW. 11. 8. 3. Ii. 77h. D. 24 323. Flugzeugkörper. Armand Jean Auguste Deperdussin, Paris; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr. R. Wirth, »ipl.-Ing. C. Weihe, Dr. H. Weil, Frankfurt a. M. 1, u. W. Dame, Berlin SW. 68. 30. 11. 10. Priorität aus der Anmeldung in Frankreich vom 14. 10. 10. anerkannt. 77h. N. 34 412. Flugzeugrumpf mit Flügelstümpfen. E. Rumpier, Luftfahrzeugbau G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg. 29. 11. 11. Fahrgestell für Flugzeuge. *) Die Erfindung betrifft eine besondere Ausbildung des Fahrgestells von Flugzeugen und besteht darin, daß nebe i den bekannten Laufrädern eine Bremsordnung vorgesehen ist, welche selbsttätig im Augenblicke der Landung trotz des Vorhandenseins der Räder zur Wirkung kommt. Das Rahmengestell des Fahrzeuges trägt neben den zum Anfahren dienenden Laufrädern, welche auf Federn gelagert sind, Schlittenkufen, welche relativ zu den Rädern so hoch gelagert sind, daß sie gewöhnlich den Boden nicht berühren, aber mit diesem in Berühiung kommen können, sobald sich die Räder an der Längsseite des Radgestells entgegen der Wirkung der Federn nach Aufwärts verschieben. Diese bewegung der Räder erfolgt beim Landen derart, daß infolge Aufschleifens der Kufen eine Bremswirkung erzielt wird. Die Erfindung ist auf beistehender Zeichnung in einem Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Abb. 1 stellt einen mit dem Flugzeuggestell gemäß der Erfindung ausgerüsteten Drachenflieger in Seitenansicht dar. Abb. 2 ist zugehörige Ansicht von vorn. An dem mit den Tragflächen b versehenen Rumpf a befindet sich ein Rahmengestell beliebiger Koustiuktion. Im Zeichnungsbeispiel ist ein Querbalken d an zwei Streben c und c' auf jeder Seite angebracht. An diesem Querbalken d sind Federn g befestigt, welche die Radachse h tragen. Die unteren Enden der Streben c und c1 werden durch die Gleitkufen e verbunden. Diese Gleitkufen sind so hoch angebracht, daß sie in der Normalstellung den Boden nicht berühren; sie kommen dagegen beim Landen in dem Augenblicke, wo die Räder den Boden berühren, dadurch zur Wirkung, daß die Federn g stark durchgebogen werden. Die Laufräder können dabei so angeordnet sein, daß sie seitlich frei drehbar sind, so daß sie sich beim Aufsetzen des Fahrzeuges auf den Boden selbst-tiitig in die jeweilige Bewegungsrichtung einstellen. Ein weiterer Vorteil der Anordnung besteht darin, daß die Gteitkcifen das Freimachen der Räder erleichtern, wenn diese beim Fahren auf dem Boden in eine Vertiefung; geraten. *) D. R. P. Nr. 249483, Rene Arnoux in Paris. a 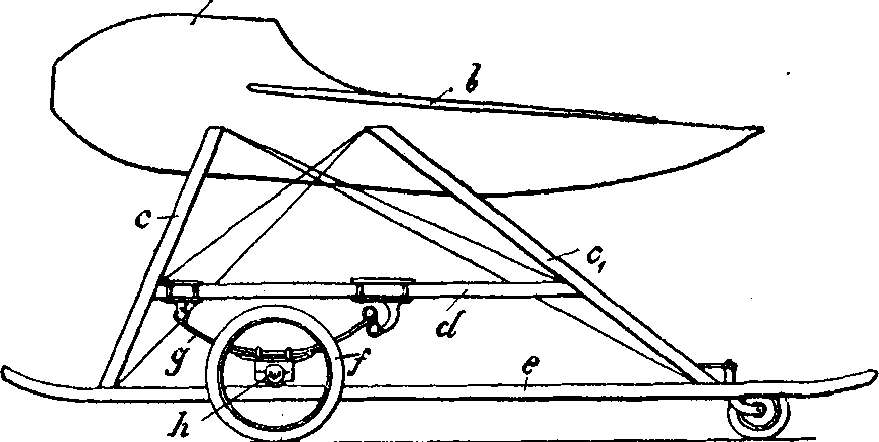 Abb. 1. 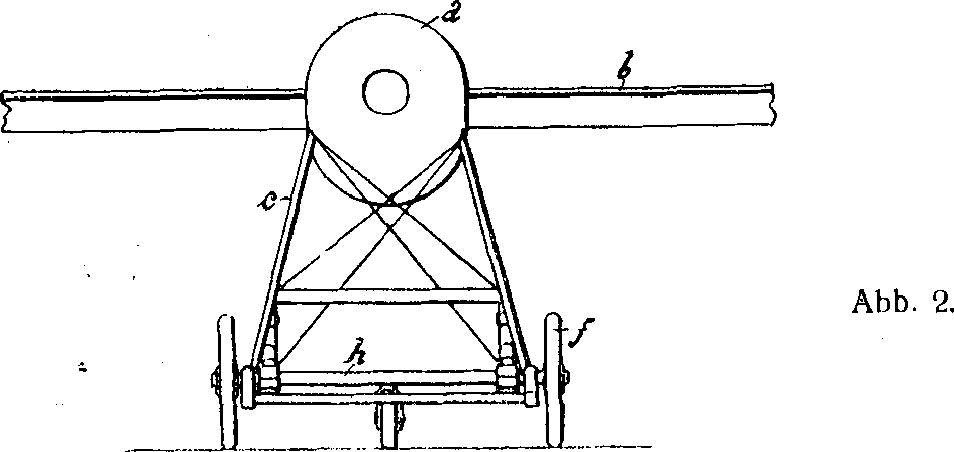 Flugzeug mit einziehbarem Anlanfgesteil.*) Die F.rfindung betrifft ein Flugzeug mit einziehbarem Anluufgestell. Sie besteht darin, daß das die Laufräder tragende Gestänge durch Streben versteift ist, die mit dem Gestänge und dem Flugzeug gelenkig verbunden und außerdem m t ihrem oberen Gelenk längs des Flugzeuges in einer Richtung verschiebbar angeordnet sind, die entgegengesetzt zu dem Landungsstoß gerichtet ist derart, daß das Gestänge und die Streben wie Messer und Schneide zusammengeklappt und dann heraufgeschwenkt werden können. Die Erfindung ist in beistehender Abb 1 in der Stellung beim Anfahren, in Abb. 2 mit hochgezogenem Rade dargestellt. Es sind 1 das Laufrad, 2 dessen Tragstange und 3 eine Verbindungsstrebe. Die Tragstange 2 ist um das Gelenk 4, die Strebe 3 und die Gelenke 5 und 6 drehbar, und außerdem ist das Gelenk 6 auf einer Führungsbahn 7 verschiebbar, die ungefähr parallel zu den Tragflügeln 8 liegt. Die Verschiebungsrichtung der Strebe 3 ist, wie durch den Pfeil angedeutet, entgegengesetzt zu dem Landungsstoß gerichtet. Die beiden Teile 2 und 3 werden zum Zwecke des Einziehens vorerst nach Art eines Taschenmessers zusammengeklappt und dann in diesem Zustande gemeinsam heraufgeklappt. *) D. R. P. 256610 E. Rumpier Luftfahrzeugbau G. rn. b. H., Lichtenberg bei Berlin. Patent-Anspruch. Fahrgestell für Flugzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß die zum Anfahren bestimmten Laufräder (f) gegenüber einer oder mehreren Gleitkufen (e) derart elastisch gelagert sind, daß sie bei der Landung gegenüber den Gleitkufen zurücktreten und ein Schleifen des Fahrzeuges auf letzterem ermöglichen. Paten t-An spru ch. Flugzeug mit einziehbarem Anlaufgestell, dadurch gekennzeichnet, daß das die Laufräder 1 tragende Gestänge 2 durch Streben 3 versteift ist, die mit dem Gestänge 2 und dem Flugzeugjgelenkig verbunden und außerdem mit ihrem oberen 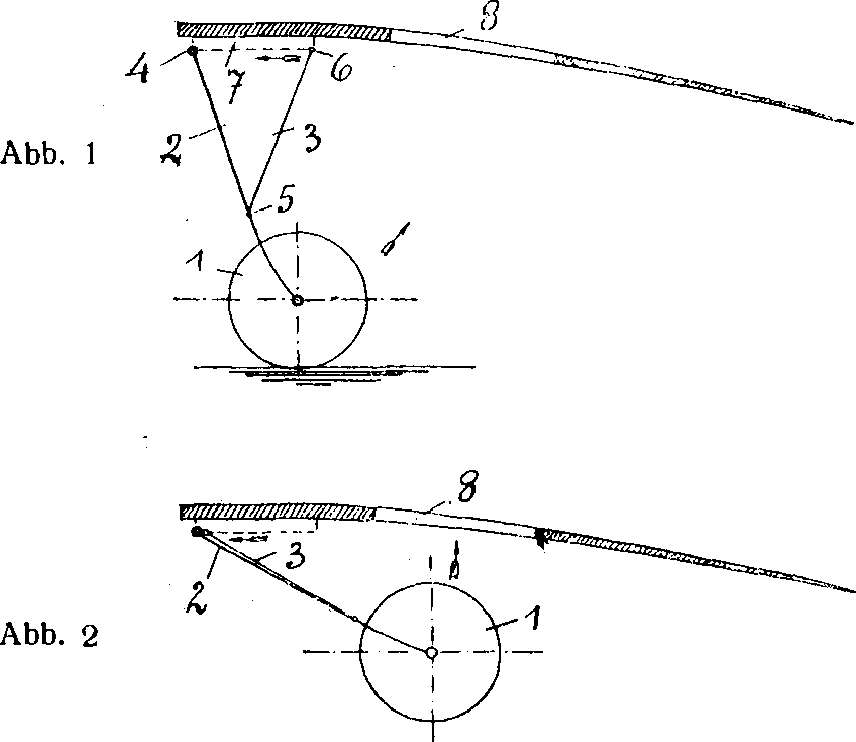 Gelenk längs des Flugzeuges in einer Richtung verschiebbar angeordnet sind, die entgegengesetzt zu dem Landungsstoß gerichtet ist, derart, daß das Gestänge 2 und die Streben 3 wie Messer und Schneide zusammengeklappt und dann heraufgeschwenkt werden können. Steneranordnong für Fingzeuge mit vorderem und hinterem Steuer*) Bei den bekannten Flugzeugen mit einem vorderen und einem hinteren Steuer nahmen die Steuer durch die Art ihrer Verbindung mit dem Steuerrad an jeder Stelle der durchfahrenen Kurve eine solche Lage gegeneinander ein, daß beim Kurvenfahren die Flugzeuglängsachse jederzeit tangential an der Kurven-bahn lag. Hierbei erhalten die Tragflächen an ihrer Außenkante eine positive und an ihrer Innenkante eine negative Zusatzgeschwindigkeit in der Fahrtrichtung; infolgedessen übertraf dabei die Hubwirkung zwischen der Flugzeuglängsachse und der Außenkante diejenige zwischen der Längsachse und der Innenkante, wodurch die sich beim Kurvenfahren einstellende Schräglage der Flügel leicht derart zunahm, daß das Flugzeug in die Gefahr des Umschlagens kam oder sogar tatsächlich umschlug. Durch die Erfindung soll der Winkel der Schräglage der Tragflächen beim Kurvenfahren stets in solchen Grenzen gehalten werden, daß das Flugzeug nicht in die Gefahr des Umkippens kommt. Dies wird durch eine solche gegenseitige Stellung der Steuer erreicht, daß sie beide im gleichen Sinne verstellbar sind, und zwar das vordere im größeren Winkel als das hintere. Diese Maßnahme hat zur Folge, daß das Flugzeug sich beim Kurvenfahren unter einem Winkel zur jeweiligen Tangente an die Kurve einstellt, so daß das Flugzeug nicht mehr nur mit seiner Vorderkante, sondern auch mit der Innenkante voran seinen Weg zurücklegt. Dadurch nimmt die negative Zusatzgeschwindigkeit der Fliigelinnenkante ab, das heißt das Druck-zentrum rückt mehr nach der Innenkante hin. *) D. R. P. Nr. 255 343, Frederick William Lanchester in Birmingham. Eine Steueranordnung gemäß der Erfindung ist auf der Zeichnung in einem Ausführungsbeispiel schematisch an einem Flächenflieger veranschaulicht. Bei diesem Ausführungsbeispiel sind vorn und hinten am Flugzeug oberhalb der Tragfläche Steuer a und b hintereinander angebracht, wie bereits bekannt. Auf einer Vertikalwelle e sitzen zwei starr miteinander verbundene, ungleich große Riemenscheiben c und d. Die größere Riemenscheibe c ist mit der Riemenscheibe f durch ein umlaufendes Zugorgan verbunden, das auf der Welle des Vordersteuers a sitzt. Die kleinere Riemenscheibe d ist in gleicher Weise durch 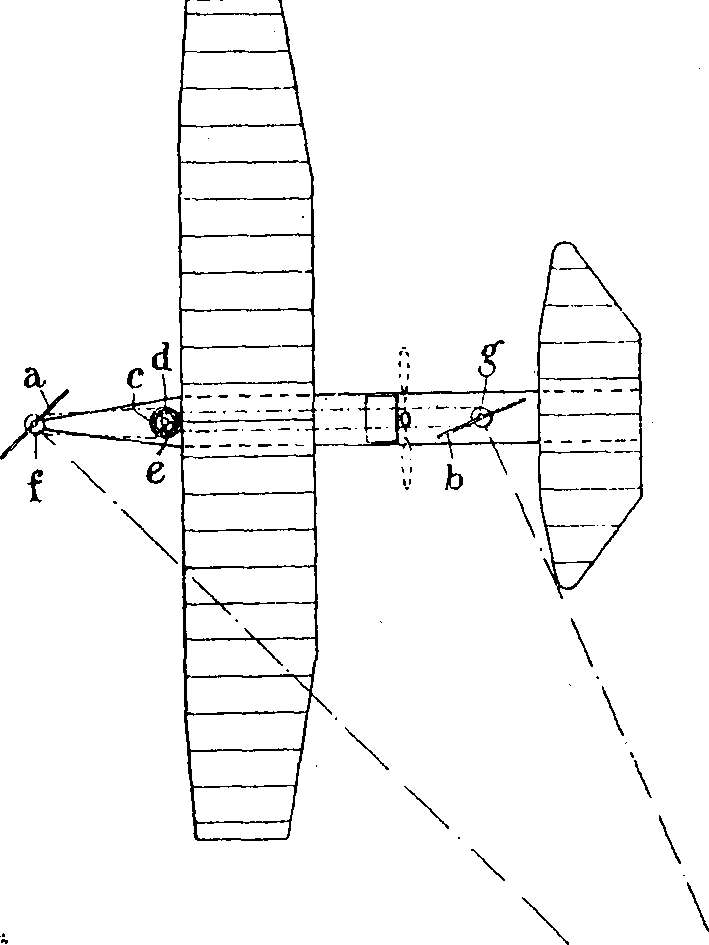 \ \ \\ \\ ein Zugorgan mit der auf der Welle des hinteren Steuers b sitzenden Riemenscheibe g verbunden. Die Durchmesser der Riemenscheiben auf den Steuerwellen sind so gewählt, daß beim Drehen der Antriebswelle e das Vordersteuer sich um einen größeren Winkel bewegt als das hintere Steuer. ^Bei solcher Anordnung schneiden sich, wie dies auf der Zeichnung in strichpunktierten Linien angedeutet ist, die auf den Steuern in ihrer Drehachse errichteten Senkrechten an einem Punkte, der um ein gewisses Stück hinter der Maschine (seitwärts derselben) liegt. Durch entsprechende Wahl des Verhältnisses der einzelnen Teile der Steuereinrichtung zueinander kann man selbstverständlich dem Schnittpunkt der Senkrechten jede beliebige Lage geben. Durch Anordnung des hinteren Steuers in genügend weitem Abstand vom Vordersteuer kann man seine erforderliche Drehbewegung beliebig verringern, und wenn es möglich ist, dieses'_Steuer weit genug nach hinten zu verlegen, kann man es feststehend anordnen. Die beabsichtigte Wirkung kann gewüntchtenfalls durch Aufwärtsbewegen der Enden der Tragflächen vergrößert werden. Beim Einschwenken des Apparates aus gerader Fahrt in Kurvenfahrt nimmt der Apparat infolge der Anordnung der Steuer oberhalb seines Schwerpunktes eine Schräglage nach dem Innern der Kurvenbahn hin ein, wie dies bekannt ist. Gleichzeitig beginnt das Flugzeug, sich mit seinem Vorderteil nach dem Innern der Kurvenbahn hin um einen gewissen Winkel gegen die Tangente an die Bahn zu verschieben. Patent-Anspruch. Steueranordnung für Flugzeuge mit vorderem und hinterem Steuer dadurch gekennzeichnet, daß beide (Steuer a, b) im gleichen Sinne verstellbar sind, und zwar das vordere (a) in größerem Winkel als das hintere (b). Elastische Luftschraube mit veränderlicher Flügelsteigung ) Den Gegenstand der vorliegenden Erfindung bildet eine Luftschraube mit nachgiebigen Flügeln, deren Steigung selbsttätig und von Hand veränderlich ist. Verstellbare Schrauben mit auf der Achse verschiebbaren Nabenteilen und Flügelarmen sind bereits bekannt. Diese Anordnung genügt, wenn die Flügelflächen in die der jeweiligen Geschwindigkeit entsprechende Stellung gebracht Abb. 1. Abb. 2. 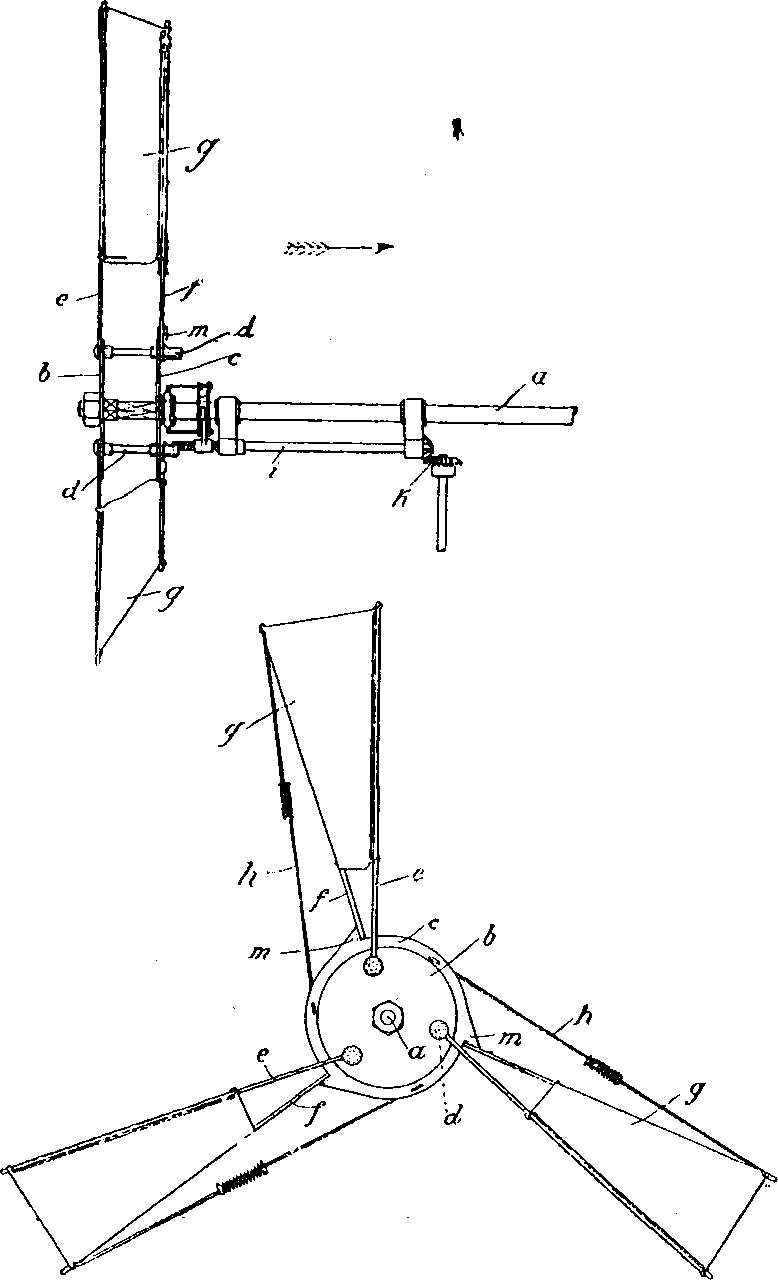 werden sollen. Bei stark böigem Wetter, oder wenn ein Flügel gegen ein Hindernis stößt, genügt diese bekannte Ausführung aber nicht, und es wird ein *) D. R. P. Nr. 254 975, Robert Jordt in Hamburg. Bruch irgend eines Teiles erfolgen. Bei der Ausführung gemäß der vorliegenden Erfindung dagegen besitzt der Flügel in der besonderen Anordnung seines federnden Gestänges auf Bolzen eine genügende Nachgiebigkeit, so daß sich der Flügel selbsttätig dem plötzlich auftretenden Drucke entsprechend einstellen wird. Es sind nämlich die die Flügelflächen begrenzenden Stangen an den hintereinander angeordneten auf der Achse gegeneinander verschiebbaren Nabenscheiben angelenkt, wobei die Stange der vorderen Flügelkante im Ruhezustande durch eine federnde Zugstange gegen einen Anschlag der vorderen Nabenscheibe gepreßt wird. Der Gegenstand der Erfindung ist auf der Zeichnung in einer bespiels-weisen Augführungsform dargestellt, und zwar ist Abb. 1 eine Seitenansicht und Abb. 2 eine Endansicht. Von einem Motor wird in üblicher Weise die Propellerachse a angetrieben. Die Nabe des Propellers besteht aus zwei Scheiben b und c, von welchen die hintere, b, fest auf der Achse, die vordere, c, aber verschiebbar angeordnet ist. Auf der Scheibe b sind Bolzen d angebracht, welche als Führung für die Scheibe c dienen. Außerhalb der Scheiben dienen die Bolzen als Zapfen, über welche die Gestänge e und f der Propellerflächen g gezogen sind, und zwar haben die Gestänge e und f an ihren unteren Enden Oesen, durch welche die Bolzen d greifen, so daß eine gewisse Beweglichkeit der Stangen e und f um diese Bolzen möglich ist. An das obere Ende der vorderen Stange f greift eine federnde Zugstange h an, unter deren Einwirkung sich die Stange f im Ruhezustande gegen den Anschlag m der Scheibe c anlegt. Die Verschiebung der vorderen Scheibe c auf der Achse a erfolgt in bekannter Weise durch mittelbar oder unmittelbar an der Scheibe angreifende Schraubenstangen i, welche durch ein konisches Getriebe k oder dgl. in Unidrehung versetzt werden. Patent-Anspruch. Elastische Luftschraube mit veränderlicher Flügelsteigung, dadurch gekennzeichnet, daß die die Flügelflächen begrenzenden Stangen an zwei hintereinander angeordneten, auf der Achse gegeneinander verschiebbaren Nabenscheiben angelenkt sind, wobei die Stange der vorderen Flügelkante im Ruhezustand durch eine federnde Zugstange gegen einen Anschlag der vorderen Nabenscheibe gepreßt wird. Fahrgestell für Fingsenge.4) Die Erfindung betrifft ein Fahrgestell für Flugzeuge, bei welchem in be kannter Weise jede der Kufen an der Achse eines Räderpaares elastisch aufgehängt ist, and zwar in der Weise, daß die Radachse in senkrechter Ebene um ihren Befestigungspunkt an der Kufe schwingen kann. Bei den gebräuchlichen Fahrgestellen dieser Art (Bauart Farman) erfolgt diese Befestigung an der Kufe mittels eines starren Rahmens. Dieser besteht aus zwei nahe den Enden der Radachse angreifenden Zugstangen, welche am anderen Ende zusammengeführt und an dieser Vereinigungsstelle mit der Kufe durch ein Gelenk verbunden sind. Das Gelenk, um welches das Gestell zugleich seitlich ausschwingen kann, wird, wie dies be'anntlich für gute Selbsteinstellung der Räder erforderlich ist, möglichst weit vor der Radachse angebracht. Daraus ergibt sich aber der Nachleil, daß schon bei verhältnismäßig geringem Ausschlagwinkel das eine der beiden Räder mit der Kufe in Berührung kommt, was die Einstellfähigkeit des Fahrgestells sehr beschränkt. Dieser Uebelstand wird bei dem Fahrgestell der vorliegenden Erfindung dadurch vermieden, daß die Radachse in ihrer Mitte an einer mit der Kufe durch ein Kugelgelenk verbundenen Stange drehbar befestigt und an zwei auf den beiden Seiten der Radachse gelegenen Punkten mit einer zweiten Stellen der Kufe durch elastische Glieder verbunden ist. Durch diese Einrichtung wird bewirkt, daß bei verhältnismäßig geringen seitlichen Ausschlägen der Verbindungsstange, bei welchen also eine Berührung zwischen Rädern und Kufe noch nicht eintritt, die Radachse um einen erheblich größeren Winkel gedreht wird, in dem die elastischen Glieder eine zusätzliche Relativschwenkung der Achse gegenüber der Verbin-dungsstange herbeiführen. Da ferner die Mitte der Achse um einen geringen Betrag seitlich ausgeschwungen wird, kommt als weiterer Vorteil hinzu, daß die D. R. P: 251 307. Paul Zens in Paris zur Aufhängung dienenden elastischen Glieder weniger stark in Anspruch genommen werden. Die Erfindung ist auf nebenstehenden Abbildungen in einem Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Abb. 1 stellt die Ansicht, Abb. 2 den Grundriß des Fahrgestells dar. Oberhalb jeder der beiden Kufen ist eine Stange b angebracht, die an ihrem voideren Ende mit einem Kugelkopf b1 und an ihrem hinteren Ende mit einem Gabelbopf b5 versehen ist, welche beide zu je einem Gelenk gehören. Der Kugelkopf b' ruht in einer Pfanne a1, welche auf der Oberseite der Kufe be- ■ ; m 1 -Abb. 1 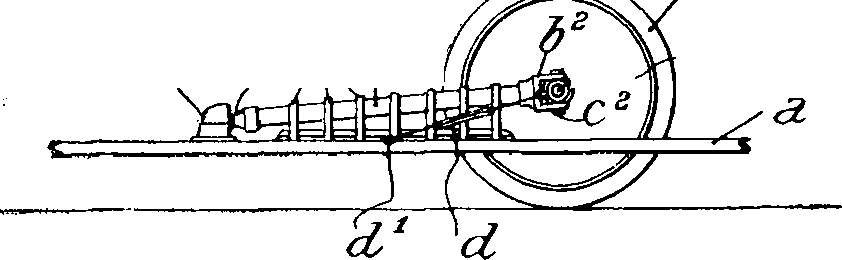 C
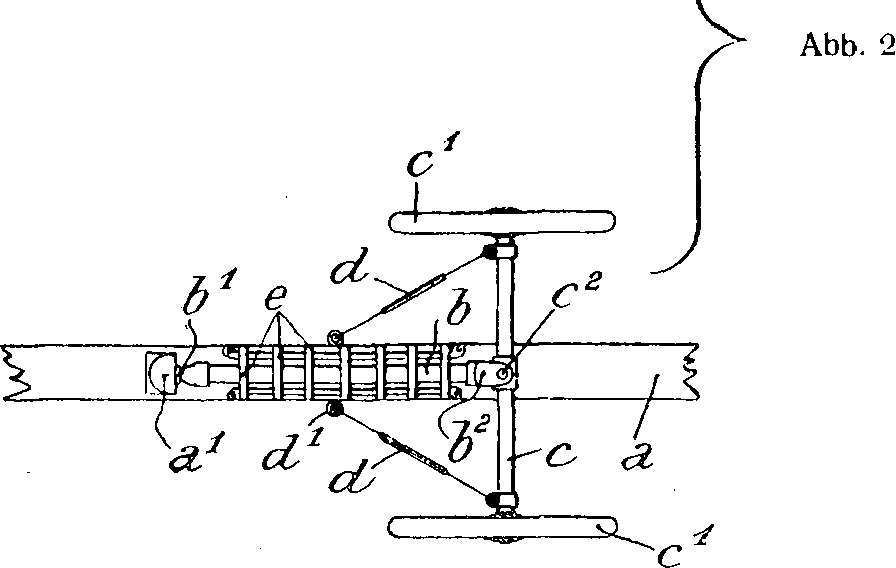 festigt ist; die beiden Arme des Gabelkopfes liegen übereinander, so daß die Achse ihrer Bohrungen, d. h. die Geknkachse, ziemlich senkrecht gerichtet ist. An dem hinteren Ende der Stange h ist die Radachse, die auf jeder Seite ein lose aufgesetztes Rad c' trägt, angeschlossen und zwar mit Hilfe des in ihrer Mitte angebrachten Bolzens c2, welcher die Achse des Gabelgelenk s bildet. In einem Punkte der Kufe, der mehr oder weniger in der Nähe der Pfanne ' — zweckmäßig zwischen dieser und der Radachse — liegt, werden ein paar elastische Verbindungen d befestigt, die entweder selbst aus elastischem Stoff hergestellt sind oder einen federnden Teil enthalten. Diese Verbindungen greifen mit dem anderen Ende an der Radachse c in der Nähe je eines ihrer Endpunkte an, derart, daß sie mit der ersteren in der Normalstellung etwa ein gleichschtnkeliges Dreieck bilden. Die federnde Aufhängung der Kufe wird durch besondere elastische Glieder gebildet, welche die Stange b umschlingen und in geeigneter Weise an der Kufe a befestigt sind, beispielsweise durch die in der Zeichnung veranschaulichten elastischen Bänder e. Eine andere gute Ausführung erhält man, wenn man die Bänder durch eine einzige schraubenförmig gewickelte Feder ersetzt. Die Wirkungsweise der Vorrichtung erhel t aus folgender Ueberlegung: Wird die Stange b um einen kleinen Winkel seitwärts ausgeschwungen, so würden die Verbindungen d, wenn die Achse nicht gelenkig mit der Stange verbunden wäre, verschiede i stark gespannt werden. Das Vorhandensein des Gelenkes ermöglicht einen Ausgleich dieser Spannungen, welcher seinerseits zur Folge hat, daß die Radachse eine Drehung relativ zur Stange b vollführt, sich also um einen größeren Winkel gegenüber der Kufe dreht als die Stange b. Die relative Drehung der Radachse ermöglicht eine starke Ausschwenkung derselben, bevor eine Berührung zwischen den Rädern und der Kufe erfolgt. Es ist weiterhin beachtenswert, daß in Anbetracht der gelenkigen Verbindung der Achse c mit der zugehörigen Stange b die Einstellung der Räder in die Fahrtrichtung bei der Landung ermöglicht wird, ohne daß erhebliche, auf Verbiegung gerichtete Beanspruchungen auftreten. Auch die auf die elastischen Glieder e ausgeübten Zugkräfte halten sich beim Ausschwenken des Fahrgestells in mäßigen Grenzen, da die seitliche Ausweichung der Radachsenmitte verhältnismäßig gering ist. Diese geringe Ausweichung ermöglicht erst die an sich recht vorteilhafte Aufhängung der Kufe an der Stange b durch elastische Bänder oder dergl. Es sind selbstverständlich Abänderungen der in der Zeichnung veranschaulichten Anordnung möglich; so könnte man die Vorrichtung aus nur einer Kufe und einem einzigen Räderpaar bilden oder die Kufen durch eine irgendwie anders gestaltete Tragvorrichtung ersetzen. Patent-Anspruch. Fahrgestell für Flugzeuge, deren Kufe derart elastisch an der Radachse aufgehängt ist, daß letztere in senkrechter Ebene um ihren Befestigungspunkt an der Kufe schwingen kann, dadurch gekennzeichnet, daß die Radachse c in ihrer Mitte c'2 an 4 einer mit der Kufe a durch ein Kugelgelenk a' verbundene Stange b drehbar "befestigt und an zwei auf den beiden Seiten der Radachse gelegenen Punkten mit einer zweiten Stelle d1 der Kufe durch elastische Glieder d verbunden ist. Verschiedenes. Der Streit um die Wright-Patente. Am 26. Februar hat das Reichsgericht über die Gültigkeit der Wright-Patente sich ausgesprochen. Der Präsident verkündete in seinem Urteil, daß die Verwindung mit biegsamen Tragdecken als bekannt zugegeben wird. Als nicht bekannt wird die Verwendung der mit der Verwindung zum Zwecke der Schrägstellung gekuppelten Seitensteuerung bezeichnet. Der Patentanspruch der Wrights hat demnach eine Einschränkung erfahren, wonach die Verwindung mit dem Seitensteuer bestehen bleibt. Der Anspruch erhält demnach folgende Fassung: „Mit wagerechtem Kopfruder und senkrechtem Schwanzruder versehener Gleitflieger, bei welchem die beiden übereinander angeordneten Tragflächen an entgegengesetzten Seiten unter verschiedenen Winkeln zum Winde eingestellt werden können und behufs schraubenförmigen, mittels einer Stellvorrichtung zu bewirkenden Verdrehens um e;ne quer zur Flugrichtung gedachte Achse biegsam geslaltet sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Schwanzruder mit der Stellvorrichtung derart gekuppelt ist, daß es dem Winde mit derjenigen Seite dargeboten wird, welche den unter dem kleineren Winkel eingestellten Tragflächenseiten zugekehrt ist, zum Zweck, den ganzen Gleitflieger um die in der Flug- richtung liegende Mittelachse zu drehen, ohne daß eine gleichzeitige Drehung des Apparates um seine senkrechte Mittelachse erfolgt." Die Beteiligung an dem großen Wasserflug-Wettbewerb in Monaco ist in diesem Jahre eine sehr große Bis jetzt sind 26 Meldungen eingegangen und zwar 1. M. Farman 1 (Renault 120 PS), Führer Renaux 2. H. Farman 1 (Gnom 160 PS) Fischer. 3. H. Farman 11 (Gnom 80 PS) Chevillard. 4. M. Farman II (Renault 120 PS) Gaubert. 5. Nieuport I (Gnom 100 PS) -. 6. Nieuport II (Gnom 100 PS) -. 7. D'Artois I (Gnom 100 PS) -. 8. D'Artois II (Gnom 100 PS) —. 9. Borel I (Gnom 160 PS) Chemet. 10. Borel II (Gnom 100 PS) Daucourt. 11. Borel III (Gnom 100 PS) -. 12. Bleriot (Gnom 80 PS) Giraud. 13 Morane-Saulnier (Le Rhone) Gilbert. 14. Breguet 1 (Salmson 160 PS) de Montalent. 15. Breguet II (Salmson 120 PS) —. 16. Breguet III (Salmson 120PS)-. 17. Bossi (Gnom) —. 18. de Marcay (Anzani 100 PS) -. 19. Deper-dussin ( (Gnom 160 PS) Vedrines. 20. Deperdussin II (Gnom 100 PS) Janoir. 21. Deperdussin III (Gnom 100 PS) Prevost. 22. Deperdussin IV (Gnom 100 PS) Laurens. 23. Deperdussin V (Gnom 100 PS) Vivienne und Scoffier. 24. Astral (Renault 120 PS) —. 25. Astra II (Renault 120 PS) —. 26. Fokker (Renault 70 PS) Fokker. Unter diesen Meldungen vermißt man Paulhan mit seinen Curtiss-Apparaten, der infolge Arbeitsüberlastung nicht an dem Wettbewerb teilnehmen kann. Kleine Mitteilungen. Die Adler-Werke Akt.-Ols. vorm. Heinr. Kleyer, Frankfurt a. M., beabsichtigen, wie wir erfahren, den Bau von Rotationsmotoren aufzunehmen. Literatur. Ein kleiner Führer über den Flugplatz Johannisthal ist zum Preise von 10 Pfg bei Willy Sänke, Berlin N. 37, Schönhauser Allee 185 erschienen. Derselbe enthält eine Anzahl Abbildungen von Fliegern und Flugzeugen, ferner Verzeichnisse der Flugzeugfabriken und Fliegerschulen in Johannisthal. Das Schadensersatzrecht der Luftfahrt nach geltendem Recht und de lege ferenda. Von Dr. jur. Alex Meyer. Verlag von Gebrüder Knauer Frankfurt a. M. Preis brosch. Mk. 2 50. Der durch seine verschiedenen Arbeiten auf dem Gebiete des Luftrechts bestens bekannte Verfasser gibt in dem vorliegenden Werke zunächst eine umfassende und klar geschriebene Uebersicht über die rechtliche Behandlung der auf dem Gebiete der Luftfahrt möglichen Schadensersatzfälle nach den zur Zeit gültigen Gesetzen. Die Beziehungen der Luftschiff- und Flugzeugführer, bezw. Besitzer zu den Hilfs- und Bedienungsmannschaften, den Passagieren und dem Publikum werden, soweit sie zu vertraglichen oder außerkontraktlichen Schadensersatzansprüchen führen können, eingehend behandelt. Dieser Teil der Arbeit ist insofern wertvoll, als die Rechtsprechung bisher nur wenig Gelegenheit hatte, derartige Fälle zu entscheiden, da diese bisher meist eine zeitliche Einigung fanden. Die Ergebnisse, zu denen Verfasser in der vorliegenden Schrift kommt, berücksichtigen die Forderungen des Luftsportes in hinreichender Weise, soweit dies nach den bisherigen Gesetzen möglich ist; es kann diesen Ergebnissen durchweg zugestimmt werden Im zweiten Teile kommt Verfasser sodann auf die Mittel und Wege zu sprechen, durch Schaffung neuer Gesetze den durch den warmen Aufschwung des Flug- und Luftfahrsportes eingetretenen Verhältnissen Rechnung zu tragen ist. Daß die sogenannte Gefährdungshaftung, die zur Zeit den Eisenbahnen, Tierhaltern und Automobilbesitzern auferlegt ist und die den Nachweis eines besonderen Verschuldens nicht erfordert, auch auf die Führer, bezw. Halter von Flugzeugen und Luftschiffen früher oder später durch ein Spezialgesetz ausgedehnt werden wird, kann als sicher gelten. Die Vorschläge des Verfassers zu dieser Frage zeugen von tiefem Eindringen in die Materie und verdienen Beachtung. In einem Schlußworte kommt Verfasser sodann kurz auf das internationale Privatrecht der Luftfahrt zu sprechen. Ein besonderer Verdienst des Verfassers ist die unseres Erachtens lückenlose Zusammenstellung der bereits vorhandenen Literatur, die eine eingehende Würdigung gefunden hat. Das Buch gibt dem Juristen wertvolle Zusammenstellungen und Anregungen, den Führern von Flugzeugen, Lenk- und Freiballons ermöglicht es einen klaren Ueberblick über die Tragweite und rechtlichen Folgen ihrer Handlungen.  Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.) Dienst in der Fliegertruppe. Wegen der vielfach an uns gerichteten Anfragen haben wir uns an zuständiger Stelle erkundigt und wurde uns hierauf folgendes mitgeteilt: Freiwilige werden in der Fliegertruppe nach Bedarf eingestellt. Mannschaften werden entsprechend ihrer Fähigkeiten bei Bedarf zu Flugzeugführern ausgebildet. Die Freiwilligen müssen das 17. Lebensjahr überschritten haben. Freiwillige, die in einer Flugzeugfabrik beschäftigt gewesen sind, werden bevorzugt. Die Dienstzeit ist auf 2 Jahre festgesetzt. Gesuche sind an das Kommando der Fliegertruppe in Döberitz zu richten. Merkur. Auf Ihre Anfrage über die Schlaufenbildung mittels Kupferhülse führen wir Ihnen in beistehender Abbildung den Werdegang derselben vor. Die Kupferhülse wird im Schraubstock eliptisch gepreßt, hierauf über das verzinnte Drahtseilende gezogen und nach Einfügung der Kausche so dicht wie möglich an dieselbe herangeschoben. Hierauf hält man das an der Kausche gelegene 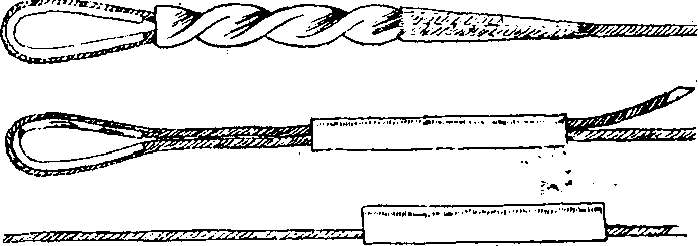 Kupferrohrende fest, sei es mit einer Flachzange oder im Schraubstock, erfaßt das andere Ende des Kupferrohres, und dreht dasselbe schraubenförmig auf. Das überragende Ende wird längs des Drahtseiles angelegt, mit Bindedraht umwickelt und dann verlötet. Diese Schlaufenbildung ist bereits im Telegraphenwesen und im Eisenbahnsignalbau mit Erfolg bekannt. Hein. Der Schwerpunkt einer Flugmaschine wie eines Modells wird am einfachsten auf graphischem Wege ermittelt, zu dessen Durchführung Ihnen die einzelnen Gewichte bekannt sein müssen. Zur Orientierung über dieses Verfahren empfehlen wir Ihnen das Werk „Lauenstein, Graphostatik". Nach Ermittlung des Schwerpunktes verlegen Sie die Drittellinie der Tragflächen von der Vorderkante an gerechnet durch denselben, wodurch Sie den Unterstützungspunkt im Fluge aerodynamisch festlegen. Bei pfeilförmig ausgebildeten Maschinen oder Modellen müssen Sie den Druckmittelpunkt des Einzelflügels in seiner Stellung zum Rumpf feststellen, was Sie am einfachsten auf zeichnerischem Wege durchführen. Zur näheren Orientierung über die Druckmittelpunktslage eines Flügels möge Ihnen folgende Angabe dienen : derselbe befindet sich je nach der Flügelkonstruktion insbesondere Profilform 30—45% vom Rumpfansatz nach außen hin. 3 Zyl. Hilz-Flugmotor auf 25 PS abgebremst, gebraucht jedoch soeben in der Fabrik neu nachgesehen, mit Accumulator, aus einer (918 Konkursmasse für 500 Mk. verkäuflich. Auskunft durch den Konkurs-Verwalter Referendar Reuter, Lübz (Meckl.) 5IIIÜ5CllfliulllDüOII Standort Frankfurt, passend für Grade-Flugzeug, mit Bodenbelag in tadellosem Zustand komplett zum Preise von 200 M. zu verkaufen. Anfragen sind zu richten unter 770 an die Expedition.  technische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef.4557 Amt I. Oskar UrsinUS, Civilingenieur. Tel.-Adr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14 tägig. = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 2. April. Aus dem Johannisthaler Fliegerlager. (Berliner Korrespondenz des „Flugsport"). Am Abend des 7. März; konnte man in den Straßen Berlins unaufhörlich die Zeitungsverkäufer „Der Prinzregent bei den Fliegern" rufen hören. Ja, Johannisthal hatte wieder mal ein „großen" Tag hinter sich, aber leider nicht den „ganz; großen" wie er von allen erwartet worden ist. „Der Kaiser kommt nach Johannisthal" hieß es drei Tage vorher, aber er kam nicht. Da es das erste Mal gewesen wäre, daß der Monarch den größten Flugplatz Deutschlands — und er liegt doch so nahe an der ßeichshauptstadt — besucht hätte, so schwand mit der Nachricht, daß er im letzten Augenblick seinen Besuch absagte, ein Teil der Feierlichkeit der Veranstaltung, die als große Parade gedacht war. So kam nur der Prinzregent mit seinem Gefolge, der bereits im vergangenen Sommer den Flugplatz besucht hatte. Die Flugplatzdirektion hatte geplant, sämtliche Apparate der Firmen in zwei Reihen längs des Waldes in Paradelinie aufzustellen. Das schlechte Wetter machte jedoch der ganzen Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung und so sahen sich denn die einzelnen Firmen gezwungen, lediglich vor ihren eigenen Schuppen die Apparate aufzustellen. Gegen drei Uhr fuhren die Automobile mit dem Prinzregent durch den Adlershofer Eingang zur Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, wo Professor Dr. Bendemann Bericht über den Wettbewerb vom Kaiserpreis der Flugmotoren erstattete. Inzwischen war, trotz des schlechten Wetters, Hirth auf seiner Albatros Taube aufgestiegen und unternahm verschiedene „Cascadenflüge", die bei dem Prinzregent und dem Publikum großen Beifall fanden und wiederum die außerordentlichen Fähigkeiten Hirths erkennen ließen.  Besichtigung des Flugplatzes Johannisthal durch Seine Königliche Hoheit den Prinzregenten Ludwig von Bayern. Im Vordergrund rechts: Staatssekretär des Reichsmarineamts Excel lenz vonTirpitz, Se. Kpnigl. Hoheit Prinzregent Ludwig von Bayern, der Direktor des Wcrft-depardements Excellenz Diek; im Hintergrund K,apitän Labbert, Dezernent für Marineflugwesen im Reichsmarineamt. Nachdem der Prinzregent die Gesamtanlage der Versuchsanstalt in Augenschein genommen hatte, begab er sich auf den Flugplatz zur Wright-Ges., deren Gebäude reichen Fahnenschmuck zeigten. Abramowitsch, der eben erst von schwerer Krankheit genesen ist, und der junge Wright - Flieger Sedlmayr führten ausgezeichnete Flüge aus. Acht Wrightmaschinen waren in Paradefront aufgestellt und mit Flaggen in den deutschen und bayrischen Farben geschmückt. Der Prinzregent schritt die Front der Flugzeuge ab und zog die bei den Wright-Werken ausgebildete russische Fürstin Schakowskoy und den Flieger Abramowitsch in ein längeres Gespräch und drückte der Fürstin wiederholt in liebenswürdiger Weise die Hand. Dann fuhr der Prinzregent über den Flugplatz zu den Rumplerwerken, wo Direktor Rumpier die Honneurs machte und die ausgestellten Apparate erklärte. % ■ Zu Fuß ging es nun den ßallonhallen zu. Unterdessen hatte Victor Stoeffler seinen 100 PS L. V. G. auf die Bahn geschoben und startete mit der typischen Schneidigkeit dieser Apparate. In rasendem Tempo zog Stoeffler seine Kreise, wobei der Apparat trotz des Unwetters nicht die geringsten Schwankungen erkennen ließ. Nach längerem Aufenthaltin den Ballonhallen verabschiedete sich der Prinzregent mit seiner Begleitung und verließ um 5'/4 Uhr den Flugplatz kberimmerwie-der hörte man: „Wenn nur der Kaiser gekommen wäre..... Die Jagd auf Rekordflüge in Johannisthal hat nun begonnen, denn die Preise, 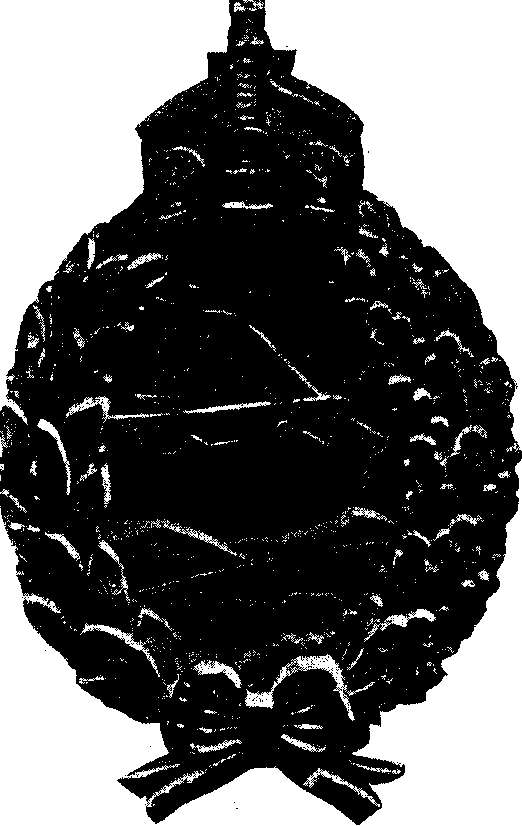 Feldpiloten-Abzeichen für Offiziere. (Vergl. die Bestimmungen in Nr. 3 auf Seite 108.) die den Fliegern aus derNational-Flugspende winken, sind ein starkes Lockmittel. Der erste, der sich eine Prämie aus der Volkssammlung holte, war H a -n u s c h k e , der mit seinem Eindeckereinen offiziell kontrollierten Stundenflug ausführte und damit die Mark 1000.— Prämie erhält. Nun kam Friedrich, der bisherige Inhaber des Deutschen Dauerrekordes ohne Fluggast und bereitete sich für einen grö- ßeren Dauerflug vor, um neben den Einzelprämien; noch die monatliche Rente von 2000 Mk. bis zum 1. 1. 1914 zu bekommen, die bekanntlich derjenige erhält, der einen Flug über 6 Stunden aufweisen kann, und die ihm solange ausbezahlt wird, wenn nicht vorher ein anderer Flieger seine Höchstleistung überbietet und damit das Recht der Rente in Anspruch nimmt. Friedrich flog mit einer Ri'mpler-Taube mit 70 PS Mercedes ununterbrochen 5 Stunden und 18 Minuten. Das Wetter war keineswegs einladend und dabei einen Dauerflug von mehreren Stunden auszuführen, ist eine Leistung, die man auf keinen Fall unterschätzen darf. Vor der Landung von Friedrich hatte sich Sedlmayr auf Wright-Doppeldecker mit 55 PS N. A. G.-Motor auf die Reise gemacht und zog ununterbrochen seine Kreise, wobei der Apparat, 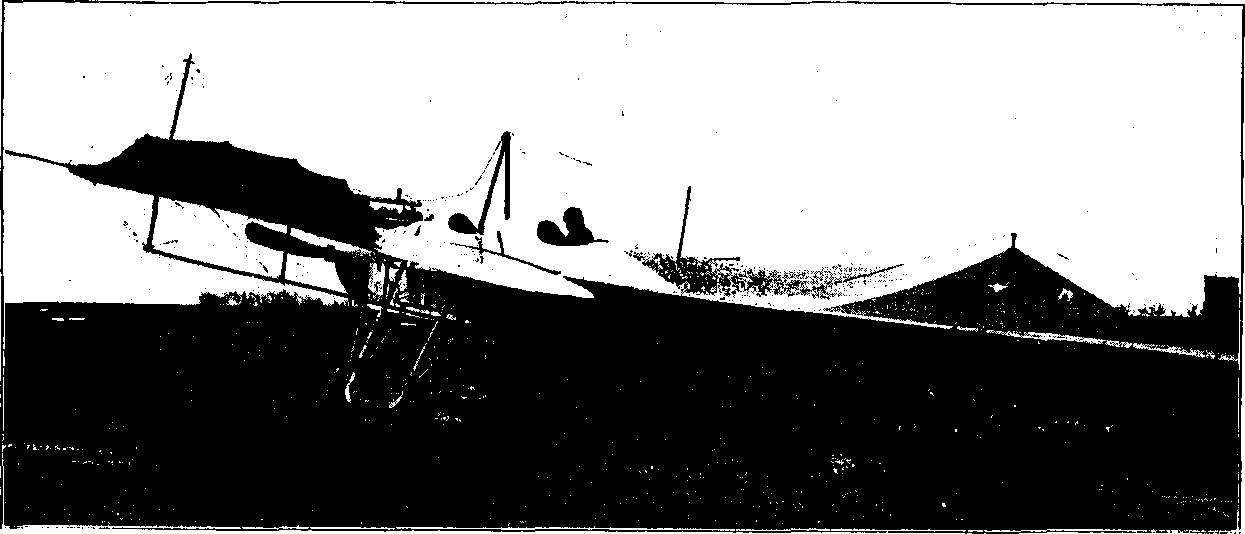 Helmuth Hirth am Steuer der neuen Albatros-Taube. höhere Anforderungen an den Führer stellt, als wohl bei irgend einem anderen Apparat. Sedlmayr ist somit im Besitze des deutschen Dauerrekordes ohne Fluggast. Wie lange er ihn behalten wird, ist eine offene Frage, denn Vorbereitungen werden von verschiedenen Fliegern getroffen, die Leistung zu überbieten. F o k k e r hat in letzter Zeit wieder erfolgreiche Flugversuche mit seiner Wasserflugmaschine unternommen und wird wohl in Kürze mit großen Leistungen in die Oeffentlichkeit treten. Sein Beteiligung an dem Wasserflugmaschinen - Meeting in Monaco ist jedoch unbestimmt, da die neue Maschine wohl kaum bis zu dem bestimmten Termin fertiggestellt sein wird. ... er. Der Wasser-Eindecker Deperdussin. (Hierzu Tafel VII.) Deperdussin zeigte, wie wir in den Ausstellungsberichten bereits mitteilten, auf der Olympia-Ausstellung einen Wasser-Eindecker, der in seinen Formen von der bisherigen Wasserflugmaschine erheblich abweicht. Der Rumpf dieses Eindeckers ist torpedoartig ausgebildet. Der Führersitz befindet sich hinter dem Gastsit.z. Die Tragdecken verbreitern sieh nach den Enden zu. Um ein gutes Gesichtsfeld zu ermöglichen, sind die Tragdeckenenden ai~u Rumpf ausgespart. Der durch den stärker werdenden Wind, manchmal in sehr gefährlich ausschauende Situationen geriet, die der tüchtige Flieger jedoch immer parierte. Stunde um Stunde verging und in vollständiger Dunkelheit landete Sedlmayr, nachdem er 6 Stunden und 2 Minuten geflogen war. Dieser Dauerflug muß als eine wirklich schöne Leistung anerkannt werden, wenn man in Betracht zieht, daß die Steuerung eines Wright-Doppeldeckers bei derartigen Witterungsverhältnissen viel Einfallswinkel der Haupttragfläche beträgt 7° gegen die Horizontale. Ferner sind die Tragdecken, von vorn gesehen, V-förmig 3° nach oben gestellt. Die wesentlichste Neuerung des Wasser-Eindeckers ist die Anordnung eines Gitterträgers unter den Tragdecken. Hierdurch fällt die über den Tragdecken sonst übliche Verspannung vollständig weg. Die sich nach den Tragdeckenenden zu verjüngenden Gitterträger sind aus Stahlrohr hergestellt und mittels 5 mm starken Stahlseilen verspannt. An den Enden der Gitterträger sind tropfenförmige Stütz-schwimmer angeordnet, (s. Tafel VII). Die größte Spannweite beträgt 14m, die größte Tragflächentiefe 2,4 m, die Gesamttragfläche 28 qm Die konstruktive Durchbildung des Schwanzes ist unverändert von der normalen Passagiertype geblieben. Die SchwanzfJäche mißt 3,6 qm Inhalt, die Höhensteuerklappen 1,8 qm, das Seitensteuer 0,6 qm, der Inhalt der Kielfläche 0,375 qm Zur Unterstützung dient ein mittels Schellen an den eigenartig gebogenen Kufen befestigter Hauptschwimmer von 2,1 m Breite, 2,2 m Tiefe und 0,4 m Höhe. Zur Unterstützung des hinterlastigen Gewichtes ist ein kissenartig geformter Stützschwimmer angeordnet. Unter diesem Stützschwimmer befindet sich ein Wassersteuerruder, das zwangläufig mit dem Seitensteuer verbunden ist. Zum Betriebe des Wasser-Eindeckers dient ein 100 PS Zehnzylinder luftgekühlter Anzani - Motor mit einer Schraube von 2,7 m Durchmesser. Die Fluggeschwindigkeit beträgt 90 km, das Leergewicht der Maschine 600 kg und die Nutzlast 300 kg. Der neue L. V. G.-Doppeldecker Typ Schneider. Ingenieur Schneider von der Luft-Verkehrs-Gesellschaft hat einen neuen Doppeldecker herausgebracht, der in allen Teilen den Anforderungen der Militärverwaltung entspricht. Die durch 15 Patente geschützte Maschine zeigt in ihrer gedrungenen massiven Form harmonische Linienführung und ist gleich bei dem ersten Versuch richtig geflogen, ohne daß nachträglich Aenderungen vorgenommen werden mußten. Die Tragdecken sind nach den neuesten aerodynamischen Prinzipien unter Berücksichtigung eines höchsten Effektesund guten Gleitvermögens konstruiert Das obere Tragdeck mißt 14 m Spannweite und ragt über das untere Deck hinaus. Die seitliche Stabilität wird durch je 2 an den Tragdeckenden befindliche Hilfsklappen, die, um eine bessere Wirkung zu erzielen, gegenseitig versetzt sind, bewirkt. Die senkrechten Streben bestehen aus ovalen Stahlrohren, die an ihren Knden in Gelenken sitzen. Zur Verspannung der beiden Tragflächen ist das Minimum der notwendigen Verspannungsseile angewendet, ohne die Sicherheit im geringsten Maße zu gefährden. Der Konstrukteur hat auch sein Augenmerk darauf gerichtet, die Demontage der Flächen in möglichst kurzer Zeit zu vollführen und ist auf eine Lösung gekommen, die durch ihre Einfachheit direkt verblüffend wirkt. Es findet nämlich beim Abnehmen der Flächen absolut kein Lösen irgend eines Spannseiles statt. Das Herausziehen einiger Bolzen ermöglicht es, die Flächen direkt aufeinander zu klappen und sie seitlich an den Rumpf anzulehnen. Der sehr lang gestreckte Rumpf erinnert in seiner Ausführung an die Konstruktion des Eindeckers der gleichen Firma, ist jedoch vorn bedeutend breiter gehalten und bietet Raum zur Mitnahme von vier Personen. Am hinteren Teil finden 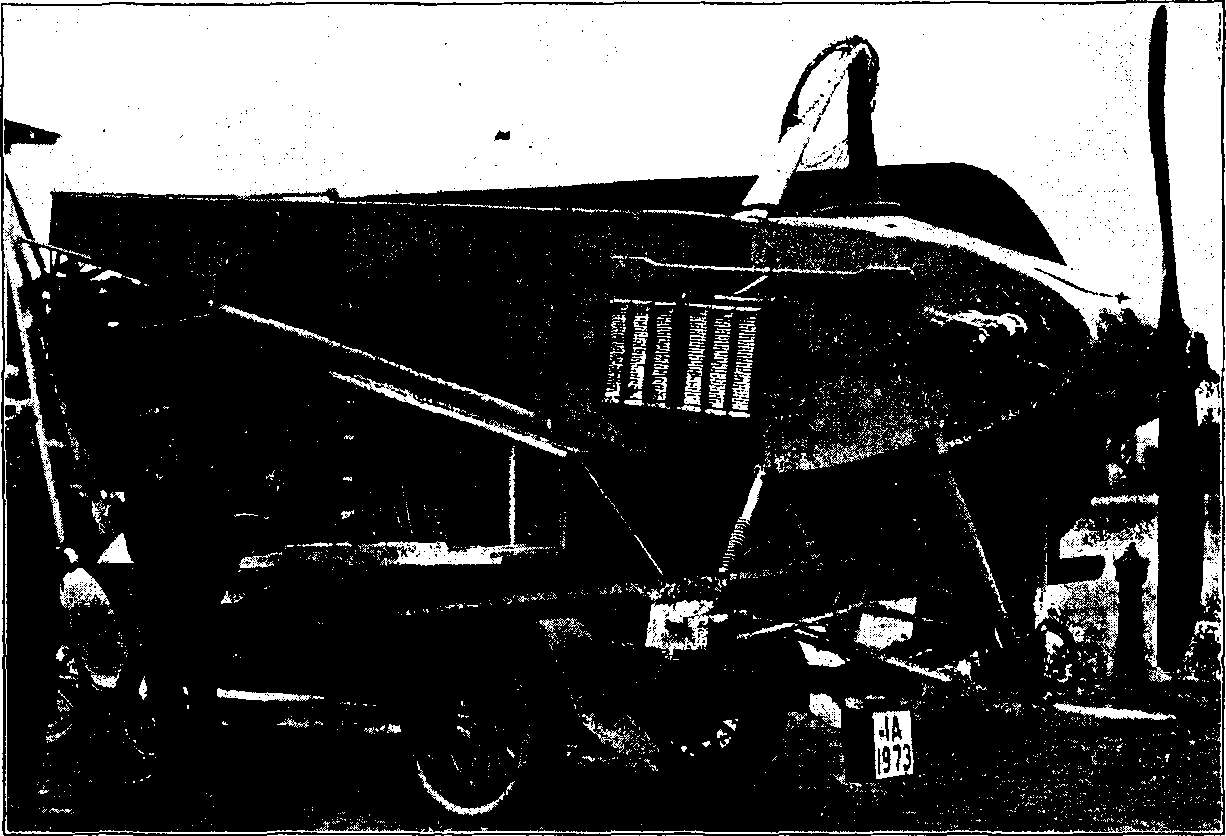 Flugmaschinen-Transport- und Reparaturwagen der L. V. G. wir wieder das typische Höhen- und Seitensteuer des L. V. G.-Eindeckers. Die Sitzanordnung ist so getroffen, daß zwei Personen bequem nebeneinander Platz finden. Das Fahrgestell ist bei diesem Apparat sehr einfach und zweckmäßig angeordnet. Die Räder sitzen auf einer gemeinsamen Achse und sind durch Gummiringe in einem Bügel, der durch zwei Stahlrohe gebildet wird, federnd aufgehängt. Zur Vermeidung von Kopfstürzen und zum Schutze des Propellers ist vorn ein kleines Laufrad mit Löffelkufe angeordnet, die gegen den Rumpf und das eigentliche Fahrgestell durch Stahlrohre abgestützt sind. Direkt, auffällig ist die Verwendung von nur zwei Spanndrähten am Fahrgestell, die als Diagonal-Ver-spannung dienen. Im vorderen Teil des Rumpfes ist die Maschinenanlage angeordnet und besteht aus einem Sechszylinder 100 PS Mercedes-Motor, der eine zweiflüglige Integral-Schraube direkt antreibt. Die Steuerung ist die bekannte Hebel-Steuerung. Durch Anziehen, bezw. Abdrücken wird das Höhensteuer, durch seitliches Neigen werden die Verwindungs-klappen betätigt. Die Bewegung des Seitensteuers erfolgt durch einen Fußhebel. Wie die Abbildung zeigt, sind sämtliche Außenteile 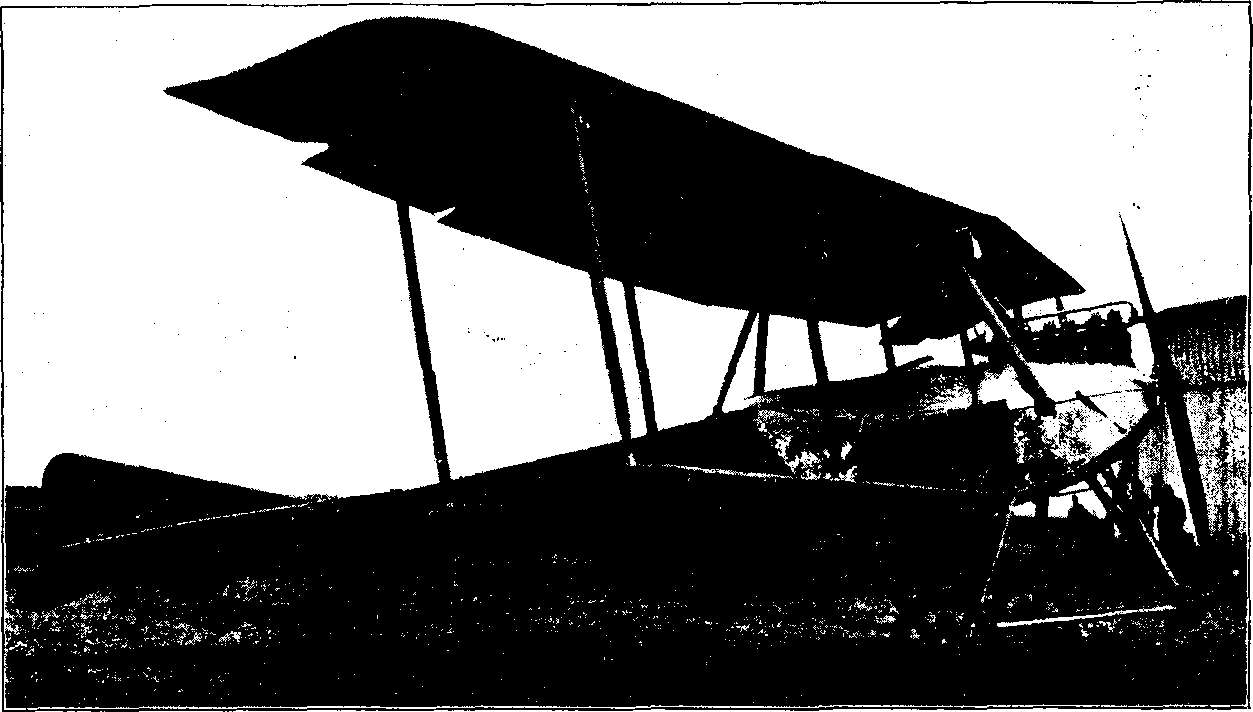 L. V. G.-Doppeldecker Typ Schneider. auf günstigsten Luftwiderstand zugeschnitten. Der Apparat hat unter Führung von Rupp ein sehr gutes Start- und Steigvermögen mit Belastung ergeben. Die Geschwindigkeit ist über 100 km. Bei einem Wind von 14 m Stärke unternahm Rupp einen Flug von 1 s/,( Stunde Dauer in 400 m Höhe, wobei sich der Apparat in allen Lagen als äußerst stabil zeigte. e. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Die gegenwärtige Krisis im französischen Militärflugwesen, von der an anderer Stelle in eingehender Weise die Rede ist, hat die französischen Flieger nicht gehindert, mit vollem Elan an die Arbeit zu gehen, und die zum Teil großartigen Erfolge, welche wiederum sowohl die Militär- als auch die Zivilflieger zu verzeichnen haben, zeigen, daß man die Lehren aus der augenblicklichen Verstimmung zu ziehen und sie zum Vorteil zu nutzen verstanden hat. Aus der großen Reihe hervorragender Fingleistungen seien einige der wichtigsten erwähnt. Am letzten Montag unternahmen gleichzeitig drei Flieger den Fern fing von Paris nach Lyon, eine Distanz von 512 km und alle drei gelangten glücklich ans Ziel. Eugene Gilbert flog auf einem Morane-Eindecker 50 PS Motor Le Rhone am Mittag von Paris ab und kam, nachdem er in Nevers eine Zwischenlandung vorgenommen hatte, um 4 Uhr in Lyon an. Die wirkliche Flugzeit betrug 3% Stunden, was einer mittleren Stundengeschwindigkeit von 120 km gleichkommt, wobei bemerkt sei, daß der schnellste Eisenbahnzug von Paris nach Lyon die Strecke in 6 Stunden 13 Minuten, also mit 82 km Durchschnittsgeschwindigkeit durchfährt. Der Flieger Martin flog auf einem Henri Farman-Zweidecker 50 PS Motor Le Rhone die gleiche Strecke, indem er zwei Zwischenlandungen vornahm, sodaß er erst am Abend am Ziel eintraf. Und auch Le-gagneux machte sich am gleichen Tage auf einem Morane-Eindecker 50 PS Gnom auf den Weg und gelangte arn ersten Tage von Villa-coublay nach Auxonne, von wo er am nächsten Morgen bis Chälons flog, um schließlich von dort in einem Zuge nach Lyon zu fliegen. Einen interessanten Flug führte auch Laurens auf einem Deperdussin-Wasserflugzeug aus, indem er, mit dem bekannten Sportsmann Jaques Schneider an Bord, am vergangenen Montag von Nizza nach Genua flog. Der Abflug gestaltete sich gewissermaßen dramatisch, denn die Maschine wollte nicht recht in Gang kommen, und als endlich der Abflug gelungen war, sah man Laurens nach einer halben Stunde wieder an die Abflugstelle zurückkehren. Es stellte sich heraus, daß der Motor nicht gut funktionierte und nachdem man auch noch die Schwimmer durch Leisten verstärkt und 70 1 Benzin und 30 1 Oel an Bord genommen hatte, ging der Start vor sich. Nach einer Zwischenlandung in Spatorna langten die beiden Flieger in Genua an; sie hatten die Entfernung von 170 km in 1 Stunde 52 Minuten hinter sich gebracht. Einen gelungenen Passagierflug von Paris nach London führte Marty aus, der einen Caudron-Zweidecker 80 PS Gnom-Motor auf dem Luftwege nach London brachte, um ihn an das englische Kriegsministerinm abzuliefern, und dabei einen Passagier an Bord des Flugzeugs nahm. Noch beachtenswerter ist eine Flugleistung Perreyons, des Chef-Fliegerä der Bleriot-Schule zu Buc, welcher am 12. März auf dem dortigen Flugplatz einen neuen Höhen-Weltrekord mit 5850 m aufstellte. In Gegenwart einer zahlreichen Menge von Interessenten, die zu dem Experiment von Bleriot geladen waren, stieg Perreyon um 11 Uhr 15 auf und beschrieb während einer Stunde sieben Minuten gewaltige Kurven über dem Flugplatze Der Himmel war so hell, die Atmosphäre so durchsichtig, daß man, mit einem guten Glas bewaffnet, den Apparat während des ganzen Fluges nii-ht einen Augenblick aus den Augen verlor. Perreyon stieg bis auf 5850 m und kam dann, nachdem er die Zündung abgestellt hatte, im ciehwebe-fluge glatt zur Erde. Die einzelnen Zahlen, die bei dieser Flugleistung konstatiert wurden, sind folgende: Aufstieg; 1 OlX) in in 2 Min ; 2000 m in 5 Min.; 30(10 m in 'J Min.; B8O0 in in Ii Min.; 5850 m in 55 Min. Abstieg: 5850 in in 12 Minuten. Zu erwähnen ist, daß Perreyon den Eindecker zum ersten Male versuchte; er hatte den bisherigen Siebenzylinder 80 PS Gnom durch einen Vierzehnylinder 160 PS ersetzt. Der Apparat selbst gehört der abgeänderten Type XI an. Perreyon ist auf seinem Fluge von der Kälte stark belästigt worden, namentlich an den Händen. In 5700 m Höhe begegnete er heftigen Windströmungen und er hatte schwer zu kämpfen. Interessant ist, daß Perreyon das Experiment von neuem unternehmen und auf über 6000 m steigen will. Zu diesem Zwecke will er eine Aen-derung in der Vergasung vornehmen; er ist dabei, eine Art kleiner Turbine auf seinen Apparat zu montieren, welche die Luft ansaugen und gegen den Vergaser zurückwerfen soll. Der bisherige Höhenrekord von Garros mit 5610 m (am 11. Dezember 1912 in Tunis) ist also um nahezu 250 m gedrückt worden. Zwei Flugprojekte, die wohl dieser Tage zur Ausführung gelangen werden, verdienen Beachtung: Brindejonc des Moulinais will, mit Etappenlandungen in Bayonne, Victoria und Burgos, an einem Tage von Paris nach Madrid fliegen, und Seguin will, indem er von Marseille nach Algier fliegt, eine Ueberquerung des Mittelmeers vornehmen. Er will, von einer Flottille französischer Torpedoboote begleitet, von Marseille bis Alcudia (auf den Balearen) fliegen und von dort bis Algier gelangen. Die spanische Regierung hat das Kanonenboot Nueva Espana und zwei Torpedoboote nach den Balearen beordert, welche dem Flieger auf seinem Fluge von dort bis Algier das Geleit geben sollen. Die Entfernung von Marseille bis Alcudia ist 430, diejenige von Alcudia bis Algier 343 km. Es scheint überhaupt jetzt die Saison der Weitflüge angebrochen zu sein, und zwar beteiligen sich daran auch die französischen Flieger in den Kolonien, welche in der letzten Zeit zahlreiche beachtenswerte Fernflüge unternommen haben, von denen namentlich ein 400 km-Flug über die asiatische Steppe erwähnt sei. Verminck flog auf einem Bleriot 50 PS Gnom von Saigon nach Pnom-Penh, wobei er die 400 km, welche die beiden Hauptstädte von Indo-G'hina und Kambodsche trennen, in 4lji Stunden durchquerte. Die Militärflieger in den Kolonien haben einen Geschwaderflug von 1200 km durch Tunis unternommen und zu glücklichem Ende geführt, der sicher Beachtung verdient. Eine Flottille von drei Farman-Zweideckern, von den Leutnants Rimbert, Jolain und Hnrard, sämtlich mit Begleitern an Bord, sowie die Leutnants Magnien und Jeanuerod führten diesen prächtigen Weitflug aus. .letzt will man eine Wasserflugzeug-Schule in Bizerta installieren sowie ferner eine Klug/.imgsl.iil.ion in Tunis, erstere für die Sicherheit des genannten Hafens, letzten! zur I Ic.lierwachung der nordtunesischen Küste. Aber auch das hunnische französische Militärflugwesen hat nicht gefeiert. Leutnant Dietrich ging auf einem Deperdussin-Eindeckar bei heftigem Winde von Reims nach Nancy und Leutnant Devarrenne auf einem Maurice Farman 70 PS Renault in 2 Stunden 20 von Verdun nach Buc, eine Distanz von 260 km, wobei ersterer zwei Passagiere an Bord seiner Maschine hatte. Auf einem Caudron-Apparat gemischten Systems vollführte Leutnant Le Bihan vom 8. Inf.-Regiment den ersten Fernflug auf einem Militär-Wasserflugzeug, indem er von Le Crotoy nach Boulogne und zurück flog, wobei er sich mehrere Male auf dem Meere niederließ. Bemerkenswert ist, daß das Flugzeuggeschwader von Beifort dieser Tage eine probeweise Mobilisierung vorgenommen hat, die über Erwarten gelungen >st. Auf eine am späteu Abend eingetroffene Ordre hatten sich am frühen Morgen 6 Militärflieger in geschlossener Luftflottille, mit den zugehörigen Transport- und Materialfahrzeugen, auf dem Felde von Mailly einzufinden. Alles klappte vorzüglich Hierbei sei erwähnt, daß soeben neue Abzeichen für die Militärflieger geschaffen worden sind, deren Form und Aussehen zwar noch nicht endgültig feststehen, die sich aber nicht viel von den bisherigen unterscheiden sollen. Einige, zum Teil ernstere Unfälle sind aus den letzten Tagen zu verzeichnen : Ein von Gaulard gesteuerter Apparat schlug bei einem Fluge zwischen Long und Pont Remy auf den Boden und der Flieger wurde schwer verletzt. Ein "Wasserflugzeug Breguet versank während eines Versuchs auf der Rhede von St. Raphael; Fliegerund Mechaniker konnten gerettet werden. Vom Mißgeschick verfolgt ist entschieden die Firma Nieuport. Nachdem beide Brüder Nieuport bekanntlich tötlich verunglückt sind, ist nun am letzten Freitag auch der Fluglehrer der Firma in Villacoublay abgestürzt. Er versuchte einen neuen Apparat und als er sich damit oberhalb des Gehölzes von Hotel-Dieu befand, wurde er plötzlich von einem heftigen Windwirbel erfaßt, und als er sich zum Landen anschickte, stieß der Eindecker mit der Spitze nach unten und überschlug sich. Mandelli wurde mit sehr schweren Verletzungen aus den Trümmern seiner Maschine gezogen. Jetzt beginnt auch der Wettstreit um die ausstehenden Bewerbe und Brindejonc hat sich soeben bei der Ligue Nationale Aerienne für den Pommery-Pokal einschreiben lassen, den bekanntlich gegenwärtig Pierre Daucourt mit 852.300 km innehat. Der Aero-Club hat auch sein Reglement für das „Kriterium des Aero-Clubs" festgesetzt, welches in der Zeit vom 1. Mai bis 31 Dezember d. .1s. bestritten werden kann: Sieger des Bewerbs wird sein, wer die, größte Distanz in geschlossenem Rundfluge, ohne Zwischenlandung, geflogen haben wird, und zwar in Frankreich oder in Algier. Die Rund- strecke setzt sich zusammen aus einer durch zwei Pfosten markierten Strecke, welche voneinander mindestens 500 m entfernt und die zu umkreisen sind. Auf einer zweiten kleinen Bahnstrecke wird der Bewerber seinen Flug zu vollenden haben, jp,uch hier ohne Zwischenlandung. Uebrigens hat sich der Aero-Club nunmehr neu konstituiert, und zwar wurden am Donnerstag gewählt: zum Präsidenten Henri Deutsch de la Meurthe; zu Vicepräsidenten Graf Henri de la Vaulx, Jaques Balsan, Alfred Leblano; zum Generalsekretär Georges Besancon; zum Schatzmeister Graf Castillon de Saint-Victor. Man hofft, daß diese Neuwahl die starke Erregung innerhalb des Aero-Clubs beilegen wird, die sich in letzter Zeit gezeigt und zeitweilig den Charakter einer Krisis im Aero-Club angenommen hat. In der Hauptsache handelte es sich hierbei um die Nichtwiederwahl Leon Barthous zum Vizepräsidenten, infolgedessen mehrere angesehene Mitglieder ihre Demission gaben. Man arbeitet emsig an der Beilegung der Differenzen, welche in der Hauptsache persönlicher Natur sind. Mit Interesse verfolgt man auch die Generalversammlung der Association Generale Aeronautique, die dieser Tage stattfand. Der Präsident Balsan gab einen Ueberblick über die überaus umfangreiche Tätigkeit der Vereinigung im abgelaufenen Jahre und konstatierte, daß die Mitgliederzahl in 1912 von 3175 auf 6595 gestiegen ist. Eine große Anzahl neuer Fliegerpatrnte wurde erteilt und folgende offizielle Homologationen vorgenommmen: Höhenrekord (Flieger und 4 Passagiere): Guggenheim, S.Februar 1913, Etampes, 840 m. Rekords, von Guillaux am II. Februar 1913 zu Etampes aufgestellt: Geschwindigkeit (Flieger und 1 Passagier): 2Ü0 km in 2:04:27—2 250 „ „ 2:34:48—2 300 „ „ 3:04:50 350 „ „ 3:34:46-4 400 „ „ 4:04:42—3 Distanz (Flieger und 1 Passagier): 410 km Dauer „ „ 1 „ 4:10:46-4 Zeiten „ „ 1 „ in 2 Stunden: 191.900 km „ 3 „ 291.900 „ „ 4 „ 391.900 „ Höhe „ „ 4 „ 1050m; Guggenheim, 10.2. 1913 Etampes Höhe „ „ 3 „ 1330 m; Chevillard, 12. 2. 1913 Etampes Dauer „ „8 „ 11: 28 -2 Frantz, 2. 3. 1913 Chartres Höhe „ „ 5 „ 600 m; Frantz, 28. 2.1913 Chartres Wie verlautet, steht für die nächste Zeit ein besonders zahlreicher Angriff auf die bestehenden Flugrekords bevor, an dem sich die ersten Flieger Frankreichs beteiligen wollen. Rh Englischer Brief. (Von unserem Londoner Korrespondenten.) Das Flugwesen hat hier allerorts sehr unter der Interesselosigkeit nicht nur der Fachkreise, sondern auch in den Kreisen der gesamten Bevölkerung sehr gelitten. Die „Royal Aircraft Factory" macht der Vereinigung der Ingenieure Vorwürfe, daß sie sich um den Bau von Flugmotoren so wenig bekümmert haben. Anstatt nun sich ernsthaft an die Arbeit zu begeben, streitet man sich in den Zeitungen herum, wo jeder seine Unschuld beteuert. Indessen ist die geschickt inscenierte Zeitungsreklame mit ihren Luftgespenstern nicht umsonst gewesen. Das Interesse für das Flugwesen ist hierdurch gewaltig gesteigert worden. Hauptsächlich seit der Olympia-Ausstellung spürt man überall neues Leben. Großes Interesse bringt man besonders der Wasserflugmaschine entgegen. Der italienische Schiffsleutnant Calderrara hat sich neuerdings in London ansässig gemacht, um seine Wasserflugmaschine dort ku bauen. Von der Maschine eines Australiers Wigram, ein sogenanntes „Fliegendes Boot", mit 100 PS Green-Motor, verspricht man sich sehr große Erfolge. Auch Cody ist unter die Wasserflugmaschinen-Bauer gegangen. Er ist mit dem Bau einer fiiesen-Wasserfiugmasehine beschäftigt, die sich im Prinzip an seine Landflugmaschine anschließt. Das vom Amt des Innern in London erlassene Luftschiffahrtsgesetz ist natürlich hier mit großer Begeisterung aufgenommen worden. Die Konstrukteure und Fabriken denken allerdings hierüber etwas anders Bekanntlich ist jeder Fingzeug- und Luftschiffverkehr über bestimmte Oertlichkeiten, es sind dies 70 Punkte, verboten. Unter diesen Orten sind hervorzuheben: Kriegshäfen, Festungen, Stationen für drahtlose Telegraphie, wichtige Eisenbahnknotenpunkte u. s. w. Gesuche zur Erlaubnis des Landen ausländischer Flugzeuge müssen 18 Stunden vor dem beabsichtigten Flug in allen Einzelheiten an das Innere Amt in London gerichtet werden. Die Flieger müssen ferner ihre Ankunft an der Küste melden und dürfen ihren Flug nur fortsetzen, wenn sie Erlaubnis hierzu erhalten haben. Das Mitführen zollpflichtiger Gegenstände, fotografischer Apparate, Brieftauben, Sprengstoffe, Schußwaffen ist streng untersagt. Uebertretungen dieser Bestimmungen werden mit 6 Monaten Gefängnis und 200 Lstr. bestraft, Spionage aus Flugzeugen und Luftschiffen mit 7 Jahren Zuchthaus. Auf Flugzeuge und Luftschiffe, die über Oertlichkeiten hinweg fliegen, kann geschossen werden. Sie sind also vogelfrei. In Fachkreisen sind diese Bestimmungen, wie bereits erwähnt, mit geteilten Empfindungen aufgenommen worden. Der Gesetzgeber scheint sich über die Tragweite nicht klar gewesen zu sein. Unter diesen Umständen können nicht einmal mehr die einheimischen Flieger riskieren zu fliegen, da man ja von der Erde aus nicht beurteilen kann, ob es sich um einen in- oder ausländischen Flieger handelt. Man sieht, es herrscht in diesen Kreisen eine große Unkenntnis. Sonst würden derartige Gesetze niemals erlassen worden sein. * Die Ausgestaltung des Militärflugwesens in anderen Ländern, hauptsächlich in Frankreich und Deutschland, ist hier in letzter Zeit mit einer gewissen Unruhe verfolgt worden. Am 17. März machte Oberst Seely beim Bericht über den Militär-Etat über das Flugwesen folgende Mitteilungen: Es sind vier Fluggeschwader mit 128 ausgebildeten Fliegern zusammengestellt. Für das folgende Etatsjahr 1913/14 werden ein fünftes und sechstes Geschwader gebildet. In der Denkschrift wird darüber geklagt, daß es sehr schwer wäro, die geeigneten Flieger für die Besetzung der Maschinen zu erhalten Ferner bestehen große Schwierigkeiten darin, Flugzeuge britischen Fabrikats zu erlangen. Man hofft jedoch, in Zukunft diesem Uebelstand abhelfen zu können. Das Fliegerkorps soll nach dem Etat 100'J Offiziere und Mannschaften außer dem Stab der Fliegerschulen zählen. Gegenüoer dem vorjährigen Etat soll die Zahl der Flugzeuge vermehrt werden. In dem Etat sind 501000 Lstr für das Flugwesen gefordert. Sho. . . Ueber die Entscheidung der Wright-Patente in anderen Ländern. In Frankreich hat am 13. März nach einwöchentlicher Verhandlung der Appellationsgerichtshof in Paris seine Entscheidung im Wrightprozeß ausgesprochen. Jm großen ganzen lehnt sich diese Entscheidung an die Urteile der ersten Jnstanz an Die Entscheidung ist infolge der neu hinzukommenden Momente für die französische .Industrie günstiger. Entgegen der Meinung der ersten Jnstanz Lst der Appellationsgerichtshof der Ansicht, daß nicht allein die Kupplung von Flügel-verwindung und Vertikalsteuer, sondern überhaupt die gleichzeitige Existenz dieser beiden Organe unter das "Wright-Patent fallen Duich die jetzige Lage wird es den französischen Konstrukteuren möglich sein, auf Grund von früheren Erfindern, wie Ader und verschiedene andere, bei welchen das gleichzeitige Vorhandensein von Verwindung und Seitensteuer vorlag, den Wright-Patenten entgegen zu halten. In Amerika hat die amerikanische Wright-Gesellschaft gegen die Curtiss Company ihren Prozeß erfolgreich durchgefochten. Curtiss und andere Konstrukteure dürfen daher ihre Flugmaschinen nicht mehr bauen und verkaufen. Jn dem Urteil heißt es: „Curtiss hat den Grundgedanken der Wright-Patente benutzt, und die einzigen Abweichungen beschränken sich auf Konstruktionseinzelheiten Er hat seine Maschine so gebaut, daß man zur Wiederherstellung des seitlichen Gleichgewichts dieselben Manöver ausführen muß, wie beim Wright-Apparat, und nach Aussagen der Zeugen bedient er sich des vertikalen Ruders nicht allein als Richtungssteuer, sondern auch zur Widerherstellung des Gleichgewichts". Die gesamte Flugzeugindustrie ist durch diese Entscheidung in eine kritische Lage versetzt worden. Man braucht sich nicht zu wundern, daß die .Industriellen so wenig die Sache kümmert. Das Beste was sie tun können. 160 PS Farman - Zweidecker. Die großen Steiggeschwindigkeiten z. B. des Bleriot-Eindeckers mit Perreyon am Steuer, haben großes Aufsehen erregt. Durch diese Leistungen ist mit einem Schlage klar und deutlich bewiesen, daß es für eine Flugmaschine ein Leichtes sein wird, einen Lenkballon zu überhöhen. Neuerdings hat Farman einen noch leistungsfähigeren Apparat, einen Doppeldecker von 19 m Spannweite, 60 qm Tragfläche und 8 m Gesamtlänge gebaut. Diese Maschine ist mit einem 160 PS Gnom-Motor ausgerüstet, der, wie die Abbildung zeigt, eine Schraube von 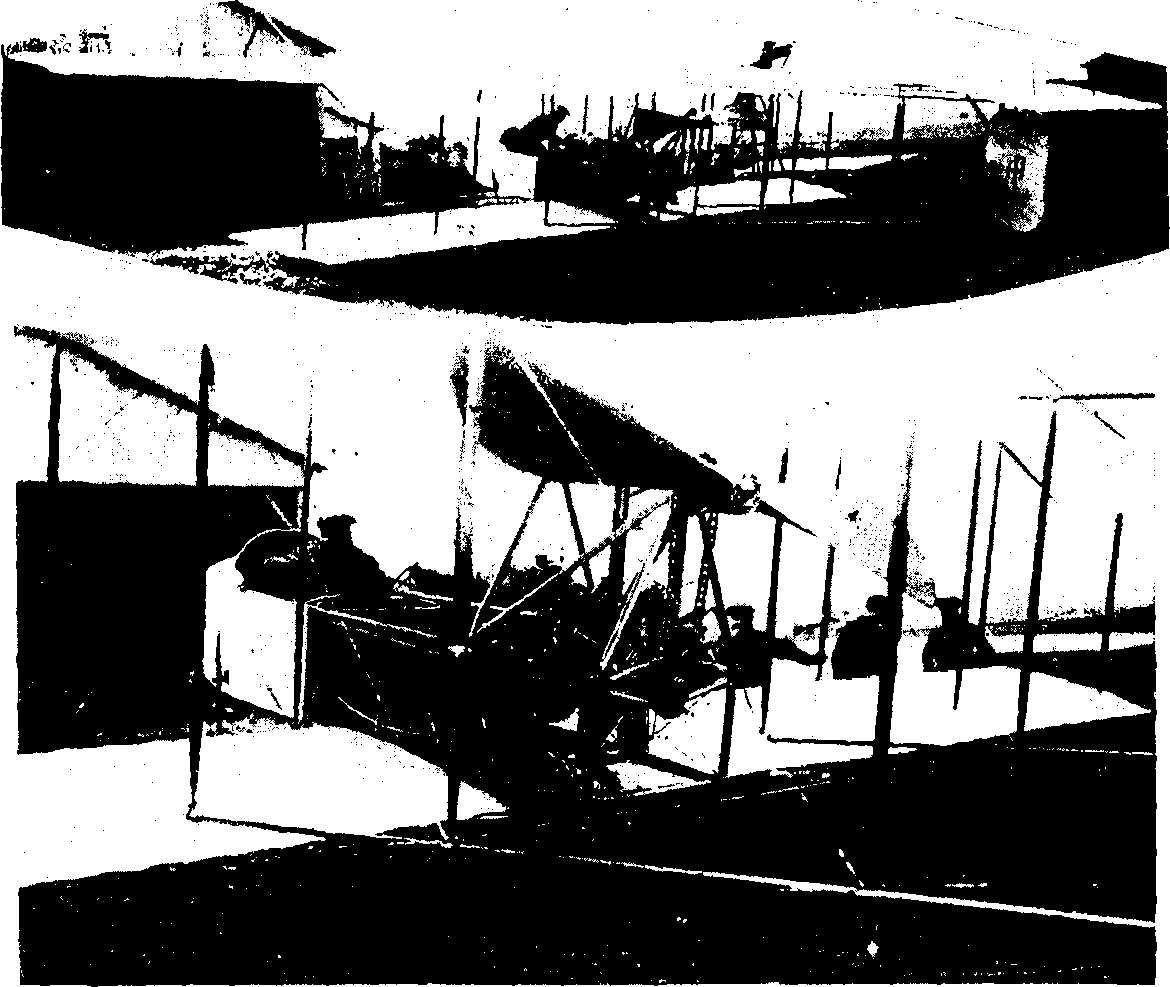 Farman-Zweidecker mit 160 PS Gnom-Motor. 4 m Durchmesser mittels Gelenkkette antreibt. Durch diese Untersetzung ist es zunächst möglich, die Maschine mit einem sehr niedrig gehaltenen Fahrgestell zu versehen und einen höheren Wirkungsgrad der Schraube zu erzielen. Das Gesamtgewicht der Maschine beträgt 750 kg. Auf die Resultate dieses neuen Apparates darf man gespannt sein. Der Otto-Zweidecker Typ 1913. Die Flugmaschinenwerke G-ustav Otto, München, haben seit ihrem Bestehen 92 Apparate fertiggestellt. Mit Beginn des Jahres 1913 wurden von der Bayer. Heeresverwaltung, die ausschließlich Otto-Zweidecker verwendet, 40 weitere Apparate in Auftrag gegeben. Die Einzelheiten dieses modernen Zweideckers sind kurz folgende: Die Haupttragzelle ist vollständig aus Stahlrohr konstruiert. Sie besteht aus 5 leicht zerlegbaren Teilen, die einzeln ausgewechselt werden können. Die beiden unteren Seitenflächen sind V-förmig nach oben gestellt zur Erhöhung der Seitenstabilität. Die Schwanzgitterträger sind ebenfalls auch aus Stahlrohr und besitzen in der Propellerbahn eine vierfache Wandung, sodaß die Träger gegen abfliegende Propellerstücke vollständig geschützt sind. Die Schwanzzelle besteht aus einer oberen Tragfläche, einem Höhensteuer und 3 Seitensteuern und den federnden Schwanzkufen. Dieses bildet ein komplettes Ganzes und kann auf ganz einfache Weise an die Schwanzträger angehangen werden. Bei der Konstruktion des Otto-Apparates ist das Hauptaugenmerk auf die rasche Zerlegbarkeit und Auswechselbarkeit aller Teile  Otto-Zweidecker Typ 1913. gelegt. Die Maschine läßt sich ebenso rasch montieren wie ein normaler Eindecker. Besonders gut ist das hochschwenkbare Fahrgestell, das sofort nach Lösung der Außenkabel nach Innen hochgeschwenkt worden kann. Der Motorrahmen ist äußerst kräftig gehalten, ebenfalls Stahlträger, Stahlrahmenkonstruktion und ist mit 6 Stoßstangen nach vorn gegen Vorrücken gesichert. Es ist daher noch nie vorgekommen, daß sich der Motor von seiner Unterlage gelöst hätte. Ganz besonderer Wert ist auf die Konstruktion des Sitzbootes gelegt worden, das in einer außerordentlich festen Stahlrohrkonstruktion Führer und Gast vor Unfällen schützt. Unter diesem Kielboot, das außerdem einen sehr geringen Luftwiderstand hat, ist ein starker Kiel montiert, der bei starkem Vorneigen des Apparates den Boden berührt und den Apparat nach hinten zurück federt. Die Konstruktion ist am besten aus den Abbildungen ersichtlich. Die Innenausstattung ist wie bei modernen Automobilen, breite Polsterränder bieten größtmöglichen Schutz gegen Verletzungen. Der Benzin- und Oelkessel trägt Schaugläser mit automatischer Absteilvorrichtung, sodaß nur auf Wunsch des Führers während der Fahrt Kontrolle in den Schaugläsern möglich ist. Es ist dadurch jede Brandgefahr vollständig ausgeschlossen. Die ursprüngliche Holzkonstruktion wurde durch Stahlrohrkonstruktion ersetzt, so daß das heutige Flugzeug den vollendeten Doppeldeckerkriegstyp darstellt. Der Apparat besitzt bei einer Belastung von 2 Personen und Betriebsstoff für 4 Stunden eine Steigfähigkeit von 1000 m in 9 Minuten bei der geringen Spannweite von 12,5 m mit 100 PS Argusmotor und 13,5m Spannweite von 100 PS Mercedesmotor. Die Gewindigkeit beträgt über 100 km. Was geht in Frankreich vor? Die Wahrheit über das französische Militär-Flugwesen. (Schluß) Es kann nicht verwundern, daß angesichts der geschilderten Mißstände sich allmählig - das Verlangen nach einer durchgreifenden Reorganisation des Militärflugwesens bemerkbar machte. Allerdings, bevor die allgemeine Öffentlichkeit sich schweren Herzens entschloß, an die Mangelhaftigkeit und Unzulänglichkeit der bestehenden Organisation zu glauben, bedurfte es zunächst einiger beherzter Stimmen, die, selbst unter Hintansetzung ihrer persönlichen Interessen, mit anerkennenswertem Freimut auf die schweren Schäden hinwiesen und es unternahmen, den Finger in die Wunde zu legen. Es ist noch in Erinnerung, wie der bekannte Offiziersflieger, Leutnant Clavenad, im Juli vorigen Jahres seinen „Cri de Soldat" in die Oeffentlichkeit brachte, wie er einen schweren und undankbaren Kampf gegen den Bureaukratismus im Flugwesen unternahm, der ihm seine Zurückberufung aus Marokko und seine Strafversetzung in eines der Regimenter an der Ostgrenze einbrachte. Damals freilich handelte es sich um die schreienden Mißstände in den Kolonien, wo ein gewaltip.es Material an Mannschaften und Flugzeugen unbenutzt brachlag, wo die Flieger.nannschaften sogar ohne Sold blieben, so daß Clavenad, um der dringendsten Not der Leute vorzubeugen, sie aus seinen eigenen Mitteln bezahlen mußte, bis sein Geld aufgebraucht war und er dann die „Flucht in die Oeffentlichkeit" antrat. Clavenad schilderte damals, wie der damalige Oberst Hirschauer, sowie der die Truppen in Marokko befehligende General Lyautey immer und immer wieder Reklamationen in das Kriegsministerium sandten, wie sogar der Kriegsminister selbst sofortige Maßnahmen als dringend notwendig anerkannt hatte, aber an der Willkür der „Bureaus" im Ministerium scheiterte jede Aktion. Nichts geschah. Der Wille der Chefs blieb unausgeführt. Alle Energien wurden lahmgelegt und das Militärflugwesen in Marokko hatte zehn Monate, nachdem die Offiziere und .Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel VII. 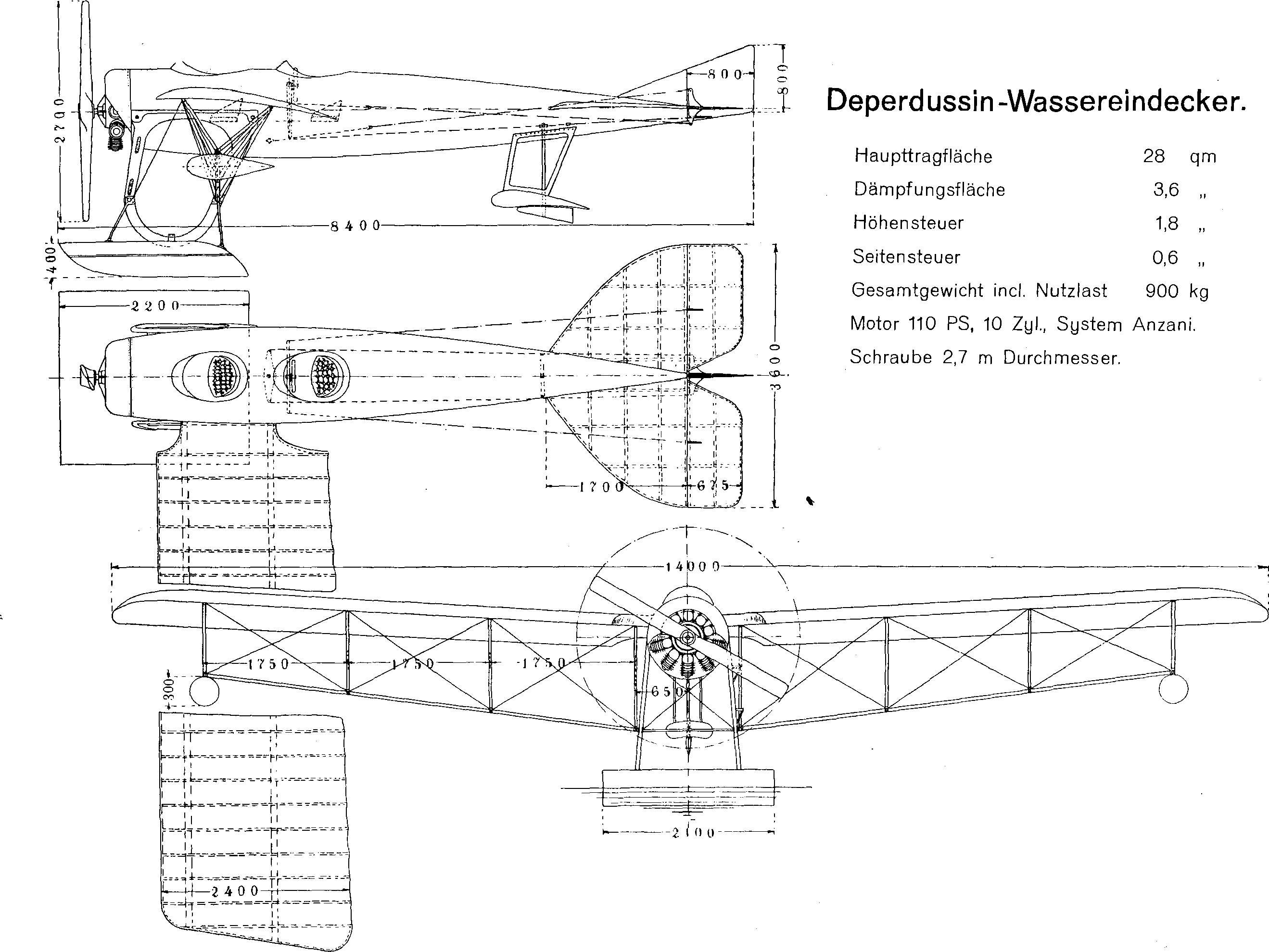 Nachbildung verboten. Mannschaften mit kompletem Material hinausgegangen waren, noch keine legale Organisation und niemand wagte, einen Flug zu unternehmen; niemand wußte, wer Vorgesetzter und wer Untergebener war und die strikten Verfügungen des obersten Chefs des Flugwesens und des Kriegsministers blieben unausgeführt. Die den Flugzeugen beigegebenen Automobile standen sechs Monate lang in Paris zur Absendung bereit und niemand kümmerte sich um die Expedition. Drei Monate blieben die Flugzeuge in Marokko ohne Unterkunft, weil man die leichten Hallen, die für sie vorgesehen waren, nicht abschickte. Das Flugwesen in den Kolonien verfügte nicht über ein einziges Centrum, das mit einer an einen guten Hafen angeschlossenen Eisenbahn verbunden war. „Will man ein Flugwesen oder nicht?" rief damals Clavenad aus, „aber jedenfalls hat man kein Recht, ein großes Material und zahlreiche Mannschaften in den Kolonien zu lassen, die völlig untätig bleiben müssen, während sie in Frankreich gute Dienste leisten können. Man hat kein Recht die unsägliche Aufopferung und die zeitweilig unerträglichen Entbehrungen der Flieger und Mechaniker'durch eine unerhörte Ungerechtigkeit und durch verächtlichen 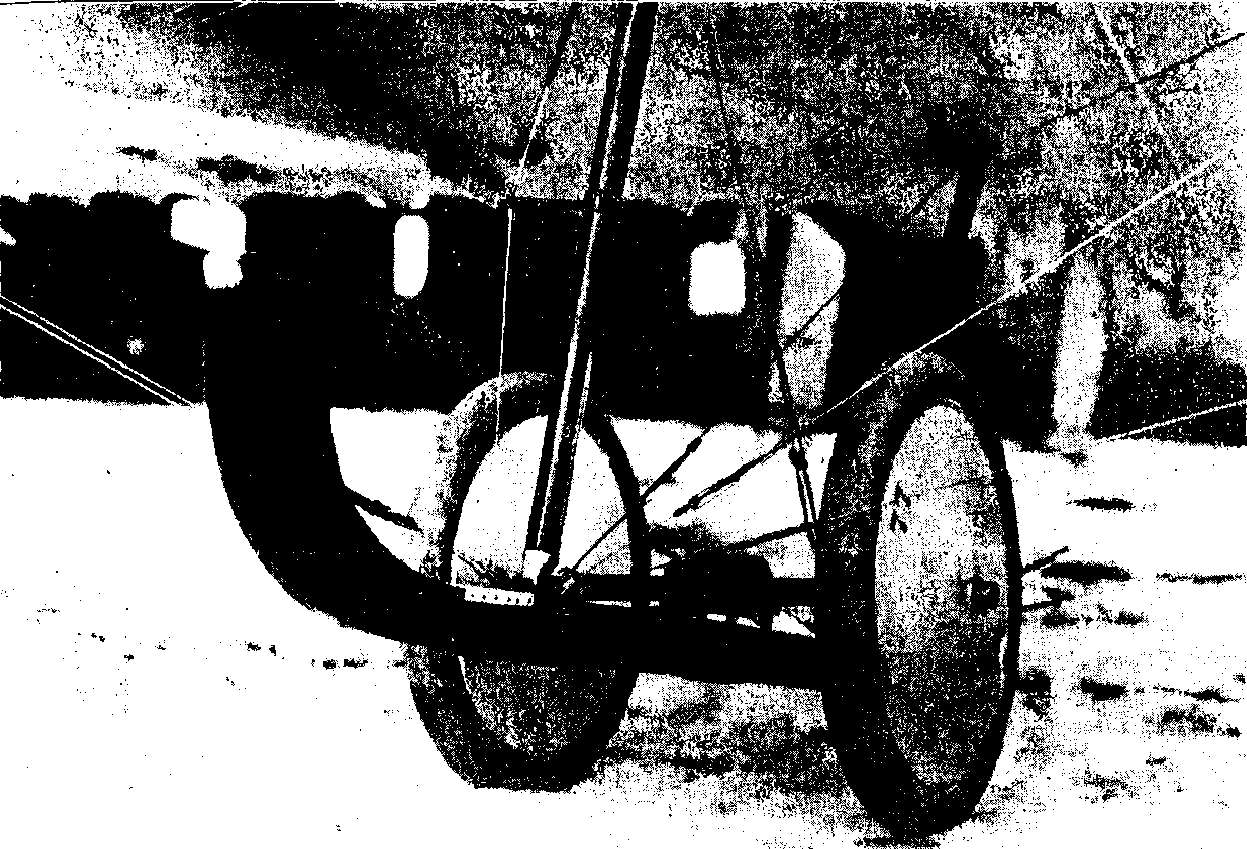 ϖv- Kjife des Otto-Zvieidea\er Typ 1913, mit aufgehängtem Räderpaar. Spott zu lohnen." Aber wenn dieser Notschrei eines aktiven Fliegerotfizieres sich auf die Kolonien bezog, wo allenfalls die Weitläufigkeit der Verkehrsmittel mildernd in Betracht gezogen werden konnte, so erhoben sich andere Stimmen, welche freimütig die von uns kurz angedeuteten Verhältnisse in Frankeich selbst einer scharfen, aber berechtigten Kritik unterzogen. Großes Aufsehen namentlich erregte ein Artikel im „Temps", einem Regierungsblatt (!), aus der Feder des bekannten Generals de Lacroix, des ehemaligen Generalissimus der französischen Armee, der in Frankreich als eine der ersten Autoritäten gilt, und gerade der Umstand, daß die Ausführungen im offiziösen „Temps" erschienen, zeigt die Ohnmacht der Regierung gegenüber dem erdrückenden Bureaukratismus. Der Artikel des Generals gipfelte in der Forderung „Ordnung und Disziplin in die Flugcentren hineinzubringen, indem man dort Chefs anstellt, welche imstande sind, eine Autorität geltend zu machen, die dort bisher völlig fehlt". So sagt de Lacroix zum Beispisl wörtlich: „Unsere jungen Offiziere sind in diesen Flugcentren zu sehr sich selbst überlassen. Die Offiziere, welche dorthin kommen, um sich im Fliegen unterweisen zu lassen, sind von gutem Willen und von Verwegenheit beseelt. Aber diese Verwegenheit muß eingedämmt werden. Diese jungen Leute haben nötig, daß sie geleitet, kontrolliert, einer strikten Ordnung und Disziplin unterworfen werden, wovon wir heute weit entfernt sind Die Leitung der Flugcentren ist zu jungen Offizieren anvertraut worden, welche nicht imstande sind, eine wirkliche Autorität über die Flieger auszuüben, die gewöhnlich in gleichem Grade mit ihnen stehen. Wenn wir bedauerlicherweise keine höheren Offiziere haben, welche eine gründliche Kenntnis des Flugwesens besitzen, so müssen wir uns damit begnügen, daß sie wenigstens die notwendige Autorität haben, die dringend nottut.' Man hat freilich für die Flugcentren ein schönes Reglement ausgearbeitet, welches genau die Bedingungen festsetzt, unter denen die Flieger ihre Uebungen vorzunehmen, wie sie in der Flugbahn sich zu verhalten und wie sie zu landen haben. Aber es ist niemand da, der die Befolgung dieser Vorschriften kontrolliert und der vor allem die Befolgung erzwingen kann. Daher sind auch jene beklagenswerten Unfälle gekommen, wie die Katastrophe von Brayelle, bei der zwei Offiziersflieger, welche entgegen aller Vorschrift, sich in verschiedener Richtung in der Flugbahn bewegten, zusammenstießen und ihr Leben verloren. — Kaum war dieser Aufsehen erregende Artikel des Generals de Lacroix erschienen, der naturgemäß in hiesigen Fliegerkreisen lebhaft besprochen wurde, als in der angesehensten militärischen Fachzeitschrift Frankreichs, in „La Defense Nationale", unter dem Pseudonym eines „Leutnants de Saint-HeJise" ein neuer Angriff auf die Organisation des französischen Militärflugwesens erschien, der, es war das offenes Geheimnis, eine der angesehensten und hochstehendsten Persönlichkeiten der Armee zum Verfasser hatte. Die ganze Bitterkeit, mit der hier ein hochverdienter Fachmann sich über die gegenwärtigen Zustände ausläßt, gehen schon aus nachfolgenden Sätzen hervor: „Wenn man noch nicht leugnet, daß der Militärflieger den Wagemut besitzt, in edler und patriotischer Weise sein Lebnn zu wagen, wenn man ihm noch nicht das Verdienst abgesprochen hat, dal) er einen Mut zeigt, den er täglich in bewundernswerter Weise an den Tag legt, so ist man doch schon soweit gekommen, daß man die uneigennützigen Motive unserer Offizierzsflieger in Frage zieht. Man spricht es heute bereits unverblümt aus, daß nicht alle mit demselben Geist der Ergebenheit und Selbstlosigkeit diese Karriere eingeschlagen haben. Noch wagt man es nicht, zu behaupten, daß nur der erhöhte Sold unsere Offiziere veranlaßt, ihr Leben in die Schanze zu schlagen, aber es ist schon genug, daß man einen derartigen Verdacht gegen diese Elite-Phalanx auch nur andeutet Andere behaupten, daß unser Flugwesen eine Schule der Disziplinlosigkeit sei. Ein Stückchen Wahrheit steckt freilich darin. Man ist gezwungen, dein Flieger und seinem Mechaniker-Personal eine gewisse Selbstinitative zu lassen. Aber dieser Initiative verdanken wir jene großartigen Flugleistungen, welche das französische Flugwesen an die erste Stelle gestellt hatten. Richtig ist ferner, daß unsere Offiziersflieger und ihre Mechaniker häufig eine vernachlässigte Haltung haben, aber es ist niemand da, der es wagen kann, ihnen darüber Vorstellungen zu machen. Und warum versagt man den Fliegern alle jene Ehren, die man so reichlich auf andere Dienstzweige aus schüttet? Heute ist es erforderlich, daß ein Flieger sich mindestens ein Bein oder einen Arm bricht, ehe seine Vorgesetzte daran denken, ihm eine Ehrung zuteil werden zu lassen. Es gibt einflußreiche Stellen, die durchaus keine Bevorzugung der Flieger zulassen, die unsere Offiziersflieger zu einfachen „Chauffeuren von Luftfahrzeugen" herabwürdigen wollen, denen ein besonderes intellektuelles Verdienst nicht zusteht. Man will aus dem Fliegerdienst einen dem Generalstabe untergeordneten Dienst machen, wobei der Flieger den „Arm", der Generalstabsoffizier das „Hirn" darstellen soll. Will man wirklich behaupten, daß die Offiziersflieger allein nicht imstande sind, die Luftrekognoszierungen vorzunehmen?" Als der jetzige Inspekteur des französischen Flugwesens, der General Hirschauer, seinen Posten übernahm, schien ein neuer Geist in die Organisation kommen zu wollen. Unverblümt äußerte sich der General Hirschauer Uber die mannigfachen Schäden, die er erkannte, und er erklärte, daß er entschlossen sei, den morschen Bau an Haupt und Gliedern zu reorganisieren. Er erkannte die großen Opfer an, die das Land der neuen Waffe, der „Hoffnung des Landes", gebracht hat und wollte seine ganze Energie daran wenden, das Flugwesen auf diejenige Höhe zu bringen, auf der es eigentlich sich befinden sollte. Bald aber türmten sich die Hindernisse und Widerwärtigkeiten vor ihm, auch seine Kraft war nicht ausreichend, um des „heiligen Bureaukratius" Herr zu werden. So wissen wir, daß General Hirschauer von dem Grundsatz ausging, daß das Flugwesen zwei Flugzeugtypen benötige: das leichte und das schwere Flugzeug, beide armiert und geschützt, soweit dies mit den Erfordernissen des zu erreichenden Zwecks und der Konstruktion vereinbar ist. Der erstere sehr beweglich, sehr schnell, für Flüge von kurzer Dauer in der Nähe der Grenze bestimmt, mit einer leichten Mitrailleuse armiert und im Interesse des Apparats und des Fliegers geschützt; der zweite, mächtiger, für Flüge von längerer Dauer, mit einer Mitrailleuse und mit Wurfgeschossen ausgerüstet, dazu bestimmt, Lenkluftschiffe, Hallen u. s. w zu zerstören, und gepanzert. Er ging von der Ansicht aus, daß die übliche Anlage der Flugzeuge das größte Hindernis für ihre rationelle Nutzwertung bilde. Im allgemeinen sind die Eindecker viel schneller, als die Zweidecker und folglich geeignet, auf diese Jagd zu machen. Nun sind die Eindecker mit der ziehenden Propellerschraube ausgestattet, welche das Schießen bei der Verfolgung wesentlich hindert. Die langsameren Zweidecker müßten imstande sein, wenn sie verfolgt werden, zu schießen. Sie aber verwenden die stoßende Propellerschraube, die wiederum für das Schießen nach hinten hinderlich 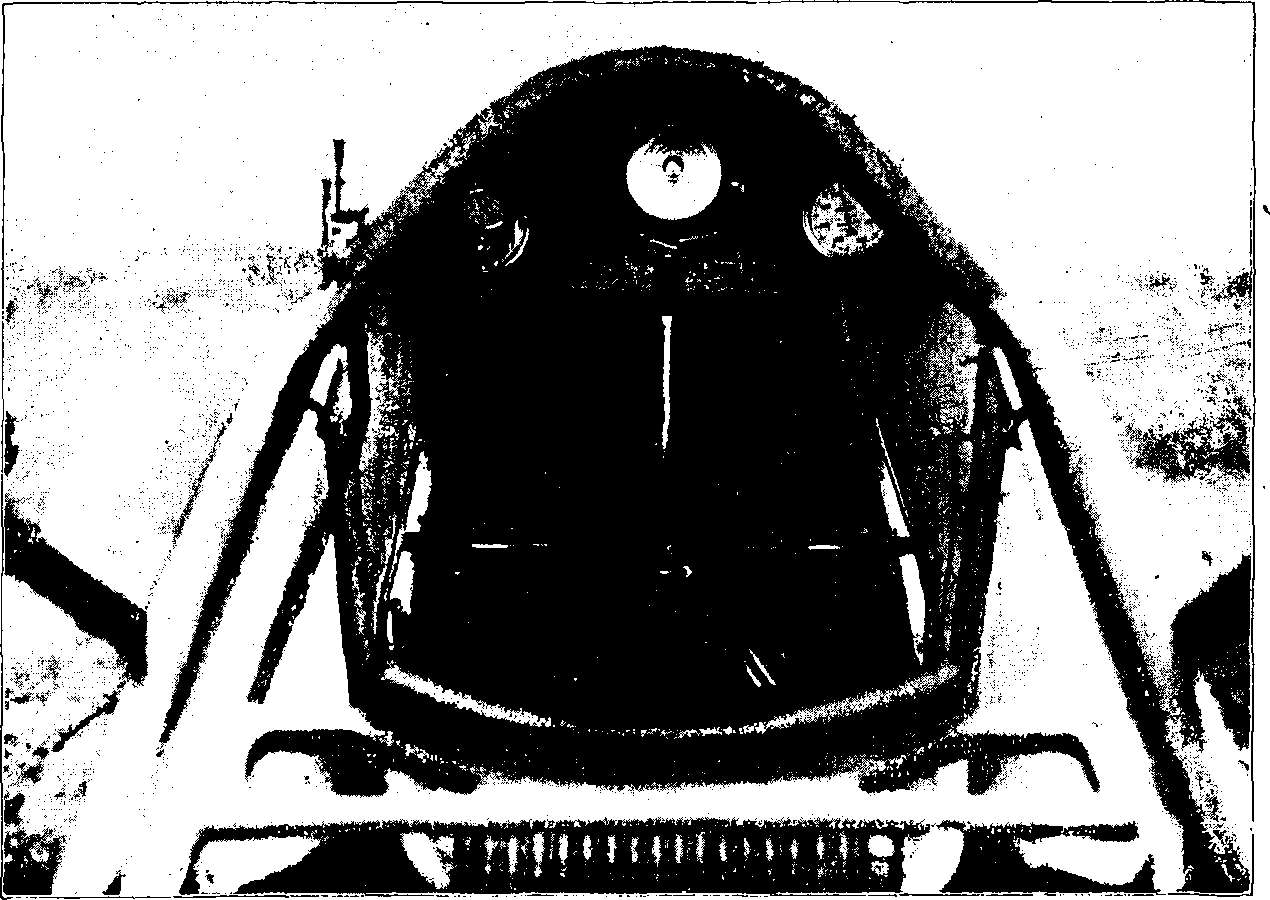 Fährerraum im Otto-Zweidecker Typ 1913. ist. Es scheint daher, als ob der Kampf zwischen Flugzeugen sehr schwierig sein wird und daß in der Hauptsache die größere Geschwindigkeit und die leichtere Manövrierfähigkeit die Chancen des Erfolges bestimmen werden. Auch diese Grundsätze vermochte der Chef des Flugwesens gegenüber dem Ministerial-bureau nicht zur Geltung zu bringen. Es ist bekannt, wie die jeweiligen Kriegsminister in Frankreich ihrerseits nichts unversucht gelassen haben, das Militärflugwesen zu fördern und zu erweitern, und namentlich der frühere Kriegsministar Millerand hat durch den von ihm bei der Deputiertenkammer eingebrachten und durchgesetzten Gesetzentwurf vom März vorigen Jahres in dieser Hinsicht viel getan Das wesentlichste, was dieses neue Gesetz anstrebte, war die völlige Autonomie des Flugwesens, deren Notwendigkeit in den Motiven des Gesetzes klar zum Ausdruck gekommen war. „Es handelt sich nicht darum, dem Militärflugwesen eine starre Rüstung zu geben, welche seine Bewegungsfreiheit und seine Entwicklung beeinträchtigen müßte. Die Ansichten, betreffend die Einzelorganisation des Flugwesens, können mit der Zeit, je nach Maßgabe der Verhältnisse, sich andern, aber wir müssen einen weiten und elastischen Rahmen schaffen, welcher ermöglicht, den einmal ge- troffenen Dispositionen diejenigen Aenderungen nach und nach zu geben, wie sie durch das Fortschreiten der unternommenen Studien sich erforderlich machen werden." Wenn das angezogene Gesetz ein autonomes Flugwesen schaffen wollte, so meinte es damit nicht ein in sich abgeschlossenes Fliegerkorps. Offiziere und Unteroffiziere sollten, je nach den Erfordernissen des Dienstes, wieder zu ihrer ursprünglichen Waffe zurückkehren, sowie wenn ihr Alter und ihre physische Beschaffenheit dfe Verwendung im Fliegerkorps nicht mehr angezeigt erscheinen ließ. Auf diese Weise sollte zwischen der fünften Waffe und der übrigen Armee ein Wechselstrom hergestellt werden, welcher jeden Gedanken an eine Exklusivität ausschließen sollte. Aus diesem Grunde sollten die Flieger auch ihre eigentliche Uniform beibehalten und nur ein besonderes Abzeichen dazu anlegen. Aus diesen Bestimmungen ging eine klar umränderte Organisation hervor, die sich, wie folgt, kurz charakterisieren läßt. Die Aviations-Kriegseinhelt wurde als Fliegergeschwader bezeichnet. Ein solches Geschwader umfaßte acht Flugzeuge, von denen sechs in erster Linie, zwei in Reserve bleiben, sowie das unerläßliche Material, um die Apparate unterzubringen, zu verproviantieren und zu reparieren. Um dem Luftgeschwader eine Beweglichkeit zu geben, die ihm gestatte, allen Standveränderungen des Stabes, dem es beigegeben ist zu folgen, wurde es mit Automobilen ausgestattet, welche den rapiden Transport des Materials möglich machten. Jedes Geschwader zerfällt in Sektionen von je zwei Flugzeugen der gleichen Type (Eindecker, Zweidecker, Mehrdecker). Jede dieser Sektionen ist mit zwei Trakteuren und einem Automobil - Camion ausgestattet und dem ganzen Geschwader ist ein Atelier-Camion beigegeben. Im Prinzip wurden die Flugzeuge der neuesten Konstruktion den mobilisierbaren Geschwadern zugeteilt, während die älteren Apparate für Unterweisungszwecke zu dienen hatten. Auf diese Weise sollte das Materia! in erster Linie stets auf der Höhe der technischen Fortschritte gehalten werden. Diese Luftgeschwader werden den großen militärischen Einheiten zugeteilt und sollen ferner zur Platzverteidigung, sowie zur Ueberwachung gewisser Punkte der Küste verwendet werden. Abgesehen von dieser Verwendung für den Generalstab sah das Gesetz die Heranziehung der Flugzeuge für mannigfache andere Nutzzwecke vor, so beispielsweise für die Kontrolle und Regulierung der Wirksamkeit des Artilleriefeuers, sowie für das Auswerfen von Sprenggeschossen und andere Dienste, welche sich aus den jeweiligen Notwendigkeiten ergeben werden. Auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmungen wurde dann die noch heute bestehende organische Aufstellung geschaffen, die sich wie folgt darstellen läßt: Es wurden drei große Gruppen (Versailles, Reims und Lyon) gebildet, die ihrerseits wieder in eine Anzahl sogenannter Centren zerfielen und zwar soweit das Flugwesen in Betracht kommt: Versailles: 1 Kompagnie Flieger Detachements in: Douai, Etampes Depots und Ateliers: im Bereiche des Militär-Gouverneurs von Paris, der 1., 2.. 3., 4., 5., 9., 10. und 11. Armeekorps, sowie in Marokko und Tunis Reims: 1 Kompagnie Flieger Detachements in: Verdun, Toul, Epinal, Beifort Depots und Ateliers im Bereiche der 6., 7. und 20. Armeekorps (mit Ausnahme von Amberieu, das der Gruppe Lyon zugeteilt ist) Lyon: 1 Kompagnie Flieger Detachements in: Pau Depots und Ateliers: im Bereiche der 8., 12, 13., 14., 15., 16., 17., 18. und 19. Armeekorps und in Amberieu. Was das praktische Militärflugwesen innerhalb dieses ihm gezeichneten Rahmens vollbracht hat, ist aus den regelmäßigen Berichten, wie sie im „Flugsport" erscheinen, bekannt. Namentlich die großartigen Leistungen im Laufe der letzten Manöver, sowie die ununterbrochenen Erkundungsflug-Uebungen in der Nähe der Ostgrenze haben durch ihre Kühnheit und ihren im allgemeinen lückenlosen Erfolg die Bewunderung der interessierten Kreise hervorgerufen. Und wenn dies trotz der geschilderten erheblichen Organisationsmängel möglich war, so ist das ein neuer Beweis für die sieghafte Kraft des modernen Flugwesens, das, selbst aller Mißwirtschaft und aller beengenden Fesseln zum Trotz, sich mächtig zu entfalten und fortzuentwickeln vermag. Natürlich haben diese Leistungen der Militärflieger, zu denen sich die nahezu täglichen mehr oder minder sensationellen Flüge der Zivilflieger gesellten, den Franzosen das wohltuende Bewußtsein gegeben, daß sie die unbestrittenen Herren der Luft seien, wenigstens was die „Schwerer-als-die-Luft''-Maschinen anbetrifft, und das Wort von der „Suprematie der Luft" wurde für sie zur ständigen Schablone, an der sich das empfängliche Volksbewußtsein geradezu berauschte- Allmählich erst dämmerte es bei ihnen auf, daß „jenseits der Berge auch noch Menschen wohnen" und mit einer unverhohlenen Bestürzung konstatierte man, daß namentlich das deutsche Flugwesen in den letzten Jahren sich in ganz unerwarteter Weise entwickelt hat. Jetzt begann man sich zu beunruhigen und die gesamte Presse gab das Stichwort aus: Wie können wir unsere Suprematie der Luft wieder zurückerlangen? Die Dithyramben der französischen Presse waren verklungen, eine Ernüchterung trat ein und man begann nachzudenken. Während die Franzosen mit andächtiger Verzückung über einen neuen „Rekord", über einen neuen sensationellen Distanzflug oder über irgend eine bedeutende sportliche Flugleistung jubelten, während sie, mit dem Sanguinismus ihrer Rasse, die unentwindbare 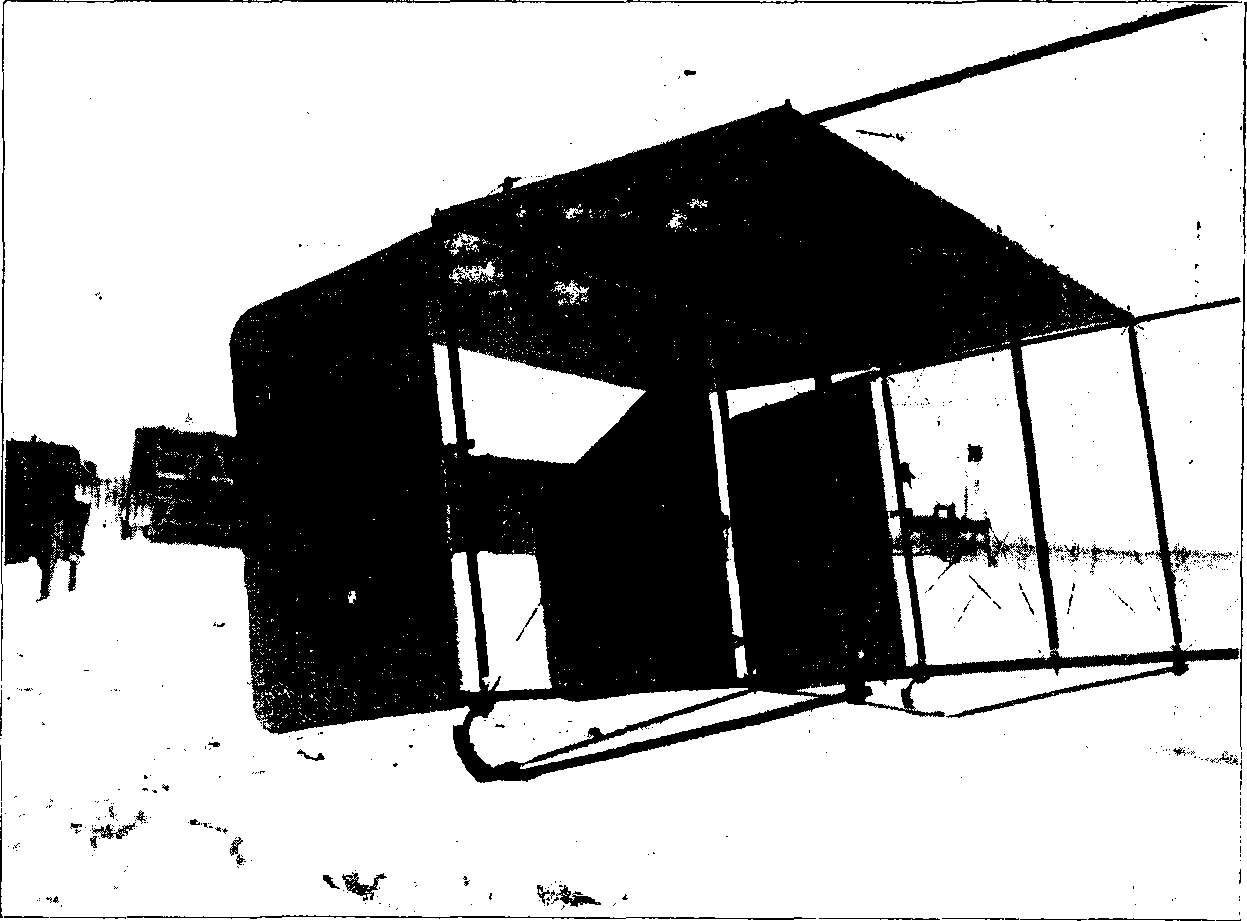 Sdiwanzzelle des Otto-Zweideckers Typ 1913. Hegemonie der Luft für sich reklamierten, arbeitete man in Deutschland mit ruhigem Ernste. Zunächst freilich nahm man die Versuche unserer deutschen Flieger nur mit Spott auf und es ist wiederholt in den „Pariser Briefen" darauf hingewiesen worden, wie eine gewisse Presse in ihrem chauvinistischen Eifer stehende Rubriken für die anfänglichen Mißerfolge des deutschen Flugwesens unter irgend einem geschmacklosen Titel einrichteten und wie sogar die Tragik der beklagenswerten Unfälle nicht den Hohn der Franzosen zu entwaffnen vermochte. Allmählich aber verstummten die spottenden Hinweise auf Deutschland und endlich entschloß mah sich, offen anzuerkennen, daß das deutsche Flugwesen durchaus ernst zu nehmen ist. Nun begannen die vorher erwähnten Anklagen gegen das französische Flugwesen, das sich habe überflügeln lassen und eine der angesehendsten Fachzeitschriften konnte wörtlich sagen : „Wir haben in Frankreich die elende Manie, uns als die Könige der Schöpfung zu betrachten. Andere Völker können Zähigkeit, Ausdauer, methodischen Geist, den Willen zum Siege, kurz alle Tugenden besitzen, die uns fehlen, das tut nichts, wir ersetzen all das einfach durch die blöde Formel: das Genie unserer Erfinder, die Beharrlichkeit unserer Konstrukteure, das Wissen unserer Ingenieure, die Kühnheit und Vermessenheit sind unser! und wie sonst noch die sinnlosen Prahlereien lauten. Was sind wir für armselige Könige der Schöpfung, denn während unser Genie uns die wertvollsten Entdeckungen ermöglicht, so fehlt uns die Ausdauer und die Methode, um die Früchte davon zu ziehen, welche andere durch ihr systematisches Vorgehen mühelos aufsammeln Alle Lobreden auf unser Genie haben nicht verhindert, daß wir vor 42 Jahren eine furchtbare Züchtigung erhalten haben und auch die heutigen überspannten Redensarten von unserer Unerreichbarkeit werden uns vor bitteren Enttäuschungen nicht schützen. Wie wir mit all diesen Redensarten den deutschen Rhein verloren haben, haben wir auch die Suprematie der Luft verloren. Anstatt der stupiden Selbstbeweihräucherung brauchen wir methodische und stille Arbeit, ohne unnützen Tam-Tam. Wir haben keine Minute zu verlieren, nicht um die Suprematie wieder an uns zu bringen, sondern um uns überhaupt nur auf ein gleiches Niveau mit Deutschland zu bringen. Was immer unsere Optimisten auch sagen mögen, unsere Inferioriät gegenüber Deutschland ist heute offenbar. Wir müssen Flugzeuge von bewährten Typen bauen, wir müssen für unsere Flugmaschinen Unterkunftshallen schaffen, wir müssen eine geordnete Organisation einführen und vor allen Dingen irgend eine Autorität schaffen, die für unser Flugwesen in Wirklichkeit verantwortlich und die nicht von allen Seiten durch kleinliche Eifersüchteleien behindert und belästigt wird Man kann sich denken, wie derartige und ähnliche Auslassungen hier die Oeffentlichkeit in Erregung brachten; sie wirkten geradezu wie der Funke im Pulverfaß, bis endlich sich das Parlament mit der Sache zu befassen anfing und nach Mitteln suchte, um den offenbaren Mißständen, welche diese Ernüchterung herbeigeführt haben, abzuhelfen. Man setzte die bereits vorerwähnte parlamentarische Untersuchungs-Kommission ein, welcher der frühere Minister, Cochery, als Präsident, sowie die Abgeordneten Clömentel, dem Berichterstatter der Armeekommission, Painleve, Le Herisse, Joly Benazet, Doussaud und Girot angehören, und welche die Aufgabe hat, sämtliche militärischen Flugcentren und Etablissements zu besuchen und eingehend zu studieren, sowie festzustellen, welche Maßnahmen zu treffen sind, um die bestehenden Mißstände zu beseitigen. Die Kommission ist mit großem Ernst an ihre Aufgabe herangegangen und täglich finden Besichtigungen statt, deren Ergebnisse erst später in einem offiziellen Berichte zusammengefaßt werden sollen. Aber schon jetzt verlautet, daß die inspizierenden Mitglieder der Kommission, obgleich man sicherlich sie nicht allzuviel sehen lassen wird, mancherlei interessante Feststellungen gemacht haben. So äußerte sich dieser Tage der Berichterstatter Clementel, eines der angesehendsten Mitglieder des Parlaments etwa folgendermaßen: „Wir haben unsere Arbeit noch nicht beendet und es lassen sich heute endgiltige Resultate noch nicht geben. Aber nach dem, was wir bis j.etzt gesehen haben, ist im Militärflugwesen bei uns nicht alles so gegangen, wie es wünschenswert wäre. Wir wollen sämtliche bedeutenden Flugcentren, wie Buc, Reims, Verdun, Chälons, Beifort u. s w., aufs eingehendste besichtigen, um uns von den Verhältnissen Rechenschaft zu geben, welche die Patrioten des Landes aufs höchste beunruhigen. Wir wollen alles Geräusch nach außen und alle sensationellen Enthüllungen vermeiden (!), doch werden wir alle erforderlichen Maßnahmen verlangen, um den Mängeln abzuhelfen. So werden wir darauf dringen, daß der administrative Teil der Flugcentren nicht auch Offizierfliegern übertragen, sondern in die Hände von Verwaltungsoffizieren gelegt werde. Man kann eben nicht gleichzeitig fliegen, sich mit technischen Fragen beschäftigen und außerdem noch Verwaltungsangelegenheiten erledigen. Alle Fehler, die wir bisher gesehen haben, beziehen sich nicht auf das Flugwesen an sich, sondern auf die Organisation. Ohne Zweifel, Irrtümer sind begangen worden, Fehler sind gemacht worden und diese Fehler wollen wir der Regierung signalisieren, damit Abhilfe geschaffen wird; aber ein Grund zur Beunruhigung scheint nicht vorzuliegen." Wie wir sehen, wird auch in diesem Falle das so beliebte System der „liebevollen Nachsicht und Bemäntelung" geübt werden, damit die aufgeregte öffentliche Meinung wieder beruhigt und die Opferfreudigkeit des Volkes nicht beeinträchtigt werde. Doch wird es schwierig sein, die öffentliche Meinung welche nun einmal geweckt ist, mit leeren Redensarten einzulullen, zumal man jetzt entschieden mißtrauisch geworden ist. Man hat dem Volke gar zuviel vorerzählt, man hat ihm zu lange eingeredet, wie herrlich und unvergleichlich schön alles sei, als daß es nun, wo die schwersten Mißstände unumwunden zugegeben werden, leichtherzig sich wird überzeugen lassen. Man hat ihm so oft erzählt, wie die französische Armee im Jahre 1910 105 Flugzeuge, im Jahre 1911 deren 160, im Jahre 1912 deren 283 angeschafft habe, so daß das Heer gegenwärtig 548 Flugmaschinen besitzt und man hat zu oft demgegenüber den schwachen Bestand an Flugzeugen in der deutschen Armee vor Augen geführt. Jetzt verlangt man gründliche Reformen, damit das französische Flugwesen wieder an die Spitze trete. Natürlich sehen vor allem die direkt interessierten Kreise dem Ergebnis der Enquete und den von der Untersuchungskommission vorzuschlagenden Maßnahmen mit besonderer Spannung entgegen. Was in diesen Kreisen von der Kommission erwartet wird, läßt sich kürz in folgende Thesen zusammenfassen.c.: Was man von der Kommission erwartet. 1. Notwendigkeit, das ganze Flugwesen zu militarisieren, um so aus dem Flugwesen eine wirkliche Waffe zu machen. Zu diesem Zwecke sollen alle diejenigen, welche dieser Waffe zugeteilt sind, bei ihr ihren ganzen Dienst durchmachen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, eine Rekrutierung für das Flugwesen zu organisieren, genau wie für andere Waffen, für Infanterie, Kavallerie, Artillerie oder Genie. Die kapitulierenden Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften sollen beim Flugwesen eine Karriere vor sich haben. Die entlassenen Offiziere und Mannschaften sollen periodisch ihre Uebungen bei dieser Waffe auszuführen haben. Absolutes Aufgeben der absurden Idee, daß die Flieger aus allen anderen Waffen zusammengesucht und nachdem sie eine Zeitlang im Flugwesen gedient, wieder zu ihrem Truppenteil zurückgeschickt werden. 2. Absolute Trennung zwischen den Flugcentren und den Fliegerschulen. Es soll zu diesem Zwecke eine gesonderte praktische Schule eingerichtet werden, mit Lehrern, Instrukteuren,[Laboratorien, Kursen, Vorträgen, Eintritts- und Abgangsprüfungen und mit einem Klassement, welches auf den Resultate dieser Prüfungen basiert ist. 3. Notwendigkeit, in Fri e den s z e i t en vollkommen ausgerüstete große Centren zu haben, von denen aus die Kampf-Einheiten während einer mehr oder minder langen Zeit ihre Flüge unternehmen, zu den Manövern gehen oder im Falle der Mobilisierung in vollständiger Ausrüstung den Dienst aufnehmen können. Diese Centren sollen alle erforderlichen Einrichtungen aufweisen, permanente betonnierte Fliegerhallen, mit Zentralheizung, elektrischer Beleuchtung, umfangreichen Ateliers, Spezialtechniker für alle Gebiete, Bureaus, Kasernements u. s. w., das Ganze völlig isoliert und vor jedem Spionageversuch genügend geschützt. 4. Notwendigkeit einer Organisation der Mobilisierung, Staffelmäßige Anlage mit Fliegerparks, mit Verproviantierungsmöglichkeit im Rücken, mit Verdopplung der Reserveeinheiten, mit Magazinen für Kriegs-Flugzeuge, ständig in bestem Zustande gehalten. Periodische Mobilisierungsversuche. 5. Strenge Reglementierung des inneren und des Felddienstes. Genaue Bestimmungen über die Aufrechterhaltung der Verbindung mit den anderen Truppengattungen und Uber die Art der Verwendung für Flugzeuge. Unbedingte Vorschrift, nur auf Befehl oder gemäß dem Dienst-Tableau zu fliegen. Anzahl und Verwendung der Bedienungsmannschaften. Reglement für den Felddienst. Die Beziehungen des Fliegerkorps mit den anderen Waffen in jedem einzelnen Falle. Genau bestimmte Instanzenfolge. 6. Notwendigkeit, um Leute von Beruf zur Verfügung zu haben, den im Flugwesen dienenden Offizieren und Mannschaften Vorteile mit Bezug auf Besoldung, auf Avancement und Auszeichnungen zu gewähren. Formation von Einheiten, die von einem Hauptmann befehligt werden, von Gruppen unter dem Befehl von Eskadronchefs, von Regimentern unter dem Befehl von Obersten und von Brigade- und Divisionsgruppen, von Generälen befehligt. Starkes Verhältnis zu gunsten der höheren Offiziersgrade,).zwecks Förderung*deslAvancements. Die Chefs müssen praktische Flieger sein. 7 Ueb=ertr agu ng der Organisation an Flieger, ebenso wie die Abschlüsse, die Bestellungen, die Ueberwachnng der Konstruktion und die Abnahme von Flugzeugen nur durch praktische Flieger erfolgen'soll. S. Klassifizierung der Flugzeuge in Schul-, Uebungs- und Kriegs-Flugzeuge.' j Studium deriAngriifs-Organisation gegen Lenkballons, gegen andere Flugzeuge, gegen Fußtruppen gegen Anlagen, Brücken, Schienenwege, Flieger-liullen, Depots und Festungen. Studium der Verteidigurigs-Organisation,-Panzerung Unsichtbarmachung, Verhütung von Geräusch u. s. w. 9. Studien üb e.r Na c ht f I üg e , über vereinigtc^Luftmanöver, über den Nachrichtenverkehr sowohl zwischen den Flugzeugen und der Erde, als auch zwischen den Flugzeugen untereinander. Die wichtigste Frage aber für den Augenblick scheint nach Ansicht der hiesigen beteiligten Kreise die Frage der Formation von Fliegerreserven zu sein. Die Ligue Nationale Aerienne hat vor kurzem eine anerkannte Autorität, den Dr. Julliot aufgefordert, ein Gutachten über die Formation äronautischer Reserven auszuarbeiten, und die von Julliot zu diesem Problem beigebrachten Gedanken entbehren gewiß nicht des allgemeinen Interesses. Es heißt in dem Gutachten u. a.: „Die ersten Tage eines Krieges werden ohne Zweifel einen erbarmungslosen Kampf zwischen den beiderseitigen Luftflotten bringen, von denen jede um die Meisterschaft der Luft kämpfen wird. Eine der Flotten wird völlig aufgerieben werden können, doch die andere wird diesen Sieg nicht ohne beträchtliche Opfer errungen haben. Man wird deshalb unbedingt damit zu rechnen haben, daß zu Beginn der Feindseligkeiten schon die Luftgeschwader, über die eine Nation verfügt, in erheblichem Maße zusammenschmelzen werden. Abgesehen von den durch den Feind außer Kampf gesetzten Einheiten, wird man mit den infolge der normalen Defekte verursachten Verlusten zu rechnen haben. Indem sich der strategische Dienst der Fluggeschwader oberhalb feindlichen Territoriums vollziehen wird, wird schon der geringste mechanische Defekt hinreichen, die Gefangennahme des Fliegers und den Verlust des Flugzeugs herbeizuführen. Hinter der Luftflotte erster Linie, aus aktiven Elementen zusammengesetzt, wird man deshalb eine Reserveflotte benötigen, bereit, erstere zu ersetzen. Gerade auf diese Bereitschaft ist der wichtigste Accent zu legen. Denn während man immer Offiziere finden wird, um die Flugzeuge als Beobachter zu begleiten, sind die Zivilpiloten und ihre Apparate naturgemäß für einen unvorhergesehenen Appell nicht immer bereit. Aber auch die Flotte zweiter Linie bedarf einer ergänzenden Organisation. Es müssen die Verbindungen von einer Armee zur anderen, von Armeekorps zu Armeekorps, von D.vision zu Division vorgesehen werden. Auch mit isolierten Einheilen, mit belagerten Städten muß die Verbindung aufrecht erhalten werden. Wie können diese Verbindungen gesichert werden? Neben der Kavallerie rechnet man auf den Telegraphen, dessen Zerstörung natürlich das erste Ziel des Feindes sein wird. Die Verwendung der drahtlosen Telegraphie erscheint für diese Zwecke noch mehr als problematisch. Was Not tut, ist eine beträchtliche Anzahl von Luft-Depeschenträgern, den rapideslen Estafetten der Welt. Unabhängig von dem Aufklärungsditnste, von der Aufstellung von Kampf-Einheiten, von der Uebermittlung von Befehlen und Informationen, werden andere Erfordernisse im Rücken der Armeen sich ergeben, denn die Fortbewegung der gewaltigen Massen wird eine der wesentlichsten Schwierigkeiten künftiger Feldzüge sein. Die Flieger erscheinen auch hier als das einzige Heil, sie werden die Entwirrung der sich voranbewegenden Massen bedeutend erleichtern. Für alle diese angeführten Nutzzwecke wird man nicht über einen einzigen Flieger verfügen, nicht über einen einzigen Apparat, denn der Frontdienst wird alles in Anspruch genommen haben und für ihn werden die verfügbaren Einheiten nicht einmal genügen. Es ist deshalb eine unbestreitbare Notwendigkeit, entweder eine drei- oder vierfach so große Luftflotte zu haben, wie wir besitzen, oder aber eine Reserve-Flotte zu organisieren. Wir brauchen die Requisitionsmöglichkeit von Flugzeugen und wir brauchen Leute, die imstande sind, die requirierten Maschinen zu besteigen. Erwünscht wären dazu Leute, die ebenso instruiert sind, wie die Militärflieger und Apparate von der gleichen Güte wie die Militärflugzeuge. Ist es möglich sich Zivilflieger zu sichern, welche die gleiche Befähigung besitzen, wie die Militärflieger? Das ist zu hoffen, denn das Flugwesen war erst zivil, bevor es militärisch geworden ist. Die Frage dreht sich nur um die Anzahl und dieses Problem ist von einer Schwierigkeit, welche zu den energischsten Maßnahmen berechtigt. Was wird man von den betreffenden Fliegern verlangen ? Zunächst daß sie ihre Lehrzeit selbst und auf ihre eigenen Kosten durchmachen, bevor sie bei Militär eintreten; daß sie, wenn sie entlassen sind, eine bestimmte Reihe von Jahren fortfahren, das Flugwesen zu üben, immer auf ihre eigenen Kosten, und in einer fast ebenso intensiven Weise, wie die Militärflieger. Man wird von ihnen verlangen, daß sie bei jeder Witterung Flüge von 300 bis 400 km in 1200 Meter Höhe ausführen. Ein derartiges Resultat verlangt natürlich Arbeit, Ausdauer und ein Kapital. Aber all das wird man von den Zivilfliegern erreichen können, unter einer Bedingung freilich: daß man sie bezahlt. Die ökonomische und wirksamste Form hierfür wäre, daß man die Dauer ihres aktiven Dienstes herabsetzt. Das ist auch durchaus gerechtfertigt, denn man wird den Dienst, den der Infanterist oder der Kavallerist tut, so anstrengend jener auch sein mag, nicht in Vergleich ziehen können mit dem Kampf gegen die Elemente, welcher die Flieger täglich zwingt, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Der Fliegerdienst im Frieden muß als ebenso gefährlich angesehen werden, wie der Felddienst vor dem Feinde. Die Fliegerdienstjahre müßten deshalb ebenso wie die Feldzugsjahre doppelt zählen. Abgesehen von dieser 'Diensterleichterung müßten die Flieger auch eine gewisse Pension haben. Ein Militärflieger kostet jedes Jahr ziemlich viel. Andererseits würden einige kleine Zubilligungen an die Zivilflieger während ihres aktiven Dienstes, während ihrer Reserveübungen und später in Form einer Pension, für das Heeresbudget nur eine geringe Belastung ausmachen, während dadurch die wesentlichsten Resultate erreicht werden würden. Das gleiche gilt für die Flugzeuge. Wollte der Staat die Reserveflugzeuge selbst in Depot nehmen, so würde er dafür Unsummen aufzuwenden haben, und zwar für Ankauf, Unterbringung und Unterhaltung des gewaltigen Materials. Man sollte lieber die Konstruktion fördern und die einmal hergestellten Apparate im Bedarfsfalle requirieren. Dazu wären Prämien an die Konstrukteure nötig, wie das heute schon für die Automobil- Schwergewichte üblich ist" 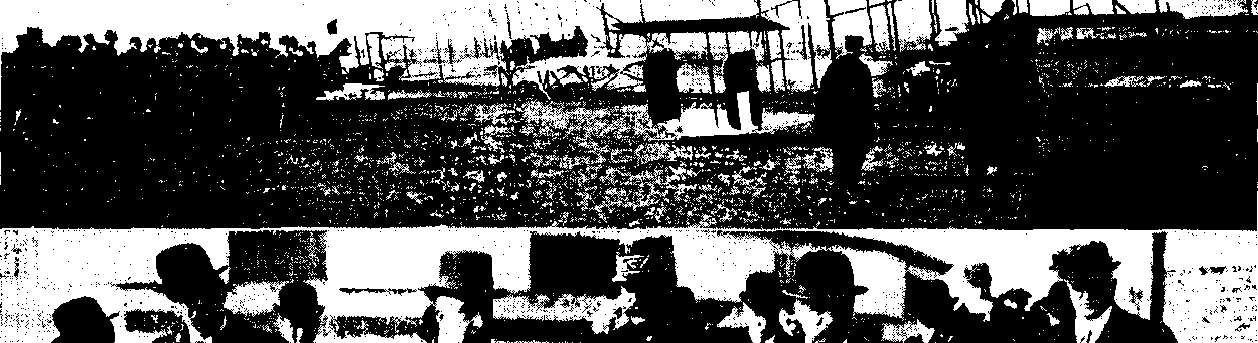 Was geht in Frankreich vor? Oben: Die zu besichtigenden Maschinen in Parade-Aufstellung. Unten: Besichtigung der Flugstation Saint Cyr durch die Kommission anter Führung des Generals Hirschauer Noch andere mehr oder weniger kompetente Stellen und Personen haben sich zu dieser Frage geäußert, die hier jetzt allenthalben mit großer Lebhaftigkeit diskutiert und als für die zukünftige Gestaltung des Militärflugwesens, sowie des gesamten Flugwesens überhaupt, außerordentlich wichtig angesehen wird. Die Flieger verlangen einfach, daß man ein Geschwader freiwilliger Zivilflieger formieren und diesen Fliegern pekuniär beistehen soll. Ein Parlamentarier hat sogar, nachdem er sich mit einigen bekannteren Zivilfliegern ins Einvernehmen gesetzt hat, einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, den er der Kammer unterbreiten will. Darnach sollen die freiwilligen Flieger während einer Periode von 30 Tagen (in einem oder in zwei Malen) pro Jahr eingezogen und mit einer Entschädigung von 3000 Francs abgefunden werden. Natürlich müssen sie diplomierte Flieger sein. Während der Uebungsperioden gehen sämtliche Kosten für Mechaniker, Reparaturen u. s. w. zu Lasten des Staates Für diese Lösung des Problems sind einige bekannte Flieger, wie Leblanc, Chambenois u. s. w. eifrig tätig. In diesen Kreisen erhebt man übrigens den nicht unberechtigten Vorwurf, daß in die Enquete-Kommission nicht einige erfahrene praktische Flieger hineingenommen worden sind, deren Kenntnis der einschlägigen Materie den Herren von der Untersuchungskommission, die im Grunde vom Flugwesen wohl nur eine nebelhafte Vorstellung haben, wohl sehr zugute gekommen wären. Wie schon gesagt, man wird den Herren einigelhübsch auflackierte Flugzeuge vorführen, die Sappeure werden in tadellosem Anzüge mit „blankgeputzten Knöpfen" neben den Maschinen ausgerichtet, aufgestellt sein und.....alles wird in schönster Vollkommenheit sein. Sicher ist, daß jene Herren nur das sehen werden, was man ihnen zeigen will. Anders wäre es gewesen, wenn einige Flieger die Kommission begleitet hätten; die hätten es verstanden, ein wenig „in die Ecken zu sehen." Eine Lehre für uns. Wir setzen als sicher voraus, daß die Ausführungen, welche wir unserer vorstehenden Besprechung zu Grunde gelegt haben, von unseren Lesern und von allen Interessenten in der richtigen, in der einzig richtigen Weise verstanden werden. Zweierlei Zwecke haben wir damit verfolgt: Indem wir in eingehender Weise auf die Mißstände in Frankreich hingewiesen haben, wollten wir vor allen Dingen die mannigfachen Fehler zeigen, die schließlich zu den unbefriedigenden Zuständen geführt haben. Wir wollten, daß gewisse Stellen in Deutschland sich in dem Spiegelbilde, das wir gegeben haben, wieder erkennen. Denn nach dem, was man sich hier am Stammtisch der Flieger erzählt, und nach gewissen Gerüchten, die sogar aus Deutschland selbst hierher gelangen, wird es dort um das Flugwesen nicht viel besser bestellt sein. Keineswegs werden wir die Schilderungen der französischen Verhältnisse mit der Genugtuung desjenigen lesen können, der sagen kann : „Bei uns ist es denn doch anders!" Es muß berücksichtigt werden, daß in Frankreich, infolge der eigenartigen Struktur des staatlichen Gebäudes, derartige Dinge viel leichter ans Tageslicht zu ziehen sind, wie in anderen Staaten. Zu einer Ueberhebung liegt wahrscheinlich kein Anlaß vor; vielmehr sollte man einmal daran gehen, die deutschen Flugplätze auf ähnliche Dinge hin eingehend zu untersuchen und vorurteilsfreie Feststellungen vorzunehmen. Denn trotz einiger anerkennenswerter Leistungen, die indessen einen Maßstab für die allgemeine Beurteilung nicht geben können, geht die übereinstimmende Ansicht aller Fachkreise dahin, daß das Flugwesen auch in Deutschland noch sehr der Entwicklung und des systematischen Ausbaus bedarf. Und dann darf doch nicht übersehen werden, daß alle inrede-stehenden Mängel lediglich verfehlte organisatorische und administrative Einrichtungen betreffen, durch welche der aktuelle Wert des französischen Militärflugwesens nicht in wesentlichem Maße berührt wird. Wir haben gesehen, was das französische Flugwesen zu leisten vermag und wir werden in Deutschland noch viel zu arbeiten, noch viele Anstrengungen zu machen, noch viele Opfer zu bringen haben, ehe wir unser Flugwesen auf diese Höhe bringen werden. Sehen wir uns nur an, was die französischen Militärflieger im Laufe des Jahres 1912 geleistet haben : I. Grunpe (Versailles): Anzahl der Flüge: 844; durchflogene Kilometer: 330.000; Dauer der Flüge: 3.872 Stunden; Anzahl der in Dienst befindlichen Flugzeuge: 134; Anzahl der PS: 7.820. II. Gruppe (Reims: Anzahlj der Flüge: 1.119; durchflogene Kilometer 124.903; Dauer der Flüge: 1.533 Stunden; Anzahl der in Dienst befindliehen Flugzeuge: 110: Anzahl der PS: 5.740. III. Gruppe (Lyon): Anzahl der Flüge: 434; durchflogene Kilometer: 50.600; Dauer der Flüge: 589 Stunden; Anzahl der in Dienst befindlichen Flugzeuge 47; Anzahl der PS: 2.650. Insgesamt also: Anzahl der Flüge: 2.387; durchflogene Kilometer 505.503; Dauer der Flüge: 5994 Stunden; Anzahl der in Dienst befindlichen Flugzeuge: 291 ; Anzahl der PS: 16.210. Und um den heutigen Wert des französischen Militärflugwesens zu illustrieren, sei noch angeführt, daß die Militärflieger während der letzten Manöver Rekognoszierungs- und Konzentrationsflüge von insgesamt 56 000 Kilometer ausgeführt haben! Das sind Zahlen, die deutlicher als Worte uns zeigen, was wir noch zu tun haben. Nicht zum selbst befriedigten Stillstehen, sondern im Gegenteil zu immer intensiverer und energischerer Arbeit sollten also unsere Ausführungen anregen. Umsomehr, als gerade die Aufdeckung der Mißstände in das französische Militär-Flugwesen einen neuen kräftigen Impuls ge tragen hat, dessen Wirkungen sicher nicht ausbleiben werden. Man wird auch hier mit noch erhöhtem Eifer arbeiten, man wird die Schäden ausbessern, man wird hierund da Erweiterungen vornehmen und das Militärflugwesen wird aus der organisatorischen Krisis ohne Zweifel gestärkt und gefestigt hervorgehen Wir wissen, wie das Marineministerium in Frankreich mit bewundernswertem Eifer daran ist, das Wasserflugzeug für die Marine dienstbar zu machen und wie zahlreiche Marine-Flugstationen installiert werden, von denen später im Zusammenhange berichtet werden wird. So haben also die Franzosen es verstanden, die vorübergehende Krisis zu ihrem Vorteil zu nutzen. Mögen die führenden Kreise im deutschen Flugwesen daraus Veranlassung nehmen, die Verhältnisse aufs genaueste zu prüfen und dort, wo es nötig ist, den Hebel kräftig anzusetzen. Wir müssen alles versuchen, unter sorgfältiger Vermeidung der in Frankreich begangenen Fehler, unser Flugwesen auf die Höhe des französischen zu bringen. Rl. 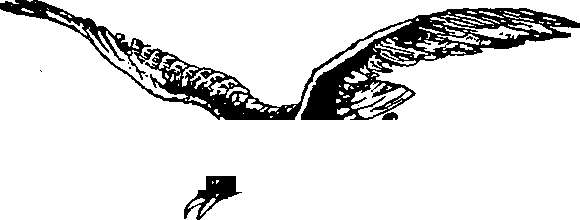 Flugtechnische Z^F-' Rundschau. Inland. Flugflihrer-Zeugnisse haben erhalten: No. 3ö2. Paschen, Wolfram, Halberstadt, geb. zu Kaliß ii: Mecklenburg am 3. November 1886, für Zweidecker (Deutsche Bristol-Warke), Flugplatz Halberstadt, am 17. Februar 1913. No. 363. Diedrichs, Heinrich, Mülhausen i. Eis., geb. zu Mülhausen am 17. Januar 1894, für Eindecker (Aviatik), Flugfeld Habsheim, am 17. Febr. 1913. No. 364. Schroeder, Reinhard, Mainz-Gonzenheim, Fa Goedecker, geb. zu Gmunden am 21. Dezember 1880, für Eindecker (Goedecker) Flugplatz Großer Sand, am 20. Februar 1913. Von den Flugplätzen. Vom Flugplatz Puchheim. Auf dem von den Flugmaschinenwerken Gustav Otto geppchteten Flugplatz Puchheim herrschte in der letzten Zeit wieder reger Flugbetrieb. Am Mittwoch den 12. März unternahmen Lindpaintner und Schöner auf ihren Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argus mehrere kleinere Ueberlandflüge, wobei die Orte Bergkirchen, Roggenstein, Gröbenzell in beträchtlicher Höhe überflogen wurden. Als Schöner in einer Höhe von ungefähr 700 m Höhe über Gröbenzell kreuzte, setzte wegen mangelhafter Benzinzufuhr plötzlich der Motor aus; Schöner jedoch brachte den Apparat in tadellosem Gleitflug zur Erde, wo trotz des außeiordentlich schlechten Terrains die Landung glatt erfolgte. Am Freitag den 14. März flogen Lindpaintner und Schöner über Aubing-Pasing nach Nymphenburg und von hier über Lochhausen zurück nach Puchheim, wo sie nach einer Flugdauer von 45 Minuten aus 800 m Höhe im Gleitfluge landeten. Von den Kondor-Flugzeugwerken. In der ersten Hälfte des März machte Suwelack auf seinem Kondor eine große Anzahl Flüge und zwar größtenteils mit Passagier. Am Mittwoch den 5. März besuchte eine Anzahl Studenten der Universität Leipzig, die sich auf einer Studienreise durch das Industriegebiet befanden, die Kondorwerke. Die Einrichtungen des Werkes, sowie die Apparate wurden den Studenten durch Suwelack gezeigt, und eingehend erläutert. Unter der großen Anzahl Flüge, die Suwelack in der Berichtszeit machte, sind besonders diejenigen vom 13. bemerkenswert. Bei ungemein starkem Wind machte Suwelack fünf Flüge, wobei er eine Höhe von 800 m erreichte und den Flugplatz mehrere Male umkreiste. /Militärische Flüge. Von der Darmstädter Fliegerstation flogen anläßlich der Besichtigung der Eulerwerke durch den General-Inspekteur des Militär-Luft- und Kraftfahrwesens Generalmajor von Haenisch am 12. März die Lts. von Mirbach, Sommer und Reinhard mit Passagieren nach dem Euler-Flugplatz, um sich zu melden. Am Abend kehrten die Lts. von Mirbach und Sommer mit Fluggästen wieder nach Darmstadt zurück. Lt. von Mirbach dehnte seinen Flug nach Darmstadt Uber Wiesbaden-Biebrich und Mainz aus und blieb über eine Stunde in der Luft; er hat damit als erster Offiziersflieger die Bedingungen erfüllt, die an den Ehrenpreis der Nationalflugspende für einen Ueberlandflug mit Passagier geknüpft sind. Lt. Reinhard flog am nächsten Tage nach Darmstadt zurück. Fernflug München-Wien. In der letzten Woche führte der Flieger der Flugmaschinenwerke Gustav Otto, Robert Janisch einen bemerkenswerten Ueberlandflug aus, dessen Endziel die österreichische Hauptstadt Wien werden sollte. Janisch stieg am Donnerstag den 6. März morgens 7 Uhr auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor in Puchheim auf, und verließ alsbald in etwa 800 m Höhe das Flugfeld. Bei Müsldorf sah sich der Flieger durch ein herannahendes Gewitter, von dem er in 1500 m Höhe heftige Böen erhielt, zu einer Zwischenlandung gezwungen, setzte aber bald seinen Weg wieder fort. Ein Defekt am Motor zwang ihn zu einer Notlandung bei Grieskirchen in der Nähe von Linz, nachdem er über die Hälfte der Strecke glatt zurückgelegt hatte. Nachdem der Schaden repariert worden war, stieg Janisch am folgenden Tage bei heftigem Winde wieder auf, mußte jedoch infolge Nebels noch zwei Zwischenlandungen bei Klosterneuburg und St. Pölten vornehmen und landete am folgenden 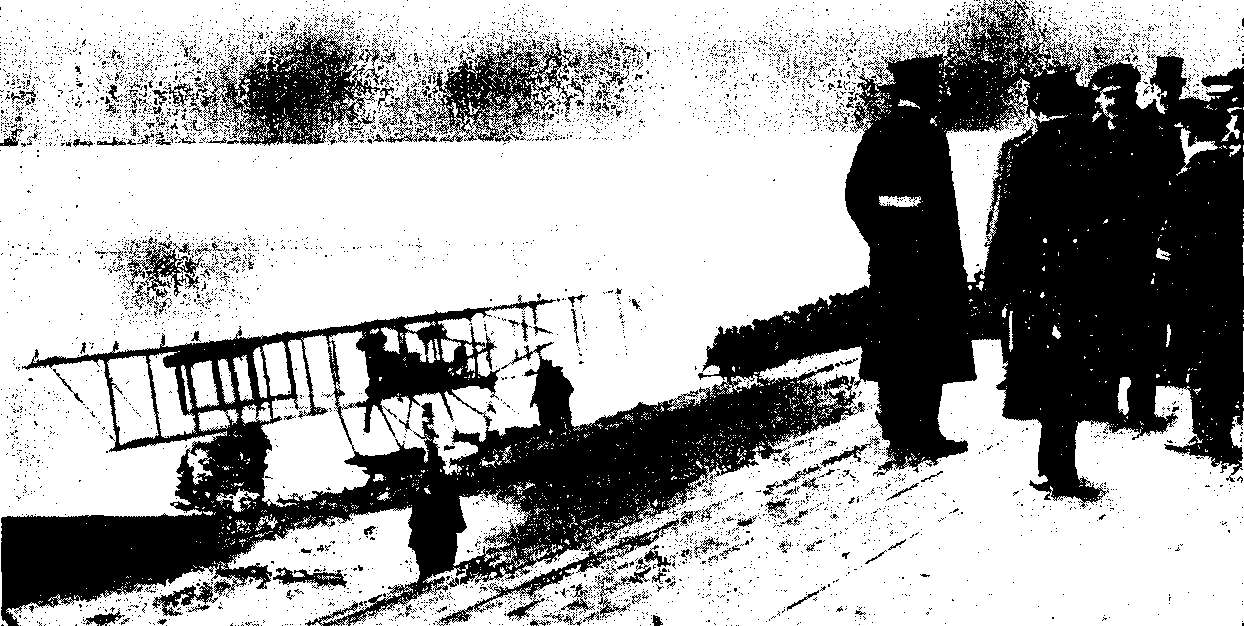 Besichtigung der Marineflugstation durch den K^aiser. (S. den Bericht in Nr. 5 Seite 178) Tage bei etwa 12 m Wind glatt auf dem Flugfelde Aspern bei Wien. Die etwa 450 km lange Strecke München-Wien wurde von dem Flieger in einer reinen Flugzeit von 3 Stunden 45 Min. zurückgelegt, was einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 120 km pro Stunde entspricht. Der von Janisch benutzte Otto-Doppeldecker ist der bewährte Typ, wie er auch von der bayr. Herresverwaltung angekauft wurde. Er ist mit einem 100 PS Argus-Motor ausgerüstet, besitzt ein Stahl-Schutzboot für Führer und Passagier und ist mit allen notwendigen Instrumenten wie Höhenmesser, Chronometer, Kartenrollapparat etc. ausgestattet. Ausland. Die Wasserflugmaschine Icar£ von Voisin, gesteuert von Colli ex, hat vor einigen Tagen wiederholt sehr gute Flüge ausgeführt. Die Maschine wurde bereits in No. 3 auf Tafel IV, (Jahrgang 1913) ausführlich beschrieben. Um die Tragfähigkeit zu erhöhen, hat man das untere Deck entsprechend dem oberen verbreitert. Flugpreise. Einen Flugpreis von 5000 Mark hat die bekannte Zigarettenfirma Manoli dem Flugplatz Johannisthal für die Mai-Flugwoche zur Verfügung gestellt und die Festsetzung der Bedingungen dem Organisations-Ausschuß überlassen. Patentwesen. Patentanmeldungen. 77h. G. 34 412. Flugzeug mit übereinander liegenden durch Gelenkstangen miteinander verbundenen Tragflächen. Ambroise Goupy, Paris; Vertr. : Dipl.-lng. H. Caminer, Pat. Anw., Berlin SW. 68. 11. 5. 11. 77h. W. 36045. Sichelartig nach hinten spitz auslaufende, an der Vorderkante ohne Einbuchtung verlaufende Tragfläche für Flugzeuge. Alois Wolfmüller, Berlin, Brückenallee 30. 12. 11. 10. 77h. S. 37 644. Abgefedertes Laufrad, insbesondere für Flugzeuge. Societe Anonyme des Aeroplanes Robert Savary, Paris; Vertr.: Dipl.-lng. B. Wassermann, Pat.-Anw., Berlin SW 68 19. 11. 12. 77h. W. 38 218. Flugzeug, dessen Tragflächen um eine senkrecht zur Flugrichtung liegende Achse geschwenkt werden können. John Washington Wilson, Boston, V. St. A.; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat-Anw., Leipzig. 21. 12. 09. 7?h. H. 59 635. Aus einzelnen Flügeln bestehender Propeller, insbesondere für Flugzeuge, bei welchen Drähte o. dgl. zur Erhöhung der Festigkeit verwendet sind. Hellmuth Hirth, Berlin, Bunsenstr. 11. 11. 12. 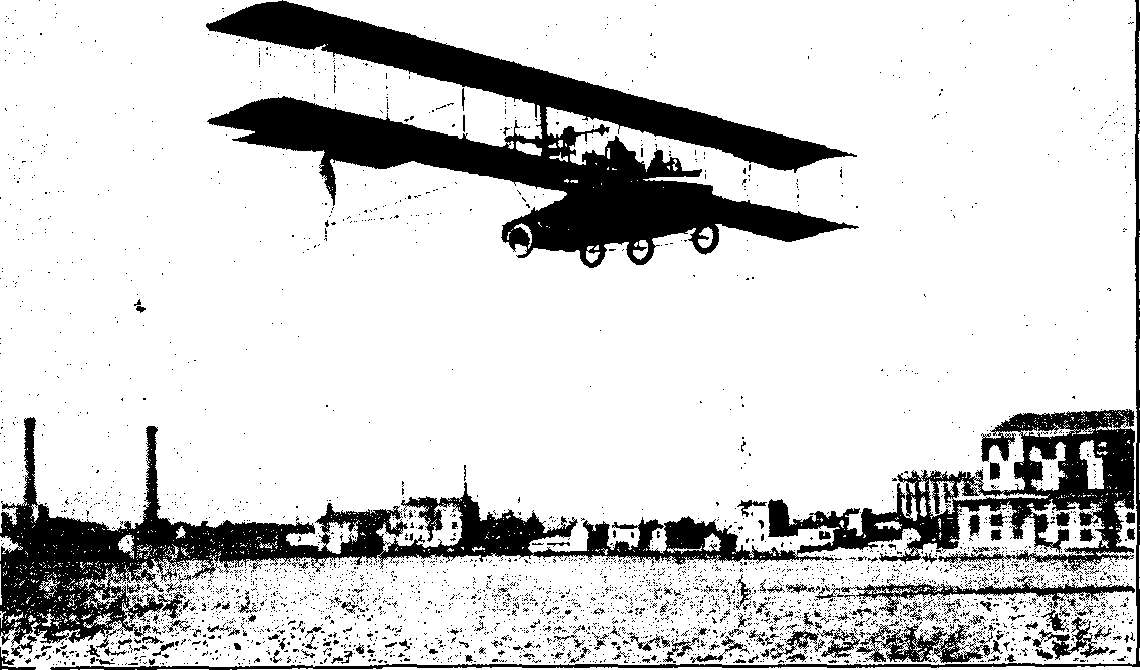 Wasserjlagmasdiine Icare von Voisin. Patenterteilungen. 77h. 257 596. Fahrbare Haltevorrichtung für Luftfahrzeuge, Albert Langen-siepen. Elberfeld, Wülfingstr. 30. 18.6.11. L 32 573. 77h. 557 631 Flugzeug mit Ausbiegungen in den hinteren Tragflächenteilen. Josef Miksch, Charlottenburg, Danckelmannstr, 45. 23. 6. 10. M. 41 629. 77h. 257 801. Strebenbefestigung für Flugzeuge. Siemens-Schuckcrt Werke G m. b. H., Berlin. 4. 2. 11. S. 33 145. Lösbare Befestigung für Schraubenflügel auf ihrer Nabe.*)]^ Die Erfindung bezieht sich auf eine lösbare Verbindung der Schraubenflügel mit ihrer Nabe, welche beim Bruch eines Flügels den Ersatz desselben, die Einstellung des Gleichgewichts und der Neigung und eine rasche Betriebsfertigstellung auf eine bequeme Weise gestattet. Das Wesen der Flügelbefestigung besteht im wesentlichen darin, daß der mit Hohlkehlen versehene Fuß des Flügels mit einer geschlitzten ringförmigen Hülse in Eingriff tritt, wobei durch an beiden Teilen vorgesehene Vorsprünge eine Art Baionettbefestigung entsteht.; Die Hülse paßt in eine geschlitzte, mit der Nabe aus einem Stück bestehende Büchse. Auf die Nabenbüchse wird noch eine Hülse geschraubt, welche Kegelflächen besitzt, die auf entsprechende Flächen der federnden Naben-büchse treffen und sehr festes Anpressen der Nabenbüchse an die Hülse bewirken, in der der Fuß des Flügels sitzt. Abb. 2 Abb 4 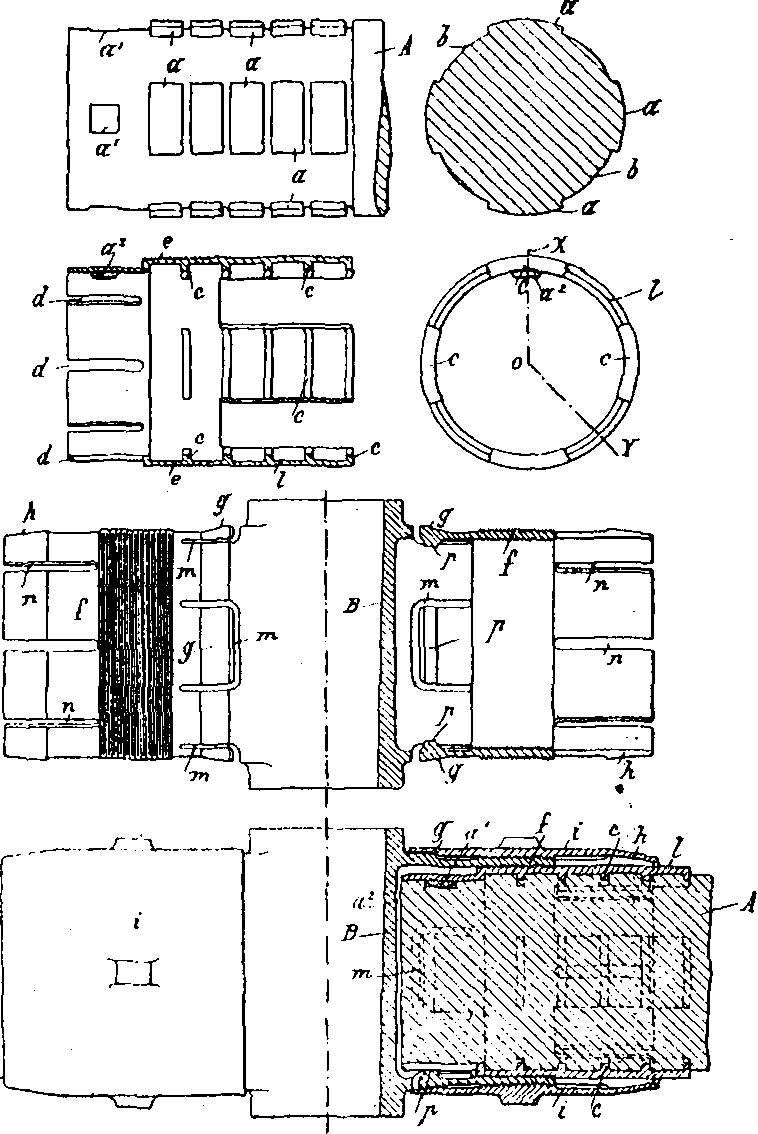 Abb. 1 Abb. 3 Abb. 5 Abb. 6 * Die Zeichnung veranschaulicht die Erfindung an einem Ausfuhrungsbeispiel. Abb. 1 zeigt den mit Hohlkehlen versehenen Fuß des Flügels im Schnitt, Abb. 2 zeigt den Flügel in Ansicht, Abb. 3 die Seitenansicht der mit Gewinde versehenen ringförmigen Hülse zur Aufnahme des Flügels. Abb 4 zeigt die Hülse im Schnitt. Abb. 5 stellt im Aufrisse die teilweise geschnittene Nabe dar. Abb 6 zeigt teils in Ansicht, teils im Schnitt nach der Linie X-O-Y der Abb. 3 die Zusammensetzung des Flügels mit seiner Hülse und die Verbindung mit der Nabe durch die auf die Nabenbüchse aufgeschraubte Hülse. Die Flügel A sind am Fuß (Abb. 1 und 2) mit 5 Reihen von Vorsprüngen oder Nocken a versehen. Diese Reihen von Vorsprängen a am Umfang des *) D. R. P. 255845 Lucien Chauviere in Paris. Flügelfußes lassen entsprechende Zwischenräume frei, und die Vorsprünge a jeder Reihe lassen unter sich Zwischenräume b frei von einer Größe, welche mindestens ihrer Breite entspricht. Ferner sind 4 Aussparungen a' auf dem abgesetzten Teil des Flügelfußes angeordnet. Die Vorsprünge a passen in die Ringhülse 1, welche fünf Reihen von Leisten besitzt, die auf mindestens die Breite der Vorsprünge a des Flügelfusses unterbrochen sind. Wenn nun der Fuß des Flügels in achsialer Richtung in die Hülse 1 geschoben wird, bis er anstößt, wobei die Vorsprünge a des Flügels zwischen die Vorsprünge c der Innenseite der Büchse gepaßt werden müssen, wird der Flügel um eine Vierteldrehung gedreht, um seine Vorsprünge a zwischen die Vorsprünge x der Innenseite der Hülse 1 zu bringen. Die der zur Einführung des Flügels bestimmte Seite, entgegengesetzte Seite der Hülse 1 besitzt einen verengten Teil, welcher mit Schlitzen d und einer Nase a2 versehen ist. Das Ende des Flügels ist entsprechend verjüngt, damit es in diesen engeren Teil eintreten kann und die Nase a2 in eine der vier Aussparungen a1 paßt Die Hülse ist außen im mittleren Teil bei e mit Gewinde versehen. Mit diesem Gewinde kann sie in das lnnnengewinde der mit der Nabe B aus einem Stück bestehenden Büchse f eingeschraubt werden. Die Büchse f ist in der Mitte nach außen mit Gewinde versehen. Zu beiden Seiten dieses mit Gewinde versehenen Teils sind Einschnitte bezw. Schlitze m und n angebracht, welche diese beiden Teile der Büchse f federnd machen. Ferner sind Kegelflächen g und h auf der Büchse f vorgesehen. Im Innern der Büchse f befinden sich Vorsprünge p, die sich infolge der Federung der Teile g fest an die federnde, den Fuß des Flügels umschließende Hülse 1 anlegen, wenn die Außenhülse i auf die Nabenbüchse f aufgeschraubt wird. Die Klemmhülse i ist in der Mitte mit Innengewinde versehen. Sie besitzt ferner auf beiden Seiten innen Kegelflächen, die mit den entsprechenden äußeren Kegel-flächen g und h der federnden Büchse f in Berührung treten. Wenn die Hülse i fest angezogen wird, stellt sie eine feste Verbindung zwischen der elastischen Nabenbüchse und den beiden Enden der den Flügelfuß festhaltenden Hülse 1 vor. Die Vorsprünge p pressen sich unter der Wirkung des kegelförmigen Teiles fest gegen die Hülse I, so daß eine sehr widerstandsfähige Befestigung erzielt wird. Um die Einstellung des Gleichgewichts und der Neigung eines Flügels zu bewirken, wird der mit seiner Hülse versehene Flügel mehr oder minder in die elastische Nabenbüchse eingeschraubt, nachdem vorher die Befestigungshülse vorübergehend etwas gelockert wurde, so daß sie nach beendigter Einstellung nur wieder angezogen zu werden braucht. Um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen, genügt es, die Befestigungshülse etwas mehr anzuziehen. Patent-Ansprüche: 1. Lösbare Befestigung für Schraubenflügel auf ihrer Nabe, dadurch gekennzeichnet, daß der mit Vorsprüngen versehene Flügelfuß in eine mit inneren Vorsprüngen versehene Hülse eingesetzt und durch Teildrehung eine Art Bajonettverschluß hergestellt wird, worauf diese Hülse in eine federnde Büchse der Nabe eingeschraubt und durch eine auf diese Büchse aufgeschraubte Klemmhülse festgestellt wird. 2. Befestigung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine an einem vorspringenden federnden Teil der eingeschlitzten Hülse sitzende Nase in eine von mehreren Aussparungen des Flügelfußes eingreift. 3. Befestigung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwei federnde Kegelflächen an der Büchse angeordnet sind, deren eine sich am geschlitzten Ende befindet, während die anderen an in Ausschnitten liegenden Zungen des Mittelteiles angeordnet ist, und die Sicherung der Hülse sowie die Feststellung des Flügelarmes dadurch bewirkt wird, daß beide Kegelflächen durch eine Mutter zusammengepreßt werden. Flugzeugfahrgestell mit freihängender, seitwärts und aufwärts verschiebbarer Achse.*) Gegenstand der Erfindung ist ein Fahrgestell für Flugzeuge mit freihängender, seitwärts und aufwärts verschiebbarer Achse in Verbindung mit Zug- *) D. R. P. 256555. Julius Kohlscheen in Kiel. seilen, durch welche ein aufrichtendes Drehmoment auf das Flugzeug bei schiefer Landung ausgeübt wird. Bei fester Lagerung oder bestimmter Führung der Radachsen brechen die Räder oder das Fahrgestell des Apparates sehr oft bei heftigen, durch Unebenheiten des Erdbodens hervorgerufenen Stößen sowie beim zu harten gleichseitigen wie auch ungleichseitigen Landen. Dieser Nachteil soll durch die vorliegende Erfindung beseitigt werden. Der Erfindungsgegenstand ist in der Zeichnung dargestellt und zwar in Abb. 1 in Vorderansicht, in Abb. 2 in Seitenansicht. Es bezeichnet a die Radachse, b und b, die Streben des Gestells, hinter denen die Radachse liegt, c und c, die Federn, die so stark bemessen sind, daß sie die Achse mit den Rädern durch die über die Rollen g und gj geführten Schnurzüge in der Normalstellung halten, wenn der Apparat auf dem Erdboden steht. Die Federn d und d, mit den daran hängenden Rollen k und k, dienen zur Aufnahme und Führung der Zugseile 1 und Ii, die von diesen Rollen über die zweischeibigen Rollen f und f, am Fußpunkt der Streben b und bi hinweg zu den Enden i und i, der Radachse führen. 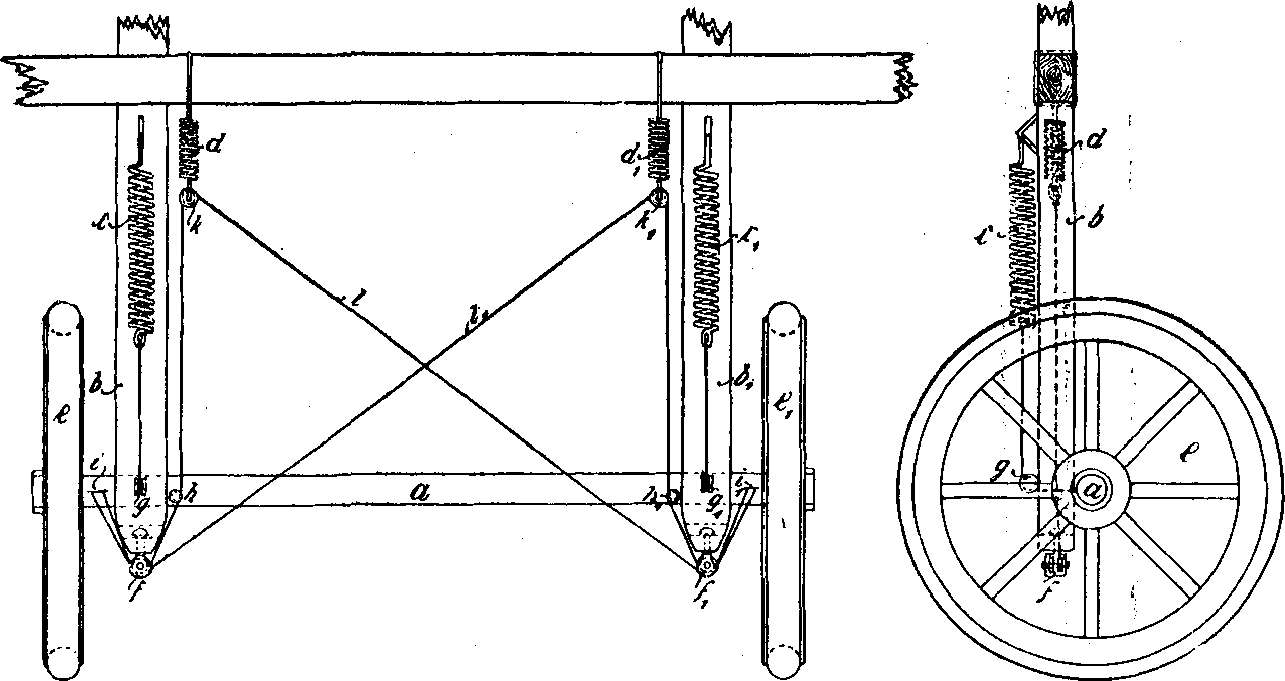 Abb. 1 Abb. 2 Beim Anfahren sowie beim horizontalen Landen des Flugzeuges weichen die Räder e und e, mit der Achse a in der Richtung der auftretenden Stöße nach seitwärts, hinten oder unter einem Winkel zur Horizontalen aus. Nach dem Auffangen der auftretenden Stöße wird die Achse durch die Spannkraft der Federn in die normale Lage zurückgebracht. Beim einseitigen Landen hat das eine Rad das Gesamtgewicht des Flugzeuges verstärkt durch das Fahrmoment aufzunehmen. Durch das Ausweichen des Rades e kommt die Feder c, in Spannung. Der auftretende Zug wird auf die diagonal verlaufenden, lose über die Rollen f, h, k, f und f,, h,, ft geführten und bei i und i, an der Achse befestigten Zugseile I und 1, übertragen, wodurch ein aufrichtendes Drehmoment auf das Flugzeug ausgeübt wird. Patent-Anspruch. Flugzeugfahrgestell mit freihängender, seitwärts und aufwärts verschiebbarer Achse, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung der Achse mit dem Flugzeugkörper durch zwei sich kreuzende Zugseile bewirkt wird, welche von der einen Befestigungsstelle an der Achse über eine tiefer liegende Rolle einer senkrechten Strebe des Flugzeugkörpers aufwärts zu einer zweiten am Flugzeugkörper befestigten Rolle und von da zum Befestigungspunkt am anderen Ende der Achse geführt sind, wodurch ein aufrichtendes Drehmoment auf das Flugzeug ausgeübt wird. Wettbewerbe. St-hauflüge in Coblenz. Im Anschluß an den Prinz Heinrich Flug wird der Coblenzer Verein für Luftfahrt am 12 und 13. Mai 1913 Schauflüge auf der Kurschneise bei Coblenz, dem Exerzierplatz der Coblenzer Garnison, veranstalten. Es sind recht erhebliche Preise in Aussicht genommen. Jeder Flieger soll ein der Vereinbarung mit dem veranstaltenden Verein unterliegendes festes Nenngeld und für jeden Flug von mindestens 5 Minuten Dauer 70 M, von mindestens 10 Minuten Dauer 100 M erhalten. Außerdem sind für Frühpreise 850 M, für Höhenpreise 1500 M, für die längsten Gesamtflugzeiten mit Fluggast 750 M und noch ein besonderer Dauerpr.eis von 500 M ausgesetzt. Die Gelder für Mitnahipe von Fluggästen erhalten die Flieger gleichfalls. Ausschreibung und Nennungsmuster sind von Herrn Hauptmann Flaskamp, Coblenz, Hohenzollernstraße 71 zu beziehen. Nennungsbeginn 1. April. Verschiedenes. Der Frankfurter Flugsportklub veranstaltetete am Mittwoch den 12. ds. im Frankfurter Hof sein diesjähriges Jahresfest, zu dem, wie alljährlich, der Protektor des Klubs, der Großherzog von Hessen mit Gefolge erschienen war, desgleichen waren die Spitzen der Zivil- und Militärbehörden anwesend. Die Flugzeug-Industrie war durch den Flugzeugfabrikanten, August Euler vertreten. Der Abend wurde eingeleitet durch einen Vortrag von Leutnant Reinhard von der Fliegerabteilung Darmstadt, der erst kurz vor Beginn des Vortrags mit seinem : Flugzeug von Darmstadt herübergekommen war. Der Redner sprach über !Ernstes und Heiteres aus seinem Fiiegerleben und schilderte in interessanter und launiger Weise verschiedene Flüge, die er ausgeführt hat. So den Flug nach Karlsruhe, der von den Fliegeroffizieren anläßlich der Verlobung der Prinzessin Viktoria Louise zugleich mit dem Luftschiff L. Z. 15 unternommen wurde Einen nicht ungefährlichen Sturz erlitt der Redner bei einem Flug nach Neustadt, wo er eine Notlandung in einem Morast vornehmen mußte. Leutnant Reinhard berichtete weiterhin über eine Ballonfahrt, in deren Verlauf der Ballon bei der Landung kurz vor Metz explodierte. Er hob dieses Ereignis deshalb hervor, um nachzuweisen, daß auch der Ballonsport nicht ohne Gefahr sei. Weiterhin schilderte der Redner seine Flüge im Manöver des vergangenen Jahres, bei denen er ausgezeichnete Nachrichten überbringen konnte. Der Redner schloß seine von den zahlreich erschienenen Zuhörern mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Ausführungen mit einer Schilderung seiner Erlebnisse bei dem Süddeutschen Rundflug. Nach Mem Vortrag fand ein gemeinsames Abendessen für die Mitglieder des Klubs statt, an dem auch der Großherzog teilnahm. Beschlossen wurde der Abend durch Cabaret-Aufführungen, welche von Künstlern der Frankfurter Theater dargeboten wurden. Die Errichtung von Flugstützpunkten ist von verschiedenen Gemeindenbeschlossen worden. Der in Weimar ansässige deutsche Flugverband glaubt es sich zur besonderen Aufgabe stellen zu sollen, die Errichtung dieser Flugstützpunkte vorzunehmen. Gegen diese Maßnahmen haben die dem Deutschen Luftfahrer-Verband angehörenden Vereine in ihrem Heimatsgebiete Einspruch erhoben. Da der deutsche Flugverband infolge seiner Organisation nicht in den Deutschen Luftfahrer-Verband aufgenommen werden kann und ein Handinhand-arbeiten mit den einzelnen Vereinen nicht möglich ist, wurde entschieden, daß die Errichtung von Flugstützpunkten den betreffenden Heimatsvereinen untersteht. In verschiedenen Städten ist in dieser Richtung bereits intensiv gearbeitet worden. Die Stadt Osnabrück hat ein vom Kriegsministerium zu verzinsendes Darlehen von 15000 Mark hergegeben und beabsichtigt, mit einem Betrage von 6000 Mark aus der National-Flugspende einen Flugstützpunkt zu errichten. Der (.Gemeinderat der Stadt Gera hat 10 000 Mark für einen Flugstützpunkt ausge-worfet:. Der Stadtrat der Stadt Zweibrücken hat gleichfalls größere Beträge jj(.bewilligt. Ebenso sind in Freiburg seitens der Stadtverwaltung Mittel für die v .Errichtung eines Flugstützpunktes und zum Schuppenbau bereit gestellt worden. ~<y Uebungen für Flugzeuge und Luftschiffe beabsichtigt die Heeresver-waltung in den nächsten Tagen stattfinden zu lassen. In Frage kommen die Stationen Cöln, Metz und Oos bei Baden-Baden. 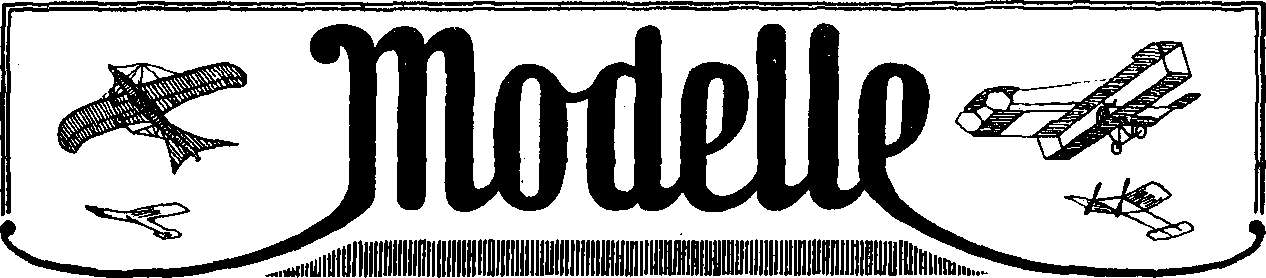 Fahrgestelle. Mit Recht ist der schwachen FahrgestelleTschon oft Erwähnung getan. Ein gut gebautes Modell wird man um einiger Gramm Mehrgewicht willen nicht der Zerstörung durch Bruch des Fahrgestelles aussetzen. Um einen Fingerzeig zu geben, seien einige Konstrtiktionsarten angeführt. 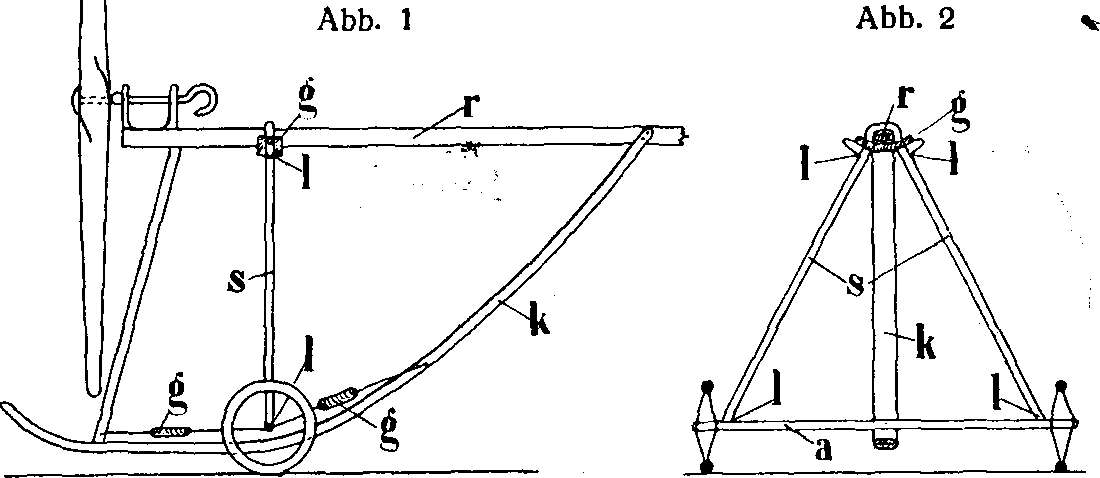 Abb. 4 Abb. 3 Abb. 1 - 4 zeigt ein Fahrgestell, das vermöge seiner Aufhängung nach allen Seiten nachgeben kann. Zur Erläuterung sei bei allen Figuren: a = Achse, b = Blech, c = Gummi (wie zu Motoren, Querschnitt = 2X2 mm), k = Kufe, 1 = Lötstellen,, n = Nabe, r = Rumpf, s = Streben (Eisendraht Holz), u = Uhrfeder. Zu Abb. 1—3 wäre nichts zu erwähnen. Abb. 4 zeigt, wie der Gummi zu den erforderlichen Ringen zusammengenäht wird. Die in die Seile eingelassenen Gummistücke werden, sofern Draht zur Verspannung gebraucht wird, von diesem durchstochen; bei Verwendung von Faden geschieht die Befestigung durch einen Nadelstich. Abb. 5, die ebenfalls ein allseitig ausweichendes Fahrgestell anp.ibt und Abb. 6 und 7, die ein solches kufenlos und nur nach hinten federnd zeigen, 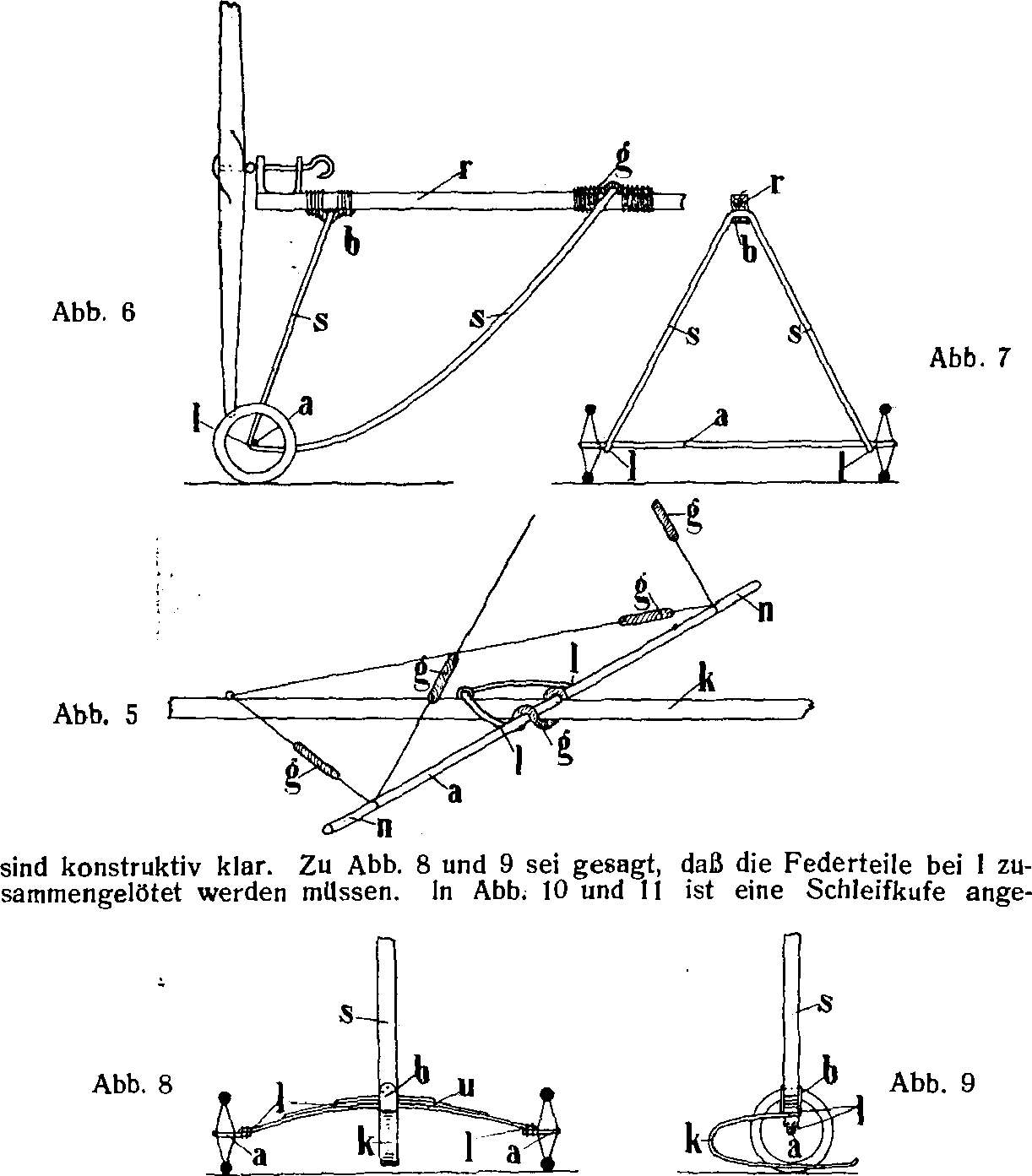 Abb. 10 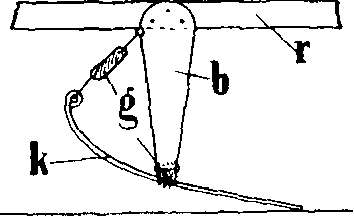 Abb. 11 deutet, bei der das schwierige Kugel- oder Kardangelenk durch ein eingenähtes Stückchen Gummi ersetzt ist. Der mit einem Messer (nicht Schere) zu bearbeitende Gummi muß auf eine Unterlage gelegt werden. Alles übrige geht aus den Zeichnungen hervor. f(- L. Das Gleichgewicht (Stabilität) der Modellmaschine. Es ist eine feststehende Tatsache, daß in öffentlichen Modellausstellungen beim Wettfliegen 9 0°/o der ausgestellten Apparate nicht fliegen und nur sehr, sehr wenige richtig fliegen, d. h. vom Boden aufsteigen, eine gewisse Strecke parallel zum Boden fliegen und in glattem Gleitflug wieder landen! Von den nichtfliegenden Modellen ist der größte Teil mit denü Kapitalfehler der Hinterlastigkeit behaftet, der Rest aber ist zu schwer. Auf eben diesen Fehler verfallen die meisten Anfänger, denn es fehlt ihnen zum größten Teil eine tiefere Kenntnis der Gesetze der Aerodynamik! So nimmt z. B. der angehende Modellbauer einen Plan nebst Photographie des ihm ideal erscheinenden Flugzeugs; er konstruiert nun seine Modellmaschine in den entsprechenden Proportionen der Großen und bringt natürlich auch die Flügel an derselben Stelle unter, ohne jedoch zu bedenken, daß beim großen Flugzeug das ganze Gewicht vorne liegt und aus Motor, Führer, Benzinreservoir etc. besteht, während beim Modell der Gummimotor sein Gewicht auf die ganze Länge des Apparats verteilt: „Es entsteht hieraus eine Verschiebung des Schwerpunktes, die eine vollständige „Längsunstabilität" bedingt, mit anderen Worten, die Maschine ist total hinterlastig und fliegt infolgedessen nicht. Bei sämtlichen existierenden Flugzeugen befindet sich der Schwerpunkt etwas vor dem Auftriebsmittelpunkt, infolgedessen muß sich aber auch der Modellbauer folgenden Grundsatz stets vor Auge halten: „Ein auf der Fingerspitze balanciertes Flugzeugmodell muß dann im Gleichgewicht sfcin, wenn sich der „Balancierpunkt" (in diesem Fall der Finger) etwas vor dem vorderen Drittel der Tragdeckentiefe befindet." Ein nach obigem Grundsatz konstruiertes Modell muß fliegen, mehr oder weniger weit, je nach seinem Gewicht, aber fliegen muß es! Früher bauten alle anfangenden Modellkonstrukteure zuerst leichte Apparate, die vor allem Flugfähigkeit besaßen und erst nachdem sie an denselben gelernt hatten, auf welche Art man Flüge reguliert, den Schwerpunkt genau bestimmt, gingen sie zum Bau von schweren verbesserten Maschinen über! Diese Methode war die richtige; nachdem aber jetzt in den verschiedenen Zeitschriften genau beschrieben wird, wie Modelle zu bauen sind, beginnen die meisten Anfänger gleich mit „Rennmaschinen", „Fokkereindecker" mit automatisch stabilisierenden Flächen und hochliegendem Schwerpunkt und dergleichen schönen Sachen, ohne dabei zu bedenken, daß sie sich durch den Versuchsbau einer einzigen kleinen, leichten Maschine viele mühevolle Arbeit und vor allem sehr viel Kleinholz sparen würden! Nun noch einiges über moderne Modellflugzeuge für fortgeschrittenere Konstrukteure: Es gibt 2 Arten Modelle zu bauen, die ersten nennt man Aeroplanspiel-zeuge, die letztere Flugzeugmodelle und es wird wohl kaum ein Zweifel existieren, welche von beiden Arten die interessantere ist. Die erste Art sucht möglichst große Entfernungen hinter sich zu bringen, unter Anwendung von „Gewaltmitteln" d. h. unter Weglassen des Fahrgestells, sowie anderen ähnlichen entbehrlichen Gegenständen und man bezeichnet dieselben mit dem treffenden Namen „flying stich" (fliegender Stock). Die zweite Art, der Studienapparat ist ein schwereres Modell, in der Absicht konstruiert.Verbesserungen zu versuchen, deren Anbringung auch an wirklichen Maschinen möglich wäre und zu diesem Zweck sind solche Modelle wie große Flugzeuge zu konstruieren und ist hierbei in erster Linie dem Fahrgestell Rechnung zu tragen, das zweckmäßig durchgebildet sein muß. Es ist ja über Modelle schon viel, sehr viel geschrieben worden und ich möchte hier nur noch einige Tatsachen hinzufügen, die nicht ohne Interesse sein dürften. Die beste, vorteilhafteste Größe für Modelle mit Gummi-Motor, die noch immer die betriebsichersten und die am wenigsten ; kostspieligen sind, liegt zwischen 90 und 100 cm Spannweite auf dieselbe Länge! Und waren es.bis jetzt solche Modelle, die die weitesten und schönsten Flüge bei größtmöglich reduzierter Bruchgefahr ausgeführt haben. Bei der letzten großen Pariser Ausstellung ftir'Modelle'des „Aeroclub de France" war es ein Modell mit einfachem Gummimotor ohne jede Üebersetzung mit 95 cm Spannweite, das den Sieg über 78 Modelle der verschiedensten Komplikationen davontrug, unter denen sich auch 3 Preßluftmodelle von respektabler Größe befanden, die in der Ausstellung „unbesiegbar" ausgesehen hatten. Seite 234 „FLUGSPORT." No. 6 Die Forme! für obige Flüge war: Zurückgelegte Entfernung ϖ des Gewichts der Maschine Gewicht des Gummi Man vermeide Uebersetzungen, stürze sich nicht in die Unkosten eines Preßluftmotors, der sich beim ersten Sturz in verbogene Metallstücke verwandelt, und bleibe beim direkt auf die Achse montierten Gummi. Auf diese Weise fallen Reparaturen von herausgesprungenen Zahnrädern und ähnliche Unannehm-lickheiten weg. Nun einiges über Flügel : „Die Kipptendenz eines Modells vergrößert sich mit der Dicke und Wölbung der Flügel aus nachstehendem einfachen Grunde: Der Druck- oder Auftriebsmittelpunkt verschiebt sich um so weniger leicht, je flacher der Flügel ist und in der Tat haben sich Modelle mit absolut flachen Flügeln als ausgezeichnete Windflieger erwiesen. Diese Tragdecks tragen wohl etwas weniger als gewölbte, jedoch ist die Differenz so gering, daß sie durch eine kleine Vergrößerung der Flügel ausgeglichen werden kann. Nicht zu unterschätzende Vorteile bieten die neuerdings gemachten Versuche mit „elastischen Flügeln", die überraschende Erfolge gezeiiigt haben. Die beiden Längsholme dieser Tragflächen sind einander so nahe gerückt, daß 2/s der Ivnteren Flügeltiefe elastisch sind, was am besten auf beistehender Skizze ersichtlich ist, die Längsholme haben 3X4 mm und sind aus ["H-Pappel-holz, die Querrippen dünn gespaltenes Bambus. ffiv Der ziemlich stark angestellte Flügel wird von jeder Seite aus nach oben und nach unten durch je 2 Drähte verspannt. Beim Beginn des Fluges stellt sich nun die Tragfläche je nach dem Winddruck entsprechend ein und läßt seitliche Windstöße einfach unten „durchfedern", da sich der Hinterrand ziemlich hoch aufbiegen kann! Durch diese flache, elastische Flügelkonstruktion in Verbindung mit leichter V-Stellung kann die seitliche Stabilität des Modells als gelöst gelten und der geringe Äuftriebsverlust, der dadurch resultiert, spielt keine Rolle. Pfeilstellung nach hinten und ähnliche Dinge können als überflüssiger Luxus wegfallen. Die Frage, ob Ententyp oder Penaudsteuer mag der Entscheidung des Einzelnen überlassen bleiben. Die Ententype arbeitet sehr vorteilhaft, da das Prinzip der Neigungswinkeldifferenz angewendet ist und die Tragflächen in wirbelfreier Luft arbeiten, Apparate .mit hintenliegendem Höhensteuer und Zugschrauben fliegen rascher und landen glatter! Die Modelle mit bestem Nutzeffekt wiegen bei 90—100 cm Spannweite 150-180 Gramm und haben Schrauben von 30 cm Durchmesser. Heer. Strebenverbindung im Modellbau. Eine einfache Strebenverbindung läßt sich, wie die nebenstehende Abbildung zeigt, dadurch bewirken, daß man die Längsträger an der Verbindungsstelle mit Zwirnfaden dicht zueinander umwickelt und die Streben, deren Enden gleichfalls mit Zwirnfaden umwickelt sind, wie in der Skizze angedeutet, durch kleine Stecknadeln befestigt. 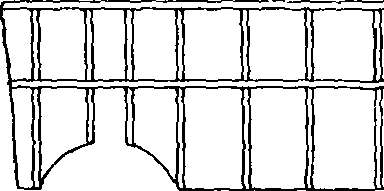 Literatur.*) Ueber luftfahrtrechtliche Fragen von R. - A. Dr. Taurfer in Berlin, juristische Verlagsbuchhandlung Friedr. Freusdorf. Das vorliegende Schriftschen verdankt seine Entstehung einem Vortrage, den der Verfasser im Berliner Anwaltverein gehalten hat. Es befaßt sich mit den beiden wichtigsten Fragen des Privatrechts der Luftfahrt, kann der Grundeigentümer das Ueberfliegen seines Grundstücks verbieten und der Frage der Schadenshaftung. Im ersten Teile seiner Abhandlungen vermehrt Verfasser die Schar derjenigen, welche nach dem B. G. B. jedem Eigentümer das erwähnte Verbotsrecht gewähren wollen, unseres Erachtens jedoch aus nicht überzeugenden Gründen. Dagegen sind die Ausführungen zur zweiten Frage sehr klar und treffend. Einige Bemerkungen de lege ferenda geben der Abhandlung einen futen Abschluß. Mit Interesse haben wir dem Werkchen entnommen, daß bereits er Entwurf eines Luftfahrtgesetzes im Reichsamt des Innern und Reichsjustizamt ausgearbeitet ist. Infolge der knappen Darstellungsweise gibt das Schriftchen doch einen guten Ueberblick trotz des kleinen Umfangs von nur etwa 20 Seiten. Denkschrift über den zweiten deutschen Zuverlässigkeitsflug am Oberrhein 1912. Preis Mk. 4.—. Soeben ist die Denkschrift über den zweiten deutschen Zuverlässigkeitsflug am Oberrhein erschienen. Die dem Prinzen Heinrich gewidmete Denkschrift ist von Oberstleutnant Freiherr v. Oldershausen herausgegeben. In 10 Kapiteln sind der Verlauf des Fluges, die teilnehmenden Flugzeuge, die während des Fluges gesammelten Erfahrungen niedergelegt. Das sehr sachgemäß angeordnete Tabellenmaterial wird dem Konstrukteur manche wichtige Nachrechnung ermöglichen, um so mehr, da auch wichtige Notizen, wie Windgeschwindigkeiten die Dr. Linke in dem Kapitel „Wetter und Wetterdienst" gibt, enthalten sind, so daß auch Umrechnungen aus der Relativgescliwindigkeit in die wirkliche Geschwindigkeit möglich sind. Der Denkschrift sind beigegeben eine ausführliche Tabelle enthaltend die Abmessungen, Leistungen und sonstige Eigenart der Apparate, die Ausschreibung, die Dienstanweisung, die sportlichen Leiter, welche Daten für manche Flugveranstaltung als Unterlagen dienen können, sowie zwei übersichtliche Karten in farbiger Ausführung. Kein Fachmann sollte es unterlassen, sich die Denkschrift für seine Bibliothek anzuschaffen, um so mehr als nur eine kleine Auflage derselben gedruckt ist. *) Sämtliche bespiochenen Bücher können durch die Expedition des „Flugsport" bezogen weiden. Berichtigung. In unserem Bericht über den Absturz Werntgens in Nr. 5 muß es anstatt am 21. Februar richtig heißen: am 26. Februar. Wir suchen für unsere Flugzeugfabrik einen erfahrenen, energischen Schlossermeister, der mit dem Akkordwesen vertraut ist. Angebote mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen und frühestem Eintrittstermin erbeten an (9:,:1 Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Fabriken Hennigsdorf bei Berlin. 3 Dorner Eindecker sind sehr preiswert zu verkaufen. Dorner Flugzeug Gelelllchait m.b.H.i.L., ^.Va,?  Jllustrirte No 7 technische Zeitschrift und Anzeiger «„„„nemant.- 2- April für das gesamte *ℜm. u 1913. Jahrs.«. „Flugwesen" pn"ahr' unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Teief.4557ftmti. Oskar Ursinus, Civilingenieur. Tei.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. . - —= Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. .. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 16. April. Neue französische Wasserflugmaschinen. Von Ingenieur Oskar Ursinus. Die große bereits typisch gewordene Wasserflugmaschinen-Konkurrenz von Monaco beginnt am 4. April vormittags 9 Uhr mit den Vor-Wettbewerben. Schon seit einer Woche hat ein reger Flugbetrieb vor den Terrassen von Monte Carlo begonnen. Der Ausgang des diesjährigen Wettbewerbs, für den die Franzosen besondere Anstrengungen gemacht haben, wird in Fachkreisen mit spannendem Interesse erwartet werden, umsomehr, als verschiedene nach neuen Gesichtspunkten konstruierte Maschinen erscheinen werden. Der Einfluß der französischen Marine auf die Konstruktionen kommt bei mehreren Maschinen zum Ausdruck. Auch einige Lehren van Heiligendamm scheint man sich zu Nutzen gemacht zu haben. Die Motorleistungen für Hochsee-Wassermaschinen "werden immer größer. Man ist bereits bei 400 PS angelangt. Schon im Vorjahre habe ich an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß wir für die hohe See Flugmaschinen mit größeren Motorleistung! n, über 500 PS, mit seetüchtigen Gleitbooten haben müssen. Derartige Riesenmaschinen sind selbstverständlich für Landungszwecke nicht zu verwenden. Es wird die Zeit kommen, wo man mit noch größeren Motorleistungen operieren wird. Die größte von den Franzosen bis heute gebaute Maschine ist das Wasserflugzeug Jeanson konstruiert von Colliex. Dieser Riesendoppeldecker (s. die nebenstehenden Abbildungen) besitzt bei 24 m Spannweite und 16 m Gesamtlänge 120 qm Tragfläche. Das Gewicht der Maschine in betriebsfertigem Zustand beträgt 4000 kg. In dem 7 m langen sehr stark konstruierten Gleitboot befinden sich neben den Führer- und Gastsitzen im hinteren Teil zwei 200 PS Chenue-Motoren, die unter Vermittlung einer Gelenkkette eine Chauviere-Schraube von 4,4 m Durchmesser antreiben. Zu beiden Seiten der Kette sind Lamellen-Kühler angeordnet. Der Doppeldecker besitzt zwei Haupttragdecken und eine vordere kleine stark belastete unter größerem Neigungswinkel gestellte Tragfläche (Prinzip der Neigungswinkeldifferenz). Das Höhen- und Seitensteuer sind in den Schwanz verlegt Die seitliche Schwimmstabilität wird durch zwei kleine Stützschwimmer an den Tragdeckenenden gesichert. In dieser Maschine sehen wir bereits einen Vorläufer, wie er für Hochseezwecke evtl. Verwendung finden kann. Die den Lesern unserer Zeitschrift vom letztsn Pariser Salon her bekannte Wasserflugmaschine La Marseillaise wird voraussichtlich in Monaco auch versucht werden. (S. die beistehenden Abbildungen.) Die Maschine besitzt eine Spannweite von 12 m und eine Gesamtlänge von 7,5 m. Der Tragflächeninhalt beträgt bei 12 m Snannweite unter Berücksichtigung der vorderen Stabilisierungsfläche 30 qm. Hiervon entfallen auf die vordere Stabilisierungsfläche 6,5 qm, auf die Haupttragfläche 21 qm und auf die Schwanzfläche 2,5 qm. Die Tragdeckentiefe der mittleren Fläche mißt 1,75 m. Das Gewicht beträgt 1050 kg. Zum Betriebe dient ein horizontal gelagerter 110 PS Salmson-Motor, der unter Vermittlung^ von Kegelrädern eine vorn liegende vierflügelige Schraube antreibt. Die seitliche Schwimmstabilität sollte ursprünglich durch zwei an den Schwimmkörper anschließende Fabre - Schwimmer erhalten werden ; bei den Versuchen ergab sich jedoch, daß diese Schwimmer nicht genügten. Mau hat dann unter den Tragdecken zwei weitere Hilfsstützschwimmer angeordnet. Eine weitere interessante Maschine hat Borel herausgebracht. Dieses Flugzeug ähnelt in seinen Ausführungsformen der in Heiligendamm leider vom Pech verfolgten Ma-.chine von Goedecker. Der Gnom-Motor, Führer- und Gastsitze sind in ein großes Gleitboot verlegt. Der Antrieb der vierflügeligen Schraube geschieht durch eine Gelenkkette. Höhen- und Seitensteuer befinden sich im Schwanz. (Siehe Abb. S. 244.) Von den bekannten Typen ist ein Maurice Fartnan in Monaco bereits versucht worden und in Trümmer gegangen. Dieser Apparat besaß eine Spannweite von 20 m. (Siehe S. 246.) Sehr beweglich erwies sich bei seinen ersten Probeflügen der vom Pariser Salon her bekannte Astra-Doppeldecker. Diese kleine Wassermaschine besitzt bei 12 m Spannweite 50 qm Tragfläche. Die Gesamtlänge mißt 11 m. Die Maschine wiegt mit einem 100 PS 12 Zyl. Renault-Motor 750 kg. (S. 246.) Zusammenstellung der wichtigsten Tragdeckenprofile. (Hierzu Tafel VIII.) Die wichtigsten Tragdeckenprofile sind im Flugsport bereits bei den Beschreibungen der einzelnen Flugmaschinen veröffentlicht worden. Jede Flugmaschinenkonstruktion verlangt je nach ihrer Bestimmung ein entsprechendes lJrofil. Gerade durch die falsche Anwendung von Profilen werden oft recht gefährliche, unstabile Maschinen geschaffen. Wie oft lassen sich noch wenig eingeweihte Flugtechniker 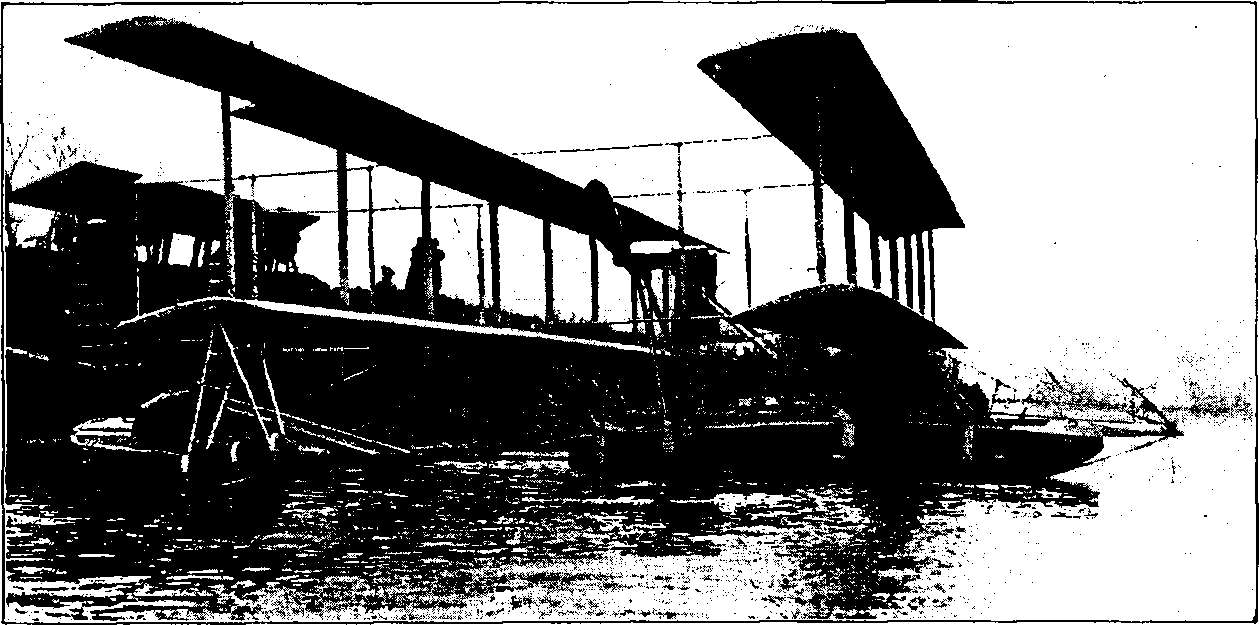 Wasserflugmaschine Jeanson. Seitenansicht. verleiden, z. B. das vielgelobte Nieuportprofil zu kopieren. Sie konstruieren einfach ohne die Stabilitätsverhältnisse zu untersuchen, in dem Glauben den Stein der Weisen gefunden zu haben, munter darauf los. Es würde hier zu weit führen, Anleitungen zu geben, wie die Konstruktion des Tragdeckenprofils durchzuführen ist. Hierzu gehört ein genaues Studium der einschlägigen Literatur. (Siehe Luftwiderstandsversuche von Eiffel). Wir beschränken uns vielmehr darauf, denjenigen, die die Veröffentlichungen im Flugsport nicht von Anfang an verfolgen konnten, eine Zusammenstellung der wichtigsten Profile zu geben. 'Siehe Tafel VIII.) Soweit man die praktisch zur Ausführung gelangten Formen übersehen kann, halten sich dieselben bis auf geringfügige Abweichungen konstruktiver Natur an Lilienthal. Dieselben zeigten im Anfangsstadium der Flugtechnik fast ausnahmslos eine einseitige Bespannung und zwar der Unterseite des Tragdecks. Man war sich eben über die Strömungsund Druckverhältnisse an Ober- und Unterseite desselben im Unklaren. Dies änderte sich mit der unabhängigen aber systematischen Forschung von Kutta, Joukovsky, Bendemann, Eiffel, Finsterwalder und anderer mehr. Sie gelangten zur Auffassung, daß auf der Oberseite des Tragdecks die Strömungsgeschwindigkeit infolge der Kreisströmung verbunden mit einer Druckverminderung zunehme, während auf der Unterseite eine Verminderung der Strömungsgeschwindigkeit zur Druckerhöhung führt. Für den Konstrukteur folgt hieraus, daß zur Erzielung einer hohen Fahrtgeschwindigkeit die Oberseite besonders günstig zu gestalten ist. Kanten, Ecken und sonstige Profilunterbrechungen müssen sorgsam vermieden werden, und unumgänglich notwendige Befestigungspunkte für Verspannungsorgane und Streben sollen die für den Fahrwiderstand günstigsten Formen annehmen. Die Unterseite dagegen soll die Bedingungen für größte Tragfähigkeit und Stabilität in sich vereinigen. Die konstruktive Entwicklung des Tragdecks brachte neben der beiderseitigen Bespannung große Holm-dimensionen mit sich, weil man die Anzahl der Verspannungsorgane verminderte. Bahnbrechend waren hierfür die Erfolge von Nieuport. Um den Stirn widerstand des Holmes möglichst zu vermindern, verlegte er denselben in das Tragdeck und verjüngte das Profil keilartig an der Vorderkante. Ein derartiges Profil für schnelle Maschinen ist jedoch großen Druckwechseln unterworfen und daher ziemlich unstabil. Die Ursache hierfür liegt, wie Eiffel festgestellt hat, in dem großen Druck, der auf der Oberseite der Keilschneide ruht, welcher beim Abwärtssteuern der Flugmaschine derartig zunimmt, daß die Maschine, wie aus den Unglücksfällen der Gebr. Nieuport und Mandelli hervorgeht, zum Kopfsturz kommt. Hänriot verbesserte das Nieuport'sche Profil,, indem: er die Keilschneide herunterzog, die Wölbung vergrößerte, und das ausschweifende Ende der Tragrippe nach oben krümmte. Die Profile mit runder Vorderkante, Wright, Harlan, Etrich u. s. w. mit unvermindertem Stirn widerstand verhalten sich dagegen bei Einfallswinkel und Gesehwindigkeitsänderungen sowie im Gleitflug bedeutend stabiler, weil der Druckmittelpunkt geringeren Verschiebungen unterworfen ist. Ferner bemerkenswert ist bei Rennmaschinen die systematische Verringerung der Wölbungstiefe. Als extremes Beispiel hierfür sei der Deperdussiu-Renneindecker angeführt. (Siehe Profil.) Die Sicherheit des Flugbetriebes hängt von der Ausführung der Tragdeckenholme ab. Dieselben werden mit Stahlband armiert, das in eine flach gefräste Nute zu liegen kommt. In Abständen von 10 bis 30 cm wird das Stahlband mittels Holzschrauben festgeschraubt. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Tragflächen bei Eindeckern mit Verwindung bei seitlichem Aufkommen viel widerstandsfähiger sind als die bei Doppeldeckern mit Klappen, da der hintere Holm in Richtung seiner Verwindungsbeweglichkeit nachgeben kann. Um vielen falschen Anschauungen zu begegnen, sei darauf hingewiesen, daß es nicht möglich ist, auf Grund von Profilformen allein einen allen Anforderungen genügenden automatisch stabilen Flug zu erzielen. Es muß vielmehr die gesamte Tragdeckform und ihre Stellung zum Rumpfe in Erwägung gezogen werden. Einige der eisten, die ihr Hauptaugenmerk darauf richteten, waren Etrich und Ahlborn. Sie ahmten'die Zanoniaform des indischen Flugsamens nach und erreichten eine hohe automatische Stabilität. Auf ähnlichen Erwägungen (der Neigungswinkeldifferenz innerhalb der Tragdecken) beruht die den Lesern des Flugsport bekannte schwanzlose Pfeilfliegerkonstruktion von dem englischen Offizier Dünne. Hanuschke-Eindecker Militärtyp 1913. Hanuschke, der durch seine Flugleistungen bekannt ist, macht zur Zeit die größten Anstrengungen, seinen Eindecker zu verbessern. Die alte Maschine bewies bereits eine sehr gute Steigfähigkeit. Der neue Eindecker ist wie die früheren vollständig aus Stahlrohr hergestellt und autogen verschweißt. Die Stahlrohrversteifungen laufen alle im Dreiecksverband zusammen. Die Verbindungsstellen mit ihren gefährlichen Schweißstellen sind durch Blechstege verstärkt. Der dreieckig ausgeführte Motorrumpf verläuft nach der Motorlagerung trapezartig aus. 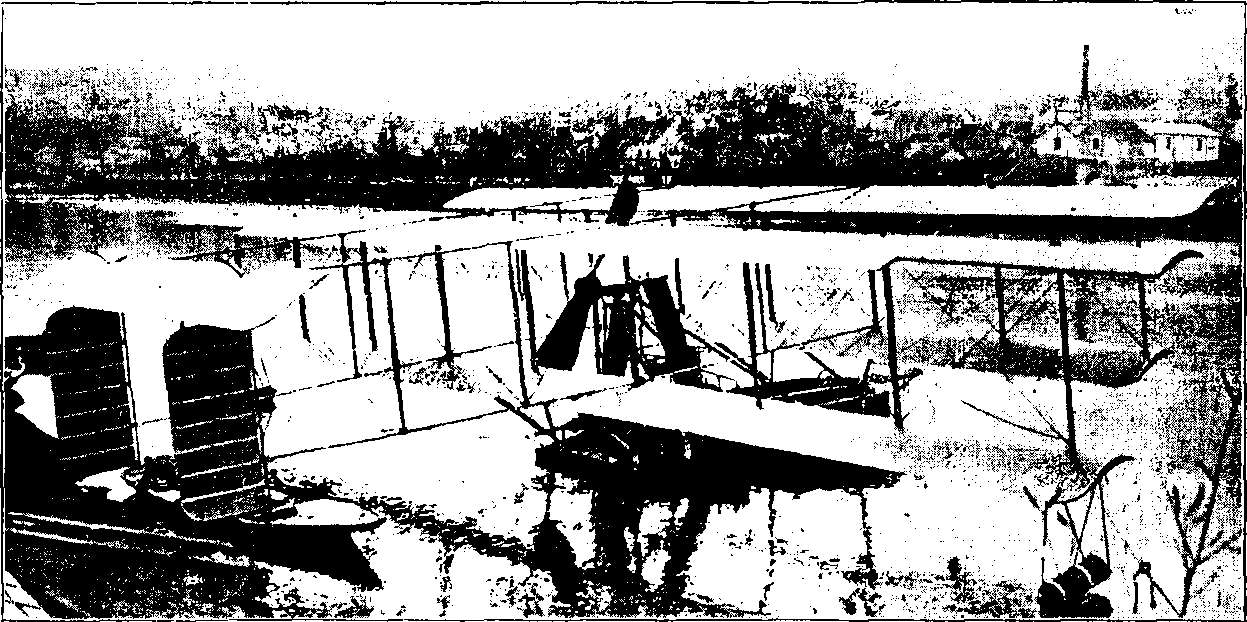 Wasserflugmaschine jeanson, Hinteransicht. Die unter den Tragdecken befindlichen Führer- und Gastsitze sind zum Schutze der Insassen und zur Verringerung des Luftwiderstandes von einer Aluminiumhaube umgeben. Für die Steuerung ist die allgemein übliche Militärsteuerung mit doppelt geführten Steuerzügen verwendet. Zum Betriebe dient ein 80 PS Gnom-Motor mit einer Schraube von '2,7 m Durchmesser Um die Insassen vor dem Oelregen zu schützen, ist der Motor mit einer Blechhaube, verkleidet. Diese Blechhaube verjüngt sich zwecks Verringerung des Luftwiderstandes 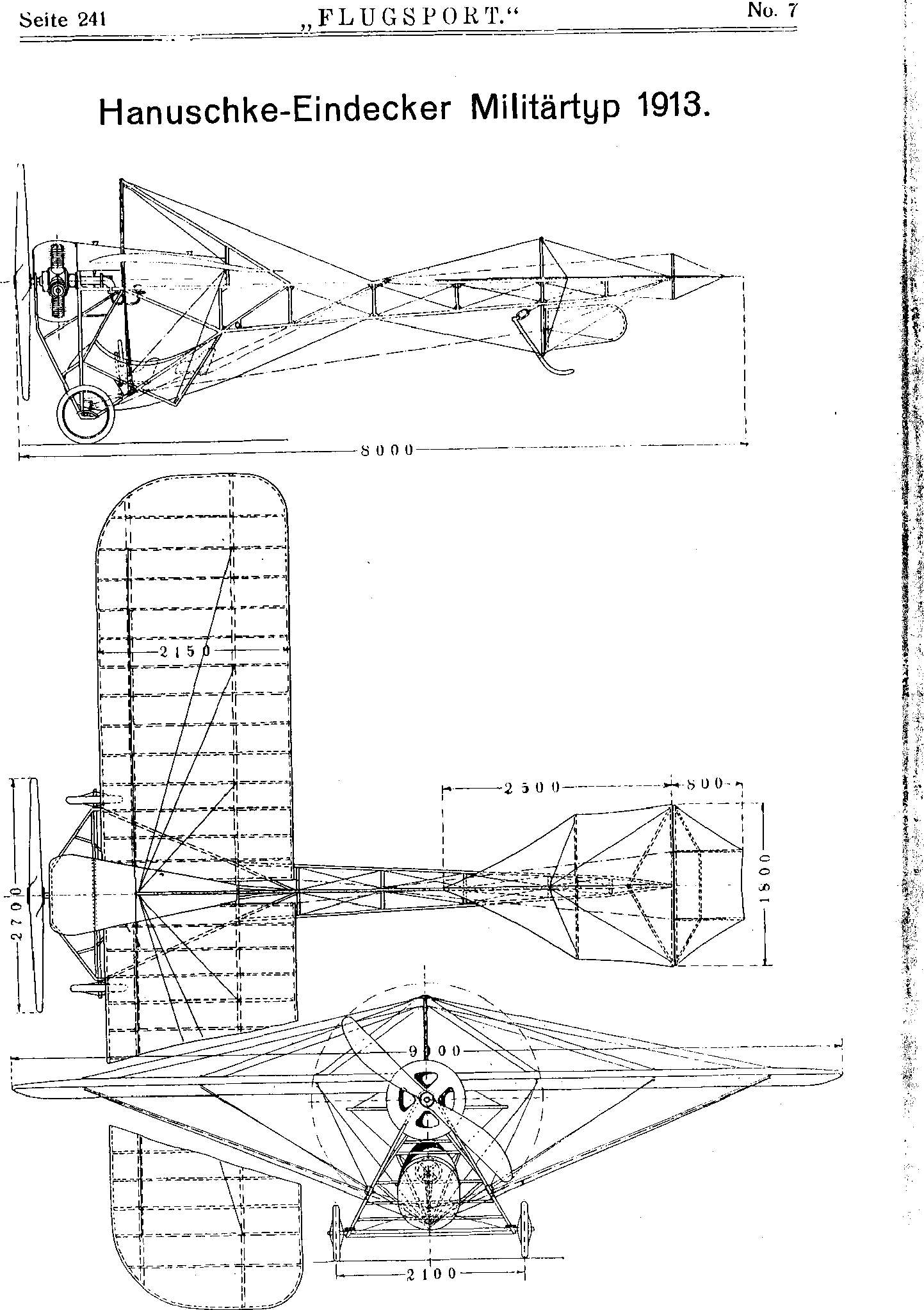 Nachbildung verboten. nach hinten tropfenförmig. In dem tropfenförmigen Teil ist gleichzeitig das Benzin- und Oelreservoir untergebracht. Die Radachse des Fahrgestells, dessen Räder 2,1 m Spurweite besitzen, ist in bekannter Weise mittels Gummiringen aufgehängt. 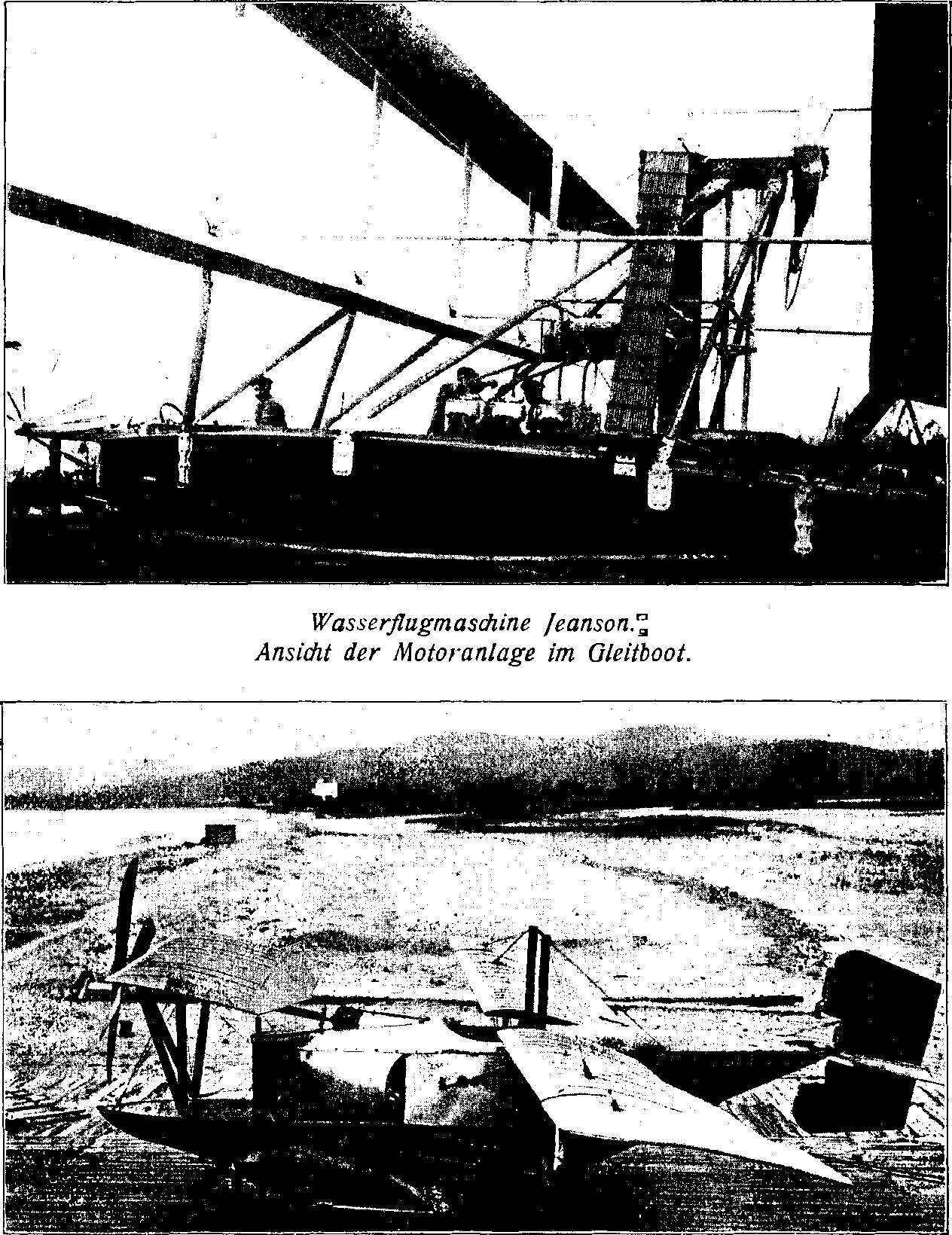 Wasserflagmaschine „La Marseillaise", Seitenansicht. J Die gegen die früheren Typen vergrößerten Tragdecken besitzen 18 qm Flächeninhalt. Die Flügelholme aus Eschenholz sind zur Verstärkung mit Stahlbändern armiert. Das Gewicht des einzelnen Flügels beträgt 50 kg. Zur Verspannung dienen 5 mm starke Stahlkabel. Die Eindecker von Hanuschke zeichnen sich aus durch ihre große Steigfähigkeit und den kurzen Anlauf. Mit dem 80 PS Gnom-Motor besitzt die Maschine eine Geschwindigkeit von über 100 km. Das Gesamtgewicht beträgt 250 kg. Aus dem Johannisthaler Fliegerlager. (Berliner Korrespondenz des „Flugsport"). Die von der Heeresverwaltung gestellten Bedingungen zur Abnahme von Militärflugmaschinen, besonders das Erreichen einer Höhe von 800 m in 15 Minuten mit Betriebsstoff für die Dauer von 4 Stunden, sind Faktoren, die jetzt bei dem Bau der Flugmaschinen allgemein berücksichtigt.. werden. Bekanntlich hat die Militärverwaltung vorgeschrieben, daß die Motorenstärke nicht über 100 PS betragen soll. In letzter Zeit sind auffallend viele Sechszylinder-Motore zur Verwendung gekommen, die ja bekanntlich dem Vierzylinder gegenüber verschiedene Vorteile besitzen und auch in der PS-Zahl etwas größere Leistungen ergeben. Bei verschiedenen Firmen finden wir schon viele Sechszylinder-Motore eingebaut und hier ist es wieder der Mercedes-Motor, der allgemeine Verbreitung gefunden hat. Bei Aloatros hat eine Vergrößerung der Fabrikräume stattgefunden, in denen der serienweise Bau von Doppeldeckern und Albatros-Tauben stattfindet. Die Firma ist dauernd beschäftigt und wird in der nächsten Zeit auch zwei Kennapparate herausbringen, die für die diesjährigen-, großen Konkurrenzen bestimmt sind. Vom 1. April ab sind wiederum 12 Offiziere den Albatroswerken zugeteilt, darunter 8 bayrische, die die Steuerung von Doppeldeckern und Eindeckern erlernen sollen. ; Auch bei Kumpler herrscht reger Flugbetrieb und wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit schon die Eröffnung der auf dem Flugplatz errichteten Fabrik erfolgen. Rosenstein, der frühere Fluglehrer, ist aus den Diensten dieser Firma getreten und wurde von der Gothaer Waggon-Fabrik, die auch den Bau von Flugmaschinen aufgenommen hat, als Fluglehrer engagiert. Zur Luft-Verkehrs-Ges. sind ebenfalls 6 Offiziere vom 1. April ab kommandiert. Der neue Doppeldecker ist bereits von der Heeresverwaltung abgenommen worden. Leutnant Carganico, der bekannte Metzer Offiziers-Flieger versuchte vor einiger Zeit zum ersten Male einen 70 PS L. V. G.-Eindecker mit Schwade-Motor und führte sofort verschiedene gelungene Flüge ans. Er war überrascht von der leichten Steuerbarkeit und Sicherheit des Apparates. Bei Fokker ist vor einigen Tagen der erste Apparat mit 100 PS Sechszylinder Mercedes-Motor fertiggestellt worden und hat Fokker selbst sofort den Apparat in gewohnter Sicherheit geflogen, ohne die geringste Aenderung irgend eines Teiles der Maschine vorzunehmen. Fokker zeigte die gleichen steilen Kurven, wie er sie mit seinen normalen früheren Maschinen ausführte und entwickelte mit dem Apparat eine Geschwindigkeit von über 100 km. Vergangenen Sonnabend erfolgte die Ueberführung dieser von der Heeresverwaltung bestellten Maschine nach Döberitz auf dem Luftwege und benötigte Fokker hierzu 12 Minuten, eine Zeit, die noch von keinem andern Apparat auf dieser Ueberlandflug-Streeke erzielt worden ist. In 600 m Höhe herrschte eine Windstärke von 21 m. 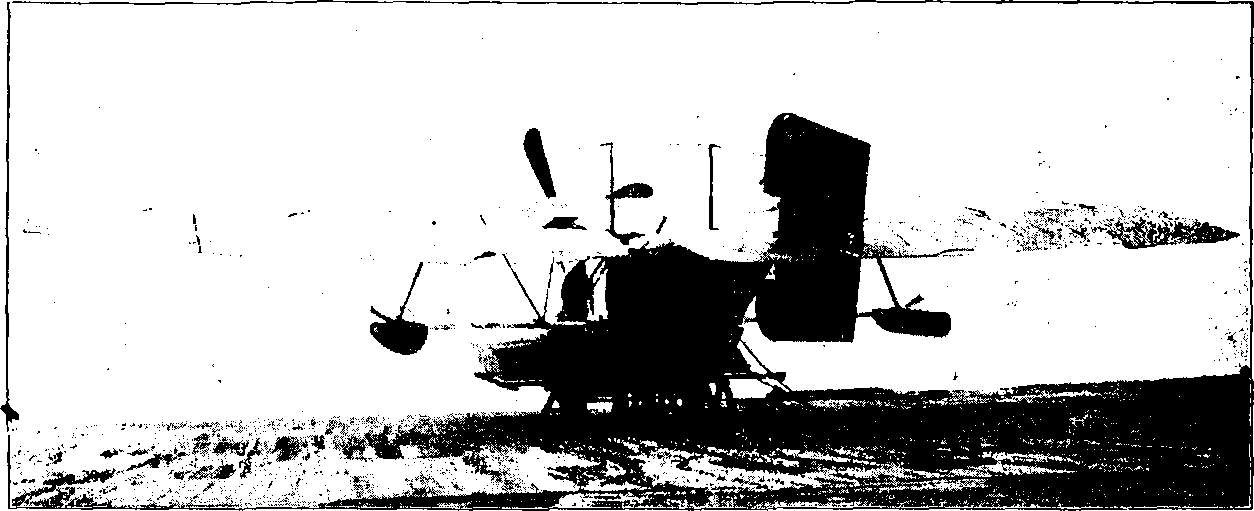 Wasserflugmasdiine „La Marseillaise, Hinteransicht. 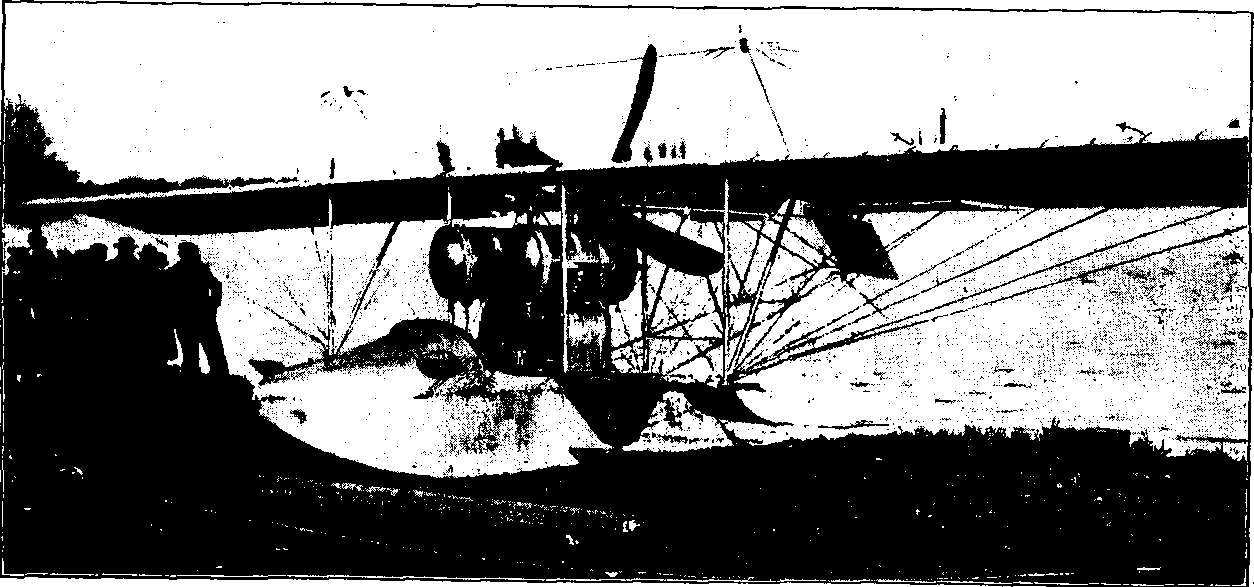 Wasserflugmaschine Borel. Der früher bei den Goedecker-Werken angestellte Flieger de Waal hat sich jetzt mit der Steuerung der Fokker-Apparate seines Landsmannes vertraut gemacht und trainiert auf den verschiedenen Typen. Vom 1. April ab sind acht Offiziere zur Ausbildung bei Fokker kommandiert, um dort die Steuerung des automatisch stabilen Eindeckers zu erlernen. Drei Civil-Flieger werden auf Kosten der National-Flugspendc ausgebildet und haben bereits ihre ersten Allein-Fliigc hinter sich. Oberleutnant zur See a. D. Schulz hat vor einigen Tagen seine Feldpiloten-Prüfung bestanden und dabei eine Höhe von 2000 m erreicht. Das gute Wetter, das in der letzten Zeit herrschte, benutzte Fokker eifrig dazu, die Versuche mit seiner Wasserflugmaschine auf der Spree fortzusetzen. Zunächst zeigt sich, daß mit dem Doppeldecker, der bekanntlich ohne jegliche mechanische Vorrichtungen zur Erhaltung der seitlichen Stabilität gebaut ist, ebensolche steilen Kurven-Flüge als mit dem Fokker-Eindecker möglich sind. Eine Beteiligung an der Wasserflugmaschinen-Konkurrenz Monaco ist nicht möglich, da die Firma sehr stark mit der Erledigung der Militärbestellungen beschäftigt ist. Der von der chilenischen Armee abkommandierte Hauptmann Ahumada hat bereits seinen ersten Allein-Flug hinter sich. Sehr interessante F allschirm- Versu che stehen, für die nächste Zeit bevor. Ein von dem Obermaschinistenmaat Dressel konstruierter Fallschirm hat sich bei verschiedenen Versuchen sehr gut bewährt. Fokker hatte mit dem Schirm einen Sandsack von HO kg Ballast an seinen Apparat angehängt und dann den Schirm aus beträchtlicher Höhe fallen lassen, wobei die Vorrichtung anstandslos funktionierte und der Schirm sich nach einer gewissen Zeit entfaltete, um den Ballast sicher zur Erde gleiten zu lassen. Dressel beabsichtigt mit seinem Fallschirm von einem Fokker-Apparat abzuspringen. Aus einem Freiballon hat er es bereits vollführt und ist sicher auf die Erde gelangt. Bei Jeannin herrscht ein sehr eifriger Flugbetrieb und werden momentan 15 Schüler unter Leitung von Stip 1 otscheck ausgebildet. Die neuen Fabrikräume sind fertiggestellt und vor einiger Zeit bezogen worden. Die Jeannin-Stahltaube mit Sechszylinder 100 PS Argus-Motor hat in Döberitz die neuen Abnahmebedingungen sehr gut erfüllt. Krieger trainiert gegenwärtig auf der flirth'schen Bann-Maschine, au? den vorjährigen großen Konkurrenzen, um sich für die Prämienflüge der National-Flugspende vorzubereiten. Bekanntlich ist der Apparat mit Vierzylinder Benz-Fluginotor, dem Gewinner des Kaiserpreises, ausgerüstet. ... er. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Wiederum hat das französische Flugwesen einige großartige Flugleistungen zu verzeichnen, welche nicht verfehlen werden, das Interesse der flugsportlichen Welt auf sich zu lenken. Zunächst war es ein Fernflugunternehmen Paris—Madrid, welches den bekannten Brindejonc des Moulinais, der im vorigen Jahre durch seinen Flugversuch von Paris nach Berlin, bei dem er bekanntlich nach zurückgelegten 520 km in Attendorn in Westfalen landete, auch in Deutschland viel von sich reden machte, wiederum in den Vordergrund des Interesses rückte. Brindejonc des Moulinais flog auf einem Morane-Eindecker (50 PS Gnom-Motor) am Ostermontag von Paris ab und gelangte nach 8 Stunden 45 Minuten nach Bordeaux, nachdem er während seines Fluges einen schwierigen Kampf gegen die Elemente bestanden hatte. Auch am nächsten Tage war das Wetter sehr schlecht und es ging ein heftiger Wind. Trotzdem flog Brindejonc von Bordeaux ab und gelangte bis "Vitoria, nachdem er die Pyrenäen unter äußerst schwierigen Umständen überflogen 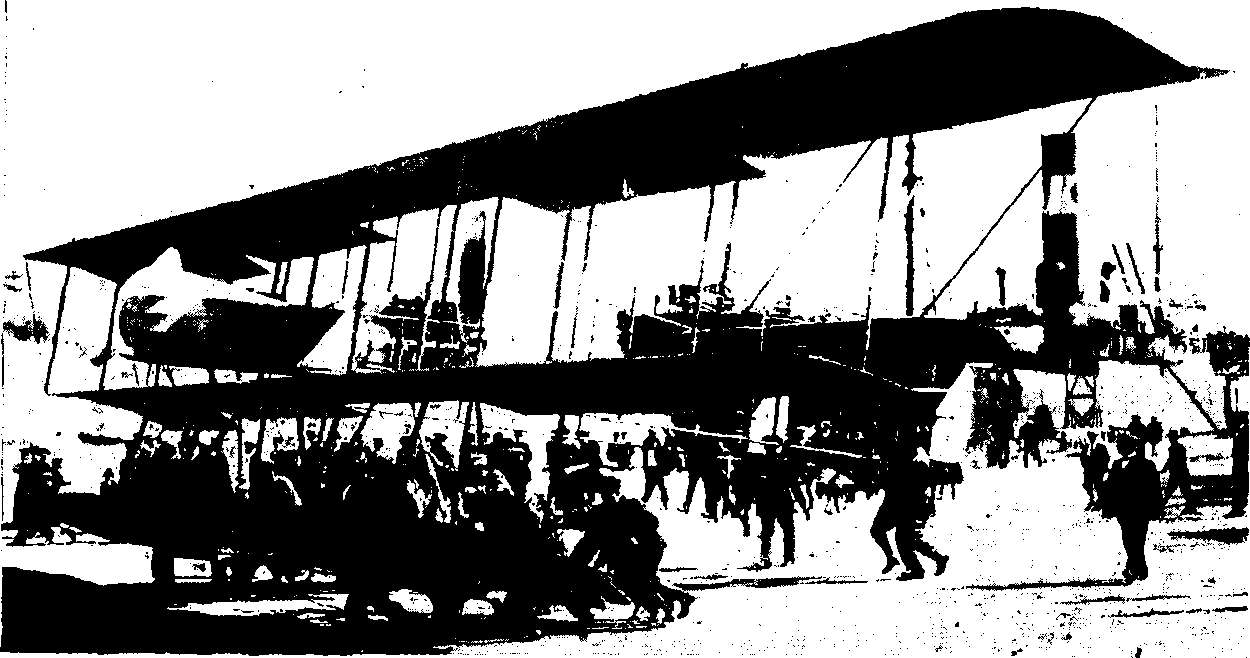 Wasserflugmasdiine Maurice Forman. 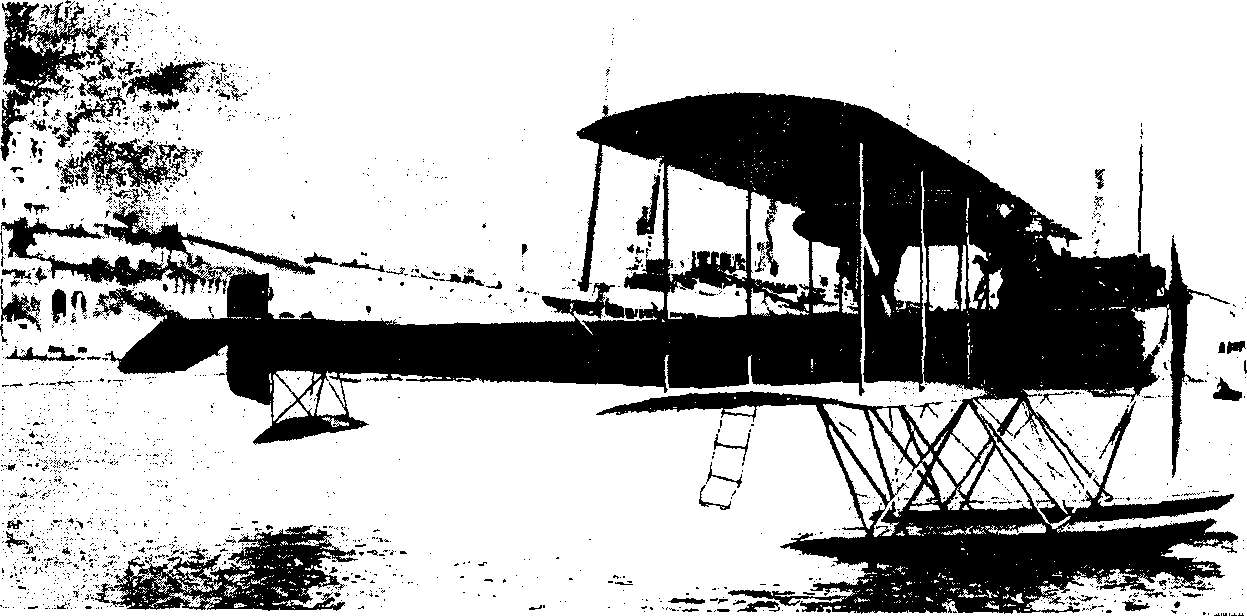 Astra-Doppeldecker. hatte. Als er von dort die noch 220 km entfernte spanische Hauptstadt zu erreichen suchte, wurde er durch einen Zündungsdefekt an seinem Motor (der durch den strömenden Regen durchnäßte Magnetapparat funktionierte nicht mehr regelmäßig) gezwungen, in der Nähe von ßurgos auf einem gebirgigen Terrain zu landen, wobei sein Flugzeug mehrfache Beschädigungen erlitt, sodaß er zwecks Vornahme notwendiger Reparaturen mit dem Apparat nach Vitoria zurückkehren mußte. In den nächsten Tagen hofft er, den verbleibenden Teil seiner Reise beenden zu können. Am vorgestrigen Freitag gingen hier zwei grandiose Fernflüge vor sich, die schon durch die dabei erzielten G-eschwindigkeiten erwähnenswert sind. Eugene Gilbert unternahm auf einem Morane-Eindecker (50 PS Rhone-Motor) einen Flug von Lion nach Paris, wobei er des morgens um 9 Uhr 30 Min. von Lyon abgeflogen war und um 12 Uhr 40 Min. mittags in Villacoublay landete, nachdem er für die Entfernung zwischen den beiden Städten (400 km) in 3 Stunden 10 Min., also mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 125 km, hinter sich gebracht hatte, trotzdem er zwei Drittel der Reise bei wolkenbruchartigem Regen zurückgelegt hatte. Gilbert selbst erzählt, daß sein Flugzeug sich nach allen Richtungen drehte und wandte und, daß es förmlich in den Fugen krachte; er wäre sicher aus seinem Sitz geschleudert worden, wenn er nicht in solider Weise daran festgeschnallt gewesen wäre. An demselben Tage ging der belgische Flieger Crombez vom Flugfelde von Betheny bei Reims nach seiner Heimat und legte die Strecke von Reims nach Lüttich, eine Entfernung von 330 km, mit Zwischenlandung in Turnai, in 2 Stunden 40 Min. zurück, sodaß auch er eine mittlere Geschwindigkeit von 123,750 km realisierte Crombez steuerte einen Deperdussin-Eindecker, 80 PS Gnom-Motor. Unglücklich verlief leider ein Fernflug, den der französische Offiziersflieger Leutnant Bresson an dem gleichen Tage von Reims nach Verdun unternommen hatte, wo er an einem Flugmanöver teilnehmen sollte. Ein Zylinder seines Motors platzte in der Luft und der unglückliche Flieger fand bei dem unvermeidlichen Absturz seinen sofortigen Tod Ein ähnlicher Unfall passierte vor wenigen Tagen dem Leutnant Mouchard; dieser aber befand sich in dem Augenblick in 1200 Meter Flughöhe und es gelang ihm, das Flugzeug nach einem Sturz von 900 Metern in etwa 300 Meter Entfernung von der Erde wieder in seine Gewalt zu bekommen. Bresson flog aber nur in 300 Meter Höhe, als der Unfall eintrat, sodaß er nicht mehr die Zeit für die erforderlichen Manöver hatte. Auch zwei Kanalüberquerungeu sind in dieser Woche erfolgt: Robert Flack ging um Mittag, mit seinem Sohne an Bord seines Bleriot-Eindeckers, von Dover ab und landete 45 Minuten später glatt in Calais, und Hamel flog, gleichfalls mit einem Passagier an Bord seines Bleriot, zum neunten Male die gleiche Strecke ohne Zwischenfall. Es war dies die 62. Kanalüberquerung, welche das moderne Flugwesen auf sein Konto setzen kann. Und während so die französischen Flieger wieder mit vollem Eifer an die Arbeit gehen, hat auch Vedrines, der große Vedriues, nicht untätig bleiben wollen. Er hat sich wieder einmal interviewen lassen und dabei die bedauerliche Tatsache kund und zu wissen getan, daß er die Absicht, selbst zu konstruieren, aufgegeben habe und fortan nur noch Flieger, einfacher Flieger bleiben wolle. Wie schade! Welche epochemachenden Verbesserungen hatte der geniale Vedrines uns in Aussicht gestellt, welche ungeheuren Fortschritte nach der Richtung der Sicherung des Maschinenfluges hatte er versprochen, und nun zieht er sich schmollend zurück ! Das Erfinden scheint doch etwas schwieriger zu sein, als das Reden und Prahlen. Aber der kleine Mechaniker, der sich immer noch in der Rolle des „Retters des Vaterlands" gefällt, verspricht etwas anderes: er will jederzeit bereit sein, alle Flugzeuge mit variablen Flächen, die andere erfinden sollen, zu probieren. „Denn", so fügt er hinzu, „ich bin überzeugt, der Apparat der Zukunft wird der sein, der im Fluge die größten Geschwindigkeiten realisieren und imstande sein wird, vermittels einer Vergrößerung seiner Tragflächen sich sehr langsam auf dem Boden niederzulassen. Das ist es, was erfunden werden muß". Uebrigens wird Vedrines, dem sein bisheriger Freund und Arbeitgeber den Laufpaß gegeben hat, ja nun Muße haben, selbst an dieser Erfindung zu arbeiten, bis .... die Beiden sich von neuem wieder vertragen. Daß das französische Militärflugwesen andauernd in emsiger Tätigkeit ist, ist schon im vorigen Berichte erwähnt worden. Namentlich nehmen die Rekognoszierungsflüge an der Ostgrenze ihren täglichen Fortgang und an einigen Stellen, wie beispielsweise in Toul, sind dabei beachtenswerte Flugleistungen zu Wege gebracht worden. Besonders interessant sind die Versuche, die der Leutnant Laianne zu Longwy mit dem Auswerfen von Bomben fortlaufend unternimmt. Dieser Tage hat er bei einem Experiment, dem der Divisionsgeneral und der Gouverneur von Maubeuge beiwohnten, sämtliche sechs Wurfbomben aus 600 Meter Höhe in den Zielkreis von 50 Meter Durchmesser zu lancieren vermocht. In erster Reihe handelt es sich bei diesen Versuchen wohl um eine Vorübung zu dem bekannten Michelin- Luftzielscheiben-Preis, der natürlich auch für dieses Jahr zur Bestreitung steht, und der ebenso wie der Internationale Michelin-Pokal noch recht interessante Kämpfe zeitigen dürfte. Bekanntlich verlangt der letztere mit 40000 Francs ausgestattete Preis, daß der Bewerber bis zum 31. Dezember dieses Jahres die größte Distanz in geschlossener Flugstrecke unter den Bedingungen des Reglements zurückgelegt hat, doch darf diese Distanz nicht weniger als 2000 km betragen. Aber auch die anderen großen Preise beginnen, das Interesse der Flieger wachzurufen. So hat sich soeben Legagneux mit einem Morane-Eindecker für den Pommery-Pokal einschreiben lassen, dessen laufende Halbjahrsprämie demjenigen Flieger zufällt, der den längsten Flug in gerader Linie ausgeführt haben wird. Natürlich steht jetzt unzweifelhaft im Vordergrunde allen Interesses das Große Internationale Wasserflugzeugrennen um den Pokal Schneider, für welches bekanntlich jede Nation drei Apparate zu melden das Recht hat. Von den Franzosen sind beim Aero-Club die Meldungen von 2 Nieuport, 2 Deperdussin, 2 Breguet, 1 Borel und Moräne eingegangen, so daß die Aviations-Kömmission des genannten Clubs sich gezwungen sieht, ein Ausscheidungsrennen zu veranstalten, um auf diese Weise die drei Vertreter Frankreichs bei dem entgiltigen Rennen festzustellen. Täglich treffen jetzt hier Berichte ein von den großartigen Flugleistüngen in den Kolonien und namentlich in Marokko haben die Leutnants Jeannerod und Magnien Flüge von insgesamt 200 km ausgeführt, die noch durch die zum Teil sehr hohen Gebirge besonders schwierig waren. Jeannerod hatte auf einem seiner Flüge den Motor in 1150 m Höhe zum Stehen gebracht und eine Landung in Spiralform vorgenommen, als das Flugzeug in einigen Metern vom Boden durch einen Windwirbel erfaßt und zur Erde geschleudert, wobei das Landungsgestell des Apparates bescsädigt wurde. Das schon früher erwähnte marokkanische Rekognoszierungs-Luftgeschwader hat inzwischen die von ihm zurückgelegte Distanz auf mehr als 2000 Kilometer gebracht. Unter den mannigfachen hervorragenden Leistungen der Flugzeuge im Balkankriege sei hier nur folgendes erwähnt: der russische Flieger Sakoff wurde von Nikopolis aus auf einem Maurice Farman (100 PS Renault) nach Janina geschickt, um dort bei der Belagerung mitzuwirken. Er hatte sechs Bomben an Bord. Natürlich wurde das Flugzeug mit Artilleriesalven begrüßt und zwei Schrapnells platzten dicht bei dem Apparat, ohne ihn indessen zu beschädigen. Der Flieger überflog in 1400 m Höhe das Fort Bizani, auf welches er seine sechs Bomben herabfallen ließ. Die Verwüstungen, welche die Explosivgeschosse anrichteten, waren gewaltige und eine furchtbare Panik brach unter der Garnison des Forts aus. Jetzt wollte Sakoff wieder nach Nikopolis zurückkehren, doch als er nur noch eine kurze Distanz von dieser Stadt war, bemerkte er, daß sein Benzin ausging. Das Reservoir war von einem der feindlichen Geschosse getroffen worden und hatte sich allmählich geleert, Sakoff landete ohne Zwischenfall im Schwebefluge auf gebirgigem Terrain in der Nähe von Luras, 20 km von Preverza, und gelangte nach einer schnell vorgenommenen Notreparatur heil nach seinem Standort. Jetzt ist hier eine Bewegung im Gange, eine weitere große Anzahl von Landungs-Terrains für Flieger anzulegen und die Militär-Verwaltung hat sich mit dem nationalen Comite in Verbindung gesetzt, um einen neuen Apell an das Land um Ueberlassung von Terrains und Geldmitteln zu erlassen. Unsere Voraussage, daß die französische Militärverwaltung neue und inten- sivere Anstrengungen zu machen im Begriff ist, um das Militärflugwesen weiter auszubauen und zu fördern, trifft demnach zu. Mit großem Interesse verfolgt man hier auch die Entwicklung des russischen Militärflugwesens, wo eine völlig neue Organisation in Aussicht steht. Da auch in Rußland die Zahl der Flieger mit jedem Tage wächst, hat Stchetinin, der Organisator der russischen Fliegersektion bei den alliierten Balkanstaaten, dem russischen Kriegsminister die Schaffung einer Flieger-Miliz vorgeschlagen, an der sämtliche Zivilflieger teilnehmen können. Der Minister und der Generaktab haben das Projekt gutgeheißen, und zwar werden die Zivilflieger jährliche Uebungsperioden durchzii-machen, sowie an den Manövern teilzunehmen haben. Ihre Organisation erfolgt in Geschwader- und Sektionsverbänden. Die Apparate der Miliz werden stets für die Mobilisierung bereit gehalten werden müssen. Außerdem veranstaltet der russische Generalstab im Monat August dieses Jahres einen großen Flugzeug-Bewerb, bei dem der wesentlichste Wert auf solche Vervollkommnungen gelegt werden wird, welche das Beobachten und das Zielen von Bord der Flugzeuge erleichtern. Der Kriegsminister hat für diesen Bewerb einen Kredit von 70000 Rubel verlangt, von denen 55 000 Rubel für Preise, die restlichen 15 000 Rubel für die Organisation bestimmt sind. Inzwischen ist nun auch hier nach langen mühseligen Verhandlungen der „Freundschafts-Bund der Flieger" endgiltig konstituiert worden, eine Schöpfung, die nicht ohne ein weiteres Interesse ist, denn der neue Bund hat nicht nur den Zweck, die gemeinschaftlichen Interessen der Flieger zu verteidigen, sondern in erster Reihe ein Korps freiwilliger Flieger zu schaffen. Die Militärbehörden, besonders der General Hirschauer, haben diese Neugründung mit allen Mitteln gefördert. Zum Präsidenten wurde Alfred Leblanc, zu Vizepräsidenten Garros und Vedrines, zum Schatzmeister Martinet, zum Sekretär Chambenoit gewählt. Ferner gehören dem Vorstande an: Senator Reymond, Weymann, Molla, Fourny, Daueourt, Bregi, Legagneux, Prevost, Guillanx, Helen, Goby und Champel. Der Bund zählt bereits 130 Mitglieder. PJ. Konstruktive Einzelheiten.*) Die Startvorrichtung von Rubery Owen & Co. besteht in der Hauptsache aus zwei gabelartigen Blechen, die unter Einfügung eines Zwischenbleches an dem ßefestigungspunkte a an-einandergenietet sind. In dem Zwischenraum ist ein hakenartiges *) Unter dieser Rubrik sollen in Zukunft in zwangloser Folge Einzelteile besprochen werden. Blechstück h eingefügt, das sich um den Nietbolzen c dreht. In geschlossenem Zustande wird der Haken b durch die Sperre d arretiert, durch die Feder e mit dem Haken b in Eingriff erhalten. Durch Lüften der Sperre d wird der Haken b ausgelöst und gibt die in der Oeffnung f festgehaltene Seilschlinge frei. (Abb. i) Eine praktische Bolzensicherung, die in der mannigfaltigsten "Weise verwendet werden kann, ist in nebenstehender Abb. 2 wiedergegeben. Am Ende des Bolzens a befindet sich ein Riegel b, der um Nietbolzen c drehbar gelagert ist. Drückt man die Feder d zusammen, so kann man den Riegel b in Richtung des Bolzens a einstellen und denselben heraus ziehen. Abb. 1 u. 2. Strebenschuhbefestigung mittels Laschen für Doppeldecker. Die beistehende Abbildung 3 zeigt eine perspektivische Ansicht obiger Befestigung. Ein gegossener Aluminiumschuh besitzt in seinen Flanschen zwei zargenartige Einsprünge. In dieselben kommen zwei Stahlblechlaschen zu liegen, die am Ende mittels zwei Schrauben in der Nute festgehalten werden. Auf der Unterseite des Holmes liegen ebenfalls zwei Laschen. Bei dieser Ausführungsform wird eine Durchbohrung des Holzes vermieden. Versteilvorrichtung für Auslegerstützen bei Doppeldeckern. (Abb. 4.) Zwischen 2wei Blechstegen, die am Holm des Unterdecks befestigt sind, liegt ein kardanartiges Fassonstück. Dasselbe wird mit einem Durchgangsbolzen festgehalten. Hieran greift ein gabelartiges Stahlstück, das am Ende mit einem Gewindezapfen versehen ist. Am Boden der Stahlrohrstütze ist ein mit Gewinde versehenes Stahlstück eingelötet. Der Zapfen wird in das Gewinde eingeschraubt und gestattet hierdurch eine Verstellung der Ausleger. Beim Einziehen derselben kann man die Auslegerstützen wegdrehen, ohne dieselben vom Unterdeck abschrauben zu müssen. 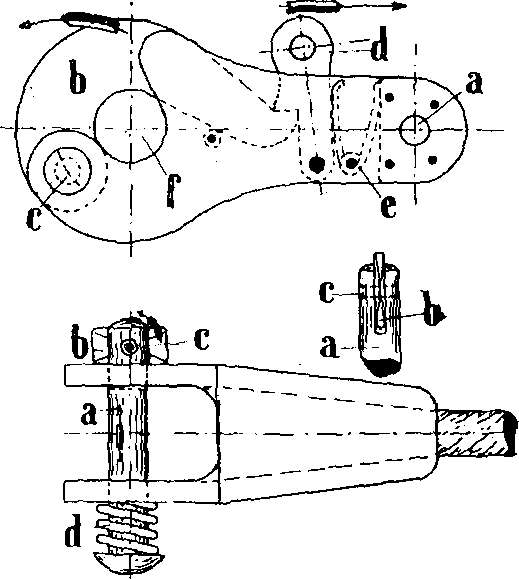 Die Wettbewerbe der National-Flugspende. Um mehrfache Anfragen zu erledigen, sei noch einmal darauf hingewiesen, daß jeder Bewerber versichert sein muß. Ferner soll in folgendem das System an einigen Beispielen (Vergl. auch die Bestimmungen S. 153 bis 15() in No. 5 des Flugsport) erläutert werden: Die Flugleistungen können bestehen 1) in einem gewöhnlichen Fluge auf dem Flugplatz, bei dem lediglich die Zeitdauer des ununterbrochenen Fluges für jede Stunde mit 1000 M gewertet wird, 2) in einem Passagierfluge, der 30 km vom Flugplatz sich entfernen muß und mit 1500 M für jede Stunde ununterbrochenen Fluges bewertet wird, 3) in einem Passagierfluge über Land innerhalb 24 Stunden mit beliebigen Zwischenlandungen. Bei letzterem Fluge wird eine Rente für den Inhaber des jeweiligen Rekords bei einer Mindeststrecke von 500 km bezahlt. Sämtliche Flüge können derart miteinander verbunden werden, daß derjenige, der z. B. 500 km mit Passagier über Land fliegt und dabei 6 Stunden ununterbrochen in der Luft bleibt, erhält: 1) 6 X 1500 M = 9000 M, 2) Rente für Zeit bis zu 10 000 M, 3) Rente für Strecke bis zu 15 000 M. Wird et überboten, so fällt die betreffende Rente von diesem Zeitpunkt an demjenigen zu, der eine längere Zeit in der Luft bleibt oder eine längere Strecke durchfliegt. Die Rente kann jeder sich auch ein zweites Mal erfliegen, während die Stundenpreise für jede Stunde nur einmal gezahlt werden. Fliegt ein anderer also 550 km in ununterbrochenem 7 stündigem Fluge, so erhält dieser; 1) 7 X 1500 M = 10500 M, 2) Rente für Zeit bis zu 10000 M, 3) Rente für Strecke bis zu 15000 M. Fliegt darauf der im ersten Beispiel Genannte 600 km in 8 stündigem ununterbrochenen Fluge, so erhält er: 1) Zusatzprämie für 2 Stunden = 3 000 M, 2) Rente für Zeit bis zu 10000 M, 3) Rente für Strecke bis zu 15000 M. Um Unglücksfälle bei den Bewerbungen um die Preise der I Nationalflugspende nach Möglichkeit zu vermeiden, sind die Sport- I zeugen durch Vermittelung des Deutschen Luftfahrerverbandes ersucht | worden, ihre Tätigkeit als Sportzeugen in allen Fällen abzulehnen, in denen Flugzeuge verwendet werden sollen, die den an ihre Sicher-;: heit zu stellenden Anforderungen nicht entsprechen. Die Flugplatz- verwaltungen sind gebeten worden, derartige Flugzeuge nach Möglichkeit auszuschließen. Ferner hat der Deutsche Luftfahrerverband auf Veranlassung der Nationalflugspende Formulare , zur Aufzeichnung über die Flug-j leistungen bei Bewerbungen um Preise der Nationalflugspende drucken und an die Heimatvereine verteilen lassen. Die Sportzeugen müssen diese der betreffenden Flugleistung entsprechend ausfüllen, unterzeichnen und ihre Unterschriften vom Heimatvereine beglaubigen lassen. Der Heimatverein gibt das Formular dem Luftfahrerverbande weiter, der es bei der Geschäftsstelle der Nationalf lugspende einreicht. Diese gibt dann dem Bankhaus Mendelsohn, Berlin W 56, Jägerstrasse 49/50 Anweisung, den betreffenden Betrag dem Berechtigten auszuzahlen.  Der Bewerb für die Sicherheit auf der Flugmaschine. Wie seinerzeit berichtet worden ist, hat die französische „Union für die Sicherheit auf der Flugmaschine" beschlossen, einen Bewerb zu veranstalten, der ausschließlich dem inredestehenden Problem gewidmet sein soll. Man hat es in Fliegerkreisen auffällig vermerkt, daß das Reglement für diesen Wettbewerb so lange auf sich warten ließ, indessen dürfte die Verzögerung der Bekanntgabe wohl auf finanzielle Fragen zurückzuführen sein, die sich umso leichter erklären lassen, als es sich um eine Veranstaltung handelt, an welcher zahlreiche Gruppen von Interessentenvereinigungen teilnehmen, so wie sich die Union selbst aus derartigen Gruppen zusammensetzt. Man hat bekanntlich die beträchtlichen Mittel, mit denen man den Bewerb ausstatten wollte, im Wege der Subskription aufbringen wollen und hat hierin einen unerwartet großen Erfolg gehabt. Bis zum 7. März waren im ganzen 582511 Francs gezeichnet worden, darunter 300000 Francs vom französischen Kriegsministerium und 5000 Frs. vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten, sowie 25000 Francs vom Aero Club de France, 10000 Francs vom Automobil-Club de France, 10000 Francs vom Touring-Club de France usw. Nunmehr ist der Bewerb eröffnet, und zwar auf Grund des nachstehenden Reglements : 1. Es können an dem Bewerbe nur Apparate in absolut betriebsfähigem Zustande teilnehmen, die bereit sind, unter den gleichen Bedingungen ausprobiert zu werden, unter denen ihre endgiltige Verwendung gedacht ist. Irgendwelche Pläne, beigegebene ergänzende Erklärungen oder verkleinerte Modelle werden von der Jury nicht berücksichtigt werden. Nur Erfindungen, welche unter den vorstehend angegebenen Voraussetzungen zum Bewerb gebracht werden, können auf Prüfung Anspruch erheben. 2. Ein „Großer Preis" in Höhe von 400000 Francs wird als Entschädigung für den Erfinder und Hersteller eines Apparates bestimmt, welchen die Jury des Bewerbs dahin beurteilt, daß er mit Bezug auf die Sicherung des Maschinenfluges ein außergewöhnliche < Interesse erweckt. Dieser Preis von 400 000 Francs wird nicht unter mehrere Bewerber teilbar sein. 3. Prämien, deren Höhe später von der Jury festgesetzt werden wird, die aber nicht weniger als 20000 Francs betragen werden, sind für die Erfinder solcher Apparate vorgesehen, welche ein beträchtliches Intresse beanspruchen können- Die Gesamtsumme dieser Prämien, ihre Anzahl und ihre Höhe, hängt von der Gesamtsumme der Gelder ab, die durch die Subskription eingehen werden. Von dieser Summe kommen außer den für den „Großen Preis" bestimmten 400000 Francs noch 5°/o in Abzug, welch letztere die Kosten der Organisation zu decken bestimmt sind. Außerdem wird der Betrag der nicht rückerstatteten Eintragungsgelder gleichfalls dem für die Prämien reservierten Fonds zugeführt werden. 4. Angehörige aller Nationalitäten können an dem Bewerbe teilnehmen. 5. Die Bewerber haben ihren Wunsch, sich in die Bewerberliste eintragen zu lassen, durch eingeschriebenen Brief an den Präsidenten der Union für die Sicherheit im Flugzeug („Union pour la Securitö en Aeroplane") zu Paris, 35. Rue Francois I., zu richten. Diese Einragungsgesuche sind von jetzt ab bis zum 31. Dezember 1913 (einschließlich) zulässig und zwar gilt das Datum des Post-Aufgabe-stempels. Jeder dieser Anträge muß von dem Nennungsgeld in Höhe von 200 Francs begleitet sein. Er wird nur dann als giltig angesehen werden, wenn ihm außerdem beigefügt sind: a) eine kurz gefaßte, aber hinreichend verständliche Beschreibung des angemeldeten Apparats, seines Grundprinzips und seiner Anwendung im Betriebe, unter Beifügung vou Skizzen und Zeichnungen zur besseren Uebersicht; diese Beschreibung wird die besonderen Eigenschaften des Apparats zu präzisieren haben, die nach Ansicht des Bewerbers einen Fortschritt mit Bezug auf die Sicherheit des Maschinenfluges darstellen; b) eine Zustimmungserklärung zu dem hier wiedergegebenen Reglement des ßewerbes; c) eine Erklärung, durch welche die Union, ihre Vertreter und Agenten gegenüber dem Bewerber oder seinen Bevollmächtigten von jeder Verantwortlichkeit mit Bezug auf das Bekanntwerden der betreffenden Erfindung befreit werden; d) eine Erklärung, durch welche die Union, ihre Vertreter und Agenten von jeder Verantwortlichkeit für Unfälle befreit werden, welche im Laufe der Demonstrationen und Versuche der betreffenden Erfindung sich ereignen können; e) eine Option zugunsten der französischen Regierung auf den Ankauf der Erfindung, für den Fall, daß dieser Erfindung mindestens eine Entschädigung von 50000 Francs zugefallen ist. Diese Option wird bis zum 1. Januar 1915 giltig sein müssen. Für diese verschiedenen Verpflichtungs-Erklärungen sind F'ormu-lare im Sekretariat der Union niedergelegt. 6 Jedem Bewerber wird eine zur Teilnahme am Bewerb berechtigende Empfangsbestätigung der Anmeldung zugehen, sobald die Union über die Annahme der Anmeldung beschlossen haben wird. Diese Empfangsbestätigung verpflichtet die Union nicht zur Prüfung der angemeldeten Erfindung, sofern die Jury bereits über die zur Verfügung stehenden Gelder verfügt hat; in diesem Falle aber wird das Nenngeld zurückerstattet. 7. Eine Jury wird beauftragt, die Apparate zu prüfen, alle ihr erforderlich erscheinenden Experimente vornehmen zu lassen und den „Großen Preis" und die Prämien zuzuteilen. Die Entscheidungen der Jury sind endgiltig, sie werden aber erst nach Homologierung durch die Union rechtsgiltig. 8. Die Jury wird aus 15 Mitgliedern zusammengesetzt sein, von denen zehn durch die Union, eines durch den Minister der öffentlichen Arbeiten, eines durch den Marineminister und drei durch den Kriegsminister ernannt werden. 9. Für die Sitzungen der Jury werden bestimmte Daten nicht festgesetzt; sie wird vielmehr auf Einladung ihres Präsidenten zu- sammentreten. Auf Verlangen von fünf Jury-Mitgliedern muß aber der Präsident innerhalb zweier Wochen eine Sitzung der Jury anberaumen. 10. Die angemeldeten Apparate in demjenigen Zustande, wie er durch das vorstehende Reglement verlangt ist, müssen spätestens zwei Monate nach Eintreffen der Anmeldungserklärung zur Disposition der Jury gehalten werden. Auf Grund eines vom Präsidenten der Jury auszustellenden Zertifikats wird das Nennungsgeld von 200 Francs jedem Bewerber zurückerstattet werden, welcher den vorstehenden Vorschriften genügt haben wird. Die Jury wird entweder selbst oder durch von ihr delegierte Kommissare die Prüfung der eingereichten Apparate vornehmen. Sie wird Ort und Datum für diese Prüfung bestimmen und wird dann diejenigen Experimente vornehmen lassen, die sie für zweckmäßig hält. Für diese Experimente übernimmt der Bewerber dadurch, daß er selbst sie auszuführen hat, die volle Verantwortlichkeit. Ein Apparat wird um den „Großen Preis" nur dann konkurrieren können, wenn er sich in flugbetriebsfähigem Zustande an einem Flug über 100 km in geschlossener Rundstrecke, bei einer durchschnittlichen Fluggeschwindigkeit von mindestens 60 km in der Stunde, beteiligt hat. 11. Die Beurteilung der Apparate im Bewerbe wird eine rein individuelle und nicht eine vergleichende sein. Die Zuteilung des Großen Preises und der Prämien wird deshalb erfolgen können, sobald sich die Jury imstande glauben wird, über einen Apparat ein end-giltiges Urteil zu fällen. Diese Entscheidungen der Jury sind nur dann giltig, wenn sie in Sitzungen gefaßt sind, an denen wenigstens *U der Mitglieder teilgenommen haben und wenn sie mit mindestens "U Majorität der anwesenden Mitglieder zustande gekommen sind. 12. Die Entscheidungen der Jury werden den Interessenten mitgeteilt werden, sobald sie definitiv geworden sind. Wenn der Große Preis zugeteilt wird oder wenn die für Prämien zur Verfügung stehenden Gelder erschöpft sein werden, wird den Bewerbern davon Mitteilung gemacht werden. 13. Der Bewerb wird am 1. Juli 1914 geschlossen ; mit diesem Tage erlischt auch die Vollmacht der Jury. Rl. Der L. V.G.-Flugzeug-Transport- u. Reparaturwagen. (System Schneider.) Ein Faktor, der bei dem Bau von modernen Militärflugmaschinen immer mehr in konstruktiver Beziehung Berücksichtigung findet, ist die Möglichkeit der schnellen Demontage und Transportierung auf besonders geschaffenen Fahrzeugen. Es ist vollständig klar, daß eine Flugmaschine nicht jeder Zeit bei militärischen Uebungen von ihrem Concentrationslager nach dem Orte auf dem Luftweg gebracht werden kann, wo sie momentan zur Ableistung eines Erkundungsfluges benötigt wird. Ungünstige Witterungsverhältnisse, schlechtes Gelände zum Starten, sowie sonstige Umstände können dazu beitragen, daß die Maschine nicht mit eigener Kraft ihr Lager verlassen kann. Um nun dieses Hindernis aus dem Wege zu räumen, sind zwei Möglichkeiten vorhanden, eine Fhigmaschine auf dem Erdboden zu befördern: 1. Durch eigene Kraft, mit Hilfe eines besonderen, eingebauten Getriebes, das in die Laufräder des Fahrgestells eingreift; 2. Mit Hilfe eines Trakteurs, wobei die Flugmaschine in einem Anhängewagen verpackt, mittels Zugtieren oder Lastautomobilen befördert werden kann, oder auch, durch Vereinigung dieser beiden Organe durch Schaffung eines Fahrzeuges, das gleichzeitig als Transport- und Zugmittel konstruiert ist. Versuche anzustellen, die Flugzeuge durch ihre Krait mit Hilfe von Getrieben fortzubewegen, dürften als hoffnungslos zu bezeichnen sein, denn es ist praktisch unmöglich, den Propeller als Antriebsmittel zu benutzen. Es muß aber auch betont werden, daß der Einbau von Uebertragungsorganen nach dej^Laufrädern des Fahrgestells größere Schwierigkeiten bietet, als es im ersten Augenblick scheint. Man darf niemals vergessen, daß die Laufräder infolge 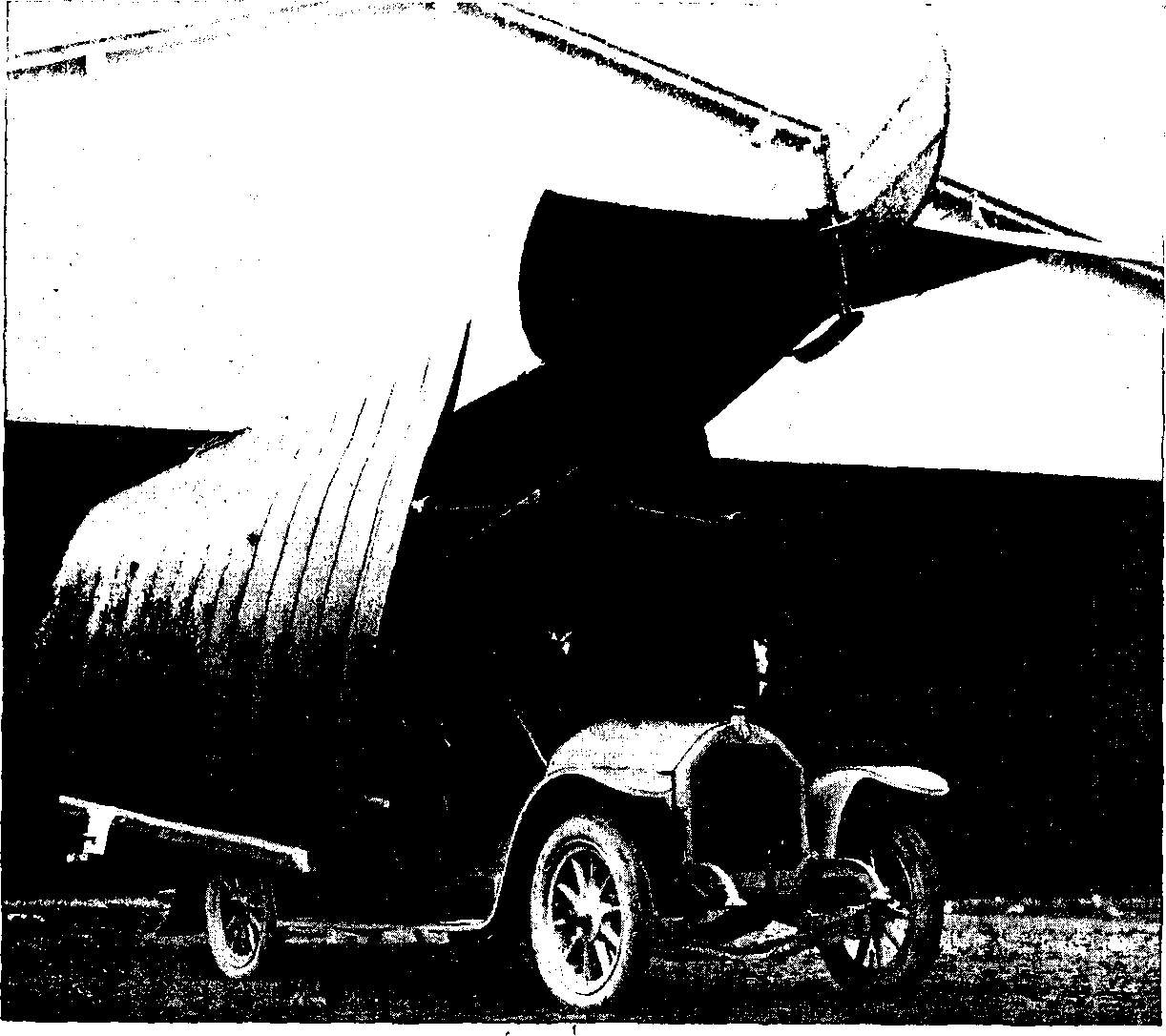 Der L. V. Q-Flugzeug-Transport- und Reparatur-Wagen,System Schneider ihrer hedingten Federungen niemals gleichen Abstand halten können mit dem Antriebsorgan, mit anderen Worten, die Achsen des Motors und der Laufräder sind bei dem Fahren auf dem Boden niemals in konstanter Entfernung, wodurch eine technisch richtige Kraftübertragung ausgeschlossen ist. Das Mehrgewicht des Einbaues dieser Organe ist natürlich auch ein Faktor, der bei unseren heutigen nicht allzuleichten Flugmaschinen eine Rolle spielt. Ein sehr interessanter Flugzeug-Transport- und Regaraturwagen ist vor einiger Zeit von der Luf t-V erkehrs-Gesellsch af t in Johannisthal, nach den Plänen ihres Konstrukteurs, Ing. Schneider, erbaut worden. Das Fahrzeug ist für den Transport von Eindeckern und Rumpfdoppeldeckern mit vornliegendem Motor bestimmt. Wie die Abbildung erkennen läßt, (Vergl. auch die Abb. auf Seite 202 in No. 6) sind die verschiedenen Gesichtspunkte bei dem Bau des Wagens in hervorragendem Maße berücksichtigt worden. Derartige Fahrzeuge haben den Vorteil, daß ihre Gesamtlänge lediglich die der Flugmaschine ist, während bei anderen Konstruktionen die Länge sich aus Anhängewagen plus Zugm ttel zusammensetzt. Die Wendigkeit von kombinierten Transportwagen ist natürlich eine viel größere, als es bei anderen der Fall ist. Treten z. B. bei großen Zugkolonnen auf der Landstraße Stockungen ein, so ist besonders das Rückwärtsmanöverieren sehr leicht zu bewerkstelligen, was man von anderen Fahrzeugen nicht behaupten kann. Der Hauptvorteil liegt jedoch in der großen Eigengeschwindigkeit dieser Typen, wodurch ein ganz erheblicher Gewinn im militärischen Interesse erzielt wird. Als Unterbau und Fortbewegungsmittel dient ein normales 30 PS^ Benz-Chassis, auf dem sich die übrigen Teile in harmonischer Art aufbauen. Direkt hinter dem Führersitz befindet sich der große Werkzeug- und Reparaturkasten, der gleichzeitig als Hauptstützpunkt für die Aufnahme des Fiugmaschinenkörpers dient. Die Verschlußtür des Reparaturkastens ist derartig ausgebildet, daß sie beim Oeffnen einen Schraubstock trägt und als Werkbank benutzt werden kann. In dem Innern des Schrankes sind Ersatzteile, Werkzeuge, ein vollständiger Schweißapparat und ein Zelt für die Bedienungsmannschaften untergebracht. Der Rumpf der Flugmaschine wird rückwärts auf das Fahrzeug hinauf geschoben und die Achsstummel in ihren Lagern durch Keile fixiert, sodaß der ganze Apparat fest und sicher mit dem Fahrzeug verbunden ist. Die Tragflächen der Flugmaschine werden in gefütterten Rinnen zu beiden Seiten des Wagens für den Transport befestigt und durch starke Bänder verspannt. Ueber jedem Trittbrett befindet sich noch ein Sitz, sodaß im ganzen vier Personen in dem Fahrzeug mitfahren können. Die größte Höhe beträgt 3,80 m und gestattet das Passieren sämtlicher staatlichen Unterführungen. Die größte Oberbreite ist 1,70 m, sodaß der Wagen selbst in kleinen Gassen fahren kann. Bei den Versuchen hat sich dieser Transportwagen auf das Beste bewährt und erzielte eine Maximal-Geschwindigkeit von 55 km pro Stunde, ohne dabei die Steuerung zu erschweren und die Sicherheit der Insaßen zu gefährden. Ausbau des Marine - Luftfahrtwesens. Im Ergänzungsetat ist eine Nachforderung von 3 Millionen Mark für das Luftschiff- und Flugwesen enthalten. In der beigegebenen Denkschrift heißt es: Die Marineverwaltung muß mit der Beschaffung und dem Betriebe von Luftschiffen und Flugzeugen nebst den erforderlichen Nebenanlagen in größerem Umfang vorgehen als bisher in Aussicht genommen war, wenn sie nicht anderen Nationen gegenüber ins Hintertreffen kommen will. Für Flugzeuge ist die Errichtung von 1 Mutterstation und von 6 Außenstationen mit einem Bestände von 50 Flugzeugen geplant, von denen 6 Gruppen zu 6, zusammen 36 Flugzeuge in Dienst gehalten werden sollen. 14 Flugzeuge dienen als Materialreserve. Die Mutterstation ist als Standort für alle 6 Gruppen gedacht; sie soll mit einem Flugplatz und mit allen zu Uebungszwecken, zur Ausrüstung, Instandsetzung und Unterbringung von Flugzeugen und Personal erforderlichen Anlagen ausgestattet werden. Es ist beabsichtigt, die Außenstationen im Kriege ständig zu besetzen, im Frieden dagegen nur zu einzelnen Uebungen. Die Außenstationen erhalten Einrichtungen zur Unterkunft für je 10 Flugzeuge mit zugehörigem Personal, zur Lagerung von Brennstoff und für geringfügige Instandsetzungen. Die Flugzeuge sollen nach Bedarf ersetzt werden. Kosten. 1. Luftschiffe Zur Durchführung des vorstehenden Planes sind während der Jahre 1914 bis 1918 35 Millionen Mark erforderlich. Hiervon entfallen rund 11 Millionen Mark auf die Beschaffung von Luftschiffen, 14 Millionen Mark auf die Herstellung der Landanlagen und 10 Millionen Mark auf laufende Kosten (Luftschiffsbetrieb und -Instandsetzung, Betriebskosten der Landanlagen, Subventionen für private Hallen und Luftschiffe usw.) In diesen Beträgen sind sämtliche einmaligen und fortdauernden Aufwendungen für die Luftschiffe und ihren Betrieb enthalten bis auf die für das Personal, dessen Gesamtstärken und Kosten unter No. 3 veranschlagt sind. Da bereits in der Kostenberechnung, Anlage 4 zum Entwürfe der Flottengesetznovelle vom 14. Juni 1912 (Reichstagsdrucksache No. 353 der 13. Legislaturperiode, 1. Session 1912), für die Jahre 1914 und 1915 mit jährlich 2 Millionen Mark, zusammen mit 4 Millionen Mark zu Luftschiffzwecken gerechnet worden ist, so beträgt der Mehrbedarf in den 5 Jahren 1914 bis 1918 im ganzen 31 Millionen Mark. 2. Flugzeuge. Die Flugzeuge erfordern in den Jahren 1914 bis 1918 im ganzen 9 Millionen Mark. Hiervon entfallen rund 3 Millionen Mark auf die Beschaffung der Flugzeuge, 4 Millionen Mark auf die Landanlagen und 2 Millionen Mark auf den Betrieb. Auch in diesen Beträgen sind alle Kosten enthalten bis auf die des Personals. 3. Personalkosten. Für die vorstehend erläuterten Luftfahrzwecke für die Zeit 1914—1918 ist ein Personal von 1452 Deckoffizieren, Unteroffizieren und Manschaften erforderlich. Diese Gesamtstärke soll durch alljährliche Steigerung bis zum Jahre 1918 allmählich erreicht werden. Die Besoldung und Verpflegung dieses Personals wird für die Jahre 1914 bis 1918 einschließlich etwa 6 Millionen Mark erfordern. 4. Gesam tkosten. Demnach erfordert die Entwicklung der Luftschiffe und Flugzeuge für die Marine - soweit jetzt zu übersehen ist — in den 5 Jahren von 1914 bis 1918 einschließlich des Personals insgesamt 50 Millionen Mark. Hiervon werden etwa 32 Millionen auf Schiffe und Landanlagen, 12 Millionen auf Betrieb und Unterhaltung, 6 Millionen auf das Personal entfallen. Die Höhe der Jahresraten beträgt demnach durchschnittlich 10 Millionen Mark, ihre Bemessung im einzelnen muß aber naturgemäß den besonderen Bedürfnissen jedes Jahres angepaßt werden und deshalb vorbehalten bleiben. Wichtige Bestimmungen des deutschen Luftfahrer-Verbandes. Wie von der F. A. I. die Rekorde für Flugzeuge anerkannt werden. Dauer: Längste Dauer bei geschlossenem Flugweg ohne Zwischenlandung. Flieger allein. Flieger mit einem Fluggast. Flieger mit zwei Fluggästen usw. Entfernung. Größte Entfernung bei geschlossenem Flugweg ohne Zwischenlandung. Flieger allein. Flieger mit einem Fluggast. Flieger mit zwei Fluggästen usw. Geschwindigkeit. Größte Geschwindigkeit bei geschlossenem Flugweg. Flieger allein. Flieger mit einem Fluggast. Flieger mit zwei Fluggästen usw. Auf: 5 km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 100 km 150 km 200 km 250 km 300 km 350 km 400 km 450 km 500 km und weiter um je 100 km. Geschwindigkeit in gegebener Zeit. Geschlossener Flugweg. Flieger allein. Flieger mit einem Fluggast. Flieger mit zwei Fluggästen usw. \'4 Stunde ϖ/ϖ » 1 2 Stunden 3 4 „  7 8 9 10 Größte Geschwindigkeit. Geschwindigkeit in der Stunde bei geschlossenem Flugweg ohne Rücksicht auf die Dauer des Fluges. Flieger allein. Flieger mit einem Fluggast. Fljeger mit zwei Fluggästen usw. Höhe (über den Aufstiegpunkt). Flieger allein. Flieger mit einem Fluggast. Flieeer mit zwei Fluggästen usw. Die Höhe ist zu bestimmen durch plombierten Barographen oder Maxitnal-Höhenmesser aus dem die Höhe zu ermitteln ist gemäß dem Anfangsdruck, ohne Feuchtigkeits- oder andere Korrektur. Das plombierte Instrument ist nach der Flugleistung einer wissenschaftlichen Stelle zur Prüfung zu übersenden. Die Prüfungsbescheinigung ist dem Gesuch um Anerkennung beizufügen. An welche wissenschaftliche Stelle das Instrument einzusenden ist, ist in jedem Fall von der Geschäftsstelle des D. L. V. zu erfragen. Fluggäste. Zur Gültigkeit der Rekorde müssen die Fluggäste mindestens 18 Jahre alt sein und jeder Einzelne mindestens 65 Kilo wiegen; sie dürfen auf dieses Gewicht durch Ergänzung mittelst Ballast gebracht werden, Die Verrechnung des eventl. Mehrgewichts des Fliegers oder eines Fluggastes ist nicht zulässig. Die Feststellung des Gewichts hat vor und nach der Flugleistung stattzufinden. Flugprüfer. Die in den Flugbestimmungen des D. L. V. vom 15. Dezember 1912 und in den Bestimmungen für die Erwerbung des Flugführerzeugnisses als „Sportzeugen" bezw. „Flugsportzeugen" bezeichneten Funktionäre erhalten künftig die Bezeichnung „Flugprüfer". Ihre Ernennung geschieht nach den folgenden Bestimmungen: 1. Die Flugprüfer des D. L. V. werden von den Heimatvereinen vorgeschlagen und von der Flugzeugabteilung ernannt unter gleichzeitiger Erteilung einer Bestallung nach untenstehender Vorlage. Zu Flugprüfern dürfen nur männliche Angehörige eines Heimatvereins des D. L. V. ernannt werden, die auf dem Gebiet des Flugwesens als Sachverständige anzusprechen sind. (S. auch unter 9.) 2. Besitzer und Leiter von Fabriken, Fabrikangestellte, Berufsflieger für Fabriken sollen in der Regel nicht zu Flugprüfern ernannt werden. In besonderen Fällen, wo eine Ernennung derartiger Personen unumgänglich erscheint, ist der Vorschlag zur Ernennung der Flugzeugabteilung gegenüber besonders zu begründen. 3. Die Vereine sind dem D. L. V. für alle Folgen verantwortlich, die sich aus der Tätigkeit ihrer Flugprüfer ergeben; insbesondere, wenn durch die nicht ordnungsgemäß erfolgte Prüfung eines Flugschülers irgend welche Nachteile entstehen. Die Vereine sind ferner für die Erfüllung der den Flugprüfern aufzuerlegenden Bedingungen verantwortlich. 4. Die Flugprüfer haben die unter 5 aufgestellten Bedingungen zu erfüllen, bevor sie von ihren Heimatvereinen vorgeschlagen werden können. 5. Bedingungen, die vor der Anmeldung zum Flugprüfer erfüllt sein müssen: a) Vollendung des 21. Lebensjahres. b) Möglichste Unabhängigkeit — s auch unter 2. c) Genügende Kenntnis der Bestimmungen der F. A. 1. und der Flugbestimmungen des D. L. V., insbesondere der Prüfungs- und Rekordbestimmungen. d) Der Nachweis der Kenntnis der Prüfungsbestimmungen für Flugführer muß gelegentlich einer Prüfung erbracht sein, worüber ein Protokoll dem D. L. V. einzureichen ist. Als Nachweis für die abgelegte Prüfung dem Verband gegenüber genügt eine Bescheinigung des Vorstandes des vorschlagenden Heimatvereins. 6. Die Mitglieder der Flugzeugabteilung sind berechtigt, ohne weiteres als Flugprüfer zu amtieren. 7. Die Flugprüfer müssen sich schriftlich verpflichten, auf Anfordern, soweit dies ihre Zeit irgendwie gestattet, Prüfungen abzuhalten. 8. Flugprüfer können den Ersatz für Auslagen, die ihnen bei der Prüfung, insbesondere auch durch Hin- und Rückweg zur Prüfung entstehen, von dem Auftraggeber der Prüfung anfordern. Besondere Abmachungen in dieser Richtung bleiben den Vereinen vorbehalten. 9. Die gemäß Ziffer 18 d der Flugbestimmungen bei Wettbewerben anzulegende Binde ist nur von den jeweiligen amtierenden Flugprüfern zu tragen. 10. Die Entziehung der Bestallung kann durch den betreffenden Heiinat-verein bei der Flugzeugabteilung beantragt werden Der Antrag ist zu begründen. Die Flugzeugabteilung ist auch berechtigt, ohne einen solchen Antrag und ohne Angabe von Gründen die Bestallung: zu entziehen Eine Berufung an den Vorstand ist statthaft. Dessen Entscheidung ist endgültig. Bestallung als Flirgprüfer. Herr....., wohnhaft zu (Adresse) ..... wird auf Antrag des (Name des Vereins).....zum Flugprüfer ernannt. Er verpflichtet sich durch gleichzeitige Unterschrift auf diesem Schein, das Ehrenamt nach Ehre und Gewissen getreulich warzunehmen. ........den .... 19 . . Berlin, den........19 . . Unterschrift des Flugprüfers. Deutscher Luftfahrer-Verband. Vom 1. April d. J. ab dürfen nur die den vorstehenden Bestimmungen gemäß ernannten Flugprüfer die in den Flugbestimmungen den Sportzeugen bezw f-'lugsportzeugen zugewiesenen Funktionen ausüben. Bis dahin bleibt die Befugnis zur Ausübung dieser Funktionen für die bisher ernannten Sportzetigen in Kraft. Prüfungsbedingungen für Zeitnehmer. 1. Zeitnehmer sind besoldete, ausnahmsweise auch ehrenamtliche Organe des D. L. V. 2. Die Flugzeugabteilung überträgt die Prüfung der Zeitnehmer den Heimatvereinen. Die Prüfung hat ein sachverständiger Zeitnehmer in Gegenwart von zwei Flugprüfern abzunehmen. Für die ersten Prüfungen sind anerkannte Zeitnehmer eines anderen Sports heranzuziehen; diese können von der Flug* zeugabteilung ohne Förmlichkeit einer Prüfung auch im Luftfahrwesen zugelassen werden. 3. Zeitnehmer können 'unbescholtene männliche Personen werden, deren Zuverlässigkeit außer Zweifel steht. Sie müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. 4. Die Prüfung der Zeitnehmer erstreckt sich auf nachstehende Punkte: Der Zeitnehmer muß eine Stoppuhr, die den Anforderungen von Punkt 2 des Art. 54 der Bestimmungen der F. A. 1. und 20 b der Flugbestimmungen des D. L. V. entspricht, nach folgenden Prüfungsbestimmungen bedienen können. Es sind zu stoppen a) Die Zeitdauer des Durchfahrens einer festgelegten Fahrstrecke durch einen Radfahrer. b) Die Zeitdauer das Durchfahrens einer festgelegten Fahrstrecke durchwein Automobil. c) Der fliegende Start eines Radfahrers. d) Der fliegende Start eines Automobils. e) drei Startzeiten eines Flugzeugs, gerechnet wird die letzte Bodenberührung f) drei Zeiten beim Landen eines Flugzeugs (Bodenberührung). g) drei Zeiten des fliegenden Starts eines Flugzeugs. 5. Der Zeitnehmer muß die gewonnenen Zeiten in Form eines Berichtes festlegen können. 6. Der Zeitnehmer muß die Kenntnis der in den Satzungen und allgemeinen Vorschriften der F. A. I. (Ausgabe 1912) Art. 53 - 65 enthaltenen Grundsätze sowie der Flugbestimmungen des D. L. V. vom 15. 12. 1912 durch Beantwortung bezüglicher Fragen nachweisen. 7. Geprüfte Zeitnehmer haben einen Revers zu unterschreiben, in welchem sie sich verpflichten, nach Ehre und Gewissen ihr Amt getreulich zu verwalten. Dieser Revers ist der Geschäftsstelle des D. L. V. einzusenden. 8. Die Tätigkeit der Zeitnehmer unterliegt der Anordnung der Sportleiter. 9. Zeitnehmer erhalten ein Zeugnis, das vom Vereinsvorstand auszustellen und vom Vorsitzenden der Flugzeugabteilung mitzuunterzeichnen ist, und führen die Bezeichnung „Amtlicher Zeitnehmer des Deutschen Luftfahrer-Verbandes". Sie tragen nur in Ausübung ihrer Tätigkeit die in Ziffer 20 h der Flugbestimmungen vorgeschriebene Binde. 10. Beamtete Zeitnehmer haben nach folgendem Tarif zu arbeiten: Nach auswärts: Fahrkarte 11. Klasse hin und zurück, 25 M. Tagegeld. Am Ort: Einschließlich Auslagen für Fahrgelegenheit 15 M. pro Tag. Die Kosten müssen von dem Auftraggeber getragen werden. Ehrenamtliche Zeitnehmer können die Kosten der vereinbarten Fahrgelegenheit liquidieren. Flugplatzangestellte sowie Angehörige dort wohnender Firmen erhalten mindesten 6 M. bis zur Zeitdauer von drei stunden, für jede weitere Stunde 1,50 M. Jedoch dürfen die Gesamtkosten 15 M. pro Tag nicht übersteigen. Der Präsident des Deutschen Luftfahrer-Verbandes. Fr ei h e rr v. d. G ol tz. Protokollformular für Flüge um Preise aus der Nationalflugspende. Gemäß Ziffer VI der Bestimmungen des Kuratoriums der Nationalflugspende über die Zuverlassigkeitsprei.se der Nationalf lugspende und gemäß den Bestimmungen über den Nationalf 1 ugpreis erfolgt die Kontrolle der Flugleistungen durch einen Fliegeroffizier oder zwei vom Deutschen Luftfahrer-Verbande anerkannte Flugprüfer nach dessen allgemeinen Vorschriften. Hierzu werden seitens des Verbandes, entsprechend den Protokollformularen für die Flüge zur Erlangung des Flugfuhrerzeugnisses, besondere Protokollformulare ausgegeben, auf welchen die Flugleistungen seitens der nach den vorstehenden neuen Bestimmungen ernannten Flugprüfer zu bescheinigen sind. Die Protokolle sind von den Flugprüfern dem zuständigen Heimatverein zur Beglaubigung der Unterschriften und Weitergabe an den Deutschen Luftfahrer-Verband einzureichen. Bis zum Inkrafttreten der vorgenannten Bestimmungen über Flugprüfer, d h. bis zum 1. April d. J., sind zur Bescheinigung der Flugleistungen die von den Heimatvereinen bisher angemeldeten Sportzeugen berechtigt. Die Protokollformulare sind von der Geschäftsstelle zu beziehen. Flugtechnische 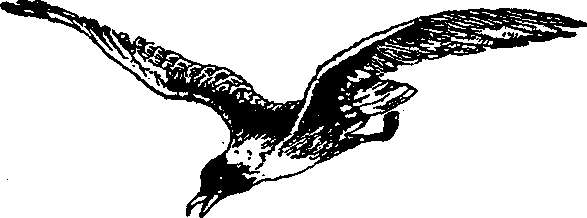 Rundschau. Inland. Mugjührer-Zeugnisse haben erhalten No. 365. von Borcke, Hans Herbert, Leutn. im Füs.-Rgt. 33, Gumbinnen, ■ geb. am 19. Juli 1886 zu Aachen, für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 3. März 1913. No. 366. Neumann, Peter, Techniker, Köln, geb. am 16. Mai 1891 zu Köln, für Eindecker (Rumplertaube), Flugplatz Johannisthal, am 5. März 1913. No. 367. Schulz, Felix, Kapitän der Handelsmarine, Johannisthal, geb. am 7. Januar 1878 zu Cottbus, für Eindecker (Fokker), Flugplatz Johannisthal, am 8. März 1913. Am 25. März unternahm der Fluglehrer der Fliegerschule Otto, Georg Schöner auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor einen Ueber-landflug in der Richtung nach Starnberg und kehrte nach einer Flugdauer von fast 1 Std. wieder wohlbehalten zum Flugplatze zurück. Auch von den Flugschülern wurde das günstige Wetter fleißig zu Uebungs-flügen benützt und werden in nächster Zeit wieder mehrere Schüler ihre Fliegerprüfung ablegen können. Am 29. März bewarben sich die Flieger Schirrmeister und Langer um die Stundenprämien der Nationalflugspende. Langer flog auf seinem Deutschland-Doppeldecker 2 Std. und gewann damit einen Preis von 2000 M., während Schirrmeister durch einen einstündigen Flug die ausgesetzte Prämie von 1000M. erhielt. Als Sportzeugen waren Dr. Raabe und Dr. Steinmetz vom bayr. Aeroklub erschienen. Oberlt. von Obernitz flog auf Albatros-Doppeldecker mit einem Fluggast am 26. März von Döberitz nach Rathenow, wo er auf dem Exerzierplatz landete. Nach Einnahme von neuen Betriebsmitteln flogen die Offiziere nach Döberitz zurück. Von der Darmstädter Fliegerstation flog Lt. Koch am 31. März auf einem Euler-Doppeldecker von Darmstadt nach Frankfurt, überflog die Stadt in 1000 m Höhe und landete auf dem Euler-Flugplatz. Am gleichen Tage flogen die Lts. von Mirbach, Sommer und Reinhard drei neue Euler-Kriegsmaschinen nach ihrem Bestimmungsort, der Fliegerstation Darmstadt. _ Versuche mit Wasserflugzeugen auf dem Starnberger See. Die Flugmaschinenwerke Gustav Otto in München werden in nächster Zeit Versuche mit Wasserflugzeugen auf dem Starnberger See veranstalten, wozu die nötigen Vorkehrungen schon getroffen wurden. Von den Plugplätzen. Vom Flugplatz Puchheim. Vom Flugplatz München-Milbertshofen. ^Illitärische Flüge. Das erste Wasserflugzeug der Firma wird der bekannte Herrenflieger O. E. Lindpaintner steuern und, falls die Versuche gut ausfallen, will Lind-p a i n t n e r mit einem Apparat gleichen Typs an der Wasserflugmaschinenkonkurrenz in Monaco teilnehmen. Rund um Cassel. Der Grade-Flieger Otto Toepffer, der seine Maschine bei der Casseler Fliegerschule untergestellt hat, unternahm dieser Tage mit seinem ständigen Fluggast Heinz Heinroth einen Sti'.ndenflug rund um Cassel. Der Flug war als Demonstrationsflug gedacht, weil in Cassel vielfach die Ansicht vertreten war, daß man mit einer Grade-Maschine keinen längeren Flug ausführen könne. Die beiden Flieger überflogen die Ortschaften Bergshausen, Söhre, Crumbach,Ochshausen, Bettenhausen,das Tannenwäldchen, den Aschrottschen Park, Wahlershausen, an dem historischen Herkules vorbei, zur Dönche und kehrten von hier aus zum Waldauer Exerzierplatz, dem Flugplatz der Casseler Fliegerschule von E. Abelmann zurück. Der Flieger vollführte aus 1400 Meter Höhe einen steilen Gleitflug und landete nach 1,02 Stunden glatt vor der Halle Wettbewerbe. Der Bodensee-Wasserflug ist jetzt endgiltig für die Zeit vom 29. Juni bis 5. Juli festgesetzt. Es ist dies der einzige deutsche Wasserflug-Wettbewerb, der in diesem Jahre mit Genehmigung der Flugzeug-Industrie stattfindet. Die schlesische Plugwoche findet von 8. bis 15. Juni statt. Mit dem Wettbewerb ist eine Transport-Konkurrenz für Flugzeuge, für die das preußische Kriegsministerium 10000 Mark ausgeworfen hat, verbunden. Die teilnehmenden Apparate müssen zunächst auf dem Breslau-Leerbeuteler Flugplatz einen Flug ausführen und landen. Nach der Landung wird die Maschine demontiert und mittels Automobil nach einem 10 km entfernten nach dem Flug bekannt zu gebenden Platz gebracht. Dort wird die Maschine wieder montiert und nach dem Flugplatz Breslau-Leerbeutel zurückgeflogen. Flugpreise. 100000 Kronen für einen Rundflug durch Oeslerreich-Ungarn sind von der Georg Schicht Aktien-Gesellschaft dem Oesterreichen Aero-Club und dem Oesterreichischen Flugtechnischen Verein zur Verfügung gestellt worden. Der Schicht-Flug, ein Etappenflng, wird als Hauptstalionen Wien, Brünn, Prag und Budapest umfassen. Patentwesen. Patenterteilungen. 77h. 257 820 Durch Propellerschrauben fortbewegbarer Lufttorpedo Eugen Hornung, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen, A. Büttner und E. Meißner, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 61. 14. 11. 11. H. 55 948. 77h 257909. Vorrichtung zur selbsttätigen Zurückführung eines Flugzeugs in eine von Hand einstellbare Fahrrichtung. Carl Bloeß, Rössel, Ostpr. 12. 2. 10 B. 57448, 77h. 257 953. Steuervorrichtung mit zwei in e'nander gelagerten Wellen. Ernst Bucher, Heidelberg. 18.1 10. B. 57 12Ö. Gebrauchsmuster. 77h. 539 262. Schwimmer für Wasserflugzeuge. A. H. G. Fokker Johannisthal. 10. 1. 13. F. 27443. No. 7 LU G S P 0 R T." Seite 264 77h. 539355. Bremse für Flugzeuge, bestehend aus federnd gegen den Boden gedrückten Kufen. Allgemeine Elektritäts-Qesellschaft, Berlin. 26. 6. 12, A. 18744. 77h. 540706. Radhaube zur Verminderung des Luft- bezw. Wasserwiderstandes, Dipl.-Ing. A. M. Joachimczyk, Berlin, Kurfürstenstr. 46. 10. 10. 12. J. 13258. 77h. 540732. Federndes Fahrgestell für Luftfahrzeuge. Wilhelm Duesberg. Gelsenkirchen, Hofstr. 10. 17. 1. 13. D. 24198. 77h. 540 741. Verspannungsmaterial für Luftfahrzeuge mit tropfenförmigem Querschnitt. Max Court, Charlottenburg, Salzufer 4. 20. 1. 13. C. 10116. 77h. 540976. Verspannungsmaterial für Luftfahrzeuge mit tropfenförmigen Querschnitt. Max Court, Berlin, Salzufer 4. 20. 1. 13. C. 10117. 77h. 540 980. Schrägsteuerung für Flugzeuge. Max Court, Charlottenburg, Salzufer 4. 22. 1. 13. C. 10124. 77h. 541 144. Stahlband-Verspannung für Flugzeuge. Max Court, Berlin, Salzufer 4. 22. 1. 13. C. 10125. 77h. 541 163. Vorrichtung zum Heben bezw. Senken der Laufräder von Flugzeugen, welche sowohl vom festen Lande als auch von einer Wasserfläche abzufliegen vermögen. Automobil- & Aviatik Akt.-Ges., Burzweiler b. Mülhausen i. E. 27. 1. 13. A. 19927. 77h. 541 378. Rad für Anfahrgesteile von Flugzeugen. E. Rumpier, Luftfahrzeugbau G. m. b. H, Berlin-Lichtenberg. 23. 1. 13. R. 34967. 77h. Flugzeug mit Brückenverstrebung und Spanndrähten. Melli Beese, Johannisthal b. Berlin. 23. 11. 12. B. 61002. 77h. 541525. Flugzeug. Gustav Tweer, Osnabrück, Johannisstr. 35. 28. 12. 12. T. 15276. 77h. 542383. Zusammenreffbares Höhensteuer für Flugzeuge. E. Rumpier Luftfahrzeugbau G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg. 19. 7. 12 R. 33368. 77h. 542 471. Einrichtung zur Verhinderung des Kippens von Flugapparaten. B. Haas, Leipzig, Carlstr. 22. 10. 1. 13. H 59071. 77h. 542500. Flugzeug für Verkehrszwecke. Wilh. Hünn, Selb. 3. 2. 13. H. 59467. Flugzeug mit um seine Längsachse beweglicher Tragfläche.*) Die Erfindung hat zum Gegenstand die Ausbildung eines Flugzeugs bekannter Art, dessen Tragfläche mit Bezug auf die Gondel, die pendelartig aufgehängt ist, beweglich ist, und zwar um eine Achse, welche mit seiner Längsachse zusammenfällt bezw. ihr parallel ist. Die Vorrichtung hat den Zweck, dem Flugzeug eine bedeutende seitliche Stetigkeit, namentlich bei Schwenkungen zu verleihen, und zwar mittels einer besonderen Bauart der Flügel, derart, daß die Anwendung des Steuerrades entbehrlich gemacht und das Steuern lediglich durch das Rechts- bezw. Linksneigen der Tragfläche mit Bezug auf die Gondel verwirklicht wird. Zu diesem Zweck sind die Tragflächen oder Flügel aus elastischen Federn mit sehr biegsamen Rändern konstruiert, die sich von unten nach oben gegen die weniger biegsamen Ränder bezw. die Rippen der angrenzenden Federn stützen. Dies hat zur Folge, daß unter der Wirkung des von unten nach oben gerichteten Luftdrucks die Federn gegeneinander liegen und eine undurchlässige Fläche bilden, welche den ganzen Effekt des Druckes empfängt. Zu gleicher Zeit geht der auf die Oberseite des Flügels wirkende Luftstrom zwischen den Federn hindurch und übt auf den Flügel nur eine sehr unbedeutende Wirkung aus. Außerdem ist der Flügel derart konstruiert, daß seine Biegsamkeit von vorn nach hinten und nach den seitlichen Enden hin zunimmt. Bei irgendwelcher Schwenkung des Flugzeugs, wobei die Flügel in dem gewünschten Sinne geneigt sind, gleitet der Apparat seitlich nach unten und das biegsame Ende des Flügels, welches am untersten liegt, hat das Bestreben, sich unter dem Luftwiderstand nach rückwärts zu biegen. Wäre der Flügel in gleicher Weise von oben nach unten oder von unten nach oben durchlässig bezw. undurchlässig, so würde das Rückwärtsbiegen sowohl in dem einen wie in dem anderen Sinne erfolgen können, D. R. P. 256611. Georg Plaisant in Paris. wobei es sehr gefahrbringend wäre, wenn es von oben nach unten geschähe. Denn in diesem Falle würde der Luftstrom gegen die Oberseite des Flügels stoßen und die seitliche Neigung derart vergrößern, daß ein Umschlagen unvermeidlich wäre. Dank der besonderen Anordnung der Federn reagiert der Flügel lediglich gegen die von unten nach oben gerichteten Drücke und vermag sich nur nach oben rückwärts zu biegen, wodurch die Gefahr des Umschlagens beim seitlichen Gleiten vermieden wird Hierdurch wird die Sicherheit derart erhöht, daß der Apparat das Steuerruder und die senkrechte Befiederung entbehren kann, wodurch die Bauart vereinfacht und erleichtert wird. Das Steuern erfolgt einfach durch das Neigen der Flügel nach links bezw. nach rechts mit Bezug auf die daran pendelartig auf- fehängte Gondel; die Dyssymmetrie der Luftwirkungen auf die Flügel und auf ie Gondel läßt alsdann den Apparat auf die Seite des untersten Flügel schwenken. Eine derartig angeordnete Flugmaschine vereinigt somit im wesentlichen folgende an sich bekannte Vorbedingungen: 1. die pendelartige Aufhängung der Gondel an den Flügeln; 2. die bedeutende Biegsamkeit der Flügel, besonders an ihren seitlichen und hinteren Enden; 3. die Durchlässigkeit des Flügels von der Oberseite nach der Unterseite und seine Undurchlässigkeit von der Unterseite nach der Oberseite. Die Gesamtheit dieser Vorbedingungen hat zur Wirkung, daß der Flieger die Möglichkeit besitzt, durch einfaches Neigenlassen der Flügel zu schwenken, ohne sich um das seitliche Gleichgewicht bekümmern zu müssen, da das letztere infolge des selbsttätigen Rückwärtsbiegens des unteren Flügels nach oben nie eine Gefahr veranlassen kann. Die Biegsamkeit und einseitige Durchlässigkeit der hinteren Enden der Flügel haben ebenfalls zur Wirkung, die stützende Eigenschaft der Flügel in dem Sinne zu verbessern, daß jeder schädliche Druck der zeitweilig auf die Oberseite der Flügel wirken könnte (Strudel, Wirbel u. s. w.) unwirksam gemacht wird, während alle auf die Unterseite einwirkenden Drucke vollständig wirksam bleiben. Abb. 1 zeigt die Draufsicht des Flügels einer Flugmaschine laut der Erfindung; Abb. 2 ist ein Schnitt nach Linie A-A, Abb. 3 ein Längsschnitt des Flügels. Abb. 4 zeigt die geneigte Lage des Flügels; Abb. 5 ist die Ansicht einer Feder, Abb. 6 ein Querschnitt dieser Feder nach Linie m-n in größerem Masstabe Abb. 7 ist die Draufsicht einer Flugmaschine laut der Erfindung. Abb. 8 ist die Draufsicht einer anderen Ausfiihrungsform des Flugapparates. Der Flügel besitzt eine bis zur höchsten Empfindlichkeit steigende Biegsamkeit von vorn nach hinten und nach den Seiten zu, das heißt steigend von a nach c, von b nach d und im allgemeinen von a nach ß. Durch die Konstruktion aus Federn jst der Flügel für die Luftwirkungen auf der einen Seite viel empfindlicher "als auf der anderen; jeder von unten, F (Abb. 2), kommende Luftstrom erzeugt eine Gestaltsänderung des ganzen Flügels, während jeder von oben, F1, kommende Luftstrom lediglich eine örtliche und unbedeutende Gestaltsänderung verursacht. Außerdem ist der Flügel um eine mit dem Gestell des Flugapparates ein Ganzes bildende Achse o-o1 beweglich; der Flügel ist symmetrisch mit Bezug auf diese Achse, und seine Neigung um dieselbe mit Bezug auf das Gestell läßt sich nach Belieben des Fliegers regeln. Der Flügel kann, wie Abb. 2 zeigt, gekrümmt sein, wodurch die Sicherheit auf Kosten des Stützvermögens erhöht wird. Dank dieser Vorbedingung sichert der Flügel: 1. die selbsttätige Stetigkeit in dem Sinne, daß jeglicher Bewegung im Sinne o-c (Abb. 3) sofort beim Entstehen, und zwar durch eine wünchenswerte Gestaltsänderung, entsprechend o-f, entgegengewirkt wird; die gefahrbringende Gestaltsänderung, entsprechend 0-7', ist nach dieser Konstruktion unmöglich und die Sicherheit wird durch die natürlichen Bogen der Flächen (Abb. 2) vermehrt; 2. die Möglichkeit des Lenkens der Maschine durch die Neigung des Flügeis um die Achse o-o1 (Abb. 4) mit Bezug auf das durch die Linie o-e schematisch dargestellte Gestell der Flugmaschine; die Luftwirkung auf den Teil c-o-e ist stärker als auf den Teil o-c1, wodurch o-c mit Bezug auf o-cl gehemmt wird. Die Stetigkeit ist im übrigen dank der Eigenschaften der Flügelenden c gesichert, die dem Umschlagen während des seitlichen Abstieges im Sinne o-c bei einer Schwenkung entgegenwirken. Die stabilisierenden Flächen werden durch dachziegelartiges Nebeneinandersetzen der Federn genannter Teile bewirkt. Die schematisch durch f-m-p-n (Abb. 5) dargestellte Feder setzt sich zusammen erstens aus dem Teil f-i-p-m von einer in Richtung von f nach p und von g nach m bis zur Höchstgrenze wachsenden Biegsamkeit, wobei m-n ein beliebiger Querschnitt ist, und zweitens aus einem schmalen Teil t-i-n oder Sohle, welche lediglich als Stütze für die biegsame Seite f-m der benachbarten Feder dient. Die Linie f-i stellt eine Rippe bis zur äußersten Empfindlichkeit von f nach i wachsender Biegsamkeit dar. Die Feder kann praktischerweise mit einer Rippe von Metall oder Holz hergestellt werden, massiv oder hohl, von entsprechendem und abnehmendem Querschnitt; auf ihr sind leichte Gewebeschnitte in der Weise befestigt, daß die Dicke von p nach f und von m nach g anwächst und so abnehmende Steifheit und Biegsamkeit erzeugt. Die Steifheit kann durch von der Rippe ausgehende Metalldrähte von abnehmendem Querschnitt vermehrt werden. Fie '■ Fig. 5- 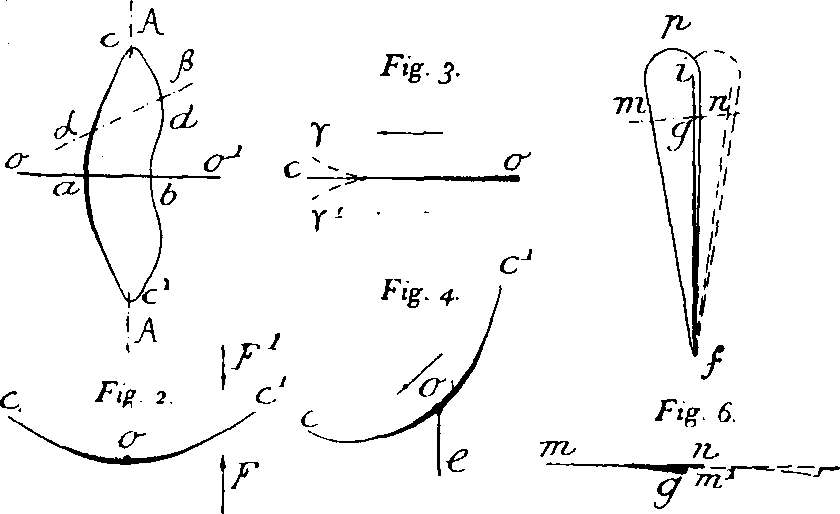 Die Gewebeschnitte können durch elastische gleichmäßige Plättchen ersetzt werden, die derart gegossen oder gewalzt sind, daß in jedem Punkt eine geeignete Dicke erzielt wird (aus Metall, Kautschuk oder anderem elastischen Material) Ebenso kann man die Feder aus einer gleichmäßigen, gewalzten oder gegossenen Masse dera't ausarbeiten, daß sie ein ähnliches oder gleiches Profil wie m, n (Abb. 6) erhält. Die Dicke dieses Querschnitts nimmt von f nach p (Abb. 5) ab, während die Breite entsprechend anwächst (Metall, Kautschuk oder anderes elastisches Material). Jede Feder kann flach oder krumm sein und eine geradlinige oder gekrümmte Rippe haben. Die Nebeneinandersetzung der Federn, um einen Flügel herzustellen, geschieht nach Abb. 5 und 6. indem die biegsame Seite m' einer Feder unter die Stutze m der benachbarten Feder sich anlegt. Diese Federn können miteinander um den Punkt f herum (Abb. 5) befestigt sein oder nach Be- lieben eine auf der anderen parallel zur Achse o-o1 des Flügels (Abb. 1) mit Hilfe eines Zapfens oder einer Gleitstange anliegen. Mit einem oder mehreren derartigen Flügeln kann man Flugmaschinen (Ein- oder Vieldecker) herstellen. Eine Ausführungsform nach Abb. 7 besteht aus einem starren Rippenwerk oder Rumpf j-k-l-q, j'-k'-l'-q1 aus Holz oder Metall, voll oder hohl, flach oder gekrümmt, welches bestimmt ist, die Flügelflächen zu tragen und deren natürlichen Bogen in möglichste Uebereinstimmung mit dem natürlichen Bogen jeder Feder zu bringen. Der Teil q-k, k'-q1 bildet eine Fläche der starren Stützung. An diesem Rumpf sind Federn der oben beschriebenen Art befestigt (punktiert schematisch angedeutet). Diese Federn können nötigenfalls eine auf der anderen, längs von j-k und j'-k1 anliegen. Ein Schwanzstück 1-r, l'-r1 mit von 1-1' gegen r-r' anwachsender Biegsamkeit, aber gleichmäßig empfindlich auf seinen beiden Flächen, ist bei der Handhabung seitens des Luftschiffers oder Piloten um 1-11 beweglich; dieser sitzt in einer Gondel, die an zwei Ringen s-s1 an der Achse o-o1 des Rumpfes aufgehängt ist und den Piloten, Passagiere, Motor und Schraubenflügel trägt. Gleichwohl können die Schraube oder die Schraubenflügel vorteilhaft auf der Achse o-o1 angeordnet werden; der Antrieb der so angeordneten Flügel, sei es mittels Treibriemens, sei es mittels Zahngetriebes, hindert dann nicht die Drehbewegung der Gondel um die Achse o-o1. Man kann die Leichtigkeit der Maschine vergrößern, indem man sie wie nach Abb. 8 vereinfacht. Sie besteht aus einem aus zwei starr vereinigten Röhren v-v1, x-x1 zusammengesetzten Rumpfe, der Flügel der oben beschriebenen Art trägt. Ein biegsamer Schwanz l-r, P-r1 ist beweglich um l-l1 angeordnet und wird von der Gondel aus gesteuert Die Gondel besteht aus einem Rahmen, ähnlich einem Fahrradrahmen, der an der Röhre v-v1 aufgehängt ist, welche den Sitz und den Motor trägt. Patent-Anspruch: Flugzeug mit um seine Längsachse, mit Bezug auf das daran pendelartig aufgehängte Gestell beweglicher Tragfläche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Fläche, besonders an den seitlichen Enden, eine größere Biegsamkeit unter nach oben gerichtetem Druck hat als unter nach unten gerichtetem, und zwar mittels Anordnung von nach unten durchfedernden Teilen am hinteren und seitlichen Flächenrande, welche Teile durchweg einen sehr biegsamen sich von unten nach oben gegen den minder biegsamen Rand des angrenzenden Teiles stützenden Rand besitzen. Verschiedenes. Die Leipziger Luftschiffhafen- und Plugplatz-Aktiengesellschaft ist am 15. März mit einem Aktienkapital von 1 200000 M. in den Räumen der Allgemeinen Deutschen Creditanstalt in Leipzig gegründet worden. Gründer der Gesellschaft sind Geheimer Kommerzienrat Habenicht, Kommerzienrat Paul Sack, Kommerzienrat Polter, Kommerzienrat Weichelt, Konsul de Liagre, Kaufmann Alfred Naumann, sämtlich in Leipzig. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören an, aus dem Kreise des Vorbereitenden Ausschusses Kommerzienrat Biagosch als Vorsitzender, Bankdirektor Petersen als dessen Stellvertreter, Baurat Paul Ranft, Rechtsanwalt Dr. Georg Sachse, Bankdirektor Hoff, Hofjuwelier Schneider, von Seiten der Stadt Bürgermeister Roth, Oberbaurat Scharenberg, Stadtrat Esche und die Stadtverordneten Fabrikbesitzer August Frizsche und Steinmetz-Obermeister Günther. Als Direktor der Gesellschaft ist gewählt Oberleutnant z. See a. D. von Schroetter. Vom Rat der Stadt Leipzig ist der Gesellschaft auf Eutritzch-Mockauer Flur ein Gelände von etwa 120 ha unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden, außerdem übernimmt die Stadt die Umzäunung und Einebnung und gewährt einen jährlichen Zuschuß von 20000 M. Das Preußische Kriegsministerium hat sich bereit erklärt, die für militärische Zwecke in Betracht kommenden Anlagen mit 4°/,, ihres Wertes, bis zur Höhe von 30 000 M. jährlich zu unterstützen. Aus dem beistehenden Plan ist die Lage der einzelnen Baulichkeiten, das Gastwirtschaftsgebäude, welches mit Saal und Gesellschaftsräumen ausgestattet wird, sowie die Flugzeugschuppen, für welche Größen von 20/15, 15/15, 13/15 m in Aussicht genommen sind, ersichtlich. Die Einweihung soll am 22. Juni d. J. statt- No. 7 „JF L UGSPOR T." 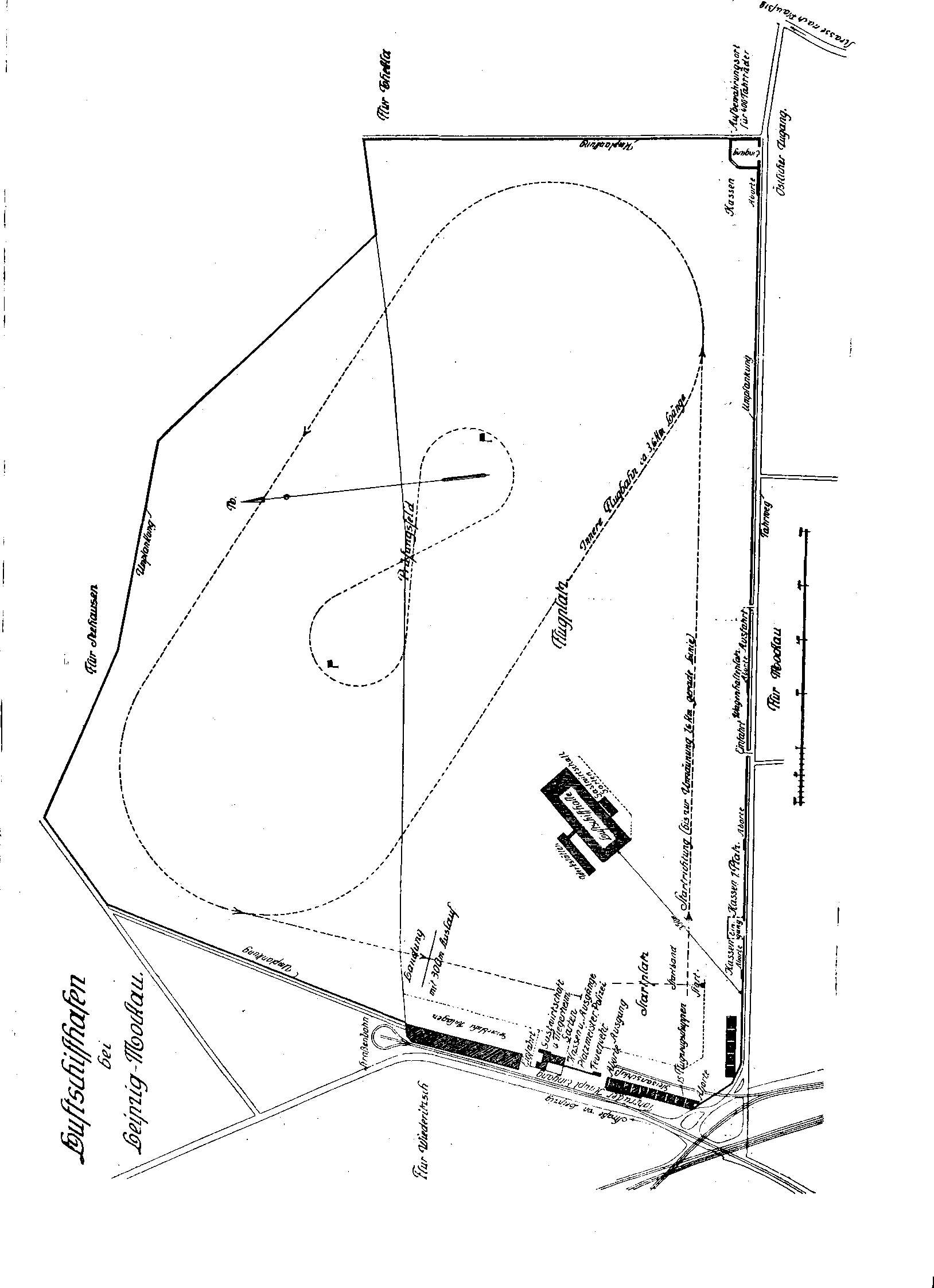 finden und haben S. M. der König von Sachsen und Excellenz Graf Zeppelin ihr Erscheinen zugesagt. Die ersten großen Flugwettbewerbe sind für den 23. bis 25. August geplant. Eine Fliegerstation ist in Graudenz projektiert und zwar sollen 28 Flieger stationiert werden. Die Stadt überläßt kostenlos das Gelände zum Bau von Kasernen und Flugzeugschuppen, ferner das Gelände, das für die Zufahrtstraßen nötig ist. Ein Wasserflugplatz bei Warnemünde soll bei der sogenannten hohen Düne errichtet werden. Ein neues Metallisierungsverfahren für Plugzeug-Bestandteile ist von dem Züricher Schoop in den Handel gebracht worden. Das Verfahren besteht darin, daß ein Metalldraht mittels Knallgasgebläse zum Schmelzen gebracht wird. Die feinen Metallteilchen werden gegen den zu metallisierenden Gegenstand geschleudert und haften auf demselben fest Die zum Schmelzen und Zerstäuben benutzte Druckluft geht durch eine kleine Turbine von 30000 Umdrehungen pro Minute, die ihren Antrieb durch ein mehrfaches Schneckengetriebe erhält. Der Schmelzdraht ist auf einer Spule aufgewickelt, der in der Knallgasdüse genau in demselben Maße vorrückt, als er weggeschmolzen wird. Die Vorrichtung ist sehr handlich und ähnelt äußerlich einem Revolver. Dieses Verfahren eignet sich zum Metallisieren von Stahlrohr, Holz, Stoff etc. Anstelle des Knallgasgebläses kann auch der elektrische Lichtbogen treten. Einen 9 Zyl. 100 PS Gnom-Motor, bei dem alle 9 Zylinder in einer Ebene liegen, hat die SociStß des Moteurs Gnöme soeben herausgebracht. Die Zylinder besitzen 124 mm Bohrung und 150 Hub. Der Motor leistet bei 1200 Touren 102 PS und wiegt in flugfertigem Zustand 120 kg. Ein Preisausschreiben für einen Beschleunigungsmesser und einen Geschwindigkeitsmesser zur Beurteilung der in einem Flugzeug bei Störungen des Gleichgewichts auftretenden Ueberlastungen soll von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Flugtechnik ausgearbeitet werden. Die Schaffung eines derartigen Instrumentes entspricht einem großen Bedürfnis und wird es mit Freuden zu begrüßen sein, wenn durch eine derartige Ausschreibung ein solches Instrument geschaffen würde. 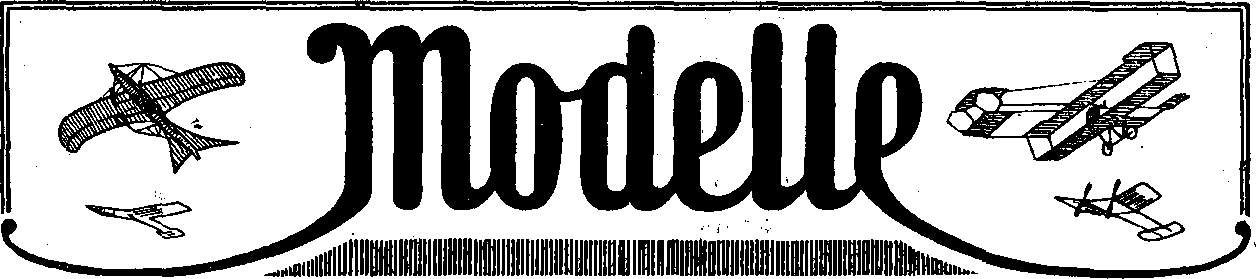 Förderung des Modellflugsports. Nach welchem Programm die Modellvereine arbeiten sollen! Wie gelangt man in den Besitz eines Plugmodells ? 1. durch Kauf eines fertigen Apparates. Vorteile: bequem; rascheste Flugerfolge. Nachteile: für wenig Bemittelte kaum gangbar! das Wesen der Flugtechnik und die Kenntnis der Materialien, welch letztere doch vielfach mit den bei großen Maschinen gebrauchten übereinstimmen, bleibt dem Käufer verborgen. 2. durch Kauf der Einzelteile'u n d Zusamm en Setzung derselben. Vorteile: auch noch bequem; nicht zu teuer, im Gedächtnis bleibt die Art des Aufbaues eher haften. Nachteile: die Einzelteile müssen zusammenpassen; der Käufer muß sich an bestimmte Modelle halten; sein Erfindungsgeist wird wenig angeregt; auch hierbei bleibt Kennenlernen der Materialeigeschaften aus. 3. durch Selbstherstellung möglichst aller Einzelteile und Zusammensetzung derselben. Vorteile: Bei guter Anleitung rasche Fortschritte in der Formgebung von Arbeitsstoffen, da bei der Herstellung von Modellen eine Bearbeitung von Papier, Pappe, Holz und Metallen stattzufinden hat; die Ausgaben sind mäßig; dem Erfindungsgeist ist Spielraum geboten; das Wesen der Flugtechnik wird gründlicher erfaßt; die errungenen Handfertigkeiten sind zeitlebens verwendbar. Nachteile: etwas längerer Zeitraum erforderlich, bis flugfähige Modelle vorgeführt werden können. Für Anfänger dürfte sich ein Lehrgang nach Punkt 3 am zweckmäßigsten erweisen. Ein solcher Lehrgang würde etwa folgendes enthalten : a) einige allgemeine Bemerkungen Uber Flugzeuge (Arten, Kraftbedarf, Erfolge u. s. w.) b) Erläuterungen Uber den Bau von Modellflugmaschinen (Hauptteile, Nebenteile, Material, Ausstattung, Gewicht, Arbeitsfolge u. s. w.) c) Praktische Anleitung an Hand von Modellen und unter Verwendung von Material, welches die Mitglieder beizubringen haben. d) Prüfung von Apparatteilen oder fertigen Apparaten, die zuhause hergestellt worden sind. Für den Unterricht wird es am förderlichsten sein, wenn er zur Vermeidung von Extraausgaben in dem vielleicht zu erlangenden Raum eines Privathauses stattfinden kann. Zur Erprobung fertiger Modelle ist eine beliebige Turnhalle das Geeignetste. Ausstellungswesen. Internationale Plugzeug - Ausstellung Turin 1013. Die „Societä Aviatione Torino" veranstaltet, wie die „Ständige Ausstellungskommission für die Deutsche Industrie" bereits bekannt gegeben hat, vom 17. Mai—1. Juni ds. Js. im Palazzo Stabile al Valentino zu Turin eine „III. Internationale Flugzeug-Ausstellung. Nachdem nun vorliegenden Reglement sind für die Veranstaltung, deren Protektorat der König von Italien übernommen hat, folgende 9 Gruppen vorgesehen: 1. Aerostaten, 2. Aeroplane, 3. Motoren und Propeller, 4. Materialien und Zubehör, 5. Transport-Einrichtungen und Hangars, 6. Wissenschaftliches Material, 7. Karten und Literatur, 8. Verschiedene Industrien, 9. Unterricht etc. Die Platzmiete ist für die einzelnen Gruppen verschieden. Sie beträgt incl. einheitlicher Dekoration für Freiballone und für lenkbare Luftschiffe unter der Voraussetzung, daß der Raum unter den Gondeln verfügbar bleibt, 2 Frcs. pro qm, Aeroplane' 1500 Frcs. pro Apparat, die andern Gruppen und Klassen 8 Frcs. pro. qm. Diejenigen Aussteller, welche bereits an der vom 26. April-11. Mai ebenfalls im Palazzo Stabile al Valentino stattfindenden „Internationalen Automobil-Ausstellung" teilnehmen, erhalten einen Preisnachlaß von 257o- Ausdrücklich wird im Reglement hervorgehoben, daß bei der Zuerkennung der Plätze den nationalen (italienischen) Ausstellern der Vorzug gegeben wird. Für den Abschluß von Verkäufen werden Abgaben nicht erhoben. Anmeldungen sind bei Vermeidung eines Preisaufschlages von 50bis zum 6. April an die „Commission Executive (Consiglio Direttivo della S. A T.) ä Turin" einzureichen. Die Ausstellungsdrucksachen können an der Geschäftsstelle der Ständigen Ausstellungskommission (Berlin NW, Roonstraße 1) eingesehen werden. Firmennachrichten. Das Flugwerk Deutschland G. m. b. H. München-Mibertshofen beabsichtigt den Bau von Flugapparaten einzustellen, da es sich aus kaufmännischen Gründen als zweckmäßig erwiesen hat, nicht Flugzeuge und Motore in der gleichen Fabrik zu bauen. Der Motorenbau wird im gleichen Umfange wie bisher betrieben und kommt wie wir hören, die 1. Serie des 100 PS Stahlzylinder F. D. Flugmotors im kommenden Monat auf den Markt, nachdem derselbe sich in einer großen Reihe von Flügen in den eigenen Apparaten in jeder Beziehung bewährt hat. Personalien. Adressenverzeichnis der Mitglieder der Flugzeugabteilung. 1. Herr de la Croix, Vorsitzender, Rittergut Haasel bei Linderode, N.-L. 2. „ Hauptmann a. D. Blattmann, stellvertretender Vorsitzender, Berlin W 50, Bamberger Straße 17. 3. „ Privat-Dozent Prof. A. Baumann, Obertürkheim, Uhlbacher Straße 140. 4. „ Prof. Berson, Gr. Lichterfelde-West, Fontanestr. 2 b. 5. „ Direktor Fröbus, Berlin W 62, Kleiststr. 8 6. „ Ing. Hans Grade, Bork, Post Brück i. d. M. 7. „ Hauptmann a. D. Dr. Hildebrand, Berlin W 30, Martin-Luther-Straße 10. 8. „ Dr. F. Huth, Neukölln b. Berlin, Böhmische itraße 46. 9. „ Kapitänleutnant a. D. Kaiser, Charlottenburg, Schloßstraße 24 —25. 10. „ Dr. F. Linke, Frankfurt a. M., Kettenhofweg 105. 11. „ Oberleutnant Mickel, Spandau, Klosterstr. 37 12. '„ Dir. Ing. E. Rumpier, Lichtenberg bei Berlin, Siegfriedstr. 202. 13. „ Direktor Schmal, Leipzig-Lindenthal, Deutsche Flugzeug-Werke. 14. „ Ernst Schröder, Essen-Ruhr, Schubertstr. 10. 15. „ Oberleutnant z. S. a. D. von Schroetter, Leipzig, Geibelstr. 10. 16. „ Hauptm. v. Selasinsky, Paderborn, Inf.-Regt. 158. 17. „ Major a. D. von Tschudi, Berlin W 35, Potsdamer Straße 112. Der Arbeitsausschuß setzt sich zusammen aus folgenden Herren: 1. Herr de la Croix, Vorsitzender. 2. „ Hauptmann a. D. Blattmann, stellv. Vorsitzender. 3. „ Kapitänleutnant a. D. Kaiser. 4. „ Major a. D. v. Tschudi. 5. 1 Herr von den 4 der Flugzeugabteilune angehörenden Mitgliedern der Industrie, welcher jedesmal vom V. D.M. I. bestimmt wird. Adolf Daimler f. Die Daimler-Motorenwerke, Untertürkheim, verlieren in dem früh dahingeschiedenen Direktor Adolf Daimler, bisheriger Leiter der Betriebs Abteilung einen unersetzlichen Organisator des gesamten Betriebes. Im Januar 1899 trat Adolf Daimler in die Daimler-Motoren-Werke ein, wurde schon 1900 zum Oberingenieur und Prokuristen befördert, vier Jahre darauf stellvertretendes Vorstandsmitglied und übernahm sodann im Jahre 1907 die Stelle des verantwortungsreichen Direktors der Betriebsabteilung. Gleichzeitig wurde er in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Durch die hervorragende Begabung für die Technik, das großartige Organisationstalent hat er aus jeder einzelnen Abteilung eine möglichst hohe Produktivität herauszuholen gewußt, sodaß die Daimler-Motorengesellschaft ihren Weltruf vor allem auch dem viel zu früh vom Tod dahin gerafften Direktor Adolf Daimler zu verdanken hat. Auch außerhalb seines geschäftlichen Wirkungskreises hat Adolf Daimler in verdienstvoller Weise als eifriger Förderer des Flugsports und der Luftschiffahrt mitgewirkt. Nun hat der Tod dem rastlos vorwärtsstrebenden Manne, eine Persönlichkeit von hervorragendem Wissen und Können, ein Ziel gesetzt. Adolf Daimler hat sich selbst einen Markstein in der Geschichte der Daimler-Motorengesellschaft gesetzt.  Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.) Neuhauss. Die Aufhängung des Kompasses erfolgt in kardanischen Ringen. Der äußere Ring wird durch Bänder festgehalten, die am Flugzeugrumpf befestigt sind. Die Erschütterungen spielen keine große Rolle, da Spezialkompasse schon zur Anwendung gelangen, die diese schon genügend berücksichtigen. Bekannt ist uns, daß Bleriot zur Isolation von magnetelektrischen Strömen des Motors seinen Kompass in eine Oelkapsel legt, was auch die Erschütterungen abhält und allseitige Beweglichkeit gestattet. Literatur.*) Ein Jahrbuch 1912 hat der Niederrheinische Verein für Luftschiffahrt herausgegeben. Dieses Jahrbuch enthält einen ausführlichen Bericht vom 10. Vereinsjahr von Prof. Dr. Bamler, das Zeugnis gibt von reger Vereinstätigkeit im vergangenen Jahr. Der zweite Teil des Jahrbuchs enthält eine Reihe interessanter Kapitel wie: Flugtechnische Fragen von Suwelak, der Kondor von Ernst A. Schroeder u. s w Es wäre zu wünschen, daß die Arbeiten der anderen Vereine in ähnlicher Weise festgelegt würden, da es ausgeschlossen ist, daß durch ein Jahrbuch des Deutschen Luftfahrer-Verbandes die Verbandsvereine ihre Tätigkeit in durchgreifendem Maße festlegen. Bulletin de L'Institut Aerodynamique in Koutchino. Von D. Riabouchinsky. Moskau 1912, J. N. Kouchnereff & Cie. Das vorliegende Buch gibt einen eingehenden Einblick in den Wirkungskreis des Forschers Riabouchinsky. Es behandelt meist experimentelle Untersuchungen von Profilen und Tragdecken im Tunnelluftstrom, am Schleuderarm und am Propellerprüfstand. Das Werk ist Flugzeug- und Propellerkonstrukteuren aufs wärmste zu empfehlen, da es verschiedene bemerkenswerte Aufschlüsse Uber aerodynamische Erscheinungen bei größeren Luftgeschwindigkeiten gibt. Die Broschüre erscheint in französischem Text und enthält eine große Anzahl von Tabellen über Versuchsreihen. Abrege sur L'Helice et la Resistance de L'Air von Maurice Gandillot. Paris 1913. Librairie Gauthier-Villars, 55 Quai des Grand-Augustins. Preis 10— Frs. Die Broschüre behandelt im wesentlichen die Schraubenrechnung und Luftwiderstandsversuche und fußt auf den Arbeiten von Riabouchinsky. Sie ist in französischem Text erschienen. Der fliegende Tod der Japaner. Kriegstagebuch eines deutschen Offiziers. Westdeutsche Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. Preis brosch. Mk. 1,20, geb. Mk. 1,80. *) Sämtliche besprochenen Bücher können durch die Expedition des „Flugsport" bezogen werden. Aeronautische Meteorologie. Von Fr. Fischli. Berlin 1913. Richard Carl Schmidt & Co. 216 Seiten mit 49 Abbildungen, Karten und Tafeln. Preis in eleg. Leinenbande Mk. 6.—. Die Technik im 20. Jahrhundert. Unter Mitwirkung hervorragender Vertreter der technischen Wissenschaften herausgegeben von Geh. Rat Dr. A. Miethe, Prof. an der königl. Technischen Hochschule zu Berlin. Band 4. Preis Mk. 15.-. 1912. In dem vorliegenden 4. Bande behandelt Major z. D. Prof. von Parseval die Luftfahrt, wobei er zunächst die Versuchsmethoden zur Untersuchung des Luftwiderstandes an verschieden geformten Körpern bespricht. Eingehend werden die Versuche Eiffels und Prandtls an Aeroplanflächen unter verschiedenen Lagen und Strömungsverhältnissen im Windtunnel erörtert und mit gutgewählten Abbildungen dem Verständnis näher gebracht. Ebenso werden auch die verschiedenen Luftwiderstanasfocmeln für Drähte, Flächen u. a. m. besprochen Die Mechanik des Vogelfluges zeigt den wesentlichen Unterschied zwischen dem Ruderflug, den Lilienthal für seine Apparate anzuwenden versuchte, und dem Gleitflug, auf dem unsere heutigen Maschinen basieren. Die Luftschraube, bis jetzt unser einziges Fortbewegungsmittel, wird zunächst theoretisch behandelt, um dann an Abbildungen in praktischen Ausführungsbeispielen gezeigt zu werden. Welch edler Gönner (960 würde 2 jungen Leuten, denen auf eine wicht. Erfindung d. Musterschutz erteilt wurde, den Betrag von 400 Mk. leihen z. Ausprobierung d. Erfindung. Rückzahlung in vierteljährlichen Raten nach Uebereinkunft. Angebote bitte unter H. H. 100. Limmritz N/M postlagernd. Tüchtiger strebsamer PILOT für Eindecker sofort gesucht. Ausführliche Angebote an PAUL, DAHNEN, CSln, Gereonstrasse 5. (953 Junger Mann sucht Lehrstelle in Flugzeugfabrik, wo gründliche Ausbildung gewährleistet. Bedingung: Nach beendigter Lehrzeit Aasbildung z. Piloten-Examen eventl. gegen Honorar. Ausführl. Angebote unter H. H. 100 an die Annoncen-Expedit. Ludwig Rutz, Neuss a. Rh._ (956 IHechaniherT der schon Erfahrungen im Flugwesen hat sucht Stellung in einem Flugzeugwerk oder bei einem Flieger als Mechaniker. Gefl. Off. u. 962 an die Exp. erb.  mit Doppelzündung vollständig neu, im Januar abgeliefert, zu dem spottbilligen Preise von Mk. 4600.— ferner 55 PS Daimler Motor zu Mk. 2500.— gegen Kasse sofort zu verkaufen. Gefl. Offerten u. E. W. 805 an die Exp._ Flugmotor 50/60 PS Argus, fast neu, tadellos laufend, einsohl. Kühler, Benzin- u. Oelbehälter, ferner diverse Stahlrohre, Spannschlösser, Phylax, Benzintank, Fliegerdress preiswert zu verkaufen. Gefl. Anfragen an E. Naujoks, Heidelberg, Kron-prinzenstrasse 47 (957 Holzarbeiter, der 3 Jahre im Flugzeugbau tätig war und in der Herstellung vun Propellern, Tragflächen sowie allen Holzteilen für Flugzeuge bewandert ist, sucht in gleichem Betriebe Stellung. Offerten sind zu richten unter 955 an die Exped. d. Bl.  No. 8 16. April 1913. Jahrg. V. Abonnement: Kreuzband M.14 Postbezug M. 14 pro Jahr, Jllustrirte technische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef.4557 Amt I. Oskar UrsinUS, Civilingenieur. Tel.-fldr.: Ursinus Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. ===== Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ..... Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 30. April. Wasserflug-Wettbewerb in Monaco. Von Ingenieur Oskar Ursinus. (Hierzu Tafel IX.) Wie war's in Monaco? Haben Sie viel neues gesehen? Sind die Franzosen weiter wie wir? — — Mit ein paar Worten lassen sich diese Fragen nicht beantworten. — Wenn man daher verschiedene Fachleute, die ich in Monaco traf, sagen hörte, das können wir auch; so muß man zunächst unterscheiden: das Können des Fliegers, das Können der Maschine und nicht zuletzt den Zufall. Wie oft haben wir die Erfahrung gemacht, daß bei Wettbewerben durch die Leistungen des Fliegers und den Zufall nicht gerade die besten Maschinen aus dem Wettbewerb siegreich hervorgingen. Diejenigen Fachleute, die bereits nach einem bestimmten System gearbeitet und dasselbe lieb gewonnen haben, dürften überhaupt ein ungetrübtes Bild von Monaco kaum sich machen können. Genau so wie man in Deutschland vorläufig auf den Doppeldecker schwört, so schwörte die gut trainierte JSTieuport-Mannschaft auf ihre Eindecker. Monaco hat so richtig gezeigt, daß das Wasserfliegen eben gelernt werden muß. Daß die Deperdussin-Mannschaft mit ihren Maschinen nicht vertraut war, beweisen die Unfälle am 7. April (vergl. weiter hinten.) Das Wassern ist die Hauptschwierigkeit für den Wasserflieger. Den Fliegern, die das durchsichtige klare Wasser und die starke Dünung nicht gewöhnt waren, machte das Anwässern große Schwierigkeiten. Da bei den Hauptflügon vom 12. —14. April in erster Linie die Geschwindigkeit gewertot wird, war der größte Teil der erschienenen Flugzeuge mit sehr starken Motoren ausgerüstet. Auffallend ist das Vorherrschen der sternförmigen wassergekühlten Canton Unne-Motore (Salmson), die beim Laufen sofort durch ihren blechernen Klang auffielen und der Gnom-Motore. Von letzteren war zum ersten Male der 100 PS Neunzylinder, der in einem Borel-Eindecker eingebaut war, vertreten. Als einziger Rivale des Gnom-Motors erschien der den Lesern des „Flugsport" vom letzten Pariser Salon her bekannte Motor le Rhone, der in einen Moräne Saulnier eingebaut war. Dieser Motor wurde von Fachleuten infolge seiner ausgezeichneten Drosselfähigkeit und des gleichmäßigen Laufes viel beachtet. i i Sämtliche Maschinen besaßen Andrehvorrichtungen, durch die der Motor vom Führersitz aus angedreht werden konnte. Die Andrehvorrichtungen bestehen aus einem kleinen Zahnradvorgelege, das mit einem besonderen Induktor in Verbindung steht. (Siehe die schematische Abbildung ) In der Frage der Schwimmer herrscht, wenn man die verschiedenen Konstruktionen auch der einzelnen Firmen vergleicht, ziemliche Unklarheit. Man scheint sich, mit wenigen Ausnahmen, mit dem Einschwimmersystem noch wenig befreunden zu können. Die Schuld dürfte in der unsachgemäßen Anordnung der seitlichen Stützschwimmer zu suchen sein, deren Zweck vollständig verkannt wird. I ie seitlichen Stützschwimmer sind bei fast sämtlichen Einschwimmer-Maschinen viel zu tief angeordnet und gehen zu hart im Wasser. Nur Breguet hat einen schüchternen Versuch gemacht, die seitlichen Stützschwimmer elastisch auszubilden, (siehe Abbildung) welcher jedoch mißlungen ist, da die Federung viel zu hart war. Man muß sich wundern, daß das einfachste und beste, ja, geradezu großartige Hilfsmittel, die Schwimmer durch federnde Fühlbretter Abgefederter Stützschwimmer von Breguet. elastisch zu machen, nirgends zu finden war. Die im Grundriß nach vorn spitz zulaufenden Schwimmer von Deperdussin 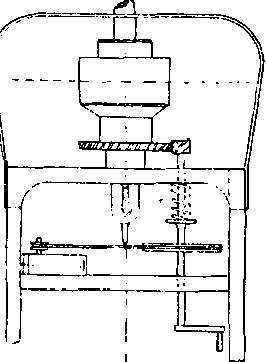 Andrehvorrichtung für Rotationsmotore. 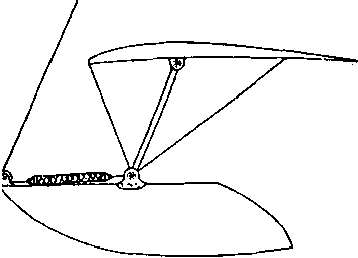 haben sich /licht bewährt, da sie zu leicht unterschneiden. Am besten dürften sich die Formen von BoreL Nieuport und Henry Farman bewähren. Herry Farman, dessen Maschine von Fischer gesteuert wurde, hatte seine Schwimmer elastisch abgefedert und zwar hatte er die Abfederung innerhalb des 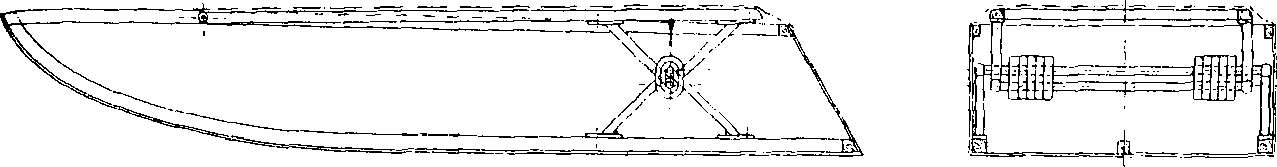 Elastischer Schwimmer von Henry^Farman. Schwimmers verlegt. Die Konstruktion dieses Schwimmers ist aus der beistehenden Abbildung ersichtlich, während Maurice Farman die Abfederung an der Außenseite der Schwimmer angeordnet hatte. Die Unklarheit im System kam sehr deutlich bei den Maschinen von Breguet zum Ausdruck. Breguet hat einfach zwei große Landmaschinen mit starken Motoren auf Schwimmer gesetzt; davon eine Maschine mit einem Hauptschwimmer^' und zwei seitlichen Stützschwimmern sowie  Der Wasserflug-Wettbewerb in Monaco. Deperdussin-Eindecker, Oben links: kurz vor dem Abwassern, oben rechts: im Fluge, unten: Ansicht schräg von hinten. eine Maschine mit zwei Hauptschwimmern. Wohl in der Hauptsache infolge des hohen Eigengewichts dieser Maschinen wurden trotz der großen Motorleistungen nennenswerte Erfolge nicht erzielt. Die Breguet-Apparate sind noch nicht einmal über das Anfangsstadium ihrer Entwicklung hinaus. Zum Ueberfluß, -vielleicht um dem Publikum zu imponieren, hatte Breguet die „berühmte Marseillaise", wie man in Frankreich sagt, mitgebracht. Ueber das Unzweckmäßige der Schwimmer-Konstruktion der Marseillaise (die beiden angesetzten Fabre Schwimmer) habe ich mich bereits an vielen Stellen ausgesprochen. Es war ausgeschlossen, daß mit dieser Schwimmerform die Maschine vom Wasser loskommen konnte, denn das Bugwasser mußte selbstverständlich seinen Weg über diese beiden seitlich angeordneten Fabre-Schwimmer nehmen und das ganze Schwimmersystem überwassern. Bereits am dritten Flugtage machten sich dann auch einige Monteure mit der Säge daran, die beiden Schwimmer einfach abzusägen. — — Im übrigen erscheint das Deplacemeut des Hauptschwimmers viel zu klein, sodaß die Maschine bei den ersten Versuchen auf hoher See kopfüber gehen wird. Alle diese Konstruktionen sind weiter nichts als Probiermaschinen in einem Versuchsstadium, nicht besser wie in Heiligen dämm. Mehrere Konstrukteure bemühen sich, einen neuen Typ zu finden. Sie sehen, daß man nach den Trugerfolgen der vergangenen, insbesondere des vorjährigen Monacoer Wettbewerbs nicht weiter bauen kann. Die Hauptaufgabe der Konstrukteure besteht zunächst darin, eine Maschine zu bauen, die ein sicheres Anwässern bei hohem Seegang gewährleistet. Wenn es den schnellen Zweischwimmermaschinen auch teilweise gelang, einigemale gut an Wasser zu kommen, so waren das eben Zufalls- und Geschicklichkeitsleistungen. Meistenteils schneidet bei den Zweischwimmermaschinen gewöhnlich nur ein Schwimmer unter und das führt die Katastrophe herbei. Es ist nun sehr naheliegend, daß, wenn bei den Zweischwim-mersystenien die Seitenschwimmer noch einmal so groß wären, diese Schwimmer schwerer unterschneiden. Wenn man daher das nötige Deplacement der zwei Schwimmer zu einem Mittelschwimmer vereinigt, so wird man, ohne das Deplacement unnütz zu vergrößern, entschieden mehr Sicherheit gegen Unterschneiden und Ueberschlagen erlangen. Die Aufgabe der seitlichen Stützschwimmer bei den Einschwimmersystemen ist von verschiedenen französischen Konstrukteuren verkannt worden Die seitlichen Stützschwimmer sollen nur dazu dienen, beim Liegen auf dem Wasser die Schwimmstabilität zu erhalten. Während der Fahrt müssen sie sofort vom Wasser freikommen. Um ferner das Kippmoment beim Anwässern zu verkleinern, ist es nötig, den Schwerpunkt möglichst lief zu legen, d. h. alle schweren Teile, Motor, Insassen, Betriebsstoff müssen möglichst tief gelegt werden. Ja man sollte sogar veisuchen, das Moment, wenn es ginge, negativ zu machen, d. h. wenn der vordere Teil des öchwimmers an die See stößt und nach oben zu gleiten sucht, der hintere Teil des Gleitbootes nach unten gedrückt wird. Dieser theoretisch gedachte Idealzustand sei nur zum Verständnis hier angeführt, da er praktisch wohl schwer durchzuführen sein dürfte. Von den Einschwimmermasohinen, die konstruktive Verbesserungen des Curtiss-ßootes darstellen, sind die den Lesern des „Flugsport" vom letzten Pariser Salon her bekannten Zweidecker Artois und der neue Eindecker von Borel, die sogenannte Aero-Yacht vertreten. Diese Aero-Yacht kam leider auch vollständig unausprobiert nach Monaco und hat daher keine besonderen Leistungen vollbringen können. Die Wassermaschine ist auf der Tafel IX in dieser Nummer dargestellt. Das Oberdeck, 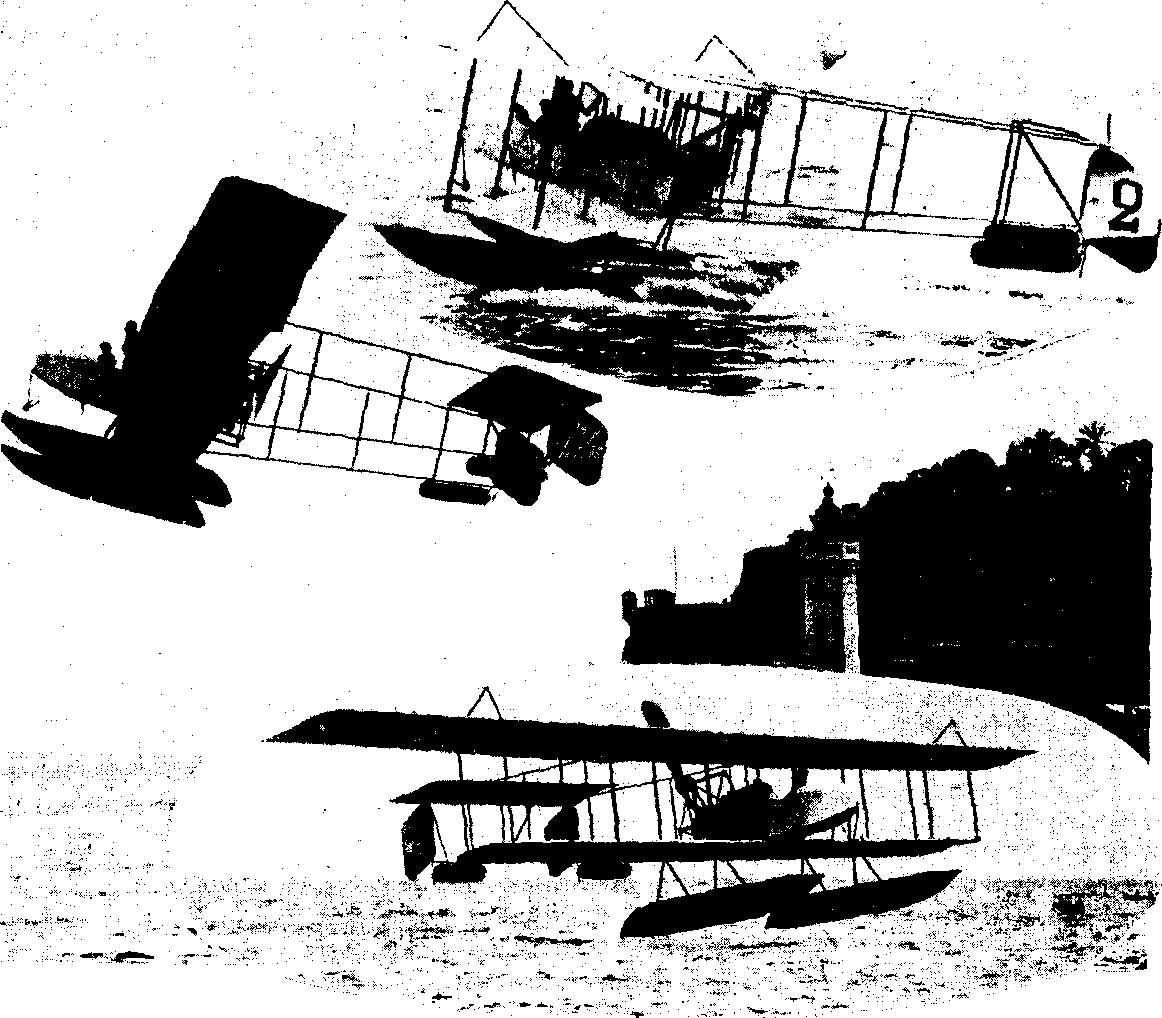 Der Wasserflug-Wettbewerb in Monaco. Fischer auf Ii. Farman mit 160 PS Gnom und untersetzter Schraube. Oben rechts: das Abwassern, links: steiler Anstieg, unten: gestreckter Gleitflug. das eigentliche Tragdeck, besitzt bei 15 m Spannweite 30 qni Tragfläche, die Sehwanzfläche 4,6 qm. Seitlich an dem Gleitboot sind zwei dreieckige Flächen, die gleichzeitig mit als Tragflächen ausgebildet sind, angeordnet, die in der Hauptsache dazu dienen, das Bug- und Spritzwasser von dem Motor fern zu halten. Die beiden Decken sind durch Dreiecksverband miteinander versteift. Die hinteren oberen Tragdeckenenden sind elastisch ausgeführt und können verwunden werden. Der untere Teil des Schwimmers besitzt mehrere, seitlich verkleidete, daher nicht sichtbare Stufen. Die seitlichen Stützschwimmer Die mit * versehenen flogen außer Konkurrenz. sind richtig angeordnet, besitzen jedoch keine Fiihlbretter. Zum Betriebe dient ein 100 PS 14 Zyl. Gnom-Motor. Die Veranstaltung von Monaco begann am 3. April mit einer Ausstellung der teilnehmenden Wasserflugzeuge in dem Hafen vor Condamine 'S. die Abbildung). Es waren folgende Maschinen vertreten: H. Farman gesteuert von Fischer 160 PS Gnom M. Farman „ „ Gaubert 120 J S Salmson Nieuport „ „ Espanet 100 PS Gnom Artois „ „ Gaudart 80 PS Gnom Borel „ „ Daucourt 100 PS Gnom 14 Zyl. Borel „ „ Chemet 100 PS Gnom 9 Zyl. Morane-Saulnier „ „ Gilbert 80 PS Le Rhone Breguet „ „ Bregi 120 PS Salmson Breguet „ „ Moineau 200 PS Salmson Marcay-Mooner „ „ Bielovucie 100 PS Anzani Deperdussin „ „ Prevost 160 PS Gnom Deperdussin „ „ *)Devienne 100 PS Gnom Deperdussin „ „ *)Scoffier 100 PS Gnom Deperdussin „ „ Janoire 100 PS Gnom 9 Zyl. Astra „ „ Labourot 120 PS Salmson Astra „ „ Barra 120 PS Salmson Für die Zeit vom 4—11. April waren die Vorwettbewerbe ohno Klassement und auf den 12.— 14 April die Hauptwettbewerbe angesetzt. An den Hauptwettbewerben konnten nur Bewerber teilnehmen, die. die Vorbedingungen bestanden hatten und zwar durften nur solche Maschinen teilnehmen, die 1. vom Wasser selbsttätig aufsteigen und auf dasselbe niedergehen konnten, wobei die Bedienung nur von den an Bord befindlichen Mannschaften bewirkt werden durfte. 2. An Bord sollen sich während der Dauer des Wettbewerbes befinden a) zwei sitzende Personen, Führer und Fluggast. Das Gewicht des Fluggastes war mit 70 kg angesetzt und mußte, wenn nötig, durch Ballast ergänzt werden, andernfalls anstelle des Fluggastes auf dessen Sitz 70 kg Ballast gesetzt wurden. Der Flieger mußte vor Antritt in den Wettbewerb sich entscheiden, ob er mit Ballast oder mit Fluggast fliegt. Er durfte dann während der Flüge nichts mehr ändern. b) Für Marine-Maschinen waren folgende Bedingungen aufgestellt: 1 Anker von 7 kg Gewicht, 30 m Kette, Kabel oder Tau, womit der Anker niedergelassen werden konnte, eine Boje am Tau befestigt, an dem man den Apparat auf offener See festhalten kann. (Die Boje bestand verschiedentlich aus einem angeseilten Rettungsring ? —) c) 1 ausbalancierter Kompaß und 1 Registrierhöhenmesser. d) 1 Apparat für drahtlose Telegraphie oder an dessen Stelle eine Kiste von 25 kg Gewicht, die im Minimum 27 cm lang, '21 cm breit und 65 cm hoch sein mußte. Der Telegraphie-Apparat muß vom Gastsitz aus bedient werden können. Für die Vorwettbewerbe waren folgende Bedingungen aufgestellt: 1. Ingangsetzen des Motors ohne fremde Hilfe und ohne daß die Sehraube berührt wird Abfahren einer Strecke von 100 m zwischen zwei durch Bojen bezeichnete Linien. 2. Aufstieg vom Wasser auf 500 m Höhe und Wasserung innerhalb 30 Minuten. 3. Aufstieg vom Wasser und Gleitflug mit in 100 m Höhe abgestelltem Motor. 4. Aufhissen des Flugzeugs aus dem Wasser und wieder zu Wasserbringen durch einen Kran. 5. Schleppen des Apparates durch ein Ruder- oder Motorboot. 6. Abfahren einer Strecke von 6,25 km mittels eigner Motorkraft, wobei die Maschine die Schnelligkeit eines Motorbootes haben muß. 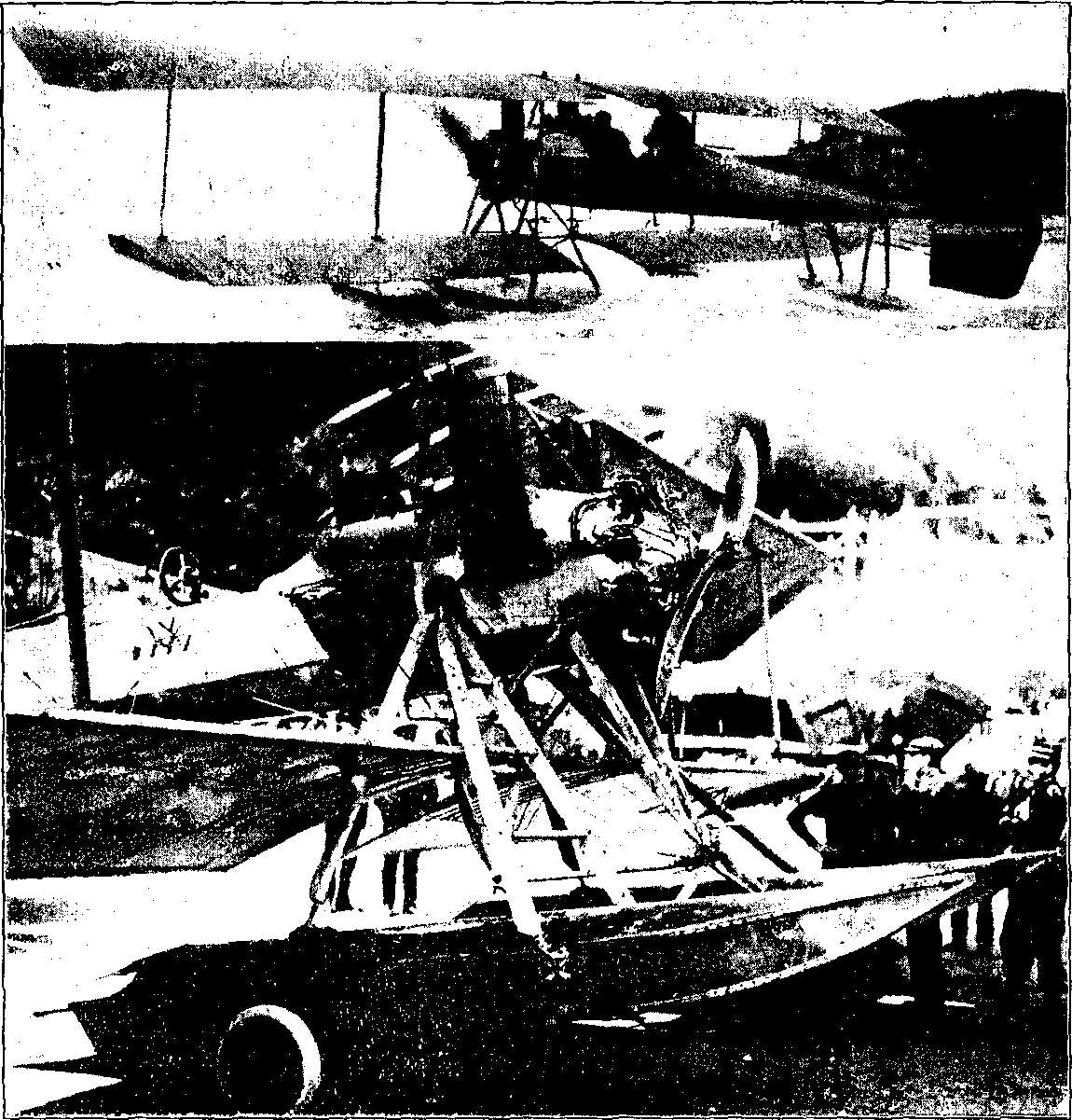 Der Wasserflug-Wellbcwerb in Monaco. Der Breguet-Zweidecker. Oben : während der Fahrt, unten : Motoranlage und Anordnung der 2 Schwimmer. Man beachte die Abfederung der Schwimmer am Rumpf. Bedingungen für die Hauptwettbewerbe. 1. Tag, 12. April. Kreuzungsflug Monaco, San-Remo, Monte Carlo, Beaulieu, Monaco mit obligatorischen Zwischenlandungen in San-Remo und Beaulieu. Die Zeit der Zwischenwasserung wird nicht bewertet. Die Wettbewerber müssen nur das Wasser vor einer Bojenlinie berühren und ohne das Wasser zu verlassen nach einer zweiten Bojenlinie schwimmen und hinter derselben wieder aufsteigen. 2. Tag, 13. April. Rennen in derBay von Monaco um ein Polygon in ungefähr 10 km Entfernung, offen für Wettbewerber, die die Versuche des ersten Tages bestanden haben. Entfernung 500 km, die die Bewerber unter folgenden Bedingungen zurücklegen müssen; 1. Unterwegs sind zwei Zwischenwasserungen, die erste nach 50 km inmitten eines Bojenvierecks vorzunehmen und die zweite be liebig vor der letzten Runde. 2 Während des 500 km-Fluges darf keine Neuverproviantierung stattfinden. 3. Zwischen Abflug und Landung darf nirgends fremde Hilfe in Anspruch genommen und nirgends angelegt werden. Die Vorprüfungen erforderten sehr viel Zeit und Geduld, auch von den "Zuschauern. Ob die verschiedenen Bedingungen der Vorprüfungen von so großer Bedeutung für die Entwicklung des Wasserflugwesens sind, erscheint Zweifelhaft Da die Vorprüfungen zu ganz 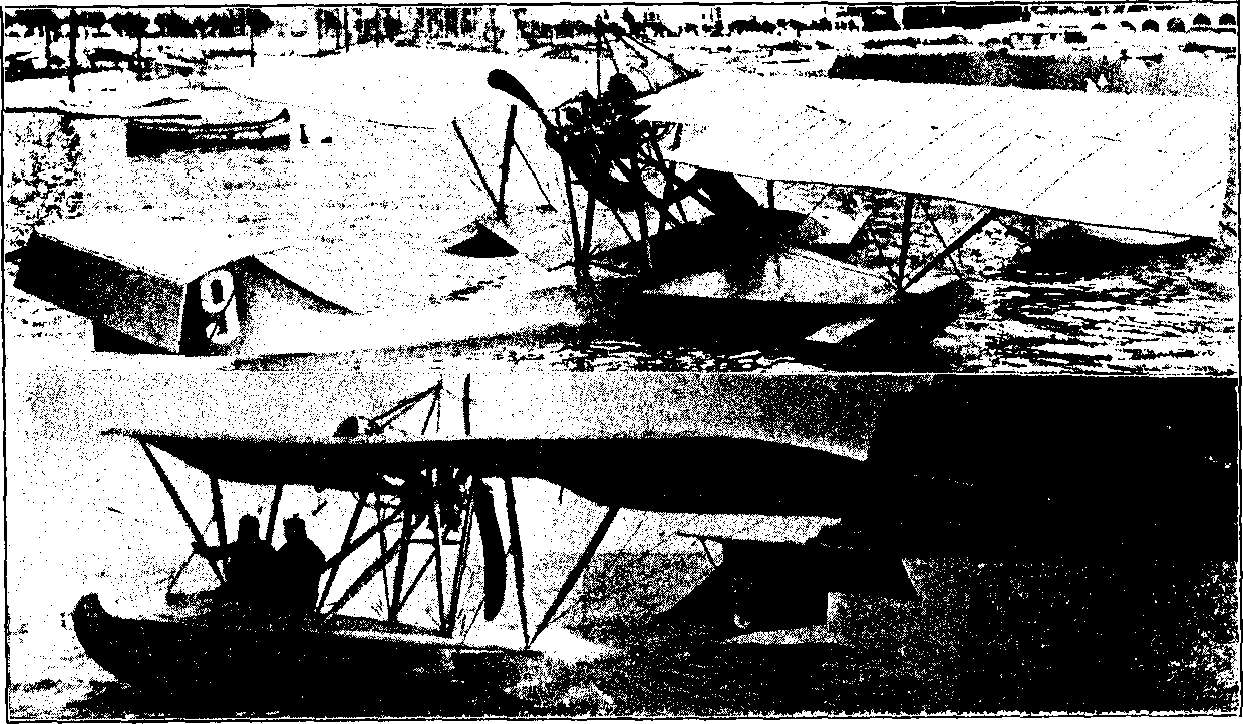 Der Wasserflug-Wettbev/erb in Monaco. Aero-Yacht von Borel, Hinter- und Vorderansicht. verschiedenen Zeiten unter verschiedenen Witterungs- und See-Verhältnissen ausgeführt wurden, so können Vergleiche über die Güte der einzelnen Maschinen kaum angestellt werden. Ein Vergleich läßt sich nur ermöglichen, wenn die Vorsuche zu gleicher Zeit stattfinden. Das herrliche Wetter am 3. April, am Tage der Ausstellung der Flugzeuge, veranlaß!« verschiedene Flieger ihre Maschinen zu probieren. Fischer mit seinem 160 PS Henry Farman kam nach sehr kurzem Anlauf, ca. 30 m, spielend vom Wasser weg und führte einen größeren Rundflug aus. Bei der Wasserung kam der Schwimmer etwas hart auf. Durch den Stoß, der auch durch den elastischen Schwimmer nicht abgeschwächt wurde, brachen die beiden Schwanzträger, so daß die Maschine nach hinten versackte. Mit großer Spannung erwartete man daher den Beginn des Wettbewerbs Leider setzte am 4. und 5. April ein tropischer Regen ein. Es war ein ungewohntes Bild, die Flugzeuge, die teilweise noch auf See geblieben waren, im strömenden Regen auch am Strand ohne Schuppen stehen zu sehen Die Apparate schienen vollständig 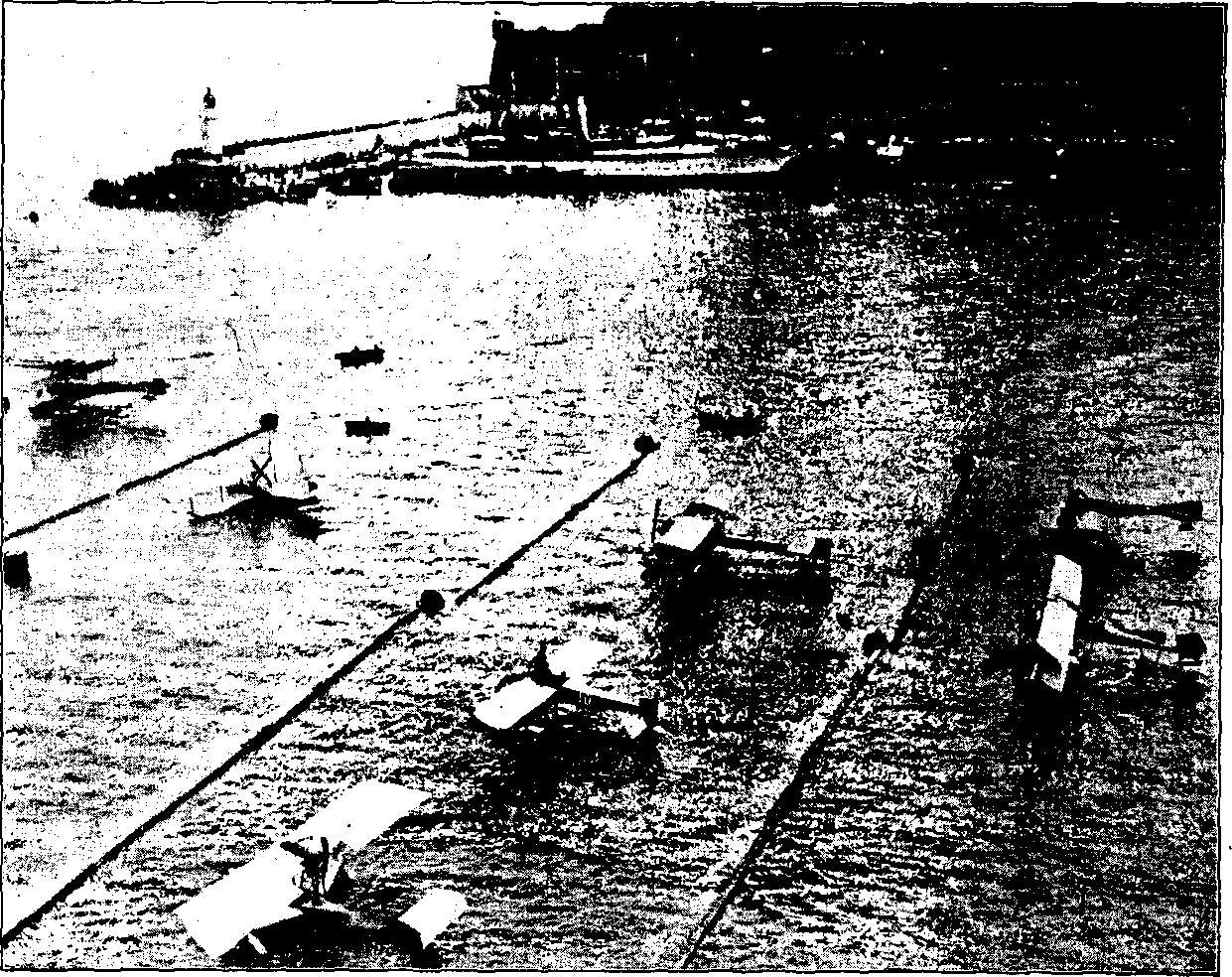 Der Wasserflug-Wettbewerb in Monaco. Die Ausstellung der Flugzeuge im Hafen von Monaco. durchweicht und doch hat der Regen dank der vorzüglichen Imprägnierung der Tragdecken und der einzelnen Teile wenig geschadet. Gerade diese Regentage haben gezeigt, daß es eigentlich überflüssig ist Schuppen für Wasserflugmaschinen, die ja doch auch den Einflüssen des Seewassers standhalten müssen, zu bauen. Für Segelschiffe baut man ja auch keine Unterkunftsräume. Wir werden uns bald daran gewöhnen, die Wasserflugmaschinen bei Wettbewerben im Freien stehen zu sehen, wobei selbstverständlich die Motorteile in ein Futteral gesteckt werden, wie man es in Monaco bereits beobachten konnte. Am 6. April erfüllten die Vorprüfungen: Gaubert (M. Farman) Vorprüfung No 1, 5 und (> Espanet (Niuuport) „ „ 1, 5 „ Ii Labouret (Astra) Vorprüfung No 1, 5 und ti Weymann (Nieuport) „ „ 1, 5 „ 6 Gilbert (Morane-Saulnier) „ „ 1 Bregi (Breguet) „ „ 5 „ (i Der 7. April war ein Unglückstag für die Deperdussin-Fliegcr. Vormittags 10:30 Uhr führte Janoire mit seinem Deperdussin 100 PS Gnom einen Probeflug aus Bei der Wasserung wurde er von der Sonne geblendet und verschätzte sich in der Höhe. Der Eindecker kam sehr hart auf und überschlug sich, wobei die Tragdecken zerbrachen. Nachmittags zeigte sich am Horizont der in Toulon stationierte Deperdussin-Eindecker gesteuert von Devienne. Der Eindecker versuchte in steilem Gleitfluge vor dem Taubenschießstande schräg zur Dünung zu wassern. Durch die starke See wurden beide Schwimmer seitlich auseinander gerissen, ohne daß sich der Apparat überschlug Gegen 4 Uhr wasserte Prevost mit seinem Deperdussin 160 PS Gnom so hart, daß der Schwanz abbrach. Um 5 : 15 Uhr versuchte Labouret auf Astra 120 PS Salmson im Hafeneingang zu starten. Labouret hatte jedoch den Apparat zu zeitig hochgerissen und dieser rutschte, sich überschlagend, rechts nach hinten ab. Die Insassen blieben vollständig unversehrt. Wäre der Sturz auf dem Lande vor sich gegangen, so wären sie sicher ohne Verletzungen nicht davon gekommen, Die Vorprüfungen bestanden an diesem Tage: ßregi (Breguet) Vorprüfung No. 1 Prevost (Deperdussin) „ „ 1, 2, 3 und 6 Chemet (Borel) „ „ 1 und 6 Daucourt (Borel) „ „ 1 und 6 Gilbert (Morane-Saulnier) „ „ 6 Espanet (Nieuport) „ „ 2 Am 8. April wurden folgende Vorprüfungen bestanden: Barra (Astra) Vorprüfung No. 1, 5 und 6 Bregi (Breguet) „ v 2 Gaubert (M. Farman) „ „ 2 und 3 Weymann (Nieuport) „ „2 Espanet (Nieuport) „ „ 3 Gegen 6 Uhr ging Gaudart auf Artois zum ersten Male heraus und kam schnell vom Wasser weg. Er wasserte nach einem Fluge von ca. 10 Minuten sehr hart, ohne etwas zu zerbrechen. Gegen 9 Uhr erschien Garros auf Morane-Saulnier Eindecker von Frejus kommend am Horizont, um an dem Coup Schneider mit teilzunehmen. Am 9. April erfüllten die Vorprüfungen: Weymann (Nieuport) Vorprüfung No. 3 und 4 Espanet (Nieuport) n v 4 Bregi (Breguet) „ 4 Moineau (Breguet) „ 4 Am 10. April startete Chemet auf Borel, blieb jedoch an einem Boot hängen und überschlug sich, wobei der linke Flügel seines Eindeckers zerbrach Ferner flog Fischer um die Vorprüfung. Barra zerbrach ebenfalls den linken Kluge] seiner Maschine Die Vorprüfungen waren somit beendet. Es qualifizierten: 1. Henri ßregi (Breguet, 120 PS Salmson) 2. Weymann (Nieuport, 100 PS Gnom) 3. Espanet (Nieuport, 100 PS Gnom) 4. Prevost (Deperdussin, 160 PS Gnom) 5. Moineau (Breguet, 120 PS Salmson) 6. Gaubert (Maurice Parman, Renault) 7. Fischer (Henry Farman, 160 PS Gnom). Am 11. April begannen die Ausscheidungsflüge um den Coup Schneider. Es hatten gemeldet: Espanet (Nieuport), Chemet (Borel), Garros (Morane-Saulnier), Bregi (Breguet) und Prevost (Deperdussin). Bregi schied im letzten Moment aus. Espanet, Garros und Prevost ließen sich zum Taubenschießstand hinausschleppen. Dann schwammen sie mit eigener Motorkraft bis zum Kap Martin, 2% Meilen, wo zuerst Garros mit seinem leichten Morane-Saulnier Eindecker hochkam. Espanet mit seinem Nieuport mußte sich erst Gegenwind suchen, um vom Wasser los zu kommen. Prevost auf Deperdussin glitt sehr gut über die Wellen und zeigte eine sehr hohe Geschwindigkeit. 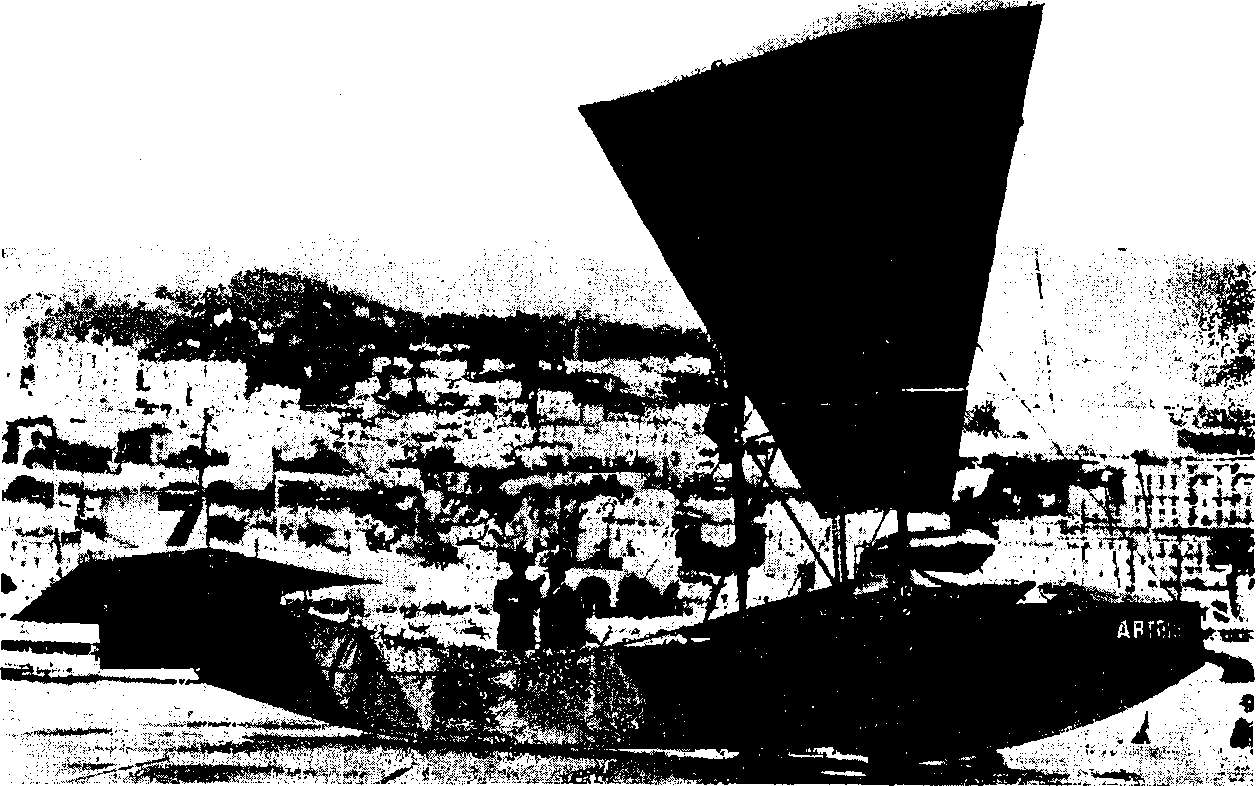 Der Wasserflug-Wettbewerb in Monaco. Der Artois-Zweidecker. Für die 40 km Strecke, wovon 5. km auf dem Wasser zu schwimmen waren, wurden folgende Zeiten erreicht: 1. Prevost (Deperdussin) 31 :28 Min., (davon 5 Schwimm- kilometer in 9:18) 2. Garros (Morane-Saulnieri 407.. Min., (davon 5 Schwimm- kilometer in 5 : 13 Vi) 3. Espanet fNieuport) 42 : 36 Min., (davon f> Schwimmkilometer in 6 : 34). Endlich am 1'2. April begann der Wettbewerb um den großen Preis von Monaco. Dieser Tag war der bedeutungsvollste aller bisherigen französischen Wasserflugkonkurrenzen. Der größte Teil der Maschinen wurde kurz und klein geschlagen. Die See ging sehr hoch und die Windstärke wurde mit 7 angegeben Durch die Ereignisse an diesem Tage wurde mit einem Male der Schleier gelüftet. Die Konstrukteure sahen mit Entsetzen, daß man mit den bisherigen unzulänglichen Mitteln nicht in der Lage ist, gegen die schweren Seen anzukämpfen. 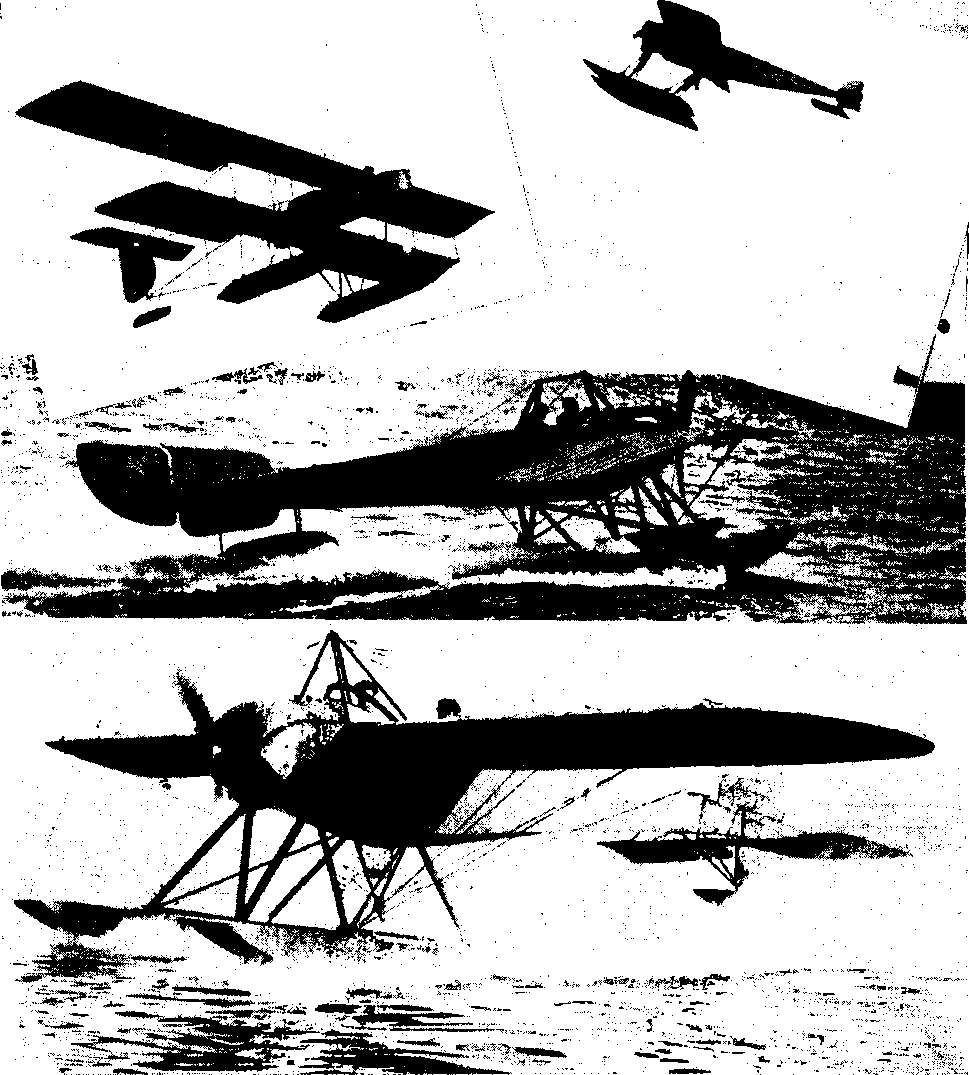 Der Wasserflug-Wettbewerb in Monaco. Morane-Saulnier Zweideaker mit Motor le Rhone im Fluge. Rechts oben: Oarros auf Morane-Saulnier, in der Mitte: Nieuport während der Fahrt, unten: Boret während der Fahrt. Was nützen die schönen Wasserflugmaschinen, wenn sie sich nicht auf offener See halten können, wenn sie bei der Wasserung oder auf hoher See kurz und klein geschlagen werden ? Dem Fachmann werden jetzt manche Ausführungen, die an dieser Stelle oft genug wiederholt wurden, klar werden. Bei manchem deutschen Konstrukteur, der die Vorgänge am 12. beobachten konnte, werden Zweifel aufgetaucht sein, ob es überhaupt möglich ist, den Kampf mit den Wellen erfolgreich aufzunehmen. Allerdings, die Schwierigkeiten sind sehr groß, es genügt eben nicht, daß man eine gewöhnliche Landmaschine auf ein paar Schwimmerchen setzt. Die Erfolge von Heiligendamm erscheinen jetzt angesichts der Erfolge von Monaco auch denjenigen, die sie nicht gern sahen, in einem ganz anderen Lichte. Die deutschen Konstrukteure, die den Vorgang am 12. studierten, haben enorm viel gelernt und sind hoffentlich überzeugt, daß wir einen ganz anderen Weg einschlagen müssen. 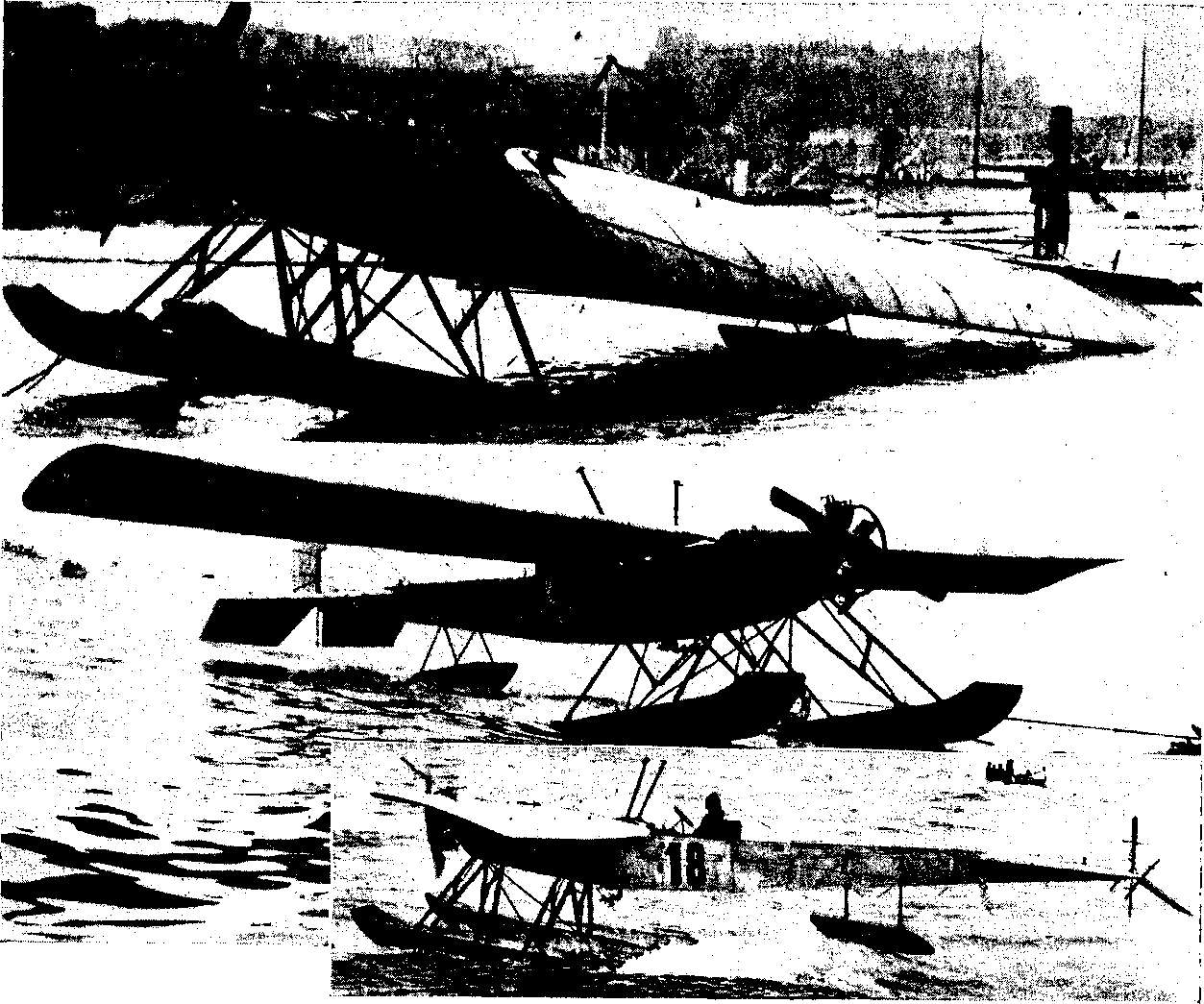 Der Wasserflug-Wettbewerb in Monaco. Eindecker Marcay-Mooner. Oben: zusammengelebt, in der Mitte: mit entfalteten Flügeln, unten: während der Fahrt auf dem Wasser. Dringend warnen möchte ich vor der Anschauung, daß wir bedeutend mehr leisten wie die Franzosen. Unseren Maschinen wäre es in Monaco nicht anders ergangen. Die französischen Flieger haben mit großer Energie und mit Schneid versucht, ihre Aufgaben zu lösen. Fischer auf H. Farman und Gaubert auf M. Farman flogen am Taubenschießstand gegen den Wind spielend vom Wasser ab. Den Eindeckern mit ihren kleinen Tragflächen machte das Abwassern Schwierigkeiten. Espanet (auf Nieuport) flog quer zur Dünung, wobei das Wassergestell verbogen wurde. Bregi und Hoinau (auf Breguet) kamen nur schwer vom Wasser weg. Prevost (auf Deperdussin) zerschlug sich an dem hohen Seegang den Propeller. Fischer gelang es, trotz der hohen See bei Beaulieu zu wassern und die 5 km abzufahren. Durch einen plötzliehen Windstoß wurde der Apparat einseitig hochgerissen und auf das Wasser zurückgeworfen, wodurch ein Flügel ins Wasser geriet. Die Maschine schlug um und wurde zertrümmert. Weymann (auf Nieuport) gelangte auch bis Beaulieu, und versuchte die Schwimmkilometer mit abgedrosseltem Motor zu absolvieren. Hierbei brach plötzlich der Schwanz des Apparates und die Maschine versackte. Moineau (Breguet) war gleichfalls bis Beaulieu geflogen, absolvierte seine 5 Schwimmkilometer, wasserte ab und flog nach San ßemo, wo ein noch größerer Seegang herrschte. Die Wasserung erfolgte ohne Unfall. Eine Viertelstunde lang kämpfte Moineau mit den Elementen. Infolge Kurzschluß blieb plötzlich der Motor stehen. Der Flieger hatte daher die Gewalt über seine Maschine verloren. Sofort eilte ein Dampfer herbei, der die Maschine ins Schlepptau nahm und zu retten suchte. Das Flugzeug wurde wie eine Nußschale hin und her geworfen und kenterte plötzlich. Die Insassen wurden gerettet. Gaubert (auf M. Farman) war gleichfalls bis Beaulieu geflogen, konnte jedoch seine Maschine nicht gegen den Wind bringen. Er zog es vor zu ankern, um einen günstigeren Wird abzuwarten. Ebenso entschloß sich Bregi in Beaulieu zu bleiben. Infolge der ungünstigen Witterungsverhältnisse beschloß die Sportkommission, das Rennen zu annullieren. Von den ausgesetzten Preisen gelangten 25 000 Frs. an die Teilnehmer zur Verteilung. Moineau erhielt 13000 Frs., Fischer, Gaubert, Weymann und Bregi je 3000 Frs Der verbleibende Rest von 25 000 Frs. ist für einen weiteren Flug für den nächsten Tag bestimmt. Am 14. April hatte sich das Meer etwas beruhigt, auch die Windverhältnisse waren bedeutend besser geworden. Die in Beaulieu liegen gebliebenen Apparate von Gaubert (M. Farman) und Bregi (Breguet) flogen nach Monaco zurück Ferner flogen Gilbert auf Morane-Saulnier-Zweidecker und Gaudart auf Artois. Borel hat inzwischen seinen Riesen-Eindecker mit 160 PS Gnom-Motor, der für die italienische Flotte bestimmt ist, für einen Demon-strationsflug hergerichtet. Dieser Eindecker besitzt einen Führer- und zwei Gastsitzo, die hintereinander liegen. Aus dem Johannisthaler Fliegerlager. (Berliner Korrespondenz des „Flugsport"). Wer heute Flieger werden will, muß die Pilotenprüfung ablegen, und wer diese Prüfung abnimmt bezw. kontrolliert, das sind die „Sportzeugen" — pardon Flugprüfer. Was der D. L. V. mit den Bestimmungen über die Flugprüfer angerichtet hat, wissen wir in Johannisthal am besten. Zu Anfang dieses Monats mehrten sich die Klagen über die neuen Bestimmungen, es war sogar so weit, daß kein Flugschüler sein Examen ablegen und kein Flieger um einen Preis aus der National-Flugspende starten konnte. So etwas passiert auf dem ersten Flugplatz Deutschlands, auf dem die Bedingungen des D. L. V. gelten. Die Schimpfereien der Flieger, denn auf derartige Bestimmungen muß man schimpfen und sogar ganz gehörig, haben erreicht, daß der Flugplatz wieder mit Sportzeugen — klingt bedeutend besser als Flugprüfer — versorgt ist. Wir wollen hier nicht auf die näheren Umstände, die zu den Klagen geführt haben, eingehen. Die Flieger und jeder vernünftig denkende Mensch, der etwas von der praktischen Fliegerei versteht, hätten derartige Bestimmungen nicht herausgebracht. Pilotenzeugnisse und Flüge um Preise der Nationalflugspende werden nun mal nicht auf dem grünen Tisch ausgeflogen, sondern auf dem Flugplatz . . . Bei Albatros sind die ersten Tauben herausgekommen, die unter Führung von Hirth ganz ausgezeichnete Resultate erzielt haben. 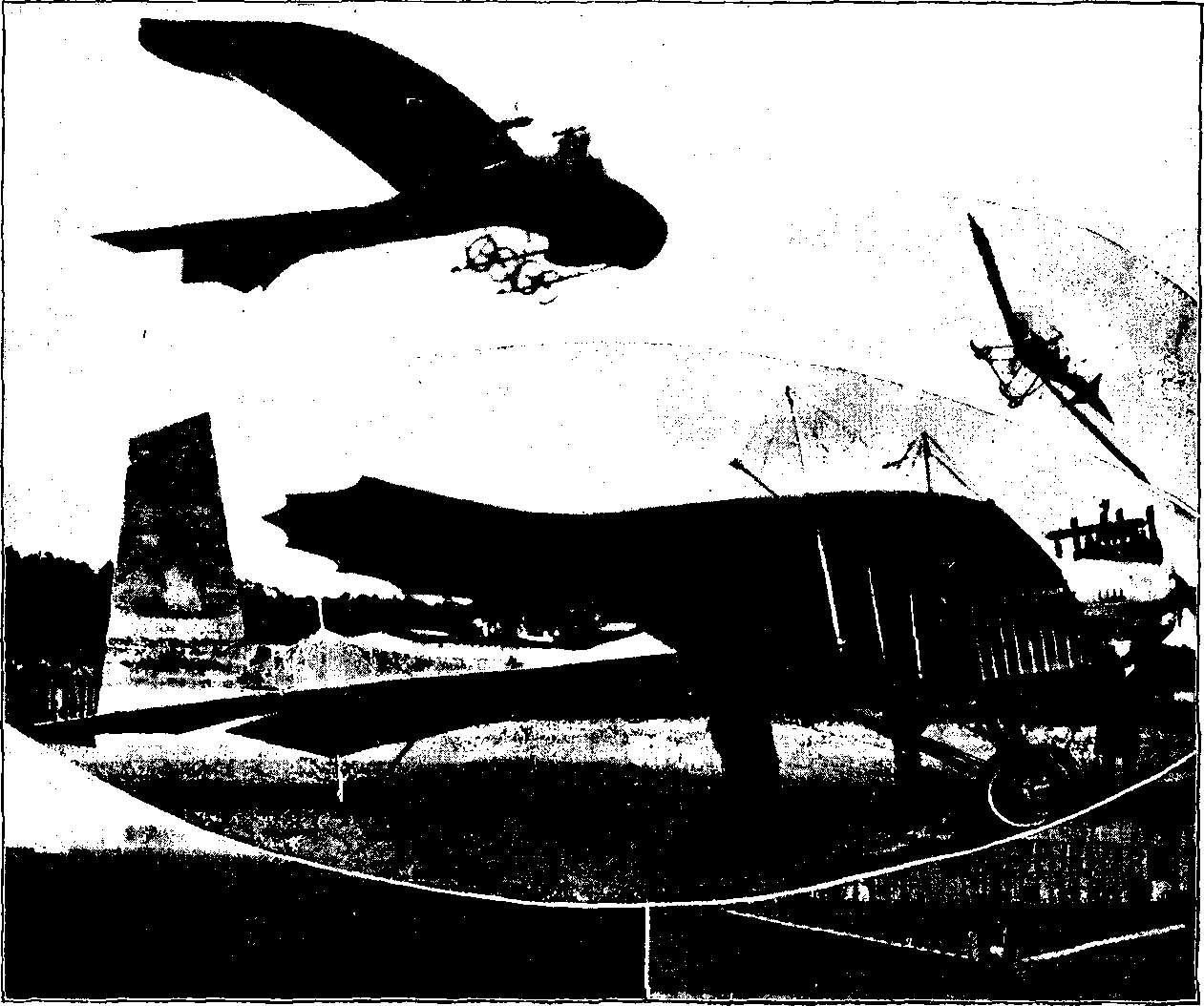 Aus dem Johannisthaler Fticgcrlager. Oben links: Dr. Geest-Eindecket im Fluge. Oben rechts: Ein kühner Kurvenflug Fokkers. In der Mitte: Neue Rnmpler-Taube. Bekanntlich fordert die Heeresverwaltung, daß der Apparat mit einer Nutzlast von 200 kg und Betriebsstoff für 4 Stunden eine Höhe von 800 m in maximum 15 Minuten erreicht. Hirth gebrauchte hierzu bei seinem erstmaligen Versuch !) Minuten und später erreichte er 800 m in 6l/3 Minuten, Diese Leistung ist bis jetzt von keinem anderen Apparat bei gleichen Bedingungen erreicht worden und dürfte vielleicht später die Heeresverwaltung veranlassen, die Steiggeschwindigkeit noch zu erhöhen. Der von der Luft-Verkehrs-Ges. herausgebrechte Doppeldecker mit 100 PS Mercedes Motor ist nun in den Besitz der Militärverwaltung übergegangen. Leutnant Carganico, der bekannte Metzer Offiziersflieger, hat mit dem Apparat in letzter Zeit verschiedene hervorragende Flüge ausgeführt. Wirklich bewundernswert ist die außerordentliche Stabilität bei starkem Winde. Am 8. d. M. unternahm Leutnant Carganico mit Leunant II a a c k als Beobachter einen größeren Ueberlandflug, der als Ziel Breslau hatte. Der Apparat startete morgens um 6l/2 Uhr, mußte jedoch 18 Kilometer von Beeskow wegen Vergaserdefektes eine Notlandung vornehmen. Nachdem der Schaden gehoben war, flog Leutnant Carganico nach Beeskow zurück und führte dort über dem Exerzierplatz verschiedene Schauflüge aus. Am darauffolgenden Tage begann der Start um 6 Uhr in der Richtung nach Breslau. Ein starker Rückenwind begünstigte die Fahrt und legte der Apparat 260 km in der Zeit von 98 Minuten zurück, was einer Stundengeschwindigkeit von ca. 160 km entspricht. Die Landung erfolgte glatt in Breslau. Wie Leutnant Carganico erzählte, vollzog sich die Reise in den ersten 200 km in Schnee- und Hagelwetter. Weiterhin wurde der Apparat häufig durch VertikalBöen auf und nieder geworfen. Trotzdem hatte der Führer sehr wenig zur Erhaltung der Seitenstabilität zu tun und war hocherfreut über die außerordentliche Leistungsfähigkeit des Apparates. Bei Rumpier wird von Beck eine neue Taube mit vereinfachtem Fahrgestell ausprobiert, die bei ihrem Probefliegen eine ziemlich hohe Geschwindigkeit entwickelte. Sehr gute Fortschritte macht auch Dr. Geest, der einen neuen Apparat mit 100 PS Argus herausbrachte. Der schöne möwenartige Eindecker mit seinen automatisch stabilen Flügeln erwies von neuem die Richtigkeit des Weges, den Dr. Geest trotz vielfacher Anfeindungen eingeschlagen hat und unverdrossen weiter geht. Es fällt jedem, auch dem Laien sofort auf, mit welcher Selbstverständlichkeit und Sicherheit der Apparat seine Kreise zieht. Die Maschine führte vor einiger Zeit unter Steuerung von Roempler verschiedene hervorragende Flüge, die bis zu 300 m führten, aus. Ltn. Coler hat zum Bau einer neuen Type von Flugmaschinen die „Cormoran-Ges." gegründet, die in nächster Zeit schon den Betrieb eröffnen wird. ... er. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Jetzt hat Frankreich auch seinen „Zeppelintag" gehabt. Allerdings hat die deutsche Militärluftschiffahrt sich nur unfreiwillig daran beteiligt, nichtsdestoweniger hat die Sache einen großartigen „Erfolg" gehabt und die Franzosen, die erst sich über den „Spionageversuch1' furchtbar aufgeregt haben, zeigen sich heute in hohem Maße befriedigt über das Mißgeschick des deutschen Lenkluftschiffs, das sich in diesem Falle freilich nicht sehr „lenkbar" erwiesen hat; sie haben sich nun „Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel IX. 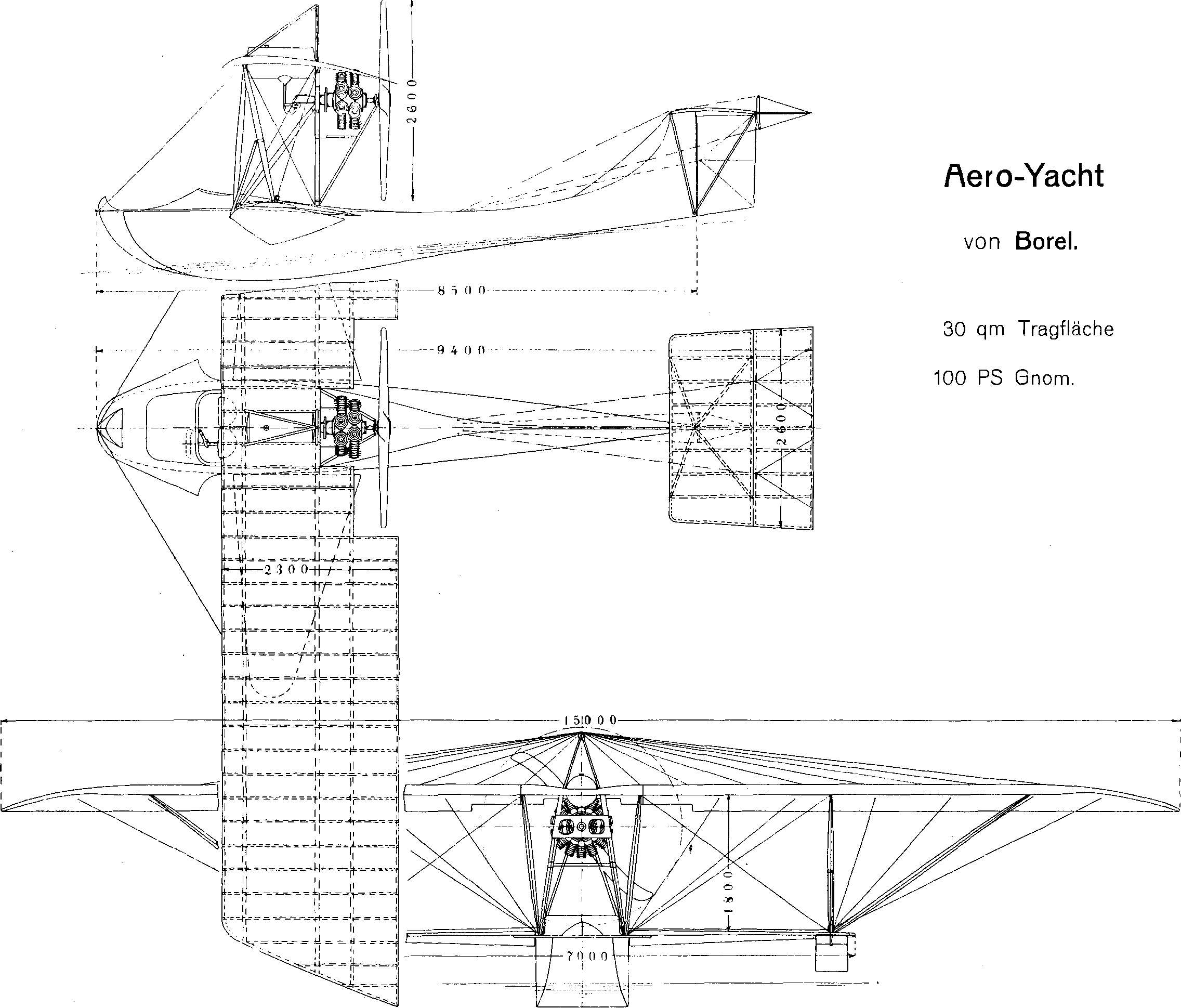 Nachbildung verboten. den geheimnisvollen Bau in aller Nähe und in aller Muße betrachten, haben zahlreiche photographische Aufnahmen von allen Einzelheiten des Militärluftkreuzers machen können, die heute in zahllosen illustrierten Zeitungen erscheinen, und haben die aus Paris und allen Teilen Frankreichs telegraphisch herbeigerufenen Ingenieure auf den flügellahmen Zeppelin geschickt, dem man der Vorsicht halber vorher die Magnetzündung genommen hatte, so daß der Motor zur Untätigkeit gezwungen war. Und wie zum Hohn kamen aus Vesoul, aus Toul, aus Luneville die Flugzeuge herbei, von Offizierspiloten gesteuert, und umkreisten das ohnmächtig auf dem Felde von Luneville liegende Luftungeheuer. Das war ein Triumph des „Schwerer- als-die-Luft" über den Lenkballon..... Es ist, als ob die Franzosen aus dieser Zeppelin-Affaire einen neuen Ansporn gewonnen haben für die Betätigung ihres Flugwesens, das sie, wohl nicht ohne Grund, höher bewerten, als die Lenkluftschiffahrt, wenigstens soweit militärische Gesichtspunkte dabei in Betracht kommen. Das französische Militär-Flugwesen hat sich in den letzten Tagen außerordentlich rührig gezeigt. Der Unteroffizier Strohl flog dieser Tage von Le Crotoy auf einem 50 PS Caudron-Zweidecker ab und gelangte bis nach dem Manöverfelde von Beauvais, wo er sich von neuem verproviantierte, um seinen Flug fortzusetzen. Er flog dann bis nach dem Flugplatz von Saint-Cyr und von dort zurück nach Le Crotoy und hatte so insgesamt eine Distanz von 300 km hinter sich gebracht, wobei er eine Flughöhe von mehr als 1000 Metern innegehalten hat. Vom Flugcentrurn Maubeuge flog am letzten Sonnabend ein Luftgeschwader von vier Flugzeugen ab, und zwar vier Deperdussin-Eindeckern, welche Befehl erhalten hatten, sich nach dem Schießplatz von Sissone zu begeben, um dort die Zieleinstellung der Artillerie zu kontrollieren und zu beglaubigen. Trotz des heftigen Windes gingen die vier Flieger, die Lts Eadisson, La 1 a n n e, Eo ch e t te und der Unteroffz. Verdier, von Maubeuge ab und nahmen jeder einen Beobachtungsoffizier an Bord ihrer Maschine mit. Inzwischen hatte die Militärverwaltung zwei anderen Fliegern, den Lts. Brocard und Didier, welche in Reims stationiert sind, den gleichen Auftrag erteilt. Das Geschwader Maubeuge langte zuerst auf dem Schießplatze, an, es hatte die Entfernung in 40 Minuten zurückgelegt. Wenige Minuten später trafen die Reimser Offiziere am Ziel ein. Am gleichen Tage wurden zwei Offiziersflieger aus Chälons gleichfalls zur Ziel-Beobachtung beordert. Es waren das die Leutnants deGensac und Dambe rvi 11 e, welche auf ihren 80 PS Farman-Zweideckern, mit je einem Beobachtungsoffizier an Bord, sich ihrer Aufgabe in vorzüglicher Weise entledigten. Sie hielten sich dabei in beträchtlicher Höhe und brachten Dokumente zurück, die von dem kommandierenden General als außerordentlich wertvoll bezeichnet wurden. Eine interessante Leistung vollbrachte der bekannte Flieger, Hauptm. Aubry, welcher als einer der besten Fußballspieler in Frankreich gilt. Aubry hat dabei ein seltenes Maß von Kaltblütigkeit gezeigt, und bewiesen, daß diese Eigenschaft sehr oft das Leben der Flieger zu retten imstande ist. Von Reims abgeflogen, um sich nach Longwy zu begeben, blieb er mit seinein Deperdussin-Eindecker (60 PS Clerget-Motor) in Longwy, um daselbst mehrere Flüge auszuführen. Am Donnerstag nahm Aubry bei sehr starkem "Winde (auf dem Eiffelturm wurden 11 Meter gemessen) seinen Abflug. Plötzlich wurde der Apparat von einem furchtbaren Windstoß erfaßt. Aubry, der sich auf seinem Sitze nicht festgemacht hatte, wurde mit großer Heftigkeit auf das Steuerrad geworfen und das Flugzeug ging mit der Spitze nach unten gegen den Hoden. Ein zweiter Windstoß drehte den Apparat vollständig um und der Eindecker flog 200 Meter weit mit den Landungsrädern in der Luft dahin. In dieser Stellung ist übrigens das Flugzeug von der Erde aus photographiert worden. Aubry, der sich krampfhaft an seinen Sitz klammerte, vermochte endlich sein Gleichgewicht wieder herzustellen, und als er bemerkte, daß er sich über sumpfigem Terrain befand, stellte er den Kontakt wieder her und landete 3 km weiter hin. General Hirschauer hat den kühnen Flieger telegraphisch beglückwünscht und es steht eine Auszeichnung Aubrys bevor. Daß neben diesen mannigfachen beachtenswerten Leistungen das französische Militärflugwesen leider auch einige schwere Unfälle zu verzeichnen hat, muß erwähnt werden. Am vergangenen Mittwoch langten auf dem Flugplatze von Amiens zwei Flieger vom Flugcentrum Reims in kurzen Abständen an: der Artillerieleutnant Arreteau und der Artilleriewachtmeister Ghauroux. Die Landung des ersteren erfolgte ohne Zwischenfall. Im Augenblick aber, wo Ohauroux landen wollte, neigte sich der Eindecker stark auf die Seite und der linke Flügel streifte den Boden, sodaß der Apparat plötzlich umschlug. Der Flieger hatte sich von der bevorstehenden Gefahr Rechenschaft gegeben; er erhob sich von seinem Sitze, um herauszuspringen. Der heftige Aufprall der Maschine aber schleuderte ihn hinaus und der unglückliche Flieger stürzte mit dem Kopfe auf die Erde, wo er sofort tot liegen blieb. Ein zweiter Unfall ereignete sich auf dem Militärflugplatz von Buc. Hier unternahm der Adjudant Faure einige Uebungsflüge, als plötzlich der Apparat infolge Nachlassens des Motors mit der Spitze nach unten stürzte. Faure wurde herausgeschleudert, während die Maschine sich nachher in der Luft überschlug und unglücklicherweise auf den Flieger herabfiel, welcher dabei seinen sofortigen Tod fand. Auch ein Zivilflieger, und zwar der bekannte Geo Verminck, hat in Indo-China, wo er seit einigen Monaten weilte und wo er durch seine gelungenen Flüge, namentlich oberhalb der Stadt Saigon großen Enthusiasmus entfesselte, durch Absturz seinen Tod gefunden. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß der bekannte Oberst Bouttieaux von der Militärverwaltung nach Marokko entsandt worden ist, wo er die Flugcentren von Biskra, von Algier und von Constantine besichtigen soll. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen ersten Schritt zur Abhilfe der vielmals gerügten Organisationsmängel in den Kolonien. Einen hübschen Flug vollbrachte dieser Tage Letort auf einem Zweidecker Henri Farman, 9 Zylincler-Motor Le Rhone, indem er von Lyon abflog, in der Absicht sich nach Paris zu begeben. Infolge der dichten Wolkenbildung konnte Letort nicht über die Oevennen No. 8 „FLUGSPORT." Seite 29Ö pausieren, weswegen er in Maeon landete. Als sich das Wetter etwas aufgeklärt hatte, setzte er seinen Flug fort, ging in 600 Meter Höhe über die Cevennen hinweg und gelangte nach Nevers, von wo er am nächsten Morgen wieder abflog. Er ging in 400 bis 500 Meter Höhe den Lauf der Loire entlang, passierte über Montargis, Malesherbes und kam glücklich nach Etampes, wo er im regelrechtem Schwebefluge landete. Hamel scheint sich zum Spezialisten der Kanal-Ueberquerung herausbilden zu wollen; er hat wiederum zweimal die Reise nach dem Kontinent unternommen, wobei er das erste Mal von Calais aus bis Gent flog, während er am vergangenen Freitag den Flug von Dover nach Dunkerque und zurück ohne Zwischenlandung ausführte, wobei er etwa 11 Meilen von der französischen Küste einen heftigen Windwirbel antraf, der ihn eine Zeitlang in Gefahr brachte. Viel Interesse erweckt der Kampf um den Pommery-Pokal, den Leganeux und Brindejonc des Moulinais unternahmen. Wie berichtet worden, hatte letzterer seinen Flug nach Madrid in Burgos unterbrochen, von wo er ihn endlich bis nach der spanischen Hauptstadt fortsetzte. Er flog um 9 Uhr von Burgos ab, langte 9 Uhr 50 in Aranda an, ging von dort nach einer Stunde wieder davon, übersetzte die gefürchtete kastilische Gebirgskette, die Sierra di Guada-rama und langte schließlich wohlbehalten in Madrid an. Von Madrid aus wollte der Flieger den Flug nach Paris (1110 km) auf seinem Morane-Eindecker (50 PS Gnom-Motor) unternehmen; er flog dieser Tage von dort ab und landete nach 2'U stündigem Fluge in Saragossa, nachdem er die 300 km trotz heftigen Seitenwindes hinter sich gebracht hatte. Von dort flog er nach Barzelona und von dort über Montpellier nach Monte melimar. Dort hatte sich sein Freund Legag-neux zu einer Begegnung eingefunden und beide Flieger setzten die Weiterreise fort, indem sie zusammen bis nach Chalon-sur-Saöne flogen, von wo sie dieser Tage Paris zu erreichen gedenken. Weniger günstig läßt sich die angekündigte Ueberquerung des Mittelländischen Meeres im Wasserflugzeug an, die bekanntlich Seguin auf einem Farman - Flugzeug (140 PS Vierzehnzylinder Gnom-Motor) projektiert. Seit einigen Wochen schon sind alle Vorbereitungen für diesen Flug, der von Marseille nach Algier führen soll, beendet und die von der französischen Regierung bereit gestellten fünf Torpedoboote liegen schon lange im Hafen von Marseille, aber bisher hat Seguin seinen Abflug von Tag zu Tag verschoben, nicht ohne daß die Presse jeden Tag einen neuen Grund für die Verzögerung zu finden bemüht ist. Wiederholt hat Sogain in Marseille Abflugversuche unternommen und bei einem solchen wäre er beinahe verunglückt. Am letzten Dinstag unternahm er, mit einem Passagier an Bord, wiederum einen Abflugversuch; als er sich in der Höhe der Insel Frioul befand, wurde der Apparat von einem Windstoß ins Meer geschleudert. Beide Insassen wurden heil aus dem Wasser gezogen, der Apparat ist schwer beschädigt. An- gesichts dieses mißglückten Versuchs erscheint das Projekt eines Amerikaners, den Atlantischen Ozean im Flugzeug zu überqueren als geradezu ungeheuerlich. Ein in den Vereinigten Stauten bekannter Akrobat, namens Rodmann Law, will in Begleitung eines Landsmannes das Wagnis unternehmen, von Neufundland aus nach der Westküste von Irland über den Ozean zu fliegen. Sie wollen dazu ein Wasserflugzeug benutzen, welches speziell für diesen Zweck gebaut wird. Der Apparat wird mit zwei Sitzplätzen versehen, die so angelegt sind, daß beide Insassen abwechselnd die Steuerung ausführen und sich ausruhen können. Der Abflug soll im Monat Juli dieses Jahres vor sich gehen, die Daner der Reiso ist auf 36 Stunden angenommen. Hiesige Fachleute meinen, daß der Flug in zwei Etappen möglich wäre, mit einmaligem Niedergehen auf dem Wasser, wo ein zu diesem Zweck stationiertes Schiff den beiden Fliegern neuen Betriebsstoff und Nahrungsmittel zuführen würde. Allerdings schreibt ja auch die englische „Daily Mail" einen namhaften Preis für eine Ozeanüberquerung aus, aber auch dieses Projekt dürfte wohl, und damit wird die „Daily Mail" wohl auch gerechnet haben, vorläufig unrealisiert bleiben. Nichtsdestoweniger interessiert man sich hier für den neuen Preis des englischen Blattes, besonders nachdem hier bekannt geworden ist, daß sich außer den Engländern Gordon und Cody auch der Deutsche Rumpier an dem Bewerb beteiligen will. Bleriot hat darauf erklärt, daß in diesem Falle anch er sich für den „Daily Mail"-Bewerb eintragen lassen werde. Vorläufig wendet man sich hier den leichter realisierbaren Flugprojekten zu und namentlich die regulären Preise werden sehr bald lebhaft umstritten werden. Für den vorhin bereits erwähnten Pommery-Pokal haben sich bei der Ligue Nationale Aerienne noch Vidart mit einem Moräne-Eindecker, Bathiat mit einem Eindecker Bathiat-Sanohez ßesa, und Audemars mit einem Morane-Eindecker einschreiben lassen. Bekanntlich läuft die Bewerbsfrist Ende dieses Monats ab. Audemars beabsichtigt, den Distanzrekord, den gegenwärtig Daucourt mit 852,300 km inne hat, anzugreifen. Auch an dem großen belgischen Wasserflugzeugbewerb 1913 sollen sich die Franzosen beteiligen; der Aero-Club von Belgien organisiert diesen Bewerb, bei dem die Flugzeuge von Lüttieh abfliegen, bis nach Mastricht in Holland gelangen und von dort über Antwerpen nach Gent zurückkehren müssen. Das Zivilfliegerwesen hat wieder einige interessante Auszeichnungen zu verzeichnen: Jacques Balsan und ReneQuinton sind zu Rittern der Ehrenlegion ernannt worden. Uebrigens geht die Bewegung zugunsten des Zivilflugwesens weiter. Aufsehen erregte hier die Rede, welche kürzlich der Oberstleutnant Renard in der Sorbonne hielt und in der er sagte, daß die jungen Leute vor den Gefahren des Fliegens zurückschrecken und daß daran das Zivilllugwesen ciahinsieche. Die „Gesellschaft der Flieger" hat darauf den Herrn Oberstleutnant öffentlich scharf angegriffen und ihn mit vollem Rechte darauf aufmarksam gemacht, daß nicht ein einziger Apparat, auf dem die Militärflieger ihre Flüge ausführen, aus den Ateliers herausgegangen ist, ohne daß er vorher von „den ängstlichen jungen Zivilmenschen" probiert worden ist. Die Zivilflieger seien ebenso tüchtig wie die Militärflieger; aber während diesen letzteren der Staat jede denkbare Förderung und Unterstützung zu Teil werden lasse, existieren für ihn die Zivilflieger nicht, die somit ganz auf sich angewiesen sind. Die Sache wirbelt hier viel Staub auf .... El. Kriegsflieger. Von Fr. Wm. Seekatz. Ihre Brauchbarkeit als Kriegswerkzeug hat die Flugmaschine zum ersten Mal im tripolitanischen Feldzuge erwiesen. Die Erkun-dvmgsflüge, die damals speziell von Hauptmann Rossi ausgeführt wurden, sich jedoch nur über ziemlich kurze Entfernungen erstreckten, waren Leistungen, denen man das größte Interesse zusprach. Bekanntlich hatten es die italienischen Kriegsflieger darauf abgesehen, nicht nur allein die Flugmaschine als Erkundungsmittel, sondern auch als direktes Angriffsmittel zu verwenden. Zu diesem Zwecke waren die Apparate mit Lanciervorrichtungen versehen, die es mit ziemlicher Genauigkeit ermöglichen sollten, die Bomben nach dem gewünschten Ziele zu werfen. Die hierbei gesammelten Erfahrungen ergaben jedoch das Resultat, daß die Flugmaschine als Angriffsmittel lange nicht die Bedeutung — wenigstens in der letzten Zeit — erreichen wird, die sie für einen Erkundungsflug besitzt. Die kriegsmäßige Höhe für eine Militärflugmaschine wurde in der ersten Zeit von den italienischen Kriegsfliegern mit 800 m angegeben. Es ergab sich jedoch, daß hierbei die Sicherheit des Apparates gefährdet wird und die von Geschossen herrührenden Löcher in den Tragdecks und an sonstigen Teilen der Flugmaschine, zeigten, daß in dieser Höhe ein sicherer und gefahrloser Erkundungsflug nicht möglich ist. Später wurden dann auch Höhen über 1000 m aufgesucht und Hauptmann ßossi, der wohl die meisten Flüge in Tripolis ausgeführt hatte, erklärte, daß die Höhen von 1100—1200 m die sichersten Flughöhen gewesen sind. Im Balkankrieg ist es vorgekommen, daß Militärflugmasehinen, die nicht in genügender Höhe flogen, einfach von den Feinden herunter geschossen wurden. Ueberhaupt litt die Militär-Aviatik im Balkan krieg sehr unter mißlichen Umständen, die dazu angetan waren, die Bedeutung der Flugmaschinen im modernen Kriege über Bord zu werfen. Von großen Leistungen hörte man selten etwas. Die Flieger beschränkten sich darauf, kurze Ueberlandflüge auszuführen, ohne jedoch über solchen feindlichen Hauptstellungen zu operieren, deren Erkundung für die eigene Heeresleitung von größter Bedeutung gewesen wäre. Gewiß, die Rolle eines Kriegsfliegers ist eine sehr schwere. Die Anforderungen, die hierbei an einen Menschen gestellt werden, steigen in das Riesenhafte. Aber wieviel Apparate sind im Balkankrieg durch unfaehmäßige Behandlung schon flugunfähig geworden, bevor sie überhaupt einen Meter auf dem Boden gerollt haben. Die Trümmerhaufen von Bleriotmaschincn bei Adrianopel sind den Lesern wohl noch aus den im „Flugsport" veröffentlichen Fotos bekannt. Sehr gut haben bei Adrianopel die deutschen Albatros-Doppeldecker abgeschnitten, die zu Anfang der Belagerung erfolgreiche Erkundungsflüge ausgeführt haben. Aber auch auf türkischer Seite sind zu Anfang des Krieges schon viele Maschinen unbrauchbar geworden. Die türkische Heeresverwaltung hatte z. B. verschiedene französische B EP-Eindecker bezogen, die jetzt herrenlos dastehen und von keinem Menschen geflogen werden wollen. Den genauen Grund konnte ich nicht erfahren. Vor einiger Zeit war, wie schon früher berichtet wurde, der türkische Instrukteur für Militär-Flugwesen, Adolf Eentzel in Deutschland und reiste nach kurzem Aufenthalt mit den deutschen Fliegern Ltn; Brey und dem früheren Harlan-Flieger Scherff, die beide für die Türkei Mars-Doppeldecker mit 100 PS Mercedesmotoren während des Krieges steuern sollten, ab. Es dauerte auch gar nicht lange, so berichteten schon die Tageszeitungen von erfolgreichen Erkundwngs-flügen dieser beiden Flieger. Die Türkei hatte keinen schlechten Griff gemacht Fast täglich fanden auf dem Aerodrom San-Stefano Aufstiege mit dem Mars-Doppeldecker statt und die Ergebnisse der Erkundungen waren für die Heeresverwaltung von größter Bedeutung. Unsere deutschen Flieger haben hier auf dem Kriegsschauplatz die ausländischen, besonders die französischen, Kriegsflieger in ihren Leistungen ganz bedeutend überboten. Das muß man unterstreichen und den Franzosen vorhalten. Aber mit Recht! "Wenn die bekannte französische Militärzeitschrift „La France Militäire" in einem Artikel schreibt: „Die letzten bekanntgegebenen deutschen Berichte über die in der Flugtechnik im Laufe des Jahres 1912 gemachten Fortschritte zeigen an, daß Deutschland in der Konstruktion von Flugmaschinen nichts mehr zu lernen hat, bedeutet jedoch, daß Frankreich in der Motorenfabrikation noch an der Spitze steht," so ist das in vollem Maße berechtigt, wenigstens in „einem" Punkt. .. Also., den Wert und die Leistungen unserer deutschen Flugmaschinen erkennt diese bedeutende Militärzeitschrift an, beansprucht aber immer noch die Ueberlegenheit der französischen Motore. "Wer hat bis jetzt die meisten Kriegsflüge unternommen und welcher Motor zeigte hier die bedingte Zuverlässigkeit ? Ein deutscher Apparat mit deutschem Motor! Der größte bisherige Kriegsflug ist von einem deutschen Flieger, von M. Scherff ausgeführt worden, der 4 Stunden 2 Minuten ununterbrochen direkt über den bulgarischen Stellungen flog. Im folgenden einige Berichte über die letzten erfolgreichen Kriegsflüge von M. Scherff Am Sonnabend den 22. März um ;5 Uhr morgens wurde der Mars-Doppeldecker auf dem Flugplatz San-Stefano wieder für einen größeren Ueberlandflug vorbereitet. Um 5 Uhr bestiegen Scherff und der Hauptmann im großen Generalstab Kemal Bey als Beobachtungsoffizier den Apparat und flogen den feindlichen Stellungen entgegen, die sofort ein heftiges Feuer auf ihn eröffneten. Zur Sicherheit wurden große Höhen aufgesucht und war 2500 m das Maximum. Der Flug wurde der Aufklärung halber von San-Stefano in der Richtung auf Serail im Zickzack ausgeführt und hatte als Ziel die Hauptstellung der Bulgaren bei Tschorlu. Der Hinflug ging am Marmara-Meer entlang über die Tschataldja-Linie, Silivri, Tschorlu, der Kückflug am Schwarzen Meer entlang über den Bosporus und Konstantinopel Die zurückgelegte Strecke beträgt ca. 390 km. Auf dem ganzen Flug beschossen die Bulgaren den Doppeldecker. Es muß für die Insassen ein unangenehmes Gefühl gewesen sein, als direkt über den Hauptstellungen der Bulgaren bei Tschorlu der Motor anfing unregelmäßig zu arbeiten Es war die Magnetzündung,  Kriegsflleger. Oben links: Der Mars-Doppeldecker. Unten links: Hauptmann Kemal Bey und M. Scherff nach der Landung. Unten rechts: Apparate die niemand mehr fliegen will. die manchmal aussetzte. Scherff schaltete dann immer auf Batterie und kam ohne Störung weiter. Direkt über den Häusern von Konstantinopel blieb der Motor stehen, da kein Tropfen Benzin mehr im Behälter war. Aus 2400 in erfolgte darauf die Gleitfluglandung. Der vom Hauptmann Kemal Bey erzielte Erfolg war großartig. Er konnte einen ausführlichen Bericht über die bulgarischen Stellungen abstatten und genau die Punkte der verschiedenen Befestigungen angeben. Der Vize-Oberbefehlshaber der Armee .Izzet Pascha, war über die Resultate des Erkundungsfluges derart befriedigt, daß er Scherff ein prächtiges Zigarettenetui für „Bravourleistungen" überreichen ließ. Am 27. März führte Scherff wieder einen großen Erkundungsflug aus, der 3 Stunden 27 Minuten dauerte. In großen Schleifen flogen sie über Silivri und Umgebung und stellte Kemal Bey jede Verschanzung und Batterie fest. Der Hinflug erfolgte in nur 600 Meter Höhe, da der Rückenwind den Apparat immer wieder herunterdrückte. Der Rückflug erfolgte mit Gegenwind in 2000 m. Auch dieser Flug war in militärischer Hinsicht von großer Bedeutung. Vor zwei Tagen traf ein kurzer Bericht von Scherff ein, den ich im Original wiedergeben möchte. San-Stefano, den 7. April 1913. Flog heute bei denkbar elendem Wetter mit Hauptmann Kemal Bey 2 Stunden 30 Minuten über die Bulgaren nach Strandjan und Kabakscha. Ziemlich niedrig, da Rückenwind mich immer runterdrückte. Bulgaren schössen mit Schrappnels, Kanonen und Infanterie heftigst. In Kabakscha, jetziges bulgarisches Hauptquartier, warfen wir 5 kg Bomben mitten ins Lager rein. Schlugen ein, riesige Staubwolke. Bulgaren bringen alles, was Beine hat vor Tschataldja, ich glaube, daß die Tschataldja-befestigungen in ca. 8Tagen von den Bulgaren gestürmt werden, vorausgesetzt, daß der Friede bis dahin nicht definitiv wird. Alles was in Adrianopel frei geworden, bringen die Bulgaren nach Tschataldja. Viele neue Befestigungen, Gräben, Wälle i hauptsächlich am Bahngleis. Hauptausladepunkt der Bulgaren ist Bahnhof Kabakscha. Start 4,53 Uhr Nachmittag, Landung 7,30 bei vollständiger Finsternis glatt. Monteure hatten große Benzinleuchtfeuer angezündet. Resultat von glänzendem Ergebnis. Eine Kugel mitten durch den oberen Holmen vom linken Tragdeck. Eine Kugel durch die rechte Verwindungsk1appe, alles von hinten , gesehen. Dritte Kugel unteres Tragdeck links i letzte Spiere Vierte Kugel glatt durch die Hö- hensteuer-Leinwand." Das Bild, das uns Scherff von der Tätigkeit als Kriegsflieger in diesem Bericht gibt, läßt erkennen, welchen großen Gefahren unsere Flieger im modernen Krieg ausgesetzt sind, es zeigt aber auch, welches Vertrauen er dem Apparat und dem Motor entgegenbringt. Die großartigen Leistungen, die Scherff bis jetzt in der Türkei vollbracht hat, stehen unvergleichlich da. Ausbildung von Flugzeugführern. Nach dem Beschluß des Kuratoriums ist die wichtigste Aufgabe der National-Flugspende, eine möglichst große Zahl von Flugzeugführern auszubilden. Dabei darf aber die Prüfung der Frage nicht unterlassen werden, was aus solchen auf Kosten der National-Flugspende ausgebildeten Flugzeugführern später werden soll; denn in den Betrieben von riugzengfabriken kann mir eine beschränkte Zahl von Flugzeugführern ihren F,rwerb finden. Auch erscheint es zweifelhaft, ob nicht in späteren Jahren das Einkommen aus der Beteiligung an Wettbewerben wesentlich eingeschränkt wird oder sogar in Wegfall kommt, zumal die von der National-Flugspende in Aussicht genommenen Wettbewerbe nicht auf die Dauer veranstaltet werden können. Da die Förderung des Flugwesens durch die National-Flugspende vor allem auch der Wehrhaftmachung des Vaterlandes dienen soll, so kommt bei der Ausbildung von neuen Flugzeugführern außer der Industrie im besonderen das Interesse der Heeres- und Marine-Verwaltung in Frage. Dabei sind 2 Gruppen zu scheiden: einerseits gilt es den Fliegertruppen der Heeres- und Marineverwaltungen in ihren Rekruten bereits ein Material zuzuführen, das durch Neigung sowohl wie durch praktische und theoretische Kenntnisse des Flugwesens als Nachwuchs dieser Truppen besonders geeignet ist. Auf der anderen Seite aber genügt für den Kriegsfall die aktive Fliegertruppe allein nicht. Es muß daher Vorsorge getroffen werden, unter den Mannschaften des Beurlaubtenstandes der Heeres- und Marineverwaltung für den Kriegsfall ausgebildete Flugzeugführer zur Verfügung zu stellen. Diese Erwägungen führen dazu, drei verschiedene Personengruppen zur Ausbildung von Flugzeugführern heranzuziehen Dieses sind: 1. Personen, die nach militärärztlichem Zeugnis voraussichtlich militärtauglich sind und noch nicht gedient haben, aber bereit sind sich zum nächsten Einstellungstermin der Fliegertruppe zur Verfügung zu stellen. Dabei wird abgeschlossene Bürger- oder Mittelschulbildung verlangt. Auüerdem muß ein Führungszeugnis beigebracht werden. Die National-Flugspende hat bei den zuständigen preußischen Ministeren angeregt, Flugzeugführern bei hervorragenden Leistungen im Fliegen und gutem vor einer besonderen Kommission dargetanen theoretischem Wissen gemäß § 89 Ziffer 6 (sogenannter KUnstlerparagraph) der Wehrordnung die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienste auf Grund einer Prüfung in den Elementarkenntnissen zu gewähren und es steht zu hoffen, daß dieser Anregung in Kürze stattgegeben wird. 2. Personen des Beurlaubtenstandes im Alter bis zu 35 Jahren, die sich während ihrer Militärzeit gut geführt haben Voraussetzung ist, daß sie sich verpflichten, in ihrem Beurlaubtenverhältnis zur Fliegertruppe überzutreten und dort im Laufe der nächsten zwei Jahre jährlich zwei dreiwöchige Uebungen abzuleisten. Es kommen hierfür nur Reserveoffiziere, Reserveoffizieraspiranten, Unteroffiziere und Gefreite in Frage. 3. Personen, die ohne jede Rücksicht auf ihr militärisches Verhältnis infolge technischer Vorbildung oder aus sonstigen Gründen als besonders ge-einret erscheinen. Hierüber wird vor allem auf Schüler von technischen Hoch- und Mittelschulen, Konstrukteure usw, Bedacht genommen. Die Ausbildung zum Flugzeugführer kann sich nach übereinstimmender Meinung aller auf diesem Gebiet in Frage kommenden Sachverständigen nicht allein auf das Fliegenlernen auf dem Flugplatz beschränken. Kriegsmäßig brauchbar sind vielmehr nur solche Flugzeugführer, die sich auch in fremdem Gelände orientieren können. Die Ausbildung muß daher unbedingt Uber das internationale Flugzeugführerexamen hinaus bis zum Feldfliegerexamen erfolgen. Aber auch das genügt noch nicht. Die außerordentliche Bedeutung theoretischer Kenntnisse für den Fliegerberuf wird jetzt allseitig anerkannt. Frankreich, das seinen Vorsprung auf dem Gebiete des Flugwesens nicht in letzter Linie einer besonderen theoretischen Vorbildung seiner Flieger verdankt, erfordert neuerdings eine weitgehende Ausbildung im Kartenlesen, in der Orientierung, der Wetterkunde, der Instrumentenkunde, in der Kenntnis der wissenschaftlichen und mechanischen Grundlagen des Flugzeugbaues sowohl wie in der Kenntnis des Motorenbaues. In Oesterreich sind seit einiger Zeit ähnliche Grundsätze für den Erwerb des Feldfliegerzeugnisses aufgestellt worden. Das gleiche gilt für England. Eine derart umfassende Ausbildung zu erteilen, sind mit ganz verschwindenden Ausnahmen die bestehenden Industrie-Unternehmungen nicht in der Lage. Es fehlt ihnen einmal an den nötigen Lehrmitteln und ferner an geeigneten Lehrkräften, endlich auch an Zeit. Es wird daher zu erwägen sein, die theoretische Ausbildung besonderen Anstalten zu überweisen oder hierfür besondere Anstalten zu begründen. Es wird ins Auge gefaßt, eine solche Anstalt in Berlin und eine zweite — falls ein Bedürfnis hierfür vorliegt und die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden können — in München zu errichten. Auf diesen Anstalten werden die Schüler in Zukunft vor ihrer eigentlichen Ausbildung im Fliegen — bis auf weiteres auf Kosten der National-Flugspende — in einem Dreimonatskurs auf den vorbezeichneten Wissensgebieten zu unterweisen sein. Die Auswahl der unter die erste und zweite Gruppe fallenden Personen wird vorläufig den Fabriken Uberlassen. Die Auswahl der Personen der dritten Gruppe wird seitens der National-Flugspende durch einen besonders zu bildenden Ausschuß selbst vorgenommen. Die Prüfung der Gesuche erfolgt am besten von den Heimatsvereinen des Deutschen Luftfahrerverbandes. Es wird daher diesem Verbände nicht nur ein Vorschlagsrecht eingeräumt, sondern die Annahme des Gesuchstellers von der Befürwortung des zuständigen Heimatsvereins abhängig gemacht. Die augenblicklich wichtigste Aufgabe ist die Ausbildung von Personen der ersten Gruppe, da der Einstellungstermin (1. Oktober) vor der Tür steht. Zu- Eleich soll sich aber, um Erfahrungen über das für die Ausbildung günstigste ebensalter zu sammeln, die Ausbildung auch auf die zweite Personengruppe im Verhältnis von 3 zu 2 erstrecken. Personen mit technischer Vorbildung sind in allen Fällen zu bevorzugen. Zur Ausbildung sollen im Interssse der Sicherheit der Schuler nur solche Fabriken zugelassen werden, die bereits drei Personen bis zum ersten Fliegerexamen auf im eigenen Betriebe hergestellten Flugzeugan ausgebildet haben. Ferner muß zur Sicherung einer geordneten Ausbildung verlangt werden, daß für die für die National-Flugspende auszubildenden Schüler ein Flugzeug mit einer beim Militär verwendeten Steuerung zu Lehrzwecken dauernd zur Verfügung steht und ein weiteres mit gleicher Steuerung in Reserve gehalten wird. Eines dieser beiden oder ein drittes muß so beschaffen sein, daß darauf die Feldfliegerprüfung bestanden werden kann. Endlich muß der ausbildende Fluglehrer das Feldfliegerexamen oder gleichwertige Flugleistungen erfüllt haben. Daß diese Bedingungen erfüllt sind, muß von 2 Offizieren oder von dem zuständigen Heimatsverein des Deutschen Luftfahrerverbandes geprüft und bescheinigt werden. Fabriken, die unter diesen Bedingungen die Ausbildung von Feldpiloten übernehmen wollen, können nach Zulassung durch die Geschäftsstelle der National-Flugspende nach ihrer Wahl je drei Personen der ersten und zwei der zweiten Klasse zu Feldpiloten gemäß den für das Jahr 1913 von der Militärverwaltung herausgegebenen Bedingungen ausbilden. Die Ausbildung muß bis zum 30. September 1913 vollendet sein; bei Personen der zweiten Gruppe können Ausnahmen zugelassen werden. Die Militärverwaltung stellt den zur Ausbildung von Flugzeugführern seitens der National-Flugspende zugelassenen Fabriken zur Untersuchung der anzunehmenden Schüler Militärärzte kostenlos zur Verfügung. Die Fabriken sind verpflichtet, bei Annahme eines Schülers diesen sofort bei der National-Flugspende zum Zwecke der Versicherung anzumelden. Die Versicherung wird sodann von der National-Flugspende bewirkt und bei Auszahlung der Ansbildungsprämie für jeden versicherten Schüler der betreffenden Fabrik"ein Betrag von 180 M. abgezogen. Für die \or drei Sportzeugen, unter denen sich ein aktiver Fliegeroffizier befinden muß, bestandene Feldpilotenprüfung eines jeden der oben genannten Schüler, sofern er am 1. Apr.l 1913 noch nicht im Besitze des internationalen Pilotenpatentes wnr, erhält die Fabrik den Betrag von 8000 M. Die Bedingungen für die Pilotenprüfung sind: 1. Ausführung eines Stundenfluges über Land in einer Minde.stdurchschnitts-höhe von 500 m über dem Gelände; 2. Ausführung einer Landung aus 150 m Höhe mit abgestelltem Motor (Kurvengleitflug); 3. Nachweis einer genauen Kenntnis des Motors, mit dem das Flugzeug ausgerüstet ist: Auswechseln einzelner Teile und Ausführung kleinerer Reparaturen am Motor, soweit es mit den an Bord befindlichen Mitteln möglich ist. Für sämtliche aus dieser Auslobung hervorgehende Streitigkeiten wird unter Ausschluß des Rechtswegs ein Schiedsgericht gebildet, dessen Vorsitzender der geschäftsführende Kurator der National-Flugspende oder ein von diesem bestellter Vertreter ist, und in das vom Verwaltungsausschuß der Nationel-Flug-spende je ein Beisitzer 1. aus dem Deutschen Luftfahrerverband, 2. aus dem Verein „Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt", 3. aus den deutschen Flugzeugfabrikanten, 4. aus den deutschen Flugzeugführern gewählt wird. Nachtrag. Die Ausbildung von Flugzeugführern auf Kosten der Nationalf lugspende hat am 1. April begonnen. Zur Ausbildung sind folgende Fabriken zugelassen : 1. Ago-Flugzeugwerk, G. m b. H., Berlin-Johannisthal, Waldstraße 11, 13/14. 2. Albatroswerke, G m. b. H-, Berlin-Johannisthal. 3. Automobil- und Aviatik-A.-G., Mülhausen-Burzweiler (Elsaß). 4. Centrale für Aviatik Hamburg, A. Caspar, Hamburg, Große Bleichen 31. 5. Deutsche Bristol-Werke, Flugzeug-Gesellschaft m. b. H., Halberstadt. 6. Deutsche Flugzeug-Werke, G. m. b. H, Lindenthal bei Leipzig. 7. Euler-Werke, Frankfurt a. M.-Niedenad- 8. Flugmaschine Wright, Gesellschaft m. b. H., Berlin W. 62, Kleiststraße 8. 9. Flugzeugbau Friedrichshafen, G. m. b. H., Friedrichshafen i. B. 10. Flugwerke Deutschland, G. ni b. H., München-Milbertshofen. 11. Flugzeug-Werke Gitstav Schulze, Burg bei Magdeburg. 12. Flugzeug-Werke J. Goedecker, Mainz-Gonsenheim. 13. Fokker-Aeroplanbau, Berlin-Johannisthal, Parkstraße. 14. Hans Grade, Flieger-Werke, Bork bei Brück i. d. M 15. Harlan-Werke, G. m. b. H,, Berlin-Johannisthal, Moltkestraße 21. 16. Luft-Verkehrs-Gesellschaft, A.-G., Berlin-Johannisthal. 17. Gustav Otto, Flugmaschinenwerke, München, Schleißheimer Straße 135. 18. E. Rumpier, Luftfahrzeugbau. G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg, Siegfriedstr. 202. 19. Otto Schwade & Co., Erfurt. Hierbei ist darauf Bedacht genommen, ein sich über ganz Deutschland erstreckendes Netz von ausbildenden Fabriken zu bekommen, um so einem jeden Schüler die Ausbildung in der Nähe seiner Heimat zu ermöglichen. Das Verfahren ist so gedacht, daß eine zugelassene Fabrik das Recht hat, bis zum 30. September dieses Jahres auf Kosten der Nationalflugspende auszubilden: 1. Drei Herren mit abgeschlossener Bürger- oder Mittelschulbildung, die nach militärärztlichem Zeugnis voraussichtlich militärtauglich sind, noch nicht gedient haben und sich verpflichten, am 1. Oktober 1913 in die Fliegertruppe zur Ableistung ihrer Dienstpflicht einzutreten; 2. Zwei Herren im Alter bis zu 35 Jahren, die in ihrem militärischen Verhältnisse Gefreite, Unteroffiziere, Reserveoffiziera^piranten oder dergleichen sind und sich zur Ableistung von je 2 dreiwöchigen Uebungen bei der Fliegertruppe in den nächsten zwei Jahren verpflichten. Sobald einer dieser Schüler das Feldpilotenexamen besteht, erhält die Fabrik 8000 Mark ausgezahlt. Jeder Schüler ist während seiner Ausbildungszeit gegen Unfall versichert. Vom Oktober dieses Jahres an wird sich die Ausbildung auch auf solche Personen erstrecken, die sich wegen technischer Kenntnisse besonders eignen. Inzwischen ist auch, der Anregung der National-Flugspende folgend, für das Gebiet der preußischen Heeresverwaltung bestimmt worden, daß auf Grund des § 89,6 der Wehrordnung solche jungen Leute zur erleichterten Prüfung für den Einjährig-Freiwilligen-Dienst zugelassen werden dürfen, die sich auf dem Gebiete des Flugwesens besonders auszeichnen oder Hervorragendes darin leisten. ■ Die Erfüllung dieser Voraussetzung ist durch ein von dem Kuratorium der National-Flugspende ausgestelltes Zeugnis nachzuweisen. Wegen Herbeiführung gleicher Bestimmungen für die Königlich Bayerische und Königlich Sächsische sowie Königlich Württembergische Heeresverwaltung schweben Verhandlungen.  Flugtechnische 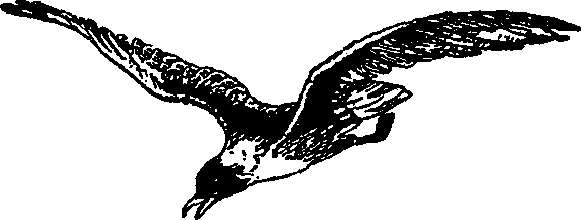 Rundschau. Inland. l'luyfilhTer-Zeug nix se haben erhalten : No. 368. Milkoff, Radttl, Bulgarischer Oberleutnant Inf.-Regt. 29, Sofia, geb. 5. März 1885 zu Philippopel, für Zweidecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 22. März 1913. No. 369. Zahn, Hans, Johannisthal, geb. zu Würzburg den 10. November 1890, für Zweidecker (Otto), Oberwiesenfeld, am 2T. März 1913. Lt. Canter fliegt mit Passagier auf Rumpler-Taube von Jüterbog nach Lübeck in 6 St 19 Min. Lt. Canter und sein Passagier .Lt. Boehmer, die nach Jüterbog abkommandiert waren, um die Verwendungsmöglichkeit der Flugzeuge für artilleristische Zwecke zu erproben, hatten schon lange die Absicht, einen großen Rundflug durch Deutschland anzutreten Zu diesem Zweck wurde die mit einem 85 PS 6 Zylinder Stahl-Mercedes-Motor versehene Rumpler-Taube mit besonders großem Benzin-Reservoir, welches ein vielstündiges Verweilen in der Luft gestatten sollte, ausgerüstet Endlich am 31. März gestatteten die Witterungsverhältnisse die Ausführung dieses Vorhabens. Der Start fand in Jüterbog um 6 Uhr 55 Minuten vormittags statt. An Bord befanden sich 190 Liter Benzin und 25 kg Oel, da ein Stundenverbrauch von 30 Litern angenommen wurde. Die Absicht Lt. Canters war, den Flug zunächst in nordöstlicher Richtung aufzunehmen und die definitive Entscheidung, ob nach Königsberg oder nach Holstein geflogen werden sollte, erst in Küstrin zu treffen, bis die Witterungsverhältnisse einigermaßen gekärt waren. Der Weg ging nun zunächst nach Johannisthal, welches sie 7 Uhr 37 Minuten erreichten. Hierauf wurde Berlin Uberflogen und trafen sie 8 Uhr 38 Minuten in Küstrin ein. Hier entschied sich Canter wegen der außerordentlich starken Gegenwinde, einen nördlichen Kurs einzuschlagen. Es wurde zunächst der1 Weg nach Stettin, das um 6 Uhr ?5 Minuten erreicht wurde, genommen. Hier wurde eine Meldung abgeworfen, deren Eintreffen vom Oberpostrat Schwieger bestätigt wurde. Von Stettin wurde dann nordwestliche Richtung eingeschlagen und zunächst Neubrandenburg um 10 Uhr 39 Minuten, Lübeck um 12 Uhr 30 Minuten erreicht. Da die Rumpler-Taube fast l> Stunden in der Luft war, und wegen der sehr tiefliegenden Wolken und der Nähe des Meeres sowie des zur Neige gehenden Benzinvorrates, mußte an die Landung gedacht werden. Dieselbe wurde um 1 Uhr 4 Minuten in Malente-GremsmUhlen auf dem Gute Rodensande glatt vollzogen. Vor der Landung vollführte Lt. Canter noch über dem Lübecker See lange Kreise um den Zeit-Welt-Rekord, welchen er sich bereits gesichert hatte, möglichst auszudehnen. Die genaue Gesamtzeit, die Canter durchflog, ist 6 Stunden 9 Minuten, die durchschnittliche Höhe betrug 750—800 m, die größte erreichte Höhe 950 m. Ohne Rücksicht auf die Kreisflüge beim Starten und beim Landen betrug die zurückgelegte Strecke genau 599 km, so daß sich eine mittlere Geschwindigkeit von 97,4 km ergab. Es muß insbesondere auch in Betracht gezogen werden, daß derartige Ueberland-flüge an das Können des Fliegers ungleich höhere Anforderungen stellen als die Flugplatz-Rekorde, da bedeutende meteorologische Kenntnisse für die Orientierung nötig sind und die Haupterschwerung der zu lösenden Aufgabe darstellen Der verwendete Motor ist ein 85 PS 6 Zylinder Stahl-Mercedes-Motor, welcher im Kaiserpreis-Wettbewerb den 2. Preis erstehen konnte. Dieser Ueberlandflug Canters mit Passagier bedeudet für das deutsche Flugwesen einen besonderen Erfolg und zeigt wieder, daß wir einen Vergleich mit anderen Ländern nicht zu scheuen brauchen. Der junge schneidige Offizier hat durch diese Leistung diesen /VUlitärische Flüge. doppelten Welt-Rekord, die sogenannten großen Kanonen des Auslandes nicht etwa mit einer Specialmaschine, sondern mit einer normalen Militärmaschine glatt überboten. Die bisherige größte Leistung war: Lt. Barrington Kennet auf einem englischen Eindecker Typ Nieuport 401,5 km in 4 Stunden 51 Minuten. 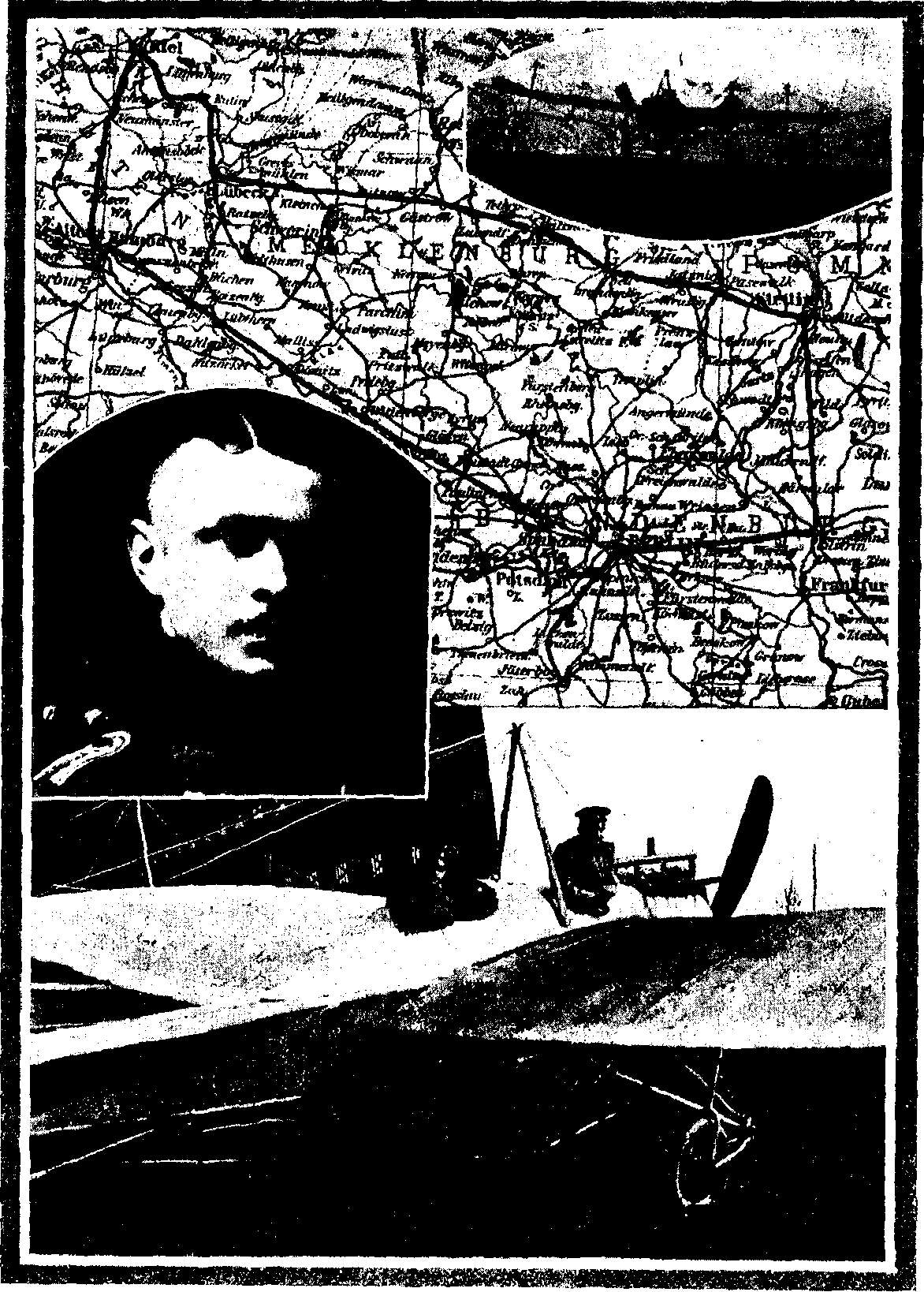 Weltrekord-Ueberlandflug von Lt. Canter and Lt. Boehmer. Oben: Kartenskizze des von Lt. Canter mit Lt. Boehmer als Fluggast durchflogenen Weges Oben rechts: Die Rampler-Taube beim Start. Links: Lt. Canter. Unten : Ankunft von Lt. Canter und Lt. Boehmer vor der Ballonhalle in Kiel. Es ist somit durch diese zurückgelegte Strecke zugleich ein Ueberland-Distanz-Weltrekord erreicht. Lt. Canter hatte die Absicht seinen Flug gleich fortzusetzen, konnte dies aber nicht ausführen, da er durch besonders schlechtes Wetter zurückgehalten wurde. Da kein Zelt zur Verfügung stand, mußte die Rumpier Taube mehrere Tage und Nächte unbedeckt im Freien, Sturm und Regen ausgesetzt zubringen. Um nicht von den Winden fortgerissen zu werden, wurde die Maschine durch Stricke und Pflöcke in der Erde verankert. Am 2. April klärte sich das Wetter auf und Lt. Canter unternahm zuerst einige Probeflüge um festzustellen, ob die Maschine durch den Aufenthalt im freien Felde nicht gelitten hatte. Am 3. April um 8 Uhr 5 Minuten vormittags startete Canter von Malente, überflog Plön und flog nach Kiel. Dort kreuzte Canter längere Zeit über dem Kieler Hafen. Um 9 Uhr 15 Minuten erfolgte die Landung auf dem Spiel- und Sportplatz, dort wurde das Flugzeug in der Zeppelin Halle untergebracht. Die Herren Canter und Boehmer wurden von dem Chef der Marinestation Ex. v. Cörper gastfreundlich aufgenommen, ebenso wie von dem Vorstand des Nordmarkenvereins, Direktor Claasen. In Kiel begann das Wetter wieder sehr stürmisch zu werden und der Abflug konnte daher erst am 6. April bewirkt werden. Der Flug ging nun nach Hamburg, das um 3 Uhr 10 Minuten erreicht wurde. Die Landung geschah auf der Bahrenfelder Rennbahn, zum Zweck der Benzinaufnahme. Da daselbst kein genügender Benzinvorrat aufzutreiben war, flog Canter nach dem Fuhlsbütteler Flugplatz. Unterdessen war es zu spät geworden um den Flug nach Berlin fortzusetzen und so begnügte sich Canter noch einige Probeflüge zu machen, bei denen er es bis zu einer Höhe von 2700 m brachte. Da am 7. April das Wetter zu schlecht war, konnte der Flug erst am 8. fortgesetzt werden. Der Start fand unter sehr ungünstigen und schwierigen Windverhältnissen um 7 Uhr 5 Min. statt. Es wurde nun Lauenburg um 7 Uhr 45 Min , Dömitz um 8 Uhr 20 Min., Wittenberge um 8 Uhr 44 Min.. Nauen um 9 Uhr 40 Min. überflogen, worauf die Landung auf dem Döberitzer Flugplatz um 9 Uhr 45 Min. glatt erfolgte. Diese 255 km wurden in 2 Std. 40 Min. zurückgelegt, was einer mittleren Geschwindigkeit von 95 km entspricht. Das Wetter, welches am Anfang der Fahrt sehr günstig war, verschlechterte sich bei dem letzten Teil des Fluges. Abgesehen von den starken Böen kam die Rumpler-Taube in schwere Regenschauer. Die größte Höhe betrug 1C00 m, der Durchschnitt 800 m. Die letzte Strecke wurde wegen der sehr tiefgehenden Wolken in Höhe von 400 m durchflogen. Während des ganzen Rundfluges, der 11 Stunden 34 Min. und etwa 1200 km betrug, wurde weder an dem Motor noch an dem Flugzeug irgend eine Reparatur vorgenommen. Desgleichen ist es interessant festzustellen, daß alle Arbeiten zum Betrieb des Flugzeuges, wie Benzin, Oel auffüllen etc. durch Lt. Canter und seinen Begleiter nur mit Hilfe der an Bord befindlichen Hilfsmittel ausgeführt wurden. Um die Länge des Gesamtfluges besser beurteilen zu können, sei hier noch ausgeführt, daß diese Strecke doppelt so lang ist, wie die des in diesem Jahre auszuführenden Prinz-Heinrich-Fluges und daß Lt. Canter für diese Strecke trotz meist sehr ungünstiger Witterungsverhältnisse nur vier Flugtage benötigte. Wenn diese Leistung von einem Zivilflieger ausgeführt worden wäre, betrügen die von der National-Flugspende ausgeschriebenen Preise für den Weltrekord pro Stunde 1000 M., das ist 600 M. und eine monatliche Rente von 3000 M. bis zum Höchstbetrage von 15 000 M. resp. bis zu dem Tage, an welchem der Rekord von einem andern Flieger geschlagen wird. Von Metz nach Hamburg. Am 1. April flog Lt. Pretzeil vom Inf. Reg. 132 mit Lt. Kerner auf toilitär-Rumpler-Taube A 13 um 8 Uhr morgens von Metz ab und landete 10:30 Uhr in Köln. Gegen 12 Uhr erfolgte der Weiterflug nach Münster, wo die Flieger um 2 Uhr auf der Loddenheide landeten. Am 2. April vormittags 10:30 trafen die Flieger auf der Horner Rennbahn bei Wandsbek ein. Die Maschine wurde per Bahn nach Metz zurückgebracht. Mehrere Fernfliige wurden von Döberitz aus am 9. April unternommen und zwar landete auf dem Flugplatz Görries bei Schwerin Lt. Muelich-Hoffmann nach einem Flug von 2 Stunden 4 Min. Nach etwa :l/< Stunden landete auf dem großen Exerzierplatz bei Schwerin Lt. v. Eckenbrecher mit Lt. v. Eberhardt als Fluggast. Wasserflüge auf dem Bodensee. Der Flieger Gsell von der Flugzeugbau Friedrichshafen G. m. b. H. hat bis jetzt 4000 km über dem Bodensee ohne Zwischenfall zurückgelegt. Am 28. März flog Gsell von dem Bodensee ab und landete nach 40 Minuten nach Ueberqtierung einer 650 m Hügelkette in Frauenfeld in der Schweiz auf festem Boden, wo er am 30. März Schauflüge ausführte. Der zurückgelegte Weg betrug 60 km. Am 31. März machte Gsell in Gegenwart des Prinzen von Wales, der die Fabrik besichtigte, bei Sturm und hohem Seegang einen längeren Flug. Der Bodensee war sehr unruhig, so daß beim Start die Wellen über das untere Tragdeck schlugen. 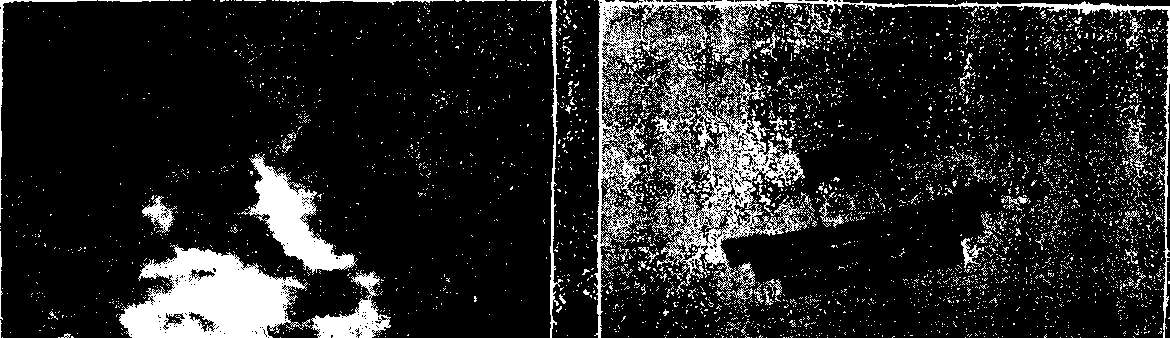 Interessante Flugbilder. Links: der Mars-Zweidecker im Abendhimmel. Rechts: Der neue Euler-Dreidecker schräg von hinten gesehen. Marineflugstatiou Kiel. Bekanntlich werden zur Zeit mehrere neue Wasserflugstationen errichtet, die erste davon in Kiel, wo die beiden Albatros-Zweidecker, die seiner Zeit dem Kaiser in Wilhelmshaven vorgeführt wurden, untergebracht werden. Der Flieger Lichte ist am 9 April auf dem Flugplatz Rotthausen während eines Stundenfluges um eine Prämie der Nationalflugspende tödlich abgestürzt. Von den Flugplätzen. Flugplatz Gelsenkirchen-Essen-Botthausen. Im Monat März konnte an 14 Tagen geflogen werden. Die Summe sämtlicher geflogener Zeiten beträgt 9 Stunden 40 Minuten. An den Flügen beteiligten sich außer Suwelack, der im ganzen 2'/2 Stunde in der Luft war, die Flieger Schlatter, Mürau, Krüger, Lichte und Schlüter sowie die Flugschüler Heiter, Höfig, Blank, Frl. Horn, Dirks und Riemann. Letzterer hatte bekanntlich am 29. März das Unglück abzustürzen und den von ihm geflogenen Otto-Doppeldecker zu zertrümmern, wahrend er selbst mit weniger gefährlichen Verletzungen davon kam. Inzwischen haben zwei neue Konstrukteure auf dem Flugplatz ihren Einzug gehalten. Sie beabsichtigen einen Schwingenflieger zu bauen, der es ermöglicht, ohne Anlauf sich vom Boden zu erheben. Die erste Flugmaschirie soll im Mai fertig sein und alsdann von den Konstrukteuren selbst eingeflogen worden. Der Besuch des Flugplatzes war im März sehr erfreulich. Es waren über 10000 zahlende Personen zu verzeichnen. Wettbewerbe. Für die Frühjahrsflugwoche in Johannisthal stehen Preise im Betrage von M 55000,— zur Verfügung. Die Summe setzt sich zusammen aus: Königl. Preußisches Kriegsministerium . . . . M 25 000,— Lotterie.......,........., 10 000 — National-Flugspende...........„ 10 000,- Manoli-Preis, gestiftet von Herrn J. Mandelbaum M. 5000,— Kaiserlicher Automobil-Club........ „ 2 000,— Verein deutscher Motorfahrzeug-Industrieller . . „ 1 000,— Flug-und Sportplatz Berlin-Johannisthal G.m.b. H. „ 1500,— Gemeinde-Johannisthal.......... „ 500.— M 55CO0 — Die Ausschreibungen sind dem Deutschen Luftfahrer-Verbande eingereicht und werden in einigen Tagen veröffentlicht werden Der diesjährige Preisbetrag ist bedeutend höher, als die in den früheren Frühjahrsflugwochen ausgeflogenen Summen. Der Prinz Heinrich-Plug 1913 wird auch in diesem Jahre die größte Ueberlandflug-Veranstaltung werden. Von der preußischen Heeresverwaltung werden 9 Offiziersflieger teilnehmen und zwar: Lt. Blüthgen, Doppeldecker (voraussichtl Mars-Pfeil) Lt. Canter, Rumpler-Taube Lt. von Hiddessen, Albatros-Doppeldecker Lt. von Thüna, Rumpler-Taube Lt. von Mirbach, Euler-Doppeldecker Lt. Kastner, Rumpler-Taube Lt. J o 1 y, Rumpler-Taube Lt. Weyer, Aviatik-Doppeldecker Oberlt. Donnevert, Rumpler-Taube. Ferner wird die bayrische Militär-Verwaltung 3 Offiziersflieger an dem Wettbewerb teilnehmen lassen. In der Kategorie 3b der Ausschreibung (Flugzeugbesitzer ist Wettbewerber, s. die Wettbewerbsbedingungen in No, 5 des „Flugsport") werden voraussichtlich starten: 2 Apparate der Deutschen Flugzeugwerke, Leipzig-Lindenthal 2 Aviatik-FIugzeuge 2 Euler Apparate 2 Albatros, hierunter ein Ein- und ein Doppeldecker 1 Goedecker-Eindecker. An der strategischen Aufklärungsübung am 16. Mai nimmt bestimmt Luftschiff „Sachsen" teil. Am 17. Mai, gelegentlich der taktischen Aufklärung, wird das Lufschiff „Sachsen" mit den Ehrengästen des Prinz Heinrich-Fluges an Bord die Aufklärung der Flugzeuge begleiten. Die für den Prinz Heinrich-Flug 1913 gestifteten Preise sind sehr zahlreich. An erster Stelle steht die Gabe Sr. Majestät des Kaisers. Weiter haben Ehrenpreise gestiftet: Prinz Heinrich, der Großherzog von Baden, Prinz Max von Baden, der Fürst von Thum und Taxis, Regensburg — der schöne goldene Pokal ist bereits eingegangen —, Fürst von Hatzfeld — Wildenburg auf Schloß Crottdorf b. Coblenz, Prinz Carl Anton von Hohenzollern, der Fürst zu Wied, der Statthalter von Elsaß-Lothringen Graf von Wedel, der kommandierende General des XI. Armeekorps, General der Infanterie von Scheffer-Boyadel, Cassel, hat einen Ehrenpreis für die beste militärische Flug eistung auf der Etappe Wiesbaden —Cassel versprochen. Ferner haben Preise gestiftet: Das Königlich Bayerische Kriegsministerium, der Geheime Kommerzienrat Oswald, Coblenz, und, was besonders hervorgehoben zu werden verdient, die Damen der Stadt Coblenz. Terminkalender der Flugveranstaltungen 1913. Flugzeugwettbewerbe. a) Verbandsveranstaltungen. I. Ueberlandflüge: Geschäftsstelle: 1. Prinz Heinrich-Flug der Südwest- Straßburg i. Eis., Blauwolkeng. 21 gruppe ....... 10.—17. (19) Mai 2. Ostpreußischer Rundflug . . . Ostpreuß Verein f. L., Königsberg i. Pr, Kneiph. Langgasse 8, 1 10.-17. August II. Rundflüge: 3. Rund um Berlin......Berlin W. 9, Linkstr. 25 30. u 31. August od 6. u. 7. Septbr. 4. Essen-Gelsenkirchen .... Westdeutsch. Fluggesellsch. Gelsenkirchen 26. Juli—3. August III. Oertllche Veranstaltungen: 5. Frühjahrsflugwoche in Johannis- thal ......... 6. Breslauer Flugwoche .... 7. Nordmarkverein in Kiel . . . 8. Leipziger Flugveranstaltung . . 9. Herbstflugwoche in Johannisthal 10. Wasserflug-Wettbewerb am Bodensee .... b) V e r e i n s v 1. Rundflüge: Rund um München..... II. Oertliche Veranstaltungen: 1. Dresdener Flugveranstaltungen 2. Flugveranstaltung des Luftfahr- vereins in Gotha 3. Dresdener Herbstflugwoche . , 4. Herbstveranstaltung in München Flug- u. Sportplatz Berlin-Johannisthal G. m. b. H., Berlin W. 35, Potsdamerstraße 112 25. Mai—1. Juni Schlesischer Aero-Club, Breslau I, Schweid. nitzer Straße 16/18 II 8.—15 Junj Hauptm. Götze, Kiel, Neumarkt 5 9.—16. Juli Juwelier Schneider, Leipzig, Markt 1 23.-25. August Flug- u. Sportplatz Berlin-Johannisthal G. m. b. H., Berlin W. 35, Potsdamerstraße 112 28. Sept.—5. Okt. Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8 29. Juni-5. Juli. eranstaltungen. Geschäftsstelle: Bayerischer Aero-Club, München, Residenzstraße 27/28 14.-16 Juni Kgl. Sachs. Verein, Dresden, Ferdinandstr.5,1 30. April-5. Mai Luftfahrverein Gotha 16.—18. August Kgl. Sachs Verein, Dresden, Ferdinandstr. 5,1 14.—21. September Bayerischer Aero-Club, München, Residenzstraße 27/28 11. u. 12. Oktober. Verschiedenes. Vom Oesterreichischen Militärflugwesen. Der Kommandant des Militärflugwesens Oberstleutnant Uzelac hat einen hervorragenden Passagierflug unternommen. Er stieg mit einem für militärische Zwecke in Neusatz bestimmten Zweidecker in Fischamend am 10. April um 6 Uhr früh in Begleitung seines Chauffeurs auf und traf, ohne daß eine Zwischenlandung erfolgte, um 9 Uhr in Neusatz ein. Die Strecke Fischamend-Neusatz beträgt in der Luftlinie 410 km, sodaß eine Stundenleistung von 136 km erreicht wurde. Uzelac, der Abends mit der Bahn nach Wien zurückkehrte, erzählte, daß er in tieferen Regionen mit starken Winden zu kämpfen hatte und meist in einer Höhe von 1300 bis 1500 tn fuhr. Erwähnenswert ist, daß die im Augenblick der Abfahrt in Fischamend aufgegebene Depesche erst nach der Ankunft des Fliegers in Neusatz bestellt wurde! Frankfurter Flugmodell-Verein. Die am 3. Oktober vorigen Jahres zu Frankfurt a M. gegründete „Vereinigung von Freunden des Modellflugsports" hat ihren Namen in „Frankfurter Flugmodell-Verein" (kurz F. F. V.) umgeändert und steht unter dem Protektorat des Frankfurter Verein für Luftfahrt. Laut Beschluß der Versammlung vom 3. April wurde der Monatsbeitrag auf Mark: 1.50 erhöht und erhält hierfür jedes Mitglied die Zeitschrift „Flugsport" frei ins Haus geliefert. Die Mitglieder werden dringend gebeten, den ivonatsbeitrag pünktlich an den Kassierer Adolf Jäger, Frankfurt a. M., Rotteckstraße 2 zu senden. Am Sonntag den 6. April fand eine Besichtigung der Goedecker-Flugzeug-werke in Mainz-Gonsenheim statt. Der Flugschüler Burggraf, welcher erst zum 4. Male die Flugmäschine steuerte, unternahm 2 bewunderungswürdige Rundflüge über dem Flugplatz Großer Sand.  JHustrirte No g technische Zeitschrift und Anzeiger AbonnemBM. 30. April das gesamte 1913. jahrg. ü. ^pljjg^yeSeil" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef. 4557 Amt I. Oskar UrsinUS, Civilingenieur. Tel.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. . ■ : Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. - Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" vorsehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 14. Mai. Entwicklungsfragen. Die Fluginteressenten sind durch die sich überstürzenden Ereignisse und gesteigerten Fortschritte auf dem Gebiete des Flugwesens der letzten Jahre etwas verwöhnt worden. Das Flugwesen beginnt sich jetzt ruhiger, langsamer, aber in desto bestimmteren Bahnen weiter zu entwickeln. Besonders auffallend sind die Fortschritte, die unsere Offiziersflieger gemacht haben. Es ist eine Freude zu sehen, mit welcher Präzision sie ihren Dienst versehen. Die früher von verschiedenen Seiten gehegten Bedenken, daß unsere Offiziere den zu erfüllenden Aufgaben nicht gewachsen seien, sind glänzend widerlegt worden. In der Wilhelmstraße scheint man auch mit den Erfolgen zufrieden zu sein. Das ist die militärische Seite unseres Flugwesens ! Anders sieht es auf der Zivilseite aus! Hier sind von Industrie und Wissenschaft noch sehr schwierige Aufgaben zu überwinden. Die Flugmaschine befindet sich in den allerersten Anfängen ihrer Entwicklung. Zum Flugmaschinenbau gehört auch Fliegen.' — — Wir brauchen Fabriksflieger! — — Wir brauchen jungen Nachwuchs ! — — Bei der Bedürfnisfrage des Nachwuchses muß man feststellen, daß in letzter Zeit der Zugang von Interessenten zu dem Flugwesen etwas abgenommen hat. Vielleicht hat man diese Frage bei den vielen Ereignissen der letzten Zeit — Nationalflugspende und anderes mehr — etwas übersehen, vielleicht für überflüssig ge- Manoli-Preis, gestiftet von Herrn J. Mandelbaum M. 5 000,— Kaiserlicher Automobil-Club........ „ 2 000,— Verein deutscher Motorfahrzeug-Industrieller . . „ 1 000,— Flug-und Sportplatz Berlin-Johannisthal G.m.b. H. „ 1500,— Gemeinde-Johannisthal.......... „ 500.— M 55C00 — Die Ausschreibungen sind dem Deutschen Luftfahrer-Verbande eingereicht und werden in einigen Tagen veröffentlicht werden Der diesjährige Preisbetrag ist bedeutend höher, als die in den früheren Frühjahrsflugwochen ausgeflogenen Summen. Der Prinz Heinrich-Flug 1913 wird auch in diesem Jahre die größte Ueberlandflug-Veranstaltung werden. Von der preußischen Heeresverwaltung werden 9 Offiziersflieger teilnehmen und zwar: Lt. Blüthgen, Doppeldecker (voraussichtl Mars-Pfeil) Lt. Canter, Rumpler-Taube Lt. von Haddessen, Albatros-Doppeldecker Lt. von Thüna, Rumpler-Taube Lt. von Mirbach, Euler-Doppeldecker Lt. Kastner, Rumpler-Taube Lt. J o 1 y, Rumpler-Taube Lt. Weyer, Aviatik-Doppeldecker Oberlt. Donne vert, Rumpler-Taube. Ferner wird die bayrische Militär-Verwaltung 3 Offiziersflieger an dem Wettbewerb teilnehmen lassen. In der Kategorie 3b der Ausschreibung (Flugzeugbesitzer ist Wettbewerber, s. die Wettbewerbsbedingungen in No, 5 des „Flugsport") werden voraussichtlich starten: 2 Apparate der Deutschen Flugzeugwerke, Leipzig-Lindenthal 2 Aviatik-Flugzeuge 2 Euler Apparate 2 Albatros, hierunter ein Ein- und ein Doppeldecker I Goedecker-Eindecker. An der strategischen Aufklärungsübung am 16. Mai nimmt bestimmt Luftschiff „Sachsen" teil. Am 17. Mai, gelegentlich der taktischen Aufklärung, wird das Lufschiff „Sachsen" mit den Ehrengästen des Prinz Heinrich-Fluges an Bord die Aufklärung der Flugzeuge begleiten. Die für den Prinz Heinrich-Flug 1913 gestifteten Preise sind sehr zahlreich. An erster Stelle steht die Gabe Sr. Majestät des Kaisers. Weiter haben Ehrenpreise gestiftet: Prinz Heinrich, der Großherzog von Baden, Prinz Max von Baden, der Fürst von Thum und Taxis, Regensburg — der schöne goldene Pokal ist bereits eingegangen —, Fürst von Hatzfeld — Wildenburg auf Schloß Crottdorf b. Coblenz, Prinz Carl Anton von Hohenzollern, der Fürst zu Wied, der Statthalter von Elsaß-Lothringen Graf von Wedel, der kommandierende General des XI. Armeekorps, General der Infanterie von Scheffer-Boyadel, Cassel, hat einen Ehrenpreis für die beste militärische Flug eistung auf der Etappe Wiesbaden —Cassel versprochen. Ferner haben Preise gestiftet: Das Königlich Bayerische Kriegs-ministerium, der Geheime Kommerzienrat Oswald, Coblenz, und, was besonders hervorgehoben zu werden verdient, die Damen der Stadt Coblenz. Terminkalender der Flugveranstaltungen 1913. Flugzeugwettbe werbe. a) Verbandsveranstaltungen. I. Ueberlandflüge: Geschäftsstelle: 1. Prinz Heinrich-Flug der Südwest- Straßburg i. Eis., Blauwolkeng. 21 gruppe ....... 10.—17. (19.) Mai 2. Ostpreußischer Rundflug . . . Ostpreuß Verein f. L., Königsberg i. Pr, Kneiph. Langgasse 8, 1 10.—17. August II. Rundflüge: 3. Rund um Berlin......Berlin W. 9, Linkstr. 25 30. u 31. August od. 6. u. 7. Septbr. 4. Essen-Gelsenkirchen .... Westdeutsch. Fluggesellsch. Gelsenkirchen 26. Juli—3. August Verschiedenes. Vom Oesterreichischen Militärflugwesen. Der Kommandant des Militärflugwesens Oberstleutnant Uzelac hat einen hervorragenden Passagierflug unternommen. Er stieg mit einem für militärische Zwecke in Neusatz bestimmten Zweidecker in Fischamend am 10. April um 6 Uhr früh in Begleitung seines Chauffeurs auf und traf, ohne daß eine Zwischenlandung erfolgte, um 9 Uhr in Neusatz ein. Die Strecke Fischamend-Neusatz beträgt in der Luftlinie 410 km, sodaß eine Stundenleistung von 136 km erreicht wurde. Uzelac, der Abends mit der Bahn nach Wien zurückkehrte, erzählte, daß er in tieferen Regionen mit starken Winden zu kämpfen hatte und meist in einer Höhe von 1300 bis 1500 m fuhr. Erwähnenswert ist, daß die im Augenblick der Abfahrt in Fischamend aufgegebene Depesche erst nach der Ankunft des Fliegers in Neusatz bestellt wurde! Frankfurter Flugmodell-Verein. Die am 3. Oktober vorigen Jahres zu Frankfurt a M. gegründete „Vereinigung von Freunden des Modellflugsports" hat ihren Namen in „Frankfurter Flugmodell-Verein" (kurz F. F. V.) umgeändert und steht unter dem Protektorat des Frankfurter Verein für Luftfahrt. Laut Beschluß der Versammlung vom 3. April wurde der Monatsbeitrag auf Mark: 1.50 erhöht und erhält hierfür jedes Mitglied die Zeitschrift „Flugsport" frei ins Haus geliefert. Die Mitglieder werden dringend gebeten, den iv'onatsbeitrag pünktlich an den Kassierer Adolf Jäger, Frankfurt a. M., Rotteckstraße 2 zu senden. Am Sonntag den 6. April fand eine Besichtigung der Goedecker-Flugzeug-werke in Mainz-Gonsenheim statt. Der Flugschüler Burggraf, welcher erst zum 4. Male die Flugmäschine steuerte, unternahm 2 bewunderungswürdige Rundflüge über dem Flugplatz Großer Sand. III. Oertliche Veranstaltungen: 5. Frühjahrsflugwoche in Johannis- Flug- u. Sportplatz Berlin-Johannisthal G. m. thal......... b. H., Berlin W. 35, Potsdamerstraße 112 25. Mai—1. Juni 6. Breslauer Flugwoche .... Schiesischer Aero-Club, Breslau I, Schweid. nitzer Straße 16/18 II 8.—15 Jun, 7. Nordmarkverein in Kiel . . . Hauptm. Götze, Kiel, Neumarkt 5 9.—16. Juli 8. Leipziger Flugveranstaltung . . Juwelier Schneider, Leipzig, Markt 1 23.-25. August 9. Herbstflugwoche in Johannisthal Flug- u. Sportplatz Berlin-Johannisthal G. m. b. H., Berlin W. 35, Potsdamerstraße 112 28. Sept.—5. Okt. 10. Wasserflug-Wettbewerb am Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8 Bodensee...... 29. Juni—5. Juli. b) Vereinsveranstaltungen. 1. Rundflüge: Geschäftsstelle: Rund um München.....Bayerischer Aero-Club, München, Residenzstraße 27/28 14.-16 Juni II. Oertliche Veranstaltungen: 1. Dresdener Flügveranstaltungen Kgl. Sachs. Verein, Dresden, Ferdinandstr. 5,1 30. April-5. Mai 2. Flugveranstaltung des Luftfahr- Luftfahrverein Gotha 16.—18. August Vereins in Gotha 3. Dresdener Herbstflugwoche . , Kgl. Sachs Verein, Dresden, Ferdinandstr. 5,1 14.— 21. September 4. Herbstveranstaltung in München Bayerischer Aero-Club, München, Residenz- straße 27/28 11. u. 12. Oktober. halten. Man könnte auch dabei einwerfen, ja wir bekommen doch Flieger. Es werden doch Unteroffiziere ausgebildet, die später in der Industrie Stellung suchen! Ob diese Flieger aber, die sich im militärischen Dienst ganz hervorragend eignen können, sich auch immer als Fabriksflieger eignen, erscheint doch zweifelhaft. Jedenfalls ist diese Frage wichtig genug, um den Interessentenkreisen Veranlassung zu geben, dirigierend einzugreifen. Dann kommt ein anderes Kapitel. Früher wars mal das erste. Und das ist der Sport! Wenn vor allen Dingen ältere Flieger behaupten, daß es in der Fliegerei keinen Sport gäbe, so begründen sie dies mit den Erfahrungen aus der Zeit, die sie im Flugwesen mit erlebten. Man muß sich dabei die Frage vorlegen, wieviel sogenannte Sportsletite haben sich überhaupt in dem Flugsport versucht? Wäre es nicht möglich gewesen — es waren einige darunter — die Begeisterung für den Flugsport wachzuhalten, wenn mans anders gemacht hätte?! Eine kleine Auszeichnung für verschiedene dieser Pioniere hätte vielleicht manches anders werden lassen. Hier ist gefehlt worden. Es ist nicht übersehbar, welche Vorteile ein derartiger Sport, und wenn er in dem kleinsten Rahmen geführt worden wäre, auch im Landesverteidigungsinteresse haben könnte. Und dann das allervvichtigste! Mit einem Flugsport wäro es vielleicht doch möglich gewesen, die Grenzen der Länder zu verwischen. Wir hätten hier nicht allein zum Nutzen unserer Flugindustrie, sondern unserer gesamten deutschen Industrie gehandelt. Hoffentlich wird der Versuch mit dem Wasser-Flugsport günstigere Resultate ergeben. Der Staffeidecker mit V-förmig nach oben und pfeilförmig nach hinten gestellten Tragflächen. Von Bomhard ist am 22. Mai 1911 ein Flugzeug mit zwei übereinander angeordneten Tragflächen zum Patent angemeldet worden. Wir unterlassen es, den Wortlaut der Anmeldung, da wir hierzu nicht autorisiert sind, hier zu veröffentlichen. Der Apparat, welcher von den Union-Flugzeugwerken G. m. b. H., Berlin, gebaut wird, ist ein Doppeldecker, dessen beide Tragdecken V-förmig nach oben und pfeilförmig nach hinten gestellt werden. Das Oberdeck ist gegen das Unterdeck nach vorn gestaffelt. Durch diese Anordnimg soll eine automatische Seiten- und Längsstabilität erzielt werden. Die automatische Seitenstabilität hat bereits Ferber an seinem Doppeldecker bei seinem denkwürdigen Flug am 25. Juni 1908 verwendet. Ferber hatte bei seiner Maschine nur die Flächen V-förmig nach oben und hinten gestellt. Ebenso hatte Santos-Dumont bei seinem Flugapparat die Flächen V-förmig nach oben gestellt. Die französischen Konstrukteure verzichteten aber mit Rücksicht auf den etwas geringeren Auftrieb auf die V-förmige Stellung. Die Vergrößerung des Auftriebes durch Staffelung wurde bereits von Goupy erkannt. Sie wurde besonders modern während des Jahres 1911. Bei der Militärkonkurrenz in Reims sah man mehrere gestaffelte Apparate. Farman brachte sogar einen gestaffelten Doppeldecker, bei dein die Flächen leicht nach hinten gebogen waren. (Vergl. Flugsport Nr. 11, Jahrgang 1911, Seite 277.) Die Franzosen kamen jedoch von der Staffelung wieder ab. Es hat sich gezeigt, daß die Druckpunktwanderung bei gestaffelten Flächen eine verschiedene war. "Weiter sind noch zu erwähnen, die 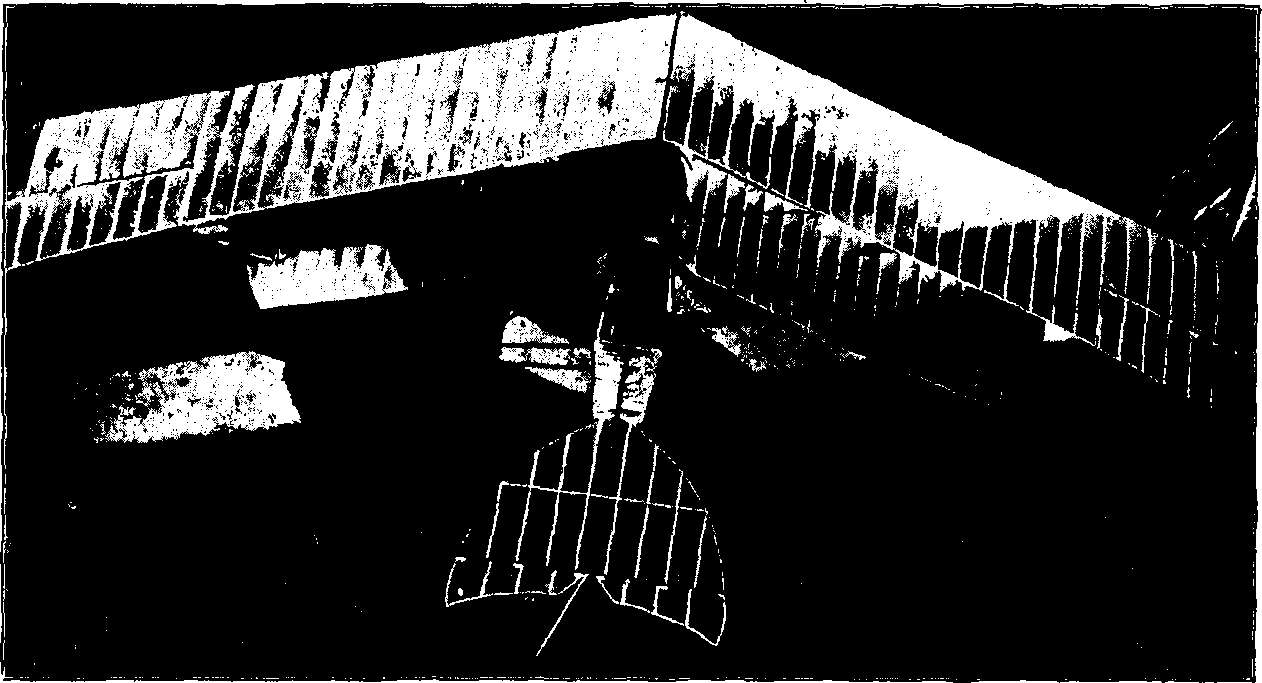 Bomhard-Pfeil-Doppeldecker, Passagiermaschine, Ansicht von oben. unseren Lesern bekannten Versuche von dem englischen Leutnant Dünne mit seinem schwanzlosen Pfeil-Doppeldecker. Die vorliegende Konstruktion des Bomhard-Pfeil-Doppeldeckers dürfte durch die oben genannten Versuche beeinflußt worden sein. 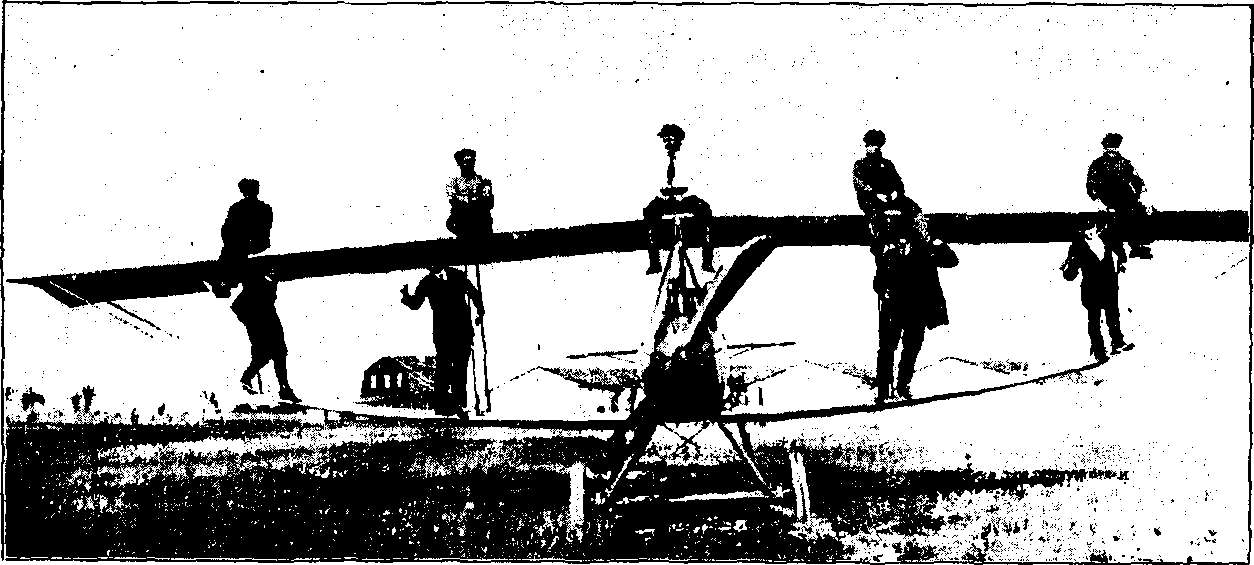 Bomhard-Pfeil-Doppeldecker. Belastungsprobe mit 9 Personen. Auch mehrere andere Flugzengfabriken dürften diese Versuche nicht unbeachtet gelassen haben. Insbesondere beeinflußt durch die Versuche von Lt. Dünne entstanden verschiedentlich pfeilförmige Staffeidecker. Ob diese unter das Patent von Bomhard fallen, ist nicht unsere Sache zu untersuchen. Die Union-Flugzeugwerke bauen zwei verschiedene Typen, eine kleine Maschine ohne und eine größere Maschine mit Begleitersitz 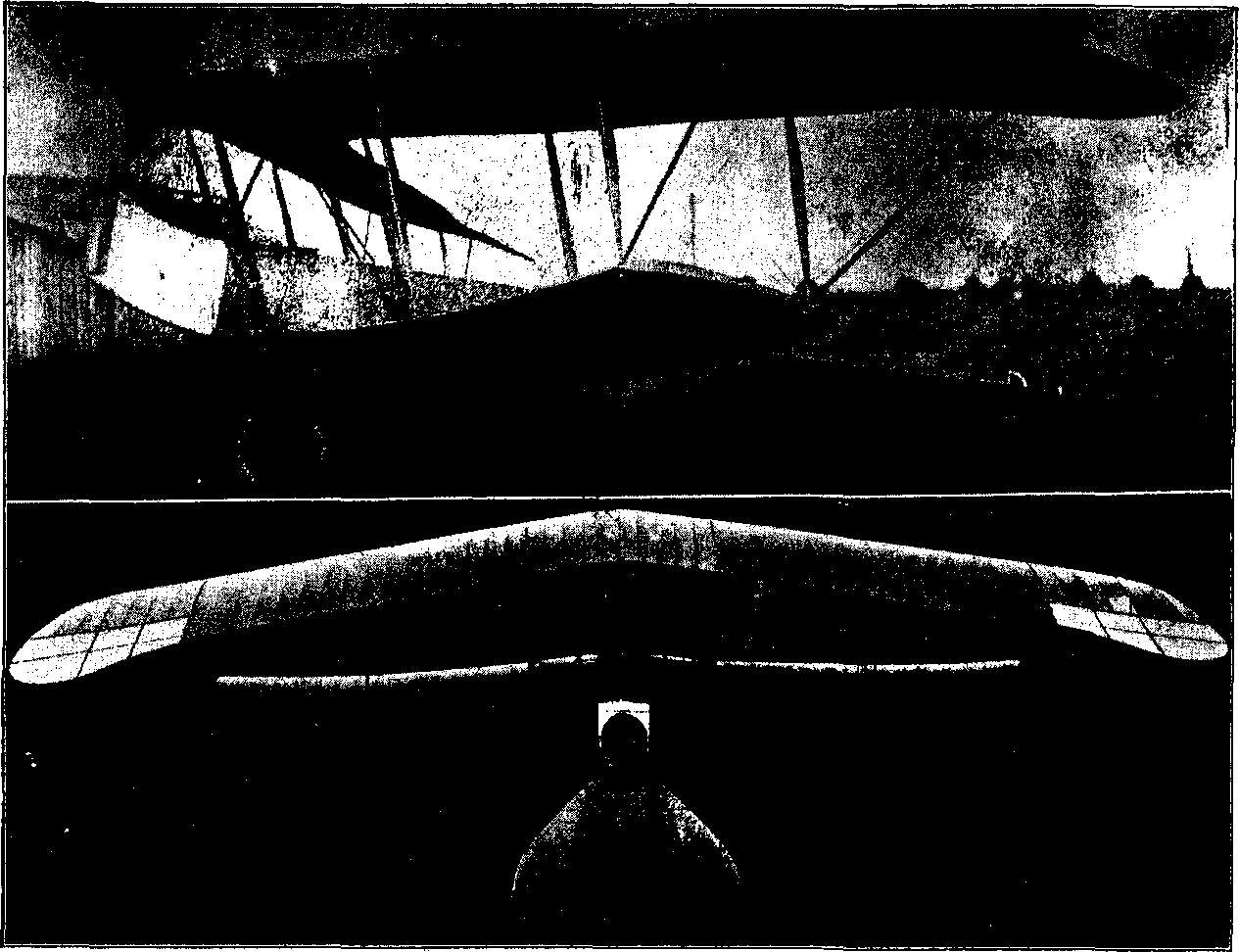 Bomhard-Pfeil-Doppeldecker. Seilen- und Hinteransidll. Die beiden Typen sind in den beistehenden Abbildungen dargestellt. Zum Betriebe dienen 6 Zyl. 100 PS N. A. G.-Motoren. Bei beiden Maschinen ist-.die Militärsteuerung zur Anwendung gebracht. Der Pippart-Noll-Eindecker Militärtyp. (Hierzu Tafel X.) Den älteren Typ von Pippart-Noll haben wir bereits in No. 3 unserer Zeitschrift beschrieben. Der neuerdings herausgebrachte Militär-Eindecker Typ 191,3 weist entsprechend den Erfordernissen der Heeresverwaltung verschiedene technische Verbesserungen auf. Der tropfenförmig ausgebildete Rumpf besitzt, wie aus der Zeichnung auf Tafel X ersichtlich ist, runden Querschnitt. Der reichlich bemessene Raum für die Fluggäste, in dem bequem zwei Personen untergebracht werden können, ist ziemlich weit vorn angeordnet, so daß die Insassen vor den Tragdecken nach unten sehen können. Das Fahrgestell ist bedeutend verstärkt, so daß das untere Ende des Propellers 500 mm vom Boden absteht. Die Tragdecken zeigen, wie die Zeichnung erkennen läßt, eine gute Profilierung. Mit dem 70 PS Motor besitzt die Maschine "eine verhältnismäßig gute Steigfähigkeit. Der Flieger Senge erreichte 350 m Höhe in 3% Minuten. Die konstruktive Durchbildung der einzelnen Teile geht aus der Zeichnung auf Tafel X hervor. Sehr gut bewährte sich der metall-farbene Anstrich, der selbst aus geringer Entfernung die Flugzeuge als ein außerordentlich schlechtes Zielobjekt erscheinen läßt. 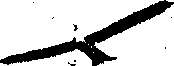 Pippart-Noll-Eindecker. Oben: Im Fluge. Unten: Ansicht von hinten. Eine weitere Maschine von diesem Typ soll mit einem 100 PS Benz-Motor ausgestattet und der Heeresverwaltung in Döberitz vorgeführt werden. Die 150 PS Radley-Wasserflugmaschine (Hierzu Tafel XI.) ist in Huntingdon von James Radley konstruiert worden. Das Schwimmersystem ist katamaranartig als Doppclschwimmer ausgeführt. Das rechte Boot nimmt, fahrtwärts gesehen, den Flugzeugführer und zwei Begleiter auf, während das linke zur Aufnahme von drei Begleitern eingerichtet ist. Die Form des Bootes ist die gleiche wie bei Rennbooten. Eine Stufe ist nicht vorgesehen. Etwaige Ungleichmäßigkeiten in der Gewichtsverteilung bei voller Besatzung werden durch die 3 m großen Stabilisierungsklappen ausgeglichen. Das ßootsmaterial ist Mahagoniholz. Charakteristisch ist die Motoranlage. Sie besteht aus drei Gnom-Motoren von je 50 PS. Dieselben rotieren ziemlich dicht über dem unteren Tragdeck und treiben mittels Gelenkketten eine vierflügelige Luftschraube an. Der vorderste Motor ist wegen de« umherspritzenden Oeles mit einer Blechhaube umgeben. Ucber der Schraubenwelle ist ein kombiniertes Benzin- und Oelgefäß angebracht. Es faßt 95 1 Benzin und 45 1 Oel. Der vierflügelige Propeller ist eigene Konstruktion und hat einen Durchmesser von 3 m. Er ähnelt in der Ausführung der Ratmanoff-Schraube. Die Haupttragflächen haben 46 qm Flächeninhalt bei einer Spannweite von 14 m. Das Unterdeck ist etwas kürzer als das Oberdeck. Die Schwanztragfläche ist mit den Haupttragflächen in bekannter Weise durch einen Gitterträger verbunden und mißt 5,25 qm Tragfläche. Davon entfallen 2,25 auf die Dämpfungsfläche und 3 qm auf das Höhensteuer. Darunter befinden sich zwei Seitensteuer, die insgesamt 1,5 qm Flächeninhalt haben. Die Maschine soll 570 kg wiegen Die Steuerung ist die bekannte englische Militärsteuerung. (Siehe die Zeichnung auf Tafel XI). Gegenwärtig werden Probefahrten mit der Maschine unternommen, nach deren günstigem Verlauf das Flugzeug um den Daily Mail-Preis starten soll. Erfolgversprechend erscheint die gesamte Konstruktion nicht. Interessant für uns wäre nur, ob die Motoranlage sich bewährt. Die Anordnung der Schwimmer ist vollständig verfehlt. Man sieht, der Konstrukteur hat sich noch wenig mit dem Bau von Wasserflugmaschinen, insbesondere in Praxis, beschäftigt. Die beiden Schwimmer werden auf hoher See sofort voll Wasser laufen, ganz abgesehen davon, daß die Insassen ohne ein kaltes Bad wohl kaum davonkommen. Wasserflug-Wettbewerb in Monaco. Ueber den Ausgang des Wasserflugwettbewerbs in Monaco wäre noch folgendes nachzutragen. (Cf. den Artikel in Nr. 8 des Fingsport.) Bekanntlich hatten nur 7 Apparate die Vorprüfungen bestanden, von denen auch nur vier flugfähig zu dem 25.000 Frs. Preis des Internationalen Sporting-Clubs am Start erschienen, Prevost (Deperdussin), Gaubert (M. Farman), Espanet (Nieuport) und Bregi (Breguet). Die hohe Belastung, 350 kg Benzin und; 100 kg Oel, stellten an die Maschinen große Anforderungen. Als Erster kam Bregi mit seinem schweren 200 PS Breguet-Apparat vom Wasser weg und gewann 50 km Vorsprung. Prevost auf Deper-dussin gab das Kennen bereits nach 30 km als aussichtslos auf. Ebenso schieden aus dem Rennen Espanet infolge Motorschwierigkeiten nach 190 km, Bregi nach 260 km und Gaubert infolge Benzinmangels nach 270 km aus. Am letzten Tage, 14. April fand die Konkurrenz um den Pokal Schneider statt. Auch an diesem Wettbewerb beteiligten sich nur 4 Flieger. Bekanntlich mußten 19 km schwimmend und ca. 275 km in der Luft in 28 Runden zurückgelegt werden. Am Start erschienen: Weymann auf Nieuport mit 160 PS Gnom, Espanet auf Nieuport mit 160 PS Gnom, Prevost auf Deperdussin 160 PS Gnom und Garros auf Moräne mit 80 PS Gnom. Um 8 : 5 startete als Erster Prevost auf Deperdussin. Ihm folgten 8:16 Garros auf Moräne, 8: 20 Espanet (Nieuport) und 9 : 16 Weymann (Nieuport). Garros kehrte infolge Motordefekts zur Reparatur an Land zurück. Nachdem er zum zweiten Male gestartet hatte, mußte er wegen Ventilbruchs wieder seinen Flug aufgeben. Das größte Interesse beanspruchte der Wettkampf zwischen Prevost (Deperdussin) und Weymann (Nieuport). Weymann war beim Schwimmen gegen Prevost um 8 Minuten zurückgeblieben. In der 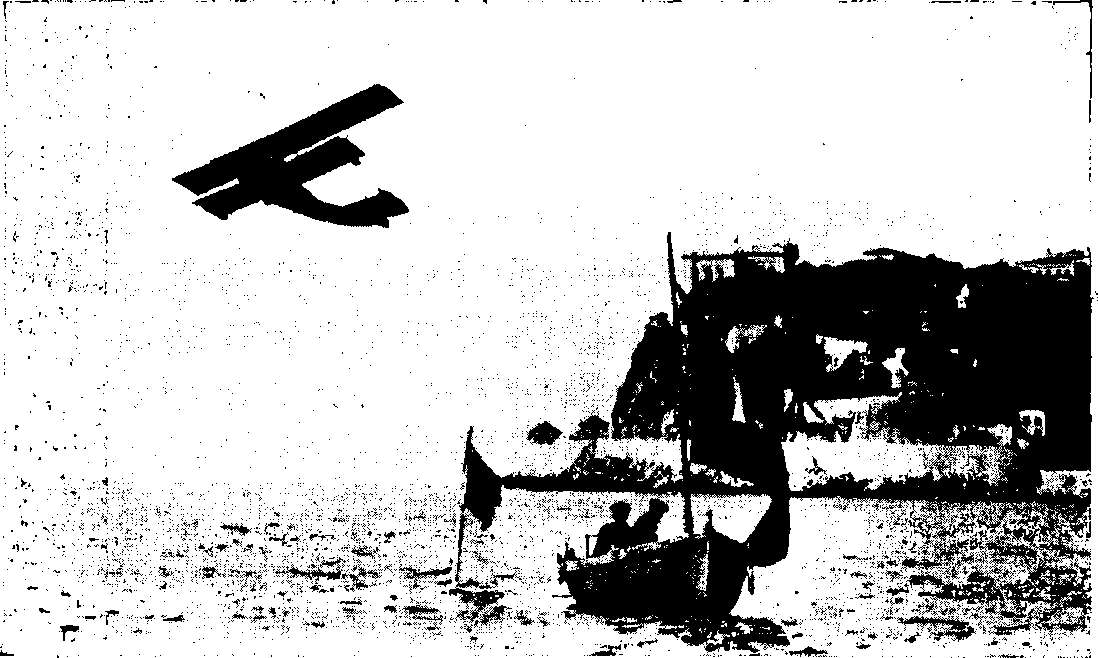 Wasserflugwettbewerb in Monaco. Gaudart auf Artois.*) Luft jedoch gelang es Weymann mit seinem schnellen Nieuport die verlorene Zeit wieder einzuholen. Für die ersten 100 km benötigte er 58 Miauten, entsprechend einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 111 km Nach 150 km hatte Weymann Prevost eingeholt und bereits einen Vorsprung von 3 Sekunden. Leider passierte Prevost nicht vorschriftsmäßig die Ziellinie, über welche im Gleitfluge hinweg geflogen *) Gaudart rutschte mit seinem Apparat nach hinten ab, schwamm erst kurze Zeit auf dem Wasser und ertrank. werden mußte. Prevost hatte fälschlich 500 m vor der Ziellinie gewassert und war von dort in den Hafen zurückgekehrt, wo man ihn auf den Irrtum aufmerksam machte. Vor dem Ziel mußte leider Weymann infolge Heißlaufens seines Motors niedergehen Als das Prevost sah. flog er sofort wieder auf und setzte seinen Flug fort, um ihn vorschriftsmäßig zu beenden. Garros ging gleichfalls, durch den Mißerfolg Weymanns ermutigt, nochmals ins Rennen, und besetzte den zweiten Platz. Das Resultat ist folgendes: 1. Prevost in 3 : 48 : 22 (reine Flugzeit 2 : 50 : 47); unter Berücksichtigung der Unterbrechungszeiten wurden zurückgelegt: 50 km in 34 : 49, 100 km in 1 : 3 : 42, 150 km in 1 : 33 : 10, 2o0 km in 2 : 2 ; 29, 250 km in 2: 31 : 37. 2. Garros 50 km in 2: 7 : 23, 100 km in 3 : 34: 18, 150 km in 4:3:35, 250 km in 5:40:14. 3. Weymann 50 km in 49 : 37s, 100 km in 1:6: 22, 150 km in 1 : 33 : 7, 200 km in 1 : 49 : 23, gab auf nach 240 km. Pariser Brief. . Von unserem Pariser Korrespondenten. Mit dem Beginn der besseren Jahreszeit hat sich im französischen Flugwesen eine geradezu fieberhafte Tätigkeit eingestellt und neben den mannigfachen Einzelleistungen der französischen Flieger hat namentlich auch der Kampf um die großen Bewerbe des Jahres eingesetzt und bereits zu außerordentlich interessanten und teilweise sensationellen Resultaten geführt. Die große Reihe von grandiosen Flugleistungen begann am 14. April, an welchem Tage Ohampel und Marty sechs neue Flugrekords aufgestellt haben. Ohampel war am Tage vorher von Juvisy nach Orleans geflogen und Unternahm nun dort auf dem Manöverfelde von Cercottes einen Angriff auf die bisherigen Vierpassagierrekords. Er steuerte einen großen Zweidecker eigener Konstruktion, 110 PS Zehnzylinder Anzani-Motor, und führte mit vier Passagieren an Bord, zu fünfen einen Flug von 3 Stunden 1 Minute über 250 km aus. Interessant sind die Einzelziffern dieser Rekordleistung, weil sie zeigen, mit welcher Regelmäßigkeit dieser Flug zu fünfen ausgeführt wurde: Zeit: 30 Min. 40 km 2 Std. 165 km 1 Std. 82 km 2 V, „ 208 km IV» „ 122.km 3 „ 249 km Geschwindigkeit: 50 km in 36:31 200 km in 2 : 29 : 03 100 km in 1 : 13 : 01 250 km in 3 : 01 : 00 150 km in 1 : 49 : 11 Distanz: 250 km (bish. Rekord: Busson, 25,740 km 10. März 1911) Dauer: 3 Stde. 1 Minute (bish. Rekord: Faller, 1 : 18, 31. Dez. 1912) Am gleichen Tage stellte der junge Flieger Marty in Le Crotoy auf einem Caudron-Zweidecker, 100 PS Zehnzylinder Anzani, neue Höhenrekords, erst mit drei, dann mit vier Passagieren, auf. Jeder der beiden Flüge dauerte 35 Minuten. Die neuen Rekords sind : Flieger und drei Passagiere: 1800 Meter (bish. Rekord: Ohevillard, 1350 m, 12. Februar 1913) Flieger und vier Passagiere: 1450 Meter (bish. Rekord Guggenheim, 1120 m, 10. Februar 1913) Alsdann folgte der großartige Passagierflug Hamels auf einem Bleriot von Dover nach Köln, 405 km in ununterbrochenem Fluge über vier Länder hinweg (England, Belgien, Holland, Deutschland) und zwar über Calais, Dunkerque, Malines, Aachen; die Dauer des Fluges war 4 Stunden 5 Minuten. Zweifellos die interessantesten Flugleistungen aber brachte der Kampf um den Pommery-Pokal, an dem eine Reihe von Fliegern, wie Daucourt, Janoir, Gilbert, Le-gagneux, Brindejonc des Moulinais, Guillaux, Marty u. a. m. teilnahmen. Die erste Sensation war der Flug Paris-Berlin, den Daucourt am 16. April auf einem Borel-Eindecker der Militärtype, 50 PS Gnom-Motor, in 7 Stunden 40 Minuten effektiver Flugzeit ausführte. Die Einzelheiten dieses Fluges sind ja aus der Tagespresse hinlänglich bekannt, ebenso die geradezu enthusiastische Aufnahme, welche der Flieger in Berlin gefunden hat. Den hier lebenden Deutschen mutet es allerdings eigenartig an, daß gerade Daucourt eine solche Begeisterung drüben auslösen konnte. Denn es ist erinnerlich, wie dieser Flieger durch seine geschmacklosen deutsch-hetzerischen Spaße vom vorigen Jahre, die sogar eine diplomatische Vorstellung vonseiten des deutschen Botschafters und eine ernste Verwarnung vonseiten der französischen Regierung zur Folge hatten, von sich reden machte. Daß Audemars, der am selben Tage nach Berlin fliegen wollte, in Wanne landen mußte, ist gleichfalls bekannt. Noch großartiger war die Leistung, die am letzten Freitag von Gilbert vollbracht worden ist, welcher, gleichfalls um den Pommery-Pokal, einen Flug von Paris nach Spanien, 825 km in ununterbrochenem Fluge zu "Wege brachte. Gilbert und Legagneux, beide auf Morane-Ein-decker, hatten sich entschlossen, am genannten Tage vom Flugplatze zu Villacoublay um den Pommery-Pokal zu starten; sie hatten sich zwei Flugrouten, die eine Paris-Warschau, die andere Paris-Salamanka vorbereitet. Als am frühen Morgen des Freitag ein leichter Nordwind wehte, entschieden sie sich dafür, dieRichtung nach Spanien einzuschlagen. Legagneux hatte einen Einsitzer, 50 PS Gnom; Gilbert einen Zweisitzer, 60 PS Le Rone, aber anstelle des Passagiers hatte er ein zweites Reservoir von 125 Liter Inhalt an Bord anbringen lassen, sodaß er für einen zwölfstündigen Flug gerüstet war. Legagneux nahm nur 130 Liter Betriebsstoff mit sich und wollte unterwegs, in Angouleme oder in Biarritz,sich neu verproviantieren. Um 4 Uhr 48, also unmittelbar nach Sonnenaufgang, flog Legagneux ab, 20 Minuten später nahm Gilbert seinen Start. Um 9 Uhr landete. Legagneux in Angouleme und eine halbe Stunde später in Barbezieux, wo er den Weiterflug aufgab und nach Paris zurückkehrte. Glücklicher war Gilbert. Um 11 Uhr 30 passierte er über Biarritz und um 1 Uhr 30 landete er in Vittoria; er hatte die Distanz von 825 km also in 8 Stunden 22 Minuten hinter sich gebracht. Von Paris bis Bordeaux flog Gilbert mit günstigem Rückenwinde mit 120 km Stundengeschwindigkeit. Dann setzte ein heftiger Regen ein, der während 300 km anhielt. Zwischen Bordeaux und Biarritz mußte er in 600 Meter Höhe fliegen. Auf der Strecke Biarritz bis Vittoria hatte er Gegenwind, sodaß er zwei Stunden brauchte, um diese 115 km hinter sich zu bringen. Als Gilbert in Vittoria landete, hatte er noch Betriebsstoff für zwei Stunden Flug. Er empfand nur vom langen Sitzen eine große Müdigkeit. Um 3 Uhr 30 Minuten flog Gilbert von Vittoria ab, um nach SaJamanka zu gelangen. In diesem Augenblick fehlten ihm nur noch 75 km, um die Leistung Daucourts (Paris-Berlin) zu erreichen. Um 6 Uhr abends landete er in Medina del Cambo, einige Kilometer von Salamanka, nachdem er 1046 km zurückgelegt hatte und so die größte Distanz im Stadt-zu-Stadt-Flug an einem Tage erreicht hatte. Auf der letzten Strecke hatte Gilbert schlechtes Wetter und heftigen Gegenwind. Beim Landen in Medina del Cambo wurde eines der Räder an seinem Apparat verbogen. Mit dieser Leistung hat sich Gilbert zum ersten Anwärter auf den Pommery-Pokal gemacht, doch dürften noch einige Versuche anderer Bewerber zu erwarten sein. Noch andere gelungene Flugunternehmungen sind zu erwähnen. Vidart wollte, mit einem Passagier an Bord, von Paris nach Marseille fliegen; er mußte aber in Savigny infolge heftigen Windes landen. Duval unternahm auf einem Deperdussin 50 PS Clerget, einen Flug um den diesjährigen Michelin-Pokal, welcher bekanntlich verlangt, daß der Flieger an beliebig vielen Tagen, aber ohne einen einzigen Tag auszulassen, den weitesten Distanzflug ausführt. Duval hatte die Flugstrecke von Etampes nach Gidy, in der Nähe von Orleans, gewählt, welche ein Ausmass von .08 km hat. Er umkreiste diese Strecke achtmal und landete, wie das Reglement es vorschreibt, nach jeder Runde, um sich in das Kontrollbuch einzuzeichnen. Die Runden legte er mit großer Gleichmäßigkeit in 1 Stunde 2 Minuten bis 1 Stunde 3 Minuten zurück Bekanntlich ist für diesen Pokal eine Durchschnittsgeschwindigkeit von mindestens 50 km zur Bedingung gemacht. Duval, der seinen ßewerbflug am folgenden Tage fortsetzen wollte, wurde durch einen heftigen Sturm daran verhindert, sodaß seine erwähnte Leistung leider nicht mehr in Anrechnung kommt. Auch der Anzani-Goldanhänger ist wieder auf die Tagesordnung gekommen. Bosano unternahm am letzten Montag von Issy aus auf einem Caudron-Zweidecker, 40 PS Sechszylinder Anzani-Motor, seinen Abflug und flog von Paris bis Haarlem, 450 km in 4 Stunden 10 Minuten mit Zwischenlandung in Brüssel. Wie erinnerlich, verlangt der Bewerb einen Flug von mindestens 500 km in gerader Linie an einem Tage. Dagegen scheint der seit langem angekündigte und von Tag zu Tag verschobene Flug über das Mittelländische Meer aufgegeben zu sein. Die französische Regierung, welche seit Wochen einige Torpedoboote in Marseille liegen hatte, die den Flieger Seguin auf seinem Fluge nach Algier begleiten sollten, scheint endlich die Geduld verloren zu haben und hat den Befehl gegeben, daß die Schiffe sofort ihren zuständigen Hafen aufsuchen. Großes Interesse zeigt sich hier für den vom Aero-Club von Belgien geplanten und von uns bereits erwähnten großen belgisch-holländischen Wasserflugzeugbewerb der, wie soeben bestimmt worden ist, gegen Ende Juni vor sich gehen und ein Ausdauer- und Geschwindigkeitsbewerb über 600 km werden soll. Die Association Generale Aeronautique hat beschlossen, mehreren bekannten Fliegern Gedenkmedaillen für hervorragende Fernflüge zu verleihen und hat bereits mit den Fliegern Gilbert, Guillaux, Garros, Bider, Bielovucie, Daucourt, Brindejonc und Kühling den Anfang gemacht. Zu erwähnen ist noch, daß am vergangenen Sonntag Victor Tatin, einer der besten französischen Flugtechniker, der sich um die Entwicklung des modernen Flugwesens vielfach verdient gemacht hat, verstorben ist. Tatin, welcher Ritter der Ehrenlegion war und dem Direktorium des Aero-Club de France angehörte, hat ein Alter von 70 Jahren erreicht. Neben dem Zivilflugwesen hat auch das französische Militärflugwesen in den letzten Tagen eine eifrige Tätigkeit entwickelt, die freilich durch einen schweren Unfall getrübt worden ist. Am Dienstag unternahm ein Luftgeschwäder, und zwar zum ersten Male ein Wasserflugzeuggeschwader einen Fernflug auf Caudron-FJugzeugen, die von den Leutnants Gerard und Le Bihan gesteuert wurden. Sie flogen um 8 Uhr von Le Crotoy ab und landeten, nach Zwischenlandungen in Berck und Boulogne, um 12 Uhr 15 bei strömendem Regen in Calais. Das dritte Flugzeug wurde von dem. Kaporal Strohl gesteuert, der einen Begleiter an Bord hatte. In Villacoublay stürzte Leutnant de Blanmont, als während eines Fluges sein Flugzeug von einem heftigen Windstoß erfaßt wurde, aus 500 m ab, wobei er aus seinem Apparat fiel und seinen sofortigen Tod fand. Auch auf dorn Felde von Mailly schlug ein Zweidecker, in dem zwei Unteroffiziere saßen, um und stürzte zur Erde; die beiden Insassen wurden schwer verletzt. Eine schöne Flugleistung ist vom französischen Kolonial-Flugwesen zu verzeichnen. Das Saharah-Luftgeschwader, bestehend aus vier Flugzeugen, die von den Leutnants Reimbert, Cheutin, .Jolain und dem Wachtmeiser Benott gesteuert wurden, hat einen Rundflug von 800 km über der Wüste glücklich durchgeführt. Das Geschwader flog am 14. April: von Biskra nach Tuggurt, 220 km, am 15. April: von Tuggurt nach Uargla, 180 km, am 16. April: von Uargla nach Tuggurt, 180 km, und am 17. April: von Tuggurt nach Biskra, 220 km. Auf dem Flugzeug des Leutnants Cheutin hatte der bekannte Oberst Bout-tieaux Platz genommen, welcher zwecks Reorganisierung des Flugwesens von der Heeresverwaltung in die Kolonien geschickt worden ist. In Franz. Indochina, woselbst van den Born gegenwärtig eine Militärfliegerschule einrichtet, ist ein bedauerlicher Unfall passiert: Geo Verminck, der in Saigon in Gemeinschaft mit seinem Bruder und dem Flieger Pourpre erfolgreiche Schauflüge veranstaltete, ist am vergangenen Montag dort abgestürzt und hat dabei seinen Tod gefunden. Das französische Militärflugwesen hat dieser Tage einen schweren Verlust erlitten. Der bekannte Hauptmann Clavenad, der durch seine Aufdeckung der zahlreichen Mängel im Flugwesen der Kolonien und durch seine „Flucht in die Oeffentlichkeit" seinerzeit so viel Aufsehen erregte und der dafür von der Militärverwaltung gemaßregelt, später aber wieder zum Flugwesen zurückversetzt wurde, wo er eine außerordentliche Organisationsgabe entwickelte, ist am Donnerstag bei einem Ausflug im Kugelballon in Gemeinschaft mehrerer bekannter Luftschiffer infolge Explosion des Ballons ums Leben gekommen. Uebrigens steht die seit langem reklamierte Neuorganisation des Militärflugwesens unmittelbar bevor, indem das Militärflugwesen nunmehr dem Ressort des Geniekorps entzogen und zur selbständigen Waffe umgewandelt werden soll, die im Kriegsministerium ihren eigenen Abteilungsdirektor haben wird. Schon der frühere Kriegsminister Millerand hatte sich zu diesem Projekt bekannt und der gegenwärtige Minister will dessen Durchführung vornehmen. Diese Umgestaltung ist für die weitere Entwicklung des Militärflugwesens von größter Bedeutung. Sie wird die bisherigen Verschleppungen auf dem umständlichen Instanzenwege beseitigen und eine prompte und sachgemäße Förderung aller auf das Flugwesen bezüglichen Angelegenheiten zur Folge haben. Die neu einzurichtende Abteilung für das Flugwesen im Kriegsministerium wird die gleichen Machtvollkommenheiten besitzen, wie die analogen Abteilungen für Infanterie, Kavallerie. Genie etc. Damit ist ein lang gehegter und geäußerter Wunsch der Militärflieger erfüllt. Soeben trifft noch die Meldung ein, daß der bekannte Flieger Janoir, welcher gestern einen Flug um den Pommery-Pokal unternahm, und der um 7.5 Uhr morgens von Biarritz abgeflogen und um '/j7 Uhr in Bordeaux gelandet war, von wo er um 7 Uhr wieder abflog, in der Nähe von Sanxay aus 50 m Höhe abgestürzt ist. Janoir ist schwer verletzt ins Hospital geschafft worden. Rl. Aus dem Johannisthaler Fliegerlager. (Berliner Korrespondenz des „Flugsport"). Der 16. April war eine kleine Abwechslung für die Johannis-thaler Flieger. Galt es doch, den französischen Kameraden Daucourt würdig zu empfangen. Und er wurde würdig empfangen. Ob er mutig genug ist, dies seineu französischen Kameraden auch zu erzählen ? In den Zeitungen war nicht viel zu lesen. Daucourt, der am 16. April bei Paris aufstieg, war nach mehreren Zwischenlandungen nachmittags um 3:30 (s. Bericht an anderer Stelle) von Hannover nach Berlin aufgestiegen. Im Fliegerlager wurde es daher gegen Abend lebendig. Alles eilte hinaus. Das Wetter war herrlich. Man sah Maschinen von fast sämtlichen in Johannisthal vertretenen Firmen in den Lüften. Für Unterhaltung des zahlreich erschienenen Publikums war daher gesorgt. Gegen 61/» Uhr erschien am Horizont in 200 m Höhe der kleine Borel-Ein-decker und flog im Bogen über die Haupttribüne, um mitten auf dem Flugplatz 6:39 zu landen. Das Bild, das jetzt folgte, war charakteristisch genug. Mehrere der herumschwirrenden Flugmaschinen landeten sofort neben der Landungsstelle des Borel-Eindeckers. Automobile eilten über den Flugplatz. Man sah, wie Daucourt, der nach dem langen Fluge etwas steif geworden war, aus dem Eindecker gehoben und über den Flugplatz getragen wurde. Vor dem Klubhaus des Kaiserl. Aero Clubs brachte man dem erfolgreichen Flieger lebhafte Ovationen dar. Das offizielle Protokoll über die Landung wurde von Major von Tschndi und Ellery von Gorrissen aufgenommen. Wie Daucourt mir erzählte, ist sein Motor tadellos gelaufen. Die Orientierung hatte er sich schwieriger vorgestellt. Besonders unangenehm war die Fahrt über Westfalen, wo er tüchtig arbeiten mußte. Daucourt flog in einer durchschnittlichen Höhe von 800 m.  Daacourts Empfang in Johannisthal. Bei Hannover mußte er infolge der böigen Winde einmal auf 2000 m gehen. Am 17. April wurde dem französischen Flieger noch eine besondere Ehrung zuteil. Der Bund der deutschen Flugzeugführer veranstaltete in engerem Kreise im Zentralhotel zu Ehren des Borel-Fliegers ein Festessen, an welchem die bekanntesten Persönlichkeiten von Johannisthal teilnahmen. Viel Zeit für Feste und Feiern gibt es jetzt hier nicht. In allen Werkstätten wird mit Hochdruck gearbeitet. Fieberhaft bereitet man sich für die kommenden Wettbewerbe vor. Bei Fokker erfüllte der Handelskapitän Schultz die Feldpilotenprüfung in tadelloser Form. Kiessling bestand auf AGO-Doppeldecker die Flugzeugführerprüfung. Nachzutragen ist noch, daß am 17. April Frank Seydler auf Melli Beese-Taube mit 100 PS Argus-Motor mit 2 Std. 5 Min. um einen Preis der Nationalflugspende flog und die 2000 Mark an sich brachte. Seydler flog teilweise in strömendem Regen. Die Flugmaschinen - undExplosions - Motoren-Gesellschaft, welche bisher in Teltow ihre Werkstätten besaß und Eindecker nach System Coler baute, ist seit 1. April nach Johannistal übergesiedelt. Leider hat uns die vergangene Woche zwei sehr bedauerliche Unfälle gebracht. Es ist hier nicht der Ort, zu erörtern, ob sie hätten vermieden werden können. In den Tageszeitungen ist alles mögliehe geschrieben worden. Die bekannte Wright-Fliegerin Fürstin Schale owskoy war am 24. April 6Uhr45 mitWsse-wolod A b r a m o w i t s c h auf einem 35 PS Wright-NAG aufgestiegen. In der bekannten gefährlichen Ecke in der Nähe der Versuchsanstalt für Luftfahrt geriet der Zweidecker, der in ca. 8 m Höhe flog, in den Wirbel einer „Taube" und begann in der Längsrichtung stark zu schwanken. Der Fürstin Schakows-koy gelang es nicht, den Zweidecker, der nur eine Steuerung besaß, ins Gleichgewicht zu bringen. Abramowitsch mußte zusehen, wie die Fürstin Sdiakov/skoy mit Abramowitsch, Maschine nach vorn zu letzterer am 24. April tödlich abgestürzt. Bodenstürzte. DieFürstin 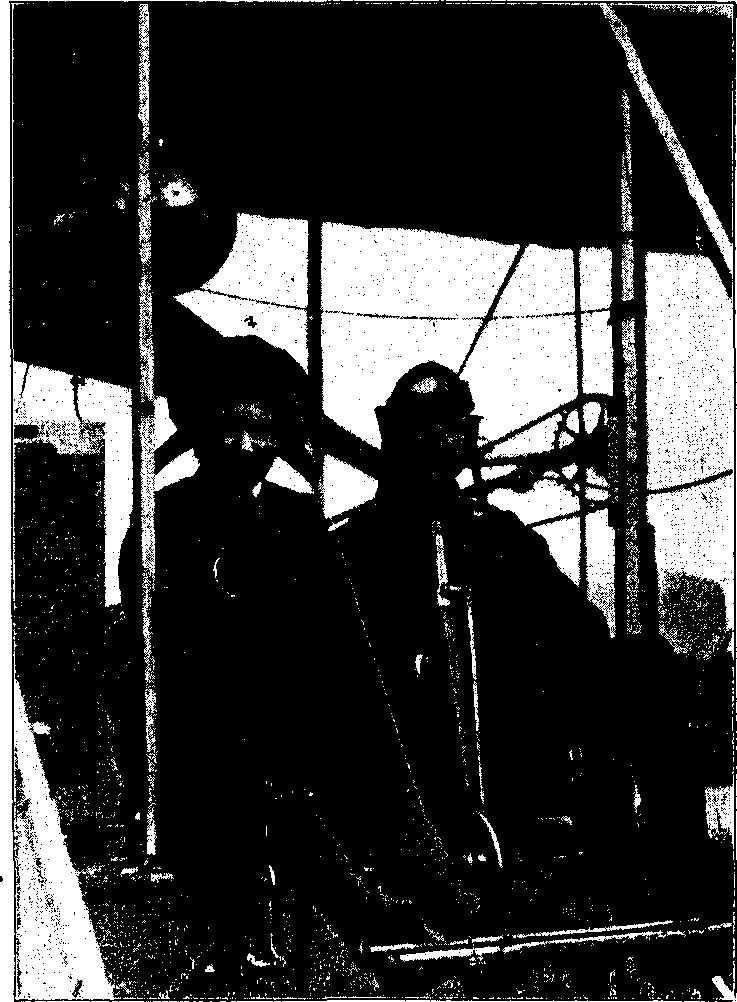 Schakowskoy wurde nur leicht, Abramowitsch indessen sehr schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er starb. Wssewolod Abramowitsch ist 1890 zu Odessa geboren und lernte im Sommer 1911 in Johannistal fliegen. Anfang Oktober bestand er auf Wright-Doppeldecker die Flugzeugführerprüfung und galt bald als einer der tüchtigsten Flieger in Deutschland. Bekannt geworden ist er besonders durch seinen Flug nach Petersburg mit Regierungsbaumeister Hackstedter. An der Petersburger Kriegsflugzeugprüfung nahm er mit so großem Erfolg teil, daß die russische Heeresverwaltung bei der Wright-Gesellschaft eine größere Anzahl Doppeldecker bestellte. Einige Minuten später ereignete sich ein weiterer schwerer Unfall. Der in Johannisthal populäre und beliebte Russe Elia D u n e t z stürzte aus großer Höhe tödlich ab. Nach Aussagen mehrerer Augenzeugen stieg Dunetz, nachdem er vorher schon einen Probeflug von 6 bis 10 Minuten gemacht hatte, kurz vor 7 Uhr auf, kam schnell auf 1000 m Höhe und ging von dort in steilem Sturzfluge mit annähernd vollaufendem Motor herab In 300 m Höhe soll der Gleitwinkel 45 Grad betragen und von da sich immer mehr der Senkrechten genähert haben. In dieser Höhe sah man plötzlich, begleitet von einem furchtbaren Schlag, wie die beiden Flügel nach oben zusammenklappten und der Apparat senkrecht zur Erde stürzte, wobei der Motor noch lief. Die Luft - Verkehrsgesellschaft gibt folgende Erklärung des Unfalls ; Infolge Ueberanspruchung beim Sturzflugist der Propeller in 300 ni Höhe gesprungen. Dnrch die abfliegenden Teile sind die Spieren des Fl ügels herausgerissen worden. Durch das Durchschlagen der Spieren wurde die Steifheit des Flügels aufgehoben, die Ueber-reste des Flügels klappten nach hinten und der Absturz erfolgte. Elia Dunetz war ein außerordentlich gewandter Flieger. Im Vertrauen auf sein Können und auf die Festigkeit des Apparates machte er schon in den letzten Tagen, nachdem er kaum einige Aufstiege auf diesem Eindecker absolviert hatte, überaus kühne Flüge, so daß sowohl der Konstrukteur Schneider als auch mehrere Flieger ihn gewarnt hatten. Dunetz f  „FLUGSPORT." No. 9 Elia Dunctz war am 22. Dezember 1882 in Rußland geboren. Seine Fliegerlaufbahn begann er 1910 in Frankreich, wo er auch das Pilotenpatent auf Blöriot erwarb. Dann war er in Italien l1^ Jahre lang Mitarbeiter des Konstrukteurs Caproni, dessen Eindecker er in Som-malombardo sehr erfolgreich flog. Im Sommer 1912 kam er nach Deutschland, wo er in Heiligendamm den Garuda-Wasser-Eindecker fliegen sollte. Am 23. September trat er als Flieger in die Dienste der Harlan-Werke, bei denen er bis zum 1. April d. J. mit Erfolg tätig war. Seit einigen Tagen flog er auf dem schnellen Eindecker der Luftverkehrs-Gesellschaft, mit der er wegen eines Engagements in Unterhandlungen stand. — — Bei den Albatros-Werken hat Hirth seinen Apparat für den Prinz Heinrich-Flug bereits ausprobiert. Dieser Eindecker besitzt bei 13 m Spannweite 35 qm Tragfläche. Der 8 m lange spindelförmige Rumpf ist vollständig aus Holz gebaut und mit Faurnier überzogen. Führer und Gastsitze liegen bei dieser Maschine nebeneinander. Zum Betriebe dient ein 6 Zylinder-Mercedes-Stahl-Motor von 85 PS. Die französische Regierung und die Regelung des Luftverkehrs. Der Zeppelin-Vorfall, nämlich die irrtümliche Landung des deutschen Luftkreuzers Zeppelin IV auf französischem Boden, in der Nähe von Luneville, hat, abgesehen von der großen Erregung in den der Ostgrenze benachbarten französischen Landesgebieten und einer endlosen Preßkampagne, bereits ein Wunder zu Wege gebracht: eine Frage, die seit Wochen und Monaten „im Schöße der Regierung" studiert und erwogen wird und die aus dem schlafähnlichen Zustande zu erwecken die gesamte Fachpresse sich vergeblich bemüht hat, diese Frage wird nunmehr nach jähem Erwachen voraussichtlich in aller Kürze ihre Realisierung erleben, und das hat der Zeppelin getan. Der französische Ministerrat hat in einer besonderen - Sitzung vom Sonnabend, den 12. April beschlossen, dem Parlament sofort nach dessen Wiederzusammentritt einen Gesetzentwurf Uber die Regelung der gesamten Luftschiffahrt und des Luftverkehrs zu unterbreiten. Natürlich kann es sich bei dem Beschlüsse der Minister nur darum handeln, daß jenes Gesetzprojekt im Prinzip beschlossen ist, denn dessen Durcharbeitung muß den zuständigen Fachtechnikern in Gemeinschaft mit den militärischen Sachverständigen jwörbehalten bleiben. Indessen ist es nun sicher, daß die Angelegen-he^i^lRonefi gekommen ist und daß die lang erwartete gesetzliche Regelung defv eins£htägjgen Fragen ihre Verwirklichung finden wird, und zwar in verhältnismäßig kürzer Zeit, denn im wesentlichen wird man sich wohl bei Ausarbeitung iSer gesetzlichen Bestimmungen an die seitens der früher schon eingesetzten Sonderkommission, die ihre Arbeiten längst beendet hat, anlehnen.. Der, zu erwartende Gesetzentwurf der französischen Regierung wird zwar vom Minister der öffentlichen Arbeiten vor dem Parlamente vertreten, aber mit Rücksicht auf die wichtigen militärischen und fiskalischen Interessen, die dabei mit im Spiele sind, von dem Kriegsmiriister und dem Finanzminister mit unterzeichnet werden. Wir können nachstehend die wesentlichsten Punkte angeben, auf welche sich, nach den vom Ministerrate geäußerten Wünschen, die dem Gesetzentwurf zugrunde liegenden Bestimmungen zu erstrecken haben werden: .Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel X. 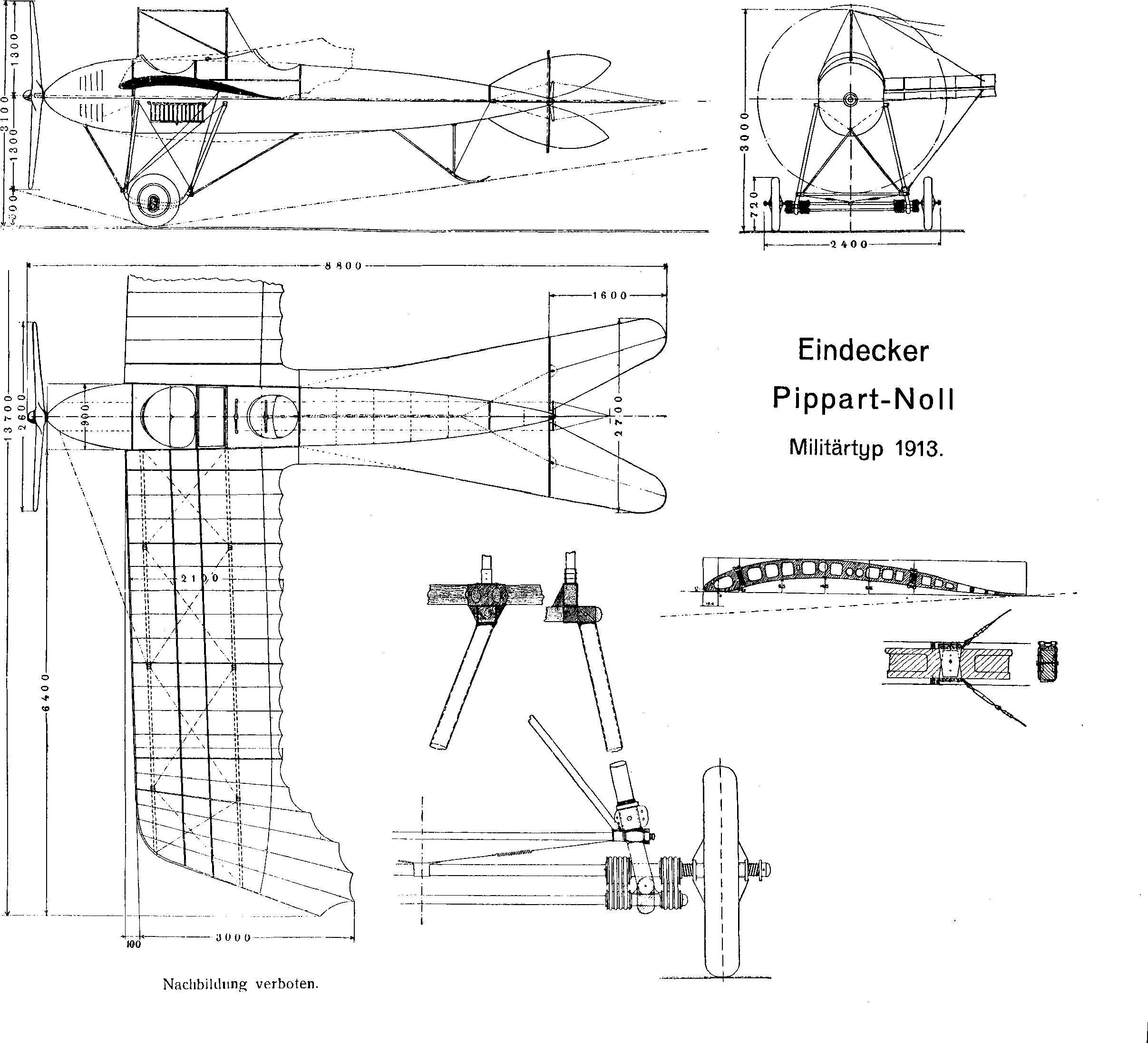 ugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XI. Radley-Wasserflugmaschine 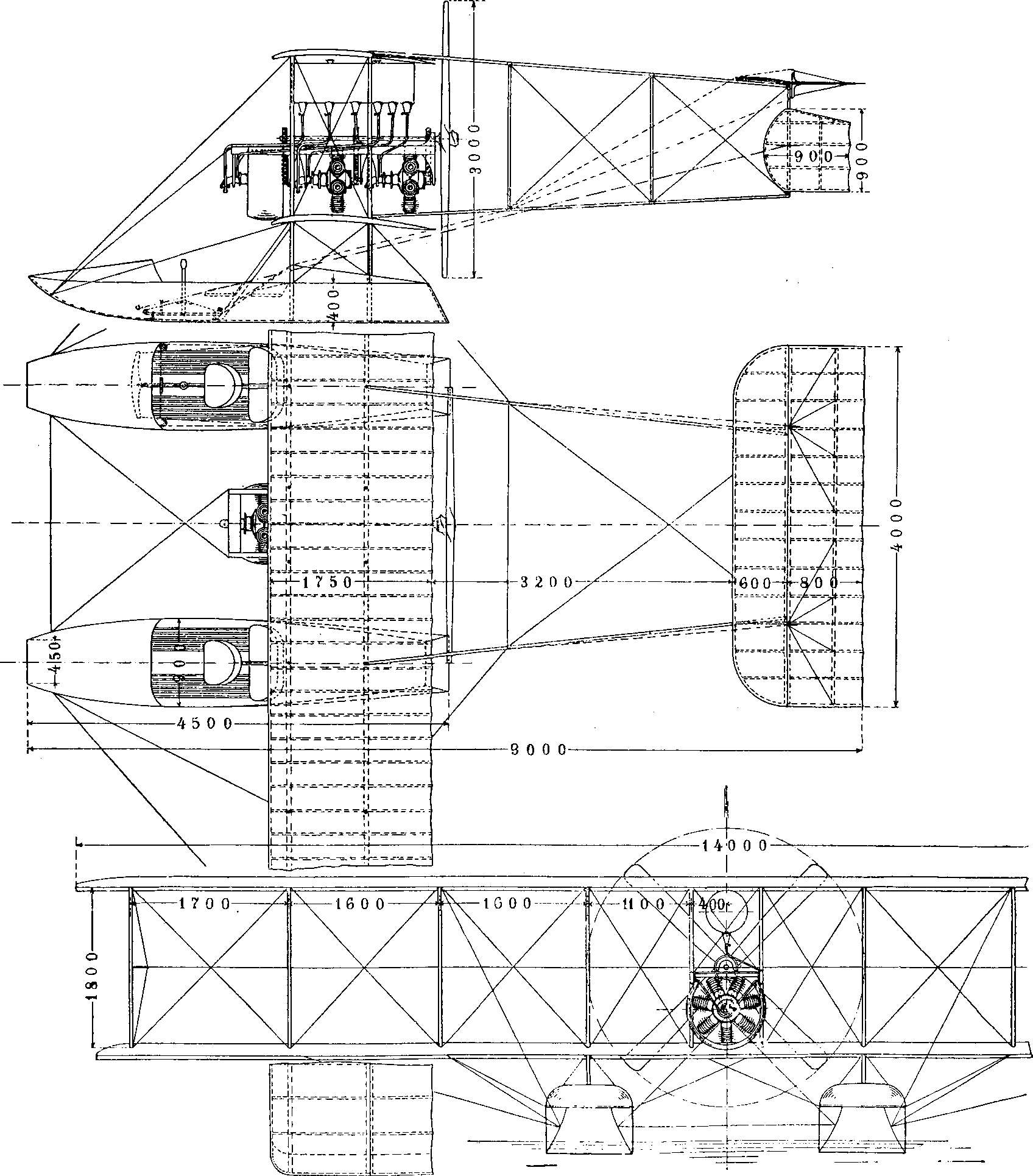 Nachbildung verboten. 1. Bestimmung des Eigentums der Luft. Bisher erstreckte sich in der Tat nach dem Zivilrecht nicht nur auf den Boden, sondern auch auf das was unter der Erde und über der Erde, ohne Einschränkung, sich befand, so zwar, daß auf Grund der gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen ein Besitzer eventuell als berechtigt angesehen werden kann, jedem Flugzeug das Passieren über seinem Besitztum absolut zu untersagen. Es wird nun immer dringender erforderlich, aufs genaueste zu definieren, von welcher Höhe ab die Luft Eigentum der Allgemeinheit wird; 2. Bestimmung der Nationalität der Luftfahrzeuge. Hier soll die Frage entschieden werden, auf welcher Basis die Nationalitätszugehörigkeit bestimmt werden soll: Soll es der Standort des Flugzeugs, die Nationalität des Fliegers bezw. Luftschiffers oder diejenige des Konstrukteurs des Luftfahrzeugs sein? :!. Reglementierung des Luftverkehrs in zollfiskalischer Beziehung. Das evt. Recht der eingehenden Besichtigung und Durchsuchung des Fahrzeugs, Bestimmungen über das Recht der Einsichtnahme des Bordbuchs u. s. w. 4. Fragen der nationalen Verteidigung. Hier soll die schwierigste Materie einer präzisen Regelung zugeführt werden Flüge oberhalb oder in unmittelbarer Nähe von Festungen und befestigten Anlagen; genaue Definition des Begriffs „Spionage", des Begriffs „force majeure"; Verhaltungsmaßregeln im Falle eines Vorkommnisses wie das der neulichen Zeppelinlandung. 5. Reglementierung des Luftverkehrs im Hinblick auf die Öffentliche Sicherheit. Allgemeine Polizeivorschriften für die Luft, Begegnungen von Fahrzeugen in der Luft, Signale u. s. w. Schon aus dieser kurzen Ausführung der wesentlichsten Punkte, deren endgiltige Regelung das französische Ministerium angeordnet hat, erkennt man, wie außerordentlich kompliziert die Materie ist, doch wird man sich anscheinend in vielen Punkten an die bestehenden Vorschriften der Seeschiffahrt anzulehnen suchen. Rl. No. 370. von Arnim, Hans Gotthard, Johannisthal, geb. zu Potsdam am 8. Mai 1884, für Eindecker (Fokker), Flugplatz Johannisthal, am 28. März 1913. No. 371. von Skrbensky, Egon., Oberleutnant z. S., Wilhelmshaven, geb. zu Groß-Bresa, Kr. Neumarkt, am 7. Dezember 1883, für Zweidecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 29. März 1913. No. 372. Schröter, Bruno Erich, Johannisthal, geb. zu Dresden am 2S. März 1894, für Eindecker (Harlan), Flugplatz Johannisthal, am 31. März 1913. No. 373. Hans, Georg, Johannisthal, geb. zu Leipzig am 21. November 1884, für Zweidecker (L. V. G.), Flugplatz Johannisthal, am 31. März 1913. No. 374. Kießling, Wilhelm, Chefmonteur der Ago-Flugzeugwerke, Niederschöneweide, geb. zu Berlin am 21. September 1882, für Zweidecker (Ago), Flugplatz Johannisthal, am 1. April 1913. Flugtechnische  Rundschau. Inland. Fluyfilhrer-Zeuyni&se haben erhalten: Von den Flugplätzen. Vom Goedecker-Flugplatz. Am 6. er. absolvierte der Goedecker-Flieger Reinhard Schroeder auf einem 100 PS Mercedes-Goedecker-Eindecker einen Stundenflug für die Nationalflugspende. Als Gast flog Ltn. a. D. Kuhlmann aus Darmstadt mit. Die genaue Flugzeit betrug 1 Stunde 4 Min. Schroeder stellte bereits über Biebrich den Motor ab und landete im Gleitflug aus ca 700 m Höhe Danach flog der Goedecker-Flieger Traut wein ebenfalls mit einer 100 PS Mercedes-Goedeckermaschine und Ltn. a. D. Kuhlmann als Fluggast nach Darmstadt. Die Fahrt dorthin betrug etwa 19 Minuten. Trautwein landete aus 800 m Höhe mit vollständig abgestelltem Motor im Curvengleitflug auf dem Exerzierplatz am neuen Bahnhof in Darmstadt. Nach kurzer Rast startete Trautwein zum RUckflug mit Wilhelm Kölsch aus Mainz als Gast und landete nach k0 Minuten Flugdauer glatt auf dem großen Sand. Am Donnerstag den 10. er. startete Trautwein zu einem Ueberlandflug mit Ltn. a. D. Kuhlmann und berührte dabei Worms und Bensheim. Nach 1 Stunde 1 Min. Flugdauer landete er in Darmstadt auf dem Griesheimer Exerzierplatz. Einen Rückflug nach dem großen Sand wiederholte Trautwein abermals u. z. mit Oberleutnant von der Haagen von der Militär-Fliegerstation Darmstadt. Auf dem Flugplatz Habsheim. Infolge der nach Habsheim kommandierten Unteroffiziere herrscht reger Flugbetrieb. Es bestanden ihre Flugzeugführer-Prüfung die Unteroffiziere Heppe, Zottmann und L i s k e. Oberlt. Linke und Flieger I ngwer brachten mehrere Aviatik-Rumpf-Doppeldecker auf dem Luftwege nach der Fliegerstation Straßburg zur Ablieferung. Ing. Schlegel, der für den Prinz Heinrich-Flug gemeldet hat, trainiert auf seinem Renn-Eindecker. Auf dem Flugplatz Jjeipzig-Lindenthal hat Oberlt. Steffen die Feldpilotenprüfung bestanden. Er stieg auf seinem Mars-Doppeldecker auf 1500 m Höhe und landete nach I Stunde 4 Min. Vom Flugplatz Puchheim. Am 20. April führte der Flieger Schöner auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS A G. O.-Motor einen Ueberlandflug mit Passagier aus. Er nahm die Richtung Augsburg, beschrieb bei Mehring eine Kurve und kehrte wieder über Pasing, Lochhausen zurück- Nach beinahe 1 stündiger Fahrt landete der Flieger aus 500 m Höhe in tadellosem Gleitfluge glatt auf dem Flugfeld. Auch Lindpaintner unternahm mehrere Passagierflüge in die nähere Umgebung des Flugplatzes, von denen sich einer bis Schleißheim erstreckte. Gleichzeitig absolvierte auch Janisch einige kleinere Flüge. Flugfeld Teltow von welchem in letzter Zeit wenig gemeldet werden konnte, ist jetzt einer umfassenden Neugestaltung unterzogen worden, um diesen, gerade für das Einfliegen neuer Konstruktionen vorzüglich geeigneten Flugplatz wieder zu einer Stätte ernster Arbeit auszubauen. Außer dem Wright-Apparat, den Stagge fast täglich fliegt, wird jetzt u. a. der neue Pfeilflieger der Union-Flugzeugwerke vonS abl a t n i g herausgebracht. Bemerkenswert ist auch die jetzt weiter ausgebaute Versuchsanlage der Stndiengesellschaft für Aviatik, deren neue Startmaschine sich nahezu vollendet auf dem Platze erhebt, und die ihre Versuche in Kurzem wieder beginnen wird. Außerdem wird das Flugfeld für seine Mieter und Fluggäste einen Kon-vers.itioiisraum mit Fachbibliothek erhalten, Einrichtung für photographische Aufnahmen und Dunkelkammer etc. Zur Durchführung des gesamten Organisationsplanes ist das Flugfeld einer neuen Verwaltung unterstellt worden. Als Direktor desselben wurde Oberingenieur Schräder gewählt. /Wllitärische Flüge. Die Fliegeroffiziere der bayr. Fliegerkompagnie führten in den letzten Tagen mehrere größere Ueberlandflüge aus und zwar flog Lt. Freiherr von Haller mit Lt. von Könitz als Beobachter auf einem Otto-Doppeldecker nach Nürnberg. Die Offiziere waren um 6 Uhr in München aufgestiegen und trafen um %8 Uhr wohlbehalten auf dem Flugplatz Hainberg bei Nürnberg ein. Am 23. April flog Lt. Emmerich vom 4. Inf.-Regt. auf einem Militär-Otto-Doppeldecker in 88 Min. über Ingolstadt nach Regensburg. Nach kurzem Aufenthalte erfolgte die Rückfahrt über Landshut nach München, wo die Offiziere um 9 : 45 glatt landeten. An dem Fluge, dessen reine Flugzeit 2'/j Stunden betrug, nahm als Beobachtungs Offizier Lt. Kögler vom 22. Inf.-Regt. teil. Am 24. April flogen Oberleutnant Hailer mit Oberleutnant Leonhard und Lt. Vierling mit Lt. von König als Beobachter auf ihren Otto-Doppeldeckern nach Nürnberg. Während Lt. Vierling wieder nach München zurückflog, setzte Oberlt. Hailer seinen Flug nach Stuttgart fort und landete abends 6 : 45 nach einer Flugzeit von 1'/. Stunden glatt auf dem Cannstatter Wasen. Am Freitag morgens um 5 Uhr flogen die Offiziere wieder ab, nachdem sie am Donnerstag noch verschiedene prächtige Fluge in der Umgebung Stuttgarts unternommen hatten Die Flieger nahmen den Kurs über Ulm nach München und landeten nach glänzend verlaufener Fahrt um 7 : 30 auf dem Militärflugplatz in Oberschleißheim. Flug von Darmstadt nach Arracourt (Frankreich). Dieser Flug (am 22. April,1, der in den Tageszeitungen zur Genüge behandelt worden ist, sei hier nur der Vollständigkeit wegen registriert. Der Führer dieses Euler-Doppeldeckers war Leutnant von Mirbach mit Hauptmann von Dewall als Beobachter. Die Flieger machten über den Vorfall folgende Angaben: „Heute früh 5 Uhr 30 Min. fuhren wir von Darmstadt ab, um über Zweibrücken nach Metz zu fliegen. In 2 Stunden 43 Minuten legten wir die 270 Kilometer lange Strecke von Darmstadt nach Arracourt zurück. Ueber Saarbrücken wurde die Orientierung bereits erschwert durch den Hüttenrauch und den Dunst von der Saar; dann legten sich Nebelschwaden zwischen Fahrzeug und Erde, sodaß wir schließlich die Orientierung gänzlich verloren. Als wir wieder das Land erkennen konnten, bemerkten wir, daß wir auf französischem Gebiet waren. Wir versuchten nun, so schnell als möglich das deutsche Gebiet wieder zu erreichen. Ein kleines Flüßchen unter uns hielten wir für die Grenze. Als wir nun nach vieler Mühe — denn das Benzin war uns ausgegangen — jenseits des Flüßchens gelandet waren, erfuhren wir von einer Frau, daß wir noch in Frankreich waren. Sofort stellten sich Beamte ein und bald erschien auch Militär, darunter die berühmten 18. Chasseurs ä cheval, die schon in Luneville zugegen waren. Diese sperrten uns von der Bevölkerung ab. Wir durften den Platz nicht verlassen, worauf wir allerdings schon im eigensten Interesse verzichteten. Wir telegraphierten sofort nach Paris an die deutsche Botschaft und nach Metz an die Fliegerstation. Von Paris erhielten wir bald die Antwort, daß der Fall jedenfalls in Güte beigelegt werden würde. Dieselbe Antwort erhielt auch der Unterpräfekt von Luneville, Monsieur La Combe. Kurz vor der Abfahrt teilte der Unterpräfekt die Erlaubnis zur Abreise in amtlichem Tone mit, worauf Hauptmann von Dewall in französischer Sprache er- klärte: „Herr Unterpräfekt, ich spreche Ihnen unseren Dank aus für die Liebenswürdigkeit und Energie, mit der Sie den Fall erledigt haben." Bei der Abreise verhielten sich die zahlreich versammelten Zuschauer ziemlich ruhig. Bemerkenswert ist, daß die französischen Offiziere glaubten, daß die Sicherungsringe an den Drähten des Apparates für drahtlose Telegraphie bestimmt seien. Eine Militärkommission hat uns untersucht, der Apparat wurde von französischen Fliegeroffizieren photographiert, visiert und ausgemessen, auch viele französische Journalisten photographierten den Apparat. Wir mußten unsere Karten und Papiere abgeben, erhielten sie aber wieder zurück, als wir die Erlaubnis zur Abreise bekommen hatten, auch durften wir erst dann Benzin einfüllen. Für die Flurschäden mußten wir 70 Francs bezahlen." Um 5 Uhr nachmittags kam vom französischen Ministerium die Genehmigung für den Rückflug nach Metz, welches sie nach kurzer Zeit erreichten. Eine Nachtübung, an welcher 40 Flugzeuge teilnahmen, fand am 23 April von der Fliegerstation in Metz aus statt. Von 6 Uhr 30 Minuten abends ab wurde de ganze Flotille, bestehend aus 40 Flugmaschinen, vor die Hallen gefahren 30 Maschinen blieben in der Reserve stehen, während zehn Apparate 7:30 mit besonderen Aufträgen abflogen. Sie wurden von Scheinwerfern verfolgt. Eine neue Art der Abgabe von Meldungen wurde ausprobiert. Die Landungen erfolgten sämtlich ohne Unfall. Anläßlich der Anwesenheit des Kaisers auf der Burg Hohkönlgsburg am 26. April erschienen gegen 5 Uhr, von Straßburg kommend, nacheinander acht Militär-Flugzeuge, drei Tauben und fünf Doppeldecker, über der Hohkönigs-burg, die sie in prachtvollen Flügen mehrfach umkreisten, und eine Reihe von wohlgelungenen Manövern ausführten. Gegen 61/, Uhr nahmen die Maschinen, nachdem sie über der Stadt Schlettstadt gekreuzt hatten, wieder die Richtung gegen Straßburg, wo sie, sämtlich ohne jeden Unfall, glatt landeten. Der Jeannin-Stahleindecker. Bereits in No. 2 dieser Zeitschrift haben wir auf Seite 45— 47 den Jeannin-Eindecker ausführlich beschrieben. Jeanniu hat bei seinem Apparat als Konstruktionsmaterial Holz nach Möglichkeit ausgeschaltet und an dessen Stelle Stahl verwendet. Bei dem neuesten Typ ist die 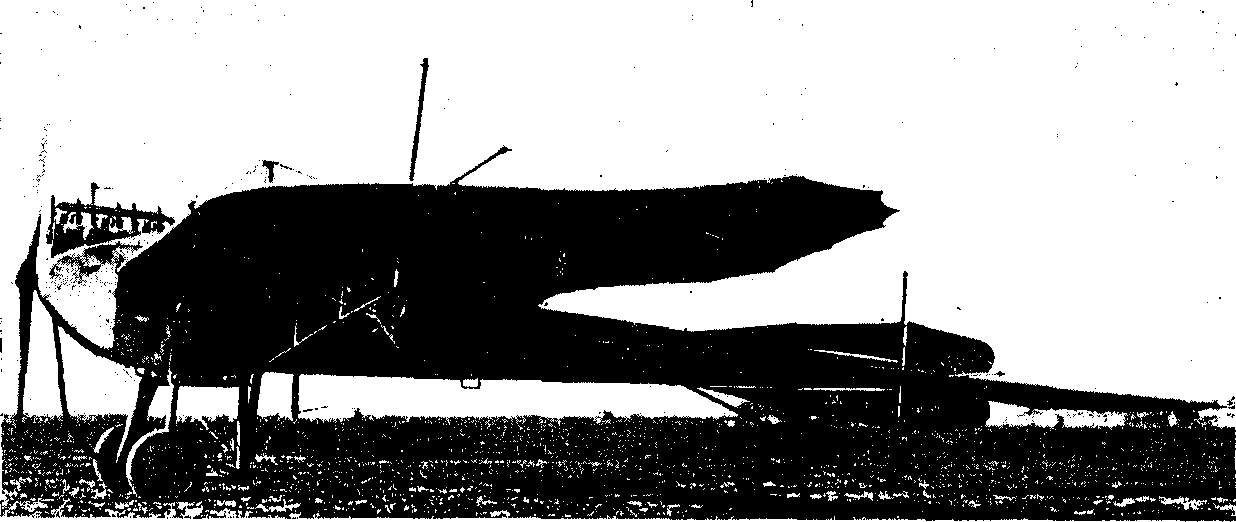 Jeannin-Stahltaube, Militärtyp, Seitenansicht- No. 9 „FLUGSPORT." Kufe etwas verkürzt. Am hinteren Ende der Kufe befindet sich ein Bremssporn, der vom Führersitz aus betätigt werden kann. Die sehr kräftig gehaltene Abfederung des Fahrgestells besteht aus je zwei Spiraldruckfedern, die Stöße bei 21 cm Federweg aufnehmen. Damit das Einsinken der Räder bei weichem Boden 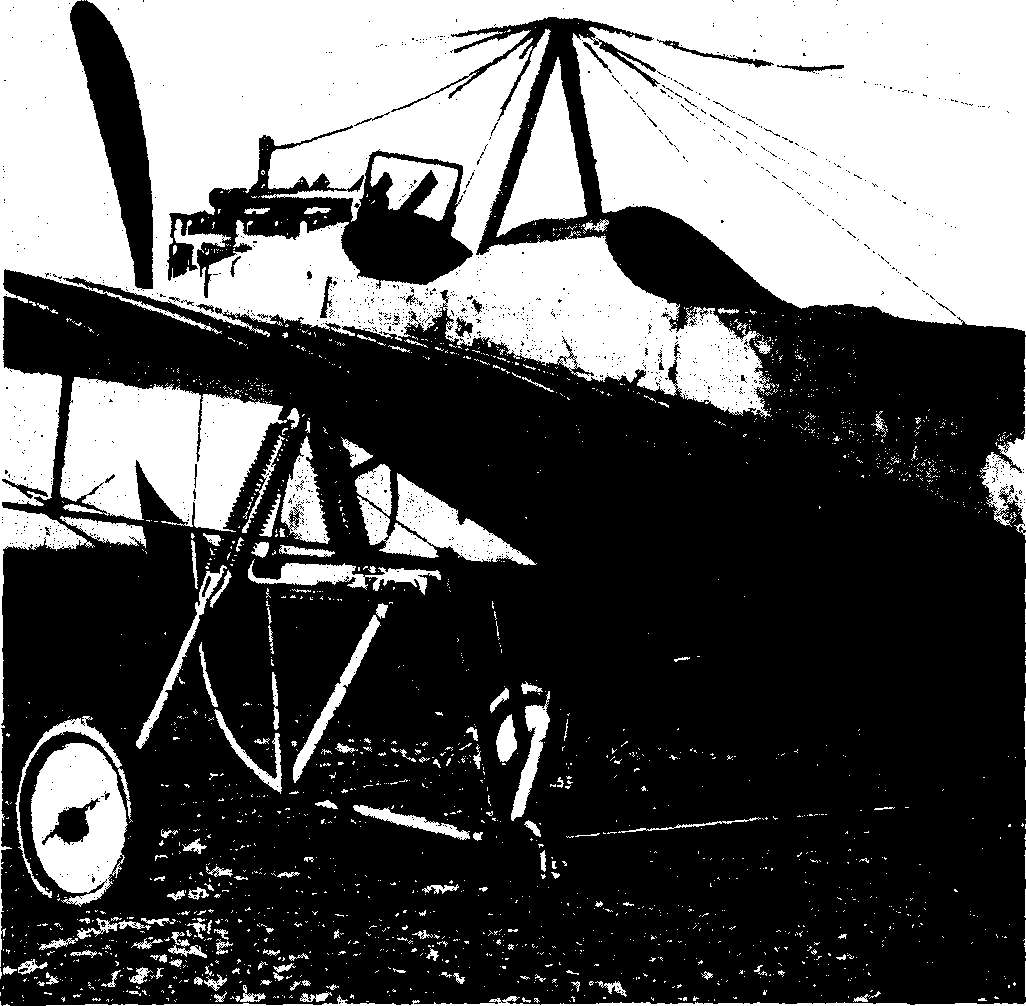 Jeannin-Stahltaube, Militärtyp. Ansicht auf das Fahrgestell vermieden wird, sind bei den Militärmaschinen die Felben paarweise aneinander geschweißt und mit doppelten Pneumatiks versehen. Die sehr kräftig gehaltene durchlaufende mittlere Kufe setzt bei Radbrüchen auf und vermindert evtl. weiteren Bruch des Fahrgestells. Die Anordnung der Motorenanlage, Führer- und Fluggastsitze ist sehr gedrungen durchgeführt. Zum Betriebe dient ein 150 PS 6 Zyl. Stoewer-Motor. Zum Schutze des Fluggastes ist eine durchsichtige Schutzscheibe angeordnet. Die neuen Militärbedingungen erfüllte der Apparat durchschnittlich mit 70 m Anlauf. Die Steigfähigkeit betrug 800 m in 13 Min. und 1000 m in 18 Min., der Auslauf 60 m. In demontiertem Zustand beträgt die Gesamtlänge der Maschine 7 m. Der Grade-Flugzeugführer Carl Abelmann, Inhaber der Casseler Fliegerschule Cassel-Waldau, erflog mit mit seinem 16/24 PS Flugzeug am 16. April durch einen Dauerflug von 2 Stunden 2 Min. die Zweistundenprämie aus der Nationalf lugspende. Seinen 2000. Flug führte vor einigen Tagen der bekannte Flieger Willy Rosenstein auf dem Fluglatz Fuhlsbüttel bei Hamburg aus. Rosenstein ist bekanntlich in die Dienste der Gothaer Waggon-Fabrik getreten und leitet die Fliegerschule dieser Firma in Hamburg, wo er den bemerkenswerten Flug auf einer Hansa-Taube ausführte. Ausland. Zweidecker Ponnier, der zur Zeit in Frankreich versucht wird, ist vollständig aus Stahl hergestellt. Das Fahrgestell ähnelt dem des Euler-Zweideckers. 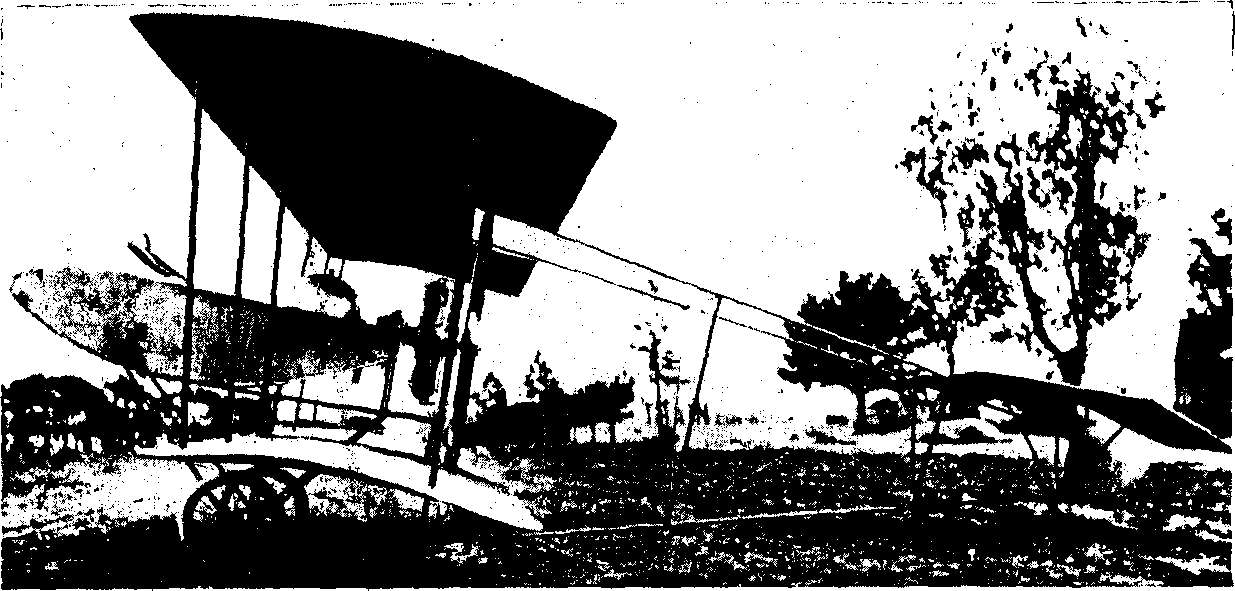 Zweidecker Ponnier. Seitenansicht. Der Schwanz wird von 3 Längsträgern, die dreieckförmig verbunden sind, getragen. Der Zweidecker besitzt bei 9 m Spannweite 32 qm Tragfläche Die Gesamtlänge beträgt 8 m. Zum Betriebe dient ein 80 PS. Gnom-Motor. Flüge um den Pommery-Pokal. Audemars auf Morane-Saulnier Eindecker mit 50 PS. Gnom-Motor startete am 16. April vormittags 6 : 20 in Villacoublay. Bis Köln hatte er tadelloses Wetter ohne Böen.; Die Strecke Paris— Yiezieres, 225 km, legte er \n 1 Std. 35 Min. zurück. Von Mezieres nach Wanne, wo er um 10 : 57 eintraf, benötigte er 2 Std. Infolge des böigen Wetters gab Audemars in Wanne den Flug auf. Daucourt auf Borel-Eindecker mit 50 PS Gnom-Motor startete früh 5 : 6 auf dem Flugfeld Buc bei Paris und erreichte Lüttich um 1 : 5, landete auf dem großen Bult in Hannover und flog 3 : 38 nach Berlin weiter, wo er 6 : 39 landete. Abzüglich der Zeit für die Zwischenlandungen durchflog Daucourt die 975 km lange Strecke Buc-Lüttich-Hannover—Johannistal in ca. 9 Stunden. Der englische Flieger Harne] flog am 17. April von Dover nach Köln. Er stieg mittags 12 : 37 (engl. Zeit) in Dover auf, überflog den Kanal, Belgien und landete 6 : 36 auf dem Kölner Flugplatz. Wettbewerbe. Folgende Aussehreibungen sind soeben erschienen: Bodensee-Wasserflug 1913, vom 29. Juni bis 5. Juli, Geschäftsstelle : Frankfurt a. M„ Bahnhofsplatz S. Die Ausschreibung ist in dieser Nummer veröffentlicht. Frühjahrsflugwoche Johannisthal, vom 25. Mai bis 1. Juni. Geschäftsstelle: Flug- und Sport-Platz Berlin-Johannisthal G. m. b. H., Berlin, Potsdamer-str. 112. Nenngeld für einen Flieger 150 Mk., für jeden weiteren Flieger 50 Mk Nennungsschluß 15. Mai. Nachnennung nicht gestattet. An dem Prinz Heinrich-Flug werden außer den genannten Militärflugmasehinen folgende Zivilflugmaschinen teilnehmen: 1. Doppeldecker der Deutschen Flugzeugwerke : Flieger unbestimmt. 2. Doppeldecker der Deutschen Flugzeugwerke: Flieger Lt. Zwickau. 3. Militäreindecker der Automobil- und Aviatik, Mülhausen: Flieger Schlegel. 4. Aviatik-Pfeil-Doppeldecker: Flieger Oberlt. Linke. 5. Albatros-Doppeldecker: Flieger Ing. Thelen. 6. Albatros-Eindecker: Flieger Hirth. 7. Gothaer Waggonfabrik-Doppeldecker: Flieger Lt. a. D. Krüge r. 8. Gothaer Waggonfabrik-Doppeidecker: Flieger Lt. Joly. 9. Goedecker-Eindecker: Flieger Treutwein. Außer Konkurrenz wird voraussichtlich Grade teilnehmen. Kieler Woche 1913, vom 10.-15. Juli. Geschäftsstelle: Hauptmann Goetze, Kiel, Neumarkt 5. Nennungsschluß 25. Juli. Nenngeld 200 M; Nachnennungen bis 2. Juli, Nenngeld 300 M. An Preisen sind vorhanden : für einen Dauerwettbewerb 20000 Mark, Höhenpreis 3000 Mark, Erkundungswettbewerb 9000 Mark, Wurfwettbewerb 5000 M. Dieser vom Reichsmarineamt gestiftete Preis wird verteilt im Verhältnis zur Trefferzahl unter diejenigen Bewerber, die aus einer Höhe von mindestens 500 m ein in der Kieler Föhrde verankertes Fahrzeug von mindestens 37 m Länge und 8 m größter Breite treffen. Ueber Ort der Verankerung und Größe des Fährzeugs erhält der Flieger vor dem Wettbewerb Auskunft. Der Wettbewerb wird nur an einem von der Sportleitung zu bestimmenden Tage ausgeflogen. Jedem Bewerber sind 5 Würfe gestattet. Das Gewicht der selbstzubeschaffenden Wurfgeschosse hat mindestens 5 kg zu betragen. Ferner für ein Belastungswettbewerb 4000 Mk., Start- und Landungswettbewerb 2000 Mk. und Herausforderungspreis 800 Mk. 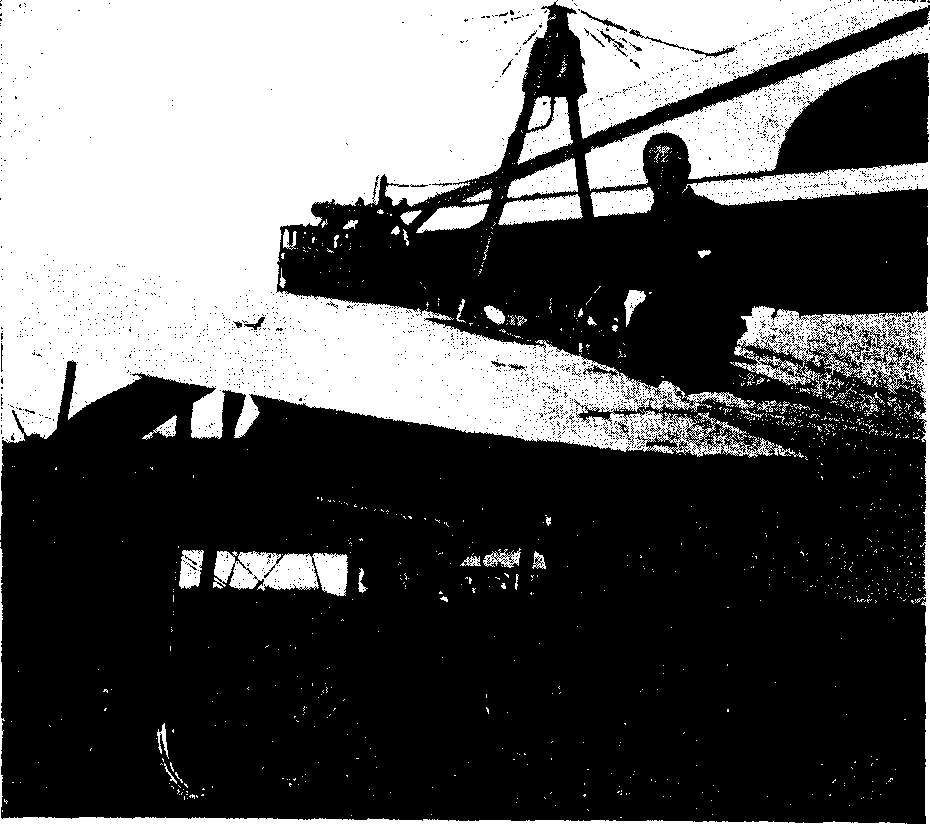 Willi Rpsensteln, der seinen 2000sten Fing ausführte. (Seite 228.) Seite 33l „Flugsport:." No. 9 Ausschreibung für den Bodensee-Wasserflug vom 29. Juni bis 5. Juli 1913. § l. Die Südwestgruppe des Deutschen Luf'tfaruer-Verbandes veranstaltet unter dem Protektorat Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Baden in der Zeit vom 29. Juni bis 5. Juli 1913 einen Wasserflug-Wettbewerb bei Konstanz am ßodensee. 8 2. Art der Veranstaltung. Der Wettbewerb zerfällt in: I. „Großer Preis vom Bodensee", Flug über eine Strecke von ca. 200 km. II Weitere Wettbewerbe. A. Steigfähigkeitsprüfung auf 500 m. B. Flug über 100 km für Sportflugzeuge bis zu 75 PS. C. Konstruktionspreis. III. Prämien. A. Prämien für die Befähigungsnachweise. B. Mechanikerprämien. §.3. Der Wettbewerb führt den Namen „Bodensee-Wasserflut 1913" und findet nach den internationalen Bestimmungen der Föderation Aeronautique Internationale und nach den nationalen Bestimmungen des Deutschen Luftfahrer-Verbandes statt. § Beteiligung. Zur Teilnahme an den Wettbewerben berechtigt sind Flugzeuge, die, abgesehen vom Motor, in ihren Hauptteilen wie Fahrgestell, Flügel, Steuer, Schwimmer und Rumpf in Deutschland hergestellt sind. Wettbewerber ist der Flugzeugbesitzer. Die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt. Sollten insgesamt weniger als 8 ordnungsmäßige Anmeldungen eingehen, so entscheidet der Arbeitsausschuß innerhalb einer Woche nach Nennungsschluß, ob der Flug stattfindet. Der Wettbewerb ist offen für Flieger, welche deutsche Eeichs-angehörigkeit besitzen und für Ausländer, die vor dem 1. April 1913 in Deutschland ansässig waren und im Dienste einer deutschen Flugzeugfirma stehen, wenn sie bei vorkommendem Proteste auf Berufung an die F. A. I. verzichten. § 5. Nennung. Ein Flugzeugbesitzer kann eine beliebige Anzahl von Flugzeugen anmelden. Die Art und Zahl der Flugzeuge, nach Möglichkeit auch der Namen des Fliegers, sind in dem offiziellen Anmeldeformular einzutragen. Für jeden Flieger kann ein Vertreter namhaft gemacht werden. Die Namen der Flieger und ihrer Vertreter müssen bis spätestens 21. Juni angegeben sein. Zur Meldung ist das anliegende offizielle Anmeldeformular gemäß der Flugbestimmungen tj 26 a und c mittels eingeschriebenen Briefes oder telegraphisch unter gleichzeitiger schriftlicher Bestätigung mit eingeschriebenem Brief an die Geschäftsstelle mit der Adresse: Bodensee-Wasserflug, Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8, zu richten. Das Nenngeld für jeden Apparat, der bis zum 2. Juni angemeldet wird, beträgt M 500, späterhin M 1000. Nach Abnahme eines Flugzeuges wird das Nenngeld bis zu M 500.— zurückgezahlt. Die Anmeldung hat erst Gültigkeit, wenn das Nenngeld eingetroffen ist. Nennungsschluß ist am 15. Juni, abends 6 Uhr. § 6. Leistungen, Preise und Prämien. I. Großer Preis vom Bodensee 40000 M und Ehrenpreis des Staatssekretärs des Reichsmarineamts. Flug über eine Strecke von ca. 200 km. Der Abflug erfolgt vom Land aus. Der Flug führt zweimal um den Bodensee. Der genaue Flugweg wird von der sportlichen Leitung am Tage vor Beginn des Wettbewerbes bekannt gegeben. In der ersten Runde ist in einem bestimmten, durch Bojen bezeichneten Viereck von ca. 500 m Seitenlänge zu wassern, der Propeller zum Stillstand zu bringen und innerhalb des Bojenvierecks wieder aufzusteigen. Danach ist der Flug zu beendigen und im Bojenviereck bei Konstanz zu wassern. Der Aufenthalt in der Zwischenwasserungsstelle wird in die gebrauchte Zeit eingerechnet. Fremde Hilfe darf hierbei in keiner Weise in Anspruch genommen werden Aufnahme von Betriebsstoffen während des Fluges ist verboten. Während des Fluges muß einmal eine Höhe von 500 m erreicht werden. Gewertet wird die kürzeste Zeit, in welcher die vorgeschriebene Bahn mit der vorgeschriebenen Zwischenwasserung einschließlich aller Zwischenlandungen und Wasserungen zurückgelegt wird. Die Mitnahme eines Fluggastes ist erforderlich. Das Fliegerund Fluggastgewicht wird durch Ballast auf 180 kg ergänzt. Der Start kann beliebig wiederholt werden. Nach Vollendung des Fluges ist eine einmalige Wiederholung zulässig. Es gilt der bessere Flug. Ein Flug wird nicht bewertet, wenn das Flugzeug nach Beendigung des Fluges kein aufstiegfähiges Fahrgestell oder Schwimmer mehr besitzt. Um diesen Flug können nur Flugzeuge und Flieger starten, welche die vier Befähigungsnachweise IIIA während der Veranstaltung bereits erbracht haben. I. Preis M 25 000.— davon 18 000 M von der Nationäl-Flugspende 7 000 M von der Südwestgruppe des Deutschen Luft-fahrer - Verbandes. II. Preis „ 10 000— III. Preis „ 5 000.— Offen vom zweiten Flugtage bis zum Schluß der Veranstaltung. Für diejenigen Flieger, welche bei mehr als 7 m Wind geflogen sind, steht ein Ehrenpreis des Staatssekretärs des Reichsmarineamts zur Verfügung, der in der Reihenfolge ihrer Leistungen bei dem Finge um den Großen Preis vom Bodensee zuerkannt wird. Dieser Preis wird nur dann zuerkannt, wenn mindestens 5 Flugzeuge während der Bodensee-Veranstaltung geflogen haben. II. Weitere Wettbewerbe. Steigfähigkeitsprüfung auf 500 m. Das Flugzeug hat mit Fluggast, ergänzt auf 180 kg, vom Wasser oder vom Land abzufliegen, auf 500 m zu steigen, in einem bestimmten durch Bojen bezeichneten Viereck zu wassern. Die beste Leistung ist diejenige, bei welcher die Höhe von 500 m in kürzester Zeit erreicht wurde. Die Messung erfolgt nach Anweisung der Oberleitung durch Barograph. Wiederholung ist zulässig. Bester Flug gilt, I. Preis M 3000 II. Preis „ 2000 Offen vom 1. bis 4. Juli einschließlich. B. Flug über ca. 100 km. Geldpreise für Sportflugzeuge bis zu 75 PS und Ehrenpreis des Kaiserl. Automobil-Clubs. Zugelassen sind Flugzeuge, deren Motor höchstens 75 PS hat. Die Motorstärke wird aus den Hubvolumen der Motorzylinder berechnet. Bezeichnet V das Hubvolumnen in Litern (ebdem) so wird als PS — Zahl angesehen: I. Für den Viertakt-Motor mit ruhenden Zylindern und mit Wasserkühlung.........10 V II. Für den Viertakt-Motor mit umlaufenden Zylindern ohne Wasserkühlung..........6,5 V III. Für den Zweitakt-Motor mit ruhenden Zylindern ohne Wasserkühlung...........10,5 V Wird ein Motor, der keiner dieser drei Kategorien angehört, gemeldet, so stellt der Arbeits-Ausschuß vor Annahme der Nennung im Einvernehmen mit dem Wettbewerber die entsprechende Formel fest. Der Flieger fliegt aus dem Bojenviereck am Strande oder vom Lande ab und hat eine durch Bojen markierte Ziellinie zu überfliegen, hinter der Ziellinie zu wassern, wobei der Motor weiterlaufen kann, auf dem Wasser zu wenden und über die Ziellinie wieder zur Wasser- oder Landabflugstelle zurückzukehren. Bleibt während der Wasserung der Motor stehen, so darf für seine Inbetriebsetzung keine fremde Hilfe benutzt werden. Der Flug kann beliebig wiederholt werden. Der beste Flug gilt. Gewertet wird die kürzeste Flugzeit. Der Aufenthalt auf dem Wasser wird in die Flugzeit eingerechnet. I. Preis M 5000 und Ehrenpreis II. Preis „ 3 000 Offen vom 29. Juni bis 4. Juli einschließlich. C. Konstruktionspreis. Der Wettbewerb ist nur offen für Flugzeuge, welche die Befähigungsnachweise IIIA b bis d erbracht und während der Veranstaltung einen Passagierflng von mindestens 5 Minuten ausgeführt hauen. Es wird gewertet: 1) Verkürzung der Tragflächen vom Führer sitz aus...........0- -25 Punkte 2) Hochziehbares Fahrgestell.....0—20 ,, 3) Schwimmerkor.struktion ... . . 0—20 ,, 4) An der Maschine befindlicheHiß-,Bergungs- und Rettungsvorrichtung.....0—15 „ 5) Anwerfvorrichtung ........ 0—15 „ 6) Schutz des Motors sowie seiner Einzelteile gegen Spritzwasser.......0—15 7) Schutz des Propellers gegen "Wasser . 0—10 8) Einbau und Zugänglichkeit des Motors . 0—10 , 9) Verankerungsvorrichtung......0—1U ,, 10) Sitzanordnung, welche einschnelles Ver- lassen der Maschine gewährleistet . . 0—10 „ 11) Einrichtung, welche eine seitliche Stabilität gewährleistet und ein Eintauchen der Flügelenden beim Liegen auf dem Wasser vermeidet...........0—10 ,, 12) Art und Weise, wie die einzelnen Teile der Maschine gegen Seewasser unempfindlich gemacht sind......0—10 „ 13) Leichte Demontierbarkeit der über dem Mittelteil vor stehenden Tragflächen . 0—10 ,, 14) Gutes Gesichtsfeld in vertikaler Richtung nach unten..........0— 5 15) Einbau von Hilfs-u. Kontrollinstrumenten 0— 5 „ Sieger ist das Flugzeug, das die größte Gesamtzahl der Punkte aller Mitglieder der Bewertungskommission auf sich vereinigt. Die Bewertungskommission besteht aus den Mitgliedern der Abnahmekommission, von der jedes einzelne Mitglied für sich die Konstruktionsteile beurteilt und mit Punkten bewertet. Etwa erforderliche Prüfungen werden am Schluß der Veranstaltung vorgenommen. I. Preis M 5000 II. Preis „ 3000 III. Preis „ 2000. D. Ehrenpreise. Für besondere Leistungen sind Ehrenpreise ausgesetzt, über deren Zuerkennung das Preisgericht entscheidet. III. Prämien. A. Prämien für die Befähigungsnachweise. Jedes Flugzeug kann einmal folgende Prämien gewinnen: a) Für einen Abflug vom Lande . . M 20Ü b) Für ein Niedergehen auf dem Wasser ,, 200 c) Für einen Wasserabflug, nachdem der Propeller stillgestellt war . . „ 300 d) Für einen Höhenflug auf mindestens 200 m Höhe........, 300 Diese Prämien werden nicht ausgegeben für Flüge um die Preise I, IIA und IIB. B. Mechanikerprämien. Die Mechaniker der siegenden Maschine in I, II A, II ß erhalten eine Prämie von M 500, die an den Besitzer der Maschine auszuzahlen ist. § 7. Ankauf von Flugzeugen. Das Reichsmarineamt behält sich vor, zwei Flugzeuge eines Typs der beim Wettbewerb beteiligt gewesenen Maschinen zu kaufen, falls sie an der See den Bedingungen für Marineflugzeugen entsprechen. Die Prüfung, eine nicht öffentliche, erfolgt in Putzig durch die Marinekommission. Die Transportkosten werden, wenn ein Ankauf stattfindet, vom Reichsmarineamt getragen und vor dem Transport nach Putzig vereinbart. § 8. Flugzeiten. Die Wettbewerbe und die Befähigungsnachweise können von morgens 4 bis 11 Uhr und von nachmittags 3 bis abends 9 Uhr bestritten werden. Die Veranstalter (Oberleitung) behalten sich vor, die Flugzeit zu verändern, die einzelnen Wettbewerbe auf bestimmte Tage zu beschränken und Ruhetage einzulegen. Die diesbezüglichen Entschließungen der Oberleitung werden abends zuvor bis 7 Uhr bekannt gegeben. § 9. Anlieferung, Unterbringung und Abnahme der Flugzeuge. Die Flugzeuge können vom 26. Juni ab in den von den Veranstaltern kostenlos gestellten Zelten untergebracht werden. Die Abnahme erfolgt am 28. Juni vormittags von 11 Uhr ab, wobei der Wettbewerber oder dessen Vertreter zugegen sein muß. Ueber die etwaige Abnahme später eintreffender Flugzeuge entscheidet die Oberleitung. Die Flugzeuge werden in ihren wichtigsten Teilen nach Ermessen der Abnahmekommission plombiert, gestempelt und während der Konkurrenz nachgeprüft. Nach der Abnahme dürfen keinerlei Konstruktionsänderungen mehr vorgenommen werden. Auswechselung der Motore und einzelner Teile mit Ausnahme des Rumpfes sind nach vorheriger Anzeige an die Sportleitung gestattet. Zum Auswechseln bestimmte Fahrgestelle und Schwimmer müssen schon bei der Abnahme vorgestellt und abgestempelt werden. Jedes abgenommene Flugzeug erhält eine Startnummer. Die Oberleitung behält sich vor, Flugzeuge, die nach Ansicht der Abnahmekommission nicht den Anforderungen für Sicherheit der Flieger, der Fluggäste und des Publikums entsprechen, unter Rückzahlung des Nenngeldes zurückzuweisen. Die Flugzelte werden des Nachts bewacht, jedoch wird von den Veranstaltern jede Haftung abgelehnt. Den An- und Abtransport der Flugzeuge haben die Meldenden mit eigenen Mitteln und auf eigene Kosten zu besorgen. Die Veranstalter sind bemüht, für die Eisenbahnfracht besondere Vergünstigungen zu erlangen. § 10. Start und Kontrolle. Der Start erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Bei gleichzeitiger Anmeldung oder auch im Zweifelfalle wird die Reihenfolge des Startes durch das Los bestimmt. Die Starterlaubnis gilt nur für 5 Minuten. Danach ist Neuanmeldung erforderlich. Als Beginn des Fluges vom Lande aus gilt das Zeichen des Fliegers zum Loslassen des Flugzeuges. Als Beginn des Fluges vom Wasser gilt das erste Anspringen des Propellers. Als Landung gilt der Augenblick, in dem das Flugzeug inner» halb des abgesperrten Landungsplatzes den- Boden berührt, als Wasserung- derjenige Augenblick, in dem das Flugzeug innerhalb des Bojenvierecks das Wasser berührt. Flugzeuge von Bewerbern, die an den Wettbewerben I und IIA (§ 6) teilnehmen wollen, müssen mit einem Barographen ausgestattet sein, der von der Sportleitung kontrolliert wird. Die Sportleitung behält sich vor, die Barographen auszuwechseln. Die Barographen sind nach der Landung sofort an die Sportleitung abzuliefern. Die Namen der sportlichen Leiter werden im Programm bekannt gegeben. § 11. Betriebsstoffe. Benzin und Oel bestimmter Herkunft steht den Fliegern gegen Zahlung auf dem Flugplatz zur Verfügung. Jedoch übernehmen dio Veranstalter für die Qualität des Materials keinerlei Verantwortung. § 12. Preisgericht. Ueber die Zuerteilung der Preise entscheidet ein Preisgericht gemäß § 43 der Flugbestimmungen. Obmann des Schiedsgerichts ist Seine Excellenz General der Infanterie z. D. Gaede, Freiburg i. ßr. § 13. Haftung. Die Veranstalter lehnen für sich und ihre Organe jede Haftpflicht für Schäden irgend welcher Art ab, welche den Teilnehmern, ihren Angestellten, Flugzeugen oder ihrem sonstigen Eigentum, Mitfahrern oder anderen Personen und deren Eigentum, sei es durch eigene Schuld, die Schuld Dritter oder höherer Gewalt, widerfahren und zwar sowohl während des Fluges als auch vor und nach erfolgter Landung. Vielmehr ist jeder Flieger für den von ihm angerichteten Schaden allein verantwortlich. § 14. üeber alle den Flug betreffenden Fragen, soweit sie in dieser Ausschreibung oder in den Flugbestimmungen des D. L. V. nicht berührt sein sollten, entscheiden endgültig und unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges die sportlichen Leiter bzw. das Schiedsge» rieht bzw. als höchste Instanz die Flugzeugabteilung. Auch gegen die Entscheidung des Preisgerichtes ist der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen. Die Südwestgruppe des Deutschen Luftfahrer-Verbandes Der Arbeitsausschuß für den Bodensee-Wasserflug 1913. Patentwesen. Patentanmeldungen. 77h. V. 9669 Propellerantrieb durch einen Umlaufmotor, bei dem das Gehäuse mit den Zylindern nach der einen Richtung, die allen Kolben gemeinsame Kurbelwelle nach der entgegengesetzten Richtung umlaufen. Ansbert Vorreiter, Berlin, Bülowslr. 73, u. der Erben des Georg Sehend-I, Johannisthal b. Berlin. 8, 11. 10. 77h. F. 32 059. Propeller mit stark nach hinten geneigten hinteren mittleren Saugflächen. Antoine Padoue Filippi, Paris; Vertr.: Dipl.-Ing Eugen Maier, Pat,-Anw, Nürnberg 23 3. 11. Priorität aus der Anmeldung in Frankreich vom 26. 3. 10. anerkannt. 77h. Sch 41497 Abwurfvorrichtung für Geschosse aus Luftfahrzeugen. Friedrich Wilhelm Kleine, Sebastianstr. 47, u. Ewald Schmidt, Acherstr. 7., Bonn. 17. 7. 12. 77h. H 59284. Zielvorrichiung für Bombenabwurf aus Luftfahrzeugen zur Ermittelung des Vorhaltwinkels durch Probeschuß. Otto Haude, Charlottenburg, Kurfürstenallee 41. 11. 10. 12. 77h. B 59786. Antriebsvorrichtung mit Differentialgetriebe für Flugzeugpropeller. Max Bucherer, Cöln-Lindenthal. 10. 8. 10. Patenterteilungen. 77h. 259067. Flugzeug; Zus. z. Pat 249794. Blair Atholl Aeroplane Syndicate Limited, London; Vertr.: Dipl.-Ing. H. Caminer, Pat.-Anw., Berlin SW. 68. 3 4. 10. B. 61 756. 77h. 249108. Flugzeug mit seitlich stufenförmig übereinander liegenden verstellbaren Tragflächen. Reinhold Klämbt u. Paul Schulze, Berlin, Kochstr. 19. 25. 7. 11. K. 48572. 77h. 259339. Flugzeug mit verwindbaren, durch senkrechte Stützen gelenkig verbundenen Tragflächenrahmen. Orville Wright, Dayton, V. St. A.; Vertr.: H. Springmann, Th. Stört u E. Herse, I'at.-Anwälte, Berlin SW 61. 13. 11. 08. W. 36101. Priorität aus der Anmeldung in Frankreich vom 18. 11. 07 anerkannt. 77h. '259353. Steuervorrichtung für Flugzeuge u. dgl. Halvor Gaard, Bö, Telemarken, Norwegen; Vertr : H. Springmann, Th. Stört u. E. Herse, Pat.-An-wälte, Berlin SW. 61. 14 8. 10. G. 32280. 77h. 259354. Holzpropeller mit gekrümmten Flügeln. Ralf Kornmann Berlin, Tauentzienstr. 6. 18. 7 11 K. 48534. 77h. 259 355. Flugzeug mit unter Vermittlung von Fühlflächen verstellbaren Stabilisierungsflachen. Joseph Wetterwald, Luzern, Schweiz; Vertr.: Max Theuerkoru, Zwickau i. S. 29. 10. 10 W. 35 949. 77h. 259 356. Flugzeug mit ringförmiger Tragfläche. William Swart Romme, New York; Vertr.: C. Röstel u. R. H Korn, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 11. 12. 7. 10 R. 31200. 77h. 259357. Selbsttätiges unter Federwirkung stehendes Höhensteuer für Flugzeuge. Giulio Romagnoli, Bologna; Vertr : L Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 68. 10. 9. 10. R 31 557. Gebrauchsmuster. 77h. 544 758. Holzprofilkörper für Flugzeuge mit Metallschicht. Georg König, Berlin-Südende, Brandenburgischestr. 29. 24. 2 13. K. 57 014. 77h. 546126. Drachenflieger mit übereinander angeordneten Tragflächen. Karl Bomhard, Berlin. Neue Winterfeklstr. 46. 6 6. 12 B 58 755. 77h. 546139. Flugzeuge für Militärzwecke. Wilh. Hünn, Selb. 3. 2. 13 H. 59 468. 77h. 546155. Schutzschuh für Flugzeuge, mit dem befindlichen Laufrad. Luft-Verkehrs-Gesellschaft Akt.-Ges., Johannisthal b. Berlin. 21. 2. 13. L. 31 351 77h. 546.118 Spant für Flugzeug-Tragflächen. Ago Fluggesellschaft m. b. H., Johannisthal b. Berlin. 13 2. 13. A. 20025 77h. 546 492. Ein durch ein Draht verstärkter Träger für Tragflächen von Luftfahrzeugen. Luftverkehrs-Gesellschaft Akt -Ges.Johannisthal b. Berlin. 3. 3. 12. L. 31 351. _ Bremsvorrichtung für Flugzeuge mit durch den Fahrtwind aufklappbaren Luftfangflächen.*) Den Gegenstand der Erfindung bildet eine Bremsvorrichtung für Luftschiffe und Flugzeuge. Gemäß der Erfindung werden die an sich bekannten, durch den Fahrtwind aufklappbaren Luftfangflächen in zweckmäßiger Weise am Flugzeug angeordnet und zwar so. daß sie als Taschen an der Unterseite der Tragfläche ausgebildet sind und bei Nichtgebrauch in den Tragflächen eingebettet liegen. Die Zeichnung stellt ein Ausführungsbeispiel dar. Abb. 1 und 2 stellen lotrechte Schnitte durch eine Bremsvorrichtung gemäß der Erfindung im Ruhezustand und während ihrer Benutzung dar. Abb. 3 zeigt die Bremsvorrichtung in ihrer Benutzungsstellung von vorn gesehen. Die Vorrichtung besteht im wesentlichen aus einem taschenförmigen Körper a 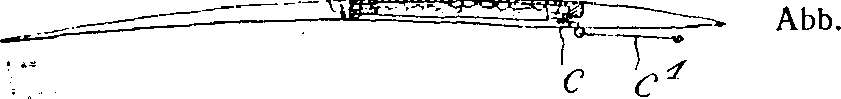 Abb. 2 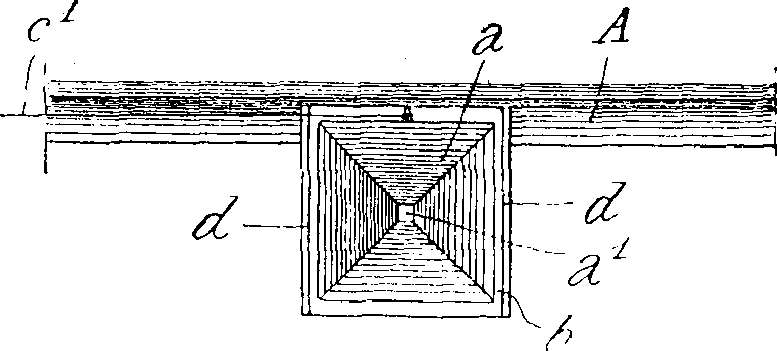 Abb. 3 aus weichem Stoff in Kegel- oder Pyramidenform mit abgestumpfter oder auch nur durchbrochener Spitze a'. Dieser taschenförmige Körper wird zweckmäßig mittels eines Rahmens b *) D. R. P. 355936. Iwan Imbert in Ramonchamp, Vosges, Frankr. an dem mit einer Aussparung versehenen Teil A der Fläche gelenkig befestigt. Der Rahmen b wird in der Aussparung der Tragfläche von einem Riegel c festgehalten, welcher durch eine Schnur c1 zurückgezogen werden kann; sein Anschlag wird durch eine Schnur d begrenzt. Patent-Anspruch. Bremsvorrichtung für Flugzeuge mit durch den Fahrtwind aufklappbaren Luftfangflächen, dadurch gekennzeichnet, daß diese Flächen als Taschen an der Unterseite der Tragfläche ausgebildet sind und bei Nichtgebrauch in den Tragflächen eingebettet liegen. Verschiedenes. Eine flugsportfreundliche Stadt. Aus Cottbus wird uns geschrieben: Ich bin hier seit ca. drei Jahren mit der Konstruktion von Flugzeugen eigenen Systems beschäftigt und habe im Dezember vorigen Jahres mein Pilotenzeugnis für Eindecker erworben. Da ich jetzt hier einen ständigen Schuppen zur Unterbringung meines neuen Flugzeuges und späterer Eröffnung einer Fliegerschule bauen wollte, habe ich mich an den Magistrat der Stadt gewandt, mit der Bitte, mir die Rennbahn zur Verfügung zu stellen und den Bau des Schuppens zu gestatten. In der letzten Sitzung wurde die Sache aber rundweg abgelehnt, weil man sich keinen Vorteil versprach Merkwürdig ist aber doch, daß die Behörden auswärtigen Fliegern bei der vorjährigen Schauflugveranstaltung die weitgehendste Unterstützung zuteil werden ließen, jetzt aber mich als einheimischen Flieger unterdrücken wollen. Es ist doch im höchsten Grade bedauerlich, wenn ein Flieger bei den maßgebenden Stellen so wenig Unterstützung findet, so etwas sollte doch wohl nicht vorkommen, wo der Flugsport noch gröüter Unterstützung bedarf." — — — 13. Kongreß russischer Naturforscher und Aerzte, nebst Fachausstellung in Tiflis, 15. Juni bis 14. Juli 1913. In Tiflis wird anläßlich des 13. Kongresses der russischen Naturforscher und Aerzte vom 15. Juni bis 14. Juli eine „Internationle Fach-Ausstellung" veranstaltet, die, wie die „Ständige Ausstellungskommission für die Deutsche Industrie" auf Grund zuverlässiger Informationen bekannt gibt, den Zweck verfolgt, den jetzigen Stand der Industrie, soweit sie sich auf das Gebiet der Naturforschung erstreckt, durch Auslegung von Lehrapparaten, Sammlungen, Bibliotheken, Zeitschriften usw. zu veranschaulichen. Es sind folgende Abteilungen vorgesehen: 1. Mathematik, 2. Physik einschl. Elekrotechnick, 3. Physikalische Geographie, Meteorologie, Seismologie, Luftschiffahrt, 4. Chemie, 5 Mineralogie und Geologie* 6. Botanik, 7. Zoologie, 8. Anatomie und Physiologie, 9. Geographie Ethnographie, Antropologie, Linguistik, Statistik, 10. Agronomie, 11. Medizin, 12. Hygiene, 13. Tierheilkunde, 14. Pädagogik. Außer der zollfreien Einfuhr der Ausstellungsgegenstände ist auch der unentgeltliche Rücktransport der auf der Ausstellung nicht verkauften Waren, wenigstens was russische Bahnen anbelangt, genehmigt worden. Ein entsprechender Antrag an deutsche Eisenbahnen ist in Aussicht genommen. Anmeldungen sind unter Benutzung der vorgeschriebenen Formulare bis zum 14. Mai d. Js. an den Alisstellungsausschuß (Rasporjaditelny Komitet XIII. Sjesda Jestostwoispita-telei i Wratschei, Tiflis, Kanzelarrija Popetschitela Kawkasskawo utschebnawo okruga) zu richten. Die Exponate sollen in der Zeit vom 28. Mai bis 10. Juni eingeliefert werden. Die Ausstellungsdrucksachen in russischer Sprache (Satzungen, Programme, Abdruck der die Zoll- und Frachtbegünstigungen betreffenden Verfügungen, Anmeldeformulare, Fracht-Begleitscheine, Etiketten etc.) liegen an der Geschäftsstelle der Ständigen Ausstellungskommission (Berlin N. W. Roon-straße 1) vor. Ausstellungswesen. Exposition Internationale de l'Automobile. du Cycle et des Sports' Marseille 1913. Die von der „Chambre Syndicale de l'Automobile et de l'Aviation" in Marseille im April ds. Js. im Grand Palais (Parc de l'Exposition, Rond-Point du Prado) veranstaltete „Internationale Automobil-Ausstellung (Exposition Inter- nationale de l'Autoinobile, du Cycle et des Sports)" hat, wie die „Ständige Ausstellungskommission für die Deutsche Industrie" auf Grund zuverlässiger Information bekanntgibt, den in sie gesetzten Erwartungen ni<ht entsprochen. Die Zahl der Aussteller und der zur Darstellung gelangenden Autos, Lastwagen, Omnibusse, Motor- und Fahrräder sowie der Ersatz- und Zubehörteile war verhältnismäßig gering, sodaß die Veranstaltung, zumal eine Beschickung seitens des Auslandes völlig fehlte, fast nur lokalen Charakter trug. Deshalb war auch der ursprüngliche Name später in die Bezeichnung ,Salon de l'Automobile" umgeändert worden. Auch der Besuch der Ausstellung war, was nur zum Teil auf die Ungunst des Wetters zurückzuführen sein dürfte, recht dürftig und konnte selbst dadurch nicht sehr gehoben werden, daß man es für angebracht hielt, eine Variete-Vorstellung auf einer mitten in den Ausstellungsräumen errichteten Bühne vorsichgehen zu lassen. Es ist nicht anzunehmen, daß eine ähnliche Ausstellung im nächsten Jahr in Marseille stattfinden wird; jedenfalls könnte nach den diesjährigen Erfahrungen der Deutschen Automobil- und Flugzeug-Industrie eine Beteiligung nicht empfohlen weiden. Ausstellellungskataloge wurden nicht ausgegeben, doch können über die Veranstaltung orientierende illustrierte Fachberichte sowie einige Aussteller-Drucksachen an der Geschäftsstelle der Ständigen Ausstellungskommission Berlin NW., Roonstraße 1 eingesehen werden. Firmennachrichten. Flugwerke Deutschland Q. m. b. H In einer am 17. April abgehaltenen Ges. Versammlung wurde die Liquidation der obengenannten Gesellschaft beschlossen. Gleichzeitig bildete sich aus den Gesellschaftern des Flugwerks ein Con-sortium, welches die Motorabteilung des Flugwerks aufkaufte und welches auf der gleichen Basis wie bisher den Flugmotorenbau unter der Firma „Flugmotorenfabrik Deutschland G. m. b H, München—Milbertshofen" fort betreiben wird.  Anonyme Anfragen werden nicht" beantwortet.) G. H. Eine Medell-Ausstellung und Modell wettfliegen findet dieses Jahr in Darmstadt statt. Sie wollen sich dieserhalb an'den Verein für Luftfahrt in Darmstadt wenden. Die Leistungen von Modellflugzeugen, welche von Vereinen bestätigt worden sind, finden Sie im letzten Jahrgang des „Flugsport" unter der Rubrik „Modelle" veröffentlicht. Offiziell kontrollierte und prämierte Höchstleistungen unter der Formel Flugzeuggewicht, Gummigewicht und Weg!gibt es bis heute noch nicht. Bund der Flugsportfreunde. Der angefragte Eindecker wird nicht gebaut- Auf Schultze-Herford ist zu dieser Zeit niemand tötlich abgestürzt. Bruno Büchner ist in Alt-Gersdorf Kr. Löhau (Sachsen) geboren und zur Zeit bei der Gothaer Waggonfabrik, welche Ein- und Zweidecker baut, beschäftigt. Die übrigen Fragen können wir mit Rücksicht auf die anderen Firmen nicht beantworten. Wir bitten Sie, sich dieserhalb direkt an die betreffenden Firmen zu wenden. Mafrö. Ueber die Entscheidung der Wright-Patente ist in „Flugsport" Jahrgang 1913 in No. 5 auf Seite 194 und No. 6 auf Seite '219 ausführlich berichtet worden. Der Gleitflugapparat von Lilienthal ist in „Flugsport" Jahrgang 1910 No. 6 auf Seite 184 an Hand von Skizzen ausführlich beschrieben.  Jllustrirte No 10 technische Zeitschrift und Anzeiger Ab0„„ement: 14. Mai ^ das gesamte ZZV»" 1913. Jahrg. II. PlUgWCSeil" pr° unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef. 4557 ftmt i. Oskar Ursinus, Civilingenieur. Tel.-fidr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz8. Erscheint regelmäßig 14tägig. > : Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 28. Mai. Prinz Heinrich-Flug 1913. Die Fortschritte des Flugwesens in Deutschland zeigen sich bei dem diesjährigen Prinz Heinrich-Flug nicht nur in einem intensiveren Flugbetrieb, sondern auch in der technischen Durchführung der Maschinen. Auffallend sind die großen Fortschritte in der Verfeinerung der Konstruktionen gegenüber ausländischen. Die primitiven Streichholzkönstruktionen, wie man sie noch viel in Frankreich sieht, waren überall verschwunden. Man sieht, daß die zielbewußte Ingenieurarbeit eingesetzt hat. Die Solidität ist für die Zuverlässigkeit erste Hauptbedingung. In dieser Hinsicht wird die bereits historisch gewordene Veranstaltung des Prinz Heinrich-Fluges auch veredelnd wirken. Einzelne Maschinen zeigten in ihrer Durchführung eine geradezu mustergiltige Arbeit. Auf die präzise Konstruktion von Einzelteilen haben verschiedene Firmen sehr viel Sorgfalt verwandt. Selbst der Laie hat das Gefühl, daß man diesen Maschinen sich mit viel größerer Sicherheit anvertrauen kann. Den Konstrukteuren ist das beste Material noch nicht gut genug. Das igt der richtige Weg, auf dem wir intensiv weiter arbeiten müssen. Die einzelnen technischen Neuerungen sind den Fachleuten von den Flugplätzen her bekannt. Indessen dürfte es doch interessant sein, die Maschinen mit ihren Eigentümlichkeiten und Neuerungen zu besprechen. Um keiner Firma den Vorzug zu geben, wollen wir alphabetisch die Erzeugnisse aufzählen. Von den Albatroswerken wurde zunächst der neue Eindecker von Hirth mit großem Interesse erwartet. Dieser Renneindecker ging leider am ersten Prüfungstage bei einem Fehlstart, wobei er sich überschlug, in Trümmer. Hirth und sein Begleiter blieben dabei unverletzt. Durch diesen l'nfall war es uns auch nicht möglich, die Maschine im Bilde festzuhalten. Charakteristisch für die äußere Form des Eindeckers war die Durchbildung des Rumpfes, der, von vorn gesehen, elliptischen Querschnitt hat und zwar lag infolge der nicht hinter einander, sondern nebeneinander angeordneten Sitze die große Achse der Ellipse nicht senkrecht, sondern wagrecht. Um ein sanftes Abströmen der Luft zu ermöglichen, sind die Uebergänge vom runden Querschnitt zu den Tragflächen durch sanft gerundete Hohlkehlen aus Aluminium bewirkt. Das Mittelstück, der mit Sperrholzplanken versehene Rumpf und die angesetzten Tragflächen haben die Form eines Marmelrochen. Der Rumpf hat bei dem Sturz keinerlei Beschädigung erlitten. Die Tragflächen ähneln in ihrem Querschnitt der Nieuport-Tragfläche. Die Maschine hatte bei 12 m Spannweite und durchschnittlich 2,3 m Tragdeckentiefe 21 m Tragfläche. Die seitliche Stabilität wurde durch Verwindung aufrecht erhalten. Die hintere Dämpfungsfläche besaß 3,1 qm, die zwei Höhensteuerflächen 2 qm, das Seitensteuer 0,5 qm. Die Gasamtlänge der Maschine betrug nur 8 m, das Gewicht ohne Betriebsstoff 500 kg. An Betriebsstoff konnti n 130 1 Benzin und 15 1 Oel mitgenommen werden. Zum Betriebe diente ein 75 PS Stahlzylinder-Mercedes-Motor, mit dem die Maschine eine Geschwindigkeit von 115 km erzielen sollte. Der erforderliche Anlauf bei Windstille beträgt ca. 60 m, der Auslauf ca. 40 m. Das von Oberlt. Beaulieu (Flug No. 4) gesteuerte Militär-Flugzeug ist eine normale Albatros-Doppeltaube mit bootsförmigem Rumpf und hinten liegenden Steuerorganen. Die Spannweite des Oberdecks beträgt 16,4'm und die des Unterdecks 13 m, die durchschnittliche Flächentiefe 2,05 m, die Gesamttragfläche 52 qm, das Gewicht ohne Betriebsstoff 680 kg, 150 1 Benzin und 20 1 Oel. Zum Betriebe dient ein 100 PS Stahlzylinder-Mercedes-Motor. Die von Dipl.-Ing. Thelen gesteuerte Doppeltaube (Flug No. 18) ist ein etwas verbesserter Typ und unterscheidet sich durch die geringere Tragdeckentiefe. Die Streben in der Tragzelle sind mit den Flächenholmen derartig gelenkig verbunden, daß die beiden Tragdecken zusammen gelegt werden können, ohne daß die Streben entfernt werden müssen. Ebenso ist das Fahrgestell etwas vereinfacht. Es besteht nur aus zwei Holzstreben, die unten in einem gemeinsamen Schuh endigen, über welchem die Achse in Gummiringen aufgehängt ist. Das obere Tragdeck besitzt 14,4 m Spannweite und das untere 10,8 m. I.'ie Flächentiefe beträgt 1,7 m, das Tragflächenareal 39 qm, das Gewicht ohne Betriebsstoff 630 kg, Benzin 150 1 und Oel 20 1. Zum Betriebe dient ein 100 PS Stahlzylinder-Mercedes-Motor. Von der Automobil- und Aviatik Akt.-Ges. sind vertreten ein Doppeldecker älterer Konstruktion, der von Lt. Weyer (Flug No. 7) und Oberlt. Burmeister gesteuert wird, ferner ein 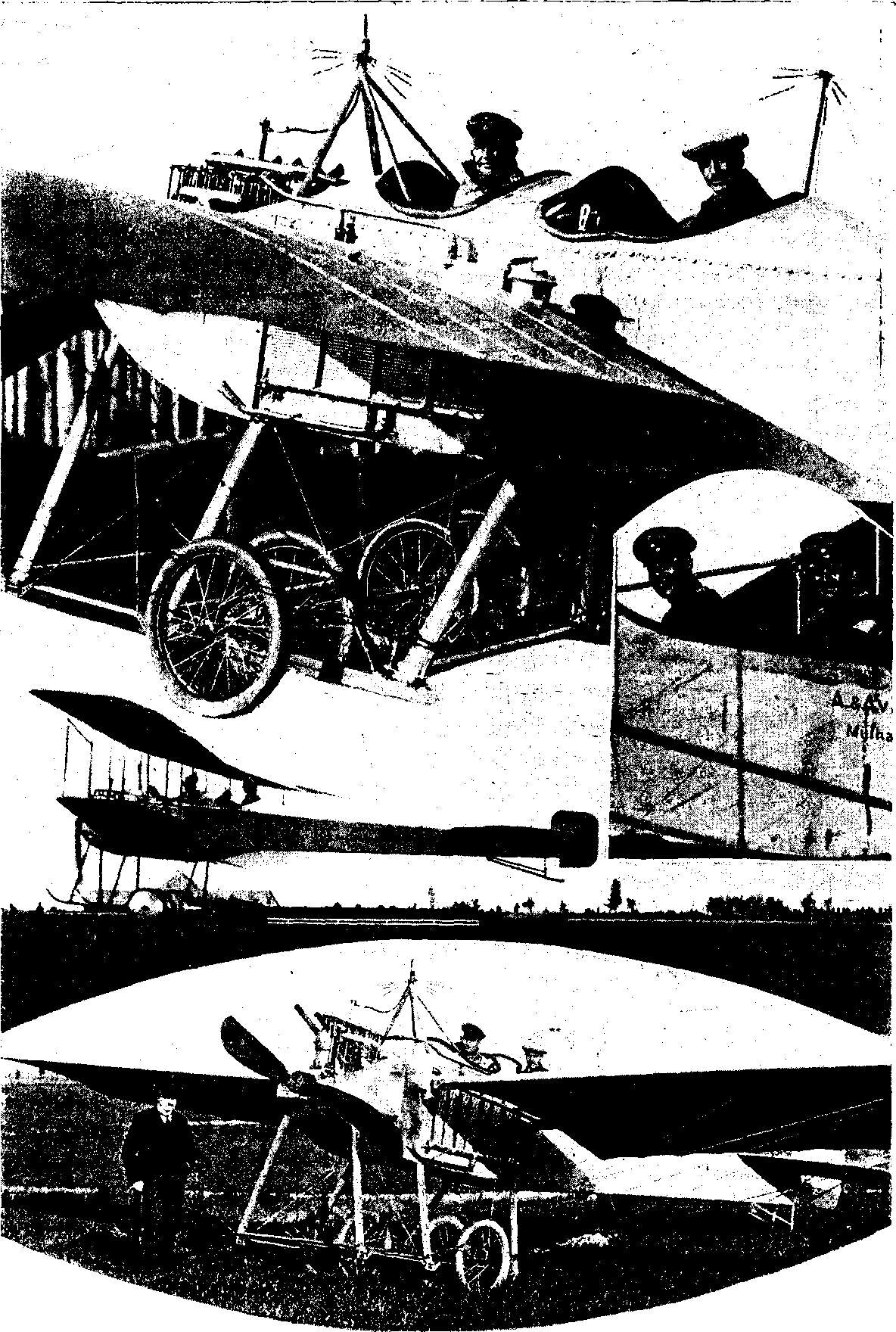 Prinz Heinrich-Flug 1913. Die Aviatik-Flugzeuge. Oben: fng. Schlegel mit Lt. Prestien als Beobachter auf Aviatik-Eindeckcr. Links mitte: Aviatik-Pfeil-Doppeldecker gesteuert von Ober/t. Linke im Fluge. Rechts: Lt. Weyer mit Oberlt. Barmeistcr. Unten mitte: der Avintik- Eindecker von vorn gesehen. Aviatik-Pfeil-Doppeldecker, gesteuert von Oberlt. Linke (Flug No. 17) und ein Aviatik-Eindecker, gesteuert von Ing. Schlegel (Flug No. 16). Der Pfeil-Doppeldecker ist in der nebenstehenden Abbildung im Fluge dargestellt. Die Tragdecken sind V-förmig nach oben und nach hinten gestellt. Zum Betriebe dient ein 100 PS Argus-Motor. Das Fahrgestell wird aus zwei kräftigen Kufen, die mit dem Rumpf durch sechs Streben verbunden sind, gebildet Die vier Eäder tragende, durchgehende Achse ist in bekannter Weise an Gummiringen aufgehängt. ' Das gleiche Fahrgestell (s. die Abb.) wird auch an dem neuen von Schlegel gesteuerten Eindecker verwandt. Zum Betriebe des Eindeckers dient gleichfalls ein 100 PS Argus-Motor. Die Deutschen Flugzeug-Werke, Leipzig-Lindenthal sind mit einem ^normalen Mars-Doppeldecker, gesteuert von Lt. Blüthgen (Flug No. 1) und zwei Eindeckern, gesteuert von Lt. von v. Hiddes sen.fElug.No 14) und Lt. Zwickau (Flug No. 15) vertreten Die Ausführung des Rumpfes und des sehr robusten Fahrgestells ist bei Ein- und Zweidecker gleich, da der Rumpf bezw. das Fahrgestell jederzeit für beide Flugmaschinenarten verwendet werden kann. (S. die nebenstehende Abb.) j ä Die Euler-Werke sind nur durch eine Maschine, einen Doppeldecker vertreten, (Flug No. 6), der % Stunde vor Abnahmeschluß in Frankfurt fertig und auf dem Luftwege von Lt. Sommer nach Wiesbaden gebracht wurde. Anstelle der bekannten Euler-Steuerung ist in diesen Apparat, der als Flugzeug der deutschen Heeresverwaltung teilnimmt, die Militär-Steuerung eingebaut. Goedecker hatte für den Prinz Heinrich Flug einen schönen Eindecker gebaut, der leider bei einem Probeflug auf dem Fabriksfeld in Trümmer ging. Die Maschine ist an anderer Stelle ausführlich beschrieben. In dem Wettbewerb erscheinen zum erstenmal zwei Maschinen der Flugzeugbau-Abteilung der Gothaer Waggonfabrik und zwar zwei taubenartige Eindecker, gesteuert von Lt Joly (Flug Nr. 20) und Lt. Engwer (Flug Nr. 21). Die beiden Maschinen zeigen sehr saubere und sachgemäße Arbeit. Es steht zu erwarten, daß die Gothaer Waggonfabrik, die in ihrer Branche in der Metall- und Holzbearbeitung reiche Erfahrung besitzt, auf dem Gebiete des Flugmaschinenbaues in Zukunft noch viel leisten wird. Während der von Lt. Joly gesteuerte Eindecker, der mit einem 76 PS 6 Zyl. Mercedes-Motor ausgerüstet ist, mit dem bisher bei Tauben viel verwendeten Fahrgestell mit schwenkbaren Rädern versehen ist, wurde unter dem Apparat von Lt. Engwer ein einfaches Strebenfahrgestell mit einer Achse und zwei Rädern vorgesehen. Zum Betriebe dieser Maschine dient ein 100 PS 4 Zyl. Argus-Motor. Auch Grade fühlte das Bedürfnis, den Wert seiner Maschinen gegenüber den bisher 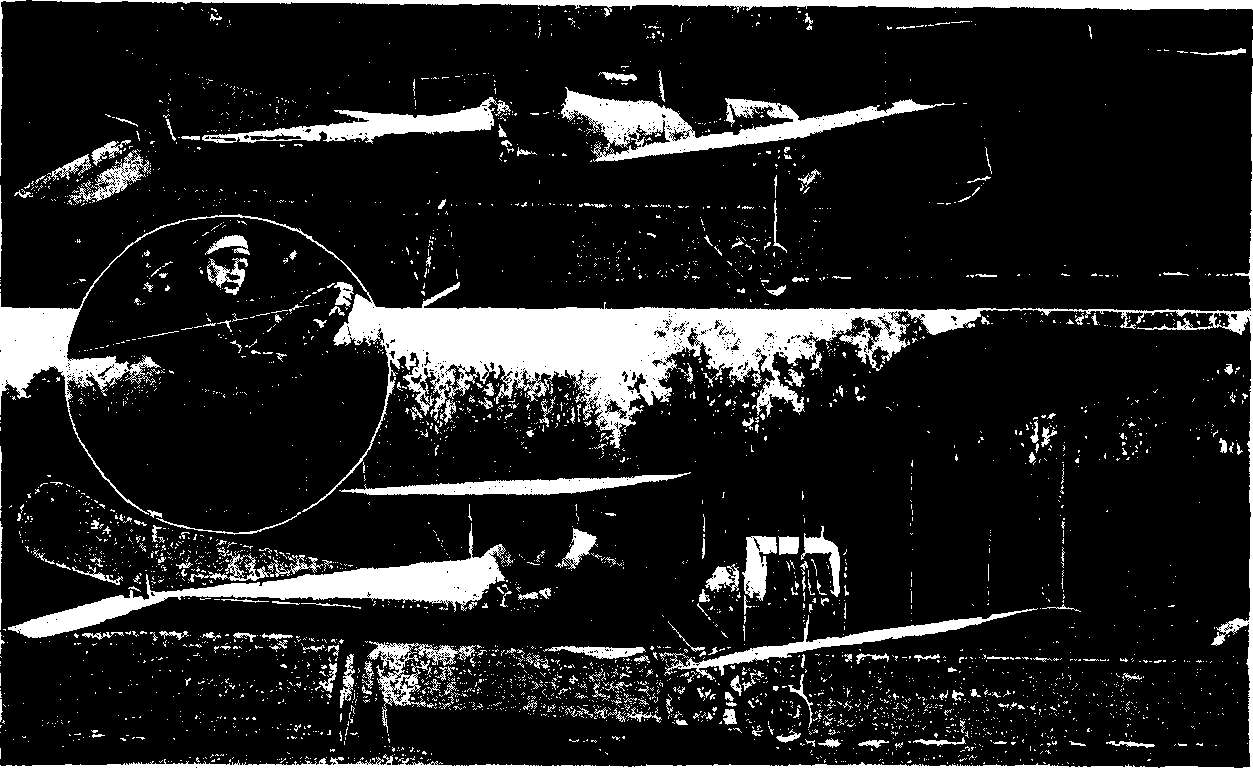 Prinz Heinrich-Flug 1913. Ein- und Doppeldecker der Deutschen Flugzeug-Werke, in der Mitte Lt. v. Siddessen, 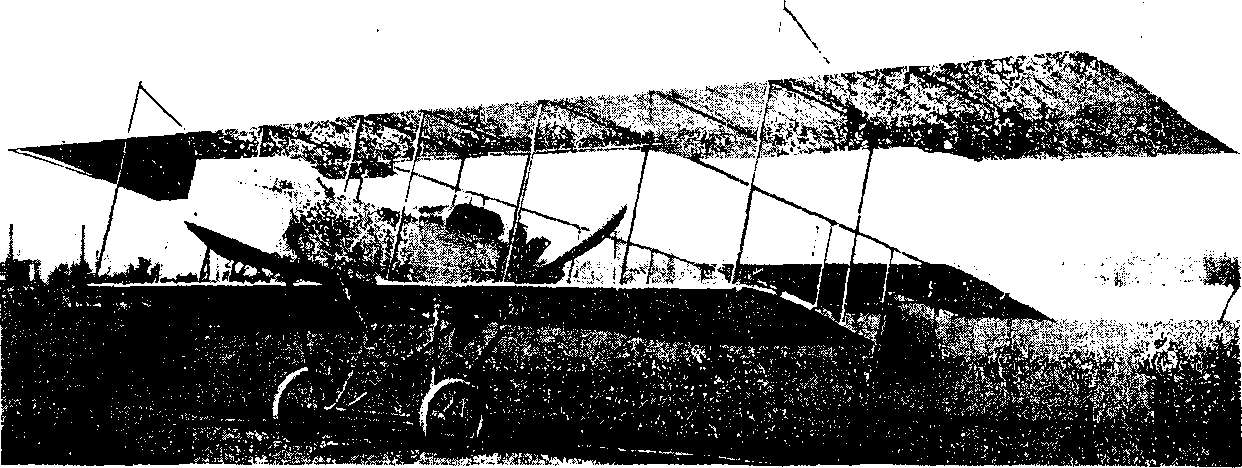 Prinz Heinridi-Flug 1913. Euler-Doppeldecker. energisch versucht, seinen luftgekühlten Zweitaktmotor zu vervollkommnen. Es ist schade, daß er bisher vom Pech verfolgt und seine Bemühungen nicht belohnt wurden. Hoffentlich kann er.s durchhalten eingeführten Militärmaschinen zu zeigen. Er beabsichtigt, außer Konkurrenz zu fliegen. Der Grade-Eindecker mit karossiertem Führerund ßeobachtersitz besitzt einen 50 PS luftgekühlten 4 Zyl. Grade-Motor. Bei den Probeflügen am Samstag zeigte die Maschine eine sehr hohe Geschwindigkeit. Es ist immerhin erfreulich, daß Grade Die Jeannin -Taube der deutschen Heeresverwaltung (Flug Nr. 9) wird von Lt. Coerper gesteuert. Dieser unseren Lesern aus früheren Beschreibungen bekannte Eindecker ist mit einem 103 PS 6 Zyl. Argus-Motor ausgerüstet. Von den Kondor-Flugzeugwerken fliegt in Reserve, evtl. außer Konkurrenz, Ingenieur Suwelack (Flug Nr. 23). Dieser Eindecker ist der einzige mit vollständig spindelförmigem Rumpf. Zum Betriebe dient ein 95 PS 6 Zyl. Mercedes-Motor. Der Kondor-Eindecker ist in dieser Zeitschrift bereits früher ausführlich beschrieben worden. Von der Luft -Verkehrs - Gesellschaft nehmen eine Maschine der deutschen Heeresverwaltung, gesteuert von Lt. Freiherr von Thüna (Flug Nr. 3) und ein von der Firma in Reserve gemeldeter Doppeldecker, gesteuert von Lt. Carganico, (Flug Nr. 24) te'l. Die beiden Doppeldecker erregten unter den Fachleuten infolge ihrer äußerst sauberen Arbeit viel Aufsehen. Hervorzuheben ist sowohl die technische Durchführung als auch die saubere "Werkstattarbeit. Man sieht an den Maschinen sehr interessante Details, bei denen Festigkeit, und Zweckmäßigkeit in formvollendeter Weise vereinigt sind. Interessant ist das karabinerhakenartige lösbare Spannschloß, das durch Herausziehen eines Splintes gestattet, die Ver-spannung, ohne die Länge des Seiles zu verändern, zu lösen. (S. die Abb.) Von der bayrischen Heeresverwaltung sind drei Otto-Doppeldecker, gesteuert von Lt. Hailer, Lt. Vierling und Lt. Frhr. v. Haller (Flug No. 10, 11 und 12) vertreten. Die Doppeldecker zeigen die den Lesern des „Flugsport" bekannte Ausführung. Die Firma E. Rumpier Luftfahrzeugbau G. m. b. H. ist durch einen von der Heeresverwaltung gemeldeten Eindecker, der von den Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken Seiner Majestät dem Kaiser zum Geschenk gemacht wurde, vertreten. Dieser Eindecker, eine normale Rumpler-Taube, wird von Lt. Canter (Flug No. 2) gesteuert. Wenn man die Ausführungen dieser stattlichen Anzahl von Flugmaschinen gegen die vom Vorjahre vergleicht, so muß man feststellen, daß das Flugwesen sich doch erheblich entwickelt hat und daß voraussichtlich in diesem Jahre auch größere Leistungen erzielt werden. Jedenfalls wird der Kampf um den Prinz Heinrich-Preis der Lüfte ein sehr heißer. In dieser Hinsicht ist die von Bildhauer Carl Korschann ausge= führte Trophäe sehr treffend gewählt. Die Broncegruppe stellt die Herausforderung des Königs der Lüfte dar. Die Gruppe selbst ist 84 cm hoch und ruht auf einer achteckigen Holzsäule, die 125 cm hoch, ein Bronceschild mit der Aufschrift „Prinz Heinrich Preis der Lüfte 1913" trägt. Entgegen den vielen bekannten Darstellungen der beflügelten Menschen wirkt diese Gruppe durch die Einfachheit und 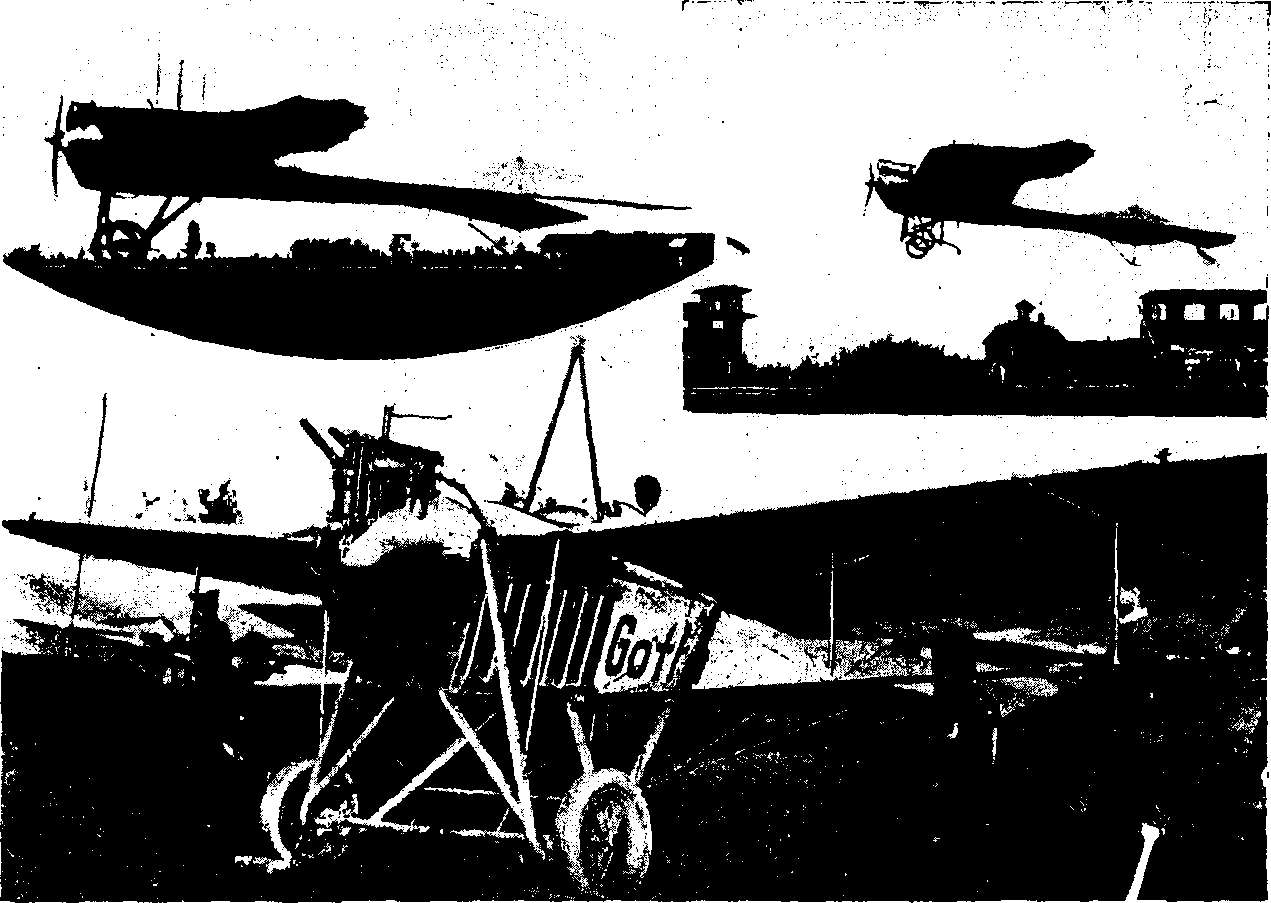 Prinz Heinrich-Flug 1913. Die Eindecker der Gothaer-Waggonfabrik. Unten: neuer Typ mit verstärktem Fahrgestell. Oben links: derselbe im Fluge. Oben rechts: Eindecker alter Typ mit ausschwenkbaren Rädern. 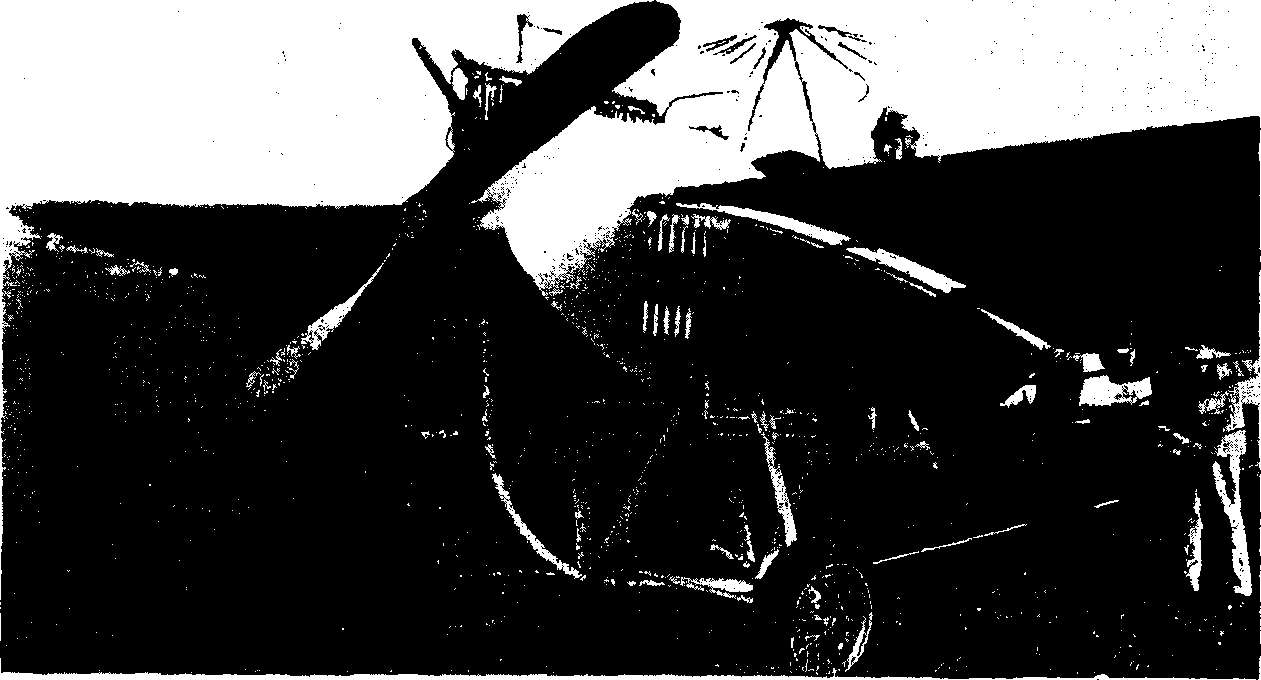 Prinz Heinrich-Flug 1913. feannin-Eindecker mit Lt. Coerper am Steuer. kräftige Linienführung. Wie der Künstler in seht gelungener Weise das Trotzige und Herausfordernde des Menschen gegenüber der Natur zum Ausdruck gebracht hat, läßt sich sehr schwer beschreiben. Man siehe die Abbildung. * * * Verzeichnis der Teilnehmer. I. Flugzeuge der deutschen Heeresverwaltungen. -J Blüthgen, Lt. I.-R. 167, k. z. Fl.-St. Döberitz; Mars-Doppeldecker, Deutsche Flugzeugwerke Leipzig; Motor: Daimler-Werke; 95 PS, Beobachter: Frhr. v. Fryburg, Lt. 3. G.-R. z. F.; Unparteiischer: Frhr. v. Hammerstein, Hauptmann und Adjutant des Gouvernements Köln. Canter, Lt. Fl.-St. Döberitz; Rumpler-Taube; Motor: Daimler-Werke; 72,7 ♦ PS; Beobachter: Böhmer, Lt. Feldart.-Schießschule; Unparteiischer: Frhr. v. Biegeleben, Oberlt Feldart.-Reg. No. 25. Q Frhr. v. Thüna, Lt. 5. G.-R. z F. k. z. Fl.-St. Döberitz; Luftverkehrs-gesellschaft-Doppeldecker; Motor: Daimler-Werke, 95 PS; Beobachter: v.Falkenhayn, Lt. 1. G.-Gr.-R.; Unparteiischer: Frhr. v. Babo, Oberl. I.-R No. 114. 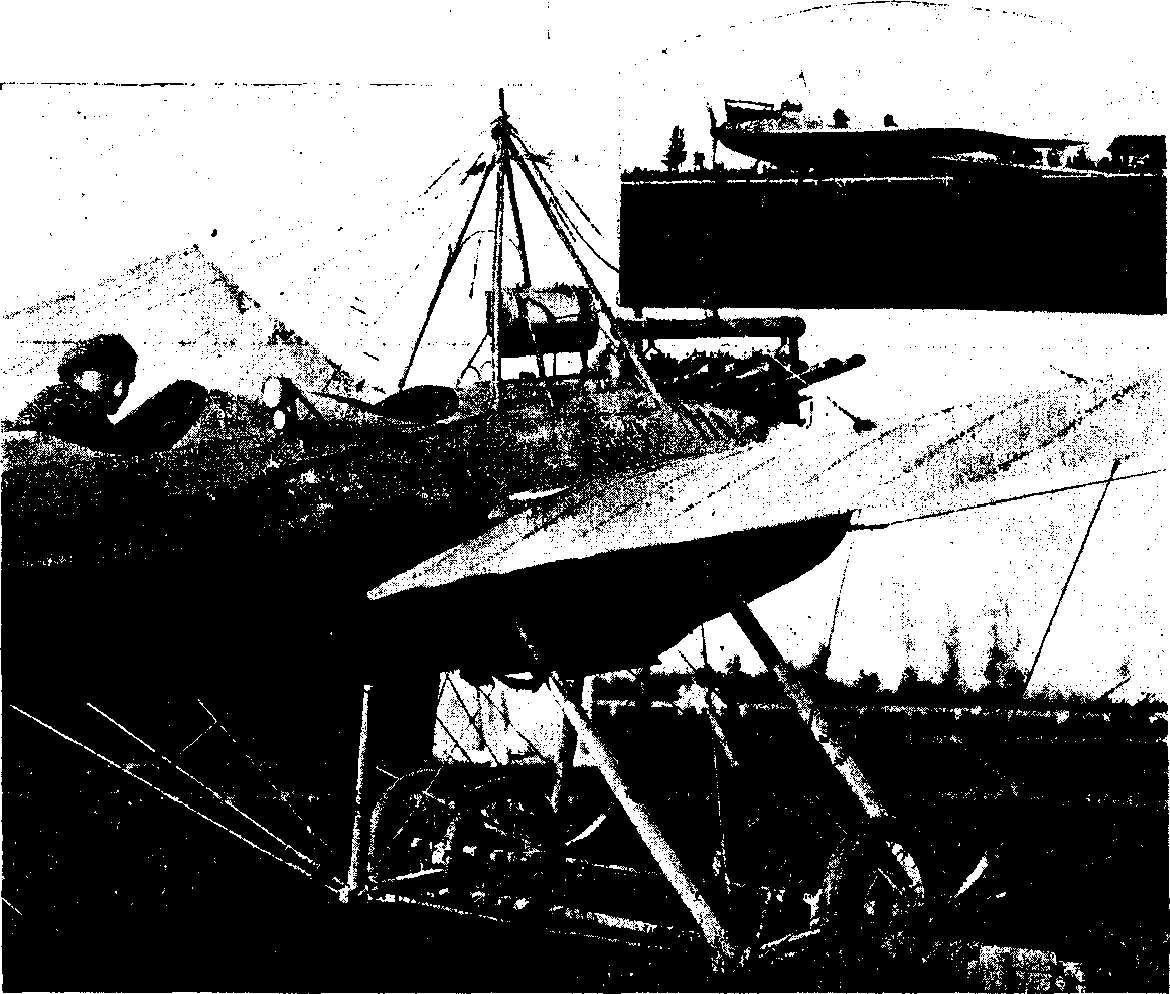 Prinz Heinrich-Flug 1913. Suwelaek auf seinem Kondor-Eindecker. Rechts oben: der Kondor-Eindecker beim Start kurz vor dem Abheben. 4v. Beaulieu. Oberlt. F.-R. 36, k. z. Fl.-St. Döberitz; Albatros-Doppeldecker; ♦ Motor: Daimler-Werke, 95 PS; Beobachter: Heintz, Lt. I.-R. No 157; Unparteiischer: Block, Hptm. I.-R. No. 105. 5Kastner, Lt. Fußart.-R. No. 8, k. z. Fl-St. Köln; Rumpler-Taube; Motor: ♦ Daimler-Werke, 95 PS: Beobachter: Niemoeller, Oberl. Fußart.-Schießschule; Unparteiischer: Rein, Oberlt. P. No 8. Ii Sommet, Lt. I.-R. No. 134, k. z. Fl.-St. Döberitz; Euler-Doppeldecker; Gnom-Motor, 76,9 P-; Beobachter: v. Beers, Lt. F-A. 84; Unparteiischer: Moers, Oberlt. I.-R. No. 67. 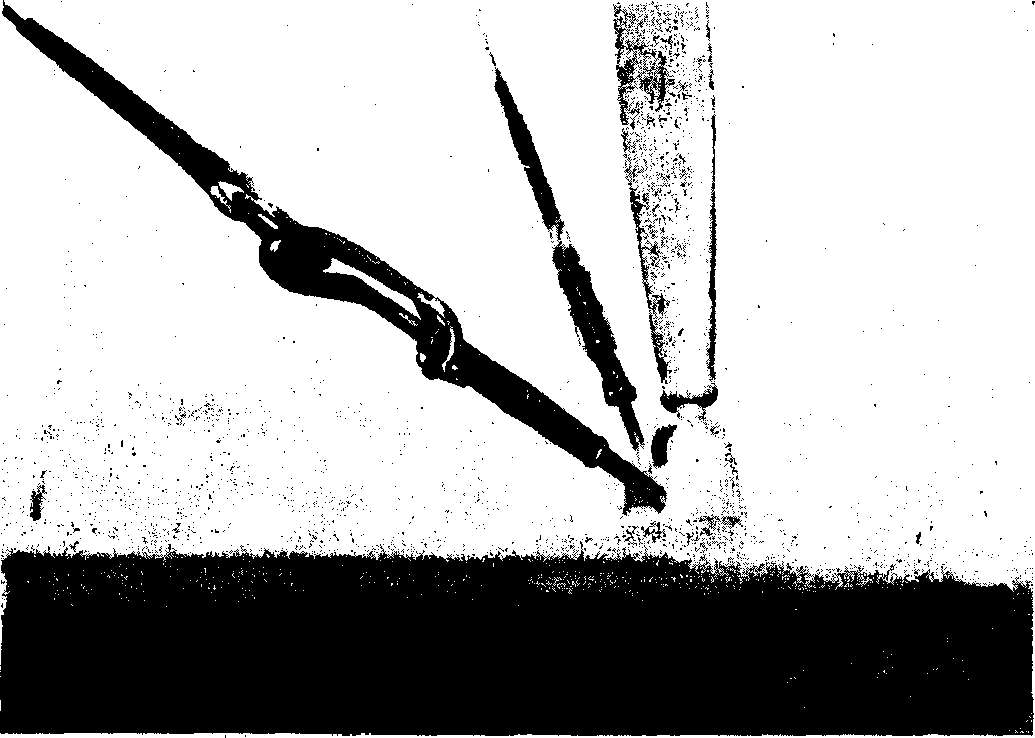 Prinz Heinrich-Flug 19J3. Mit selbsthemmendem und gesichertem Karabiner armiertes Spannschloß der Luß-Verkehrs-Gesellschafl 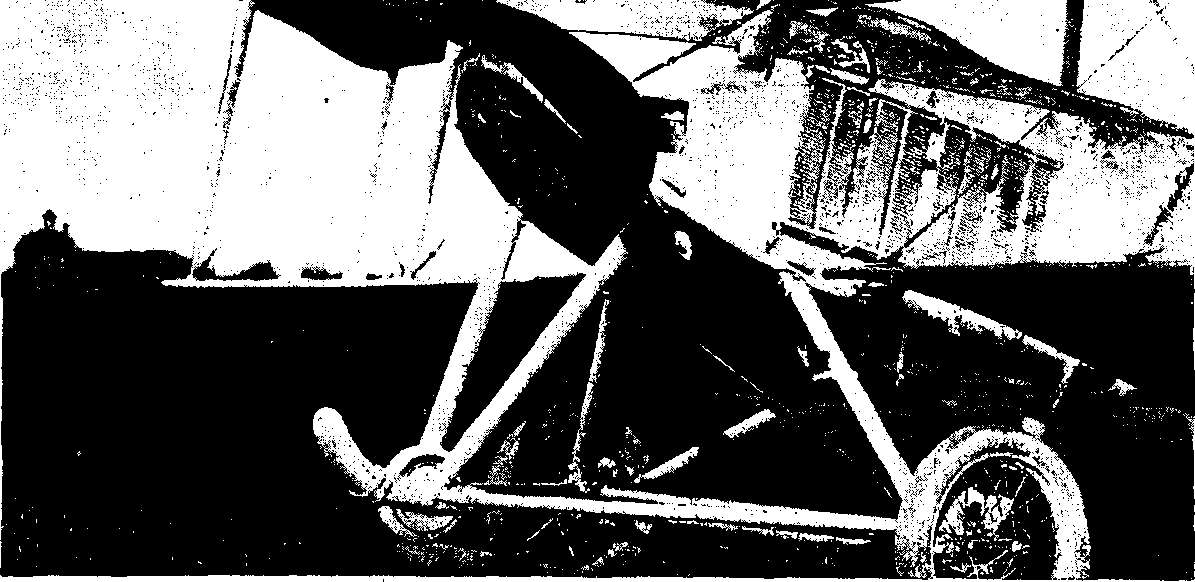 Prinz Heinrich-Flug 1913. L. V. G.-Doppeldecker, oben links: der Apparat im Fluge. 7 Weyer, Lt I.-R. No. 131, k. z. Fl.-St. Metz; Aviatik-Doppeldecker; Motor Argus-Werke, 86,2 PS; Beobachter: Burmeister, Oberlt I.-R. No. 131; Unparteiischer: v. Pirch, Oberlt. F-A. No. 23. SDonnevert, Oberlt. Feldart-R. No. 31, k z. Fl.-St. Straßburg; Rumpler-♦ Taube; Motor: Argus-Werke, 86,2 PS; Beobachter: Warsow, Lt. Fußart-R. No. 14; Unpartei scher: Renk, Oberlt. I-R. No. 126. 9Cörper, Lt. I.-R. No. 144, k. z. Fl.-St. Döberitz; Jeannin-Taube; Motor: ♦ Argus-Werke. 103,5 PS, Beobachter: v. Schröder. Lt. Füs.-R No. 35; Unparteiischer: Dincklage, Hptm. I.-R. No. 65. Ha il e r, Lt. bayer. Mil.-Flieger-Station ; Besitzer des Flugzeugs: bayr. ♦ Heeresverwaltung; Otto-Zweidecker, Mil.-Typ; Motor: Daimler-Werke; 95 PS.; Beobachter: Leonhard, Oberlt. bayr. I.-R. No. 9: Unparteiischer: Donnevert, Oberlt. Feldart.-R. No. 84. UVierling, Lt, bayr. Tl.-Bat.; Besitzer des Flugzeugs: bayr. Heeres-♦ Verwaltung; Otto-Zweidecker Mil.-Typ; Motor: Daimler-Werke; 95 PS.; Beobachter: Hufenhäuser, Oberlt. bayr. I.-R No. 6, k. z. Kriegsakademie; Unparteiischer: Hempel, Lt. bayr. Flieger-Komp. ϖj o Frhr. v. Haller, Lt. bayr Mil.-Fliegerstation; Besitzer des Flugzeuges: bayr. Heeresverwaltung; Otto-Zweidecker Mil.-Typ; Motor: Daimler-Werke 95 PS; Beobachter: Frhr. v. Könitz, Oberlt. bayr. 1 schw. Reiter-R.; Unparteiischer: Frhr. Kreß v. Kressenstein, Lt. bayr. Inf-Leib-R. un 1 Bez.-Adj. ii. Flugzeuge Im Privatbesitz. v. Hiddessen, Lt. Drag.-R. No. 24, k. z. Fl.-St. Döberitz; Besitzer: ♦ Deutsche Flugzeugwerke Leipzig-Lindenthal; Eindecker der D. Fl.-W.; Motor: Daimler-Werke; 95 PS; Beobachter: Behm, Lt. I.-R. No. 78; Unparteiischer: Werbe, Hptm., I.-R. No. 132; Zwickau, Lt. P.-Bat. No. 10; Besitzer: Deutsche Flugzeugwerke ♦ Leipzig-Lindenthal; Eindecker der D. Fl.-W.; Motor: Daimler-W.; 95 PS; Beobachter: Müller, Lt. Jäger No. 7; Unparteiischer: Creydt, Fuß-Art No. 13. \ fl Schlegel, lng., Besitzer: Automobil- und Aviatik A.-G. Mülhausen; **** Mil.-Eindecker Aviatik 1913; Motor; Argus-Werke; 86,2 P.-; Beobachter: Prestien, Lt. I.-R No. 142"; Unparteiischer: Krüger, I.-R. No. 142. Linke, Oberlt. I.-R. No. 34; Besitzer: Automobil- und Aviatik-A.-G. Mül- ♦ hausen, Aviatik-Pfeil-Doppeldecker Militärtyp 1913; Motor: Argus-Werke: 86,2 PS; Beobachter: Reichenbach, Oberlt. I.-R. No 34; Unparteiischer: Friedberg,, Lt. Jäger No. 14. Thelen, Diplomingenieur; Besitzer: Albatroswerke G. m. b. H. Albatros- ♦ Zwei<iecker; Motor: Daimler-Werke; 95 PS; Beobachter: Weiß, Kapitänleutnant 2. Torpedodivis.; Unparteischer: Vogt, Oberlt. I.-R. No. 32. 4 q Hirth, techn. Direktor; Besitzer: Hirth; Albatros-Hirth-Eindecker; Motor: LiJ* Daimler-Werke.; 72.7 PS; Beobachter: Palmer, Oberlt Gr.-R. No. 123; Unparteiischer: Zschiedrich,' Hptm. I.-R. No. 105. 90 J°Iv> Lt- P-Bat- No- 24, k. z. Fl-St. Köln; Besitzer: Gothaer Waggon »v» Fabrik A.-G ; Gothaer Waggonfabrik-Eindecker; Motor: Daimler-Werke; 72,7 PS; Beobachter: Felmy, Oberlt. I.-R. No. 61, k. z. Fl.-St. Döberitz; Unparteiischer: Schmidt, Rittm. Hus. No. 14. Eng wer, Lt. Fliegertruppe Döberitz; Besitzer: Gothaer Waggonfabrik, ♦ A.-G.. Gothaer Waggonfabrik-Eindecker; Motor: Argus-Werke; 86,2 PS; Beobachter: Zimmer, Lt. Fuß.-Art. No. 14; Unparteiischer: Wartenberg, Lt. 1-R. No. 81. 90 Schröder, Pilot; Besitzer: Goedecker Flugzeugwerke, Gonsenheim bei Mainz; Goedecker-Eindecker; Motor: Daimler-Werke; 95 PS; Beobachter: Aumann, Lt. P. 24; Unparteiischer: Genee, Hptm, I.-R. No. 132. o'^ (Reserve, ev. außer Konkurrenz) Suwelack, Ingenieur; Besitzer: Kondor - Werke Essen; Kondor - Eindecker; Motor: Daimler-Werke: 95 PS; Beobachter; v. Ascheberg, Oberlt. Feld.-Art. No. 22; Unparteiischer; Zeumer, Lt. I.-R. No. 105. o/l (Reserve, ev. außer Konkurrenz.) Carganico, Lt. Fl.-St. Metz; Be-sitzer; L. V. G. - Doppeldecker; Motor: Argus-Werke; 103,5 PS; Beobachter: Lt. Koch, Gren.-R. No. 110. ischer 26. 27. 28. 29. 30. 31. III, Außer Konkurrenz. Grade, Ing.; Besitzer: Grade Bork; Eindecker Hans Grade; Molor Grnde-Werke; 50,9 PS; Beobachter: Rapmund, Lt. P. No. 9; Unpartei-Dransfeld, Lt. I.-R. No. 8S. IV. Teilnehmer an den Aufklärungsübungen. Taeufert, Oblt. J -R. 27 (Fl.-Stat. Straßburg). BeoUcliter: Cleß, Lt. Rumplertaube, 100 PS Argus. Geyer, Lt. J.-R. 95 (Fl.-Stat Straßburg). Beobachter: Prins, Lt. Aviatik-D. D. 100 PS Argus. Schmickaly, Lt. (Fl-Stat. Straßburg). Beobachter: Genec-, Hptui. J.-R. 132. Avialik Rumpf-Pfeil D. D. 100 PS Argus. Wulff, Lt J.-R. 56 (Fl.-Stat Straßburg. Beobachter: Baumbach, Oblt. J.-R. 95 Aviatik D. D. 100 PS Argus. von Eickstädt, Oblt. 5. G. z. F. (Fl.-Sta». Straßburg). Taube 100 PS Argus. Lom, Lt. Pi. 1 (Fl.-Stat. Straßburg). Aviatik D. D. 100 PS Argus.  Prinz Heinrich-Flug 1913. Lt. Cancer mit Lt. Boehmer als Beobachter auf Rumpler-Taube 'jo von Beaulieu, Oberlt. j.-R. 79 (Fl.-Stat. Slraßburgi. Aviatik D. D. 100 PS Argus. ti'J von Oste.rroth, Lt. J.-R. 152 (Fl.-Stat. Straßburg. Aviatik D.D. 100 PS Argus. 34. Kohr, Lt. P. B 3 (Fl.-5tat Straßburg). Aviatik D. D 100 PS Argus. tipi Schulz, Lt. Pi 16 (Fl.-Stat. Metz) Bedachter: Fürstenw^rt Oblt. «-»^» J.-R. 166. Albatros D. Ü. I00 PS Argus. t>ti Pretzen, Lt. J.-R. \3'2 (Fl.-Stat Metz). Beobachter: Reinhold Lt. J.-R. «'"♦ 61. Rumplertaube 100 PS Argus. 4>7 Schneider, Lt. F-A. 12 (Fl.-Metz). Beobachter: Kürner, Lt. P. B. 15. L.-V. G.-D. D. 100 PS Ar^us. oo Koch, Lt J.-R. 116 (Fl.-Stat. Darmstadt). Beobachter: v. d. Hagen Oblt. .jo. j.R. 153. Euler D. D. 70 PS Gnome. * * * Seile 352 Der Verlauf des Prinz Heinrich-Fluges. Am !). Mai bei prächtigem Frühlingswetter erhoben sich die ersten Flugzeuge zu Probeflügen über dem Wiesbadener Rennplatz. Fast sämtliche Maschinen waren zur Stelle. Vor den Zelten wurde lebhaft gearbeitet. Die stattliche Reihe der vor den Zelten aufgestellten Flugzeuge gewährte einen interessanten Anblick. Ueberau machte man die letzten Motorproben. Ein Höllenspektakel! Lt. Canter, Lt. von Hiddessen und Lt. Kastner machten Probeflüge, Lt. Weyer mit Oberlt. Baumbach als Beobachter waren vormittags 5: 45 Uhr von Straßburg weggeflogen und landeten nach 1 Std. 35 Min. in Mainz. Am 10. Mai begann man bereits sehr früh mit den Probeflügen. Hierbei fuhr Oberlt. Linke bei einem Fehlstart in Thelens Flugzeug, das leicht beschädigt wurde Hirth, der mit seiner Rennmaschine einen Proflug ausführen wollte, riß die Maschine zu zeitig hoch, so daß sie sackte. Hierbei kam das rechte Tragdeck mit dem Boden in Berührung, sodaß sich die Maschine überschlug. Der Begleiter, Oberlt. Palmer, wurde herausgeschleudert und erlitt einige Hautabschürfungen, während Hirth sich in die Karosserie verkroch und vollständig unverletzt blieb Nachmittags 4 Uhr wurden die Flüge für die Bedingungen der Heeresverwaltungen fortgesetzt. Die Bedingungen haben bestanden: Lt. Joly (Gothaer Waggonfabrik-Eindecker) Lt. von Hiddessen (D. F.W.-Eindecker), Lt Engwer (Gothaer Waggonfabrik-Eindecker), Lt. Zwickau (Mars-Eindecker.) und Ing. Schlegel (Avi^tik-Eindecker). Abends gegen 8 Uhr traf Lt. Sommer mit seinem Erler-Döppel-decker von Frankfurt kommend in Wiesbaden ein Nachdem bis abends der Goedeoker-Eindecker nicht eingetroffen war und Hirth durch Kleinholz ausschied, traten die Reserve-Flieger Suwelack und Carganico offiziell in den Wettbewerb ein. Leider ereignete sich noch spät abends am Schluß ein schwerer Unfall. Lt. Weyer war mit seinem alten. Aviatik-Doppeldecker zu einem Probeflug aufgestigen und wurde in der Kurve durch eine Böe zu Boden gedrückt. Hierbei wurde Lt. Weyer herausgeschleudert und erlitt einen Alm- und Beinbruch. Der Flieger befindet sich wohl. Der erste Ueberland-Flugtag, Sonntag der 11. Mai, Etappe Wiesbaden-Gießen-Cassel, begann leider mit recht unangenehmem Wetter. Der Start wurde erst 7:30 Uhr, nachdem Prinz Heinrich mit den Fliegern Rücksprache genommen hatte, freigegeben. Auf den Start verzichteten der am Vorabend abgestürzte Lt. Weyer, Hirth, Schröder und Oberlt. Linke. Der von Oberlt. Linke gesteuerte Apparat war von dem Flugzeugbesitzer zurückgezogen worden. Für Lt. Carganico, der die Abnahmebedingungen nicht erfüllt hat, wurde noch im letzten Moment der Start freigegeben unter der Bedingung, die Abnahmeprüfung in Coblenz nachzuholen. Prinz Heinrich hatte selbst die Oberleitung übernommen. In schneller Reihenfolge starteten die Flieger. Es war das reinste Hürdenrennen, wie die Apparate Zäune und Bäume passierten und erst nach und nach größere Höhen gewannen. Als erster startete Lt. von Hiddessen (ü. F. W. Eindecker) um 7:57 Uhr. Es folgten: No. 10 ^iiUGSPOET^ Seite 3o3 Oblt. von Beaulieu (Albatros-Doppeldecker) 8 : 04, Lt. Ganter (Rumpler-Taube) 8:08, Lt. Sommer (Euler-Doppeldecker) 8:1.1, Lt. Frh. von Thüna, (L. V. G.-Doppeldecker) 8:19, Lt. Hailer (Otto-Doppeldecker) 8:21, Ing. Schlegel (Aviatik-Eindecker) 8:22, Lt. Engwer (Gotha-Taube) 8:31, Lt. Zwickau (1). F. W.-Eindecker) 8:34, Oberlt, Donnevert (Rumpler-Taube) 8; ;-56, Ing. Suwelack (Kondor-Eindecker) 8:37, Lt. v. Haller (Otto-Doppeldecker) 8:41, Lt. Blüthgen (Mars-Doppeldecker) 8 : 43, Lt. Vierhng (Otto-Doppeldecker) 8 : 45, Lt. Joly 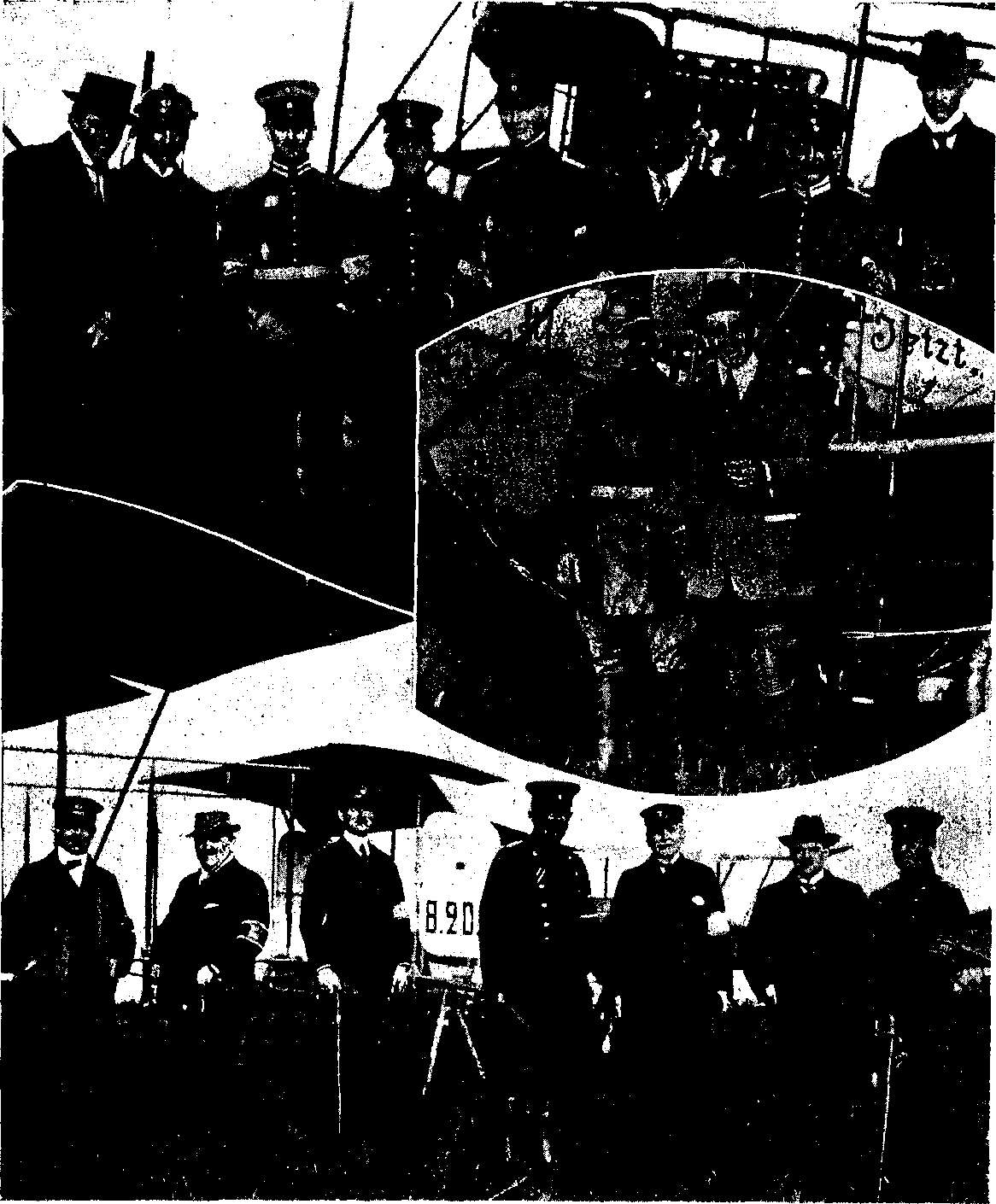 Prinz Heinrich-Flug 1913. Oben die Bayern, von links nach rechts: König, Lt. Leonhard, Lt. Vierling, Lt. v. Könitz, Lt. Frh. Kress von Kressenstein, Baierlein und Lt. Frh. von Haller. Rechts in der Mitte: Lt. Hailei und Lindpaintner. Unten: bekannte Persönlichkeiten von der Oberleitung, von links nach rechts: Dr. Isbert, Rittm.d.p. Engler, Hauptm. v. Selasinski, Dr. Linke und Oberst/t. v. Oldershausen. (Gotha-Taube) 8:53, Ing. Thelen (Albatros-Doppeldecker) 8:55 und Lt. Kastner (Albatros-Taube) 11:23. Leider mußte Lt. Vierling, auf den man große Hoffnungen gesetzt hatte, dicht hinter Wiesbaden, wegen Stehenbleibens des Motors, eine Notlandung vornehmen, wobei er den Apparat zerbrach. Er montierte ab und schickte die Maschine nach München zurück. Von den 18 gestarteten Fliegern absolvierten 17 vorschriftsmäßig die Zwischenlandung in Gießen. Suwelack hatte sich in die Gegend von Worms verflogen und kehrte infolge des großen Zeitverlustes nach Wiesbaden zurück, um den Flug nachmittags nochmals auszuführen. In Gießen landeten 9 : 09 Uhr Lt. Canter, 9 : 12 Lt v. Hiddessen, 9:18 Lt. Hailer, 9:20 Lt. Frh. v. Thüna, 9:23 Lt Sommer, 9:39 Lt. v. Haller, 9:45 Lt ßlüthgen, 9:45 Oberlt. v. Beaulieu, 9:51 Ing. Schlegel, 9 : 51 Ing. Thelen, 9 : 52 Oberlt. Donnevert, 9 : 53 Lt. Engwer. 10:01 Lt. Joly und 12:11 Lt Kastner. Lt. Hailer hatte beim Aufstieg in Gießen einen Fehlstart, wobei er seinen Apparat zerbrach. Er gab den Flug auf und sandte die Maschine nach München zurück. Trotz des heftigen Regenwetters und der böigen Winde war in Gießen bis nachmittags 3 : 30 Uhr der größte Teil der Flieger nach Cassel abgeflogen. In Cassel trafen ein: 12:19 Uhr Lt. v. Hiddessen, 12:25 Oberlt. Donnevert, 12:30 Lt. Frh. v. Thüna, 1:22 Lt. Joly, 2:15 Lt Canter, 2:57 Ing. Schlegel. Es folgten dann Oberlt. v. Beaulieu, Lt. v. Haller, Lt. Blüthgen, Ing. Thelen, Lt. Kastner, der dank der vorzüglichen Orientierung durch Oberlt Niemoeller, der schnurgerade Luftlinie hielt, die beste Zeit erzielte und schließlich um 5:55 Lt Carganico Lt. Carganico war als Ersatz für den in Wiesbaden ausgeschiedenen Lt. Weyer in den Wettbewerb getreten. Als letzter Flieger traf 7:44 bei strömendem Regen Suwelack in Cassel ein. Lt. Engwer hatte bej Bimmsroda eine Notlandung vornehmen müssen, desgl. Lt. Zwickau und Lt Sommer auf freiem Felde. Von den 18 in Wiesbaden abgeflogenen Flugzeugen waren somit 13 in Cassel gelandet. Wenn man die überaus schwierige Wetterlage, das anhaltende Regenwetter und die böigen Winde berücksichtigt, so ist dies eine wirklich hervorragende Leistung. 2. Etappe, Cassel-Coblenz. Am Montag den 12. Mai, dem zweiten Ueberlandflugtag, regnete es zwar nicht, aber ein undurchdringlicher Nebel verhinderte jegliche Orientierung. Der Start wurde daher von 5 Uhr auf 8 Uhr verschoben. Als erster startete um 7:4.? Uhr Oborlt. v. Beaulieu. Es folgten um 8.51 Lt Frhr. v. Haller, 8:52 Ing Thelen, 8:55 Lt. v. Hiddessen, 9:0 Lt. Frhr. v Thüna, 9:04 Lt. Canter, 9:24 Ing. Schlegel, 3:28 Lt. Kastner, 4:58 Ing. Suwelack und schließlich Lt. Sommer und Lt. Blüthgen Lt. Sommer war von seiner Notlandungsstelle, ca 10 km vor Cassel, mittags herüber geflogen. Ferner traf noch in Cassel ein 10:38 Lt Engwer. Am selben Tage waren in Wiesbaden noch aufgestiegen 5:16 Ing. Grade und 5:45 Lt. Zwickau. Grade machte bei Niederursel eine Zwischenlandung. Bei Oppenrad mußte er wieder notlanden, wo er liegen blieb. Lt. Coerper flog in sehr kurzer Zeit von Wiesbaden nach Gießen, wo er um 5 : 15 nach Cassel startete und 6 : 16 landete. Lt. Zwickau mußte in Homburg eine Notlandung vornehmen und traf erst 8 : 50 in Cassel ein. In Cassel starteten nach Coblenz 12 Flieger. Von diesen trafen in Coblenz ein 10 : 38 Ing. Thelen, 10 : 44 Oberlt. v. Beaulieu, 10 : 49 Lt. v. Haller, 11 : 11 Lt. v. Haddessen, 11 : 52 Lt, Frhr. v. Thüna, 11 : 12 Lt. Canter, 12 : 12 Lt Joly, 12 : 19 Ing. Schlegel, 6 : 37 Ing. Suwelack, 6 : 48 Lt. Carganico. Infolge ungünstiger Aufstellung der Flaggenposten in Coblenz geriet Thelen in ein Wasserloch, wobei er sich die Tragdecken, die Schraube nnd das Fahrgestell beschädigte. Der Coblcnzer Flugplatz wird den Fliegern überhaupt in unangenehmer Erinnerung bleiben, denn Lt Canter stellte seine Taube auf den Kopf und zerbrach Fahrgestell und Sehraube, Lt. v. Hiddesscn gleichfalls das Fahrgestell. Die Defekte waren jedoch so, daß sie am gleichen Tage repariere werden konnten. Die Zeit für Reparaturen wird in der Flugzeit, entsprechend den Wettbewerbsbedingungen, eingerechnet. Die bis zum 12. Mai in Coblenz nicht eingetroffenen Flieger erhalten einen Aufschlag von 50 °/o. Lt. Engwer mußte bei Cassel eine Notlandung vornehmen. Hierbei zerbrach der Apparat vollständig, so daß er aus dem Wettbewerb ausscheidet. Am 13. Mai startete Lt. Coerper vormittags 8 : 03 nach Coblenz. Er mußte infolge des strömenden Gewitterregens in der Nähe von Gießen eine Notlandung vornehmen. Nach einiger Zeit flog er weiter und erreichte Coblenz um 4 : 50 Lt. Sommer, der am gleichen Tage in Cassel startete, mußte bei Schörck eine Notlandung vornehmen. Um 8 : 45 stieg er dort wieder auf, wurde jedoch durch niedergehende Böen uu Boden gedrückt, wobei er den Apparat zerbrach und sich bedenklich verletzte. Bis zur Etappe Coblenz wurden von der Oberl itung die Leis- tungen der Flieger wie folgt bewertet: Bewertete Leistung Tatsächliche Zeit Thelen..... 219,7 223,5 Carganico .... 230,1 227.5 Canter..... 236,2 262.8 Joly...... 237,2 263^5 v. Thüna .... 239,4 243,5 v. Haller .... 239,5 244,7 v. Beaulieu . . . 244,7 248,9 Schlegel .... 257,7 269,9 v. Hiddessen . . . 316,8 322,0 In der Zahl für die bewertete Leistung in vorstehender Tabelle ist die Stärke des Motors, Belastung etc. berücksichtigt. Für die Plazierung sind selbstverständlich die Bewertungszahlen maßgebend. Zur 3. Etappe Coblenz—Karlsruhe starteten in Coblenz am 14. Mai um 4 : 37 Uhr Ing. Schlegel, 4 : 40 Lt. Frh. v. Haller, 4 : 41 Ing. -Suwelack, 4 : 43 Lt. Frh. v. Thüna, 4 : 47 Lt. v. Hiddessen, 4 : 52 Lt. Joly, 4 : 54 Lt. Canter, 5 : 06 Lt. Seite 356 Coerper, 5 : 09 -Lt. Carganico, t"> : 25 Ing. Thelen, 6 : 58 Lt. Kastner, 7 : 1 Oberlt. v. Beaulieu, 6 : 03 Stiploscheck. Die Kontrollstation Frankfurt wurde überflogen um 6:24 von Ing. Suwelack, 6:26 Lt. v. Haller, 6:36 Ing. Schlegel, 6:39 Lt. v. Thüna, 6:59 Lt. Coerper, der hier landete. Ferner überflog Frankfurt 6 : 47 Lt. Canter. 7:04 landete Lt. v. Hiddessen. Die Kontrollstation passierte hiernach 7:09 Lt. Joly. 7:38 flog Lt. v. Hiddessen weiter. Ing. Thelen passierte Frankfurt um 8:07. Lt. Carganico mußte infolge Motordefektes in Mainz, eine Zwischenlandung vornehmen. Er passierte Frankfurt 9:46. Notlandungen machten Ing. Thelen 8.50 bei Mörfelden infolge Motordefektes, Ing. Schlegel 9: 03 bei Neustadt a. Haardt, Lt. Kastner bei Zeilsheim vor Frankfurt. Oberlt. v. Beaulieu mußte in Mainz um 10:05 infolge starker Böen landen. Als erster traf in Karlsruhe ein Lt. v. Hiddessen um 10:03 Uhr. (Fortsetzung folgt) Der A. E. G.-Zweidecker. Die A. E. G. beschäftigt sich schon seit 2 Jahren mit dem Bau von Flugmaschinen und hat bei Nieder-Neuendorf ein Fabriksflugfeld eingerichtet. Zur Zeit werden mehrere für die Döberitzer Fliegertruppe bestimmte Doppeldecker eingeflogen. Die A. E. G. baut unter Verzicht auf sportliche Abnehmer lediglich Doppeldecker mit zusammenlegbaren Flügeln für die Militärverwaltung. Der Doppeldecker ist in nebenstehenden Abbildungen dargestellt. Der Zweidecker hat bei 14,5 m Spannweite der Tragflächen 44 qm Tragflächeninhalt. Das Unterdeck ist leicht V-förmig nach oben gestellt. An den seitlichen Enden des Oberdecks befinden sich verwindbare Stabilisierungsklappen. Zur Vermeidung von Luftwirbeln und Widerstand ist der nach hinten tropfenförmig auslaufende Rumpf von den Flügeln getrennt. Führer- und Gastsitze sind sehr tief in den Rumpf gelegt und vor den Einwirkungen des Schraubenwindes geschützt. Das Fahrgestell ist aus Stahlrohr autogen geschweißt und besitzt in der Mitte eine Stoßkufe bezw. ein abgefedertes Stoßrad. Die Achse mit den Laufrädern ist an Gummiringen in bekannter Weise elastisch aufgehängt. Zum Betriebe werden vorherrschend 95 PS 4 Zyl. N. A. G.Motoren für Schulmaschinen und neue 100 PS 4 Zyl. N. A. G.Motoren mit Schalldämpfern für Kriegsmaschinen verwendet. Durch die Verwendung von Schalldämpfern wird das lästige Beschlagen der Brillen vermieden und vor allen Dingen eine Geräuschverminderung erzielt. Der Motor kann vom Führer durch Anlasser und vom Beobachter durch Ankurbeln in Betrieb gesetzt werden. Die Tragflächen werden bei Landtransporten für das Unterstellen an beiden Seiten des Rumpfes nach hinten zusammengeklappt. Sie schließen den Rumpf mit ein und bilden ein festes Ganzes. Der .Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XII. 35 PS Graham White-Doppeldecker. 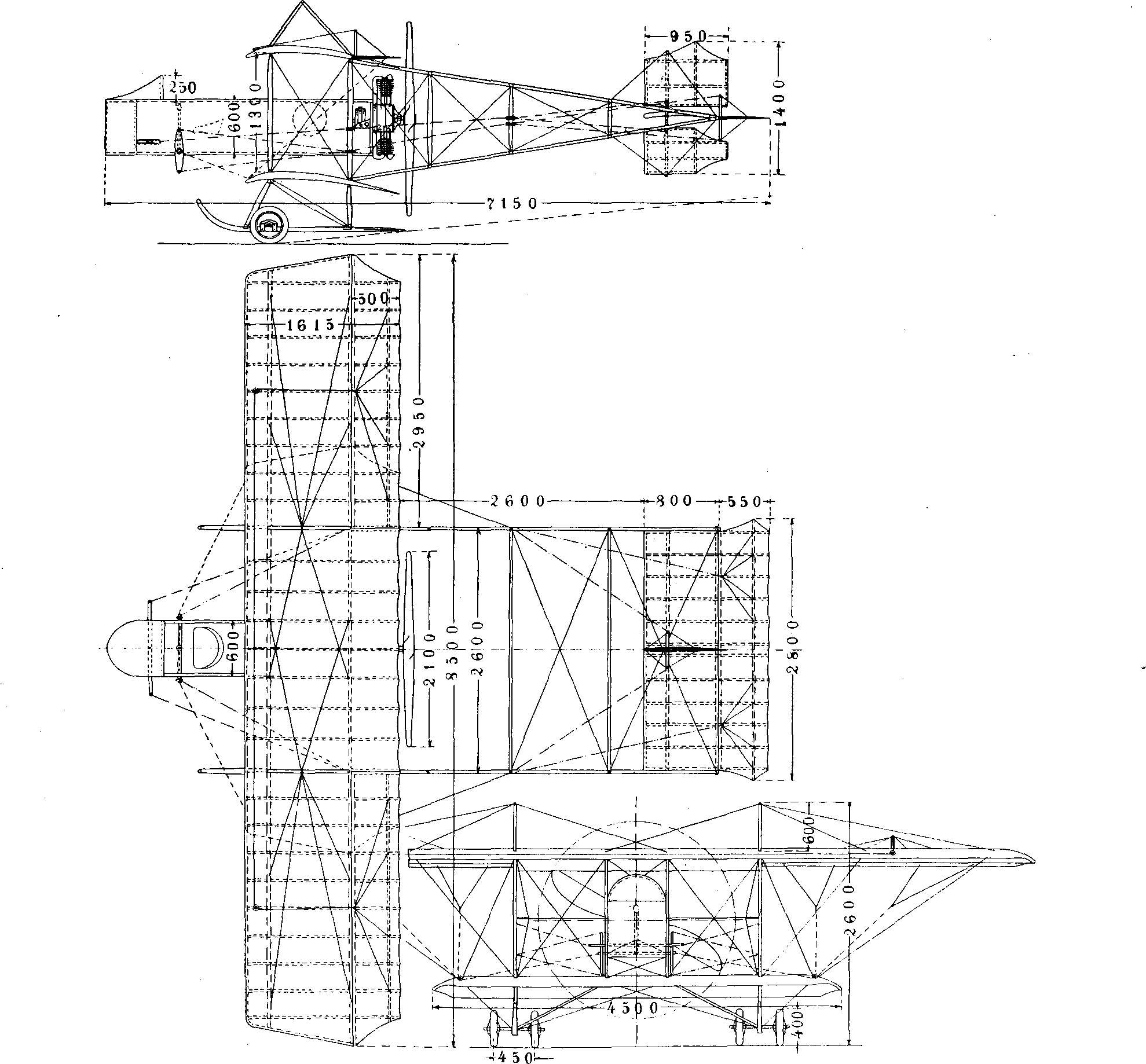 Nachbildung verboten. .Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XIII. 60 PS Boland-Doppeldecker. 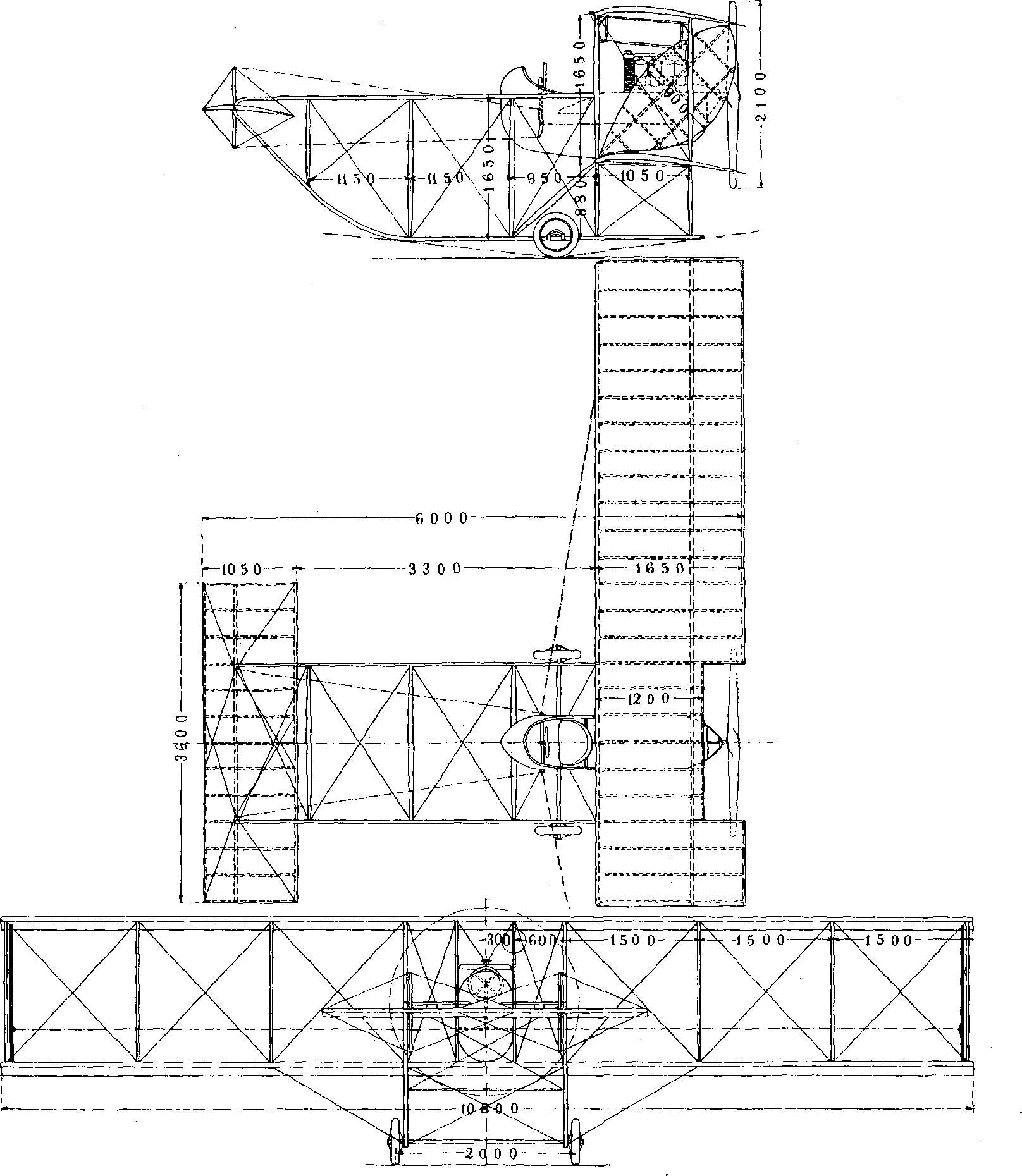 Nachbildung verboten. Baumbedarf beträgt entsprechend der bei den Eisenbahnen zulässigen Lademassen dann nur 2,8 m Höhe, 2,6 m Breite und 9,5 m Länge. Aus dem zusammengeklappten Zustande heraus kann der Abflug nach 3 Min. 20 Sek. erfolgen. Als Hilfsmannschaften sind hierfür 3 Personen nötig. Ein Justieren der Kabel ist hierbei- nicht erforderlich, 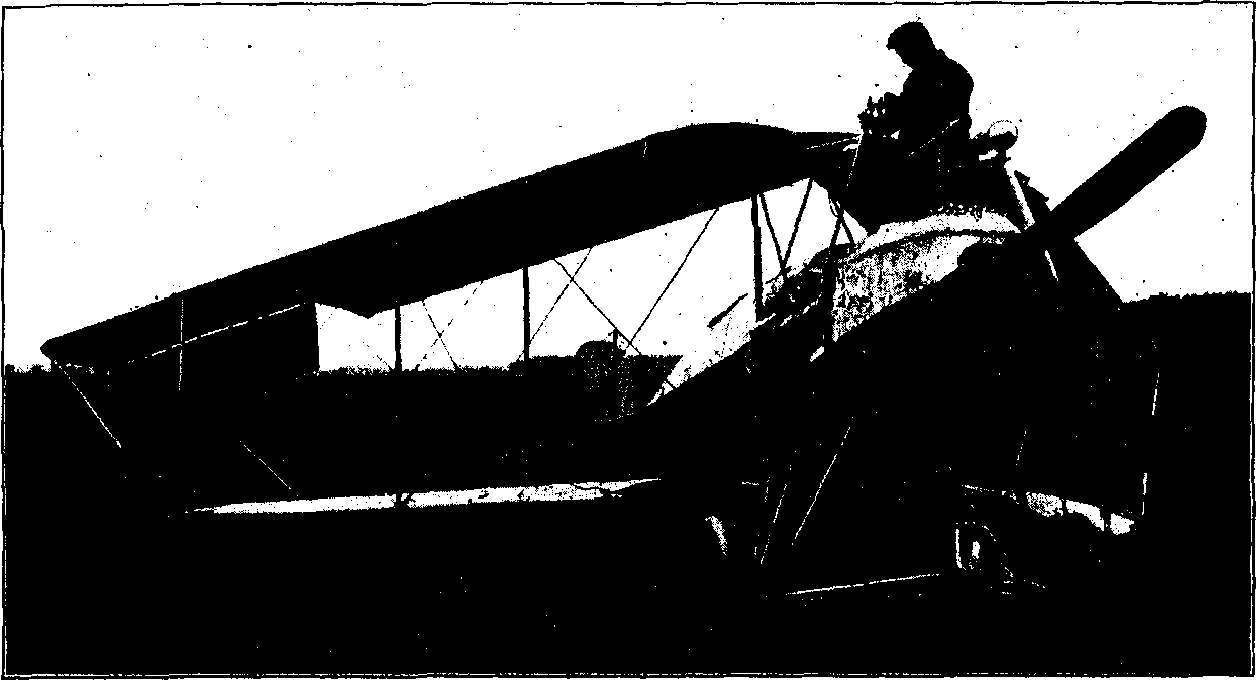 A. E. G.-Zweidecker während des Zarückklappens der Flügel. 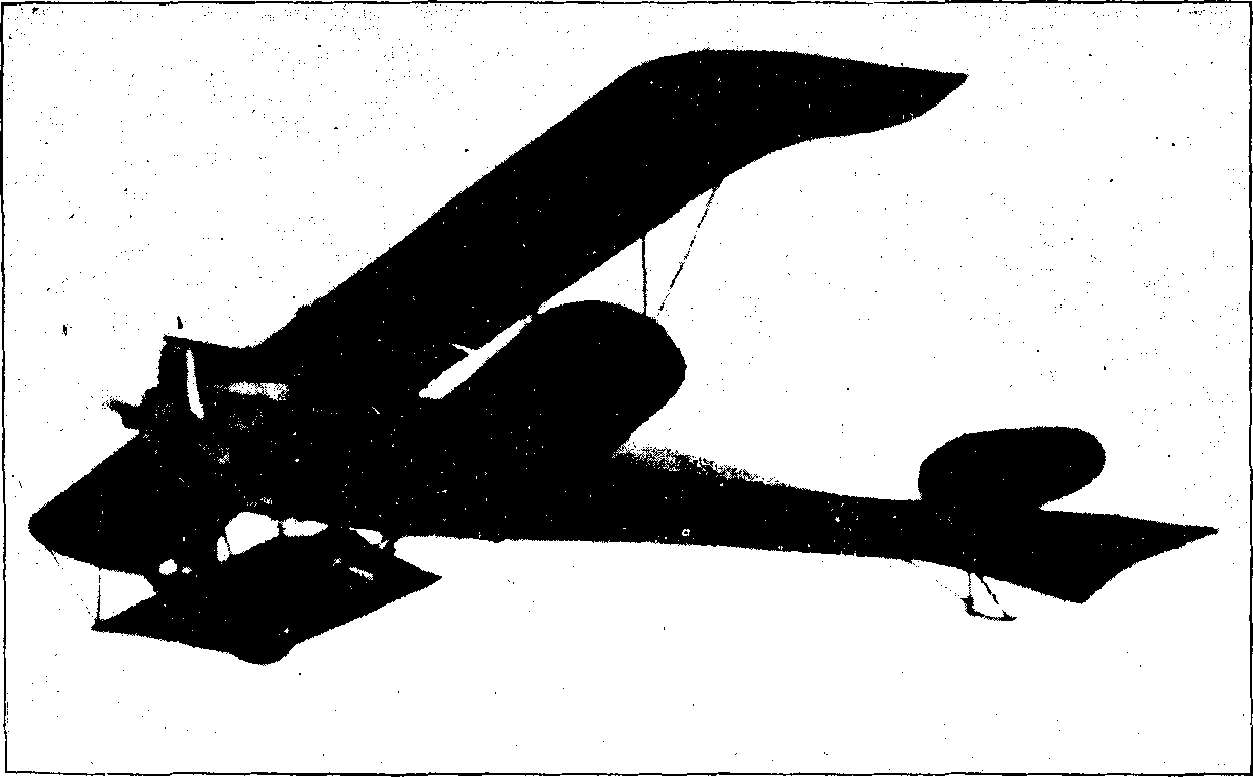 A. E. G.-Zweidecker im Fluge. da die notwendige VerSpannung beim Vorwärtsklappen von selbst wieder eintritt. Für große Landtransporte hingegen ist, um die Reifen zu schonen, ein zweirädriger leichter Transportwagen vorgesehen, auf welchem das komplett zusammengeklappte Flugzeug verladen werden kann. Dieser Transportwagen ist als Anhängewagen für Automobile mit Kupplung eingerichtet und mit wasserdichtem Stoff bespannt. Ein Zelt wird durch diesen Wagen vollständig überflüssig. Als Material wird in der Hauptsache außer zu den Tragrippen Stahlrohr verwendet. Bei den Versuchen auf dem Uebungsfeld zeigte die Maschine selbst bei starken Winden neben einer ausgezeichneten automatischen Stabilität eine hohe Geschwindigkeit und Steigfähigkeit. Das Gesamtgewicht der kompletten Maschine beträgt 720 kg. Der 35 PS Graham White -Doppeldecker. (Hierzu Tafel XII) Dieser Doppeldecker erinnert in seinen Grundzügen an den bekannten Farman-Doppeldecker. -Die Maschine stellt einen leichtsn Sporttyp dar. Der Konstrukteur Graham-White, ein erfolgreicher englischer Flieger der verschiedensten Flugzeug-Systeme, hat aufs neue gezeigt, daß man schon mit geringer Motorstärke ein zweckmäßiges Flugzeug bauen kann. Das Fahrgestell ist sehr breit gehalten. Es ruht auf zwei in Gummiringen aufgehängten Räderpaaren von 400 mm Durohmesser. Die weitausladenden Kufen werden durch 3 Streben von torpedo-elliptisohem Querschnitt abgestützt. Der Motorrumpf ist einsitzig und etwas über dem unteren Tragdeck angeordnet Derselbe ist oval zugespitzt, trägt vorn den Führersitz, in der Mitte den Benzinbehälter und hinten den dreizylindrigen 35 PS Anzani-Motor. Dieser treibt eine Levasseur Luftschraube vom 2,1 m Durchmesser und 1,5 m Steigung an. Die Tragflächen sind anderthalbdeckerartig angeordnet und haben 20 qm Flächeninhalt. Das Unterdeck hat eine Spannweite von 4,5 m, das Oberdeck eine von 8,5 m. Die ca. 3 m langen Ausleger des Oberdecks sind abnehmbar und mittels Spannsäulen von oben und unten verspannt. Die Tragzelle hat auf diese Weise nur 8 vertikale Streben, welche wie die Tragdeckholme, aus Spruce hergestellt sind. Das Profil der Tragdeoks ist das gleiche wie bei Bleriot XI und. steht im Fluge unter einem Einfallswinkel von 5". Die an den Auslegerdecks angebrachten Stabilisierungsklappen sind zwangläufig durch Seilzüge miteinander verbunden. Die Schwanztragfläche wird mit den Haupttragflächen durch zwei verjüngte Gitterträger verbunden. Dieselbe hat einen Flächeninhalt von 3,5 qm. Davon entfallen 2 qm auf die üämpfungsfläche und 1,5 qm auf das Höhensteuer. Das Seitensteuer ist um einen Stahlrohrmast inmitten der Dämpfungsfläche drehbar angeordnet. Dasselbe ist zweiteilig und teils oberhalb und teils unterhalb angebracht, Es hat insgesamt 1 qm Flächeninhalt Die Dämpfungsfläche ist für gewöhnlich auf 2° Einfallswinkel eingestellt 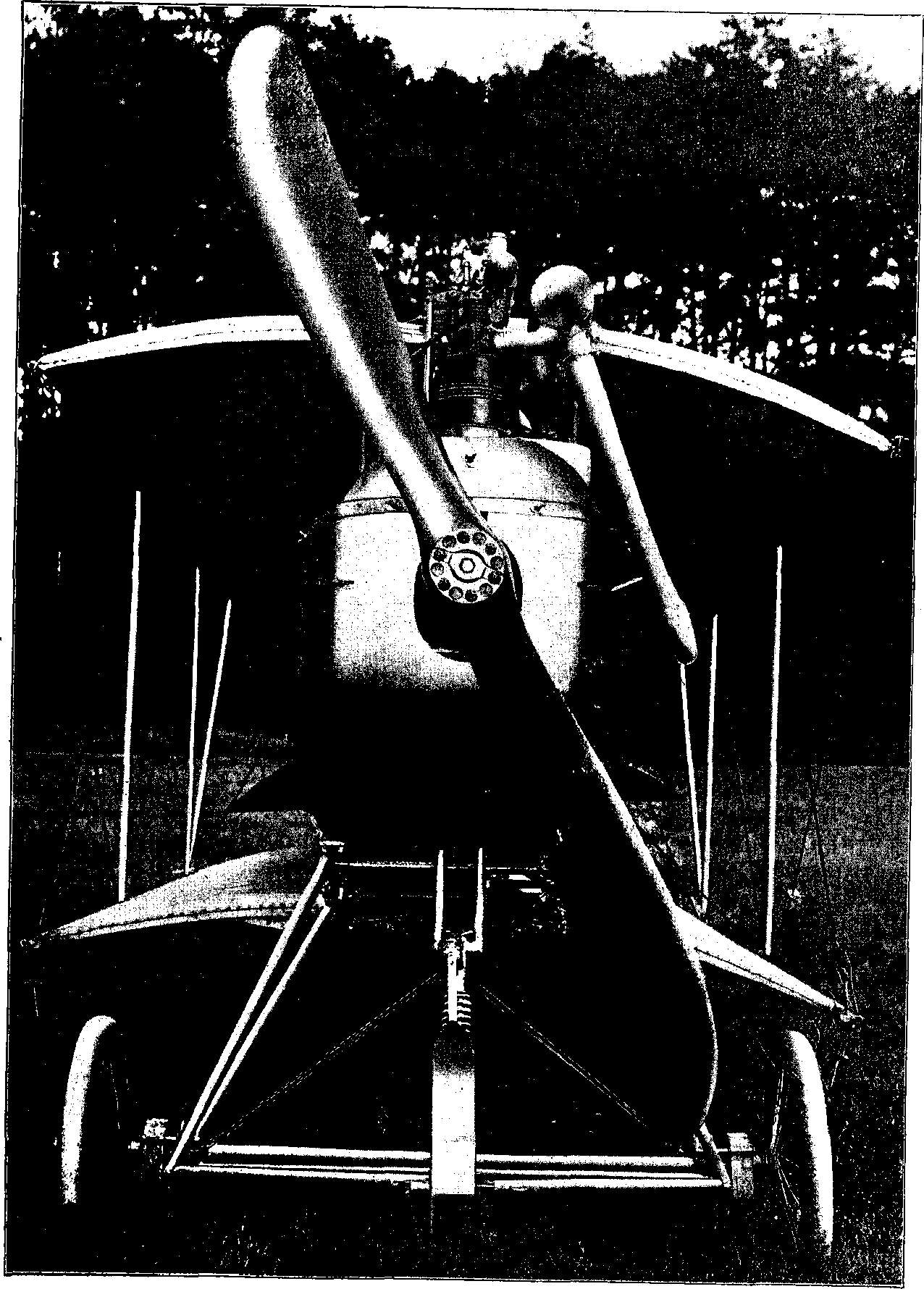 A. £. Q-Zweidecker. Ansicht von vorn in zusammengeklapptem Zustande. Das Gewicht der Maschine beträgt in betriebsfertigem Zustande incl. Führer, Benzin und Oel 275 kg. Ihre Geschwindigkeit soll 85 km pro Stunde betragen. Auf Wunsch wird dieselbe Maschine mit einem 50 PS Gnom-Motor geliefert. Der Boland-Doppeldecker (Hierzu Tafel XIII.) ist nach dem Ententyp gebaut. Frank Boland, Inhaber der Aeroplan-und Bolandmotor-Co. U. S. A., der Konstrukteur dieser Maschine, hat hierbei ein neuartiges Stabilisierungselement in Anwendung gebracht. Die Haupttragflächen haben 35 qm Flächeninhalt. Längs der äußersten Vertikalstreben an den Tragdeckenden sind zwei blattförmig ausgeführte Hilfsflächen angeordnet, die um eine schräge Stahlrohrachse nach innen schwingen. Dieselben dienen zur Erhaltung der Querstabilität und zur Seitensteuerung. In der Mitte der Tragflächen ist der vorn und hinten verjüngte Motorrumpf eingebaut. Vorn befindet sich der Führersitz, in der Mitte ist Raum für einen Begleitersitz und hinten die Motoranlage. Dieselbe besteht aus einem wassergekühlten 8 Zylinder-Bolahd-Motor, auf dessen Welle eine Schraube von 2,1 m Durchmesser sitzt. Der Motor leistet bei 1250—1500 Umdrehungen pro Minute 60 PS und wiegt 120 kg. Das kombinierte Benzin- und Oelgefäß ist wie bei Wright angeordnet. An der vorderen Bodenwand desselben befindet sich ein Einfüllstutzen. Das Fahrgestell ruht unterhalb der Haupttragzelle auf zwei durch Gummiringe abgefederten Rädern von 500 mm. Die Kufen sind nach vorn verlängert bis zum Höhensteuer und bilden im Verein mit einem horizontal laufenden Holm einen Gitterträger. An der Spitze desselben liegt das Höhensteuer, von 3.8 qm Flächeninhalt. Die Stabilität der Maschine wird durch das bekannte Prinzip der Neigungswinkel-Differenz erhalten. Die Steuerung des Apparates erfolgt vom Führersitz aus mittels der vor- und rückwärtsschwenkbaren Steuersäule und Drehen des Handrades. In derselben Ausführung gelangt ein Wasserdoppeldecker zur Ausführung. Die Schwimmer werden hierbei unter den gitterträgerartig ausgebildeten Kufen angebracht. Goedecker Militär-Eindecker 1913. Bei einer Gesamttragfläche von 36 qm hat das Flugzeug eine Spannweite von 14 m und eine Länge von .11 m. Charakteristisch an dieser Maschine ist die mögliche Vermeidung von Spanndrähten und Verminderung des Luftwiderstandes durch günstige Formgebung- Außerdem ist hauptsächlich darauf Wert gelegt, die Flügel leicht abmontieren and den Motor mit seinen sämtlichen Zubehörteilen bequem aus dem Rumpf nehmen zu können. Der Rumpf ist ganz ohne Spanndrähte und Blechbeschläge zusammengefügt. Er ist vorn vierkantig und läuft nach hinten in dreikantigem Querschnitt zu. Die Längsträger, Querspanten und Schottwände werden durch 3 mm starkes Fournier zusammengehalten und bilden somit ein elastisches Ganzes. In diese Verkleidung sind zwei Balken, welche untereinander versteift sind, ähnlich einer Schublade eingeschoben. Auf diesen beiden Balken ruht der Motor mit seinen sämtlichen Zu- 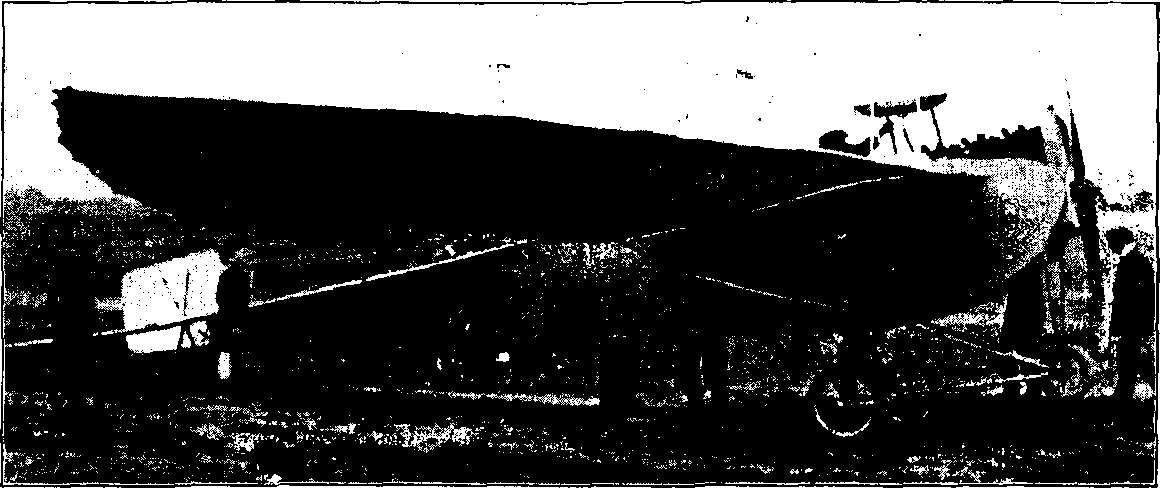 Qoedecker-Militär-Eindecker. behörteilen, der Kühler, sämtliche Steuerhebel und die Sitze für Führer und Fluggäste. Diese Anordnung ermöglicht ein leichtes und bequemes Auswechseln der kompletten Motorenanlage bei Beschädigungen. Die Konstruktion der Flügel insbesondere der Flügelträger ist wie bei allen Goedecker Maschinen aus Stahlrohr, ohne obere Verspannung. Die Bespannung besteht aus Segeltuch mit eingeschobenen Bambusstäben, die an den Enden sehr elastisch wirken. Um die Verwindungsklappen bei Transporten nicht zu beschädigen, können die Bambusse herausgezogen und der Stoff zusammengefaltet werden. Die Flügel sind am Rumpf mit 3 Charnierbolzen befestigt und können daher leicht abgenommen werden Das Fahrgestell ist das seit Jahren bewährte sehr elastische und stabile Goedecker Fahrgestell mit einem vorderen Stoßrad, das bereits Nachbildungen gefunden hat. Die Steuerung ist die normale Militärsteuerung. Seite 302 „FLUGS l'ü KT. No. 10 Der dramatische Entscheidungskampf um den „Pommery-Pokal". Von unserem Pariser Korrespondenten. Es war begreiflich, daß je näher der Termin für die endgiltige Zuteilung des „Pommery-Pokals" rückt, diese Trophäe umso heftiger und nachhaltiger umstritten werden wird, weil bekanntlich nach dem Reglement derjenige Flieger, der den Pokal im letzten Halbjahr des Jahres 1913 an sich bringt, ihn als definitives Eigentum zugesprochen erhalten wird. Freilich handelte es sich bei dem diesmaligen Kampfe nur erst um das vorletzte Halbjahr, sodaß man die zeitweilig dramatischen Vorgänge, die sich in diesem Kampfe abgespielt haben, gewissermaßen als Generalprobe zu dem bevorstehenden Schlußkampfe ansehen kann. Sie sind aber schon an sich in hohem Maße interessant, als dabei Flugleistungen zuwege gebracht worden sind, wie sie vor noch nicht langer Zeit als geradezu irrealisierbar angesehen worden wären und wie sie den gewaltigen Fortschritt, welchen das moderne Flugwesen in letzter Zeit vollbracht hat, in deutlicher und hoffentlich lehrreicher Weise vor Augen führen. Nachdem schon früher, wie bereits gemeldet, hier und da Versuche um die diesmalige Halbjahrprämie (Ablaufsfrist 30. April) unternommen worden sind, hat der eigentliche Kampf mit dem denkwürdigen Fluge Daucourts nach Berlin eingesetzt, durch den sich der genannte Flieger mit 920 km Tagesflug in direkter Linie zum ersten Anwärter auf die Prämie gemacht hatte. Dann unternahm es Gilbert, die Daucourtsche Leistung zu drücken, was ihm bekanntlich durch seinen grandiosen Flug von Paris nach Medina del Oampo, in der Nähe von Saragossa, eine Flugdistanz von 1020 km, gelang. Diese beiden Leistungen, welche die flugsportliche Welt in berechtigte Bewunderung setzten, waren das Signal für einen Massenluft-kampf, wie ihn das Flugwesen bisher nicht gesehen hat. Guillaux, Vedrines, Audemars, Letort, Legagneux, Janoir, Seguin, Brindejonc des Moulinais, wer zählt sie alle, die mit einem nie gekannten Eifer daran gingen, um den Pokal zu starten. Die interessanteste Flugleistung, die dabei zu Tage gefördert wurde, ist diejenige des bekannten Fliegers Guillaux, welcher einen metallischen Eindecker Clement-Bayard (Gewicht, einschließlich des 90 kg wiegenden 70 PS Clerget-Motors, nur 350 kg) steuerte. Guillaux flog am 28. April um 4 Uhr 42 früh von Biarritz ab und wandte sich nach Bordeaux, wo er kurz vor 6 Uhr landete. Die Flugdistanz bis dahin betrug 180 km. Um 6,30 Uhr flog Guillaux von Bordeaux ab und gelangte, über Angouleme hinwegsegelnd, nach Villacoublay, in der Nähe von Paris, woselbst er um 10 Uhr 35 seine Landung vornahm. Nachdem er sich aufs neue verproviantiert hatte, setzte Guillaux um 12 Uhr 36 seinen Flug fort. Um 2 Uhr landete er in dem belgischen Städtchen Ath, weil er durch heftiges Uebelbefinden dazu gezwungen war. Zwei Stunden später hatte er sich so weit erholt, um seine Reise wieder aufnehmen und bis nach Kollum, einer kleinen holländischen Ortschaft im Friesischen, an der Leeuwardener Bai, zu gelangen, wo er um 7 Uhr landete. Er hatte damit an einem einzigen Tage eine Flugdistanz von 1253 km hinter sich gebracht! An demselben Tage unternahm Audemars zum zweiten Male den Versuch, von Paris nach Berlin za fliegen. Er ging von Villa,-coublay um 1/25 Uhr ab und landete in Hannover um 5 Uhr abends. Er hatte durch einen Benzindefekt eine lange Versäumnis gehabt, so daß er in Hannover den Flug aufgab. Letort, kurz nach Audemars in nordöstlicher Richtung abfliegend, war gezwungen, in Vise, einem zwischen Lüttich und Brüssel gelegenen Orte, zu landen, wobei er seinen Apparat beschädigte. Noch ein dritter Bewerber trat an dem gleichen Tage in die Schranken : Seguin, der durch sein Flugprojekt der Ueberquerung des Mittelländischen Meeres in letzter Zeit viel von sich reden gemacht hat, flog, mit seinem Mechaniker an Bord, vom Flugfelde bei Marseille ab und landete ein erstes Mal zu Dijon, von wo er bis Mourmelon-le-Grand weiterflog, wo er um 2 Uhr 30 anlangte. Um 3 Uhr flog er von dort ab, in der Absicht, Kopenhagen zu erreichen. Doch erreichte er nur Namur, nachdem er 900 Kilometer zurückgelegt hatte, was einen neuen Passagier-Weltrekord darstellt! Vedrines wollte von Lyon aus bis nach Edinburgh fliegen. Er verließ zu diesem Zwecke Villacoublay auf dem Luftwege, um sich nach Lyon zu begeben, wo er, nach Zwischenlandung in Nevers, auch glücklich anlangte, um am folgenden Tage die Luftreise zu unternehmen. Aber noch andere Flieger hatten für diesen Tag große Flugunternehmungen vorbereitet. Brindejonc des Moulinais wollte über Lüttich, Bremen, Kopenhagen nach Stockholm fliegen; Gilbert wollte auch seinerseits den Flug nach der schottischen Hauptstadt unternehmen; Konstantin Schemel wollte von Chantilly aus abfliegen, um Deutschland von Westen nach Osten zu überqueren; Marty wollte Danzig zu erreichen suchen, und Grazzioli ging ohne vorgeschriebene Flugroute davon. Mit atemloser Spannung wartete man auf Nachrichten über das Schicksal der wagemutigen Flieger, die noch am letzten Tage der Bewerbsfrist den Kampf aufnahmen. Namentlich um das Schicksal Brindejonc des Moulinais war man sehr beunruhigt, weil von ihm seit seiner Landung in der Nähe von Lüttich keine weitere Nachricht eingetroffen war. Endlich traf die Meldung ein, daß Brindejonc vom Flugplatze von Ans, nahe Lüttich, nachdem er sich verproviantiert hatte, um 8 Uhr 15 in der Richtung nach Holland weitergegangen sei. Er gelangte bis Renslage, in der Provinz Hannover, von wo er am letzten Sonntag erst nach Bromen weiterging, um von dort den Versuch, nach Kopenhagen zu gelangen, zu unternehmen. Vedrines ging um 4 Uhr 30 von Lyon ab und landete zuerst auf dem Flugplatz von Nevers, von wo er nach zehn Minuten Aufenthalt seine Reise fortsetzte, und zwar bis Paris. Auf der Strecke von Lyon nach Paris hat Vedrines, welcher jetzt einen Moräne - Eindecker steuert, den Geschwindigkeitsrekord geschlagen, indem er die Entfernung von 400 km in 3 Stunden 10 Minuten zurücklegte und so den bisherigen Rekord, der Gilbert gehörte, um 10 Minuten schlug. Nach kurzem Aufenthalt in Villacoublay setzte Vedrines seinen Flug in nördlicher Richtung fort Aber das Wetter hatte sich plötzlich verschlechtert und der Flieger geriet in einen heftigen Regensturm, der in zwang, beträchtliche Höhen aufzusuchen, um sich aus dem Wolkenmeer, das ihn einhüllte, zu befreien. Er wollte nach Boulogne fliegen, war aber seiner Flugrichtung nicht mehr sicher und landete, um sich von neuem zu orientieren. So kam es, daß er in Rouen niederging. Vedrines erkannte nun, daß sein Versuch, noch an diesem Tage Schottland zu erreichen, keine Aussicht auf Erfolg habe und gab deshalb auf. Auch Gilbert war bei seinem Versuche das Opfer des Wetters. Als er morgens früh Amberieu verließ, war er durch einen leichten Südwind begünstigt. Als er aber in das Seinebecken geriet, stellte sich heftiger Wind ein, der nach Westen gedreht hatte, in vier Stunden ging Gilbert ohne Zwischenlandung von Amberieu bis nach Corbeaulieu, in der Nähe von Compiegne. Nachdem er sich dort verproviantiert hatte, flog er um 8 Uhr 30 wieder ab. In der Nähe von Doullens wurde er von einem Wirbelsturm erfaßt und arg geschüttelt, sodaß er Kehrt machte und wieder nach Gorbeaulieu zurückkehrte. Hier entschloß auch er sich, von einem weiteren Kampfe gegen die Elemente abzustehen. Grazzioli war des morgetis von Issy-les-Moulineaux abgeflogen und hatte sieh nach Norden gewendet. Zu Beaucamps, im Departement Somme, war Grazzioli gezwungen, zu landen, da ihm das Benzin ausging. Bei der Landung wurde das Flugzeug völlig zerstört, und auch der Flieger erlitt einige Verletzungen, die zum Glück nicht bedenklich sind. Die beiden andern Pommery-Flieger, Marty und Schemel, suchten den Westwind sich nutzbar zu machen. Schemel hatte die Absicht, nach Rußland zu fliegen; er mußte aber nach zurückgelegten 400 km in der Nähe von Köln landen. Schemel steuerte bei diesem Fluge einen Eindecker Schemel-Ruchonnet mit 70 PS Gnom-Motor. Marty, der letzte derjenigen, welche noch in zwölfter Stunde die Trophäe an sich zu bringen suchten, flog auf seinem Zweidecker Caudron 100 PS Anzani-Motor um 4 Uhr 26 vom Flugfelde von Le Crotoy ab und nahm sofort die Richtung nach Deutschland hin; er hatte Benzin und Oel an Bord, das für einen Flug von zehn bis elf Stunden genügend war. Doch als er bis in die Nähe von Düsseldorf gelangt war, geriet Marty in einen heftigen Sturm, der ihn zur Landung zwang. Damit war die Bewerbsfrist des Pommery-Pokals abgelaufen und das Resultat des Kampfes war demnach, daß Guillaux mit seinem Fluge nach Kollum, 1253 km, Sieger für dieses Halbjahr geblieben ist. Nun bleibt noch die letzte Halbjahrsprämie, die des zweiten Semesters 1913, zu bestreiten und mit ihr, wie schon vorher erwähnt, der endgiltige Besitz des Pokals. Daß diese bevorstehende Entscheidung sehr interessante Kämpf e und Flugleistungen bringen wird, läßt sich mit Sicherheit voraussetzen. Man braucht sich nur die Entwicklung des Flugwesens an den laufenden Ergebnissen des „Pommery-Pokals" anzusehen, welcher bekanntlich bis zum Jahre 1911 zurückreicht. Wir geben nachstehend zur leichteren Uebersicht die Flugleistungen der Sieger um die Pommery-Prämie in den einzelnen Halbjahren seit Schaffung des Bewerbs, sowie im Anschluß daran die Hauptleistungen der Flieger, die in diesem soeben abgeschlossenen ersten Halbjahr 1913 sich um die Prämie bewarben: 1. Halbjahr 1911 2. „ 1911 1. „ 1912 2. „ 1912 1 „ 1913 Vedrines, Paris-Poitiers, 336 km Vedrines, Paris-Angouleme, 400 ,, Bedel, Villacoublay-Biarritz, 645 ,, Daucourt, Valenciennes-Biarritz, 852 ,. Guillaux, Biarritz-Kollum, 1253 ,, Die besten Flüge dieses Halbjahrs: 16. April: Daucourt, Paris-Berlin, 910 km 16. ,, : Audemars, Paris-Wanne, 525 ,, 24. „ : Gilbert, Paris-Medina, 1020 „ 24. ,, : Legagneux, Paris-Angouleme, 420 ,, 27. „ : Guillaux, Biarritz-Kollum, 1253 „ 28. ,, : Audemars, Paris-Hannover, 700 ,, 28. „ : Letort, Paris-Vise, 300 „ 28. „ : Seguin, Marseille-Namur, 900 „ 29. ,, : Brindejono, Paris-Quakenbrück, 600 „ 30. ,, : Grazzioli, Issy-Neuville, 125 „ 30. ,, : Vedrines, Lyon-Rouen, 525 ,, 30. „ : Gilbert, Amberieu-Doullens, 524 „ 30. „ : Schemel, La Vidamee-Köln, 400 „ 30. ,, : Marty, Le Crotoy-Düsseldorf, 375 „ Nur die oben angeführten hauptsächlichsten Flüge innerhalb der letzten vierzehn Tage des Pommery-Pokals stellen also eine Flugdistanz von nicht weniger als nahezu 9000 km dar! Und schon beginnt von neuem das Ringen; Guillaux will seine eigene Leistung überbieten, Vedrines und Legagneux haben sich bereits als Konkurrenten für das letzte Halbjahr einschreiben lassen. Außerdem werden sich noch andere zahlreiche Flieger an dem Schlußkampf beteiligen. Wie heiß dieser werden wird, geht schon daraus hervor, daß es sich darum handelt, noch mehr zu leisten, als Guillaux mit seinen 1253 Kilometern! Zum Schlüsse seien noch einige persönliche Eindrücke Guillaux' auf seinem denkwürdigen Fluge erwähnt: Was den Flieger besonders frappiert hat, war die phantastische Geschwindigkeit, mit der er von Biarritz nach Bordeaux flog. Der Wind trieb ihn mächtig und er hatte nur eine Stunde für die 180 km gebraucht. Sensationell war der Wiederabflug von Villacoublay: Die Sonne schien hell und verursachte sehr heftige Hitzestrahlen und Wirbel. Guillaux hatte umso schwerer gegen sie zu kämpfen, als er den kompleten Vorrat von Benzin und Oel an Bord genommen hatte, wodurch das Flugzeug wesentlich belastet war. Oberhalb des Waldes von Compiögne, wo Guillaux stark hin und hergeworfen wurde, begann er, sich unwohl zu fühlen, sodaß er die erwähnte Landung vornehmen mußte. Von Breda ab hatte Guillaux keine Orientierungskarte mehr ; er war dann lediglich auf seinen Kompass angewiesen. In dichten Nebel eingehüllt, wurde Guillaux nach der Nordsee angedrängt und als er die unendliche Wassermasse unter sich gewahrte, bog er scharf nach Osten ab und gelangte so wieder an die Küste, von der aus er bald Kollum erreicht hatte. Guillaux meint, daß, wenn die zurückgelegte Entfernung auch nur 1253 km beträgt, er doch mindestens 1550 km geflogen ist. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Das französische Flugwesen hat neuerdings eine Glanzperiode durchgemacht, die von seiner gewaltigen Entwicklung beredtes Zeugnis ablegt. An anderer Stelle ist von den großartigen Flug- Seite 366 „F i. CG.-U'ORT. No. 10 leistungen die Rede, welche der Schlußkampf um die diesmalige Halbjahrsprämie des „Pommery-Pokais" gezeitigt hat, abei der mit dem beginnenden Frühling einsetzende Eifer der französischen Flieger hat sich damit nicht genügen lassen ; man hat die Arbeit an allen Punkten fortgesetzt und den vorerwähnten großen Erfolgen neue Ruhmesblätter angereiht. Daß Brindejonc des Moulinais seinen Flug von Bremen aus fortgesetzt hat, ist wohl aus der Tagespresse bekannt. Er entschloß sich, die Heimreise zu einer Tour Bremen-Brüssel-London umzugestalten und flog in der Tat am Freitag früh um 8 Uhr 40 von Bremen ab. Er gelangte um ■/« 11 Uhr nach Wanne, wo er auf dem dortigen Flugplatze landete, um eine halbe Stunde später seinen Flug wieder aufzunehmen. Um Mittag kam er nach Lüttich. von wo ör, nachdem er sich aufs neue verproviantiert hatte, wieder abflog. Nach etwa 2 km aber geriet er in einen Gewittersturm, der ihn nötigte, in einem Feld zu landen, setzte aber später seine Reise fort und landete um 3 Uhr in Louvain, um schließlich gegen */8 7 Uhr auf dem Manöverfelde von Etterbeck bei Brüssel seinen Flug zu beenden. Die zurückgelegte Distanz Bremen-Brüssel beträgt 450 km. Einon bemerkenswerten Flug vollbrachte Gilbert am letzten Mittwoch; er flog von Villacoublay bis Clermont, 390 km ohne Zwischenlandung in 3 Stunden 25 Minuten, obgleich er stellenweise einen hinderlichen Gegenwind hatte. Gilbert steuerte auch bei dieser Gelegenheit einen Morane-Eindecker. Am 8. Mai stellte Frangeois einen neuen Höhenrekord mit sechs Passagieren auf; er erhob sich auf dem Flugfelde von Chartres auf einem Savary-Zweidecker, 11J PS Salmson-Motor, mit sechs Passagieren an Bord, auf 850 m. Der Flug dauerte 1 Stunde 13 Minuten. Auch das Militärflugwesen hat in letzter Zeit mit intensiver Tätigkeit, begonnen und namentlich hat ein junger Offizier, der Leutnant B r o c a r d, vom Flugzentrum Reims, durch einige hervorragende Leistungen viel von sich reden gemacht. Nachdem Brocard vor einigen Tagen in Reims auf einem seiner dreisitzigen Deperdussin, mit zwei Unteroffizieren an Bord, sich während eines Fluges von 1 '/a Stunde auf 230Q m erhoben hatte, unternahm er dieser Tage, mit einem Passigier und Bagage an Bord, einen Flug von Reims nach Buc. Noch bewerkenswerter sind vielleicht die Flüge des Leutnants de Laborde. Dieser flog von Buc ab, in der Absicht, sich nach Dover zu begeben, wo sein Bruder weilte. Er ging am Donnerstag nachmittag um 2 Uhr 20 von Buc ab, langte um 3 Uhr 50 in Le Crotoy an, flog von dort um 4 Uhr 40 wieder ab und landete um 5 Uhr 35 glatt in Dover. Am nächsten Tage führte er den Heimflug auf demselben Wege und in derselben Weise aus; jeder dieser Flüge umfaßt eine Strecke von rund 300 km. Leider sind auch wieder einige Unfälle vorgekommen. Auf dem Flugfelde von Reims nahm eine Kommission von Marineoffizieren die Besichtigung des dortigen Luftgeschwaders vor und zahlreiche gelungene Flüge waren bereits vollbracht, als Simon, mit einem Soldaten an Bord, seinen Abflug nahm, um der Kommission seinen Apparat vorzuführen. Eben war er im Begriff, seine beliebten Achter-Flüge auszuführen, als der Apparat plötzlich aus unbekannten Ursachen mit der Spitze nach unten auf die Erde stürzte. Beide Insassen der Maschine wurden schwer verletzt. Noch schlimmer verlief ein Unfall in Saint-Cyr, wo der Sergeant Battini aus 20 Meter abstürzte und seinen sofortigen Tod fand. Ein besonders glanzvolles Ereignis war eine Parade von 94 Flugzeugen auf dem Flugplatz von Buc aus Anlaß der Anwesenheit des Königs von Spanien. Die endlose Reihe schmuck hergerichteter Flugzeuge mit ihren Fliegern und Bedienungsmannschaften inmitten des festlich geschmückten Flugplatzes und der großen Zahl glänzender Uniformen war in  Flugzeugparade vor dem König von Spanien auf dem Flugplatz Buc der Tat ein reizvolles und imposantes Bild. Das drückten auch die hohen Besucher gegenüber dem General Hirschauer wiederholt aus. Aber nicht nur das Militärflugwesen hatte an dem Erfolg teilgenommen, auch das Zivilflugwesen hatte man dazu herangezogen, schon um die Industrie den spanischen Gästen in Erinnerung zu bringen, und als nach der Parade die Flieger vor dem Könige evolutionierten, waren es unbestritten die Zivilflieger, besonders Chevillard und Garros, welche durch ihre grandiosen Leistungen das allgemeine Staunen hervorriefen. Zeitweise erregte ihr Wagemut sogar Furcht, denn der General Hirschauer brummte deutlich in seinen Bart: „Wahnsinnig sind sie, sie werden noch eine Katastrophe herbeiführen. Es ist das erste aber auch das letzte Mal, dass ich gestattet habe, dass die Zivilflieger an einem militärischen Flugfeste teilnehmen !" Noch mehr Erregung herrschte in den offiziellen Kreisen, als die vom spanischen König wegen ihrer Leistungen beglückwünschten Zivilflieger sich zumeist in wenig hoffähiger und zeremonieller Weise ausdrückten. Den Vogel schoss auch diesmal der unvermeidliche Vedrines ab, der dem König, der ihm seine Anerkennung über einen gelungenen Flug ausdrückte, schlicht und einfach erwiderte: „Na, bekommen Sie nicht auch Lust, es mit dem Fliegen zu versuchen und sich.einen Apparat anzuschaffen?" Der König ist ihm die Antwort darauf schuldig geblieben. Jetzt ist nun, wie wir bereits angekündigt hatten, die französische Regierung daran gegangen, die Reglementierung des Luftverkehrs durch Gesetz vorzunehmen. Der Minister der öffentlichen Arbeiten hat den von der Sonderkommission ausgearbeiteten Entwurf dieser Tage der Deputiertenkammer unterbreitet, die voraussichtlich schon nach den Feiertagen mit der Beratung beginnen wird, sodass eine baldige Annahme des Gesetzes zu erwarten ist. Interessant sind die Motive zu dem Regierungsentwurf, in denen eingehend dargelegt wird, welch eine gewaltige Ausdehnung das Flugwesen in Frankreich innerhalb der letzten fünf Jahre genommen hat. Die Zahl der vom Aero-Club erteilten Fliegerpatente betrug im Jahre 1909 17, in 1910 328, in 1911 359 und in 1912 490. Die Anzahl der in Frankreich konstruierten Flugzeuge belief sich im Jahre 1910 auf 800, in 1911 auf 1350, in 1912 auf 1800. Seit dem Jahre 1910 trage das Flugwesen in glorreicher Weise an der nationalen Verteidigung des Landes bei. Es habe sich daraus die Notwendigkeit ergeben, zum Schutze der Flieger und der Oeffentlichkeit eine strenge Reglementierung vorzunehmen und die Regierung habe hervorragende Fachleute und Rechtsgelehrte mit den Vorarbeiten betraut gehabt. Neben der allgemeinen Sicherheit habe aber die Regierung vor allen Dingen das Ziel verfolgt, keinerlei Bestimmungen zu treffen, welche die nationale Flugzeugindustrie in ihrer Entwicklung hemmen oder stören könnten. Eine so junge Industrie brauche und verdiene die tatkräftigste Förderung und man müsse ihr die volle Entwicklungsfreiheit lassen, soweit diese mit den Interessen und der Sicherheit der Allgemeinheit vereinbar ist. Mit Stolz weist der Minister auf die nationale Initiative hin, welche das französische Flugwesen auf seine heutige Höhe gebracht habe, und er schließt diesen Teil des Entwurfs: „Wir haben heute in Frankreich 1800 Flugzeuge. Die Rekords, welche diese Flugzeuge aufgestellt haben, sind: für die Geschwindigkeit 170,777 km die Stunde; für die Höhe 5 610 Meter; für die weiteste Distanz ohne Zwischenlandung 1010,900 km." Auf die Einzelheiten des Gesetzentwurfs wird noch zurückzukommen sein. Gleichzeitig hat der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten eine ganz eigenartige Initiative ergriffen: er hat eine ministerielle Kommission damit beauftragt, die Lösungen zu studieren, welche Frankreich für seine aeronautischen Beziehungen zum Auslande zu akzeptieren habe. Von dem Ergebnis dieser Kommission wird erst später die Rede sein können. Die Kommission Sportive Aeronautique hat dieser Tage folgende Homologierungen vorgenommen. Höhe: Flieger und 3 Passagiere: Marty, 15. April 1913, Crotoy: 1 680 Moter Flieger und 4 Passagiere: Marty, 15. April 1913, Crotoy: 1 400 Meter Geschwindigkeit: Flieger und 4 Passagiere: Champel, 15. April 1913, Orleans: 30 km in 21 : 53 4 150 km in 1 : 49 : 11—4 40 km in 29 : 13—2 200 km in 2 : 25 : 02- 1 50 km in 36 : 31 250 km in 3 : 01 : 17 100 km in 1 : 13 : 01 — 1 Distanz: Flieger und 4 Passagiere: Champel, 15. April 1913, Orleans: 250 km Dauer: Flieger und 4 Passagiere: Champel, 15. April 1913, Orleans: 3 : 01 : 17 Zeit: Flieger und 4 Passagiere: Champel, 15. April 1913, Orleans: */4 Stunde 20 km Va Stunde 40 km 1 Stunde 82,343 km 2 Stunden 165,000 km 3 Stunden 247,343 km El. Aus dem Johannisthaler Fliegerlager. (Berliner Korrespondenz des „Flugsport"). In Johannisthal ist es jetzt verhältnismäßig ruhig geworden, da die meisten Firmen sich für den Prinz Heinrich Flug vorbereiteten und ein großer Teil der Flieger sich nach dem Oberrhein begeben hat. Schall auf Grade-Eindecker holte sich am 2. Mai durch einen Stundenflug eine Prämie aus der Nationalflugspende. Eine Glanzleistung wurde von dem Flieger Ernst Kühne mit Oberlt. Schäfer als Beobachter am 10. Mai ausgeführt. Die Flieger stiegen morgens um 4:03 Uhr in J ohannisthal auf einer Albatros-Taube mit 100 PS 6 Zyl. Mercedes-Motor auf und überflogen Dresden um 6: 15 Uhr, beschrieben eine große Schleife und flogen nach Johannisthal zurück, wo sie um 7 :45 wieder eintrafen. Um die von der Nationalflugspende ausgesetzten Preise zu erhalten, mußte die Flugzeit noch verlängert werden. Kühne flog daher noch mehrere Runden bis 8:22 Uhr. Die Gesamtflugzeit betrug 4 Std. 9 Min. Kühne hat somit einen Preis von 6000 M. aus der Nationalflugspende zu erwarten. Am 13. Mai startete um 3 : 30 Uhr der Fokkerflieger de "W a a 1 mit einem Fluggast zu einem Fluge nach Amsterdam, de Waal machte 6 : 10 in Hannover eine Zwischenlandung und flog 9 : 40 nach Utrecht weiter. Der Flugbetrieb im vergangenen Monat April war ein sehr reger und zwar wurde an 29 Tagen geflogen. Die eifrigsten Flieger, die im April über 10 Stunden flogen, sind folgende:
Ein Bewerb ohne Bewerber. (Von unserem Pariser Korrespondenten.) In den Kreisen der französischen Flieger und Konstrukteure herrscht gegenwärtig nicht geringes Aufsehen. Der Aero-Club de France hatte, wie erinnerlich, für diesen Sommer einen großen Wasserflugzeugwettbewerb in Deauville ausgeschrieben, für den vor allen Dingen das Marine-Ministerium durch Schaffung des „Preises des Marineministers" und durch Inaussichtstellung belangreicher Aufträge auf GrunJ der Resultate des Bewerbs das weiteste Interesse erweckt hatte. Die gesamte Industrie für Wasserflugzeuge hatte diesem Ereignis mit begreiflicher Spannung entgegengesehen, umsomehr, als man von demselben eine wünschenswerte Belebung und Förderung dieser jungen Industrie erwartete. Nicht weniger als 100,000 Francs waren als Preise für diesen Bewerb ausgeworfen worden und schon ging man allenthalben mit großem Eifer an die Arbeit, um sich einen Anteil an den Ehren, den materiellen Erfolgen und den Aufträgen zu sichern. Da kommt nun das unter Mitwirkung des französischen Ma, itieministeriums entworfene Reglement heraus, das in den erwähnten Kreisen eine derartige Bestürzung hervorgerufen hat, daß in der Tat das Zustandekommen des Bewerbs im Augenblick mehr als zweifelhaft erscheint. Dieses Reglement wird, namentlich nach den Lehren, welche das kürzlich stattgehabte Meeting von Monako geliefert hat, als ein bei weitem zu schwieriges angesehen, das mit dem heutigen Stande der Wasserflugzeugtechnik in keinem Verhältnis steht, und es scheint in Wirklichkeit, daß man bei dieser Gelegenheit von dem noch nicht völlig entwickelten Wasserflugzeug unendlich mehr verlangt, als es heute zu leisten imstande ist. Gegen den Bewerb, wie er für Deauville geplant wird, wäre das Meeling von Monako allerdings ein Kinderspiel gewesen. Konstrukteure und Flieger weigern sich auch mit aller Entschiedenheit, ihre Beteiligung an dem Meeting von Deauville auf der Basis des bekannt gegebenen Reglements auch nur in Betracht zu ziehen und es hat allen Anschein, als ob sich dieser mit so großer Spannung erwartete und verheißungsvolle Bewerb ohne Bewerber abspielen wird, sofern nicht noch die verlangten und notwendigen Aenderungen an den Propositionen vorgenommen werden. Wir geben in nachstehendem die wesentlichsten Bestimmungen des Reglements wieder: Vor allen Dingen können an dem eigentlichen Bewerbe nur diejenigen Apparate teilnehmen, welche den eingehenden Bedingungen des Reglements, sowie einer Reihe von Ausscheidungsprüfungen genügt haben. Es wird in der Hauptsache verlangt: Ursprungsbedingungen: Sämtliche Flugzeuge müssen in Frankreich durch eine französische Gesellschaft hergestellt sein. Der Motor insbesondere muß dieser Bedingung entsprechen. Nur einzelne Elemente können ausnahmsweise im Auslande gefertigt sein. Technische Konstruktionsbedingungen: a) die Apparate müssen zwei Sitze haben, einen für den Flieger, einen für die Begleitperson ; b) die Apparate müssen ein völlig freies Gesichtsfeld lassen; c) die Verwendung von Aluminium ist nur für solche Teile des Apparats oder des Motors zulässig, die keinerlei Beanspruchung zu erdulden haben, die leicht zugänglich und mit einer Decke bezogen sind, die sie vor jeder Lufteinwirkung schützt; d) der Motor muß vom Sitz des Fliegers aus in Gang gesetzt werden können, oder allenfalls vom Sitze des Begleiters aus; e) die Benzinspeisung muß automatisch erfolgen, ohne Intervention des Fliegers oder Begleiters; f) die Schwimmer müssen in Einzelabteilungen eingerichtet oder gegen das Eindringen von Wasser geschützt sein; g) die Steuerräder oder Hebel müssen antimagnetisch sein; h) die Motoren müssen gegen Spritzwass^r gechützt sein, der Magnetapparat muß sich in einem wasserdichten Gehäuse befinden und alle Vorkehrungen zur Verhütung von Kurzschluß müssen getroffen sein. Definition der Betriebsausrüstting: In flugfertiger Ausrüstung wird das Gewicht des Fliegers und des Begleiters durch unbenutzbaren Ballast (blei oder Sand) auf je 90 kg ergänzt werden müssen, in welchem Gewichte die mitgeführten Vorräte an Lebensmitteln und Trinkwasser dargestellt werden sollen; die tatsächliche Anwesenheit eines Begleiters an Bord ist übrigens nicht unbedingt erforderlich. Außerdem muß das Flugzeug einen Benzinvorrat für vier Stunden Flug, sowie folgende Instrumente an Bord haben: einen Fluidkompass, einen Tourenzähler, einen Geschwindigkeitsanzeiger, einen Anzeiger für seitliche Neigung, ein Behälter für die Karten, ein Marinefernglas, ein Anker von 7 kg und ein Kabel von wenigstens 40 Metern. Mindestgeschwindigkeit und Aktionsradius; a)die mittlere Geschwindigkeit des Apparats wird während der ersten halben Stunde eines vom Meer aus in voller Ausrüstung unternommenen Fluges gemessen werden. Zu diesem Zwecke wird der Flieger eine Strecke von nicht weniger als einer Meile hin und her zu fliegen haben. Die auf diese Weise erzielte Geschwindigkeit darf nicht weniger als 50 Seemeilen betragen; b) der unter a) vorgeschriebene Flug wird ohne Unterbrechung fortzusetzen sein, bis auf wenigstens zwei Stunden Flugdauer. Der Flieger wird vor den Kommissaren in unmittelbarer Nähe seiner Abflugstelle anzuwässern haben. Diese Bestimmungen gelten nicht für die sogenannten „Bord-Flugzeuge," die nach den später erwähnten besonderen Bedingungen zu bewerten sind. N aut is che Eig e nsch af t e n; a) die Kommissare können alle diejenigen Apparate ohne weiteres ausschließen, die nach ihrer Ansicht nicht die genügende Seetüchtigkeit besitzen; b) die Verankerung bei 10 Meter Tiefe muß leicht zu bewerkstelligen sein, und zwar von der Gondel aus; c) die schwimmenden Apparate müssen 1. hintereinander drei A.hten zwischen zwei 400 Meter von einander entfernten Bojen beschreiben, 2. bei 1 Meter Seegang dreimal die Seiten eines Vierecks von mindestens einer Meile Diagonale durchmessen und, dabei die zu diesem Zwecke verankerten Bojen umkreisen, 3 zehn Minuten lang unbeweglich bleiben bei einem Winde bis zu 12 Metern die Sekunde, 4. die Gleicngewichtsstellung des Apparates muß gegen Vorderwind sein, wobei der Apparat völlig sich selbst überlassen bleiben muß. Jeder Apparat, der.bei diesem Versuch dreht oder umschlägt, wird ohne weiteres vom Bewerb ausgeschlossen; d die Apparate in völliger Ausrüstung müssen zweimal Abflüge und dazwischen ein Anwässern bei 1 Meter Seegang vornehmen. Nach dieser Probe bleiben die Flugzeuge während einer Stunde verankert. Die Schwimmer werden besichtigt und die Flugzeuge, wenn irgend eine Undichtigkeit an den Schwimmern fest-gestgestellt wird, eliminiert werden; bei ruhiger See wird das Abwassern in weniger als 300 Metern erfolgen müssen. Die Bewerbe c) und d) können dreimal von neuem versucht werden. Für j den dieser Versuche wählen die Kommissare (fä5""ihnen geeignet erscheinende Wetter. Höhe n leis tun gen: Die völlig flugfertigen Apparate müssen, auf mindestens 500 Meter steigen und innerhalb einer Gesamtzeit von 30 il$inuten anwässern; die Zeit zählt von dem Augenblick an, wo das Flugzeug abwassert. Jeder Bewerber hat das Recht auf drei Versuche. Was nun den endgiltigen Bewerb anbetrifft, so werden nur diejenigen Flugzeuge ein Anrecht auf irgend einen Preis haben, welche in weniger als 8 Stunden die vorgeschriebene Strecke von 250 Meilen zurückgelegt haben. Hierbei wird die Stabilität des Apparats in Betracht gezogen werden. Das Reglement für den Endbewerb versteht sich für I. Küsten- und Bordfahrzeuge: Abwassern bei bewegter See: an dem von den Kommissaren gewählten Tage werden die Apparate, in voller Ausrüstung, und jeder von einem Torpedoboot begleitet, eine Reihe von Abfliegen und Anwässern bei bewegter See vorzunehmen haben. Ein Kommissar oder der Kommandant des Torpedobootes wird mit möglichster Genauigkeit die Höhe der Wellen und die Windstärke zu messen haben. Geschwindigkeitsabstand: Nachdem eine möglichst lange Basis von den Kommissaren ausgewählt sein wird, werden die Apparate auf dieser Basis zwei aufeinanderfolgende Fahrten (hin und zurück) auszuführen haben: zuerst mit ihrer höchsten Geschwindigkeit, sodaß die Strecke im ganzen viermal zu durchmessen ist. Bei Beginn und beim Ende der Strecke muß die Flughöhe des Apparats nahezu die gleiche sein. Geschwindigkeitsproben: Diese erfolgen auf einer Strecke von ungefähr 250 Seemeilen, in geschlossenem Kreise, mit einer Anzahl von Etappen und Kontrollstellen. Die festgesetzte Flugstrecke wird je nach ihrer Ausdehnung ein oder mehrere Male zu durchqueren sein. Die erste Etappe, mit einer Kontrollkurve, wird ungefähr 100 Seemeilen messen. Es werden hierbei zwei Arten von Preisen zur Verteilung gelangen: 1. für die auf der ersten Etappe ohne Anwässern realisierte Geschwindigkeit, 2. für die mittlere Geschwindigkeit, die auf der Gesamtstrecke von 250 Meilen erzielt worden ist. Im Falle des An-wasserns, das während der ersten Etappe nicht vorgenommen werden darf, können Reparaturen nur mit den an Bord befindlichen ausgeführt werden. Es werden drei Starts verlangt werden können, jeder an einem anderen Tage. Ausdauerbewerb: Der vorerwähnte Bewerb wird gleichzeitig für ein Klassement dienen, und zwar nach der längst durchlaufenen Strecke ohne Anwässern. Zu diesem Zwecke bleibt es den Bewerbern überlassen, den Flug über die 250 Meilen hinaus fortzusetzen. In diesem Falle werden die Apparate an den Endstationen nicht anwässern, sondern in 100 m Höhe einen Kreis zu beschreiben haben, um die Kontrolle zu sichern. Drahtlose Telegraphie: Besondere Preise sind für solche Flugzeuge reserviert, welche mit drahtloser Telegraphie ausgerüstet sind. Die Betriebsweite der Telegraphie muß mindestens 50 Seemeilen betragen. II. Bord-Plugzeuge: Die folgenden Bewerbe sind ausschließlich für Wasserflugzeuge mit abnehmbaren öder zusammenfaltbaren Flügeln reserviert, die ■ sich von einer Plattform oder von einer festen Stelle aus auf weniger als 35 m zu erheben haben, mit oder ohne Hilfe eines besonderen Abtriebapparates, dessen Umfang aber nicht mehr als 10. m Länge, 7 m Breite und 2 m Höhe messen darf. Die Verwendung von Schienen, von Abfluggestellen, von Kabeln ist gestattet. A bf 1 ug.prei s : Wenn sich der Apparat in Abflugstellung befindet, mit abgenommenen oder gefalteten Flügeln, wird die Zeit gemessen werden zwischen dem Augenblick, wo der Start gegeben wird und dem Augenblick, wo der Apparat seinen Abflug nimmt. Diese Zeit darf eine halbe Stunde nicht übersteigen und das Flugzeug muß sich auf weniger als 35 m von der Startstelle erheben können. Diese Probe kann dreimal wiederholt werden; die beste dabei erzielte Zeit wird als Basis für das Klassement genommen werden. F 1 üge 1 falt-Preis: Der Apparat wird sich nach einem Fluge auf dem Wasser niederzulassen und seine Flügel mit eigenen Mitteln zusammenzufalten haben, worauf er sich unter den Aufzughaken eines bestimmten Bootes zu begeben hat^ ; Die Zeit zwischen dem Anwässern und dem Einhaken gilt als Basis für das Reglement. Flügelentfalt-Preis: Das an einem Boote angeseilte Flugzeug wird auf ein gegebenes Kommando seine Flügel zu entfalten und abzuwassern haben. Auch hier wird die hierfür aufgewendete Seite als Basis für das Klassement benutzt. Besonders muß noch die allgemeine Bestimmung hervorgehoben werden, wonach der Marineminister sobald die betreffenden Konstrukteure bis zum festgesetzten Termin (14. Juni) ihre Absicht, an dem Bewerb teilzunehmen, bekannt gegeben haben werden, einen Offizier in das betreffende Atelier delegieren wird, der dort die Konstruklionsmethoden des Konstrukteurs zu beaufsichtigen haben wird. Und die Berichte dieser Aufsichts-Offiziere werden bei den später zu erteilenden Aufträgen als Grundlage dienen. Man kann sich denken, daß diese Bestimmung, sowie die Einzelheiten des Bewerbs die Konstrukteure nicht gerade entzückt haben und auch die Flieger haben sich mit den Konstrukteuren solidarisch erklärt, sodaß ein allgemeiner Boykott des Deauville-Bewerbs bevorsteht, wenn nicht eine gründliche Revision der Propositionen vorgenommen wird. Ein sehr bekannter Flugzeugkonstrukteur hat sich dieser Tage dahin geäußert, daß diejenigen, welche das vorskizzierte Reglement aufgestellt haben, offenbar keinerlei Fühlung mit der Industrie und dem heutigen Stande der Technik haben und daß das Marineministerium mit diesem Reglement „den Pflug vor die Ochsen gespannt" habe. Man kann füglich gespannt darauf sein.welchen Ausgang die Sache nehmen wird. 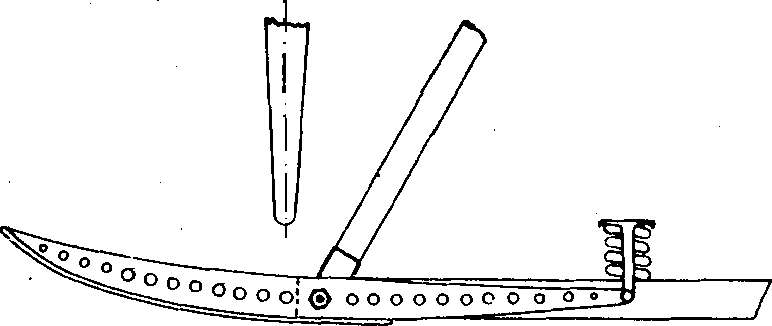 Konstruktive Einzelheiten. Eine federnde Kufenspitze (Abb. 1) ist an dem englischen Avro-Doppeldecker vorgesehen. Das Kufenholz wird dicht hinter dem vordersten Strebenschuh abgeschnitten. Durch das stumpfe Ende desselben geht ein Schraubenbolzen, um den sich der autogeh geschweißte Stahlblechsporn dreht. Die durchbohrten Blechstege desselben laufen gabelartig um die stumpfe Kufenspitze und werden auf ihrem verlängerten Ende elastisch durch eine Feder oberhalb der Kufe abgefangen. Eine Stoßradbefestigung des engl. Sopwith-Doppeldeckers zeigt Abb. 2. Zwei beiderseits der stumpfen Kufenspitze angeschraubte Bleche umfassen gabelartig das Stoßrad. Der Verbindungsbolzen an den Gabelenden dient als Radachse. Gegen seitliche Beanspruchung sind die Gabelarme mit ausgetriebenen Wülsten zwecks Erhöhung der Festigkeit versehen. Ein kombiniertes Verspannungsmittel von Drahtseilen und Stahlband ist in Abb. 3 dargestellt. Das Drahtseil liegt, wie die Zeichnung im Querschnitt zeigt, vorn, das Stahlband dahinter. Die Zwischenräume beider Verspannungsorgane werden durch eine elastische Masse, z. B. durch Gummi, zur Tropfenform ergänzt. Der Luftwiderstand wird dadurch bedeutend vermindert. Abb. 1 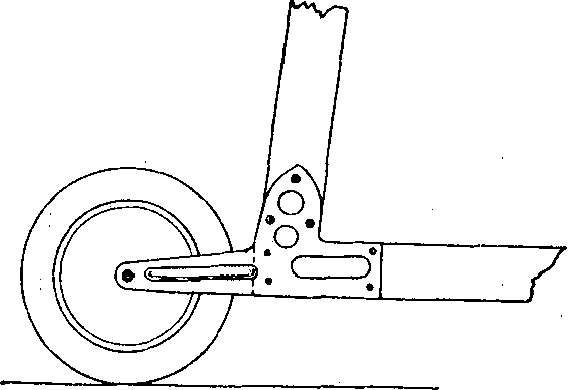 Abb. 2 Abb. 3 Das Drahtseil hat den Zweck, eine Verspannungs-Reserve für das Stahlband zu bilden. Reißt das Stahlband aus irgend welchem Grunde, so wird der Ruck allmählich durch das Drahtseil aufgenommen. Aeußerlich kann man an der ver» letzten Gummimasse die defekte Stelle des Stahlbandes fesstellen. Die Anordnung der Verwindungs-rollen für die Seilzüge des hinteren Holms beim Sopwith - Doppeldecker zeigt Abb. 4. Die Stahlblechfassung am Strebenfuß ist sehr hoch ausgeführt. Die Rollen werden in einem elliptischen Schlitz untergebracht, der durch das armierte Strebenende geht. Mittels Abb. 4 eines Schraubenbolzens, welcher den Strebenfuß fahrwärts durchdringt, werden die Rollen festgehalten. 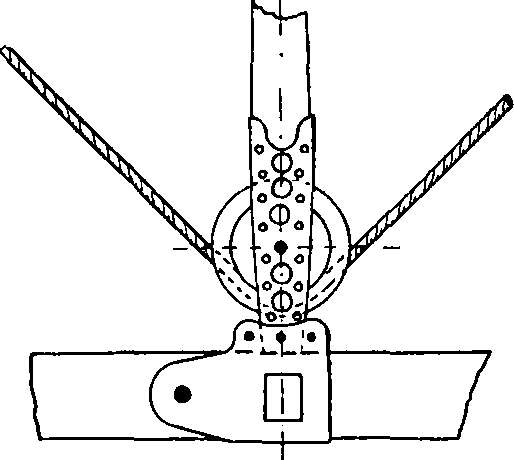 Schutz von Metallteilen durch Sherardisieren. Dem Rosten und Oxydieren der Metallteile bei Flugmaschinen hat man vergeblich durch Anstrichmittel zu begegnen versucht. Eine Flugmaschine ist kein Schönwetter-Verkehrswerkzeug. Es ist etwas Alltägliches, daß die Flugmaschinen bei Ueberlandflügen im strömenden Regen im Freien bleiben müssen und das Regenwasser in die feinsten Ritzen, Scharnierteile und Gewindeteile etc. eindringt, so daß diese verrosten. Durch Anstrichmittel gerade diese gefährlichen Stellen zu schützen, ist praktisch nicht durchführbar, da die sich bewegenden und aneinander reibenden Teile den Anstrich wegreiben. Noch viel größer als bei Landflugmaschinen ist die Gefahr des Oxydierens bei Wasserflugmaschinen, die den scharfen die Oxydation noch fördernden Einflüssen des Seewassers ausgesetzt sind. Trotz der verhältnismäßig guten Ausführung der neuen Maschinen hat man diesem Gegenstand noch verhältnismäßig wenig Beachtung geschenkt. Das mag wohl daran liegen, daß Verfahren, diesem Uebelstand zu begegnen, noch nicht bekannt oder, richtiger gesagt, nicht gebräuchlich waren. Seit einiger Zeit werden von der Marine und auch von verschiedenen Zweigen der Industrie Metallteile durch Trockenverzinken, sogenanntes Sherardisieren, gegen das Oxydieren unempfindlich gemacht. Dieses Verfahren, von Sherard Cowper Coles zur praktischen Verwendung gebracht und in sämtlichen Kulturstaaten patentiert, besteht in der Hauptsache darin, daß die zu verzinkenden Gegenstände unter Luftabschluß in Zinkstaub geglüht werden und zwar bei einer Temperatur, die 150" bis 200° unter dem Schmelzpunkte des Zinkes liegt. Es bildet sich bei dieser niederen Temperatur eine Eisenzinklegierung und darüber, je nach der Erwärmungsdauer ein mehr oder minder dicker Ueberzug von Reinzink. Die legierte Schicht enthält 8 bis 10°/0 Eisen und entspricht der Wolog-dineschen Formel FeZn,0 Sie ist sehr zäh und hart und scheint den Hauptwiderstand gegen Korrosion zu bilden. Die auf dieser Schicht fest haftende Zinklage zeigt bei richtiger Betriebsweise eine metallische Silberfarbe, ist durchaus gleichmäßig und porenfrei. Der Gang der Sherardisierung*| ist folgender: Die Eisenteile werden zuerst in üblicher Weise metallisch rein gemacht, d. h also von Zunder, Oxyden, Formsand, u. dgl. befreit. Dies geschieht durch Beizen in Säure (vorzugsweise Schwefelsäure), oder durch Scheuern bzw. Abblasen mit Sand. Im allgemeinen erfordert die Reinigung bei diesem Verfahren nicht soviel Sorgfalt wie z. B bei der elektrolytischen Verzinkung, welche die peinliche Entfernung aller Oxyde *) nach Bernheim „Stahl und Eisen". und namentlich aller und jeder Fettspuren bedingt. Bei der Trockenverzinkung schaden die letzteren nicht, denn bei der Erwärmung verflüchtigt sich das Oel und wirkt sogar reduzierend. Eine leichte Oxydschicht, die sich oft nach dem Abspülen der Beize bildet, verhindert die Trockenverzinkung keineswegs. Hingegen sollen die gereinigten Gegenstände, wenn möglich, nicht naß in den Zinkstaub gelangen. i Zinkstaub. Der im Handel befindliche Zinkstaub enthält gewöhnlich 80 bis 90% metallisches Zink, im übrigen aber Zinkoxyd mit Spuren von Eisen, Kadmium, Schwefel und seltener Blei. Er ist von außerordentlich feinem Korn und rieselt in die feinsten Ritzen. Der Staub kann solange zur Verzinkung verwendet werden, bis sein Metallgehalt infolge der wiederholten Zinkentziehung auf 18 bis 19°/0 gesunken ist. Ist er einmal bei dieser Grenze angelangt, so kann er immer noch für andere Zwecke, z. B. zur Farbenfabrikation, verwendet werden. Eine wesentliche Verbesserung des Verfahrens hat F. W. Gauntlett erzielt,*) indem er an Stelle von reinem Zinkstaub eine Mischung von Zinkstaub und inertem Material, wie Quarz, oder gewöhnlichem, weißem, hartem Sand benutzt. Das Gemisch kann aus 80 bis 90"/0 Sand und 20 bis 10 /„ Zinkstaub bestehen, es liefert dabei eine dichtere, klarere und gleichmäßigere Verzinkung als der reine Zinkstaub selbst. Dieses Mischmaterial ist sehr wichtig für die Behandlung von Blechen, Draht, Hohlkörpern, profilierten Teilen u. dgl. Es verhindert ein Zusammenballen des Staubes, verhütet ferner bei Ueberschreitung einer Temperatur von 380° ein Blättrigwerden der äußeren Zinkschicht und beseitigt endlich auch die Gefahr der Selbstzündung des heißen Staubes an der Luft. Ueberdies werden die mechanischen Verluste bei solchem Mischungsverhälrnis ganz geringfügig, die Staubbelästigung wird beseitigt und das Verfahren verbilligt. 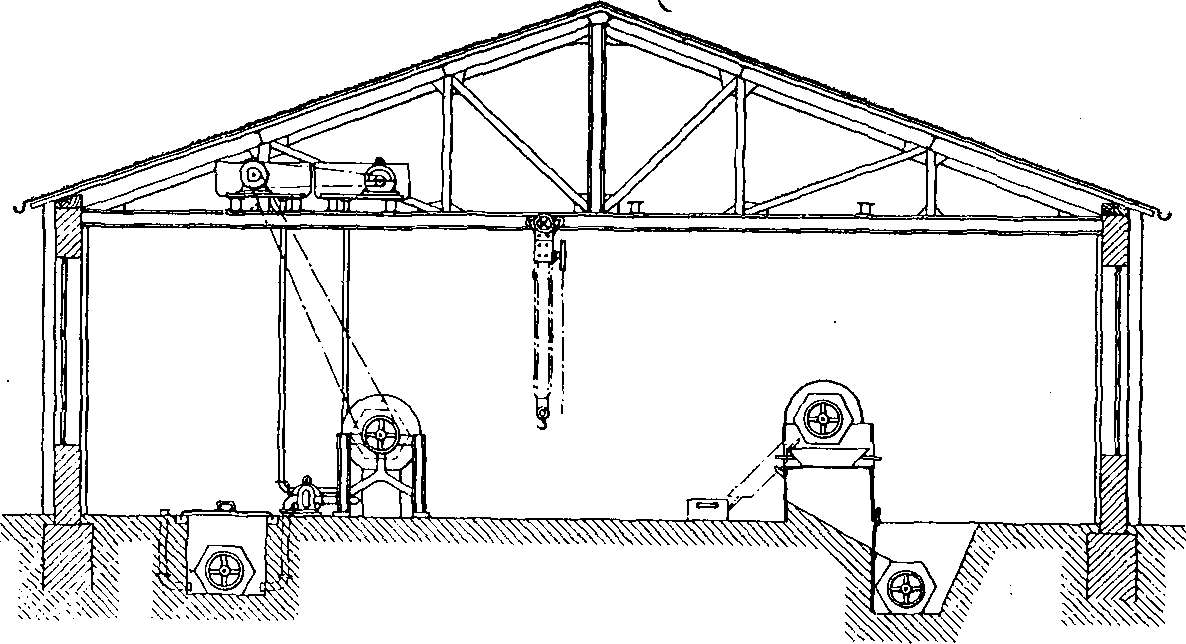 Abb. 1. Anlage einer KJein-Trockenvet zinkung. Die entzogene Zinkmenge muß durch Hinzufügen von neuem Zinkstaube zur alten Mischung stets ersetzt werden. Regelmäßig ausgeführte Analysen bieten eine sichere Kontrolle des Verfahrens. Zinkstaub ist leicht oxydierbar, man hat deshalb einen Zusatz von gemahlener Holzkohle vorgeschlagen. Dies hat sich aber nicht bewährt, da Kohle bei so niedrigen Wärmegraden nicht reduzierend wirkt; dagegen verwendet man neuerdings zur Bildung einer reduzierenden Atmosphäre mit gutem Erfolg kleine Mengen von Kohlenteeröl oder noch besser Naphthalin. Die Teile zeigen dann nicht mehr die von Zinkoxyd und Zinkkarbonat herrührende dunkle und matte Farbe; sondern einen schönen Metallglanz. Zugleich ist der Ueberzug zähe und dauerhaft. Verzink ung. Das Glühen der Teile geschieht in'einem eisernen Gefäß, gewöhnlich einer drehbaren Trommel. Dieselbe wird bei kleineren Ausführungen *) D. R. P. No. 205 902. auf Zapfen in einem Gehäuse gelagert, dessen Deckel das Ein- und Ausheben der Trommel gestattet (vergl. Abb. 1.) Der Antrieb geschieht von Hand oder durch Riemenscheibe. Bei großen Abmessungen ruht die Trommel mit zwei Laufringen auf vier Rollen eines Wagens (Abb. 2), der auf einem Gleise in den gemauerten Ofen eingefahren wird (Abb. 3). Die Drehung der Trommel erfolgt durch Pratzen einer die Ofenrückwand durchdringenden Welle, welche durch Schneckenübersetzung und Riemenscheibe vom Vorgelege aus betätigt wird. Große Trommeln machen 40 Umdrehungen in der Stunde, kleinere bis zu 20 Umdrehungen in der Minute. Trommel und Ofen werden je nach örtlichen Verhältnissen konstruiert. Für kleinere Teile erhält die Trommel Seitenöffnungen; sie wird alsdann durch Drehen entleert. Trommeln mit Enddeckeln (z. B. für Stangen, Röhren u.s.w.) müssen abgehoben und gekippt werden. Der Ofen ist von einfacher Bauart (vgl. Abb. 2); er wird durch Gas oder Oel geheizt, um die Temperatur bequem regeln zu können. Brennstoff wird nur während der Glühperiode verbraucht, und die Wärmeausnutzung im Ofen selbst ist nicht ungünstig. Die Füllung der Trommel hat so zu geschehen, daß alle Teile mit Staub bedeckt sind und sich auch leicht bewegen können, die Trommel soll also nicht zu voll gepackt sein. Die Deckel müssen gut abgedichtet sein, damit der Gasdruck den Zinkstaub nicht herausbläst, wodurch dieser unnötigerweise verbrennen würde Die Praxis hat gezeigt, daß man bei jeder Temperatur von 230 bis 400'' C. erfolgreich sherardisieren kann. Schmiedeeiserne Gegenstände, wie Nägel, Schrauben, Beschläge u. dgl., werden bei 320° C, Gußteile, Tempergußstücke wie Fittings usw. am besten bei 350° C. geglüht. Slahlteile werden bei 270° C. und weniger sherardisiert, ohne an Härte einzubüßen. Blau angelassene Stücke eignen sich ebenfalls, und selbst Spiralfedern u. dgl., verlieren nicht ihre Elastizität. Nach 1 bis 2 Stunden ist die gewünschte Temperatur erreicht, und 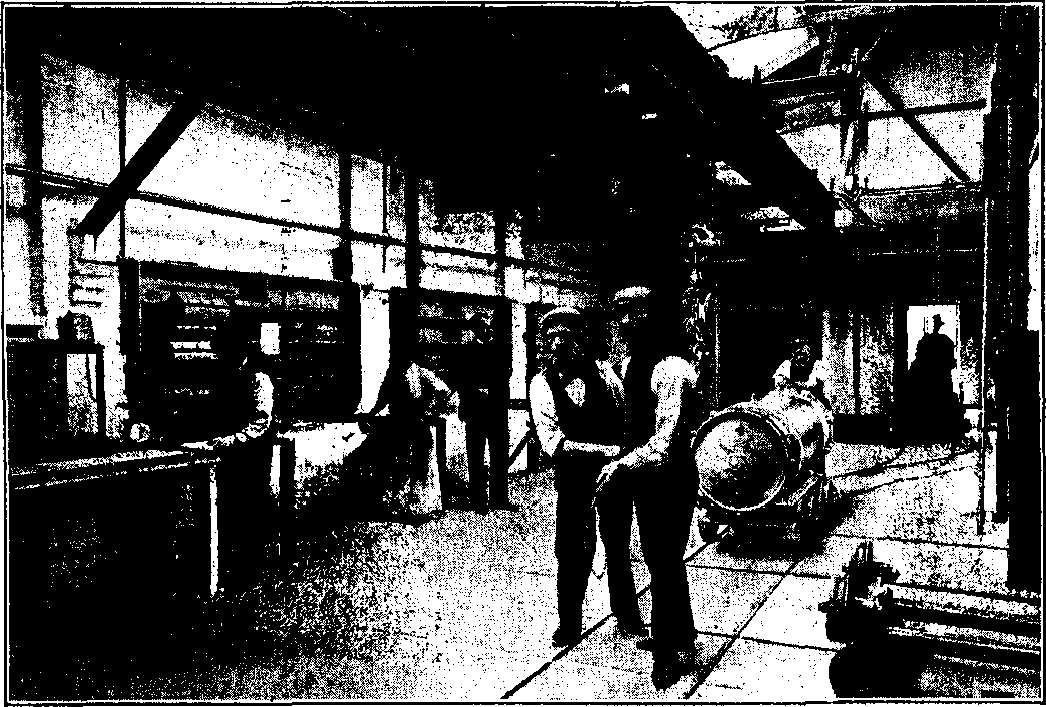 Abb. 2. Wagen mit Tiommel. nach weiterem Glühen von 1 bis 4 Stunden, je nach Ware, kann die Trommel ausgefahren werden. Der Inhalt muß zur Vermeidung von Selbstentzündung abkühlen, ehe man die Trommel entleeren kann. Durch Rütteln auf einem Sieb (Abb. 4) werden die Teile vom Staub getrennt. Zur Vermeidung von Staubwolken kann dieses Absieben in einer geschlossenen Kammer geschehen, wobei der Staub durch ein Becherwerk in einen hochgelegenen Bunker befördert wird. Bei kleinen Anlagen fällt der Staub durch das Sieb auf eine Rutsche, und von da wieder in eine Trommel (vgl. Abb. 1 rechts), während die verzinkten Teile durch Kippen der Siebschale abgeworfen werden. Erzeugnis. Die Eisenzinklegierung, deren Bildung sonst nur bei Schmelztemperatur möglich war, wird hier durch Zementation erzielt; sie ist äußerst zäh und dicht. Die Zementation hört nach einer gewissen Erwärmungs- dauer auf, und es schlägt sich dann eine homogene Schicht von kristallinischem Zink nieder. Je höher die Glühtemperatur ist, um so geringer ist das „Eindringen" des Zinks, um so stärker aber ist die Reinzinkschicht und umgekehrt. — Materialien mit inneren Spannungen, wie Gußstücke u. dgl., werden dadurch in ihrer Qualität verbessert, daß diese Spannungen durch das Ausglühen entfernt werden. Dieses langsame Glühen hat sich namentlich für Temperguß gut bewährt. Teile mit feinen Profilierungen oder Hohlräumen, wie Schrauben und Muttern, werden so gleichmäßig verzinkt, daß sie kein Nachschneiden erfordern. Weiterverarbeitung. Sherardisierte Gegenstände können mechanisch bearbeitet, gepreßt oder gezogen werden, ohne daß der Ueberzug abspringt. Ferner lassen sie sich leicht polieren, wodurch sie einen silberähnlichen Glanz erhalten, der auch dauerhafc ist. Dabei ist natürlich eine längere Glühdauer (20 Stunden) bei etwa 270° C erforderlich, um eine möglichst harte Oberfläche zu erzielen. Ein weiterer Vorteil dieses Materials ist seine Fähigkeit, ohne weiteres jeden Anstrich anzunehmen. Rostschutz. Der durch Sherardisierung erzeugte Ueberzug bietet einen wesentlich größeren Rostschutz als andere Zinküberzüge von gleicher Dicke. Dies wird von Prof. Burrgess bestätigt, und Hinchley gibt an, daß er gleich sei dem dreifachen Gewichtsauftrag durch Heißverzinkung. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Seeluft und Salzwasser wird trocken verzinktes Material vielfach von der amerikanischen und englichen Marine verwendet. Anwendung, las Verfahren eignet sich für alle Eisenwaren, die sich gut in eine Trommel packen lassen; am besten aber für kleinere Massenteile. In Amerika, wo dieses Verfahren, obwohl europäischen Ursprungs, hauptsächlich zur praktischen Ausbildung gelangt ist, werden auch große Gegenstände in bedeutenden Mengen sherardisiert. Kosten. Die.Gestehungskosten setzen sich zusammen aus den Kosten für Zink und Brennstoff, ferner aus Löhnen, Verzinsung und Amortisation. Die Zinkmenge richtet sieh nach dem Verwendungszweck, und man darf ohne großen 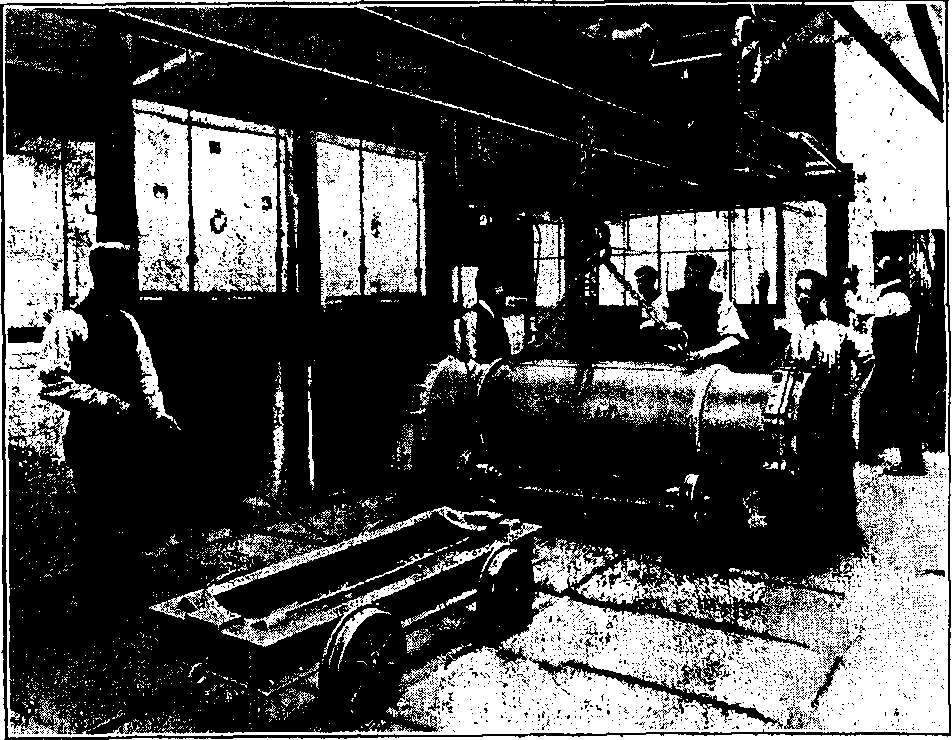 Abb. 3. Einfahren der Trommel in den Ofen. Fehler mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 3 \ des Einsatzgewichtes rechnen. Der Brennstoffverbrauch kann lür ungünstige Fälle, wie z B. Fittings zu 100000 WE für 100 kg angenommen werden. Eine Anlage von 1000 kg Leistung in der Schicht erfordert bloß einen Mann zur Bedienung. Für Teile wie Schrauben, Drahtstifte usw. stellen sich die Kosten für 100 kg ungefähr wie folgt: Zink....... 1.10 M. 31,8% Brennstoff. .... 1.— „ 28,5 % Löhne ...... 1.— „ 28,5% Kraft ...... 0.35 „ 10,0 "Z, Verschiedenes . . ■ 0.05 „_1,2°/„ 3.50 M. 100,0 % Zur vollen Ausnutzung des Ofens werden zwei oder drei Hitzen in der Schicht gemacht, so daß stets eine Trommel abkühlt bezw. gefüllt wird, während sich die andere im Ofen befindet. Prüfung. Sherardisiertes Material hält 8 bis 30Eintauchungen von einer Minute Dauer in neutraler 20 % Kupfersulfatlösung aus. Aber diese Tauchprobe ist hier nicht eigentlich gerechtfertigt Es genügt hier nicht, die Zinkmenge durch Ablösung zu messen, da ja die zementierte Schicht den Rostschutz bildet; diese Schicht läßt sich aber durch kein Mittel von dem aufgenommenen Zink befreien Die beste Prüfung ist und bleibt ein praktischer Rostungsversuch. Theorie. Von den verschiedenen Theorien Uber das Wesen derTrocken-verzinkung erscheint diejenige von Alfred Sang am einleuchtendsten. Danach besteht Zinkstaub aus Teilchen mit einer Außenhaut von Zinkoxyd oder  Abb 4. Absieben der verzinkten Gegenstände auf einem Rüttelsieb Zinkkarbonat. Sang nimmt an, daß die starre Kruste amorphes Zink einschließt, und das ganze Staubkörnchen sich in einem gespannten, unstabilen Zustande befindet. Bei der kritischen Temperatur wird die Spannung ausgelöst, das Bläschen platzt und befreiter Zinkdampf stürzt sich gierig auf das Eisen. Anwendung auf andere Metalle. Die Zinkzementation kann auch auf Messing-, Kupfer- oder Alumihiumteile angewendet werden. Ferner lassen sich entsprechende Ueberzüge durch Zementation mit Messing-, Kupfer- oder Antimonstaub herstellen. Schlußfolgerungen. Von den drei Verzinkungsarten, die heute in praktischer Anwendung sind, der alten Heißverzinkung im flüssigen Bade, der elektrolytischen Kaltverzinkung und der Trockenverzinkung, wird wohl keine zugunsten der anderen verschwinden. Für jede derselben gibt es Anwendungsgebiete, und eine jede hat gewisse Fortschritte zu verzeichnen. Bei der Heißverzinkung hat man in letzter Zeit durch besondere Zusatzmetalle die Ueberzüge wesentlich verbessert, und eine grundlegende Neuerung (gemauerte Wannen ohne eiserne Pfanne, direkte Heizung) ist berufen, viele Uebelstände zu beheben. Das elektrolytische Verfahren hat namentlich durch Verwendung zuverlässiger Dauerelektrolyte, welche bei hoher Stromdichte einen hochglänzenden Niederschlag erzeugen (z. B. Mea ker-Elektrolyt), bessere Erfolge erzielt. Das Sherardisieren eignet sich, wie aus diesem Berichte hervorgeht, hauptsächlich für Massenartikel; in der Praxis treten folgende Vorteile in die Erscheinung: 1. Geringe Anlagekosten. 2 Sparsamer Zinkverbrauch. 3. Geringer Aufwand für Löhne und Kraft. 4. Günstige Ausnutzung des Brennstoffs. 5. Einfachheit der Arbeitsweise. 6. Möglichkeit eines ununterbrochenen Betriebes. 7. Anwendbarbeit in jeder Produktionshöhe. 8. Gegenstände aller, auch ganz unregelmäsiger Formen, sind zur Be- handlung geeignet. 9. Innere Materialspannuneen werden ausgeglichen, 10. Der Ueberzug ist gleichmäßig und läßt alle Konturen scharf. 11 Sherardisiertes Material kann bearbeitet (gezogen usw,) werden, ohne daß der Ueberzug abspringt. 12. Polierfähigkeit der sherardisierten Waren. 13. Zuverlässiger Rostschutz, selbst bei Seeluft und Salzwasser. Flugtechnische jgP^ Rundschan. Inland. Flugfuhrer-Zäuijnisae haben erhalten: No. 375. Kuntner, Franz, Mechaniker, Adlershof, geb. zu Wien am 19. April 1890, für Eindecker (Fokker), Flugplatz Johannisthal, am 11. April 1913 No. 376. Bodenbarg, Paul, Magdeburg, geb. zu Westerhüsen-Magdeburg am 8. Mai 1885, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 11. April 1913. No. 377. Jahn, Frifz, Tiefbauführer, Magdeburg-Fermersleben, geb. zu Magdeburg am 20. April 1891, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 11. April 1913. No. 378. Schroff, Herbert, Leutnant im Fußart.-Regt. 16, Diedenhofen, geb. zu Görlitz am 10. November 1888, für Zweidecker (Deutschland», Flugfeld Oberwiesenfeld, am 12. April 1913. No. 379. von Livonius, Joachim Friedrich, Leutnant im Gren.-Rgt. No. 4, Rastenburg, geb. zu Rittersberg, Westpreußen, am 2. Januar 1887, für Zweidecker (Bristol). Flugplatz Halberstadt, am 17. April 1913. No. 380. von Blanc, Heinrich, Leutnant, Garde-Gren.-Regt. No 2, Berlin, geb. zu Kiel am 9. August 1885, für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 17. April 1913. No. 381. Dirks, Leonhard, Mechaniker, Leer, Ostfriesland, geb. zu Leer am 20. Januar 1888, für Eindecker (Taube), Flugplatz Wanne, am 17. April 1913. No. 382. Boehm, Reinhold, Johannisthal, geb. zu Gertlauken am 7. Juli 1890, für Zweidecker (L.V.G.), Flugplatz Johannisthal, am 18. April 1913. No 383. Baron von Ascheberg, Percy, Oberleutnant, Feldart.-Schieß-schule geb. zu Groß-Buschof, Kurland, am 24. Juni 1880, für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 22. April 1913 No. 384. Scherkamp, Otto, Leutnant im Inf.-Regt. 78, geb. zu Dortmund am 29. März 1884, für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 22. April 1913. No. 385. Freind, Rene\ Johannisthal, geb. zu Brülingen am 21. Juni 1886, für Eindecker (Jeannin), Flugplatz Johannisthal, am 22. April 1913. Flugzeuge mit zusammenlegbaren Tragdecken. Seitens der Militärverwaltung wird zur Zeit im Flugzeugbau besonderer Wert darauf gelegt, die Spannweiten der Maschinen so schnell als möglich zu verkürzen, um in der Hauptsache die Apparate in kleinen leichten Zelten unterbringen zu können. In den beistehenden Abbildungen ist ein Ein- und ein Doppeldecker der Deutschen Flugzeugwerke dargestellt, die in Spezialzelten untergebracht werden können.  Eindecker der Deutschen Flugzeugwerke mit zusammengeklappten Flügeln in einem Spezialzelt. Namentlich der Eindecker läßt sich auf einen sehr kleinen Raum zusammenklappen, so dati die vorherige Spannweite von 16 m mit zusammengeklappten Flügeln auf 8 m herabgemindert werden kann. Das gesamte Zelt wiegt nur 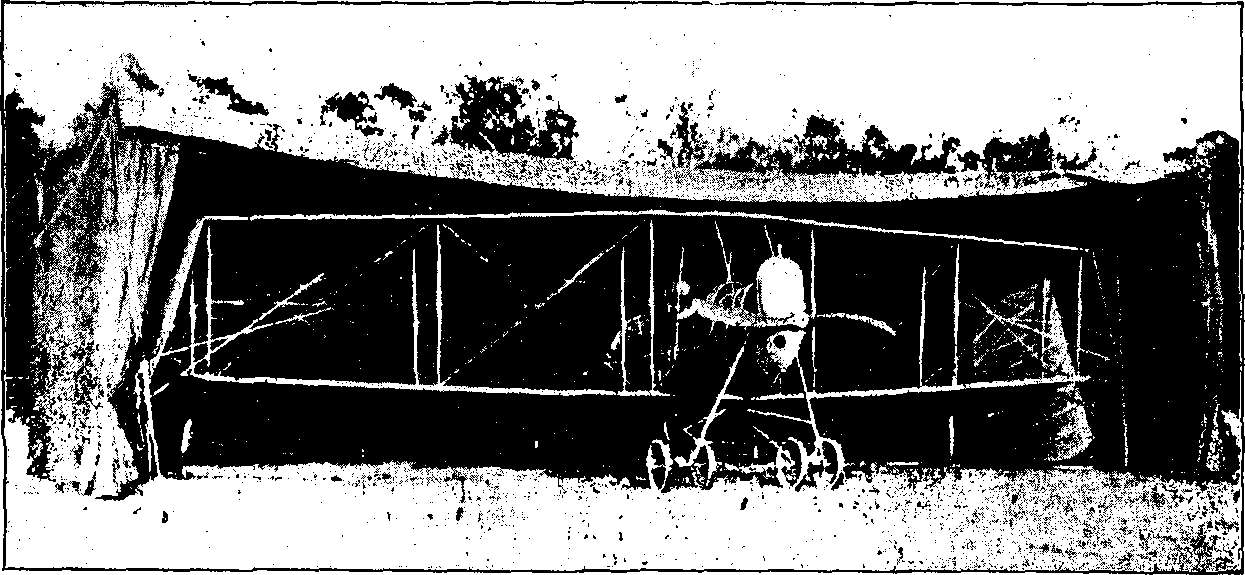 Doppeldecker der Deutschen Flugzeugwerke mit verkürzter Spannweite in einem SpezialZeit. 180 kg, ist also noch sehr leicht zu transportieren. Die Konstruktion des Zeltes ist derart ausgeführt, daß es sich sehr leicht und schnell auf- und abmontieren läßt. Durch die Verkürzung der Spannweite auf 8 m ist auch die Möglichkeit gegeben, das Flugzeug auf eigenen Rädern über Chauseen, enge Durchfahrten und dergleichen zu transportieren. Der Doppeldecker laßt sich von 16,5 m Spannweite auf 12 m Spannweite verkleinern. Lt. v. Mirbach mit v. Brun als Beobachter ist am 30. April auf einem Militärdoppeldecker bei einem steilen Gleitfluge mit laufendem Motor tödlich abgestürzt. Lt. v. Mirbach, der auf dem Euler-Flugplatz die Feldpilotenprüfung bestand, war einer der tüchtigsten Militärflieger der Darmstädter Station. Ausland. Ein Fernflug Bremen—Brüssel—London wurde von Brindejonc des Moulinais ausgeführt. Brindejonc flog am Freitag den 8. Mai in Bremen ab und erreichte nach verschiedenen Zwischenlandungen in Wanne, Brüssel, Etter-beck und Calais am Sonntag, den 11. Mai London, wo er nachmittags 3 Uhr auf dem Flugplatz Hendon landete. Die Agramer Flugzeugfabrik Mercep beabsichtigt in Prag eine Filial-fnbrik zum Bau von Flugzeugen ins Leben zu rufen. Wettbewerbe. Ein Wettfing „Rund um München" wird von dem Münchner Verein für Luftschiffahrt, dem Bayrischen Aero-Club und der Akademie für Aviatik in der Zeit vom 14.—16 Juni veranstaltet und zwar ist ein dreimaliges Umfliegen von München in Aussicht genommen. . Patentwesen. Patentanmeldungen. 77h. O. 8031. Vorrichtung zum Entspannen und Anziehen der Spanndrähte bei Flugzeugen. Max Oertz, Neuhof bei Hamburg. 29. 3. 12. 77h. E. 17 833. Flugzeug. August Euler, Frankfurt a. M.-Niederrad. 28. 2. 22. 77h. P. 25774. Kreiselstabilisator für Flugzeuge. Hugo Pietsch, Kl. Möllen b. Köslin. 5. 10. 10. 77h. F. 33807. Flugzeug. Anthony Herman Gerard Fokker. Johannisthal b. Berlin, Parkstraße 18. 25. 1. 12. 77h. R. 36 008 Spannvorrichtung für die Gehänge von Flugzeugen. E. Rumpier Luftfahrzeugbau G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg. 21. 12 12. 77h. S. 37 290. Abwurfvorrichtung für Geschosse, insbesondere für Luftfahrzeuge. Sprengstoff A.-G. Carbonit, Hamburg. 30. 9 12. Patenterteilungen. 77h. 260004 Flugzeug, bei dem gleichzeitig mit der Tragfläche auch eine Schwanzfläche verstellt wird. Alfred Brink, Harburg, Elbe, Gartenstraße 27. 23. 2. 10. B. 57587. 77h. 260049. Doppeldecker mit versetzten Tragflächen. Wilhelm Blank, Dresden, Münchener Platz 2. 10. 6. 11. B. 63418. 77h. 260050. Flugzeug mit verwindbaren Tragflächen; Zus. z. Pat. 173378. Orville Wright, Dayton, V. St. A.; Vertr.: H. Springmann, Th. Stört u. E. Herse, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 61. 16. 11. 08. W. 30 870. Priorität aus der Anmeldung in Frankreich vom 18. 11. 07 anerkannt. 77h. 260051. Flugzeug mit gelenkig an dem Fahrgestell angebrachtem Tragflächenrahmen. John Washington Wilson, Boston; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 22. 12. 09. W. 33 595. Strebenbefestigung für Flugzeuge.*) Gegenstand der Erfindung ist eine Einrichtung zum Befestigen von sich schneidenden Hölzern, im besonderen bei Flugapparaten. Erfindungsgemäß wird dazu bügeiförmiges Blech verwendet, das im Gegensatz zu den vielfach verwendeten, den Helm umspannenden Schellen in das durchlaufende Holz eingelegt ist, während die Schenkel mit den anstoßenden Hölzern verschraubt oder vernietet sin d. Auf nebenstehenden Abbildungen sind zwei Ausführungsformen der Erfindung dargestellt. Abb. 1 und 2 zeigen die Einrichtung bei zwei sich rechtwinklig schneidenden Hölzern, Abb. 3 und 4 bei drei Stäben, von denen zwei schräg auf den dritten aufgesetzt sind. In den durchlaufenden Stäben a sind Schlitze von der Breite des bügeiförmigen Bleches b eingeschnitten, durch die Abb. 1 Abb. 2 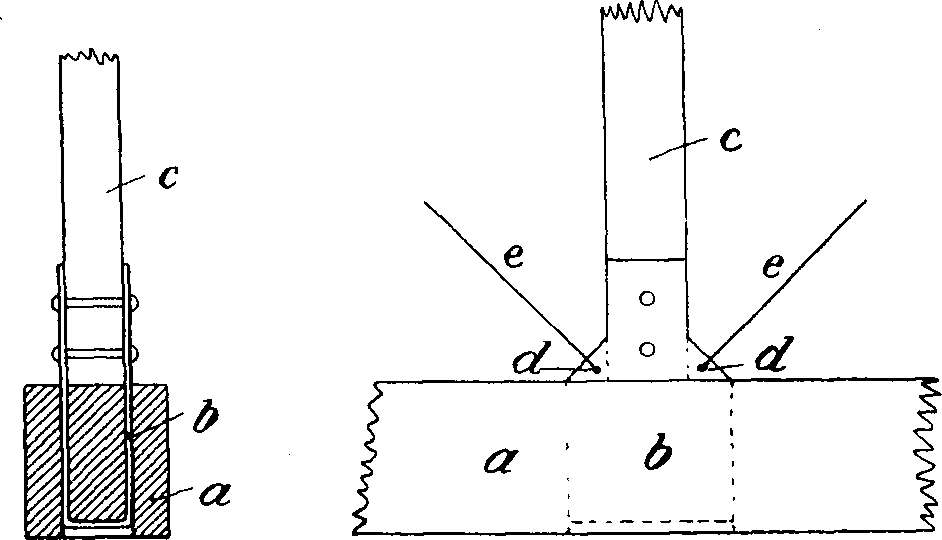 Abb. 3 Abb "4 ___ das Blech von unten hindurchgesteckt wird. Die freien Schenkel des Bleches sind mit dem zweiten Holz c vernietet. An der Stelle, an der das Blech aus dem durchlaufenden Träger heraustritt, können Löcher d zum Befestigen von Spanndrähten e angebracht sein. Stoßen zwei Stäbe Ci und c2 gegen einen dritten (Abb. 3 und 4) durchlaufenden Stab, so werden die Schenkel des Blechbügels in der Richtung der Stäbe abgebogen und in Schlitze eingelegt. Der Blechbügel liegt dann bis auf die Ansclilußteile für die Spanndrähte vollständig im Holz eingeschlossen. Die Anordnungen zeichnen sich aus durch große Einfachheit und Billigkeit in der Herstellung, geringes Gewicht, Festigkeit und geringe Beanspruchung des Holzes. Bei dem durchlaufenden Holz kann man Schrauben- oder Nietenver- *) D. R. P. 257 801. Siemens-Schuckert-Werke G. m. b. H., Berlin. bindungen vollständig entbehren. Ist das durchlaufende Holz beispielsweise eine Kufe, die auf dem Boden laufen soll, so versenkt man den Bügel vorteilhaft etwas ins Holz, wie die Abbildungen zeigen, und schließt die Oeffnung wieder, so daß die untere Kante vollständig glatt ist. Patent-Ansprüche: 1. Strebenbefestigung für Flugzeuge, gekennzeichnet durch ein bügeiförmiges Blech, das mit seinen Schenkeln parallel in das durchlaufende Holz eingelegt und an dem anstoßenden Holz befestigt ist. 2. AusfUhrungsform nach Anspruch 1 zum Befestigen von drei sich^schnei-denden Stäben, von denen zwei auf den dritten schräg laufgesetzt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die abgebogenen Schenkel des [Bügels in Schlitze der schrägen Stäbe eingelegt sind. Flugzeug mit Ausbiegungen in den hinteren Tragflächenteilen.*) Es ist bereits bekannt, daß die Stabilität eines Flugzeuges dadurch erhöht wird, daß man den Luftslrom, der an der geschlossenen Tragfläche entlangstreicht, durch Abbiegungen nach oben in deren hinteren Teilen zwingt, seinen Lauf zu ändern. Man hat daher sowohl die seitlichen Flügelenden nach oben abgebogen, als auch am hinteren Rande die Tragfläche etwa in der Flugrichtung aufgeschnitten und dreieckige Teile derselben nach oben abgebogen. Eine ähnliche Einrichtung bildet den Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Im Gegensatz zu den bekannten Vorrichtungen wird hier jedoch ein in sich ver- t 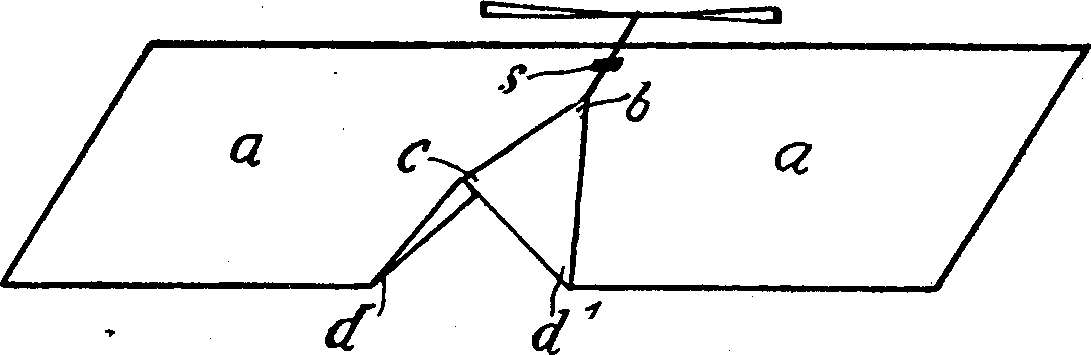 schlossener Teil am hinteren Rande der Tragfläche nach oben gebogen, so daß ein von vorn nach hinten sich vergrößernder dachförmiger Ausbau entsteht. Wie aus der Zeichnung ersichtlich, besitzt die Tragfläche a einen Ausbau, welcher seinen Anfang im ersten Drittel bei Punkt b hat, nach hinten in die Höhe c und Breite d und d1 dachförmig endet. Bei s ist der Schwerpunkt. Patent-Anspruch. Flugzeug mit Ausbiegungen in den hinteren Tragflächenteilen, dadurch gekennzeichnet, daß ein geschlossener Teil der Tragfläche vom ersten Drittel ab derartig ausgebogen wird, daß ein dachartiger von vorn nach hinten sich vergrößernder Ausbau entsteht. 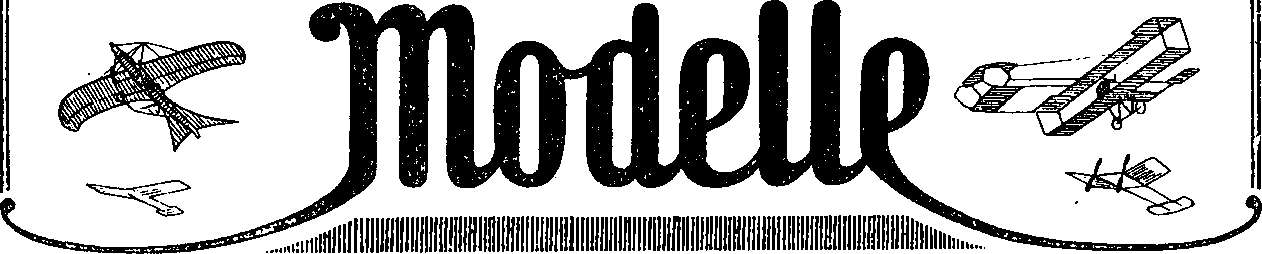 Wie man sich Kugellager für Modelle selbst herstellen kann. Bei größeren Propellern und stärkeren Gummimotoren istfes unerläßlich, den durch Gummi entstehenden starken Zug durch ein Kugellager aufzunehmen, da andernfalls durch gewöhnliche Lager die Reibungsverluste sehr hohe werden. *) D. R. P. Nr. 257631, Josef Miksch in Charlottenburg. Ein einfaches und vor allen Dingen leichtes Kugellager läßt sich gemäß der nebenstehenden Abbildung in sehr einfacher Weise herstellen. Die Laufflächen für die Kugeln werden aus zwei Messingröhrchen A und B von verschiedenen Durchmessern gebildet, die auf eine Grundplatte C, bestehend aus 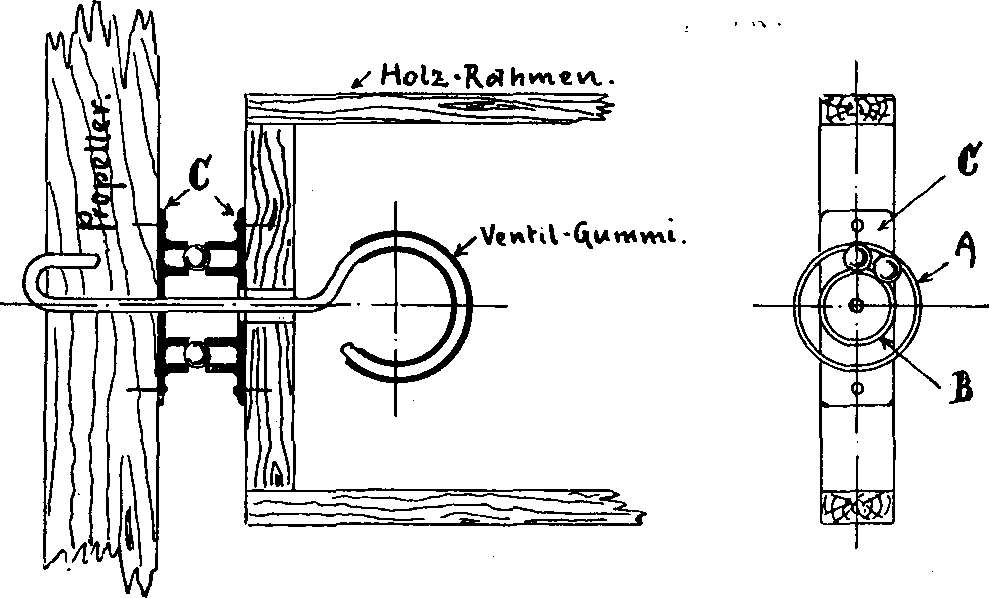 Messingblech, aufgelötet werden. Selbstverständlich müssen die beiden Röhrchen A und 3 genau konzentrisch aufgelötet werden. Man kann dies in der Weise bewirken, daß man zwischen die beiden Rohre von verschiedenen Durchmessern ein entsprechendes anderes Rohr, um die Distanz zu halten, einschiebt. Feststellbare Steuerhebel. Um ein Modell genau auszuprobieren und die größte Flugweite zu erreichen, ist es unbedingt nötig, daß man die Steuerung verstellbar einrichtet. Diese Notwendigkeit kann man durc den in nebenstehender Skizze dargestellten starken 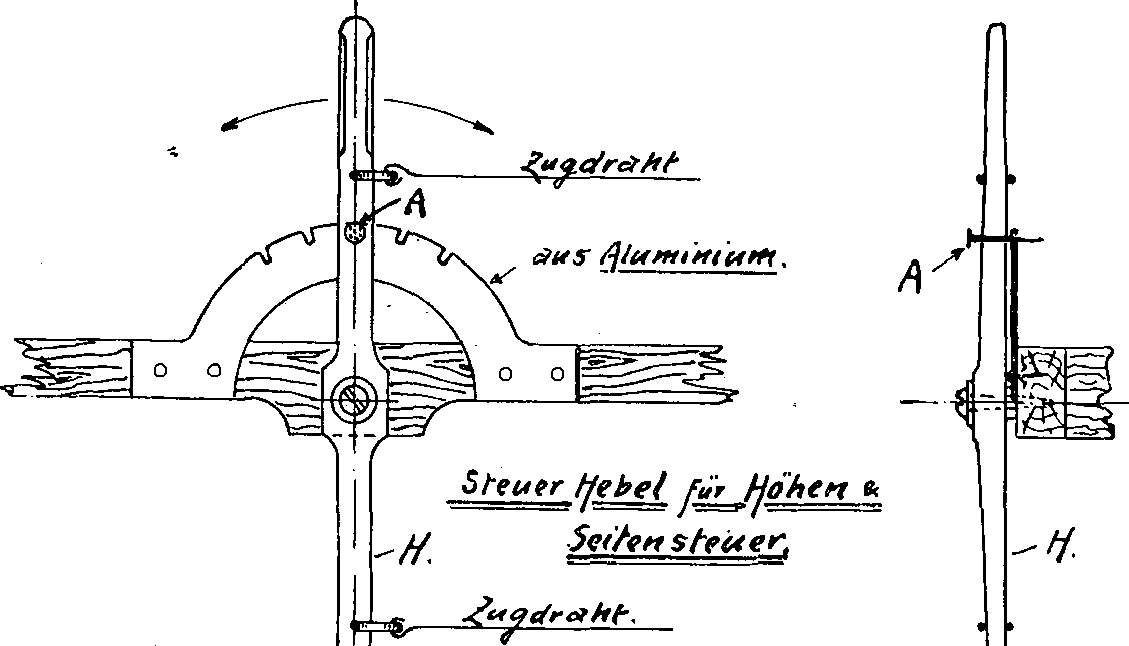 Steuerhebel, der als Höhen- und auch als Seitenstcucr verwendet werden kann, beseitigen. Der Hebel H bewegt sich über ein Segment aus Aluminium, an dessen Peripherie kleine Ausschnitte oder Löcher eingebohrt sind. Durch einen Steckstift a wird der Hebel festgestellt. H. Wöllenstein. Frankfurter Flugmodell-Verein. In letzter Zeit veranstaltete der F. F. V. wieder einige Uebungsflüge, wobei sehr gute Resultate erzielt wurden. Nachstehend seien einige Flüge aufgeführt: Reigner (Eindecker) 41, 60, 64 Meter, Kopietz (Pfeil-Eindecker) 46, 65'/,. 78, 96, 83, 70, 100 Meter, Kopietz (Tandem-Eindecker) 35 Meter, Specht (Pfeil-Eindecker) 45, 65, 71, 34 Meter, K. Jäger (Eindecker „Ente") 33 Meter, Kämmerer (Eindecker) 15, 18, 22 Meter. Weitere Beachtung verdienen die Flüge des Eindeckers von Züsch. Dieser Eindecker weist V-Stellung nach oben und hinten auf und erreicht dadurch automat. Stabilität. Das Modell hat incl. Gummimotor ein Gewicht von 250 g und führt Flüge von 60—70 m aus. Da für dieses Jahr einige Veranstaltungen (Ueberfliegung des Maines, Ausstellung und Wettfliegen, Beteiligung an der Darmstädter Modell-Konkurrenz) vorgesehen sind, werden die Mitglieder gebeten, sich eifrig für die Veranstaltungen vorzubereiten. Auf dem Gelände der ehemaligen Rosenausstellung findet Sonntag den 18. Mai vormittags zwischen 7 und 11 Uhr ein Modell-Uebungsfliegen und Sonntag den 25. Mai ein Modell-Prämienfliegen statt, wozu einige Geldprämien ausgesetzt sind. Ferner ist eine Bibliothek errichtet worden und werden die Mitglieder gebeten, Bücher sowie Zeitschriften etc. dieser leihweise zur Verfügung zu stellen. Dieserhalb wolle man sich an N. Welkoborsky, Grüneburgweg 57 wenden. Anfragen sind zu richten an den Vorsitzenden Fritz Wittekind, Frankfurt a. M., Eppsteinerstr. 26. Der Hamburger Modellflug-Verein ist in letzter Zeit eifrig tätig gewesen. Es ist beschlossen worden, einen Schuppen und einen Flugplatz zu errichten, der den Mitgliedern zur freien Verfügung gestellt werden soll. Der Modellbau wird von einem Fachmann, der bereits 3 Jahre in der Flugtechnik tätig und im Besitze des Fliegerzeugnisses ist, geleitet. Die Förderung des Modellflugwesens soll ferner erreicht werden durch Wettbewerbe, Ausstellungen, Beteiligung an Preisausschreibungen, Besuch von Flugplätzen, Abhalten von Versammlungen sowie durch Halten guter Zeitschriften. Als Uebungsplatz ist dem Verein der Platz , der Hamburger Luftschiffhallen-Gesellschaft in Fuhlsbüttel zur Verfügung gestellt worden. Die Gesellschaft gibt für die Mitglieder Jahreskarten, die für sämtliche Veranstaltungen zum Eintritt berechtigen, heraus. Die Kosten der Karten werden vom Verein getragen. Das Präsidium des Vereins haben übernommen: L. Dittmer, Schatzmeister des Hamburger Vereins für Motorluftschiffahrt in der Nordmark; W. Jordan, Redakteur der Neuen Hamburger Zeitung; Dr. W. H. Fischer. Redakteur der Neuen Hamburger Zeitung. Berichtigung. In der in No. 9 des „Flugsport" beschriebenen Jeannin-Stahltaube ist nicht ein 6 Zyl. 150 PS Stoewer-Motor, sondern ein 6 Zyl. 100 PS Argus-Motor eingebaut gewesen. Die fragliche Jeannin-Stahltaube hat mit diesem Motor die Militärbedingungen in tadelloser Form erfüllt. Carl Gustav Nowack, Neumarkt 16 Billigste Bezugsquelle für freifliegende Flugmaschinen-Modelle Flu ^maschinell Bestandteile gsport", Organ d. Flugzeug-Fabrikanten, Bund d. Flugzeugführer u. d. Verbandes d. Modellflugvereine. 1916. Modellversuche für Flugzeugschwimmer und Flugboote. Tafei iv. Horizontale Wasserwiderstände und Kippmomente für verschiedene Geschwindigkeiten bei gleichbleibendem Anstellwinkel a = 4". 300
I i Fahrfgesdnvmcfigke/f in km /j> Abb. 14 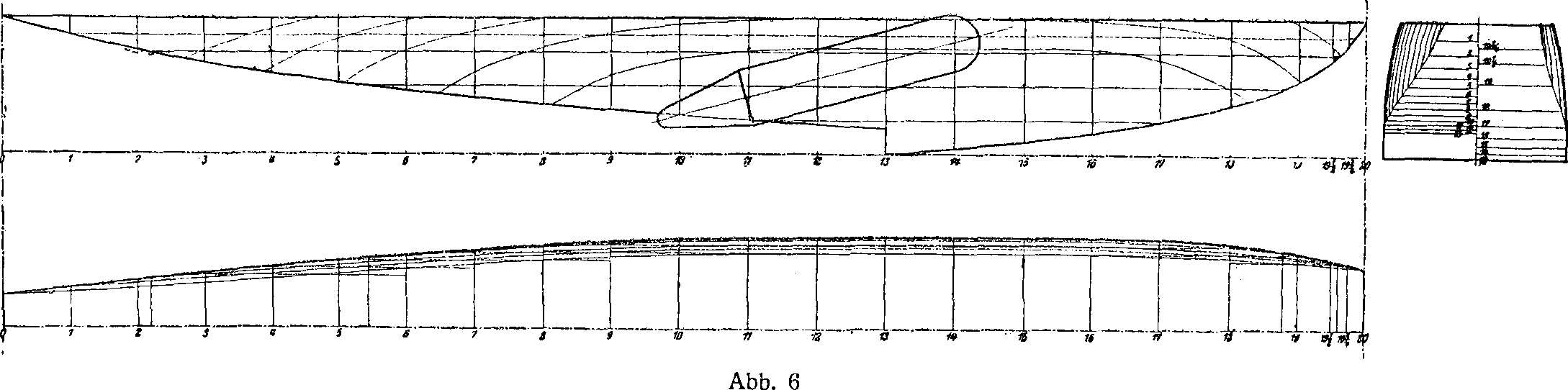 Länge = 8,910 m fjr. Breito=l,180 m Seitenhohe — 0,S80 m Nachbildung verboten. .Flugsport", Organ d. Flugzeug-Fabrikanten, Bund d. Flugzeugführer u. d. Verbandes d. Modellflugvereine. 191 Versuche mit Flugbootmodellen. Tafel V. 2000] iaoo ■1600 1VOO ■ 1200 800 fOO 200 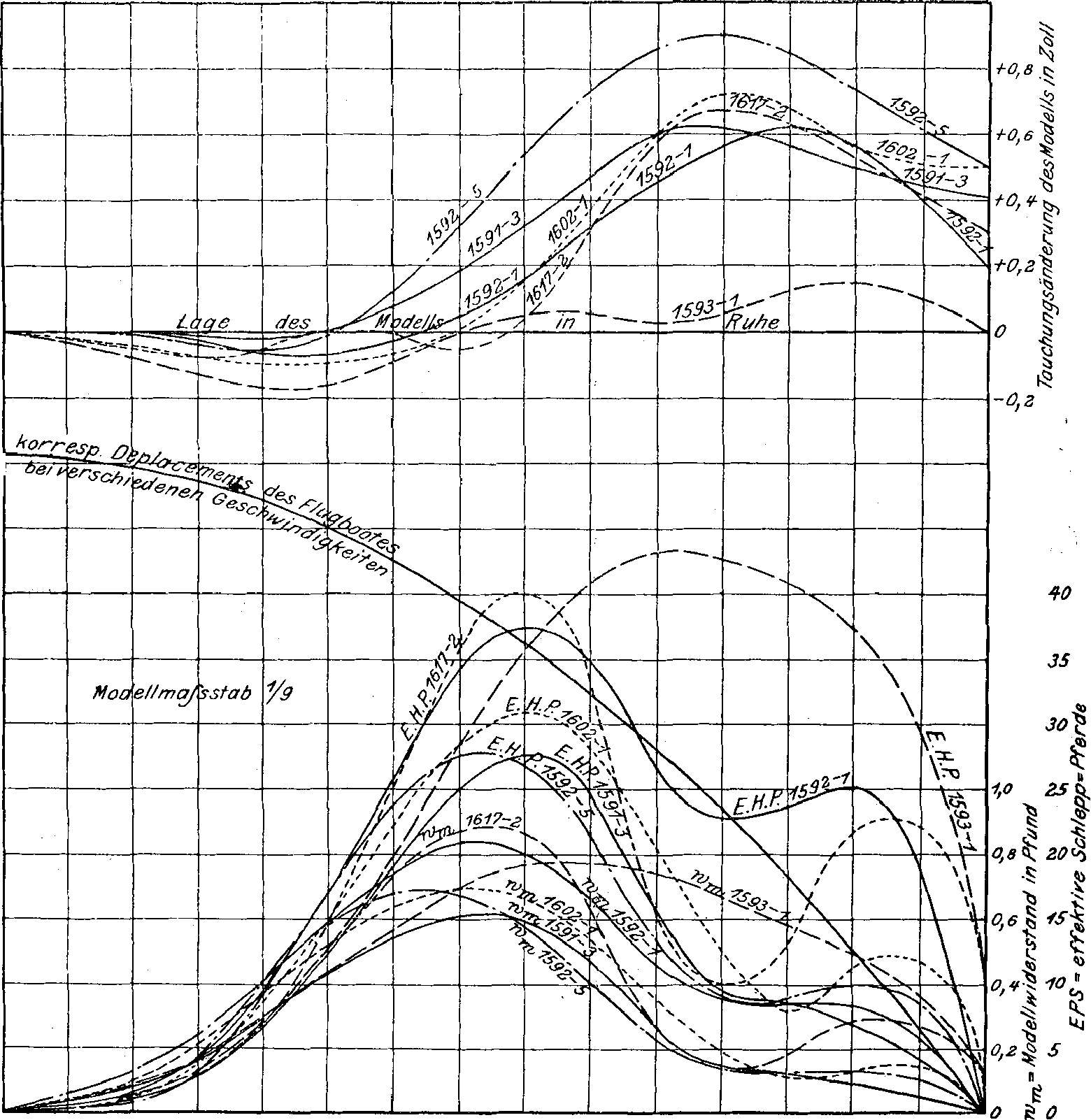 12 36 13 39 *2 15 #5 ? S 6 7 S 9 10 11 = ModeHgeschwindigkeit in fups/sek. O 3 6 3 12 15 18 21 2f 27 30 33 Vs - Flugbootsff eschivindigke/'t /n Meilen/std. Abb. 5. Modelle lür Flugboote von 2200 Pfd. Gewicht Angenommene Abflugsgeschwindigkeit Va = 45 Meilen/std.; Diagramme der Modellschleppwiderstände win der effektiven Schlepp-Pferdeslärken EPS der Flugboote sowie der parallelen Tauchungsänderungen der Modelle. Nachbildung verboten. 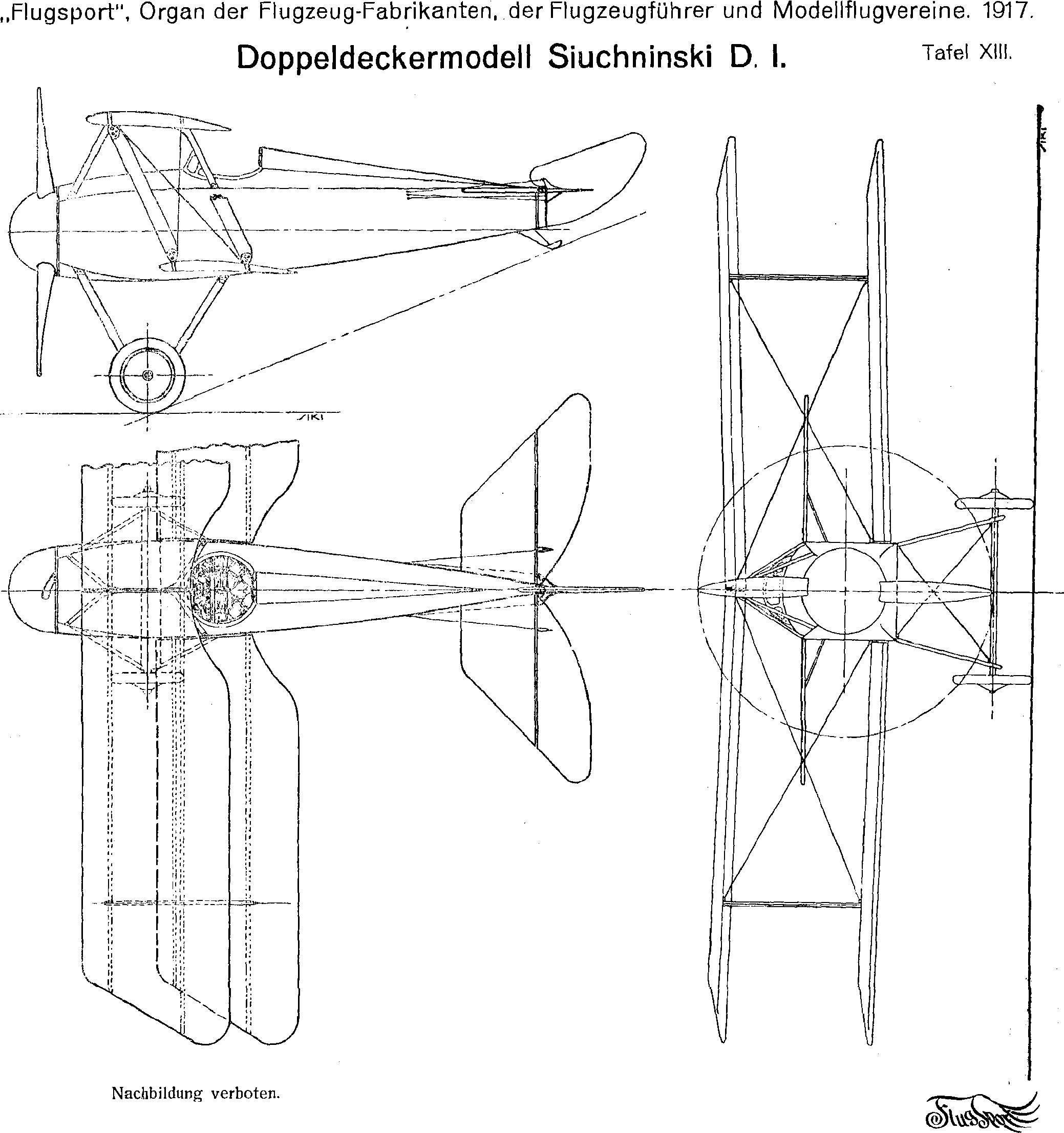 p cd' cd co cd —i o cd" cd v> cd 3 0) =! o: < cd CD 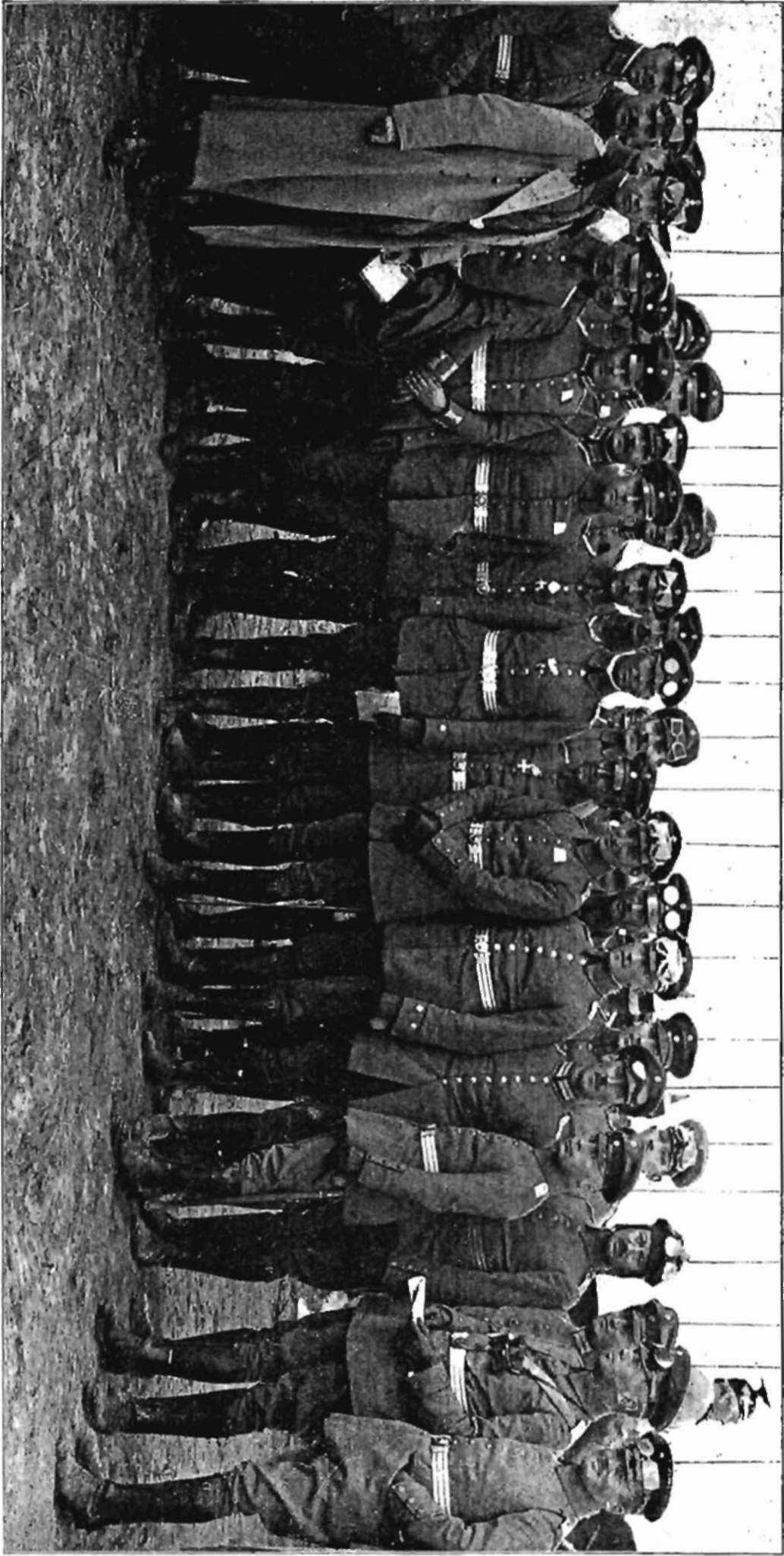 Oberlt. Falkenstein Riltmstr. Hantelmann hauptm. Palm (Gr Generalstab) Lt. Fink Oblt. Madienthun Lt Mahnke Lt. Frhr. v. Freiberg Lt. Blüthgen Lt. Mühlig-Hoffmann Lt. Reiche Oberlt. Steffen Lt. loly Lt. Berger f Lt. Knofe Lt. Reinhardt Oblt. Otto Keller Lt. Lauer Lt. Wulff Oblt. Albredit Lt. v. Buttler Lt. Scfimickaly Oblt. Junghans f Lt. Palm Lt. Blumbadi Lt. '/.immer Jllustrirte No. n technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnement: oo Ma; für das gesamte Kreuzband m.u £a- ma' s Postbezug M. 14 1913. Jahrg. V. Fllf^WCSCIl" pr»jahr. unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef. 4557 ftmt I. Oskar UrsinUS, Civilingenieur. Tel.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsports Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. . . - Zu beziehen1 durch alle Buchhandlungen. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 11. Juni Stillstand ist Rückschritt. Die plötzliche Eroberung der Luft hat sich in ein paar Jahren abgespielt. Nachdem man sich Jahrtausende mit diesem Problem abmühte, erscheint uns armen Menschen der Erfolg riesengroß. Man scheint übermäßig zufriedengestellt. Das heiße Sehnen, in desAethers Blau zu schweben, das tausende von Menschen fortgesetzt in intensiver Arbeit beschäftigte, ist etwas gestillt und damit ein sehr hohes Maß von Forschungskraft lahmgelegt. Diesen wichtigen Faktor haben selbst die Vertreter des Flugwesens an den führenden Stellen nicht erkannt. Selbstverständlich wird zugegeben, auf dem Gebiete des Flugwesens ist in den letzten Jahren Hervorragendes geleistet worden. Andererseits' kann man auch mit Recht sagen,, daß, nur die ersten Drachenflugmaschinen mit den uns zur Verfügung stehenden großartigen Hilfsmitteln, Motoren u. s. w., vervollkommnet sind. "Wenn wir die Flugmaschinen als Verkehrsmittel ausbilden wollen, so dürfen wir uns mit dem Geschaffenen auf keinen Fall zufrieden geben. Genau wie seiner Zeit bei der Entwicklung des Automobils, ob Dampf oder Benzin, so sollte man auch versuchen, noch die anderen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die Schwingen- und Rnttelf'lieger, bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit auszubauen. In der Literatur, insbesondere wenn man die älteren auf dem Vogelfing basierenden Werke studiert, findet der Ingenieur sehr be- achtenswerte Anregungen. Daß die in Frage kommenden Slellen dem Erfindergeist noch nicht Mittel und Wege gegeben haben, sich praktisch zu betätigen, liegt daran, daß sie zu wenig mit der Materie vertraut sind. Das muß endlich mal an dieser Stelle, die dazu berufen ist und sich verpflichtet fühlt, ausgesprochen werden. Den Wert der kostspieligen Laboratoriumsversuche wollen wir nicht bezweifeln. Das Flugwesen könnten wir jedoch zur Zeit am besten fördern, wenn wir die Mittel für den Ausbau der Erfindungen verwenden. Man muß sich wundern, daß in der National-Flugspende bis jetzt für diese Sache keinerlei Beträge reserviert sind. Wir können wohl behaupten, daß ein nicht geringer Teil der Zeichner die Unterstützung und Entwicklung des Flugwesens sich in diesem Sinne gedacht hatte. Nach unserer eingehenden Kenntnis der interessierten Kreise würde sicher beispielsweise ein Wettbewerb, wenn er mit hohen Preisen, 25,000 Mk., dotiert würde, einen Schwingenflieger entstehen lassen, der mindestens in der Lage wäre, sich mit eigener Kraft vom Boden zu erheben. Wir wissen allerdings auch dabei, daß gewisse Leute an namhaften Stellen diesmal wieder lächeln. Sie worden auch diesmal vorläufig das Hindernis sein und sich hindernd mit der bekannten Laienautorität i— — den Fortschritten in den Weg stellen. Wir werden jedoch Mittel und Wege finden, auch diese Hindernisse zu beseitigen, die in gleicher Weise seiner Zeit, als wir mit dem Ballonwesen kämpften, fortgesetzt unseren Bemühungen, das Flugwesen zu fördern, entgegen arbeiteten.  „Man startet morgens 5:5 in ßuc bei Paris und landet um 6:35 abends in Berlin. Was ist leichter?", hatte Daucourt im „Matin" gesagt. Für ihn waren auch die 900 km nichts, denn eine derartige Strecke in einem Tage mit einer Flugmaschine zurückzulegen ist bei unseren westlichen Nachbarn zur Selbstverständlichkeit geworden. , Hut ab vor derartigen Leistungen, muß man jetzt sagen. Wer weiß was wir im nächsten Jahr für Eintag-Ueberlandflüge sehen? Wenn jetzt ein Guillaux die Entfernung Biarritz-Kollum in Holland, einschließlich dreier Zwischenlandungen, eine Strecke Von 1253 km, in einem Tage zurückgelegt hat, dann müssen wir in 2 Jahren Ueber-landflüge haben, an deren Ueberwindung heute noch sehr wenige denken bezw. glauben. Es sind auch wirklich angenehme Reize, die der UeberlandfJug mit sich bringt. Ewig und ewig auf dem Flugplatz seine Linksrunden zu ziehen führt vielleicht noch soweit, daß die Maschine überhaupt in keine Rechtskurve mehr einschwenkt..... Warum werden bei uns so wenig Ueberlandflüge ausgeführt?, hört man so oft fragen. Liegt die Schuld an den Maschinen, Fliegern oder Fabriken? Es wären schon sidher große Ueberlandflüge, die in ihren Entfernungen den französischen gleichkommen, zu verzeichnen, wenn die Flugzeugfabriken den Fliegern Apparate zur Verfügung stellen würden. Dann und wann kommt dies ja auch mal vor! "Was nützen dem deutschen Reich alle seine Civilflieger und was nützt die Nationalflugspende — die Spende des ganzen deutschen Volkes — wenn die größte Zahl sämtlicher Flieger Platzflieger sind, die von großen Ueberlandflügen noch nicht den leisesten Vorgeschmack besitzen. Wieviel Flieger sind es denn, die Ueberlandflugpraxis haben und die wir in große Rennen schicken können? Die Nationalflugspende hat doch ihre Preise für Ueberlandflüge und wo bleiben die Leistungen? Sfe kommen und kommen nicht! Die französische Zeitschrift „Vie au grand Air" hat in einer  De Waal auf Fokker flog Berlin-Utrecht 580 km in 6 St. 20 Min. ihrer letzten Nummern eine graphische Darstellung sämtlicher Ein-tags-Ueberlandflüge um den Pommery-Pokal gebracht. Das Gefühl, was einem bei Betrachtung dieses Bildes beschleicht, ist für einen Deutschen wirklich kein angenehmes, wenn er unsere Leistungen mit denen der Franzosen vergleicht. Wir dürfen über sie so viel schimpfen wie wir wollen, wir können unsere Apparate in den Himmel hoch heben und wir können uns mit kommenden großen Flügen die Köpfe voll reden, aber wirklich gezeigt haben wir noch nichts. Bitte sehr, den Prinz Heinrich-Flug nicht zu vergessen, wird man entgegenhalten! Leider waren hier fast ausnahmslos Militär- flieger, sodaß eine richtige Beurteilung nicht einsetzen kann. Und dann kommen derartige Etappenfiüge gar nicht in Betracht, denn das waren Strecken aber keine „Entfernungen". Die Jahreszeit ist jetzt so günstig wie möglich, an einem Tage können hunderte von Kilometern zurückgelegt werden, aber es rührt sich niemand. Unsere Militärflieger sind Gott sei Dank noch für Ueberland-flüge zu haben und verbessern ständig ihre Leistungen. Es war wirklich eine Wohltat, als endlich einmal wieder ein Oivilflieger eine größere Reise mit einer Flugmaschine antrat. Eine Glanzleistung war der Flug Berlin—Utrecht von De Waal auf Fokker-Eindecker mit 100 PS Argus-Motor. Mit seinen 580 km Luftlinie kommt er schon eher den französischen Leistungen näher, aber leider ist die Freude nur eine halbe, da der tüchtige Flieger Holländer ist. Die Vorbereitungen hatten auch schon eine Art französischen Anstrich.' Am Nachmittag vor Antritt des Fluges hatte Fokker sein Einverständnis zu dem Ueberlandflug gegeben und am nächsten Morgen 3 : 30 „türmten" sie schon ab. De Waal hatte als Begleiter den Fokker-Flieger Kuntner — auch ein Ausländer, nämlich Oesterreichert,*r*t^zu dem beabsichtigten Fluge nach Amsterdam mitgenommen.. Ihre- Ausrüstung war sehr minimal, einige Schlüssel und Zündkerzen. Auch fehlte der sonst unvermeidliche große Kompaß mit Einzeiehnung der Abweichung, zu deren Feststellung gewöhnlich allein ein Tag benötigt wird und wobei iman sich nachher trotzdem mit um so größerer Sicherheit — verfliegt. De Waal hatte eine einfache Eisenbahnkarte zur Orientierung mitgenommen. Bis Hannover hatten die Flieger herrliches Wetter und landeten dort auf der Vahrenwalder Heide um 6 : 10. Im Eifer des Gefechtes hatte De Waal vergessen nach Hannover zu telegraphieren, daß dort Benzin und Oel bereit gehalten werde. So warteten sie bis 1Ü Uhr, als endlich der langersehnte Betriebsstoff zur Stelle gebracht worden war. Auf dem schlechten Gelände erfolgte der Start mit Seitenwind und siehe da, zum Unglück hatte der Vergaser noch das Bedürfnis den Fliegern einen Streich zu spielen. In 10 m Höhe setzte der Motor aus — die Düse war verstopft — und der Apparat sackte durch und landete ohne Schaden zu nehmen im Sand. Nach Behebung des Defektes erfolgte nach 10 Minuten ein neuer Start. Es war 9 Uhr 40 Minuten. Die Flieger gerieten in leichten Nebel und hatten besonders über dem Teutoburger Wald mit Fallböen zu kämpfen. Zwischen Osnabrück und Münster kamen sie in ein Gewitter, der Wind hatte sich gedreht, sodaß das Vorwärtskommen sehr langsam ging. In der Nähe der holländischen Grenze beschloß de Waal zu landen, da er durch die andauernden Anstrengungen sehr ermüdet war und sich auch Benzinmangel einstellte. So erfolgte denn in Hengelo in Holland, wo die Flieger von dem Publikum stürmisch begrüßt wurden, die zweite Zwischenlandung. Endlich, um halb 7 Uhr abends, nachdem sich das Wetter gebessert hatte, erfolgte zwischen dem Publikum in einer Gasse von ca. 30 m Breite, der Start. Unter ungeheurem Jubel verließ de Waal Hengelo und nahm die. Richtung auf Arnheim, wo er sein väterliches Haus überflog. Weiter ging's nach Goesterberg in der Nähe von Utrecht, wo die Flieger Mühe hatten, den Flugplatz zu erkennen, da es mittlerweile dunkel geworden war. Die auf dem Flugplatz anwesenden Militärflieger hatten Feuer angezündet und erleichterten dadurch die Landung, die 7:30 Uhr abends erfolgte. Die reine Flugzeit beträgt t> Stunden 20 Minuten. De Waal ist einige Tage später nach Haag geflogen und hat eine Reihe von Passagierflügen mit holländischen Offizieren ausgeführt. Woran viele schon gedacht haben, was manchmal fast unvermeidlich schien, ist leider zur grotesken Wirklichkeit geworden, ein Zusammenstoß in der Luft, wobei die beiden Insassen des einen Apparates den Tod landen. Am 14. Mai war dieser Schreckenstag, Hauptmann Jucker und sein Flugschüler Dietrich waren die Unglücklichen. Wenn zwei FJieger auf solche Art ums Leben kommen, ist es bedauerlich. Ich will den bekannten Satz: „Wie sich das Unglück zugetragen hat, ist nicht genau festzustellen", nicht als Richtschnur nehmen. Es" fragt sich: „Lassen sich Vorkehrungen treffen, daß derartige Unfälle vermieden werden können?" In gewissem Sinne muß man diese Ernst Kühne auf Albatros-Taube. Inhaber des deutschen Ueberlandflugrekords für Civilßieger. Flug Berlin-Dresden-Berlin. (Vergl. „Flugsport" Nr. 10 Seite 369.) Frage mit ja beantworten. Wie manchmal auf dem Flugplatz Johannisthal das Starten vor sich geht, ist nicht zu beschreiben. An vier verschiedenen Stellen des Flugplatzes stehen die Apparate. Als erster Grundsatz, der doppelt zu unterstreichen ist, gilt: „Rücksicht auf andere und gegen sich selbst". Es ist für die Flieger auf dem „alten Startplatz" unmöglich, das linke Feld des Flugplatzes bis an die Barrieren genau zu über- sehen. Warum nicht! Weil sich hier ein langer Erdhügel entlangzieht, der jede Aussicht versperrt. Es ist Pflicht der Flugplatz-Verwaltung, hier auf schnellstem Wege Abhilfe zu schaffen. Wie ging nun der Zusammenstoß von statten? Hauptmann Jucker kam von der ßallonhalle und Wecsler quer über den Platz mit anschließender Kurve. Wecsler will den Doppeldecker durch den Kurvenflug nicht gesehen haben und rannte dem gradeaus fliegenden Zweidecker in die Flanke. Beide Apparate Stürzten zu Boden, die Insassen des Doppeldeckers erhaschte das Todeslos. Hauptmann Jucker war sofort tot, sein Begleiter Dietrich erlag am 23. dieses Monats seinen schweren Verletzungen. Jucker war ein äußerst vorsichtiger und besonnener Pilot, der seines Könnens wegen allgemein geschätzt wurde. Es muß hier ein Punkt erwähnt werden, der bei diesem Unglücksfall eine Rolle gespielt hat, deren Definition mir erspart bleiben möge. Auf dem Flugplatz Johannisthal befinden sich ca. 500 Personen, die in der Flugzeugbranche beschäftigt sind. 80 Flieger und eine große Zahl Offiziere sind auf dem Platz tätig. Daß die Fliegerei mit Gefahren verknüpft ist, braucht nicht gesagt zu werden, aber hier soll es noch einmal zum Ausdruck gebracht werden, denn sonst stände nicht ein Heilgehilfe mit einer Krankenzyklonette als einziges Mittel den Fliegern bei Unfällen zur Verfügung. Es gehört schon für einen gesunden Menschen viel dazu, mit dieser Zyklonette auf dem unebenen Terrain des Flugplatzes zu fahren, ohne daß er nach dieser genußreichen Fahrt Erinnerungen mitnimmt, die ihm ein späteres Fahren verleiden. Einen verunglückten Menschen in einem derartigen Vehikel über den Flugplatz zu transportieren ist eine Anmaßung, für die die schärfsten Verurteilungen zu gut sind. Der letzte Transport hat ja auch die Tagespresse in Aufregung versetzt und es ist traurig, daß man auch noch über die sanitären Einrichtungen des Flugplatzes Worte verlieren muß. Wozu haben wir denn die Nationalf lugspende? Ist denn der Besitz eines modernen Krankenautomobils und die Stationierung eines ständigen Flugplatzarztes von den Fliegern eine unberechtigte Forderung? Wir leben doch im Jahre 1913 und wenn während der Pfingstferien im Reichstag der Abg. Dr. Müller-Meiningen den Reichskanzler auf die vollständig unzureichenden Rettungseinrichtungen auf dem Flugplatz Johannisthal aufmerksam machte und um sofortige Abstellung der Mißstände bat, dann war es die allerhöchste Zeit. .er. Die Frühjahrsflugwoche Johannisthal. Am letzten Sonntag begann die Flugwoche im Johannisthal. Die Tribünen waren stark besetzt. Man fühlt, auch der verwöhnte Berliner beginnt langsam, der Fliegerei etwas Interesse abzugewinnen. Das war höchste Zeit. Für die Flieger existiert das Publikum nicht, Sie sehen im Geiste nur immer ihr Ziel und das, was sie gewinnen. Die brennende Sonne mit der böigen Luft machte den Fliegern am Sonntag den Aufenthalt in der Luft nicht gerade angenehm. Trotz des 6 Meter windes wurde fleißig um den Dauer Wettbewerb geflogen. Es erzielten folgende Zeiten mit Fluggast: 1. Linnekogel (Rumpler-Taube) 1:41; 2. Stiploscheok (Jeannin=Taube) 1:37; 3. Wieting (Rumpler-Taube) 1:30; 4. Stagge (Wright) 1:24; 5 Stiefvater (Jeannin-Taube) 1:08; 6. Michaelis (Etrich-Taube) 45 Min.; 7. dänisch (Otto-D.) 38; 8 Zahn (Ago-D.) 25; 9. Freindt (Jeannin-Taube) 21; 10. Sedlmayr (Wright) 17; 11. Kießling (Ago-D.) 13; 12 Boutard (M-B.-Taube) 6; 13 v. Gorrissen (Ago-D.) 5; 14. Colombo (Moeve) 2 Min. — Mit Fluggast und vorgeschriebener Mindesthöhe von 700 Metern. 1. Michaelis (Etrich-Taube) 45 Min., 1700 Meter Höhe. Dauerflug ohne Fluggast 1. Schiedeck (A. F. G.) 1:19; 2. Schlegel (Aviatik-E.) 51 Min ; 3. Hanuschke (Hanuschke-E.) 36; 4. Roth (Harlan) 30; 5. Schwandt (Grade) 30; 6. V. Stoeffler (Aviatik-D.) 29; 7. Colombo (Moeve) 11 Min. Von den den Fachmann interessierenden neuen Konstruktionen sind zu nennen der Baumann-Frey tag-Doppeldecker, der bereits in Stuttgart auf dem Stuttgarter Wasen nennenswerte Flüge ausgeführt hat Die Konstruktion der Tragdecken des Baumann-Freytag- 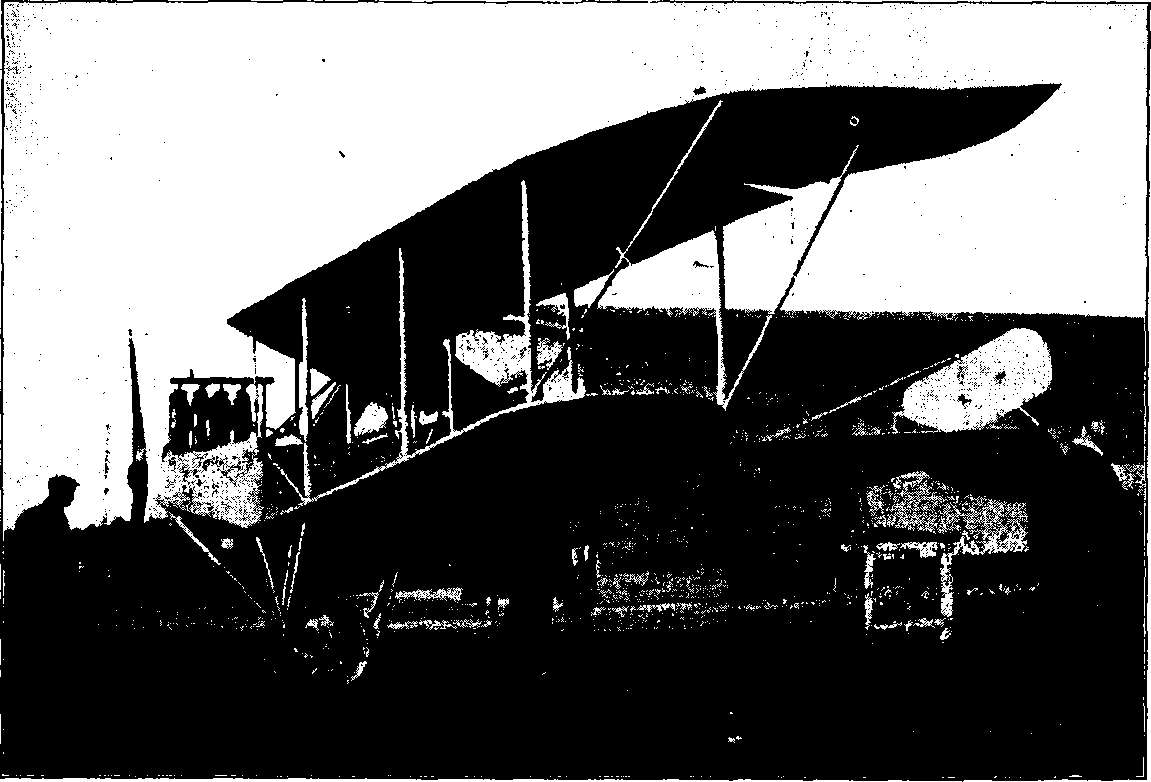 Zv/eidedier der Luftfahrzeug-Gesellschaft. Doppeldeckers ist eine vollständig neuartige. Das Tragdeckenprofil paßt sich automatisch der Geschwindigkeit und der Belastung an. Wir werden später auf die Einzelheiten dieses Apparates ausführlich zurückkommen. Ferner sah man einen Pfeildoppeldecker der Luftfahrzeug-Gesellschaft (s. die Abbildung), der von Langer geflogen wurde. Die Automobil- und A v i a ti k-Ak t - Ges. zeigte ihren Pfeil-Rumpf-Doppeldecker, der von Victor Stoeffler geführt wird und in der Luft eine ausgezeichnete Stabilität beweist. Der Otto-Doppeldecker wurde von dein Berliner Repräsentanten E. v. Gorrissen geflogen. In diese Maschine war ein 100 PS 6 Zyl. Argus-Motor eingebaut. Gemeldet waren folgende Flugzeuge und Flieger: Anmelder: Ago-Flugzeugwerke G.m.b.H. Allgemeine Fluggesellschaft tn. b. H. Automobil- und Aviatik A.-G FlugmaschineWrightG.ni.b.H. Flugschule Melli Heese G. m. b. H. Fokker Aeroplanbau G.m.b.H. Werner Freytag Dr. Geest Gothaer Waggonfabrik A.-G. Bruno Hanuschke Harlan - Werke G. in. b. H. Emil Jeannin Flugzeugbau G. m. b. H. Luftfahrzeug-Gesellschaft m. b. H. Luftverkehrsgesellschaft A.G. Gustav Otto, Flugmaschinenwerke E. Rumpier Luftfahrzeug- bau G. rn. b. H. Fliegerschule O. Schulz Otto Schwade & Co. Paul Schwandt Sport-Flieger G. m. b. H. Ernst Ph. Stoeffler Flugfülirer: v. Gurrissen W. Kießling Hans Zahn Theodor Schauenburg Alfred Friedrich Hermann Schiedeck Paul V. Stoeffler Ernst Schlegel Artur Faller Charles Ingold Gerhard Sedlmayr Ludwig Kammerer Lt. der Res. Stüber Charles Boutard Otto d'Ballod Heinz Erblich Frl. Ljuba Galanschikoff Hermann Gasser Albert Colombo Bruno Büchner Bruno Hanuschke Leo Roth Rubin Wecsler Alois Stiploscheck Otto Stiefvater Rene Freindt Bruno Langer Albert Rupp Felix Laitscli Robert Janisch Linnekogel Werner Wieting Walter Stagge Alfred Hennig Paul Schwandt Curt Müller G. A. Michaelis Ernst Philipp Stoeffler Flugzeug: 4 Ago-Doppeldecker 2 Tauben 1 Mars-Eindecker 1 Farman - Doppeldecker 1 Mars-Pfeil-Doppeld. 1 Aviatik-Eindecker 4 Aviatik - Doppeldecker 6 Wright - Doppeldecker 2 MB.-Tauben 1 Fokker-Eindecker 2 Baumann-Freytag- Doppeldecker 1 Geest-Eindecker 1 Gotha-Doppeldecker 2 Hanuschke-Eindecker 4 Harlan-Eindecker 3 Jcannin-Staliltaubcn 2 Pfeil-Doppeldecker 2 L. V. G. Eindecker 1 L. V. G. Doppeldecker 1 Otto-Doppeldecker 3 Rumpier-Tauben 1 Rumpler-Eindecker I Wright-Doppeldeckcr 1 Schwade-Stahlherz- , Doppeldecker 3 Grade-Eindecker 1 Etricli-Taube 1 Sportflieger-Taube 1 Albatros-Doppeldecker Prinz Heinrich-Flug 1913. (Fortsetzung und Schluß von S. 356 Nr. 10.) Wie wir bereits in der letzten Nummer des „Flugsport" berichteten, traf als Erster in Karlsruhe Lt. v. Hiddessen ein. Die meisten Flieger waren infolge der durch die glühende Sonne entstandenen Böen und durch geringes Tragvermögen der Luft gezwungen, Zwischenlandungen vorzunehmen. Die 320 km lange Strecke mit ihren vielen Kontrollstationcn stellte an die Flieger außerordentlich hohe Anforderungen. Der Bayrische Offiziersflieger Lt Freih. v. Haller blieb bei Worms mit seinem arg beschädigten Doppeldecker liegen. Von den auf der Strecke liegen gebliebenen Fliegern trafen spät abends in Karlsruhe ein Ing. Schlegel, Lt. Canter, Lt. Joly und Lt. Carganico. Am 15. Mai flog Ing. Thelen von seiner Zwischenlandungsstelle in Heidelberg um 4: 33 ab und landete 5 :22 in Karlsruhe. Lt. Coerper startete in Heidelberg 4: 44 und landete in Karlsruhe 5:12. Oberlt. v. Beaulieu stieg in Frankenthal 6 : 45 auf, passierte Heidelberg 7:33 und erreichte Karlsruhe um 8:04. Lt. Freih. v. Thüna erlitt bei Eschstein 5 km vor dem Ziel Zylinderbruch und mußte in sumpfigem Terrain landen. Nach der Reparatur flog er am folgenden Tage nach Karlsruhe, jedoch ohne Passagier. Zur Teilnahme an der am 16. Mai stattgefundenen Aufklärungsübung waren auf dem Luftwege in Karlsruhe eingetroffen: Oberlt. Taeufert, Lt. Geyer von Mainz kommend, Lt. Schmickaly und Lt. Wulff von Straßburg kommend, Lt. v. Beguelin, Lt. Pretzell Lt. Ehrhardt und Oberlt. ßarends von Mainz. Lt. Schulz hatte 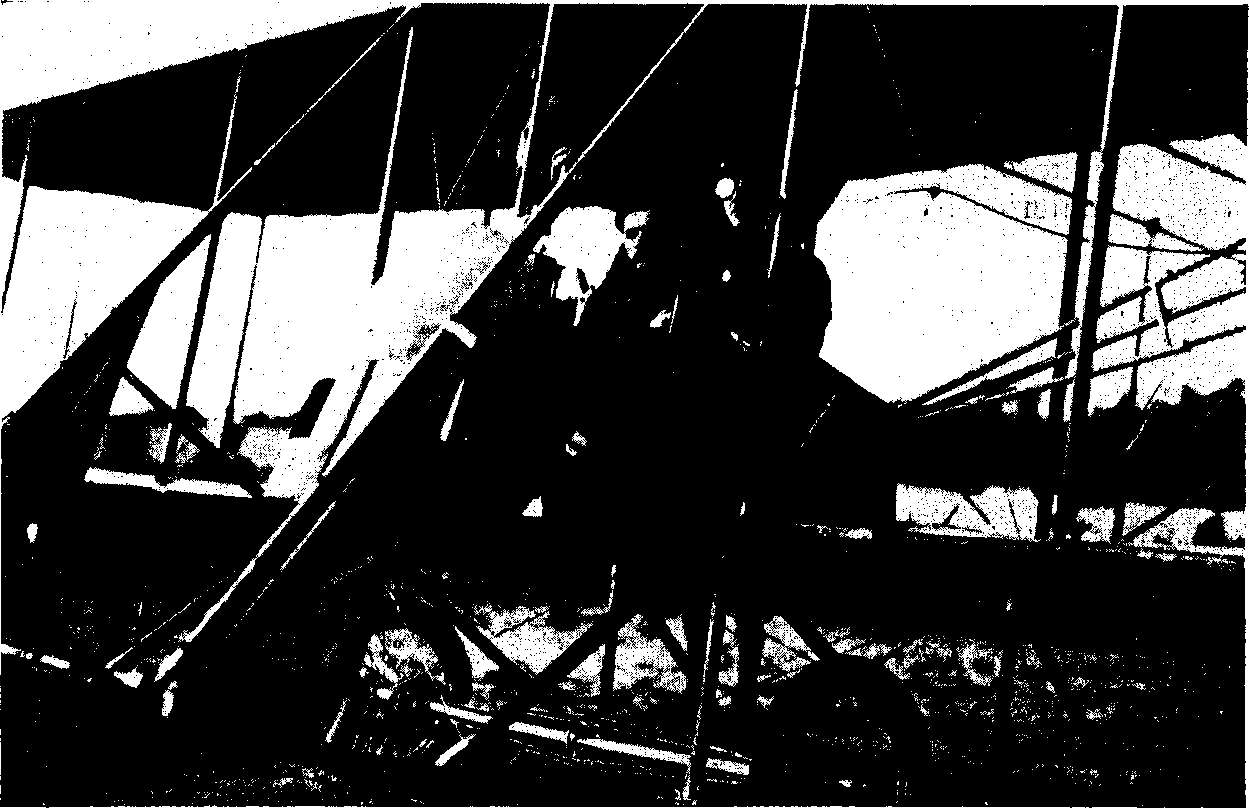 Von der Flugwoche Johannisthal. Scdlmayr auf dem neuen Wright-Doppeldecker mit eingeschlossenem Führersitz- seinen Apparat durch die Eisenbahn nach Karlsruhe kommen lassen Ferner erschien Lt. v. Haller mit neuem Apparat durch die Luft von München. Prinz Heinrich, der Leiter des Fluges, hielt in der Wohnung des Preußischen Gesandten v. Eisenstecher, eine Besprechung ab über die am nächsten Tage stattfindende Aufklärungsübung, der folgende Kriegslage zu Grunde lag. Allgemeine Kriegslage: Während blaue Kräfte am Oberrhein sich versammeln, sind rote Kräfte im Vormarsch in östlicher Richtung. Besondere Kriegslage: Bei dem Armee-Oberkommando der dritten blauen Armee (Karlsruhe), welcher eine Fliegerabteilung unterstellt ist, geht am Abend des 15. Mai folgende Meldung der dritten Kavalleriedivision ein: „Am Katharinenthaler Hof, 4 km nördlich von Pforzheim, Pforzheim, 15. Mai, 8 Uhr abends, an 8:45 abends. Starke, feindliche Kolonnen, anscheinend rechter Flügel des Feindes, erreichte heute mit Anfängen Stuttgart und Ludwigsburg." Die Flieger müssen bei diesen Uebungen eine kriegsmäßige Höhe von 800 m erreichen. Den Fliegern wird am Morgen mitgeteilt, wo die Kavalleriedivision sich befindet, damit sie über diese hinausfliegen können, um ihre Erkundigungen anzustellen. Erst von der Stellung der Kavalleriedivision ab müssen sie die kriegsmäßige Höhe einhalten. Die Lastwagengruppe des Grafen Pfeil marschiert vollständig kriegsmäßig hinter den Fliegern einher, während die andern Lastwagen friedensmäßig von Straßburg nach Karlsruhe fahren.. 1. Tag der Aufklärungsübung, 16. Mai. Bei dieser Aufklärungsübung kam es in erster Linie auf Vollständigkeit und Eichtigkeit, erst in zweiter Linie auf Geschwindigkeit der Meldung an 4: 15 vormittags bei Morgengrauen hielt Prinz Heinrich eine Instruktion an die teilnehmenden Flieger. Ergänzend zu der am Vorabend bekannt gegebenen Kriegslage war noch hinzuzufügen, daß 4 Marschkolonnen durch rote Flaggen dargestellt wurden, während die Kavallerie in Wirklichkeit vorhanden war. Startbereit waren 23 Flugmaschinen, von den 22 starteten, während eine infolge Motordefektes zurückbleiben mußte. Punkt 5 Uhr flog als erster Lt. Pretzell ab. Ihm folgten: Oblt. Donnevert 5:2, Lt. v. Hiddessen 5:7, Lt. v. Beguelin 5: 8, Lt. Coerper 5 :. 9, Dipl.-Ing. Thelen 5 : 10, Oblt. v. Beaulieu 5 : 10, Lt. Gayer 5 :10, Lt. Schulz 5 : 13, Ing. Schlegel 5 : 14, Lt. Schmickaly 5 : 16, Oblt. Barends 5 : 25, Lt. Carganico 5 : 25, Lt. Frhr. v.. Haller 5 : 29, Lt. Ehrhardt 5 : 31, Oblt. Taeufert 5 : 31, Lt. Zwickau 5 : 33, Lt. Joly 5 : 37, Lt. Engwer 5 : 43, Lt. Wulff 5 : 44 und Lt. Frhr v. Thüna 5 : 54. Auf der Meldeabgabestelle Katharinentalerhof trafen die Prinzen Heinrich, Waldemar von Preußen und Georg von Bayern ein. Die Meldesammelstelle, der Katharinenthaler Hof bei Pforzheim erreichten 19 Flieger, davon Lt. Schulz nach einer Zwischenlandung, Als Landungsplatz diente eine neben einem bewaldeten Berge gelegene trockene Wiese, 5 km nördlich Pforzheim. Prinz Heinrich hatte sich von der Abflugstelle in Karlsruhe mittels Automobil dorthin begeben, um die Flieger zu empfangen. Mit großem Eifer widmete er sich seiner verantwortungsvollen Aufgabe. Für jeden ankommenden Flieger hatte er ein paar aufmunternde freundliche Worte und schüttelte jedem kräftig die Hand. Sein sportlicher Geist und sein großes Verständnis — er ist eben selbst Flieger — belebte seine gesamte Umgebung und nicht zum wenigsten die Flieger seihst. Prinz Heinrich äußerte sich auch sehr befriedigend über die Leistungen und sagte: „In diesem Jahre haben Sie kolossal viel ge- lernt. Es ist ein riesiger Fortschritt in unserer Fliegerei und er liegt nicht zum mindesten auf persönlichem Gebiete, darin daß jeder mehr Zutrauen gewonnen hat". 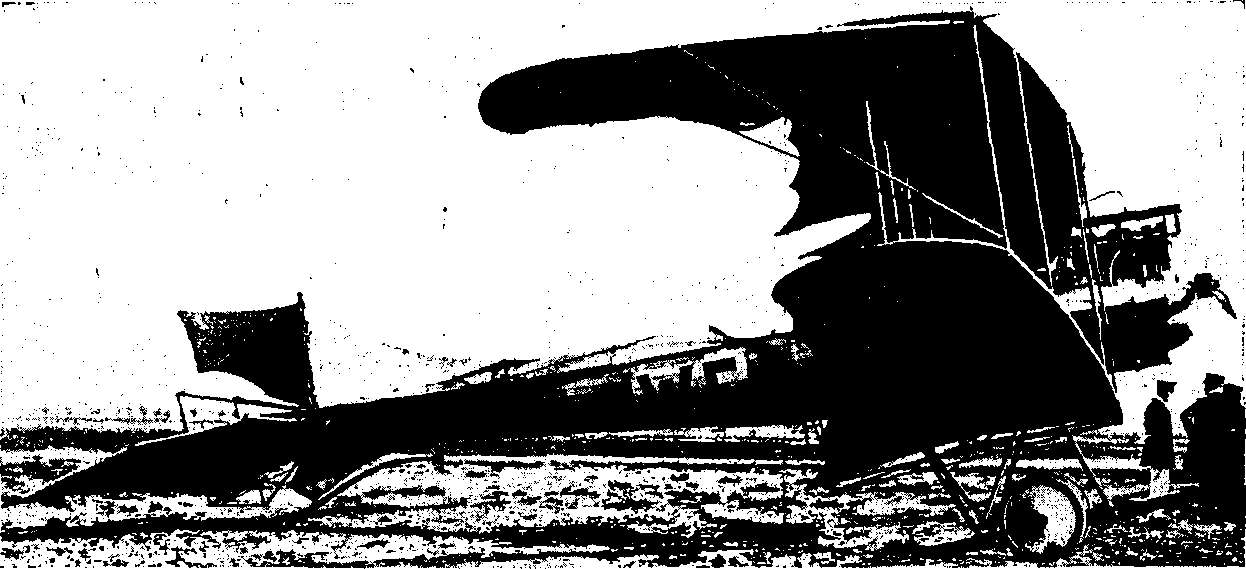 Von der F/ugwoche Johannisthal. Doppeldecker Baumann-Frey tag. Die Flieger mußten ihre Meldung im Flugzeug schreiben und skizzieren. Die von den Beobachtern erzielten Resultate waren zum Teil vorzüglich. Viele hatten 4 Marschkolonnen genau beobachtet,  Von der Flugwoche Johannisthal. Doppeldecker Baumann-Freytag Ansicht von vorn. Die unter den Tragdecken befindlichen Löcher dienen zum Einströmen der Luft, um das hintere untere Tragdeckenende zu wölben. Rechts oben^ein Wright-Doppeldecker im Fluge. ihre Stärke und Marschrichtung feststellen können. Eine solche Meldung lautete beispielsweise folgendermalten: „An den Führer der 3. Kav.-Div. Katharinentalerhof. Auf Straße Winzingen—Hemmingen 6:50 vorm. feindliches Bataillon in Marschkolonne, Gewehre zusammengesetzt. Anfang im Bachtale östlich Hemmingen. Davor abgesessene Kavallerie in Zugstärke. Einzelne Reiter ritten in westlicher Richtung durch Hemmingen". Die beste Meldung brachte Lt. Boehmer, der Beobachter von Lt. Canter. Die Uebung war um 8 : 30 beendet. Von dem Katharinenthaler Hof flogen bis zum Nachmittag 17 Flieger ab, die ohne Zwischenlandung in Straßburg ankamen. Auf der Meldeabgabestelle blieben liegen Lt. Schulz, Oblt. Taeufert und Lt. Zwickau. Interessant sind die kurzen Flugzeiten von Karlsruhe nach Straßburg. So brauchte Ing. Thelen 41 Min., Lt. Carganico 43 Min., Lt. Coerper 46 Min., Lt. Kastner auf seiner Albatros-Mercedes-Taube hatte in Karlsruhe Kühlerreparatur und flog erst abends nach Straßburg. Die Flieger landeten in Straßburg in folgender Reihenfolge:
um das Programm der am anderen Tage stattfindenden Aufklärungs-übiing zu besprechen. 2. Tag der Aufklärungsübung, 17. Mai. Die abends zuvor bekanntgegebene Kriegslage war folgende: Starke rote Kräfte sind gegen den Oberrhein vorgegangen. Neu-breisach wurde auf dem linken Rheinufer eingeschlossen und auf der Süd- und Westfront angegriffen. Die bei Eichwald Neuenbürg auf das rechte Rheinufer hinübergeführten roten Kräfte werden bei Freiburg durch blaue Truppen geschlagen, konnten sich aber südlich des Neuenwagen- und Müchlinbaches anscheinend in der Linie Hartheim-Stauffen festsetzen. Auf dem Polygon herrschte noch undurchdringliche Dunkelheit. Ein böiger Wind schlug uns klatschend den Regen ins Gesicht. Prinz Heinrich hielt eine Besprechung ab und entschied sich, den Start erst 5 : 30 frei zu geben. Die vorgenommenen Windmessungen ergaben in 600 m Höhe eine Stärke von 14 Sek/m. Den Fliegern war die Aufgabe gestellt zwecks Ausführung zweier kriegsmäßiger Uebungen zunächst nach Freiburg zu fliegen., dort zu landen und ihren Auftrag, der folgendermaßen lautete, entgegenzunehmen: „Sie erhalten vom Führer der Feldflieger-Abteilung für Freiburg folgenden Befehl: Erkunden Sie die Aufstellung des Gegners östlich der Bahn Freiburg—Müllheim. Besonderer Wert wird auf Erkundung der feindlichen Artilleriestellung sowie eventuell zurückgehaltener Reserven gelegt". Nach Ausführung dieses Auftrages mußte in Freiburg gelandet und Meldung erstattet werden, worauf die Flieger mit einem zweiten Auftrag wieder starten mußten: „Von Neubreisach hat Infanterie des Angreifers die Ostränder des Kastenwaldes (Forst Kolmar) und die südlichen Waldstücke gewonnen. Stellen Sie fest wieviel und welcher Art der Artillerie vom Feinde gegen die Westfront der Festung zwischen Straße Neubreisach-Appenweier und dem Vanbankanal entwickelt ist und wo sie sich befindet". Im ganzen flogen in Straß bürg 13 Flieger ab, hiervon erfüllten 9 ihre Aufgabe in vollem Umfange. Als Erste starteten um 5 : 39 Lt. Geyer, ferner Lt. Coerper, Ing. Thelen, Lt. Ganter, Lt. Carganico, Lt. Kastner, Lt. von Hiddessen, Lt. Freih. v. Haller und Ing. Schlegel. Oberlt. v. Beaulieu mußte infolge ßenzinrohrdefektes aufgeben. Lt. Engwer machte einen Fehlstart und beschädigte seine Taube. 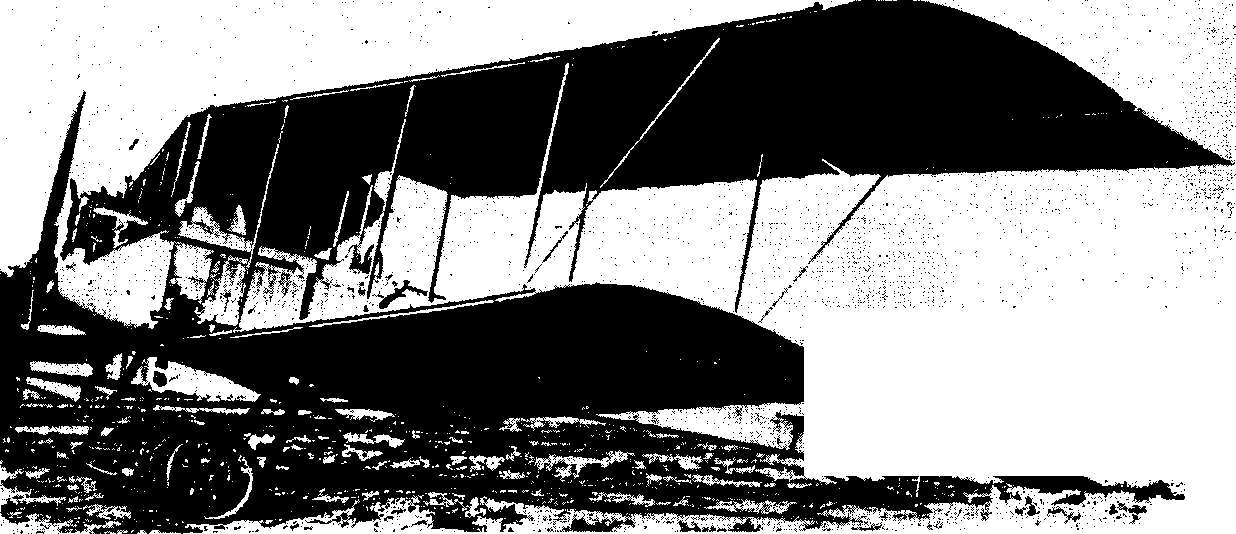 Von der Flugwoche Johannisthal. Aviatik Pfeildoppeldecker. Oberlt. Donnevert mußte kurz hinter Straßburg eine Notlandung ausführen. Ing. Schlegel verzichtete auf den Start. Die für die Aufklärungsübung gestellte Aufgabe wurde von folgenden Fliegern gelöst: Lt. Canter, Beobachter Lt. Böhmer (Rumpler-Taube, 75 PS Mercedes) Dipl.-Ing. R. Thelen, Beobachter Kap.-Lt. Weiß (Albatros-Doppeldecker 95 PS Mercedes) Oberlt ßarends (Rumpler-Taube 100 PS Argus) Lt Frhrr. v. Haller, Beobachter Oberlt. v. Könitz (Otto-Agn-Doppeldecker 100 PS Argus) Lt. Joly, Beobachter Oberlt. Felmy (Gotlia-Taube 95 PS Mercedes) Lt. Frhrr. v. Thüna, Beobachter Lt. v. Falkenhayn (L.-V.-G.-Doppeldecker 95 PS Mercedes) Lt. Carganico, Beobachter Lt. Koch (L.-V.-G.-Doppeldecker 100 PS Argus) Lt. Coerper, Beobachter Lt. v. Schroeder (Jeannin-Stahltaube 100 PS Argus) Lt. Geyer, Beobachter Lt. Prins (Aviatik - Doppeldecker 100 PS Argus) Der bisher an der Spitze stehende Lt. v. Hiddessen auf D. F. W.-Eindecker geriet leider auf dem Flugplatz Freiburg beim Start zum zweiten Auflärungsflug in einen Graben, wobei er sich seinen Apparat sehr stark beschädigte und ausschied. Lt v. Hiddessen hatte gegenüber seinen Konkurrenten einen recht erheblichen Vorsprung, so daß dieser Zwischenfall sehr zu bedauern ist. Die während der Aufklärungsübungen erzielten Resultate waren in militärischer Hinsicht befriedigend. Für die Beobachter war es nicht leicht, aus der kriegsmäßigen Höhe die verdeckten Artillerie-dtellungen zu finden. Es war eben Krieg. Die Maschinen wurden durch die Böen mächtig gerüttelt und hin- und hergeworfen. Für den Beobachter gab es aber nur einen Gedanken, zu sehen und zu schreiben. Was die Flugmaschine machte, war ihm gleich Das war Sache des Führers und der erfüllte seine Aufgabe in tadelloser Weise. I Der Prinz Heinrich-Flug, die größte Prüfung der deutschen Flugmaschinen, ist somit zu Ende. Der Flug ist infolge seiner vortrefflichen Organisation programmäßig verlaufen Der komplizierte Apparat funktionierte wie ein Uhr werk, dank der hervorragenden und aufopfernden Tätigkeit seines Protektors und Oberleiters, des Prinzen Heinrich von Preußen. Für ihn gab es keine Ruhe, keinen Schlaf. Seine Aufmerksamkeit galt sämtlichen Einzelheiten des Fluges. Ueberau wollte er zugleich sein, um den Fortgang zu beobachten, um im geeigneten Moment selbst eingreifen zu können. Daß das Unternehmen so vorzüglich gelang, ist auch nicht zum wenigsten den peinlichen exakten Vorarbeiten, die Oberstlt. v. Oldershausen, Dr. Linke, Dr. Joseph und Hauptmann Spangenberg leiteten, zu danken, ferner den arbeitsfreudigen Herren des freiwilligen Auto» mobilkorps und den Automobilisten, die die Begleitwagen stellten. Wenn mar! die Gesamtleistungen nachstehender Tabelle vergleicht, und dabei die vielen Zwischenlandungen und die ungünstigen WitterungsVerhältnisse berücksichtigt, kann man es begreiflich finden, daß die Leiter des Fluges und Militärs, die es in erster Linie angeht, mit den Leistungen zufrieden waren. I. Etappe: Wiesbaden—Kassel: Wiesbaden gestartet: 19. Gießen Zwischenldg.: 17. Kassel gelandet: 16. II. Etappe: Kassel—Koblenz: Kassel gestartet: 16. Koblenz gelandet: 12. III. Etappe: Koblenz—Karlsr.: Koblenz gestartet: 12. Karlsruhe gelandet: 9. (dazu 11 Teilnehmer anden Aufklärungsübungen.) I. Aufklärungsübung: Karlsruhe — Pforzheim Straßburg: Karlsruhe gestartet: 23. Pforzheim gelandet: 20. Straßburg gelandet: 18. II. Auiklärungsübung: Straß bürg—Freiburg— Neubreisach—Straßburg: Straßburg gestartet: 15 (abgeflogen 13). Neubreisach gelandet: 10. Straßburg gelandet: 9. Nach dieser angestrengten entsagungsvollen Arbeit herrschte, während des Schlußbanketts am Abend des 17. Mai, das im Hotel Stadt Paris in Straßburg unter dem Vorsitz des Prinzen Heinrich stattfand, recht freudige Stimmung. Vor allen Dingen war es für den Protektor des Fluges, den Prinzen Heinrich, eine große Befriedigung, in seiner Bede feststellen zu können, daß die Veranstaltung glücklicherweise kein Menschenleben gekostet hat. Prinz Heinrich sagte in seiner weiteren Begrüßungsrede: „Vergleiche ich den diesjährigen Flug mit den ähnlichen Veranstaltungen der beiden letzten Jahre, so drängt sich mir unwillkürlich auf, daß in diesem Jahre die Fortschritte besonders groß zu nennen sind, und zwar liegen die Fortschritte auf zwei Gebieten, einmal auf rein technischem Gebiet und ferner auf dem flugtechnischen Gebiet. Es ist der merkwürdige Fall festzustellen, daß die flugtechnischen Fortschritte größer sind als die rein technischen. Mit anderen Worten, die Herren Flieger sind vorzüglich durch- und ausgebildet. Sie haben ihre Maschinen vorzüglich in der Hand, sie riskieren bedeutend mehr als in den vergangenen Jahren, sie sind sicherer und ihrem Motor überlegen. Trotz aller Anstrengungen scheint es der Technik noch nicht gelungen zu sein, die Motoren so herzustellen, wie sie sein müßten. Die Zusammenbrüche sind zum größten Teil auf den Mangel an Zuverlässigkeit der Motoren zurückzuführen. Der Pforzheimer Aufklärungstag war ein Ehrentag für das deutsche Flugwesen. Wer Gelegenheit gehabt hat, unsere jungen Herren und die dabei beteiligten Zivilingenieure aus der Ferne kommen zu sehen, vor eine rein kriegsmäßige Aufgabe gestellt, sie lösen, landen, melden zu sehen, aus dem tiefblauen Himmel herabschweben, den, sei er ein noch so großer Skeptiker, packt es doch, und unwillkürlich mußte man bei sich denken: An der Fliegerei ist doch was dran. Es ist sehr viel dran, meine Herren. Ich will mich eines Vergleiches bedienen: Der Marineoffizier gilt besonders in jungen Jahren vermöge seiner Aufgabe und seines Berufes als besonders schneidig. Es wird Ihnen bekannt sein, daß die jungen Offiziere auf dem Torpedoboot tätig sind. Das Torpedoboot für die Armee ist das Flugzeug Der Charakter wird gestählt, hohe Anforderungen an den einzelnen Menschen und die Willenskraft werden gestellt. Er kommt unwillkürlich mit der Technik in Berührung. Die Technik ist auch für den Menschen bildend und erziehend. Die Armee sollte dankbar sein, daß sie einen großen und später, wie wir hoffen, noch größere Kreise in dieses Mittel hineinziehen und erzieherisch ausbilden kann". Hiernach überreichte der Prinz im Sachsencasino den Fliegern eigenhändig die vom Preisgericht zuerkannten Preise. Es erhielt: den Kaiserpreis Lt. Canter auf Rumpler-Taube für die beste Gesamtflugleistung, ferner den Prinz Heinrich-Preis der Lüfte für die beste Leistung bei der Aiifklärungsübung und den zweiten Zuverlässigieits-preis (Ehrenpreis des Bayr. Kriegsministers). Sein Beobachter, Lt. Boehmer, erhielt für die beste Meldung den Preis des Großherzogs von Baden. Der erste Preis im Zuverlägsigkeitsflug und damit die 5000 Mark der Nationalflugspende, fiel an Lt. von Hiddessen (D. F.-W. Eindecker 95 PS Mercedes), der auch den Preis des preußischen Kriegsministeriums erhielt. Der 3. Preis (Frankf. Autom.-Cl.) und 3000 Mk. G-eldpreis fiel an Ing. Schiegel (Aviatik - Eindecker 100 PS Argus), der 4. und 2000 Mk. an Lt. Joly (Gotha-Taube, 95 PS Mercedes), 5. Lt. Carganico (L. V. G. 100 PS Argus), 6. Oberlt v. ßeaulieu (Albatros-D.-D. 95 PS Mercedes), 8. Lt. Kastner, (Albatros-Taube 95 PS Mercedes) und .9. Preis Lt. Coerper (Jeannin-Stahltaube, 100 PS Argus.) Für zwei zurückgelegte Flugstrecken erhalten Preise: Lt. v. Thüna (L. V. G. 95 PS-Mercedes) (Preis des Statthalters Graf Wedel); Lt. v. Haller (Preis des Prinzen Karl Anton von Hohenzollern) und Ing. Suwelack. Für eine zurückgelegte Flugstrecke Lt. Blüthgen; Oberlt. Donnevert; Lt. Zwickau, Lt. Sommer und Lt. Engwer. Startpreise erhielten Lt. Hailer, Lt. Vierling und Lt. Weyer. Die Preise für die Aufklärungsübungen wurden folgendermaßen verteilt: Prinz Heinrich-Preis der Lüfte: Lt Canter (Rumpler-Taube,); Lt. Böhmer als Beobachter im Canterschen Flugzeug (Preis des Großherzogs von Baden); 2. Preis Lt Geyer (Aviatik-Argus D. D.) und der Beobachter Lt. Prins; 3. Preis Lt. von Haller (100 PS Otto Argus D. D.) und der Beobachter Oberlt. v. Könitz; 4. Preis Oberlt. Barends (Rumpler-Taube) und der Beobachter Oberlt. Wilberg; 5. Preis Ingenieur Thelen und der Beobachter Kaplt. Weiß; 6. Preis Lt. Coerper und der Beobachter Lt. v. Schröder; 7. Preis Lt. Joly und der Beobachter Oberlt. Felmy; 8. Preis Lt.- Carganico und der Beobachter Lt. Koch; 9. Preis Lt. v. Thüna und der Beobachter Lt. v. Falkenhayn; 10. Preis Lt. v. Hiddessen und der Beobachter Lt. Behm; 11. Preis Oberlt. Donnevert und der Beobachter Lt. Warso. Endlich erhielt Lt. Ehrhardt noch einen besonderen Preis. Die Zuverlässigkeitsflüge der Südwestgruppe des D. L. V., deren dritter hiermit sein Ende erreicht hatte, haben sich mittlerweile zn einem klassischen Flugwettbewerb ausgebildet, auf den die Augen der ganzen ,Welt gerichtet sind. Es ist deshalb mit Freuden zu begrüßen, daß Prinz Heinrich seine Mitarbeit für das nächste Jahr wieder in Aussicht gestellt hat. Der Bristol-Eindecker (Hierzu Tafel XIV) eine der bekanntesten und geschmackvollsten Konstruktionen englischer Herkunft, wird von der „Bristol Comp." fabrikmäßig hergestellt. Das Fahrgestell rnht hauptsächlich auf zwei in Gummiriagen aufgehängten Rädern von 750 mm Durchmesser. Vier sehr kräftige Holzstreben von tor-pedoelliptisohem Querschnitt verbinden die Kufen mit dem Rumpf. Die Verbindungsstellen an den Enden derselben sind durch eingeleimte. Holzklötzchen verstärkt und durch ausgesparte Blechbeschläge armiert. Hierdurch werden allmähliche, Uebergänge geschaffen und auftretende Sclmbbeanspruolmngen im Verein mit der starken Kabel-verspar.nnng günstig abgefangen. Vorn laufen die Kufen sclniabel- .Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XIV. Engl. Bristol-Eindecker. 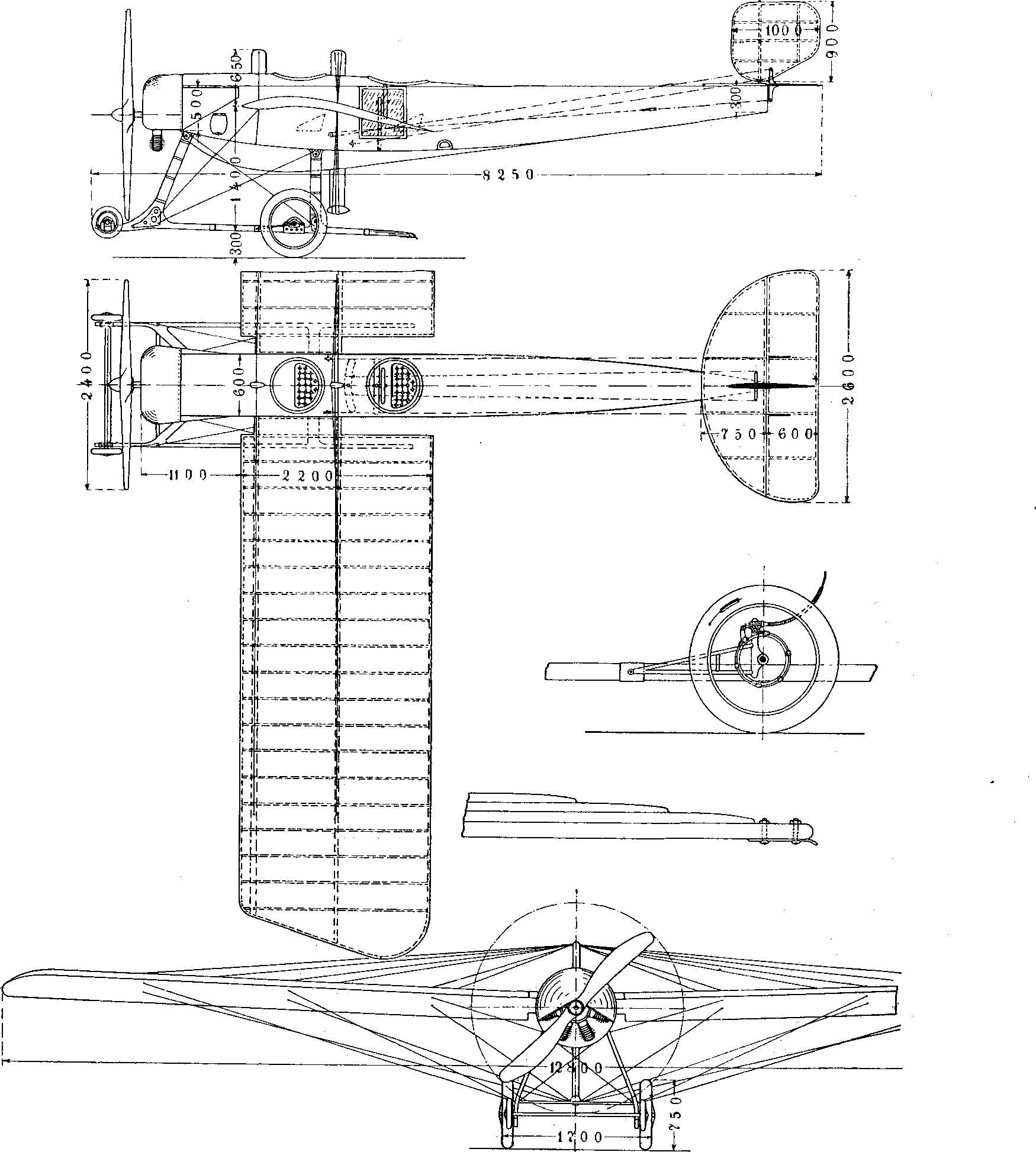 Nachbildung verboten. artig aus und tragen eine mit Gummiringen abgefederte Stoßachse, auf deren Enden zwei kleine Stoßräder von 350 mm Durchmesser sitzen. Hinten laufen die Kufen blattfederartig aus. Gegen Abnutzung sind ihre Enden mit Stahlblechkrallen bewehrt. (Siehe Detail rechts unten) Um den Auslauf der Maschine zu verkürzen, wird vielfach an den Laufrädern eine Bandbremse angebracht. (Siehe Detail rechts oben) Dieselbe wird gegebenenfalls vom Führersitz aus mittels Bowdenzug in Tätigkeit gesetzt. Eine zwischen den Bandenden eingeschaltete Druckfeder lockert das Bremsband auf der Bremsscheibe, sobald der Bowdenzug nachläßt. Der zweisitzige Motor-Rumpf verjüngt sich fischleibartig nach hinten. Vorn befindet sich ein 80 PS Gnom-Motor, der eine Luftschraube von 2,4 m Durchmesser antreibt. Eine Aluminium-Blechhaube umschließt größtenteils den Motor und läuft allmählich in den Rumpf über. In der Mitte desselben zwischen den zwei nasenartigen Spannsäulen befindet sich der Begleiter-Sitz, dahinter der Führersitz. Seitlich im Rumpf in der Nähe des Führersitzes befinden sich steigbügelartige mit Blech eingefaßte zum Einsteigen dienende Oeffnungen. Zur Verbesserung der Führeraussicht sind in den vertikalen Rumpfseiten Glimmerscheiben eingesetzt. Die Tragflächen haben eine Spannweite von 12,8 m und eine Flächentiefe von 2,2 m. Dieselben sind zwei Grad nach oben gestellt und zeigen nieuport-artige Profilierung. Der Flächeninhalt der Tragdecks beträgt 25 qm. Die Flügelenden sind trapezartig nach hinten abgeschrägt und zugerundet. Am Rumpf sind die Flächen ausgespart, um ein bequemeres Ein- und Aussteigen und eine bessere Aussicht der Insassen zu ermöglichen. Zur Verspannung wird ausschließlich Stahldrahtseil verwendet. Die Schwanztragfläche ist 2,8 qm groß. Hiervon entfallen 1,5 qm auf das Höhensteuer und 1,3 qm auf die Dämpfungsfläche. Das 0,8 qm große Seitensteuer dreht sich um einen Stahlrohrmast, der inmitten der Schwanzfläche steht. Die Steuerung ist die normale Militärsteuerung und erinnert in ihrer Ausführung stark an die bekannte Deperdussinsteuerung (siehe Flugsport Jahrg. 1911 Seite 736 Tafel XII.) Das Gewicht der Maschine beträgt in betriebsfertigem Zustande incl. Betriebsstoffvorrat für 4 Stunden 450 kg. Die Maschine soll dabei eine Geschwindigkeit 116 km pro Stunde erreichen. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. "Wer hier in Frankreich lebt, muß sich die Neugier abgewöhnen. Es ist das um so schwerer, als diese Neugier gar zu häufig durch die Vorkommnisse mannigfacher Art angeregt wird. Da stürmt unerwartet von irgend einer Seite her so eine rechte große Sensation heran: die Presse entrüstet sich in spaltenlangen Artikeln und ruft „Skandal"! Die Flieger zucken verzweifelt die Schultern, die eingeweihten Kreise schimpfen und die ganz Eingeweihten blinzeln sich verständnisinnig zu. Alles ist in heller Aufregung, man verlangt Remedur, man schreit nach Maßregeln oder Gegenmaßregeln, beschuldigt sich gegenseitig und setzt Kommissionen ein, die, „die Sache schon besorgen werden". Und am nächsten Tage braust ein neuer Skandal heran, wieder schimpft und beschuldigt man sich, wieder ruft man nach energischen Maßregeln und wieder setzt man die unvermeidliche Kommission ein . . . und wendet sieh der neuesten Sensation zu. Man erregt sich hier unglaublich leicht und vergißt ebenso unglaublich leicht. "Wenn man heute beispielsweise an den maßgebenden Stellen sich erkundigt, was aus der mit Bezug auf die Militärflugplätze angeordneten , grossen Enquete geworden ist, dann wird man kaum verstanden; es sind inzwischen so viele neue interessante Dinge auf die Tagesordnung gekommen, daß man sich jener Episode längst verklungener Zeit gar nicht mehr erinnert. "Wirklich, der Neugierige kommt hier nicht auf die Kosten. "Wenn aber die eingeleitete „strenge und gründliche Untersuchung" überhaupt einen wahrnehmbaren Erfolg gehabt hat, so ist es, wie ja seinerzeit auch an dieser Stelle vorausgesagt worden ist, das kräftige Emporblühen des Militär-Flugwesens, welches jetzt zwar in stillerer, aber bei weitem nachhaltiger Weise arbeitet und seine Vervollkommnung betreibt. Geben wir uns darüber keiner Täuschung hin; die: französischen Militärflieger suchen sich in systematischer Weise fortzuentwickeln und namentlich ihre Organisation an der Ostgrenze wird von Tag zu Tag eine geschlossenere und mächtigere. Unaufhörlich werden auch an der Grenze Uebungsflüge vorgenommen, bei denen zum Teil sehr ansehnliche Leistungen erzielt und immer neue Formen und neue Fortschritte gefunden werden. So hat im Laufe dieses Monats in der Region von Troyes ein grosser Rekognoszierungsflug des Generalstabs stattgefunden, an dem ein General und fünfzehn höhere Offiziere teilgenommen haben. Zu dem Geschwader von Troyes hatte man noch weitere Luftgeschwader, die sich aus Breguet-Zweideckern und Borel-Eindeckern zusammensetzten, hinzugezogen und der Flug, der sich auf sechs Tage erstreckte, hat einen durchaus normalen Verlauf genommen. Wenige Tage später hat das Luftgeschwader von Maubeuge, bestehend aus fünf Flugzeugen, die von drei Offizieren und '2 Unteroffizieren gesteuert werden, einen geschlossenen Plug von Maubeuge nach Calais ausgeführt, wobei in Dunkerque eine Zwischenlandung vorgenommen wurde. Von Calais aus ging das Geschwader auf dem Luftwege wieder in seine Garnision zurück; auch dieser Flug verlief in ungestörter Weise. Eine interessante Flugleistung wurde auch von dem Geschwader von Toul vollbracht: diese aus vier Flugzeugen zusammengesetzte Einheit (vier Henri Farman, die von dem Hauptmann Schneegans, dem Leutnant Prat und zwei Feldwebeln gesteuert werden) war nach dem Lager von Mailly kommandiert worden, um dort gelegentlich der Artillerie-Schießübungen Zielfeststellungen vorzunehmen. Das Geschwader flog am frühen Morgen geschlossen von Toul ab und langte dort am Abend auf dem Luftwege wieder zusammen an, nachdem es- die 175 km ohne Zwischenfall zurückgelegt hatte. Zahllose weitere Flüge sind dieser Tage von Militärfliegern vollbracht worden: von Buc nach Epinal (Leutnant Recke, Borel-Gnom, in 2 '/j Stunden), von Chartres über Orleans nach Buc, von Etampes bis Chartres und zurück (Leutnant Cassin, Farman-Gnom, 200 km), von Etampes nach Mailly und zurück (Hauptmann Faure, Bleriot-Gnom in 3 Vj Stunden), u. s. w. Uebrigens hat der Kriegsminister soeben besondere Instruktionen für die Luftgeschwader in den Militärlagern erlassen, in denen folgende wesentliche Bestimmungen getroffen werden: Sämtliche Bewegungen der Luftgeschwader haben auf dem Luftwege zu erfolgen, ausgenommen Fälle von „force majeure", über die aber jedesmal dem Kriegsminister direkt Bericht zu erstatten ist. Die den Geschwadern im Mobilisierungsfalle zugeteilten Flieger haben an den Uebungsflügen teilzunehmen. Das zu den Geschwadern gehörige Material an Automobilen soll nach Möglichkeit reduziert werden; dagegen sollen diejenigen Geschwader, welche nicht die genügende Anzahl von Flugzeugen in Bereitschaft haben, sich durch die Mobilisierungsflugzeuge ergänzen. Jedem Geschwader ist ein siebendes Flugzeug, als Reserve, mitzugeben. Ersatzteile sind rechtzeitig an den Bestimmungsort des Geschwaders vorauszusenden. Ferner wird bestimmt, daß in einer Reihe von Geschwadern die einsitzigen Flugzeuge durch zweisitzige ersetzt werden. Auch das Zivilflugwesen betätigt sich hier andauernd in emsigem Maße. Der Flug ßrindejoncs, der in England dadurch eine unliebsame Unterbrechung erfuhr, daß der Flieger vor die Gerichte zitiert wurde, weil er nieht, wie angekündigt, in Dover gelandet ist, sondern ohne Autorisation seinen Flug bis London fortgesetzt hat, hat durch durch den letzten Teil der Reise von London nach Calais mit einem Passagier seinen Abschluß gefunden. Bei der Landung an der französischen Küste geriet der Morane-Eindecker in einen Graben und schlug um. Saulnier, der sich an Bord des Apparats befand, blieb unverletzt. Brindejonc selbst erlitt aber einige Verletzungen, die sich zum Glück später als unerheblich herausstellten. Auf dem FJugfelde von Buc versuchte Perreyon am letzten Mittwoch einen Angriff auf den bisherigen Passagier-Höhcnrekord. Auf einem Blrriot-Tandemzweisitzer, 80 PS Gnom, mit einem Passagier an Bord, erreichte er während seines 2'/2 stündigen Fluges eine Flughöhe von 4060 Metern, welche den französischen Passagier - Höhenrekord (bisher: Legagneux, 27. Januar 1912, 3670 m) darstellt. Die Passagier-Höhenrekords aller Nationen stehen demnach im Augenblick wie folgt: Oesterreichischer und Weltrekord: Oberlt. Blaschke, 23. Juni 1912, 4360 m; französischer Rekord: Perreyon, 21. Mai 1913, 4060 m; deutscher Rekord; Hirth, 1. Oktober 1911, 2475 m ; englischer Rekord : ßrindejonc des Moulinais, 17. Mai 1913, 2300 m; italienischer Rekord: Hauptmann Bongiovanni, 24. September 1912, 1800 m. In Saint Raphael hat am letzten Mittwoch Levasseur auf einem 100 PS Nieuport den Höhenrekord für Wasserflugzeuge aufgestellt, indem er mit einem für die französische Marine bestimmten Apparat auf 1600 m Höhe kam. Guillaux, der Held des Pommery-Pokals, der durch seinen grandiosen Flug Biarritz-Kollum so berechtigte Bewunderung erregte, ist dieser Tage fast das Opfer eines schweren Unfalls geworden. Er nahm an einem in der Nähe von Evreux veranstalteten Meeting teil und trotz strömenden Regei.s entschloß er sich, von Issy aus dorthin zu fliegen. Als er über Vaucresson dahinsegelte, wurde der Apparat durch einen heftigen Windstoß auf die Erde geschleudert. Guillaux vermochte durch seine Kaltblütigkeit und Gewandheit eine Katastrophe zu verhüten, sodaß er nur ziemlich unsanft auf die Erde aufstieß, ohne daß er Schaden erlitt; der Apparat allerdings wurde reparaturbedürftig. Inzwischen hat sich der erfolgreiche Clement-Flieger von seinem Schrecken erholt und er hat dieser Tage zu wiederholten Malen Flüge in beträchtlicher Höhe über Paris ausgeführt, die viel Beachtung und Interesse erweckt haben Ein eigenartiges Experiment wurde dieser Tage in Chartres vorgenommen : dort; wünschte der erblindete Organist der Kirche, an einem Fluge als Passagier teilzunehmen. Es ist dies wohl das erste Mal, daß ein Blinder in einem Flugzeug sich befunden hat. Im Augenblick der Landung erklärte der blinde Organist, daß er während des Fluges genau das Gefühl gehabt habe, als ob er sich in einem Boot auf dem Wasser befände. Viel beachtet wurde hier der Flug des jungen schweizerischen Fliegers Oskar Bider, welcher auf einem 80 PS Bleriot von Bern nach Sion in 2:19 die Berner Alpen überquert hat. Bider stieg in Bern auf seinem Eindecker um 4:00 morgens auf, überflog Simmenthai und die Gegend von Wildstrubel und landete um 6:19 wohlbehalten in Sion, Bider, welcher auf diesem Fluge 80 km über Eisgletscher dahingesi'gelt ist, hat stellenweise eine Höhe von 3200 m erreicht; er hatte unter der Kälte arg zu leiden. Hier bereitet sich jetzt eine neue „Sensation" vor: ein Flugmatch zwischen Garros und Audemars gegen einen Einsatz von 10,000 Francs. Die Veranstaltung soll am 1. Juni auf dem Flugfelde von Juvisy vor sich gehen und zwar wird sie bestehen aus 1. einem Geschwindigkeitsrennen über 50 km, wobei beide Flieger auf ein gegebenes Signal gleichzeitig starten sollen; 2. einem ßewerb der größten Aufstieggeschwindigkeit, füi den die beiden Eindecker mit besonderen Höhenrneß-Apparaten (Mindesthöhe 2500 m) ausgestattet sein werden; 3. einem Bewerb für Fantasie- und gemeinsame Geschicklichkeitsflüge. Man wird bedauern können, daß sich zwei so tüchtige Flieger, wie Garros und Audemars, zu einem derartigen ebenso gefährlichen wie nutzlosen akrobatischen Schauspiel hergeben, nur um das Reklamebedürfnis eines exzentrischen Konstrukteurs zu befriedigen, der sich „die Sache etwas kosten läßt", aber durch den zu erwartenden Andrang des Publikums zu dieser Zirkus-Schaustellung und durch die unausbleibliche Bombenreklame für seine Apparate schon auf seine Kosten kommen wird. Ein großer Teil der Presse wendet sich denn auch mit großer Entschiedenheit gegen diese Veranstaltung-, mit der sich wohl auch noch die Aufsichtsbehörden zu beschäftigen haben werden. Mehr Interesse verdienen die nun in Aussicht stehenden ernsten Bewerbe, wie beispielsweise der Luftzielscheibenpreis Michelin für dessen Bestreitung die Aviations-Kommission des Aero-Klub folgende Perioden: 15. bis 22. Juni, 13. bis 20. Juli und 10. bis 17. August, sowie die Flugplätze von Croix d'Hins, Crau, Chartres, Buc und Etampes festgesetzt hat. Ferner ist jetzt endgiltig beschlossen worden, daß die Ausscheidungsläufe zum Gordon Bennett-Pokal bei denen es sich um die Auswahl der französischen Teilnehmer an dein Internationalen Pokal handelt, auf dem Flugplatze von Betheny an den Tagen des 21., 28. und 29. September vor sich gehen sollen. Aber auch um den Entscheidungskampf um den Pommery-Pokal regt es sich schon. Als erster hat sich eben Vedrines einschreiben lassen, der dabei natürlich wieder seine bekannten Salbadereien zum Besten gegeben hat, die eine gefällige Presse in aller Breite wiedergibt. Selbstverständlich handelt es sich für Vedrines nur darum, zu wollen, und er hat den Pommery-Pokal weg. In seiner unnachahmlichen Bescheidenheit hat er einem Zeitungsinterviewer die Versicherung gegeben, daß er den Pokal an sich bringen wird, und alle Welt lacht. Von Interesse ist die Zusammensetzung der permanenten Kommissionen der Handelskammer der aeronautischen Industrien, die dieser Tage vorgenommen worden ist. Die Kommission der Flugzeug-Konstrukteure setzt sich zusammen aus den Herren: Bazaine, Borel, Brcguet, Deperdussin, Esnault-Pelterie, Farman, Fetterer, Goupy, Kapferer, Leblanc, Mallet, de Mengin, Moräne, Savary. Zu Ehrenmitgliedern wurden bei dieser Gelegenheit ernannt: Ader, Archdeacon, Deutsch de la Meurthe, Eiffel. Godard, Drzewiecki, Micheliu, Senator Reymond, Zaharoff. Dieser Tage hat der Präsident der Ligue Nationale Aerienne ein Schreiben an den französischen Kriegsminister zugunsten der Armierung der Flugzeuge gerichtet, in welchem auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, die modernen Militärflugzeuge zu armieren. Es wird dem Minister der Beschluß der Militärkommission der Liga mitgeteilt, der folgenden Wortlaut hat: „Wir halten es für dringend erforderlich, daß, abgesehen von der Organisation spezieller Artillerie, welche die Aufgabe hat, die selbst in beträchtlicher Höhe fliegenden Lenkballons zu zerstören, unverzüglich eine große Anzahl der Luftgeschwader wirkungsvoll armiert werde (mit Mitrailleusen oder mit Schnellfeuergewehren), daß sie eine besondere gut eingeübte Mannschaft erhalten, und daß die Flugzeuge ganz besonders darauf eingeübt werden, die deutschen Lenkballons zu verfolgen, sie zu überfliegen und zu zerstören." Gewiß ein interessantes Schriftstück, dessen Wortlaut, sofern er auf die Luftkreuzer einer anderen Nation hinweist, mit der Frankreich augenblicklich in Frieden lebt, wohl beispiellos ist . . . Von Vorgängen im ausländischen Flugwesen ist zunächst die am vergangenen Sonnabend erfolgte Eröffnung des Internationalen Automobil-Salons in Turin zu erwähnen, wo neben manchen internationalen Modellen die italienische Industrie mit den Marken Bobba, S. I. A., Asteria und Caproni vertreten ist. Letztere Marke stellt den bekannten Eindecker aus, auf dem der Flieger Slaworossoff den Fernflug Mailand—Rom ausgeführt hat. Uebrigens soll im Anschluß an die Turiner Ausstellung ein Fernflug Turin—Rom veranstaltet werden, für den sich bereits Perreyon (S. I. T.), Bathiat (Sanchez Besa) und Deroy (S. I. A.) haben einschreiben lassen. Nur solche Flugzeuge können an diesem Fluge teilnehmen, die in der Ausstellung vertreten sind. Auch das Dekret des Königs von Belgien, durch welches endgiltig ein Flugwesen in der belgischen Armee geschaffen wird, hat hier viel Beachtung gefunden, schon weil man wohl in erster Reihe auf die belgische Kundschaft rechnet. Rl. Vom italienischen Militär-Wettbewerb. Ein Interview mit Victor Stoeffler. Die italienische Heeresverwaltung hatte für die Monate April-Mai einen Wettbewerb ausgeschrieben, der für solche Fabriken offen war, die in Italien ihren Sitz haben und die Apparate mit Ausnahme des Motors selbt herstellen. Victor Stoeffler ist seit einigen Tagen aus dem rosigen Süden zurückgekehrt und hat mir gerne meine Fragen über niesen interessanten Wettbewerb, in dem er heißer Favorit ist, beantwortet. „Waren die Bedingungen ungefähr so gehalten, wie im französischen Militär-Wettbewerb in Reims," fragte ich Stoeffler. „Ja, aber bedeutend schärfer und dann war bei uns die Bewertung eine ganz andere. In Reims war derjenige der beste, der überall die besten Zeiten erzielte, ohne daß irgend eine Beeinflussung durch den verwendeten Apparat stattfand. Es wurde nämlich in Turin alles mit Punkten gewertet, deren Zahl dem Bewerber aber nie mitgeteilt wurde." „Welche Maschinen waren denn hauptsächlich vertreten?" „Meistenteils waren es nachgeahmte oder verbesserte französische Deper-dussin-, Nieuport- und Bleriot-Maschinen. Auch Bristol hatte seinen Vertreter. Von italienischen Fabrikaten sind der Caproni-Apparat und Bobba-Eindecker, sowie mein Apparat zu erwähnen. Ich besaß einen S. A. N. L.-Doppeldecker mit 80 PS wassergekühltem Aetos-Motor." „Sind Sie mit großen Chancen in den Wettbewerb gegangen ?" Stoeffler lächelt! „Mit gar keinen! Laut Reglement konnten die Maschinen von ausländischen Fliegern gesteuert werden und wen treffe ich da ? Nur bekannte französische und italienische Kanonen! Denken Sie nur Gobe, Helen, ßielovucie und Perreyon, der Inhaber des Höhenrekords, sowie Rossi, der italienische Kriegsflieger. Ich hatte Lust, gleich wieder abzureisen, denn solchen Fliegern glaubte ich nicht gewachsen zu sein." „Es kam ja auch anders", warf ich dazwischen. „Nun ja, ßielovucie war nicht vom Glück begünstigt, auf ihn paßte der Spruch veni . . . ., vielmehr er zerbrach sofort einen Caproni-Eindecker."  Vom italienisdien Militär-Wettbewerb. V. Stoeffler nach der Ankunft; die Kommissare prüfen den Barographen. „Es waren doch zuerst Ausscheidungsprüfungen wie in Reims." „Ja, wir hatten sogar drei Prüfungen: 1. die Ausscheidungsprüfungen, 2. die definitiven- und 3. die fakultativen Prüfungen." „Sind die Abnahme-Bedingungen streng gehatten worden ?" „Und ob! Bedenken Sie nur! War bei einem Apparat ein Spannschloss ungesichert, dann konnte der Bewerber wieder nach Hause ziehen. Am Morgen des 1. April standen 27 Apparate zur Abnahme und davon durften 16 an dem Wettbewerb teilnehmen." „In was bestanden die Ausscheidungsprüfungen ?" „Vom 1.—30. April sollten diese Prüfungen für die 16 Apparate dauern. Es wurde folgendes verlangt und mit Punkten gewertet: kurzer Anlauf und Auslauf. Dann galt es mit Vollast, d. h mit Betriebsstoff für 300 km und 200 kg Nutzlast, eine Höhe von 500 Metern in 15 Minuten zu erreichen. Bei der Schnellig-keitsprtifung in geschlossenem Kreis durfte die Geschwindigkeit nicht unter 80 km sein. Sehr schwierig war auch das Starten und Landen auf einem kreuz und quer gepflügten Acker. Auch auf Demontage und Montage des Apparates wurde sehr viel Wert gelegt. Den Schluß dieser Ausscheidungsprüfungen bildet ein kleiner Ueber-landflug mit einer vorher unbekannten Zwischenlandung von 30 km hin und zurück. „Und wieviel bestanden von den 16 die Prüfungen?" „Nur 4" und das waren Rossi auf Bobba-Eindecker ßobba , Deroy „ ltalia alle drei mit 80 PS Gnom und ich auf S. A. N. L.-Doppeldecker mit 80 PS Aetos-Motor. Ich. war hier den anderen gegenüber im Vorteil, da mein italienischer Motor mit mehr Punkten bewertet wurde. Nun jetzt kamen ja erst die Hauptprüfungen Zunächst galt es 1000 Meter mit Vollast hochzufliegen. Die hierbei erzielten Zeiten schwankten zwischen 17 und 25 Minuten. Bedenken Sie aber, Turin selbst liegt 250 Meter über dem Meeresspiegel. Der große Tag war der 9. Mai, an dem der Ueberlandflug Turin—Chivasso—Vercelli—Mailand und zurück über Casale—Chivasso—Turin, eine Strecke von 300 km, die mit Vollast zurückzulegen war, stattfand. Es war hierbei Bedingung, während des Fluges eine Stunde lang die Höhe von 1000 Metern einzuhalten. Sehen Sie auf diesem Bild, das nach meiner Ankunft aufgenommen wurde, kontrollieren die Kommissäre den Paragraphen. „Sind alle vier in Turin wieder angekommen ?" „Nur Rossi und ich, die anderen sind auf der Strecke niedergegangen. Deroy wegen Motordefektes und Bobba wegen Benzinmangels. Wir hatten uns auch um mindestens 20 Minuten verflogen und benötigten ca. 4 Stunden, während es Rossi in 3 Stunden 10 Minuten geschafft hatte. Nach der Landung wurde das Benzin nachgemessen, wobei ich noch für 1 Stunde Betriebsstoff hatte, was wieder eine Gutpunktwährung bedeutet." „Wie war denn die Landungsmöglichkeit auf dem großen Ueberlandflug?" „Miserabel! Ueberau Maulbeerbäume, von denen der italienische Bauer nicht genug pflanzen kann und Reisfelder, die unter Wasser stehen. Sie können sich ja vorstellen, was hier eine Landung heißt — Bruch." „Es dreht sich also nur noch um Sie und Rossi, wer den großen Preis von 100,000 Lire erhält.?" „Ja, aber anschließend an den Ueberlandflug begannen die fakultativen Prüfungen. Es waren dies, wie es das Wort auch ausdrückt, rein freiwillige Prüfungen, die lediglich eine Erhöhung der Punktzahl zur Folge hatten. Ich habe mich um die Langsamkeits-Prüfung beworben und dabei eine Reduzierung von 200/o der Eigengeschwindigkeit erzielt. Zur Erprobung der Stabilität meines Apparates durch plötzliche Ballastabgabe ließ ich aus 200 m 40 kg herabfallen, ohne daß der Apparat in Schwankungen geriet. Dieses Experiment wurde von dem Kommissaren von unten aus mit Ferngläsern beobachtet. Eine Demontage meines Motors erledigte ich in 7 Minuten, während die Montage 8 Minuten lang dauerte. Durch den Einbau einer Doppelsteuerung war mein Passagier in der Lage, die Steuerung während des Fluges zu Ubernehmen und der Besitz einer Anlaßvorrichtung waren alles günstige Faktoren für mich." „Wann erfahren Sie denn das Resultat?" „Die Resultate liegen momentan dem Kriegsministerium vor und die beiden Maschinen stefjen immer noch hinter Schloß und Riegel. Qui vivra — verra!" Fr. wm. seekau. 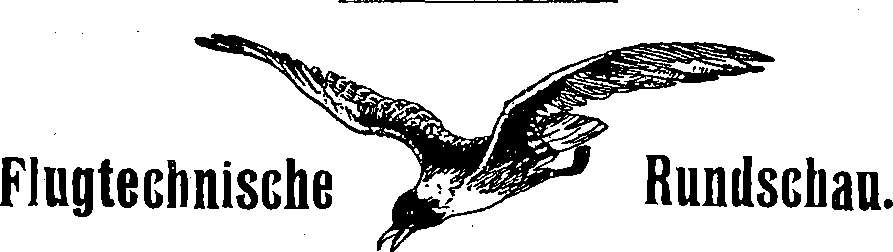 Inland. Mug/ührer-Zeugnisse haben erhalten: No. 386. Onigkeit, Otto, Magdeburg, geb. am 18. Januar 1877 zu Berlin, für Eindecker (eigene Konstruktion), Flugplatz Gr. Anger b. Magdeburg, am 24. April 1913. No. 587. Steffen, Hans, Oberleutnant i. Fiis.-Regt. Prinz Heinrich von Preußen, Quaßnitz b. Leipzig, geb. am 8. März 1885 zu Lenneß, Reg.-Bez. Düsseldorf, für Eindecker (Dtsch. Flugzeugw.) Flugplatz der Dtsch. Flugzeugwerke, Leipzig-Lindenthal, am 26. April 1913. No. 3S8. Reichelt, Hermann, Ingenieur, Niederschöneweide, geb. am 18. März 1878 zu Dresden, für Eindecker (Reichelt), Flugplatz Johannisthal, am 26. April 1913. No. 389. Roth, Leonhard, München, geb. am 2. Mai 1891 zu Augsburg für Eindecker (Harlan), Flugplatz Johannisthal, am 30. April 1913. No. 390. Faber, Wallher, Oberleutnant z. S., Johannisthal, geb. am 30 August 1888 zu St. Leonhard b. Braunschweig, für Zweidecker (L.V.G.), Flugplatz Johannisthal, am 5. Mai 1913. No. 391. Braumüller, Georg, Johannisthal, geb am 4. Dezember 1887 zu Zagelsdorf, für Eindecker (Rumpier), Flugplatz Johannisthal, am 5. Mai 1913. 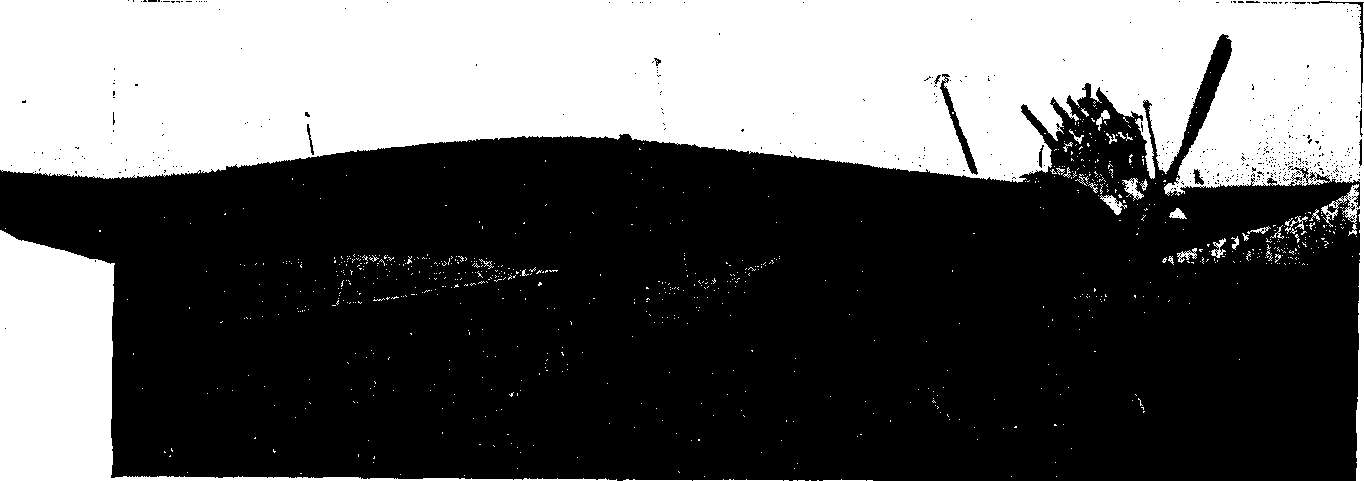 Enler-Eindecken 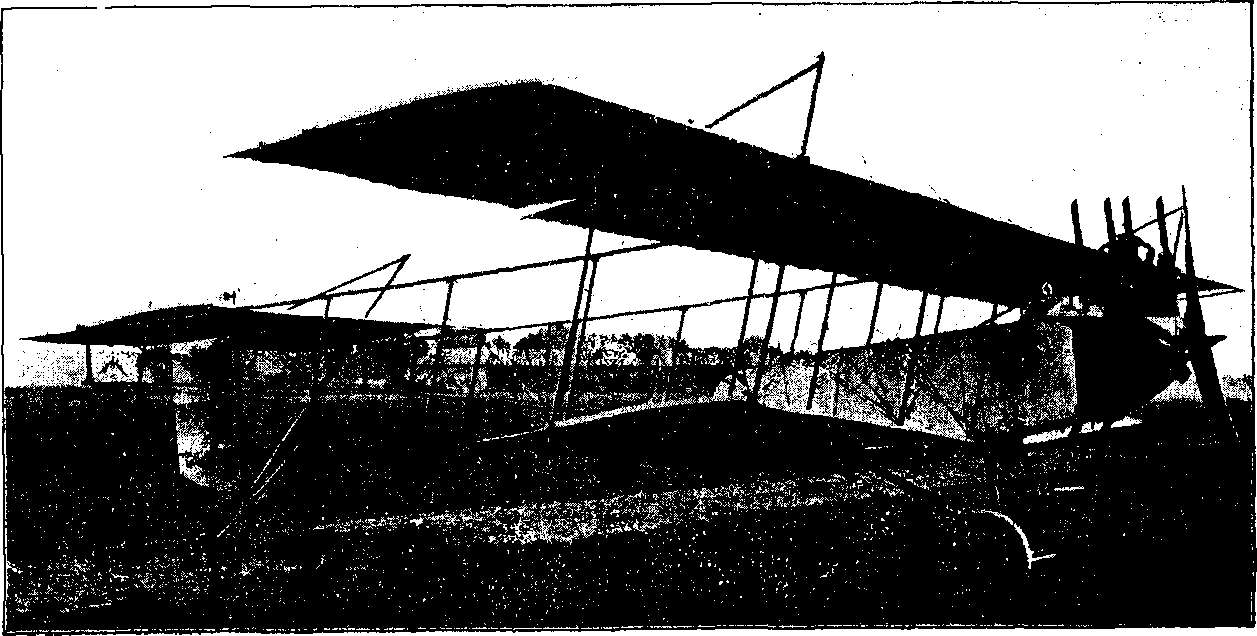 Gestaffelter Ealer-Zvieidecker. No. 392. Schiller, Hans, Leutnant z. S., Johannisthal, geb. am 1. Juli 1889 zu Straßburg i Eis., für Zweidecker (L.V.G.), Flugplatz Johannisthal am 5. Mai 1913. No. 393. Pollandt, Max, Charlottenburg, geb. am 9. Januar 1889 zu Charlottenburg, für Eindecker (jeannin-Stahltatibe), Flugplatz Johannisthal am 5. Mai 1913. No. 394. üoebel, Wilhelm, Hauptmann i. Inf.-Regt. Graf Bülow-Dennewitz, Kommandoführer der Militär-Fliegerschule Halberstadt, geb. am 3. Juli 1878 zu Glatz (Schles), für Eindecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 5. Mai 1913. No. .95. Heppe, Karl, Unteroffizier i. Inf.-Kegt. 173, St. Avold, Lothr., geb. am 20. Januar 1886 zu Dillich, für Zweidecker (Aviatik), Flugplatz Habsheini, am 5. Mai 1913. „FLUGSPORT." No. 11 No. 396. Liske, Alberl, Unteroffizier i Pion.-Batl.4, Magdeburg, (Friedrichstadt), geb. am l.März 1890 zu Plötzkau (Anhalt), für Zweidecker (Aviatik) Flugplatz Habsheim, am 5. Mai 1913. König, Martin, Mechaniker, Johannisthal, Inhaber des Zeugnisses No. 346 für Eindecker, hat die Prüfung für Zweidecker (Albatros) am 3. Mai 1913, abgelegt__ Mitteilungen des Deutschen Luftfahrer-Verbandes. 1. Verschiedene Vorkommnisse und Beschwerden geben Veranlassung darauf hinzuweisen, daß alle Flugzeugführer, die selbst Schauflüge veranstalten oder mit Stadtverwaltungen Verträge zur Abhaltung von Schauflügen eingehen, auch wenn an denselben nur sie selbst oder höchstens 2 Flieger teilnehmen, verpflichtet sind, gemäß Ziffer 9 der Flugbestimmungen, diese Flüge rechtzeitig dem Deutschen Luftfahrer-Verbände anzumelden. Nichteinhaltung dieser Bestimmung kann vorübergehende oder dauernde Entziehung der Lizenz oder des Flugfuhrerzeugnisses zur Folge haben 2. Die Vereine des Bayerischen Kartells: Akademie für Aviatik, Königlich Bayrischer Automobil-Club, Bayrischer Aero-Club und Münchener Verein haben sich mit der Süddeutschen Gruppe des Deutsche:! Luftfahrer-Verbandes vereinigt, so daß diese nunmehr die folgenden Vereine umfaßt: Augsburger V. f. L., Akademie für Aviatik, Bayrischer Aero-Club, Königlich Bayrischer Automobil-Club, Münchener V. f. L., Oberschwäbischer V. f. L., V. f. L. u. Fl. Nürnberg-Fürth, Würtembergischer Flugsport-Club, WUrtembeigischer V. f. L. 3. Für die Erledigung der Bayrischen Landesangelegenheiten haben die Bayrischen Verbandsvereine eine Bayrische Luftfahrt-Centrai e gegründet, der zurzeit die folgenden Vereine angehören: Akademie für Aviatik, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, Augsburger V. f. L, Bayrischer Aero-Club, Deutscher Touring-Club (mit beratender Stimme), Flugverein Neustadt a. H., Fränkischer V. f. L., Königl. Bayrischer Automobil-Club, Münchener V. f. L., Luftfahrtverein Touring-Club, Luftfahrt-Verein Speyer, Regens-btirger V. f. L., V. f. L. u. Fl.- Nürnberg-Fürth. Von den Flugplätzen. Vom Euler-Flugplatz. Die Baulichkeiten der im Vorjahre im großen Stile angelegten Euler-Flugzeugwerke bei Niederrad haben sich schon jetzt als zu klein erwiesen. An der Südseite der großen Flugzeughalle wird zur Zeit ein neues Gebäude, in c'em die technischen Büros und Unterkunftsräume für die Schüler untergebracht werden, errichtet. Außer den modernen Zwei- und Drei-deckertypen, die unseren Lesern bekannt sind, hat der neue Euler-Eindecker in den letzten Wochen erfolgreich debütiert. Lt. v. Mirbach hat auf diesem Eindecker sofort 5 Flüge von ca. 10 Minuten Dauer ausgeführt, Lt. v. Hiddessen blieb gleichfalls beim ersten Start V4 Stunde in der Luft. Auffallend war trotz der hohen Geschwindigkeit von ca. 130 km das gute Gle tvermögen. Vom Flugplatz Puchheim. Infolge des günstigen Wetters konnte in letzter Zeit wieder häufig geflogen werden. Am 19. d. M. flog Weyl auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argus von Oberwiesenfeld nach Puchheim und benötigte hierzu trotz Gegenwind nur 12 Minuten. Am Sonntag, 25. Mai herrschte besonders reger Flugbetrieb. Die Flieger Baierlein, Weyl, Schöner und Breton führten verschiedene, gelungene Flüge aus. Weyl flog in einer Höhe von 1100 m über Bruck, Aubing nach Pasing und landete nach einer Flugdauer von 50 Min. im prächtigem Gleitfluge wieder glatt auf dem Flugplatz. Auch Schöner stieg zu einem größeren Ueberlandflug auf und überflog dabei die Orte Olching, Bergkirchen und Emmering in ansehnlicher Höhe. Nach '/t stündiger Fahrt traf der Flieger wieder wohlbehalten in Puchheim ein. Gleitflüge von H. Richters in Berlin. Auch im Norden Deutschlands beginnt man langsam, sich für den Gleitflugsport zu interessieren. Außer den bekannten erfolgreichen Gleitflugversuchen des Frankfurter Flugtechnischen  Oleitfliigejon H.]Riditers in Berlin. Unten links der Apparat im Fluge. Vereins und der Gleitflugvereinigung Darmstadt ist in Deutschland noch wenig geleistet worden. In letzter Zeit hat H. Richters in Berlin auf dem Flugplatz Johannisthal mit einem sehr einfachen Gleitflugapparatjganz nette Resultate erzielt. Der Gleiter ist in nebenstehender Abbildung dargestellt. Wettbewerbe. Folgende Ausschreibungen sind soeben erschienen: Flug „Rund um München" 14.—15. Juni. Zugelassen zum Wettbewerb sind nur deutsche Flugzeuge und Motoren, gefühlt von Fliegern deutscher Herkunft (als Flieger auch solche Ausländer, die seit mindestens R Monaten in Deutschland ansässig sind). Der Wettbewerb besteht aus drei Rundflügen um die Stadt München, einmal am ersten, zweimal am zweiten Flugtage; an den Rundflug des ersten Tages schließt sich ein Schleifenflug von etwa 20 Kilometer Länge an. Sämtliche Flüge haben mit Fluggast und 200 Kilogramm reiner Nutzlast zu erfolgen. Entscheidend bei dem Wettbewerb ist die zur Zurücklegung der drei Flüge mit Einschluß der Notlandung benötigte Zeit. Außer einigen Ehrenpreisen betragen die zur Verfügung stehenden Geldpreise insgesamt 14000 M. Jahrhundertfeier-Flugwoche, veranstaltet vom Schlesischen Aero-Club, Breslau, vom 8.—15. Juni. An Preisen stehen zur Verfügung ca. 40000 M. Meldeberechtigt sind Flugzeugbesitzer deutscher Reichsan?ehörigkeit oder solche ' Ausländer, die ihren Fabrikationssitz in Deutschland haben und der Konvention der Flugzeug-Industriellen im Verein Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller angehören. Nennungen sind zu richten an den Schlesischen Aero-Club, Breslau. Schweidnitzerstr. 16/18. Nennungsschluß 25 Mai, Nachnennuiigsschhiß 1. Juni. Patentwesen. Patenterteilungen. 77h. 260173. Flugzeug, dessen Tragflächen um eine senkrecht zur Flug-riclitung liegende Achse geschwenkt werden können. John Washington Wilson, Boston; Vertr.: Ed Breslauer, Pat.-Anw, Leipzig. 22.12.09. W. 38218. 77h. 260 183. Fahrgestell für Flugzeuge. E. Rumpier Luftfahrzeugbau G m. b. H, Berlin-Lichtenberg. 20. 6. 11. R. 33430. 77h. 260 275. Wendeflügelrad für Luftfahrzeuge. Dr Jacob Ludwig Bonn, Meckenheimerstr. 45. 23. 6. 09 L. 28297. 77h. 260550. Propeller, dessen Flügel aus mit Stoff überspannten Rahmen bestehen, Theodor Schober, Zürich; Vertr.: Dr. B. Alexander-Katz, Pat.-Anw, Berlin SW. 48. 28. 12. 09. Sch. 40115. 77h. 360456. Flugzeugsteuerung mit zwei Steuerhebeln. Harlan-Werke G. m. b. H., Johannisthal b. Berlin. 12. 12. 11. H. 56234. 77h. 260557. Flugzeug mit selbsttätiger Stabilisierung. Max Meister, Zürich; Vertr.: Karl J. Mayer, Pat.-Anw, Barmen. 8.4.11. M. 44 230. Flugzeug mit nach unten konkaven Tragflächen, die durch aus-schiebbare Hilfsflächen vergrößert werden können.*) Der Gegenstand der Erfindung bildet ein Flugzeug mit nach unten konkaven Tragflächen, die durch ausschiebbare Hilfsflächen vergrößert werden können Von den bekannten Flugzeugen dieser Art unterscheidet sich der Er-findungsgegenstand dadurch, daß diese Hilfsflächen die Tragfläche sowohl an dem vorderen wie an dem hinteren Rande überragen, so daß beim Verschieben derselben der Neigungswinkel, den der vordere oder hintere Teil der Fläche zur Längsachse des Flugzeugs bildet, veränderbar ist. Diese Hilfsflächen bestehen aus starren oder biegsamen Flächen, die etwas gewölbt sind, und die über oder unter den Tragflächen angeordnet sein können. Auf den beistehenden Abbildungen ist der Erfindungsgegenstand veranschaulicht und zwar zeigt: Abb. 1 eine Aufsicht auf einen Eindecker mit der neuen Vorrichtung, Abb. 2 einen Schnitt längs der Linie A-B der Abb. 1. Auf den Tragflächen 8 eines beliebigen Eindeckers sind Führungen 4, 5 und 6, 7 von gekrümmter Form angebracht, in denen die Hilfsflügel 9, 10 gleiten. Diese Flügel sind paarweise mileinander verbunden und werden durch Rohre oder Seile 11 in unveränderlichem Abstand voneinander gehalten. Sie bestehen gleich wie die Tragflächen aus einem biegsamen Gerippe, das mit Aeroplanstoff bezogen ist, und werden durch über nicht dargestellte Rollen laufende Ketten oder Seile 12, die mit ihrem Ende an ihnen befestigt und über Rollen 13 geführt sind, bewegt. Die Rollen 13 sitzen fest auf Wellen 14, die durch Handräder 15 von dem Führer gedreht werden können. *) D. R. P. 255 248. Dr. Joseph Cousin in Pertuis, Frankreich. Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist nun folgende: Der Führer hat in jeder Hand ein Steuerrad 15. Je nach dem Sinne der Drehung dieser Räder treten die Flügel 9 oder 10 mehr über den Rand hervor. Wenn die Flügel 9 auf der Ruckseite über die Tragflächen hervortreten, so wird der Neigungswinkel an der hinteren Kante vergrößert, und das Flugzeug steigt, im entgegengesetzten Fall (Abb. 2) dagegen erfolgt ein Fallen. Außer diesem Steigen oder Fallen des Flugzeugs infolge der gleichzeitigen Bewegung der beiderseitigen Hilfsflügel tritt hierbei noch eine Hemmung oder Beschleunigung des Flugzeugs ein. Wird nur ein Hilfsflügel auf der einen Seite herausgeschoben, so wird das Flugzeug eine Wendung machen. Durch entgegengesetztes Verschieben auf 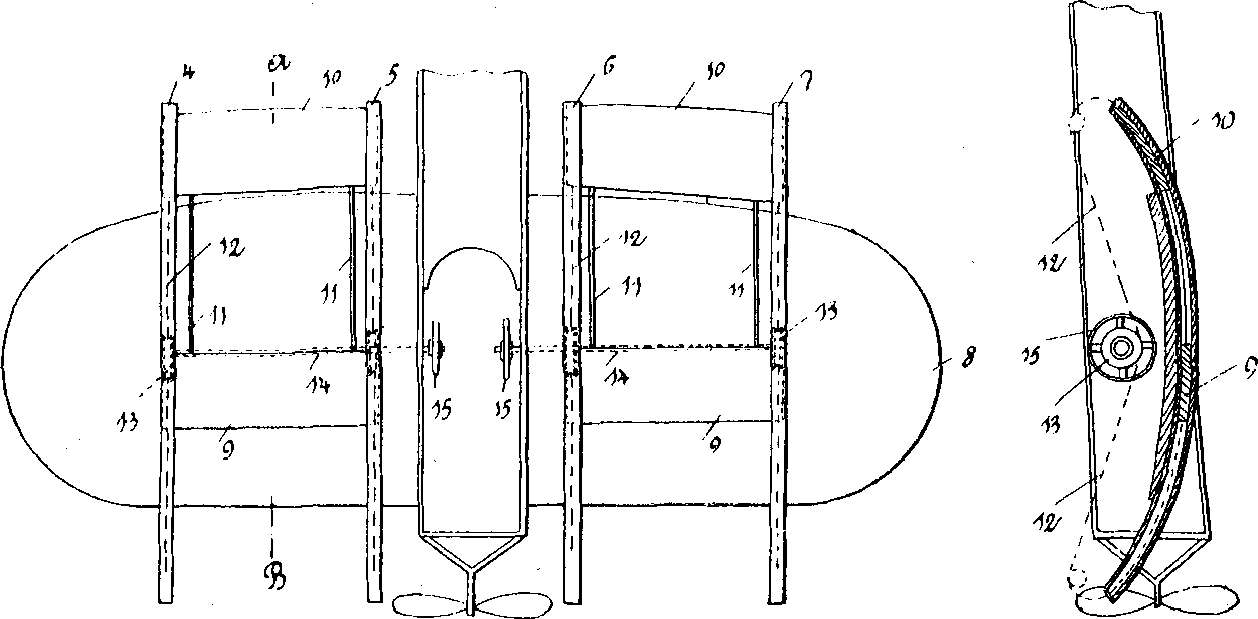 Abb. 1 Abb. 2 beiden Seiten wird eine Drehung um die Längsachse des Flugzeugs erfolgen, also die Seitenstabilität auf diese Weise wieder hergestellt werden können. Es ist hieraus ersichtlich, daß durch die verschiebbaren Hilfsflächen alle anderen Steuer ersetzt werden können. Patent-Anspruch: Flugzeug mit nach unten konkaven Tragflächen, die durch ausschiebbare Hilfsflächen vergrößert werden können, dadurch gekennzeichnet, daß die in der Flugrichtung verschiebbaren Hilfsflächen sowohl Uber die Vorderseite wie Uber die Hinterseite der Tragflächen hinausgeschoben und in beliebiger Lage eingestellt werden können, so daß der Neigungswinkel des vorderen oder hinteren Teiles der Fläche veränderbar ist. 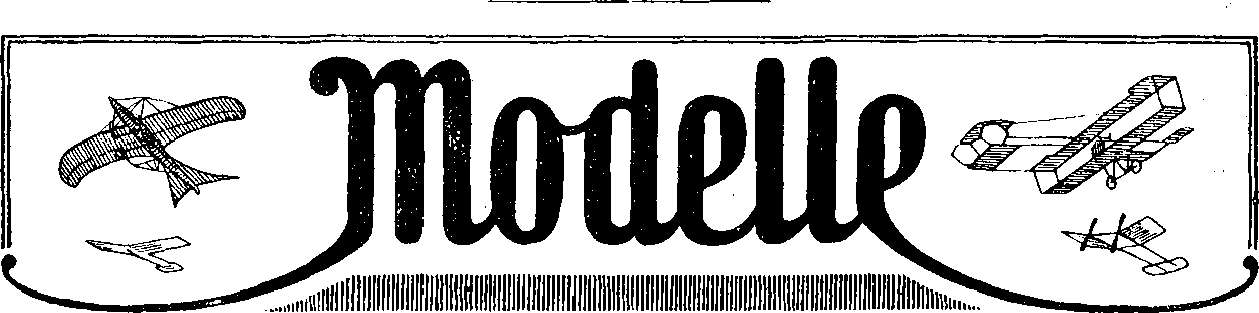 An die verehrl. Modell-FIugvereine! Um die vielen an uns gerichteten Anfragen beantworten zu können, bitten wir ergebenst, uns das Arbeitsprogramm der Vereine, sowie die etwa bis Ende 1913 geplanten Modellflugveranstaltungen und Ausstellungen bekannt zu geben. Die Redaktfon des „Flugsport". Das Wasserflugzeug-Modell Johnson wurde auf der letzten Olympia-Schau ausgestellt. Bemerkenswert und neuartig an diesem Modell ist der einfach durchgeführte Vierschraubenantrieb. Wie aus der Zeichnung (Abb. 1) hervorgeht, kreuzen sich die Gummimotoren. Die Luftschrauben haben einen Durchmesser von 225 mm; die Länge des Modells beträgt 900 mm, die Spannweite 600 mm und die Tragflächentiefe 75 mm. Das Modell ruht auf drei Korkschwimmen. Dieselben haben ähnliche Ausführungsformen wie die bekannten Curtiss-Schwimmer älteren Systems. Das Gewicht beträgt 240 g. Die 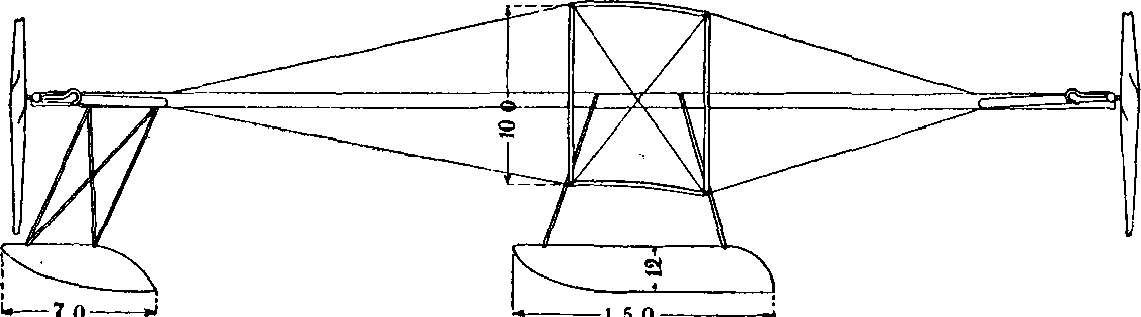 Abb. 1 dreieckigen Rahmen vorn und hinter den Tragdecks, die den Motorstab abstützen, sind als Hilfsflächen ausgebildet. Beim Anfliegen hebt die vordere Fläche, während die hintere nach abwärts drückt. Umständlich an diesem Modell ist der Start, weil immer zwei Personen das Modell bedienen müssen, wenn keine Arretiervorrichtung für das eine oder das andere Propeller-Paar angebracht wird. Einen Stoßdämpfer für Modelle zeigt Abb. 2. Derselbe besteht aus einem schleifenartig gebogenen Stahldraht a, welcher zum Festhalten des Gummimotors dient. Beim Anstoßen des Modells biegt sich die Schleife zusammen und dämpft auf diese Weise den Anprall des Modells. Ferner ist auf dem Motorstab ein Seitensteuer b aus dünnem Aluminium- Abb. 2 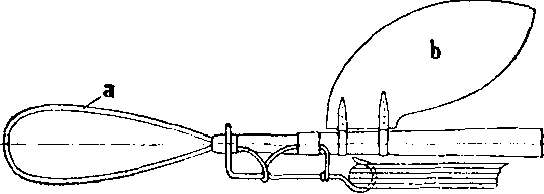 Blech aufgeklemmt, mit welchem man durch Umbiegen desselben die Flugrichtung einstellen kann. Ein anderer Stoßdämpfer für Wasserflugzeugmodelle ist aus Abb. 3 ersichtlich. Er wird von einer Stoßstange a gebildet, welche vorn ösenartig umgebogen ist, in der Mitte durch eine Führung geht und hinten auf ein Gummipolster b stößt. Dasselbe ist quer zur Stoßrichtung gespannt. Unterhalb des Abb. 3 Schwimmers befindet sich noch ein durch die Gummischnur d elastisch abgefedertes FUhlbrettchen c. Wie man auf einfache Weise Modelle zerlegbar macht. Zum Transport größerer Modelle muß man dieselben möglichst leicht zerlegbar herstellen, ohne das Gewicht zu erhöhen und die Festigkeit zu beeinflussen. Die Tragflächen steckt man am besten mit den Holmen in kleine Röhrchen a (Aluminium), welche wie Abb. 4 zeigt am Motorstab b aufgeleimt und festgebunden werden. Der runde Motorstab b kann eventl. folgendermaßen teilbar gemacht werden: nachdem der Stab b an der gewünschten Stelle durchschnitten ist, werden beide Teile etwa 2 cm lang zur Hälfte ausgeschnitten, damit sich der Stab Abb. 4 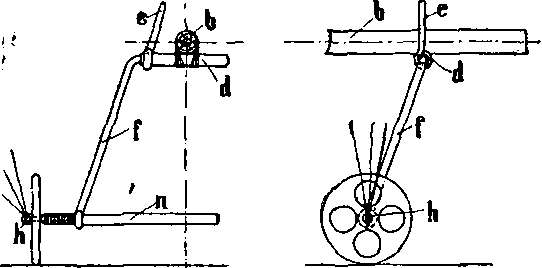 nicht dreht und in eine Röhre c, die man sich aus Papier kleben kann, zusammengesteckt. Das Fahrgestell b und der Spannturm e (Abb. 5) (bestehend aus 3 mm Aluminium) wird in, oder um eine Röhre d drehbar gelagert und kann mit einigen Spanndrähten verspannt, oder nach Lösung derselben zusammen gelegt werden. um außerdem die Spanndrähte der Flächen leicht lösen zu können, werden diese oben am Spannturm und unten in einem Häkchen befestigt, welches, ähnlich wie beim Fokker-Eindecker, am Fahr-... gesteil in eine Oese eingehakt wird. AbD- 5 Die Oese wird von dem Stift h gebildet, welcher in der Achse n (4 mm Peddigrohr) befestigt ist. Um weiter verschiedene Propeller auszuprobieren oder zerbrochene auszuwechseln, sind dieselben folgendermaßen leicht zu befestigen: Die Propellerwelle m wird, wie aus Abb. 6 ersichtlich, vorn etwas breitgeschlagen und am äußersten Ende ein Loch gebohrt, durch welches, nachdem der Propeller p aufgesteckt ist, der Stift 1 gesteckt wird. Das Loch im Propeller kann man mit einem glühenden Draht zum Schlitz erweitern. Der Haken am Ende der Welle m wird erst gebogen, nachdem man die Welle fertig in das Lager geschoben hat. Erwähnt sei noch die Propellerlagerung. Man schneidet sich ein Stück Kork wie Abb. 6 erkennen läßt zurecht, durch welches man ein Loch bohrt, wo das Röhrchen k eingeleimt wird. Dieses Lager wird vorn auf den Motorstab b aufgeleimt und mit Garn umwickelt. W. Saeger. Frankfurter Flugmodell-Verein. Am Sonntag den 25. Mai fand auf dem Eulerflugplatz ein Modell-Prämienfliegen statt und wurden hierbei folgende Resultate erzielt: 1. Züsch (Pfeil-Eind.) 80 m Flug. 2. Koch (Eindecker) 55 „ „ 3. A. Jager (Eindecker) 40 „ „ Außer Konkurrenz flog das Modell Züsch bei Windstille weit über 100 m. 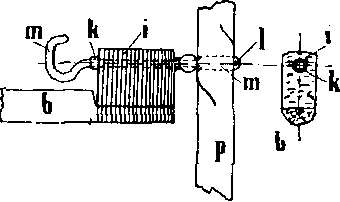 Abb. 6 Das nächste Uebungsf liegen findet Sonntag den 1. Juni vormittags 7 und 11 Uhr auf dem Gelände der ehemal. Rosenausstellung statt. . . Am 5. Juni abends Va 9 Uhr findet Versammlung im Stadtgarten statt und wird hier Herr Züsch ein Referat über Bau und Behandlung von Flugmodellen halten. Anfragen etc. sind zu richten an Herrn Fritz Wittekind, Frankfurt a. M., Eppsteinerstr. 26. Verschiedenes. Bevorzugung von Fliegern hei der Einjahrig-Freiwilligen-Prüfung. Das Sächsische Kriegsministerium hat angeordnet, daß junge Leute, die im Flugwesen hervorragende Leistungen vollbringen, bei dem einjährig-freiwilligen Dienst zu erleichterten Bedingungen zugelassen werden sollen. Das Preußische Kriegsministerium hat sich diesem anerkennenswerten Beschluß angeschlossen. Literatur.*) Die Deutschen Flugzeuge in Wort und Bild von C. Walther Vogelsang, Verlag C. J. E. Volcmann Nachf., Berlin-Charlottenburg. Pr. 1,50 M. Vorliegende Broschüre gibt eine kurzgefaßte aber vollständige Uebersicht über die deutsche Flugzeugindustrie. An Hand von zahlreichen Illustrationen kann man sich bestens Uber alle Flugzeuge orientieren und empfiehlt sich hierdurch dieses Werkchen jedermann von selbst. Die Erfindung des Flugdrachen von Hermann Hoernes. Wallishausser'scher Verlag. Wien 1913. Der Verfasser ist in der Broschüre bemüht, an Hand von Patentzeichnungen Skizzen und sonstigen mühsam gesammelten Argumenten den Beweis zu erbringen, wem die Ursprungsidee des Flugdrachens zukommt. Es ist besonders interessant in die Vorgeschichte des heutigen Flugzeugs einzudringen und man kann jedem Laien und Fachmann diese Druckschrift studienhalber bestens empfehlen. *)' Sämtliche besprochenen Bücher können durch die Expedition des „Flugsport" bezogen werden. Sehr wenig gebrauchter 5 Zyl. 40-50 PS Motor mit Magnet oirka 75 kg, weil defekt für 700 Mk. abzugeben. Ferner ein Hilz-Motor 3 Zyl. 25 PS mit Propeller und Zubehör für 500 Mk. zu verkaufen. Offerten unter J. K. 1033 an die Expedition erbeten. Zu kaufen gesucht Jahrgang 1, 2, 3 und 4 des Flugsport" 99 ferner (1041) 1 Motor ca. 1—2 PS für ein größeres Flugmodell. Off. u. Chiffre X 2074 G an Haasen-stein & Vogler, St. Gallen (Schweiz). Junger Mann sucht Firma od. Kapitalist, welche ihm Gelegenheit geben, sich zum Berufspiloten auszubilden. Zurückzahlung sicher, eventl. verpflichtet sich Suchender, später zu Gunsten des Geldgebers zu fliegen. Werte Off. u. K. U 699 an Rudolf Mosse, Bielefeld erbeten. (1040) Drei Stück 3 Zyl. Motore! mit Magnetzündung, ca 25 PS, für leichte Apparate vorzüglich I geeignet, sind spottbillig abzugeben. (983) I Bayrische Motoren-und Flugzeugwerke | G. m. b. H. Nürnberg-Gibitzenhof, Platenstrasse 56  No. 12 11. Juni 1913. Jahrg. V. Jllustrirte technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnement: für das gesamte Kreuzband M.14 __ Postbezug M. 14 „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef. 4557 ftmt I. Oskar UrslnUS, Civilingenieur. Tel.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. - Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 25. Juni. Der Bodensee-Wasserflug 1913 vom 29. Juni bis 5. Juli. Der einzige diesjährige unter dem Protektorat Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog von Baden stehende Wasserflug am Bodensee hat bei den Wasserflugmaschinon bauenden Firmen großen Anklang gefunden. Die Firmen, die sich ernsthaft mit dem Bau von "Wasserflugmaschinen befassen, wollen sich die günstige Gelegenheit eines vorbereiteten Uebungswassers mit einem kostspieligen komplizierten Rettungsdienst nicht entgehen lassen. Am Sonntag, den 8. Juni, wurde von dem geschäftsführenden Ausschuß die Strecke für den großen Flug festgelegt. Der Wasserflugplatz liegt 3 km nordöstlich von Konstanz entfernt. Der große Flug führt vom Wasserflugplatz über die Kontrollstellen Romanshorn, Arbon, voraussichtlich Bregenz nach dem Wasserungsviereck im Hafen von Lindau und von da zurück nach dem Wasserflugplatz Konstanz. An den einzelnen Kontrollstellen sowie an den wichtigsten Punkten auf dem See werden für den Rettungsdienst Motorboote stationiert, die mit Signaleinrichtungen, Raketen und Flaggen versehen werden. Ferner werden Dampfer mit Hebebrahmen ausgerüstet, die auf die Notsignale der Motorboote bczw. der Flieger selbst nach den Unfallstellen gerufen werden können. Der Rettungsdienst erfordert ungemein viel Arbeit und finanzielle Aufwendungen. Die einzelnen Firmen können sich den kostspieligen Rettungsapparat nicht leisten. Wenn bei den bisherigen Hochseekonkurrenzen sich noch verhältnismäßig wenig Unfälle ereignet baben, so ist dies lediglich dem Zufall zu verdanken. Der Unfall von Gaudart in Monaco, der nur einige 100 m vor dem Hafen versackte, war lediglich dem mangelhaften Rettungsdienst zuzuschreiben. Der am 2. Juni stattgefundene Vornennungsschluß ergab 16 Nennungen, die von 10 Firmen abgegeben waren. Diese große Anzahl der teilnehmenden Apparate berechtigt zu den besten Hoffnungen Es haben genannt: E. Rumpier, Luftfahrzeugbau, G. m. b. H., Johannisthal bei Berlin: 1 Eindecker. Gustav 0 tto Flugzeugwerke, München: 2 Doppeldecker. Flieger: Weyl, Baierlein und Lindpaintner. Automobil- und Aviatik-Akt.-Ges., Mülhausen i Eis.; 2 Doppeldecker. Flieger: Faller und Stoeffler. Flugzeugbau Friedrichshafen, G. m. b. H.: 1 Zweidecker und 1 Eindecker. Flieger: Gsell. Ago -Flugze ugwerk e, G. m. b. H., Berlin-Johannistal: 2 Doppeldecker. Union Flugzeugwerke, G. m. b H, Berlin: 1. Pfeil-Doppeldecker. Flieger: Sablatnig. Strack Flugzeugwerke, Duisburg: 1 Eindecker. Flieger: Carl Strack. Gothaer Waggonfabrik A.-G., Gotha: 1 Doppeldecker, Flieger: Büchner. Albatroswerke G. m. b. H., Berlin-Johannisthal: 1 Doppeldecker und 2 Eindecker. Flieger: Hirth und Thelen. Ungenannt: 1 fliegendes Boot. Die Südwestgruppe des Deutschen Luftfahrer-Verbandes hat mit ihrem Bodensee-Wasserflug den richtigen Weg beschütten. Das zu erstrebende Endziel sind hochseetüchtige Wassermaschinen. Um jedoch das Interesse der Konstrukteure und vor allen Dingen der Firmen am Wasserflugzeugbau nicht erlahmen zu lassen, ist es uubedingt nötig, Schritt für Schritt vorzugehen und Gelegenheit zu bieten, die Wassermaschinen in ihren ersten Anfängön zu vervollkommnen.' Angesichts der letzten Mißerfolge von Monaco ist es für jeden wirklichen Fachmann klar, daß es uns bei einer Hochseekonkurrenz in diesem Jahre nicht besser ergangen wäre und unsere vielen Maschinen, die sich noch im Entwicklungsstadium befinden, unter den gleichen Verhältnissen auf hoher See vernichtet worden wären. Hiermit wäre jedoch gleichzeitig unsere in der Entwicklung begriffene Wasserflugzeug-Industrie vernichtet worden. Es würde keinem Industriellen mehr einfallen, sich auf die hohe See zu begeben und sein Geld zu versenken, wie es tatsächlich in Frankreich sich gezeigt hat. Cormick's Flugboot für 4 Personen. Der Amerikaner Harold F. Mc. Cormick, hat sich bei Curtiss ein Flugboot für 4 Insassen bauen lassen. Diese Maschine weicht von dem bekannten Flugboot von Curtiss erheblich ab. Der Motor ist nicht mehr hinten, sondern vor den 12 m breiten Tragdecken eingebaut. Führer uud Insassen können daher beim Ueberschlagen sich sehr leicht aus den Sitzen retten. 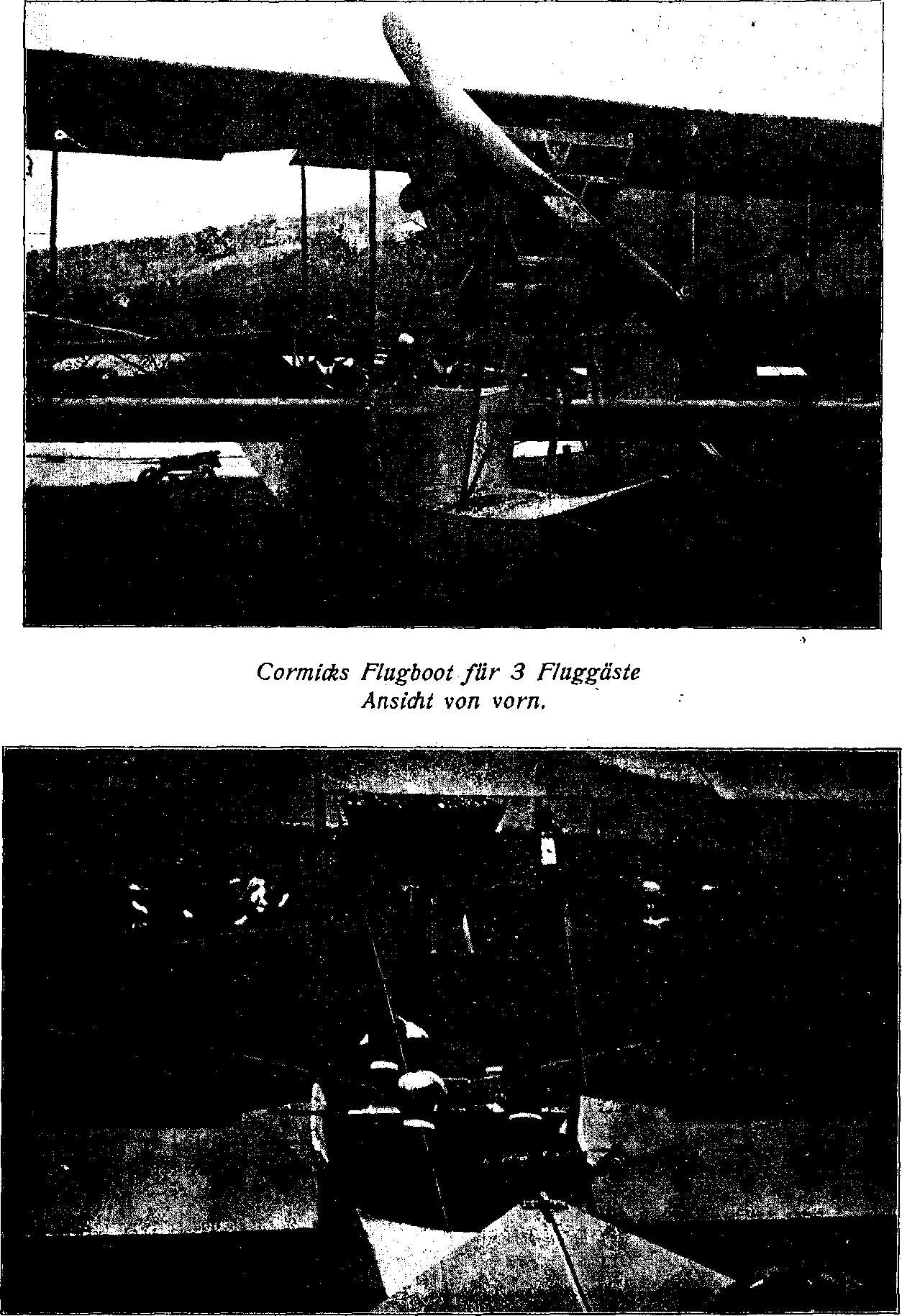 Cormidts Flugboot für 3 Fluggäste Ansidit von hinten. Wesentliche Veränderungen zeigt bei vorliegender Maschine die Ausbildung des Bootes. Der Bug des Bootes ist flach schnabel-schuhartig ausgebildet. Curtiss rechnet damit, daß bei Seegang die Wellen über den Bug hinweg gehen. Zum Schutze des Führers ist ein großer Setzbord vorgesehen, der die Bugwellen ableitet. Der Führersitz befindet sich vor den Gastsitzen. Zum Betriebe dieser Maschine dient ein in ein Gehäuse eingekapselter 90/100 PS Curbiss-Motor. Links und rechts sind die beiden 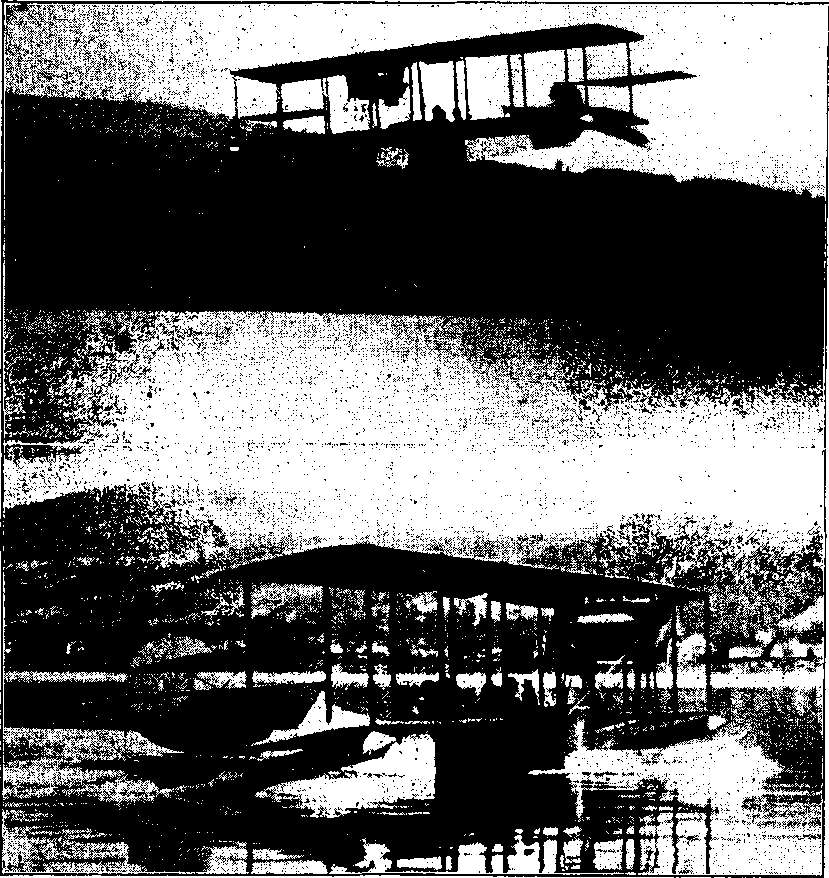 Cormicks Flugboot für 3 Fluggäste, oben: im Fluge, unten: während der fahrt. Schalldämpfer angeordnet. Der Motor ist außer mit einer Kurbel noch mit einer besonderen Anlaßvorrichtung versehen. Die Kurbel kann vom Führer- bezw. Gastsitz aus bequem betätigt werden. Das Hauptbenzingefäß von 150 1 Inhalt ist, um den Schwerpunkt tief zu legen, unter dem Führersitz angeordnet, von wo es zu dem im Motorgehäuse befindlichen kleinen Benzinbehälter von 10 1 Inhalt gepumpt wird. Der kleine Benzinbehälter ist wie üblich mit Schauglas etc. versehen. Als Steuerung ist die unseren Lesern bekannte Curtiss-Steuerung vorgesehen. (S. Flugsport No. 4, Jahrgang 1913.) Curtiss, der die Maschine bei ihrem ersten Versuche selbst steuerte, erreichte trotz des hohen Gewichtes auf dem Wasser eine Geschwindigkeit von 80 km. Die Geschwindigkeit in der Luft betrug 95 km. Nach dem ersten Probeflug unternahm Curtiss einen Flug mit einem und hiernach einen mit drei Fluggästen. Mit 3 Fluggästen erzielte er auf dem Wasser schwimmend als Motorboot 64 km Geschwindigkeit. In Amerika scheint sich der Wasserflug tatsächlich als Sport zu entwickeln. Zur Zeit sind auf dem Keuka-See 7 Maschinen, die sich alle in Privatbesitz befinden, fast täglich im Fluge zu sehen. Den deutschen Firmen kann daher nicht dringend genug der Bau von Sportmaschinen empfohlen werden. Urs. Der neue Hanriot-Eindecker. (Hierzu Tafel XV.) Der Hanriot-Eindecker erinnert bei dem ersten Anblick an den Nieuport-Eindecker, zeichnet sich aber vor diesem durch eine sorgfältigere Werkstattarbeit aus. Der Konstrukteur Pagny hat lange Zeit mit Edouard Nieuport zusammengearbeitet. In dem letzten Pariser Salon und auf der Olympiaschau konnte man an der un-bespannten Ausstellüngsmaschine alle Feinheiten der Detailkonstruktion besonders in Augenschein nehmen. Bemerkenswerte Details wurden bereits im „Flugsport" Nr. 23, 1912 auf Tafel XIII ausführlich beschrieben und konstruktiv dargestellt. Als oberster Grundsatz in der Detailkonstruktion scheint das Prinzip zur Anwendung gelangt zu sein, keine Strebe oder Kufe durch Schrauben, Bolzen, Splinte etc. zu durchbohren. Sämtliche Verbindungsdetails werden lediglich durch Festklemmen in ihrer Lage festgehalten und sind durch Spanndrähte verspannt. Das Fahrgestell ist nach dem Zweikufensystem ausgebildet. Die auf einer Achse sitzenden Räder haben einen Durchmesser von 600 mm. Sechs elliptische Stahlröhre verbinden den Rumpf mit den Kufen. Der zweisitzige Motorrumpf ist über dein Fahrgestell ein Meter hoch und verjüngt sich nach vorn und hinten. An der Spitze des Rumpfes befindet sich ein doppelt gelagerter 80 PS Gnom-Motor. Derselbe ist teilweise mit einer Blechhaube umgeben und treibt eine Luftschraube von 2,4 m Durchmesser an. Die Tragflächen verjüngen sich trapezartig von 2,5 m auf 1,6 m nach außen. Die Ecken der Trapezform sind zugerundet. Der Flächeninhalt beträgt bei einer Spannweite von 12 m insgesamt 22 qm. Die Profilierung der Rippen ähnelt der von Nieuport. Die Wölbung nimmt vom Rumpf aus nach den Flügelspitzen hin ab. Die Schwanztragfläche besteht aus einem autogen geschweißten Stahlrohrgerüst. Dieselbe ist von unten her symmetrisch durch zwei Stahlrohrstützen abgestützt. Das 0,6 qm große Seitensteuer ist ebenfalls aus Stahlrohr hergestellt, autogen verschweißt und ragt teilweise über den Rumpf hinaus. Die Steuerung ist die bekannte Morane-Steuerung, über die wir bereits im „Flugsport" Nr. 10, Jahrgang 1912 ausführlich berichtet haben. Die Geschwindigkeit der Maschine beträgt über 120 km pro Stunde. Bielovucie hat bekanntlich mit diesem Typ den Simplon überflogen.  Aus dem Johannisthaler Fliegerlager. . iif. (Berliner Korrespondenz des „Flugsport"). t.i: 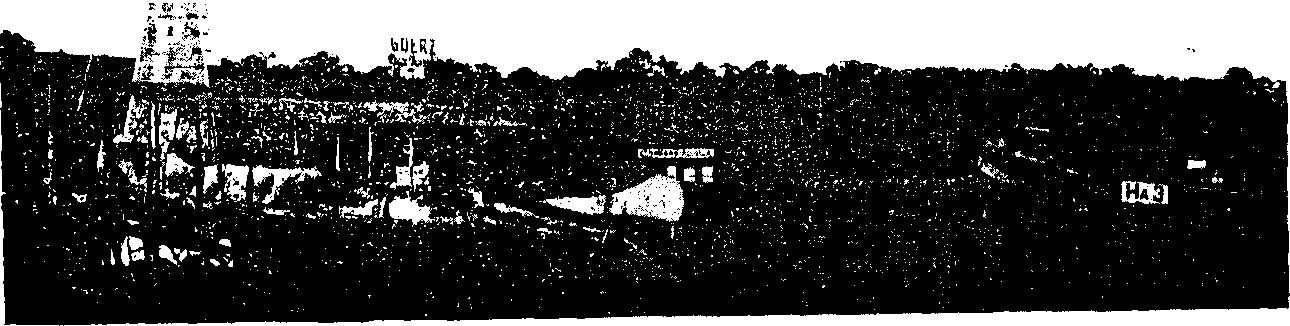 Man ist froh, die arbeitsreichen, vielleicht auch unerquicklichen Tage der Flugwoche hinter sich zu haben. Die durch den Fliegerstreik mit seinen Begleiterscheinungen hervorgerufene gereizte Stimmung bei den Fliegern legt sich nur langsam. Diese Vorgänge und andere kleine, wie die Ansprüche der Industriellen für den Ausfall von Preisen durch die nicht konventionierten Firmen haben im Fliegerlager eine gewisse Nervosität hervorgerufen. Man blickt neidisch auf die Provinz-Flugplätze, wo es verhältnismäßig ruhiger zugeht und,nicht dieser scharfe Konkurrenzkampf geführt wird wie hier in Johannisthal. Man sollte sich wirklich durch solche Vorgänge das Leben nicht zu schwer machen, sondern vor allen Dingen suchen, diese Fragen sachlich zu behandeln j und die Oeffentlichkeit dabei aus dem Spiele zu lassen. Ueber die internen Vorgänge erfährt man hier auf dem Platze verhältnismäßig wenig. Wenn man hier etwas über das Neueste erfahren will, muß man sich schon in der Provinz erkundigen. Die vor einigen Tagen in den Blättern erschienene Notiz über die Gründung einer 2V> Millionen=Gesellschaft genannt „Atlas-Werke" betrifft eine projektierte Gründung von Arthur Müller. In dem zum Versand gebrachten Prospekt figurieren Generalleutnant z. D. von Nieber und Rechtsanwalt Cohnitz. Ferner soll an der Gründung mitwirken Freiherr Rudolf v. ßrandenstein. Der Sitz der Gesellschaft soll Berlin—Johannisthal sein. Nach der bisherigen Situation glaubt man hier, daß die Gründung kaum zustande kommen wird. Auf die Ausführungen in der letzten Ausgabe des„Flugsport" daß die Rettungseinrichtungen auf dem Flugplatz Johannisthal vollständig unzureichend seien, wird mir offiziell von der Flug- und Sportplatz-Gssellschaft mitgeteilt: „Diejenigen Reichs- und Staatsbehörden, die auf Grund des Briefes des Abgeordneten Müllers sich mit der Rettungsfrage befaßten, haben uns volle Genugtuung zuteil werden lassen. Durch zahlreiches ßeweismaterial sind wir im übrigen in der Lage zu beweisen, daß stets alles dasjenige geschehen ist, was im Rettungswesen maßgebliche ärztliche Autoritäten für notwendig gefunden hatten. Ohne unsere bezügliche Bitte erhielten wir seitens des Centrai-Komitees vom Roten Kreuz von Herrn Generaloberarzt Dr. Marsch ein Schreiben nachstehenden Inhalts : „Das Ergebnis meiner heutigen Ihrerseits gewünschten Besichtigung Ihrer sanitären Maßnahmen fasse ich dahin zusammen, daß dieselben nicht nur völlig ausreichend, sondern durch ihre Zweckmäßigkeit und Uebersichtlichkeit mustergültig und im Stand sind, jeden Augenblick schnell, sicher und in schönster Weise bei Unglücksfällen und plötzlichen Erkrankungen Fliegern und Zuschauern die erste ärztliche Hilfe zu gewähren." So weit die Zuschrift von der Platzleitung. — 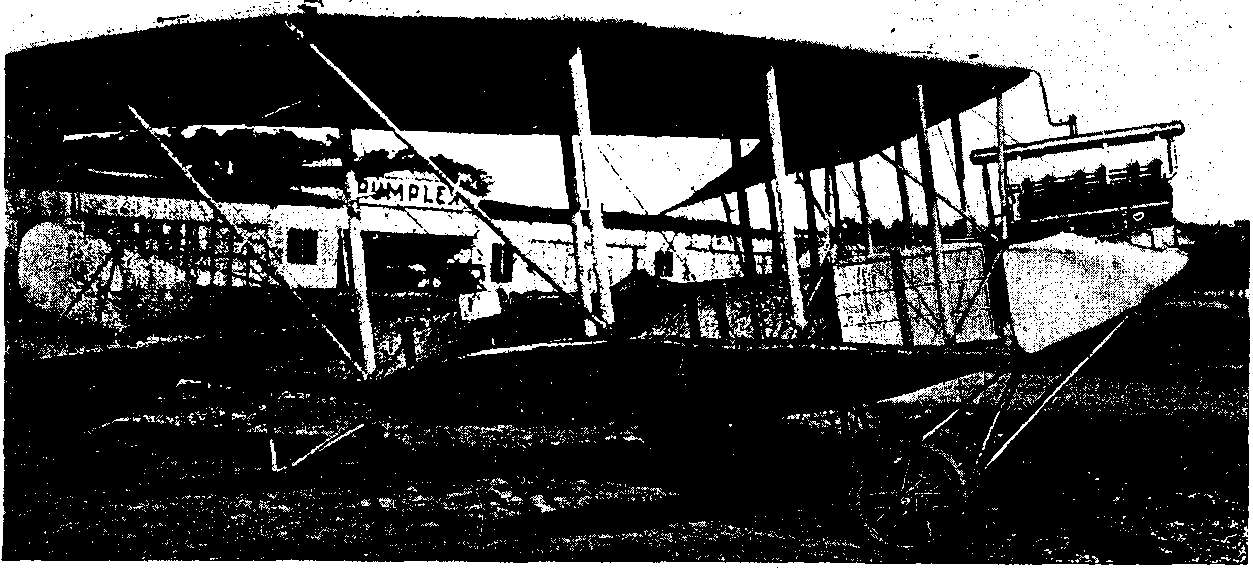 Luftjahrzeug Pfeil-Doppeldecker (Motor 6 Cyl. Daimler 95 PS) Die hier ansässigen Firmen sind nach wie vor stark beschäftigt. Einige Firmen sehen davon ab, um die Spesen zu vermeiden, sich an den Wettbewerben zu beteiligen. Ihre Ersparnisse, die sie hierbei machen, sind größer, wie die eventl. zu erzielenden Gewinne, insbesondere wenn die Ueberlandflugveranstaltungen nicht genügend dotiert sind und die Beträge sich auf eine große Anzahl von Bewerbern verteilen. Der Bau der Werkstätten von Rumpier geht seiner Vollendung entgegen. In der letzten Berichtszeit erfüllten mehrere Herren die Feldpilotenprüfung. Hiervon sind zu nennen Lt. Graf Rambaldi auf Harlan-Eindecker, sowie der Flieger Georg Luther auf Jeannin-Stahltaube. Am 4. Juni wurde von Sablatnig ein Union-Pfeil-Doppeldecker zwecks Ablieferung an die Herresverwaltung auf dem Luftwege nach Döberitz überführt. Am 7. Juni stieg Lt. Oarganico auf einem L. V. G.-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor zu einem Fernflug nach Breslau auf. Leider mußte er 60 km vor Breslau infolge verölter Kerze eine Zwischenlandung vornehmen. Die Frühjahrsflugwoche Johannisthal. (Fortsetzung von Seite 393, Nr. 11.) Der Verlauf der diesjährigen Flugwoche war außerordentlich reich an Zwischenfällen mannigfaltigster Art. Am 2. Flugtag, den 26. Mai, fegte ein Gewittersturm über den Flugplatz, der den Staub vor den Fliegerschuppen und von den Anlaufbahnen in die Luft wirbelte und den Fliegern gefährlich wurde. Die wohl nie zu beseitigende Staubplage war tatsächlich die Ursache mehrerer Unfälle. Der Harlan-Flieger Roth wollte nach einem Passagierflug landen, verschätzte sich jedoch infolge der in Staub gehüllten Landungsstelle in der Höhe und zerbrach seinen Eindecker total. Beide Insassen kamen mit geringen Abschürfungen davon. Wecsler erging es ähnlich. Der 27. Mai brachte leider einen schweren Unfall. Der bekannte Flieger Gustav Adolf Michaelis stürzte auf einer Etrich-Taube ab und wurde schwer verletzt. Michaelis trainierte für das am Nachmittag des gleichen Tages stattfindende Flugrennen und flog vom Startplatz nach dem Zielpunkt, wo er.in scharfer Kurve, um keine Zeit zu verlieren, die Wendemarke rundete. Auch auf dem Flugplatz machte er in 150 m Höhe die gleiche scharfe Kurve, wobei sein Eindecker sehr schräg lag und seitlich abrutschte. Michaelis, der nicht festgeschnallt war, stürzte kurz über Terrain aus der Maschine, die vollständig zertrümmert wurde. Nachmittags fanden die Flugrennen statt. Für die Rennen mit leichten Eindeckern starteten Hanuschke auf Hanuschke-Eindecker mit 50 PS Gnom-Motor, Schwandt auf Grade-Eindecker mit 45 PS Grade-Motor und Felix Laitsch auf L. V. G.-Errjdecker mit 60 PS Schwade-Siahlherz-Rotationsmotor. Die Wendemarken befanden sich in 10 km Entfernung von dem Flugplatz und es brauchten: Laitsch 12 : 56,8 Min., Schwandt 16 : 33,6 Min. und Hanuschke 17 : 31,4 Min. Der zweite Preis wurde Hanuschke zuerkannt, da Schwandt die für den Wettflug vorgeschriebene Mindesthöhe von 200 m nicht erreicht hatte. Von neuen Maschinen wurde der Dr. Geest-Eindecker viel beachtet. Der Generalinspekteur des Militär-Luft- und Kraftfahrwesens General v. Hänisch besichtigte diesen Apparat sehr eingehend und ließ sich denselben erklären. Der 28. Mai brachte eine angenehmere Abwechslung und zwar einen ausgezeichneten Höhenflug, der von dem Rumpler-Flieger Linnekogel ausgeführt wurde. Linnekogel erreichte mit kriegsmäßiger Belastung und Fluggast mit einer Rumpier 95 PS Mercedes-Taube 2750 m Höhe in 42 Minuten. Auch beachtenswerte Dauerflüge wurden ausgeführt. So flogen Linnekogel und Wieting 2 Std. 13 Min., Stiplo-scheck auf Jeannin-Stahltaube blieb 2 Std. 12 Min in der Luft, Stoeffler auf Aviatik 1 St. 24 Min. Sportlieh interessant war der "Wettbewerb für den kürzesten Anlauf. Von 6 Bewerbern erzielte v. Gorrissen mit seinem neuen 100 PS Ago-Argns-Doppeldecker den kürzesten Anlauf von 76,9 m. Am 29. Mai wurde das zweite Flugrennen mit gleichzeitigem Start für Maschinen mit Motoren über 80 PS ausgetragen. An dem Start erschienen endgiltig Laitsch (L. V. G.-100 PS Gnom-Eindecker), Stiploscheck (Jeannin-Stahltaube 100 PS 6 Zyl. Argus) und Schlegel (Aviatik 100 PS 4 Zyl. Argus). Start und Landung erfolgten ohne Zwischenfall. Es wurden folgende Zeiten erzielt: Laitsch 11 : 28 Min. Stiploscheck 12 ; 37,4 Min. und Schlegel, der eine zu große Höhe erreicht hatte, 13 ; 40,6 Min. Gegen Laitsch wurde Protest wegen unvorschriftsmäßiger Meldung des Motors eingereicht. Dem Protest wurde stattgegeben und Laitsch wurde disqualifiziert. Den ersten Preis erhielt demnach Stiploscheck und den zweiten Schlegel. Die Flugwoche endete mit einem Fliegerstreik. Der am 27. Mai abgestürzte, in Fliegerkreisen sehr beliebte Flieger Michaelis war im Krankenhaus in Oberschöneweide seinen Verletzungen erlegen. Infolge eines Beschlusses des Bundes der deutschen Flugzeugführer dessen Mitglied Michaelis war, wonach am Orte seines Absturzes nicht 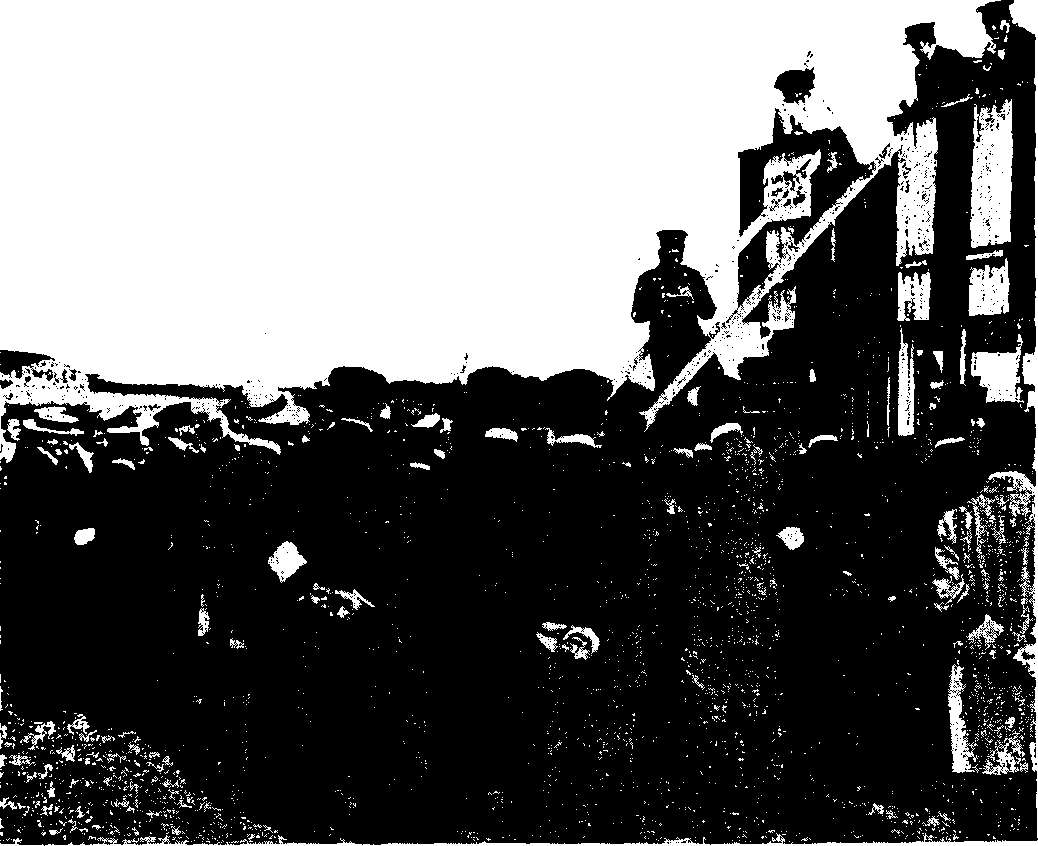 Flugwodie Johannisthal. "JJ" '< Der Leiter Major von Schönermark unterhandelt mit den streikenden Flugzeugführern. geflogen werden soll, stellten die Flieger ihre Tätigkeit ein. Obschon bisher dieser Beschluß ohne Einschränkung durchgeführt war, machte man infolge der noch nicht beendeten Flugwoche eine Ausnahme, indem die Flieger außer Wettbewerb starten durften und zwar sollte kein Flieger mehr wie 20 Minuten in der Luft bleiben. Diesen Beschluß respektierten alle Flieger außer Hanuschke. Die sportliche Leitung gab ihm daher auch die, Starterlaubnis. Hanuschke war der einzige Flieger, der fliegen konnte. Erst gegen 7 Uhr erklärte die Sportleitung, daß numnehr außer Konkurrenz geflogen werden könne. Hiernach stiegen mehrere Maschinen auf, so daß das Publikum wenigstens einigermaßen etwas zu sehen bekam. Für die Fiugwoehe standen 56000 Mark zur Verfügung. Das Endergebnis ist folgendes: Wettbewerb I. Kürzester Anlauf (7000 Mark). a) Eindecker: Schlegel (Aviatik) 1. 126,10 Meter, 2 127,8 Meter (126,95 Meter) 1237,50 Mark. Laitsch (L. V. G.) nicht meßbar. Stiploscheck (Jeannin) nicht meßbar. 2. und 3. Preis gelangen nicht zur Verteilung, b) Doppeldecker: v. Gorrissen (Ago) 76,96 Meter, 1237,50 Mark, Zahn (Ago) 103,10 Meter, 742,50 Mark, Kießling (Ago) 119,95 Meter, 495,00 Mark, Janisch (Otto) 1. 119,72 Meter, 2. nicht meßbar, Gasser (Baumann-Freytag) 1. nicht meßbar, 2. nicht meßbar. Preis des K. A. C.: v. Gorrissen 1980,00 Mark. Gesamtsumme 5692,50 Mark. Wettbewerb II. Kürzester Auslaut (5000 Mark). a) Eindecker: Laitsch (L. V. G.) 49,85 Meter, 1237,50 Mark, Stiploscheck (Jeannin) 62,58Meter, 742,50 Mark, Linnekogel (Rumpler-E.) 85,40 Meter, 495,00 Mark. Wieting (Rumpler-Taube) 106,22 Meter, Schlegel (Aviatik - Eindecker) 131,40 Meter, b) Doppeldecker: Janisch (Otto) 70,10 Meter 1237,50 Mark, Viktor Stoeffler (Aviatik) 73,25 Meter, 742,50 Mark, Zahn (Ago) 1. 139,9 Meter, 2. 102,5 Meter (121,2 Meter) 495,00 Mark. Gesamtsumme: 4950,00 Mark. Wettbewerb IIIA. Dauer ohne Fluggast (1 Minute: 1,2001119 Mark). Friedrich (A. F. G.) 7 Minuten 8,42 Mark, Schiedeck (A. F. G/ '293 Minuten, 351,63 Mark, V. Stoeffler (Aviatik) 5 Minuten, 6 Mark? Schlegel (Aviatik) 51 Minuten, 61,20 Mark, Frl. Galanschikoff (Fokkerj 11 Minuten 13,21 Mark, Hanuschke (H.) 296 Minuten, 355,23 Mark' Roth (Harlan) 14 Minuten, 16,80 Mark, Schwände (Grade) 174 Minuten' 208,82 Mark, Müller (Grade) 83 Minuten, 99,61 Mark. Gesamtsumme 'ϖ 1120,91 Mark. Wettbewerb IIIB 1. Dauer mit Fluggast (1 Minute: 2,4002238 Mark). v. Gorrissen (Ago) 20 Minuten, 48 Mark, Kießling (Ago) 155 Minuten, 372 03 Mark, Zahn (Ago) 93 Minuten, 223,23 Mark, Friedrich (A. F. G.) 7 Minuten, 16,80 Mark, Schauenburg (D. F. W.) 65 Minuten, 156,01 Mark, Viktor Stoeffler (Aviatik) 378 Minuten, 907,29 Mark, Schlegel (Aviatik) 274 Minuten, 657 67 Mark, Kammerer (Wright) 188 Minuten, 451,24 Mark Sedlmayr (Wright) 17 Minuten, 40,81 Mark, Stüber (Wright) 56 Minuten, 134,41 Mark, Boutard (Wright) 28 Minuten, 67,21 Mark, d' Ballod (M.B.) 191 Minuten, 458,44 Mark, Roth (Harlan) 38 Minuten, 93,60 Mark, Wecsler (Harlan) 6 Minuten, 14,40 Mark, Stiploscheck (Jeannin) 652 Minuten, 1564,94 Mark, Stiefvater (Jeannin) 348 Minuten, 835,28 Mark, Freindt (Jeannin) 228 Minuten, 547,25 Mark, Langer (Pfeil) 484 Minuten 1161,71 Mark, Janisch (Otto) 193 Minuten, 463,24 Mark, Linnekogel (Rumpier) 661 Minuten, 1586,54 Mark, Wieting (Rumpier) 667 Minuten, 1600,95 Mark, Michaelis (Etrich) 145 Minuten, 348,04 Mark. Gesamtsumme : 11 749,09 Mark. Wettbewerb III B 2. Mit Fluggast und vorgeschriebener Höhe. (1 Minute: 5,7827103). Viktor Stoeffler (A.viatik) 329 Minuten, 1902,51 Mark, Schlegel (Aviatik) 100 Minuten, 578,27 Mark, Stiploscheck (Jeannin) 548 Minuten, 3168,93 Mark, Langer (Pfeil) 350 Minuten, 2023,95 Mark, Linne-kogel (Rumpier) 559 Minuten, 3232,54 Mark, Wieting (Rumpier) 537 Minuten, 3105,31 Mark, Michaelis (Etrich) 145 Minuten, 838,49 Mark. 14850,00 Mark, Zusammen: 27 720 Mark. Wettbewerb III C (1000 Mark) gelangt nicht zur Auszahlung, da die einzige teilnehmende Dame, Frl. Galanschikoff, im ganzen nur 11 Minuten geflogen ist. Wettbewerb IV. Rennen (15000 Mark). a) Eindecker unter 80 PS. Laitsch (L. V. G.) 12 Min. 56,8 Sek. 3300 Mark, Hanuschke (H.) 17 Min. 31,4 Sek. 1650 Mark, Schwandt (Grade) erreichte nicht die vorgeschriebene Höhe von 200 Meter, b) Eindecker über 80 PS. Stiploscheck (Jeannin) 12 Min. 37,4 Sek. 3300 Mark, Schlegel (Aviatik) 13 Min. 40,6 Sek. 1650 Mark, c) D o p p e 1-decker über 80 PS. Janisch (Otto) 14 Min. 56,8 Sek. 3300 Mark, Kießling (Ago) 17Min. 3,8 Sek'1650 Mark, Zahn (Ago) 20 Min. 18,8 Sek. Gesamtsumme 14850 Mark. Trostpreis für Stagge 500 Mark. 1 pCt. der ausgeschriebenen Preise an die Luftfahrerstiftung 560 Mark. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Die unbeständige Witterung der letzten Tage hat die französischen Flieger vielfach an der praktischen Arbeit verhindert oder wenigstens ihre Leistungen beeinträchtigt. Sogar das in unserem vorigen Berichte erwähnte akrobatische Fliegermatch Garros-Audemars, das am vergangenen Sonntag in Juvisy vor sich gehen sollte, mußte vertagt werden und soll nun bestimmt an diesem Sonntag stattfinden. Inzwischen mehren sich die Stimmen derer, welche, wie es an dieser Stelle bereits zum Ausdruck gebracht worden ist, jene Veranstaltung der jeder praktische Nutzen (außer der baren Einnahme für den Konstrukteur-Impresario) fehlt, desavouieren, und sogar die Societe Fran-caise de Navigation Aerienne hat in ihrer Generalversammlung dieser Tage einen von ihrem Vorsitzenden, Berthelot, gestellten Antrag einstimmig angenommen, der alle „rein akrobatischen Matche, aus denen ein Nutzen für das Flugwesen nicht erwachsen kann, aufs strengste verwirft und dem Wunsche Ausdruck gibt, daß derartige Veranstaltungen in Zukunft nicht mehr gestattet werden mögen." Vorläufig ist die Genehmigung zu dem Match Garros-Audemars seitens des Präfekten von Seine-et-Oise erfolgt, nur mit der Einschränkung, daß die beiden Flieger in keinem Augenblick über den Köpfen der Zuschauer fliegen dürfen, sodaß also das 50 km-Rennen, sowie die Höhen-und „Phantasie"-Flüge nur über der offenen Bahn vor sich gehen dürfen. Interessant ist übrigens, daß man sich auch im Schöße der aeronautischen Sport-Kommission, also der höchsten Sportinstanz, über jenes „Fliegermatch auf Leben und Tod" aufs höchste erregt, ohne daß indessen diese Instanz von ihrem Einspruchsrecht bisher Gebrauch gemacht hat. So wird also wohl das beängstigende Zirkusstück vor sich gehen, hoffentlich ohne daß die Juvisy-Bahn ihren Namen als „FLUGSPORT." No. 12 Unglücksbahn aufs neue in Erinnerung bringt. Vielleicht wird es auch garnicht ganz so schlimm sein; vielleicht dienen die pomphaften Ankündigungen nur dazu, um das Publikum, das so gern das Gruseln empfindet, in Scharen nach Juvisy und ihnen die Silberstücke in Bergen aus der Tasche zu ziehen, und die beiden Flieger werden sich mit harmlosen Evolutionen begnügen, wie sie auf den Flugplätzen häufig genug zu sehen sind. Hier zittert noch die Aufregung nach über das große Fliegerunglück, das sich am letzten Mittwoch auf der Flugbahn von Buc ereignet hat, wo der unter dem Namen „Bernard" bekannte Fluglehrer Bernard Lagarot, einer der gewandtesten Flieger Frankreichs, mit einer jungen Flugschülerin. Mademoiselle Amicet, ums Leben gekommen ist. Auch der unvermeidliche Vedrines wäre dieser Tage in Algier, wohin er sich mit einem Moräne-Eindecker, 100 PS Gnom-Motor, begeben hatte, um Schauflüge zu veranstalten, beinahe das Opfer eines schweren Unfalls geworden. Er flog von Oran ab, um sich nach dem Manöverfelde von Mostaganem zu begeben, als er 4 km vor dem Ziel durch Motorendefekt zum Landen gezwungen wurde. Dabei geriet das Flugzeug in die Telegraphendrähte und stürzte ab. Vedrines ist ziemlich heil davon gekommen, der Apparat ist zerstört. Besser erging es Daucourt, welcher am letzten Montag einen gelungenen Zeitungsbeförderungsflug von Paris nach Marseille, 750 km ausführte, wobei er gegen den Schnellzug Paris -Marseille einen Vorsprung von drei Stunden hatte. Er machte in Dijon, Lyon Zwischenlandungen und verteilte auch dort die Zeitungen Zu dem Fluge benutzte er einen Borel, 50 PS Gnom-Motor. Auch Maurice Farman, welcher neuerdings Geschmack an Weitflügen zu haben scheint, flog neulich 4 800 km innerhalb 24 Stunden. Sein Flug führte ihn über Rambouillet, Cartres, Beaugency nach Chambord, und von dort zurück über Pont-Levoy, Montrichard, Orleans, Etampes und Rambouillet. Noch beachtenswerter ist die Flugleistung des bekannten Fliegers Perreyon, welcher erst kürzlich durch seinen Passagierflug Turin-Rom-Turin von sich reden machte, wobei er um 4:56 Uhr vom Flugplatze von Mirafiori abflog, um 7:57 Uhr in Pisa landete, um 9:45 von dort weiterging, um 11:26 in Rom eintraf, um dann denselben Weg zurück vorzunehmen, wo er kurz vor 9 Uhr eintraf. Sein Mechaniker begleitete ihn auf diesem Fluge, bei dem er eine Distanz von rund 1000 km hinter sich brachte Am Dienstag, den 3 Juni, hat nun Perreyon auf seinem Bleriot-Zweisitzer, mit einer jungen Dame an Bord, mit einem 160 PS Gnom-Motor einen neuen Welt-Höhenrekord mit einer Person, und zwar mit 5100 Metern. aufgestellt. Perreyon flog um 11:1 Uhr ab; sein Reservoir enthielt Betrebsstoff für zwei Stunden Flug. Der Aufstieg vollzog sich mit großer Geschwindigkeit, in nur 55 Minuten war die Höhe von 5100 Metern erreicht, und 12^Minuten später, um 12:8 Uhr landete der Flieger nach einem Schwebefluge in langer Spirale. Von 4000 Metern äb mußte seine Begleiterin Sauerstoff-Einatmungen vornehmen. Mit dieser Leistung ist also der bisherige Passagier-Welthöhenrekord des Oberleutnants Blaschke mit 4360 Metern (23. Juni 1912) gedrückt. Originellerweise kann man konstatieren, daß bei den Angriffen auf diesen Rekord fast stets eine Dame an Bord als Passa-giererin anwesend war. Legagneux, der früher den französischen Rekord inne hatte, war von Miß Davies, Oberleutnant Blaschke von seiner Braut, und Perreyon von der vorerwähnten jungen Dame, übrigens einer Dame aus der ersten Pariser Gesellschaft, begleitet. Interessant verspricht der Endkampf um den Pommery-Pokal zu werden, mit dessen diesmaliger letzter Halbjahresprämie gleichzeitig die endgilttige Zuteilung der Trophäe erfolgen wird. Uebrigens ist jetzt seitens des geographischen Dienstes der Armee die genaue Flugdistanz festgestellt worden, welche im vergangenen Halbjahre der Sieger des Pommery-Pokals, G-uillaux, bei seinem Fluge von ßiarritz 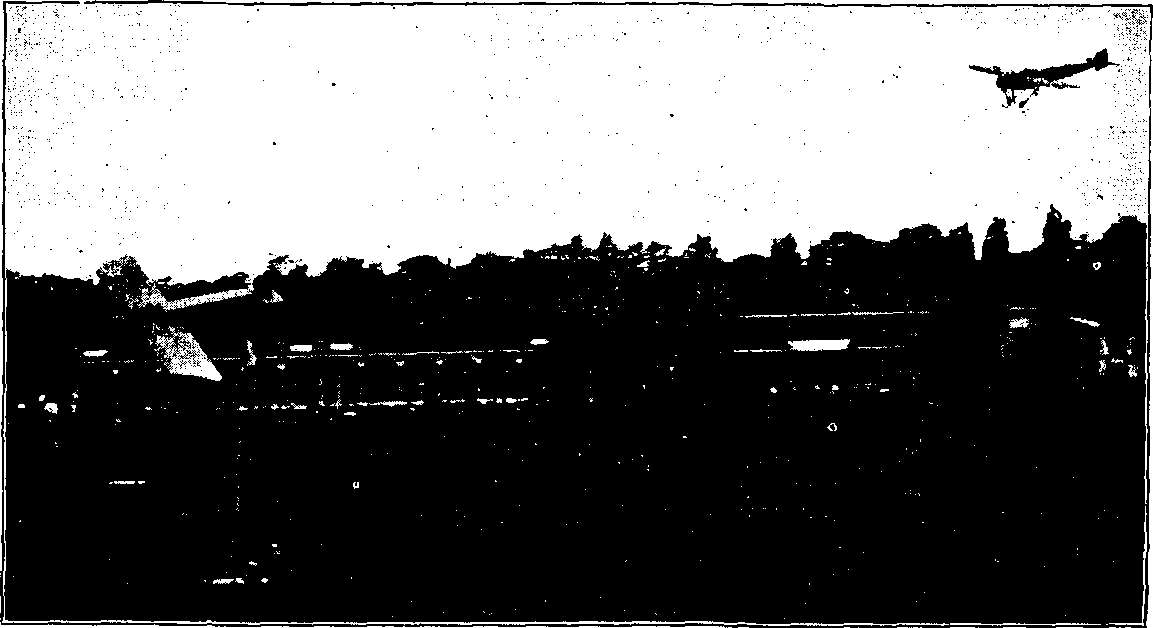 Matdi zwischen Qarros und Audemars auf Morane-Saulnier-Eindeckern. nach Kollum zurückgelegt hat: es sind das 1229,600 km. Die drei längsten Flüge an einem einzigen Tage sind demnach gegenwärtig Guillaux, ßiarritz - Kollum, 1229,600 km Perreyon, Turin—Rom—Turin, 1200 km Gilbert, Paris—Medina, 1020 km Für das begonnene Semester, also für den Schlußkampf, stehen noch großartigere Leistungen bevor. Guillaux, Brindejonc des Moulinais, Daucourt und Vedrines wollen von Paris nach Warschau event. nach Petersburg also eine Distanz von 2400 km fliegen, die wohl schwerlich, selbst an den längsten Junitagen, an einem Tage zu bewältigen sein wird. Dagegen scheint der Flug von Paris nach Warschau, eine Entfernung von 1400 km, eher realisierbar. Uebrigens wollen die'vier genannten Flieger Deutschland überqueren, ohne dort eine Landung vorzunehmen. Die Distanz von Nancy nach Warschau beträgt 930 km; wie bekannt, ist die bisher zurückgelegte weiteste Entfernung ohne Zwischenlandung 840 km (Gilbert). Der Aero-Club von Rußland hat sich an die russische Regierung mit dem Ersuchen gewendet, die Grenzaufseher anzuweisen, daß sie auf die ankommenden französischen Flieger nicht schießen sollen. Die Kontrollkommission der Ligue Nationale Aerienne hat soeben die Entscheidung getroffen, daß die Bewerber um den Pommery-Pokal während des Bewerbes die Apparate wechseln dürfen, unter der Bedingung, daß beim jedesmaligen Auswechseln ein Kommissar zugegen ist Mancherlei Interessantes ist auch vom französischen Militärflugwesen zu melden, das wiederum einige beachtenswerte Leistungen hinter sich hat, die freilich auch durch ernste Unfälle getrübt worden sind. Die Luftgeschwader haben ihre stille Arbeit fortgesetzt. Das Geschwader No. 5 (Epinal) war seit einigen Wochen auf dem Artillerie-Schießplatze von Soulon mit der Zielkontrolle beschäftigt, worauf es diese seine Mission durch einen langen Rekognoszierungsflug an der Ostgrenze abschloß, von dem es ohne Zwischenfall in seine Garnison zurückgekehrt ist. Das Geschwader bestand aus 7 Maurice Farnian-Flugzeugen, mit 70 PS Renault-Motoren, und wurde vom Hauptmann de Saint Quentin befehligt. Es hat auf seinem langen Fluge verschiedene Städte besucht, wo es überall mit großem Jubel empfangen wurde. Der bekannte Militärflieger, Leutnant Brocard, hat dieser Tage einen sensationellen Erkundungsflug ausgeführt. Er flog auf einem Deperdussin, mit einem Soldaten an Bord, von Reims ab und legte die Strecke Reims—Troyes—Dijon—Qrenoble— Chambery—Annecy -Lyon— Macon— Dijon—Reims, eine Distanz von 1340 km, zurück, ohne daß während dieses Fluges der geringste Zwischenfall eingetreten wäre. Das Luftgeschwader von Toul unternahm gleichfalls lange Rekognoszierungsflüge zwischen Toul, Frouart, Nancy, Pont-Saint-Vincent, Commercy, und zurück nach Toul. Während dieses Fluges führte Hauptmann Schneegans und Unteroffizier Guitou eine Höhenprobe aus, bei der ersterer auf 2350, letzterer auf 2180 m gelangten. In Bourges unternahm der zum Flugzentrum von Avord gehörige Artillerieleutnant Kreder Experimente mit Wurfbomben, die er aus verschiedenen Höhen herabschleuderte, während eine Kommission die jeweilige Wirksamkeit der Würfe zu kontrollieren hatte. Kreder war so etwa eine Stunde in der Luft, als sich plötzlich ein furchtbares Gewitter entlud; man signalisierte dem Flieger die herannahende Gefahr vermittelst Bombensignale. Kreder stellte dann die Zündung ab und versuchte im Schwebeflug zu landen. Als er sich 80 m von der Erde befand, geriet das Flugzeug in einen Wirbelwind, Kreder wurde aus seinem Sitz gerissen und auf den Boden geschleudert, wo er mit zerschmetterten Gliedern liegen blieb. Der Apparat wurde zertrümmert. Wir hatten berichtet, daß eine besondere Ministerialabteilung für das Flugwesen eingerichtet werden soll; wie jetzt verlautet, wird der General Bernard wahrscheinlich mit deren oberster Leitung betraut werden. Bernard hat, als er noch Oberst in Vincennes war, in außerordentlich reger Weise mit dem Obersten Etienne an dem Ausbau des Militärflugwesens mitgearbeitet, dessen wesentliche Rolle er m der Zukunft als artilleristische Waffe sieht. Von sonstigen bedeutungsvollen Flügen wären noch zu erwähnen die Vorgänge der letzten Tage in Rußland, woselbst die zum Flugzentrum von Kiew gehörigen Hauptleute Hartmann und Worotnikow und die Leutnants Nestereff und Takatsöheff gleichzeitig sehr wirkungsvolle Flüge oberhalb Petersburgs, und zwar in 1500 m Höhe, ausführten; der Flug dauerte */2 Sunde. Noch größeres Aufsehen erregt hier ein Parforceflug Sebastopol—Poltawa—Kiew, eine Distanz von 800 km welche an diesem Sonnabend die Leutnants Makeff und Tonnoschensky, sowie der Hauptmann Bertschenko auf Befehl der Militärbehörden unternommen haben, die sich durch dieses Manöver vergewissern wollten, ob die jetzige Jahreszeit sich zu Weitflügen eigne. Die drei Offiziere haben ihre Aufgabe glänzend erfüllt; als sie in Kiew ankamen, war es schon spät abends und sie mußten erst 40 Minuten lang über der Stadt evolutionieren, ehe sie sich orientieren konnten, wo die Landung vorzunehmen war. Der französische Bewerb für Marineflugzeuge, der an dieser Stelle besprochene Bewerb ohne Bewerber, bildet andauerd das Tagesgespräch. Der Marineminister hat zwar, angesichts der allgemeinen Opposition, sich zu einigen Aenderungen im Reglement veranlaßt gesehen, doch sieht man diese immer noch nicht als hinreichend an, sodaß bisher sich noch niemand zur Beteiligung entschließen kann. Wie wir zu melden in der Lage sind, wird der diesjährige Aeronautische Salon aller Wahrscheinlichkeit nach vom 6. bis 21. Dezember vor sich gehen, doch ist die offizielle Feststellung noch nicht erfolgt. Mit Interesse sieht man der nächsten Sitzung der Internationalen Aeronautischen Föderation entgegen, welche am 20. Juni sich in Gestalt ihrer Gordon Belinett-Kommission zusammen finden wird, um die Vorschläge zu beraten, die der nächsten Vollkonferenz im Haag am 8.0. Juli mit Bezug auf das Reglement zum Gordon Bennett zu machen sein werden/ Viel besprochen wurde hier ein interessanter Vortrag, welchen der Direktor der Hochschulstudien, Magnan, dieser Tage in der .Akademie der Wissenschaften über ein neues Konstruktionsprinzip für Eindecker hielt. Magnan hat in Gemeinschaft mit dem bekannten Professor Houssay über diese Frage lange eingehende Studien vorgenommen und deren Resultate in dem erwähnten Vortrage zusammengefaßt. Die beiden Forscher haben sich dabei auf die Charakteristiken gestützt, welche sich aus der Beobachtung der Struktur der Vögel ergibt. Im wesentlichen äußerte sich Magnan wie folgt: „Bisher hat man bei der Konstruktion von Flugzeugen bei weitem nicht auf die Lehren Rücksicht genommen, welche sich aus dem Studium der Vögel ergeben. Methodische Untersuchungen haben gezeigt, daß es sehr wohl möglich ist, die von der Natur gelieferten Zahlen zu verwenden. Trotz des beträchtlichen Gewichtunterschiedes, der den Vogel vom Flugzeuge unterscheidet, hat man dennoch die Dimensionen eines Apparats berechnen können, der nach dem Modell eines Vogels konstruiert ist, und hat auf diese Weise einen neuen Beitrag zu dem interessanten Problem beibringen können. Da die Charakteristiken der Vögel variieren, je nachdem diese den Schwebe-, den Segel- oder den Schüttelflug ausführen, haben die Forscher drei verschiedene Kategorien von Berechnungen aufgestellt, von denen nur die eine, welche die Vögel mit Schwebeflug betrifft, da diese sich dem Flug eines Eindeckers am meisten nähert, erwähnt sein mag. Man hat demnach für eine solche Maschine, die ein Gewicht von 500 kg transportiert, wenn sie die Charakteristiken des Schwebevogels kopieren soll, folgende Maße berechnet. Flügelfläche: 14,70 Quadratmeter Gewicht der Flügel: 98,500 kg Spannweite: 10,50 Meter Breite des Flügels: 1,87 Länge des Schwanzteils: 2,06 „ Länge des Apparats: 4,67 „ Durch die Verwendung der vorgeschlagenen Formel ergibt sich, wie Magnan in seinem Expose hervorhebt, der Vorteil, daß die Dimensionen eines Eindeckers genau nach dem Gewicht, welches die flugbereit ausgerüstete Maschine tragen soll, berechnet werden können. Die heute üblichen Eindecker seien zu lang- im Verhältnis zu dem Vogel, den sie kopieren wollen. Die Ausführungen des Gelehrten werden in hiesigen interessierten Kreisen lebhaft besprochen EL Ueber neue Gesichtspunkte zum Flugproblem insbesondere auch zum Tierflug. Von G. Vorndran. 1. Das Wesen der Luft. Wenn man dem Flugproblem beikommen will, so muß man wohl mit der ■ Luft beginnen, denn das kann als feststehend betrachtet werden, daß die Luft auf irgend eine Art die fliegenden Körper trägt. Das- ist aber auch das einzig feststehende, denn schon über die Art, wie die Luft diese Arbeit besorgt, gehen die Ansichten weit auseinander. Es ist jedenfalls zweckdienlich, sich zunächst klarzumachen: Was ist die Luft eigentlich? Die Antwort lautet einfach: Ein gasförmiger Körper. Aber ^'gerade darüber, was ein gasförmiger Körper ist, herrschen immer noch grosse Meinungsverschiedenheiten, ja, ich möchte sogar behaupten, diese Frage ist bis jetzt noch gar nicht ein-wandsfrei gelöst. Um meine Theorie richtig entwickeln zu können, muß ich auch kurz auf die festen und flüssigen Körper zu sprechen kommen, um das Entstehen der Gase zu erklären. Nach der allgemein gültigen Ansicht bestehen die festen Körper aus Molekülen, die durch die Kohäsion zusammengehalten werden, beim Erwärmen schwingen die Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Hugtechn. Vereine 1913. Tafel XV. Hanriot-Eindecker. 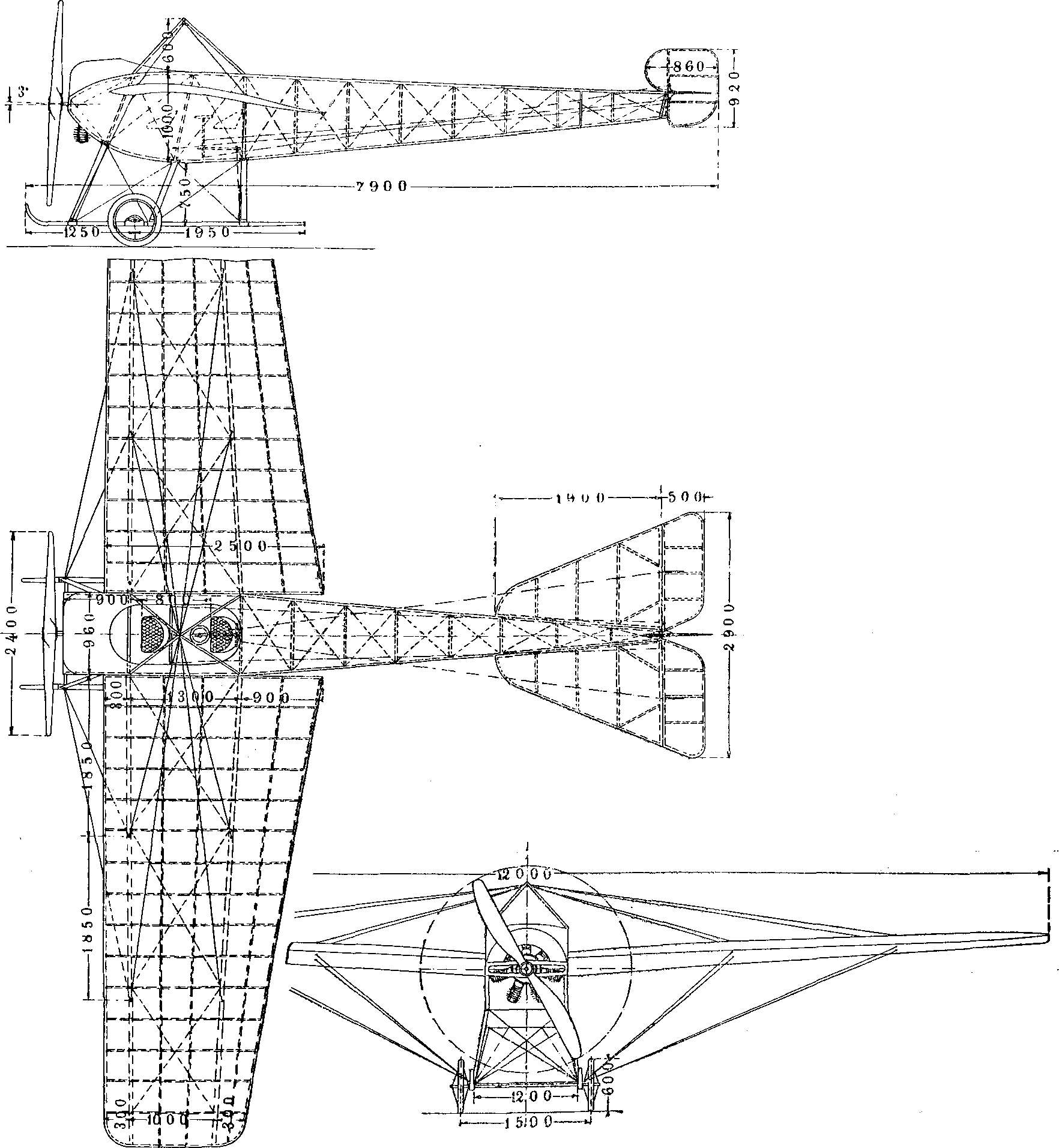 Nachbildung verboten. ,,Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XVI. R. A. W. 6 Cylinder-Motor. 100 PS. Militärtyp 1913.  J Moleküle, ihre gegenseitige Entfernung wird dadurch größer, die Kohäsion deshalb geringer, der Körper wird flüssig, bei noch stärkerer Erwärmung wird die Kohäsion ganz aufgehoben und infolge ihrer Schwungkraft fliegen die Moleküle ab, der Körper wird gasförmig und die Moleküle fliegen nun mit großer Geschwindigkeit durch den ßaum. Ich halte diese Theorie für unrichtig, zum mindesten unvollkommen und die physikalischen Phänomene nicht erschöpfend erklärend. Ich stelle dem gegenüber die Behauptung auf: Jedes Molekül hat einen negativen und positiven Pol wie ein Magnet. *) Im festen Körper sind die Moleküle so gelagert, daß je der negative Pol des einen Moleküls vom positiven des nächstliegenden angezogen wird. Dadurch wird der Körper zusammengehalten. Beim Erwärmen schwingen die Moleküle um eine Achse, die Achse fällt jedoch nicht mit der Verbindungslinie der Pole zusammen. Sobald die Temperatur eine bestimmte Höhe erreicht hat, werden die Schwingungen so groß, daß der sogenannte tote Punkt übersprungen wird, die Moleküle beginnen um ihre Achse zu rotieren. Nun tritt folgende Lage ein: Es werden nie stets gleicher Zeit die gleichnamigen und die ungleichnamigen Pole der Moleküle gegenüberstehen, Anziehung und Abstoßung werden sich gegenseitig ablösen, der Körper wird flüssig. An der Oberfläche der Flüssigkeit werden aber in dem Moment, wo sich die gleichnamigen Pole gegenüberstehen, die äußersten Moleküle abgestoßen, es erfolgt Verdampfung. Der Dampf oder das Gas besteht also aus Molekülen, deren jedes einen positiven und negativen Pol hat und die um eine Achse rotieren und eine gewisse Entfernung von einander haben. Es werden sich also gleich wie bei der Flüssigkeit stets in gleicher Zeit die gleichnamigen und die ungleichnamigen Pole gegenüberstehen. Im ersten Fall: „Gegenüberstehen der gleichnamigen Pole" erfolgt, wie leicht verständlich, Abstoßung, daher das Bestreben der Gase, sich auszudehnen und jeden Eaum auszufüllen. Aber auch im zweiten Fall: „Gegenüberstehen der ungleichnamigen Pole", £0 _ können sich die Moleküle nicht vereinigen, - + iO + denn erstens wirkt die Anziehung ja auf -i Ol * fO jedes Molekül von allen Seiten, so daß ^ , *0" * " es sich im Gleichgewicht befindet und -O - (O ,*qx zweitens kommen infolge der Eotation der 'Q- t " Moleküle stets vorher die gleichnamigen .O* ~* r r ?Q ' _. Pole wieder zusammen, es tritt also Ab" O * ^ »O- stoßung ein, ehe sich die Moleküle ver-"(S * einigen könnten. , - " * A\ Es kann nicht Zweck dieser Zeilen sein, Y , + 0^ ~ die vorstehend aufgestellte Theorie in allen 0 ' Einzelheiten und in ihrer ganzen Tragweite j anzuführen, dies muß vielmehr einer späte- ren Abhandlung vorbehalten bleiben. Für jetzt handelt es sich lediglich darum, das Wesen der Luft in ihrer Beziehung als Träger der fliegenden Körper festzustellen. Nach dem *) Es ist höchst wahrscheinlich, daß die Moleküle der meisten Stoffe mehrere bis viele negative und positive Pole haben, dies ist aber für die hier in Frage stehenden Erscheinungen belanglos, die Wirkung ist ganz gleich, als ob nur je ein negativer und positiver Pol vorhanden wäre. oben Angeführten kann dies folgendermaßen ausgedrückt werden: Die Luft besteht aus freischwebenden kleinsten Teilen (Molekülen), die sich fortgesetzt gegenseitig abstoßen, bezw. das Bestreben haben, sich gegenseitig von einander zu entfernen. (Abb. 1).. Nach dieser Feststellung können wir einen Schritt weiter gehen und 2. das Wesen des Luftwiderstands als die eigentliche Grundlage des Fluges zu ergründen suchen. Aus der Theorie, daß die Moleküle sich fortgesetzt gegenseitig abstoßen, kann ohne weiteres gefolgert werden, daß die Luftmoleküle auch auf einen in der Luft befindlichen festen Körper abstoßend wirken, in gewissem Sinne also einen Druck auf ihn ausüben. Da dieser Druck von allen Seiten gleichmäßig erfolgt, so tritt er für gewöhnlich nicht in Erscheinung. Sobald man jedoch auf einer Seite des Körpers die Luft entfernen würde, so würde auf dieser Seite der Druck aufhören. Auf der anderen Seite wäre also ein Ueberschuß an Druck vorhanden, die Folge müßte notwendigerweise eine Bewegung des Körpers nach der Seite hin sein, auf welcher die Luft entfernt ist. Die Erfahrung lehrt uns, daß dies auch in der Tat so ist. Man könnte diese Erscheinung etwa als negativer Luftwiderstand bezeichnen im Gegensatz zu dem positiven Luftwiderstand, der entsteht, wenn man in der relativ ruhenden Luft den Körper bewegt, "Wir wissen, daß die Luft einer Bewegung eines in ihr befindlichen Körpers einen Widerstand entgegensetzt, zu dessen Ueberwindung ein gewisser Arbeitsaufwand erforderlich ist. Wir wissen ferner, daß dieser Widerstand im Quadrat der Geschwindigkeit des bewegten Körpers wächst. Diese Erscheinung können wir uns nun sehr leicht erklären, sobald wir die oben aufgestellte Theorie über die Beschaffenheit der Luft als richtig annehmen: Die Luftmoleküle haben das Bestreben, sich gegenseitig von einander zu entfernen, durch die Bewegung des Körpers werden aber die vor demselben befindlichen Moleküle genötigt, sich zu nähern, ihre gegenseitige Abstoßung setzt dem einen Widerstand entgegen, dies ist der Luftwiderstand. Auf der Rückseite des Körpers wird durch die Bewegung den Luftmolekülen die gegenseitige Entfernung erleichtert, es wird also der unter normalen Umständen vorhandene Druck vermindert: es entsteht ein negativer Luftwiderstand. (S. Abb. 2) Die Luftmoleküle suchen jedoch alsbald wieder ins Gleichgewicht zu kommen und ihre vorherige Entfernung wieder anzunehmen, indem sie den von dem Körper empfangenen Druck durch wellenartige Schwingungen weitergeben. Diese Schwingungen pflanzen sich mit einer gewissen Geschwindigkeit fort und es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Geschwindigkeit mit der Schallgeschwindigkeit übereinstimmt. *) Immerhin ist also für den Druckausgleich eine gewisse Zeit erforderlich. Wenn man sich dies vor Augen hält, so ist leicht einzusehen, daß je schneller der Körper bewegt wird, desto näher er an die Luftmoleküle herankommt, denn um so weniger Zeit wird den Molekülen *) Es ist aber damit nicht gesagt, daß auch die Spannung sich mit dieser Geschwindigkeit ausbreitet. Die Moleküle schwingen vielmehr vor und zurück und nur die Differenz zwischen einer Vor- und Rückwärtsschwingung drückt die Geschwindigkeit des Spannungsausgleichs aus. 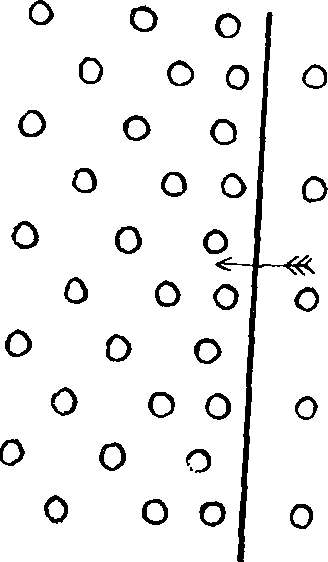 o Abb. 2 zur Entfernung geboten. Wenn also z. B. die Bewegungsgeschwindigkeit des Körpers verdoppelt wird, so haben die Luftmoleküle nur die halbe Zeit zur Entfernung, sie können sich also auch nur die halbe Strecke von dem Körper entfernen, vorausgesetzt, daß ihre Wellengeschwindigkeit o unveränderlich ist, was sehr wahrscheinlich ist. Die Luftmoleküle haben also im Durch-o schnitt nur noch die halbe Entfernung von dem bewegten n Körper. Wendet man hierauf nun das Coulomb'sche Gesetz vom Magnetismus an, wo-q nach die Abstoßungskräfte sich umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen o verhalten, so haben wir auch damit die Lösung, warum der Luftwiderstand im Quadrat der Geschwindigkeit steigt. Wir haben also ohne Schwierigkeit eine Erklärung für alle Erscheinungen des Luftwiderstands, und können uns nun daran machen, 3. die vorteilhafteste Ausnützung des Luftwiderstands für die Zwecke des Fluges zu suchen. Die beim Flug aufgewendete Arbeit hat zwei verschiedene Funktionen zu leisten: 1. die Fortbewegungsarbeit in wagrechter Richtung, 2. die Hebearbeit. Betrachten wir zunächst die erstere, die zur Zeit wohl allgemein mittels Luftschrauben übertragen wird. Die schief gestellten Flügel der Luftschrauben drücken auf die Luft, wodurch die Luftmoleküle etwas zusammengedrückt werden, dadurch entsteht die oben beschriebene gleichsam magnetische Spannung und der Gegendruck gegen die Schraubenflügel. Diese Spannung wirkt aber, wie leicht einzusehen, nach vorn und hinten gleich stark. Vorn auf die Schraubenflügel und das daran befindliche Flugzeug, hinten auf die umgebende Luft. Bei Beginn der Bewegung wird sich aber das Fahrzeug infolge seiner Trägheit nur sehr langsam in Bewegung setzen, die Spannung der Luftmoleküle wird sich also in der Hauptsache nach rückwärts ausgleichen, was einen Arbeitsverlust bedeutet, denn nur der Teil der Spannung, der sich nach vorwärts ausgeglichen hat, ist zur Fortbewegung nutzbar geworden. Mit fortschreitender Bewegung wird aber das Verhältnis zwischen nutzbarer uud verlorener Arbeit immer günstiger, denn da das Fahrzeug wieder infolge seiner Trägheit die erhaltene Bewegungsgeschwindigkeit beizubehalten sucht, so wird jede weitere durch die aufgewandte Arbeit erzeugte Spannung zur Beschleunigung dienen. Nach einiger Zeit tritt ein Gleichgewichtszustand ein, wenn nämlich die durch die Schraubenflügel erzeugte Luftspannung dem durch das Flugzeug infolge seiner Bewegung erzeugten Luftwiderstand das Gleichgewicht hält. Tritt dieser Zeitpunkt dann ein, wenn die Geschwindigkeit, mit der die Luft von den Schraubenflügeln nach rückwärts gedrückt wird, mit der Geschwindigkeit des Flugzeugs selbst übereinstimmt, so wird die aufgewendete Arbeit vollkommen ausgenutzt. Mit den z. Z. vorhandenen Propellern wird diese Bedingung allerdings noch nicht vollkommen erfüllt, immerhin kommen einige Konstruktionen dem theoretischen Ideal ziemlich nahe, so daß man sagen kann: Bei der Fortbewegung in wagrechter Richtung wird der Luftwiderstand bezw. die aufgewandte Arbeit genügend vorteilhaft ausgenützt. Durchaus nicht der Fall ist dies aber bei der Hebearbeit. Hier entstehen bei den z. Zt. üblichen Drachenfliegern ganz beträchtliche Verluste. Die Tragdecken dieser wirken ganz ähnlich wie die Schraubenflügel. Solange sich aber das Flugzeug nicht hebt, sondern nur wagerecht fortbewegt, kann sich die erzeugte Luftspannung überhaupt nur nach unten ausgleichen, die gesamte aufgewandte Arbeit erscheint also verloren, bezw. bewegt nur die Luft nach unten. "Wird bei gesteigerter Geschwindigkeit die Luftspannung größer als das Gewicht des Flugzeugs, so wird es sich zwar heben, aber viel langsamer, als der Spannungsausgleich erfolgt, so daß in diesem Fall zwar eine geringe Ausnutzung des Arbeitsaufwands entsteht, der größte Teil aber immer noch verloren geht. Es ist also ein sehr unbefriedigender und unwirtschaftlicher Zustand. Während sonst allgemein ein Arbeitsaufwand nur zum Heben einer Last erforderlich ist, nicht aber um eine Last auf einer bestimmten Höhe zu halten, ist bei den Drachenfliegern allein schon für das Halten in einer bestimmten Höhe eine ganz beträchtliche Arbeit erforderlich, also für etwas, wozu theoretisch eigentlich gar kein Arbeitsaufwand nötig sein sollte. Auf den ersten Blick erscheint es unmöglich, dieses Problem zu lösen und diesen Verlust, wenigstens zum großen Teile, zu vermeiden, und doch hat die Natur dieses Problem gelöst, und zwar auf eine höchst geniale, weil ganz einfache Weise. Wie oben des näheren ausgeführt, entsteht der Luftwiderstand, angenommen einer ebenen Platte, die senkrecht zu ihrer Ebene durch die Luft bewegt wird, dadurch, daß die Luftmoleküle zusammengedrückt werden und dem infolge ihres Bestrebens, sich gegenseitig zu entfernen, Widerstand entgegensetzen. Je schneller die Bewegung, je größer der Widerstand, wie oben gezeigt. Aber so groß man auch die Geschwindigkeit der Bewegung gestalten mag, einen absoluten Widerstand, wie den eines festen Körpers, der die weitere Beschleunigung der Bewegung überhaupt verhindert, wird man nie erreichen können, denn jede auch noch so schnelle Bewegung können wir nicht anders herstellen als allmählich ansteigend. Dadurch werden die Luftmoleküle selbst in eine relative Bewegung versetzt, die immer größer wird, und in der Richtung des Spannungsausgleichs wirkt und diesen erleichtert, was einen absoluten Widerstand verhindert. Wenn man sich nun eine Möglichkeit denken könnte, daß die bewegte Platte mit großer Geschwindigkeit plötzlich auf die ruhende Luft wirkt, so würde dies ein ganz anderes Ergebnis haben. In diesem Fall hätten die Luftmoleküle zum Spannungsausgleich keine genügende Zeit, sie würden also sehr nahe an die Platte herankommen, was einen großen, fast absoluten Widerstand verursachen würde. Aber es erscheint unmöglich, diese Bedingung zu erfüllen. Zunächst kann man annehmen, daß wenn überhaupt, es nur mittels periodischer Bewegung möglich wäre, einen derartigen plötzlichen Schlag zu führen, denn die Begriffe: „plötzlich und fortdauernd" schließen sich natürlich gegenseitig aus. Aber auch jede periodische Bewegung beginnt je mit der Geschwindigkeit 0, wächst dann und nimmt wieder ab bis 0, ein plötzlicher Schlag ist damit also auch unmöglich. Und doch ist die praktische angenäherte Lösung des Problems möglich, so daß die Verluste zwar nicht gänzlich vermieden, aber doch so vermindert werden können, daß das Schweben an sich fast keinen Arbeitsaufwand verursacht. Wohl allgemein bekannt ist das kleine Experiment mit dem Zigarrenkistendeckel und dem Zeitungsblatt. Ein dünnes Zigarren-brettchen wird so an die Tischkante gelegt, daß etwa ein Viertel über den Tisch hervorsteht, über den übrigen Teil wird das Zeitungsblatt glatt auf den Tisch gelegt. Schlägt man nun mit der Faust auf den vorstehenden Teil des Brettchens, so wird es eher abbrechen, ehe sich das Zeitungsblatt vom Tisch abheben läßt, während, wenn man die Bewegung langsam ausführt, das Blatt sich leicht abhebt. Dies ist die Lösung des Problems: Die Bewegung wird geteilt, zunächst bewegt sich die Faust allein, bis sie große Geschwindigkeit erreicht hat, dann trifft sie das Brettchen mit dem darüber gelegten Zeitungsblatt, das nun plötzlich diese Geschwindigkeit annehmen soll, die Luftmoleküle darüber werden so nah zusammengepreßt, daß sie fast absoluten Widerstand leisten, so daß eher das Brettchen abbricht, ehe sich das Zeitungsblatt hebt. 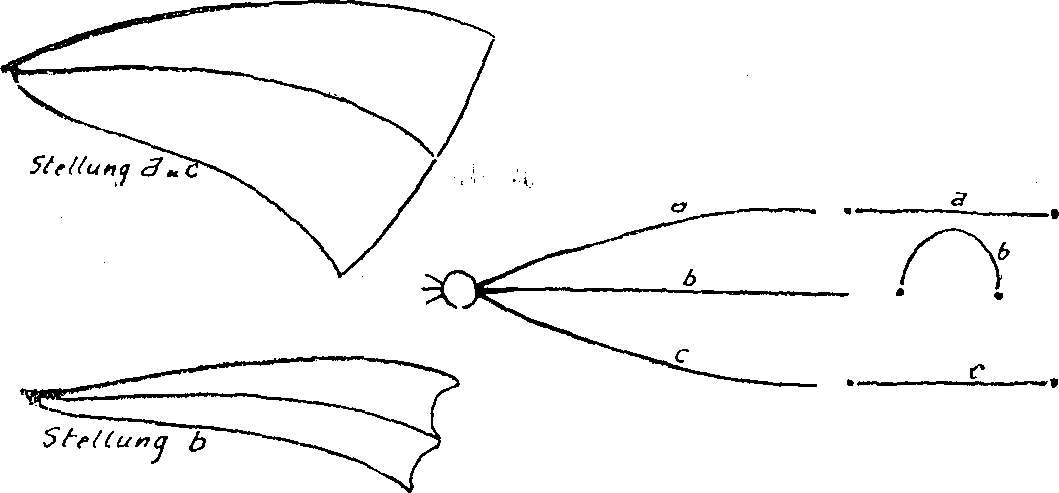 Abb. 3 Um dieses Prinzip auf den Flug anzuwenden, müßte man also folgendermaßen verfahren: Man müßte zunächst die Flügelfläche selbst nicht bewegen, sondern nur irgend welche lose mit derselben befestigte Arme, erst wenn diese eine genügende Geschwindigkeit erreicht hätten, müßten sie plötzlich die Flügelfläche fassen und mitzureißen suchen, dadurch würde ein sehr großer Widerstand erzielt. Genau so verfährt nun die Natur, wie ich im nachfolgenden nun zeigen möchte. 4. Der Insektenflügel. Der Insektenflügel besteht aus elastischen, im allgemeinen ihn der Länge nach durchziehenden Rippen, zwischen welchen eine elastische Haut ausgespannt ist. In der Hauptsache gehen die Rippen strahlenförmig von der Wurzel aus. Würde man nun die Rippen näher zusammendrücken, so würde die Haut, da sie dann zu weit wäre, je zwischen 2 Rippen eine Rinne bilden. Dieser Vorgang findet nun während des Fluges statt. Nehmen wir an, der Flügel ist gehoben und das Abwärtsschlagen beginnt soeben. Stellung a (Abb. 3) die Haut ist vollständig gespannt. Während der ersten Hälfte des Abwärtsschlages werden die Rippen genähert, die Haut dazwischen bildet Rinnen. (Stellung b). Es bleibt also dabei ein großer Teil der Haut und die darunter befindliche Luft oben, obgleich die Rippen heruntergehen. In der Mitte der Bewegung haben aber die Rippen nun einen großen Schwung erreicht, jetzt werden die Rippen wieder auseinandergezogen, so daß die Haut wieder angespannt wird und in der zweiten Hälfte des Abwärtsschlages die Luft der nun eintretenden, plötzlichen, raschen Verdrängung sehr großen Widerstand leistet, so daß das Tier gehoben wird. (Stellung c). Wie in der Natur diese verschiedenen Bewegungen erzielt werden, kann hier aus Raumgründen nicht im einzelnen dargelegt werden, ist auch für das Prinzip im ganzen unerheblich. Es sei nur noch bemerkt, daß durch eine sinnreiche Verteilung der Rippen in Verbindung mit ihrer Elastizität dafür gesorgt ist, daß auch während des Flügelhubs ein Teil des Flügels eine Auftriebwirkung hervorbringt. Wir kommen nun zu 5. dem Vogelflügel. Dieser ist im Prinzip ganz ähnlich gebaut wie der Insektenflügel, hierbei bilden die Federkiele die Rippen und die Fahnen die elastische Haut, aus der die unten offenen Rinnen gebildet werden. In Abbildung 4 ist der Vorgang schematisch dargestellt. Der Flügel besteht aus einem Arm a, an welchem die Rippen b ungefähr senkrecht befestigt sind. Dieser Arm a wird in einer halben Kegelfläche auf- und abbewegt. Infolge seiner Elastizität wird dieser Arm a sich bei den Schwingungen stets abwechselnd nach vorn und hinten, sowie nach oben und unten ausbiegen, so daß die Rippen an ihren Enden sich nähern und entfernen, wodurch die gleiche Wirkung wie bei den Insektenflügeln erreicht wird. An dem Ende e des Armes a sind um e drehbar die Schwanzfedern f befestigt, die sich in umgekehrter Reihenfolge nähern und entfernen, wie die Rippen b, wodurch in Verbindung mit der Elastizität der Federn ein müheloses Heben des Flügels erzielt wird. 6. Schlußfolgerung. Wenn wir nun alle vorstehend beschriebenen Erscheinungen zusammenfassen, so erscheint es heute nicht unmöglich, daß unsere vorgeschrittene Technik das Flugproblem auch auf diesem Wege lösen könnte, einem Wege, der aller Wahrscheinlichkeit nach zu weit günstigeren Resultaten führen könnte, als die z. Zt. bevorzugten Systeme, die ja jetzt schon fast an ihrem höchsten Punkt angelangt sind und für die Zukunft keine erheblichen Verbesserungen mehr erwarten lassen, und dabei doch technisch und wirtschaftlich höchst unbefriedigende Lösungen darstellen. Als höchstes erreichbares Ideal gilt ja unseren Flugtechnikern immer noch der Schwebeflug der Vögel und sie glauben, mit den Drachenfliegern dieses Ziel einst erreichen zu können. Aber sie bedenken nicht, daß damit eigentlich im Grunde nicht viel gewonnen wäre. Zunächst ist ja Schwebeflug ohne Kraftaufwand nur bei genügend starkem Wind möglich. Sich den nötigen Wind erst selbst herzustellen, wie dies sozusagen die Drachenflieger tun, ist doch im höchsten Grade unwirtschaftlich, es gibt auch in der ganzen Natur kein Beispiel dafür, da die Natur nicht so verschwenderisch mit ihren Mitteln umgeht. Der Schwebeflug ist aber nur berechtigt, wenn die Kraft, nämlich der Wind, ohnehin schon vorhanden ist und nur ausgenützt zu werden braucht. Dann ist aber auch beim Schwebeflug 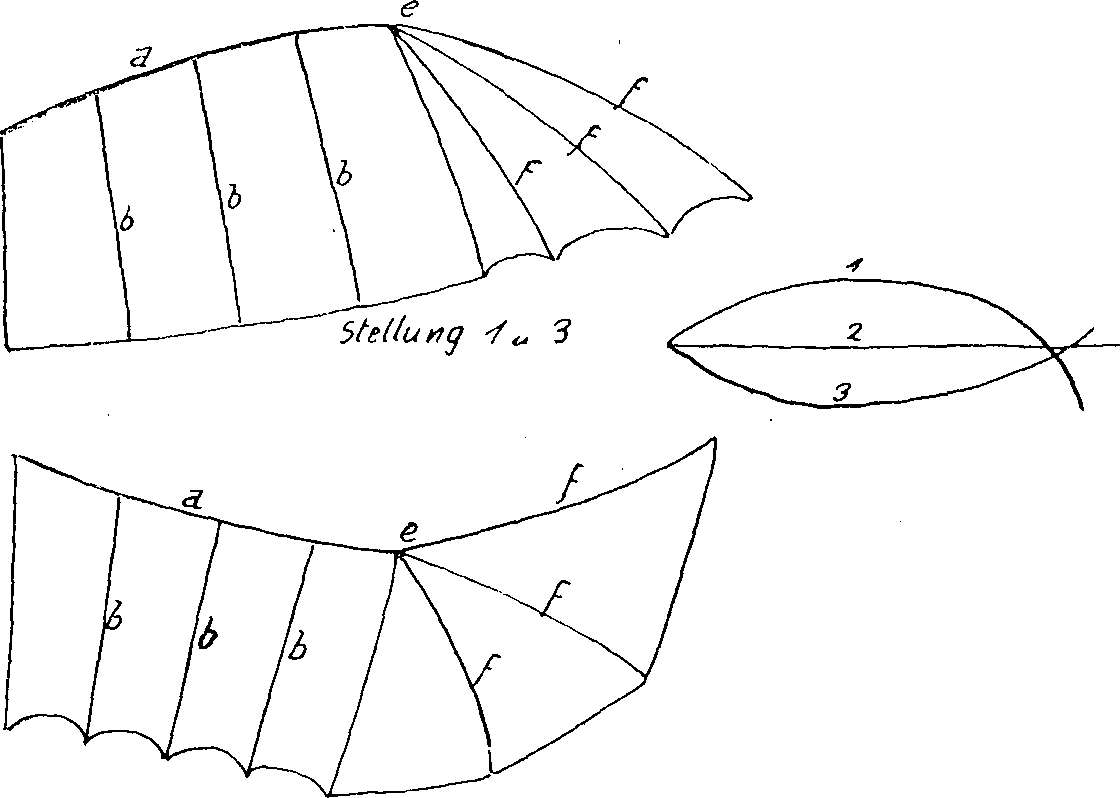 Stellung 2 Abb. 4 eine Reise in gerader Linie unmöglich. Alle Schwebeflieger in der Natur benutzen den Schwebeflug nur zum Kreisen oder Hin- nud Herstreifen in mehr oder weniger stark gekrümmten Kurven. Wollen sie aber einen bestimmten Punkt in gerader Linie erreichen, so ist ihnen dies nur mittels regelmäßiger Flügelschläge möglich. Soll aber das Flugzeug ein menschliches Verkehrsmittel werden, so hat es doch keinen großen Wert, wenn es nur imstande ist, schöne Kreise und Kurven in der Luft zu beschreiben. Von einem solchen Verkehrsmittel muß doch verlangt werden, daß es imstande ist, zwischen zwei Punkten in gerader Linie zu verkehren, nötigenfalls an jeder beliebigen Stelle anzuhalten und vom Wind möglichst unabhängig zu sein. Um dieses Ideal zu erreichen, müssen wir uns ein anderes Vorbild wählen, nicht die Schwebeflieger, die nur als Sport-Ideale dienen können. Ganz hervorragende Eeiseflieger sind die Schwärmer unter den Schmetterlingen. Verschiedene Arten sind imstande, das Mittelmeer zu überfliegen und kommen von der Nordküste Afrikas sogar über die Alpen weg bis zu uns. Dabei ist ihr Flug gerade, zielsicher und selbst von sehr starkem Wind vollständig unabhängig. Sie sind imstande, in der Luft an jeder beliebigen Stelle stillzustehen, ja sogar rückwärts zu fliegen, sie sind das Ideal eines vollkommenen Luftfahrzeugs. Sie nachzuahmen, muß das Ziel der Mugtechnik sein, dann ist die Luft erst erobert. Ich halte es heute nicht mehr für unmöglich, dieses Ziel in absehbarer Zeit zu erreichen. Deutsche Ingenieure an die Front! R. A. W. 6-Cylinder-Flugmotor 100 PS. Militärtyp 1913. (Hierzu Tafel XVI.) Dieser Motorentyp war von den Rheinischen Aerowerken zum Wettbewerb um den Kaiserpreis gemeldet. Verschiedene Gründe, welche auch das Preisgericht als Umstände höherer Gewalt anerkannte, verhinderten leider, daß dieser Motor bei dem Kaiserpreiswettbewerb rechtzeitig abgeliefert wurde und zur Vorführung gelangte, was umso mehr zu bedauern ist, als er eine in jeder Beziehung der Neuzeit entsprechende Konstruktion darstellt, mit doppelter Magnet-zündung ausgerüstet ist und jedenfalls große Anwartschaft auf einen Preis gehabt hätte. Die normale Dauerleistung dieses Motors beträgt 104 PS bei 1280 Touren. Die Cylinder aus feinkörnigem Spezial-Graugus von hoher Festigkeit stehen zur Verminderung der Kolbenreibung desaxial zur Kurbelmitte. Die Kühlmäntel reichen sehr tief herab und sind nach einem besonderen Schweißverfahren aus Eisenblech hergestellt. Diese Art der Kühlmantelnerstellung, welche von den Rheinischen Aerowerken schon seit 2'/2 Jahren ausgeführt wird, hat sich sehr gut bewährt und ist für eine Reihe von neueren Flugmotoren-Typen vorbildlich gewesen. Diese aus Eisenblech geschweißten Kühlmäntel gestatten nämlich bei der Bearbeitung der Cylinder die genaue Kontrolle der Wandstärke im Gegensatz zu gußeisernen Mänteln. Sie haben ferner den Vorteil, dieselbe Wärmeausdehnung wie die Cylinder zu haben, wodurch Wärmespannungen vermieden werden, welche bei kupfer-galvanisierten Mänteln das bekannte, sehr lästige Leckwerden verursachen, j. Beide Ventile sind vollkommen zwangsläufig gesteuert, durch, einen in einer Säule schwingenden Doppelhebel. Die Ventilfedern sind aus mehreren Einzelfedern hergestellt, sodaß der Bruch einer Feder die Ventile nicht außer Tätigkeit setzt. Die hohlgebohrte Kurbelwelle ist sehr kräftig gehalten und mit einem starken Konus versehen, sodaß sie auch bei schwierigen Landungen und Propellerbrüchen gut stand hält. Am Gehäuse-Oberteil sind Handlöcher zur schnellen Kontrolle des Motor-innern angebracht. Der Deckel dieser Handlöcher wird durch eine Traverse mit Flügelmutter zentrisch dicht schließend angedrückt. Am Gehäuse-Unterteil ist ein großer Oelbehälter vorgesehen, welcher ein für mehrere Stunden ausreichendes Oelquantum im Motor selbst mitzuführen gestattet. Der Motor ist mit d o p p e 11 e r Schmierung ausgerüstet und zwar saugt eine Oel-Zirkulationspumpe aus der Mitte dieses Oelbehälters das Oel ab durch einen in wenig Sekunden herausnehmbaren Oelfilter und führt das so gereinigte Oel nach Kontrolle durch ein Manometer sämtlichen Lagerstellen wieder zu. Die Druckleitung dieser Zirkulationsölung geht als gerades Rohr durch das Gehäuse-Innere und läßt sich von der Propellerseite des Motors durch Lösen einer Mutter bequem herausziehen und eventuell reinigen. Eine zweite Oelpumpe dient als Frischölpumpe und drückt ein genau regulierbares Quantum Frischöl zu sämtlichen Hauptlagern. Diese doppelte Oelung ist entschieden sehr gut durchgebildet, was gerade bei einem 6-Cylinder Motor infolge seiner Baulänge von Wichtigkeit ist. Bei manchen anderen Motoren erfolgt dieOelung nur durch Frischölung allein. Eine solche Schmierung ist aber besonders bei Flugmotoren unzureichend, da das nicht gebrauchte Oel sich im Unterteil des Gehäuses ansammelt und bei stärkerer Schräglage ein Ueberölen der tiefer liegenden Cylirider verursacht. Bei dem R. A. W. 6-Cylinder Motor ist das eigentliche Kurbelgehäuse auch bei starker Schräglage stets ölleer, da das überschüssige Oel sofort in den großen Oelbe-hälter des Gehäuse-Unterteils abläuft und von hier aus durch den Oelfilter hindurch zur Zirkulationsölung gelangt. 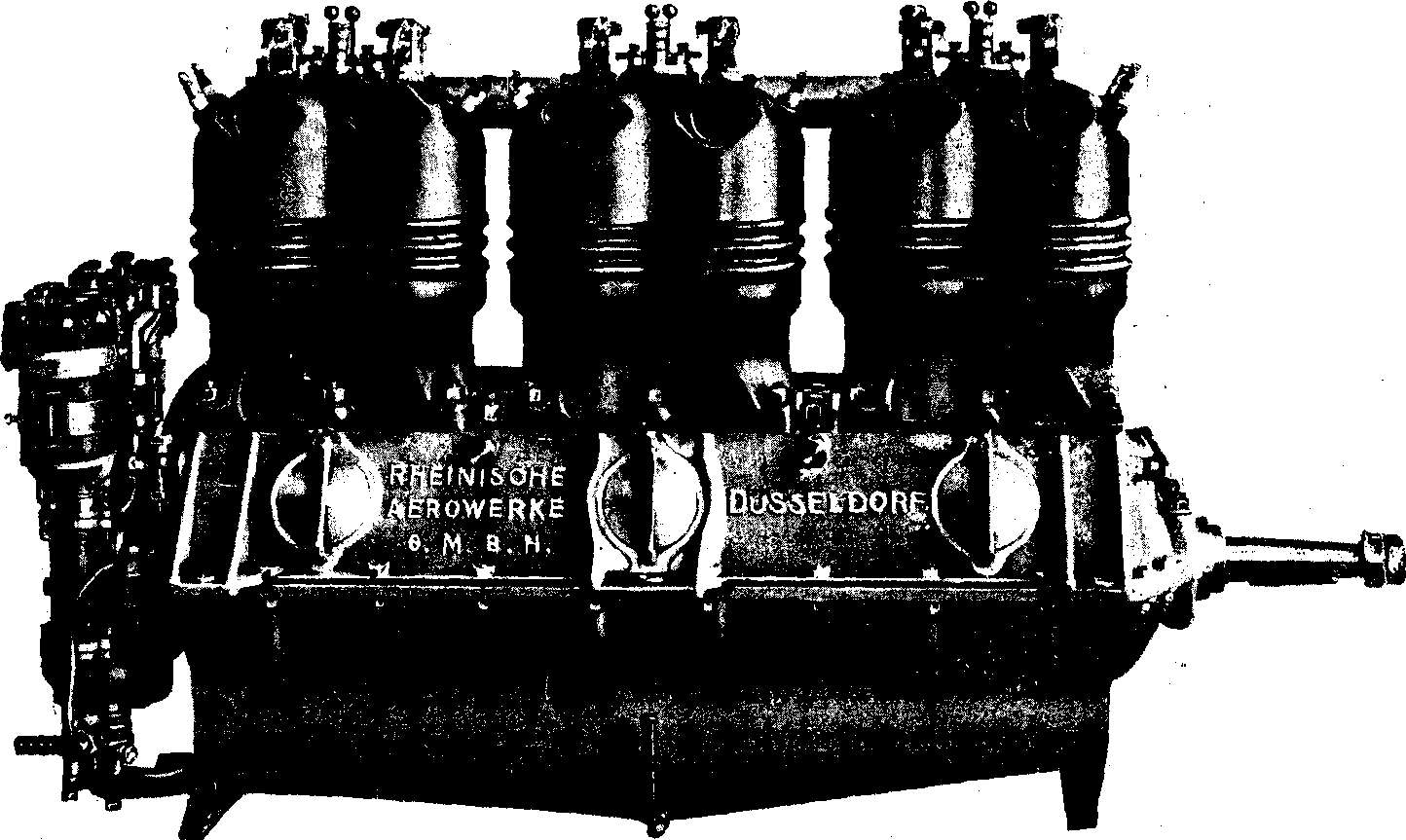 R. A. W. 6-Cylinder Flugmotor 100 PS, Militärtyp 1913. Ebenso wirkt auch die Zündung doppelt und zwar durch zwei oel-und wasserdicht gekapselte Boschmagneten mit getrenntem Antrieb, getrennter Leitung und getrennten Kerzen (für jeden Cylinder sind zwei Kerzen vorgesehen). Einer der Magneten ist zum Anschluß der Anlaßzündung eingerichtet, mit welcher der Motor ohne Anwerfen des Propellers sicher anspringt. Das Gewicht von 168 Kilo für den betriebsfertigen Motor ist als verhältnismäßig sehr gering zu bezeichnen, wenn man dabei berücksichtigt, daß 2 Oelpumpen, 2 Magnete mit getrenntem Antrieb, Leitung und Kerzen, sowie der große Oel-behälter mit Oelfilter im Gewicht mit eingeschlossen sind. Es sei noch erwähnt, daß diese Flugmotoren als Präzisions-Fabrikate hergestellt werden, das heißt, mit Austauschbarkeit aller Teile. Alle Wellen und reibenden Teile sind aus Chrom-Nickelstahl, gehärtet und geschliffen. Konstruktion ind Ausführung des Motors sind derartig, daß sie zu großen Hoffnungen berechtigen. Der französische Entwurf zur Reglementierung des Luftverkehrs. (Von unserem Pariser Korrespondenten.) Dem französischen Parlament ist dieser Tage der Gesetzentwurf der Regierung zugegangen betreffend die Reglementierung des gesamten Luftverkehrs, und schon in naher Zeit wird sich die Kammer mit dieser Vorlage zu beschäftigen und sie durchzuberaten haben. Bekanntlich hatte der französische Minister der öffentlichen Arbeiten eine besondere Kommission mit den erforderlichen Vorarbeiten betraut und diese hat nun nach langer mühevoller Arbeit sich auf einen Entwurf verständigt, der im wesentlichen von dem Minister seinem Gesetzesvorschlag zu Grunde gelegt worden ist. Bei der außerordentlichen Wichtigkeit der Materie an sich, sowie bei der unabwendbaren Notwendigkeit, daß jene eine internationale Regelung findet, begreift man das lebhafte Interesse, welches man dem projektierten Vorgehen Frankreichs schenkt, und es seien deshalb hier die hauptsächlichsten Grundgedanken des Gesetzes angeführt. In erster Reihe beschäftigt sich das Gesetz mit dem Artikel 552 des Code Civil, nach dessen Wortlaut der Besitz des Bodens „gleichzeitig den Besitz von allem, was darunter und darüber sich befindet" umfasst. Das wird nun in der Weise ausgelegt, daß sich dieses Besitzrecht nicht auch auf die die Atmosphäre ausdehnt, die unmöglich in den Privatbesitz mit eingegriffen werden kann. Infolgedessen können sich die Besitzer nicht dem widersetzen, daß ihr Terrain überflogen wird; dagegen müssen sie gegen alle Mißbräuche geschützt werden und sie haben deshalb Anspruch auf Entschädigung für allen Schaden, der ihnen aus dem Verkehr und aus dem Landen von Luftfahrzeugen erwächst. Nachdem dieses Grundprinzip einmal festgestellt ist, handelt es sich darum, die polizeilischen Bestimmungen zu fixieren, denen das Flugwesen im Interesse der öffentlichen Sicherheit, sowie im Interesse der nationalen Verteidigung zu unterwerfen ist. Der Gesetzentwurf enthält mit Bezug auf diese Bestimmungen sechs Artikel, deren Analyse folgende ist: Der Verkehr der Luftfahrzeuge: Die Freiheit des Verkehrs oberhalb dem gesammten Landesterritorium wird für die Luftfahrzeuge proklamiert, vorbehaltlich der strikten Befolgung der besonderen Gesetzesvorschriften, Dagegen ist es den Luftfahrzeugen untersagt, sofern nicht ein Fall von force majeure vorliegt, in einem abgeschlossenen Terrain ohne die Zustimmung des Besitzers zu landen, und ebenso nicht innerhalb von Menschenansammlungen, abgesehen von den für diesen Zweck hergerichteten und bestimmten Stellen. Die Führer der Luftfahrzeuge werden für den von ihnen angerichteten Schaden verantwortlich sein, ohne daß der Geschädigte den Beweis zu erbringen haben wird, daß den Führer des Luftfahrzeugs direkt und persönlich eine Schuld trifft. Die privaten Luftfahrzeuge: Die Verkehrsberechtigung eines privaten Luftfahrzeugs unterliegt der Ausfertigung eines Verkehrs-Erlaubnisscheins, und jedes Fahrzeug muß die ihm im Augenblick seiner Immatrikulation zugeteilten unterschied! chen Buchstaben und Nummern in erkennbaren Schriftzeichen tragen. Jederzeit wird eine Besichtigung der Luftfahrzeuge vo genommen werden können, um ihre jeweilige Beschaffenheit und Verwendbarkeit zu prüfen. An Bord jedes Luftfahrzeugs muß sich ein diplomierter Führer befinden. Das Führerdiplom wird nur solchen Personen ausgeliefert werden, die moralisch intakt und, eine spezielle Autorisation ausgenommen, mindestens 18 Jahre alt sind. Das Passieren der verbotenen Zonen ist den Luftfahrzeugen untersagt. Diese Zonen, welche durch besonderen Erlaß namhaft gemacht werden sollen, werden das Territorium der befestigten Plätze umfassen, die gegen indiskrete Beobachtung geschützt werden sollen. Der Transport von Explosivstoffen, Waffen, Kriegsmunition, Brieftauben, photographischen, radiotelegraphischen und radiotelephonischen Apparaten an Bord der Luftfahrzeuge ist ohne spezielle Autorisation verboten. Ein Bordbuch muß geführt und noch zwei Jahre nach der letzteingetragenen Notiz aufbewahrt werden. Die letztere Bestimmung wird damit gerechtfertigt,„daß/esjm Interesse der öffentlichen Sicherheit und der nationalen Verteidigung nützlich schien, sich während einer gewissen Zeit von den durch ein Luftfahrzeug ausgeführten Fahrten und von den Personen, die daran teilgenommen haben, informieren zu können. Die öffentlichen Luftfahrzeuge: Die öffentlichen Luftfahrzeuge tragen ein einziges Erkennungszeichen, welches verschieden ist, je nachdem es sich um ein militärisches oder einer öffentlichen Verwaltung zugehöriges Fahrzeug handelt. Die Benutzung dieses speziellen Erkennungszeichens ist den privaten Luftfahrzeugen untersagt. Der Verkehr ausländischer öffentlicher Luftfahrzeuge ist in Frankreich und in den Kolonien ausnahmslos untersagt. Luftfahrzeuge, die aus dem Ausland kommen : Besondere, von den öffentlichen Verwaltungsbehörden zu erlassende Bestimmungen werden die Bestimmungen festsetzen, denen die Luftfahrzeuge und ihre Führer zu entsprechen haben werden, damit ihnen der Eintritt in französisches Gebiet und dessen Verlassen auf dem Luftwege nach einer dort vorgenommenen Landung gestattet werden soll. Diese Bestimmung hat den Zweck, der Regierung die nötige Freiheit für Verhandlungen zu lassen, welche mit Bezug auf diesen Punkt zwischen den einzelnen Nationen stattfinden werden. Die mit Bezug auf diese Gattung von Luftfahrzeugen zu erlassenden Bestimmungen haben naturgemäß eher ihren Platz in internationalen Konventionen als in der Gesetzgebung eines Einzelstaats. Allgemeine Bestimmungen: Die Lokalbehörden haben die Pflicht, den in Not befindlichen Luftfahrzeugen nach Maßgabe der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel Beistand zu leisten. Jede Person, die das Wrack eines Luftfahrzeugs auffindet, hat davon der zuständigen Behörde unverzüglich Mitteilung zu machen. Für öffentliche Schaustellungen auf dem Gebiete einer Kommune ist die Autorisalion des Präfekten, die auf Grund eines Antrags des zuständigen Bürgermeisters erteilt wird, erforderlich. Die Motive zu dem Gesetzentwurf erklären diese Bestimmung damit, daß es notwendig erschien, die endgiltige Entscheidung nicht dem Bürgermeister zu überlassen, der in häufigen Fällen nur darauf bedacht sei, nicht das Mißfalen seiner Gemeinde zu erregen. Wenn die Flugvorführ;.ngen auf freiem Felde stattfinden sollen, so wird der Präfekt die Burgern eister all derjenigen Gemeinden zu Rate ziehen, wo der Abflug, die Ankunft oder eine Zwischenlandung vorgesehen ist. Falls mehrere Departements interessiert sind, wird der Minister die Entscheidung zu treffen haben. Es ist hervorzuheben, daß hierbei jene Bewerbe zwischen zwei festgesetzten Orten, aber zu unbestimmtem Zeitpunkt, wie beispielsweise die Fernflüge Paris—Brüssel, Paris-Puy de Dome u. s.w., nicht unter diese Bestimmung fallen. Der Start zu derartigen Flügen soll nicht als öffentliche Schaustellung angesehen werden, da erst im letzten Augenblick beschlossen wird, je nach dem Entschluß des Fliegers und nach den atmosphärischen Verhältnissen. Schließlich hat die französische Regierung auch die fiskalische Ueber-wachung der neuen Fortbewegung in der Luft in Betracht gezogen, sofern dabei die Rechte der Zoll- und Oktroi-Verwaltungen zu wahren sind. Da aber die Organisation einer wirklich wirksamen Ueberwachung ungeheuere Schwierigkeiten verursacht, hat man zu dem Ausweg gegriffen, den Luftfahrzeugen zu untersagen, an Bord Waren ausländischen Ursprungs oder solche Waren inländischen Ursprungs, welche einer Abgabe unterliegen, zu befördern. Der sechste und letzte Artikel des Regierungsentwurfs setzt die Strafen für Zuwiderhandlungen gegen die projektierten Bestimmungen fest. Im allgemeinen wird man zugeben müssen, daß der vorstehend in seinen wesentlichen Zügen skizzierte Gesetzentwurf in ziemlich liberalem Sinne abgefaßt ist, trotzdem es bedauerlich erscheint, daß man alle Gattungen von Luftfahrzeugen zusammengefaßt hat, was insbesondere für das Flugwesen eine unerwünschte Belastung bedeutet. Von Wichtigkeit ist die Bestimmung, welche den Fliegern gestattet, im Notfalle auf dem Terrain eines Privatbesitzers zu landen, ohne daß er sich dadurch gerichtlichen Verfolgungen aussetzt. Gerade die Vorgänge in Frankreich, wo namentlich die Konstruktionsfirma Bayard-Clement einen Rattenkönig von Prozessen mit einem Nachbarbesitzer auszukämpfen hatte, haben die gesetzliche Regelung dieser Frage angezeigt erscheinen lassen. Was den Verkehr aus dem Auslande kommender Luftfahrzeuge anbetrifft, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß mit Bezug auf diesen Punkt eine internationale Regelung unbedingt notwendig ist Der große Vorteil, der sich daraus ergeben wird, dürfte diplomatische Zwischenfälle, wie sie bisher schon vorgekommen sind, verhüten Und wenn jene diplomatischen Zwischenfälle bisher sich in freundlicher Weise und glatt abgespielt haben, so könnte es doch in Zeiten internationaler Spannungen anders sein und deshalb ist die internationale Festlegung allgemein giltiger Bestimmungen unerläßlich. Die Vorgänge von Nancy und Luneville haben gezeigt, wie dringend ein internationales Reglement notwendig ist. Daß das Ueberfliegen gewisser Zonen im Prinzip untersagt ist, erscheint durchaus verständlich Aber man wird von den Fliegern das strikte Innehalten dieses Verbots schlechterdings nicht verlangen können. Es kommt in der Praxis häufig vor, und zwar sowohl bei den Flugzeugen und Freiballons, als auch bei den Lenkballons, daß ein aus den Wolken hervorkommendes Luftfahrzeug sich plötzlich und ungewollt über einer dieser verbotenen Zonen befindet und somit ohne Verschulden gegen die betreffende gesetzliche Bestimmung verstößt. In solchen Fällen wird es schwierig sein, zu bestimmen, ob eine böswillige Absicht des Fliegers oder ein von dessen Willen unabhängiger Fall von „force majeure" vorliegt. Das Verbot des Mitfiihrens photographischer und radiotelegraphischer Apparate, sowie von Brieftauben, so berechtigt es vom Gesichtspunkte der Spionagebekämpfung sei, nimmt dennoch den Flugzeugführern einen wesentlichen Teil ihrer Freiheit und beraubt sie auch eines Mittels, dessen sie für ihre eigene Sicherheit häufig bedürfen. Man sollte mit Bezug auf diese Art von Apparaten etwas liberaler sein, dagegen wird man gegen das Verbot der Mitführung von Sprengstoffen, Munitionen und Waffen nichts einzuwenden haben. Das Bordbuch ist ein Dokument, das häufg seinen Nutz und sein Interesse haben wird, namentlich bei den Freiballons und Lenkluftschiffen, auf denen es während der Fahrt in aller Bequemlichkeit geführt werden kann, je nach Maßgabe der Vorkommnisse und Beobachtungen. Anders aber verhält es sich mit den Flugzeugen, namentlich mit den einsitzigen Flugzeugen. Hier beschränkt sich das „Bordbuch' gewöhnlich auf ein einfaches Notizbuch, in dem einige Notizen mit telegraphischer Kürze vorgenommen werden können, das aber wohl sehr viel weißes Papier aufweisen wird In jedem Falle wird die Befolgung dieser Bestimmung für die Flieger eine große Anzahl zusätzlicher Schwierigkeiten bedeuten und wenn der französische Flieger sich damit zu helfen suchen wird, erst bei Beendigung seines jeweiligen Fluges sein „Bordbuch" abzufassen, dann tun mir schon heute die zukünftigen Bewerber der Pommery- und anderer Pokale leid, die so an einem Tage ihre 12 oder 1500 km zurückgelegt haben No. 398. Burggraf, Hugo, Mainz-Gonsenheim, geb. am 19. August 1891 zu Freiburg i. Br., für Eindecker (Goedecker), Flugfeld „Großer Sand" bei Mainzi am 7. Mai 1913. No. 399. Schlüter, Benno, Dorsten i. W„ geb. am 28. Februar 1893 zu Dorsten i. W., für tindecker (Grade), Flugplatz Gelsenkirchen, am 7. Mai 1913. No. 400. Frhr. v. Gienanth, Eberhard, Fluglehrer, Halberstadt, geb. am 29. August 1866 zu Brüssel, für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 7. Mai 1913. No. 401. Jannsen, Willi, Maschinenbauer, Kronshagen b. Kiel, geb. am 17. April 1891 zu Schrevenborn, für Eindecker (Steffen-Falke), Flugfeld Kronshagen, am 10. Mai 1913. No. 402. Schäfer, Paul Albert, Wissenbach (Dillkreis), Nassau, geb. am 16. September 1890 zu Wissenbach Dillkreis), für Eindecker (Steffen-Falke), Flugplatz Kronshagen, am 10. Mai 1913. No. 403 Ringe, Oskar, Dr. phil., Johannisthal, geb. am 24. Dezember 1884 zu Hannover, für Eindecker (Fokker), Flugplatz Johannisthal, am 19. Mai 1913. No. 404. Stoll, Siegfried, Leutnant, Inf.-Regt. 112, Mülhausen i. E., geb. am 23. April 1886 zu Heidelberg, für Eindecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 20. Mai 1913. No. 405. Hüttig, Bruno, Leutnant, geb. am 27. Oktober 1886 zu Jena, für Zweidecker (Deutsche Flugzeugw.), Flugplatz Leipzig-Lindenthal, am 20. Mai 1913- No. 406. Wentscher, Bruno, Leutnant, geb. am 27. Dezember 1887 zu Stade, für Zweidecker (Deutsche Flugzeugwerke), Flugplatz Leipzig-Lindenthal, am 20. Mai 1913. werden  Rundschau. Inland. Mugführer-Zeugnisse haben erhalten: No. 407. Friedensburg, Leutnant z. S., Johannisthal, geb. am 6. Januar 1889 zu Breslau, für Zweidecker (Ago), Flugplatz Johannisthal am 20. Mai 1913. No. 408. Ballod, Otto, Johannisthal, geb. am 30. Mai 1889 zu Riga, für Eindecker (M.B.-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 20. Mai 1913. No. 409. Lölhöffel von Löwensprung, Franz, Oberlt., Inf.-Regt. 153, geb. am 17. Juni 1881 zu Königsberg i. Pr.r für Eindecker (Rumplertaube), Flugplatz Johannisthal, am 22. Mai 1913. No. 410. Müller, Ludwig, Leutnant, Inf.-Regt. 32, Meiningen, geb. am 29. Juli 1889 zu Wandersleben, Kr. Erfurt, für Eindecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 22. Mai 1913. Von den Flugplätzen. Tom Flugplatz Frankfurt a. M.-Rebstock. Auf dem Rebstöcker Flugplatz haben in letzter Zeit mehrere dort befindliche Flugmaschinen Flüge ausgeführt. U. a. führte am 9. Juni der Flieger Trautwein auf einem Sommer-Pfeil-Doppeldecker mit 70 PS Rotationsmotor unter der offiziellen Kontrolle von Dr. Linke, Neumann und Colin mehrere Flüge aus. Die von der Militärverwaltung verlangte Höhe von 800 m wurde in 7 : 30 Min. erreicht. Von den auf dem Platze ansässigen Konstrukteuren sind zu nennen: Haenlein (Eindecker mit 50 PS Hilz-Motor), Qrebe (Eindecker mit 100 PS Argus-Motor), Ulbrich (Eindecker mit 50 PS Motor der Bayr. Flugzeug- und Motorenfabrik), 2 Euler-Doppeldecker des Frankfurter Flugsport-Club (ein 70 PS Gnom-und ein 50 PS Argus-Motor), von Berg (Eindecker 70 PS R. A. W.-Motor) und ein Doppeldecker mit 60 PS Hoffmann-Rotations-Motor. Auf dem Flugplatz Weimar, der 500X230 m mißt, sind im Monat Mai verschiedene Flüge ausgeführt worden, von denen folgende zu erwähnen sind: Der Grade-Flieger Abelmann veranstaltete an Pfingsten auf seinem Grade^Eindecker (16/24 PS Grade-Motor) Schauflüge. Am 21. Mai landete Lt. v. Thüna auf L. V. G.-Doppeldecker mit 95 PS Mercedes-Motor (Begleiter Lt. v. Falkenhayn) auf dem Flugplatz. Am 22. Mai flog er weiter nach Leipzig und von da nach Döberitz. Am 26. Mai landete Lt. Hüttig (Begleiter Lt. Theim) auf D.F.W. Doppeldecker und flog am 28. Mai weiter. Am 31. Mai vormittags landete Lt. Mühlig-Hoffmann mit Lt. Böhmer als Beobachter auf Fokker-Eindecker auf dem Flugplatz und flog am 2. Juni nach Braunschweig weiter. Flugplatz Gelsenkirchen-Uesen-Kotthausen. Im Monat Mai wurden auf dem Flugplatz Gelsenkirchen-Essen-Rotthausen im ganzen 15 Stunden und 27 Minuten geflogen, die sich auf 23 Flugtage verteilten. Hiervon entfallen auf das Konto des stets fleißigen und sportfreudigen Fliegers Schröter von den Kondorwerken 11 Stunden und 17 Min. Krüger (Grade) leistete am 21. Mai einen Stundenflug, wofür er eine Prämie von 1000 M. aus der Nationalflugspende erhält. Suwelack konnte nur an wenigen Tagen auf dem Platze fliegen, da er inzwischen seinen Ueberlandflug nach Bielefeld machte und außerdem am Prinz Heinrich-Flug teilnahm. Ueber seine Leistungen ist mehrfach berichtet worden. Außerdem flogen noch an einzelnen Tagen Mürau, der nebenher uuch in Güttingen und Marburg Schauflüge veranstaltete, sowie Schlüter, Heiter, Blank, Frl. Müh ring und Schlatt er. Letzterer hat inzwischen auch wieder mit der Ausbildung von Flugschülern begonnen. Der Besuch des Flugplatzes im Monat Mai war ein sehr reger; er beträgt rund 30 000 Personen. _ Der Flieger Alwin Horn ist am 28. Mai auf einem Jatho-Eindecker während eines Ueberlandfluges bei Burgwedel aus 150 m Höhe tötlich abgestürzt Wettbewerbe. Zu dem Rundflug Lübeck—Schwerin—Wismar—Lübeck, über den der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin das Protektorat übernommen hat, haben gemeldet: Stiploscheck (Jeannin-Stahltaube), Schauenburg (D. F. W.-Doppel-decker), Kießling (Ago-Doppeldecker), Ingold (Aviatik), Rosenstein (Zentrale für Aviatik), Fräulein Galanschikoff (Fokker-Eindecker). Der Flug beginnt am 22. Juni mit der Etappe Lübeck-Schwerin (60 Kilometer). Der dritte Flugtag führt die Teilnehmer von Schwerin über Wismar, wo eine Zwangszwischenlandung von mindestens 10 Minuten Dauer vorgeschrieben ist, nach Lübeck zurück. Außer festen Etappenprämien sind für die drei Flieger mit der kürzesten Gesamtflugzeit auf der Strecke Lübeck—Schwerin—Wismar—Lübeck Preise in Höhe von 3000, 2000 und 1000 Mark ausgesetzt. Der Ostpreußische Rundflug, der am 9. August beginnt, ist offen für deutsche und österreichische Civilflieger,^, sowie deutsche Offiziersflieger. Offiziers- und Civilflieger haben getrennt 3^ Etappenflüge auszuführen. Preise insgesamt bis 50000 Mk. Meldeschluß 1. Juli. Nachmeldungen sind bis 15. Juli beim Ostpreußischen Verein für Luftschiffahrt, Königsberg i. Pr. einzureichen. Patentwesen. Oebrauchsmuster. 77h. 546 493. Verwindungsklappen für Tragflächen von Luftfahrzeugen zur Sicherung der Querstabilität. Luftverkehrs-Gesellschaft, Akt.-Ges., Johannisthal b. Berlin. 3. 3. 13. L. 31 374. 77h. 536 622. Flugzeug. Wilhelm HUnn, Selb. 3. 2. 12. H. 59 466. 77h. 546763 Drachenflieger mit übereinander angeordneten Tragflächen. Karl Bomhard, Berlin, Neue Wimerfeldstr. 46. 5. 6. 12. B. 58 754. 77h. 546 814. Flugapparat. Johann Groborsch, Tarnowitz O.-S. 5. 3. 13. G. 32 774. 77h. 537 004. Flugzeug. Engelbert Isphording, Dorsten i. W. 24. 6. 12. J, 12 903. 77h. 547121. Flugapparat mit einer Tragfläche. Union-Flugzeugwerke G. m. b. H., Berlin. 8, 3. 13. U. 4356 77h. 547 122. Flugapparat. Union Flugzeugwerke G. m. b. H, Berlin. 8. 3. 13. U. 4357. 77h. 547 280. Stabilisierungsvorrichtung für Flugzeuge, Staat Kansas, V. St. A.; Vertr.: Hi Wiegand, Rechtsanw , Berlin W. 8. 10. 3. 13. G. 32 809. 77h. 547 530, Befestigung für Bespannungen an Flugzeugen. A. H. G. Fokker, Johannisthal b. Berlin, Parkstraße 18. 5. 3. 13. P. 28 792. 77h. 547882. Seitensteuer für Flugzeuge. E. Rumpier Luftfahrzeugbau G m. b. H, Berlin-Lichtenberg 13. 12. 12. R. 34627. 77h. 547938. Lauf- und Landungsgestell für Land- und Wasserflugzeuge Gustav Otto Flugmaschinenwerke, München. 14. 3. 13. O. 7778. 77h. 547939. Einrichtung zum selbsttätigen Verbinden von einander trennbarer Teile an Flugzeugen. Gustav Otto Flugmaschinenwerke, München, 14. 3. 13. O. 7781. 77h 548414. Abfederung der Laufräder von Flugzeugen. E. Rumpier Luftfahrzeugbau G. m b. H. Berlin-Lichtenberg. 19. 3 13. R. 35470. 77h. 548518. Probierstand für Flugzeugmotoren Daimler-Motoren-Gesellschaft. Stuttgart-Untertürkheim. 30. 9. 12. D. 132S1. 77h. 548890. Automatischer Stabilisierungsapparat für Flugzeuge. Carl Puhlmann, Bernburg, Anhalt. 22. 3. 13. P. 23 321. Zielvorrichtung für Flugzeuge mit fest eingebautem Maschinengewehr nach Patent 248601.*) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zielvorrichtung für Flugzeuge, bei denen ein Maschinengewehr gemäß Patent 248601 in der FTugrichtung fest eingebaut ist. Sie geht von dem Bestreben aus, den Führer des Flugzeugs möglichst zu entlasten, so daß er lediglich die Steuerung zu bedienen und vermittels derselben zu zielen hat, während alles andere, insbesondere die gesamte Bedienung des Maschinengewehrs, einem zweiten Mitfahrenden vorbehalten bleibt. 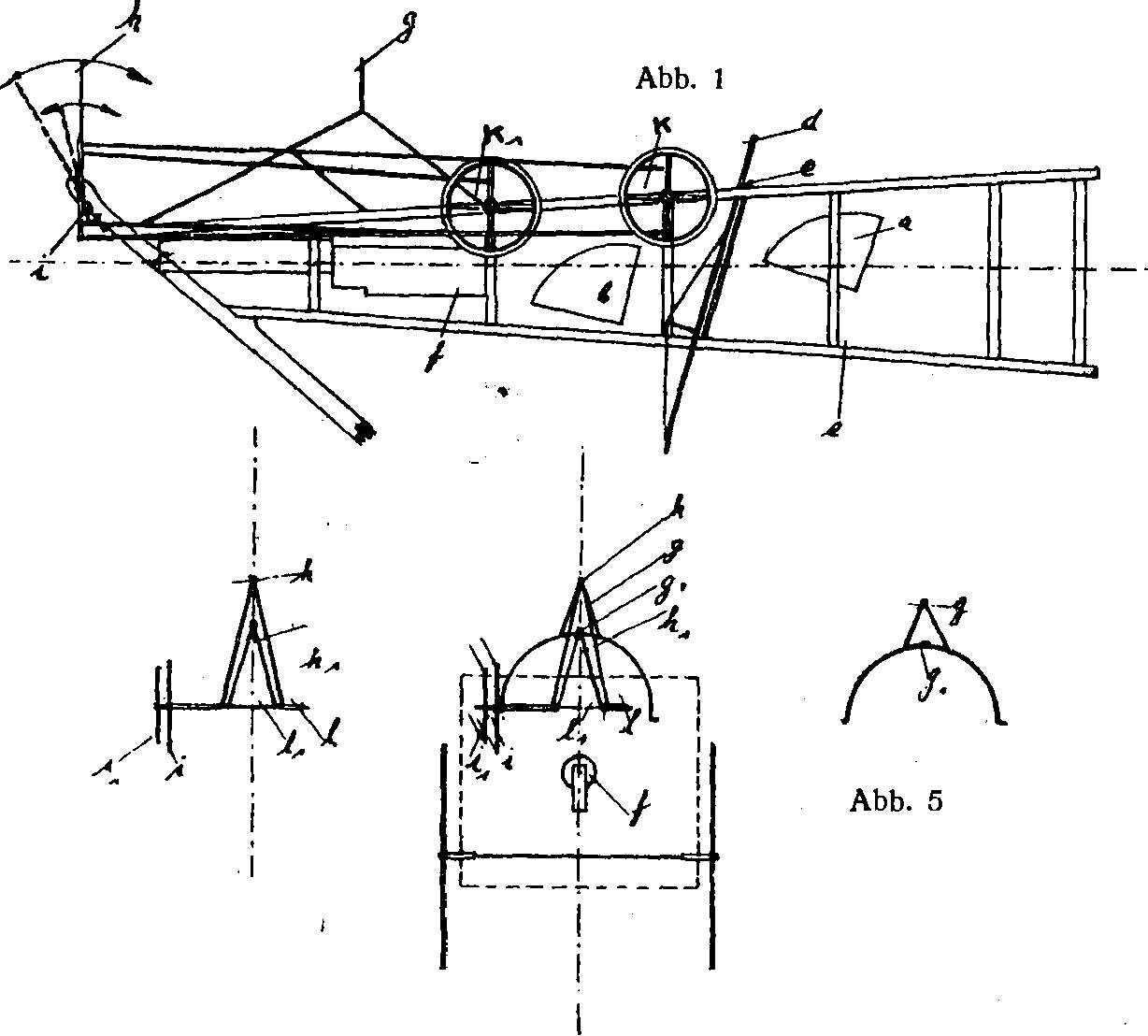 Abb. 4 Abb. 2 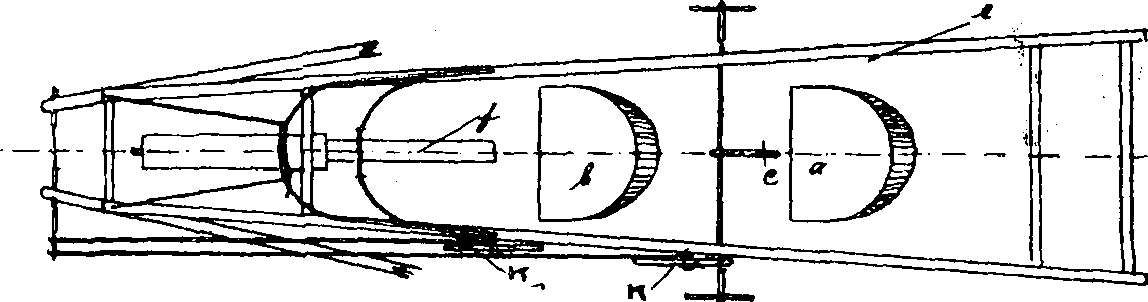 Abb. 3 Dieser Zweck wird durch eine neuartige Zielvorrichtung in Verbindung mit der Gesamteinrichtung des Flugzeugs erreicht, wie aus den beistehenden *) D. R. P. 258 918. August F.uler in Frankfurt a. M.-Niederrad. schematischen Abbildungen sich erhellt. Der Führer des Flugzeugs sitzt auf dem hinteren, etwas höher gelegenen Sitze a und hat die Höhen-, Seiten- und Schräglagensteuer c und d zu bedienen, die in bekannter Weise arbeiten. Vor ihm auf dem Sitze b hat der Mitfahrer seinen Platz. Zwischen seinen Beinen befindet sich das fest in das Anfahrgestell e eingebaute Maschinengewehr f; er hat sonach beide Hände zur Bedienung der Waffe sowie zur Regulierung des Ladestreifens und der Patronenzufuhr frei. Er kann ferner beobachten und sein Augenmerk auf die unmittelbar vor ihm angebrachten Instrumente — den Tourenzähler und den Höhenmesser — sowie auf die Oelgläschen halten. Der vordere Teil des Anfahrgesteils, in dem auch diese Instrumente befestigt sind, ist vermittels einer Art Haube zugedeckt. Auf dem Rande dieser Haube sind nun eine untere Kimme (g bezw. g,) angebracht, von denen g auf das Auge des auf a sitzenden Führers, g, auf das des auf b sitzenden Mitfahrers eingerichtet ist. Am vorderen Ende des Anfahrgestells sitzen die zu diesen Kimmen gehörigen Korne h und h,, die von dem Platz a bezw. b aus vermittels je eines mit einer Skala versehenen Hebels oder Handrades k bezw. kt und einem System von Zügen und Hebeln nach oben oder unten verstellt werden können, je nachdem auf größere oder kleinere Entfernung, aus größerer oder geringerer Höhe geschossen werden soll. Die Abbildungen zeigen eine Ausführungsform, bei der dies dadurch bewirkt wird, daß die Korne h, hn auf ineinander liegenden Röhren 1, 1, sitzen, die vermittels der Hebel i, it gedreht werden können, so daß die Kornspitzen höher oder tiefer zu liegen kommen. Die Hebel i, i, sind durch Drahtzüge mit den Handrädern k, k, verbunden, die mit je einer Skala versehen sind. Beobachtet nun der Mitfahrer auf b einen Feind, so ruft er dem Führer Ziel, Entfernung und Höhe zu, und beide stellen vermittels der Handräder k, k, die Korne h, h, ein. Dann zielt der Führer unter Benutzung von Höhen- und Seitensteucr über Kimme g und Korn h und sucht das Ziel mit diesen beiden und seinem Auge in eine Linie zu bringen. Gleichzeitig zielt der Mitfahrer über Kimme g, und Korn k,. Sobald er nun merkt, daß durch die Manöver des Führers diese beiden mit dem Ziel und seinem Auge in einer Linie liegen, gibt er mit dem Maschinengewehr Feuer. Durch diese zweite Kontrollvisiereinrichtung g„ h, ist es somit dem Mann, der das Maschinengewehr bedient, ermöglicht, im richtigen Moment mit dem Feuer zu beginnen und aufzuhören, obgleich er nicht selbst die das Zielen bewirkenden Steuer bedient. Es ist damit also bei festem Einbau des Maschinengewehrs und Zielen vermittels der Steuerung mit ihren mannigfachen Vorteilen die Trennung zwischen Führung des Flugzeugs und Bedienung des Maschinengewehrs und somit eine Entlastung des Führers ermöglicht Abb. 1 zeigt die Ges'amtanordnung von der Seite, Abb. 2 von oben gesehen. Abb. 3 stellt beide Visiereinrichtungen von vorn gesehen, Abb. 4 die Korne, Abb. 5 die Kimmen allein dar. Patent-Ansprüche: 1. Zielvorrichtung für Flugzeuge mit fest eingebautem Maschinengewehr nach Patent 248601, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem vorderen Teil des Anfahrgestells zwei je aus Kimme und Korn bestehende Visiereinrichtungen angebracht sind, von denen das obere auf den erhöht hinten sitzenden Führer, das untere auf den vorn tiefer sitzenden Mitfahrer, der das Maschinengewehr zu bedienen hat, eingestellt ist, zu dem Zwecke, dem letzteren zu ermöglichen, festzustellen, wann der Führer das Geschütz vermittels der Steuerung richtig eingestellt: hat-und er selbst daher Feuer geben muß. 2. AusfühVungsform wie zu 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Korne der Visiereinrichtungen sowohl des Führers wie des Mitfahrers von deren Plätzen aus vermittels je eines mit Skala versehenen Hebels oder Handrades je nach Höhe und Entfernung des Zieles verstellt werden können. Verschiedenes. Berliner Flugsportverein. In dem durch zahlreiche Wandtafeln illustrierten Vortrage über Maschinenflug und Vogelflug hob Baumeister GustavLilicnthal den Unterschied hervor, welcher zwischen dem Flugsystem unserer Drachenflieger und dem Vogelflug besteht. Es ging hieraus die Unzulänglichkeit des Anpassungsvermögens der Flugmaschinen zu den wechselnden Ansprüchen des Windes hervor, wogegen der Vogel diesen Anforderungen völlig gewachsen ist. Der Vogel ist im ,,Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XVII. Buttler-Eindecker. Amerikanisches Rekord-Modell. 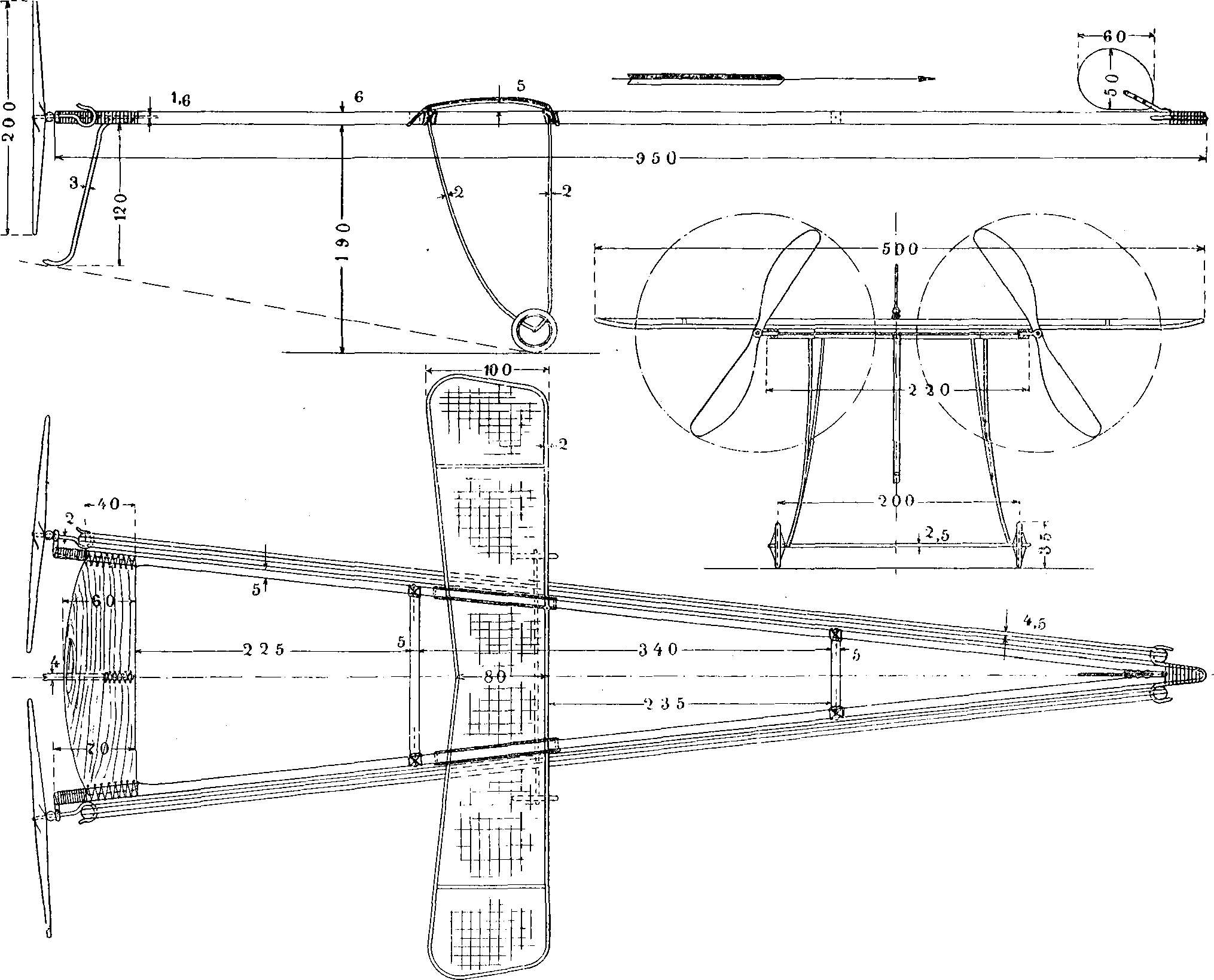 Nachbildung verboten. Stande, seine Flügelstellung in jedem Augenblick seitlich, nach vorn oder nach hinten zu verschieben und das Areal seiner Flügelflächen zu verringern oder zu vergrößern. Eine große Ueberlegenheit besitzt der Vogel durch den Vorwärtstrieb, welchen die Vordrehbarkeit des ganzen Flügels resp. der Schwungfedern zwischen dem Auf- und Niederschlag erzeugt gegenüber dem Vortrieb durch ein besonderes Organ, die Luftschraube. Dieses Flugsystem der Drachenflieger war in der Vogelwelt im Urvogel vertreten, dessen Vortrieb sich auch durch ein spezielles Organ vollzog. Wie Redner an der Hand vorzüglicher Zeichnungen nach der Eichstädter Platte des Archäopterix schlagend nachwies, geschah der Vortrieb durch den breit gefiederten langen Wirbelschwanz mittels flunderartiger Bewegungen. Heute haben wir im fliegenden Fisch einen Vertreter dieser Flugart, welcher gleichfalls sich durch die Schwanzbewegungen im Wasser so viel Geschwindigkeit gibt, daß er durch die ausgebreiteten Flossen nach dem Herausschnellen aus dem Wasser getragen wird. Die Flossen bilden hierbei leicht gekrümmte Trageflächen. Sehr interessant waren auch die Gleitflugerklärungen, die sich an die sagenhaften Flüge des Daidalos und Ikaros knüpften. Das Thema der nächsten Vorlräge am 18. Juni wird speziell über den Segelflug handeln, und es werden dabei ganz neue Experimente vorgeführt werden, durch welche es erklärlich wird, wie durch den Einfluß des Windes nicht nur Tragewirkungen, sondern auch Vorwärtsbewegungen auf den Vogel mit bewegungslosem Flüge! ausgeübt werden. Zum Schluß forderte Redner zur Bildung einer Vereinigung auf, die den Vogelflug zum Gegenstand spezieller Studien machen soll. Es wurden zahlreiche Beitrittserklärungen abgegeben und dem Redner Beifall ausgedrückt. Die Centrale für Aviatik in Hamburg, deren Schuppen im Vorjahre durch Feuer vernichtet wurden, hat eine allen Anforderungen der Neuzeit entsprechende neue Schuppenanlage errichtet. Die 3 nebeneinander liegenden Schuppen sind durch große Schiebetore verschlossen. Die beistehende Abbildung zeigt die Neubauten während der Eröffnung.  Die Flugzeughallen der Centrale für Aviatik in Hamburg. Der 100 PS Stahlzylinder Motor der Flugmotorenfabrik Deutschland G. m. b. H., München, wurde vor einigen Tagen mehreren Dauerversuchen unterworfen. Der Versuchsmotor war einer jetzt zur Ablieferung kommenden Serie entnommen und lief zweimal 7 Stunden ununterbrochen, nachdem eine sechsstündige Vorprüfung vorausgegangen war. Der Motor lief somit 20 Stunden mit voller Belastung im Freien am Stand mit Schubpropeller. Die Lufttemperatur betrug 29° C„ die Kühlwassertemperatur 90" C, der Benzinverbrauch 33 1 und der Oel verbrauch 1,5 1 pro Stunde. Berichtigung. E. von Gorrissen hat während der Flugwoche in Johannisthal nicht einen Otto-Doppeldecker, wie wir berichteten, sondern einen in den Ago-Flugzeugwerken hergestellten Ago-Doppeldecker geflogen. 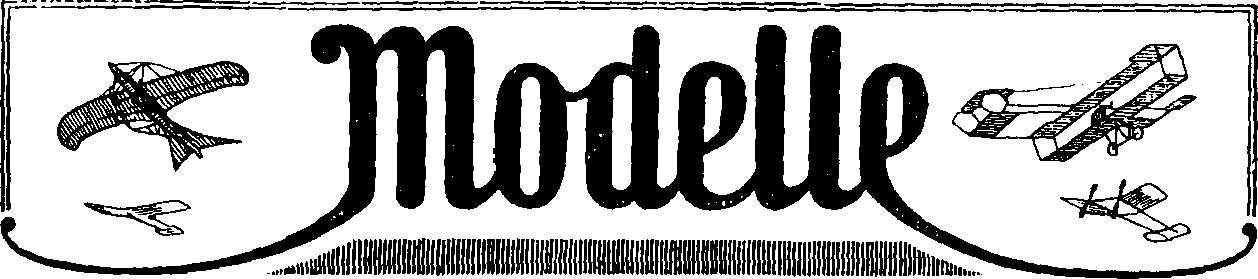 Der Buttler-Eindecker, das amerikanische Rekord-Modell von Californien. (Hierzu Tafel XVII). Dieses Modell System „Buttler", zeichnet sich durch Einfachheit und große Flugweite aus Wie aus Tafel XVII ersichtlich, ist das Modell 950 mm lang und 500 mm breit. Die Tragflächen haben die Form des Deperdussin Renneindeckers. Sie sind aus Stahldrahtrahmen mit Rohseidebespannung hergestellt und unverspannt. Die Gummimotoren bestehen aus 6 Gummisträngen von 4, 5 qmm Querschnitt, die Schwanztragfläche ist aus einem dünnen Fournierbrettchen hergestellt. Das Gewicht beträgt 1,55 kg. Das Modell soll eine größte Flugweite von 315 m bei einer Flughöhe von 45 m erreichen. Das Modell ist an Hand beiliegender Tafel leicht nachzubauen. 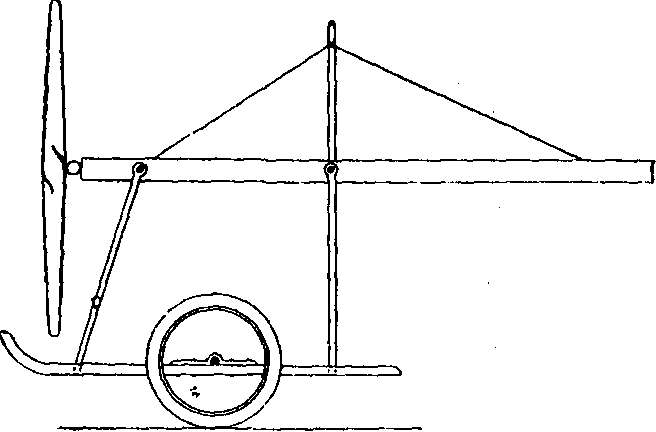 Ein festes Fahrgestell für Modelle. Das Fahrgestell (Abb. 1) eignet sich für jeden Rumpf, ist sehr widerstandsfähig und außerordentlich leicht herzustellen. Man schnitzt sich aus einem Stück Birnbaumholz (das sich wegen seiner Härte besondersdazu eignet) die beiden Kufen aus und befestigt darauf vermittels kleiner Schrauben die Lager für die Radachse. Dann verschafft man sich vier Radspeichen, an denen sich ein Gewinde befindet und schneidet sie entsprechend der Größe des Propellers zu. Die eine Seite macht man dann glühend, schlägt sie etwas breit und bohrt ein kleines Loch hindurch Darauf schraubt man die Gewinde in die Kufen, biegt das obere Ende der Speichen ein wenig um, wodurch man die gespreizte Stellung erhält, und schraubt sie an den Rumpf des Modelles. Das übrig gebliebene Ende einer Speiche benutzt man als Radachse. 2 cm von deren Enden lötet man einen Drahtring auf, schiebt die Achse durch die Lager auf den Kufen und lötet die Räder auf, nachdem man eine Perle zwischen Kufe und Rad auf die Achse geschoben hat. Auf diese Weise erhält man Abb. 1 ein äußerst stabiles Fahrgestell, das den Propeller vor jeder Beschädigung bewahrt und jeden Stoßdämpfer entbehrlich macht. Ich hoffe, daß der Leser nach Zeichnung und Beschreibung arbeiten kann. Schlange. 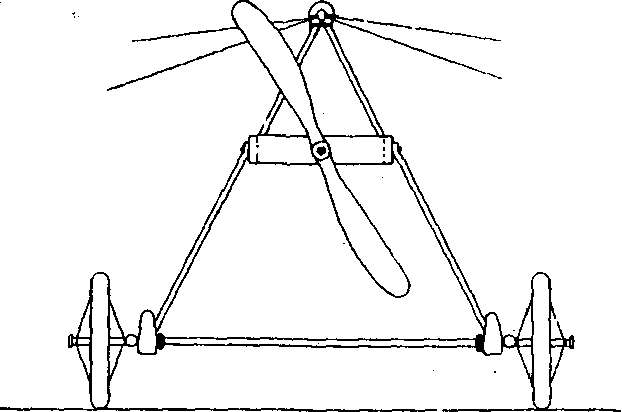 Wie man am einfachsten die Festigkeit des Motorstabes erhöht. Der Hauptholzstab wird gleich der Länge der Gummistränge längs durchschnitten, zweimal, sodaß vier Stäbchen entstehen, die an ihren Enden verwachsen sind. (Siehe Abb. 2 gestrichelte Linie) Dann werden die einzelnen Stäbchen in der Mitte auseinandergebogen und vier kleine Klötzchen von höchstens Selbstdicke des Stäbchens zwischengeschoben. Ist der in vier Stäbchen zerschnittene 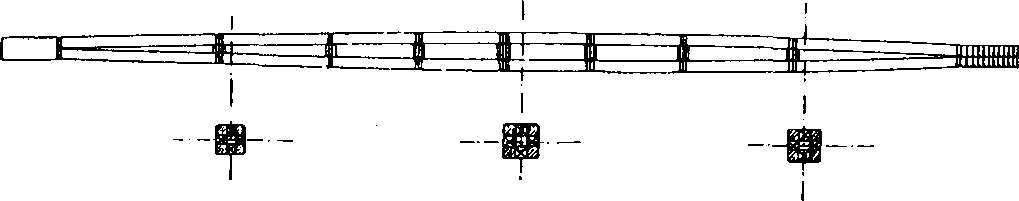 Abb. 2 Stab sehr lang, so schiebt man zu beiden Seiten des einen noch zwei andere Klötzchen ein. Dieselben werden fest verleimt, mit einer Lage Garn umwickelt und mit Schellack bestrichen. Hierdurch erhält man ein äußerst festes Ganze, das bei Anwendung eines doppelten Gummimotors (zu beiden Seiten) nicht verspannt zu werden braucht. Decker. Aufwindvorrichtung für Mehrpropeller-Modelle. In Abb. 3 ist die Aufwindvorrichtung von Edward W. Colver, dem Präsidenten des Sheffield Model Aero Club, bildlich dargestellt. Auf einem Konsol befindet sich eine große Antriebsscheibe von der zwei Rundriementransmissionen ausgehen. Dieselben führen nach zwei kleinen Rollen, die an den Enden von zwei Auslegern angebracht und ihrerseits um die Achse der Antrieb-scheibe drehbar sind. An den Enden der Ausleger befinden sich Riemenspanner, um einen gleichmäßigen Zug zu erreichen Die Propeller werden mittels einer uhrenschlüsselartigen Aufsteckvorrichtung festgesteckt und durch Antrieb von der Hauptscheibe Abb. 3 aufgezogen. Eine andere Aufwindvorrichtung ist die in Abb 4 dargestellte von W. H. Norton. Dieselbe besteht aus einem Kegelradvorgelege mit Ueber-setzung ins große. An den Enden der angetrie- Abb. 4 benen Wellen befinden sich Löcher, in welchen die Endhaken der Gummischnürbefestigung eingehakt werden. Durch Antrieb des großen Kegelrades mittels Kurbelgriff werden die beiden Gummischnüre gegenläufig aufgezogen. Nach erfolgtem Aufwinden werden die Gummischnurhaken ausgehakt und gegen das Befestigungsblech des Modelles arretierend widergelegt. Ein neuer Modell-Benzin-Motor. Zum Antriebe der Luftschrauben größerer Flugmodelle von 2 bis 3 m Spannweite wurden bisher meistens Gummischnüre oder Preßluftmotore (Abb. 1 u. 2) verwendet, deren beste Konstruktionen indessen nur eine Flugdauer des Modells von einer Minute erzielten. Sollen jedoch längere Flüge ausgeführt oder Beobachtungen und Messungen im fliegenden Modell gemacht werden, so genügt weder Gummi noch Preßluftmotor und ein Benzinmotor ist erforderlich. 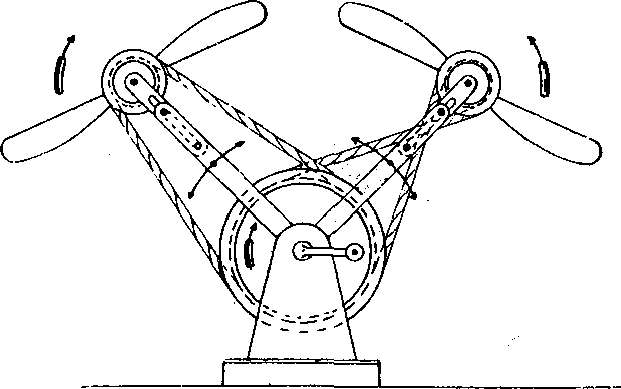 Einen zuverlässig arbeitenden leichten Benzinmotor hat Max Braune, Leipzig-R. konstruiert. Das Gewicht des V, PS Motors beträgt betriebsfertig mit Vergaser, Zündspule und Batterie nur 2 kg. Versuche in Rußland haben nachfolgende Umlaufzahlen mit normalen zwei-flügligen Liftschrauben ergeben: 70 cm Propeller 900 Touren 60 „ „ 1100 50 „ „ 1400 Ohne Propeller nur mit kleinem Schwungrad macht der Motor 2000 Umdrehungen per Minute. Bei 70 cm Luftschrauben ist eine Schwungmasse nicht 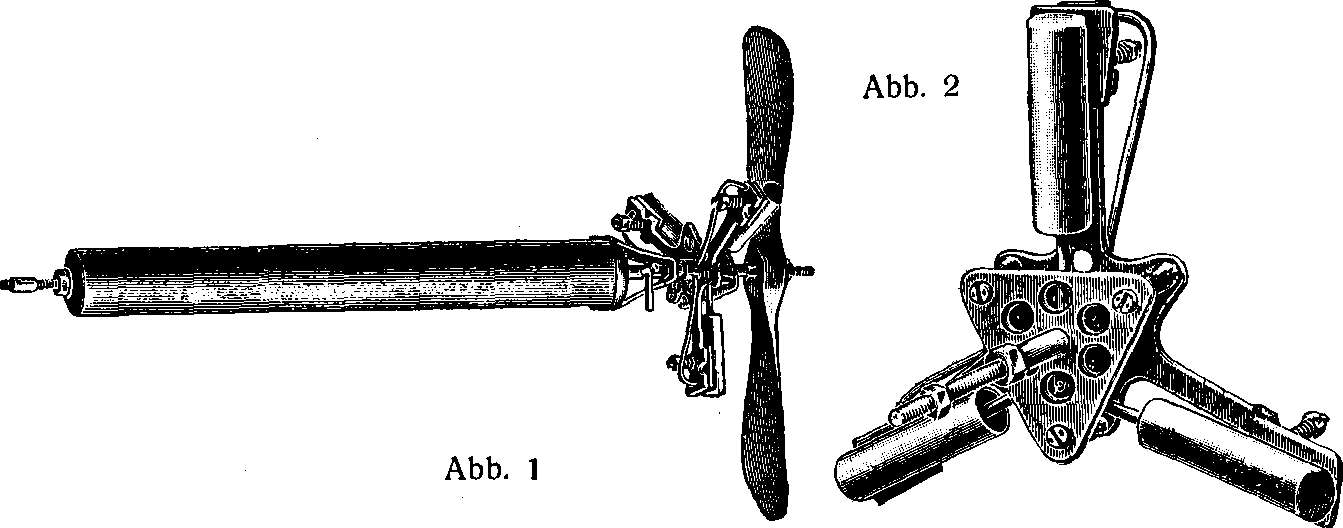 erforderlich, bei kleineren Schrauben beschwert man den Propeller am besten mit kleinen Bleigewichten oder stellt den Propeller ev. gleich aus Aluminiumguß her. Der Motor arbeitet im 4-Takt und wirken die Kolben zweier in V-Form stehender Cylinder auf eine gemeinsame Kurbelwelle (Abb. 3). Die Zündung erfolgt mittels Zündspule und Taschenbatterie und ist verstellbar auf Vor- und Nachzündung. Durch eine besondere Steuerung wird erreicht, daß die Zündungen in nahezu gleichen Zeitabständen erfolgen und somit 1 Krafthub pro Umdrehung erzielt wird Die Vergasung erfolgt in einem kombinierten Tropfvergaser, welcher zugleich Benzinbehälter ist und Benzin für 15 Minuten Laufdauen aufnehmen kann. Abb. 3 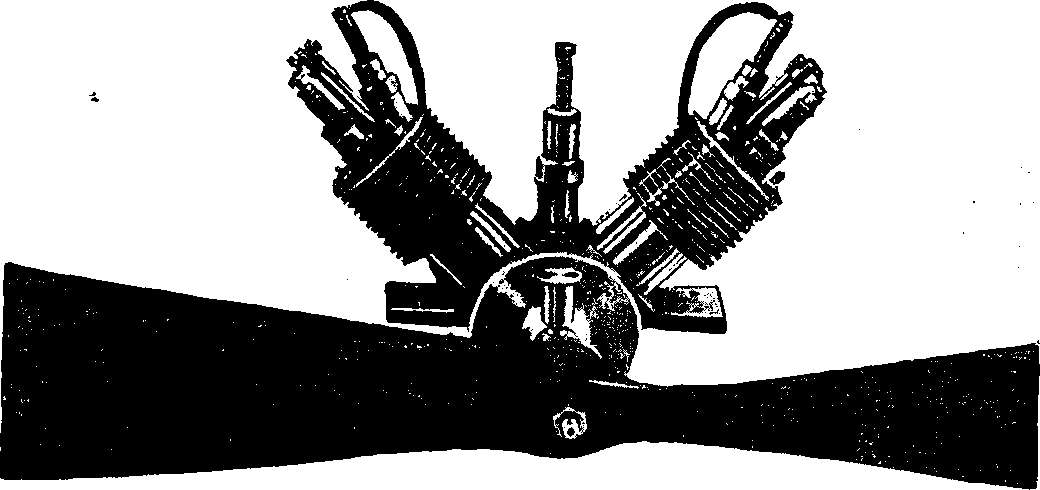 Soll der Motor für Schwingenflieger oder zum Antrieb von Schlagflächen dienen, so kann ein kleines Schwungrad auf die Welle gesetzt werden. Die Bedienung ist denkbar einfach und besteht im Oelen, Benzineinfüllen, Anwerfen und Touren regulieren. Von obiger Firma werden auch 1 PS Motore 4 kg schwer hergestellt, welche für 80 cm bis 1 m große Luftschrauben bestimmt sind. Sicherlich dürfte der Benzin-Motor großen Anklang bei ernsten Modellbauern finden und dazu beitragen, auch genaue wissenschaftliche Beobachtungen am fliegenden Modell ausführen zu können. Gleitflieger im Modellflugsport. Anlässig der 1. Berliner Modellflugzeug-Ausstellung konnte der Besucher die Beobachtung machen, daß fast alle Apparate, flugfähige, wie solche, die gänzlich unfähig dazu waren, mit Antrieb versehen sind, ganz abgesehen von den Reduktionsmodellen. Nur selten zeigte sich ein antriebsloser Apparat, der dann im Katalog mit der Bezeichnung Gleitflieger versehen war. Betrachtete man diese Produkte näher, so bemerkte man, daß man es fast durchweg mit ganz minderwertigen Fabrikaten zu tun hatte, ausgenommen ein paar nachgebildete Zanonia-flächen, die Interesse am Gleitfluge erkennen ließen. Von den übrigen Gleitfliegern waren höchstens 4 oder 5 Stück genügende Konstruktionen. Es ist ja leicht verständlich, daß der Modellbauer nach einem Apparat strebt, der sich selbst erheben kann und dann eine Strecke fliegt, aber ich möchte doch ein warmes Wort für den Gleitflieger einlegen. Erstens lernt der Modellbauer beim Bauen von Gleitmaschinen sehr viel. Er lernt slabile, richtig ausbalancierte Flugmaschinen bauen und vor allem eine peinliche Symmetrie einhalten Er lernt erst richtig den Wert der Tragflächen kennen und die Wirkung von Steuerungs- und Stabilisierungsflächen. Man verfällt jedenfalls nachher nicht in den Fehler, „geflügelte Motore" zu bauen, die rasend durch die Luft schießen und dann abstürzen, aber nie fliegen. Zweitens hat der Gleitfheger den Vorteil, daß er sehr billig ist, da ja der Antrieb gespart wird. Es wäre sehr zu wünschen, daß auch bei Modellwettfliegen Wettbewerbe für Gleitflieger eingerichtet werden, denn hier entscheidet die Maschine und nicht der Motor. Man baut solche Maschinen am besten ganz aus gespaltenem Bambus und kleiner als 80 cm Spannweite. Man halte bich zuerst an bestehende Konstruktionen. Anlehnungen an Wright, Fokker und Bleriot liefern sehr gute Gleitflieger, während ich zu „Tauben" nicht raten kann, wenn sie auch sehr stabil sind. Sie erreichen nie sehr kleine Gleitwinkel. Den Vorwurf, daß der Modellflugsport langweilig sei, muß ich zurückweisen. Jedenfalls bietet er weit mehr Anregung als die Rennen mit dem „flying stick". Man muß natürlich entsprechende Höhen 20—30 m haben, von wo man aber sehr schöne Flüge in Winkeln bis zu 5° mit der Erde erreicht. Aber wo befinden sich kleine Sandgruben oder kleine Hügel? Noch etwas über das „Ablassen". Man werfe den Gleitflieger niemals nach vorn in die Luft, sondern lasse ihn einfach aus der Hand rutschen und gebe nur soviel nach, als man fühlt, daß der Apparat nach vorn zieht. Dabei muß die Längsachse des Apparates ungefähr in einem Winkel von 30° nach unten geneig) sein. Ein stabiles Flugzeug wird dann einen bestimmten Winkel einnehmen und in ruhigem Flug der Erde zusteuern. Fliegt das Modell nicht in gerader Linie, so sind die Flügel oder die Steuerorgane schief eingestellt und müssen gerichtet werden. Für den Motorflug lernt man jedenfalls sehr viel dabei und vermeidet viel Aerger und Kosten.__ W. Sch.  Die Modelle des Frankfurter Flugmodell-Vereins, die am letzten Wettflug teilnahmen. Seite 455 „FLUGSPORT." No. \z Frankfurter Flugmodell-Verein. Sonntag den 17. August findet der Uebermainflug statt. Die Ausschreibungen werden in der nächsten Nummer des „Flugsport" veröffentlicht. Vor kurzem wurden die Herren August Euler, Ing. Ursinus, Prof. Wachsmuth, Heinrich Colin, R. Behle und W. Rühl zu Ehrenmitgliedern ernannt. Das nächste Modell-Uebungsfliegen findet Sonntag den 15. Juni vormittags von 7—11 Uhr auf dem Gelände der ehemal. Rosenausstellung statt. Am Nachmittag desselben Tages veranstalten die auf dem Flugplatz am Rebstock ansässigen Flieger ein Schaufliegen, an dem sich auch der F. F. V. mit Modellen beteiligen soll. Die Mitglieder werden deshalb gebeten, recht zahlreich mit Modellen zu erscheinen. Wir bitten die Mitglieder, rechtzeitig ihre Beiträge an Herrn Adolf Jäger, Rotteckstraße 2 zu senden. Anmeldungen und Anfragen nimmt der Vorsitzende Fritz W i tteki n d, Eppsteinerstraße 26 entgegen. Firmennachrichten. Die Harlan-Werke G. m. b. H. 6ohannisthal haben Anfang Mai ein Zweigunternehmen gegründet unter der Firma „Harlan Verkaufs- und Betriebs-Gesellschaft m. b. H." welches sich unter Ausschluß der Fabrikation mit dem Ein- und Verkauf von Flugzeugen, mit der Ausbildung von Flugschülern und der Beteiligung an Schauflügen und Wettbewerben befassen soll. Die Firma Harlan-Werke bleibt weiter bestehen, wird aber in Zukunft nur noch Flugzeuge konstruieren und herstellen. Das neue Unternehmen verfügt über Activa von insgesamt Mk. 265000.  ' ' . ~~ Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.) A. K. Die genauen Maße des Richter-Gleitfliegers können wir Ihnen nicht angeben. Am besten wenden'Sie sich persönlich an den Konstrukteur. (Adresse: Hans Richter, Berlin S.W. 61, Blücherstraße 14). Lehmann. Einen mathematischen Nachweis Uber die zu jeder Tragfläche gehörige Wölbungstiefe gibt es vorläufig noch nicht. Man stützt sich hierbei auf empirische Resultate von Laboratoriumsversuchen. Näheres hierüber finden Sie im „Bendemann, Luftschrauben-Untersuchungen", „Lilienthal, der Vogelflug" und „Eiffel, Resistance de l'Air", übersetzt ins Deutsche von Dr. Hutti, „Der Luftwiderstand und der Flug". W. W. O. Schwimmer für Wasserflugmodelle werden bei kleinen Dimensionen aus Kork hergestellt, mittlere Modellschwimmer fertigt man aus Fournier von 1 bis l'/a mm Stärke an, welche mit wasserfestem Lack bestrichen und mit leichtem Stoff überzogen werden. Grosse Modellschwimmer werden am besten aus verzinktem Stahldrahtgerüst mit wasserdichter Stoffbespannung hergestellt. Literatur.*) Mechanische Grundlagen des Flugzeugbaues Bd. I und II. von A. Baumann. Verlag Oldenbourg, München-Berlin, Preis pro Bd. 4 — M. Das von Professor A. Baumann herausgegebene Werk behandelt die mechanischen Vorgänge eines Flugzeugs von den einfachsten bis zu den kompliziertesten Fällen. Auf Grund seiner Laboratoriumsversuche hat er einfache Formeln für den Auf- und Rücktrieb an Tragflächen ermittelt. *) Sämtliche besprochenen Bücher können durch die Expedition des „Flugsport" bezogen werden. Querstabilität und Seitensteuerung- von Flugmaschinen. Dissertation von Dipl.-Ing. Karl Gehlen, Verlag Oldenburg, München 1913. Die vorliegende Doktordissertation handelt in der Hauptsache von der Theorie der kleinen Schwingungen. Es werden auf Grund der allgemeinen Bewegungsgleichungen Kriterien auf Stabilität eines Flugzeugs abgeleitet und dieselben rechnerisch ergründet. Besonders interessant ist die rechnerische Behandlung unserer heutigen automatisch stabilen Flugzeuge. Handbuch für Flugzeugkonstrukteure von Camillo Haffner. Verlag Richard Carl Schmidt & Co., Berlin 1913, Preis 8.— M eleg. geb. Das vorliegende Buch kann als ein wichtiges Nachschlagewerk für Flugmaschinenbauer bestens empfohlen werden. Der Verfasser hat sehr gewissenhaft das schwierige Thema behandelt, und sich insbesondere darauf beschränkt, die komplizierten Rechnungsmethoden zu vermeiden, um dieselben nach Möglichkeit durch Ubersichtliche Tabellen, Diagramme und konstruktive Vorschläge zu ersetzen. Man kann daher dieses Buch sowohl Laien als auch Fachleuten bestens empfehlen. Letzte Nachrichten. Brindejonc des Moulinais' Flug Paris-Warschau. Brindejonc, der Chefpilot der Morane-Saulnier-Werke, flog um den Pommery-Pokal am 10. Juni vormittags 5 : 04 Uhr von Issy-les-Moulineaux ab, machte um 9 : 45 Uhr eine Zwischenlandung in Wanne und landete um 12 : 04 Uhr auf dem Flugplatz Johannisthal. Um 3: 37 Uhr flog Brindejonc in östlicher Richtung nach Warschau ab, das er um 7 Uhr abends erreichte. Brindejonc flog mit Rückenwind mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 200 km pro Stunde. Die Gesamtflugstrecke Paris-Warschau, 1430 km, hat demnach Brindejonc, die Zwischenlandungen abgerechnet, in ca. 10 Stunden zurückgelegt. 1 Eindecker, neu mit 3 Zyl. Hilz - Motor mit Magnetz. Art Grade mit Kufen, führe im Fluge vor, wegen Krankheit für (1050) Mk. 2200.— zu verkaufen Angebote u. D. Z. 883 an Haasenstein & Vogler A.-G., Cöln. Flugmotoren Mercedes, Argus, Gnome liefern prompt und preiswert Centpale für Aviatlk Johannisthal bei Berlin Parkstr. 18 Tel. Oberschöneweide S71 bild. zum Berufsflieger aus? Off. unt. F. P. N. 9527 an Rud. Mosse, Frankfurt a.M. Verlangen Sie gratis den Katalog über meine neuen D. R. G. M. für Flugzeugmodell. Der vollendete Gummi- antrieb iür Modelle D. R. G. M. Neue Propeller und Endhaken D. E. G. M. Multiplicatoren für Rennflugzeuge D. R. G. M. Neu! Schwimmer Neu! Fordern Sie Bedingungen für den Flugzeugmodell- und photographischen Wettbewerb 1913. G. SCHILLING Berlin C 2  -6 Zylinder- Mercedes = Fliegermotor 100 PS ungebraucht, sofort lieferbar. Anfragen unt. 1048 an die Exped. des Blattes.  No. 13 25. Juni 1913. Jahrg. V. Kreuzband M. 14 Postbezug M. 14 pro Jahr. Jllustrirte technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnement: für das gesamte „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef.4557ftmtl. Oskar Ursinus, Civilingenieur. Tel.-Adr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. .. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. - Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit gen an er Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 8. Juli. Bodensee-Wasserflug 1913. Nächsten Sonnabend, den 28. Juni, beginnt die einzige diesjährige Wasserflug - Veranstaltung, der Wasserflug am Bodensee. In den Fabriken, die durch die Landwettbewerbe überlastet sind, ist an den Wasserflugzeugen in den letzten Tagen mit Hochdruck gearbeitet worden. Die wenigsten Maschinen sind auf einem Binnensee ausprobiert. Man sieht, wie begründet es war, den Wettbewerb, damit die Maschinen in ihrem Entwicklungsstadium erst ausprobiert werden können, auf einen Binnensee zu verlegen. Man hätte der Industrie und der Entwicklung des Wasserflugzeugs nicht genützt, wenn man die nicht ausprobierten Maschinen auf die hohe See gezwungen hätte, um sie zu versenken. Es wären hierbei nicht nur wirtschaftliche Werte vernichtet worden, sondern der Industrie wäre genau so wie in Frankreich, die Lust an dem Wasserflugzeugbau vergangen. Jedenfalls sollte die Industrie, ganz gleich ob Konvention, oder nicht Konvention, in Zukunft mehr wie im vergangenen Jahre nur das durchführen, was ihr förderlich erscheint und sich nicht durch die sogenannten Fachleute, die in der großen Mehrzahl keine solchen sind, beeinflussen lassen. Auch dies mußte hier endlich mal gesagt werden, denn jeder, der einmal irgend einen Artikel über Wasserflugwesen geschrieben hat, sieht sich als Autorität an. Auch hierüber muß die Industrie wachen. Denn das Flugwesen ist ja doch nun schließlich ihre Sache und nicht zuletzt ihre Existenz. Es wäre sehr zu wünchen, daß bei dem nächstjährigen unter dem Protektorat der Nationalflugspende zu veranstaltenden Wettbewerb etwas Auslese gehalten wird. "Verschiedene Veröffentlichungen in der Tagespresse von diesen Nichtfachleuten tragen nicht dazu bei, das Ansehen unserer Industrie im Ausland zu stärken. Jedenfalls ist zu verwundern, daß die Industriellen sich hiergegen noch nicht gewandt haben. Die Franzosen haben bekanntlich ihre Ansprüche auch bedeutend zurückgeschraubt. Monaco hat gezeigt, daß sie einen falschen Weg betreten haben und daß mit der Wasserflugmaschine in der bisherigen Form die Schwierigkeiten nicht überwunden werden können. Man hat vorsichtiger Weise vor dem französischen Marine-Wettbewerb einen Streckenflug auf die Seine gelegt, der am 24. August beginnt. Nur mit Mühe und 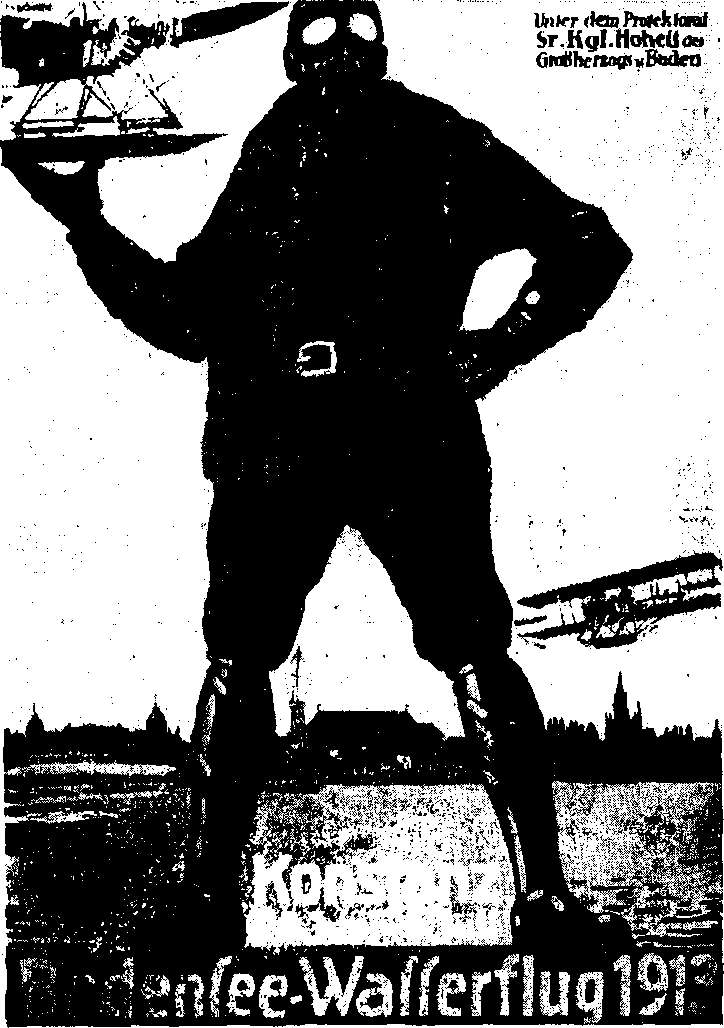 Not und unter Aufwendung hinter den Kulissen angewendeter Zwangsmittel hat man es schließlich so weit gebracht, daß verschiedene Firmen wenigstens eine Maschine in den Wettbewerb entsenden, meistenteils auch die bekannten Typen von Monaco, da man keine Lust hat, nach den französischen Marinebedingungen, worin u. a. der lakonische Satz zu lesen ist „Diejenigen Maschinen, die untergehen scheiden aus dem Wettbewerb aus" sein Geld auf hoher See zu verlieren. Nach den diesjährigen planmäßigen Arbeiten in Deutschland und vor allen Dingen auf Grund der wichtigen Direktiven, die unser Reichs-Marine-Amt gegeben hat, glaube ich behaupten zu dürfen, daß unsere Konstrukteure, nach den vorhandenen Konstruktionen zu urteilen, einen gangbaren Weg beschritten haben. Vielleicht macht sich hier und da die Einwirkung des Motorbootbaues ungünstig be- merkbar. Aus einer Landflugmaschine läßt sich nicht ohne weiteres eine Wasserflugmaschine machen und die Veraussetzungen, die für ein Motorboot maßgebend sind, sind andere wie die für eine Wasserflugmaschine. Während ein Motorboot den Seen folgt und fortgesetzt seinen Neigungswinkel ändert, ändert die Flugmaschine mit ihrem Gleitkörper, da sie durch die Luft geführt wird, ihren Neigungswinkel nur in geringen Grenzen. Würde sie ihren Neigungswinkel sehr verändern, so würde sie entweder sehr steil in die Höhe steigen oder ins Wasser schießen. Die Dämpfungen sind so groß, daß sie es nicht tut. Sie wird daher von Wellenberg zu Wellenberg springen und an die Wellenköpfe anstoßen, die durch eine geeignete Schwimmerkonstruktion überwunden werden müssen. Und da liegt der Kern- 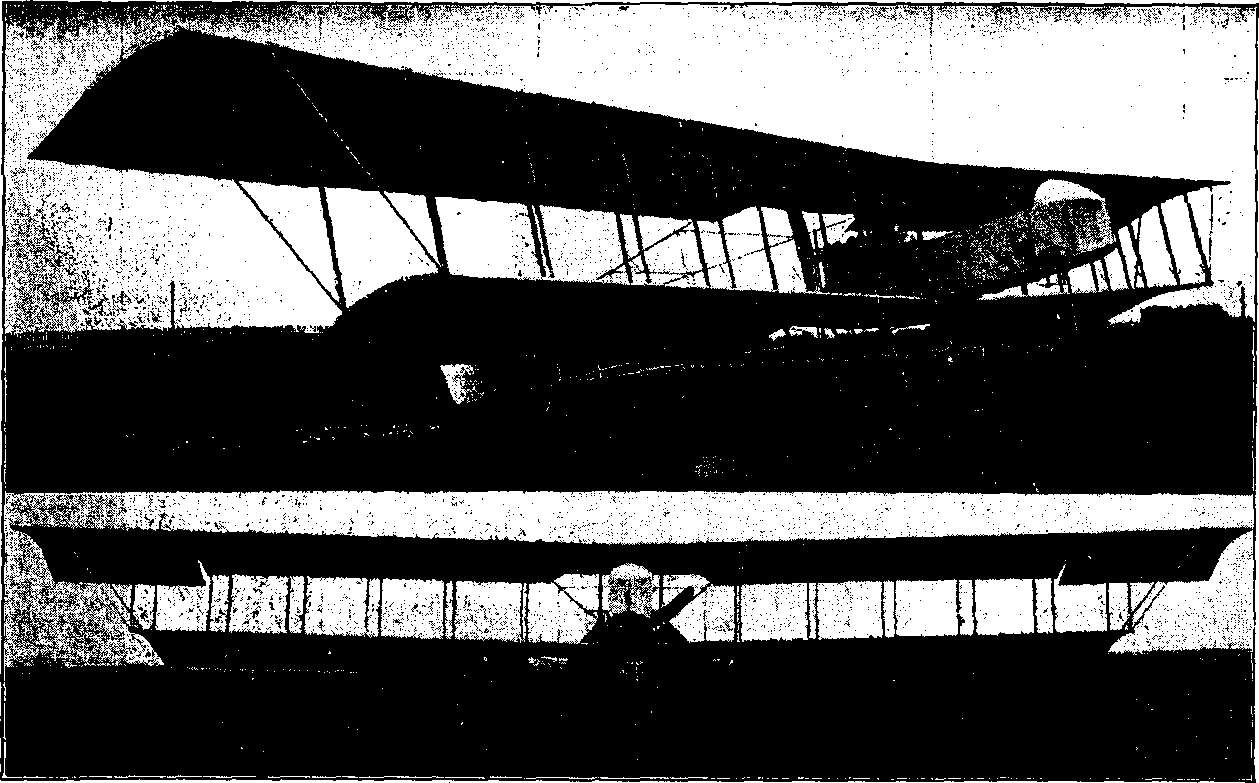 Bodensee- Wasserflug 1913. Wasserzweideäter der Gothaer Waggonfabrik. punkt. Man sieht, die Wissenschaft der Motorbootkonstrukteure hat die Flugzeugkonstrukteure auf eine falsche Fährte gewiesen. Das zeigte sich überall in Monaco, wo die bekanntesten Motorbootkonstrukteure mitgeholfen hatten. Dieses Kapitel soll nach Erledigung des Bodensee-Wettbewerbs an dieser Stelle ausführlich besprochen werden. * * * Mehrere Maschinen, wie die der Gothaer Waggonfabrik, von Gustav Otto und der Automobil- und Aviatik-Akt.-Ges. waren bereits am Montag in Konstanz eingetroffen, um dort ausprobiert zu werden. Die Ausschreibungen für den Bodenseewasserflug sind bereits in Nr. 9 wörtlich zum Abdruck gelangt, so daß es sich hier erübrigt, auf die Einzelheiten einzugehen. Für den Flug um den Großen Preis vom Bodensee ist auf dem Wasserflugplatz vom Land zu starten, die Kontrollstellen Eomans-horn, Arbon und Bregenz zu überfliegen, im Bojenviereck bei Lindau zu wassern, den Motor abzustellen, den Motor wieder anzudrehen, abzuwassern, die Kontrollstelle am Wasserflugplatz zu passieren, eine weitere Runde über die oben erwähnten Kontrollstellen auszuführen und in Konstanz zu wassern. Wenn man die hierbei gestellten schwierigen Aufgaben berücksichtigt und wenn nur einige Maschinen die gestellten Aufgaben erfüllen, so sind wir einen großen Schritt vorwärts gekommen. Nebenbei sei bemerkt, daß die Wasserverhältnisse und nicht zum wenigsten die Windverhältnisse auf dem Bodensee nicht die günstigsten sind. Die für den Wettbewerb gemeldeten Maschinen gehen aus nachstehender Tabelle hervor.
Von den vertretenen Maschinen fallen mehrere durch ihre außerordentlich exakte und saubere Werkstattarbeit auf. Auch sehen wir, wie auf verschiedene Weise die gestellten Aufgaben zu überwinden versucht wurde. Es wird für die Fachleute besonders interessant sein zu sehen, wie sich die einzelnen Konstruktionen bewähren. Das Wasserflugzeug der Flugzeugwerke der Gothaer Waggonfabrik A. G. in Gotha ist ein Doppeldecker von 20 m Spannweite und nur 10,5 m Länge bei einer Höhe von nicht ganz 4 m. Während die Tragflächen und die Stützen zwischen ihnen aus Holz hergestellt sind, besteht der kurze Schwanz aus Stahlrohr. 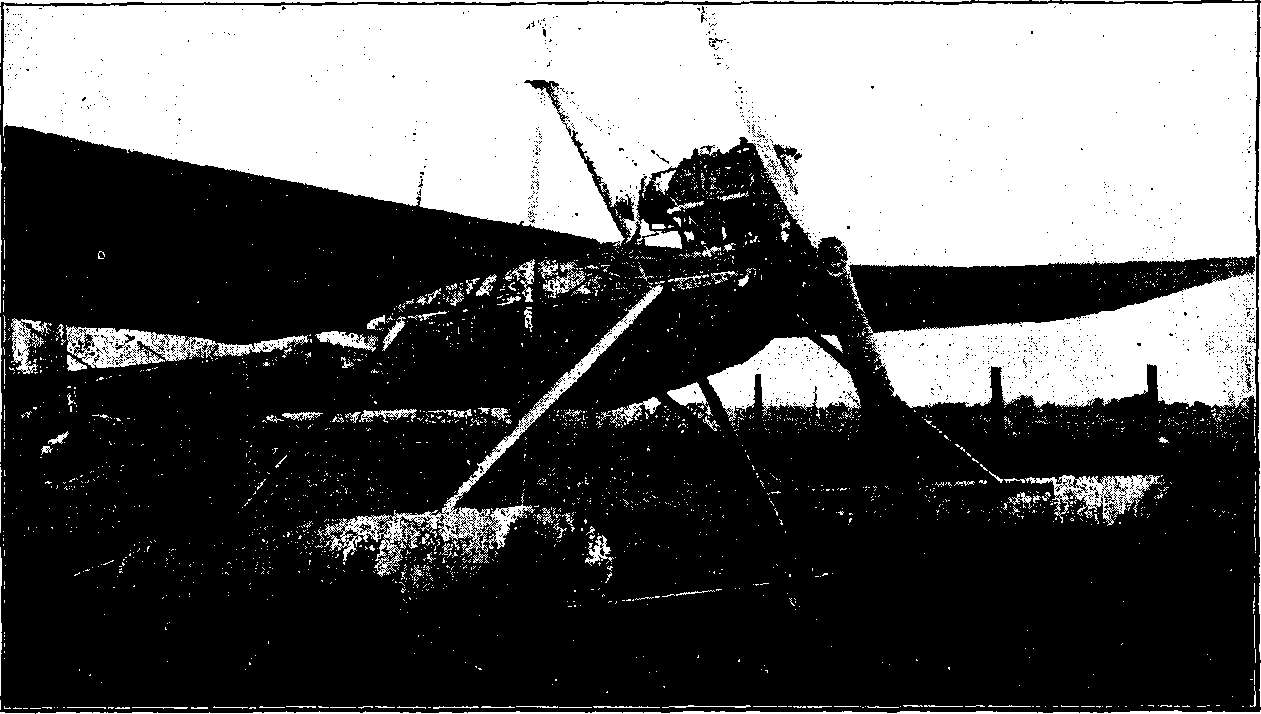 Bodensee- Wasserflug. Strack- Wasser-Eindecker. 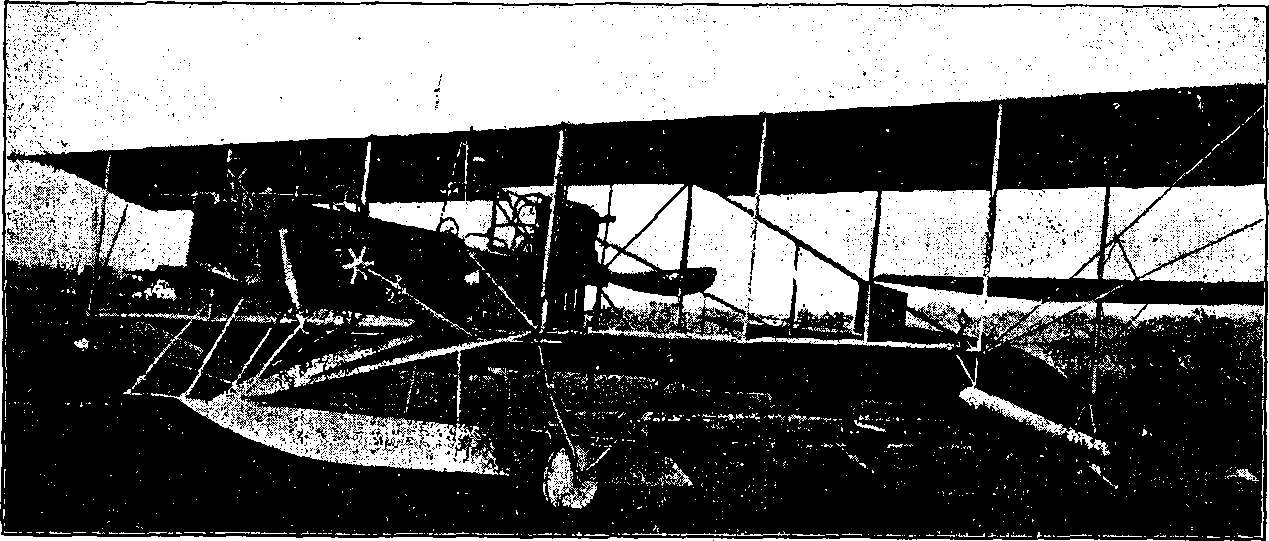 Bodensee- Wasserflug. Wasser-Zweidecker d. Flugzeugbau Friedrichshafen. Führer und Passagier sitzen in einer geräumigen Karosserie vor und über der unteren Tragfläche. Vor dem Führer sind die nötigen Instrumente auf einem Brett sehr übersichtlich montiert. Das Benzingefäß, welches Betriebsstoff für reichlich 4 Stunden aufnehmen kann, ist in Stuhlform ausgebildet und dient für den Begleiter als Sitz. Hinter dem Begleiter ist der 100 PS 6 Zylinder Mercedes-Motor mit Stahlzylindern gelagert, der eine Chauviere-Schraube antreibt. Der Motor kann vom Begleiter mit einer Handkurbel durchgedreht und vermittels eines Aulaß-Bosch-Magneten angelassen werden. Die beiden „Hazet"-Kühler liegen rechts und links vom Motor. Das Höhensteuer ist zweiteilig und in der Höhe der oberen Gurtung des Schwanzgestänges an der horizontalen Stabilisierungs-fläche angelenkt. Zwischen den beiden Höhensteuern bewegt sich ein großes Seitensteuer. Der größeren Stabilität auf dem Wasser wegen werden zwei große Schwimmer mit je einer titufe und ein kleiner Notschwimmer am Ende des Schwanzes angebracht. Da der Apparat mit Schwimmer ohne Betriebsstoff und ohne Personen nur etwa 750 kg wiegt und die Tragflächen sehr guten Auftrieb haben, soll der Versuch gemacht werden, die verkleideten Räder beim Start auf dem Wasser in dasselbe eintauchen zu lassen. Sollte wider Erwarten der Widerstand der Räder im Wasser zu groß sein, so können die beiden Räder auch hochgezogen werden. Bei dem Strack-Wassereindecker wird nicht das Fahrgestell, sondern das Wassergestell hochgehoben. Das Landgestell steht fest. Die nebenstehende Abbildung läßt erkennen, wie die beiden Schwimmer nach den beiden Seiten hochgeschwenkt werden können. Nach dem Aufstieg vom Land kann der Flieger mittels Kurbel das Wassergestell niederlassen. L>ie Schwimmer werden auf diese Weise ""sehr tief niedergebracht, so daß beim Wassern kein Teil des Apparates mit dem Wasser in Berührung kommt. Diese Bauart hat ferner den Vorteil, daß der Apparat auf dem Lande niedrig und auf dem Wasser sehr hoch steht, im Gegensatz zu der Anordnung mit hochziehbaren Rädern. Der Eindecker besitzt bei 13 m Spannweite 28 qm Tragfläche. Die Gesamtlänge beträgt 8 m, das Gesamtgewicht ohne Führer 400 kg. Die Flugzeugbau Friedrichshafen G. m. b. H., welche in Manzell am Bodensee in der alten Zeppelinhalle ihre Werkstätten hat, sendet zur Bodenseekonkurrenz einen Sporteindecker, Type F 8, und und einen Rennzweidecker F 9, die sich von den in nebenstehenden Abbildungen nicht wesentlich unterscheiden. Der S p or tein decker F 8 mit seinen schmalen langen Flügeln und dem breiten Schwanz ähnelt einer Möve in Gleitflugstellung und fällt besonders durch seine elegante Linienführung und durch seine solide Flügelkonstruktion auf. Die Spannweite des.....Flugzeugs beträgt 13 m, die tragende Fläche 22 qm. Er ist mit einem 70 PS Argusmotor ausgerüstet und hat bei einem Betriebsgewicht von 620 kg eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 95 km per Std. Die zwei neben- 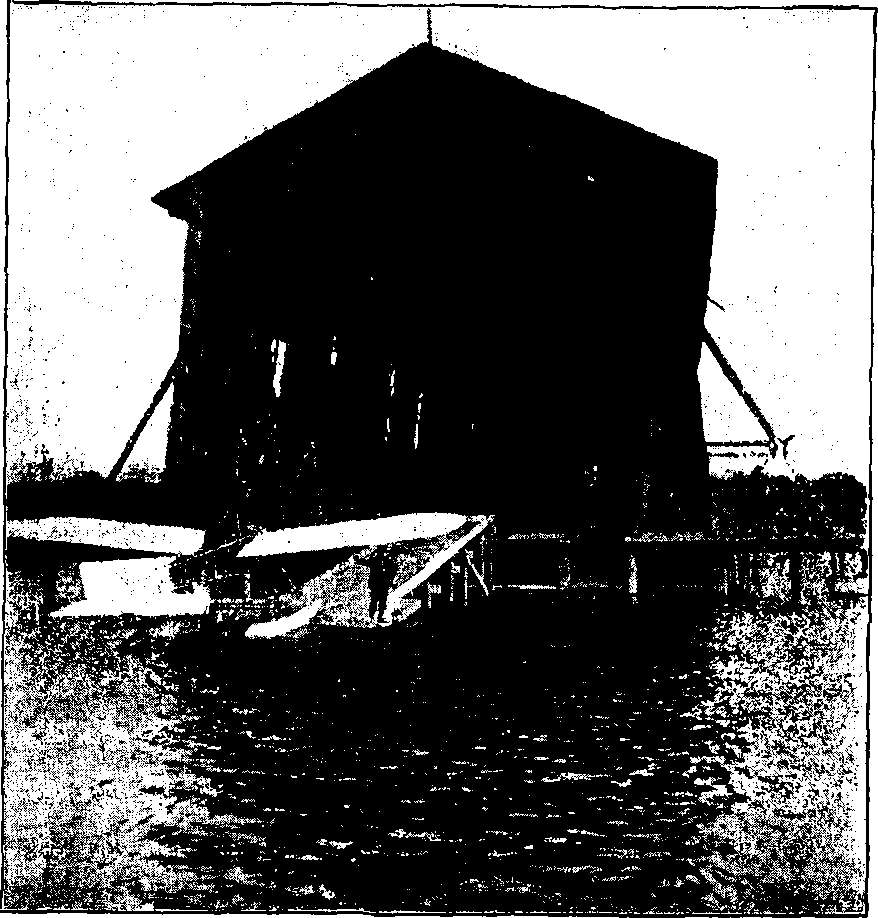 Bodensee- Wasserflug. Wassereindecker d. Flugzeugbau Friedridishafen. 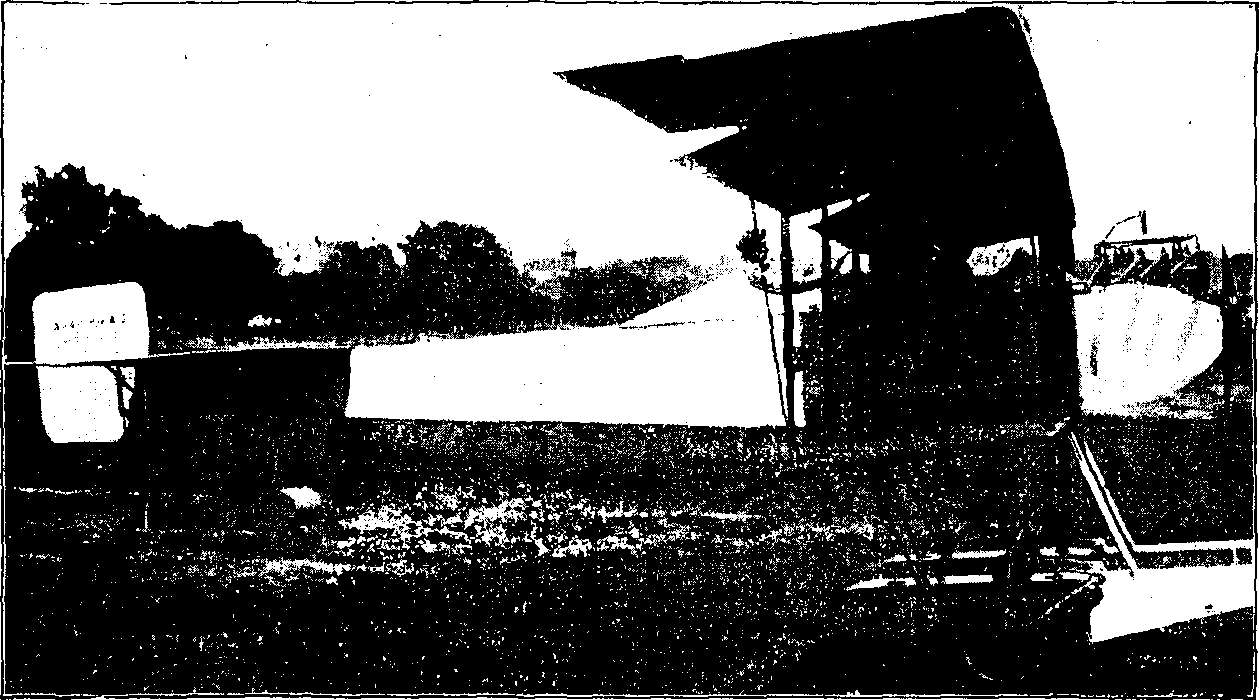 Bodaisee- Wasserflug. Aviatik Doppeldecker mit vorn liegendem Motor. eiuanderliegenden Stufen-Gleitschwimmer mit ihrer federnden Aufhängung gestatten ein leichtes Abwassern und ein Hilfsschwimmer am Schwanzende sichert ein ruhiges Liegen auf dem Wasser. Die geschlossene Karosserie, die vorn blos die Motorzylinder freiläßt, schließt sich hinter dem Führersitz an den verkleideten Rumpf an, wodurch der schädliche Luftwiderstand verringert wird. Die Steuerung entspricht der bei der deutschen Marine üblichen. Der Rennzweidecker F 9 ist aus der bekannten Type F 1 der Flugzeugbau Friedrichshafen hervorgegangen, besitzt aber einige wesentliche Neukonstruktionen und ist in den Details verfeinert worden. Das Flugzeug zeichnet sich durch seine Festigkeit bei verhältnismäßig geringem Gewicht aus. Es wiegt leer 850 kg und trägt eine Nutzlast von 400 kg. Die obere Tragdecke hat eine Spannweite von 15 m, die untere von 10 m, beide besitzen zusammen eine tragende Fläche von 42 qm. Ein 140 PS N.A.G.-Motor treibt eine hinter den Tragdecken befindliche Druckschraube direkt an und erteilt dem Flugzeug eine Geschwindigkeit bis zu 115 km/Std. Ein unter dem vollständig verschalten frei vorgebauten Rumpf zentral angeordneter Stufen-Gleitschwimmer ermöglicht ein außerordentlich rasches Hochkommen vom Wasser. An den äußeren Enden der unteren Tragdecken befindliche Hilfsschwimmer dienen zur Erhaltung des seitlichen Gleichgewichts bei Ruhelage auf dem Wasser. Das Flugzeug ist mit einem hochziehbaren Fahrgestell versehen, dessen Winde vom Flieger wie vom Begleiter leicht bedient werden kann. Die Automobil- und Aviatik Akt.-Ges. ist mit zwei Doppeldeckern verschiedener Systeme vertreten und zwar durch einen mit hinten liegenden und einen mit vorn liegendem Motor. Der Doppeldecker mit vorn liegendem Motor besitzt 18 m Spannweite, die sich durch Abklappen der seitlich überragenden Enden auf 13,6 m verkleinern läßt. Die Gesamtlänge mißt 9,4 m, die Höhe 3,8 m. Zum Betriebe dient ein 4-Zyl. 120 PS Argus-Motor. Das Hauptgewicht wird durch zwei Schwimmer mit sehr hoher Stufe getragen. Das Fahrgestell ist hochziehbar eingerichtet. Zur Unterstützung des hinterlastigen Gewichtes dient ein flacher von der Seite gesehen tropfenförmiger mit Kufen versehener Holzschwimmer. Wir werden auf die Konstruktion dieser Einzelheiten sowie sämtlicher Maschinen in der nächsten Nummer ausführlich zurückkommen. Die Aviatik -Maschinen machen durchweg einen guten Eindruck und zeigen saubere Werkstattarbeit. (Fortsetzung folgt.) Der Nieuport-Wasser-Eindecker. (Hierzu Tafel XVIII.) Die Erfolge von Tamise und teilweise auch die des letzten Monacoer Meetings haben in Frankreich den Nieuport-Wasser-Eindecker in den Vordergrund des Interesses gerückt. Die Marine hat auch mehrere derartige Apparate angekauft. Der Aufbau ähnelt in seiner konstruktiven Durchführung der Landmaschine. Das Hauptgewicht wird von zwei Doppelschwimmern, die unsern Lesern bereits aus früheren Veröffentlichungen bekannt sind, getragen. Um eine möglichst große seitliche Schwimmstabilität zu erzielen, sind die beiden Schwimmer sehr weit auseinander gelegt. Die wichtigsten Einzelheiten der Ma- fT schine gehen aus der Tafel XVIII hervor. Die Verbindung zwischen Rumpf und Schwimmer wird durch ein im Dreiecksverband aus Stahlrohr hergestelltes Strebensystem bewirkt. In dem stufenförmigen Vorderteil des Rumpfes ist ein 14 Zyl. 100 PS Gnom- f Motor, auf dessen Welle eine Schraube von 2,6 m Durchmesser sitzt, eingebaut. Infolge der starken Beanspruchung der Schraube und des Motors ist der Motor doppelt gelagert. In der Mitte des Rumpfes befinden sich die beiden Sitze für die Insassen. Die Steuerung ist die bekannte Nieuportsteuerung und wurde von uns ausführlich im „Flugsport" No. 5 Jahrgang 1912 Seite 169 beschrieben und bildlich dargestellt. Die Tragflächen haben entgegen den früheren Ausführungsformen eine Bleriot ähnliche Form. Auf Grund von Versuchen mußte von der ursprünglichen Trapezflügelform Abstand genommen werden, weil die Wirkung der Verwindung für die schwere Maschine zugering war. Bei einer Spannweite von 12 m haben die Tragflächen 24 qm Flächeninhalt. Am verjüngten Rumpfende befindet sich im Grundriß gesehen eine nierenföxmige Schwanztragfläche von 3,3 qm. Davon entfallen 2,8 qm auf die Dämpfungsfläche und 1,5 qm auf das Höhen-steuer. Senkrecht zur Schwanztragfläche sind zwei 0,7 qm große Kielflächen angebracht, die das Schlingern auf dem Wasser verhindern sollen, wenn eine Sturzwelle einen von beiden Schwimmern zurückzuhalten sucht. Unter der Schwanzfläche befindet sich e;n tropfenförmiger Stützschwimmer aus Aluminiumblech. Das zugeschweifte Seitensteuer von 0,6 qm Flächeninhalt ragt über die Kielflächen hinaus und ist wie die übrigtn Schwanzflächen aus autogen verschweißtem Stahlrohrrahmen mit wasserdichter Stoffbespannung hergestellt. Das betriebsfertige Gewicht der Maschine beträgt zirka 700 kg, wobei eine Geschwindigkeit von ca. 100 km pro Stunde erreicht wird. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Die allgemeine Aufregung war glücklicherweise umsonst. Das bang erwartete und von allen Fliegerinstanzen in Frankreich entschieden verurteilte ? Match Garros-Audemars hat denjenigen Verlauf genommen, den wir in unserem vorigen Berichte vorausgesagt haben. Die „haarsträubenden Kunststücke", welche der schlaue Herr Impresario „dem hochverehrten Publikum" verkündigt hatte, haben ihre Schuldigkeit getan: mehr als 30,000 Zuschauer hatten sich nach JiWisy begeben, um dem grausigen Schauspiel beizuwohnen; aber die beiden Flieger beschränkten sich in der Tat, auf Evolutionen, wie man sie tagtäglich auf allen Flugfeldern sehen kann. Zuerst kam das „Match" über 60 km. die Audemars in 27:24, 1 Min. zurücklegte, während Garros dann erst 44 km zu verzeichnen hatte. Dann kam ein Aufstieg-Geschwindigkeitsbewerb, der folgendes .Resultat ergab: Audemars, 1530 Meter in 6:30; Garros 1300 Meter. Und endlich brachte das Programm den Landungsbe-werb, wobei es sich für die Flieger darum handelte, in möglichster Nähe eines vbrbestimmten Punktes zu landen. Auch hier schlug Audemars mit 21 Metern seinen Rivalen, der in 51 Meter Entfernung von jenem Punkte landete. Daß beide Flieger einen identischen Apparat (Morane-Eindecker, 80 PS Gnom) steuerten, ist schon früher gesagt worden. Natürlich hatten andere, ernstere Flugleistungen ein weit höheres Interesse zu beanspruchen, namentlich der grandiose Flug von Paris nach Warschau und Petersburg, den Brindejonc des Moulinais auf seinem Moräne Eindecker in voriger "Woche um den „Pommery-Pokal" unternommen hat. Daß Brindejonc seine Absicht,-an einem Tage die ganze Distanz zu durchfliegen, nicht durchgeführt hat, kann nicht verwundern; wir hatten schon in der vorigen Nummer ausgeführt, daß höchstens die 1400 km-Distanz von Paris bis Warschau an einem Tage, zwischen Sonnenaufgang und -Untergang, wie es das Reglement des Pokals vorschreibt, zu realisieren sein wird. Und Brindejonc hat sie wirklich realisiert. Am Dienstag, den 10. Juni, flog der wagemutige Moraneflieger um 4 Uhr früh von Villacoublay ab und wandte sich nach Osten. Er vollbrachte den Flug von Paris bis Warschau in folgenden drei Etappen: 1. Paris— Wanne, 475 km, 2:50 (mittlere Geschwindigkeit: 168 km die Stunde); 2.1 Wanne—Berlin 440 km, 2:09 (mittlere Geschwindigkeit: 205 km die Stunde). 3. Berlin—Warschau 520 km, 2:50 (mittlere Geschwindigkeit: 178 km die Stunde. Er hat die Gesamtdistanz von 1435 km in 8 Stunden 9 Minuten hinter sich gebracht. Uebrigens hat Brindejonc am vergangenen Sonntag seinen Flug von Warschau nach der russischen Hauptstadt fortgetzt, nachdem erinWilna eine Zwischen- landung vorgenommen und in Dünaburg beim Landen seinen Apparat beschädigt hatte, sodaß er erst am nächsten Tag in Petersburg eintraf. Auch dort war er Gegenstand mannigfacher Ehrungen seitens des Aero-Klubs, der Fliegeroffiziere, sowie des Kaisers selbst, der ihn mit einem Orden auszeichnete. Brindejonc hat am Sonntag die Strecke "Warschau — "Wilna—Dwinsk, 560 km. und am Montag Dwinsk —Pskow—Sankt Petersburg, 500 km, zurückgelegt, sodaß er in drei Tagen eine Strecke von insgesamt 2450 km durchflogen ist. Freilich kommt nur die Leistung des ersten Tages für den „Pommery-Pokal" in Betracht. Aber auch sonst sind interessante Vorgänge aus dem hiesigen Flugwesen zu melden: Vor allem der spannende Kampf um den Michelin-Pokal 1913, bei dem ein bis dahin unbekannter Flieger, der Deperdussinpilo* Cavelier eine hervorragende Leistung vollbracht hat. Cavelier, der einen Eindecker der genannten Marke, 50 PS Le Rhöne-Motor, steuert, unternahm am letzten Montag seinen ersten Flug um den Pokal; er umkreiste die Rundstrecke Etampes-Gidy, welche ein Ausmaß von 111 km hat, achtmal, sodaß er 888 km zu seinen Gunsten hat e. Bekanntlich verlangt das Reglement dieses Pokals, daß der Flieger bis zum 1. Januar 1914 die weiteste Distanz auf geschlossener Rundstrecke, mit einem Minimum von 2000 km, durchfliegt, wobei die jeweilige Tagesleistung nur dann in Anrechnung kommt, wenn eine Mindestgeschwindigkeit von durchschnittlich 50 km erzielt ist. Cavelier hatte bei diesem Fluge viel mit der Hitze zu kämpfen. Am Tage darauf nahm Cavelier den Flug wieder auf, wobei er die Strecke neunmal zurücklegte, also weitere 999 km hinter sich brachte Am Mittwoch brachte es Cavelier auf 2062 km. Mit großem Interesse verfolgte man auch den Rekordkampf, den Prevost auf seinem Deperdussin-Eindecker 140 PS Gnom-Motor, auf dem Flugfelde der Champagne unternahm Auf einer 10 km Flugstrecke legte er sechszehn Runden zurück und stellte dabei am 17. Juni folgende neue Weltrekords auf: 50 km in 16:43-4 (bish. Rekord: Vedrines, 17,35) 100 km in 33:30-2 (bish. Rekord: Vedrines, 35:16-2) 130 km in 43:38-4, was einer mittleren Geschwindigkeit von 179 km entspricht. (Der 150 km-Rekord verbleibt mit 52:59-4 Vedrines.) Die schnellste Bahnrunde legte Prevost in 3 Minuten 20 Sekunden zurück, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 180 km gleichkommt. Gilbert flog am Montag auf einem Morane-Eindecker um das Kriterium des Aero-Klubs, dessen Reglement bekanntlich in diesem Jahre eine Aenderung erfahren hat. "Während früher der längste Flug über einem Flugfelde verlangt wurde, bestimmt das diesjährige Reglement, daß der Bewerber, von irgend einem Flugplatze abfliegend, den weitesten Flug über Land, auf einer Strecke von 500 km hin und 500 km zurück auszuführen hat, wobei die Distanz durch einen Ergänzungsflug ober- halb des Flugplatzes verlängert werden kann, indessen ist eine Zwischenlandung untersagt. Gilbert verließ Villacoublay bei prächtigem Wetter und langte auf dem Flugfelde von Crois d'Hins (bei Bordeaux) an, das er zweimal umkreiste, um sich wieder zurück nach Paris zu wenden. Unterwegs aber wurde er von einem starken Gewitter überrascht, das ihn zwang, in Poitiers zn landen, von wo er schließlich nach Villacoublay zurückkehrte. Wenn demnach dieser Flug auch für das Kriterium nicht zählt, so ist doch die Flugleistung Villacoublay-Bordeaux-Villacoublay, 1050 km an einem Tage, und 700 km ohne Zwischenlandung, immerhin ansehnlich. In dieser Woche sind auch wieder zwei Kanalüberqucrungen ausgeführt worden: Gaudron flog von Le Crotoy, mit einem Passagier an Bord eines für die englische Admiralität bestimmten Zweideckers, ab und landete glücklich in Sheerneß. Der Engländer Wilson flog von Hardelot aus mit einem Bleriot-Eindecker nach dem Flugplätze von Hendon in 1: 30. Von sonstigen Flügen, die hier lebhaftes Intresse erweckt haben, seien erwähnt1 der Flug über die Antillen des kubanischen Fliegers Domingo Rosillo, welcher auf einem Morane-Eindecker, 50 PS Gnom, in 2:04 von Key West nach Havannah, eine Distanz von 180 km über das Meer hin, zurücklegte. Der bekannte Flieger Beaumont vollbrachte dieser Tage auf einem Wasserflugzeug Donnet-Leveque an der Newamündung interessante Fbag-evoiutionen und flog, mit einem Passagier, von Petersburg nach Cronstadt. Deroye begab sich, mit seinem Mechaniker an Bord, in genau zwei Stunden von Rom nach Florenz und auch au^ Spanien werden interessante Flugleistungen gemeldet wobei besonders bemerkt sei, daß die spanische Heeresverwaltung den Obersten Vives mit der Organisation, mit der energischeu Organisation des Flugwesens betraut hat. Das militärische Programm sieht für das kommende Jahr die Anschaffung von zahlreichen Wasserflugzeugen und die Einrichtung mehrerer Flugzentren vor, und da Spanien eine Flugzeugindustrie nicht hat, wird es für die ausländischen Industrien ein ansehnliches Absatzgebiet werden. Daß die vorerwähnten großartigen Flugleistungen die Franzosen mit besonderem Stolz erfüllen, ist allerdings begreiflich. Doch ist es von Interesse, zu wissen, wie man hier den heutigen Stand des internationalen Flugwesens auffaßt. Man schätzt das Flugwesen anderer Länder außerordentlich gering ein und leistet sich eine Kritik, welche nicht nur ungerecht, sondern maßlos überhebend ist. Ein führendes hiesiges Fachblatt stellt die bisherigen großen Flugleistungen zusammen und meint: „Und was tut inzwischen das Ausland ? Es beobachtet uns, und das ist alles, was es tun kann. Seit den Tagen der Bleriot, der Farman, der Ferber sind die Ausländer nicht müde geworden, uns zu kopieren. Und wir in unserer Naivität haben sie kopieren lassen. Eine ganze Horde von Plünderern verfolgte unsere Rennen und Bewerbe, unsere 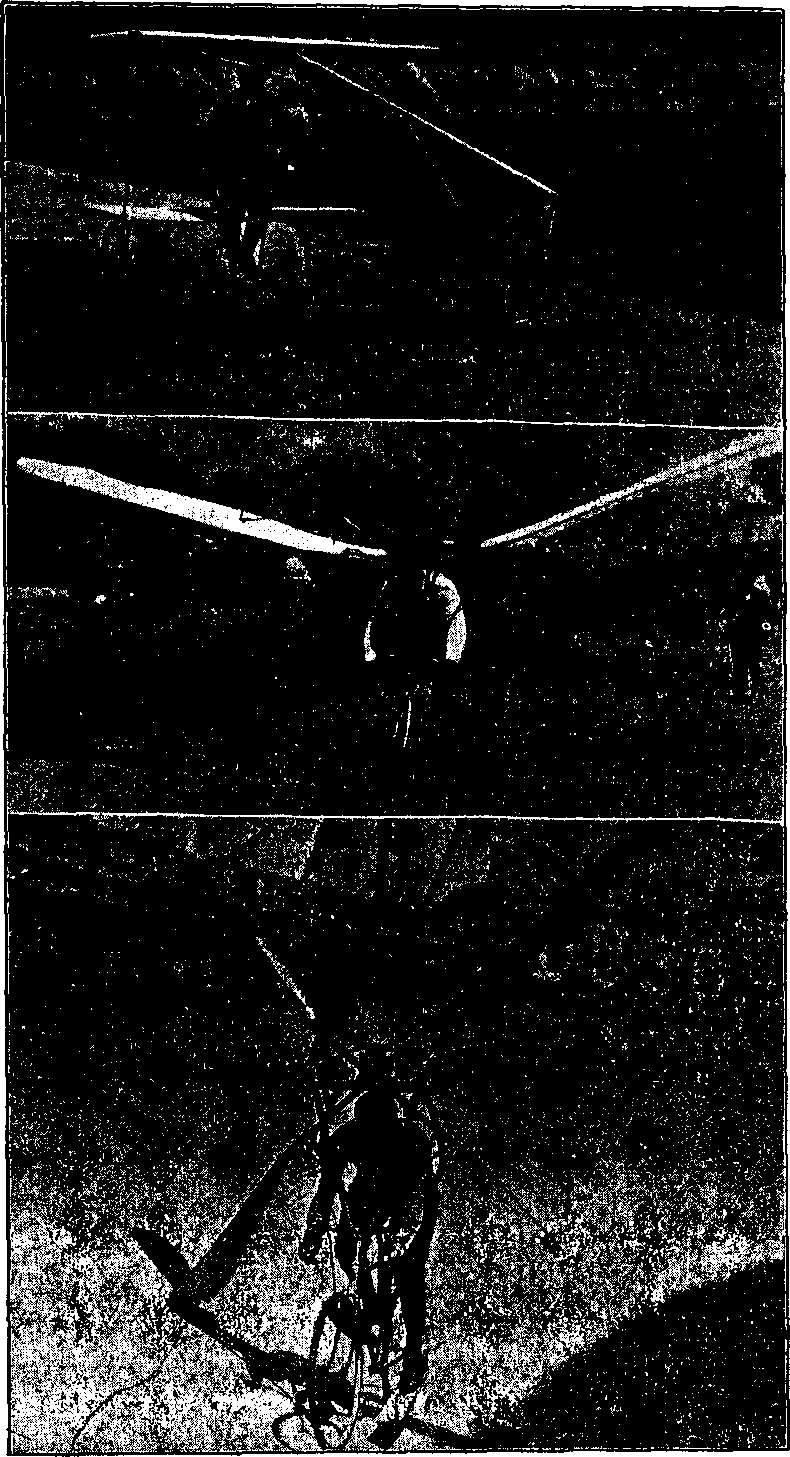 Oben: Fahrradzweidecker von Faure. In der Mitte: fliegendes Fahrrad mit am Rücken des Fliegers befestigten schlagenden Flügeln. Unten: Fahrrad mit Sdilagtlügeln von La Wera. den unseren messen kann. Und dann fehlen ihnen vor allem die Flieger. Man nenne uns einen deutschen Flieger, der sieh mit einem Brindejonc, einem Prevost, einem Garros, einem Vedrines messen kann. Können unsere Nachbarn eine einzige Flugleistung namhaft Ausstellungen, und hat unsere Eindecker, unsere Zweidecker, unsere Propeller nachgezeichnet. Und das Resultat? Unsere östlichen Nachbarn haben einige Typen zusammengestohlen, wie „Albatros" und die „Taube" und dergleichen, denen alle Eigenschaften fehlen, um hoch und schnell zu fliegen. Sie besitzen keinen Apparat, der sich mit machen, die sich mit den unsrigen vergleichen läßt? Wir kennen keine." Hoffentlich werden die „östlichen Nachbarn" weiter in rühriger und ernster Weise an dem Ausbau ihres Flugwesens arbeiten, um den Franzosen, deren gewaltige Fortschritte im Flugwesen bei uns kein Mensch herabzusetzen sucht, die aber gewohnheitsgemäß den Mund doch etwas zu voll nehmen, die richtige Antwort auf jene Frage zu geben. Daß der ■ Wunsch der hiesigen Flieger, das Reglement für das große Wasserflugzeug-Meeting von Deauville wesentlich zu mildern, erfüllt worden ist, haben wir berichtet. Nun entschließen sich die einzelnen Marken nach und nach zuj- Teilnahme an dem Bewerb, der bekanntlich am 24. August seinen Anfang nehmen und bis zum 31. August dauern wird. Am 24. August wird der gemeinsame Flug von Paris nach Deauvi le erfolgen und in j der darauffolgenden Woche geht der große Bewerb des Marineministeriums dort vor sich. Man spricht davon, daß die Beteiligung von Farman (Eugene Renaux), Nieuport, Deperdussin (Prevost, Janoir), Bathiat, Breguet (ßregi, Moineau), Clement-ßayard (Guillaux) Maurice Farman (Gaubert) als sicher anzusehen sei. Die Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung sind im Gange. Auch die Schweiz wird; im August eine gleichartige haben: der schweizerische Aviations-Club organisiert für den 9. und 10. August ein Wasserflugzeug-Meeting auf dem Genfer See, das mit Preisen von 8000, 5000 und 2000 Francs ausgestattet ist. Außerdem wird jeder Apparat, der sich nicht klassieren kann, der aber mindestens einen der vorgeschriebenen Bewerbe bestanden hat, eine Trostprämie von 500 Francs erhalten Dieser Tage ist hier ein interessanter Prozeß entschieden worden. Wie erinnerlich, fand am 1. Oktober 1911 gelegentlich des Meetings von Mailand ein Zusammenstoß in der Luft zwischen dem englischen Hauptmann Dickson und dem Flieger Thomas statt, wobei beide Flieger verletzt, beide Maschinen vernichtet wurden. Thomas verlangte 70 000, Dickson seinerseits 100 000 Francs Entschädigung. Die 5. Zivilkammer entschied nun letzten Donnerstag, daß Dickson als der allein Verantwortliche anzusehen sei und verurteilte ihn, an Thomas 5000 Francs, an die Liquidationsmasse der Antoinette-Gesellschaft (welcher der Apparat Thomas gehörte) 10 000 Francs zu zahlen. Außerdem hat er 8/I0 der beträchtlichen Kosten zu tragen. Ein Flugsachverständiger war auffälligerweise vom Gericht nicht hinzugezogen worden! Ganz besonders lebhaft ging es im französischen Militärflugwesen zu. Die Geschwaderflüge werden andauernd mit großem Erfolge fortgesetzt, und in aller Stille arbeitet die Heeresverwaltung unausgesetzt an der Vervollkommnung des Flugwesens. Die Geschwader Von Beifort, von Dijon und von Toul arbeiten mit zäher Ausdauer und haben wieder eine Reihe großartiger Erkundungsflüge vollbracht, von denen jetzt auf Weisung der Heeresleitung keine Berichte mehr gegeben werden. Einzelne Militärflieger haben sich dabei besonders ausgezeichnet, namentlich der Leutnant Varcin, der sogar neulich auf einem Maurice Farman, mit einem Unteroffizier an Bord, mit einem Fluge von 477 km ohne Zwischenlandung einen neuen französischen Rekord aufstellte. Leutnant de Lussigny flog dieser Tage die Strecke Mailly-Troyes und zurück, Mailly-Chalons, Mourmelon-Reims und zurück, insgesamt 1100 km. Zwei Unteroffiziere begaben sich, mit Sappeuren an Bord, von Maubeuge über Reims nach Bar le Duc, eine Distanz von 215 km. Das Geschwader von .Maubeuge entwickelt überhaupt eine sehr rege Tätigkeit und hat zahlreiche gelungene Rekognoszierungen vorgenommen. Es hat auch an den Manövern des 6. Armeekorps teilgenommen und sich vorzüglich bewährt. Der kommandierende General des 20. Armeekorps, der General Goetschy, hat dieser Tage, von Oberst Bouttieaux begleitet, eine Inspektion des Militärzentrums von Toul vorgenommen. Das Luftgeschwader 1, aus zwei Leutnants und zwei Unteroffizieren bestehend, sämtlich mit Passagieren an Bord, unternahm einen .Erkundungsflug zwischen Toul und Verdun, worauf der General und Oberst Bouttieaux an Bord zweier Fingzeuge als Passagiere in 1000 Meter Flughöhe die heuen Befestigungswerke von Toul besichtigten. Das Fluglager von Buc erhielt, gestern eine Art Mobilisierungs-Ordre. 'Es traf dort der Befehl ein, daß sämtliche verfügbaren Flieger'sofort einen einstündigen. Erkundungsflug zu unternehmen hätten. Vier Hauptleute, sechs Leutnants und zwei Unteroffiziere vermochten in der vorgeschriebenen Frist mit ihren Maschinen abzufliegen. Zwei Unfälle im Militärflugwesen hatten eine Störung in die letzten Tage gebracht. In Troyes stürzte ein vom Hauptmann Fiorellino gesteuerter Zweidecker Farman, mit einem Unteroffizier an Bord, aus 150 Meter ab. Wie durch ein Wunder blieben beide Insassen unverletzt, aber die Maschine wurde zertrümmert. In Etampes stürzte der Militärflieger Debewer aus nur 10 Meter mit seinem Apparat zur Erde zurüok und wurde auf der Stelle getötet. Der Leutnant Personne yom FJijgzeutrum Epinal wurde infolge eines Motorendefekts dieser T^ge in Charolle durch Absturz schwer verwundet. Uebrigens hat die Militär Verwaltung nunmehr bekannt gegeben, welche praktische und theoretische Bewerbe für das Militärfliegerzeugnis in diesem Jahre gelten sollen. Praktische Proben: 1. Ein Dreieckflug von mindestens 200 km mit zwei vorher angekündigten obligatorischen Zwischenlandungen; die kürzeste Seite des Flugdreiecks muß mindestens 20 km betragen; 2. Ein Flug von wenigstens 150 km in gerader Linie, auf festgesetzter Flugstrecke, ohne Zwischenlandung; 3. Ein Flug, an ein und demselben Tage und auf ein und demselben Flugzeug, von mindestens 150 km in gerader Linie, mit vorher angegebener Flugstrecke und einer fakultativen Zwischenlandung; im Laufe dieser Flüge wird der Bewerber einen Flug von mindestens 45 Minuten in einer nahezu konstanten Höhe von wenigstens 800 Metern ausgeführt haben müssen. Wenn atmosphärische Zustände diesen Höhenflug im Laufe eines der Bewerbflüge unmöglich machen, so wird der verlangte Höhenflug besonders auf einem Flugfelde vorgenommen werden können. Keiner der FJüge muß in Begleitung eines Passagiers erfolgen. Theoretische Proben: Die Bewerber müssen vor der Kommission ein Examen über folgende Materien ablegen : 1. Lesen von Karten, Grundsätze der Meteorologie, barometrischer Druck, Temperatur, hygrometische Fragen; Wolken, Wind; Lesen meteorologischer Karten, Benutzung meteorologischer Angaben, das Gesetz des Luftwiderstandes; 2. Das Gesetz des Luftwiderstandes in seiner besonderen Anwendung auf das Flugwesen, Konstruktion von Flugzeugen, Empfangsabnahme von Flugzeugen, Regulierung eines Flugzeugs; 3. Explosionsmotoren, Grundsätze des mechanischen Wirkungsgrades, Vergaser, Zubehörteile. Rl.  Infolge der vielen Veranstaltungen in der Provinz ist ein großer Teil der Flieger abwesend. Indessen sorgen die Fliegerschulen für einen regen Flugbetrieb. Eine sehr gute Leistung vollführte der Flugschüler Max Schüler am 16. Juni. Schüler hatte vormittags, nachdem er kaum seinen ersten Alleinflug ausgeführt hatte, die Prüfungsbedingungen für das Fliegerzeugnis in glänzender Weise bestanden. Seinen Höhenflug setzte er hierbei bis auf 600 m Höhe fort. Am Nachmittag des gleichen Tages startete er für die höhere Flugzeugführer-Prüfung. Er erreichte eine kontrollierte Höhe von 3000 m nach einer Std. 30 Min. und landete im Gleitflug aus 1400 m Höhe. Am 17. Juni vollführte er einen Flug von 2 Std. 15 Min. um die Prämie der Nationalflugspende. Eine wahrhaft grandiose Leistung! Der unseren Lesern bekannte Flugzeug-Konstrukteur Hermann Dorn er, der lange Zeit nicht mehr geflogen ist, kann das Fliegen nicht mehr sein lassen. Dorner fliegt zur Zeit eine Melli Beese-Taube, mit der er am 18. Juni mit 1 Std. 20 Min. Flugzeit sich 1000 Mark aus der Nationalflugspende holte. Leider hat sich in den letzten Tagen ein recht bedauernswerter Unfall zugetragen. Am 19 Juni stürzte der unseren Lesern bekannte Flieger Hans Krastel (Fliegerpatent Nr. 12) mit Werkmeister Gorbitz als Fluggast auf einem Doppeldecker von Professor Baumann tötlich ab. In verschiedenen Zeitungen ist über diese sogenannten Professoren-Apparate, wobei man auch des Unfalls von Hild auf ReißnerEindecker gedenkt, in unzutreffender Weise glossiert worden. Wir nehmen hier davon Abstand, eine Kritik zu üben, müssen jedoch .Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XVIII. Wasser-Eindecker Nieuport. Tragfläche: 24 qm. Motor: 100 PS Gnom 14 Cyl. 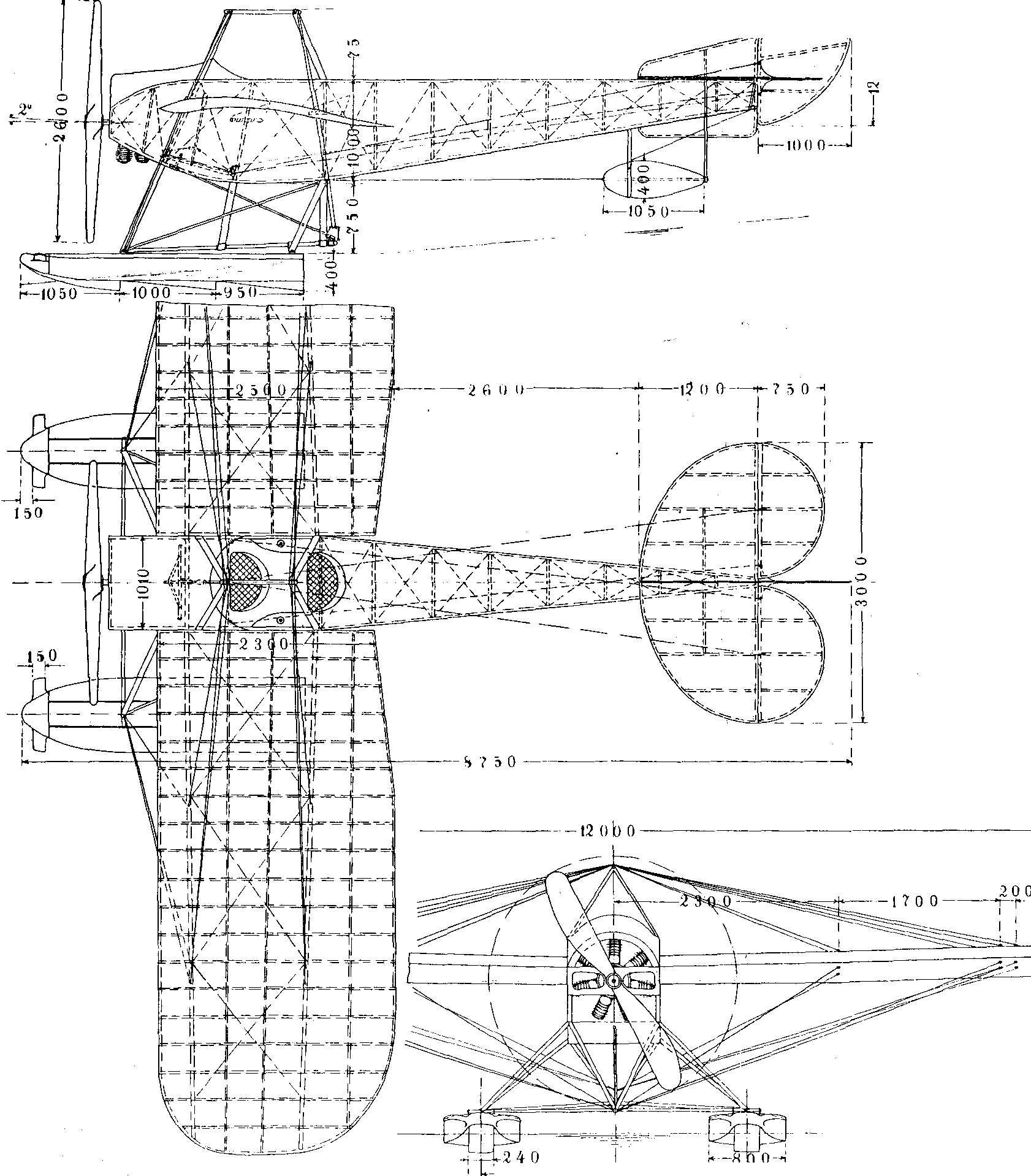 Nachbildung verboten. darauf hinweisen, daß gerade die beiden Personen, Prof. Reißner und Prof. Baumann, zu den wenigen ernstzunehmenden — es sind kaum mehr wie zwei — Theoretikern auf dem Gebiete des Flugwesens zählen und daß gerade diese Theoretiker dadurch, daß sie auch in der Praxis sich mit dem Flugwesen beschäftigten, unsere Sache immerhin ein gutes Stück vorwärts gebracht haben. Bei dem Flugwesen muß Praxis und Theorie Hand in Hand gehen. Mit ein paar Versuchen von Modellchen im Mausekanal etc. ist der Flugtechnik nicht gedient. Die letzten Tage brachten indessen noch eine angenehme Ueber-raschung und zwar schlug Thelen auf einem Albatros-Doppeldecker mit 6-Zyl. 100 PS Mercedes-Motor den Höhen-Weltrekord mit 3 Passagieren. Zwecks Abnahme eines Apparates für die Heeresverwaltung stieg Thelen mit Lt. Münster als Gast und Ballast für 2 Personen insgesamt 160 kg sowie Betriebsstoff für 2'/4 Stunden auf. Nach 3/j Stunden hatte Thelen 2150 m Höhe erreicht. Thelen landete, nachdem er die vorschriftsmäßige Stunde geflogen war, in tadelloser Form. Die Verwindungsrollen - Befestigung des Moräne-Saulnier-Eindeckers besteht nach Abb. 1 hauptsächlich aus einem zweifach ge-I kabelten Faeonstück. Dasselbe wird , durch einen Schraubenbolzen an dem Konstruktive Einzelheiten. 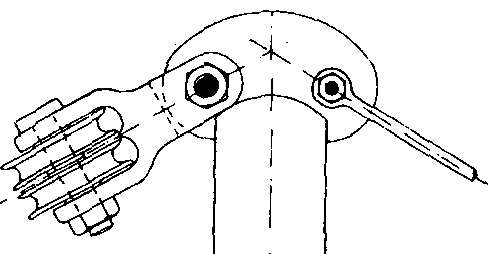 Abb. 1 senkrechten Blechstege des Spannsäulenkopfes befestigt, während ein zweiter Schraubenbolzen als Rollenachse dient. Diese Anordnung gestattet eine bequeme Einstellung der Rollen und eine leichte Montage der Verwindungsseile des hinteren Flügelholms. Die Verwindungshebelanordnung des Morane-Saulnier-Eindeckers ist aus Abb. 2 ersichtlich. Zwei ovale Stahlrohre stoßen auf dem Wellenlager der Hebelanordnung zusammen Zwei einarmige Hebel, die auf der Hebelwelle festgekeilt sind, erfassen an ihren Enden die unteren Verspannungsorgane des Eindeckers. In der Mitte der Welle befindet sich ein aus Stahlrohren geschweißter doppelarmiger Hebel, welcher horizontal liegt. An ihm greifen die Verwindungssteuerseile an. Dieser Schwinghebel ist auf der Welle fest angebracht und nimmt die Hebelwelle beim Verwinden mit. 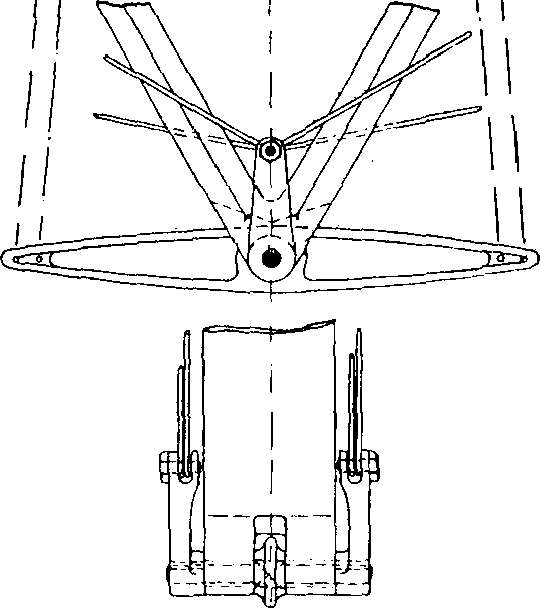 Abb. 2 Die Flügelbefestigung des Bristoldoppeldeckers ist aus Abb. 3 zu ersehen. Das am Rumpf befindliche aus zwei Stegen bestehende Faconstück ist mittels Flansch am Bumpf festgeschraubt. Am stumpfen Flügelholmende befindet sich ein gleiches Faconstück mit Flanschbefestigung. Beide Faconstücke sind derartig zueinander angeordnet, daß die Stege niemals aufeinander stoßen können. Zwischen diesen Stegen ist ein Abb. 3 kardanartiges Verbindungsstück eingeschaltet. Der Verwindungshebel des Deperdussin-Eindeckers ist in Abb. 4 bildlich dargestellt. Um einen am Fahrgestell befestigten freitragenden Zapfen, schwingt ein durch ein traversenartiges Verbindungsstück verstärkter Winkelhebel. Um den kurzen Arm des Winkel-hebels schwingt die hintere untere Flügelholmverspannung. Dieselbe greift an zwei Schraubenbolzen an. Am langen Hebelarm dagegen greifen die verwindungssteuerseile an. Zur Entlastung derselben ist Abo. 4 am kurzen Hebelarm ein mittels Spannschloß einstellbares horizontales Seil angeordnet. Der Winkelhebel wird durch einen Splint auf dem Achszapfen festgehalten und kann im Bedarfsfalle leicht heruntergenommen werden. Ueber die Aussichten des Schwingenfluges.*) Neue Untersuchungen und Vergleiche. G. Vorndran, Stattgart. In No. 12 Jhg. 1913 des „Flugsport" habe ich bereits in allgemeinen Zügen meine Ansicht über das Problem des Schwingenflugs nach den Vorbildern der Vögel und Insekten dargelegt und meine Theorie physikalisch begründet. Zweck dieser Zeilen soll nun sein, die Aussichten des Schwingenflugs nach dieser Theorie überhaupt und im Vergleich mit den anderen bekannten Theorien des Schwingenflugs, sowie des Drachen- und Schraubenflugs einer Untersuchung zu unterziehen. Im allgemeinen haben ja zur Zeit unsere Flugtechniker für den Schwingenflug kein großes Interesse und setzen keine großen Hoffnungen in seine weitere Entwicklung. Ihr ganzes Interesse gilt den Drachenfliegern. Ich glaube, sehr mit Unrecht. Auch der größte Optimist muß zugeben, daß trotz der großen Begeisterung für die Sache und trotz außerordentlicher Anstrengungen das Fliegen noch weit davon entfernt ist, ein allgemein verwendbares Verkehrsmitlei zu werden, ja, daß es überhaupt ausgeschlossen erscheint, daß es bei den heute hauptsächlich gepflegten Systemen der Drachenflieger jemals ein solches werden könnte. Ich bin fest überzeugt, daß es auch unter den Flugtechnikern selbst eine große Anzahl gibt, die meine Meinung hierin teilen und wohl wissen, daß der Drachenflieger niemals ein allgemeines Verkehrsmittel werden wird und keine entsprechende Entwicklungsmöglichkeit hat. Die darauf verwendete Mühe gilt also von vornherein einer aussichtslosen Sache. *) In dem Artikel „Ueber neue Gesichtspunkte zum Flugproblem insbesondere auch zum Tierflug" in Nr. 12 ist folgendes zu berichtigen: auf Seite 434, 18. Zeile von oben ist statt „nie" zu setzen „sich", ferner 27. Zeile von oben muß es anstatt „in gleicher Zeit" heißen „abwechselnd gleiche Zeiträume" und auf Seite 439, 11. Zeile von unten statt „Schwanzfedern" „Schwungfedern". 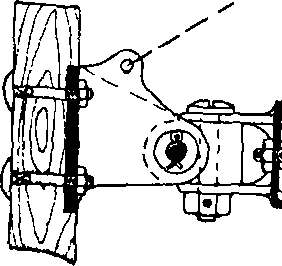 Bis jetzt ist das Flugzeug eben nur eine unter Umständen ganz gut brauchbare Kriegswaffe und höchstens noch ein Sportzeug für begüterte Kreise. Für den allgemeinen Verkehr ist sowohl die Herstellung als auch der Betrieb zu kostspielig und wird es bei diesem System auch stets bleiben. Die Kosten fallen aber viel mehr in die Wagschale als z. B. die Gefährlichkeit, die sich mit der Zeit auf ein Minimum reduzieren ließe. Die bisher bekanntgewordenen Systeme von Schwingenfliegern waren allerdings nicht geeignet, die Meinung zu stützen, daß mit den Schwingenfliegern größere und hauptsächlich billigere Erfolge zu erzielen wären. Eher das Gegenteil. Es ist aber ein Irrtum, daraus zu schließen, daß der Schwingenflug an sich verfehlt wäre, denn die Natur verwendet ja nur diesen, und es ist ganz sicher, daß die Natur den in jeder Beziehung vorteilhaftesten Weg einschlägt. Weit richtiger ist es, aus den Mißerfolgen zu schließen, daß eben der an sich richtige Schwingenflug nicht richtig ausgeführt wurde, daß wesentliche Mängel in der Theorie vorhanden waren, die den Erfolg ausschlössen. Alle bis jetzt bekanntgewordenen Theorien des Schwingenflugs*) gehen davon aus, daß das Fliegen eine dem Schwimmen bezw. Rudern ähnliche Bewegung sei. (Daher die Bezeichnungen: Ruderflug der Vögel u. s. w.). Als wesentlichste Bedingung wurde daher angesehen, daß der Flügel beim Abwärtsschlag der Luft eine große Fläche und beim Hub eine möglichst kleine Fläche biete, genau wie beim Rudern. Es wurde nun auf die verschiedensten Arten versucht, diese Bedingung möglichst vollkommen zu erfüllen, niemals aber wurde die Richtigkeit dieser Bedingung selbst angefochten, weil man sie einfach für selbstvers'ändlich hielt. Die bis heute bekanntgewordenen Systeme von Schwingenfliegern können in der Hauptsache in 3 Gruppen eingeteilt werden, wobei dann nochuebergänge und Verbindungen mehrerer Systeme auftreten, die aber alle auf dem Ruderprinzip beruhen. 1. Solche, bei denen die Flügel beim Abwärtsschlage sich ausbreiten und beim Hub zusammenfalten. Eine ganze Reihe von Konstruktionen, auch aus neuester Zeit, beruht hierauf. 2. Solche, bei denen die Flügel beim Abwärtsschlage der Luft die Breit» seite bieten und beim Hub die Kante. Auch die Wendeflügelräder ge» hören hierher. 3. Solche, bei denen die Flügel gewölbt sind und die beim Abwärtsschlage die Luft mit der hohlen Seite und beim Hub mit der gewölbten Seite verdrängen, wodurch ja auch ein veränderter Luftwiderstand entsteht. Diese Konstruktionen sind wohl die ungünstigsten. Bei allen diesen Systemen entsteht aber im Grund genommen die gleiche Wirkung dem Wesen nach, nur der Wirkungsgrad differiert etwas. Wie bei jeder periodisch hin- und hergehenden Bewegung, ist die Geschwindigkeit beim Wechsel der Bewegung = 0, wächst zu einem Maximum in der Mitte der Bewegung und nimmt dann wieder ab bis 0. Gerade so wird aber auch der Luftwiderstand zu einem Maximum in der Mitte steigen und dann wieder fallen, da ja die Luftverdrängung mit der Geschwindigkeit der Flügelbewegung erfolgt. In Abb. 1 ist in einem Diagramm der Vorgang dargestellt. A stellt die Geschwindigkeitskurve des Flügels dar, b die Luftwiderstandskurve. Der über der O-Linie stehende Teil stellt den Flügelabschlag, der unter dieser Linie den Hub dar. Der von der Kurve b und der O-Linie eingeschlossene Raum ist die aufgewendete Arbeit. Die Differenz zwischen dem oberen und unteren Teil dieses Raumes ist die hebend wirksam gewordene Arbeit. Eine wirkliche Hebung des Körpers findet aber erst statt, wenn der Luftwiderstand das Gewicht des Körpers erreicht hat. Zeichnet man also auch noch die diesem Gewicht entsprechende Wagrechte c in das Diagramm, so ist auch noch der Raum zwischen b, c, und der O-Linie als unwirksame Arbeit in Abzug zu bringen. Erst der dann noch etwa verbleibende Rest ist die wirklich ausgenützte Arbeit. *) Abgesehen von denjenigen, die den Tierflug überhaupt zum Drachenflug rechnen und die Ruderbewegungen als nur für die Fortbewegung bestimmt betrachten, den Auftrieb aber als eine Drachenwirkung ansehen, diese Systeme gehören ohne weiteres zu den Drachenfliegersystemen. 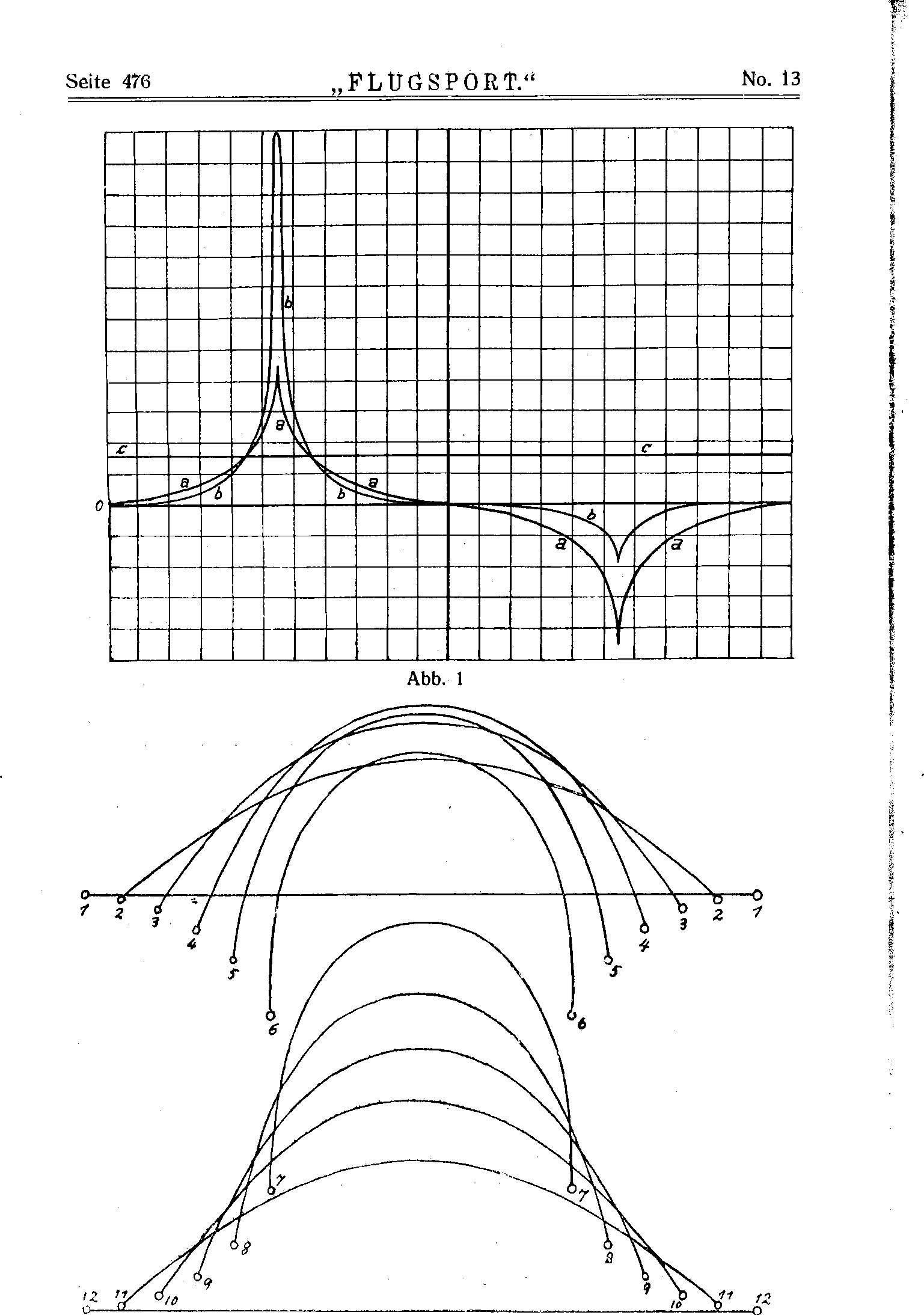 Abb. 2 Nach der Zeichnung wäre beispielsweise das Verhältnis zwischen aufgewendeter und ausgenützter Arbeit ungefähr wie 33 : 2. Diese Zahlen sollen selbstverständlich keine irgendwie durch Experimente festgestellten Werte darstellen, sondern nur Beispiele. Wie sind nun dem Vorstehenden gegenüber die Aussichten des Schwingen fluges nach meiner Theorie? Im Gegensatz zu der seitherigen allgemeinen Auffassung des Schwingenfluges als Ruderbewegung wäre nach meiner Theorie der Flug vielmehr eine Spring- oder Hüpfbewegung: „Das Tier springt oder hüpft gewissermaßen über die Luft weg, indem es sich während jedes Flügelschlags nur einen kurzen Augenblick einen Stützpunkt durch plötzliches Zusammenpressen der Luft schafft. Während der übrigen Zeit braucht es keinen Stützpunkt und daher auch keinen Luftwiderstand, da es sich vermöge seiner lebendigen Kraft eine Zeit lang schwebend halten kann, bis es wieder einen Sprung macht. Also nur für den Moment des Sprungs ist ein Luftwiderstand nötig und daher auch nur für diese Zeit ein Arbeitsaufwand, um einen Luftwiderstand zu erzeugen." Wenn man, wie oben für die bekannten Systeme, den Vorgang durch ein Diagramm darstellt, so wird die Sachlage sehr klar und deutlich. In Abb. 2 ist zunächst schematisch ein Querschnitt durch einen Flügel in einer größeren Anzahl Stellungen während der Bewegung dargestellt. Man ersieht hieraus, daß zunächst, obgleich die Rippen herabgehen, die Luft sogar eine durchschnittliche Bewegung nach oben erfährt, etwa bis zur Stellung 4. Erst von da ab wird die Luft und zwar mit sehr rasch wachsender Beschleunigung nach unten verdrängt, was sehr großen Widerstand verursacht. Während aber bei den anderen Systemen die Beschleunigung nur bis zur Mitte wächst und dann wieder - abnimmt, wächst hier die Beschleunigung der Luft (nicht des Flügels, bezw. der bewegten Rippen) noch über die Mitte hinaus, bis etwa Stellung 7, da eben von der Mitte ab die Rippen außer der Abwärtsbewegung auch noch auseinander gehen. Etwa von der Stellung 8 ab hört aber die Beschleunigung der Luft fast plötzlich auf, da der Körper bereits eine Bewegung nach oben angenommen hat, so daß der Rest des Flügelabschlags relativ nur noch eine Bewegung in Bezug auf den Körper, nicht aber die Luft ist. Beim Flügelhub könnte man nun bei oberflächlicher Betrachtung meinen, daß eine gerade entgegengesetzte Wirkung eintreten würde, indem sich die Haut nach unten auswölben würde, so daß die Rinnen oben offen wären Dies ist aber nicht der Fall. Es ist zu bedenken, daß erstens der Körper infolge der Schwerkraft stets die Neigung zu sinken hat, so daß also schon hierdurch stets ein Luftdruck von unten auf die Flügel vorhanden ist, der die Haut nach oben auswölbt. Hierzu kommt noch der infolge der Fortbewegung entstehende Luftdruck von vorn, der auch stets in diesem Sinne wirkt. Bei denjenigen Insekten, Bienen, Hummeln u. s. w., die an einer Stelle in der Luft stehen bleiben können, ist außerdem noch am Flügel eine bestimmte Partie (Außenteil oder Flügelspitze) dazu ausge-gebiidet, beim Hub Luft unter den Flügel zu treiben, so daß sich die Haut nach oben auswölbt. Also auch beim Flügelhub wird eine ganz ähnliche und zwar gleichgerichtete Wirkung wie beim Abschlag eintreten, nur in geringerem Maße. Der Flügel wird nach einander die gleichen Stellungen einnehmen, wie beim Abschlag, nur in umgekehrter Reihenfolge. Von der Stellung 12 ab bis etwa 3 wird eine Bewegung der Luft nach oben eintreten, von 3 ab wieder nach unten, wodurch Auftrieb entsteht. Das Diagramm, Abb. 3, wird sich also in nachfolgender Weise bilden. Die Kurve a, die die Bewegung des Flügels, relativ zum Körper, also speziell hier die der Rippen ohne die Haut darstellt, wird von der in Abb. 1 nicht verschieden sein. Ganz erheblich verschieden wird aber die Kurve sein, die die Beschleunigung der Luft darstellt, und davon hängt die Widerstandskurve ab, nicht von der Bewegung der Rippen. Die Geschwindigkeüskurve der Luft wird in Abb. 1 mit derjenigen des Flügels selbst, a, zusammenfallen. In Abb. 3 wird sie aber einen anderen Verlauf zeigen. Sie sei d genannt. Etwa bis Stellung 5 (siehe Abb. 2) wird sie unterhalb der O-Linie verTaufen, dann sehr rasch steigen, etwa bis Stellung 7 und zwar über die größte Höhe von a, dann wird sie ebenso rasch wieder fallen bis 12. Beim Hub wird sie wieder bis Stellung 3 unterhalb der O-Linie verlaufen und dann wieder kurze Zeit über diese Linie emporsteigen. Zeichnet man nun zu d die dazugehörige Luftwiderstandskurve b und die Wagrechte c, die dem Gewicht des Körpers entspricht, und bestimmt dann in der oben angegebenen Weise die aufgewandte und die nutzbar gewordene Arbeit, so ensteht ein erheblich günstigeres Resultat. rS 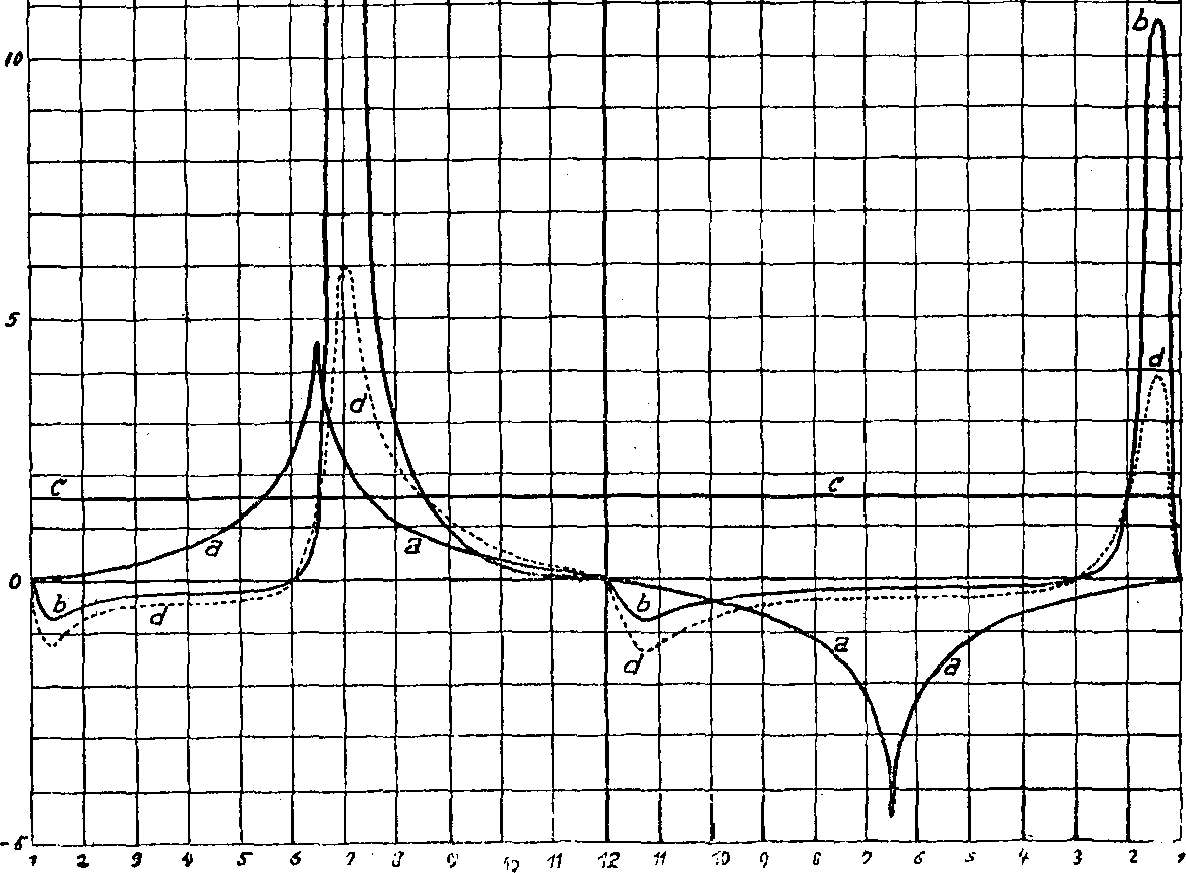 Abb. 3 Beispielsweise hier: Aufgewandte Arbeit zu nutzbarer Arbeit ungefähr wie 33:15. In Wirklichkeit ist aber das Verhältnis noch ein erheblich günstigeres, da ein großer Teil der anscheinend verlorenen Arbeit doch noch,; nutzbar gemacht wird und zwar zur Fortbewegung bei geeignetem Bau der Flügel. Will man nun auch noch die Drachen- und Schraubenflieger in den Kreis der Betrachtung einziehen, so ist dies sehr leicht möglich. Auch bei diesen läßt sich die ArbeitsausnUtzung durch ein ähnliches Diagramm darstellen und zwar wird dies bei beiden, Schrauben- oder Drachenfliegern, ziemlich gleich ausfallen, da beide im Grunde auf dem gleichen Prinzip beruhen. Sie verdrängen die Luft fortgesetzt mit gleichbleibender Geschwindigkeit und erzeugen einen gleichbleibenden Luftwiderstand. In ihrem Diagramm, Abb. 4, wird also sowohl a als b eine wagre.hte gerade Linie darstellen. Fügt man die Gewichtslinie c bei, so kann man wieder genau wie vorher die aufgewandte und die nutzbare Arbeit berechnen. Der Raum zwischen 0 und b ist die aufgewandte, der zwischen b und c die nutzbare Arbeit. Das Verhältnis ist etwa 33:6 bei dem gewählten Beispiel. Je höher man nun in den 3 Diagrammen die Wagrechte C ansetzt, desto günstiger wird das Verhältnis für meine Theorie. Bei einer bestimmten Höhe der Wagrechten C werden die anderen Systeme der Schwingen-, Drachen- und 6 9 o Abb. 4 Schraubenflieger keinen Nutzeffekt mehr ergeben, es tritt keine Hebewirkung mehr ein, während bei meinem System dieser Zeitpunkt erst bei einer viel größeren Höhe von C eintritt. Mit anderen Worten, mit meinem System ist der Hub einer viel größeren Last mit gleichem Arbeitsaufwand möglich, oder was das gleiche ist, es kann die gleiche Last mit einem viel geringeren Arbeitsaufwand geboten werden. Es sind also viel schwächere Motoren nötig, diese haben dann erstens ein geringeres Gewicht und verbrauchen zweitens weniger Betriebsstoff. Es kann also entweder mehr Nutzlast mitgenommen werden oder aber es bedingt das verringerte Gewicht einen noch geringeren Arbeitsaufwand und daher noch billigeren Betrieb. Ich möchte also unseren Flugtechnikern den Rat geben, ihr Interesse nicht ausschließlich den Drachenfliegern zuzuwenden, sondern auch dem Schwingenflug die gebührende Beachtung zu schenken und Versuche in dieser Richtung zu unternehmen. Sie werden sicher reiche Früchte tragen Ich bin fest überzeugt und glaube auch schwerwiegende Argumente dafür beigebracht zu haben, daß der Schwingenflug eine größere Entwicklungsmöglichkeit als der Drachen- und Schraubenflug hat und Ausblicke in eine ungeahnte Zukunft ermöglicht, ja daß er sicher einst die ganze Luftschiffahrt beherrschen und auch die Gasluftschiffe verdrängen wird. Die Organisation der Flieger-Landungsterrains in Frankreich. Von unserem Pariser Berichterstatter. Von allen Fragen, die für die Entwicklung des heutigen Flugwesens von einschneidendem Interesse sind, ist eine der wichtigsten diejenige, welche die Anlage von Landungsterrains und Fliegerhallen betrifft. In Wirklichkeit ist die Sicherheit der Flieger, sowohl der Militär- wie der Zivilflieger, die meist gezwungen sind, ohne Rücksicht auf die Witterung ihre Flüge zu unternehmen, in hohem Maße davon abhängig, ob sie die Möglichkeit haben, im Falle eines vollkommenen Defekts an ihrer Maschine in angemessener Weise zu landen, oder ob sie innerhalb eines Radius von 25 km, also ein wenig mehr als eine Viertel- stunde Flugdistanz, mehrere für eine Landung geeignete Terrains finden, die ihnen einen sicheren Schutz gewähren. Dieses Problem ist von den Franzosen in seiner ganzen Bedeutung richtig erkannt worden und seit längerer Zeit schon gehen die Bemühungen dahin, eine möglichst vollkommene und zweckmäßige Organisation zu schaffen, welche dem hier in Rede stehenden Zwecke dienen soll. Neuerdings hat das National-Comite für das Militärflugwesen die Sache in die Hand genommen, indem es sich entschieden hat, einen Teil der durch die Volks-Subskription aufgebrachten Gelder dafür zu verwenden. Das Comite ist nach seiner Tätigkeit ganz planmäßig vorgegangen : seine erste Aufgabe erblickte es darin, zunächst einmal eine Anzahl von „Stationen" zu errichten, welche über die hauptsächlichsten strategischen Luftstrecken, namentlich aber nach der Ostgrenze hin, verteilt sind. Allmählich soll dieses Netz nach Süden, dem Westen und im Innern des Landes ausgedehnt und erweitert werden. Der französische Kriegsminister hat die außerordentliche Wichtigkeit der Arbeit, welche jene Kommission unternommm hat, dadurch anerkannt, daß er eine Gesamtsumme von 900.000 Francs zur Verfügung des Comites gestellt hat, die in zwei Raten zur Auszahlung kommen und lediglich dem inredestehenden Problem gewidmet werden soll. Gleichzeitig hat die französische Regierung dem genannten National-Comite volle Autorisation erteilt, in ihrem Namen die erforderlichen Schritte zu unternehmen, die Arbeiten auszuführen, Terrains auszusuchen, Fliegerhallen errichten zu lassen, welch letztere mit besonderer Sorgfalt gebaut und mit allen modernen Vervollkommnungen der Technik ausgestattet sein sollen, so daß sie den Militärflugzeugen in jeder Hinsicht ein absolut sicheres Unterkommen gewähren. Der erste Teil der Arbeit, die dem Comite zugefallen ist, erscheint nahezu beendet. Die erste Serie, welche im ganzen 32 solcher Stationen umfaßt, befindet sich gegenwärtig in der Konstruktion und die Anlagen werden noch im Monat Juni dieses Jahres beendet werden. Es sind das folgende Stationen: Avesnes, Biarritz, Brienne-le-Chateau, Chambery, Chatillon-sur-Seine, Chau-mont, Commercy, Coulommiers, Dole, Evreux, Gray, Joigny, Langres, Longwy, Luneville, Meaux, Neufchateau, Pont-ä-Mousson, Remiremont, Rethel, Saint-Die, Saint-Dizier, Saint-Andre-de Cubzac, Saint Quentin, Sezanne, Soissons, Troyes, Valenciennes, Vesoul, Vincennes, Vitry-le Francois, Vouzier. Angesichts dieses ausgezeichneten Resultats hat der Kriegsminister geglaubt daß es förderlich für die weitere Arbeit der Kommission sein werde, ihr neue Fonds zur Verfügung zu stellen, damit sie weitere Landungs-Centren in ganz Frankreich organisieren könne. Parallel mit der Tätigkeit der National-Kommission, unterstützt durch das Kriegsministerium und die Behörden, geht die außerordentlich rührige Arbeit der Association Generale Aeronautique, deren Präsident Jacques Balsan sich um die gleiche Sache große Verdienste erworben hat. Es ist bekannt, daß gerade diese Vereinigung der Ausgangspunkt allen patriotischen Elans gewesen ist, welchen die öffentliche Meinung in Frankreich dem modernen Flugwesen entgegengebracht hat. Die Association Generale Aeronautique hat, lediglich aus eigenen Mitteln, die sich aus den mäßigen Jahresbeiträgen ihrer Mitglieder zusammensetzen, eine große Anzahl von Terrains installiert, die sie nachher dem National-Comite zur Verwendung für gedachte Zwecke zur Verfügung gestellt hat. Und auch die Ligue Nationale Aerienne hat ihrerseits zum Gelingen des Werkes viel beigetragen. Aus der Zusammenarbeit des National-Comites mit der Association Generale Aeronautique und der Ligue Nationale Aerienne hat sich also eine Organisation ergeben, welche schon heute auf ein beachtenswertes Resultat blicken kann, die aber erst als abgeschlossen angesehen werden wird, wenn 65 Landungszentren errichtet sein werden. Diese 65 Stationen werden in Zwischenräumen von ungefähr je 50 km, die hauptsächlichsten Luftstrecken, wie Paris-Dunkerque, Paris —Lille, Paris - Douai, Paris—Maubeuge, Paris—Charleville, Paris—Verdun, Paris -Toul, Paris—Nancy, Paris—Epinal, Paris-Beifort, Paris—Lyon, Paris-Saint Etienne, Paris-Clermont Ferrand, Paris-Pau mit Landungsterrains versehen und außerdem sollen alle diese Landungs-Centren sämtliche bisher schon geschaffenen Militär-Flugzentren untereinander verbinden. Jede der genannten Landungs-Stationen wird ein Terrain von wenigstens 10 Hektaren umfassen und für die Landungen von Fliegern einen Landungskreis von 100 Metern im Durchmesser haben, sowie einen Fliegerschuppen von 20 mal 20 Metern, welch letzterer völlig unentgeltlich zur Verfügung sowohl der Militärais auch der Zivilflieger gehalten werden wird. Schließlich sei noch bemerkt, daß die öffentliche Sammlung in Frankreich noch nicht geschlossen ist, daß das National-Comite vielmehr immer noch, und zum Teil recht ansehnliche, Beiträge erhält, welche im besonderen dem weiteren Ausbau der hier in ihren Grundrissen erläuterten Organisation vom Flieger-Landungsterrain zugeführt werden sollen. Hierbei sei bemerkt, daß das National-Comite mit den bisher durch die öffentliche Sammlung eingegangenen mehr als vier Millionen Francs nicht nur das obige Werk, sondern auch den Ankauf von 176 Flugzeugen für die Armee, sowie die Ausbildung von 78 Fliegern bewirkt hat. Es ist also auch hieraus ersichtlich, in welch gewaltigem Umfange und mit wie großem Erfolg in Frankreich alle Kräfte am Werk sind, um das moderne Flugwesen, dessen Bedeutung hier voll erkannt und gewürdigt wird, immer weiter auszubauen und zu vervollkommnen. Rl. No. 411. Kohnert gen. Niehaus, Bernhard, Recklinghausen-Süd, geb. am 25. März 1884 zu Münster, für Eindecker (Grade), Flugplatz Wanne, am 24. Mai 1913. No. 412. von Stenglin, Freiherr Ernst, Offizier der Hamburg-Amerika-Linie, geb. am 16 Januar 1888 zu Berlin, für Eindecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 26. Mai 1913. No. 413. Fahnert, Friedrich, Oberleutnant, Tel.-Batl. 1, geb. am 18. Januar 1879 zu Limbach i. Sa., für Eindecker (Rumpier), Flugplatz Halberstadt am 27. Mai 1913. No. 414. Heintz, Arnold, Leutnant, Jnf.-Regt. 157, geb. am 26. Juni 1884 zu Bromberg, für Eindecker (Rumpier), Fluplatz Halberstadt, am 27. Mai 1913. No. 415. Grunewald, Karl, Sergeant, Drag-Regt. Nr. 22, geb. am 27. Januar 1886 zu Siebierode, Provinz Sachsen, für Zweidecker (Aviatik), Flugplatz Habsheim, am 27. Mai 1913. Flugtechnische 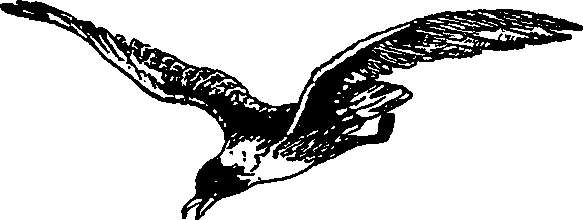 Rundschau. Inland. Mugführer-Zeugnisse haben erhalten: No. 416. Wiebeck, Otto, Leutnant, Pion -Batl. Nr. 8, geb. am 11. Juli 1886 zu Langensalza, für Zweidecker, (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 27. Mai 1913. No. 417. Viehweger, Johannes, Leutnant, Inf.-Regt. 179, geb. am 25. November 1889 zu Nimbschen bei Grimma, für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 27. Mai 1913. No. 418. Burckhard, Friedrich Karl, Leutnant, Inf.-Rgt. 54, geb. am 24. Dezember 1889 zu Köslin, für Eindecker (Rumplertaube), Flugplatz Halberstadt, am 27. Mai 1913. No. 419. Bonde, Erich, Leutnant, Inf.-Rgt. 139, geb. am 22. Januar 1891 zu Dresden, für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 27. Mai 1913. No. 420. Speer, Hans, Leutnant, Feld-Art.-Rgt. Nr. 5, geb. am 11. Februar 1888 zu Rastatt, für Eindecker (Rumplertaube), Flugplatz Johannisthal, am 27. Mai 1913. No. 421. Gundel, Ernst, Hauptmann b. St., Luftschiffer-Batl. Nr. 2, geb-am 26. September 1870 zu Guttenfeld (Ostpreußen), für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 29. Mai 1913. No. 422. Luther, Georg, Johannisthal, geb. am 25. November 1885 zu Großrosenburg, für Eindecker (Jeannintaube), Flugplatz Johannisthal, am 29. Mai 1913. No. 423. Birkner, Hermann, Leutnant, Pion.-Batl. Nr. 19, geb. am 25. Oktober 1888 zu Augsburg, für Eindecker (Fokker) Flugplatz Johannisthal, am 31. Mai 1913. No. 424. Bongardt, Georg, Leutnant, Fußart.-Regt. 12, geb. am 3. Februar 1885 zu Röslau i. Bayern, für Eindecker (Rumpier), Flugplatz Halberstadt, am 31. Mai 1913. No. 425. Salomon, Fritz, Leutnant, Pion.-Batl. 25, geb. am 18. November 1885 zu Essen, für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 2. Juni 1913. No. 426. Sprenger, Ernst, Marine-Ingenieur, Putzig bei Danzig, geb. am 23. Februar 1884 zu Bocholt, Westfalen, für Zweidecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 4. Juni 1913. No. 427. Behrbohm, Martha, Schöneberg, geb. am 6. Oktober 1888 zu Schwerin, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 4. Juni 1913. /Militärische Flüge. Von Münster nach Braunschweig flog am 15. Juni Oberlt. Alb recht auf einer Rumpler-Taube und benötigte für die gesamte Strecke, Luftlinie ungefähr 100 km, eineStunde. Am selben Tage flog Lt. von Mühlich-Hof mann auf einem Fokker-Eindecker mit Lt. Kolbe als Beobachter die gleiche Strecke und benötigte auch ungefähr eine Stunde Beide Fliegeroffiziere wurden zum Essen ins Schloß geladen. Am 16. Juni führten beide Maschinen anläßlich der Kaiser-Jubiläumsfeier über Braunschweig mehrere Rundflüge aus. Der Rückflug nach Münster erfolgte am 17. Juni früh und zwar flog mit Oberlt. Albrecht als Beobachter Oberlt. v. Hartwig. Von Münster nach Hamburg flog am 16. Juni Oberlt. von Eckenbrecher auf Albatros-Taube mit einem Beobachter an Bord, wobei er Hamburg in 2000 m Höhe überflog und dann auf dem Flugplatz Fuhlsbüttel bei Hamburg 'andete. Der Rückflug erfolgte am gleichen Tage. Von Hannover nach Münster flog am 17. Juni Lt. von Apell auf einer Rumpler-Taube. Flug Metz Frankfurt. Major Siegert flog am 18. Juni vormittags 4 : 30 mit Lt. Pretzel als Führer in Metz ab und landeten 7 Uhr vormittags auf dem Flugplatz Rebstock in Frankfurt. Die Gesamtflugzeit betrug 2 Stunden 25 Minuten. Zu gleicher Zeit flog Lt Zwickau mit Lt. Bolbrühl als Fluggast von Metz nach Frankfurt. Geschwaderflug Döberitz—Leipzig—Döberifz. Am 12. Juni flogen die Fliegeroffiziere Lt. von Hiddessen mit Oberlt Drechsel auf Doppeldecker, Lt. von Buttlar mit Lt. Friedberg auf Doppeldecker, Lt. Frhr. v. Thüna mit Lt. Winkler auf Eindecker um 4 Uhr nachmittags von Döberitz ab und erreichten Lindenthal bei Leipzig nach ca. 1 Stunde. Ungefähr 7 : 30 abends starteten die Flieger trotz des böigen Windes zum Rückflug und erreichten Döberitz ohne Zwischenfall. Von Thorn nach Johannisthal flog am 19. Juni Oberlt. von Detten mit Lt. Rickert als Beobachter. Für die Gesamtflugstrecke benötigten die Flieger 3 Stunden 11 Minuten. Ein Rundflug Döberitz-Halberstadt-Halle-Leipzig-Dresden-Döberitz wurde am 18. Juni von Oberlt. von Oertzen mit Lt. Clausewitz als Beobachter ausgeführt. Die reine Flugzeit für die 600 km lange Strecke betrug 7 Stunden 30 Minuten. Von Cöln nach Gotha flog am 20. Juni Lt. Joly mit Hauptmann Osius als Beobachter auf einer Gotha-Taube. Für die Strecke Cöln—Gießen —Gotha benötigten die Flieger 3 Stunden 30 Minuten. Aus dem Sattel in die Flugmaschine und in den Sattel. Am Sonntag den 15. Juni morgens kurz vor 7 Uhr landete auf dem „Anger" bei Magdeburg von Johannisthal kommend die Jeannin-Stahltaube 17 J 2. Ihr entstiegen Lt. Stoll als Führer und Lt. von Egan-Krieger als Passagier. Nachmittags 3 : 15 startete Lt. von Egan-Krieger auf „Jaspis" im von Gaza-Jagd-Rennen, gewann dasselbe, nahm in einem bereitstehenden Auto Platz, ließ sich nach dem 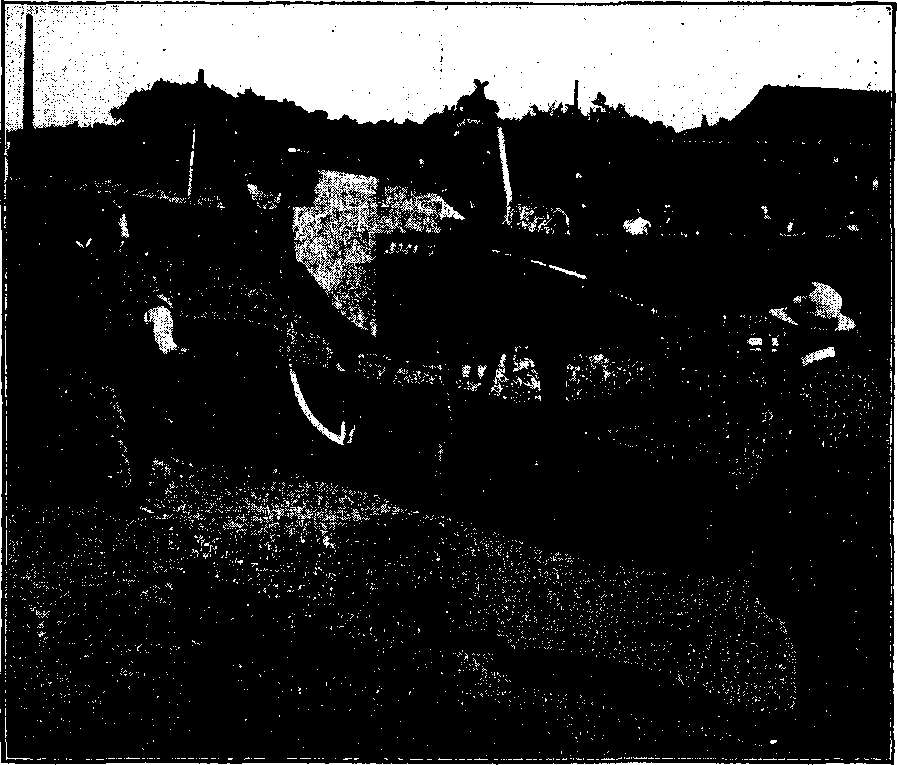 Lt. von Egan-Krieger während des Startes in Magdeburg. ^ Anger" fahren, wo inzwischen die Stahltaube startbereit gemacht war, nahm in letzterer seinen Sitz ein und 3 : 40 zog die „Taube" stolz nach der Rennbahn Grunewald davon. Auf der Fahrt nach dort hatten die Flieger stark mit Gegen winden zu kämpfen, trafen aber doch noch zeitig genug ein, sodaß Lt. v. Egan-Krieger im Offiziers-Jagdrennen um den Preis von Leipzig starten und ihn auch gewinnen konnte. Ausland. Vom schweizerischen Flugwesen. In der Schweiz liegt das Flugwesen noch recht darnieder. In der Hauptsache mangelt es an Preisen, um den Fliegern einen dauernden Aufenthalt zu ermöglichen. Von den Schweizer Fliegern ist außer Bider, der durch seinen Alpenflug bekannt ist, noch Taddeoli, der einen Eindecker fliegt und verschiedentlich ganz nette Flugleistungen zu ver-  Taddeoli startet zu einem Ueberlandflug von Bern nach Biel and verliert ein R,ad des Fahrgestells. zeichnen hatte, zu nennen. Bei einem Ueberlandflug von Bern nach Biel hatte Taddeoli einen sehr eigenartigen Unfall. Er verlor beim Aufstieg ein Rad. Sein Kollege Bider, der diesen Unfall beobachtete, verständigte Taddeoli in der Luft davon. Taddeoli ließ daher seinen Apparat bei der Landung in Biel ganz langsam ausschweben und durchsacken, so daß der Apparat fast sofort stillstand und in keiner Weise beschädigt wurde. Wettbewerbe. Wettflug „Rund um München". Am 13. Juni nachmittags erfolgte die Abnahme der gemeldeten Maschinen ; zur Teilnahme wurden zugelassen: Flieger: 1. Baierlein 2. Lindpaintner 3 Hellmuth Hirth 4 R. Janisch 5 Linnekogel 6. O. Römpler 7. Dick Zur Teilnahme waren also kurrenz war Ing. Dick zugelassen. Flugzeug: Motor; Otto-Baierlein-Doppeldecker Argus 100 PS D. F. W.-Doppeldecker Argus 100 PS Albatros-Eindecker Mercedes 95 PS Otto-Doppeldecker Argus 100 PS Rumpler-Eindecker Mercedes 95 PS D.-F.-W.-Eindecker Mercedes 95 PS D. F.W.-Doppeldecker Mercedes 85 PS 6 bekannte Flieger berechtigt, außer Kon- Die Flieger hatten die Strecke, die von Puchheim über Forstenried, Perlach, Riem, Flugplatz Schleißheim, Bergkirchen wieder zurück nach Puchheim führte, am 14. Juni einmal abzufliegen, wobei allerdings die letzte Partie Bergkirchen-Puchheim zweimal zu durchfliegen war, wahrend am Sonntag, den 15. Juni die ca. 85 km lange Route zweimal zurückgelegt werden mußte, mit einer einmaligen Zwischenlandung von 15 Min Dauer auf dem Flugplatz Puchheim.
„Rund um München", Flugplatz Puchheim. An verschiedenen Punkten der Peripherie Münchens waren Kontrollstationen errichtet worden, so in Puchheim selbst, in Forstenried, Riem, Schleißheim und Bergkirchen. Passierte ein Flieger die Kontrollstation, so hatte er eine Blechhülse, in der sich sein Name und die Nummer des Flugzeuges befand, und die an einem blau-weißen Band befestigt war, aus dem Flugzeug hinabzuwerfen. Der erste Flugtag, der 14. |uni, war von prächtigem Wetter begünstigt. Als erster startete um 5:42:]48 Römpler auf seinem D.F. W.-Eindecker und flog sofort südostwärts in der Richtung auf Forstenried. Dann folgte 5:53:7 Janisch auf Otto-Doppeldecker mit 2 Passagieren. Den Abflug setzte Janisch zu steil an, das schwerbelastete Flugzeug wurde vom Winde erfaßt und wieder zurückgedrückt. Janisch machte einen Bogen nach links, sackte jedoch beim Landungsversuch durch, wobei sich der Doppeldecker überschlug und schwer beschädigt wurde. Flieger und Passaglere blieben unverletzt. Die Sensation des Tages hildete der Abflug Hirths, der seinen Albatros-Hirth-Eindecker benutzte. Nach ihm folgte 6:29:38 Linnekogel auf Rumpler-Taube; Ing. Dick außer Konkurrenz auf D. F.W.-Doppeldecker um 6:30:10; Lindpaintner auf Otto-Doppeldecker um 6:38:0 und Baierlein gleichfalls auf Otto-Doppeldecker um 6:39:57. Als erster traf in Puchheim nach glücklicher Absolvierung der vorgeschriebenen Flugstrecke Römpler ein, der 1 Stunde 4 Minuten brauchte. Hirth landete als zweiter um 7:17:0, nachdem er noch einige Spiralen über dem Flugplatz beschrieben hatte. Es folgten dann Linnekogel 7:21:3, Dick 7:35:18 Lindpaintner 7:36:46 und Baierlein 7:37:32. Es hatten somit alle 6 abgeflogenen Konkurrenten die Flugstrecke ohne Notlandung durchmessen. Der zweite Plugtag. Am Sonntag, den 15. Juni wurde mit Rücksicht auf den ziemlich starken Ostwind der auf 4 Uhr angesetzte Start um eine Stunde verschoben. Als Erster starlete um 5 : 14 :56 Linnekogel auf Rumpler-Taube; ihm folgte 5:16:58 Hirth auf seinem Albatros-Eindecker. Auch der dritte konkurrierende Eindecker der „D. F. W." mit Römpler am Steuer ging kurz darauf hoch und war bald wie die vorher gestarteten in südöstlicher Richtung verschwunden. — Mit dem ersten Doppeldecker startete nun Ing. Dick, kehrte jedoch bald wieder zum Flugplatz zurück, da sich sein Benzinbehälter als undicht erwies. Alsdann flog um 5:54 Baierlein auf Otto-Doppeldecker ab. Da Dick nicht mehr startete, Lindpainter aber auf den Start am zweiten Tage verzichtete, da sein Vergaser trotz vorgenommener Reparatur nicht richtig funktionierte, war Baierlein der einzige Doppeldecker Flieger des zweiten Flugtages. Die Zwischenlandung: in Puchheim. Als Erster langte Linnekogel in Puchheim an; nicht allzuweit hinter ihm tauchte Hirth auf, der sich weit höher hielt, als sein vorn liegender Konkurrent. Linnekogel landete um 5:57; eine Minute später ging Hirth in prächtigem Gleitfluge mitten auf dem Felde nieder. Die Zwischenlandung Römplers erfolgte 6:6:45 Beim Aussteigen aus dem Flugzeug erlitt Römplers Passagier Oblt. König durch den noch laufenden Propeller leichte Verletzungen an Kopf und Hand, er ließ sich verbinden und nahm wieder am Weiterflug teil. Nach dem vorschriftsmäßigen Aufenthalt von einer Viertelstunde stiegen die drei Teilnehmer zum zweiten Rundflug auf. Jm 6:38:52 traf Baierlein in Puchheim ein und startete 6:55:5l von neuem. Am Ziel. Kurz vor '1,7 traf die Meldung ein, daß Linnekogel und Hirth in Sicht seien, und bald darauf erschienen die zierlichen Eindecker am Horizont. Linnekogel Uberflog das Ziel um 6 :48 : 32 und landete nach einigen kühnen Kurvenflügen um 6:51. Die offizielle Ankunft Hirth's war 6:52:35. Hirth hat also für den ersten Streckenflug 0:40:18, für den zweiten 0.40:50 gebraucht, hat also die 170 km in 81 Minuten zurückgelegt, was einer mittleren Geschwindigkeit von 120 km entspricht. Baierlein traf zum zweiten Male um 7:41:7 in Puchheim ein, fast zu gleicher Zeit kanf auch Römpler der 7:41:49 über die Ziellinie flog. Für die drei Runden brauchten die Flieger folgende Zeiten: I.Runde: 2. Runde: 3. Runde: 0:51:25 Linnekogel . 0:39:48 Linnekogel . 0:40:11 Linnekogel Hirth . . Baierlein . Lindpaintner Römpler Dick . . . 0 : 52 : 05 Hirth . . . 0:40:18 Hirth . . . 0:40:52 0 : 57 : 35 Baierlein . . 0 : 45 : 48 Baierlein . . 0 : 45 : 17 0:58:46 Römpler . . 0:50:12 Römpler . . 0:51:18 1 : 04 : 01 1 : 05 : 08 Die Gesamtzeiten für die Flieger, die alle drei Runden geflogen haben, sind somit: 1. Linnekogel . . 2 : 11 : 24 2. Hirth.....2 : 13 : 15 3. Baierlein . . . 2 : 04 : 40 4. Römpler . . . . 2 : 45: 31 Was sie gewannen: Die Tagespreise erhielten: für den ersten Tag: 1. Preis: 1000 M. Linnekogel; 2. Preis 500 M. Hirth; für den zweiten Tag: 1, Preis 2000 M Hirth; 2. Preis 1000 M. Baierlein; 3. Preis 500 M. Römpler. Linnekogel hatte zwar die kürzeste Flugdauer, kam aber für den ersten Preis nicht in Frage, da er die Kontrollstelle Riem nicht vorschriftsmäßig umflogen hat. Die Qesamtleistungspreise des ganzen Wettbewerbes erhielten: Hirth den ersten Preis 6000 M., Baierlein den zweiten Preis 3000 M. Darnach erhalten aus dem Wettbewerb insgesamt: 1. Hirth 8500 M. 2. Baierlein 4000 „ 3. Linnekogel 1000 „ 4. Römpler 500 , 14000 M. Flugwoche Breslau. Die Jahrhundert-Feier-Flugwoche ist ziemlich programmäßig verlaufen. Interessant war der Transport-Wettbewerb. Leider beteiligten sich hieran nur 2 Maschinen, Krieger auf Albatros Eindecker und Schlegel auf Aviatik Eindecker. Schlegel hatte Pech, indem er das Zielband nicht richtig überflog. Der Preis fiel daher an Krieger. Hirth wollte am 7. Juni einen Höhenflug ausführen. Der Barograph zeigte hierbei 5000 m. Der Flugbetrieb war im allgemeinen sehr rege, so daß dem Publikum wirklich viel geboten wurde. Das Resultat. Photo grafie-Wettbewerb. 1. Leutnant Carganico (L. V. Q.-Doppeld.), drei Aufstiege, 389 Punkte; Ehrenpreis. 2. Stoeffler (Aviatik-D.), 3 Aufstiege, 380 Punkte, 1. Preis 4000 Mark. 3. Friedrich (Etrich-T.), 1 Aufstieg, 122 Punkte, 2 Preis 2000 Mark. 4. Schlegel (Aviatik-E.), 1 Aufstieg, 118 Punkte, 3. Preis 1000 Mark. 5. Krieger (Albatros-E.), 1 Aufstieg, 115 Punkte, Die Leistung Kriegers kann nicht gewertet werden, da er die vorgeschriebene Höhe von über 800 m während der Aufnahme nicht erreicht hat. Die Leistungen der Offiziere als Flugbegleiter bzw. Photographen ergaben folgende Reihenfolge mit folgender Bewertung nach Punktzahl: Hauptmann Kaupisch 246 Punkte. Hauptmann Hellmich 218 Punkte. Hauptmann Thilo 215 Punkte. Major Engel 200 Punkte. Lt. d. R. Winkler 171 Punkte-Oblt. Zimmermann 170 Punkte. Lt. v. Woikolwski 106 Punkte Lt. Esche 74 Punkte. Lt. Hoppe 61 Punkte. Transport-Wettbewerb: 1. Krieger (Albatros-Eindecker) 1:10, 1. Preis 6000 Mark. 2. Schlegel (Aviatik-Eindecker) 1:39, 2. Preis. 2500 Mark. Den Ehrenpreis des Prinzen Sigismund von Preußen, ausgeflogen als Sonderhöhenpreis, erhielt Lt. Carganico, der eine Höhe von 1655 m erreichte. Dauer der Flüge: 1. Friedrich (Etrich-Taube) 8:29, 1696 Mark. 2. Stagge (Wright-Doppeldecker) 7:18, 1460 Mark. 3. Stoeffler (Aviatik-Doppeldecker) 5:20, 1069 Mark. 4. Schlegel (Aviatik-Eindecker) 4:59, 1000 Mark. 5. Schall (Grade-Eindecker) 4:46, 955 Mark. 6. Jahn (Grade-Einder.ker) 3:17, 660 Mark. 7. Krieger (Albatros-Eindecker) 0:48, 160 Mark. Anzahl der Flüge: 1. Schlegel, 37 Aufstiege, 1904 Mark. 2. Friedrich, 33 Aufstiege, 1699 Mark. 3. Stoeffler, 30 Aufstiege, 1544 Mark. 4. Schall, 15 Aufstiege, 772 Mark. 5. Jahn, 10 Aufstiege, 515 Mark. 6. Stagge, 8 Aufstiege, 412 Mark. Höhen-Wettbewerb: 1. Stoeffler, 3130 m, 5000 Mark 2. Krieger, 3030 m, 2000 Mark. 3. Lt. Carganico, 2575 m, Ehrenpreis. 4. Schlegel, 2440 m, 1000 Mark. 5. Krieger, 2135 m. Flugzeugrennen um den Kai s e r-Ju b i läums p r e i s. 1. Lt. Carganico (L. V. G.-D ) 24 Min., Ehrenpreis 245 Mark 2. Schlegel, (Aviatik-E.) 26 Minuten, Geldpreise 266 Mark. 3. Stoeffler (Aviatik-D.) 28 Minuten, Geldpreis 210 Mark. 4. Friedrich (Etrich-T.) 36 Minuten, Geldpreis 164 Mark. 5. Krieger, (Albatros-E.) 38 Minuten, Geldpreis 155 Mark. Insgesamt erhielten an Preisen: Stoeffler 12 023 M., Krieger 8469 M., Schlegel 8230 M., Friedrich 5559 M., Stagge 2672 M., Schall 20:7 M., Jahn 1175 M., Lt Carganico (Ehrenpreis) 245 M. Von der Wiener Flugwoche. Die Wiener Flugwoche, das größte österreichische flugsportliche Ereignis, ist beendigt. Unter den 24 Fliegern waren verhältnismäßig sehr wenig deutsche. Frankreich dagegen war mit 10 Fliegern vertreten. Man sieht, daß für die Deutschen in Deutschland noch genug zu holen ist, während die Franzosen im Ausland suchen müssen, auf ihre Kosten zu kommen. Sportlich brachte die Veranstaltung einige sehr gute Leistungen. Den Eröffnungspreis belegte der Schweizer Audemars mit einem Flug von .'3 Minuten 48 Sekunden. Am ersten Flugtag wurden anläßlich des Wettbewerben um den Höhenpreis folgende Leistungen erzielt: Iiiner auf einem Lohner-Pfeil-Doppeldecker erreichte nach offizieller Kontrolle mit 2 Fluggästen 4580 m, der Franzose Perreyon auf Bleriot 4540 m. Da hingegen Perreyon früher flog als Jllner, hält den Weltrekord Perreyon mit 4540 m, da bekanntlich ein Rekord, wenn er anerkannt werden soll, um 150 m überboten werden muß. Am zweiten Flugtag wurde der Höhenrekord mit zwei Fluggästen durch den Oesterreicher Iiiner gedrückt, indem er auf seinem Lohner-Pfeil-Doppeldecker 5180 m erreichte. Jllner verwendete bei seinen Rekordflügen einen 6 Zyl. wassergekühlten 120 PS Austro-Daimler Motor von 130 Bohrung und 175 Hub. Das Gewicht des Motors betrug 190 kg, der Benzinverbrauch pro PS und Stunde 250 gr und der Oelverbrauch 10 gr. Großen Eindruck machten die tollkühnen Flüge von dem Franzosen Chevillard auf einem Farman-Doppeldecker, wobei er in steilem Sturzflug niederging und kurz über der Erde den Apparat auffing. Interessant war am dritten Flugtag die Konkurrenz um den Preis des Kriegsministers, der 15000 Kr. ausgesetzt hatte für denjenigen Apparat, der bei einem Eigengewicht von 500 kg mit einer Nutzlast von 300 kg die Höhe von 2000 m in 10 Minuten erreicht. Perreyon erreichte die 2000 m mit seinem 160 PS 14 Zyl.Gnom-Motor in 9 Min. 25 Sek. Der deutsche Flieger Caspar mußte auf den Start verzichten, da seiner Gotha-Taube von Etrich Schwierig» keiten gemacht wurden. Leider mußte am Sonnabend infolge des schlechten Wetter die Veranstaltung abgesagt werden. Der 22. Juni, der letzte Flugtag, brachte bedauerlicher Weise einen Unfall. Der französische Flieger Molla auf Rep stieß mit dem Oesterreicher Stanger auf Lohner-Pfeil-Doppeldecker in ca 20 m Höhe zusammen. Beide Apparate stürzten schwer beschädigt zur Erde. Flieger und Fluggäste erhielten einige nicht lebensgefährliche Verlegungen. Sablatnig auf dem deutschen Union-Pfeil-Doppeldecker erzielte mit seinem 120 PS Austro-Daimler beim Distanzflug, einem Rundflug durch Nieder-Oester-reich über eine Entfernung von 225 km den ersten Preis. In Konkurrenz befanden sich Totard auf Sanchez-Besa und Bregi auf Breguet. 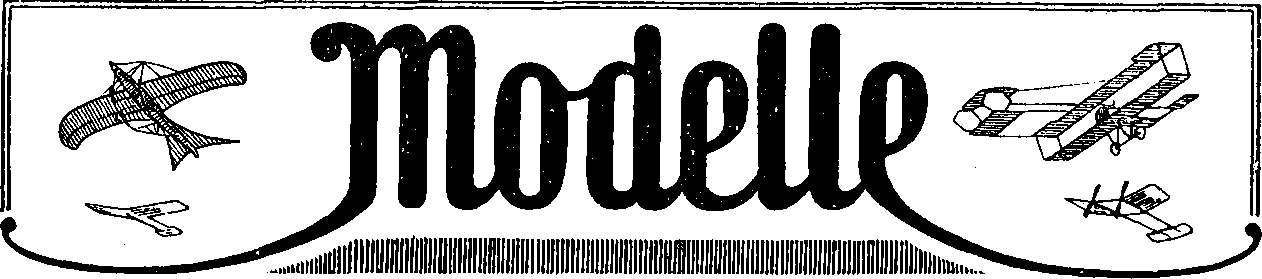 Der Modellmotor System Braune (Abb. 1). Zur Ergänzung unserer Beschreibung in „FLugsport" No. 12 führen wir unsern Lesern eine Konstruktionszeichnung des Braune Modellbenzinmotors vor. Das Kurbelgehäuse besteht aus Aluminium, welches einen breiten Flansch zur Befestigung des Motors hat. Die Zylinder stehen V förmig zueinander und sind 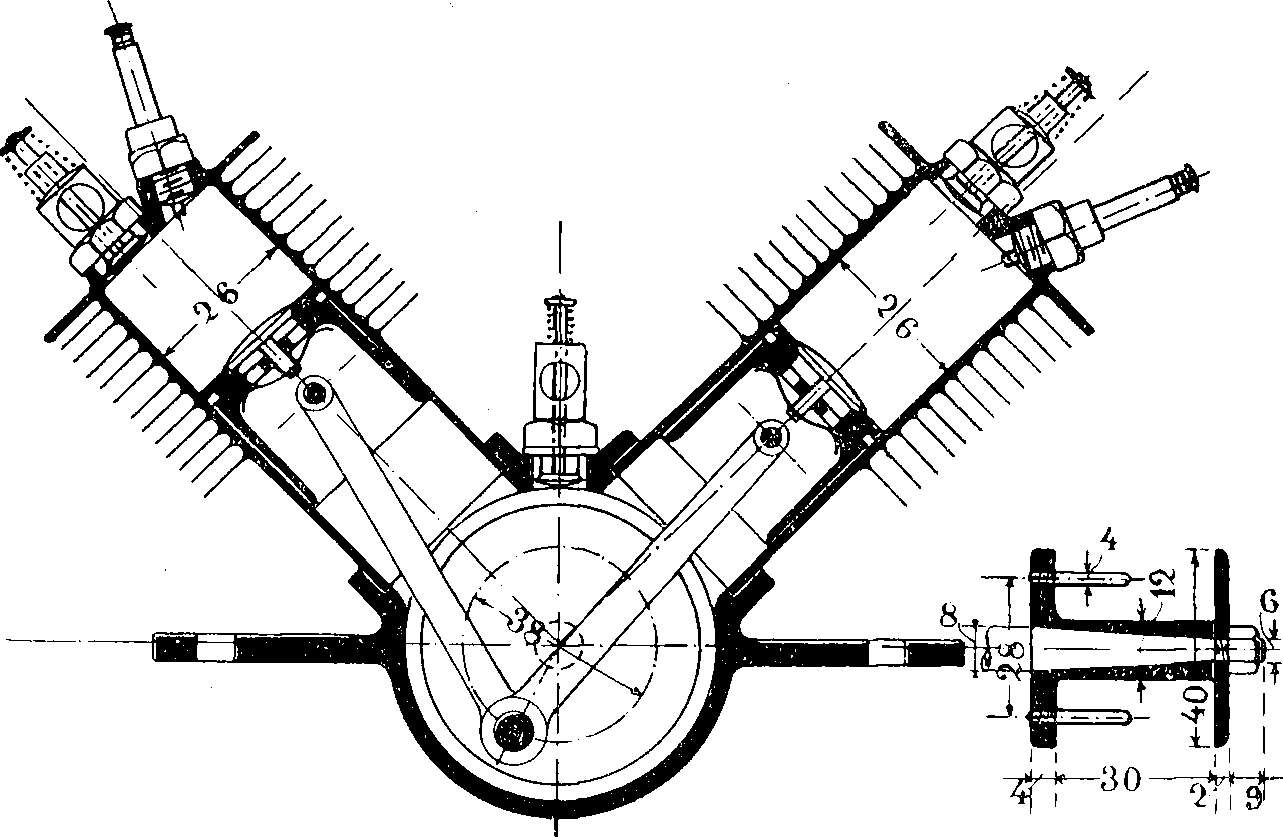 Abb. 1. Konstruktionszeichnung des Braune Modellmotors. an das Kurbelgehäuse mit 4 Durchgangsbolzen angeschraubt. Dieselben gehen durch ; die Kühlrippen und endigen auf der verstärkten obersten Kühlrippe des Zylinderkopfes. In demselben ist eine Zündkerze und ein gesteuertes Auspuffventil untergebracht. Das Ansaugen erfolgt durch das Kurbelgehäuse. Zwischen den beiden Zylindern sitzt ein Ansaugventil. Von hier aus gelangt das Gasgemisch durch die Kolbenventile in den Explosionsraum. Die Ventile werden durch eine geschweifte Blattfeder auf den Kolbenboden gedrückt und offnen sich automatisch beim Ansaughub. Die Oelung ist die sogenannte Schleuderölung. Alles Nähere geht aus Abb. 1 hervor. Das Smith-Doppeldeckermodell, welches in Abb. 2 konstruktiv dargestellt ist, wurde auf der Olympiaschau ausgestellt. Es hat eine Spannweite von 70 cm und eine Länge von 90 cm. Die Tragflächen sind nach vorn gestaffelt und unter einen Winkel von 4 Grad eingestellt. Der Motorstab ist durch 2 Spannsäulen verspannt. Der Antrieb des 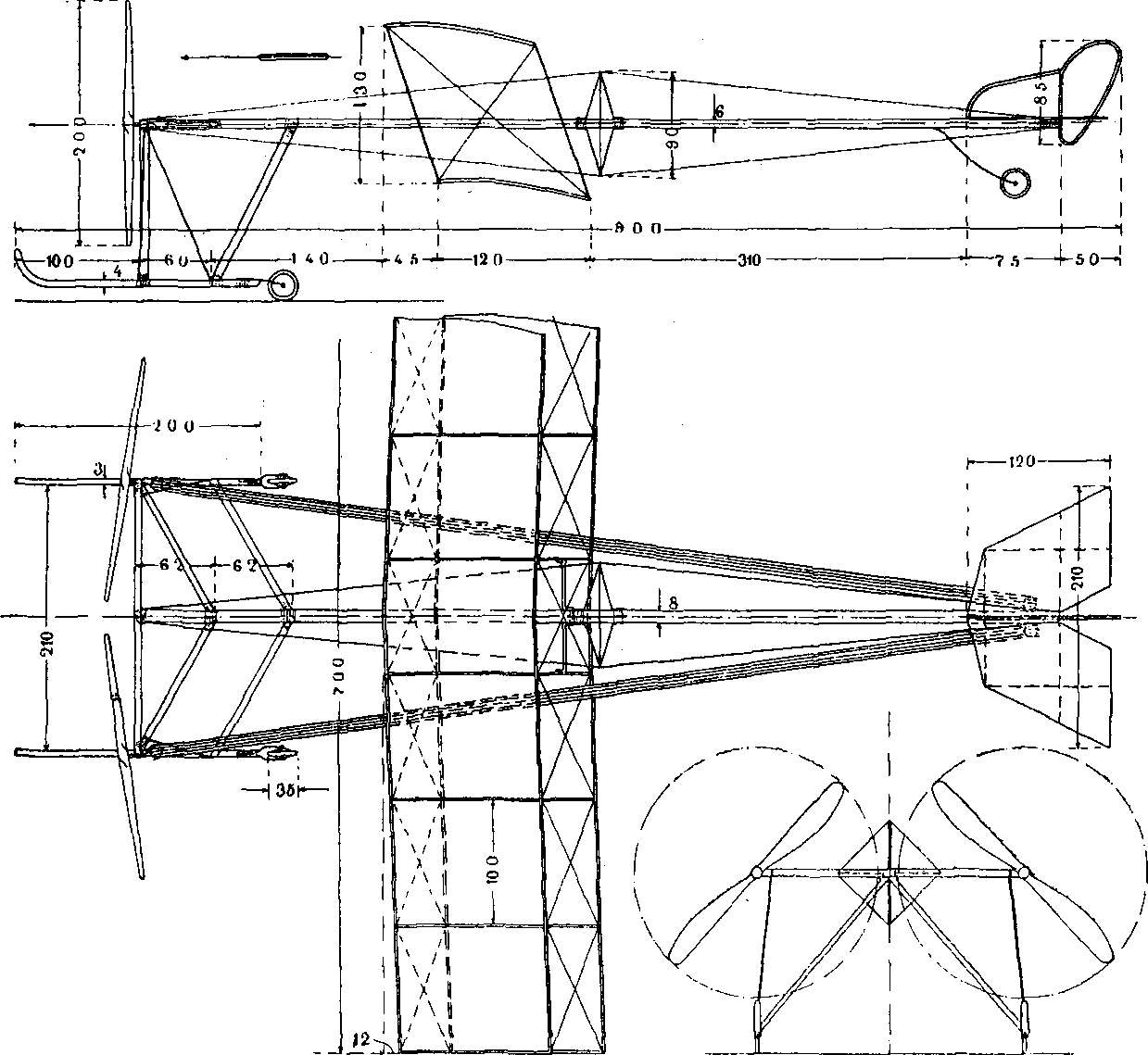 Abb. 2. Das Smith Doppeldeckermodell. Modells erfolgt durch 2 Gummimotoren. Der Propellerdurchmesser beträgt 20 cm. Das Anfahrgestell ist nach dem Zweikufensystem ausgebildet und trägt 2 separat abgefederte Rädchen von 35 mm Durchmesser. Die Schwanzfläche ist gleichfalls durch ein abgefedertes Rädchen unterstützt. Das Modell zeichnet sich durch kurzen Anlauf, geringes Gewicht und stabilen Gleitflug aus. Das Anfahrgestell ist sehr zweckmäßig und schützt infolge der weit vorragenden Kufen äußerst vorteilhaft die Propeller. Dreiteiliger Motorstab aus Aluminiumrohr. Der aus beistehender Abb. ersichtliche Motorstab ermöglicht ein leichtes Schwerpunktverschieben und schnelles Auseinandernehmen des Modells. Eine b m'r a .1 jEt* h Verspannung desselben ist -cx=rr=v^~-- -jg;—-if—'- i^g--1---—i deshalb unnötig, weil der ~~£2^\ , Stab entsprechend seiner Knickbeanspruchung den größten Querschnitt in der Mitte hat. Man ist daher in der Lage, längs des Stabes Multiplikatoren anzubringen. Dieser Motorstab besteht in der Mitte aus einem Aluminiumrohr a von 7 mm Außendurchmesser und \ mm Wandstärke. An den Enden desselben befinden sich zwei Schellen c. In das Mittelstück a werden teleskopartig zwei Rohre b von 6 mm Außendurchmesser und \ mm Wandstärke geschoben. Mittels der Schellen c werden die Rohre b am Verschieben gehindert. Führt man dagegen den Motorstab zweiteilig aus, so ist eine Verspannung desselben erforderlich. Fediner. Der Verein für Luftfahrt E. V. in Darmstadt veranstaltet in der Zeit vom 9.-12. Oktober 1913 in Darmstadt eine Flugzeugmodell-Ausstellung, mit der am 12. Oktober ein Wettbewerb freifliegender Flugzeugmodelle, Gleitflugzeugmodelle und Drachen verbunden ist. Die Ausstellung umfaßt Flugzeugmodelle und Gleitflugzeugmodelle aller Art, Zubehörteile zum Bau der Modelle, Drachen, Literatur, Photographien, Pläne, Zeichnungen, Bilder usw., die das Mödellflugwesen betreffen. Die Ausstellung ist kostenfrei für alle zugelassenen Aussteller, mit Ausnahme solcher, die die ausgestellten Gegenstände gewerbsmäßig herstellen oder vertreiben. An Geldpreisen sind für den Flugwettbewerb etwa 800 Mark vorgesehen, ferner zahlreiche Ehrenpreise Die Ausstellungs- und Wettbewerb-Bedingungen, sowie Anmeldeformulare sind gratis von der Geschäftsstelle des Vereins für Luftfahrt E. V. Darmstadt, Landgraf-Philipp-Anlage, erhältlich. Frankfurter Flugmodell-Verein. Die nächste Mitglieder-Versammlung findet Donnerstag den 3. Juli, abends '/*9 Uhr im Restaurant „Stadtgarten" statt, und werden die Mitglieder gebeten, Modelle sowie Einzelteile zur Besprechung mitzubringen. Tagesordnung: 1. Eingänge. 2. Besprechung einer Ausstellung. 3. Besprechung der Modelle etc. 4. Verschiedenes. Modell-Uebungsfliegen finden Sonntag den 29. Juni und 6. Juli, vormittags zwischen 7 und 11 Uhr auf dem Gelände der ehemal. Rosenausstellung statt, während Sonntag den 13. Juli, nachmittags von 6—8 Uhr auf dem Eulerflugplatz ein Modell-Prämienfliegen stattfindet. Die verehrl. Modellflug-Vereine werden gebeten, die mit Modellen bei Bodenstart erzielten Flüge im „Flugsport" zu veröffentlichen. Wir möchten hierzu aber noch ausdrücklich bemerken, die Flüge in gerader Linie und nur bei Bodenstart zu messen. Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an den Vorsitzenden Fritz Wittekind, Frankfurt a. M., Eppsteinerstr. 26. Einen Uebermainflug mit Wasserflugmodellen veranstaltet am 17. August der Frankfurter Flugmodell-Verein. Der Abflug-platz befindet sich nördlich des Euler-Flugplatzes bei Niederrad. Die Anmeldung hat bis spätestens den 6. August abends 6 Uhr bei der Geschäftstelle des Frankfurter Flugmodell-Vereins, Eppsteinerstraße 26, zu erfolgen. Die Bedingungen sind von Fritz Wittekind, Eppsteinerstr. 26, zu beziehen. Zuschrift an die Redaktion. (Ohne Verantwortung der Redaktion.) In Nr. 12 Ihrer gesch. Zeitschrift finden wir in der Fortsetzung „Die Frühjahrsflugwoche Johannisthal" die unrichtige Angabe, daß der Flieger Gustav Adolf Michaelis auf einer „Etrich-Taube" abgestürzt ist. Es dürfte Ihnen bekannt sein, daß die Sportflieger O. m. b H, welche die Vertretung unserer Etrich-Flieger-Werke inne hat, außer einer Etrichtaube eine selbstgebaute „Sportfliegertaube" zur Flugwoche genannt hat, wie aus der Nennungsliste ersichtlich ist. Wenn auch alle übrigen Monoplane der Sportflieger Ges. Etrichtauben sind, so kann daraus nicht gefolgert werden, daß ein von der Sportflieger Ges. selbst gebauter und stark veränderter Apparat auch als solcher bezeichnet und der Name Etrich als Konstrukteur desselben genannt wird. Ich lege besonderes Gewicht darauf, da bisher auf Tauben der Original-Etrichkonstruktion noch kein Pilot tödlich verunglückt ist und dieser Ruf nicht durch dergleichen Vorkommnisse willkürlich aufs Spiel gesetzt werden kann. Etrich-Flieger-Werke, G m. b. H. gez. Ignaz Etrich. 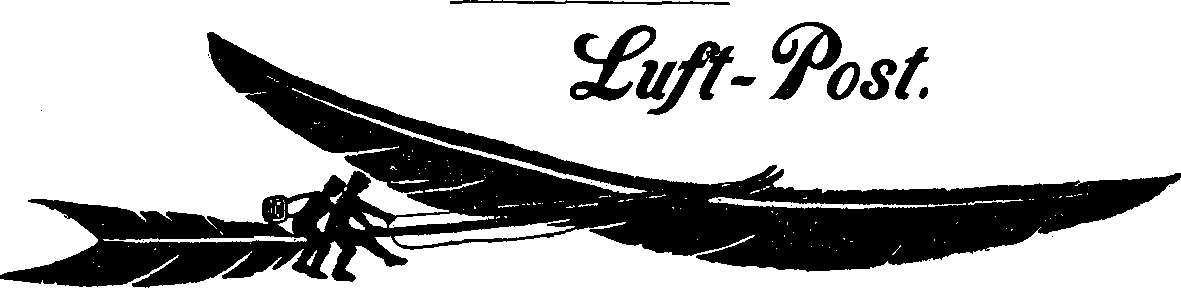 Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.) A. W. Aus Konkurrenzrücksichten können wir Ihnen die gewünschten Adressen nicht angeben. Wir verweisen Sie daher auf unseren Inseratenteil. A. K. Die Abmessungen des Richter Gleitflieger sind folgende: Die Spannweite beträgt 7,5 m, die Flächentiefe 1,7 m, der Flächeninhalt i2 qm, das Gewicht 35 kg und der Preis Mk. 300.—. C. M. Das Kurvenfliegen der Modelle verhindert man durch entsprechende Einstellung der Seitensteuer und der Flügelenden, ruhige Luft vorausgesetzt. Bei Ihrem Modell werden die Einfallswinkel der Tragflächen nicht genau übereinstimmen, oder es ist eine Seite etwas schwerer gebaut als die andere. F. K. Einer der ersten Apparate, welche ohne Seitensteuer ausgeführt wurden, ist der, „Avion" von „Ader". Das Wenden der Maschine erfolgte durch verstärkte Verwindung des einen oder anderen Flügels. Siehe „Das Flugzeug in Heer und Marine" Seite 154—155. Ein moderner Apparat, welcher gänzlich ohne Seiten- und Höhensteuer fliegt, ist der schwanzlose Dunne-Eindecker, der im „Flugsport" Nr. 19 Jahrg. 1911 Seite 662 ausführlich beschrieben worden ist. Literatur.*) Jahrbuch der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Flugtechnik. I. Bd. 1912/13 1. Lieferung. Verlag Julius Springer Berlin. Die Broschüre gibt einen umfassenden Ueberblick Uber den Wirkungskreis der Wissenschaftlichen Gesellschaft. Außer dein Mitgliederverzeichnis sind eine Reihe von Diskussionen bekannter führender Fachleute der Flugtechnik angeführt, welche den Gedankenaustausch obiger Gesellschaft aufs trefflichste zum Ausdruck bringen. Das militärische Verkehrswesen der Gegenwart von Otto Romberg Verlag E. S. Mittler & Sohn, Berlin 1913, Preis 0,8nM. Die Broschüre gibt einen gedrängten Ueberblick über den heutigen Stand des Militärverkehrswesens. Dem Luft- und Kraftfahrwesen ist besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Ausführlich werden die Chancen letztgenannter Verkehrszweige in Verbindung mit drahtloser Telegrafie erörtert. *) Sämtliche besprochenen Bücher können durch die Expedition des „Flugsport" bezogen werden.  Jllustrirte No 14 technische Zeitschrift und Anzeiger Abamm,mt: q lu|i für das gesamte Kreuzband M.14 3- JU" & Postbezug M. 14 1913. ja&rg. U. ^pJu^^ygg^n" pr°Jahr' unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef. 4557 ftmt I. Oskar Ursinus, Civilingenieur. Tel.-Adr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 23. Juli. Bodensee Wasserflug 1913. Ingenieur Oskar Ursinus. Der Wasserflug-Wettbewerb am Bodensee ist programmäßig am 5. Juli zu Ende gegangen. Abgesehen von einigem Kleinholz, ohne das es bei einer Flugveranstaltung überhaupt nicht abgeht, sind Unfälle und Verletzungen nicht zu verzeichnen. Dank der selbstlosen intensiven Arbeit sämtlicher Mitglieder des Arbeitsausschusses und der mustergültigen Organisation, hat sich die Veranstaltung in einer selten harmonischen Weise abgewickelt. Sie wird sicher allen denjenigen, die der Veranstaltung beiwohnten, stets in Erinnerung bleiben. Und jetzt das Wichtigste, die Leistungen und Erfolge. Hierzu genügt es, das Urteil des schärfsten maßgebenden Kritikers, der Marine, heranzuziehen. Die Kritik lautet „sehr gut". . . Es ist bedauerlich, daß auch bei dieser Veranstaltung in verschiedenen Tageszeitungen von Fachleuten, die sich eine Autorität anmassen, eine nicht zutreffende Kritik geübt wurde und zwar kann jederzeit nachgewiesen werden, daß die Schreiber der Artikel es nicht für nötig befanden, sich persönlich über den Vorgang und die technischen Einzelheiten an Ort und Stelle zu informieren. Die Artikel erschienen sogar teilweise vor der Veranstaltung. — — ? Die an dem Bodensee-Wettbewerb beteiligt gewesenen Industriellen haben ungemein viel gelernt, insbesondere diejenigen Firmen, die ihre Maschinen überhaupt noch nie auf dem Wasser hatten. Bei der nächsten Hochseekonkurrenz wird es unbedingt nötig sein, für die gemeldeten Maschinen eine Zulassungs-Prüfung auf irgend einem Binnensee, der der gemeldeten Firma am nächsten liegt, vorzuschreiben. Dies hätte auch für die nennende Firma den Vorteil, etwaige Mängel noch beseitigen zu können. * Konstruktive Einzelheiten. Der siegreiche von Hirth gesteuerte Albatros-Eindecker ähnelt in seinem Aufbau der Landmaschine vom Prinz Heinrich-Flug. In den aus Sperrholz hergestellten flunderförmigen Rumpf ist vorn der 100 PS 6 Zyl. Mercedes-Motor mit einer Schraube von 2,6 m Durchmesser eingebaut. Führer- und Gastsitze befinden sich nicht wie bei der Oberrhein-Maschine nebeneinander, sondern hintereinander. Die Spannweite der Maschine mißt 12,6 m, die Gesamtlänge 8,6 m und die Höhe 2,85 m. Das Tragdeckenareal beträgt 25 qm und die 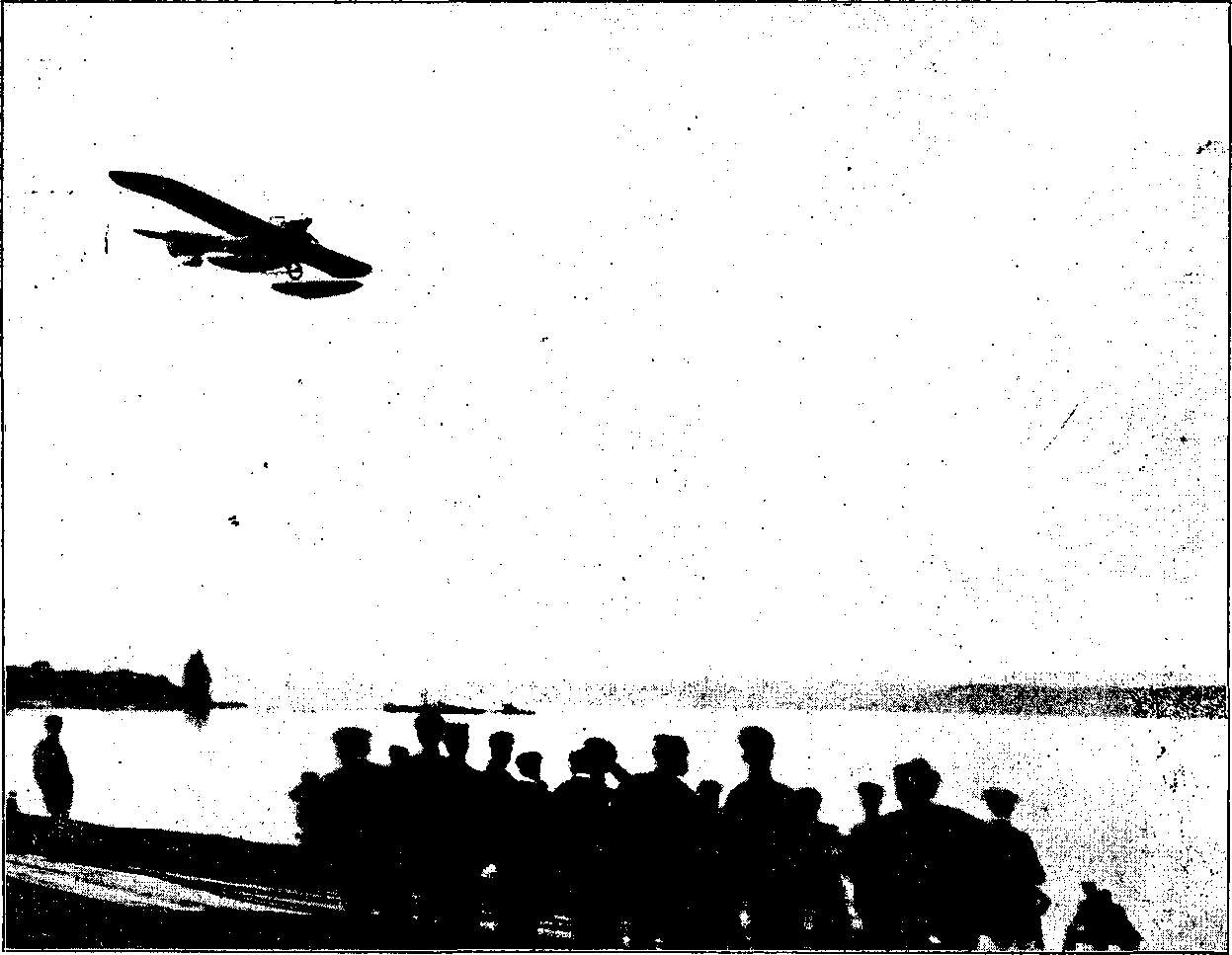 Bodensee- Wasserflug. Hirth auf Albatros-Eindecker startet für den „Großen Preis." spezifische Tragflächenbelastung pro qm 45 kg. Die Verspannung der Tragflächen ist nach unten unabhängig von den Schwimmern unter* Vermittlung eines kufenförmigen Teils, an den die beiden geteilten Radachsen angreifen, durchgeführt. Der Mechanismus des hochziehbaren Fahrgestells ist in der umstehenden schematischen Skizze (Abb. 1) 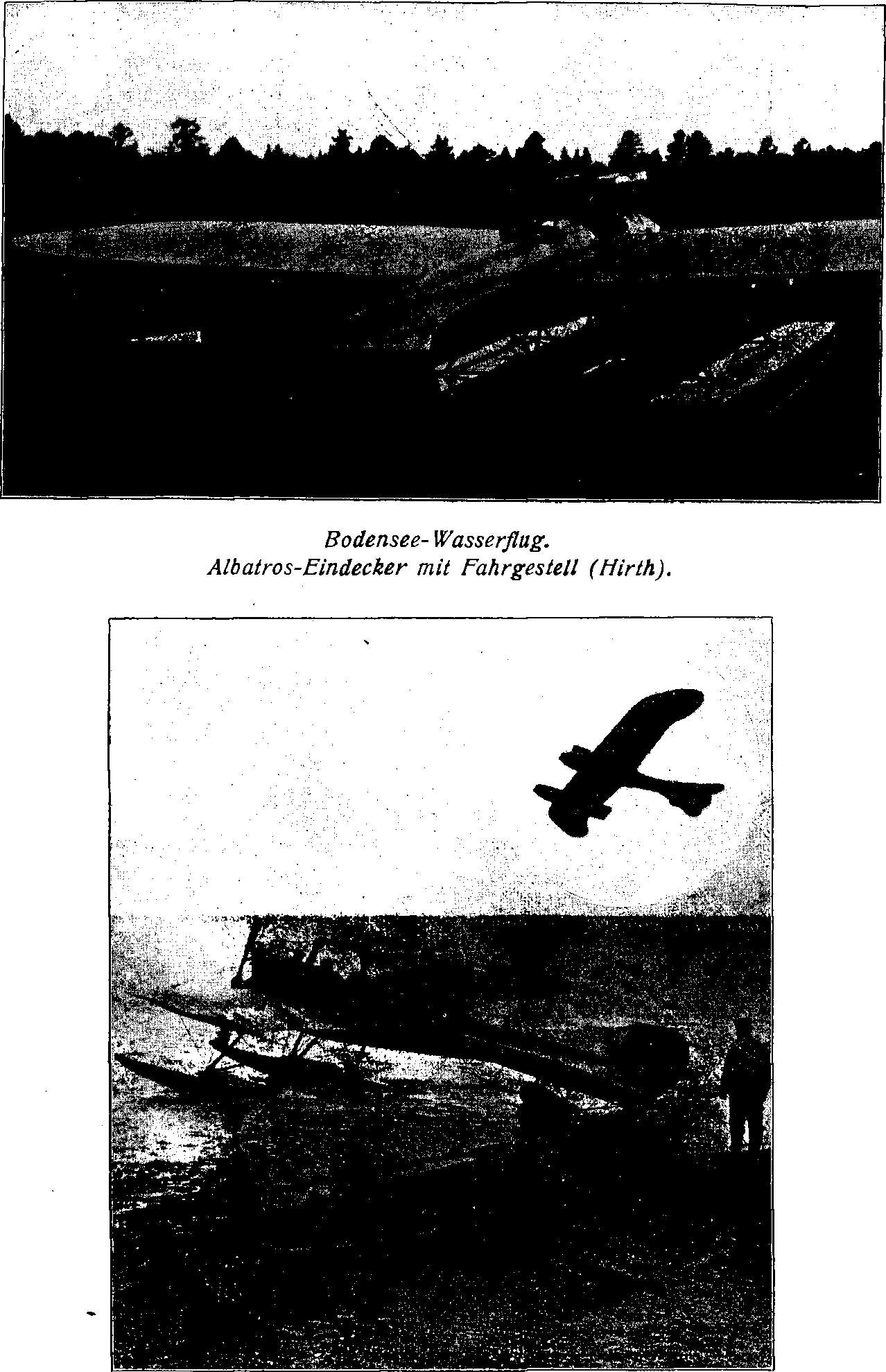 Bodensee- Wasserflug. Albatros-Eindecker ohne Fahrgestell (Vollmöller). dargestellt. Die Stoßstange a greift mittels Scharnier an der Radachse b an und trägt oben den Rumpf unter Vermittlung von Gummiringen c. Diese Gummiringe sind in einen Rahmen d eingespannt, der mit einem Ende um den Punkt e schwenkbar ist, während das 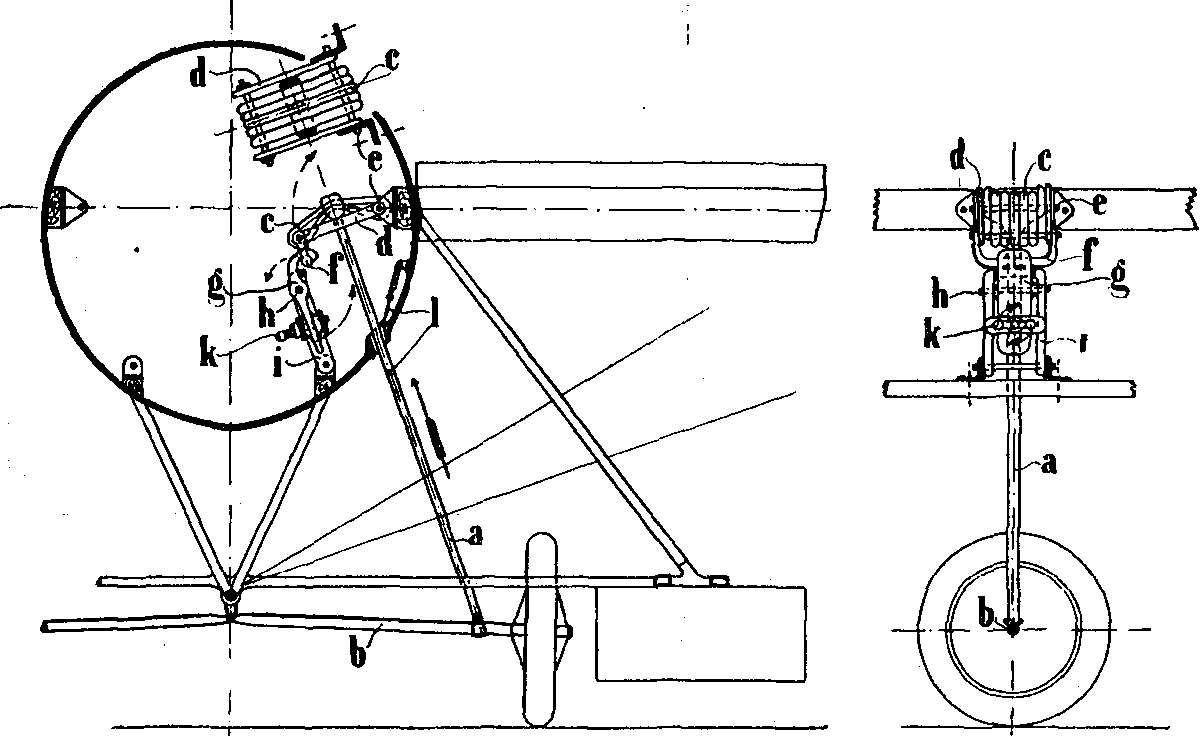 Hodiziehbares Fahrgestell Albatros-Eindedier (Hirth) Abb. 1. andere Ende unter Vermittlung des Bügels f durch den Haken g festgehalten wird. Derselbe ist um den Bolzen h in dem Rahmen i drehbar gelagert und wird durch den Wirbel k arretiert. Wird der Wirbel k | g p um 90° gedreht, so IJi ''Ifml schwenkt der Haken g um den Bolzen h und gibt den Abfederungsrahmen d frei. Dieser wird nach oben gedreht, worauf die Stange a vom Fluggast hochgehoben und durch den Vorstecker 1 am Niedersenken gehindert wird. Der Rad abstand beträgt 2,2 m. Zu beiden Seiten des Fahrgestells sind in einem Abstand von einander von Mitte zu Mitte in 3,8 m Entfernung die mit dem 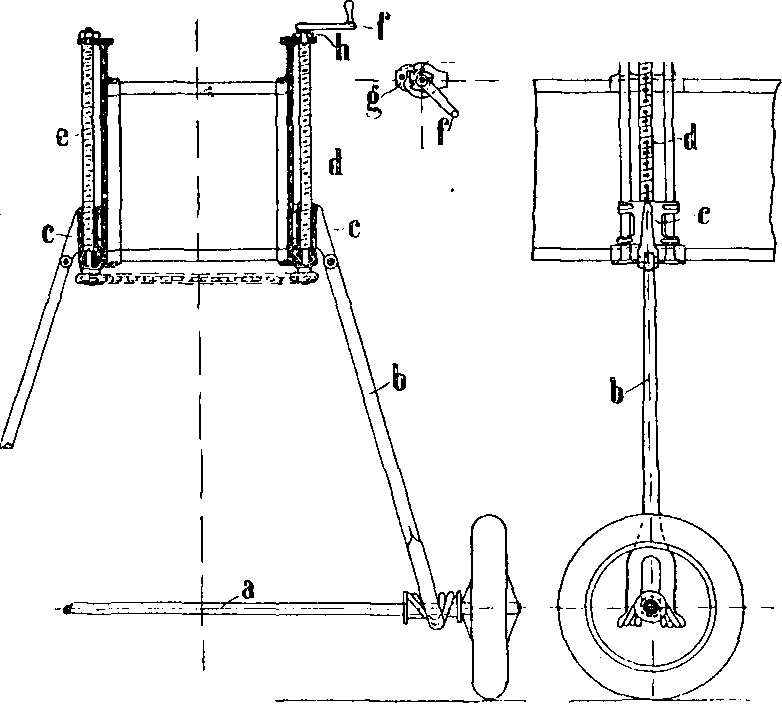 Abb. 2 Rumpf direkt versteiften stufenförmigen Haupttragschwimmer von je 9001 Deplacement angeordnet. Die vordere Gleitfläche der Schwimmer ist im Verhältnis zu dem hinter der Stufe liegenden Teil sehr lang ausgebildet. Die Schwimmer sind durch Schotten abgeteilt, die durch kleine ovale Aluminiumverschlußdeckel zugänglich sind. Zur Unterstützung des hinterlastigen Gewichtes dient ein kleiner tropfenförmiger Hilf ssoh wimmer. Der von Vollmöller gesteuerte Albatros-Sporteindecker ist aus der Prinz Heinrich Flugmaschine hervorgegangen. Vorn 1 befindet sich der 75 PS 6 Zyl. Stahl-Mercedes-Motor und dahinter nebeneinander angeordnet Führer- und Gastsitz. Die Spannweite 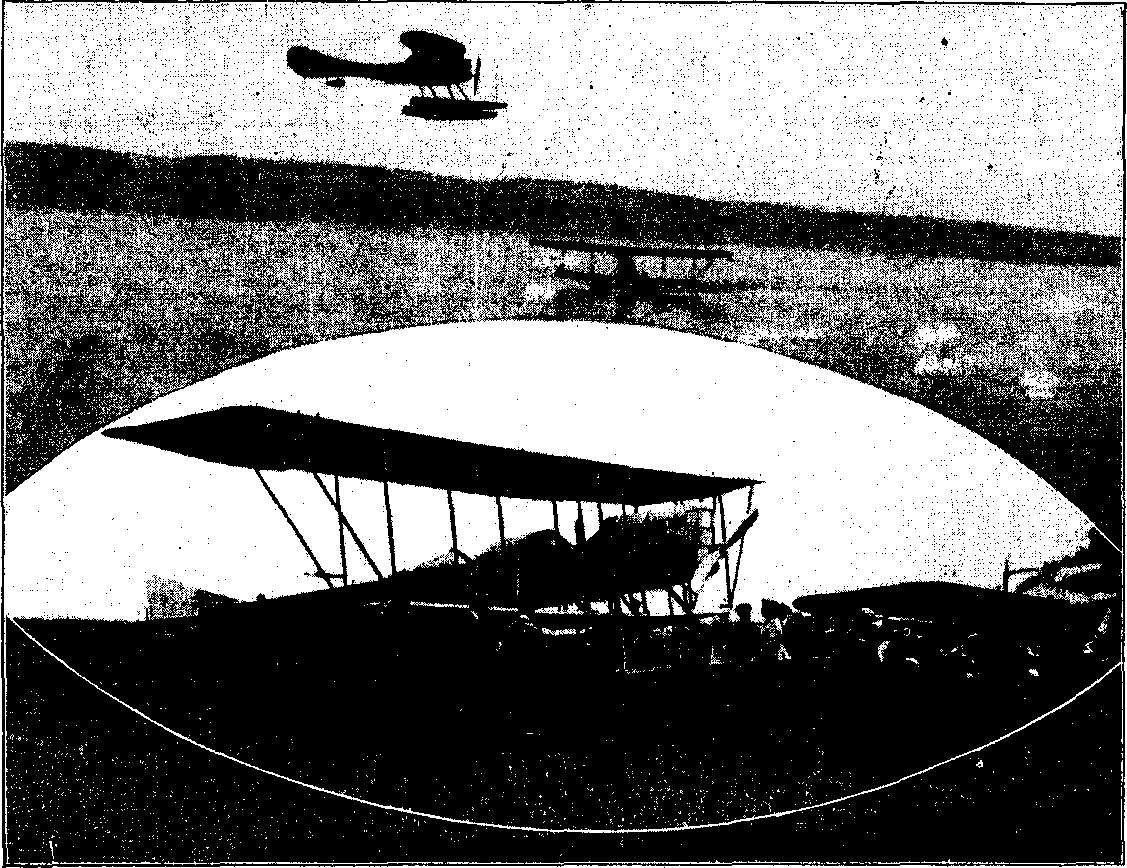 Bodensee- Wasserflug. Oben: Vollmöller auf Albatros-Sporteindecker und Theten auf Albatros-Zweidecker. Unten: Albatros-Zweidecker. beträgt 12,1 m, die Gesamtlänge 8,6 m und die Höhe 2,75 m. Die konstruktive Durchbildung der Schwimmer ist die gleiche wie bei dem vorbeschriebenen von Hirth gesteuerten Eindecker. (Vergl. die Abb.) Der von Thelen gesteuerte Albatros-Doppeldecker mit vorn liegendem 100 PS 6 Zyl. Mercedes-Motor und leicht V-förmig gestellten Tragdecken besitzt eine Spannweite von 14,6 m und eine Gesamtlänge von 10 m. Die Höhe mißt 4,2 m. Der Führersitz befindet sich hinter dem Gastsitz. Die das Hauptgewicht tragenden beiden Schwimmer sind glatt (ohne Stufen). Zur Unterstützung des Schwanzes dient ein an den Kampf anschließender Hilfsschwimmer. Sehr robust und sachgemäß war bei diesem Wasserflugzeug das hochziehbare Fahrgestell ausgebildet. (S. Abb. 2).
Auf die über die Radachse a gelegten Gummiringe stützt sich die gegabelte Strebe b. Diese Strebe greift mittels Kugelgelenk an einem Führungsstück c an. Durch die Schraubenspindeln d und e werden die Führungsstücke c hochgezogen bezw. niedergelassen. Der Antrieb der Spindel erfolgt durch die Kurbel f, unter der sich ein mit Sperrklinke gesichertes Sperrad g und h befindet. Unterhalb des Rumpfes sind die beiden Schraubenspindeln durch eine Gelenkkette verbunden, so daß beim Drehen nur einer Kurbel bereits das Fahrgestell gehoben bezw. gesenkt wird. Der Gotha-Doppeldecker ist bereits in voriger Nummer ausführlich beschrieben worden. Das Fahrgestell desGotha-Doppeldeckers (s. Abb. 3) besteht aus einer gekröpften an Gummiringen aufgehängten Radachse. Die beiden Räder liegen zwischen den beiden Schwimmern b und c. Mittels des Hebels d und der Stange e wird die Radaehse unter Vermittlung des Seilzuges f hochgezogen und niedergelassen. Der von Kießling geführte Ago-Doppeldecker mit hintem liegendem 120 PS 6 Zyl. Motor besitzt eine Spannweite von 18 m und eine Gesamtlänge von 12 m. Die Konstruktion des Fahrgestells, wie 3 es sich bereits in Heiligendamm gut bewährte, ist die gleiche geblieben, nur daß die hinteren Stützen, die am Hinterteil des Schwimmers angreifen, mit einer Abfederung versehen sind. Es ist schade, daß aus dem Ago-Doppeldecker, auf welchem Lt. z. S. Friedensburg am Bodensee seine Marinefliegerprüfung bestand, nicht mehr herausgeholt wurde. Sehr sauber durchgeführt und abweichend von den übrigen Konstruktionen repräsentierte sich der Flugzeugbau Friedrichshafen-Zweidecker, gesteuert von Gsell. Der 140 PS N. A G.-Motor, der übrigens während der Veranstaltung ausgezeichnet lief, ist hinten eingebaut. Der Führersitz befindet sich vor dem Gastsitz. Das Hauptgewicht wird von einem langen stufenförmigen Mittelschwimmer getragen. 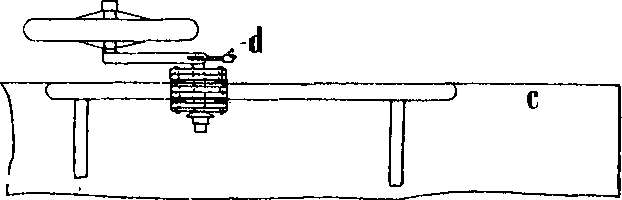 Zur Erhaltung der seitlichen Stabilität auf dem "Wasser dienen zwei kleine unter den Tragdeckenenden mit Fühlbrettchen versehene zylindrische Schwimmer. Sehr gut und robust ist das hochziehbare Fahrgestell ausge- ( bildet. (S. Abb. 4) Das Seil S führt nach einem feststellbaren Hand-'" rad am Führersitz. Beim Anziehen des Seiles wird zunächst unter" 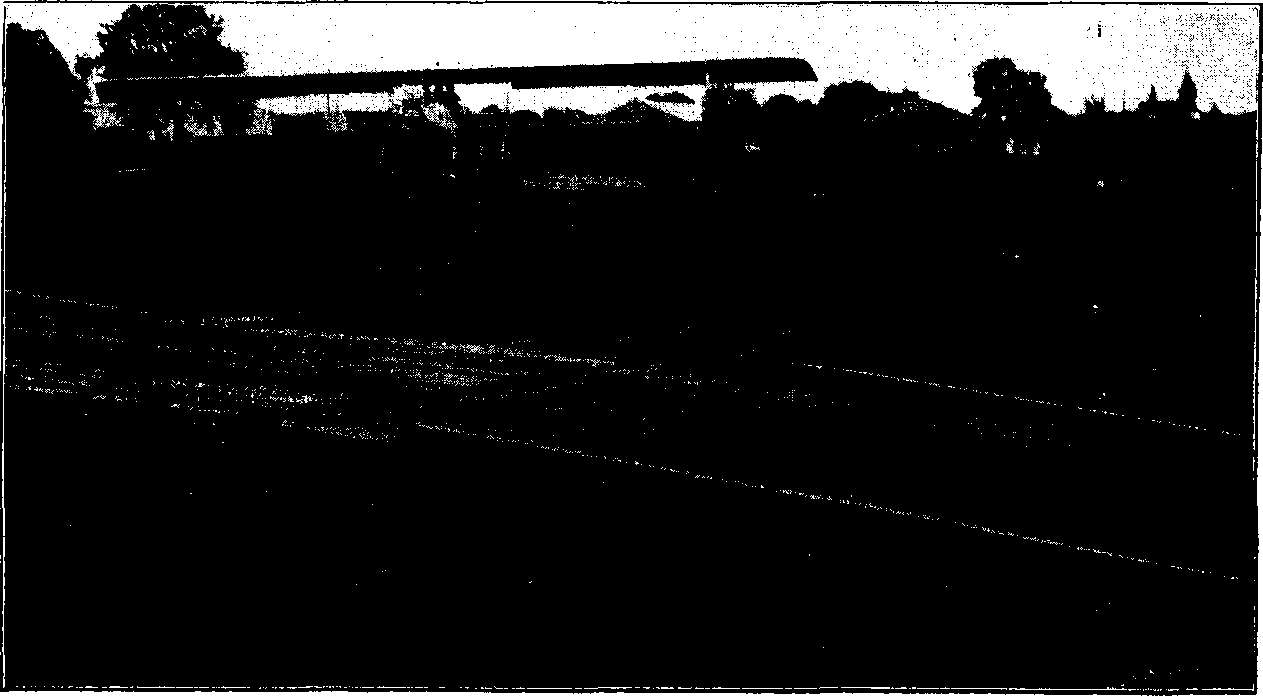 Bodensee- Wasserflug. Ago-Doppeldecker Abflug vom Lande. 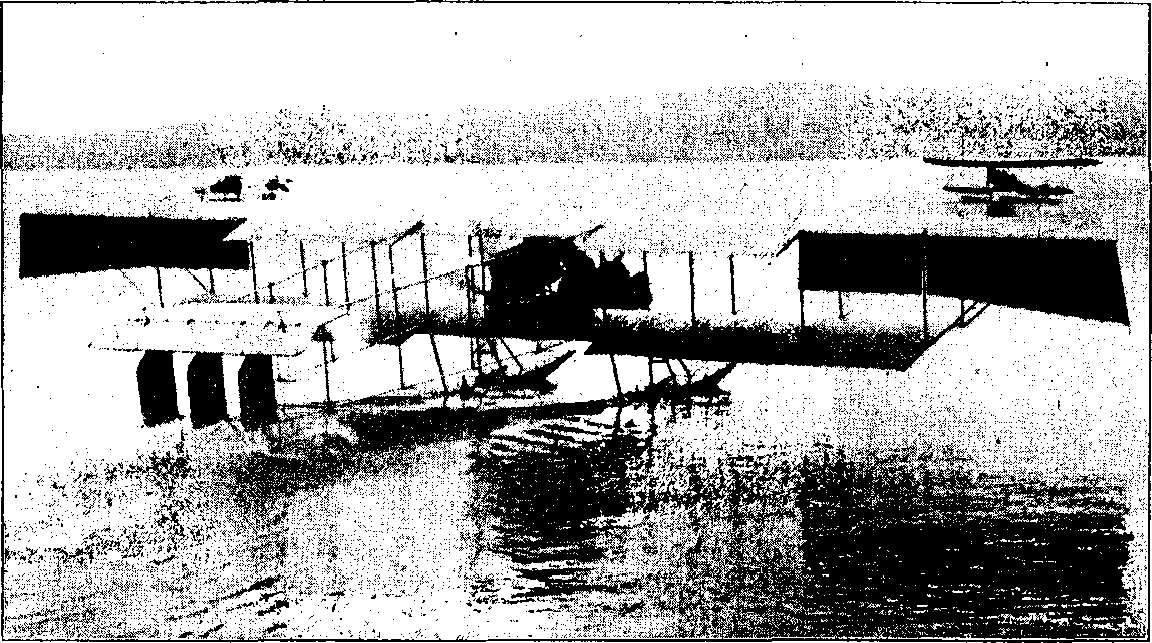 Bodensee- Wasserflug. Ago-Doppeldecker. Vermittlung des zweiarmigen Hebels a und des Seiles b der Sperrhaken c ausgeklinkt; das Dreieck d dreht sich um den Befestigungspunkt e und bringt das Dreieck f mit dem Laufrad vor die untere 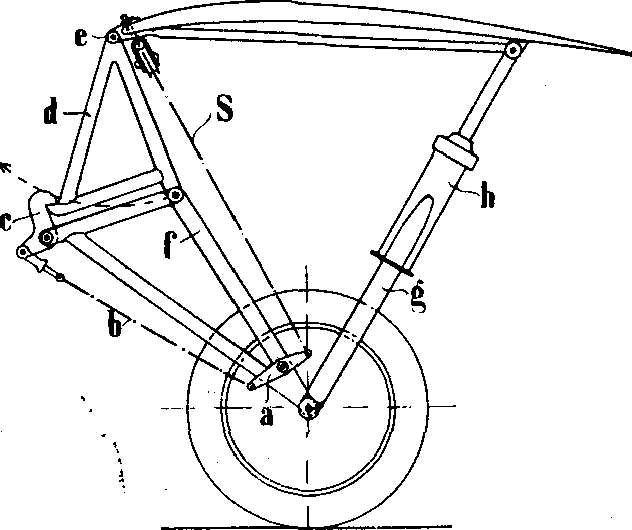 Abb. 4 Tragdecke. Die Abfederung wird durch eine Stoßstange g, in die ein Puffer h eingeschaltet, ist, bowirkt. Die Spannweite dieses Doppeldeckers beträgt 15 m und die Gesamtlänge 12 m. Zur Unterstützung des Schwanzes dient ein kleiner Hilfsschwimmer. Der von Kohnert gesteuerte Friedrichshafen Sport-Eindecker besitzt eine Spannweite von 13 m, eine Gesamtlänge von lim und eine Höhe von 3,6 m. Zum Betriebe dient ein 70 PS Argus-Motor. Das Hauptgewicht wird durch zwei Schwimmer getragen. Der über den Schwimmern liegende Kufenteil ist durch Gummiringe gegen die Schwimmer abgefedert. Zur Unterstützung des hinterlasti-chen Gewichtes dient ein kleiner metallner Hilfsschwimmer. Die Automobil- und Aviatik-Akt.-Ges. war mit zwei Maschinen vertreten, der bewährten bekannten Type, die in Heiligendamm siegreich hervorging, den Aviatik-Doppeldecker mit hinten liegendem 100 PS Argus-Motor. Fahrgestell und Einzelheiten dieser Maschine sind den Lesern dieser Zeitschrift aus früheren Veröffentlichungen bekannt. Die Spannweite beträgt 20 m, die Gesamtlänge 11 m und die Höhe 3,6 m. Die Maschine besitzt einen Haupt-Mittelschwimmer, zwei seitliche Stützschwimmer und einen Schwanzschwimmer. Neu und zum erstenmale zeigte sich an der Oeffentlichkeit der Aviatik-Pfeil-Doppeldecker, der von Stoff]er gesteuert wurde. Der 120 PS 4 Zyl. Argus-Motor ist vorn angeordnet. Das Gewicht wird von zwei Hauptschwimmern mit einer Stufe getragen. Das Landungsgestell bestand aus je zwei Räderpaaren, die links und rechts der beiden Schwimmer hochziehbar, nach einem ähnlichen Prinzip wie bei der Einschwimmer-Maschine, angeordnet waren. Der von Gustav Otto in München in den Wettbewerb entsandte Otto-Doppeldecker ähnelt in seinem Außenaufbau der bekannten Otto-Landmaschine. Der 100 PS 6 Zyl. Argus-Motor ist hinten eingebaut. Die Maschine hat folgende Abmessungen: 18 m Spannweite, 10 m Gesamtlänge und 3,5 m Gesamthöhe. Die Konstruktion des Fahrgestells für die Zweischwimmer-Maschine zeigt Abb. 5. Das Fahrgestell wird aus zwei sieh um die Schwimmer legenden Räderpaaren, deren Achsen in den Stufeneinschnitt zu liegen kommen, gebildet. Durch den Seilzug a ist das Eäderpaar b mittels der Stoßstange c um den Punkt d über das hintere Stufensohwimmerende schwenkbar gelagert. Die Abfederung wird mittels der oberhalb des Schwimmers 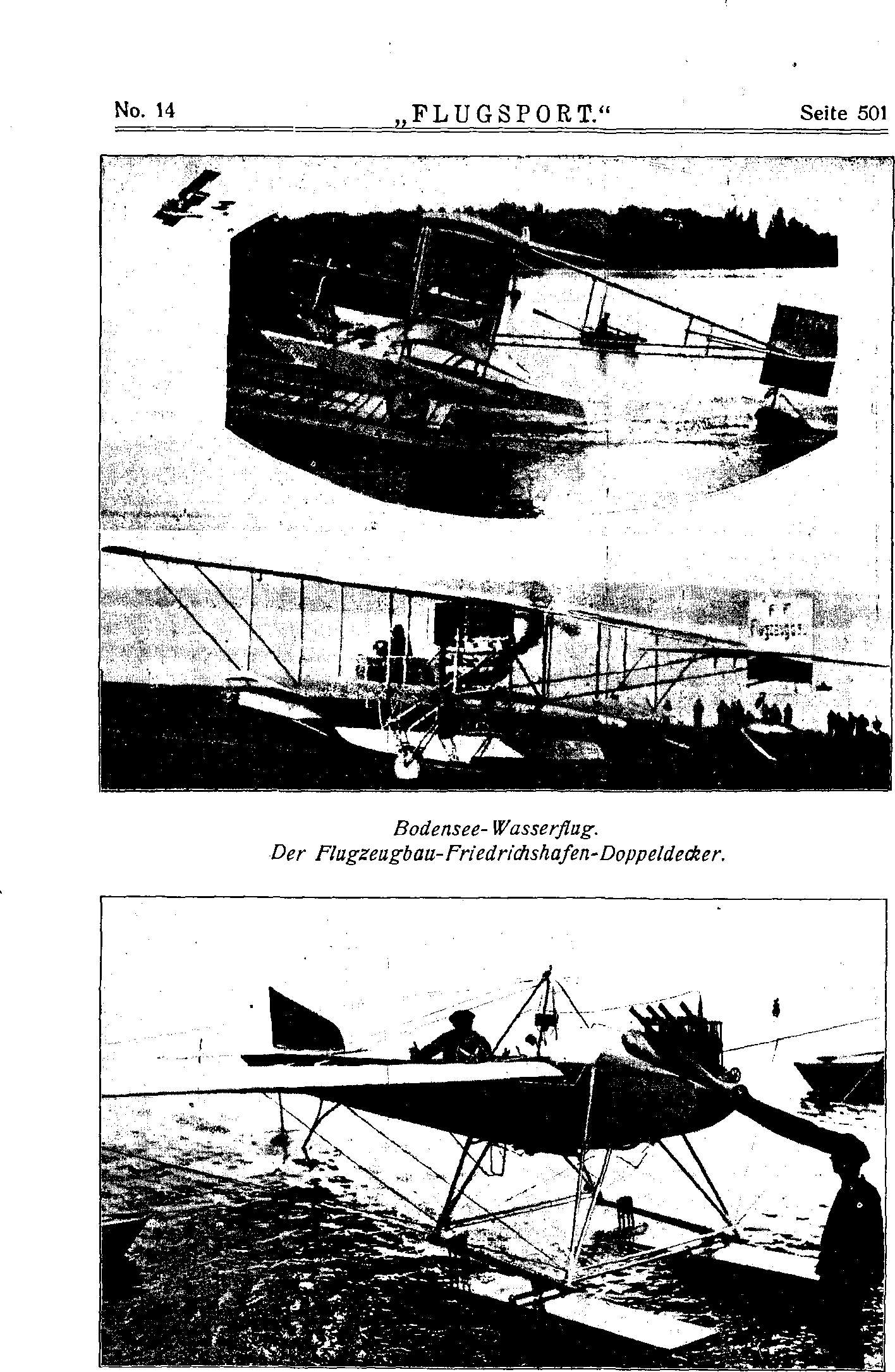 Bodensee- Wasserflug. Der Flugzeugbau-Friedrichshafen-Eindecker. angebrachten Gummiringe e und f bewirkt. Die Querstange g, welche die Abfederung auf die Bäder überträgt, ist in einer aus Stahlblech gepreßten Kulisse h geführt. Mittels Bandage wird die Kulisse auf dem hinteren Schwimmerende festgehalten. Die gekröpfte Welle ist in dem Stufeneinschnitt mittels des elastischen Polsters i gelagert. Eine eigenartige Konstruktion zeigte der Eindecker von Strack. Strack hat entgegen den bisherigen Ausführungsformen bei Wasserflugzeugen nicht das Fahrgestell, sondern die Schwimmer hochziehbar eingerichtet. Die Schwimmer werden (Siehe i Abb. 6) mittels der Seilzüge a und ' b, welche über die Seiltrommeln c und d laufen, hochgezogen. Der Antrieb der Seiltrommel welle erfolgt durch die rechts vom Führersitz angebrachte Kurbel f. Die Schwimmer g und h sind in ihrem mittleren Teile zylindrisch und schließen vorn 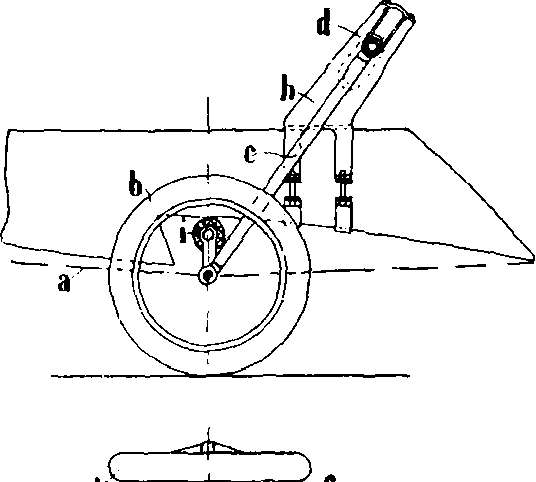
3 Abb. 5 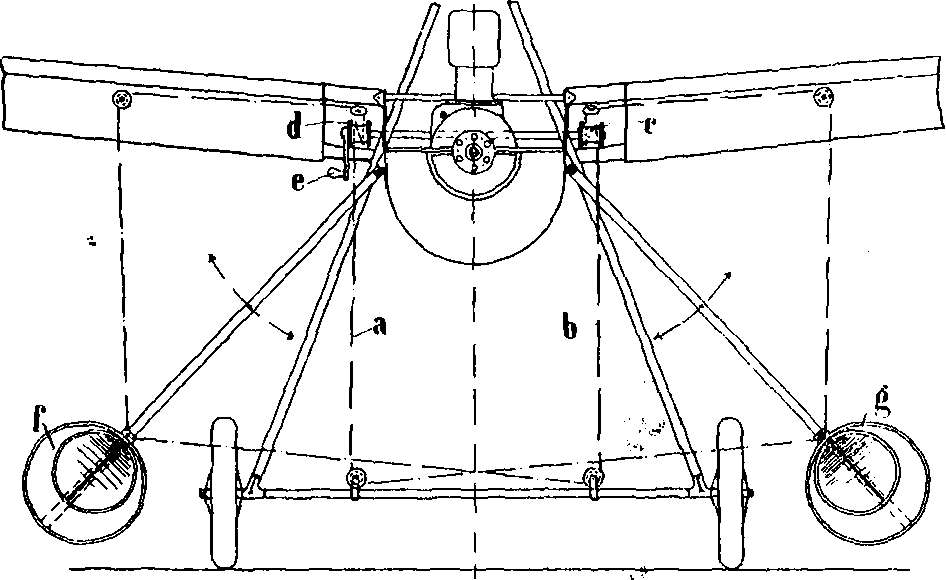 Abb. 6 mit einem abgestumpften exzentrischen Kegel ab. Der hintere Teil der Schwimmer wird durch einen flachgewölbten Boden abgeschlossen. Um eine bessere Gleitwirkung zu erzielen, hat Strack später unter den vorderen Teil des Schwimmers eine größere Abweichfläehe, die sich vorzüglich bewährte, angebracht. Der Wettbewerb begann pünktlich am 28. Juni vormittags mit der Abnahme der Maschinen. Die Kommission, bestehend aus Prof. Baumann, Prof. Bendemann, Hauptmann Kahlenberg, Obering. Kaufmann, Dr. Linke, Prof. von Mises, Hauptm. von Selasinski und Ingenieur Ursinus, nahm folgende Maschinen ab: Aviatik-Pf eil-Doppeldecker mit vorn liegendem 120 PS 4 Zyl. Argus-Motor, 2 Hauptschwimmer, Aviatik-Doppeldecker mit hinten liegendem 100 PS Argus-Motor, ein Hauptschwimmer, 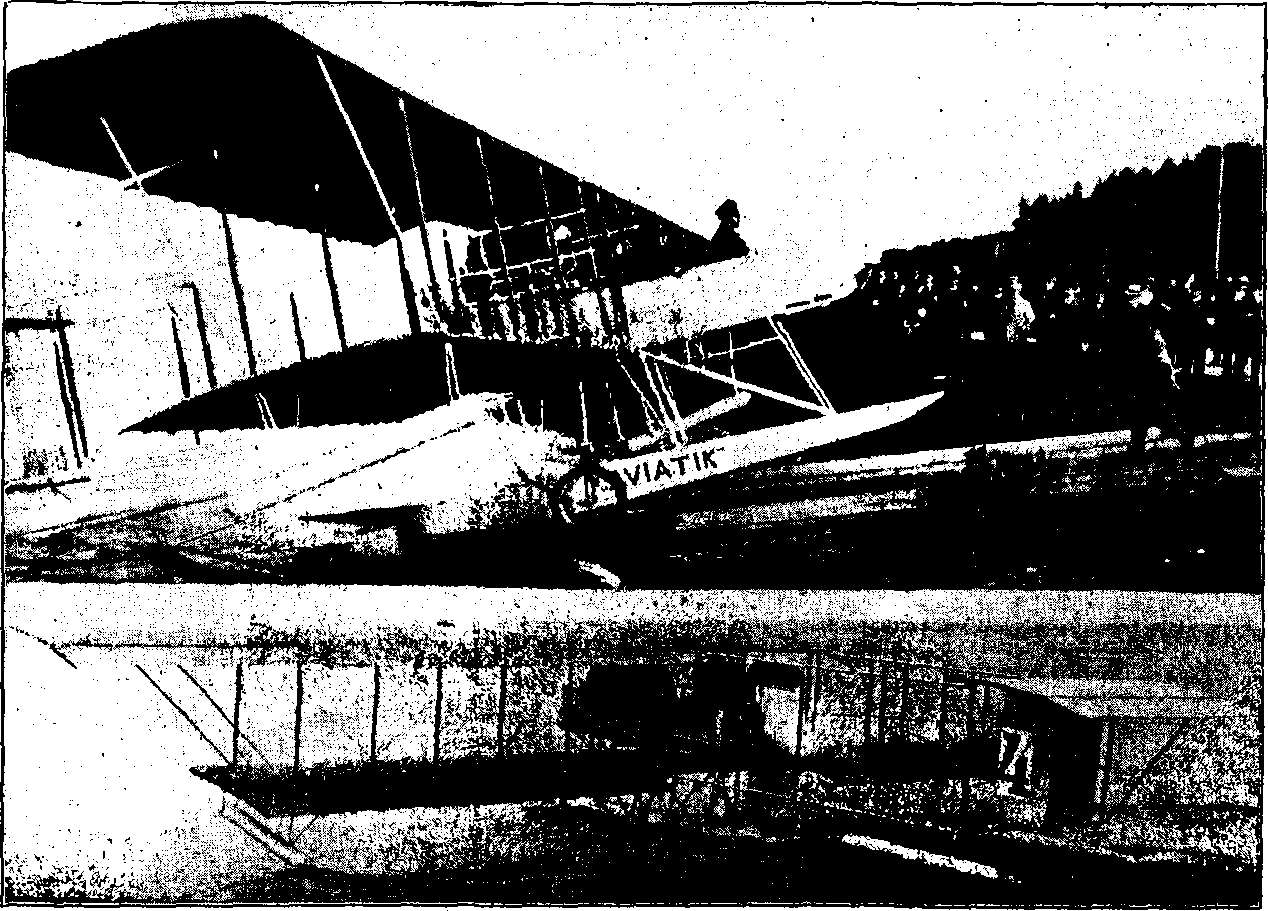 Bodensee- Wasserflug. Aviatik-Doppeldedter Seiten- und Hinteransiaht. Flugzeugbau Friedrichshafen, Eindecker-Sportmaschine mit vorn liegendem 70 PS Argus-Motor, 2 Hauptschwimmer, ohne Landungsgestell, Flugzeugbau Friedrichshafen Doppeldecker mit hinten liegendem 140 PS 6 Zyl. N". A. G.-Motor, ein Hauptschwimmer, Albatros-Eindecker mit vorn liegendem 75 PS Stahlzylinder-Mercedes-Motor, 2 Hauptschwimmer, kein Landungsgestell, Albatros-Doppeldecker mit vorn liegendem 100 PS 6 Zyl. Mercedes-Motor, 2 Stufen-Hauptschwimmer, Albatros-Eindecker mit vorn liegendem 100 PS 6 Zyl. Mercedes-Motor, 2 Hauptschwimmer, Ago-Doppeldecker mit hinten liegendem 120 PS G Zyl. Argus-Motor, 2 Hauptschwimmer, Strack-Eindecker mit vorn liegendem 55 PS Hilz-Motor und zwei hochziehbaren zylinderförmigen Schwimmern. Am nächsten Tage, dem 29. Juni, wurden noch abgenommen: Gotha-Doppeldecker mit hinten liegendem 100 PS Mercedes-Motor, 2 Hauptschwimmer, Otto-Doppeldecker mit hinten liegendem 100 PS 6 Zyl. Argus-Motor, 2 Hauptschwimmer. Der von den Union-Flugzeugwerken gemeldete Pfeil-Doppeldecker konnte nicht erscheinen, da bei einem vor dem Wettbewerb stattgefundenen Versuch die Schwimmer zerschlagen wurden. Ebenso waren der unter Ungenannt gemeldete Apparat Nr. 17, ein fliegendes Boot, der Rumpler-Kindecker, sowie der zweite Otto-Doppeldecker nicht erschienen. Zur Sicherung der Flieger bei Unfällen war auf dem See ein besonderer Sicherungsdienst, der unter der Leitung von Oberingenieur Kaufmann in vorzüglicher Weise arbeitete, organisiert. Am Landungssteg westlich des Flugplatzes lag ein großer Hebeprahm, der durch ein Dampfboot bei vorkommenden Unfällen schnell zu Hilfe eilen konnte, Zur Besetzung der Kontrollstationen und zum Sicherungsdienst waren auf dem See ca. 28 Motorboote, die in dankenswerter Weise von den am Bodensee ansäßigen Besitzern selbst gesteuert wurden, vorgesehen. Dieser Dienst war außerordentlich anstrengend, kam es doch oft vor, daß die Motorboote halbe Tage lang mitten auf See an einer Boje liegen und ihren Dienst versehen mußten. Zur durchgreifenden Sicherung des Bodensees mit Motorbooten reichte die Anzahl der zur Verfügung stehenden Motorboote nicht aus. Man griff daher zu dem Ausweg, einen kleinen Sicherungsdienst, bei dem nur die Kontrollstationen besetzt waren und einen großen Sicherungsdienst mit sämtlichen verfügbaren Motorbooten zeitweise anzusagen. Denjenigen Fliegern die mit großer Sicherheit fliegen wollten, war freigestellt, an den Tagen mit großem Sicherungsdienst zu fliegen. Die meisten Flieger dachten jedoch erst in letzter Linie an ihre persönliche Sicherheit und flogen, wie sie es für nötig befanden. Zur Verständigung zwischen den sportlichen Leitern vom Lande und den sportlichen Leitern vom Bojenviereck bei Konstanz war ein Flaggensignaldienst, der sich als unumgänglich erwies, eingerichtet. Der Flugplatz bei Konstanz war vom Verband nur vorbehaltlich der Zustimmung der teilnehmenden Firmen genehmigt worden. Man machte daher den Vorschlag, die Ausschreibung zu ändern und auf den Landstart zu verzichten. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch an der Ablehnung des Fliegers Strack. Am ersten Flugtag, dem 29. Juni, regnete es in Strömen. Heftige Regenböen peitschten über den Flugplatz, so daß die Flieger, um ihre Chancen nicht aufs Spiel zu setzen, in den Zelten blieben. Nachmittags gegen 5 Uhr erschien der Großherzog von Baden auf dem Flugplatz und besichtigte sehr eingehend sämtliche Maschinen, wobei er bei der Oberleitung dem Wunsche Ausdruck gab, ja dafür zu sorgen, daß nicht etwa die Flieger durch seine Anwesenheit beeinflußt würden, bei dem ungünstigen Wetter Flüge auszuführen. Am 30. Juni, dem zweiten Plugtag, hatte sich endlich das Wetter etwas gebessert. Bereits vormittags erfüllten fünf Firmen in glänzender Weise die Befähigungsnachweise. Die Aufgabe bestand bekanntlich aus einem Abflug vom Lande, einem Niedergehen auf das Wasser, einem Wasserabflug nachdem der Motor abgestellt war und einem Höhenflug auf mindestens 200 m. (Vergl. die Ausschreibung in Nr. 9.) Als erster startete um 8:20 Thelen auf Albatros-Doppeldecker, der eine Höhe von 280 m erreichte. Ferner erfüllten die Befähigungsnachweise Gsell auf Flugzeugbau Friedrichshafen Doppeldecker mit 240 m, Kießling auf Ago-Doppeldecker mit 260 m und Hirth auf Albatros-Eindecker mit 250 m. Vollmöller auf Albatros-Eindecker ohne Fahrgestell erreichte 210 m. Nachmittags 6:15 startete Vollmöller auf Albatros-Sporteindecker mit 75 PS Mercedes-Motor um den Preis für Sportflugzeuge und den Ehrenpreis des Kaiserl. Automobil-Klubs. Vollmöller stieg im Wasserungsviereck bei Konstanz auf, überflog die Kontrollstation Romanshorn, die durch zwei gelbe Flaggen markiert war, und wasserte vorschriftsmäßig hinter der Ziellinie, gekennzeichnet durch zwei Bojen auf dem Untersee bei Radolfzell. Hinter der Ziellinie stieg er wieder auf und flog nach dem Bojenviereck bei Konstanz zurück. Für die 84 km lange Strecke benötigte Vollmöller 95 Minuten, entsprechend einer Stundengeschwindigkeit von 105 km. 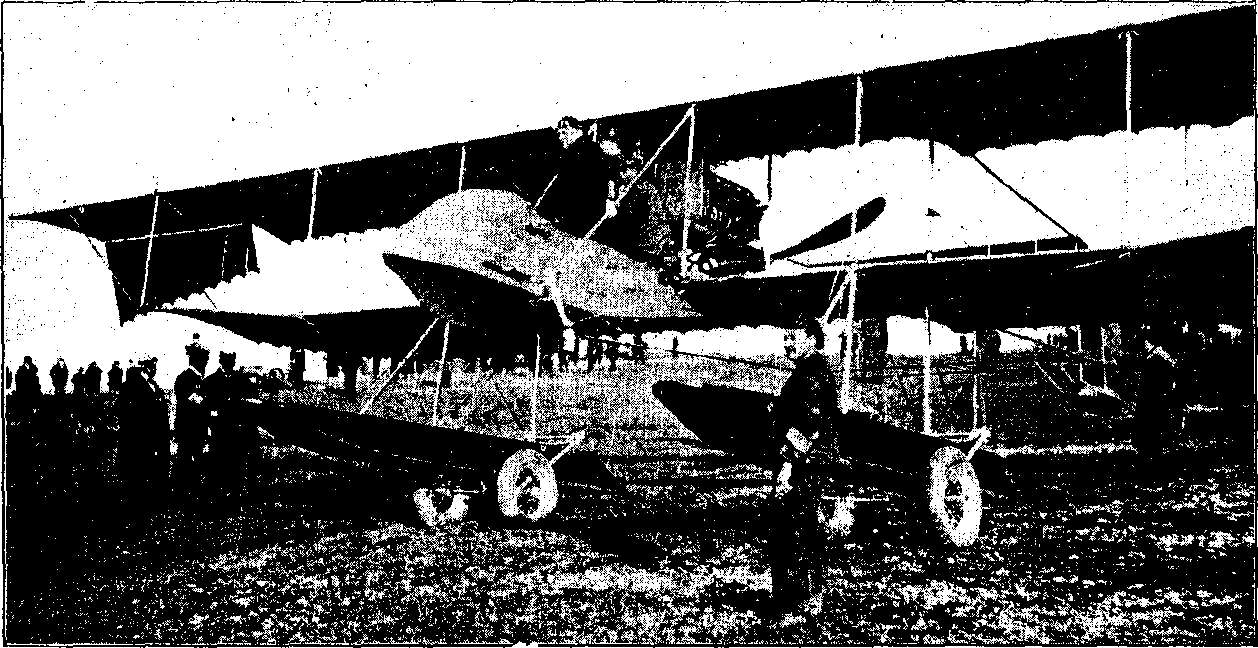 Bodensee- Wasserflug. Ot/o-Doppeldecker. Am Steuer Baierlein. Ferner erfüllte am Nachmittag Gsell auf Flugzeugbau Friedrichshafen mit 140 PS N. A. G.-Motor die letzte Prüfung für den Befähigungsnachweis, den Abflug vom Lande, wobei er einen außerordentlich kurzen Anlauf, nur 70 m, benötigte. Weiter flog noch um den Befähigungsnachweis Kießling auf Ago-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor mit Wasserstart und überschritt die Hoho von 200 m. Hieran anschließend vollführte er den vorschriftsmäßigen Landstart. Kolinert auf Flugzeugbau Friedrichshafen Eindecker mit 70 PS Argus erfüllte in glatter Weise die Befähigungsnachweise ohne Landstart. Faller mit Schmidt als Fluggast machte auf Aviatik-Doppel-decker um 7:5 abends einen Probeflug von 5 Min. Infolge der Erkrankung von Büchner zog die Gothaer Waggonfabrik ihre Maschine aus dem Wettbewerb zurück. Am 1. Juli, dem dritten Flugtag, begann der Wettbewerb um den Großen Preis vom Bodensee, für welchen 40 000 Mark ausgesetzt waren. Sieger ist derjenige, der die 200 km lange Strecke in der kürzesten Zeit zurücklegt. Die Flieger hatten aus einem durch Bojen bezeichneten Viereck bei Konstanz oder vom Wasserflugplatz bei Konstanz aufzusteigen, die Kontrollstationen bei Romanshorn, Arbon und Bregenz zu überfliegen und in dem Bojenviereck bei Lindau zu wassern, hier den Motor abzustellen und wieder anzudrehen, abzuwassern, eine Seite des Bojenvierecks bei Konstanz zu überfliegen und eine weitere Runde über den vorerwähnten Kontrollstationen auszuführen. Als erster startete vormittags 8 : 52 : 29 Uhr Gsell auf Flugzeugbau Friedrichshafen Doppeldecker und 8 : 56 : 9 Thelen auf Albatros-Doppeldecker. Beide Flieger erledigten vorschriftsmäßig die ihnen gestellten Aufgaben und wasserten im Bojenviereck bei Konstanz. Gsell benötigte 106 Min. 51 Sek., während Thelen 128 Min. 41 Sek. brauchte. Faller erfüllte vormittags auf Aviatik-Doppeldecker den Höhen-Befähigungsnachweis. Nachmittags 3 : 28 Uhr startete Kießling auf Ago-Doppeldecker vom Land, passierte vorschriftsmäßig die Kontrollstationen Romanshorn, Arbon und Bregenz und wasserte im Bojenviereck zu Lindau, wo er den Motor abstellte. Infolge Wasserronr-bruchs mußte er auf einen Wiederaufstieg verzichten und fahr auf dem Wasser nach Konstanz zurück. Gegen 4 : 30 nachmittags versuchte Faller auf Aviatik-Doppeldecker mit hinten liegendem Motor und einem Hauptschwimmer vom Land zu starten. Durch einen Fehler des Fliegers kam der linke Hilfsschwimmer auf den Boden, sodaß sich die Maschine scharf nach links drehte und das Fahrgestell abschlug. Das Flugzeug schied somit aus dem Wettbewerb aus. Gegen abend setzte ein sehr reger Flugbetrieb ein. Vollmöller führte fünf Flüge, meistenteils mit Fluggästen aus dem Publikum, aus. Ferner zeigte Gsell auf Friedrichshafen-Doppeldecker durch steile Gleitflüge und exakte Wasserstarts, daß er seine Maschine beherrscht. Thelen und Hirth führten längere Probeflüge aus. Für den vierten Flugtag, den 2. Juli, war vormittags eine Ruhepause angesetzt. Die Flieger hatten sie weniger nötig wie die Herren des Sicherungsdienstes auf dem See. Der Nachmittag war für die Befähigungsnachweise, die Steigfähigkeitsprüfung auf 500 m um den Preis der Sportflugzeuge freigegeben. Es startete als erster Kohnert auf Flugzeugbau Friedrichshafen-Eindecker mit 70 PS Argus-Motor. Kohnert durchflog die vorgeschriebene Strecke Romanshorn—Radolfzell, wasserte hinter der Ziellinie bei Radolfzell und flog nach Konstanz zurück. Die Gesamt- flugzeit betrug 97 Minuten. Er benötigte also 2 Minuten mehr wie sein Konkurrent Vollmöller. Hirth auf Albatros-Eindecker startete um 4 : 15 für die Steigfähigkeitsprüfung. Er erreichte hierbei 500 m in 12 Minuten. Gsell auf Flugzeugbau Friedrichshafen-Doppeldecker machte einen Höhenflug, um die Steigfähigkeit seiner Maschine zu erproben. Am 3. Juli, dem fünften Flugtag, war wieder nur der Nachmittag für die "Wettbewerbe um den Großen Preis, die Steigfähigkeitsprüfung auf 500 m und die Befähigungsnachweise freigegeben. Um 3: 39 startete Kießling auf Ago-Doppeldecker, überflog die Kontrollstationen Romanshorn, Arbon und Bregenz, wasserte 4:18 in Lindau und vollendete durch Ueberfliegen des Bojenvierecks bei Konstanz 4: 50: 43 die erste Runde, überflog zum zweitenmale Lindau, mußte jedoch bei Manzell 6: 05 eine Notwasserung vornehmen.  Bodensee- Wasserflug. Links: Otto-Doppeldecker. Rechts: Flugzeugbau-Friedridishafen-Doppeldecker. Die Sensation des Tages bildete indessen der Flug von Hirth um den Großen Preis. Hirth startete 3 : 43 : 10 vom Wasser aus dem Bojenviereck bei Konstanz, passierte vorschriftsmäßig die Kontrollstationen Romanshorn, Arbon und Bregenz, wasserte in Lindau und flog 4 : 16 weiter, um 4 : 30 : 43 durch Ueberfliegen des Bojenviereck bei Konstanz die erste Runde zu vollenden. Nach Durchfliegen einer weiteren Runde wasserte Hirth um 5 : 29 : 46 am Ziel in dem Bojenviereck bei Konstanz. Die Gesamtflugzeit betrug 106 Min. 51 Sek. Hirth hat hiermit die Flugzeit von Gsell um nur 35 Sek. geschlagen. Für die Steigfähigkeitsprüfung startete um 6 : 42 Thelen und wasserte 7 : 02. Gsell auf Flugzeugbau Friedrichshafen-Doppeldecker machte einen längeren Probeflug mit 2 Fluggästen nach Romanshorn. und Vollmöller auf Albatros-Eindecker um 6 : 30 einen Probeflug mit einem Fluggast. ßaierlein auf Otto-Doppeldecker gelang es, nachdem er das Fahrgestell abgenommen hatte, die Maschine vom Wasser abzubringen und einen Rundflug vou ca. 5 Minuten auszuführen. Die ausgezeichneten Leistungen von Hirth und Gsell um den Großen Preis hatten das Fliegerlager am Bodensee in nicht geringe Aufregung versetzt. Ueberau wurde mit Raffinement an den Maschinen gearbeitet, um sie in gute Form zu bringen. Man sah, wie Schwimmer, um ihnen eine große Gleitfähigkeit zu geben, mit Schmierseife massiert wurden. An anderen Stellen sah man haufenweise Propeller der verschiedensten Konstruktionen herumliegen, die nacheinander ausprobiert wurden, um eine möglichst große Geschwindigkeit zu erreichen. Handelte es sich doch nur um Sekunden, die ausschlaggebend waren. Wohl selten zeigte sich ein so guter Sport wie in diesen Tagen in Konstanz. Ain 4. Juli, dem sechsten Flugtag, startete als erster um 3:28 Kießling auf Ago-Doppeldecker. Er flog vorschriftsmäßig die zwei Runden über dem Bodensee und wasserte nach 134 Minuten bei Konstanz. Der unermüdliche und fleißige Gsell auf Fl. F.-Doppeldecker, der gestern von Hirth mit 35 Sek. geschlagen worden war, startete 4:0:36 aus dem Bojenviereck bei Konstanz. Die erste Runde vollendete er 4:52:55. Er verbesserte hierdurch seine Zeit von gestern um 3 Minuten. Leider mußte er bei der zweiten Runde infolge Zerspringens der Isolierung einer Bosch-Zündkerze bei Arbon eine Notwasserung vornehmen. Infolge der verlorenen Zeit gab er den Flug auf und wasserte außerhalb des Bojenvierecks bei Konstanz und fuhr nach dem Lande zurück. Kohnert auf Fl. F.-Eindecker startete 4:06 nochmals, um seine Zeit gegen Vollmöller um den Preis für die Sportflugzeuge zu verbessern. Um ^Zeit zu sparen, nahm er hinter der Ziellinie bei Radolfzell auf dem Wasser eine zu scharfe Kurve, wobei er mit dem einen Tragdeck das Wasser streifte und den Schwimmer abbrach, Eine kleine Ueberraschung gab es für manche, die mit Erstaunen sahen, wie 4:46 Strack auf seinem Wasser-Eindecker mit hochziehbarem Wasserungsgestell glatt die Befähigungsnachweise, Abfliegen vom Wasser, Niedergehen auf das Wasser, erfüllte. Während Vollmöller auf Albatros-Eindecker mehrere Passagierflüge ausführte, startete Kießling auf Ago-Doppeldecker zu einem Höhenflug, wobei er mit der vorschriftsmäßigen Belastung in 12,8 Min. die Höhe von 500 m erreichte. Hirth startete gleichfalls zum Höhenflug und erreichte die 500 m in nur 11,6 Min. Gsell auf Fl. F.-Doppeldecker mußte infolge des Zündkerzen-Defektes seinen Motor auseinander nehmen, um die aus der Zündkerze herausgefallenen Porzellanteilchen aus dem Motor zu entfernen. Er konnte daher an diesem Tage nicht mehr starten. Am siebenten Flugtag, den 5. Juli, startete um 8:46:43 Kießling auf Ago-Doppeldecker vom Lande, wobei er einen Anlauf von 125 m benötigte. Er gab jedoch unterwegs auf. „Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XIX. Borel Kriegs-Eindecker, Militärtyp 1913. 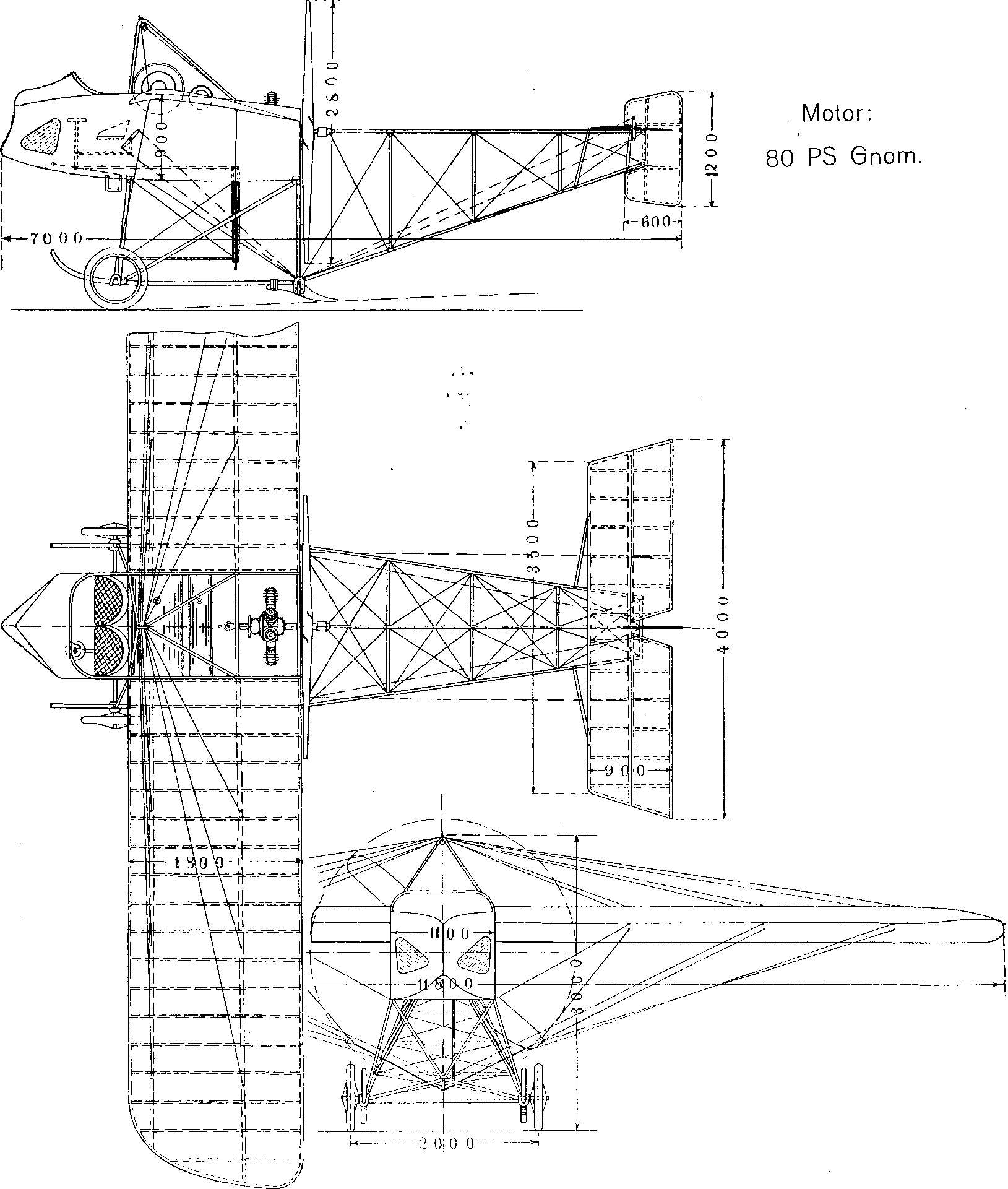 Nnchbildi'ng verboten. Um 8 : 54 startete nochmals Gsell auf Fl. F.-Doppeldecker. Das Wetter war sehr unsichtig, so daß man die Ufer nicht sehen konnte. Die Chancen waren daher für Gsell nicht günstig. Er durchflog indessen vorschriftsmäßig die beiden Runden mit den vorgeschriebenen Zwischenwasserungen und erreichte das Ziel, das Bojenviereck bei Konstanz, nach 108 Min 27 '7.» Sek. Hirth blieb hiermit Sieger im Großen Pieis. Gsell blieb mit seiner Zeit gegen seine erste Zeit von vorgestern, die in der ersten Runde besser war wie die von Hirth, erheblich zurück. Der Zünd= kerzen-Defekt vom 4. Juli kostete ihn daher 15000 Mark. Um 5 Uhr nachmittags wurden durch Sirenensignale die Oberleitung, die sportlichen Leiter, die Flieger und sämtliche Funktionäre zusammen gerufen. Oberstleutnant von Oldershausen, der Vorsitzende des Arbeitsausschusses, erklärte die Wettbewerbe für geschlossen. Um 6 Uhr trat das Preisgericht, bestehend aus: Oberstlt. Frhr. v. Oldershausen, Oberlt. z. S. Bertram, Rechtsanwalt Dr. Joseph, Hauptmann v. Kalinowski, Hauptmann Ade, Oberlt. z S. Langfeld, Dr. F. Linke, Marine -Stabsingeninur Loew, Hauptmann v. Selasinsky und Ingenieur Ursinus, zusammen. Resultate: Großer Preis vom Bodensee: 1. H. Hirth (Albatros-Eindecker, 100 PS Mercedes) 1-:46:17 (25000 Mark und Ehrenpreis des Großherzogs von Baden). 2. Rob. Gsell (Friedrichshafen-Doppeldecker, 140 PS N. A. G.) 1 : 46 : 51 (10000 Mark und Ehrenpreis des Ministers der öffentlichen Arbeiten). 3. Dipl.-Ing. R. Thelen (Albatros-Doppeldecker, 100 PS Mercedes) 2 : 08 : 00 15000 Mark und Ehrenpreis des Staatssekretärs der Marine für einen Flug bei mehr als 7 Meter Wind pro Sek.) 4. W. Kießling (Ago-Argus-Doppeldecker 100 PS), Ehrenpreis des Verkehrs Vereins Konstanz. Preis der Sportflugzeuge: 1. Hans Vollmöller (Albatros-Eindecker, 75 PS Mercedes) 48 Min. 50 Sek. (5000 Mark und Ehrenpreis des Kaiserl. Automobil-Club). 2. Kohnert (Friedrichshafen-Eindecker, 70 PS Argus) erhielt einen Trostpreis von 2000 Mark und den Ehrenpreis des Grafen Zeppelin. Konstruktionspreis: 1. Albatr os-Eindecke r (Führer Hirth) 5000 Mark, 1316 Punkte. 2. Ago-Doppeldecker (Führer Kießling) 3000 Mk., 1315 Punkte. 3. Friedrichshafen-Doppeldecker (Führer Gsell) 2000 Mark, 1308 Punkte. Steigfähigkeitsprüfung: 1. H. Hirth (Albatros-Eindecker) 500 Meter in 11,6 Min. 3000 Mark. 2. W. Kießling, (Ago-Doppeldecker, 100 PS Argus) 2000 Mark. Prämien für die Befähigungsnachweise: Es gewannen je 1000 Mark: Hirth, Thelen, Kießling, Gsell; 800 Mark: Vollmöller, Faller; 500 Mark: Kohnert, Baierlein. Strack. Mechanikerprämien: 1. Mechaniker von Hirth 500 Mark. 2. Mechaniker von Hirth 500 Mark. 3. Mechaniker von Vollmöller 500 Mark. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Wenn es noch eines weiteren praktischen Beweises bedurfte, um die gewaltige Entwicklung, welche das Flugwesen unserer Zeit erfahren hat, auch den hartnäckigsten Zweiflern vor Augen zu führen, wenn es noch notwendig war, die allgemeine Oeffentlichkeit von der außerordentlichen Wichtigkeit des modernen Flugwesens und seiner Bedeutung für die ganze Zukunft der Völker zu überzeugen, so sollte man meinen, daß dies durch den geradezu grandiosen europäischen Rundflug Brindejonc des Moulinais geschehen ist. Wie bekannt, handelte es sich bei dem erwähnten Flugunternehmen um den Kampf um die letzte Halbjahresprämie und gleichzeitig um die endgiltige Zuteilung des „Pommery-Pokals", der mit Ende dieser Saison abläuft. Die Flugleistung, welche Brindejonc soeben vollbracht hat, rückt alles in den Hintergrund, was die lebhafteste Phantasie noch vor kurzem zu ersinnen gewagt hätte. Wie berichtet, war Brindejonc auf seinem Moräne Eindecker, 80 PS Gnom-Motor, an einem Tage von Paris über Wanne, Berlin nach Warschau geflogen, eine Distanz von 1400 km. In Warschau entschloß er sich, seine Heimreise über die großen Hauptstädte des Nordens anzutreten, und mit verblüffender Energie führte er dieses Vorhaben aus, über Meere und Gebirge dahin, die bisher noch kein Mensch im Fluge überquert hatte, und zwar mit einer solchen Regelmäßigkeit, daß er an jedem Etappenziel fast genau zu der festgesetzten Stunde eintraf. Nachdem der Flieger die Etappe Wärschau-Dwinsk, 550 km, und am folgenden Tage die Etappe D winsk-Sankt Petersburg, 450 km, hinter sich gebracht hatte, nachdem er in der russischen Hauptstadt eine Woche lang Gegenstand großartiger Sympatiekundgebungen und Ehrungen gewesen war, nahm er von Petersburg wieder seinen ßückflug und gelangte am ersten Tage bis Eeval, 350 km. Von dort wollte er nach Stockholm zu gelangen suchen, zu welchem Zwecke er 400 km über das Baltische Meer zu fliegen hatte. Es war dies die schwierigste Etappe des ganzen Fluges, die er aber trotzdem in tadelloser Weise vollbrachte, indem er die Distanz von 400 km in 3 Stunden 25 Minuten zurücklegte. Brindejonc flog um 4 Uhr 35 Minuten von Eeval ab und wandte sich sofort gegen die Insel Dago. Um genau 8 Uhr landete er in Stockholm, wo ihn eine große Menschenmenge empfing. Wieder feierte man den kühnen Flieger mit Banketts und Ansprachen und die Königliche Gesellschaft Schwedischer Flieger ließ ihm durch ihren Präsidenten, den General Wrangel, eine große goldene Plakette überreichen. Von Stockholm aus handelte es sich um die Etappe Stockholm-Kopenhagen, in direkter Linie eine Entfernung von 590 km. Er ging um 2 Uhr 35 Minuten von der schwedischen Hauptstadt ab und unternahm in Malmslatt eine Zwischenlandung, um von dort um 4: Uhr 45 Minuten abzufliegen und um 7 Uhr 18 auf dem Flugfelde von Kopenhagen anzulangen, inmitten eines großen Enthusiasmus. Auf dieser Etappe hatte Brindejonc stark vom ßegen zu leiden. Am letzten Dienstag um 5 Uhr 31 flog Blinde Jone von Kopenhagen ab um den Haag zu erreichen. Kurz vor 8 Uhr langte er in Hamburg an, wo er eine Landung rornahm, um nach zweistündigem Aufenthalte seinen Flug nach Holland fortzusetzen. Um 12 Uhr 57 kam er wohlbehalten in Haag an; seine ursprüngliche Absicht, auch noch Amsterdam zu besuchen, gab er infolge des trüben und stürmischen "Wetters auf. Dafür entschloß er sich, am folgenden Tage direkt nach Paris zurückzukehren. Hier, wo man die großartige Flugleistung Brindejoncs in allen ihren einzelnen Phasen verfolgt hatte, bereitete man dem heimkehrenden Sieger einen wahrhaft königlichen Empfang. In Villacoublay, wo die Ankunft um 4 Uhr erfolgen sollte, hatte sich eine unübersehbare Menschenmenge eingefunden, die freilich sich damit begnügen mußte, die Umgebung des Flugfeldes dicht zu umsäumen, denn auf diesem selbst hatten nur die geladenen Personen Einlaß. Alles, was in der offiziellen und industriellen Welt Frankreichs einen Namen hat, war erschienen. Wir bemerkten unter den Anwesenden die Vertreter des Ministerpräsidenten, des Kriegs- und Marineministers, den Chef des französischen Militärflugwesens General Hirschauer, die russische Großfürstin Anastasia, den Grafen Castellane, viele hohe Militärs, fast sämtliche Konstrukteure und Flieger. Brindejonc war gegen 9 Uhr früh bei strömendem Regen vom Haag abgeflogen und hatte in Compiegne eine Zwischenlandung festgesetzt, um dort seinen Freund Legagneux zu besuchen. Einige Fliegerkameraden entschlossen sich, dem heimkehrenden Brindejonc bis Compiegne entgegen zu fliegen; es waren dies die Moraneflieger Gilbert, Letort und Biot, sowie der Offiziersflieger Leutnant Ronin, der gleichfalls ein Flugzeug dieser Marke steuerte. Kurz nach 11 Uhr langte Brindejonc in Compiegne an, nachdem er die Strecke vom Haag dorthin in 2 Stunden 16 Minuten hinter sich gebracht hatte. Nachdem er auch dort gefeiert worden war, erfolgte der Abflug nach Paris; zuerst, um 3 Uhr 25 ging Gilbert davon, gefolgt von Biot, Letort und Leutnant Ronin, worauf um 3 Uhr 29 Brindejonc als letzter sich in die Höhe erhob. Es war 3 Uhr 10, als die auf dem Flugfelde von Villacoublay versammelten Tausende einige schwarze Punkte gewahrten, die sich nur schwer von dem wolkigen Himmel abhoben. Als sich die sechs Flugzeuge über dem Felde befanden, begann der Abstieg, und während seine Kameraden einer nach dem anderen landeten, umkreiste Brindejonc noch hoch in den Lüften das Flugfeld, bis endlich auch er als letzter sich auf dem Feld niederließ. Eine unbeschreibliche Ovation wurde ihm dargebracht. Man stürmte alle Barrieren, alle Absperrungen, man drückte dem anscheinend selbst etwas Bestürzten die Hand, man warf mit Blumen nach ihm und es währte lange, bis in dem unentwirrbaren Knäuel von Menschen, in dem unaufhörlichen Rufen und Brüllen sich die offiziellen Ansprachen hören ließen. Man trug den glücklichen Flieger nach der Ehrentribüne und hier begrüßte ihn im Namen der Regierung Herr Leon Barthou, der Bruder des Ministerpräsidenten, worauf der Generei Hirschauer im Namen des Kriegsministers und Rene Quinton im Namen der Ligue Nationale Aerienne Ansprachen hielten. Deutsch de la Meurthe überbrachte namens des Aero-Clubs die Große Goldene Medaille und Quinton kündigte an, daß ihm der Betrag von 60.000 Francs für einen neuen Pommery-Pokal zur Verfügung gestellt worden sind, der vom nächsten Jahre ab unter veränderten Bedingungen zur Bestreitung gelangen soll. Anstelle des bisher verlangten Fluges zwischen Sonnenaufgang und -Untergang wird nunmehr ein solcher zwischen Sonnenaufgang des einen und Sonnenuntergang des folgenden Tages, also ein Flug während 40 Stunden als Grundlage dienen. Die Leistung Brindejoncs stellt sich nunmehr in ihren einzelnen Etappen folgendermaßen dar: 10. Juni: Paris—Wanne—Berlin - Warschau, 1400 km 15. Juni: Warschau—Uwinsk, 550 km 17. Juni: Dwinsk—-Sankt Petersburg, 450 km 23. Juni: Sankt Petersburg — Eeval, 350 km 25. Juni: Eeval — Stockholm, 400 km 29. Juni: Stockholm—Kopenhagen, 610 km 1. Juli: Kopenhagen—Haag, 700 km 2. Juli: Haag—Paris, 400 km also insgesamt 4860 km, womit Brindejonc sämtliche bisherigen Distanzflug-Eekords geschlagen hat. Der bisherige Eekord gehörte dem Amerikaner Fowler mit dem Fluge von San Franzisko nach Jacksonville, 3600 km. Uebrigens ist soeben Brindejonc von der französischen Eegierung zum ßitter der Ehrenlegion ernannt worden. Natürlich sind neben dieser Glanzleistung des Moranefliegers die mancherlei anderen beachtenswerten Flugleistungen der letzten Tage etwas in den Hintergrund getreten. Namentlich sind einige interessante Flüge zwischen der französischen und englischen Hauptstadt zu verzeichnen. Gelegentlich der Reise des französischen Präsidenten nach London hatte der „Matin" die Idee, den Flieger Gilbert mit einer Zeitungssendung für den König von England und für den Präsidenten nach London zu schicken Gilbert entledigte sich seiner Mission ohne Zwischenfall. Er verließ kurz nach 5 Uhr Villacoublay, ging über Paris, Pontoise, Abbeville dahin und kam nach Le Crotoy. Infolge des dichten Nebels im Kanal wartete der Flieger dort bis nach 11 Uhr, worauf er über Etaples und Boulogne weiter ging, um vom Cap Gris-Nez aus den Kanal zu überqueren. Ein heftiger Westwind trieb den Flieger nordöstlich von Dover ab, sodaß er die englische Küste entlang kreuzen mußte, um nach Folkestone zu gelangen, von wo er über Ashford, Maidstone etc. nach London gelangte, wo er um halb 3 Uhr auf dem Flugfeld von Hendon landete. Auch Chemet flog auf einem Borel-Eindecker von London nach Paris ütnd der Marineleutnant Graf de Laborde begab sich auf einem Bleriot-Eindecker von Paris nach London und zurück auf dem Luftwege. Noch interessanter ist der Flug Graham Whites. der zum ersten Male auf einem Wasserflugzeug von Paris nach London geflogen ist. Wie erinnerlich, hat vor kurzem zuerst Beaumont versucht, auf einem Wasserflugzeug von Paris nach London zu gehen. Aber infolge Umschlagens des Apparats im Hafen von Boulogne mußte er sein Vorhaben aufgeben. Nun unternahm Graham White dieselbe Leistung, und zwar auf einem Morane-A pparat. Er flog am vergangenen Donnerstag von der Seine-Insel Jatte um 3/46 Uhr früh ab, folgte dem Lauf der Seine bis Havre, wo er sich im Hafen auf dem Wasser niederließ. Um 9 :15 Uhr flog er von dort wieder ab, segelte die normannische Küste entlang und gelangte nach Boulogne. Nach einer Bast von einer Stunde wandte sich White nach der englischen Küste und landete um 1 Uhr im Hafen von Dover, von wo er über Margate in den Themselaul gelangte, dem er bis London folgte. Um 7 Uhr abends ließ er sich bei der Putneybrücke, in der Nähe von Hendon, auf dem Wasser nieder. Bei dieser Gelegenheit hat Graham White, wie nachträglich festgestellt worden ist, einen neuen Höhenrekord für Wasserflugzeuge aufgestellt, indem er zwischen Paris und Rouen eine Flughöhe von 4000 Metern erreichte. Schlimmer erging es dem Flieger Levasseur, der auf einem Nieuport-Wasserflugzeug, mit einem Passagier an Bord, die Reise von Paris nach London vollbracht hat. Sein Apparat wurde in London, da er seine Ankunft dort nicht, wie es die englischen Bestimmungen verlangen, angemeldet hatte und über verbotene Zonen geflogen war, von der Polizei beschlagnahmt und er selbst in 100 Mark Strafe und zur Sicherheitsstellung von 800 Mark auf die Dauer eines Jahres verurteilt. Dieser Vorgang hat hier große Entrüstung hervorgerufen. Auch Oskar Bider hat von neuem von sich hören lassen; der junge Schweizer hat den Flug Bern—Mailand ausführen wollen. Er flog in 4000 Meter Höhe über den Eiger, jenes 3975 Meter hohe Gebirge der Berner Alpen, aber als sich infolge atmosphärischer Einflüsse die Vergasung an seinem Motor als unzulänglich herausstellte, kehrte er nach Bern zurück. Großes Bedauern erregte hier der Todessturz des bekannten Fliegers Parisot, der gelegentlich eines Flugfestes zu Bombaye, in der Nähe von Lüttich, aus 150 Meter abstürzte und auf eine Zuschauergruppe fiel. Parisot und zwei der Zuschauer wurden auf der Stelle getötet, drei weitere Personen schwer verletzt. Auch das französische Militärflugwesen hat einige schwere Unfälle zu beklagen. Hauptmann Rey begab sich auf einem Zweidecker, mit einem Unteroffizier an Bord, von Etampes nach Chalons, als er plötzlich in 150 Meter Höhe in einen Windwirbel geriet. Der Apparat überschlug sich und Rey wurde herausgeschleudert; er wurde sofort getötet. Der Unteroffizier wurde lebensgefährlich verletzt. Ein ähnlicher Unfall betraf den Leutnant Grezaud, welcher sich mit einem Sappeur gleichfalls nach Chalons begeben wollte. Der Apparat fiel, zum Glück nur aus geringer Höhe, ab und wurde zertrümmert; die beiden Insassen kamen anscheinend mit leichteren Verletzungen davon. Die Luftgeschwader 1 (Toul) und 2 (Verdun) vollführten lange und durchaus gelungene Rekognoszierungsflüge, die sich die ganze Ostgrenze entlang erstreckten. Und auch das Flugwesen in den Kolonien hat in den letzten Tagen mit großem Eifer gearbeitet. Besonders zu erwähnen ist ein 700 km-Rekognoszierungsflug in Marokko, den der Wachtmeister Perreti auf einem Bleriot-Einsitzer, 50 PS Gnom Motor, ausführte. Er flog von Casablanca ab, flog über Fez nach Taza und kehrte auf demselben "Wege zurück. Ein Lui'tge-schwader, bestehend aus sechs Deperdussin-Ein deckern, hat bei den militärischen Operationen des Generals Alix, wie in einem Tagesbefehl ausdrücklich hervorgehoben wird, unschätzbare Dienste geleistet. In Chalons hat am vergangenen Donnerstag ein junger Flugschüler, Foulquier, einen Todessturz getan. Er stürzte aus 70 Meter Höhe mit seinem Eindecker zur Erde und wurde von der Maschine erdrückt. Dieser Vorfall verdient deshalb besondere Erwähnung, weil erwiesenermaßen eine unglaubliche Leichtfertigkeit vorliegt. Foulquier, der noch niemals selbständig ein Flugzeug gesteuert hatte, unternahm gegen den dringenden Rat seiner Fliegerkameraden bei heftigem Sturm einen ersten Flug, der auf diese tragische Weise endete. Wichtige Entscheidungen hat die Permanente Kommission der Internationalen Aeronautischen Vereinigung, welche dieser Tage in Brüssel zusammengetreten war, getroffen. Bezüglich des Internationalen Luftrechts wurde folgende Resolution angenommen: „Da mehrere Staaten im Begriff sind, oder bereits Anordnungen getroffen haben, welche geeignet sind, den internationalen Luftverkehr in ernster Weise zu behindern und sogar das Leben von Fliegern und Publikum in Gefahr zu bringen, hält es die Kommission für erforderlich, daß der Luftverkehr eine internationale Regelung finde, welche gleichzeitig die Interessen der Allgemeinheit, sowie diejenigen der Staaten wahrnimmt. Die Kommission richtet daher an die belgische Regierung das Ersuchen, den verschiedenen in der Vereinigung vertretenen Staaten die Beschlüsse der Kommission mitzuteilen und der Frage näher zu treten, ob es nicht angezeigt ist, dringend eine internationale diplomatische Konferenz zu berufen, welche die Beschlüsse der Kommission prüfen und annehmen soll." Ferner wurde beschlossen, daß gewiße Bestimmungen des Gordon Bennett-Pokals abgeändert werden, und zwar sollen sich nur diejenigen Flugzeuge für den Bewerb qualifizieren können, welche imstande sind, eine noch zu bestimmende geringe Geschwindigkeit zu realisieren! Natürlich bleibt der Bewerb trotzdem ein Geschwindigkeitsbewerb; es soll nur verlangt werden, daß die Flugzeuge auch möglichst langsam zu fliegen im Stande sind. Der Vertreter der Vereinigten Staaten, Weymann, ist beauftragt worden, einen Bericht zu dieser Frage bis zu der nächsten, am 31. Juli in Haag stattfindenden Versammlung der Vereinigung fertig zu stellen. Dieser Kongreß wird folgende Tagesordnung haben: Bericht der Kommission für Internationales Flugrecht; Bedingungen des Gordon-Bennett 1914; Projekt einer internationalen Regelung des Luftverkehrs, von Deutschland vorgeschlagen; Anerkennung der Ueberland-flug-Rekords. Hierbei sei erwähnt, daß nunmehr das Programm des großen Flugmeetings von Reims, das bekanntlich gelegentlich des diesjährigen Gordon Bennetts stattfindet, festgesetzt worden ist: 27. September: französische Ausscheidungsläufe für den Gordon Bennett-Pokal, über 150 km; 28. September: verschiedene Flug bewerbe, darunter ein großer Ueberland-flug; 29. September: der Internationale Gordon Bennett-Pokal. Die Ligue Nationale Aerienne schreibt soeben einen Preis für automatische Stabilisierung aus, dessen .Reglement durch eine Sonderkommission, unter dem Vorsitz des Majors Ferrus, ausgearbeitet wird. Erwähnt sei noch, daß Robert Esnault-Pelterie den Vorsitz in der Aviations-Kommission des Aero-Club de France niedergelegt hat und daß an seiner Stelle Soreau zum Präsidenten designiert worden ist. Die französische Handelskammer für die aeronautischen Industrien gibt das Reglement für den V. Internationalen Aeronautischen Salon bekannt, der zu Paris in der Zeit vom 5. bis 25. Dezember stattfinden wird. Die Gruppeneinteilung der Ausstellung wird die gleiche sein wie im Vorjahre. El. Der Borel-Kriegseindecker, Militärtyp 1913. (Hierzu Tafel XIX.) Auf Anregung der französischen Militärverwaltung brachte die Firma Borel einen Eindecker heraus, der für den Angriff auf Lenkballons bestimmt ist. Wie man aus der Tafel ersehen kann, hat der systematische Aufbau der Maschine bedeutende Veränderungen gegenüber den sonstigen Eindeckern erfahren. Der Motorrumpf ist in der Seitensicht schiffbugartig geformt und mit 2 dreieckigen Emaillitfenstern zur Verbesserung der Aussicht nach unten versehen. Im Vorderteil des Bumpfes befinden sich 2 nebeneinander angeordnete Sitze, in der Mitte 2 getrennte Betriebsstoffbehälter für Oel und Benzin und hinten die Motoranlage. Zum Antrieb dient ein 80 PS Gnom Motor, auf dessen Schraubenwelle eine Integral-Luftschraube von 2,8 m Durchmesser sitzt. Die Wellenverlängerung bildet den Anschluß an den dreieckigen Schwanzgitterträger. Das Fahrgestell ist nach dem Zweikufensystem konstruiert und zeigt in seinem Strebenaufbau fast ausnahmslos den Dreieckverband. Vor den vordersten Fahrgestellstreben befindet sich die nach oben gekröpfte zweiteilige in Gummischnüren elastisch aufgehängte Badachse. Am hinteren Ende der Kufen befinden sich 2 kurze gleichfalls mit Gummischnüren abgefederte Schleifkufen. vorgesetzte Stelle. Diese wird sich der überbrachten Mitteilungen nur dann be dienen, wenn sie Vertrauen zu dem Ueberbringer hat: dieser wird also Offizier sein müssen." „Der Beobachtungs-Offizier wird, um aus seinen militärischen Erkundungen und Beobachtungen aus der Höhe den besten Nutzen ziehen zu können, gleichzeitig Flieger sein müssen. Diese Eigenschaft wird ihm die notwendige Gedankenruhe gewähren, um sich ausschließlich seiner Aufgabe als Beobachter zu widmen, ohne Furcht vor etwaigen Gefahren. Andererseits wird der steuernde Flieger absolutes Vertrauen in seinen begleitenden Beobachter setzen können in schwierigen Augenblicken.* „Indem Flieger und Beobachter sich gegenseitig ablösen können, wird der Nutzungswert des Flugzeugs ein doppelter; die militärischen Vorgänge, Truppen-Versc-hanzungen und Befestigungen werden von zwei Paar Augen gesehen werden, die angestellten Beobachtungen werden zwischen den beiden Offizieren besprochen werden können, ohne daß dadurch Zeit verloren geht. Eine Ermüdung eines der beiden Flugzeuginsassen wäre nicht mehr zu befürchten: nach Ausführung einer Mission brauchten Flieger und Beobachter nur ihre Plätze zu wechseln und sofort zu einer neuen Erkundung abfliegen. Es würde sich hieraus eine Ersparnis an Zeit, an Material und an Personal ergeben " Wenn man sich auf den rein theoretischen Standpunkt stellt, so wird man diesen Ausführungen nicht widersprechen können. In der Praxis aber stellt sich das anders. Denn wenn etwa 48 Fliegeroffiziere dazu gehören, um, nach den Ideen des Leutnants Nelis, den belgischen Fliegerdienst zu sichern, so würden für andere Staaten, deren Militärflugwesen einen wesentlich größeren Umfang genommen hat, Zahlen in Betracht kommen, welche das empfohlene System sehr schwierig gestalten, wenn nicht unmöglich machen. Wollte man jedes Flugzeug mit zwei Offizieren besetzen, deren jeder als Flieger und als Beobachter ausgebildet ist, so würde man zu einer gewaltigen Zahl gelangen, über die man im Augenblick bei weitem nicht verfügt. Unter Benutzung der vorhandenen Mittel an Personal müßte eine rationelle Organisation vielmehr folgendermaßen beschaffen sein: Wir müßten haben 1. einsitzige Flugzeuge, von besonders geschickten und ausgebildeten Offizieren gesteuert, leichte Apparate für Kavallerie, für Erkundungen von kurzer Entfernung. 2. zweisitzige Flugzeuge, einen Offizier am Steuer und einen Offizier vom Stabe als Beobachter, welch letzterer nicht steuern kann. Das wird die gebräuchlichste Type für weitgehende Rekognoszierungen sein. 3. zweisitzige Flugzeuge, mit zwei Offizieren, die sich, nach der von Nelis empfohlenen Methode gegenseitig als Flieger und Beobachter ablösen können. Diese Flugzeuggattung, nach Lage der Verhältnisse weniger zahlreich, wird für besonders schwierige und delikate Missionen große Dienste verrichten können. 4. zweisitzige Flugzeuge, mit einem Reserveoffizier, einem Unteroffizier oder einem Gemeinen am Steuer und mit einem Offizier als Beobachter. Gerade diese Art von Mannschaften wird man in immer größerem Maße zur Verwendung bringen müssen, je mehr das Flugwesen sich entwickelt, denn man wird dazu übergehen müssen, die Zivilflieger sowie die militärischen Nicht-Offiziersflieger zu verwenden, solange es nicht möglich ist, eine zu große Zahl junger und be-geisterungserfüllter Offiziere den Militarflugschiffahrts-Formationen zuzustellen. Rl. Flugtechnische 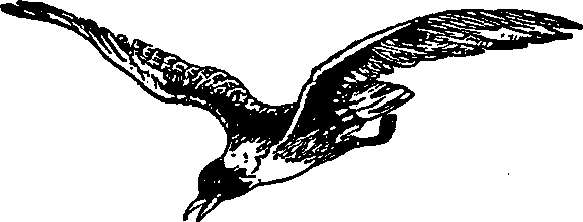 Rundschau. Inland. J'Yayfiihrer-Zeitynisse haben erhalten : No. 428. Findt, Hanns, Leutnant im 1. bayr. Inf.-Regt., geb. am 2. August 1888 zu Ingolstadt, für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 6. Juni 1913. No. 429. Heyder, Walter, Oberleutnant im Inf.-Regt. Nr. 14, geb. am 20. N-Dvember 1882 zu Reichthal in Schlesien, für Eindecker (Albatros-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 9. Juni 1913. No. 430. Grosse, Otto, Johannisthal, geb. am 23. Mai 1886 zu Neukirchen, für Eindecker (Jeannin-Stahltaube), Flugplatz Johannisthal, am 10. Juni 1913. No. 431. Schilling, Alfred, Dipl.-lng., Braunschweig, geb. am 15. November 1889 zu Braunschweig, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 10. Juni 1913. No. 432. Lorenz, Hans, Bork, Post Brück i. d. M., geb. am 18. April 1889 zu Schönau i. S., für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 10. Juni 1913. No. 433. Engelmann, Jakob, Metz-Plantieres, geb. am 29. März 1879 zu Wiebelskirchen, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 10. Juni 1913. No. 434. von Stoephasius, Waldemar, Oberleutnant, Jäger-Batl. 4, geb. am 10. August 1881 zu Halberstadt, für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 17. Juni 1913. No. 435. Clemens, Emil, Leutnant, Pion.-Batl. Nr. 22, geb. am 23. Juli 1887 zu Wolfenuüttel, für Zweidecker (D. F. W.), Flugfeld Leipzig-Lindenthal, am 17. Juni 1913» No. 436. Schüler, Max, Berlin, geb. am 30. Augist 1888 zu Berlin, für Zweidecker (Ago), Flugplatz Johannisthal, am 17. Juni 1913. Von den Plugplätzen. Vorn, Militärfluyplatz Schieissheim. Lt Hailer machte vorige Woche auf Otto-Doppeldecker mit 100 PS F. D. Stahlzylinder-Motor einen Dauerflug von 2 Stunden, ferner einen Passagierflug, der bis zu 1100 m Höhe über Dachau und München führte. Vom Fhujplatz Leip&iy-IAndenthal. Der Flugbetrieb im Monat Juni brachte wieder gute Leistungen. Die längste Flugzeit erzielte Fluglehrer Oelerich von den D. F. W. mit 10 St. 58 Min. Ihm folgt Siewert mit 8 St. 50 Min., Römpler mit 6 St. 40 Min , Pollandt mit 5 St. 3 Min., Oberlt. Bier 4 St. 38 Min., Sergeant Mante 3 St. 57 Min., Lt. Clemens 3 St. 21 Min., Oberlt. Dielze 2 St. 34 Min. und Oberlt. z. S. Mans, 1 St. 34 Min. Die größte Zahl der Flüge hat ebenfalls Oelerich mit 46 und ihm zunächst folgt Römpler mit 32. Die Fliegerprüfung bestanden Oberlt. Dietze, Lt. Clemens und Sergeant Mante. Lt. Clemens legte auch die Feldpilotenprüfung im besten Stile ab. Ueberlandflüge nach Döberitz führten Oberlt. Bier, Römpler, Oelerich und Siewert aus. Ferner flog Oelerich nach Altenburg und Römpler konnte sich bei dem Fluge „Rund um München" als Dritter plazieren. Die Schüler Hauptm. von Minkwitz, Oberlt. Walther, Lt. Prestien, Lt. von Raczeck, Lt. Bieneck, Dennicke, Iwan, Linke, Patberg und Sonntag übten fleißig und im Laufe des Monats Juli dürften wohl die meisten von ihnen die Flugzeuprüfung ablegen. Ferner beteiligten sich die Deutschen Flugzeugwerke durch einen Geschwaderflug bei der Einweihung des Leipziger Luftschiffhafens, an dem Oberlt. Bier, Römpler, Oelerich, Pollandt und Sergeant Mante als Führer teilnahmen. Der Luftverkehr in Leipzig hat im vergangenen Monat eine weitere Zunahme erfahren. Es landeten und flogen weiter: Oberlt. IDietze (Begleiter Lt. Drerhsel), von Oerzen (Lt. von Clausewitz), Freiherr von Thüna (Lt. Winkler), Lt. Meyer (Lt. Koch), Lt. von Buttler (Lt. Friedberg) und Lt. Canter (Oberlt. Hildebrandt); Wie wir hören, werden die Deutschen Flugzeugwerke, mit Rücksicht auf die starke Vermehrung der Zahl ihrer Schüler, ihre Schule nach Fertigstellung der entsprechenden Bauten nach Mockau verlegen. Die Deutschen Flugzeugwerke haben sich in erster Linie zu diesem Schritte veranlaßt gesehen, um dem Leipziger Luftschiffhafen von vornherein einen recht regen Flugbetrieb zu sichern und dieses heimische Unternehmen zu unterstützen. Die Feldpilotenprüfung erfüllten am 26. Juni Oberlt. von Helldorf auf Rumpler-Taube sowie am 4. Juli Fritz Hammer auf Harlan. Der Flieger Hennig von der Firma Otto Schwade & Co , Erfurt, startete am 4. d. Mts. nachmittags bei heftigem Wind in Gegenwart der Sportzeugen um die Prämie der Nationalflugspende. Hennig flog ununterbrochen 2 Stunden und 5 Minuten in bedeutender Höhe. Er benutzte einen „Stahlherz"-Doppeldecker mit einem deutschen 80 PS Schwade-„Stahfherz"-Rotationsmotor, der ausgezeichnet funktionierte. Ein Flugzeug-Zusammenstoß erfolgte am 4.Jull in Johannisthal. Gegen 7:30 Uhr abends waren Hölscher zu einem Uebungsflug auf A. F. G.-Doppeldecker, ferner Hauptmann Friedel auf L. V. G.-Doppeldecker aufgestiegen. Auf der Seite von Adlershof stießen die Flugzeuge in Höhe von ca. 15 m zusammen und stürzten ab. Hölscher wurde tödlich verletzt, während Hauptmann Friedel mit einigen Verletzungen davonkam. Ausland. Der französische Wettflug von Deauvilie und der Marinefiugzeug-wettbewerb vom 21.—31. August 1913. Der Wettflug Paris-Deauville wird am Sonntag, den 24. August mit dem Start, der von 8'(, Uhr stattfindet, in Pecq, etwas unterhalb der Eisenbahnbrücke, vor sich gehen. Auf der Strecke sind 23 Kontrollstationen mit Wegmarken vorgesehen. Drähte, die die Seine frei überspannen, werden durch 30 m lange und 70 cm breite Zeichen kenntlich gemacht. Die Flieger müssen genau dem Lauf der Seine folgen; daher sind die Kontrollstationen jeweils an den Krümmungen des Flusses angeordnet. Jeder Flieger muß diese Stationen umfliegen, wo Mitglieder des Aero-Club de France das Vorbeifliegen der Apparate kontrollieren werden Kein Flug, bei dem zwischen Pecq und Deauvilie das Wasser berührt wird, wird gewertet werden. Zu dem Marinewettbewerb wird auf dem Strande von Deauvilie ein besonderer Platz hergerichtet mit einer Abflugbahn, die bis in das Meer reicht und auch zum Inswasserbringen der Apparate dienen soll. Auf diesem Platz können die Konstrukt.ure ihre Schuppen und Zelte aufschlagen. Alle Fahrzeuge, die zum Transport der Flugzeuge auf das Wasser dienen, laufen auf Holzgleisen, die jeden Schuppen mit der Abflugbahn verbinden. Höchstwahrscheinlich wird der Marineminister vier Torpedoboote, fünf Torpedojäger und einen Bugsierdampfer für die Zeit vom 24.—31. August nach Deauvilie abkommandieren. Wettbewerbe. Die Resultate der Wiener Flugwoche. Ueber den Verlauf der Wiener Flugwoche berichteten wir bereits in der letzten Ausgabe des „Flugsport". Der Hauptteil der Gewinne fiel den Franzosen zu. Es erhielten: Perreyon (Bleriot) 31 000 Kronen Garros (Morane-Saulnier) 18 900 „ Iiiner (Lohner-Pfeil, 120 Austro-Daimler) 18 500 Sablatnig lUnion-Pfeil, 120 Austro-Daimler) 10 000 Audemars (Morane-Saulnier) 8500 „ Chevillard (Farman-D) 5500 Bielovucic (Hanriot-Ponnier) 5200 „ Bathiat (Bathiat-Sarichez) 5000 Hold (Lohner-Daimler) 4500 Für den Osfpreußischen Rundflug, der in der Zeit vom 9. bis 14. August stattfindet, haben gemeldet: 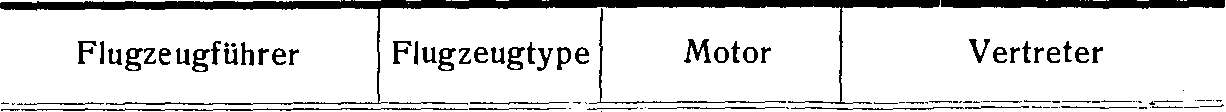 Felix Laitsch, Nieder-Schöneweide Alois Stiploscheck, Johannisthal b. Berlin J. Suwelack, Rotthausen (Krs. Essen) Victor Stoeffler, Mülhausen Eis. Ernst Schlegel, Habsheim Ober-Eis. Joseph S a b 1 a t n i g, K. Caspar, Gotha R. Thelen, Dipl.-lng. Albatroswerke Kühne, Albatroswerke Hermann Schiedeck, Johannisthal Alfred Friedrich, Sport-Fliege-Johannist. Beck, Leo Roth, Harlan-Werke Lt. Canter, Fliegeroff Berlin Willy Kan itz, Bork b. Brück in d. Mark Bruno Langer, Johannisthal Hermann R ei ch el t, Nieder-Schöneweide Eindecker L.-V.-G Jeannin, Stahltaube Kondor Aviatik, Pfeil-Doppeldecker Aviatik Eindecker Union Doppeldecker Gothaer Waggonfabrik Albatros-Doppeldecker Albatroswerke A. F. G. Eindecker Etrich-Taube Kondor Harlan -Eindecker Rumpier Luftfahrzeugbau Grade Eindecker Doppeldecker L -V.-G. 75 PS od 100 PS Gnome 6 Cyl. Daimler-Motor 130 PS 6 Cyl. Mercedes 6 Cyl Argus 4 Cyl. Argus 4 Cyl. Mercedes 100 PS 6 Cyl. Mercedes 6 Cyl. Mercedes 6 Cyl. Stoewer-Loutz-koy 4 Cyl. Daimler 6 Cyl. Mercedes 95 PS 4 Cyl. Rumpier 6 Cyl. Grade 4 Cyl. Mercedes oder Argus 4 od. 6 Cyl. Otto Stiefvater B. E. Schrote r, Rotthausen (Krs.Essen^ Charl. Ingold, Rixheim b. Mülhausen E. S t o e-f f I e r, Albatroswerke B o e h m, Albatroswerke Herbert Kohnert, Berlin Linn ekogel, Hans Loren z, Beelitz Heilstätten Gerh. Sedlmayr, Johannisthal Eindecker Argus 100 PS Harlan 4 Cyl. Der Wettbewerb ist offen für: a) deutsche Offiziere aut Flugzeugen einer deutschen Heeresverwaltung, b) andere Flugzeugführer deutscher oder österreichischer Reichsangehörigkeit, sofern dieselben gegen Haftpflicht versichert sind (500000 Mk. bei Katastrophen, 100000 Mk. im Einzelfalle). Alle teilnehmenden Flugzeugführer müssen einen ununterbrochenen Flug von einer Stunde Dauer und mindestens 10 Flüge mit Fluggast ausgeführt und wenigstens einmal die Höhe von 800 m erreicht haben Programm. Für Gruppe a): Sonntag, den 10. August, Zuverlässigkeitsfhig von Königsberg nach Allen-stein (150 km) verbunden mit photographischem Wettbewerb beim Schloß Schlobitten. Montag, den 1 1. August, Zuverlässigkeitsflug von Allenstein nach Insterburg, verbunden mit einer Aufklärungsübung (130 km). Dienstag, den 12. August, Aufklärungsübung von Insterburg aus (100km). Mittwoch, den 13. August, Zuverlässigkeitsflug von Insterburg nach Königsberg (85 km). Donnerstag, den 14.August, von nachmittags 5 Uhr an: Flug von Königsberg nach Pillau und zurück verbunden mit Aufklärungsübung an der See (70 km). Für Gruppe b): Sonnabend, den 9. August, nachmittags 5 Uhr: Vorprüfungen. Jedes Flugzeug muß mindestens 15 Minuten in der Luft sein. Mit Genehmigung der Oberleitung können hiervon Befreiungen erteilt werden. Sonntag, den 10. August, Zuverlässigkeitsflug von Königsberg nach Insterburg (85 km). Nachmittags 5 Uhr auf dem Insterburger Flugplatz: Wettbewerb für kürzesten Auslauf. Es dürfen drei Versuche gemacht werden, von denen der beste gilt. Montag, den 11. August, Zuverlässigkeitsflug von Insterburg nach Allenstein, verbunden mit einer Aufklärungsübung (130 km). Dienstag, den 12. August, auf dem Flugplatz Allenstein: Bombenwurfwettbewerb aus einer Höhe von mindestens 500 m. (5 Bomben im Mindestgewicht von 10 kg, die von den Bewerbern mitzubringen sind. Mittwoch, den 13. August, Zuverlässigkeitsflug von Allenstein nach Königsberg (150 km), verbunden mit photographischem Wettbewerb beim Schloß Schlobitten. Donnerstag, den 14. August von nachmittags 5 Uhr an: Flug von Königsberg nach Pillau und zurück verbunden mit einer Aufklärungsübung an der See (70 km). Die Flüge von und nach Königsberg müssen in einer Mindesthöhe von 500 m ausgeführt werden, d. h. die Festungswerke müssen in dieser Höhe in jedem Fall überflogen werden. Der Mecklenburgische Rundflug wurde am 21. Juni durch Schaufllige in Lübeck eingeleitet. Von den gemeldeten Maschinen erschienen am Start: Schüler auf Ago-Argus-Doppeldecker. Stiploscheck auf Jeannin-Stahltaube, Kremer auf Fokker-Argus-Eindecker, ln.old auf Aviatik-Argus-Eindecker, Dick auf D. F. W.-Pfeil Doppeldecker und Rosenstein auf Gotha-Mercedes-Taube. Die größte Höhe erreichte Stiploscheck mit 2300 m. Schüler auf Ago-Doppeldecker machte einen Ueberlandflug über Travemünde-Ratzeburg und kehrte nach dem Lübecker Flugplatz zurück. Am 22. Juni begann der Start zur ersten Etappe des Rundfluges. Es erschienen um 6JJhr morgens sämtliche Flieger am Start. In Schweiin landeten: Rosenstein nach 36 Min.. Schüler nach 37'/» Min, Dick nach 39 Min. und Kremer nach 46'ls Min. Bei den Schauflügen auf dem Flugplatz Görries in Gegenwart des Großherzogs erreichte Rosenstein auf Gotha-Taube 2700 m, Kremer auf Fokker-Eindecker 2300 m. Am 24. Juni wurde für die zweite Etappe Schwerin-Lübeck gestartet. Die Flugzeiten waren folgende: Rosenstein 55 Min., Kremer 1,05 Std, Schüler 1,30 Std., Inguld 1,56 Std. Schüler und Ingold mußten unterwegs einem Gewitter ausweichen und benötigten daher eine längere Flugzeit. Das Gesamtklassement ist folgendes: 1. Preis Rosenstein auf Gotha-Mercedes-Taube, 2. „ Kremer auf Fokker-Argus-Eiedecker, 3. „ Schüler auf Ago-Argus Doppeldecker, 4. „ Ingold auf Aviatik-Argus-Eindecker. Der Wettflug „Rund um Berlin" findet am Sonnabend den 30. und Sonntag den 31. August statt. Nennungsschluß ohne Nachnennungsgeld 20. August nachmittags 5 Uhr Die Geschäftsstelle ist die des Berliner Verein für Luftschiffahrt, Berlin W. 9, Linkstraße 25. Telegramm-Adresse: Rundflug. Dorthin sind alle Anfragen und Zuschriften zu richten. Bank-Konto: Deutsche Bank, Depositenkasse CD, Berlin W. 9, König-grätzerstr. 6 (Rundflugkonto des Berliner Vereins für Luftschiffahrt), Fernsprech-Anschluß: Amt Kurfürst 9770. Das Flugzeug muß in allen Teilen (auch der Motor) in Deutschland hergestellt sein. Die Motoren dürfen nicht stärker als 100 PS sein, jedoch soll eine Mehrleistung bis zu 10 v. H. nach dem Bremsattest des Herstellers zugelassen werden. Wird durch einen Protest eine Motorprüfung von unparteiischer Stelle nötig, so werden die Kosten aus den Nenngeldern des Verlierenden gedeckt. Die Abnahme der Flugzeuge erfolgt am Freitag, den 29. August, nachmittags von 3 Uhr ab durch die Beauftragten des Organisationsausschusses und der sportlichen Leitung in Gegenwart des Fliegers oder eines Stellvertreters, welcher schriftlich hierzu bevollmächtigt sein muß. Jedes Flugzeug wird mit 200 kg belastet, es muß außer dem Flieger einen Fluggast tragen; beider Gewicht wird vor dem Abflug festgestellt und erforderlichenfalls durch plombierten Ballast auf 200 kg ergänzt. Die Bewerber umfliegen Berlin am ersten Tage einmal, am zweiten Tage zweimal auf folgendem Wege: Flugplatz Johannisthal, Klarahöhe bei Lindenberg, Flugfeld Schulzendorf, Kaserne zwischen Bornstedt und Eiche, Luftschiffhafen Potsdam, Flugplatz Johannisthal. Bei jeder Runde muß je eine Wendemarke auf Klarahöhe, auf dem Flugfelde Schulzendorf, bei der Kaserne zwischen Bornstedt und Eiche und dem Luftschiffhafen Potsdam außen umflogen werden. Die Wendemarken müssen in der Flugrichtung links liegen bleiben. Die Bewerber um den Dreirunden-Preis müssen während eines der 3 Flüge um Berlin die Erreichung einer Höhe von mindestens 1000 Meter durch ihren plombierten Barographen oder Barometer nachweisen. Die Starterlaubnis wird an beiden Tagen von 3 Uhr 30 Min. nachmittags ab gegeben werden und zwar in der Reihenfolge der Meldungen. Die Bewerber haben am zweiten Tage zwischen der ersten und zweiten Runde eine Zwischenlandung auf dem Flugplatz Johannisthal auszuführen. Nach Ueberfliegen der Ziellinie, die sich von der Zeppelinhalle zur Versuchsanstalt erstreckt, ist Flugzeug und Motor zum Stillstand zu bringen. An Preisen stehen ca. 100 000 Mark zur Verfügung. Frühpreise. Von den Flugzeugen, welche die geforderte Tagesleistung vollbracht haben, erhält der Besitzer des zuerst abgeflogenen Flugzeugs einen Frühpreis von 750 Mark, der als zweiter abgeflogene 500 Mark. Schnelligkeitspreise, a) Rundenpreis des ersten Tages: Der Besitzer des Flugzuges, welches die Runde des 1. Tages in der besten Zeit zurückgelegt hat, erhält, gleichgiltig. ob das Flugzeug am 2. Tage geflogen ist oder nicht, 5000 Mark. Der Besitzer des zweitschnellsten Flugzeuges 2000 Mark. Der Besitzer des drittschnellsten Flugzeuges 1000 Mark. b) Rundenpreis des zweiten Tages: Der Besitzer des Flugzeuges, welches die zwei Runden des 2. Tages in der besten Zeit zurückgelegt hat, erhält, gleich-giltig, ob das Flugzeug am 1. Tage geflogen ist oder nicht, 5000 Mark. Der Besitzer des zweitschnellsten Flugzeuges 2000 Mark. Der Besitzer des drittschnellsten Flugzeuges 1000 M. c) Dre i r u n den preis: Der Besitzer des Flugzeuges, welches alle 3 Runden in der besten Gesamtzeit zurückgelegt hat, erhält den Preis der National-Flugspende = 15000 Mark Der Besitzer des zweitschnellsten Flugzeuges erhält den Preis des Preuß. Kriegsministeriums = 10 000 Mark. Der Besitzer des drittschnellsten Flugzeuges 5000 Mark. Diese drei Preise können nur von Bewerbern gewonnen werden, welche die vorgeschriebene Höhe von 1000 m erreicht haben. Ferner werden Zuverlässigkeitspreise, 49 000 Mark und die ersparten Preise nach Punktzahlen verteilt, wobei der erste Tagesstart, die erste Zwischenlandung u.s.w. berücksichtigt werden. Patentwesen. Gebrauchsmuster. 77h. 549167. Zündungsausschalter für Flugzeuge. Deutsche Flugzeug-Werke G. m. b H., Leipzig. 15. 3. 13. D. 14 629. 77h. 549198. Hilfsklappen mit zwangläufiger Führung zur Schräglagensteuerung von Flugmaschinen. August Euler, Frankfurt a. M.-Niederrad. 25. 3. 13. E. 18828. 77h. 549228-28. Flugapparat. Robert Uhland. Stuttgart, Tübingerstr. 25. 29. 2. 12. U. 3962. 77h. 549 771. Flugzeug mit einziehbarem Anlaufgesteli. E Rumpier Luftfahrzeugbau G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg, 6. 5. 11. R. 29855. 77h. E49868. Schwimmer mit Radachse für kombinierte Land- und Wasser-Flugmaschinen. Gust. Mees, Charlottenburg, Schlüt^rstr. 81. 26.3.13. M. 45796. 77h 550 332. Kufe für Flugzeug-Laufgestellc mit federnd gelagerten Laufrädern. Gustav Otto, München, Schleißheimerstr. 135. 14. 3. 13. O. 7779. 77h. 550 343. Kühler mit versetzten Kühlrippen, insbesondere für Flugmaschinen. August Euler, Fraukfurt a. M.-Niederrad. 25. 3. 13 E. 18 822. 77h. 550 650. Schwimmer für Wasserflugzeuge mit Wassereinlaß Christian Joehns, NeumUnster. 5 4. 13. J. 13867. 77h. 550 651. Schwimmer für Wasserflugzeuge mit elastischen Auftriebsflossen. Christian Joehns, NeumUnster. 5. 4. 13. J. 13 867. 77h. 550 652. Schwimmer für Wasserflugzeuge mit Querschnittsprofilen von doppelter Krümmung. Christian Joehns, Neumünster. 5. 4. 13. J. 13 868. Verschiedenes. Der III. Internationale Kongress für Luftrecht findet am 25., 26. und 27. September dieses Jahres in Frankfurt a. M. statt. 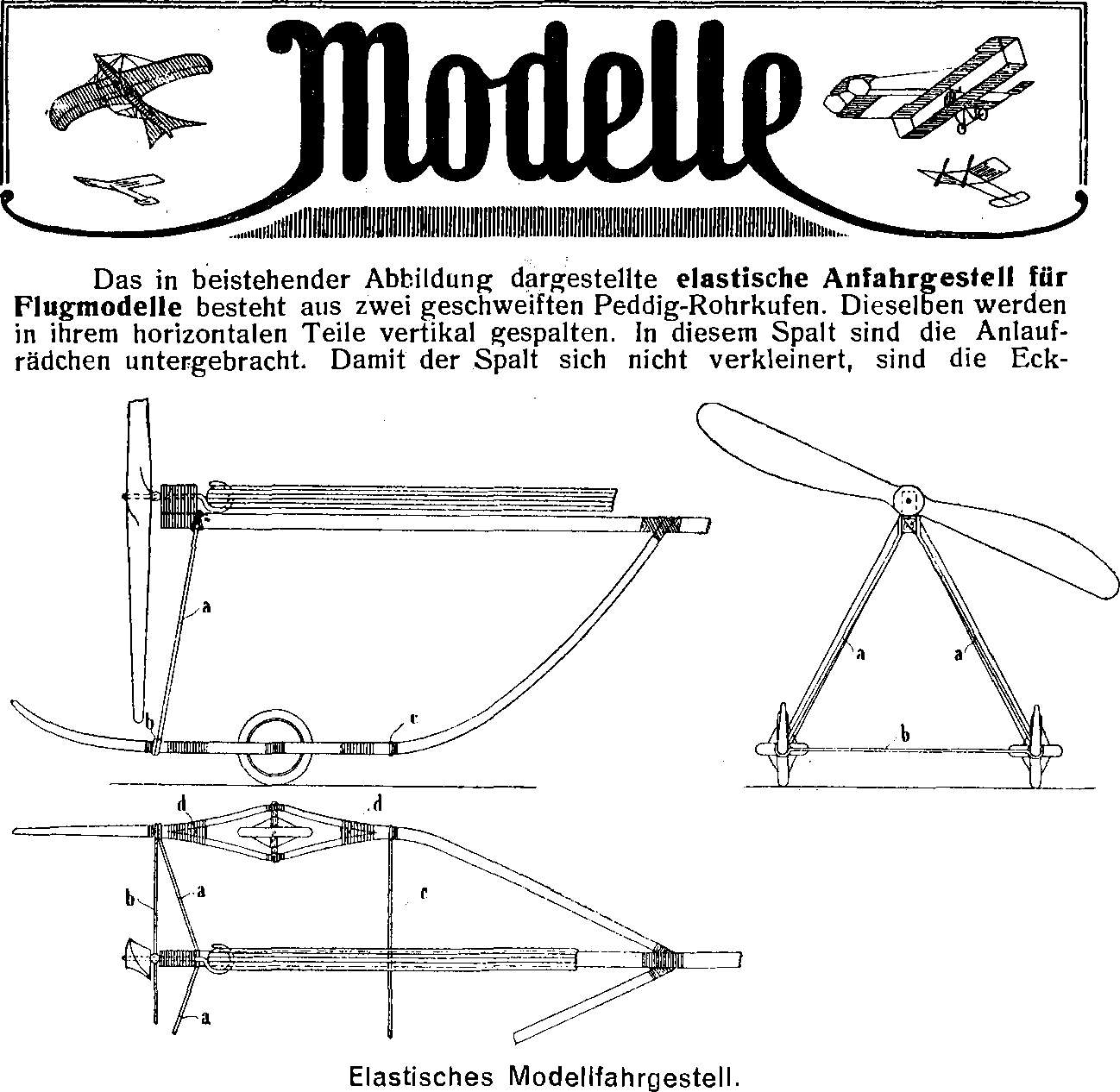 klötzchen d eingeleimt und mit Bindfaden umwickelt. Um den Abstand beider Kufen von einander innezuhalten, sind die Stahldrnhte b und c dazwischen gestellt. An den Enden dieser Querstützen befinden sich Ringösen. Zur Abstützung der Kufen nach oben sind die Stahldrahtstreben a vorgesehen, die an ihren Enden ebenfalls zu Ringösen umgebogen und über die Kufen geschoben sind. Damit §ich die Abstützungen nicht verschieben, wird vor und hinter den Ringösen ein Bindfaden aufgewickelt. Der Bindfaden muß fest angezogen und mit Leim ge-trättkt werden. Das Fahrgestell hat bei einseitigem Landen des Modells den Vorteil, daß die Rädchen seitlich nachgeben können, indem sich die Kufe in den Ringösen dreht. _ Friedrich. Ein Uebungsfliegen mit Modellen veranstaltet der „Dresdner Modellflugverein" am Mittwoch den 9. Juli, nachmittags von 4Vs Uhr an auf dem Sportplatz des Ballspielclubs Sportlust an der Helm-holtzstraße bei jedem Wetter. Zur Teilnahme sind auch Nichtmitglieder und Schüler berechtigt. Startgeld wird nicht erhoben. Der Verlauf des Uebungs-fliegens sowie photographische Aufnahmen der gestarteten Modelle werden in der nächsten Nummer veröffentlicht werden. — Im Oktober beabsichtigt der Dresdner Modell-Flugverein ein Modell-Wettfliegen größeren Stils abzuhalten. Ausschreiben für Wettbewerbe freifliegender Flugzeugmodelle, Gleitflugzeugmodelle und Drachen. Außer Ehrenpreisen stehen an Geldpreisen Mk. 800.— zur Verfügung. Der Verein für Luftfahrt E. V., Darmstadt, wird am Sonntag, den 12. Oktober 1913, nachmittags 3 Uhr auf dem Olympia-Sportplatz Heidelbergerstr. Wettbewerbe abhalten. I. Wettbewerbe für freifliegende Flugzeugmodelle. § 1. Zum Wettbewerb zugelassen sind alle durch eigne Kraft fortbewegten Flugzeugmodelle. Ausgeschlossen bleiben Modelle, deren Antrieb durch irgendwelche Hilfsmittel erfolgt, die vom Modell nicht in der Luft mitgenommen werden. Gewerbsmäßig hergestellte Modelle können außer Wettbewerb teilnehmen. Ueber Zulassung von Modellen entscheidet die Sportleitung nach eigenem Ermessen ohne Angabe von Gründen. § 2. Der Wettbewerb findet in mehreren Klassen statt Klasse A: Modelle mit Gummimotor. 1. Modelle im Gummigewicht bis 10 g 2 „ „ „ von mehr als 10 bis 50 g 3. n » » über 50 g 4. „ „ bis 10 g 5. „ „ „ von mehr als 10 bis 50 g [ Start vom Boden. 6. „ „ „ über 50 g J Klasse B: Modelle mit Federwerkantrieb. Klasse C: Modelle mit Antrieb durch verdichtete Gase usw. Bei den Klassen B und C muß der Start vom Boden erfolgen. § 3. Jedes Modell darf 3 Flüge ausführen, von denen nur der längste gewertet wird. Beim Abwerfen aus der Hand hat der Start hinter einer Schranke zu erfolgen und unter einem Stabe, der sich zwei Meter über dem Boden befindet. § 4. Gewertet wird bei allen Modellen lediglich die zurückgelegte Strecke, geradlinig gemessen zwischen der Startschranke und dem Auslaufpunkt. Bei den vonv Boden startenden Modellen muß e ne Plughöhe von mindestens ein Meter erreicht werden. Niedrigere werden nicht gewertet. § 5. Für die Wertung ist eine Mindestleistung im Freiflug nötig, und zwar bei Klasse A1 und A4 ... 10 m B . . . 10 m A2 „ A5 . . . 20 „ C . . . 30 „ A3 „ A6 . . . 30 „ § 6. Jedes Modell kann nur einen Preis erhalten. Es ist indessen gestattet, mehrere Modelle anzumelden. § 7. Modelle, die 'geeignet erscheinen Unglücksfälle oder dergl. zu verursachen, sind ausgeschlossen. Es empfiehlt sich vorherige Anfrage beim veranstaltenden Verein. § 8. Der Wettbewerb ist offen für jedermann ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit. 1 Start durch Abiwerfen aus der Hand. Außerdem mehrere Ehrenpreise für besondere Leistungen. § 9. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind fertig gekaufte Modelle. § 10. Es gelangen folgende Preise zur Verteilung: Für jede der Klasse A 1, A 2, A 3, A 4, A 5 und A 6 Ein erster Preis von 30 Mark „ zweiter „ „ 20 „ „ dritter „ „ 10 „ Für Klasse B . . Ein erster Preis von 40 Mark „ zweiter „ „ 30 „ „ dritter „ „ 10 „ Für Klasse C . . Dieselben Preise wie für Klasse B. §11. Zugelassen werden nur Modelle, die an der vom Verein für Luftfahrt in der Zeit vom 9. bis 12. Oktober 1913 veranstalteten Ausstellung teilgenommen haben und bei der Einlieferung mit dem Vermerk „Teilnahme am Wettfliegen" versehen waren. § 12. Spätestens am 10. Oktober wird in der Ausstellung eine Liste ausgehängt, aus der sich die Reihenfolge der Modelle beim Start des Wettfliegens ergibt. Teilnehmer, die auf Namenruf nicht sofort am Start erscheinen, werden übergangen. Sie können am Schlüsse des Wettbewerbes der betreffenden Klasse nachträglich zugelassen werden, wenn dadurch keine nennenswerte Verzögerung entsteht. § 13. Das Preisgericht besteht aus den Herren: Hauptmann von Dewall, Darmstadt. Geheimer Baurat Gutertnuth, Darmstadt. Fabrikdirektor Lutz, Darmstadt, Ingenieur Ursinus, Frankfurt a. M. Kommerzienrat Wittich, Darmstadt. Die Entscheidung des Preisgerichts ist endgültig, Berufung dagegen ist nicht zulässig und der Rechtsweg ausgeschlossen. II. Wettbewerb für Gleitflugzeugmodelle. § 1. Zum Wettbewerb zugelassen sind alle aus einer oder mehreren Flächen bestehenden Gebilde, gleichviel ob sie bereits vorhandenen Flugzeugen entsprechen, neue Formen von Flugzeugen im Modell wiedergeben, oder zur Ausführung im großen überhaupt nicht geeignet erscheinen. § 2. Eine Teilung in mehrere Klassen findet nicht statt. Jedes Modell darf drei Flüge ausführen Der Start geschieht hinter einer Schranke und unter einem Stabe, der sich etwa 10 m über dem Boden befindet. § 3. Gewertet wird nicht nur die im Gleitfluge zurückgelegte Strecke, sondern auch die Ausführung des Modells und seine Stabilität im Gleitfluge. Die Entscheidung über das Zusammenwirken dieser Eigenschaften bleibt dem Preisgericht überlassen. § 4 Es gelangen folgende Preise zur Verteilung: Ein erster Preis von 30 Mark 1 Außerdem Ehrenpreise „ zweiter „ „ 20 „ \ für besondere „ dritter „ „ 10 „ J Leistungen. § 5. Die im erstem Teile dieser Ausschreibung (Wettbewerb für freifliegende Flugzeugmodelle) enthaltenen Paragraphen 6, 7, 8, 9, 11, 12 und 13 gelten auch für diese Ausschreibung. III. Wettbewerbe für Drachen. § 1. Zu den Wettbewerben zugelassen sind Drachen jeder Größe und jeder Form. Sie dürfen mit keinem besonderen Hilfsmittel zum Aufstieg gebracht werden, sondern nur durch das übliche Ziehen vermittels einer Schnu/. § 2. Die Wettbewerbe sollen am Sonntag, den 12. Oktober 1913, nachmittags stattfinden. Es bleibt jedoch der Sporfleitung überlassen, die Wettbewerbe auf einen anderen Tag zu verschieben. Auch eine mehrmalige Verschiebung ist zulässig. § 3. Es finden zwei Wettbewerbe statt: a) Höhenwettbewerb, b) Wettbewerb für höchste Nutzlast im Verhältnis zum Drachengewicht. § 4 Die Dauer des Wettbewerbes beträgt zwei Stunden, kann aber von der Sportleitung beliebig verlängert werden Innerhalb der für den Wettbewerb offenen Zeit können mit jedem Drachen beliebig viele Aufstiege gemacht werden. § 5. Es gelangen in jedem der zwei Wettbewerbe folgende Preise zur Verteilung: Ein erster Preis von 30 Mark | Außerdem Ehrenpreise für besondere „ zweiter „ „ 20 „ | Leistungen, z. B. für Photographien „ dritter „ „10 „ J mit Hilfe des Drachens. § 6. Die im ersten Teil dieser Ausschreibung (Wettbewerb für freifliegende Flugzeug-Modelle) enthaltenen Paragraphen 6, 7, 8, 9, 11, 12 und 13 gelten auch für diese Ausschreibung. Schlußbemerkung. Etwaige Aenderungen der Bestimmungen und des Programms für den Wettbewerb sind der Sportleitung vorbehalten. Es ist erwünscht, daß die Modelle, die am Flugwettbewerb teilnehmen, einer Vorprüfung unterzogen werden. Vorprüfungen finden statt am 13. Juli, 7. September. Hierfür sind kleine Ermunterungspreise vorgesehen. Alle Anfragen sind an die Geschäftsstelle des Vereins für Luftfahrt E. V., Darmstadt, Landgraf Philipp-Anlage, zu richten. Frankfurter Flugmodell-Verein. An dem Uebungsfliegen am vergangenen Sonntag beteiligten sich: Zilch (Pfeil-Eindecker), Kopietz (Pfeil-Eindecker), Koch (Pfeil-Eindecker), Specht (Kondor-Eindecker und Taube), Adolf Jäger (Eindecker) und Reigner (Eindecker mit Uebersetzung.) Zilch stellte einen neuen Vereinsrekord auf, indem sein Eindecker-Modell vor den Flugprüfern Wittekind und Sieger 105 m flog. Besondere Beachtung verdient das Modell von Reigner, das mit einer Uebersetzung 1 : 2 ausgestattet ist. Es führte schöne Kreisflüge mit anschließender Gleitfluglandung aus. Das Gewicht des Modells beträgt 90 Gramm. Ferner wurden noch folgende Leistungen erzielt: Koch (Pfeil-Eind.) 50, 53, 58, 60, 61, 63, 55, 66 m Flüge, Zilch (Pfeil-Eind.. 350 gr) 78, 80, 82, 105 m Flüge Die Flüge wurden alle bei Bodenstart und in gerader Linie ausgeführt. Uebungsflüge'finden statt jeden Sonntag Vormittag von 7—11 Uhr und Mittwoch abends von 8 Uhr ab auf dem Gelände der ehem. Rosenausstellung, sowie ein Prämienfliegen Sonntag den 13. Juli von 6—8 Uhr abends auf dem Euler-flugplatz. Anmeldungen sind zu richten an den Vorsitzenden Fri t z Wi tt ekin d Eppsteinerstraße 26. Zur gefl. Beachtung: Zu der Notiz in No. 13 ist zu bemerken, daß der Uebermainflug nicht mit Wasserflugmodellen ausgeführt wird, sondern bleibt es den einzelnen Konstrukteuren überlassen, ihre Modelle mit Schwimmvorrichtung zu versehen oder nicht. Wittekind. 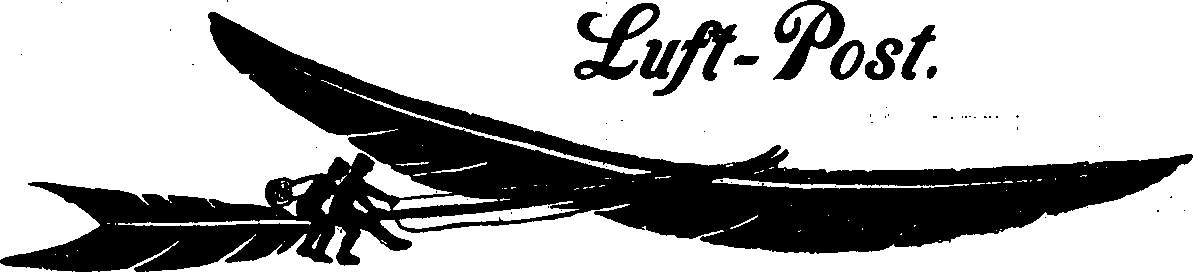 Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.) V. R. Bei Geschwindigkeitsänderungen ändert sich nur die Hebearbeit einer Flugmaschine, wenn alle anderen Funktionen dieselben bleiben. Bei ebenen Flächen (Steuerflächen) wandert der Druckmittelpunkt nach dem Gesetz von Avanzini. Die Lage des Dru ckmittelpunktes bestimmt man nach der empirischen Formel d = (0,2 + 0,3.sin. ab). Hierin bedeutet d den Abstand von der Vorderkante der Tragfläche bis zum Druckmittelpunkt, <* den Einfallswinkel der Tragfläche und b die Flächentiefe derselben. Bei gewölbten Flächen ändert sich die Druckmittelpunktslage bedeutend und hängt sehr viel von der jeweiligen Profilierung derselben ab. Zur Orientierung empfehlen wir Ihnen: Eiffel, la Resistance de l'air, Bendemann Luftschraubenuntersuchungen und Lilienthal der Vogelflug.  No. 15 23. Juli 1913. Jahrg. V. Jllustrirte technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnement: für das gesamte Kreuzband M.14 Postbezug M. 14 „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telet.4557 flmtl. Oskar UrsinilS, Civiling'enieur. Tel.-ftdr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. - = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = Her Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 6. August. Reminiscenzen. Mit Wehmut denkt man an die schönen Zeiten, wo die ersten Menschen flogen, wo man mit Begeisterung für die gute Sache arbeitete. Zu der Zeit war es ein Paradies, noch sündenrein. Und heute? Ein Sodom und Gomorra! Die Vorgänge sind zu bebannt, als daß sie nochmals besprochen werden müssen. Wer nicht „Ther-sites, nicht Grachus," Entgegnungen auf die Broschüre des Herrn Albert Greven „Moderne Gründungen," sowie die nachfolgenden Erwiderungen gelesen hat, ist nicht auf der Höhe. Eine schaurige Geschichte! Eine Erbauungslektüre für alle diejenigen, denen es vergönnt war, mit Begeisterung an der guten Sache arbeiten zu können. Ein Skandälchen folgt dem anderen. Berlin mit seinen Sensationszeitungen ist in dieser Hinsicht leistungsfähig. Wir wollen unsere Leser durch Mitteilungen von Einzelheiten über diese wenig schönen Vorgänge nicht von der guten Sache abbringen. Das große ^Reinemachen hat angefangen. Es wird noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen. Ein Zeichen für die fortgeschrittene Entwicklung in unserem Flugwesen. Von größter Bedeutung sind diese Vorgänge für unsere Behörden. Sie sind jetzt in der Lage zu beurteilen, wie sie sich zu den verschiedenen Persönlichkeiten, die sich einen Einfluß auf die Entwicklung des Plugwesens anmaßten, zu verhalten haben. Und das ist ein gewaltiger Fortschritt! Für die weniger Eingeweihten mögen allerdings diese Vorgänge entmutigend wirken. Dazu kam noch in letzter Zeit, daß die Franzoseu uns mit ihren Fernflügen begannen zu — wie sagt man doch gleich für utzen? — ■— Diejenigen Flieger mit sportlichem Gefühl hätten gern die Leistungen überboten, wenn sie gekonnt hätten. Zunächst gilt es wichtigere Aufgaben zu erledigen, Schüler aus der Nationalflugspende auszubilden, wahrlich keine leichte Arbeit. Den Schülern muß theoretischer Unterricht in Motorenkuude, Flugtechnik, Wetterkunde etc. erteilt werden. Dazu kommt der praktische Flugbetrieb auf dem Flugplatz, die Abnahmeprüfungen für Militärmaschinen und schließlich finden sich noch mit Mühe und Not einige freie Tage, um an den wichtigsten Wettbewerben, damit der Name der Firma nicht ganz vergessen wird, teilzunehmen. Die französischen Fernflüge waren weiter nichts als eine Reklame gegenüber dem französischen Kriegsministerium und um die Popularität der französischen Fliegerei im Volke zu erhöhen. Letzteres der wichtigste Faktor, mit dem die Industrie in Frankreich zu rechnen hat, im Gegensatz zu Deutschland. Auch müssen unsere Flugmaschinen, die in ihrer bisherigen Form, entsprechend den Erfordernissen der Militärverwaltung, lediglich schwere Militärmaschinen sind, für derartige sportliche Leistungen umgebaut werden. Hierzu benötigen wir in erster Linie leichtere Motoren, Rotationsmotoren, die wohl vereinzelt gebaut werden, aber noch nicht in größerem Umfange zur Verwendung gelangen. Das Interesse für den leichten Rotationsmotor ist durch den Einfluß des Automobilismus und nicht zuletzt durch den Erfolg des 4-Zyl. Benz-Motors anläßlich des Kaiserpreises gewaltsam unterdrückt worden. Es ist bezeichnend, daß während der diesjährigen Wettbewerbe sieh nicht ein einziger Benz-Motor an der Oeffentlichkeit zeigte. Demgegenüber beherrschen nach wie vor der Daimler und nicht zum letzten der gute alte Argus-Motor das Feld. Es ist schade, daß aus dem Wettbewerb nicht ein einziger Rotationsmotor, für den eben der Wettbewerb nicht zugeschnitten war, siegreich hervorging. Auch dieses Thema eignet sich nicht zur Besprechung an der Oeffentlichkeit. Jedenfalls haben die beteiligten Kreise sehr viel aus dem letzten Motorenwettbewerb gelernt. Wasserflugzeuge in England. (Von unserem Londoner Korrespondenten.*) In Verbindung mit den von der Londoner Zeitung „Daily Mail" gestifteten Preisen von 100000 M für einen Flug um England, Irland und Schottland und 200000 M für einen Flug über den Atlantischen Ozean ist es im Interesse der Leser, die englischen Wasserflugzeugkonstruktionen zusammenfassend zu besprechen. Der erstere Flug- gilt nur für solche Flugzeuge, welche ausschließlich m Großbritannien ent- *) Trotzdsm die meisten englischen Maschinen von Ingenieur Ursinus in früheren Nummern des „Flugsport" ausführlich beschrieben sind, geben wir in Nachstehendem eine zusammenfassende Beschreibung unseres englischen Flugplatz-Korrespondenten, die manche früher im „Flugsport" zum Ausdruck gebrachte Ansicht bestätigt. worfen und ausgeführt worden sind, während der zweite Flug international ist. Ersterer soll in den Monaten August-September zur Ausführung gelangen; als Start und Ziel ist ein Punkt, welcher noch näher bestimmt werden soll, in der Themsemündung vorgesehen. Da in den vorjährigen Manövern, in welchen nach den vielen Fliegerabstürzen auf Eindeckern ein Verbot erlassen wurde, das alle Eindecker aus der Armee ausschied, hat man auch in diesem Falle dem Doppeldecker den Vorzug gegeben und sind nahezu alle Maschinen, mit Ausnahme etlicher französischer Bauarten, Doppeldecker. 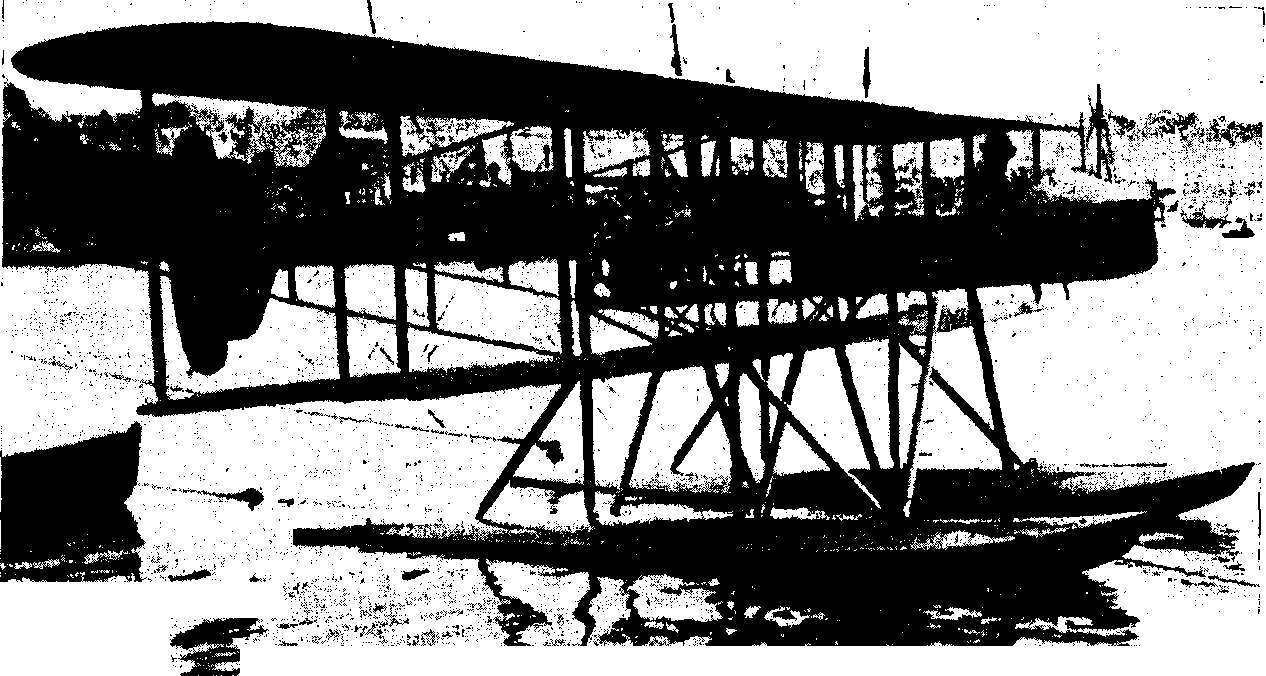 *-f. MM* Samuel White- Wasserdoppelde&er mit 160 PS Onom-Motor.  Samuel White-Wasserdoppeldecker nach einem Unfall. Die Schwimmkörper an "Wasserflugzeugen jedoch, welche früher lediglich dazu bestimmt waren, die Flugapparate beim Wassern vor dem Sinken zu bewahren, nähern sich immer mehr und mehr der Bootsform und macht sich jetzt bei allen Typen das Bestreben be- merkbar, ein den Anforderungen einer Wasserfahrt, selbst bei schlechtestem Wetter, genügendes Fahrzeug zu konstruieren. Dabei dient, ϖwie schon bemerkt ist, in den meisten Fällen das Boot als Vorbild, und bei einigen Typen wurde darin soweit vorgegangen, daß die ganze Maschine mehr einem Wasserfahrzeug als einem Flugzeug ähnelt. Eine der ältesten englischen Konstruktionen ist die der Gebrüder Short, zu Eastchurch, Insel Sheppey (Siehe Abb. Flugsport No. 5, S. 159 Jahrg. 1913). Commandeur Samson hat im vorigen Jahre auf einer dieser Wasserflugmaschinen in den Badeorten wundervolle Flüge vollführt. Dieser Wasserflugzeug-Doppeldecker besitzt fünf Schwimmkörper. Die beiden Hauptschwimmer sind von rechteckigem Querschnitt und haben eine flache, nach vorn leicht gekrümmte Gleitfläche. Jeder dieser Schwimmer ist in vier mit Oeffnungen versehene, wasserdichte Kammern eingeteilt. Auch sind Ventile angebracht, durch welche eingedrungenes Wasser leicht herausgepumpt werden kann. Die Ventile haben ferner den Zweck, der sich in höheren Regionen ausdehnenden Luft Austritt zu gewähren. An den Enden der unteren etwas kürzeren Tragfläche ist je ein kleiner zigarrenförmiger Schwimmkörper angebracht, die zur Erhöhung der Tragfähigkeit an dem hinteren Teil eine dünne Platte tragen. Unter dem am Schwanzende sich befindenden Höhen- und Seitensteuer ist ein den Hauptschwimmern ähnlicher, kleinerer Schwimmkörper angebracht. Dieser Schwimmer ist mit einem Ruder ausgestattet, dessen Achse mit einem Ende am Schwimmer befestigt und mit dem anderen im Flugkörper gelagert ist. Der Motor, ein 80 PS Gnom, ist mit einer besonderen Antriebsvorrichtung versehen, welche den A.ntrieb vom Passagiersitz aus ermöglicht. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 110 km. Der Benzinvorrat reicht für einen sechsstündigen Flug. Motor und Propeller sind im Vorderteil des Rumpfes gelagert. Der Sitz des Fliegers befindet sich hinter dem Fluggast. Damit das Flugzeug von beiden Sitzen aus gelenkt werden kann, ist eine Doppelsteuerung angebracht. Zum Bau des Rahmens und der Stützen wurden Stahlrohre verwendet, während die Sparren und Rippen der Tragflächen aus Eschenholz hergestellt worden sind. Eine andere vollständig neue Konstruktion ist der von Samuel White & Co. zu East Cowes (Insel Wlghij erbaute Wight Navyplane. (Siehe Konstruktionszeichnung in Flugsport No. 5 S. 160 Jahrg. 1913.) Diese Maschine ist der erste Versuch des bekannten Flugmaschinenkonstrukteurs Howard Wright auf dem Gebiete der Wasserflugtechnik. Im Gegensatz zu den viereckigen kastenartigen Schwimmkörpern bei älteren Maschinen verwendet der Erbauer hier zwei lange schmale Schwimmer, welche die Form eines Indianer-Kanoes oder eines Eskimo-Kajaks besitzen. Bug und Hek laufen spitz zu. Der Kiel hat 3 Stufen, jede von ungefähr 2Vj cm Tiefe, die jedoch keine Luftventile haben. Der Bootskörper ist in drei Lagen aus Eimenholz verfertigt, während für die äußeren Wände Cedernholz, auch in drei Lagen, verwendet wurde. Die Schwimmkörper, welche vollständig geschlossen sind, sind in acht wasserdichte Schotten geteilt. Die beiden Schwimmer besitzen am Hek ein kleines Steuer, welches zwangläufig mit dem Luftslcuer verbunden ist. 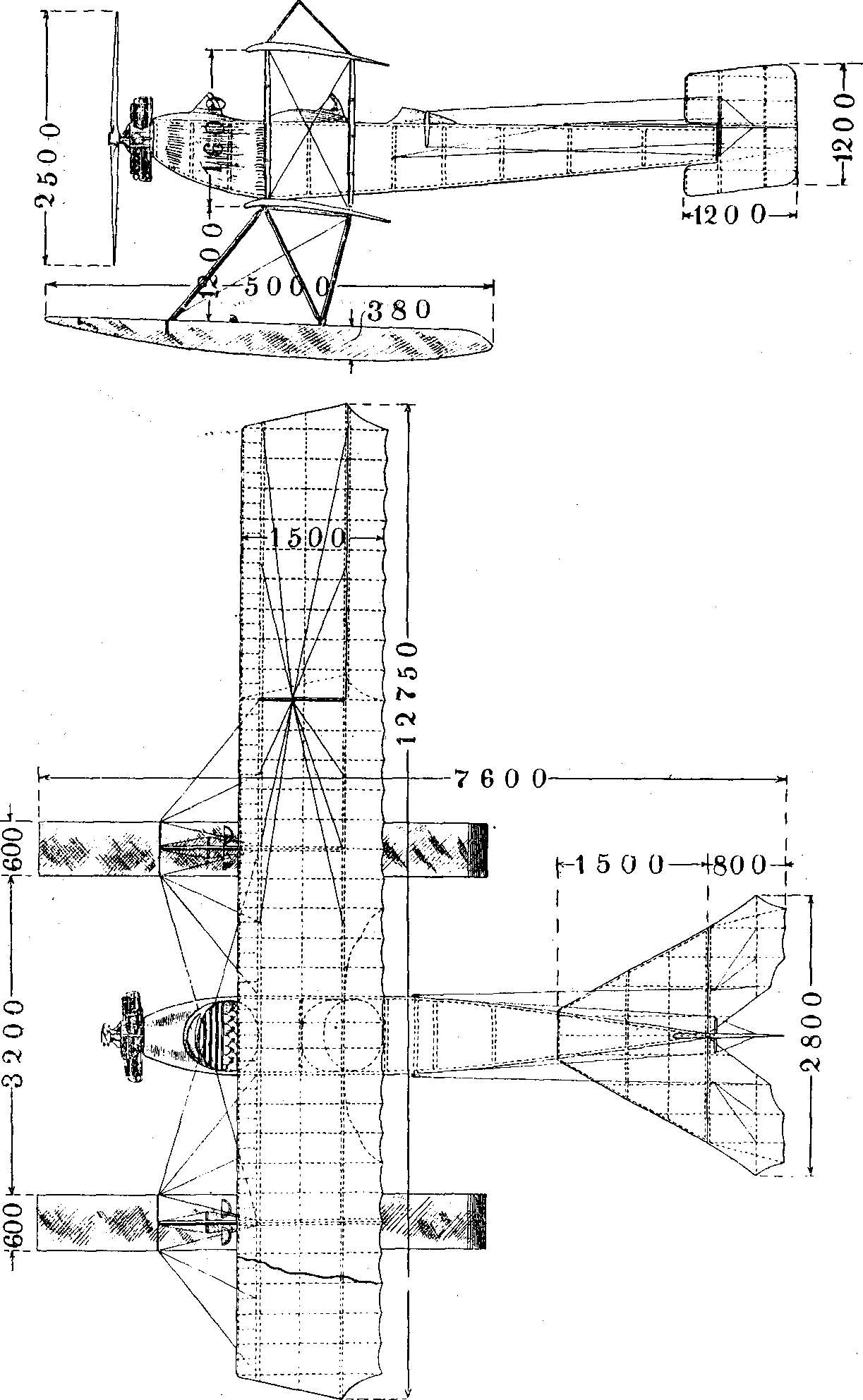 Oraliame White-Doppeldecker mit 60 PS Anzani-Motor. Die Sitze für Flieger und Fluggast befinden sich in dem unmittelbar über der unteren Tragfläche weit nach vorne vorspringenden Rumpfteil. Hinter diesem liegt der Benzinbehälter und noch weiter rückwärts ist der 160 PS Gnom-Motor montiert. Nach den Berechnungen soll der Motor bei vollem Fluge einen Kraftüberschuß von 60 PS auf» weisen. Besonders beachtenswert ist die Form des Tragflächenquerschnittes. Derselbe ist (wie aus der Olympia-Tabelle in Flugsport No. 4, S 123 Jahrg. 1913, ersichtlich) so geformt, daß die innere Fläche nur eine Krümmung, die äußere dagegen zwei Krümmungen aufweist, wodurch der Erbauer eine möglichst konstante Lage des Druckmittelpunktes zu erzielen sucht. Die Fluggeschwindigkeit des Doppeldeckers soll 50-119 km in der Stunde sein. Bei den Versuchsflügen jedoch, die am 14 Mai in der Nähe von Cowes stattfanden, erhob sich die Maschine mit dem Erbauer am Steuer, zu einer Höhe von ungefähr 10 Metern und überschlug sich dann nach rückwärts, um alsdann in den Fluten zu versinken. In Fachkreisen war man der Ansicht, daß die Maschine hinterlastig war. — Eine dritte neue Maschine ist die von der Grahame White Aviation Co. Ltd. konstruierte (Siehe Text, Tabelle und Konstruktionszeichnung in „Flugsport" No. 4 Seite 119, 123 und 124 Jahrg. 1913). Dieser Apparat ist sozusagen eine modifizierte Henry Farman Type. Die Schwimmkörper dieses Wasserflugzeuges sind zwei fünf Meter lange rechteckige Kasten mit einem Querschnitt von 60X38 cm. Bis zur Mitte ist die Gleitfläche der Schwimmkörper flach, um sich alsdann mit einer Scheitelhöhe von 10 cm nach innen zu wölben. Diesem Teil der Gleitfläche wird mittels Röhren von 5 cm Durchmesser, die an der oberen Fläche des Schwimmers heraustreten und mit Windfängen versehen sind, Luft zugeführt, um ein möglichst leichtes Gleiten zu erzielen. Die Befestigung zwischen Tragflächen und Schwimmkörpern besteht aus je drei Stahlröhren. Motor und Propeller sind auch bei dieser Konstruktion, wie beim Short-Flugzeug, im vorderen Teile des Rumpfes gelagert und treibt der 6 zylindrische 60 PS Anzanimotor den Propeller direkt. Passagier- und Fliegersitz befinden sich gleich hinter dem Motor und sind mit einem durchsichtigen Windschutz versehen, um die Insassen vor dem Luftstrom zu schützen Diese Maschine wurde nach einigen Versuchsflügen in eine Landmaschine umgewandelt und mit anderen ähnlichen Apparaten an die Heeresverwaltung verkauft. Eine von allen bisherigen Typen vollständig abweichende Konstruktion ist das Sopwith-Flugboot. (Siehe Text, Tabelle und Konstruktionszeichnung in „Flugsport" No. 4 S. 118, 121 und 123 Jahrg. 1913). Der Hauptschwimmkörper dieses Apparates ist, wie schon der Name deutlich sagt, ein Boot und wurde bei der Firma Saunders in Cowes (Insel Wight) in jeder Beziehung nach den Regeln der modernen Bootsbaukunst angefertigt. Zum Bau desselben wurden zwei Lagen Cedernholz verwendet, die nach dem patentierten Verfahren der Firma mit Kupferdraht genäht wurden. Die Länge des Bootskörpers ist 7 m, seine größte Breite 1,20 m und wiegt etwas über 80 kg, während das Gewicht der gesamten Maschine mit Motor und Flieger 540 kg beträgt. Sitzplätze für den Flieger und einen Passagier sind nebeneinander im Boot angebracht. Der Motor, ein 90 PS Austro-Daimler, ist auf einem Sockel unter der oberen Tragfläche angebracht. Die Wasserverdrängung des Bootskörpers ist so groß, daß der Vorderteil des Apparates, sollte er vornüber ins Wasser tauchen, durch den Auftrieb wieder aus dem Wasser gehoben wird, ehe die Tragflächen den Wasserspiegel berühren. (?)  Das Sopwith-Flugboot. Das Gewicht des Flugzeuges beträgt , , j t =_ *j - Vgl ein Viertel des Auf-'".". f triebes des Bootes. Das Boot ist außerdem in wasserdichte Kammern abgeteilt, so daß, selbst bei schwierigen Wetterverhältnissen, eine große Sicherheit gegen das Versinken vorhanden ist. Die aus der Zeichnung in Nr. 4 1913 S. 121 ersichtliche Stufe in der Gleitfläche des Bootkörpers hat den Zweck, starkes Stampfen zu verhindern, und ist ungefähr 80 mm tief. Ein kleines Höhensteuer, welches gemeinsam mit dem am Schwanzende reguliert wird, ist an der Spitze des Bootes angebracht. Die bei nahezu allen Bauarten hervortretende Kigcuschaft, die Schwimmkörper nicht nur seetüchtig zu machen, sondern auch deren Gleitf lache so  Wasser-Eindecker „Seagull" der englischen Deperdussin-Werke mit 100 PS Anzani. gut wie möglich zu vervollständigen, läßt die Entwicklung einer neuen Gleitbootkonstruktion vermuten, eines Gleitbootes mit Luftschraubenantrieb und Tragflächen, dessen Aktionsradius in der Luft wegen des großen Widerstandes und des Gewichtes der gleitboot-förmigen Schwimmkörper gegenüber den Flugmaschinen eine starko Einschränkung erfahren dürfte, daß aber das Flugzeug eine Geschwindigkeit zu entwickeln imstande ist, welche die gegenwärtig existierenden Gleitboote weit überragt. Der British-Deperdussin-Wasserflugzeug-Eindecker „Seagull", (Seemöve) ist eine andere bemerkenswerte Bauart auf dem Gebiete der Flugteohnik. (Siehe Artikel und Tafel in „Flugsport" No. 6, Seite 200 Jahrg. 1913). Die Seagull erregte schon vor einigen Monaten auf der Olympia-Fingzeugausstellung großes Aufsehen. Diese Maschine ist der Versuch der „Englischen-Deperdussin-Werke". Auf der Ausstellung besaß der Apparat bekanntlich nur einen großen Hauptschwimmer. Man hat nun jedoch vorgezogen, den großen, viereckigen Hauptschwimmer durch zwei schmälere Schwimmer, ähnlich denen des Short-Apparates, zu ersetzen. Ein kleiner Schwimmkörper, hergestellt aus drei Lagen Cedernholz, die mit wasserdichtem Stoff überzogen sind, ist unter dem Schwanzende des Apparates, ähnlich wie die Hauptschwimmkörper, befestigt. Auffallend ist, daß an der ganzen Maschine kein äußerer Spanndraht vorhanden ist, selbst die Kontrolldrähte für Höhen- und Seitensteuer sind im Inneren des Körpers angebracht. Eine andere Neuigkeit sind die unter den Tragflächen befestigten, mit denselben parallel laufenden Stützen. Man kommt sofort auf die Vermutung, daß der Konstrukteur es den deutschen Etrich- und Bumplertauben nachgeahmt hat. Der Motor ist ein 100 PS Anzani. Ein zweiter Apparat dieser Type nähert sich soiner Vollendung, und werden beide Maschinen nach Beendigung der Probeflüge von der Marineverwaltung übernommen werden, um in Kosyth, der neuen Marineflugstation, stationiert zu werden. Die Höchstgeschwindigkeit des Flugzeuges ist 120 km in der Stunde. Der Benzin-Kessel faßt Betriebsstoff für einen achtstündigen Flug. Eine für den transatlantischen Flug bestimmte Maschine neuester Konstruktion ist der von James Radley und Gordon England erbaute „Radley-England" Wasser-Doppeldecker (Siehe „Flugsport" No. 9, Artikel und Tafel Seite 312, Jahrg. 1913). Dieser Apparat fällt hauptsächlich durch seine Größe auf. Als Schwimmkörper sind zwei flache Boote, ähnlich dem des Sopwith-Bootes, verwendet worden, die durch Hohstützen und Drahtseile mit den Tragflächen verbunden sind. Von besonderem Interesse ist der Aufbau der drei 50 PS Gnom-Motoren. Dieselben treiben durch Kettentransmission eine vierflügelige Druckschraube an. Ueber den Motoren ist unter der oberen Tragfläche der Benzinbehälter, welcher Benzin für einen 10 stündigen Flug enthält, angebracht. Die Sitzplätze für Flieger und Fluggäste befinden sich in den Booten, und zwar in jedem drei hintereinander angeordnet. Steuervorrichtungen befinden sich in beiden Booten. Der Führer kann daher in dem einen Boote von dem Führer in dem anderen Boote abgelöst werden. Für eine Landung auf festem Boden sind Räder angebracht, die durch eine besondere Vorrichtung auf- und abgelassen werden können. Diese Flugmaschine machte vor kurzer Zeit gutgelungene Flüge unter 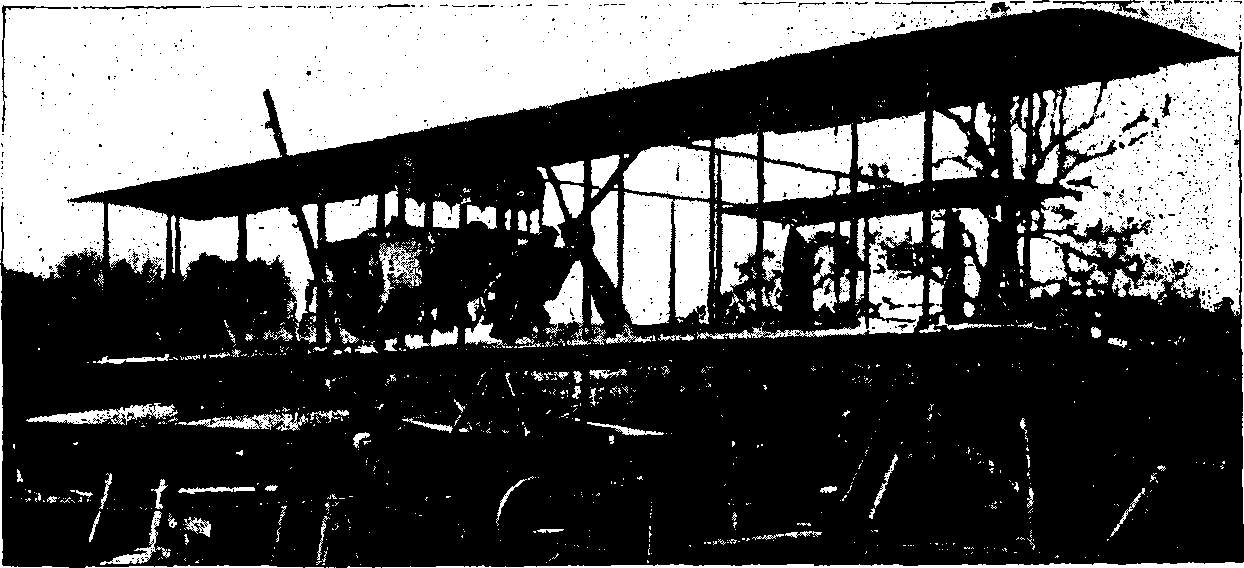 Der Radley-Wasscrdoppe'deckcr mit drei 50 PS Gnom-Motoren. 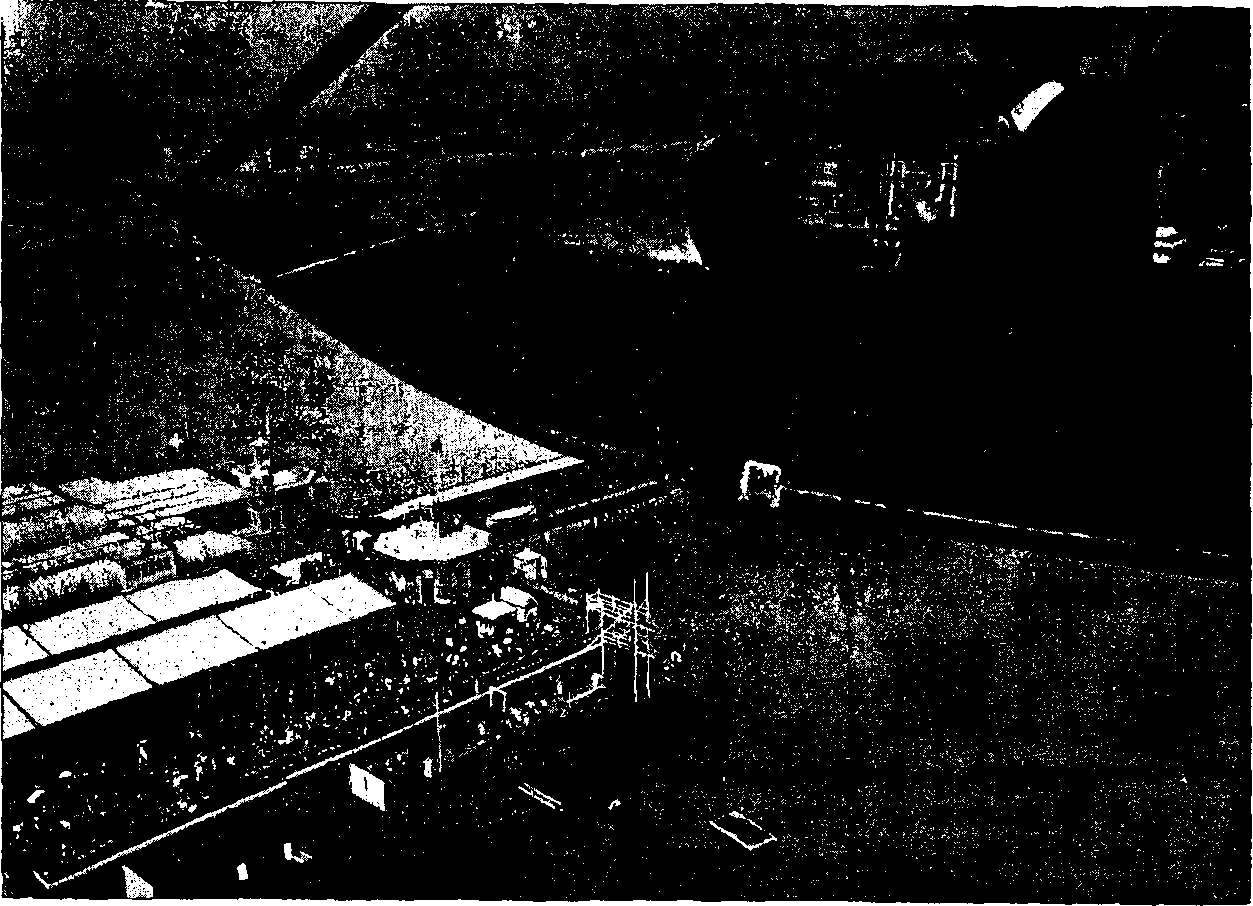 Blick auf Bad Brigthon aas dem Padley-Doppeldedzer. Die Aufnahne ist vom Passagiersitz aus dem backbord gelegenen Schwimmer au/gen ommen. der Führung des bekannten Fliegers Gordon-England, in der Nähe von dem Badeorte Brighton, und erreichte eine große Höhe. Beim Abfluge jedoch verwickelte sich einer der Verspannungsdrähte in die Motoren. Dank der Geschicklichkeit des Fliegers wurde ein größeres Unglück verhütet. Durch den gewaltigen Druck beim Wassern wurde eines der Boote leck. Deutschen, die dem französischen Flieger einen so schönen Empfang bereitet haben, hat er dabei aufzuzählen vergessen. Dem jungen ßrindejonc wurde bei all dem, was man ihm da Großartiges erzählte, offenbar ganz wirr im Schädel, und als der Herr Präsident seine Ansprache beendet hatte, lachte Brindejonc, lachte er das Lachen des Auguren. .... Interessant war, wie Herr Deutsch de la Meurthe in seiner Rede auf das Kriegsjahr 1870 hinwies (damals war ja Herr Deutsch wohl schon Franzose!), wie das belagerte und zerfleischte Paris den ziellosen Kugelballons seine BrieTe und Depeschen anvertrauen mußte, um draußen dem Lande ein Lebenszeichen zu geben. Wie anders werde es nun in einem Zukunftskriege sein : jetzt verbinden die rapiden Flugzeuge Städte, Länder und Weltteile, und es gibt keine Abgeschlossenheit mehr. Nun ist Brindejonc auf den geschmacklosen Einfall gekommen, seine plötzliche Popularität dadurch zu erhöhen, daß er die Flieger Guillaux und Audemars zu einem FliegCjrmatch herausgefordert hat, das an diesem Sonntag in Juvisy zum Austrag kommen soll, eine zweite Auflage des neulichen Matches Audemars-Garros. Daß Audemars dieser Tage den Flug Berlin—Paris realisiert und den Preis Batschari an sich gebracht hat, mußte natürlich hier besondere Genugtuung erregen. Die hiesige Fachpresse hob in allen Variationen hervor, daß der genannte Preis seit zwei Jahren ausgeschrieben sei und daß noch kein deutscher Flieger bisher die verlangte Flugleistung zu vollbringen vermocht hat. Der Kampf um den „Pommery-Pokal" wird natürlich, je mehr er sich seinem Ende und der definitiven Entscheidung nähert, immer heißer und interessanter. Maurice Guillaux unternahm auf seinem Metalleindecker Clement-Bayard letzthin wiederholte Versuche und legte dabei ansehnliche Strecken zurück, ohne indessen die bisherigen Leistungen erreichen zu können. Er legte die Strecke Paris, Bordeaux, Nimes, Avignon, Montelimar, Lyon, Dijon, Paria ohne Zwischenfall zurück. Aber zweifellos die Sensation der letzten Zeit war der ununterbrochene Flug Paris—Berlin, den Letort am vergangenen Sonntag auf einem Morane-Eindecker, 80 PS Rhone-Motor, ausgeführt hat. Bei Tagesanbruch von Villa-coublay abfliegend, erreichte Letort die deutsche Hauptstadt um Mittag, nachdem er die Distanz von rund 920 km in einem Zuge, ohne Zwischenlandung, hinter sich gebracht hatte! Letort hatte 240 Liter Benzin und 40 Liter Oel an Bord genommen. Er hatte eigentlich die Absicht, von Berlin aus über Königsberg na h Riga zu fliegen; aber er gab dann diesen Plan auf. Mit diesem Fluge hat Letort einen neuen Welt-Distanzrekord ohne Zwischenlandung, der bisher Gilbert mit seinem Fluge Paris—Vi ttoria, 825 km gehörte, aufgestellt. Dieser letztere bleibt übrigens Inhaber des Weltrekords für die größte Flugdauer in gerader Linie, mit 8 Stunden 25 und 9 Stunden 10 auf der Strecke Paris— Bordeaux -Poitiers. Es ist kurios, wie die Strecke zwischen der französischen und der deutschen Hauptstadt von jeher ein sehr beliebtes Angriffobjekt der französischen Flieger gewesen ist; noch bemerkenswerter ist, wie oft dieser Flug den Franzosen gelungen ist; Paris—Berlin : 18. -19 August 1912: Audemars 17. April 1913: Daucourt (Zwischenlandungen in Lüttich und Hannover). 10. Juni 1913: Brindejonc des Moulinais (Zwischenlandung in Wanne). 13. Juli 1913: Letort (ohne Zwischenlandung). Berlin—Paris: 12. Juli 1913: Audemars (Zwischenlandungen in Hannover, Bielefeld, Wanne und Reims.) Wie verlautet, will auch Seguin auf einem Henri Farman, 80 PS Gnom, um den Pommery-Pokal starten, und zwar hat er die Absicht, von Biarritz aus nach Schweden zu fliegen. Auch Janoir auf einem Deperdussin-Eindecker will sich um die Pommery-Lorbeeren bemühen. Von Vedrines ist es schon lange still gewesen, seit er von seinem Konstrukteurfreunde an die Luft gesetzt worden ist. Jetzt tritt er wieder auf den Plan, und zwar in seiner Weise, mit der bekannten Ringer-Geste: Nun laßt mich mal ran! Er hat noch einmal sorgfältig die reglementarischen Bestimmungen zum Pommery-Pokal studiert und herausgefunden, daß da an irgend einer versteckten Stelle der Passus steht, daß derjenige Flieger sofort als definitiver Sieger proklamiert werden soll, der eine Strecke von 1000 km im Zeitraum von 5 Stunden, das ist also mit einer Geschwindigkeit von 200 km die Stunde, durchflogen haben wird. Daraufhin hat Vedrines seinen Morane-Eindecker mit einem 200 PS Gnom versehen lassen, mit dem er die 200 km Geschwindigkeit zu realisieren hofft. Na und was der „große Jules" vor hat, das setzt er auch durch, .... wenn es ihm nicht mißlingt. Jedenfalls wird sich nun, da die von Brindejonc vorgelegten Distanzen nur schwer zu schlagen sein werden, ein Geschwindigkeits-Dnoll abspielen und die Endsituation des Pommery-kampfes wird dadurch völlig verändert. Einige andere Flugvorgänge werden gegenwärtig hier viel besprochen: Vidart hat auf einem Morane-Eindecker die Strecke Amberieu, Lalleyriat, Leeret, Beauregard, Grand, Saint-Denis, Gcx bis Divonne-les-Bains zurückgelegt, wobei er mehrere Berge und gefährliche Stellen übersetzt hat. Nach mehrfachen Schauflügen in Boulogne-sur-Mer mit einem neuen kleinen Wasserflugzeug sind zwei Apparate dieser Farmantype in gemeinschaftlichem Fluge, mit einer Zwischenlandung in Le Crotoy, nach Paris zurückgekehrt. Jeder der Ajjparate hatte einen zweiten Flieger an Bord. Aufsehen erregte auch der Flug über die Jungfrau, den der oftgenannte schweizerische Flieger Oskar Bider am letzten Mittwoch vollbracht hat. Bider hat den Flug Bern—Domodossola—Mailand projektiert und flog um 4 Uhr morgens ab ; der Direktor Liechti von der Jungfraubahn, als er von dem Flug vorhaben Biders hörte, begab sich nach dem Jungfraujoch, um den Vorbeiflug photographisch aufzunehmen. Um 6 Uhr 7 passierte Bider in 100 Meter Höhe über der Jungfrauspitze und um 6 Uhr 28 war er im Tal verschwunden. In Domodossola hatte man eine telephonische Station improvisiert, an der Stelle, wo Chavez und Bielovucie gelandet waren. Dort landete Bider um \1 Uhr, aber schon nach vier Minuten flog er wieder ab. Um 8 Uhr 42 landete er in Mailand auf dem Flugfelde von Taliedo, von der Menge enthusiastisch begrüßt. Die bei diesem Fluge zurückgelegte Distanz beträgt in gerader Linie 230 km, doch hat Bider 280 km zurückgelegt. Obgleich Bider seinen Bleriot-Eindecker um 60 kg erleichtert hatte, sodaß er nur ein Gewicht von 490 kg hatte, fiel es ihm sehr schwer, die erforderliche Höhe zu gewinnen. Oberhalb der Jungfrau hatte Bider mit 15° Kälte zu kämpfen. Ein interessantes Experiment unternahm dieser Tage ein Farmanflieger, namens David, indem er in Etampes einige Brieftauben an Bord seines Flugzeugs mitnahm, die er dann in der Höhe mit Nachrichten für die Farman-schule abließ. Das Experiment gelang vortrefflich Großes Interesse zeigt sich jetzt für das Wasserflugzeug-Meeting von Oeauville, das bekanntlich vom französischen Marineministerium organisiert ist und in der Zeit vom 24. bis 31. August unter dem abgeänderten Reglement vor sich geht. Es haben zehn Anmeldungen dazu stattgefunden: 2 Nieuport, 1 Anzani, 1 Breguet, 3 Deperdussin, 1 Borel, 1 Leveque, 1 Bathiat-Sanchez. Zwei italienische Flugleistungen, die soeben bekannt werden und wiederum neue Weltrekords bedeuten, verdienen Erwähnung: Deroy flog am Donnerstag von Mailand nach Brindisi, von Norden nach Süden quer durch Italien, eine Distanz von 915 km, mit seinem Mechaniker an Bord seines S. I.A.-Flugzeugs, 80 PS Gnom, an dessen Bord er außer seinem Mechaniker 360 kg Benzin und 90 kg Oel genommen hatte. Es ist das ein neuer Passagier-Weltrekord und dieser wird durch einen Flug ergänzt, den Cevasco auf einem Gebardini-Flugzeug ausführte und wobei er mit 150 km (Mailand— Turin) einen neuen Rekord mit 3 Passagieren aufstellte. Die Aeronautische Sport-Kommission hat in ihrer letzten Sitzung folgende Homologierungen vorgenommen: Prevost, am 17. Juni in Reims: Flieger allein: Geschwindigkeit: 10 km in 3 : 20—1 40 km in 13 : 23 20 km in 6:40-4 50 km in 16 : 43 - 2 30 km in 10 : 02 100 km in 33 : 30—2 Größte Geschwindigkeit: 179,820 km in der Stunde Zeit: in einer halben Stunde: 86,507 km. Rl. Der Avro-Wasserzweidecker. (Hierzu Tafel XX) Dieser Zweidecker ist das Erzeugnis der englischen Fingzeugfabrik A. V. Roe & Co auf dem Fluggelände von Rhoreham. Das Hauptgewicht wird von 2 Stufenschwimmern getragen, deren Wasserverdrängung dem doppelten Maschinengewicht entspricht. Die Verbindung zwischen Rumpf und Schwimmern wird durch im Dreieckverbande zueinander angeordnete Stahlrohre hergestellt. Der im Motorrumpf vorn eingebaute 100 PS Gnom-Motor ist zweimal gelagert und mit einer Aluminiumblechhaube umgeben. Die Luftschraube von 2,6 m Durchmesser besitzt 1,8 m Steigung. In der Mitte des Rumpfes sind Begleiter- und Führersitz hintereinander angeordnet. Die Tragflächen von 15 m Spannweite und 52 qm Flächeninhalt sind von den Schwimmern ab 2 Grad nach oben gestellt. Von den in drei Teile zerlegbaren Tragdecken bleibt das Mittelstück stets mit dem Motorrumpf und den Schwimmern vereinigt. Das Unterdeck ist ein Meter kürzer als das Oberdeck. Die Schwanztragfläche befindet sich am verjüngten Rumpfende und hat 4,25 qm Flächeninhalt. Hiervon entfallen auf die Dämpfungsfläche 2,85 qm und 1.4 qm auf das Höhensteuer. Die Dämpfungsfläche ist etwas belastet. Ihr Einfallswinkel beträgt 2 Grad. Das Seitensteuer ist 1 qm groß, ragt oben und unten über das Rumpfende hinweg und ist in Richtung seiner Drehachse abgefedert. Der untere Teil desselbon ist in den Schwanzschwimmer eingelassen. Die Steuerung ist die engl. Militärsteuerung Die Anlaufstrecke ist auf dem Wasser sehr kurz. Das Gewicht der Maschine beträgt incl. Betriebsstoff für 4 Stunden, Begleiter und Flugzeugführer 100U kg. Die Geschwindigkeit beträgt bei dieser Belastung 90 km pro Stunde. Die englische Admiralität zeigt lebhaftes Interesse für diesen Typ und hat bereits mehrere Maschinen in Auftrag gegeben. Audemars — Letort. Johannisthal im Juli 1913. Audemars ist den Johannisthaler Fliegern nicht unbekannt. Am 12 August vorigen Jahres begrüßten wir i n a!s den ersten „Paris-Berlm-Flieger" und jetzt hat er auch den Weg in entgegengesetzter Richtung mit seinem schnellen Morane-Saulniei-Eindecker siegreich zurückgelegt. Was wir ahnten ist eingetroffen! Die Absicht Audemars, die er uns bereiis Ende 1912 mitteilte, war zur Wirklichkeit geworden. „Ich werde mich um den Batschari-Preis bewerben", schrieb er damals .... * * * Es war an einem Wochentag, als auf einem Transpo twagen eine große Kiste, auf der in schwarzer Schrift „Morane-Saulnier" stand, durch die Straßen von Johannistal dem Flugplatz zugefahren wurde. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht: Audemars startet um den Batschari-Preis von 10000 Mark, die dem Flieger zufallen, der an einem Tage von Berlin nach Paris fliegt. Ja, darf denn sich ein Ausländer um diesen Preis bewerben? hieß es zuerst. Einige Tage vorher tatte der Deutsche Luftfahrer-Verband auf eine Anfrage hin mitgeteilt, daß die Verhandlungen über die Annahme des Batschari - Preises zur Zeit noch nicht erledigt seien. Also erst noch Verhandlungen und trotzdem steht schon ein Bewerber auf dem Plan — und sogar noch ein Ausländer. Audemars hatte aber seine schriftliche Bestätigung über seinen berechtigten Start von dem Stifter des Preises in der Tasche und traf in aller Ruhe seine Vorbereitungen. Jetzt begann es auch unter den Johannisthaler Fliegern lebhaft zu werden. Man will den kleinen, zähen Ausländer nicht allein auf die Reise gehen lassen und arbeitet mit größter Hast an einigen deutschen Apparaten, um sie rechtzeitig für den Flug fertig zu stellen. Die Tagespresse setzt mit mächtigen Anfeuerungen an die deutschen Flieger, und in erster Linie Flugzeug'abriken ein, die ihre Maschine den Fliegern für diesen Flug zur Verfügung stellen sollen. Auf jeden Fall soll Audemars — wenigstens zu Anfang — einen deutschen Reisebegleiter finden. Die Witterung ist für die Reise noch nicht günstig und Audemars führt einige kleinere Flüge aus, bei denen er uns einen Vorgeschmack von seinen Kunstflügen gibt. Abstürze und Korkzieher-Gleitllüge stehen auf dem Programm. Prächtig! Besonders fällt die großartige Steigfähigkeit des Morane-Saulnier-Eindeckers auf, der Apparat scheint lediglich an dem Propeller zu hängen. Nun, er soll erst einmal Ballast mitnehmen, dann wird der Start und das Steigen auch anders sein, höre ich sagen. Die „Probeflüge" haben sich einige Flieger als Vorbild genommen und schon kurze Zeit später üben sie sich ebenfalls in kühnen Kurven- und Gleitflügen. Hier ist es besonders Ernst Stoeffler, der auf seinem Albatros-Doppeldecker recht gefährlich-aussehende Kurven fliegt und dabei eine außergewöhnliche Beherrschung über seine Maschine zeigt. Ein Chevillard ist er noch nicht und soll es auch nicht werden, aber mit einem schweren Doppeldecker derartige Attraktionen zu vollführen ist jedenfalls recht anerkennenswert, wenn man bedenkt, daß Chevillard einen Apparat mit 80 PS Gnom benutzt, der halb so viel wiegt, als der Albatros-Doppeldecker mit 100 PS Mercedes-Motor. Kurvenflieger haben wir ja auch, also jetzt Training für große Ueberlandfliige. Beide verkörpert Audemars in sich und noch mehrere andere französische Flieger. „Ich muß am Sonntag, den 13. Juli in Paris sein, da ich mich für ein an diesem Tage stattfindendes Flugmeeting verpflichtet habe", erzählte Audemars. Es wurde also höchste Zeit. Am Dienstag, den 8. Juli begleiteten wir Audemars zum Start. Es war \4 Uhr morgens, als der kleine Eindecker aus dem Schuppen gezogen wurde. Das Wetter war schlecht und für den Flug absolut ungünstig. Trotz der großen Belastung durch die mitgeführten Betriebsstoffe startet der Apparat mit fabelhafter Leichtigkeit und ist nach kurzer Zeit, in der er mächtig steigt, den Blicken der Anwesenden entschwunden. Deutsche Konkurrenten waren ausgeblieben. Audemars flog allein! Ob er wohl hinkommen wird? Er hatte Pech. Bei Gütersloh in Westfalen mußte er wegen Benzinmangels eine Notlandung vornehmen, wobei sich der Apparat in dem aufgeweichten Boden überschlug und der Propeller zerbrach. Audemars montiert ab und am nächsten Tag ist der Apparat in — Berlin, um nochmals zu starten. An dem Motor war bei dem Sturz die Propellernabe verbogen worden, die ein Nachrichten erforderte. Wir freuten uns schon und sahen im Geist einen deutschen Flieger auf dem Weg nach Paris — vor Audemars. Wieder setzte die Tagespresse ein und wieder startete am Sonnabend den 12. Juli Audemars allein um den Batschari-Preis. Diesmal hatte er Glück. Seine Absicht war, in Hannover die erste Landung vorzunehmen und sich dort von neuem mit Betriebsstoff zu versorgen. Um 4 Uhr 15 morgens hatten wir uns zum zweiten Male von ihm verabschiedet. Auch diesmal war der Stifter des Preises anwesend. Das Wetter war wiederum schlecht. Er mußte heute nach Paris kommen! Auf der Vahrenwalder Heide bei Hannover landete er um 6 Uhr 45 und um 8 Uhr 15 erfolgte der Weiterflug. Bei Brackwede unternahm Audemars eine Notlandung, flog dann bis nach Wanne, wo er um 11 Uhr 30 eintraf. Auf dem Weg von Hannover bis Bielefeld mußte er lediglich nach dem Kompaß fliegen, da der diente Nebel eine Aussicht unmöglich machte. In Wanne startete er um 2 Uhr und landete um 5 Uhr auf dem Flugplatz in Reims, wo er an seinem Gnom-Motor einen kleinen Schaden reparierte. Um 7 Uhr 3 erfolgte der Start zur ktzten „Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XX. Englischer Avro-Wasserzweidecker. 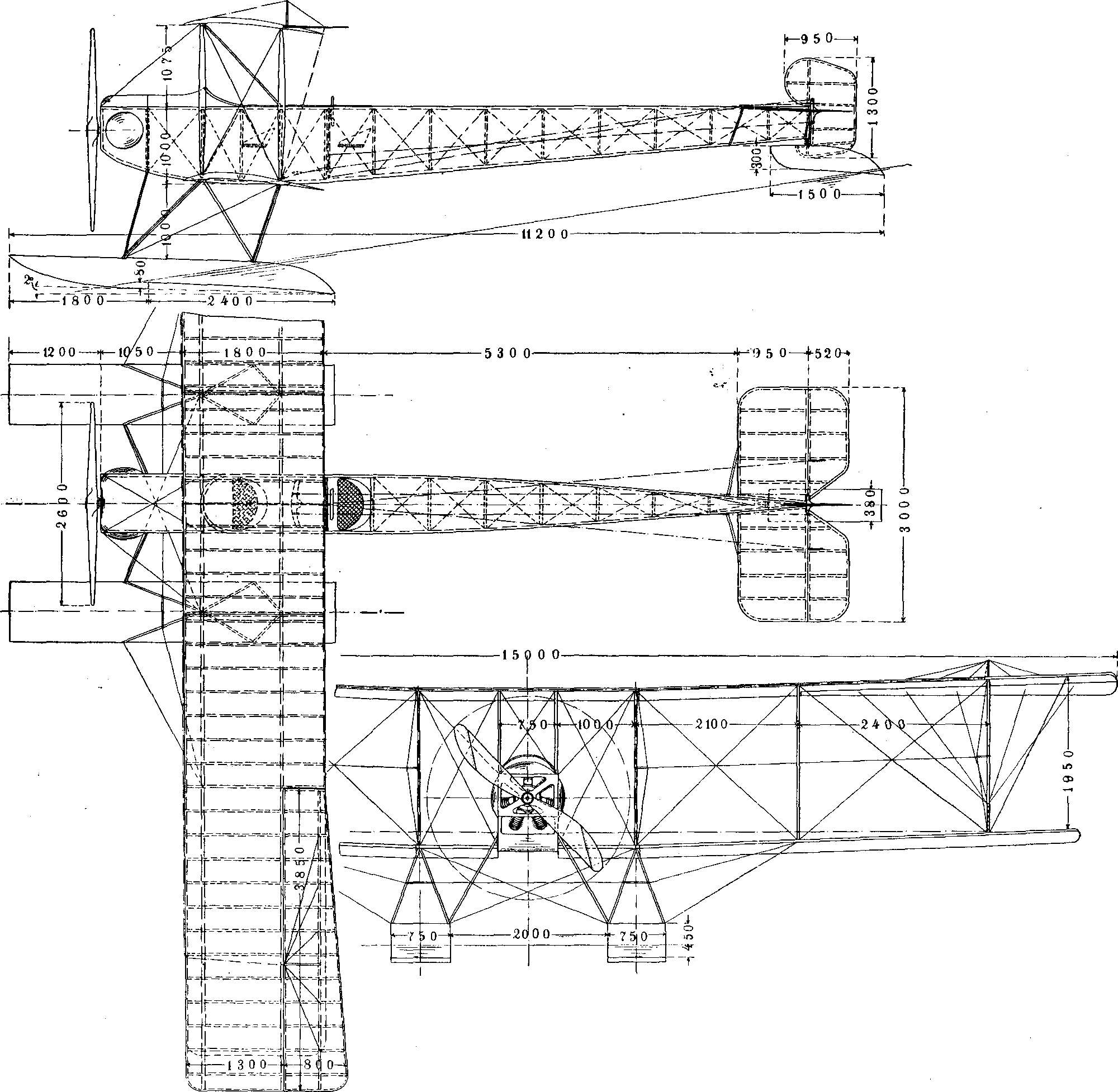 Nachbildung verboten. Etappe und um 7 Uhr 52 landete Audemars in Villacoublay. Der von einem Deutschen gestiftete Preis von 10 000 Mark war von einem.Ausländer gewonnen! Audemars erzählte, daß die Reise von 10 Stunden, infolge des Gegenwindes und Nebels sehr schwierig gewesen sei. Die durchschnittliche Flughöhe war 1500 m, aber manchmal mußte er, um sich in dem von Nebel bedeckten Gelände orientieren zu können, bis auf 30 m heruntergehen. * Sonntag wars. Die Morgenzeitungen hatten in ihren letzten Telegrammen die glückliche Landung von Audemars in Paris gemeldet. Der Batscharipreis gehört der Vergangenheit. Weiter wußte man nichts. Aber man ärgert sich, daß man wieder einmal zu spät gekommen ist. Es ist 3 Uhr nachmittags. Ein Auto fährt an dem Cafe vor und ihm entsteigt ein kleiner Herr, das Gesicht gerötet, die schwarzen Haare nach rückwärts gekämmt, die dunklen Augen unruhig 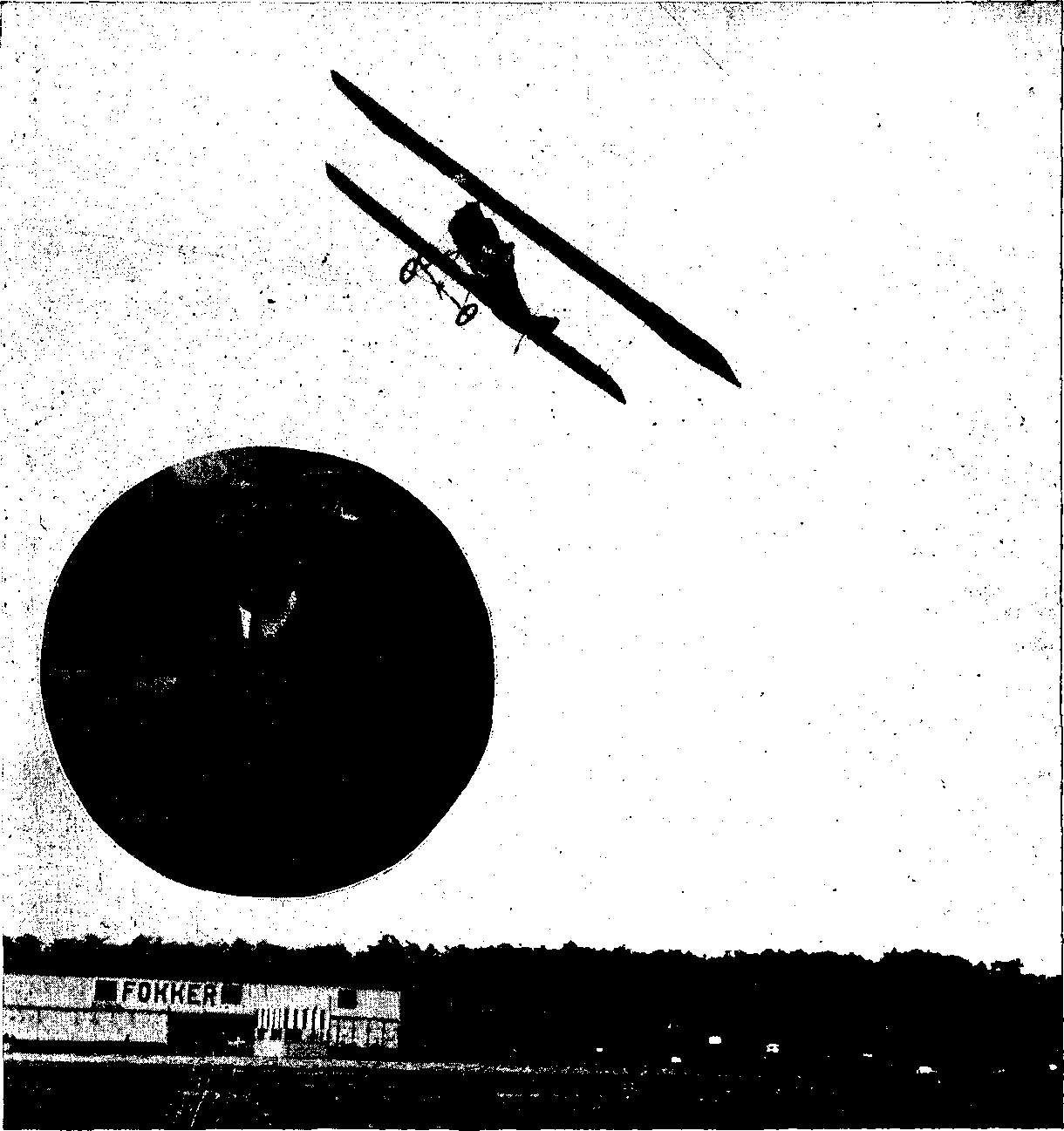 Ernst Stoeffler auf Albatros-Doppeldecker bei einem kühnen Kurienflug. umherschweifend. Der Führer des Wagens erzählt: Dieser Flieger ist soeben in der Nähe des Flugplatzes gelandet, der Apparat ist bei der Landung in dem weichen Ackerboden gekippt und dabei ist ein Spannkabel gerissen. Er ist ein Franzose, kommt aus Paris und gab mir zu verstehen, — deutsch kann er nicht — daß der Schaden an dem Apparat sofort behoben werden soll, er will weiterfliegen. Wir wollen den Apparat sofort holen und ihn reparieren. Ich gehe auf den Franzosen zu, stelle mich ihm vor, er gibt mir seine Karte: Leon Letort. — Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Flug! — Danke sehr, ich bin um den Pommery-Pokal gestartet und ohne Zwischenlandung bis hierher durchgeflogen. Allgemeines Erstaunen, ja es gibt noch Ueberraschungen. Paris-Beilin in der Flugmaschine, ohne unterwegs den Boden zu berühren, klingt im ersten Moment für unmöglich. — Sind Sie denn nicht müde von der anstrengenden Fahrt, frage ich ihn. — Gar nicht, ich will schnell etwas essen und dann, wenn mein Apparat wieder repariert ist, nach Riga weiterfliegen, denn Sie wissen, ich muß die Leistung von Brindejonc des Moulinais überbieten, um Anrecht auf den Pommery-Preis zu haben. — Welchen Apparat haben Sie? — Einen Morane-Saulnier-Eindecker, fast der gleiche Typ wie der von Audemars, nur habe ich zwei Quadratmeter mehr Fläche. — Auch mit 80 PS Gnom-Motor, füge ich hinzu. — Nein, mit 80 PS „Le RhÖne"-Motor, sagt Letort. — Für den neuen Motor eine glänzende Leistung. Letort öffnet eine Handtasche und überreicht jedem eine Nummer der französischen Zeitung „Le Mann". — Ich habe diese 100 Exemplare heute morgen in Paris eingepackt. Sie finden in dieser Nummer die Einzelheiten Uber den gestrigen Flug von Audemars. Ja wirklich! Oben rechts ist ein Stempel aufgedrückt: L' aviateur Letort sur monoplane Morane-Saulnier Moteur le Rhone vous apporte Le Matin du jour. Die Nummer ist vom 13. Juli. Unten links finden wir das Bild von Audemars und die näheren Daten über seinen Flug um den Batschari-Preis. Ja, die großen französischen Zeitungen arbeiten riesig schnell. Um 2 Uhr mittag in Berlin schon den Matin vom gleichen Tage lesen zu können, kommt nicht jeden Tag vor..... Wir fuhren nun zur Landungsstelle, der Apparat war bereits von dem kleinen Hügel zur Straße geschoben worden und erledigten die Demontage in weniger als 20 Minuten. Der von der Luft-Verkehrs-Gesellschaft verwandte Spezial-Transportwagen für Flugzeuge leistete hier glänzende Dienste. Nach Verlauf von einer halben Stunde war der Apparat in dem schützenden Hangar untergebracht. Letort hatte sich mittlerweile entschlossen, auf eine Fortsetzung des Fluges zu verzichten, da er doch so viel Zeit verlor, daß er keine große Aussichten mehr hatte, die Leistung von Brindejonc des Moulinais zu überbieten. — Warum sind Sie denn außerhalb des Platzes gelandet? — Ich begann aus 2000 Meter einen Gleitflug und als ich wieder Contact gab, sprang der Motor nicht mehr an und auf den Platz konnte ich wegen der geringen Höhe nicht mehr gelangen. Ueber seinen Flug erzählt Letort folgendes: — Ich bin heute früh um 4 Uhr 23 Min. in Villacoublay gestartet und um 1 Uhr 10 (französische Zeit) ohne Zwischenlandung hier gelandet. Also 8 Stunden 47 Minuten! An Bord meines Morane-Saulnier Eindeckers hatte ich 235 Liter Benzin und 49 Liter Oel. Bei meiner Landung waren noch 80 Liter Benzin im Behälter. Der „Le RhÖne"-Motor arbeitet äußerst ökonomisch. Bedenken Sie, der 80 PS Gnom benötigt 35 Liter in der Stunde. Allerdings war mir auch der Rückenwind von Vorteil, da ich den Motor ziemlich drosseln konnte und dadurch einen geringeren Benzinverbrauch als unter normalen Verhältnissen erzielte. Ueber Paris flog ich in 100 Meter, stieg dann auf 1000 m und traf auf meiner Fahrt durch Frankreich ständig Nebel. In Givet sah ich überhaupt nichts mehr und mußte bis auf 50 Meter heruntergehen, wo ich dann die Maas als Richtschnur nahm. Von Lüttich ab flog ich dauernd im Nebel, ohne mich auch im geringsten nach der Erde orientieren zu können. Es war nichts zu sehen. Von Lütt ich bis Hannover flog ich nur nach dem Kompaß. Während ich bis dahin Rückenwind hatte, bekam ich von Hannover ab starken Gegenwind und stieg bis 3200 Meter, wo ich ruhigere Luft antraf In dieser Höhe kam ich Uber Potsdam an, stieg auf 2000 Meter herunter und habe nun das Pech, daß mich im allerletzten Moment der Vergaser im Stich läßt...... Die Leistung von Letort ist wohl die größte, die in den letzten Tagen vollbracht worden ist. Man bedenke nur die schwierige Fahrt im Nebel und das fahrplanmäßige Eintreffen in Berlin. Letort gedenkt auf dem Luftwege Paris wieder zu erreichen und sich von neuem, aber jetzt mit Passagier, um den Pommery-Pokal zu bewerben.  Audemars auf Morane-Saulmer. ■2L V V/ v  Letort im Kreise der Johannisthaler Flieger. Unten rechts: Der Eindeaier von Morane-Saulmer im Fluge. Während ich diese Zeilen niederschreibe, erwarten zwei schon vorausgeschickte französische Mechaniker ihre Flieger aus Paris, dieebenfalls um den Pommery-Pokal starten wollen und Johannisthal als erste Zwischenlandung vorgemerkt haben...... Fr. Wm. seekatz. Das russische Riesen-Flugzeug Sikorsky. Gelegentlich des Fernfluges Sankt Petersburg—Moskau und zurück, bei dem es sich um die Durchbiegung einer Strecke von 1300 Werst (1367 km) innerhalb zwei Tagen handelte, machte zum ersten Male ein neuer Apparat von riesigen Abmessungen, der von dem Russen Sikorsky konstruiert worden ist, von sich reden, und wenn das Flugzeug auch in dem inredestehenden Fernflug sich nicht zur Geltung zu bringen vermochte, so erweckte es dennoch ein allgemeineres Interesse schon deshalb, weil es trotz seiner Riesendimensionen und großen Schwere bei den ersten Probeflügen über Erwarten gut abgeschnitten hatte. Freilich wurden die ersten Meldungen hiervon in Flieger- und industriellen Kreisen ziemlich skeptisch aufgenommen und man neigte allgemein der Ansicht zu daß das monströse Flugzeug seine praktische Verwendbarkeit erst noch zu erweisen haben wird. Inzwischen aber haben weitere Leistungen des Sikorsky-Flugzeugs gezeigt, daß es sich nicht um eine phantastische und nutzlose Konstruktion handelt und namentlich hat sich ein bekannter russischer Fachmann jetzt in einer Weise über den gigantischen Apparat geäußert, daß es angezeigt erscheint, diesen in seinen großen Umrissen etwas näher zu betrachten. Die eigenartige Gestaltung des Riesen-Apparats hat ihm die Bezeichnung als „Doppel-Eindecker" eingetragen. Die Spannweite seiner Haupttragfläche beträgt 30 Meter, sein Gesamtgewicht nicht weniger als 4000 Kilogramm! Das Flugzeug ist mit vier Argus-Motoren von je 100 PS ausgestattet, die entweder gemeinschaftlich zu gleicher Zeit oder auch einzeln für den Antrieb benutzt werden können. Der Auftrieb kann vermittelst zweier in Gang gesetzter Motore bewirkt werden. Das Flugzeug ist im Stande, 15 Personen an Bord zu nehmen und mit ihnen, wenn sämtliche vier Motoren im Betrieb sind, eine Geschwindigkeit von 130 km die Stunde zu realisieren. Am Vorderteil des Apparats ist eine Plattform für den Beobachter und ein Raum zur Unterbringung von Geschützen vorgesehen. Hinten befindet sich die Kabine für zwei Flieger und einen Mechaniker. Weiter hinten sind dann die Kabinen für die Passagiere untergebracht. Auch eine Küche, Vorratsräume u. s. w. befinden sich an Bord des Flugzeugs. Am 9. Juni vollbrachte das Flugzeug bei ziemlich heftigem Winde, mit dem Erfinder Sikorsky, dem russischen Flieger Jankowsky und vier Mechanikern an Bord, einen interessanten Probeflug. Nachdem es sich auf 300 Meter erhoben hatte, ließ Sikorsky einen der vier Motoren anhalten, was die Regelmässigkeit der Fortbewegung des Apparats nicht beeinflußte. Dieser führte mehrere Kurven aus, wobei die Insassen des Flugzeugs von dem Vorderteil nach dem Hinterteil des Apparats hinübergingen, ohne daß das Gleichgewicht der Maschine gestört worden1 wäre. Dieser Tage hat das Riesenflugzeug einen zweiten interessanten Flug über der russischen Hauptstadt ausgeführt, der bei den gewaltigen Abmessungen des Apparats (seine Flügel sind beispielsweise dreimal breiter als die des Farman-Zweideckers) natürlich großes Aufsehen erregte. Während des Fluges von 29 Minuten Dauer legte Sikorsky 55 km zurück, was freilich einer Stundengeschwindigkeit von 110 km entsprechen würde. Es wird nun von besonderem Interesse sein, zu vernehmen, was der bekannte russische Professor Langowoij, vom technologischen Institut zu Sankt Petersburg, welcher an diesem Fluge teilgenommen hat, jetzt darüber in der Press, äußert, umsomehr, als es sich hierbei um die Ansicht eines Fachmanns handelt, welche dem neuen System eine große Ueberlegenheit über die Lenkballonkonstruktionen zuspricht. Professor Langowoij erklärt sich zunächst entzückt von den Eindrücken auf dieser Luftreise. Er habe überhaupt nicht einmal bemerkt, daß die Maschine sich vom Erdboden frei gemacht und in die Luft erhoben hatte. Das gleiche konstatierte er bei der Landung, die sich sehr glatt vollzog. Langowoij ist der Ansicht, daß die Erfindung Sikorskys für die zukünftige Kriegsführung eine ganz beträchtliche Bedeutung haben werde. Apparate dieses oder eines ähnlichen Systems werden eine der mörderischsten Waffen gegen feindliche Armeen und gegen feindliche Flotten sein. Die großen Schlachtschiffe von 28.030 Tons, wie sie neuerdings allenthalten konstruiert werden, kosten jedes 30 Millionen Rubel, so meint Professor Langowoij; wenn man gegen eines dieser Seemonstren zum Beispiel zwanzig Flugzeuge von der Art der Sikorsky'schen, deren jedes 1600 Kilogramm Explosivstoffe mit an Bord führt, ausschicken würde, dann kann man sich die grausigen Verwüstungen ausmalen, die sie anrichten würden. Zu Lande, oberhalb von Festungen und feindlichen Armeen, vermöchte der erwähnte mörderische Ansturm alles fortzufegen. Am allergefährlichsten aber wird die neue Type den modernen großen Lenkluftschiffen sein, die von jener in außerordentlich wirkungsvoller und entscheidender Weise beschossen und vernichtet werden können. Die gegen das Flugzeug gerichteten Geschosse werden diesem bei weitem weniger gefährlich sein, als den Lenkballons, während sie auf die Feuernden zurück fallen würden, und zwar mit einem Drittel ihrer \uftrieb-geschwindigkeit, also mit einer Kraft, die genügt, um zu verwunden und zu töten. Professor Langowoij schließt seine viel beachteten Ausführungen mit den Worten: „Ich glaube, daß die Tage der famosen Zeppelins gezählt sind!" Wenn hierbei auch vielleicht der Wunsch des Herrn Professors ihm den Gedanken eingegeben haben mag, so wird man doch die neue russische Konstruktion mit einem gewissen Interesse zu verfolgen und die weiteren Leistungen der Sikorsky-Type mit Aufmerksamkeit zu betrachten haben, denn sie stellt eine neue Richtung in der Flugzeugkonstruktion dar, die schon vorher wiederholt, aber bisher immer sehr bald wieder aufgegeben worden ist, die aber dieses-mal unleugbare praktische Resultate zu verzeichnen hat, welche ihre Weiterentwicklung und ihren Ausbau zur Folge haben dürften. No. 437. Heldriegel, Friedrich August, Bautechniker, geb. am 3. Januar 1887 zu Hatten (Oldenburg), für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 20. Juni 1913. No. 438. Brand, Arthur, Ingenieur, Johannisthal, geb. am 8. Mai 1882 zu Hamburg, für Eindecker (Etrich), Flugplatz Johannisthal, am 20. Juni 1913. No. 439. Rast, Max, Techniker, Johannisthal, geb. am 28. August 1892 zu Freiberg, für Zweidecker (Wright), Flugplatz Johannisthal, am 24. Juni 1913. No. 440. Hempel, Claus, Oberleutnant i. Inf.-Regt. 170, Offenburg i. Baden, geb. am 16. März 1883 zu Köslin i. Pom., für Eindecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 24. Juni 1913. No. 441. Aigner, Wilhelm, Oberleutnant i. Inf.-Regt. Nr. 121, Ludwigsburg, geb. am 11. Januar 1883 zu Stuttgart, für Eindecker (Etrich-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 28. Juni 1913. No. 442. Christenn, Armin, Oberleutnant i. 2. Bayer. Inf.-Regt. Kronprinz, München, geb. am 29. Juli 1881 zu Türkheim, für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 26. Juni 1913. No. 443. Bohne, Bruno, Monteur, Bork (Mark), geb. am 25. Dezember 1893 zu Beelitz, Kr Zauch-Belzig, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 26. Juni 1913. No. 444. Preußner, Christoph Ludwig, Burg b. Magdeburg, geb. am 10. April 1888 in Hölle i. Bayern, für Eindecker (Schulze), Flugplatz Madel b. Burg, am 27. Juni 1913. No. 445. Haak, Heinrich, Leutnant i. Gren.-Regt. Nr. 5, Danzig, geb. am 13. November 1886 zu Hannover, für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 27. Juni 1913. No. 446. Hüser, Konrad, Oberleutnant i. Feldartl.-Regt. Nr. 82, Rastenburg, Ostpr., geb. am 6. November 1880 zu Hüserstedt, Kr. Gnesen, für Zweidecker (Einzerzeller-Wright), Flugplatz Johannisthal, am 28. Juni 1913. Flugtechnische 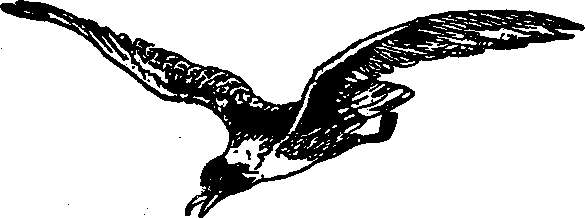 Rundschau. Inland. Flugfilhrer-Zeugnisse Juiben erhalten: No. 447. Oehler. Josef, Bork, Post Brück (Mark), geb. am 6. Marz 1889 zu Nordrach, Kr. Offenburg, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 30. Juni 1913. No. 448. Klein, Hubert Waldemar, Leutnant z. See, Johannisthal, geb. am 11. Januar 1890 zu Düsseldorf, für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 30. Juni 1913. No. 449. Polozek, Johann, Sergeant lnf.-Regt. 136, Straßburg i. Eis., geb. am 18. April 1889 zu Potempa, Kr. Gleiwitz, für Zweidecker (Aviatik), Flugplatz Habsheim, am 30. Juni 1913 No. 450. Matthies, Wilhelm, Johannisthal, geb. am 5. Mai 1890 zu Klein-Todtshorn, Kr. Harburg, für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 1. Juli 1913. _ Von den Flugplätzen. Jubiläums-Flugwoche auf dem Flugplatz GelsenJfirchen-Etmen-Jiotthausen. Bis zum 15. Juli, dem Tage des Nennungsschlusses, waren Uber 30 Anmeldungen für die Jubiläutns-Flugwoche eingegangen; da aber bekanntlich nur 12 Teilnehmer vorgesehen sind, so wurde die Auswahl ziemlich schwer, zumal da sich unter den Nennenden so ziemlich alles befand, was heute in der deutschen Flugtechnik einen Ruf besitzt. Nach sorgsamer Erwägung entschloß sich die Sportleitung, folgende 12 Flugzeugtypen zuzulassen, wobei sie besonders von dem Gesichtspunkt geleitet wurde, möglichst viele verschiedenartige Konstruktionen zu zeigen, vor allem solche, die auf unserm Flugplatze bisher noch unbekannt waren. — Es sind zugelassen: 1. Kondor-Flugzeugwerke, Flieger Beck. 2. Josef Schlatter, 1 Deutschland-Doppeldecker, Flieger Schlatt er. 3. Georg Mürau. 2 Grade-Eindecker,Flieger Mürau. 4. Harlan-Werke, 1 Harlan-Eindecker, Flieger Krieger. 5. Automobil- und Aviatik-A.-G., 1 Aviatik-Eindecker und 1 Aviatik-Pfeildoppeldecker, Flieger Schlegel und S t o e f f 1 e r. 6. E. Rumpier, 1 Rumpier-Eindecker, Flieger Linnekogel. 7. Centrale für Aviatik, 1 Gotha-Taube, Flieger Krumsieck. 8. Sportflieger, 1 Etrich - Eindecker, Flieger Friedrich. 9. Union-Flugzeugwerke, 1 Union-Pfeildoppeldecker, Flieger Sablatnig. 10. Otto. 1 Otto-Doppeldecker, Flieger Weyl. 11. Jeannin, 1 Jeannin-Stahltaube, Flieger Stiplosqheck. Falls eine der Nennungen wegfallen sollte, so tritt an deren Stelle Suwelack, der ursprünglich nur als Ersatzflieger gemeldet hatte. Vom Gcedecker-Flugplatz. Der Flieger Burggraf unternahm am 12. Juli auf einer Gcedecker-Taube 100 PS Mercedes-Motor mit Fluggast einen Dreistundenflug für die National-Flugspende. Der Aufstieg erfolgte morgens 4 Uhr 51 auf dem Truppenübungsplatz Großer Sand, die Landung 7 Uhr 50 auf dem Polygon in Straßburg Die durchschnittliche Flughöhe betrug 1600 m. Abends flog Burggraf weiter nach Freiburg und landete nach 40 Minuten Flugzeit auf dem Freiburger Exerzierplatz- Flugplatz Oberwiesenfeld. Am 18. Juli abends führte der Flieger Weyl einen prächtigen Flug über München aus. Weyl stieg auf einem für die bayrische Militärverwaltung bestimmten Otto-Doppeldecker mit 95 PS Mercedes-Motor mit dem Flugschüler Schachenmayr als Fluggast, der vorgeschriebenen Nutzlast von 200 kg und Betriebsstoff für 4 Stunden in Oberwiesenfeld auf und hatte in der auffallend kurzen Zeit von 20 Minuten eine Höhe von 2500 m erreicht. Nach einstündiger Fahrt über dem Häusermeer Münchens landeten die Flieger in tadellosem Gleitfluge aus 2000 m wieder glatt auf dem Flugplatz, womit die gestellten Abnahmebedingungen in bester Weise erfüllt wurden. (Militärische Flüge. Von Alienburg nach Johannisthal flog Lt. Loelhössel v. Löwensprung mit Lt. Uhlig als Beobachter am 7. Juli vormittags 4 Uhr auf Rumpier-Taube. Die Gesamtflugzeit betrug 110 Minuten. Ein Ueberlandflug Döberitz—Dresden wurde am 10. Juli vormittags 6 Uhr von Oberlt. Steffen, Lt. Frhr. v. Thüna und Lt. v. Buttlar ausgeführt. Die Flieger flogen auf von der National-Flugspende gestifteten Flugzeugen „Oberlausitz", „Blasewitz" und „Erzgebirge". Ferner flog um 8:30 Uhr Hauptmann v. Oertzen auf Flugzeug ..Dresden II" gleichfalls von Döberitz nach Dresden. Ein Fernflug vom Lockstedter Lager nach Westerland-Sylt führten am 10. Juli Lt. v. Haddessen und Lt. Eng wer aus. Die Flieger stiegen um 5:15 vom Lockstedter Truppenübungsplatz auf und kamen über der Nordsee in dichten Nebel. Lt. Engwer landete daher auf dem Flugplatz Fuhlsbüttel. Lt. v. Hiddessen ließ sich indessen durch den Nebel nicht abschrecken und lan.'ete nach einem zweistündigen Umherirren in der Nähe von Westerland. Von Schleißheim nachdem Truppenübungsplatz Grafenwöhr flog am 17. Juli auf einem Otto-Doppeldecker Lt. .Friiz Moosmair von der Schleißheimer-Militär-Fliegerstation. Der Abflug in Schleißheim erfolgte um 5 : 30 vormittags, ' die Landung in Grafenwöhr um 7t 40 Uhr. Es ist dies bereits das zweitemal innerhalb 3 Wochen, daß Lt. Moosmair die fast 200 km lange Strecke trotz des Gegenwindes in 2 St. 10 Min. zurücklegte. Fliegendes Boot von Ahlert. Von den Gebrüdern Ahlert ist vor kurzem ein fliegendes Boot, ein Zweidecker wie in den beistehenden Abbildungen dargestellt, auf dem Zwischenahner See bei Bremen versucht worden Dieser Wasseizweidecker besitzt bei 10,5 m Spannweite 32 qm Tragfläche. Der gleit-bootförmige in fünf wasserdichte Schotten eingeteilte Schwimmer hat eine Länge 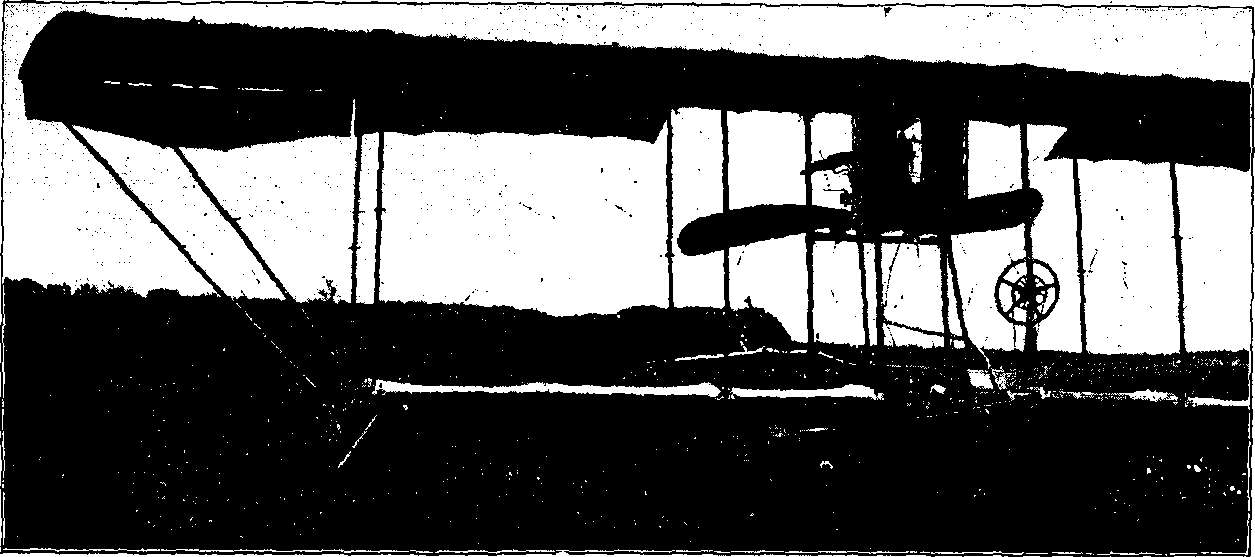 Wasserdoppeldecker von Ahlert. Vorderansidit. von 7 m und eine Tragfähigkeit von 1800 kg. Das Gerippe des Gleitbootes besteht aus einem Holzgerüst mit Drahtverspannung, das mit '/« mm dickem verzinnten Eisenblech überzogen ist. Unterhalb des Gleitbootes beträgt die Blechstärke 1 mm. Die Befestigung des Bleches ist mit Kupfernieten bewirkt, während die Nähte von außen verlötet sind. Ungefähr in der Mitte besitzt der Schwimmrr eine Stufe von 10 cm Höhe. Die Gesamtlänge der Maschine beträgt 9 m und das Gesamtgewicht 480 kg. Zum Betriebe dient ein 55 PS Argus-Motor, der sich bereits als zu schwach erwiesen hat. Einzelheiten der Maschine gehen aus den beistehenden Abbildungen hervor. 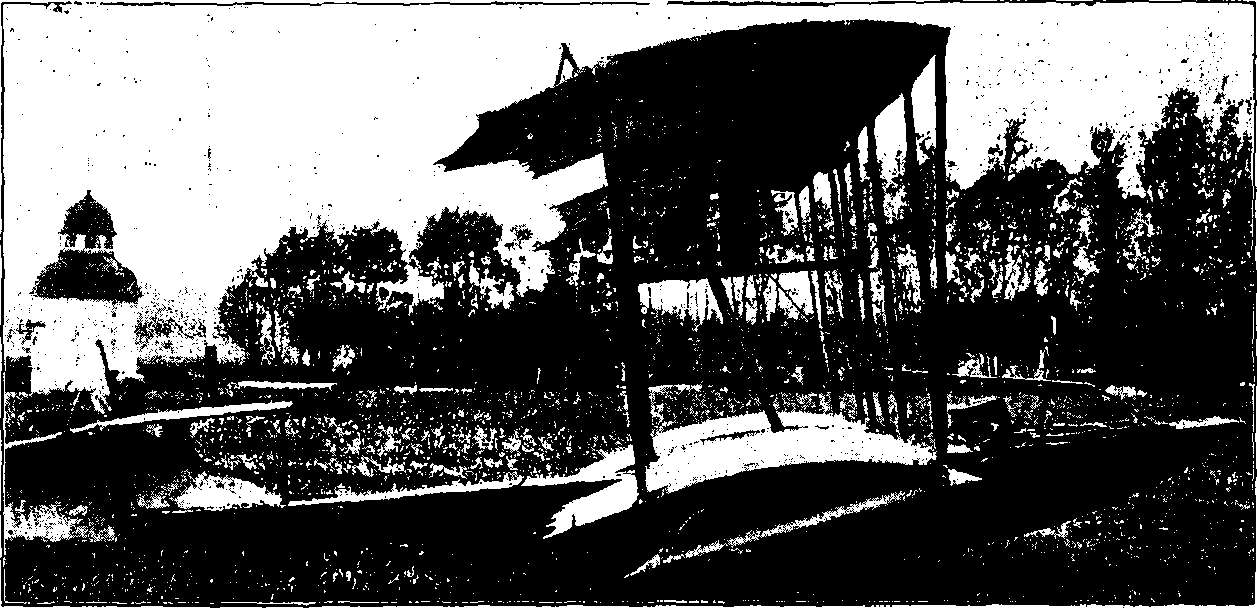 Wasserdoppelde&er von Ahlert, Seitenansicht. Einen neuen deutschen Dauerflug-Rekord hat am 8. Juli der Lehrflieger der Deutschen Flugzeugwerke in Lindenthal, H. Oelerich, bei einem Flug um die Zuverlässigkeitsprämie der National-Flugspende, in dem er 6 Std. 8 Min. auf einem D. F. W.-Doppeldecker in der Luft blieb, aufgestellt. Oelerich hat hiermit die 2000 Mark betragende Monatsrente der National-Flugspende an sich gebracht. Die Feldpilotenprüfung erfüllten am 7. Juli Paul Weidner auf Fokker-Argus-Eindecker auf dem Flugplatz Görries-Schwerin und am 14. Juli Hermann Ma.yweg. auf Harlan-Eindecker in Johannisthal. Der vor kurzem nach Döberitz geflogene Union-Pfeil-Doppeldecker System Bomhardt mit 6-Zyl. 100 PS Argus-Motor erfüllte unter Führung von Sablatnig am 8. Juli die Militär-Abnahmebedingungen beim ersten Versuch. Otto Töpfer flog am 9. Juli auf dem Grade-Flugplatz in Bork 2 Std. 7 Min. um die Prämie der Nationalflugspende. Der französische Flieger Albert Senard mit Leo Lendner als Fluggast stürzte am 8. Juli abends 7:45 in Würzburg tödlich ab. Die verwendete Maschine war ein Eindecker von 9 m Spannweite mit 80 PS 6-Zyl. Anzani-Motor und sehr leicht gebaut. Die leichte Bauart der französischen Schule scheint hier verhängnisvoll geworden zu sein. Die Maschine stieg beim ersten Probeflug mit Fluggast rapid auf 50 m Höhe und später schnell auf 500 m. Beim sehr stark angesetzten Gleitflug brach ein Flügelholm-und die Flügel klappten in bekannter Weise nach oben. Die Verspannung war bei der Prüfung noch intakt. Die Flügelholme scheinen zu schwach konstruiert gewesen zu sein. Der Flieger Diedrichs ist am 14. Juli nach einem Stundenflug um die Nationalflugspende in Habsheim aus ca. 20 m Höhe tödlich abgestürzt. Diedrichs, der am 17. Januar 1894 geboren war, zählte zu den jüngsten Fliegern. Sein Wagemut bei oft äußerst böiger Witterung, seine tollkühnen steilen Gleitflüge mit vollständig abgestelltem Motor aus großen Höhen erregten die Bewunderung und Hochachtung seiner sämtlichen Kollegen. Lt Siegfried Stoll, bekannt durch seinen Flug mit dem Herrenreiter Lt. v. Egan-Krieger, ist in Jüterbog tödlich verunglückt. Lt. Stoll, der erst 27 Jahre alt war, gehörte dem 4. Bayr. Inf. Regt. Prinz Wilhelm Nr. 5 an. Sergeant Westfäli aus Hannover wurde auf dem Frankfurter Flugplatz anläßlich einer Rollübung auf dem Boden durch eine falsche Betätigung des Höhensteuers aus dem Apparat geschleudert und tödlich verletzt. Wettbewerbe. Ostpreussischer Rundflug (9.—14. August 1913). Folgende Offiziere werden auf Flugzeugen der Heeresverwaltung an dem Rundflug teilnehmen: Oberleutnant Keller, Oberleutnant v. Hantelmann, Leutnant v. Eckenbrecher, Leutnant Geyer, Leutnant von Pretzell und Leutnant Mahncke. Aeroplanturnier Gotha. Das in diesem Jahre vom Luftfahrerverein Gotha und dem Kaiserlichen Aero-Klub veranstaltete unter dem Protektorat Sr. Kgl. Hoheit Herzog Karl Eduard von Sachsen-Coburg-Gotha stehende Aeroplan-Turnier Gotha findet in der Zeit vom 16.—18. August statt. Es sind Schnellig-keits-, Höhen-, Bombenwurf-und fotografische Wettbewerbe vorgesehen Zugelassen sind nur in Deutschland hergestellte Flugzeuge mit deutschen oder österreichischen Motoren. Jede Fabrik kann nur einen Flieger melden, jedoch kann sich jeder Flieger mit drei F.'ugzeugen beteiligen. Es werden indessen nur 6 Flieger fest engagiert. An Preisen stehen zur Verfügung Mk. 30000 Geldpreise und Ehrenpreise für die Offiziere im Werte von Mk. 2000. Die Flugveranstaltung wird in den beteiligten Kreisen großes Aufsehen erregen, da zum erstenmale für die- Bombenwurf-, Schnelligkeits- und Höhenwettbewerbe ein Totalisator in Betrieb genommen wird. Sollte sich die von dem rührigen Vorsitzenden des Luftfahrer-Vereins Gotha, Kommerzienrat Kandt, geschaffene Organisation des Totalisator bewähren, so würden sich hiermit der Fliegerei ganz neue Perspektiven eröffnen. Die Ausschreibungen sind vom Luftfahrer-Verein Gotha E. V. zu erhalten. Der Wasserflugmaschinen Wettbewerb in Genf findet in der Zeit vom 9. bis 10. August statt. An Preisen stehen 15000 Frs. zur Verfügung. Anmeldungen sind zu richten an das Komite des Meetings d'Hydroaeroplanes, Genf, 3 Place des Bergues. Die Kieler Flugwoche nahm programmäßigen Verlauf Lt. Canter machte mit Seiner Kgl. Hoheit Prinz Heinrich von Preußen einen einstündigen Flug über dem Kieler Hafen und Umgebung. Erwähnenswert ist der Flug von Referendar Caspar um den Dauerwettbewerb. Caspar war um 7 Uhr abends gestartet und hatte sich auf See verirrt. Der Flieger gab Prinz Heinrich, von welchem er zu dem Flug beglückwünscht wurde, folgende Schilderung: „Ich suchte auf möglichst große Höhen zu kommen. Dabei kam ich auf die offene See, verlor hier die Orientierung und kam bis an die dänischen und schwedischen Küsten. Um wieder Land zu erreichen, kehrte ich um, bemerkte aber zu meinem Schrecken, daß mein Benzin zu Ende ging. Ich mußte daher einen Landungsplatz suchen. Vor Fehmarn bemerkte ich, daß mein Benzinvorrat vollständig erschöpft war. Ich ging daher im Gleitfluge nieder und landete in einem Kornfeld. Landleute beschafften mir Benzin und einen Seemann, der die Feuer an der Küste kennt. Er erbot sich, mir den Weg nach Kiel zu zeigen. Ich nahm ihn als Passagier mit. Nach meinen Beobachtungen habe ich eine Höhe von 3500 Metern erreicht und damit einen neuen deutschen Passagierhöhenrekord geschaffen." Bei dem Wurfwettbewerb zeigte es sich, daß es nicht sehr leicht ist, ein derartig kleines Ziel, wie das verwendete ausrangierte Schiff, das noch kleiner ist wie ein modernes Kriegsschiff, zu treffen. Die besten Resultate erzielte der Aviatik-Flieger Ingenieur Schlegel, welcher die größte Anzahl Bomben in die Nähe des Zieles brachte.  Flieger Heinrich Dietrichs f Patentwesen. Gebrauchsmuster. 77h. 550 653 Drehbares Fahrgestell für Flugzeuge. Christian Joehns, Neumünster. 5. 4. 13. J. 13 869. 77h. 550 773. Lauf- und Landungsgestell für Flugzeuge. Gustav Otto, Flugmaschinenwerke, München. 14. 3. 13. O. 7780. 77h. 550.839. Eckverbindung für Flugzeuggestelle. Etrich-Fliegerwerke, G. m. b. H.; Liebau i. Schi. 17. 2. 13 E. 18 617. 77c. 551 204. Hydroplanfläche für Wasserflugzeuge. A. H. G. Fokker, Johannisthal. 10. 4. 13. F. 29 002. 77h. 551 206. Wasserflugzeug mit Wasserpropeller. F C. Müller Johannisthal. 10. 4 13. M. 45 990. 77h. 551 207. Wasserflugzeug mit Hydroplanfläche zur Unterstützung des Flugzeugschwanzes. F. C. Müller, Johannisthal. 10. 4. 13. M. 45 991 77h. 551 241. Einrichtung zur Aufnahme von Brennstoff, Oel u. dgl. bei Flugmaschinen. Karl Alexander Baumann, Obertürkheim b. Stuttgart, und Emil Freytag Zwickau i. Sa., Schloßgrabenweg 2. 18. 11. 12. B. 60 892. 77h. 5ol 68S. Flächengerüst für Flaugen, das durch Verspannung zusammengehalten wird. August Euler, Frankfurt a M., Forsthausstr. 105a. 7. 4. 13. E. 18 887. Steuerung für Flugzeuge mit verwindbaren Tragflächen.*) Die Erfindung betrifft eine Steuerung für Flugzeuge mit verwindbaren Tragflächen. Bei solchen Flugzeugen ist es bekannt, die Steuervorrichtung derart auszubilden, daß gleichzeitig mit der Verwindung der Tragflächen zur Aufrechterhaltung des seitlichen Gleichgewichtes das senkrechte Seitensteuer verstellt wird. Bei Flugzeugen dieser Art ist es wiederum bekannt, Seitersteuer und Tragflächen gleichzeitig durch ein Steuerseil zu verstellen und das Steuerseil für das Höhensteuer durch die andere Hand des Fahrers zu bedienen oder auch durch einen Steuerhebel das Seitensteuer und durch einen zweiten Steuerhebel, der eine Bewegung nach vorn und rückwärts sowie eine solche nach der Seite hat, gleichzeitig die Tragflächenverwindung und das Höhensteuer zu bedienen. Ferner ist es bei einer Steuerung für andere Zwecke bekannt, die Steuerhebel zweier gleichachsig liegender Steuerwellen im Bereiche der einen Hand nebeneinander zu legen und mit einem Mitnehmer zu versehen, so daß der Steuernde beide Hebel ohne seiiliche Bewegung zusammen in einer Richtung verstellen oder auch gegenseitig verstellen kann. Demgegenüber ist die Steuerung für Flugzeuge mit verwindbaren Tragflächen gemäß der vorliegenden Erfindung dadurch gekennzeichnet, daß die im Bereich einer Hand liegenden Handgriffe für die Verstellung der Tragflächen und des Seitensteuers mit gebremsten Seiltrommeln für die Steuerseile ver- 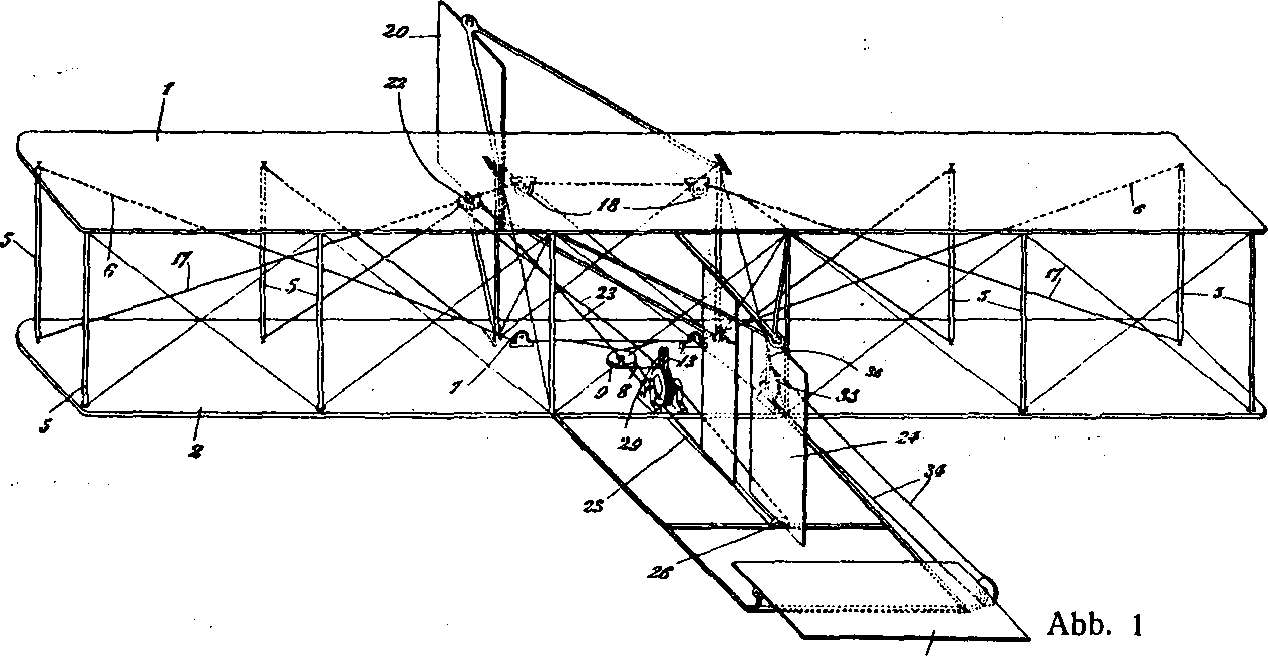 bunden sind. Durch diese Ausbildung wird erreicht, daß die beiden Steuerhebel sowohl in der gewünschten Abhängigkeit zusammen in einer Richtung als auch gegeneinander bewegt werden können, ohne daß im letzteren Falle durch den Winddruck die vorher eingestellte Lage des einen Steuerorgans gegenüber dem anderen geändert werden kann, wie dies beim Fehlen der einstellbaren Reibungsbremsen an der Steuerwelle vorkommen würde. Die beistehenden Abbildungen zeigen ein Ausführungsbeispiel eines Gleitfliegers mit der Steuervorrichtung gemäß der Erfindung. Abb. 1 ist eine perspektivische Ansicht desselben, Abb. 2 ein wagerechter Schnitt, Abb 3 ein senkrechter Schnitt nach der Linie x-x der Abb. 2, in der Pfeilrichtung gesehen, während Abb. 4 eine Einzeldarstellung der Steuervorrichtung ist. Bei dem dargestellten Beispiel besteht die Tragzelle aus den Tragflächen 1 und 2, die miteinander durch Stiele 5 verbunden sind Die Verwindung er-f Igt durch ein Spannseil 6, das mit seinen Enden nahe an den hinteren Ecken rechts und links der oberen Tragfläche befestigt und Uber geeignete Führungsrollen 7 an der unteren Tragfläche geführt ist. Zum Verziehen des Seiles 6 dient ein Steuerseil 8, das mittels einer geeigneten Schränkrolle 9 um eine Trommel 10 gewunden ist, die auf einer in Stützlagern der unteren *) D. R. P. 258 732. Orville Wright in Dayton, Ohio, V. St. A. Tragfläche gelagerten Welle 11 angeordnet ist. Die Trommel 10 ist mit einem Handgriff 13 versehen und kann an der Welle 11 mittels einer Bremse festgehalten werden, die nach dem dargestellten Beisp el vorteilhaft aus einem durchschnittenen Ring 14 besteht, der mit einer Stellschraube 15 versehen ist, um die Reibung zwischen dem Ring 14 und der Welle zu regeln. Ein zweites Spannseil 17 ist zur Uebertragurig des Verwindungszuges mit seinen Enden an der unteren Tragfläche an deren hinteren Ecken befestigt und läuft über Führungsrollen 18 der oberen Tragfläche. Zur Aufhebung des unerwünschten Drehmomentes um die rechte Achse bei der Tragflächenverwindung ist am 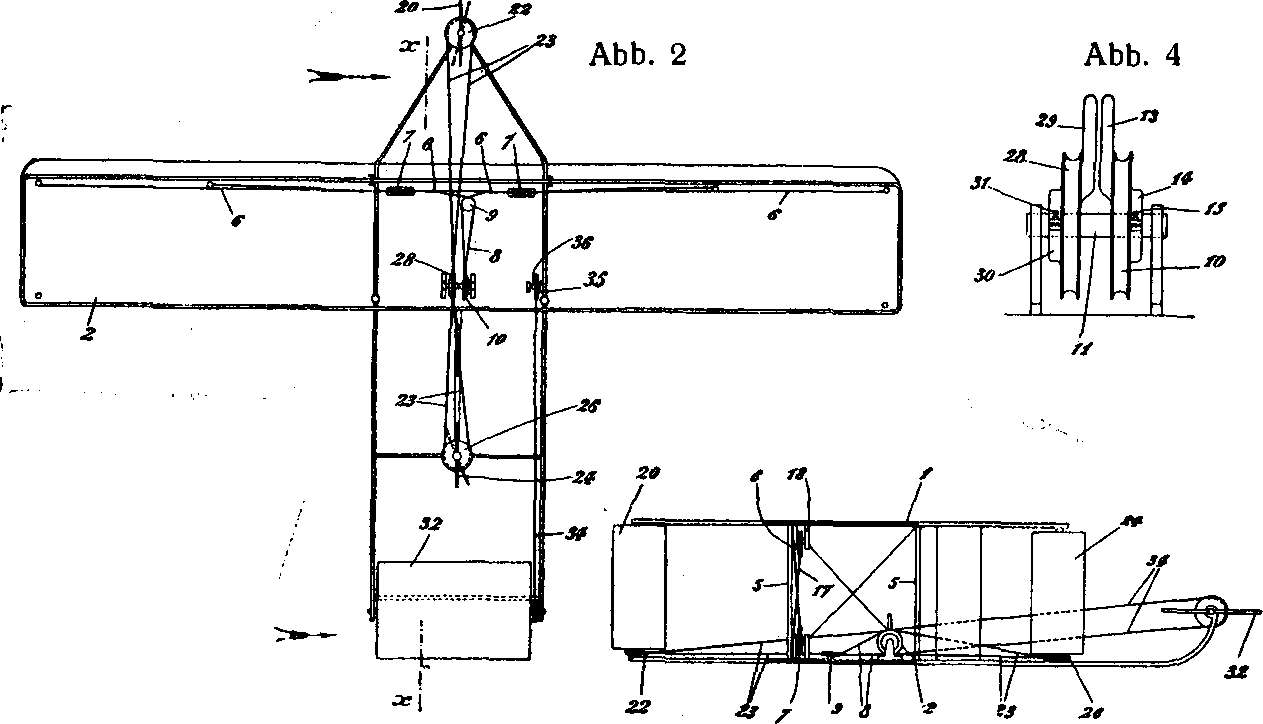 Abb. 3 hinteren Teile des Gleitfliegers das bekannte senkrechte Steuer 20 angeordnet, um dessen untere Scheibe 22 ein Steuerseil 23 läuft. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist außerdem noch ein zweites senkrechtes Vordersteuer 24 angeordnet, um dessen untere Scheibe 26 das Steuerseil 23 läuft. Das Seil 23 ist gekreuzt, um beide Steuer in entgegengesetzten Richtungen drehen zu können. Die Vorrichtung zur Verstellung dieser Steuer besteht aus einer Trommel 28, urn die das Seil 23 geschlungen ist und die auf derselben Welle 11 unmittelbar neben der Trommel 10 angeordnet ist. Der Handgriff 29 der Trommel 28 ist dem Handgriff 13 der Trommel 10 genügend nahe angeordnet, so daß beide Handgriffe 29 und 13 mit einer Hand gehandhabt werden können. Entsprechend können beide Trommeln 10 und 28 somit gleichzeitig in gleichem Sinne gedreht werden, während andererseits auch jeder Handgriff gegen den andern für sich allein bewegt werden kann, um beide Trommeln unabhängig voneinander einzustellen. Die Trommel 28 ist in gleicher Weise wie die Trommel 10 mit einer Bremse versehen, die aus einem durchgeschnittenen Ring 30 besteht, der an der Trommel 28 befestigt und mit einer Stellschraube 31 versehen ist. mittels deren man die Reibung zwischen dem Ring 30 und der Welle 11 r geln kann. Dies ermöglicht, die Seitensteuer in jeder gewünschten Lage einzustellen und ihre Steuertrommel in der eingestellten Lage gegenüber der anderen Steuertrommel für die Tragflächenverwindung durch die Reibung festzuhalten Der Widerstand der Luft an sich würde die Steuer nicht in jeder eingestellten Lage im Gleichgewicht halten, vielmehr erleichtert der Luftdruck Bald die regelnde Einstellung durch den Fahrer, bald wirkt er derselben entgegen und vermehrt die Schwierigkeiten der Steuerung Die Einschaltung der Reibungsbremse beseitigt diesen Mangel, indem sie die Steuer in d eser eingestellten Lage festhält. Auch der Handgriff 36 der Steuertrommel 35 des Steuerseils 34 für das Höhensteuer 32 wird in seinen Einsteliagen vorteilhaft durch eine in der gleichen Weise wie die bei den Trommeln 10 und 28 ausgebildete Reibungsbremse gehalten. Patent-Anspruch: Steuerung für Flugzeuge mit verwindbaren Tragflachen, dadurch gekennzeichnet, daß die im Bereich einer Hand liegenden Handgriffe für die Verstellung der Tragflächen und des Seitensteuers mit gebremsten Seiltrommeln für die Steuerseile verbunden sind. Steuervorrichtung mit zwei ineinander gelagerten Wellen.*) Vorliegende Erfindung betrifft einen Steuerapparat für Luftfahrzeuge, bei welchem sämtliche Steuerorgane mit Hilfe von zwei Handrädern bewegt werden, so daß die Füße des Führers frei bleiben. Bekannt sind bereits Flugzeugsteuerungen, bei welchen durch ein Handrad durch Hin- und Herschieben in der Richtung der Steuerwelle das Höhensteuer bewegt wird, (Voisin, M. Farman), durch Drehen des Handrades das Seitensteuer oder die Stabilisierungsorgane. Die dritte Steuervorrichtung, die Seitensteueruni oder die Quersteuerung, wird auch bei dieser Steuerung durch die Füße des Führers bedient. Bei dem vorliegenden Steuerapparat ist nun in der ersten Steuerwelle, die als Hohlwelle ausgebildet ist, eine zweite Steuerwelle mit einem Handrad verschiebbar. Abb. 1 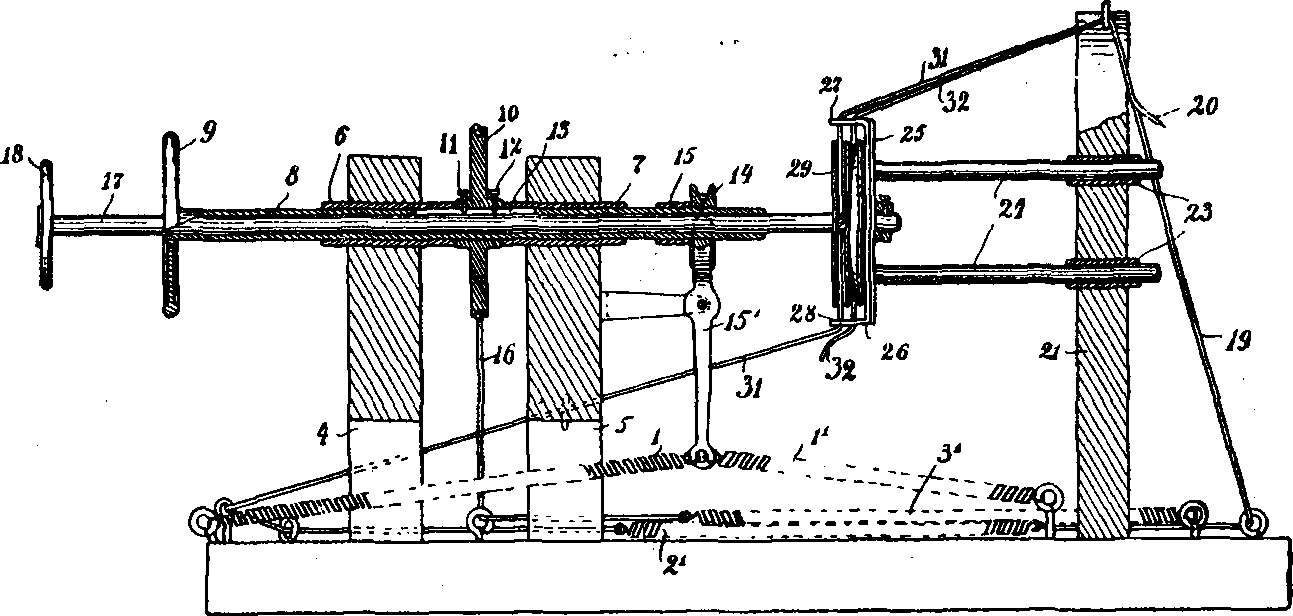 Abb. 2 Dieses Handrad läßt sich ebenfalls drehen, so daß man im ganzen mittels der beiden Handräder 4 verschiedene Steuerorgane bedienen kann. Man kann jedoch auch auf die eine Bewegung verzichten, d. h. das zweite Handrad nur hin und her schiebbar oder nur drehbar anordnen. *) D. R. P. 257 953. Ernst Bucher in Heidelberg. In diesem Falle genügt der Steuerapparat für die meisten Drachenflieger die nur ein Höhensteuer, ein Seitensteuer und die Quersteuerung besitzen. Größere Flugzeuge (z. B. von Farman gebaute Zweidecker, der Luftomnibus von Bleriot, das große Wasserflugzeug von Curtiß) besitzen jedoch schon heute zwei Höhensteuer, und zwar eines vorn, eines hinter den Tragdecken, die jedoch zur Zeit miteinander verkuppelt sind, also gleichzeitig bedient werden. Für viele Zwecke ist jedoch die besondere Bewegung jedes dieser Höhensteuer ein Vorteil. Außerdem ist die Bewegung aus Gründen der Betriebssicherheit zu empfehlen. Wird nämlich durch irgend einen Umstand das eine Höhensteuer defekt, so kann man durch das andere Höhensteuer die Längsstabilität erhalten, ohne daß das mitgeführte defekte Höhensteuer mitbewegt wird, der Bewegung hinderlich ist oder die beabsichtigte Steuerwirkung stört. Letzteres kann z. B eintreffen, wenn auf einer Seite des einen Höhensteuers eine Verspannung zerrissen ist. Auf dieser Seite gibt dann die Steuerfläche nach, und eine Bewegung dieser defekten Steuerfläche wirkt dann ähnlich wie die Verwindung der Tragflächen auf die Querstabilität. In Abb. 1 ist ein solcher Steuerapparat schematisch in der Draufsicht dargestellt, in Abb. 2 im Längsschnitt. In den Lagerböcken 4, 5 ist eine Steuerwelle 6 mit Seilscheibe 10 drehbar gelagert. Die Welle 6 ist eine Hohlwelle und nimmt die Welle 8 auf, die an ihrem einen Ende ein Handrad 9 trägt. Wird das Handrad und damit die Welle 8 gedreht, so wird mittels der in der Welle befindlichen Nut 13 und der Keilschrauben 11 und 12 am Seilrad 10 letzteres mitgedreht. Die Nut 13 ist so lang gemacht, daß das Handrad 9 und damit die Welle 8 in Richtung ihrer Achse verschoben werden kann, ohne daß die Welle 6 mit der Seilscheibe 10 bei dieser Bewegung mitgenommen wird. Dagegen überträgt sich diese Bewegung mittels der Bundscheibe 14 aur den Gabelhebel 15'. Dieser Hebel ist ein doppelarmiger Hebel, an dessen anderem Ende Seilzüge 1 und 1', z. B. zur Einstellung eines Höhensteuers, angreifen. Auch die Welle 8 des Steuerrades 9 ist als Hohlwelle ausgebildet, so daß in derselben die Welle 17 mit dem Steuerrad 18 verschiebbar gelagert ist. Wird diese Welle gedreht, so wird die am anderen Ende derselben befestigte doppelte Seilscheibe 29 mitgedreht. Die an dieser Seilscheibe befestigten Seilzuge 31, 32 verstellen zwei seitliche horizontale Steuerflächen, und zwar bei der Drehung in umgekehrter Richtung, so daß die Steuerfläche der einen Seite mit der hinteren Kante gehoben, auf der anderen Seite mit der hinteren Kante gesenkt wird. Auf diese Weise beeinflußt diese Steuerung die Querstabilität. Wird dagegen mittels des Steuerrades 18 die Steuerwelle 17 in der Richtung der Achse hin und her bewegt, also die Seilscheibe 29 nicht gedreht, sondern verschoben, so werden beide Seilzüge 31, 32 im gleichen Sinne verkürzt bezw. angezogen, so daß also auch beide zugehörigen Flächen sich im gleichen Sinne verstellen. D ese Flächen wirken dann wie ein Höhensteuer, d. h. sie beeinflußen nur die Stabilität in der Flugrichtung. Die Anordnung der Seilzüge ist nun so getroffen, daß man zur Beeinflussung der Längsstabilität und Höhensteuer beide Handräder 9 und 18 in gleicher Weise bezw. Richtung bewegen kann, indem das vor den Tragflächen angeordnete, mit dem Handrad 9 verbundene Höhensteuer, z. B. beim Nachvorneschieben des Steuerrades a, mit der Vorderkante gesenkt wird, während bei der korrespondierenden Bewegung des Steuerrades 18 die hinter den Tragflächen angeordneten Steuerflächen, die von den Seilzügen 31, 32 bewegt werden, mit der Hinterkante gesenkt werden. Die Einwirkung auf das Flugzeug durch diese beiden Steuer ergibt also ein Senken des Flugzeuges vorn, ein Heben hinten, also eine Steuerwirkung nach abwärts; das Umgekehrte tritt ein beim Nachhintenziehen der beiden Steuerräder. Ist die Seilscheibe 10, die durch das Steuerrad 9 betätigt wird, so mit dem Seitensteuer verbunden, daß beim Drehen des Steuerrades nach links Einstellung des Seitensteuers für den Flug nach links erfolgt, und wird gleichzeitig das Steuerrad 19 mitgedreht, so werden durch dasselbe die Flächen für die Quersteuerung so verdreht, daß sich das Flugzeug entsprechend dem Kurvenflug nach links neigt. Die Einstellung sämtlicher Steuer an einem Luftfahrzeug von Hand hat bei Drachenfliegern den Vorteil, daß der Flugzeugführer fest in seinem Sitz sitzt, indem er die Füße frei hat, um sich mit denselben gegen den Sitz zu stemmen. Es ist daher nicht nötig, daß sich der Führer an seinem Sitz anschnallt, was bei einem eventuellen Sturz seine Lage wesentlich gefährdet. Auch können unwillkürliche Bewegungen des Körpers sich nicht durch die auf das Seitensteuer gestemmten Füße auf das Seitensteuer übertragen. Die frei bleibenden Füße können somit zur Bedienung anderer Organe benutzt werden, z. B. der eine Fußhebel, um eine Kupplung zum Antrieb des Propellers einzuschalten, und der andere Fußhebel, um den Motor zu regulieren. 1. Steuervorrichtung mit zwei ineinander gelagerten Wellen, dadurch gekennzeichnet, daß jede der beiden Steuerwellen sowohl durch Drehung als auch durch achsiale Verschiebung zur Steuerung verwendet werden kann. 2. Steuervorrichtung nach Anspruch 1 mit seitlichen gleichartig oder entgegengesetzt verstellbaren Steuerflächen, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenwelle 17 mit ihrem freien, eine doppelte Seilscheibe zur Bewegung der seitlichen Steuerflächen tragenden Ende in einem mittels Führungsstangen 24 verschiebbar im Rahmen gelagerten Führungsbügel 26 drehbar gelagert ist, durch dessen Oesen die Steuerleinen geführt sind. Vorrichtung zum selbsttätigen Stabilisieren von Flugzeugen.*) Die Erfindung bezieht sich auf Flugzeuge, die, wie die Erfahrung zeigt, vielfach ohne erkennbare Ursache abstürzen. In höherem Grade ist jedoch die Gefahr des Abstürzens dann zu befürchten, wenn das Flugzeug während des Fluges durch von außen her auf dasselbe wirkende Kräfte aus seinem Gleichgewichtszustand gebracht wird. Trifft das Flugzeug ein böenartiger Windstoß von vorn, so werden die an den Tragflächen wirksam werdenden Hubkräfte vergrössert, das Flugzeug wird also mehr oder weniger heftig aus seiner wagrechten Lage in eine nach oben gerichtete Flugbahn abgelenkt. Umgekehrt werden die Hubkräfte verringert, wenn das Flugzeug plötzlich von einem von hinten her böenartig auftretenden Windstoß getroffen wird. Im letzteren Falle wird das Flugzeug also in eine nach unten gerichtete Flugbahn abgelenkt. Die Erfindung bezweckt nun, diesen Uebelständen vorzubeugen, und zwar sollen zu diesem Zwecke vom Fahrtwind beeinflußte Flügelräder Verwendung finden. Auf der Zeichnung ist die Erfindung in einem Ausführungsbeispiel dargestellt. Mit der, gegebenenfalls auch den übereinander angeordneten Tragflächen a ist eine Höhensteuerfläche m elastisch, etwa durch eine federnde Stange o verbunden. Die seitlichen Enden des Fahrzeuges können in ähnlicher Weise mit an den Tragflächen unmittelbar angeordneten federnden Höhensteuerflächen h versehen sein. Patent-Ansprüche: 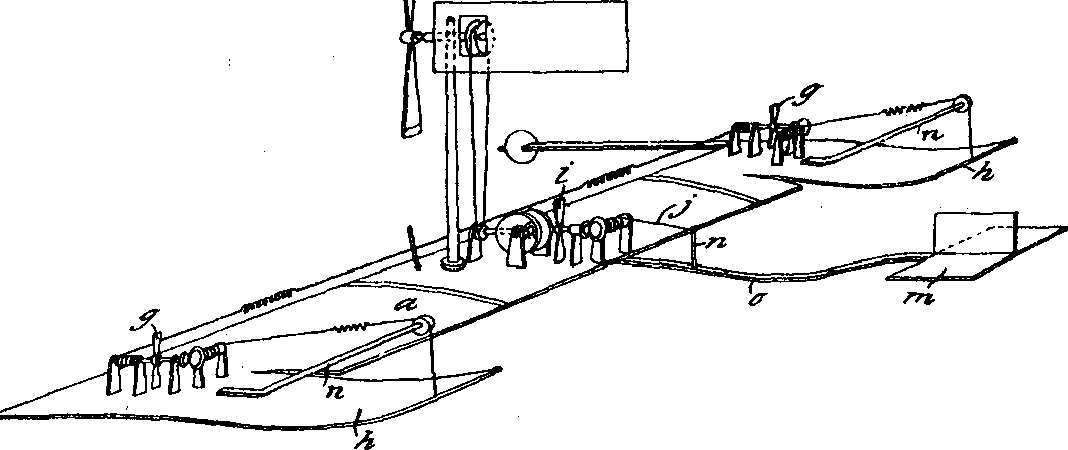 *) D. R. P, Nr. 258464, Sam Leonard Walkden in London. Gemäß der Erfindung ist das Fahrzeug nun mit vom Fahrtwinde angetriebenen Flügelrädern g, i versehen, die mit den Höhensteuern zusammenwirken, und zu diesem Zwecke stehen sie durch Zwischenglieder, im vorliegenden Falle durch ein Kegelrädergetriebe, eine Seiltrommel mit Seil j und dem Angriffshebel n mit den federnd angebrachten Höhensteuerflächen h, m in kraftschlüssiger Verbindung. Die Federkraft der Stange o ist gegenüber der durch den Fahrtwind auf die Flügelräder drehend einwirkenden Kraft so abgestimmt, daß die Flügelräder bei normaler Geschwindigkeit des Flugzeuges relativ zu der Luft, das heißt, wenn zwischen dem Gewicht des Flugzeuges und den hebenden Kräften ein Gleichgewichtszustand besteht, in Ruhe verharren, daß diese Flügelräder g, i jedoch bei Störungen des Gleichgewichtszustandes, die eine Abwärtsneigung des Fahrzeuges und demzufolge ein ällmähliges Anwachsen seiner Relativgeschwindigkeit zu der Luft zur Folge haben, unter Ueberwindung der ihrer Drehung seitens der Höhensteuerung entgegenwirkenden Federkräfte ein Aufwärtssteuerndes Flugzeugs herbeiführen im umgekehrten Falle hingegen den Federkräften seitens der Höhensteuerung nachgebend sich rückwärts drehen und dadurch ein Abwärtssteuern des Flugzeuges bewirken. Patent-Anspruch. Vorrichtung zum selbsttätigen Stabilisieren von Flugzeugen, dadurch gekennzeichnet, daß die Höhensteuerung durch vom Fahrtwind angetriebene Flügelräder entsprechend der Stärke des Fahrtwindes geregelt wird. Schwimmer mit Gleitflächen, insbesondere für Flugzeuge.*) Gegenstand der Erfindung ist ein insbesondere für Flugzeuge geeigneter Schwimmkörper, der sich von anderen Schwimmern mit Gleitflächen dadurch unterscheidet, daß die Gleitflächen an der vorderen Hälfte des Schwimmers angebracht sind, um bei der Bewegung des Fahrzeuges auf dem Wasser nicht eine a. -f- 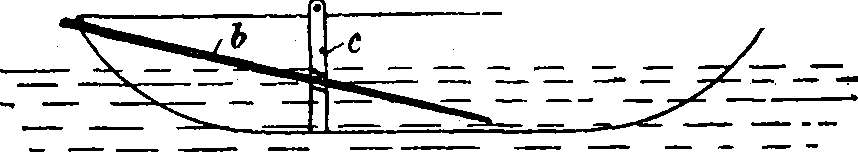 Abb. I Schräglage des Schwimmers gegen die Fahrtrichtung herbeizuführen und dadurch die Eintauchtiefe des Schwimmers entsprechend der Fahrgeschwindigkeit zu verringern. In der Zeichnung ist der mit einer Gleitfläche versehene Schwimmer in Abb. 1 in Seitenansicht und in Abb. 2 im -Grundriß dargestellt. Der aus leichtem, schwimm-fähigen Material oder als Hohlkörper hergestellte Schwimmer a ist mit einer Gleitfläche b versehen, die durch Schellen c oder in anderer Weise mit dem Schwimmkörper verbunden wird. Wird der Schwimmer aus Blech oder einem ähnlichen Material hergestellt, so kann jedoch die Gleitfläche aus einem Stück mit dem Schwimmkörper gepreßt werden. Die Gleitfläche erstreckt sich nur über den vorderen Teil des Schwimmers, sodaß sich unter dem Druck 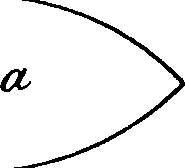 Abb. 2. des Wassers auf die Gleitfläche der Schwimmer selbst schräg einstellt und dann ebenfalls wie eine Gleitfläche wirkt. Durch diese Anordnung ist es möglich, mit kleinen Schwimmern auszukommen und bei der Fahrt auf dem Wasser den Widerstand schnell zu verringern. *) D. R.-P. Nr. 258919. Paul Groszer in Albersdorf, Holstein. Patent-Anspruch: Schwimmer mit Gleitflächen, insbesondere für Flugzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß die Gleitflächen ihre Hauptausdehnung an der vorderen Hälfte des Schwimmers haben. Verschiedenes. Bei Flügen um die Nationalllugspende ist Versicherung Bedingung. Infolge wiederholter an uns gerichteter Anfragen ersuchen wir die verehrten Herren Flieger, bevor sie sich um Flüge für die Nationalflugspende bewerben, sich die genauen Vorschriften sowie die vorgeschriebenen Protokollformulare von der Geschäftsstelle der Nationalflugspende, Berlin NW. 6, Louisenstr. 33-34. einzufordern. Bezüglich der Versicherung heißt es unter Absatz V: Ferner ist Voraussetzung für die Bewerbung um Geldpreise, daß der Bewerber bei Ausführung eines Prämienfluges auf Grund der durch die Nationalflugspende vermittelten Versicherungspolice versichert war, sofern er nicht nachweist, daß er vor dem 1. März 1913 anderweit sich in gleicher Höhe versichert hattte. Die norwegische Regierung beabsichtigt 17 Flugmaschinen anzuschaffen. Hierfür sind 554000 Kronen ausgeworfen und zwar werden 10 Maschinen und 2 Reservemaschinen im Süden und 4 und 1 Reservemaschine im nördlichen Norwegen stationiert. Wie verlautet, sollen französische Farman-Doppeldecker angekauft »erden. Die Sammlung für die schweizerische Militäraviatik hat 1,5 Millionen Francs iigeben. Es soll eine militärische Fliegertruppe geschaffen werden, die zu einem einzigen Flugzeuggeschwader, das dem Höchstkommandierenden der Armee unterstellt ist, zusammen gefaßt wird. 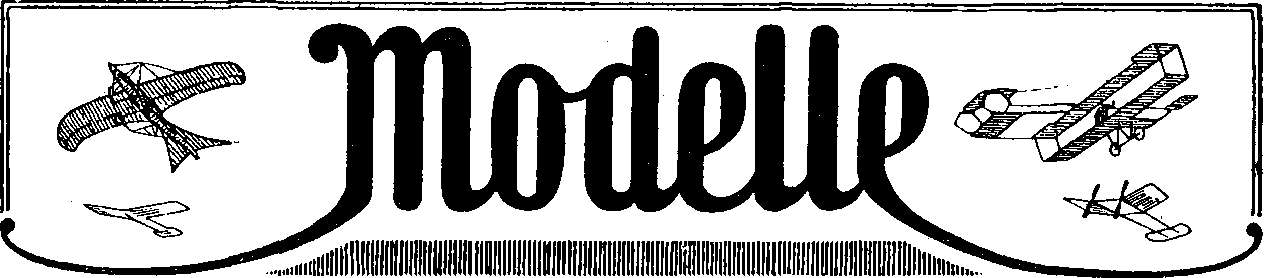 Eine Verbesserung des in Flugsport No. 12 er. beschriebenen Motorstabes kann nach beifolgender Anleitung erreicht werden. (Siehe Abb ) Einen Stab zu spalten, resp. in vier einzelne Stäbe mit verwachsenen Enden zu durchschneiden, ist schon an und für sich etwas schwierig und glückt nicht immer regelmäßig. Bei einem geringen Fehler des Stabes brechen sofort beim Auseinanderbiegen sämtliche vier Teile. Um dieser Gefahr zu entgehen, nehme man vier einzelne Stäbe und zwar nicht Rechteck- sondern Viertelkreisquerschnitl. Diese Stäbe sind in jedem Holzfurniturengeschäfl zu haben und lassen sich leicht 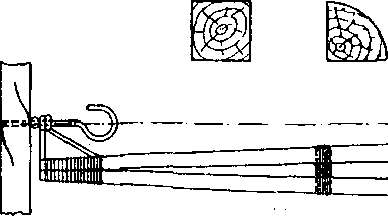 dünner abhobeln. Diese Form der Stäbe macht das ganze leichter, verliert aber wenig an Festigkeit. Man verleimt nun beide Enden und umschnürt dieselben fest. Man lasse dies ca. 24 Stunden trocknen, entferne die Uinschnürung und hoble beide Enden von ca. '/* des Stabes etwas ab, sodaß sich die Stärke nach beiden Enden hin verjüngt. Darauf umwickele man die Enden mit starkem dünnen Bindfaden, welcher verleimt oder überlackiert wird, befestige die Lagerung der Propellerwelle und den Gummiendhaken. Nun fertige man je nach der Länge des Stabes Holzkreuzchen. (Siehe Abb. Mittelquerschnitt). Bei einem Meter Stablänge nehme man vier bis fünf Stück von ungefährer Stärke des einzelnen Längsstabes und setze diese gut verleimt in die auseinandergebogenen vier Stäbe ein. Die Stelle, an der die Kreuzchen eingesetzt sind, umwickele man ebenfalls wieder mit dünnem Bindfaden und verfahre wie oben, bei Stäben von größerer Länge als einem Meter, nehme man entspr. ein oder zwei Kreuzchen mehr. Ein solcher Motorstab hält den einseitigen Gummizug bei höchster Beanspruchung mit Leichtigkeit aus Diese Art von Anfertigung bezieht sich nur auf Motorstäbe von einem Meter Länge und darüber hinaus, die großen Druck auszuhalten haben. Höh mann. Der „Dresdner Modellflugverein" veranstaltete am Mittwoch, 9. Juli auf dem Sportplatz Helmholtzstraße ein Uebungs-fliegen Es herrschte ziemlich heftiger Wind, sodaß Bodenstart mit Rückenwind nicht erfolgreich sein konnte. Dafür waren die Leistungen mit Handstart recht erfreulich Die beste Leistung erzielte Meyer mit 124 m. Nicht weniger als 6 Flüge über 100 m waren zu verzeichnen. Der Durchschnitt betrug etwa 90 m. Im ganzen wurden ca. 45 Flüge ausgeführt. Trotz des Windes bewiesen die Modelle eine fast dur. hweg gute Stabilität und namentlich Betriebssicherheit, da keiner der Teilnehmer eine Havarie halte, obwohl einige Landungen außerhalb des Platzes in Bäumen und Schwebegäten vorkamen. Mehrmals wurden schöne Höhenflüge gep.en den Wind erzielt. Interessant war es, wenn mehrere Apparate gleichzeitig starteten. Hierbei ereignete sich einmal eine kleine Kollision zweier Apparate in ca. 6 m Höhe. Die Modelle konnten jedoch beide den Flug nach Dämpfung der Störung fortsetzen und glatt landen. Am erfolgreichsten hat wieder der Ententyp abgeschnitten, der auch in der Mehrheit vertreten war. — Für den 17. Oktober plant der Verein, ein größeres Modellfliegen zu veranstalten. Der Dresdner Modellflugverein, dessen Ehrenvorsitz in liebenswürdiger Weise Seine Durchlaucht der Erbprinz von Reuß j. L. übernommen hat, beabsichtigt, sich in irgend einer Form dem Kgl. Sachs. Vtrein für Luftfahrt anzuschließen. Bis jetzt fanden seit Mai jeden 1. und 3. Dienstag im Monat Versammlungen mit Vorträgen Uber folgende Themata statt: 1. Tragdeckenkon-struktionen (Fechner); 2. Berechnungen nach dem Aehnlichkeitsprinzip (Klem-perer); 3. Versuche mit Wasserflugzeugmodellen (Meyer); 4. Schießversuche aus Modellen (Gast). Sehr anregend waren die Diskussionen, die sich stets den Vorträgen anschlössen. Anfragen sind vorläufig an die Geschäftsstelle, Landhausstr. 1, II zu richten.  Dresdener Modellflug- Verein. Meyer mit seinem Ententypmodell. Unten: der Apparat im Fluge. Frankfurter Flugmodell-Verein. Bei dem am Sonntag den 13. Juli auf dem Eulerflugplatz stattgefundenen Prämienfliegen erzielte die beste Leistung mit 68 m Karl Kopietz (Pfeil-Eindecker, 310 gr). Dann folgte Wilhelm Zilch (Pfeil-Eindecker, 370gr) 56 m und Theodor Specht (Pfeil-Eindecker, 200 gr). Die Flüge wurden bei Bodenstart und in gerader Linie ausgeführt. Modell-Uebungsflüge finden jeden Mittwoch Abend ab 8 Uhr und Sonntags vormittags von 7-U Uhr auf dem Gelände der ehem. Rosenausstellung statt. Die nächste Mitgliederversammlung ist Donnerstag den 7. August, abends V,9 Uhr im „Stadtgarten". Wittekind. Ausstellungswesen. V. Internationale Luftfahrzeug-Ausstellung, Paris 1913. Die von der Chambre Syndicale des Industrie Aeronautique organisierte „V. Internationale Luftfahrzeug-Ausstellung" (Cinquieme Exposition Internationale de Locomotion Aerienne) soll, wie die „Ständige Ausstellungskommission für die Deutsche Industrie" auf Grund zuverlässiger Informationen bekannt gibt, in Paris im Grand Palais des Champs-Elysäes vom 5. -25. Dezember 1913 stattfinden. Wie in den Vorjahren werden Aeroplane je nach der bereits bewiesenen Leistungsfähigkeit in 5 Kategoriei eingeteilt und aufgestellt. Die Platzmieten betragen für die erste Kategorie (unter der Kuppel) Frs. 6000.—, für die zweite Frs. 5000.—, für die dritte Frs 4000.—, für die vierte (Galeries du Rez-de-Chaus6e) und für die fünfte (premier etage) Frs. 2000. — . Anmeldungen sind bis zum 15. September ds. Js. an M. le Secrötaire General (2, Place de Laborde, Paris VIII Arrt). zu richten und werden einer Prüfung durch die Executif-Koinmission unterzogen, deren Entscheidung unanfechtbar ist. Die Kommission hat sich das Recht vorbehalten, Gesamt-Ansichten der Ausstellung aufnehmen und vertreiben zu lassen. — Nach Ansicht des Gewährsmannes der Ständigen Ausstellungskommission kann be-schickung und Besuch der Ausstellung heimischen Interessenten nur angelegentlichst empfohlen werden Das Ausstellungs-Reglement liegt an der Geschäftsstelle der Ständigen Ausstellungskommission (Berlin NW. Roonstrasse I) vor. Zuschrift an die Redaktion. Sehr geehrte Redaktion! In der letzten Juninummer Ihrer geschätzten Zeitschrift verteidigt mich Ihr Berliner Korrespondent bei Besprechung des Absturzes von Krastel auf Baumann-Apparat in sehr dankenswerter Weise gegen eine recht überflüssige Glosse des Berliner 8 Uhr Abendblattes über Professoren-Apparate. Herr Prof. Baumann hat an anderem Orte hierzu Stellung genommen. Mir war die Bemerkung des Berliner Blattes erst jetzt zur Kenntnis gekommen, weswegen ich Sie bitte, mir in Ihrer Zeitschrift einige Worte gegen die Oberflächlichkeit solcher Verallgemeinerung zu gestatten. Der Absturz von Hild auf meinem Eindecker (Ententyp) ist, wie ich und alle anderen Augenzeugen deutlich beobachtet haben, durch einen Steuerfehler von Hild entstanden, der nur durch eine geistige Indisposition zu erklären ist. Als Hild bergauf und mit Rückenwind den Apparat mit viel zu geringer Geschwindigkeit hoch nahm und immer weiter hochwürgte, sah ich von Anfang an mit Schrecken, daß ein Absturz kommen mußte. Dieser ereignete sich dann nach einigem typischen Hin- und Herschaukeln, als Hild den schon mit ganz geringer Geschwindigkeit „hängenden" Apparat noch über eine Telegraphenleitung hochzog. Ich habe sofort nach dem Unfall darauf bestanden, daß eine Kommission, bestehend aus den Herren Dipl.-Ing. Gaule, Prof. Rötscher und Fliegeroffizier Leutnant Siebert die Ursache des Unglücks und den Zustand des unberührt gelassenen Apparates untersuchte. Es wurde dabei festgestellt, daß alle Ver-spannungen, Steuerleitungen und Steuer in vollkommener Ordnung waren. Der Typ selbst hat unter Führung von Gsell in sehr häufigen und langen Flügen in Johannisthal eine sehr leichte Steuerbarkeit und Flugsicherheit bewiesen und es ließe sich flugtechnisch noch sehr viel aus ihm herausholen, worauf ich an anderer Stelle noch ausführlicher zurückkommen werde. Die oben auseinandergesetzte Ursache des Unglücksfalles haben Sie auch selbst damals nach unabhängigen Berichten in Ihrer Zeitschrift dargestellt und ich hatte aus den Darstellungen aller Zeitungen und aus zahlreichen Angeboten von Piloten nach dem Absturz das Gefühl, daß das Vertrauen der flugtechnischen Welt zu mir nicht gelitten hatte. Einen weiteren Beweis und eine weitere Rechtfertigung des Vertrauens der flugtechnischen Welt habe ich inzwischen in der vielfachen Benutzung und den Erfolgen meines Propellers in allen Wettbewerben dieses Jahres erblicken dürfen. Um diesen Ruf auch fernerhin nicht in unberechtigter Weise schädigen zu lassen, möchte ich nochmals mit aller Entschiedenheit betonen, daß das überaus traurige Ereignis des Absturzes von Hild nicht das geringste mit dem System oder der Einzelausführung meines Apparates zu tun gehabt hat. Wir alle arbeiten ja mit allen Kräften daran, die noch immer so sehr große Zahl der Flugunfälle zu verringern. Erfolge in diesen Bemühungen werden aber nicht durch oberflächliche Verallgemeinerungen erzielt werden, sondern nur durch Steigerung der Festigkeit und Flugsicherheit der Flugzeuge, durch körperliches und geistiges Training unserer Führer und durch strenge Flugplatzordnungen. Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr H. Reissner. Der Todessturz auf dem Baumann-Freytag-Doppeldecker. In der Presse sind an diesen bedauerlichen Unfall umfangreiche Erörterungen geknüpft worden, so auch von Leuten, die die Maschine kaum dem Aussehen nach kannten. Ja es sind Urteile über die Maschine gefällt worden, die ich nicht unwidersprochen lassen möchte. Ich glaube vor allen anderen dazu berufen zu sein, da ich zahlreiche Flüge auf dieser Maschine ausgeführt und deshalb über ihre Sicherheit und Lenkbarkeit ein Urteil habe. Ich selbst habe die Maschine in Untertürkheim als Schüler seit März allein p.eflogen, ebenso längere Zeit nach der Flugwoche in Johannisthal. Außerdem wurde die Maschine an beiden Orten von dem Flieger Gasser und dem Schüler Sido ebenso gesteuert. Ich habe zahlreiche Flüge, speziell in Johannisthal, von über einer halben Stunde Dauer auf dem Platze sowie außerhalb desselben ausgeführt, wobei ich in Höhen bis zu 150 m flog. Ferner führte ich mit der Maschine Kurvenflüge aus, wie sie in Johannisthal wohl nicht oft von einem Doppeldecker gesehen werden; ebenso steile Gleitflugabstiege. Ich bin auch bei Witterungsverhältnissen geflogen, wo andere Maschinen den Schuppen aufsuchten. Dies alles ist in Johannisthal vor Zeugen vor sich gegangen. Nicht zu meinem eigenen Lobe führe ich dies an, sondern lediglich in Rücksicht aijf die Maschine und um ferner darzutun, daß ich sie unter den verschiedensten* Verhältnissen kennen zu lernen Gelegenheit hatte, ebenso um Tatsachen anzuführen, die für die äußerste Sicherheit einer Maschine sprechen. Bei all meinen Flügen erwies sich die Maschine sehr stabil, was auch von Krastel selbst betont wurde. Stets war ich in der Lage, dieselbe ohne großen Kraftaufwand zu steuern. Sie genügte somit allen Anforderungen, die man betreffs Lenkbarkeit und Sicherheit an ein Flugzeug stellen kann; denn anders als ich in Johannithal flog, kann man meiner Ansicht nach mit anderen Sclml-maschinen auch nicht fliegen. Die Maschine von Krastel unterschied sich von der, die ich flog konstruktiv absolut nicht, besaß aber als Konkurrenzmaschine eine wesentlich größere Geschwindigkeit und Tragfähigkeit. Ihre volle Geschwindigkeit betrug bei einem 75/85 PS Motor gegen 100 km pro Stunde, ihre Tragfähigkeit bei 40 qm Tragfläche weit Uber 300 kg Nutzlast. Die Maschine war in Untertürkheim erst am Morgen des Versandtages fert:g geworden und somit waren mit ihr nur kurze Probeflüge ausgeführt. In Johannisthal zeigte sich, daß die Einstellung der seitlich angebrachten Stabilisationsflügel noch nicht stimmte. Anstatt ihre Einstellung vorzunehmen, entfernte Krastel diese Flügel und ersetzte sie durch Ailerons. Diese Ailerons trugen nicht, während die abgenommenen Seitenflügel Auftrieb hatten. Entsprach nun der Grundriß der tragenden Fläche Abb. 1, so entsprach er nach der Aende-rung Abb. 2. Die schraffierten Flächen bedeuten hierbei die nichttragenden Ailerons. Dadurch mußte notwendig die Lage des Druckmittelpunktes näher an die Vorderkante heranrücken als dies zuvor der Fall war, außerdem mußte die Wanderung des Druckmittelpunktes größer werden, weil die weggenommenen Flügelfortsätze unter einem kleineren Anstellwinkel als die Tragflächenmitte stehend dämpfend wirkten. Nun entspricht das Steuerungsschema der Maschine der Abb. 3. Die vordere Tragfläche ist um a, die Schwanzfläche um b drehbar. Beide sind durch das Seil c gekuppelt, während der Steuerhebel in üblicher Weise an der Schwanzfläche angreift. Auf Tragfläche und Schwanzfläche wirken zwei Momente 1. das vom Luftdruck herrührende und 2 das vom Eigengewicht der Flächen herrührende Moment. Bei richtiger Einstellung sind nun alle 4 Momente Abb. 1 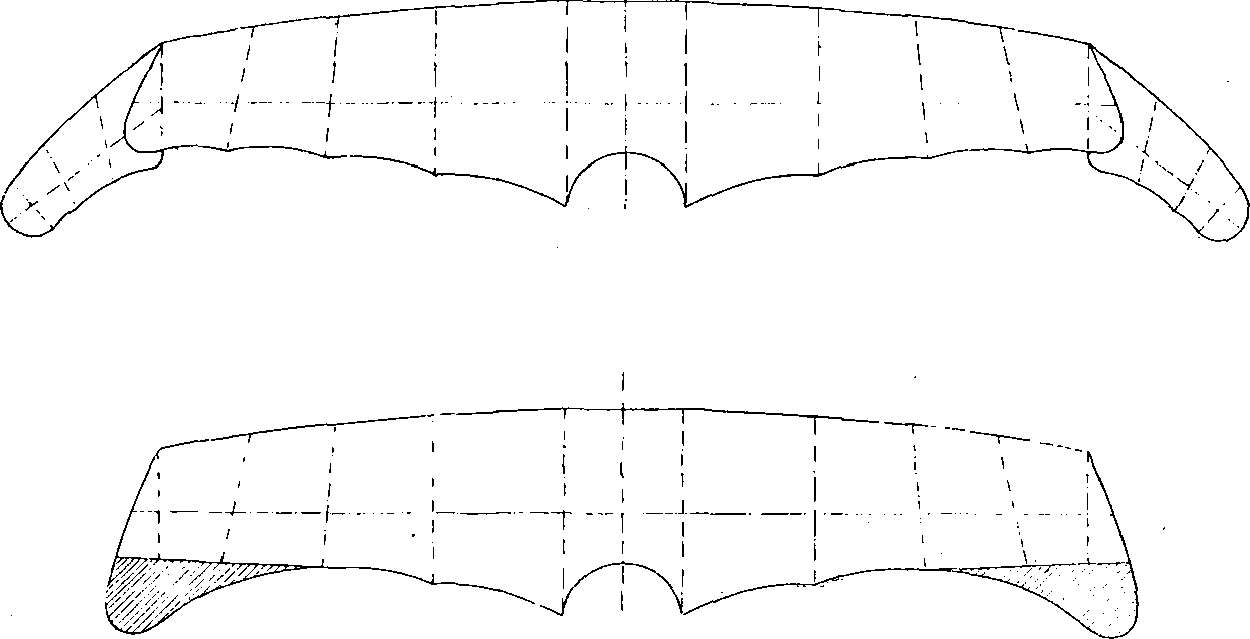 Abb. 2 unter sich im Gleichgewicht und somit ist auch kein Steuerdruck vorhanden, selbst dann nicht, wenn sich die Geschwindigkeit der Maschine ändert. Abgesehen von der Ueberlegung beweisen dies die ungezählten Flüge, die auf den Maschinen unternommen worden sind. Die Zahlen der Momente waren bei der Krastel'schen Maschine ungefähr die folgenden: Luftdruckmoment vorn 600 mkg, hinten 100, Gewichtsmoment vorn 90, hinten 15 mkg, sodaß bei einer gewissen Geschwindigkeit 600-90=X(100-15) war, wobei X das Hebelübersetzungsverhältnis im Seilzug ist und sich zu 6 ergibt. Wächst die Geschwindigkeit, so nehmen die Luftdruckmomente vorn und hinten im gleichen Verhältnisse zu, die Gewichtsmomente bleiben wie zuvor. 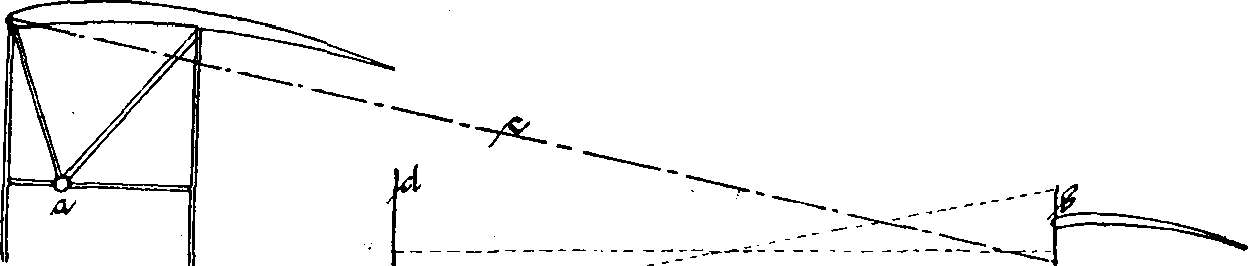 V—'"' d = Steuerhebel Abb. 3 Würde z B. die Geschwindigkeit von 25 m auf 35 zunehmen, so würde aus 600=1200 und aus 100=200 werden und es ergäbe sich: 1200-90 = X (200-15) woraus wieder X = 6 folgen würde; d. h also das Gleichgewicht bliebe bestehen, der Steuerdruck wäre nach wie vor = 0. Durch Krastels Aenderung wurde das Luftdruckmoment vorn kleiner und ging schätzungsweise auf ungefähr 450 mkg zurück. Alles andere blieb wie zuvor. Sollte nunmehr bei normalem Flug Gleichgewicht vorhanden sein, so mußte X geändert werden. Und es ergab sich 450-90 = X (100-15) woraus sich zu X = 4,25 ergibt Dann ist aber bei Verdoppelung der Luftdruckmomente durch Zunahme der Geschwindigkeit kein Gleichgewicht vorhanden; die eine Seite der Gleichung ergibt vielmehr 810 und die andere 786,25 d. h. es ist zur Vermeidung willkürlicher Steuerbewegungen vom Flieger selbst ein Moment von 23,75 mkg aufzuwenden; dem entspricht ein Steuerdruck in der Richtung nach vorn, d. h abwärtssteuernd von ca. 40 kg. Dieser Uebelstand hätte behoben werden können, wenn man in die Schwanzfläche einen Gummizug einsetzte, der diese Fläche mit 5 kg nach unten gezogen hätte, sodaß aus dem Gewichtsmoment der Schwanzfläche statt 15 = 20 geworden wäre. (Wäre es größer als 20 geworden, so hätte ein entgegengesetzter Steuerdruck auftreten müssen.) Dies wurde von Krastel trotz Anweisung unterlassen. Der Sturz selbst spielte sich nach einer Darstellung seines Monteurs Hassert, der gewissermaßen als einziger seine Flugbahn unausgesetzt beobachtete, wie folgt ab: Die Maschine legte einige Runden in geringer Höhe zurück. Jedesmal, wenn Krastel an dem Monteur vorbeikam, ließ er beide Hände am Steuer los unb winkte, was als sicheres Zeichen gilt, daß bei der Geschwindigkeit, mit der die Maschine flog, kein Steuerdruck vorhanden war. Hierauf stieg selbige mit Rückenwind auf ca. 70 m, wobei sie zusehends schneller wurde, woraus zu schließen ist, daß die Windstärke nach oben zunahm. Bei der 6. Runde nun, die Krastel nach der Aussage seines Monteurs bis zur Hälfte freihändig flog, winkte er nochmals und ging in verhältnismäßig kurzer Distanz von 70 m auf 20 m herunter und zwar mit vollaufendem Motor. Die Maschine kam nun mit durch den Abstieg weiterhin zunehmender Geschwindigkeit in den schwächeren Bodenwind. Ihre Geschwindigkeit gegenüber der Luft war also sicher bedeutend größer geworden, als sie in den vorangegangenen Runden war. Es mußte nun, entsprechend den vorstehenden Rechnungen, notwendig ein Steuerdruck auftreten, der die Maschine nach unten zu steuern strebte. Daß dieser Steuerdruck unüberwindlich groß wurde, glaube ich nicht, wohl aber, daß dem Flieger das Steuer aus der Hand rutschte, vielleicht gerade in dem Moment, als er nach der Gasdrossel greifen wollte. Denn ein Schnellen des Steuers muß stattgefunden haben; nur dadurch ist der plötzliche Schwung der Maschine zu erklären, durch den beide Insassen schon in der Luft herausgeschleudert wurden. Es sei noch erwähnt, daß die Aenderung an der Maschine ohne Wissen und wider den Willen des Herrn Prof. Baumann ausgeführt wurde, ferner, daß die Gummizüge, die Herr Prof. Baumann, nachdem er von der Aenderung der Maschine erfuhr, für den Einbau in die Schwanzanlage selbst nach Johannisthal brachte, von dem Flieger Krastel für die Steuerung der Ailerons verwendet wurden. Größere oder kleinere Gummiquerschnitte? Die Zugkraft des Gummis als Stoff ist beim gleichen Querschnitt die gleiche, einerlei, ob Fäden verschiedenen Durchmessers benutzt werden. Man nimmt jedoch für schwerere Apparate oder größere Schrauben aus dem Grunde stärkere Fäden, weil die Reibung zwischen den einzelnen Fäden umso geringer wird, je kleiner ihre Anzahl ist. Haben Uebersetzungen Vorteil ? Jede Uebersetzung verbraucht Kraft. Wenn dieser Verlust nun auch n'cht groß zu sein braucht, so spielt er doch bei der verhältnismäßig geringen Kraftentwicklung des Gummimotors schon eine Rolle. Dazu kommt, daß bei geteiltem Motor eine Erhöhung des Luftwiderstandes eintritt, ein Nachteil, den man ebenfalls zu vermeiden suchen wird. Geteilte Motore können u. E. nur den Zweck haben, eine gedrungenere Bauart des Modells herbeizuführen. Otto Breitbeil, stud. ing. Flugschüler.  Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.) O. K. Die Motorstärke berechnet man nach der Formel: N = ^q' P?ℜ ' ^ '' PS. Hierin bedeutet: F = Kolbenoberfläche in qcm = r2 n pm mittlerer Kolbendruck = 4 ~ 8 kg pr qcm (richtet sich nach Kompression) S = Kolbenhub in Metern Y = Anzahl der Explosionen pro Minute bei Vier-Takt-Motoren i = Anzahl der Zylinder. Ihr Motor leistet also bei Annahme von pm = 6 kg nach obiger Formel: _ 63,61 .6.0,11 .800.2 ^ ,g ps 60 . 75 Sollte jedoch der mittlere Druck pm geringer oder größer sein, so ändert sich entsprechend die Pferdestärke Ihres Motors. W. C. Das Brüchigwerden Ihres Gummimotors dürfte in erster Linie auf schlechte Gummiqualität zurückzuführen sein. Derselbe wird wahrscheinlich schon zu lange gelagert haben und ist infolgedessen spröde geworden. Abhilfe können Sie schaffen, wenn Sie den Gummimotor mit Glycerin einreiben, wodurch derselbe geschmeidig wird. Anstatt den üblichen Vierkant-Gummi empfehlen wir den Rundgummi anzuwenden, welcher weniger reißt. W. W. O. Das Imprägnieren von Tragdecken erfolgt mittels Aviatollack, Emaillit, Aerolack oder mit einer Mischung von Sikkativ und Leinöl, welches Sie in jeder Drogerie zusammengestellt bekommen. Vorrichtungen über automatische Seitensteuerung sind sehr ungebräuchlich und werden in feinmechan.-Werkstätten nach Angaben angefertigt. Näheres hierüber mitzuteilen ist wegen Raummangel unzuläss g. H. M. Bei heruntergezogener Vorderkante eines Tragdecks beginnt die Wölbungslinie der Unterseite meistens ganz vorn. Infolgedessen steht jeder Flügelpartie der Oberseite ein entsprechender Auf- und Vortrieb der Unterseite gegenüber. Wird dagegen, wie dies beim Nieuport-Profil der Fall ist, die Keilschneide angewendet, so beginnt die Wölbung der Unterseite erst hinter derselben. Es fehlt somit auf der ganzen Länge der Schneide von unten der Gegendruck. Außerdem lenkt die Schneide den Unterwind so weit ab, daß derselbe erst hinter dem Beginn der unteren Wölbungslinie das Tragdeck trifft. Hierbei entsteht ein Vakuum, welches den Oberwind verstärkt und die Tendenz der Einfallswinkelverkleinerung erhöht. In dem in „Flugsport" No. 4 Jahrg. 1912 S. 131-140 behandelten Artikel: „Tragflächenuntersuchungen von Eiffel" finden Sie obige Angaben in dem Druckdiagramm des Nieuport-Profils bestätigt. Das Plusvorzeichen der Druckkurve für die Unterseite verwandelt sich schon vor Beginn der Wölbungslinie in ein ausgeprägtes Minus und deutet auf ein Vakuum an dieser Stelle hin. Zur Orientierung über ähnliche u. a. Profile empfehlen wir Ihnen: Eiffel, la Resistance de I' air. Mit der Erhöhung der V-Form verschlechtert sich das Tragvermögen, da der unter den Flügeln erzeugte Luftdruck leicht nach den Seiten hin entweichen kann. Ferner wird das Fliegen bei Seitenwind erschwert, weil die aufwärts gestellten Flügel eine günstige Angriffsfläche bieten. K. v. B. Bei dem Bodenstart muß das Modell auf den Boden gesetzt und ohne Anstoß abgelassen werden. Wenn Sie dem Modell beim Start einen Stoß geben, so werden Sie keinen Vorteil, sondern einen Nachteil erzielen. Das Modell von Zilch, welches 105 m Flugweite erzielte, besitzt als Antrieb einen Gummimotor. Der Peugeolpreis, welcher international war, hat mit dem dritten am 15. Juni auf der Pariser Prinzenpark-Rennbahn abgehaltenen Wettbewerb sein Ende erreicht. Wie uns unser Pariser Korrespondent mitteilt, wird eine Wiederholung dieses Preises für fliegende Fahrräder für die nächste Zukunft nicht beabsichtigt  Jllustrirte No. 16 technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnunent: 6. August <^ gesamte tSSZℜ i9i3. janm. i. „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Teief.4557 ftmti. Oskar Ursinus, Civilingenieup. Tei.-fldr.; Urs'mus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz8. Erscheint regelmäßig 14tägig. — : Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. - ■ : Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 20. August. Englisches Marine-Flugwesen. London, den 30. 7. 13. In Deutschland hat man immer über englische Aviatik fast mitleidig lächelnd gesprochen, und hat gelegentliche Zeitungsnachrichten besser unterrichteter deutscher Fachleute wenig, meistens garnicht beachtet. Es hieß einfach, man hört aus England so viel wie nichts, und deshalb kann auch dort drüben jenseits des Kanals nicht viel los sein. Die zahlreichen Unfälle der englischen Luftschiffe* berechtigten ja schließlich zu dem Schlüsse, daß auf dem Gebiete der Flugtechnik große Erfolge in England nicht erzielt sein könnten, bis schließlich die Rede des Kriegsministers Colonel Seely und die großen Preisausschreiben der Daily Mail die Aufmerksamkeit der Nachbarländer wieder auf den Stand des englischen Flugwesens lenkten. Niemand ahnte, daß die englische Presse in der Behandlung von Marine- und Militärfragen weit diskre er ist als die deutsche. Erst jetzt, nachdem der Kriegsminister Seely die Zurückhaltung der Presse gelobt, und die deutsche Regierung die deutsche Presse gebeten hat, mit der Veröffentlichung von Heeres- und Marinesachen etwas vorsichtiger zu sein, weil dadurch das Ausland erst recht aufmerksam gemacht würde, glaubt man diese Tatsache. In Deutschland wird jedes kloine Vorkommnis sofort in die Welt hinausposaunt, und meistenteils knüpfen sich noch ganz unliebsame Erörterungen an die Ereignisse. Schon vor ungefähr 10 Jahren besaßen die Engländer sogenannte „Drachenzüge" in der Armee. Der leider zu früh tödlich verunglückte englische Sportsmann A. Rolls, Sohn des Lord Rolls, war einer der Ersten, der sich an der Sache der Gebrüder Wright mit lebhaftem Interesse beteiligte und dem es vorbehalten war, die Wright-Maschine in England einzuführen Ueberau wo es in den Jahren 1907/09 auf dem Gebiete der Plugtechnik etwas neues gab, konnte man bestimmt darauf rechnen, Rolls in dem kleinen Kreise der Gläubigen zu finden. Auch Oberst S. F. Cody, an dessen Obersten-Titel sich folgende amüsante Geschichte knüpft, begann Flugzeugo zu bauen. Es sei noch bemerkt, daß Mr. Cody nie in der englischen Armee gedient hat. Bei seinen ersten Flugversuchen in der Salis-bury-Ebene erregte der Konstrukteur die Aufmerksamkeit des Königs, und hegte dieser den Wunsch, die Maschine näher kennen zu lernen. Beim Abschied reichte der König dem Flieger die Hand und sagte: „Good lock, Colonel", (Viel Glück, Oberst!) Seitdem nennt er sich Oberst und niemand bestreitet ihm den Titel. Er pflegte zu sagen: „Der König hat mich Oberst genannt und jetzt bleibe ich Oberst." Dieser Flugzeugkonstrukteur — fälschlicherweise mit dem auch in Deutschland bekannten Buffalo Bill identifiziert, er ist ein Cousin desselben — hatte schon vorher .den Bau von bemannten Drachen aufgenommen. Später kamen dann die Engländer auf die französischen Flugplätze, namentlich in Pau wimmelte es von ihnen, und die Franzosen schufen ihrer eigenen Industrie die "Wege in England. Farman und Bleriot durften Fabriken in dem Inselreich einrichten und besitzen jetzt die größten Fliegerschulen in Hendon. Die Militärverwaltung baute notgedrungen selbst und es entstand die Royal Air-craft Factory. Verschiedene rein englische Gesellschaften, z. B. die British and Colonial Aircraft Co. Ltd., besser bekannt als die Bristol-Werke, die ja auch in Deutschland einen Flugplatz besitzen, SopVith Aviation Co. u. s. w., wurden gegründet, andere französische Flugzeug-Werke folgten Farman und Bleriot, kurz genommen, eine äußerst lebhafte Flugtechnik entwickelt sich in England. Dann kam das Schönste. Nachdem England sah, daß es sich die nötigen Kenntnisse auf diesem Gebiete angeeignet hatte, wurde es Ausländern gegenüber sehr zurückhaltend. Während man früher in Farnborough und den anderen militärischen Werkstätten und Parks herumgeführt wurde, durfte von nun ab niemand mehr auch nur in die Nähe der Werkstätten kommen. Die englischen Zeitungen brachten wenig oder garnichts, und wenn dann gelegentlich der Manöver, die ja nicht ohne Anteilnahme fremder Militärattaches abgehalten worden können, Nachrichten über erfolgreiche Verwendung von Flugzeugen veröffentlicht wurden, war man in Deutschland erstaunt, hielt es für übertrieben und schenkte den Meldungen weiter keinen Glauben Und doch wäre es für jedermann ein Leichtes gewesen, herauszufinden, daß in England ein lebhafter Betrieb herrschen mußte, Man brauchte nur auf den französischen Flugplätzen die große Anzahl von englischen Schülern zu sehen, man brauchte nur etwas genauer die Listen des Aero Club de France zu verfolgen, um staunend festzustellen, wie viele Engländer das Pilotenzeugnis er- worben hatten Wenn in England nicht viel geflogen würde, so hätte dieser Drang wohl kaum eine Erklärung. Auch nach den Besitzungen, wie Indien und Australien, sind eine große Anzahl von Flugapparaten exportiert worden. In Indien ist neuerdings eine Fabrik für Flugzeuge eingerichtet worden, und zwar in Madras. In letzter Zeit ist das englische Flugwesen besonders organisiert worden, woraus hervorgeht, daß man mit aller Macht daran geht, sich neben der Vorherrschaft auf dem Wasser die Vorherrschaft in der Luft anzueignen. Da jedoch Deutschland mit Luftschiffen, und Frankreich mit Land Flugmaschinen den Engländern zu weit voraus ist, ist ihnen nur noch eines übriggeblieben, und das ist die Wasser-Flugmaschine. Und auf diesem Gebiete kann sich England rühmen, seinen Nachbarn überlegen zu sein. Schon vor zwei Jahren vollführte Commandeur Schwann an einem Short-Wasserflugzeug-Doppeldecker in den Badeorten, bei ziemlich hohem Seegang wohlgelungene Flüge. Eines Morgens dann erregte der Flieger Mc. Clean an einem Short-Flugzeug neuer Konstruktion das Aufsehen der Londoner, indem er die Themse hinauf über Brücken hinweg, unter Brücken hindurch bis zum „Parlaments-Gebäude" flog und an demselben Tage auf gleichem Wege wieder nach Eastchurch zurückkehrte. Wie auch im vorigen Jahre, so haben auch diesmal wieder Wasserflugzeuge an den großen Flottenmanövern aktiv teilgenommen. Am 15 Juli verließen die beiden Kreuzer „Hermes" und „Actaeon" mit je drei Caudron-Wasserflug zeugen den Hafen von Sheerness, um auf hoher öee während der Manöver tätig zu sein. Die Schiffe wurden mit einer speziellen Vorrichtung für Abflüge und einer Plattform für Landungszwecke versehen. Im ganzen nahmen ungefähr 40 Wasserflugzeuge an den kürzlich abgehaltenen Manövern teil. Ueber die für dieses Jahr zur Verfügung stehenden Geldmittel für die Förderung des Flugwesens lauten die Nachrichten sehr widersprechend. Nach einer einwandfreien Quelle sind in 1913 für Wasserflugzeuge, Errichtung von Plugstationen u. s. w. 6^ Millionen Mark zur Verfügung gestellt worden, spdaß im ganzen für militärische Flugzwecke 17 Millionen bewilligt werden sollen. Für Errichtung einer Flugstation in Sheerness zur Unterbringung von 10 Wasserflugzeugen 132000 Mark, Errichtung von Schuppen für Landmaschinen u. s. w. 80000 Mark. (Ausgaben zusammengenommen im Vorjahre 300000 Mk.) Flugstation in der Mündung des Medway Flusses, für 10 Wasserflugzeuge, einschließlich einer großen Doppel-Luftschiffhalle in der Nähe von Southampton, 900000 Mk. (Im Vorjahre 60000 Mk.) Die Kriegsflotte hatte im vorigen Jahre nur 8 Wasserflugzeuge und 6 diplomierte Flieger, während vor einem Monat die Marine über 60 Flugmaschinen und 80 Flieger verfügte. Da weitere Flugzeuge in Bestellimg gegeben sind, wird in Kürze die Zahl derselben auf 100 gebracht werden. Die im Besitze der englischen Marine befindlichen Wasserflugzeuge sind folgende: Short Zweidecker (Short Bros. Eastchurch Isle of Sheppey), dürfen laut Kontrakt nicht an das Ausland liefern. Avro Zweidecker (A. V. Eoe & Co., Manchester.) Deperdussin Eindecker (British Deperdussin Aeroplane Co. Ltd., Hendon.) Sopwith Doppeldecker (Sopwith Aviation Co. Ltd., Kingston on Thames.) Farman (Maurice) Doppeldecker (Gebaut bei der Royal Aircraft Factory, Hendon und Farnborough.) Caudron Doppeldecker (Caudron Freres Le Crotoy Frankreich.) Borel Eindecker (Societe Anonyme des Aeroplanes Borel, Paris.) Nieuport Eindecker (Nieuport Hydro-Aeroplane Co.) Moräne Saulnier Eindecker. ßreguet Doppeldecker (British Breguet Aeroplanes Hendon). In letzter Zeit wurden einige Bristol-Wasser-Eindecker ausprobiert und befinden sich nunmehr im Besitze der Marine. Der Marine-Flügel des Royal Flying Corps Naval Wing, Royal Flying Corps besteht aus dem Kommando auf H. M. S. „Actaeon" und H. M. S. „Hermes", der Hauptstation zu Eastchurch, Isle of Sheppey, der Sektionen zu Isle of Grain, Sheerness, Harwich, Dover, Yarmouth, Calshot, Filey, "Walney Island, in der Nähe von Barrow in Furneß, Rosyth und Firth of Förth. Eine Zentral-Fliegerschule befindet sich in Üpavon, die aus zwei Abteilungen, einer Marine- und einer Armeeabteilung besteht. Die Saläre sind folgende: Captain R. N. Flying Wing (Oberleutnant Klg. Marine) 19,000 Mark jährliches Einkommen, Commander R. N. Flying Wing (Leutnant Klg. Marine) 10,000 Mark jährliches Einkommen, Commander Engineer Flying Wing (Ingenieur Leutnant Klg. Marine) 8850 Mark jährliches Einkommen, Assistants Flying Wing (Rang eines gemeinen Soldaten) 1180 Mark jährliches Einkommen. Die ersten Versuche, Abflüge von einem sich in Fahrt befindenden Kriegsschiffe zu machen, wurden bekanntlich zuerst in England, und zwar am 5. Mai 1912, glänzend zur Ausführung gebracht. Leutnant Gregory (jetzt Oberleutnant) flog von einer an H. M. S. „Hibernia" errichteten Plattform, an einem alten Typ (S. 38) Short Zweidecker ab, während das Schiff mit einer Geschwindigkeit von 10 Knoten, gegen einen Wind von ungefähr 12 engl. Meilen in der Stunde, vorausdampfte. Der Apparat erhob sich direkt nach dem Anwerfen des Motors und landete nach kurzem Fluge im Hafen von Weymouth. Dieses Manöver wiederholte sich am 12. Mai in der Nähe von Portsmouth, indem der Leutnant Malone von einer an H. M. S. „Africa" provisorisch angebrachten Plattform wohlgelungene Flüge unternahm. Das Schiff fuhr mit einer Geschwindigkeit von 12 Knoten in der Stunde. Auch die Privatleute unterstützen tatkräftig die Bemühungen der Regierung, das Flugwesen zu fördern. Für nächstes Jahr ist ein Flugmotoren-Wettbewerb, ähnlich dem „Kaiserpreis-Wettbewerb", mit einem Preise von 100,000 Mark, für den besten englischen Flugmotor vorgesehen. Garantierte Aufträge in Höhe von 800,000 Mark werden der gewinnenden Firma zugesagt. Die näheren Einzelheiten sind folgende: 1. Pferdestärken: 90—200 PS. 2. Zahl der Zylinder: müssen mehr als 4 sein. 3. Gewicht per P.S.: kalkuliert für 6 Stunden Betriebszeit, darf 6 kg nicht übersteigen. 4. Form des Motors: muß so konstruiert sein, daß er leicht in ein Flugzeug eingebaut werden kann. 5. Der Motor selbst muß aus ganz englischem Material verfertigt und in den Vereinigten Königreichen hergestellt worden sein. Dädalus, London. 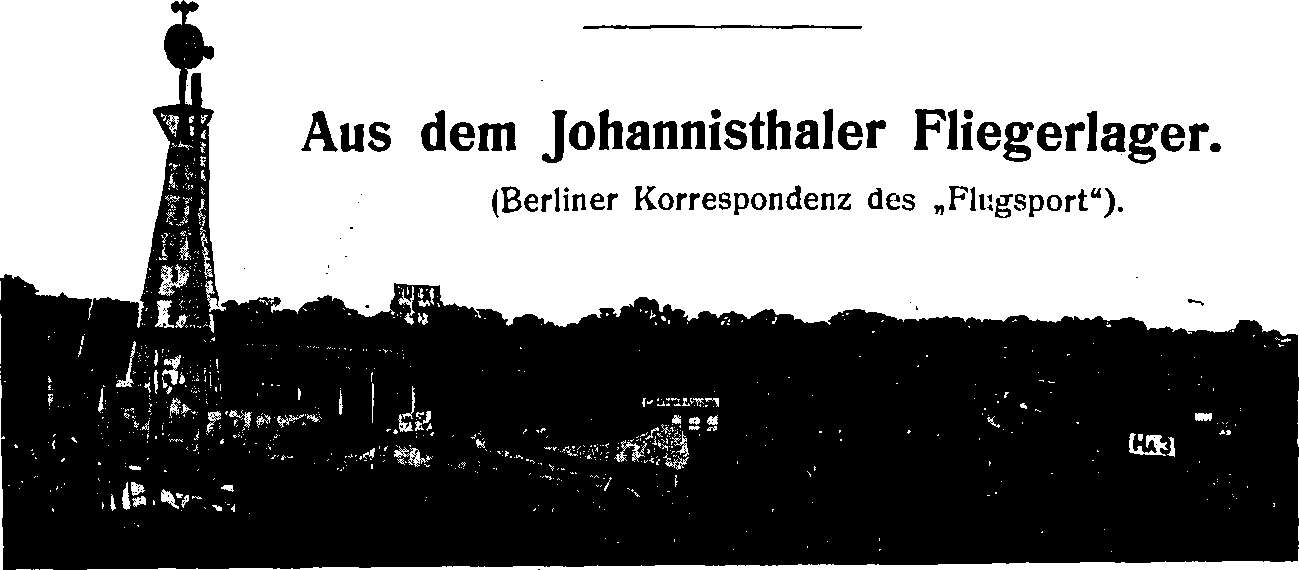 Der Besuch französischer Flieger auf dem Flugplatz in Johannisthal hat anspornend auch auf unsere deutschen Flieger gewirkt. Mit kolossalem Eifer wurden erfolgreiche Ueberlandflüge ausgeführt, um womöglich die Leistungen der französischen Flieger zu schlagen. Daß wir es auch können, haben die letzten großen Flüge gezeigt, wobei besonders der Flug Köln—Königsberg in einem Tage zu erwähnen ist, den Lt. J o 1 y mit Hauptmann Osius als Fluggast auf einer Rumpler-Taube ausführte. Der Offiziersflieger stieg morgens in Köln auf, flog ununterbrochen bis Beilin, wo er dann auf dem Flugplatz Johannisthal gegen Mittag eintraf. Nach kurzer Rast erfolgte der "Weiterflug nach Königsberg. Um 3 Uhr 30 bereits landete Joly an seinem Ziel und es ist schade, daß der Flug nicht weiter geführt werden konnte, da Joly als Offizier die russische Grenze nicht überfliegen darf. "Wenn es ein Zivil-Flieger gewesen wäre, hätte man sicher auf eine noch größere Leistung rechnen können, vielleicht hätten wir dann den Weltrekord im Ueberlandflug in der Graden in einem Tage besessen. Am 27. Juli trat Lt Joly den Rüokflug nach Köln wieder an und legte auch diese Strecke anstandslos zurück. Einen größeren Ueberlandflug, der eine Zeitlang als Rekord für Zivilflieger für die größte Leistung an einem Tage galt, stellte Reichelt auf einem Harlan-Eindecker auf. Er war um 4 Uhr morgens in Kiel gestartet mit der Absicht, sich um die dreitausend Mark Rente von der National-Flugspende zu bewerben. Sie ist für denjenigen Flieger ausgesetzt, der innerhalb 24 Stunden den größten Ueberlandflug erzielt, mindestens aber 500 km zurücklegt. Kurz vor 1 Uhr traf er in Johannisthal ein. Um 5 Uhr stieg er trotz der ungünstigen Witterung wieder auf und landete gegen 7 Uhr abends in Posen, nachdem er 560 km zurückgelegt hatte.  Lt. Joly mit liauptm. Osius vom Großen Oeneralstab als Fluggast auf Rumpler-Taube während des Fluges von Köln über Berlin nach Königsberg und zurüdi. Diese Leistung wurde jedoch von dem Ago-Flieger Schüler übertreffen, der vor einigen Tagen von Berlin nach Wien flog und sich dadurch in den Besitz der Rente aus der National-Flugspende setzte. Schüler benutzte einen Ago-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor. Am 25. Juli startete Helmut Hirth zum Flug Berlin—Mannheim auf einer Albatrostaube mit 100 PS 4 Zyl.-Benz-Motor, der im Frühjahr im Kaiserpreis-Motoren-Wettbewerb mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden war. Der Start erfolgte 3 Uhr 50 morgens und um 8 Uhr 50 hatte Hirth nach fünfstündigem Flug sein Ziel erreicht. Am gleichen- Tage flog Laitsch auf L. V. Gr.-Doppeldecker mit 100 PS Mercedes-Motor von Johannisthal nach Posen. Eine Strecke von 230 km, die ohne jeglichen Zwischenfall in bester Weise absolviert wurde. Es ist zu hoffen, daß wir in nächster Zeit auch größere Leistungen zu verzeichnen haben, um endlich auch einmal in den Besitz eines Weltrekordes im Distanz-Flug zu kommen. Die Witterungen, bei denen die Flüge ausgeführt wurden, waren nicht'sehr günstig und es hat sich gezeigt, daß unsere Flieger und unsere Apparate wohl imstande sind, an derartigen Flügen erfolgreich teilzunehmen. Flug Berlin—Mannheim. Hirth auf Albatros- Taube mit Benz-Motor nach der Landung vor der Benz'sdien Fabrik.  Unfall Brooks. Zum ersten Passagierflug Berlin - Paris startete am 27. Juli der französische Flieger L et ort, der am 13. Juli ohne Zwischenlandung von Paris nach Berlin geflogen war. Die bekannte russische Fliegerin Galanschikoff begleitete Letort auf seinem Fernflug. Am ersten Tage gelangten sie bis Hannover, am zweiten Tage bis Köln. 60 km vor Paris mußte Letort wegen Benzinmangels eine Zwischenlandung unternehmen, wobei der Apparat bei der Landung auf dem schlechten Boden beschädigt wurde. Leider hat sich in der letzten Zeit auch wieder ein schwerer Unglücksfall zugetragen, wie er bis jetzt in Johannisthal noch nie vorgekommen ist. Am 3. August abends gegen 8 Uhr flog der Flugschüler Brooks auf einer Jeannin-Stahltaube, um sein Fliegerzeugnis zu erwerben. Aus unbekannten Gründen hatte jedoch der Flieger den Motor so stark gedrosselt, daß der Apparat kolossal hängend durch die Luft zog. In der Nähe der Schuppen am neuen Startplatz traf der Apparat mit dem rechten Flügel den dort aufgestellten 8 m hohen Mast, auf dem sich der Windmesser befindet. Eine Katastrophe schien unvermeidlich. Mit furchtbarem Krach stürzte der Pylon und auch der Apparat zur Erde. Im nächsten Moment schlug eine hohe Feuersäule aus den Trümmern und schien den unglücklichen Flieger zu umschlingen. Im allerhöchsten Gefahrmoment sprang der Fluglehrer Rosenfeld hinzu und zog mit Hilfe eines Monteurs den am Unterleib schwer verletzten Brooks aus dem Flammenmeer. Im Krankenhaus Britz erlag der Unglückliche seinen schweren Verletzungen. In dem Moment, als der Pylon umschlug und den auf der Startbahn stehenden Harlan-Eindecker mit dem Flieger Roth am Steuer zu erschlagen drohte, gab der Flieger im letzten Augenblick Vollgas und entrann so einem zweiten Unglücksfall. Es muß hier die Frage angeschnitten werden, ob man an gleicher Stelle den Aufbau des Windmessers wieder vornehmen soll. Derartige Gebäulichkeften bieten immer einen Gefahrmoment für die Flieger und ebenso für diejenigen, die nicht in allzugroßer Höhe um ihr Fliegerzeugnis fliegen. Sicherlich findet sich an einer anderen Stelle des Platzes ein günstiger Aufstellungsort, wo eine Gefahr für die Flieger nicht vorliegt. -er Der Moräne Saulnier-Eindecker 1913. (Hierzu Tafel XXI.) Der bei den großen Ueberlandflügen von Brindejonc des Moulinais, Letort, Audemars u. s. w. verwendete Moräne Saulnier-Eindecker verdient in Nachstehendem ausführlicher beschrieben zu werden. Gegenüber der Type von 1912 (siehe Flugsport Nr. 10, Seite 374, Jahrg. 1912) zeigt Typ 1913 einige Veränderungen. Die Tragflächen verjüngen sich trapezartig nach hinten, sind auf einen Einfallswinkel von 10 Grad eingestellt und haben 16 (]m Flächeninhalt. Das Profil erinnert stark an die Ausführungsform von Bleriot. Die größte Pfeilhöhe des Profiles befindet sich im ersten Fünftel der Trag- 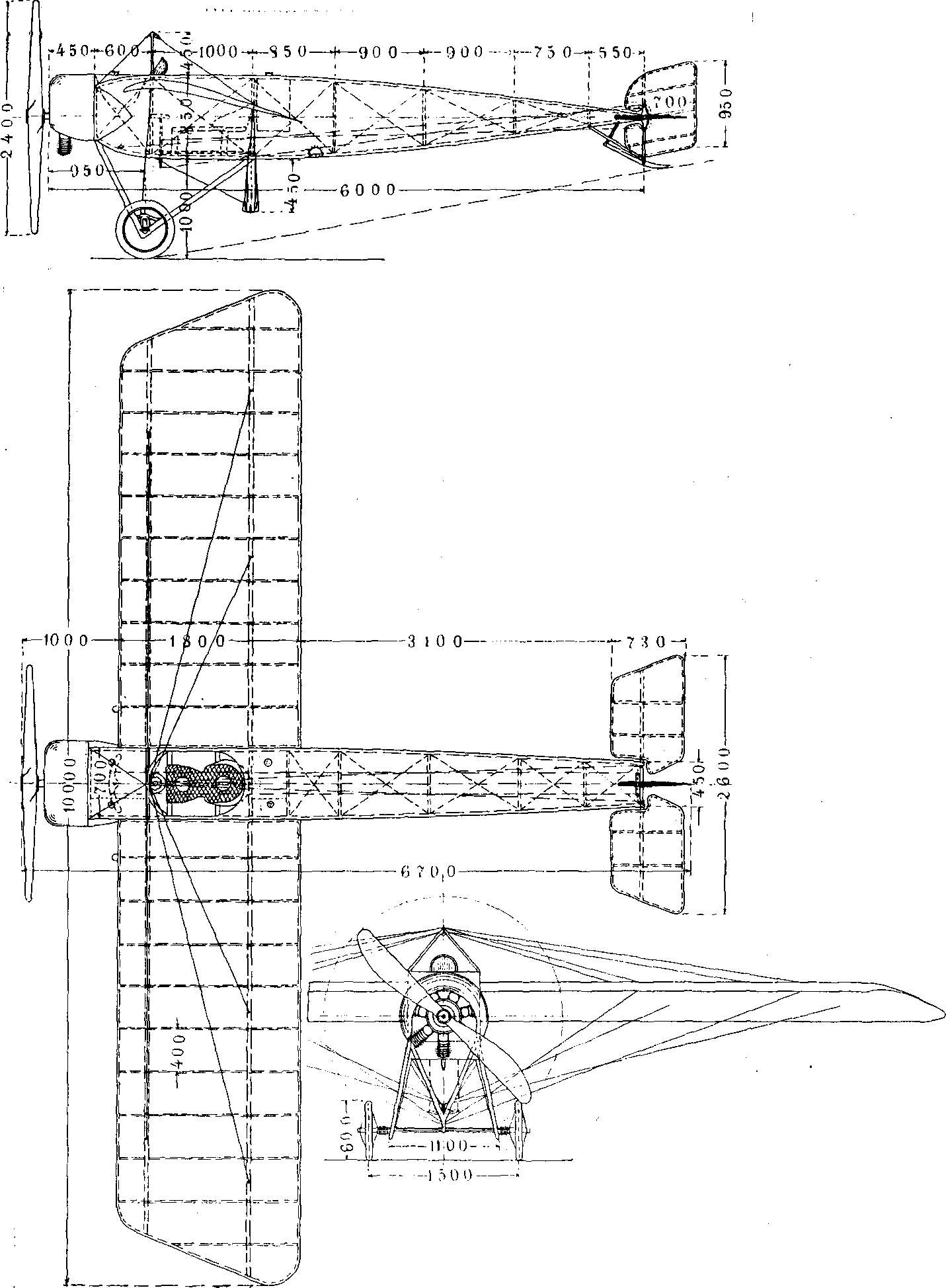 Nachbildung verboten. „Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten u. Flugtechn. Vereine 1913. Eindecker Moräne Saulnier. Tafel xxi. flächentiefe. Die Tragflächenverspannung besteht aus Stahlkabeln von 6 mm Durchmesser. Der Motorrumpf hat viereckigen Querschnitt Vorn auf fliegender Welle ist der teilweise eingekapselte 80 PS. Rhöne-Motor eingebaut. Derselbe zeichnet sich gegenüber dem früher angewendeten Gnom-Motor durch einen ökonomischeren Betriebsmittelverbrauch aus. Auf der Schraubenwelle sitzt eine Integralschraube von 2,4 m Durchmesser. In der Mitte des Rumpfes befindet sich ein Doppelsitz, der als Reitsitz für den Fluggast ausgebildet ist. Vor und hinter den Sitzen befinden sich zwei Betriebsstoffbehälter, die mit Unterteilungen für Benzin und Oel versehen sind. Um die Schutzbrille für den Flugzeugführer überflüssig zu machen, ist ein halbkreisförmiger Windschirm aus Emaillit angebracht. Auf dem Rumpfe befindet sich ein dachreiterartiger Verspannungsmast, welcher nach Lösen der oberen Flügelverspannung oder seiner vorderen Fangdrähte zur Erleichterung des Transportes niedergelegt werden kann. Von den Sitzen ab verjüngt sich der Rumpf in der Seitenansicht bis zur Schwanzfläche. Die am Modell 1912 vorhandene einstellbare Dämpfungsfläche ist weggefallen Dafür ist das Höhensteuer auf 1,5 qm Flächeninhalt erhöht worden. Das 0,6 qm große Seitensteuer greift ein wenig über das verjüngte Rumpfende hinweg, und ist zwischen dem geteilten Höhensteuer angebracht. Das Gestell sämtlicher Steuerflächen besteht aus autogen geschweißtem Stahlrohrrahmen. Eine vierseitige Stahlrohr-Pyramide und eine abgefederte Schleifkufe schützen die gesamte Steuereinrichtung. Das Fahrgestell ist gegenüber den früheren Ausführungen mit einer abgefederten geteilten Radachse versehen, welche mittels Gummischnurumwicklung in ihrer Lagerstätte festgehalten wird. Dieselbe kann in dem angeschweißten Führungsschlitz 10 cm durchfedern. Die Verwindungs-hebel und Verwindungsrollenanordnung ist bereits in „Flugsport" Nr. 18, Seite 443 eingehend behandelt werden. Die Steuerung ist die gleiche wie früher (siehe „Flugsport" Nr. 10, Jahrgang 1912, Seite 378.) Das Gewicht der Maschine beträgt leer 310 kg und die Geschwindigkeit 150 km pro Stunde. Konstruktive Einzelheiten. Die Schwimmeranordnung des Maurice Farman-Doppeldeckers (Monaco-Typ 1913) ist aus Abb. 1 zu ersehen. Ueber die Hauptschwimmer sind zwei Stahlrohre gelegt, die mittels runder Gummiringe an dem Untergestell der Maschine elastisch aufgehängt sind. Die Schwimmer laufen vorn abgestumpft ogival zu. Ihre Länge beträgt 3,9 m, ihre Breite 1,3 m und die Höhe 0,5 m. Zur Unterstützung der Schwanzzelle ist nur ein Stützschwimmer angeordnet. Seine Länge beträgt 1,7 m, seine Breite 0,4 m und seine Höhe 0,2 m. Alles nähere ist aus der Abb. zu ersehen. Eine ähnliche Schwimmeranordnung ist aus Abb. 2 ersichtlich, wie sie beim englischen Lakes-Wasser-Zweidecker angewandt wird. Die Abfederung erfolgt durch Vierkant-Gummiringe, die ähnlich wie bei der bekannten Radachsenabfederung der Landmaschi nen 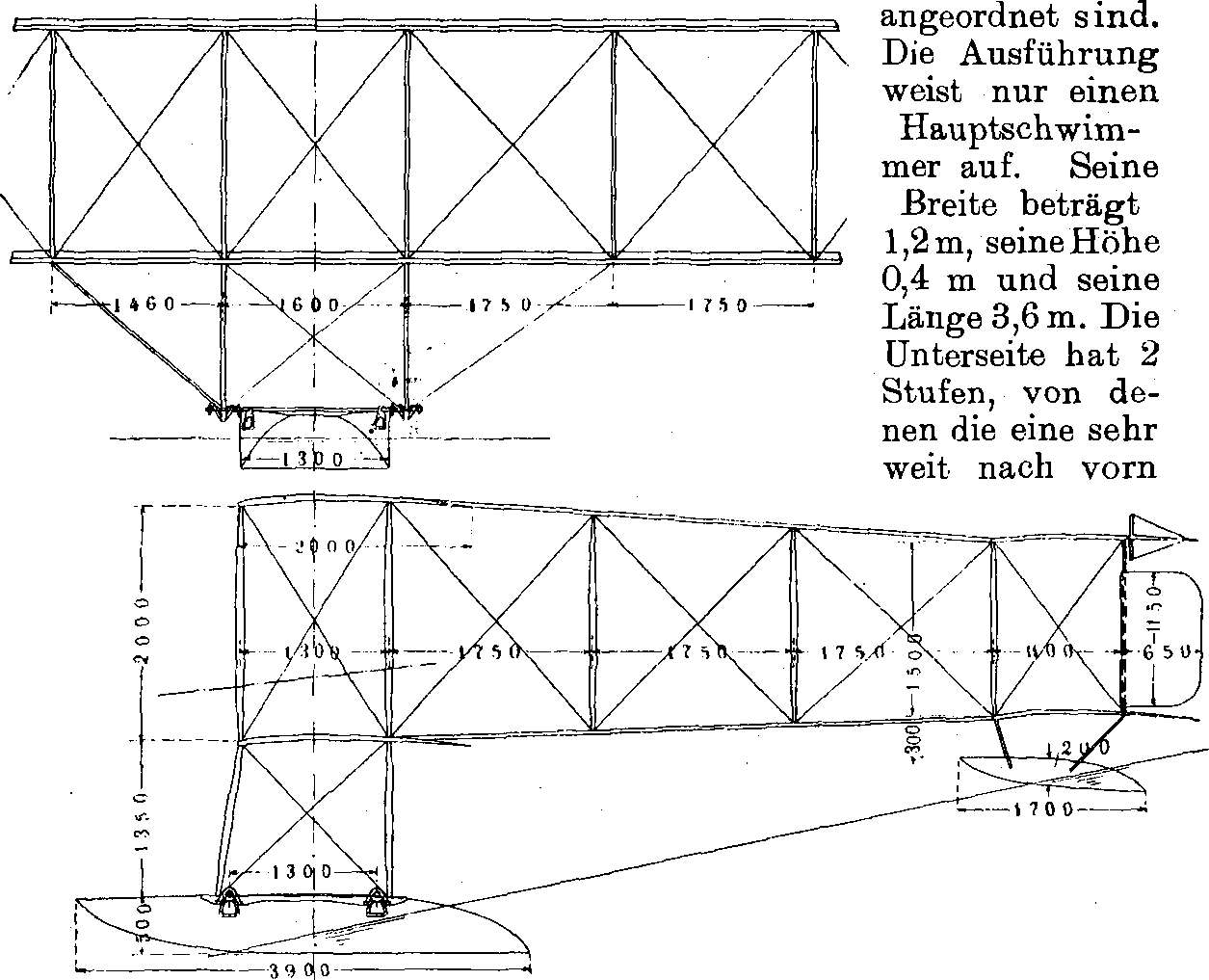 Abb. 1. Schwimmeranordnung des Maurice Farman-Doppeldeckers (Monaco-Typ 1913). gerückt ist. Zur Unterstützung des Schwanzes und der Tragflächenenden sind auf einem Holzrost aufgeschnallte pneumatische Stützschwimmer aus Gummistoff vorgesehen. Die Verwindungshebelanordnung des Borel-Wasser-Eindeckers ist in Abb. 3 dargestellt. Das innerste Verspannungsorgan läuft über eine lose Rolle, während die äußeren in einen Rollenkäfig laufen. Derselbe ist in der Querschnittszeichnung besonders dargestellt. Bemerkenswert und einfach ist die Seilführung im Rollenkäfig. Der Rollenrand ist zwischen 2 Laufrillen unterbrochen. Durch die entstandene Lücke wird das Seil hindurchgeführt und klemmt sich beim Anziehen selbsttätig fest, sodaß Seilbügel und ähnliche Befestigungsvorrichtungen, überflüssig werden. Die Ränder an der Durchbruchsstelle sind sorgfältig abgerundet, um ein Einschneiden bezw. Durchscheuern des Seiles zu verhindern. Rollenkäfig und Verwindungshebel sind fest miteinander verbunden. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Parturiunt montes nascetur ridiculus mus .... Seit langen Wochen haben die Berge gekreist, in geheimnisvollem Flüstertone hat man es sich in die Ohren erzählt, daß „etwas im Gange ist", endlich sollte für den internationalen Luftverkehr die verheißungsvolle Morgenröte anbrechen, und nun ist's raus, das deutsch-französische Luftabkommen welches dazu bestimmt ist, den Luftverkehr zwischen den beiden Ländern zu regeln, .... bis etwas besseres, nämlich das internationale Luftreglement, zustande gekommen sein wird. Viel neues und wichtiges enthä t das „Abkommen" wirklich nicht, und sein ganzer Wert wird außerdem noch durch den vielsagenden Zusatz in Frage gestellt, daß die beiden Staaten berechtigt sind, die „im Interesse der Sicherheit des Landes notwendigen Aenderungen" vorzunehmen, die allerdings die beiden kontrahierenden Staaten sich gegenseitig mitzuteilen verpflichtet sind. Das ist sehr schön und gut, doch will es scheinen, daß bei der Festsetzung der fraglichen Bestimmungen auf beiden Seiten ein Fachmann des Flugwesens nicht hinzugezogen worden ist. Was soll es zum Beispiel bedeuten, daß die an Bord eines Luftfahrzeugs befindlichen Flieger, sofern jenes im Gebiete des anderen Landes zur Erde kommt, gehalten sein sollen, ihre Flieger-Qualifikation zu erweisen ? Auch die Bestimmung, daß bei einor Notlandung auf fremdem Gebiete die „nächstzuständigen Militärbehörden1 prüfen und entscheiden sollen, ob die Landung durch „force majeure" verursacht worden ist, erscheint viel zu dehnbar, als daß sie für die mit ihren Apparaten ins Ausland verschlagenen Flieger die geringste Garantie bietet, zumal wenn dieses Ausland sieh Frankreich nennt, wo derartige Entscheidungen von der bei allen „zuständigen Militärautoritäten" mehr oder weniger stark entwickelten chauvinistischen Hetzstimmung abhängen. Die Frage hat ja ihre Bedeutung, umsomehr, als die Land-zu-Land-Flüge immer häufiger werden. Jetzt ist nun auch Letort von seinem Berliner Ausfluge heimgekehrt, nachdem er auf der Rückreise infolge starken Regenwetters in Hannover gelandet und zurückgeblieben war. Allerdings kam er nicht nach Paris zurück, sondern er landete in Bray-sur-Seine, aber die Entfernung von Berlin nach Bray ist die gleiche wie diejenige von Berlin nach Paris. Bei der Landung ist übrigens infolge eines heftigen Windstoßes das Flugzeug, ein Mornne-Eindecker, erheblich beschädigt worden; Letort aber und seine russische Begleiterin blieben unversehrt. Letort weiß nicht genug von der liebenswürdigen Aufnahme zu erzählen, die er bei den deutschen Fliegern gehabt habe. Hoffentlich revanchieren sich die Franzosen in allen ähnlichen Fällen. Ueber den letzten Teil des denkwürdigen Fluges ist kurz noch folgendes nachzutragen: Letort flog am ver^ gangenen Donnerstag von Hannover ab und kam bis nach Köln, wo er wieder wegen schlechten Wetters bleiben mußte. Am Sonnabend entschloß er sich zum Weiterflug, obgleich ihm die Offiziere von der Station Köln angesichts des nebligen Wetters davon abrieten. Um 11 Uhr 50 ging Letort von Köln ab und passierte in niedriger Flug- höhe (stellenweise kaum 20 Meter) über den Schwarzwald dahin. Nach Ueberschreitung der Grenze bei Mezieres begegnete der Flieger heftigen Windwirbeln, die ihn zwangen, eine Höhe von 1000 m aufzusuchen, bis er schließlich infolge BenzinmangeJs in Bray landete, ohne, wie er wollte, Villacoublay erreichen zu können. 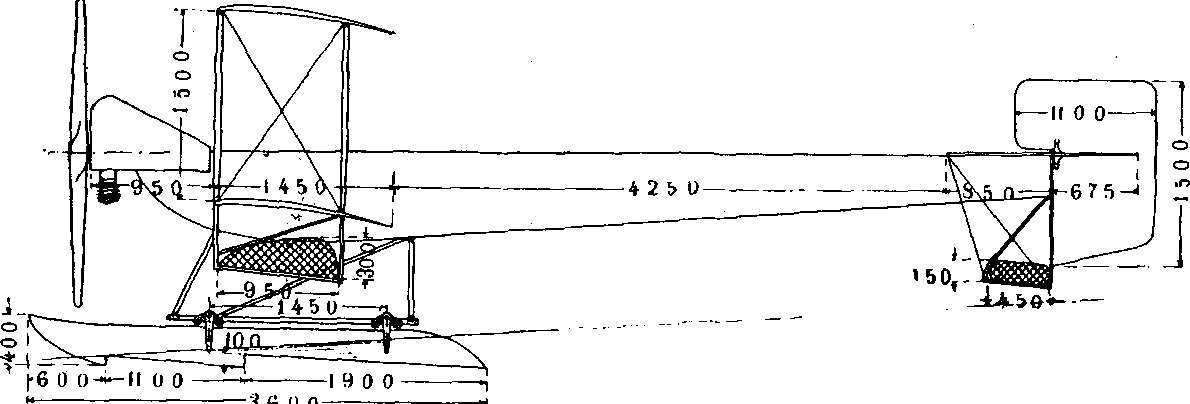
Abb. 2. Schwimmeranordnung des Lakes-Wasser-Zweideckers. (S. ü/7.) 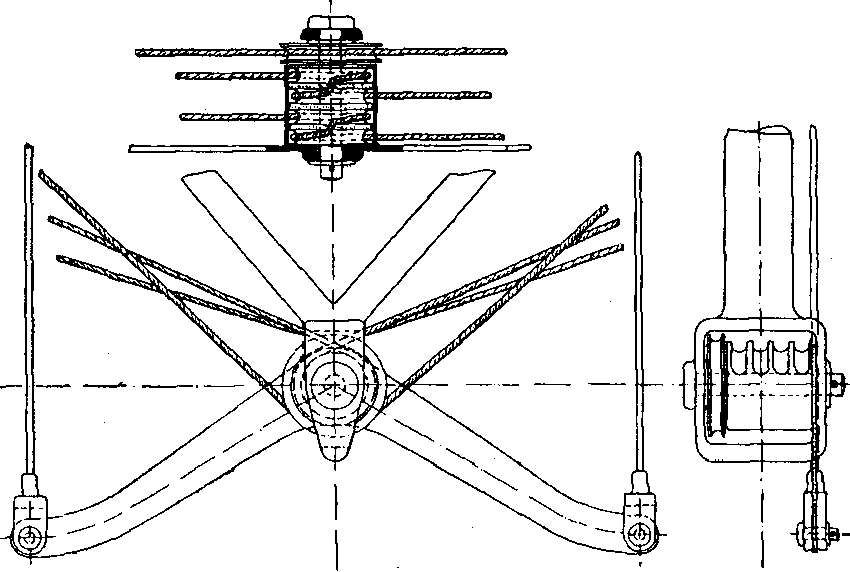 Abb. 3. Die Verwindungshebelanordnung des Borel-Wasser-Eindeckers. (S. 577.) Interessant gestaltete sich auch Oskar Biders Rückflug über die Alpen von Mailand nach Basel, wobei er 3 Uhr 30 früh von Mailand abflog und den Monte Salvatore bei Lugano übersetzte. Von Olivone aus wandte sich Bider, da das Gotthardmassiv in dichtem Nebel lag, über den Lukmanier ins Niederrheinthal. Dann flog er über den Kreuzlipaß und von dort, scharf nach Westen abschwenkend, bei Amsteg über das Reußthal, dem er bis Flüelen folgte, um schließlieh über Luzern und Triengen nach Liesthal, im Canton Basel-Land, zu gelangen, wo er infolge Benzinmangels landete. Nachdem er sich verproviantiert hatte, legte er dann den Rest der Reise ohne Unfall zurück und landete inmitten einer großen Menschenmenge, die ihn jubelnd umdrängte, auf der Schützenmatte bei Basel. Für die 275 km lange Strecke hat Bider, einschließ lieh der Zwischenlandung in Liesthal, 3 Stunden 45 Minuten gebraucht. Er durchmaß diese Entfernung in 3000 m Flughöhe. Damit sind die Alpen zum vierten Male überquert worden: 23. September 1910 von Brig nach Domodossola, durch Chavez 25. Januar 1913, von Brig nach Domodossola, durch Bielovucie 13 Juli 1913, von Bern nach Mailand, in 3:34, durch Oskar Bider 26. Juli 1913, von Mailand nach Basel, in 3:45, Oskar Bider Einen gelungenen Verlauf nahm das in dem vorigen Berichte angekündigte Fliegermatch Brindejonc des Moulinais gegen Audemars und Guillaux, das am letzten Sonntag, wiederum in Juvisy und wiederum vor einer dichten Menge, vor sich ging und zu dem sieh diesmal auffällig viele offizielle Persönlichkeiten eingefunden hatten. Der erste Gang spielte sich zwischen Audemars und Guillaux ab. Es war sofort ersichtlich, daß Audemars der schnellere war, Guillaux versuchte vergeblich, gegen seinen Rivalen anzukommen. Audemars legte die 20 km in 10:46-3 zurück, zwei Bahnrunden vor Guillaux. Im zweiten Gang siegte Brindejonc des Moulinais mit 10:16-3, Guillaux zwei Runden zurück. Der dritte Gang vereinigte die beiden Sieger der Vorläufe: Audemars und Brindejonc. Der Kampf war ein heißer und leidenschaftlicher, das Publikum zitterte vor Spannung. Das Resultat war der Sieg Audemars' in 10:48-4, vor Brindejonc (10:51). Offenbar ging dieses Resultat den Veranstaltern, die gar zu gern einen Sieg des gefeierten Brindejonc gesehen hätten, gegen den Strich, denri es wurde ein vierter Gang angekündigt, für den nach Lage der Dinge nicht der geringste Anlaß vorlag. Und diesmal gelang es Brindejonc, seinen Gegner mit 10:16-2 gegen 10:35-4 zu schlagen. Der „Gerechtigkeit" war Genüge geschehen. Uebrigens ist Brindejonc am Tage darauf nach Nantes gegangen, wo er mit Schauflügen große Triumphe feierte. Weniger glücklich waren einige seiner Kollegen Vedrines, der „große Vedrines", dem nichts mehr gelingen will, war von Paris nach Limoux abgeflogen, wurde aber unterwegs, in Langoiran in der Nähe von Bordeaux, von einem Unfall ereilt. Als in seinem Benzinreservoir eine Explosin erfolgte, wollte Vedrines landen, dabei schlug sein Eindecker um und der Flieger wurde im Gesicht und an der Hüfte ziemlich erheblich verletzt. Salmet, der von Buc aus am letzten Donnerstag abflog, war bis nach Rouen gelangt, von wo er bis Le Crotoy weiterflog. Als er sich von dort meereinwärts wandte und etwa 4 km in See war, blieb plötzlich sein Motor stehen und der Flieger stürzte mit seinem Apparat in die brausenden Wogen, aus denen er durch einen glücklichen" Zufall durch in der Nähe befindliche Fischerboote gerettet werden konnte. Noch tragischer verlief ein Unfall, der dem bekannten Flieger Chambenois das Leben kostete. Er startete zu Auterive gelegentlich eines dortigen Festes und stürzte aus beträchtlicher Höhe ab. wobei er seinen sofortigen Tod fand. Mit Chambenois verschwindet eine der sympatischsten Figuren aus dem französischen Flugwesen. Viel besprochen wird das Projekt eines Rundfluges durch Frankreich, den Henri Sergeant, der ehemalige Santos Dumont-Flieger auf einem Caudron-Zweidecker zu unternehmen gedenkt und für den er ein Komite interessiert hat, welches die erforderliche Vorarbeit und .....Reklame für ihn weidlich besorgt. Mit besonderem Interesse sieht man hier den beiden letzten Perioden des Michelin-Luftzielscheiben-Preises entgegen, die auf die Zeit vom 10. bis 17. August und vom 7. bis 14. September festgesetzt worden sind. Der Aero-Klub de France hatte an das Kriegsministerium den Antrag gerichtet, mit Rücksicht auf die wertvollen Lehren, welche gerade dieser Preis für die Heeresverwaltung haben müsse, den aktiven Offizieren die Beteiligung am Luftzielscheiben-Preis zu gestatten. Das Kriegsministerium ist diesem Ersuchen nachgekommen, sodaß der Schlußkampf um diesen Preis eine veränderte Gestalt bekommen dürfte. Man hat die Flugfelder von Buc, Etampes, Chartres, Chälons, Croix d'Hins, La Vidamee für diese Experimente bestimmt. Eine interessante Flugleistung vollbrachte im Laufe dieser Woche der Flieger Cavelier um den Michelin-Pokal. Cavelier, welcher einen Deperdussin-Eindecker, 80 PS Gnom-Motor steuert, begann seinen Flug am letzten Dienstag. Bekanntlich fällt der Michelin-Pokal endgiltig demjenigen zu, welcher bis zum 1. Januar 1914 die größte Entfernung in geschlossener Rundstrecke, mit einer Mindestleistung von 2000 Kilometern, zurückgelegt haben wird. Diese Entfernung wird aus den Einzeldistanzen zusammengerechnet, welche an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen zu fliegen sind, vorausgesetzt, daß an jedem Tage, zwischen Sonnenaufgang und -Untergang, der Flieger eine Geschwindigkeit von mehr als 50 km die Stunde realisiert. Der erste Versuch Marcel Caveliers war, wie erinnerlich, mißlungen: er mußte bei 2000 km wegen schlechter Witterung aufgeben. Am Dienstag nun begann Cavelier auf der Bahn zu Etampes seine Runden, und zwar auf der Strecke Etampes-Gidy-Etampes, die ein Ausmaß von 1125 km hat. Am ersten Tage durchmaß er die Strecke achtmal, legte also 900,400 km zurück. Am Mittwoch brachte er es auf insgesamt 1915 km. Am Donnerstag hatte er bereits 2590,720 km hinter sich gebracht. Unermüdlich setzte Cavelier seine Runden fort, am Freitag flog er weitere 788,480 km und am Sonnabend sogar 901,480 km, sodaß er bis zu diesem Augenblick insgesamt 4280,420 km hinter sich gebracht hat! Aber noch ist Cavelier nicht zu Ende, er scheint sich definitiv zum Sieger des Michelin-Pokals machen zu wollen Mit großer Spannung verfolgt man den Flug von Paris nach Casablanca, den Gilbert am Sonnabend früh von Villaooublay aus auf einem Morane-Eindecker angetreten hat. Bei scharfem Nordwestwind flog Gilbert um 4:44 Uhr auf seinem Eindecker, dem er einen 60 PS Rhone-Motor gegeben hat, in der Richtung nach Spanien. Er hatte die Absicht, sich in einem Zuge bis nach Vittoria zu begeben und dann sich nach der marokkanischen Küste zu wenden. Zu diesem Zwecke hatte er 200 Liter Benzin und 30 Liter Oel an Bord genommen. Außerdem hatte er vorsichtshalber eine Reservekanne Benzin und auch eine Kanne Oel noch mitgenommen. Um 11:45 Uhr landete Gilbert in Vittoria. Bis Bordeaux ging die Reise in normaler Weise vor sich, aber von dort bis Tolosa hatte Gilbert mit starkem Gegenwind zu kämpfen, der sein Vorankommen hinderte. Er passierte die Pyrenäen in 2000 m Höhe und langte so, stark ermüdet, in Vittoria an. In 20 Minuten war die Neuverproviantierung vorgenommen, worauf Gilbert um 1 Uhr wieder abflog. Er wandte sich nach Huelva, im Süden Spaniens, erreichte aber nur Caceres, 1165 km von Paris, wo er, wie die Nachttelegramme besagen, gelandet ist. Nach anderen Meldungen sollen zuverlässige Nachrichten über den Verbleib des Fliegers nicht vorliegen, sodaß man gewisse Befürchtungen hegt. Guillaux will übrigens am heutigen Sonntag starten und seinen Kamerad Gilbert suchen. Einige neue Rekords sind aus der internationalen Flugwelt zu melden: nachdem dieser Tage der englische Flieger Hawkes den bisher von Thelen innegehabten Welt-Höhenrekord mit drei Passagieren mit 2595 Metern (Thelen hatte am 23. Juni 1913 2150 Meter erreicht) geschlagen hatte, kommt soeben die Kunde von einem neuen Welt-Distanzrekord mit drei Passagieren, den am Sonnabend, den 2. August, der Italiener Cevasco auf einem italienischen Eindecker aufgestellt hat, indem er, mit drei Passagieren an Bord, vom Plugplatze zu Toliedo in 2 Stunden 45 Minuten nach Venedig flog, eine Distanz von 260 km. Und endlich ist noch ein Weltdauerrekord mit sieben Passagieren zu konstatieren, den der bekannte Russe Sikorsky auf seinem in der No. 15 des „Flugsport" beschriebenen Riesen-Eindecker am 2. August aufstellte, indem er, mit sieben Passagieren an Bord, in 1 Stunde 54 Minuten eine Distanz von 84 Werst, das sind also 89,544 km, zurücklegte. Bisher hatte nur ein einzige* Flieger, nämlich der Deutsche Faller, sieben Passagiere an Bord eines Flugzeugs mitgenommen. Faller flog aber damals, am 5. Januar 1913, nur während 21 Minuten, und der Flug hatte auch nicht die offizielle Homologierung gefunden. Auch aus dem französischen Militärflugwesen sind interessante Vorgänge zu berichten. Zunächst sind mehrere Flugterrains unter großen Feierlichkeiten eröffnet worden, so die Flugfelder von Beaumarais, Brienne, Valeneiennes, Vitry-le-Francois, bei denen das Kriegsministerium sich durch den Obersten Bouttieaux vertreten ließ Ein weiteres Flugfeld in Longwy, mit Fliegerhallen für sechs Eindecker, wird dieser Tage eingeweiht werden. Ein be« kannter Militärflieger, der Hauptmann Bares, vollbrachte, mit seinem Mechaniker an Bord, auf einem Maurice Farman-Eindecker dieser Tage, und zwar vom 1. bis 5. Juli, eine Reihe interessanter und viel besprochner Rekognozierungsflüge über insgesamt mehr als 2000 km. Dieser Tage wurden andauernd offizielle Versuche mit der drahtlosen Telegraphie im Flugzeug unternommen, die vom General Delarue geleitet wurden. Es handelte sich darum, die Wirkungsweite der drahtlosen Telegraphie, sowie die zweckmäßigste Art festzustellen, wie die Apparate auf dem Flugzeug zu installieren sind. Bei diesen Versuchen, bei denen ein Deperdussin-Eindecker benutzt wurde, sind interessante Resultate erzielt worden. 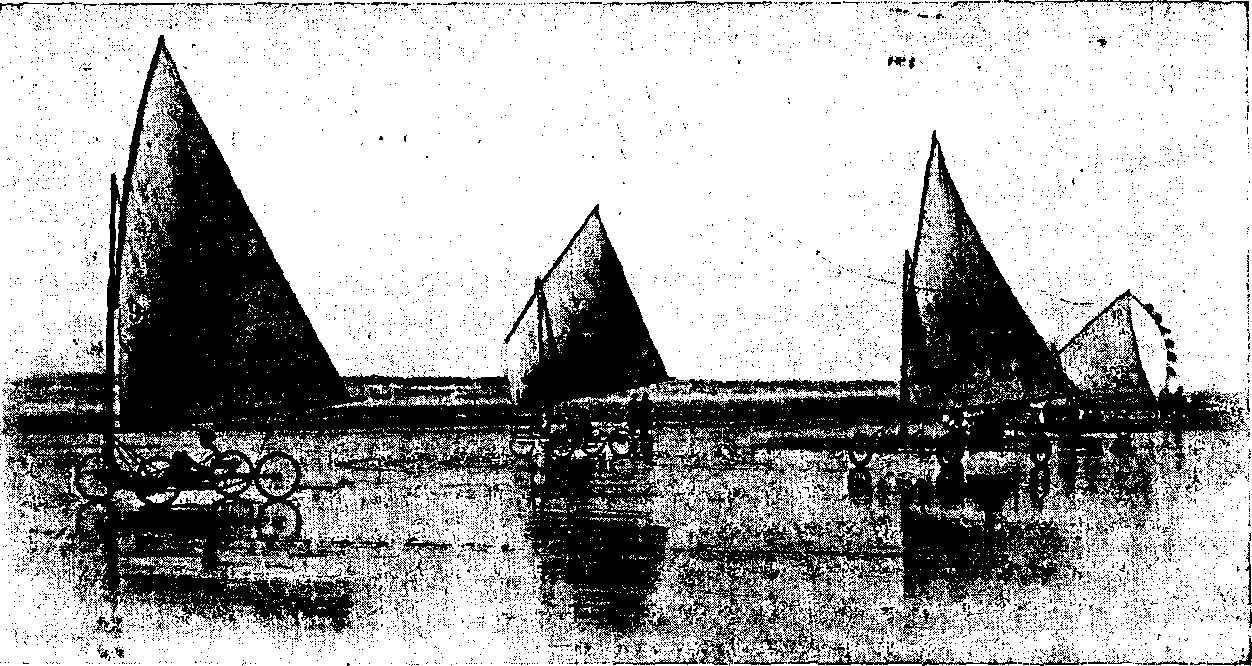 Segelwagen (Aeroplages) während des Rennens von tiardelot (Frankreich) Im Hintergrund das Meer. (S. 584.) Das von Buc abgehende Flugzeug konnte während seiner ganzen Reise bis Orleans bequem mit Buc und mit Villacoublay sich verständigen, also bis zu 100 km Entfernung. Am letzten Mittwoch wurde das Experiment auf 130 km wiederholt, wiederum mit bestem Erfolge. Das französische Militärflugwesen hat einige beklagenswerte Unfälle zu verzeichnen: in Mourmelon stieg der Leutnant Gabriel, mit einem Sappeur an Bord, auf, um sich nach Bar-le-Duc zu begeben. Gleich beim Abflug schlug der Zweidecker um. Während Leutnant Gabriel nur leichte Verletzungen erlitt, wurde der Sappeur von dem Propeller erschlagen. Am selben Tage stürzte in Pau der Leutnant Binde, als er auf der dortigen Flugbahn eine Kurve beschrieb, aus 20 Meter Höhe ab und erlitt sehr schwere innere Verletzungen; der Apparat wurde zertrümmert. Schließlich sei noch daran erinnert, daß der 3. Kongreß des Internationalen Juristischen Komitees für das Flugwesen in Frankfurt a. M. stattfindet, und zwar in der Zeit vom 25. bis 27. September. Auf diesem Kongreß wird die Ausarbeitung eines Internationalen Luft-Codex fortgesetzt werden. Rl. Segelwagen-Rennen zu Hardelot. Die Franzosen nennen sie Aeroplage. Segelwagen wollen wir sie nennen. Dieser Segelwagen ist ein neues Sportinstrument, mit welchem in Frankreich in allerneuester Zeit sogar ein internationales Meeting zu Hardelot veranstaltet wurde. Ein solcher Segelwagen besteht aus einem leichten vierrädrigen Fahrgestell, dessen vordere Räder schwenkbar sind und auf dem ein großes Segel befestigt ist. Als Uebungsplatz dient der durch die Ebbe freigewordene spiegelglatte Sandstrand des Meeres. Da die landwärtigen "Winde in der Hauptsache vorherrschen, so repräsentiert ein solcher Sandstrand eine ausgezeichnete Rennstrecke. Für das Meeting von Hardelot waren 21 Segelwagen gemeldet. Die 13 km lange Rennstrecke wurde in 56 Minuten von dem schnellsten Segelwagen durchfahren. Müheloser Segelflug der Vögel. Vortrag von Baumeister Gustav Lilienthal, gehalten im Berliner Flugsport-Verein. Redner begann mit einem Rückblick auf seinen früheren Vortrag „Maschinenflug und Vogelflug" und hob noch einmal die geringe Anpassungsmöglichkeit des Maschinenflugzeuges hervor, gegenüber der Fähigkeit des Vogels, den wechselvollen Ansprüchen des Windes zu begegnen. Er betont, daß ein Segelflug, wie ihn die Vögel ausüben mit bewegungslosem Flügel für ein modernes Flugzeug wenig Aussicht auf Erfolg hat. Auch die Bemühungen der Gebrüder Wnght haben nur einen Gleitflug in einem Wind an ansteigendem Gelände ergeben, bei welchem die Windgeschwindigkeit in aufsteigender Richtung dem relativen Fall zur Luftströmung gleich war, so daß ein Stillstehen in der Luft möglich war. Es ist dies seinerzeit auch in dieser Zeitschrift hervorgehoben worden. Der Segelflug ist dagegen ein Vorwärtsfliegen nach beliebiger Richtung in einem horizontal wehenden Wind. Es wurden dann die verschiedenen Erklärungen für die Möglichkeit des Segelfluges angeführt. Aus den meisten dieser Erklärungen geht die Unzulänglichkeit derselben schon daraus hervor, daß das Profil der Flügel dabei gar nicht in Betracht kommt. Hierzu gehört unter anderem die von Dr. Nimführ vertretene Ansicht, daß ein Vogel beim Schweben auf ein Luftquantum wirke, welches auf einer Grundfläche von vielen tausend Quadratmetern die Erde berühre. Die Größe dieses Luftquantums, wenn ein Dutzend Albatrosse das Schiff umkreisen, läßt die Absurdität dieser Erklärung sofort verstehen. Um so mehr auch, als die Entstehung eines Vorwärtsfluges gegen den Wind überhaupt gar nicht dabei berührt wird, ebenso die Tatsache, daß der Albatros auf dem Wasser sitzend mit angehobenen Flügeln vom Wi d direkt angehoben und vorwärts getrieben wird. Es wird mit dieser Theorie dem Profil der Flügel gar keine Bedeutung beigemessen, so daß es gleichgültig erscheint, ob der Vogel mit Flügeln oder mit ebenen oder beliebig geformten Flächen den Segelflug ausübt. Alle Erklärungen, welche eine Kreis- oder Kurvenbahn beim Segelflug voraussetzen, sind als unbrauchbar zu verwerfen, weil die Segler ihren Flug nicht nur in Kurven, sondern auch in geraden Bahnen ausüben. Die ihr Revier absuchenden Raubvögel und Sumpfvögel kreisen, um sich nicht zu weit von ihrem Revier zu entfernen. Das Kreisen ist nicht Mittel zum Zweck, sondern Selbst-Zweck. Da der Vogel in ständiger Vorwärtsbewegung der Lutt sein muß, so bleibt ihm kein anderes Mittel, diese Vorwärtsbewegung in Kreis- oder Kurvenbahnen auszuführen. Möven und andere Seevögel, welche auf dem weiten Ozean ihrer Nahrung nachgehen, haben zum Kreisen weniger Veranlassung, obgleich sie auch dazu im Stande sind. Die Pulsationen in der Stärke des Windes oder die Turbulenz in der Höhenrichtung für die Erklärung des Segeins heranzuziehen, ist ebenfalls nicht erfolgreich, weil der Segelflug immer in möglichst gleichmäßig strömender Luft, also in hohen Lagen, erst zur Ausführung kommt. Der Vogel sucht erst durch den Ruderflug in d!e erforderliche Höhe zu gelangen. Die seiner Zeit von Otto Lilienthal ausgesprochene Ansicht bezüglich des Segelfluges lautet: „Die Eigenschaften der gewölbten Fläche reichen für die Erklärung des Segelfluges noch nicht aus, es muß noch ein anderer Faktor hinzutreten. Es muß ein Wind von genügender Stärke wehen, dessen aufsteigende Richtung dem Vogel eine Luftwiderstandskomponente gibt, welche es . ihm ermöglicht, wie ein Drache an der Schnur, aber seibat ohne Schnur in der Luft nicht nur zu stehen, sondern sogar darin vorwärtszutreiben.*) Gustav Lilienthal definiert die dem Wind zugeschriebene Wirkung etwas abweichend. Er sagt: „Die Eigenschaft des Windes, schwebende Körper nach oben zu treiben." Die Ursache hiervon erklärt er folgendermaßen: Aehnlich wie in einem Wasserlauf alle schwimmenden Körper nach der Mitte getrieben werden, weil dort die Geschwindigkeit des Stromes größer ist als an den Ufern, so werden alle in der Luft schwebenden Teile nach oben getrieben, weil dort die Geschwindigkeit des Ein Segelviagen. Windes zunimmt, vermöge Damont auf Dumont-Segelv/agen, der aus dem Rennen der Abnahme der Reibung von Mardelot siegreich hervorging. (S. 584.) an der Oberfläche. Un- fc x verständiger Weise hat man hiergegen eingewendet, daß die Luft nicht von oben nach unten in Erdnähe wehen kann, sie müßte dann aus der Erde heraus kommen. Dies ist aber durchaus nicht erforderlich, ebenso wenig als das Wasser in Mühlengerinnen nicht von den seitlichen Wandungen zuströmt, sondern vermöge der Reibung an Boden und Ufereinfassungen zurück gestaut, daher die Strömung nach der Oberfläche der Mitte abgelenkt wird. In gleicher *) Siehe „Vogelflug" R. Oldenburg, Verlag. 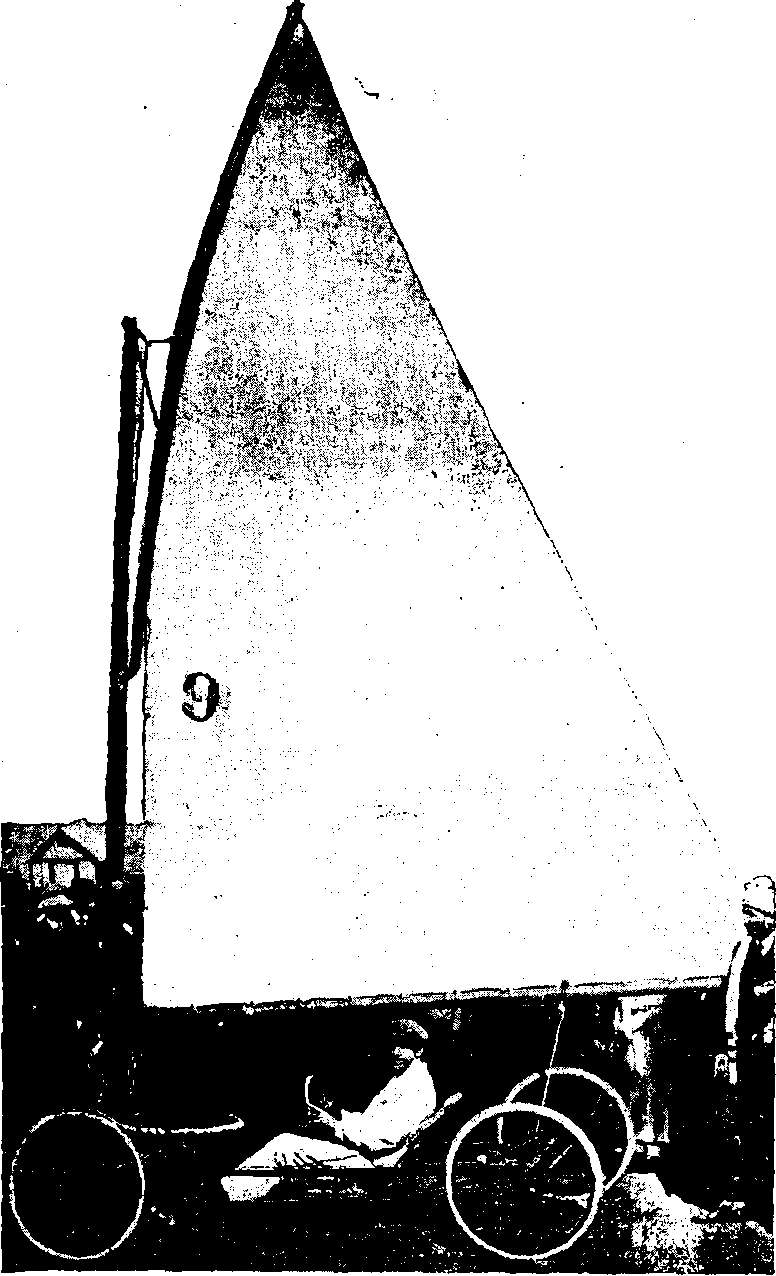 Weise wird der Wind vom Boden gestaut und so entsteht der Aufwäristrieb. Vor einigen Jahren hat man einen fast gleichen Auftrieb am Eiffelturm in 300 m Höhe während eines ganzen Jahres festgestellt und somit die früheren Versuche der Gebr. Lilienthal bestätigt. Es kann aber auch der Fall eintreten, daß in oberen Luftschichten eine Strömung von geringerer Geschwindigkeit als in einer unterliegenden Luftschicht vorhanden ist, verursacht durch meteorologische Einflüsse. In solchem Fall ändert sich der Auftrieb in einen Abwärtstrieb. Diese Erscheinung wird von den Fliegern und Ballonführern gelegentlich verspürt und 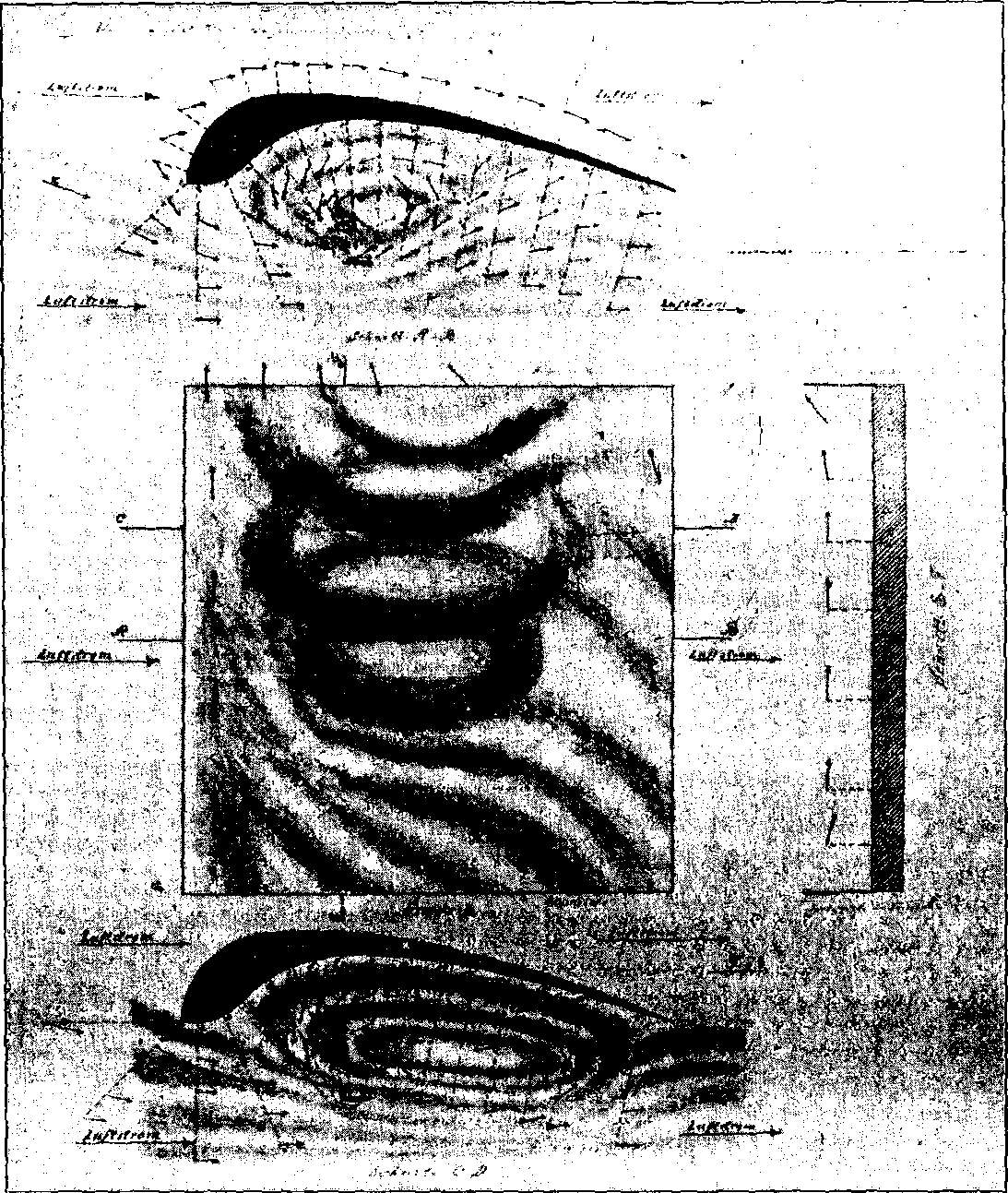 Abb. 1. (Von oben nach unten Fig. 1, 2 u. 3.) dann als Luftlöcher bezeichnet. Den Auftrieb des Windes in der Nähe der Erdoberfläche haben die Gebrüder Lilienthal 1887 schon an horizontal gelagerten und ausbalanzierten ebenen Flächen festgestellt und gefunden, datl derselbe 3 V beträgt. Gustav Lilienthal hat diese Versuche in großem Maßstab weitergeführt und auch dünne sowie dicke gewölbte Flächen dem Winde ausgesetzt. Letztere hatten die Verdickung besonders im vorderen Drittel der Breite. Dieselbe betrug '/b der Gesamtbreite. Es zeigte sich hierbei, daß die dünne gewölbte Fläche fast 7°, die verdickte aber um 16%" aus der horizontalen Lagerung durch den Wind nach oben gerichtet wurden. Durch Vorzeigung eines präparierten Fregattvogelflügels wurde bewiesen, daß der Vogelflügel ein Profil hat, welches dem Profil der verdickten Fläche gleicht. Es wurde darauf hingewiesen, daß bei allen segelnden Vögeln das Flügelprofil am Ober und Unterarm und je am Handgelenk eine ausgesprochene Verdickung zeigt, die durch einen dicken Federbelag hergestellt ist. Bei allen Vögeln, welche den Segelflug nicht ausüben können, ist die dicke des Flügels im Verhältnis zur Breite bedeutend geringer, auch sind Ober- und Unterarm, sowie die Hand unverhältnismäßig kürzer als wie bei Seglern. Lilienthal schloß aus dieser Erscheinung, daß eine gewölbte Fläche mit großer Verdickung des Vorderrandes im Wind einen geringen Vorwärtszug zeigen könnte. Der Redner führte an, wie ihn bei seinem Aufemhalt in Rio de Janeiro das Segeln der Fregattvögel besonders gereizt hätte, die Flugart des Segeins genauer zu studieren. Zu diesem Zweck stellte er einen Rundlaufapparat her, an dem vogelflügelartige Flächen befestigt und bewegt wurden. Durch angesteckte und  .y, 4 ,1 Abb. 2. (Fig. 1, 2 u. 3.) drehbare Papierfähnchen konnte er erkennen, in welchen Stromlinien die Luft die bewegte Fläche umspülte. Aus dieser Untersuchung ging hervor, daß sich unter solchen Flächen bei einer Geschwindigkeit der Bewegung von ca. 5 Sec.-Mtr. an ein großer Wirbel bildet und zwar in ovaler Form mit zwei Wirbelpunkten, so daß die Luft in einer Vorwärtsrichtung an der Unterfläche des Versuchsobjektes hinstreicht. Diese Wirbelbildung ist permanent. Es wird fortwährend neue Luft in dieselbe hineingezogen. Die ersten dieser Versuche wurdenTmit einer gleichsam einen Flügelausschnitt bildenden Fläche gemacht von ca. 0,90 cm im Quadrat und einem Profil, wie es segelnde Vögel am Ellbogengelenk haben. Die Abbildung 1, Fig. 1 und 3 zeigen das Profil, Fig. 2 den Grundriß der Fläche. Es wurde an sechzehn verschiedenen Stellen der Unterseite und Oberseite ein kleines Stäbchen nach einander auf die Fläche gesteckt, an welchem in Abständen von 6 cm kleine Fahnen aus Karton mittelst einer Nadel angesteckt waren. Diese Fahnen sind um die Nadel drehbar, so daß sie einem Luftstrom entsprechend sich einstellen können. Es war Vorsorge getroffen, daß Zentrifugalwirkung und Trägheitsmomente entsprechend ausgeschaltet wurden Wurde nun der Rundlauf durch eine Drehung bis zu 10 sek.-m Geschwindigkeit in Bewegung gesetzt, und zwar war hierzu gerade eine Umdrehung ausreichend, so stellten sich die vier übereinander gelagerten Fahnen, wie es in Abb. 1 dargestellt ist. Es ist deutlich zu erkennen, daß der sich bildende Wirbel zwei Drehpunkte hat und zwar liegt der vordere ziemlich genau im Mittelpunkt der vorderen Profilwölbung der Unterseite. An der Oberfläche streicht die Luft ziemlich parallel zur Oberfläche ab. Nur die erste Fahne an der Vorderkante zeigt eine Abwärtsneigung. Es fließt also hier noch Luft nach unten ab. Die zweite und dritte Stellung zeigt einen Uebergang zum Parallellauf. Da alle vier Fahnen übereinander an der Oberseite der Fläche ganz gleichartig standen, so ist nur die untere Fahne gezeichnet worden. Lilienthal brachte dann auch Fahnen an, welche direkt auf die Fläche so gesteckt wurden, daß die Nadel senkrecht zum Profil stand. Hieraus war die seitliche Strömung der Luft unter und Uber der Fläche zu erkennen. Fig. 2 zeigt die Fahnenrichtung an der Unterseite. Aus dieser Darstellung geht wiederum hervor, daß die Luft unter der Fläche in einen Teil der Fläche von hinten nach vorn, also entgegengesetzt der Bewegungsrichtung strömt, aber es liegt diese Region nicht in der Mitte der Fläche, sondern einseitig und zwar nach der äußeren Kreisbahn der Fläche zu. Von der Innenkreisbahn des Rundlaufs wird die Luft zugeführt, welche dann in die Wirbelbewegung hineingezogen und nach der entgegengesetzten Seite vermöge der Centrifugalkraft gedrängt wird. Lilienthal schloß hieraus, daß der Querschnitt des Wirbels in der Mitte der äußeren Hälfte der Fläche bei C I) eine größere Breite haben müßte als bei A B. Es wurde dann das Fahnenstäbchen in der Richtung C D angesteckt und wie in Abb. 1, Fig. 3 zu sehen ist, die Wirbelströmung erkannt. Der vordere Wirbelpunkt, in dem die Fahnen vollkommen rotierten, blieb fast in dem gleichen Abstand von der Vorderkante, die andere rückte aber bedeutend nach hinten, sodaß schon ganz nahe dem Hinterrand der Luftstrom zur Umkehr gezwungen wurde. Wie sehr die Luft schon vor der Fläche durch das Profil beeinflußt wird, ist aus der Fahnenstellung x ersichtlich. Diese Fahne ist um einen feinen Draht drehbar, welcher zwischen zwei kleinen Lesten gespannt war, die an den Stirnseiten der Fläche befestigt sind. Diese Fahne konnte daher frei dem Luftstrom folgen. Um den einseitigen Einfluß der Centrifugalwjrkung zu vermeiden, wurde darauf die Fläche senkrecht zum Rundlaufarm angebracht. Jetzt bildete sich der Wirbel in der Mitte der Fläche, wie bei B Fig. 2 ersichtlich ist. Die Wirbelluft windet sich jetzt symetrisch zu beiden Seiten, ähnlich wie sich die Hörner des Widders drehen, es ist daher diese Erscheinung Widderhornwirbel genannt worden. Lilienthal schloß nun aus der seitlichen Abströmung der Wirbelluft, daß die segelnden Vögel hieraus großen Nutzen ziehen könnten, wenn sie diesem Luftstrom eine schräge Flügelstellung entgegenstellen könnten. Ihm war längst bekannt, daß der segelnde Vogel den Oberarm stark anhebt und die Spitzen der Flügel nach unten drückt, da er diese Stellung überhaupt schon zur Erhaltung des seitlichen Gleichgewichts braucht, wie schon seit Jahren durch L. hervorgehoben wurde. (Siehe Abb. 4.) Es kam jetzt also darauf an nachzuweisen, ob an Vogelmodellen der Widderhornwirbel sich gleichfalls einstellte. Abb. 3, Fig. 1, 2 und 3 zeigt ein solches Vogelmodell. Es wurde am Rundlaufarm in den verschiedensten Stellungen befestigt. Der Wirbel bildete sich unter allen Umständen. Im Grundriß sind die Fahnenstellungen eingetragen, welche die seitliche Luftströmung anzeigen. Man sieht hieraus, daß bis zur äußersten Spitze die Luft in der Längsrichtung des Flügels abstreicht, während vom Ellbogengelenk die Luft nach dem Rumpf strömt. In beiden Fällen muß die Luft eine lebende Wirkung auf die Flügel ausüben, während die Vorwärtsrichtung der Strömung unter den Flügeln sich als vorwärtstreibende Kraft äußert.--Besonders deutlich wurde der Vorstrom der Wirbelluft durch eine Scheibe, welche auf einen Draht gezogen war, zur Anschauung gebracht. Der Draht war, wie Abb. 2 (Fig. 2 u. 3) zeigt, unter der Fläche von der Mitte 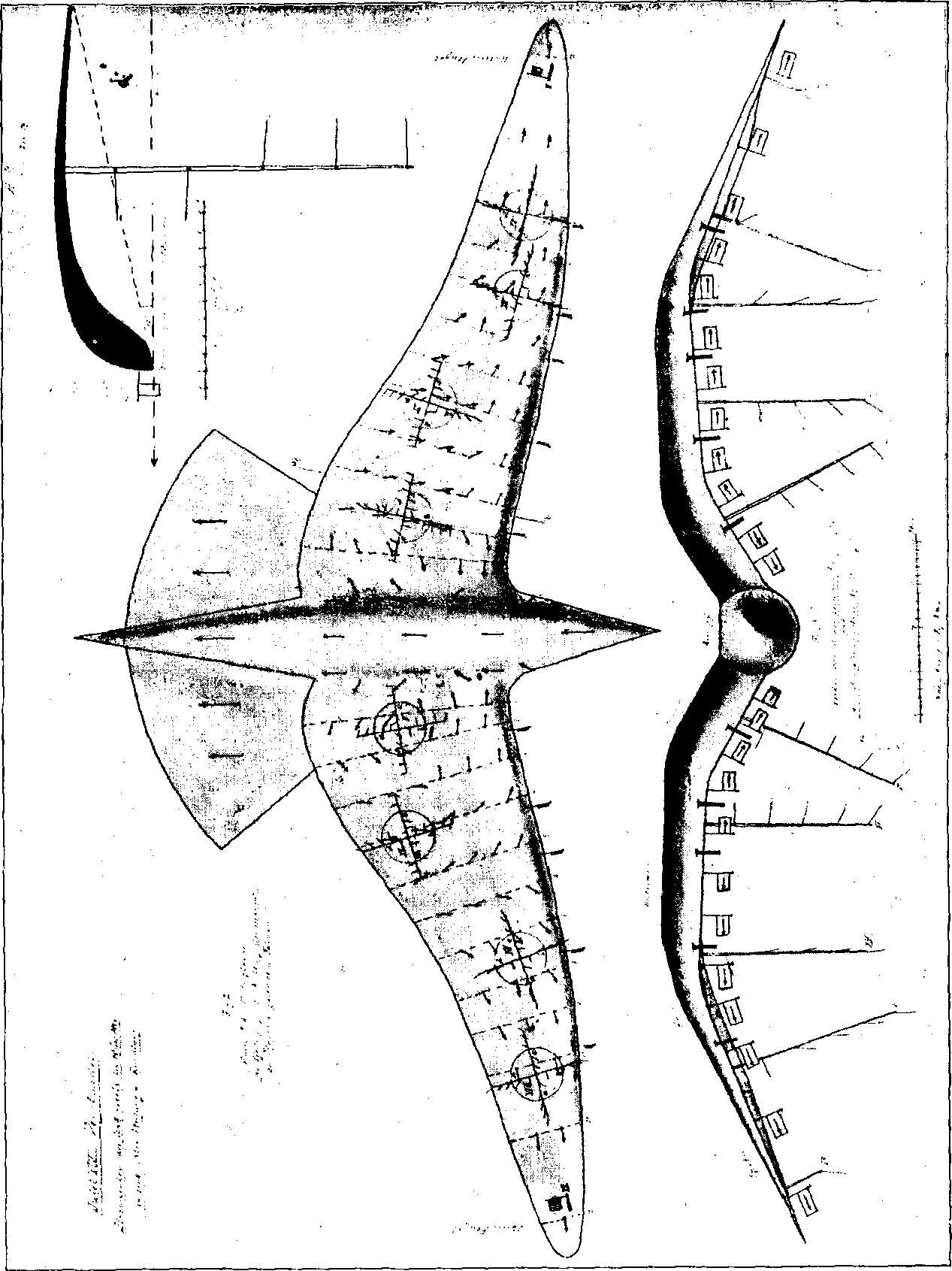 schräg nach vorn laufend gespannt. Brachte man die Scheibe unter den Hinterrand vor dem Beginn der Bewegung, so wanderte diese bei langsamer Bewegung ganz an die Hinterkante. Ueberstieg die Bewegung aber 6 Sec.-mtr., so wanderte die Scheibe rat großer Geschwindigkeit nach dem anderen Ende des Drahtes. Bei diesen Experimenten in ruhender LufttJist ausjmechanisch technischen Gründen nicht anzunehmen, daß dieser^,Vorwärtszugvschon,.größer ist als der Rückwärtsdruck, welcher durch die Reibung an der Oberfläche und den Stirnwiderstand des Rumpfes an der Vorderkante entsteht. Auch beim Vogel wird sich kein Ueberschuß des Vortriebes gegen den Stromwiderstand zeigen, deshalb kann kein Vogel bei Windstille segeln . Auch hierüber hatte Lilienthal gute Gelegenheit in Rio de Janeiro Beobachtungen anzustellen. Es ist aber sehr wohl denkbar, daß im freiem Wind die Verhältnisse sich günstiger gestalten, sodaß ein geringer Ueberschuß des Vortriebes eintritt. Man ist zu diesem Schluß deshalb berechtigt, weil bei früheren Messungen der Gebrüder Lilienthal an Flächen, welche am Rundlauf rotierten, im Gegensatz zu den Messungen im freien Wind ein bedeutender Unterschied sich herausgestellt hat. Am Rundlauf ist die Druck-Resultante der dünnen gewölbten Fläche 7° nach rückwärts gerichtet, während im freien Wind dieselbe senkrecht also um 7° günstiger steht. Eine gleiche Differenz zu Gunsten der Bewegung in freier Luft kann man daher auch für die dicke gewölbte Fläche annehmen, welche hierbei in Frage kommt. Quantitative Messungen hierüber wird Lilienthal erst vornehmen können, wenn der von ihm geplante Verein zum Studium des Vogelfluges sich konstituiert haben wird. Leider gehen die Anmeldungen hierzu, wie wir zu unserem Bedauern hören, sehr spärlich ein Einstweilen hat Lilienthal sein Vogelmodell an einem acht Meter hohen Auslegergerüst dem Winde ausgesetzt und festgestellt, daß ein Vortrieb des Windes in der Tat sich zeigt. Abb. 5 zeigt ein nach vorn gegen einen Wind von 10 Sekundenmetern bewegtes Vogelmodell. Angesteckte Fahnen zeigten dieselbe Richtung wie bei den Versuchen am Rundlauf. Es möchte der Einwand erhoben werden, daß irgend ein schwerer Gegenstand im Winde aufgehängt in Pendel ung gerät und dann im Moment der Vorwärtsrichtung photographiert werden könnte. Das trifft für diesen Fall nicht zu. Das im Wind hängende Modell ist allerdings ziemlich stark belastet, aber es kommt vor, daß es angehoben wird wenn der Wind zu stark wird, es ist dann gewichtlos. Gleich nach dem die vorliegende Aufnahme gemacht war, wurde eine 10 Gramm schwere Schraubenmutter, die an dem Modell befestigt gewesen war, entfernt. Das Modell stieg dann direkt gegen die darüber befindliche Auslegerlatte. Es hatte also vorher nur ein Gewicht von circa 10 gr gehabt. Irgend ein Gegenstand von dem geringen Gewicht von 10 gr und dem Querschnitt gleich der Stirnfläche des Wodelles wird aber vom Wind direkt und permanent nach hinten geweht und es wird auch nicht einmal annähernd in die Senkrechte zurück pendeln. Der bisher so geheimnisvolle Vorwärtszug, wodurch der Vogel im Stande ist, im Wind mit bewegungslosen Flügeln zu segeln, findet durch den Widderhorn-Wirbel seine Erklärung. Nicht eine Drachenstellung seines Flügelprofils sondern die Eigentümlichkeit dieses Profils erzielt die Wirbelbildung und dadurch eine Strömung unter den Flügeln entgegen der Windrichtung. Verstärkt wird diese Wirkung hoch dadurch, daß die Luft entgegen dem Strich der Deckfedern streicht. Bei einigen Vögeln wie z. B. beim Schwan haben die unteren Deckfedern an den Enden speziell eine Kräuselung. Der Vortrieb wird hierdurch besonders wirksam werden. Der Schwan bedarf dessen auch mehr wie andere Vögel, da sein Rumpf einen sehr großen Querschnitt hat. Anfänglich ist das Segeln sehr langsam Der Ueberschuß des Vortriebs wirkt aber als Beschleunigung; die Geschwindigkeit vergrößert sich daher mit der Zeit. Nimmt der Wind zu, etwa über 12 Sekundenmeter, so erfährt die Seitenströmung des Wirbels eine geringe Ablenkung nach hinten. Der Vogel legt in diesem Fall die Spitze etwas zurück. Abbildung 6 zeigt eine Schar segelnder Möven in einem Wind von 15 Sekundenmeter dem Dampfer folgend. Die Aufnahme wurde von Herrn Baumeister Lilienthal auf seiner Rückreise von Rio gemacht. Fliegt der Albatros bei Sturm, so legt er die Flügelspitze parallel zum Rumpf, wie Lilienthal wiederholt beobachten konnte. Für den Flug der Drachenflieger wird die Wirbelbildung nicht ausgenutzt werden können. Der Einfluß des Schraubenwindes wird sicher die Wirbelbildung stören, besonders aber ist durch Anhebung der Vorderkante der Flächen die Wirbelbildung verhindert. Dies ist aber erforderlich, um den Auftrieb zu erhalten. Wirksam kann der Wirbel daher auch nur ausgenützt werden bei einem gekrümmten Längsprofil, wie Abb. 3 Fig. 2 und wie es die Condorabbildung zeigt. Erst wenn es möglich sein wird mit brauchbaren Schlagflügeln solche Höhen zu erreichen, in denen ein gleichmäßiger Wind angetroffen werden kann, wird man versuchen können, den Segelflug möglich zu machen. Lilienthal hat daher dem Ruderflug der Vögel einen weiteren Vortrag im Berliner Flugsport-Verein gewidmet Er beschrieb hierbei die Eigentümlichkeiten der Flügelbewegungen und die einzelnen Phasen zur Ergänzung des tragenden und treibenden Luftwiderstandes. Er warnte dabei, und wir können uns dem voll und ganz anschließen, vor Konstruktionen von Schlagflügeln, ohne sich von beim Ruderflug eintretenden nicht ganz uncompliciertcn Vorgängen Klarheit zu verschaffen. Die meisten bisherigen Versuche, welche den Schlagflügelbau geradezu in Miskredit gebracht haben, stützen sich auf die irrige Ansicht, daß die Vogelflügel ein System von Ventilklappen bilden, sod&B die Luft beim Aufschlag du ch den Flügel hindurchstreicht und beim Niederschlag sich die Ventile schließen und der Flügel auf die Luft drückt. Es wurde durch Diagramme die Bewegung des Flügels während des Auf- und Niederschlages deutlich gemacht, welche Stellung das Flügelprofil hierbei einnimmt und nachgewiesen, daß der Aufschlag des Flügels keineswegs einen Niederdruck erzeugt, sondern noch ganz erheblichen Auftrieb. Nur der entstehende Rückwärtsdruck ist schädlich, aber dieser wird bedeutend von dem Vortrieb des Niederschlags übertroffen, besonders wenn der Vogel die Spitze des Flügels beim Aufschlag nach hinten etwas zurücklegt. Daß dies aber eintritt, beweist die bekannte Momentaufnahme der Marayscheri Möve. Ein sehr wichtiger Faktor für den Ruderflug bildet die von Gebr. Lilienthal entdeckte Vermehrung des Luftwiderstandes durch die Schlagwirkung. Es kann hierdurch der Druck gejenüber tiner gleich großen rotierenden Geschwindigkeit bis zum Zwanzigfachen gesteigert werden, wenn die Schlagbewrgung ohne 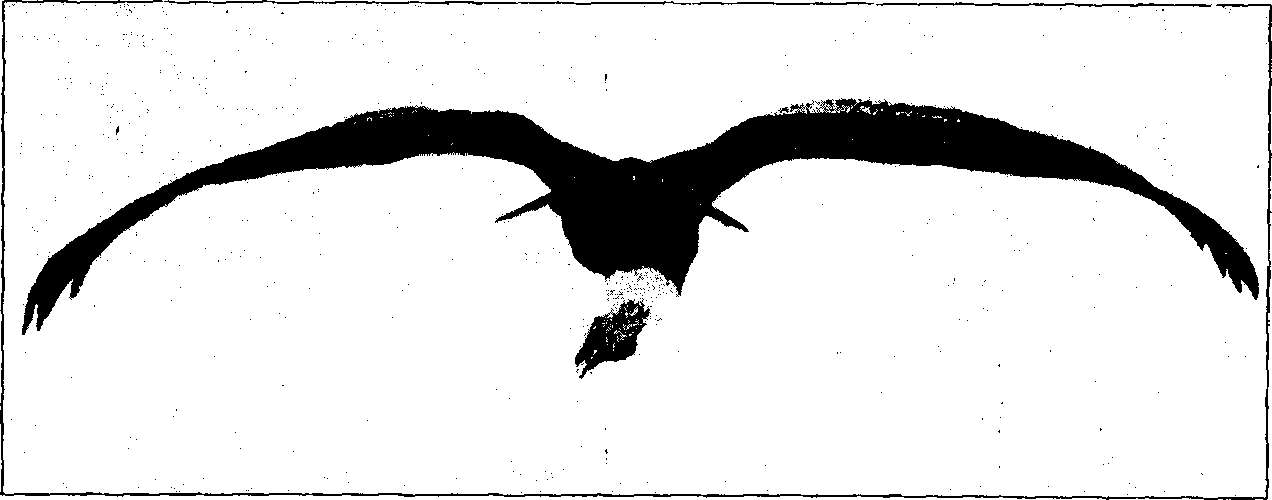 Abb. 4. Condor, Spezialaufnahme aus.vdem Berliner Zoologischen Museum. gleichzeitige Vorwärtsbewegung geschiehl. Bewegt sich der Vogel aber gleichzeitig vorwärts, so nimmt die Schlagwirkung nach einem bestimmten Verhältnis ab. Auch hierüber hat Lilienthal eingehende Versuche angestellt, deren Darstellung aber den Rahmen dieses Aufsatzes überschreiten würde. Es ist aus diesen Untersuchungen ersichtlich, wie der Vogel durch Einsetzen der Schlagwirkung im Stande ist, bei ganz geringer Vorwärtsbewegung durch Hüpfen selbst bei Windstille nach drei bis vier Schlägen schon den erforderlichen Luftwiderstand sowohl hebend wie treibend zu erzeugen, allerdings durch Aufwendung der doppelten Arbeitsleistung gegenüber der Arbeit, welche der Flug bei bewegter Luft erfordert. Träte die Schlagwirkung nicht ein, so bedürfte der Vogel entweder bedeutend größerer Flügel Tür den Aufflug oder er müßte einen viel größeren Ausschlag machen. Für die Taube ist der Ausschlag beim Aufflug schon ein Maximum, da die Flügel oben und unten schon zusammenschlagen, ihr Flügelareal müßte mehr als zehnmal so groß sein, wenn die Schlagwirkung nicht den kleinen Flügeln schon solche Druckvermehrung gewährte. Untersuchungen über tie Wirkung von Schlagflügeln sollten daher von jedem Konstrukteur gemacht werden, um die Unterlagen für solche Konstruktionen zu erhalten. Aber auch für Drachenflieger mit starren Flügeln und für Ballons ist die Schlagwirkung zu beiiicksichtigen. Es ist die gleiche Wirkung, ob die Flächen sich gegen die Luft oder die Luft sich gegen die Fläche schlagartig bewegt. Der letztere Fall trifft aber ein bei Böen. Man scheint ja endlich das Flugzeug solider zu bauen als vor vier Jahren und hört selten von dem Reißen von Spanndrähten oder Zerknicken der Holme. Schon damals hob Lilienthal hervor, daß man der Schlagwirkung Rechnung tragen müßte. Bei seinen Experimenten im damaligen Verein Deutscher Flugtechniker wies er eine fünfzehnfache Druckvermehrung nach durch die Schlagwirkung. Nach Lilienthals Ermittelungen ist unter Berücksichtigung der geschilderten Verhältnisse dieKonstruktion menschlicher Flugzeuge gar nicht so aussichtslos, als aus den bisherigen mangelhaften Versuchen allgemein geschlossen wird. Belanglos und höchst dilletantisch sind allerdings die Bemühungen der Franzosen parforce den Ruderflug zu ermöglichen durch Preise für ein fliegendes Fahrrad. Wenn so ein Vehikel wirklich durch Anlauf, also aufgespeicherte Arbeit, einen längeren Sprung macht, so ist hiermit nichts bewiesen. In ruhender Luft wird die menschliche Kraft nicht im Stande sein, selbst bei einem Konstruktionsgewicht von nur 2 kg pro 1 qm für den kompletten Apparat einen Ruderflug auszuführen. Dies ergibt sich aus der Kräftewirkung der Druckcoefficienten. Die Größe dieser Coefficienten bildet die eigentliche Grundlage der Flugtechnik, nur hieraus kann man seine Schlüsse für die Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines Flugsystems ziehen. Es sind grade diese Untersuchungen, welche Lilienthal an der seinerzeit mit sei- 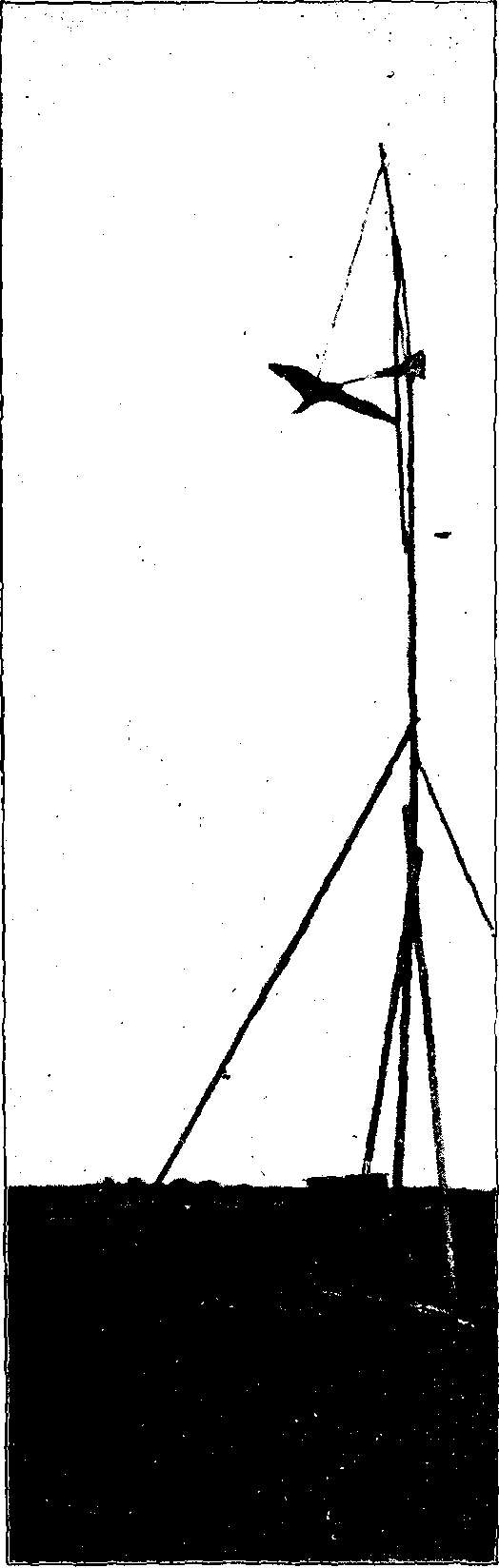 nem Bruder verfolgten Idee des freien Menschenflugs festhalten lassen. Er hat daher keine Mühe und Kosten gespart, um gerade den Wert für den Luftwiderstand festzulegen, der den Maßstab für alle Messungen abgibt. Die Größe von Kd ist derjenige Druck, welcher entsteht, wenn eine Fläche von I qm mit einer Geschwindigkeit von 1 Sec.-Mtr. in ruhiger Luft bei 15° Celsius und normalem Barometerstand bewegt wird, ohne daß in der Nähe Wände oder die Nähe des Fußbodens und der Decke einen störenden Einfluß ausüben. Ganz besonders ist zu vermeiden, daß die Versuchsfläche an dieselbe Stelle zurückkehrt, in welcher sie sich schon einmal bewegt hat. Ueber die verschiedenen Meßmethoden und speziell über seine eigenen Arbeiten handelte der letzte Vortrag in dem genannten Verein. Es wurde u. a. erwähnt, daß die Messungen von Langley u. Dines ein mangelhaftes Resultat liefern mußten, da sie einen viel zu langen Vorlauf haben mußten, bevor die Geschwindigkeit eine gleichmäßige geworden war. Der so erzeugte Mitwind mußte den Druck auf die Versuchsfläche erheblich vermindern. Auffallend ist es, daß trotz Anwendung einer ganz anderer. Meßmethode von Eiffel und in der Göttinger Versuchsanstalt ein ähnlicher geringer Wert für K gefunden wurde. Eiffel bestimmte K durch eine Fallvorrichtung, wobei die Fläche durch automatische Schreibvorrichtung, besonders aber auch durch eine wahrscheinlich entstehende seitliche Strömung behindert ^wurde, weil ^unterhalb der Abb. 5. Vogelmodell bei 10 Sec./in Wind aufgehängt Fläche Teile des Apparates angebracht waren Er bestimmte auch durch Gebläse, welches aus einem Rohrsystem Luft in eine Kammer trieb, den Druck auf Flächen von 0,1 qm. Hierbei erscheint es zwefelhaft, ob bei dem Eintritt aus den Röhren in den großen Raum der Kammer die Strömung so gleichmäßig stattfindet, um aus der Menge der geförderten Luft die Geschwindigkeit bestimmen zu können In Göttingen benutzt man einen Rundlauf, an welchem durch ein Pitot-Rohr die Druckdifferenz zwischen aerodynamischen und aerostatischen Druck festgestellt wird. Hieraus wird dann der Wert von K bestimmt unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit des Rundlaufs. Hierbei ist leider nicht zu vermeiden, daß selbst die mehrfachen Umläufe des Gestänges des Apparates Mitwind erzeugen müssen. Lilienthal hat bei seinen Untersuchungen den Rundlauf in einen Halbkreislauf geändert, dessen Radius 14,324 m ist, sodaß der Halbkreis 45,0 m Bahnlänge hat. An dem Ende des Armes wird eine Meßfläche von 1 qm befestigt Durch 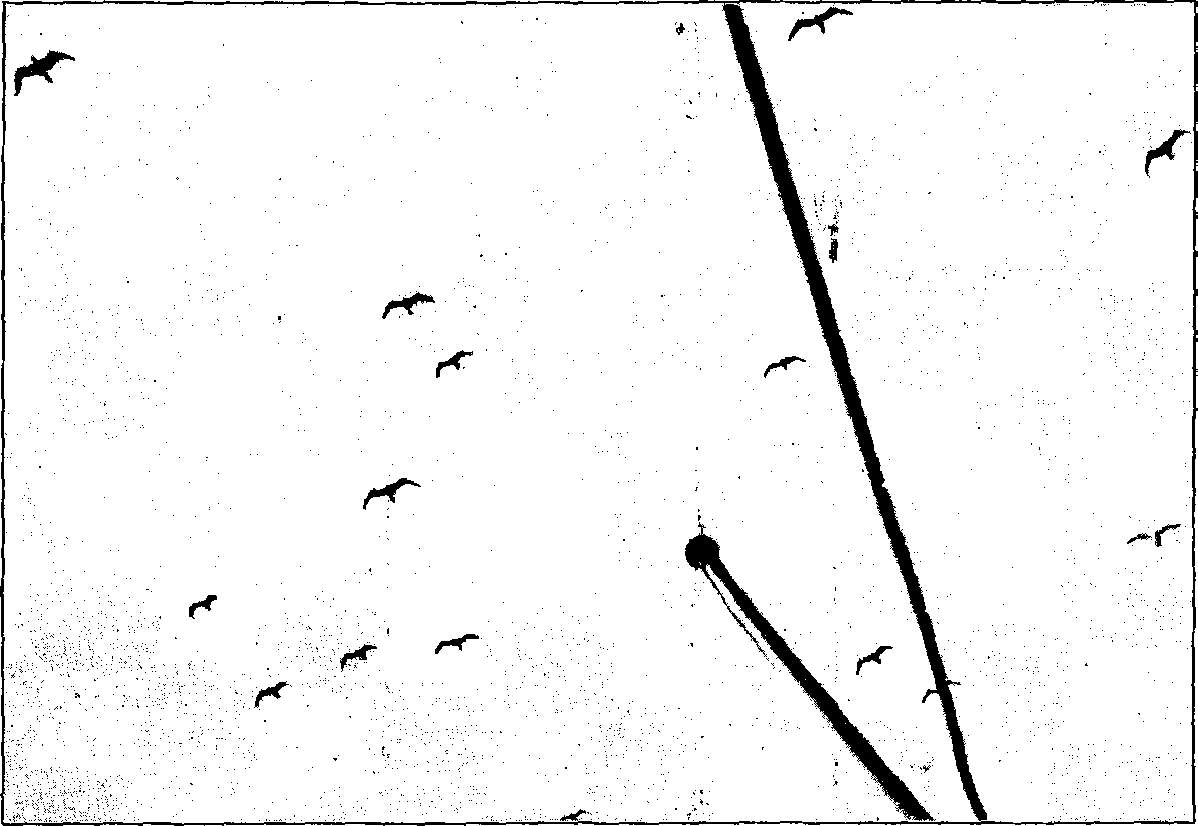 Abb. 6. Möven bei 15 Sec./m Wind segelnd. die Winkelbewegung des Armes wird die Geschwindigkeit der Meßfläche festgestellt, nachdem vorher die Belastung des Antriebs durch eine Seilscheibe von 4,398 m Umfang ein gleichmäßiger Leergang erzielt worden war. Die Extrabelastung für den Vollgang gab dann den reinen Luftwiderstand auf die Meßfläche. Aus dem Verhältnis der Durchmesser der Seilscheibe und der Länge des Armes vom Drehpunkt bis zum Druckzentrum der Fläche wurde K mit 0,0978 kg gefunden bei 15° Celsius. Um aber auch die durch die Kreisbahn etwa verursachten Störungen noch auszuschalten wurde ein weiterer Versuch gemacht. Auf einem sehr straff gespannten Draht von 4,8 mm Stärke und 20 m freier Länge war eine Fläche von 1 qm Größe beweglich angebracht, sodaß sie senkrecht zur Bewegungsrichtung stand Durch Schnur Uber Rolle und angehängtem Gewicht wird die Fläche angetrieben. Nach einem Lauf von 4 m ist die dewegung völlig gleichmäßig. 12 m Lauf dienen zur Bestimmung der Zeit, in welcher die Fläche diese Strecke zurücklegt, der Rest der Bahn dient zur Bremsung der Bewegung Durch diese Versuche ergab sich ein K von 0,102 kg pro 1 Sek -Mtr. Eine Vergrößerung der Sek.-Geschwindigkeit bis zu 2 und 3 Sek.-Mtr. ergab eine genaue quadratische Zunahme. Auf Grund dieser Untersuchungen sind Unterlagen geschaffen, nach denen sich schon eine leidliche Berechnung von Schlagflügelapparater, aufstellen läßt. Lilienthal stellt seine Anforderungen aber noch höher. Es fehlen zur Zeit noch die Messungen des Auftriebes und des Horizontalschubes auf Flächen v n Vogelflügel Profilen im freien Wind und zwar von Wind, welcher unter gleichen Umständen weht, als ihn die Segler des Meeres erhalten. Es muß daher eine Versuchsstation an der Küste und zwar an einem nicht durch Dünen behinderten Strand errichtet werden. Inland. Fiuy/ührer-Zeaf/nlsse haben erhalten: No. 451. Manie, Johannes, Sergeant, Telegr.-Batl. 2, Frankfurt a. O., geb. am 19. August 1885 zu Boeck, Kr. Randow, für Zweidecker (Dtsch. Flugzeugwerke), Flugfeld der Dtsch Flugzeugwerke, am 4. Juli 1913. No. 452. Dietze, Paul, Oberleutnant, Train-Batl. 19, Leipzig, geb. am 9. Juni 1884 zu Leipzig, für Zweidecker (Dtsch. Flugzeugw.) Flugfeld der Dtsch. Flugzeugwerke, am 4. Juli 1913. No. 453. Kiesel, Willy, Hptm u. Komp.-Chef 1. Sachs. Pion.-Btl. 12 Johannisthal, geb. am 24. Jan. 1877 zu Burg b. Mgdbg., für Zweidecker (Wright), Flugplatz Johannisthal, am 4. Juli 1913. Nr. 454. Hermann, Kurt, Leutnant, Johannisthal, geb. am 24. Mai 1888 zu Kl.-Glienicke b. Potsdam, für Eindecker (Rumpier), Flugplatz Johannisthal, am 4. Juli 1913. No. 455. Parschau, Otto, Leutnant, Inf.-Regt. 151, Adlershof, geb. am 11. November 1S90 zu Klutznick, Kr. Alienstein, für Zweidecker, (Wright), Flugplatz Johannisthal, <#m 4. Juli 1913. No. 456. von der Drift, Willi, Monteur, Burg b. Magdeburg, geb. am 20. September 1892 zu Den Haag, Holland, für Eindecker (Schulze), Flugplatz Madel, am 4. Juli 1913. No. 457. Heiter, Julius, Altenessen, geb. am 27. Dezember 1888 zu Lengerich i. W., für Eindecker (Grade), Flugplatz Gelsenkirchen am 5. Juli 1913. No. 458. Kockrow, Hermann, Cottbus, geb. am 25. November 1891 zu Cottbus, für Eindecker (Grade), Flugplatz Bork, am 8. Juli 1913. No. 459. Arntzen, Georg, Leutnant, Pion.-Batl. 26, Johannisthal, geb. am 9. Juni 1886 zu Königsberg i. Pr, für Zweidecker (Einpropeller-Wright), Flugplatz Johannisthal, am 8. Juli 1913. No. 460. Uhlig, Ernst, Leutnant, 4. Inf.-Regt. 103, Johannisthal, geb. am 4. August 1890 zu Schloß Sachsenbu g b. Frankenberg, Sa., für Eindecker (Rumpier), Flugplatz Johannisthal, am 9. Juli 1913. No. 461. Denk, Ernst Oberleutnant, Inf.-Regt. Nr. 44, Schwerin-Görries, geb. am 30. Mai 1885 zu Schneidemühl, für Eindecker (Fokker), Flugplatz Görries, am 11. Juli 1913. No. 462. Behm, Alfred, Leutnant Inf.-Regt. 18, Osnabrück, geb. am 2. Januar 1885 zu Friedrichsort b. Kiel, für Zweidecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 11. Juli 1913. Flugtechnische 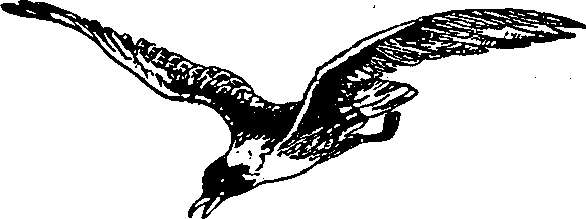 Rundschau. /Militärische Flüge. Vom Truppenübungsplatz Lockstedter Lager nach dem Flugplatz Puhlsbüttel flog am 3. August Oberlt. Steffen mit Lt. v. Kunze als Beobachter. Die Flieger stiegen 5: 59 vorm. auf dem Truppenübungsplatz mit einer Albatros-Taube auf und landeten 8 : 29 auf dem Flugplatz Fuhlsbüttel. Der Flug wurde bei heftigem Gegenwind in 1400 m Höhe ausgeführt. Einen Geschwaderflug von Metz nach Darmstadt unternahmen am 4 August drei Maschinen von der Metzer Militär-Fliegerstation. Die drei Flugzeuge waren besetzt von Lt. Schregel mit Major Siegert, Lt. Schulz mit Lt. Teubner und Lt. Giesche mit Lt Fellinger, letzterer als Beobachter. Trotz des starken Nebels und Gegenwindes konnte die Strecke Metz-Darmstadt in 21/, Stunden bewältigt werden. Von den Flugplätzen. Von den Münchner Flugplätzen. Plugplatz Oberwiesenfeld. Der Flieger Schöner der Ottowerke machte in letzter Zeit wieder mehrere bemerkenswerte Flüge. So führte er u. a. am 24. Juli auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor einen Flug von l'/s Stunden Dauer aus, und überflog hierbei mehrmals die nördlichen Stadtteile Münchens in einer Höhe von 600—800 m. Die Landung erfolgte aus 500 m Höhe in tadellosem Gleitfluge wieder glatt auf dem Flugfelde. In Oberschleissheim stieg am 29 Juli früh nach 5 Uhr Baierlein mit Herrn Oberleutnant Sorg als Passagier zu einem Ueberlandflug nach dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr auf und landete dort glatt nach 27, Stunden Flug bei sehr starkem Gegenwind. Der bei diesem Fluge benützte Motor ist ein in Milbertshofen hergestellter 100 PS Stahlzylinder-Flugmotor: F. D-System Rapp, welcher glänzend durchhielt und der mit dieser Leistung eine Gesamtflugdauer von bereits 11 Stunden ohne den geringsten Defekt aufweist. Vom Fraiiltfurter Flugplatz. Der Flieger Schäfer startete am 24. Juli auf einem Grebe-Eindecker ,nit 100 PS Argus Motor mit dem Mechaniker Stengel als Begleiter zu einem Ueberlandflug nach Dillenburg. Der Flieger floggegen den an den Flugplatz angrenzenden Wald. Ueber dem Wald wurde die Maschine durch Böen zu Boden gedrückt und geriet in die Bäume. Der Mechaniker Stengel fiel aus der Maschine und wurde tödlich verletzt, während der Flieger mit einigen leichteren Verletzungen davonkam. Alte Regel! Man starte nie gegen einen Wald, um denselben direkt zu überfliegen. Vom Dresdner Flugplatz. Die Einrichtung und einstweilige Leitung des städtischen Dresdner Flugplatzes in Raditz hat der durch viele erfolgreiche Ueberlandflüge bekannte sächsische Militärflieger Leutnant W. Meyer vom 139 Infanterie-Regiment übernommen. Der genannte Offizier ist von Sr. Maj. dem König zu diesem Zwecke auf ein Jahr beurlaubt worden. Gleitflüge von Fritz Richter. Am 27. Juli machte Richter in Berlin auf dem Leutnantsberg an der Müllerstraße einige Gleitversuche. Der längste Flug betrug bei 4 Min. Wind 30 m in einer Höhe von 12 -15 m. Bei dem letzten Flug wurde der Gleitflieger vor der Landung durch eine Böe zu Boden gedrückt und zerbrach eine Strebe. Die in den Tageszeitungen erschienenen vollständig erfundenen Mitteilungen Uber den Absturz entsprechen nicht den Tatsachen. Ueberlandflug mit einsitzigem Grade Apparat Berlin—Leipzig-Magdeburg. Ueber meinen vor kurzem ausgeführten Ueberlandflug gestatte ich mir nachstehenden Bericht zu geben. *) Ich hatte bereits längere Zeit die Absicht, mit meinem Grade-Apparat über Land zu fliegen. Teils um zu zeigen, daß der Grade-Apparat nicht so ungeeignet für Ueberlandflüge ist, wie im allgemeinen geglaubt wird, teils um zu lernen, nach Kompaß und Karte zu fliegen um mich zu orientieren, da ich nach der Karte allein mich mehrmals verflogen hatte. Berlin-Leipzig. Am Sonnabend, den 26. Juli 1913 morgens 4:30 Uhr stieg ich bei leichtem Nebel in Johannisthal auf, nachdem ich mich vorher überzeugt hatte, daß der Einbau meines Magnetes richtig war. Ich verließ den Platz und stieg zuerst in südöstlicher Richtung um die Bahnlinie nach Trebbin zu erreichen. Ich verfolgte ineine Richtung genau auf der Karte und wunderte mich, daß ich bereits nach kurzer Zeit die Bahnlinie erreichte. Wegen des leichten Nebels war es mir nicht möglich, die einzelnen Conturen der Landschaft genau zu erkennen. Ich folgte nun der Bahnlinie weiter über Wittenberge nach Bitterfeld, wobei ich fast ausschließlich nach dem Kompaß flog und zeitweilig meine Richtung mit der Karte verglich. Ich war in der Zwischenzeit auf 800 m gestiegen und befand mich über den Wolken. Bei Bitterfeld schlug ich die Richtung direkt nach Süden ein. Ich mußte, um den Erdboden zu erkennen, bis auf weniger als 50 m herunter gehen. Ich ging bei Delitzsch von der Bahnlinie ab, konnte aber infolge des Nebels den Flugplatz Leipzig—Lindenthal nicht erkennen, da ich auch der Meinung war, daß der Platz vor und nicht hinter dem einen großen Gehölz lag. Nach meiner Uhr mußte ich ungefähr dort sein. Ich kehrte daher um und suchte den Platz, konnte ihn aber wegen der Undurchsichtigkeit des Nebels nicht finden und landetelglatt bei Schladitz, nur 5 Kilometer in der Luftlinie von Leipzig-Lindenthal entfernt, nachdem ich schon dort gewesen war. Als ich einen Bauern dort pflügen sah, beschloß ich, dort hin zu rollen. Im weichen Erdreich bohrten sich jedoch die Räder ein, wodurch sich mein Apparat vorn über beugte und der Propellerstutzen leicht verbogen wurde. Ich telefonierte Herrn Kahnt, der die Freundlichkeit besaß, vom Flugplatz einen neuen Stutzen zu bringen und flog ich innerhalb dreier Minuten nach Lindenthal. Meine gesamte Flugzeit betrug 1 Stunde 52 Minuten. Leipzig—Magdeburg. Ich hatte eigentlich die Absicht, bereits am frühen Morgen nach Magdeburg weiter zu fliegen, konnte dies nicht ausführen, da Benzin in das Kurbelgehäuse gedrungen war. Ich erwartete daher meinen Monteur am Mittag, während ich selbst den Stutzen ausrichten ließ. Als ich um 5Uhr nachmittags zum Platz zurückkehrte, war .mein Monteur bereits fast mit der Arbeit fertig. Ich wollte sofort Benzin einfüllen lassen und nach Magdeburg weiter fliegen, erfuhr aber zu meinem Schrecken, daß 680/90 Benzin auf dem Flugplatz Leipzig und in der nächsten Umgegend, nicht vorhanden war. Ich ließ daher schweres Benzin einfüllen, mußte aber zum meinem Schrecken einsehen, daß ich die Rechnung ohne meinen Motor gemacht hatte. Als ich versuchte zu starten, hob sich der Apparat erst nach einem langen Anlauf vom Boden ab, und als ich eine Höhe von 15 bis bis 20 m erreicht hatte, fing er an durchzusacken. Auch ein zweiter Versuch gelang mir nicht besser. Ich sah daher an diesem Abend von meinem Vorhaben ab. Die Deutschen Flugzeugwerke in Leipzig waren so freundlich, mir von ihrem leichten Benzin abzulassen und kam mein Monteur von dort erst um 11 Uhr abends zurück. Am Morgen des Sonntags, am 27. Juli 1913 lag zuerst Nebel auf dem Leipziger Flugplatz, sodaß ich bis 5 Uhr warten mußte. Ich orientierte mich zuerst nach dem Kompaß. Der Nebel wurde immer dichter. Da ich die Bahnlinie Halle—Cöthen—Magdeburg nach der von mir berechneten Zeit bei meiner Richtung nach Norden und Nordost nicht gefunden hatte, so beschloß ich, direkt nach Osten zu fliegen. Nach einiger Zeit fand ich eine größere Stadt, wo ich zu meiner großen Freude an einer Fabrik angemalt fand „Hallesche — — — —". Von hier aus beschloß ich, direkt nach Norden zu fliegen und die Elbe zu erreichen. Ich erreichte diese in der Nähe von Aken. — Cöthen hatte ich infolge des starken Nebels nicht wahrgenommen. Ich verfolgte dann die Elbe weiter und landete auf einer Koppel in Grünewald bei Schönbeck, *) Wir geben diesen ausführlichen Bericht ungekürzt wieder, da er doch manches enthält, was den Anfänger interessiert. nach einer Fahrt von 1.40 Minuten, da ich Benzin nur für 1.40 Minuten mitgenommen hatte. Ich ließ mir Benzin und Oel bringen und landete nach einem Flug von nur 8 Minuten auf dem Krakauer Anger in Magdeburg. P. Schwandt. Wettbewerbe. Von der Gelsenkirchener Plagwoche. Am 27. Juli begann bei gutem Wetter die Gelsenkirchener Flugwoche. Es flogen: Sablatnig auf Union-Bomhardt-Pfeildoppeldecker mit 120 PS Austro-Daimler, Linnekogel auf 100 PS Rumpier-Mercedes-Eindecker, Krieger auf Harlan-Taube (s. die nebenstehende Abbildung), Stieploscheck auf 100 PS Jeannin-Argus-Stahltaube, Stoeffler auf 100 PS Aviatik-Argus-Pfeildoppeldecker und Beck auf Kondor-Mercedes-Eindecker. Am 28. Juli erreichte Krumsieck auf Gotha-Mercedes-Taube 3200 m Höhe. Um den Früh-, Höhen- und Dauerpreis starteten: Schlatter auf Deutschland-Doppeldecker, Krieger auf Harlan-Taube, Beck auf Kondor-Eindecker, Linnekogel auf Kumpler-Eindecker, Krumsieck auf Gotha-Taube, Weyl auf Otto-Doppeldecker, Stieploscheck auf Jeannin-Stahltaube und Friedrich auf Etrich-Taube. Stieploscheck erzielte mit 119 Minuten die längste Flugzeit. Hiernach folgte Krieger  Von der Gelsenkirchener Flugwodie. Krieger auf der neuen Harlan-Taube im Fluge. mit 118 Min , Stoeffler mit 110 Min., Weyl mit 93 Min. Die größte Höhe erreichte Krumsieck mit 2200 m. Im Flugzeugrennen über 20 km erzielte die kürzeste Zeit Stoeffler. Am 29. Juli war der Himmel stark bedeckt. Verlockend war das Wetter nicht Von dem Sennelager erschienen bereits vormittags die Offiziersflieger Lt v. Osterrath und Lt. Burmeister auf Aviatik-Pfeildoppeldecker, um der Flugwoche einen Besuch abzustatten. Trotz des unsichtigen Wetters machte Krumsieck auf Gotha-Mercedes-Taube in den Wolken einen Höhenflug bis zu 3000 m L'nnekogel auf Rumpler-Mercedes-Eindecker kam auf 1550 m. Die beste Zeit im Flugzeugrennen über 20 km erzielte Stieploscheck auf Jeannin-Argus-Stahltaube mit 11,52 Min. Die meisten Flieger verirrten sich im Nebel und konnten die Wendemarken nicht runden. _____tlPL UGS POET.' No. lö hro . ,Der viert? fluStaK. der 31. Juli, war von herrlichem Wetter begleitet und brachte ausgezeichnete Resultate. Sämtliche Flieger gingen auf große Höhen.  Von der Qelsenkirchener Flugwoche n ^ 1) Unks: L'"nei°gel der mit Passagier auf 4250 m stier Rechts: Krupp von Bohlcn-Halbach mit Gemahlin besucht die Flugwodie.  , Von der Qelsenkirchener Flugwoche. f*°t. m„ Maj., Beschäftigung der Flieger während der Ruhetage. Nach einem Besuch auf der Zeche Alma, vonin*^rp*:K,amsta*, wfyl, FrietJ%Zhrte%?%n% als Fährer, Sablatnig, Stoeffler, Direktor Zeyssig. Linnekogel auf Rumpler-Mercedes-Eindecker erzielte mit Fluggast 4250 m Höhe. Stoeffler auf 100 PS Aviatik-Argus-Pfeildoppeldecker gelangte auf 3400 m Höhe und Krumsieck auf 100 PS Gotha-Mercedes Taube auf 3000 m. Das Flugzeugrennen für Doppeldecker gewann Stoeffler auf Aviatik-Pfeil-Doppeldecker, das erste Eindecker-Rennen Linnekogel auf Rumpier-Mercedes-Taube, das zweite Eindecker-Rennen Krumsiek auf Gotha-Mercedes-Taube. Sonntag, der 3. August, brachte zur Abwechslung wieder bedeckten Himmel und böige Winde. Krumsieck erreichte trotzdem mit seiner Gotha-Taube 2300 m Höhe. Das Doppeldecker-Rennen wurde zur Abwechslung von Weyl auf Otto-Doppeldecker gewonnen. Im ersten Eindecker-Rennen siegte Beck auf 100 PS Kondor-Mercedes-Eindecker, im zweiten Eindecker-Rennen Stieploscheck. Die größte Höhe erreichte wieder Linnekogel'mit 4.000 m.  Der neue Otto-Doppeldecker. Weyl steuerte während der Flugwoche einen neuen Otto-Doppeldecker. Dieser besteht in seinen Hauptteilen aus einem fahrbaren Mittelchassis mit Motorbock, Fahrgestell, Sitzboot und mittlerem Tragdeck. An diesen Teil, welcher auf Bahnmaß dimensioniert ist, wird rechts und links ein Seitenteil angefügt. Der Schwanz hat dreieckige Form zum Zusammenklappen eingerichtet, sodaß die Zerlegung und Verladung des Apparates schnell und einfach vor sich geht. Die TragdeCkenverspannungen sind innenliegend, Benzin- und Oelkessel sind in dem Unterteil des Sitzbootes eingebaut, so daß die Maschine gegenüber den früheren Ausführungen erheblich an Luftwiderstand einspart. Vom Ostpreußischen Rundflug. Die Streckenorganisation des Ostpreußischen Rundfluges ist vollständig festgelegt. Die Flugstrecke ist aus der nebenstehenden Kartenskizze ersichtlich, lieber die teilnehmenden Flieger berichteten wir bereits in der letzten Nummer. Es ist erfreulich, daß in der fernsten Ecke Deutschlands dem Publikum auch etwas von der Fliegerei gezeigt wird. Wasserflugwettbewerb zu Genf. Für das am 9. und 10. August stattfindende internationale Wasserflug-Meeting zu Genf haben bis jetzt gemeldet: Burri: (Donnet-L6veque), Favre (Hanriot), Karmer, der Fluglehrer der Fluggesellschaft von Villeneuve (Sommer), Garbero (Garbero), Scoffier und Devienne (Deperdussin). Verschiedenes. Berechtigung: zum Einjahrig-Freiwilligen-Dienst für hervorragende Flugleistungen. Durch besonderen Erlaß haben die preußischen Minister des Krieges und des Innern bestimmt, daß auf Grund des § 39, 6 der Wehrordnung auch solche jungen Leute zur erleichterten Prüfung für den Einjährig-Freiwilligen-dienst zugelassen werden dürfen, die sich auf dem Gebiete des Flugwesens besonders auszeichnen oder Hervorragendes darin leisten. Dieser Bestimmung haben sich das Königreich Sachsen und das Königreich Bayern angeschlossen. Nach den Beschlüssen derNational-Flugspendekönnendie erforderlichen Leistungen sowohl auf wissenschaftlichem Gebiete, durch neue, für das Flugwesen wichtige Konstruktionen oder Erfindungen dargetan werden, als auch auf rein technischem Gebiete in besonderen Flugleistungen. Außer diesen speziellen Leistungen soll gleichzeitig von den Bewerbern eine genaue Kenntnis der für die Luftfahrt erforderlichen Wissenschaften verlangt werden. Die Prüfung wird von einer fünfgliedrigen Kommission, in der das Kriegsministerium vertreten ist, nach einer Prüfungsordnung vorgenommen. Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind bei der Nationalflugspende zu stellen (Berlin, W. 8, Kronenstraße 61—62). Die „Prüfungsordnung" umfaßt folgende 10 Gebiete: Motorbau und Betrieb, Kenntnis des allgemeinen Aufbaues der Explosionsmotoren und ihrer wesentlichen Bestandteile, Kenntnis der gebräuchlichsten Motorensysteme, Betrieb und Behandlung des Motors, die Betriebsstörungen an Motoren und an ihren Einzelteilen, praktische Kenntnisse, nachzuweisen am PrUfungsmotor. 2. Flugzeuglehre, allgemeine Gesichtspunkte über den Luftwiderstand als tragende und hemmende Kraft in der Flugtechnik und seine Ursachen. Die Größe und Richtung des Luftwiderstandes bei verschiedenen Flächen- und Körperformen, die Einzelteile des Flugzeugs und ihre Bedeutung, Erklärung der einfachsten Gesetze der Festigkeitslehre. 3. Fluglehre. Der Flug, Fliegen unter erschwerten Verhältnissen. 4. Montage und Herstellungsarbeiten an Flugzeugen. Die Prüfung eines Flugzeuges vor dem Fluge in allen Teilen. 5 Wetterkunde. 6. Karten-lesen, Orientierung, Fahrtanlage, das Grundsätzliche über die Geländedarstellung auf der Karte. 7. Kompaßlehre und astronomische Hilfsmittel zur Orientierung. 8. Instrumentenkunde, Kenntnis der Aneroidbarometer und Barographen für Luftdruck- und Höhenmessung etc. 9. Aerztliche Unterweisung und 10. Gesetz und Polizeivorschriften. Bei der Marine-Flieger-Abteilung können ferner die zu Feldpiloten ausgebildeten Si-hüler der Nationalflugspende als Einjährige oder Mehrjährig-Frei- 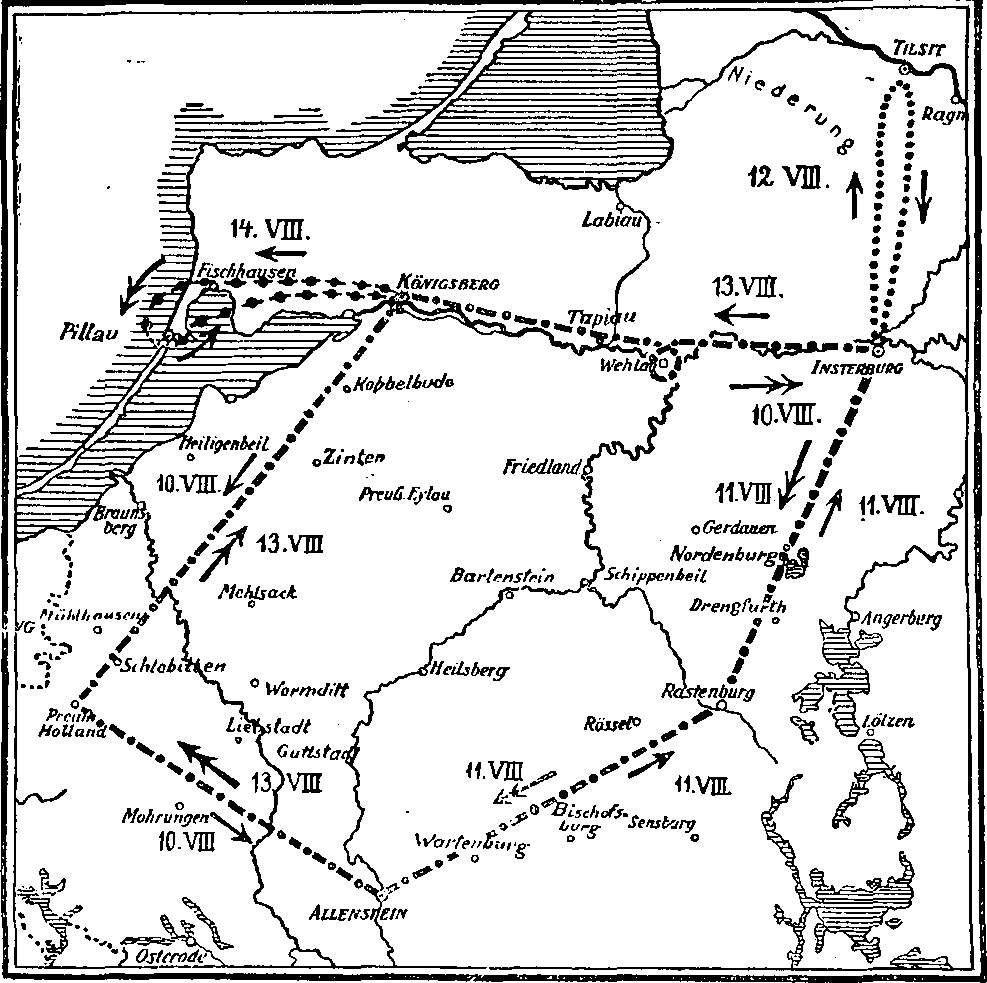 Etappcnflug-c. —> Offizierflieger auf Flugzeuge« der Heeresverwaltung". 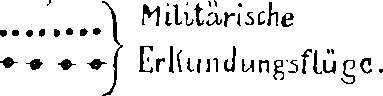 Die Flugstrecke des Osipreußisdien Randflages willige eingestellt werden. Voraussetzung ist die Erfüllung der allgemeinen Eintrittsbedingungen. In bezug auf Körperbeschaffenheit werden die gleichen Anforderungen gestellt, wie an die bei den Matrosendivisionen zur Einstellung gelangenden Mannschaften der Landbevölkerung, kleinstes Maß jedoch 1,57 m. Frankfurter Flugmodell-Verein. Der für den 17. August d. Js geplante Uebermainflug wurde ungenügender Beteiligung wegen bis auf weiteres verschoben. Wir bitten alle diejenigen Mitglieder, die beabsichtigen an dem Darmstädter Modellfliegen teilzunehmen, dies baldigst der Geschäftsstelle mitzuteilen. Uebungsflüge finden jeden Mittwoch Abend ab 8 Uhr und jeden Sonntag Morgen von 7-11 Uhr auf dem Gelände der Rosenausstellung statt. Anmeldungen und Anfragen nimmt Herr Fritz Witiekindj Frankfurt a. M., Eppsteinerstraße 26, entgegen. >v Zuschrift an die Redaktion. (Ohne Verantwortung der Redaktion) Zum Todessturz auf dem Baumann-Freytag-Doppeldecker. Sehr geehrte Redaktion! In der letzten Julinummer Ihrer geschätzten Zeitschrift fühlt sich mein Flugschüler Breitbeil berufen, den Todessturz auf dem Baumann-Freytag-Doppeldecker in Johannisthal zu kritisieren, und zwar in einer Weise, die geeignet ist, meinem verunglückten Kollegen Krastel der Alleinschuld an diesem furchtbaren Unglück zu verdächtigen. Ich bin seit 1. Januar 1913 als Fluglehrer bei der Firma engagiert gewesen und habe sämtliche Maschinen der Firma, es waren deren 3, geflogen; daß aber gerade mein Schüler Breitbeil sich zu dieser Kritik berufen fühlt, ist mir aus folgenden Gründen nicht ganz klar. Herr Breitbeil war z. Zt. des Todessturzes in Untertürkheim, hat also weder das Unglück selbst, noch die gefährlichen Experimente gesehen, die die Katastrophe herbei führten. Außerdem hat er den Todessturz-Apparat nie geflogen. Es gibt offenbar noch immer Eier, die schlauer sein wollen als die Hühner. Flugschüler Breitbeil war mein einziger Schüler, dem ich seit Mitte Januar täglich Unterricht erteilte. Beim ersten Alleinflug, Anfang April, zerbrach er die Maschine schon beim Start und einige Tage darauf demolierte er sie, infolge Kopflosigkeit, vollständig. Bei der Zeitdauer der Ausbildung war allerdings ein anderes Resultat zu erwarten; flog doch mein zweiter Flugschüler schon nach 5 Schulflügen allein, ohne den geringsten Schaden anzurichten. Die Schulmaschinen sind beide schon ein halbes Jahr in Betrieb gewesen, waren also gut eingeflogen und von mir vor jedem Schulflug ausprobiert und eingestellt worden; al60 ganz ungefährlich. Beide Apparate waren ganz gleich konstruiert und stimmten in allen Abmessungen überein. Anders war es bei der Konkurrenz-Maschine, auf der sich der bedauerliche Unfall ereignete. Rumpf, Fahrgestell, auch die Steuerungsorgane, sind in ihren Dimensionen genau dieselben geblieben, nur die Tragfläche wurde um 10 qm vergrößert, und da die Spannweite beibehalten wurde, so ergab sich eine stark vergrößerte Flächentiefe. Jedem Laien muß es doch ohne Rechnung einleuchten, daß bei dem Schema in Abbildung 3, sofort eine Störung eintritt, wenn die Flächentiefe so bedeutend vergrößert wird. Sobald das Schwanzsteuer einer Tragfläche von 32 qm entspricht, kann nicht dasselbe Schwanzsteuer einer Fläche von 42 qm unter denselben Umständen das Gleichgewicht halten. Zweifellos hätte man diese Maschine im Laufe einiger Wochen so einstellen können, daß sie wie die Schulmaschine normal geflogen wäre; allerdings hätten Flieger und Firma Hand in Hand arbeiten müssen und hätten die üblichen Rücksichtslosigkeiten der Firma unterbleiben müssen. Tatsächlich ist nämlich die Maschine unausprobiert nach Johannisthal gebracht worden, denn knapp eine Woche vor dem Transport entschloß man sich, den 4-Zylinder-Motor mit einem 6 Zyl. Mercedes mit 100 kg Zugkraft mehr, zu vertauschen. Die Umbauarbeiten wurden Dienstag abends fertig und Mittwochs früh wurde die Maschine verladen. In Johannisthal erwies sich die Maschine sehr kopflastig, außerdem reagierte sie nicht auf die Verwindung, so daß ich mich weigerte, den Apparat in diesem Zustand weiterhin zu fliegen. Ich hatte wirklich keine Lust, für andere die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Die Firma hatte mir nämlich den Herrn Flieger Hans Krastel als Patentanwalt vorgestellt, ein Geschäftstrik, der auch in UntertUrkheim wiederholt, allerdings ohne Erfolg, angewandt wurde. Tatsächlich war Krastel als Pilot für die neue Maschine engagiert. Mit Erlaubnis ja mit Verlangen der Firma, wurden nun gegen den Willen und trotz aller Vorstellungen des Herrn Professor Baumann, der um das Unglück zu verhüten zweimal nach Berlin kam, unzählige Mal schrieb und schließlich jede Verantwortung ablehnte, an der Maschine die unsinnigsten Abänderungen vorgenommen. Die Firma (N. B. In dem Wort „Firma" ist Herr Prof. Baumann nicht einbegriffen) erreichte durch große Versprechungen, daß Pilot Krastel also flog. Ich, sowie mein Flugschüler Ing. Sido warnten Herrn Krastel allzu ver-trauenseelig vorzugehen und erklärten ihm die bisher entdeckten Fehler und Eigentümlichkeiten des Apparates. Auch die Firma ließ sich nicht warnen; auf alle technische Erklärungen hin wurde gelacht und Krastel vollständig isoliert gehalten. Ich hielt von diesem Augenblick an Krastel's Sturz als unvermeidlich und nur für eine Frage der Zeit; ich machte auch von meiner Ueberzeugung keinen Hehl und war in der Erwartung des schrecklichen Augenblicks, mit einigen Bekannten seit 3 Uhr Morgens auf dem Flugplatz. Von der Ballonhalle aus sahen wir Krastels Proberunde, dann seinen letzten Aufstieg. Mit jeder Runde, es waren deren 6, nahm die Maschine sichtlich an Geschwindigkeit zu und wußte ich aus eigner Erfahrung, daß gerade bei dieser Maschine die Kopflastigkeit mit zunehmender Geschwindigkeit erheblich wuchs. Dazu gesellte sich ein Mißstand, der diesem automatischen System eigen ist; bei zunehmender bezw. abnehmender Geschwindigkeit, entsteht am Steuer, auch bei richtiger Einstellung, ein sehr starker Zug bezw. Druck, den Herr Breitbeil ja selbst mit über 40 kg zugibt. Es war ein prächtiges, vollständig windstilles Flugwetter, entgegen der Behauptung Breitbeils. Krastel stieg auf cirka 80 m Höhe an. Durch den Steuerzug ermüdet plante er eine Landung. Krastel steuerte etwas abwärts bis auf 30 m und erreichte infolge des vollaufenden Motors eine Geschwindigkeit von ungefähr 130 km. Damit war Krastels Schicksal besiegelt. Kurzschluß zum sofortigen Anhalten des Motors konnte er, wegen der vorgenommenen Abänderung nicht betätigen. (Die Symetrie der Maschine war nämlich, durch Verschieben der Tragflächen nach links, in ganz grober Weise gestört worden, so daß bei abgestelltem Motor die Maschine naturgemäß rechts gekippt und mit dem Wald kollidiert wäre.) Es blieb Krastel also nichts weiter übrig, als den Motor durch Gaswegnahme allmählich zu drosseln. Er muß das auch versucht haben; beim Loslassen der einen Hand vom Steuer hat er wohl mit der andern dem Steuerzug etwas nachgegeben. Schon der kleinste Steuerausschlag bei dieser Geschwindigkeit mußte genügen, die Maschine momentan Kopf zu stellen und hat sich auch tatsächlich das Unglück durch Ueberschlagen der Maschine in 25 m Höhe ereignet. Unverständlich ist mir Breitbeils Vorstellung, der einmal behauptet, Krastel hätte beide Hände losgelassen, einige Zeiten später, der Steuerzug habe Krastel das Steuer aus der Hand gerissen, da doch tatsächlich absolute Windstille herrschte. Ich selbst habe die Maschine so und so oft geflogen, war aber jederzeit froh, wenn ich sie glücklich mit beiden Händen und Aufwand meiner ganzen Kräfte unversehrt zum Boden znrückbugsieren konnte. Daß dann Herr Krastel, der bedeutend schwächer war als ich, die Hände frei lassen konnte, zumal er den Apparat bezw. das System zum 2. oder 3. mal flog, ist wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Die Aussagen des Monteurs Hassert sind jedenfalls auf Hallucina-tionen zurückzuführen. Der ganze Artikel Breitbeil könnte als ein Ulk erscheinen, wenn man sich die Unterschrift Otto Breitbeil, stud. ing. besieht; in Wirklichkeit ist er Schlosser von Beruf und besitzt keinerlei technische Schulbildung. Die „seinem" Artikel beigefügten Skizzen und Berechnungen wurden, wie mir Prof. Baumann mitteilt, von dem Techniker der Firma angefertigt. Hochachtungsvoll Hermann Gasser, Fluglehrer der D. F. W. Letzte Mitteilungen. Wie uns soeben telegrafisch aus Paris mi tgeteilt wird, ist der Konstrukteur Deperdussin von den Deperdussin-Werken in Paris am 5. August wegen Finanzschwindeleien verhaftet worden.  Abonnement: Kreuzband M.14 Postbezug M. 14 pro Jahr. Jllustrirte No )7 technische Zeitschrift und Anzeiger 20 AujUlSt für das gesamte mmi „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Teief. 4557 Amt 1. Oskar Ursinus, Civilingenieur. Tei.-fldr.: Ursinus Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8 Erscheint regelmäßig 14tägig. -__ : Zu beziehen durch alle Buchhandlungen = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 3. September. Die Reorganisation des französischen Militär-Flugwesens. (Von unserem Pariser Korrespondenten.) Wie erinnerlich, hat die französische Heeresverwaltung beschlossen, eine besondere Abteilung im Kriegsministerium zu schaffen, welcher das gesamte Armeeflugwesen unterstehen soll, sodaß dessen weitverzweigte Fäden ans ihrer bisherigen Verworrenheit regelrecht an einer einzigen Stelle zusammenlaufen sollen. Man hat im Zusammenhange mit dieser geplanten Maßregel mehrere hervorragende Militärs genannt, die für dieses schwierige und verantwortungsvolle Amt in Aussicht genommen seien, so namentlich den Obersten Cordonnier vom 119. In-fautorie-Regiment, der zwar nicht aus dem Polytechnikum hervorgegangen und kein Techniker ist, dem man aber ein großes Organisationstalent nachsagt. Eine endgiltige Entscheidung über die Besetzung dieses Postens ist noch nicht getroffen, doch können wir versichern, daß Oberst Cordonnier an maßgebender Stelle nicht ernstlich in Betracht kommt, daß vielmehr der General Bernard, welcher gegenwärtig die Artillerie des 7. Armeekorps in Besancon befehligt, aller Voraussicht nach Leiter des französischen Militärflugwesens werden wird. General Bernard genießt den Ruf eines hervorragenden Artillerie-Technikers, er war auch lange Zeit Chef des ersten Bureaus des Generalstabes, sodaß ihm die komplizierten Fragen der Mobilisierung geläufig sein dürften. Aber diese Personenfrage kommt für uns erst an zweiter Stelle. Hier handelt es sich in der Hauptsache darum, zu wissen und festzustellen, was im französischen Flugwesen vorgeht und welche Pläne man mit Bezug auf dessen Reorganisation hegt. In diesem Zusammenhange allerdings ist die Ernennung eines Generals der Artillerie für die Leitung, wie wir nachher sehen werden, charakteristisch. Man hat bekanntlich in der französischen Presse, und mehr noch in den beteiligten Fliegerkreisen, in letzter Zeit heftige Klage geführt über einen „Marasmus" im Militärflugwesen und gar manche Fliegeroffiziere haben in anonymen Zeitungsartikeln auseinanderzusetzen gesucht, wie die herrschenden Zustände den Offizieren jede Lust und Arbeitsfreudigkeit nehmen. Man hat in diesem Zusammenhange von einer „moralischen Krisis" innerhalb des Offizierfliegerkorps gesprochen und, wie aus der Tagespresse bekannt sein dürfte, hat ja auch das Parlament sich auf Anregung einiger Deputierten mit der Frage zu beschäftigen gehabt, allerdings mit anderem Erfolge, als man es sich gedacht hatte: die Deputiertenkammer bereitete dem Militärflugwesen eine Ovation, erkannte dessen Verdienste und Bedeutung für die Zukunft an und überließ es dem neu zu ernennenden Direktor des Flugwesens, die notwendigen Reformen in die Wege zu leiten. Die Vorwürfe, die hier und da gegen die heutige Organisation des französischen Militärflugwesens erhoben werden, können dessen jetzigen Leiter, den Obersten Hirschauer, nicht persönlich treffen, denn dieser sieht sich auf Schritt und Tritt in seiner mühevollen Arbeit durch einen schleppenden Bureaukratismus und durch ein zähes Festhalten an dem hierarchischen Instanzengange gehindert und belästigt. Man stelle sich folgenden Fall vor: in Reims hat ein Offiziersflieger einen Motor nötig. Im Instanzenwege gelangt nach mannigfachen Irrfahrten sein „Gesuch" bis zu dem Inspekteur des Flugwesens, von dem aus dem Konstrukteur der Auftrag erteilt wird. Der Konstrukteur schickt nun den Motor ab, aber nicht etwa nach Reims, wo der Flieger darauf sehnsüchtig wartet, sondern nach Gha-lais-Meudort, nach der Zentraluntersuchungsstelle für das Flugmaterial. Dort wird der Motor, selbstverständlich wenn die Reihe an ihn kommt, auseinandergenommen, worauf seine Einzelteile nacheinander „verifiziert" werden. Dann setzt man den Motor wieder zusammen und konstatiert schließlieh, daß er nicht funktioniert. Jetzt geht eine Reklamation an den Konstrukteur ab ; man schickt ihm den Motor zurück. Dieser nimmt nun seinerseits eine genaue Besichtigung vor und ruft erstaunt; „Aber der Motor ist ja falsch zusammengesetzt!'' Er schreibt an das Atelier in Chalais-Meudon und setzt den Herren auseinander, wo sie den Fehler bei der Wiederaufmontierung des Motors begangen haben. Jetzt wird der Motor zum zweiten Male nach Chalais-Meudon geschickt, dort zum zweiten Male einer hochnotpeinlichen Untersuchung unterzogen und endlich, endlich geht er nach Reims ab, wo der Offizier vier Monate lang auf seinen Motor gewartet hat und mit seinem Flugzeug untätig bleiben mußte! Derartige geradezu burleske Episoden gehören nicht etwa zu den Seltenheiten, sie bilden die Regel. Natürlich hat das in den interessierten Kreisen eine gewisse Müdigkeit und Mißstimmung erzeugt, die schon dadurch rechnerisch zum Ausdruck kommt, daß die Anträge von Offizieren auf Inkorporierung in das Fliegerkorps inner- halb eines Jahres von 81 auf 32 zurückgegangen sind. Daß trotz dieser innerorganisatorischen Mißstände das französische Militärflugwesen eine so gewaltige Entwicklung nehmen und so staunenswerte Resultate zeitigen konnte, spricht für die Vorzüglichkeit des Materials an Fliegern und Flugzeugen. Es ist ganz natürlich, daß man sich schon heute, wo die Person des neuen Leiters des Flugwesens noch nicht offiziell bekannt ist, wo aber die Neuschaffung einer besonderen Ministerialabteilung für diese neue Waffe gesichert ist, die Frage vorlegt, in welcher Weise die Neuorganisation des Militärflugwesens vor sich zu gehen haben werde und vor sich gehen wird. Wir sind da in der Lage, aus zuverlässigster Quelle in großen Zügen die Organisationspläne darzulegen, wie sie das Kriegsministerium hegt und dem neu zu ernennenden Chef des Flugwesens als allgemeine Richtschnur geben wird. In erster Reihe soll der militärische Geist im Flugwesen bei weitem mehr als bisher zur Geltung kommen; der neue Chef soll sich definitiv und energisch von dem hemmenden Bureaukratismus losmachen. Alles zuviel an Sehreiberei und an Verzeichnissen soll fortfallen. Man wird nur das unerläßliche beibehalten, vor allem aber die in Verwaltungsdiensten beschäftigten Flieger ausschließlich dem aktiven Dienste zurückgeben. Mit Rücksicht darauf, daß einige Offiziersflieger unzufrieden und entmutigt sind, daß sie ihren anfänglichen Eifer und das Vertrauen verloren haben, soll das wesentliche Augenmerk darauf gerichtet werden, die Moral unter den Fliegern zu heben. Man wird versuchen, ihnen die Monotonie und die mannigfachen Verdrüsse des Flugfeldlebens zu verkürzen. Die Urlaube sollen häufiger bewilligt und längere Ferienreisen sollen ihnen zugestanden werden. Die bisherige unsichere tastende Disziplin soll erweitert werden. Gleichzeitig wird ihnen die persönliche Mitwirkung ihres Chefs die Größe und den Heroismus ihrer Rolle demonstrieren. Um das Vertrauen der zaghafteren zu befestigen, werden die Generäle, die Obersten der verschiedenen Regimenter aufgefordert werden, häufig als Passagiere an Bord der Militärflugzeuge Platz zu nehmen und Flüge mitzumachen. Die Flieger sollen nicht allein sein, um ihr Leben zu riskieren, die ganze Armee muß sich mit ihnen der gleichen Gefahr aussetzen. Auf diese Weise werden sie auch einen höheren Begriff von ihrem Werte und ihrer Bestimmung erhalten. Noch wichtiger ist, daß die Militärflieger nicht bei ihrer flugsportlichen Vervollkommnung stehen bleiben sollen : Konferenzen und spezielle Kurse sollen für sie veranstaltet werden, durch die ihr Geist für alle Fragen interessiert werden soll. Man wird für sie Themata eines Luft-Felddienstes ausarbeiten. Man wird ihnen taktische Probleme zu lösen aufgeben, in denen das Flugzeug seine wesentliche Rolle zu spielen hat Man wird sie so häufig wie irgend möglich an den Landübungen der Truppen teilnehmen lasssen, damit sie Fühlung mit allen anderen Waffengattungen bekommen und behalten. Man wird sogar soweit gehen, jedem von ihnen die Spezialmission zu präzisieren, die ihm im Kriegsfalle zufallen wird. Beispielsweise wird ein Fliegeroffizier wissen, daß er von Ausbruch eines Krieges an die Verbindung zwischen zwei bestimmten Korps zu sichern, oder die Bewegung des Feindes in einer bestimmten Gegend zu über- wachen oder aber einen bestimmten Weitflug von 400 km auszuführen haben wird. Man will sogar von Zeit zu Zeit eine Art „Generalprobe" anstellen, bei der dann die Flieger unter möglichst kriegsähnlichen Bedingungen zu zeigen haben werden, wie sie die ihnen zugeteilte Aufgabe zu lösen versuchen. Der Offiziersflieger soll sich mit seiner Mission, mit der dafür in Frage kommenden Gegend vertraut machen. Gleichzeitig soll eine Umbildung des Fingzeugmaterials vorgenommen werden. Welche Dienste auch immer das Beobachtungs-Flugzeug zu leisten vermag, die französische Heeresverwaltung hat sich neuerdings, und das ist der springende Punkt dieser Auseinandersetzung, zu der Ueberzeugung bekehrt, daß das Flugzeug unter allen Umständen eine Angriffswaffe werden muß. Und hier sind zwei Lösungen von einander getrennt zu halten: daß die französische Regierung sich dahin entschieden hat, ihre Flugzeuge zu panzern, war schon mitgeteilt worden. Sie ist dazu durch zweierlei Erfahrungen veranlaßt worden: 1. durch die Schießübungen, welche gegen Flugzeuge in Toulon vorgenommen wurden; 2. durch die Resultate des ersten ßalkankrieges. Man hat festgestellt, daß innerhalb einer Sphäre von 0 bis 1200 Meter jedes Flugzeug erreichbar war und daß andererseits bei dem gegenwärtigen Beobachtungssystem die Flugzeuge in einer Höhe zwischen 600 und 800 Metern fliegen müssen, wenn sie sich von dem Rechenschaft geben wollen, was auf der Erde vorgeht. In dem bisherigen Zustande konnte demnach das Flugzeug und seine Insassen einer Beschießung durch Artillerie oder auch durch Infanterie nur schwer entgehen. Es mußte demnach ein Mittel gefunden werden, um die Gefahren im Kriege zu vermindern, und zur Erreichung dieses Zweckes konnten zwei Lösungen ins Auge gefaßt werden : entweder mußte man alle Flugzeuge panzern, sie mit einer zweckentsprechenden Panzerung verkleiden, welche Insassen, Motor und die wesentlichen Steuerungsorgane schützt oder aber nur die eigentlichen Angriffsflugzeuge panzern und die Beobachtungsflugzeuge in 1200 Meter Höhe segeln zu lassen, wobei der Beobachter im Rumpf des Flugzeugs lang ausgestreckt liegen mußte, sodaß natürlich auch die Beobachtungslinsen dementsprechend angebracht werden müßten. Nach langem Zögern und Beraten hat sich die französische Heeresverwaltung für die erstere Lösung' entschieden. Sämtliche Kampfflugzeuge werden in Zukunft gepanzert werden. Die nicht gepanzerten Maschinen werden ausschließlich Uebungszwecken dienen. Hierbei sei erwähnt, daß eine besondere Verfügung erlassen worden ist, wonach die Erfahrungen, die mit den neuen gepanzerten Flugzeugen gemacht werden, streng geheim zu halten sind! Die französische Kriegs-Luftflotte wird sich nun nach den neuesten Entscheidungen aus folgenden Gattungen zusammensetzen: 1. gepanzerte Einsitzer für Rekognoszierungen für Artillerie und Kavallerie, mit einer Geschwindigkeit nicht unter 120 km die Stunde; 2. gepanzerte Zweisitzer für Stabs-Rekognoszierungen mit einer Mindestgeschwindigkeit von 100 km die Stunde; 3. gepanzerte Zweisitzer, mit Mitrailleusen und Maschinengewehren armiert, welche die Aufgabe haben, feindliche Flugzeuge und Lenkluftschiffe zu verfolgen, mit einer Geschwindigkeit von nicht unter 120 km die Stunde; 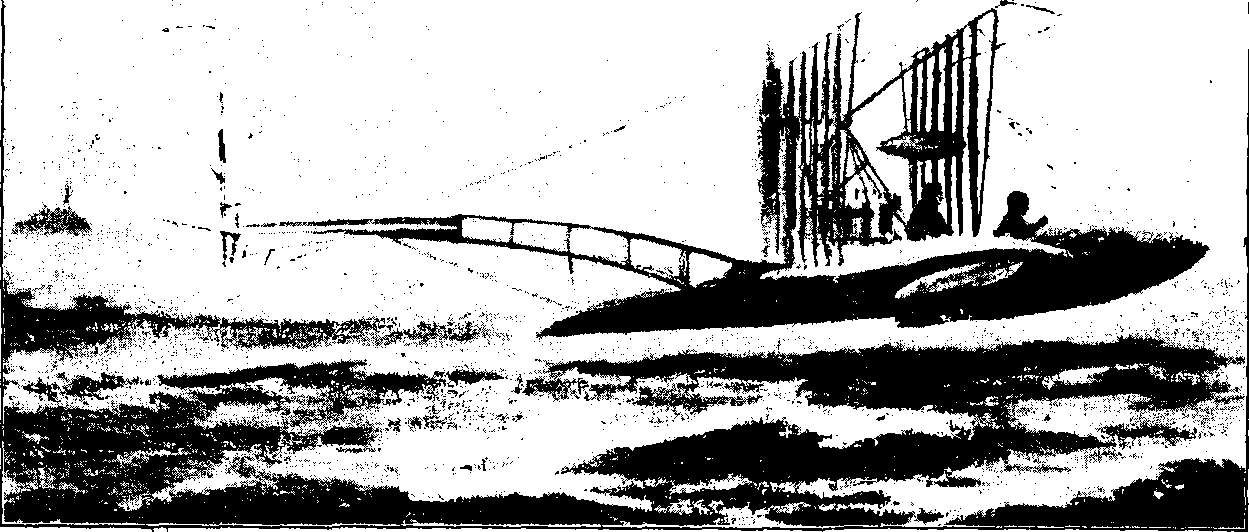 Wigwam-Flugboot. (England)  Flugzeagparade in Farnborough (England). die Möglichkeit geben, anzugreifen und zu zerstören. Wenn der Krieg ausbricht, so werden die Flugzeuge über die Grenze gehen, um die Mobilisierungsmaßregeln auszukundschaften. Sie werden aber 4. Mehrsitzer, schwere Maschinen, von großem Aktionsradius, mit einer Mindestgeschwindigkeit von 100 km, „für spezielle Missionen". Diese „speziellen Missionen" sind es, von denen noch einige Worte zu sagen sind. Man hat in hiesigen Militärfliegerkreisen in folgender Weise die Dinge dargestellt, und damit kommen wir zu der oben erwähnten zweiten Lösung des ganzen Problems des Militärflugwesens: die Flugzeuge abpanzern, wie nunmehr endgiltig beschlossen worden ist, genügt noch nicht. Man muß ihnen außerdem -—ϖϖ----—ϖϖ---:- nur recht mittelmäßige und bedeutungslose Auskünfte von diesen Rekognoszierungsflügen heimbringen können. Was werden sie in Wirklichkeit berichten? „Da unten, die zehn oder elf strategischen Eisenbahnlinien entlang, passiert alle zwanzig Minuten ein Eisenbahnzug mit Mannschaften und mit Material. In dieser oder jener Station kommt jede zwanzig Minuten ein Zug an und Mannschaften, Pferde und Geschütze werden ausgeladen. Alles das konnte man aber ohnedies voraussetzen. Das Kriegsflugzeug hat eine andere wichtigere Rolle. Man denke sich, daß das Flugzeug jenem Eisenbahntransport auf seiner Fahrt folgen, auf ihn einen Hagel von Projektilen herniederfallen und wenn möglich eine Entgleisung hervorrufen kann, welche auf jeder der zehn oder elf strategischen Linien einen Zeitverlust von einem halben Tag oder vielleicht von noch mehr verursachen würde, sodaß der feindliche Aufmarsch eine beträchtliche Verzögerung erlitte. Das gebe einen unschätzbaren Vorsprung! Diese Idee hat in den maßgebenden Kreisen immer weitere Fortschritte gemacht und heute beschäftigt man sich ernstlich mit ihrer Realisierung. Das also sind die „speziellen Missionen", auf welche in dem skizzierten Reorganisationsplan hingedeutet wird .... Einige Stellen hier gehen frei ich noch weiter und ihnen ist die geplante gigantische Reform des Militärflugwesens noch nicht weitgehend genug. Sie verlangen, daß gleichzeitig sämtliche Flugzeuge, welche die französische Armee besitzt, vollständig erneuert werden. Es seien auch nicht genügend Flugzeuge vorhanden. Jeder Flieger muß deren zwei für seinen Gebrauch haben: eines welcher der eigentliche Kriegsapparat ist, das andere als Manöver-Apparat. Und dazu kämen noch die zahlreichen Flugzeuge, welche als Lehr- und Demonstrationsapparate notwendig sind. Außerdem käme in Betracht, daß jedes Flugzeug, welches nicht imstande ist, zwei Personen auf wenigstens 400 bis 500 km zu transportieren, ohne sich von neuem zu verproviantieren, im Kriege häufig unbenutzbar sein dürfte. Nun gibt es 'aber gegenwärtig unter den Flugmaschinen der französischen Militärverwaltung nur sehr wenige Zweisitzer, welche dieser Bedingung nachzukommen vermögen. Natürlich verlangen alle diese offizielle und offiziöse Reformen seitens des Landes große Opfer, gegen die sich das Parlament aber sicherlich nicht sträuben wird, weil hier das Bewußtsein von der gewaltigen Bedeutung des Flugwesens für die Sicherheit des Landes zu tief eingewurzelt ist. Es gibt heute keinen verständigen Franzosen, der nicht auf dem Standpunkt steht, der sich kurz so zusammenfassen läßt: „Die wunderbare Entwicklung unseres Flugwesens hat sich rapid vollzogen, schneller als es selbst die beteiligten Kreise zu hoffen gewagt haben und sogar zu schnell, als daß die Organisation Schritt zu halten vermochte. Wir können fliegen und wir haben Flugmaschinen, aber wir haben keine Organisation." Und diesem Mangel soll nun in radikaler Weise abgeholfen werden. Kompliziert werden alle Reformpläne durch die Geltendmachung gewiß nicht unberechtigter Wünsche seitens der Zivilflieger, die in dem Maße, wie sich ihre Lage ständig ungünstiger gestaltet, umso lebhafter ihr Rocht gegenüber dem Lande vertreten. Jacques Balsan, der Präsident der Association Generale Aeronautique, hat dieser Tage eine Audienz bei dem Kriegsminister gehabt, in welcher die Frage der Zivilflieger, die seit langer Zeit die Schaffung eines Flieger-Reservekorps erwarten, eingehend besprochen wurde Er wies den Minister darauf hin, daß es undenkbar sei, daß Frankreich im Falle eines Krieges nicht aus dem Talent, der Begeisterung und der Befähigung der Zivilflieger Nutzen ziehen sollte für das ganze Land. Im November vorigen Jahres bereits ist bekanntlich ein entsprechender Gesetzentwurf im Kriegsministerium ausgearbeitet worden, aber bisher ist die Sache nicht vorangegangen, obgleich gewisse Fliegerkreise, allen voran der bekannte Alfred Leblanc, zugunsten jenes Gesetzes eine außerordentlich eifrige Agitation entfalten. Leblanc verlangt die Schaffung eines Zivilfliegerkorps, eine ausreichende staatliche Unterstützungskasse für die Flieger und eine staatliche Verantwortung für die Hinterbliebenen der Opfer des Flugwesens Alfred Leblanc wendet sich nun jetzt an die Oeffentlichkeit, um die Sympatien der Allgemeinheit für die von ihm vorgeschlagene Reform des Zivilflugwesens zu erwecken. Er weist auf zwei besonders markante Fälle hin: der Witwe des verunglückten Nieuport, welche in mißlichen 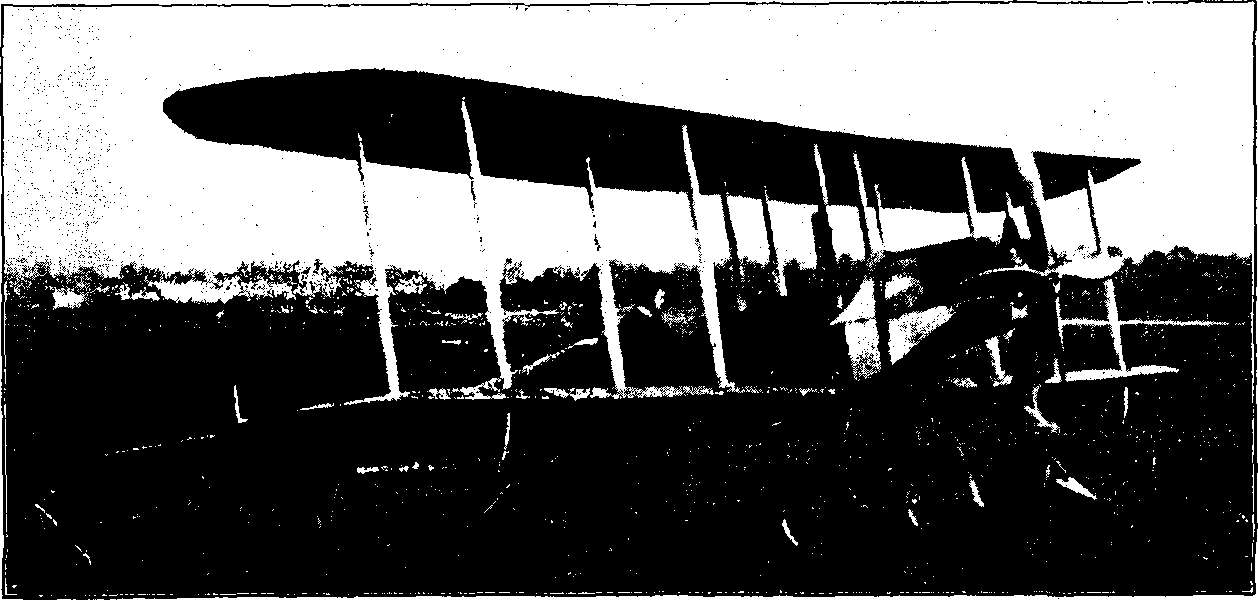 Neuester englischer Militär-Doppeldecker BE 2, hergestellt von den Kßnigl. Fiagzeugfabriken, sogenannter geräuschloser Biplan (Auspuffiopf). Verhältnissen zurückgeblieben ist, hat die Regierung, um sie vor Not zu schützen, einen staatlichen Tabakverschleiß versprochen, auf den sie nun seit zwei Jahren wartet! Und die Witwe Bertins, der mit seinem Sohne neulich verunglückt ist, hat sich eben an die öffentliche Mildtätigkeit wenden müssen. Mit Recht sagt Leblanc, daß derartige Dinge eine unerhörte Undankbarkeit gegenüber eleu Pionieren des Flugwesens bedeuten. „Der Staat muß die Zukunft unserer Flieger und deren Angehörigen sichern. Dank unseren Fliegern hat sich Frankreich wiedergefunden. Es hat freudig gebebt, als es seine rapiden Riesenvögel vorüberziehen sah, auf die es seine ganze Hoffnung gesetzt hat. Es hat begriffen, daß der französische Geist und der französische Charakter, aus Kühnheit, Initiative, Mut und Opfersinn bestehend, sich niemals in so hohem Maße betätigt hat, wie in diesem Augenblick: allein unter allen Nationen hat Frankreich hunderte von Fliegern sich in die Lüfte erheben sehen, welche ihr Vaterland bewundern, fürchten und respektieren machen. Frankreich hat eine neue Popularität erlangt. Es muß dafür zahlen. Es kann nicht, es darf nicht die Familien jener Männer subsistenzlos lassen, die für ihr Vaterland gestorben sind." El. Aus den englischen Flugzentren. (Von unserem englischen Korrespondenten.) Aldershot, den 14. August 1913. Das englische Armee-Flugwesen hat mit der Einrichtung eines Armee-Luft-Departements große Fortschritte gemacht. Die Meldung von der Ernennung General Henderson's, dem Direktor der Royal Aircraft Factory, einem eifrigen Förderer des Flugwesens, zum Generaldirektor des neuen Departments, fand ungeteilten Beifall. Kaum hatten sich die erregten Gemüter ob dieser frohen Kunde ein wenig beruhigt, da stürmt unerwartet eine neue Sensation heran. Der Marineminister Winston Churchill machte bekannt, daß die Admiralität sich nunmehr entschlossen habe, eine neue Marine-Luft-Verwaltung ins Leben zu rufen und eine Flotte von 200 Wasserflugzeugen einzurichten. Bestellungen auf Wasserflugzeuge seien bereits an viele englische Firmen ergangen. Da die Zahl der in Frage kommenden englischen Firmen jedoch sehr gering ist, habe man das Ausland mit der Lieferung einer Anzahl Maschinen betraut. In der Nähe von Chatham sollen in kurzer Zeit neue Flugzeugwerke errichtet werden, woselbst die Marine in Zukunft ihre eigenen Maschinen konstruieren wird. Laut einem» herausgegebenen Memorandum werden Wasserflugzeuge von jetzt ab „Seaplanes" und Landflugzeuge kurzweg „Planes" genannt werden. Sämtliche Flugzeuge sollen mit Apparaten für drahtlose Telegraphie ausgerüstet werden. Einige Erfolge von der Verwendung von Wasserflugzeugen während der großen Flottenmanöver sickern nun allmählich durch, so befand sich ein zu der blauen, verteidigenden Flotte gehöriger Fliegeroffizier der Station Cromarty auf einem Rekognoszierungsfluge und entdeckte ein zu der feindlichen Flotte gehöriges Unterseeboot, welches die auf der Höhe von Cromarty vor Anker liegenden Schiffe zu attackieren versuchte. Durch den Report des Fliegers veranlaßt, lief eine TorpedoflOttilie aus und überraschte das Unterseeboot, nahm die Mannschaft gefangen und brachte das eroberte Fahrzeug in den Hafen ein. Am 6. er. flog die zu Leven provisorisch eingerichtete Marineflngsektion, bestehend aus 3 Short- und 2 Borel-Wasserflugzeugen nach ihrer neuen Station zu Port Leton, der Marineflugbasis Firth of Förth in Schottland. Ein neuer Sopwith Tractor-Wasserdoppeldecker gelangte an demselben Tage zur Ablieferung an die Sektion Calshott und ein weiterer an die Sektion Cromarty, ein dritter nach Yarmouth und ein vierter nach der Isle of Grain, in der Mündung der Themse. Vier Borel-Wassereindecker gingen in den Besitz der Marine über, von deren Bestimmungsort jedoch noch nichts an die Oeffentlichkeit gedrungen ist, und mit einem Denhaut-Borel-Flngboot werden augenblicklich Versuche angestellt, deren Resultate abzuwarten sind. Auch die Armeeflieger entwickeln sich systematisch fort. In den in Ayrshire stattgefundenen Territorial-Manövern nahm die in Montrose stationierte 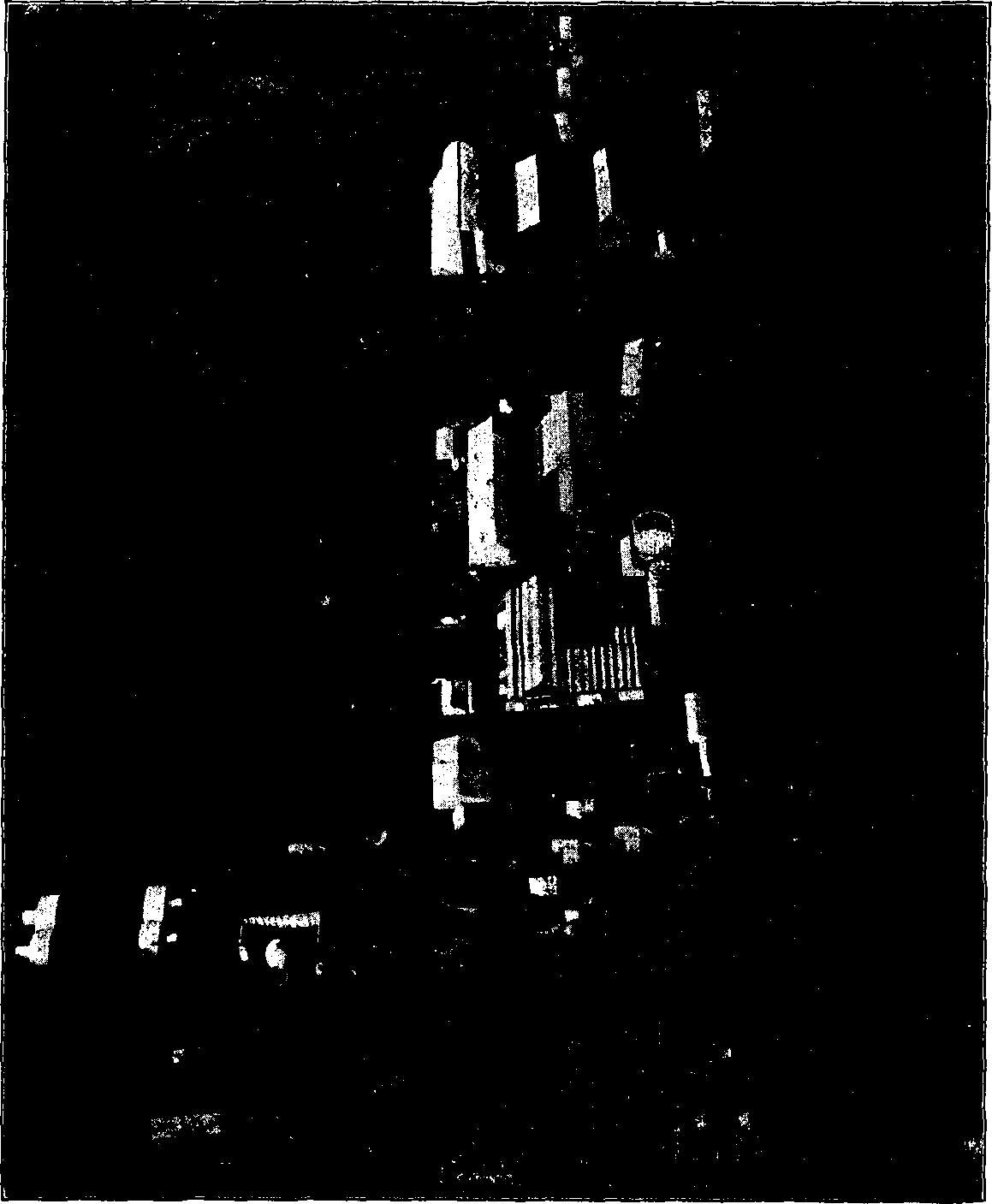 Die Royal Aircraft Factory, England (KJinigl. Flugzeugwerke), . aufgenommen aus einem Cody-Doppeldecker. 2. Flugsektion, bestehend aus 6 „BE"- und 6. M. Farman-Doppel-deckern, erfolgreich teil, und kehrte auf dem Luftwege nach ihrer Station zurück. In den am 22. September beginnenden großen Herbstmanövern sollen sämtliche in der Armee befindlichen Flugzeuge zur Verwendung kommen. Da jedoch der im Vorjahre bei den Fliegerabstürzen erlassene Bann an Eindecker noch nicht aufgehoben worden ist, kommen nur Doppeldecker in Frage. Die große Schiffswerft von Armstrong und Witworth zu Newcastle hat jetzt gleich Vickers Sons und Maxim eine Flugzeug-Abteilung eingerichtet, und konstruiert unter Kontrakt Flugzeuge für die Heeresverwaltung. 15 Apparate werden in den nächsten Tagen von dieser Firma zur Ablieferung gelangen. Ebenso haben die Firmen Handley-Page, Hewlett und Blondeau, und Saunders Bestellungen auf je 5 Flugzeuge erhalten. Weitere 15 sind bei der Coventry Ordnance Aero-plane Co. in Auftrag gegeben. Sämtliche Apparate sind von dem berühmten, geräuschlosen „BE." Typ, entworfen von den Königlichen Flugzeugwerken. Daß auch die deutsche Flugzeug-Industrie hier in England allmählich Fuß faßt, beweisen folgende Zeilen. Schon vor längeier Zeit ging ein Flüstern durch die englischen Fliegerkreise, daß demnächst eine deutsche Flugmaschine auf dem Flugplatze in  Oberst Cody's neuester Wasser-Doppeldecker. Hendon erscheinen werde. Wir sind nunmehr in der Lage, v.w berichten, daß eine Gesellschaft gegründet worden ist, die den Bau einer deutschen Maschine in England betreiben wird und zwar ist der Apparat ein Wesipfhal-Emdeckeri Der 7. August war ein schwarzer Tag für das englische Flugwesen. Colonel Samuel Franklin Cody, Englands populärster und erfolgreichster Flugmaschinenkonstrukteur und Flieger ist nicht mehr. Oberst Cody machte in den Morgenstunden auf seinem neuen Wasserdoppeldecker, mit dem er sich um den Daily-Mail-Preis bewerben wollte, auf der Laffans Piain, in der Nähe von Aldershot, Probeflüge, bei denen ihn der Leutnant Evans vom Egyptian Civil Service, als Fluggast begleitete. Cody hatte bereits 70 Meilen auf der Maschine zurückgelegt und war im Begriffe dieselbe auf dem Luftwege nach Southampton, dem Ausgangspunkte des Wettbewerbes, zu bringen. Einige male Aldershot umkreisend, flog der Apparat in der Richtung nach Cove Common davon. Plötzlich, ohne jedes vorherige Anzeichen, klappten die Tragflächen gleich einem Buche nach oben zusammen, und der Apparat stürzte mit rasender Geschwindigkeit in die Tiefe. Durch den gewaltigen Ruck wurde der Flieger aus seinem Sitze geschleudert und man fand ihn ungefähr 24 Meter von der Maschine entfernt im Grase liegend, tot vor, ebenso wurde sein Fluggast tot unter den Trümmern der Maschine hervorgezogen. Nach den Berichten von Augenzeugen habe sich Evans 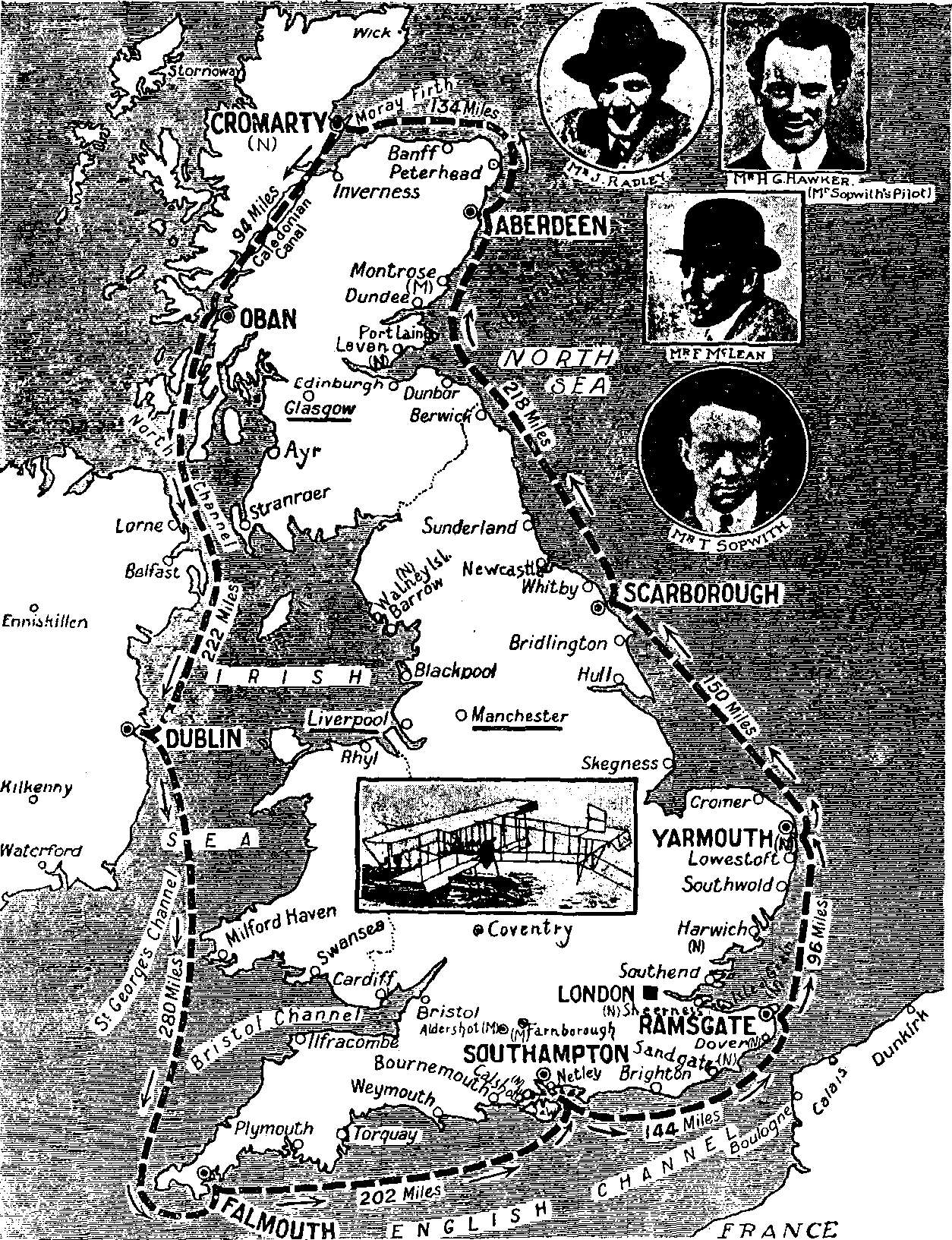 Vom Randflug um die britischen Inseln. plötzlich mit beiden Händen an dem vor ihm sitzenden Flieger festgehalten, derselbe dadurch die Kontrolle über die Maschine verloren, wodurch die Katastrophe herbeigeführt wurde. Vielbesprochen wird hier der Arrest Armand Dep6rdussin und scheinen die Manipulationen dieses Schwindelgenies auch hier zum Verhängnis geworden zu sein. Die British Deperdussin Aeroplane Company ist in Konkurs geraten. Ob dies jedoch irgend etwas mit der französischen Geschichte zu tun hat, bleibt abzuwarten. Ein ungewöhnliches Abenteuer ereignete sieh auf der Nordsee. Der Kapitän des sich auf der Reise nach London befindlichen Dampfers „Clara Menning", der Rostocker Reederei Zelck, gewahrte plötzlich ein auf der Wasserfläche treibendes Flugzeug Die „Clara Menning" setzte unverzüglich ein Boot aus, welches das Flugzeug längsseits schleppte, worauf man dieses mit dem Ladebaum auf Deck setzte. Die Flieger, welche unverletzt geblieben waren, erklärten, daß sie einen Motordefekt erlitten hätten. Sie waren in Yarmouth aufgestiegen und etwa hundert Meilen geflogen. Die Admiralität erklärte, daß die beiden Flieger Offiziere der eng iohen Marine seien, die vom britischen Kriegsschiff „Hermes 'ϖ in der Themsemündung mit dem Seeflugzeug 81 (Short) aufgestiegen waren. Die Hermes versuchte ihnen zu folgen, doch war die Geschwindigkeit des Flugapparates zu groß für sie. Infolge des Motordefektes waren die Flieger gezwung.-n, anzuwässern und waren ohne das Hinzukommen des deutschen Dampfers dem Tode des Ertrinkens preisgegeben. Die Offiziere wurden an Bord des Hermes übernommen und nach Yarmouth zurückgebracht. In ihrem Raporte an die Admiralität äußerten sich die beiden Flieger lobend über das Verhalten der „Clara Menning". Am 11. August flog der Flieger Felix auf einem automatisch stabilen Dunne-Doppeldecker bei heftigem Winde von Eastohurch (Isle of Sheppei) mit einer Zwischenlandung bei Versailles, nach Villacoublay. Der Flieger sagt aus, daß er während des Fluges die meiste Zeit geschrieben habe, währenddem sich die Maschine selbst steuerte?! Diese Aussagen erscheinen jedoch sehr zweifelhaft. Die englische Heeresverwaltung schenkte der Erfindung des Leutnants Dünne bekanntlich keine Beachtung und hatte derselbe alsdann sein Patent nach Frankreich verkauft. Nach diesen neuen Erfolgen jedoch widmen die Zeitungen der Erfindung lange Artikel, worin von Englands verlorenem Geheimnis viel die Rede ist Für den Rundi'lug um die britischen Inseln, für den die Daily Mail einen Preis von 100000 Mark aussetzte, und der, wenn diese Zeilen in Druck gehen, bereits begonnen hat, (oder ein Fiasko wird), sind nur drei Meldungen abgegeben worden. Genannt sind folgende Appnrate: Sopwith Tractor Doppeldecker (Führer Hawker, Inhaber des Höhenrekords mit drei Fluggästen, mit T. Sopwith als Fluggast), Radley Doppeldecker, (Führer Gordon England, Fluggast James Radley) und Short Doppeldecker, (Führer Mc. Clean Fluggast unbekannt). Das Rennen ist für Wasserflugzeuge bestimmt und nur für britische Konstruktionen offen. Jede Maschine muß außer dem Führer noch einen Fluggast an Bord haben. Kontrollstationen sind eingerichtet in Netley, (Southampton Gewässer) Ramsgate, Yarmouth, No. 17__llZLU_G_SJ10JRT.^______SeiteJ315 Scarborougth, Aberdeen, Cromartey, Oban, Dublin und Falmouth. An jeder Kontrollstation müssen die Teilnehmer 30 Minuten Aufenthalt nehmen. Im übrigen muß der Flug in 72 Stunden vollendet sein. Je fünf Teile des Motors und des Flugzeuges werden plombiert und min- 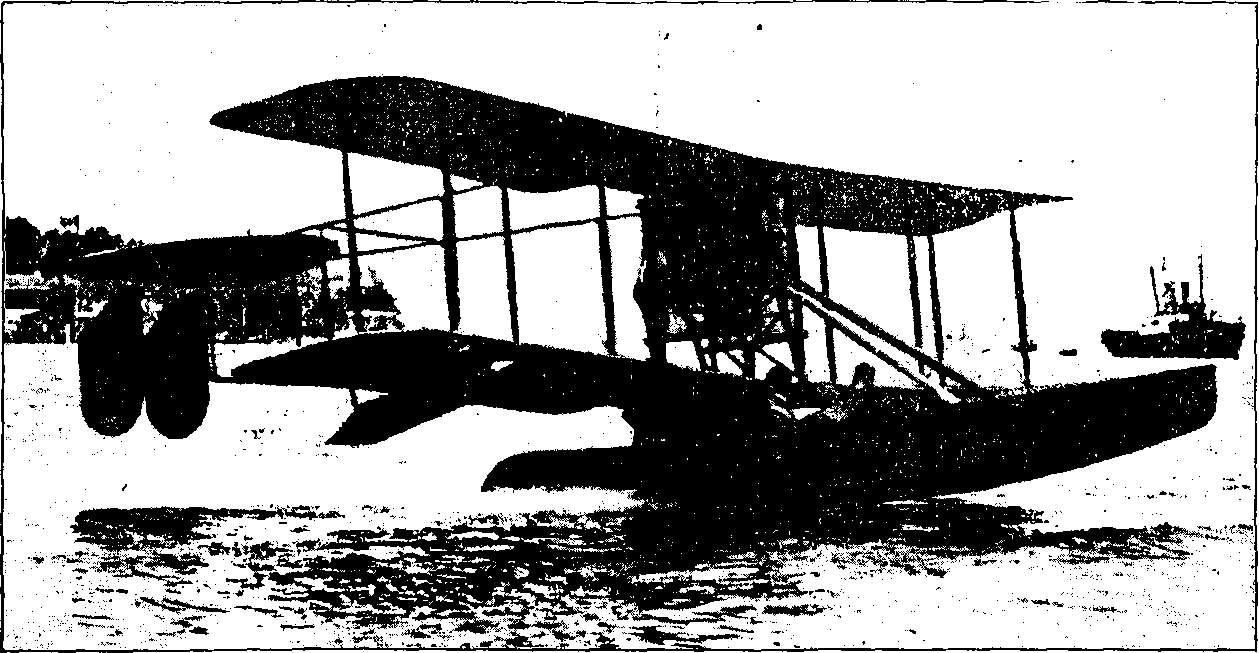 Sopv/ith-F/ugboot, Gewinner des Mortimer Singer-Preises (England). 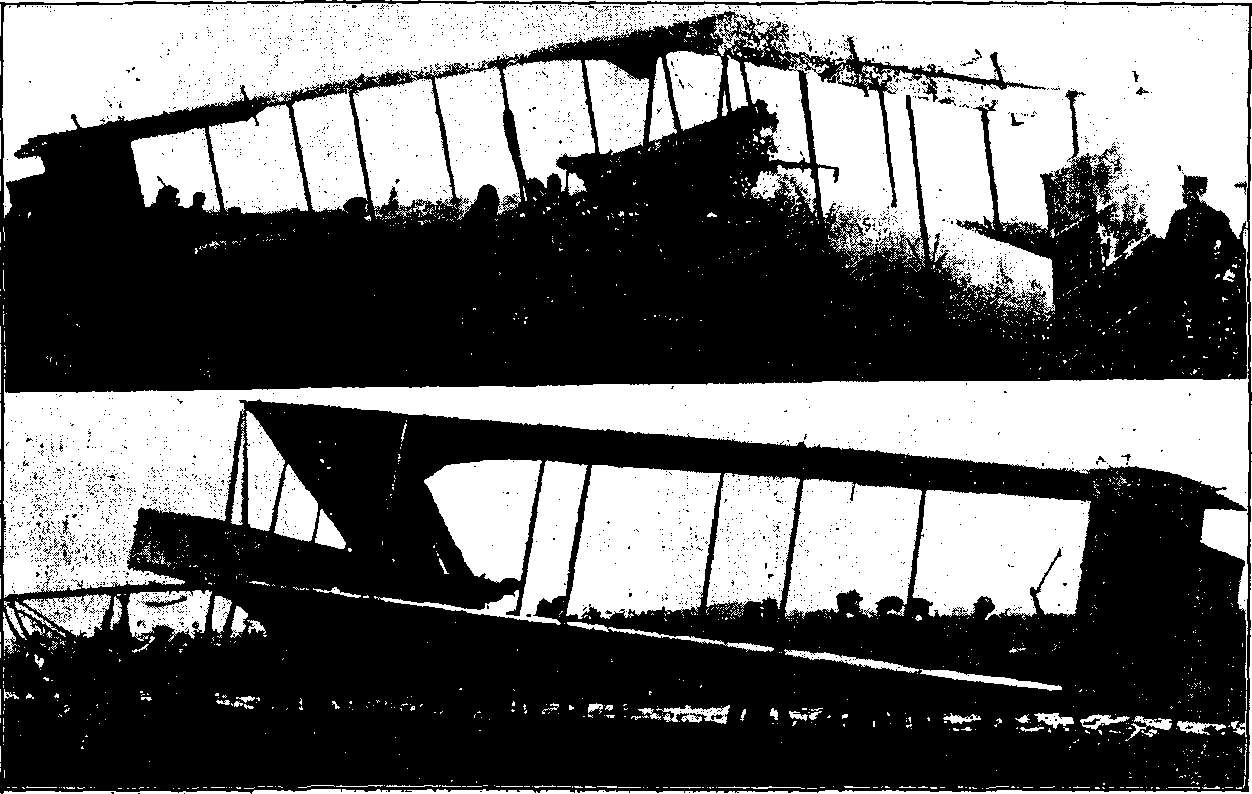 Nieuport-Dunne-Eindedier mit 80 PS Onom-Motor, mit dem Felix von Eastdiurdi nach Villacoublay flog. destens zwei dieser Teile müssen nach Beendigung einer Teilstrecke intakt sein. An jeder Kontrollstation dürfen die Konkurrenten Reparaturen ausführen und Betriebsstoff aufnehmen. Führer und Fluggast können während des Rundfluges wechseln. D. Seite 616 „FLUGSPORT. Nr. 17 Der( Caudron-Wasserzweidecker. (Hierzu Tafel XXII.) Der Caudion-Wasserzweidecker ähnelt in seiner Form der Landmaschine, die bereits in „Flugsport" Nr. 1, Seite 15, Jahrgang 1913 eingehend beschrieben wurde: Originell und einfach ist das kombinierte Landungs- und Wasserungsgestell. Es besteht aus zwei Schwimmern von 0,6 m Breite, 0,45 m Höhe und 3,6 m Länge. Unweit der Schwimmermitte befindet sich eine 1,50 m hohe Stufe, hinter derselben ein vertikaler Schacht, in welchem ein 550 mm hohes Rad läuft. Ueber die Schwimmer sind zwei Stahlrohre gelegt, von denen das eine feststeht und das andere mittels Gummischnurumwicklung am Untergestell abgefedert ist, sodaß ein und dieselbe Abfederung den Landungs- und "Wasserungsstoß aufnimmt. Zum Schutze des Schwimmerbodens ist auf demselben eine vorspringende Kufe gebildet. Ueber der Schwimmeranlage befindet sich die anderthalbdeckerartig übereinander angeordneten Tragflächen. Dieselben besitzen eine Tiefe von 1,5 m. Das Oberdeck hat eine Spannweite von 12,8 m und einen Flächeninhalt von 18,5 qm. Das Unterdeck hat nur eine Spannweite von 8,4 m und einen Flächeninhalt von 12,5 qm, sodaß sich ein Gesamtflächeninhalt von 31 qm ergibt. Zur Unterstützung der Tragflächenenden sind 2 zylindrische Stützschwimmer angeordnet. In der Mitte der Tragzelle befindet sich ein kurzer verjüngter Motorrumpf. Dieser trägt vorn auf fliegender Welle einen 80 PS Gnommotor, auf dessen Schraubenwelle eine Luftschraube von 2,6 m Durchmesser sitzt. In der Mitte des Rumpfes sind die Betriebsstoffbehälter und der Sitz des Fluggastes angeordnet. Am verjüngten Rumpfende ist der Führersitz und die Steuerungsanlage vorgesehen. Dieselbe wurde bereits eingehend in Tafel II Nr. 1 dargestellt. Ein leichter Gitterträger bildet die Verbindung von den Haupttragflächen mit der Schwanz» fläche. Der Gitterträger endigt in 2 Schleifkufen, welche die Umrahmung der dreieckförmigen Schwanzschwimmer bilden. Die Schwanzfläche kann wie bei der Landmaschine eingestellt werden und ist 5,5 qm groß. Die Seitensteuer sind sphärisch dreieckig und haben insgesamt 1,2 qm Flächeninhalt. Die Geschwindigkeit der Maschine beträgt 110 km pro Stunde. Infolge ihrer Leichtigkeit eignet sie sich vorzüglich als Sportmaschine. Ihr Gewicht beträgt 450 kg. Abfliegen von einem Drahtseil nach Louis Bleriot. Das Anwendungsgebiet der Flugmaschine wäre ein viel größeres, wenn nicht der für den Anlauf und Landung erforderliche Kaum Bedingung wäre. Die Konstrukteure haben daher, um das Anwendungsgebiet zu vergrößern, bereits seit langer Zeit gesucht, hierfür einen Ersatz zu finden. Man konstruierte für die Verwendung der Flug' maschinen auf Kriegsschiffen besondere Startvorrichtungen, entweder solche, bei denen die Flugmaschine durch eine aufgespeicherte Kraft in die Luft geschleudert, oder solche, bei denen die Anlaufbahn durch ein Drahtseil ersetzt wurde. Die Versuche, von einem Drahtseil abzufliegen, wurden von Curtiss seiner Zeit bekanntlich mit Erfolg durchgeführt und zwar balancierte die Flugmaschine, der Curtiss-Zweidecker, in Bollen laufend auf einem Drahtseil. 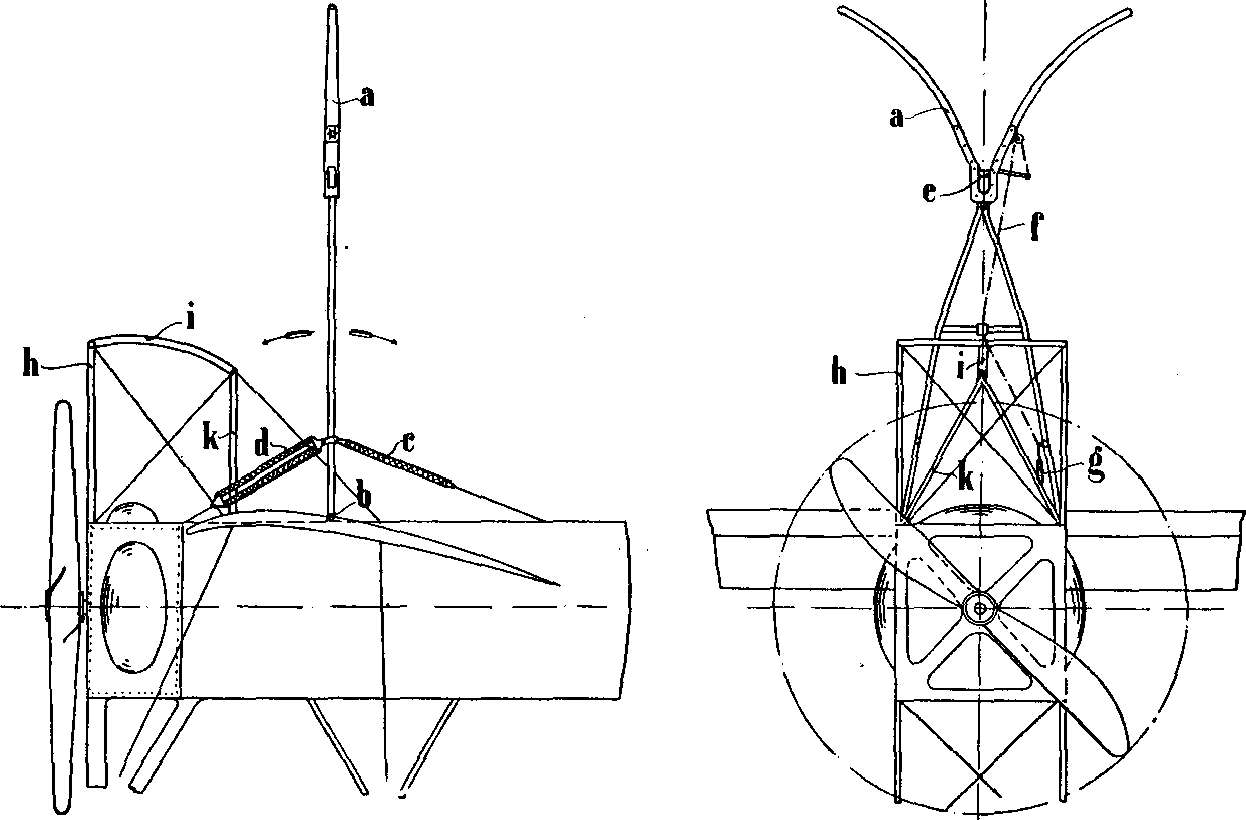 Abb. 1. Neuerdings hat nun Bleriot eine neue Drahtseil-Startvorrichtung konstruiert und mit Erfolg versucht. Im Gegensatz zu der Curtiss' sehen Startvorrichtung befindet sich der Schwerpunkt der Maschine nicht über, sondern weit unter dem Drahtseil. Die Drahtseil-Einrichtung ist folgendermaßen hergestellt: Zwischen zwei 20 m von einander entfernten Masten ist ein starkes Drahtseil gespannt, von dessen Mitte ein 80 m langes Drahtseil nach einem zweiten an zwei Masten befestigten Drahtseil führt. Auf dem Eindecker ist ein Stahlrohrgerüst angebracht, welches mehrere Meter über den Bumpf hinausragt und in einer Eschenholzgabel a endigt. (Abb. 1 u 2.) Das ganze Fanggerüst ist um den Punkt b nachgibig gelagert und wird mittels der Gummischnüre c und d elastisch gegen Vor- und ßückwärtsschwenken festgehalten. Am tiefsten Punkte des Gabeleinschnittes befindet sich eine abgefederte Klinke e, die mittels des Drahtseiles f und des Griffes g ausgelöst werden kann. Zum Schutze des Propellers dient der mittels der Absteifung i an der Spannsäule k befestigte Rahmen h. Im Ruhezustande befindet sich die Klinke e in eingeschnappter Stellung. (Siehe Abb. 1 rechts oben). Der Flieger fliegt von der Erde ab zwischen den 20 m entfernten Masten hindurch und sucht durch eine Höhensteuerbewegung das 80 m Drahtseil mittels der Gabel a zu erfassen und die Klinke e zum Einschnappen zu bringen. Ist dies erreicht, so wird der Motor abgestellt und der Eindecker rutscht in aufgehängtem Zustande unter dem Drahtseil weiter, bis die Reibung die Bewegungsenergie aufgezehrt hat. Beim Starten wird der Motor vom Flugzeugführer angeworfen, die Maschine rutscht auf dem Drahtseil ein Stück weiter und wird durch eine 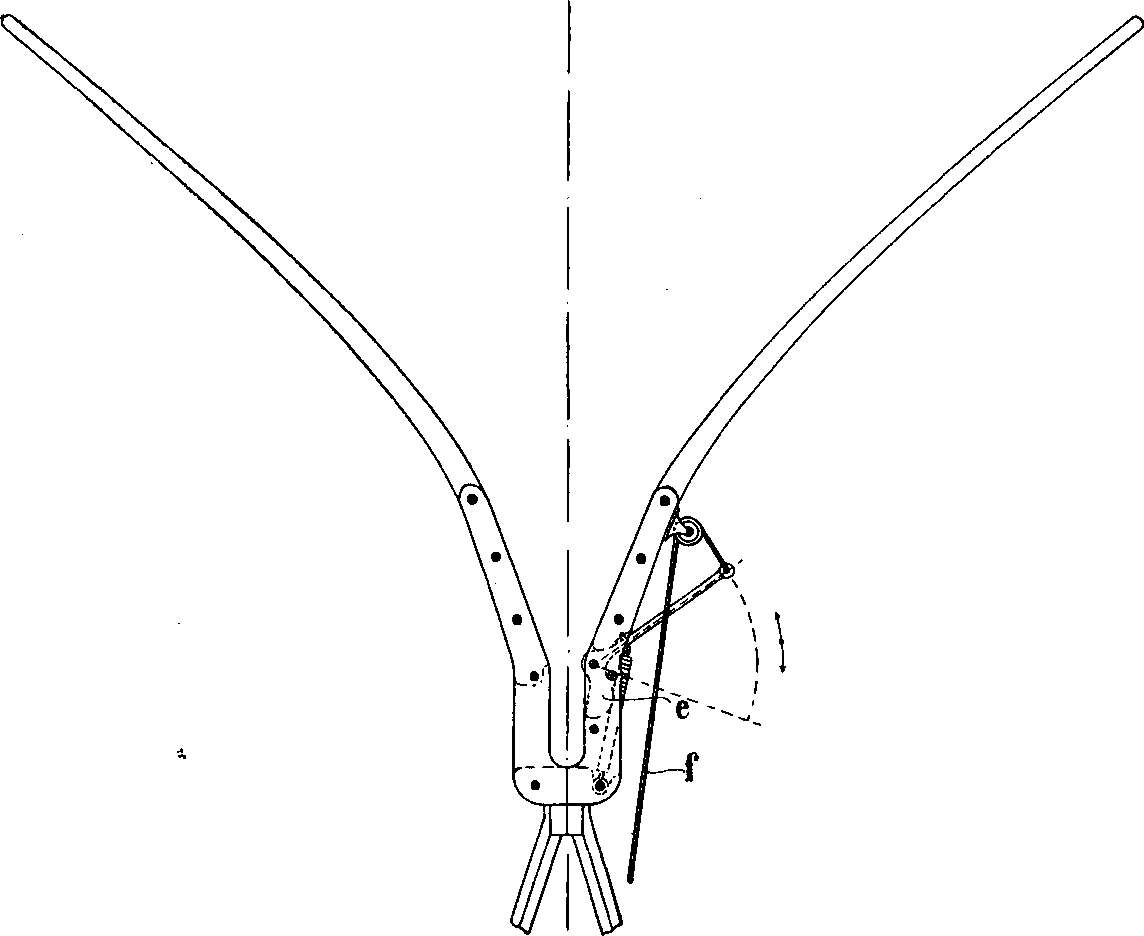 Abb. 2 Höhensteuerbewegung nach oben gedrückt. Die Reibung zwischen Klinke e und Drahtseil vermindert sieh hierbei, die Geschwindigkeit nimmt zu, worauf der Flugzeugführer mittels des Drahtzuges f und des Griffes g die Klinke e zurückzieht und die Maschine frei wird (Abb. 2 unten zeigt die Klinke e in zurückgezogenem Zustande.) Der Apparat gewinnt die Freiheit und fliegt zwischen dem zweiten Mastenpaar hindurch. Durch diese Startmethode soll ermöglicht werden, mittels einer leichten Landmaschine an Bord eines Kriegsschiffes gelangen zu können, weil das Bergen der heutigen Wasserflugzeuge infolge ihrer großen Dimensionen und Gewichte viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Versuche mit dieser Startvorrichtung wurden am 9. August 1913 auf dem Flugplatz von Bleriot in Buc und zwar in Anwesenheit des Marineministers Baudin und der beiden Admirale Barieu undLe Bris ausgeführt. „Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten u. Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XXII. Der Caudron-Wasserzweidecker. 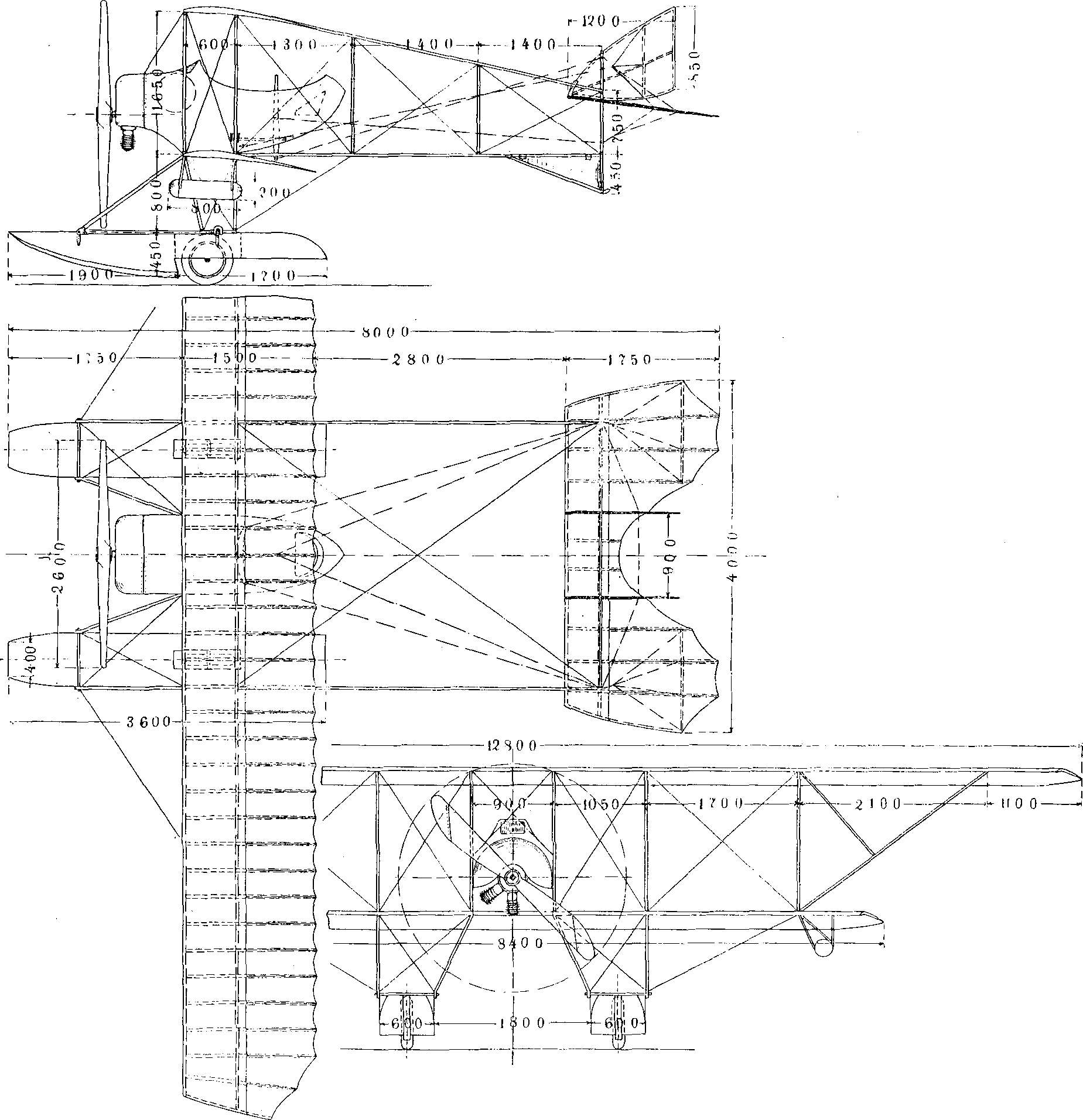 Nachbildung verboten. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Die französische Regierung ist, wie schon des öfteren betont wurde, unausgesetzt bemüht, den Eifer der Militär- und Zivilflieger durch Ehrungen aller Art anzuspornen und zu beleben. Man wird die Wirkung derartiger Auszeichnungen keinesfalls unterschätzen dürfen; der Appell an die menschliche Eitelkeit findet noch immer eine günstige Resonanz. Gelegentlich des Nationalfestes vom 14. Juli ist, wie aus der soeben erst veröffentlichten Namenliste hervorgeht, ein förmlicher Regen von Auszeichnungen auf die Flieger herniedergegangen. Wir wollen nur einige davon, welche ein allgemeineres Interesse beanspruchen dürfen, hier erwähnen. Zu Rittern der Ehrenlegion sind u. a. ernannt worden : Brindejonc des Moulinais, Caudron, Cheuret, Hanriot, Giraud, Moräne, der Sekretär der Ligue Nationale Aerienne, Celigny; der bekannte Propellerkonstrukteur Chauviere, Zens, Spieß, Jacques Balsan, Robert Es-nault-Pelterie, Saulnier und der Flieger Seguin, während Bathiat, Daucourt, Gilbert, Kühling, Perreyon usw. die Militär-Medaille erhalten haben. Ein großer Teil der Geehrten hat sich ja in der Tat um das Flugwesen verdient gemacht und erst die letzten Tage haben wieder gezeigt, daß es für die moderne Wissenschaft des künstlichen Fluges kaum noch unerreichbares gibt. Zunächst war es der Kampf um den Pommery-Pokal, \ \ ^ Ny/. ' *^QM|HBH der wieder einige prächtige 1 V ._V ■ ■> '(*ϖ■ : Leistungen zu Wege ge- bracht hat. Am Montag der ^VÄÄS^"" md vergangenen Woche unternahm liuulaux auf einem Clement Bayard>Metalleindecker und Gilbert auf einem Morane-Ein-decker einen Flug um die Trophäe, als dessen Ziel sie sich beide Portugal gesetzt hatten, wie wir bereits kurz gemeldet haben. Es handelte sich darum, den von Brindejonc mit seinem Fluge Paris—Berlin— Warschau aufgestellten Rekord von 1400 km zu überbieten. Guillaux flog von Issy-les-Moulineaux um 4 Uhr 40 ab, unternahm um 9 Uhr 15 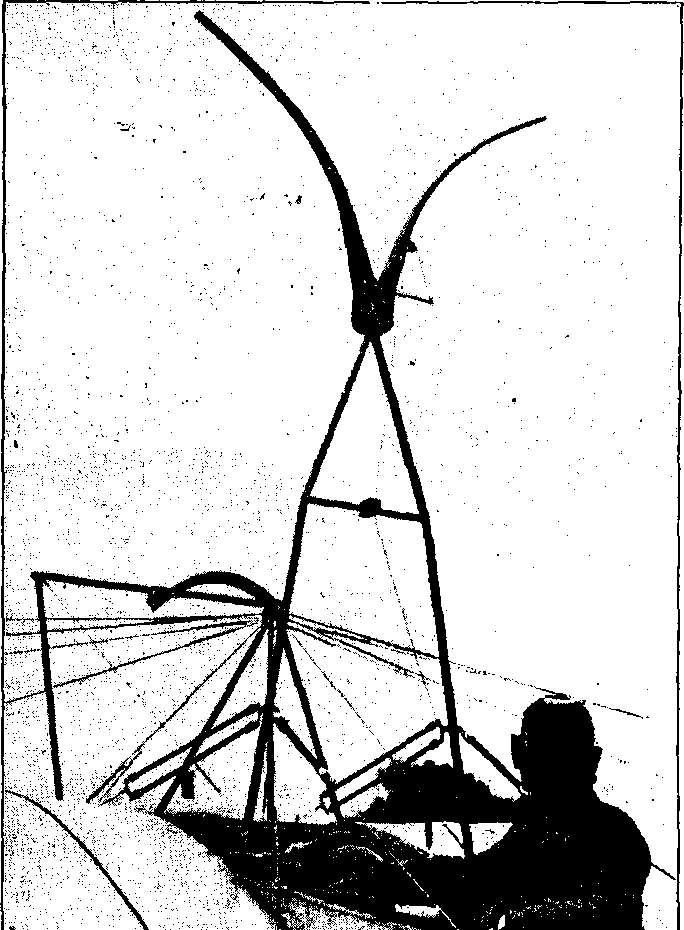 eine Zwischenlandung in Bordeaux, übersetzte die Pyrenäen und landete um 12 Uhr 30 in Vittoria. Schon nach einer Viertelstunde flog er wieder ab und gelangte bis ßermillo des Sayago an der spanisch portugiesischen Grenze, wo er infolge mißglückter Landung seinen Apparat beschädigte. Er hatte insgesamt 1160 km zurückgelegt. Der Eindecker hatte einen 70 PS Clerget-Rotationsmotor. Gilbert legte als erste Etappe Villacoublay-Vittoria, 800 km zurück; von dort flog er bis Caceres an der portugiesischen Grenze, wo er infolge heftigen Gewittersturms den Weiterflug aufgab, nachdem er eine Gesamtdistanz von 1300 km hinter sich gebracht hatte. Beide haben also die von Brindejonc vorgelegte Leistung nicht zu schlagen vermocht. Es heißt, daß Gilbert einen neuen Versuch unternehmen will. Recht dramatisch gestaltete sich der Flug Janoirs, nachdem er auf seinem Deperdussin von Paris nach Berlin, von dort nach Königsberg und Riga geflogen war, seinen Flug nach Petersburg fortsetzen wollte In Riga wurde bei der Landung der Eindecker beschädigt, sodaß zwei Tage für die Reparatur erforderlich waren, und nach den letzten Nachrichten ist der Flieger bis ßeresewo, im Gouvernement Pskow gelangt, 250 km von Petersburg, wo er aufs neue den Apparat erheblich beschädigte. Sehr interessant war der Flug von Biarritz nach Bremen, welchen der Sappeur Seguin, übrigens ein Bruder der Inhaber der Motorenwerke Gnom, am letzten Montag auf einem Zweide ker Henri Farman, 80 PS Gnom, zu Wege gebracht hat. Seguin ging um 4 Uhr 37 von Biarritz ab, landete um 7s 12 in Buc, von wo er um 12 Uhr weiterflog, um gegen 6 Uhr in Bremen anzukommen. Die erste Etappe hatte ein Ausmaß von 650 km, die zweite ein solches von 700 km, sodaß Seguin insgesamt 1350 km zurückgelegt hat, also auch nicht genug, um die Leistung Brindejoncs zu drücken. Uebrigens. beabsichtigte Seguin nach Dänemark weiter zu fliegen, aber ein Defekt an seiner Benzinnadel zwang ihn, den Flug aufzugeben. Somit bleibt Brindejonc bis auf weiteres Anwärter auf den Pommery-Pokal. Jetzt melden sich noch zwei weitere Konkurrenten: Jensen, ein dänischer Flieger, will auf einem Clement Bayard-Eindecker von Valenciennes nach Marokko zu fliegen versuchen und auch Letort will seinen Versuch wieder aufnehmen. Eine geradezu sensationelle Leistung aber vollbrachte im Laufe der vergangenen Woche der Deperdussinflieger Cavalier um den Michelin-Pokal der, wie in der letzten Nummer des „Flugsport" gemeldet wurde, am 29. Juli auf der Rundbahn zwischen Etampe. und Gidy seine täglichen Runden zu fliegen begann. Cavalier realisierte dabei folgende Tagesleistungen: 29. Juli 901,120 km 30. Juli 901,120 km 31. Juli 788,480 km 1. August 788,480 km 2. August 901,120 km 3. August 901,120 km 4. August 788,480 km 5. August 788,480 km 6. August 337,920 km also insgesamt 7091,320 Kilometer, in der Tat eine großartige Leistung! Auch um den Michelin - Luftzielscheibenpreis haben die Konkurrenzen wieder begonnen und zum Teil beachtenswerte Resultate gehabt. Im ganzen haben sich 6 Bewerber einschreiben lassen: die Leutnants Lussigny, Marzac, Varcin, Sallier, sowie 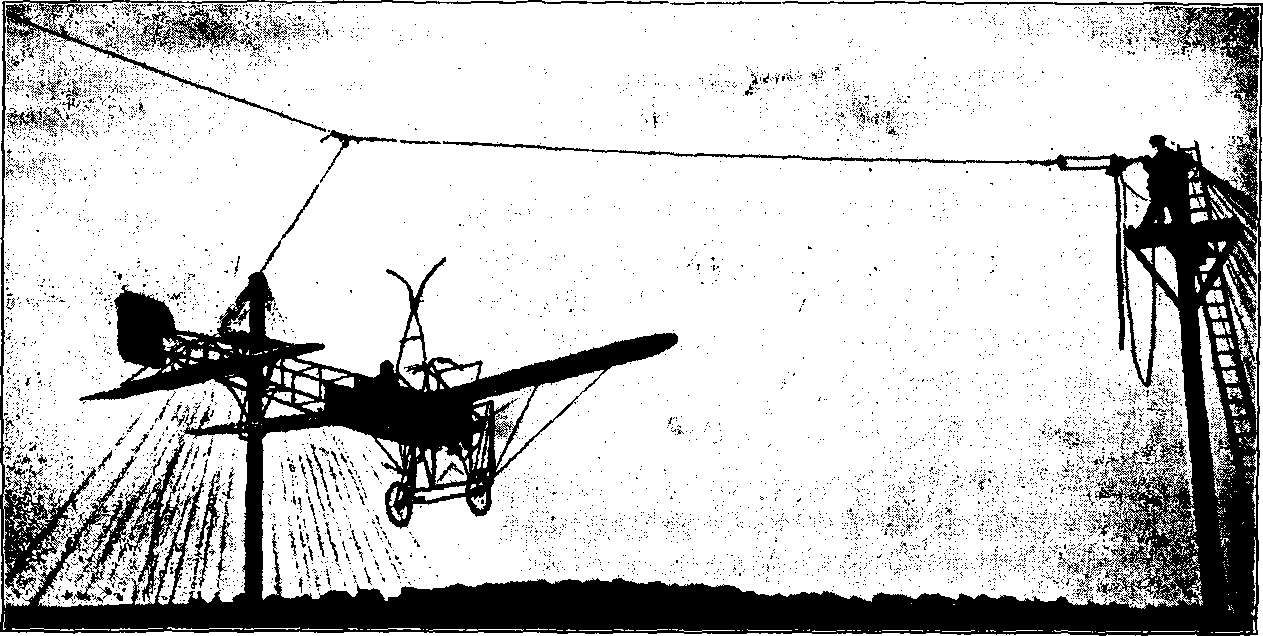 Abfliegen von einem Drahtseil System Bleriot. 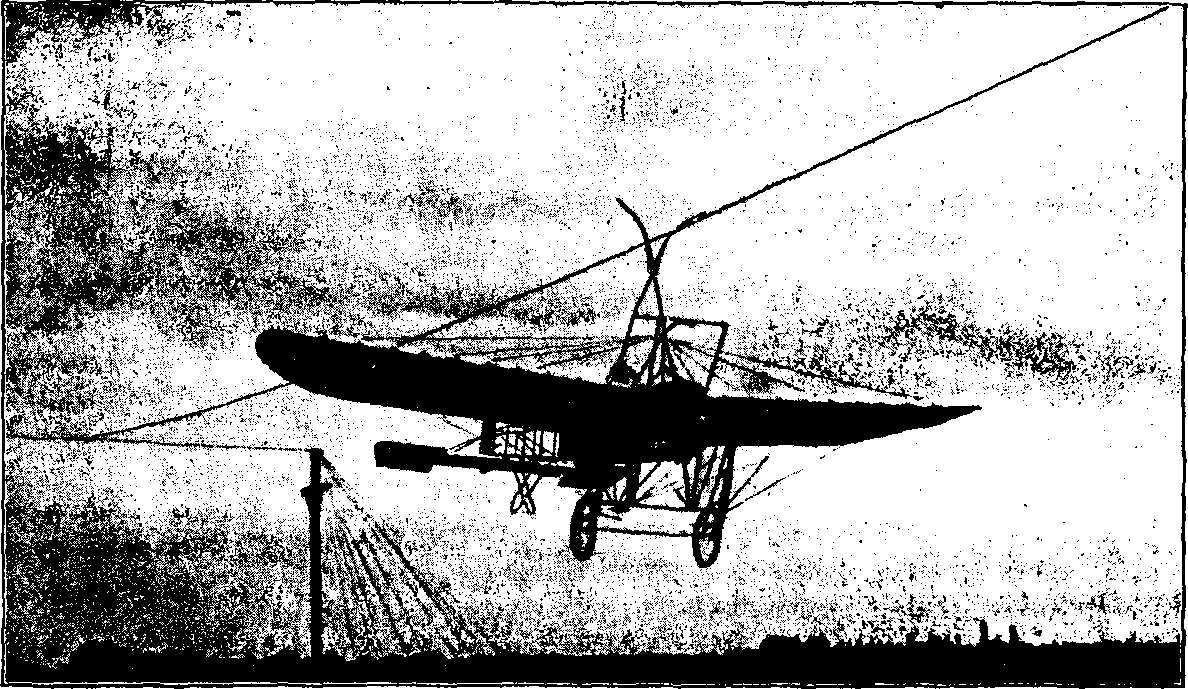 Drahtseil-Anfliegen System Bleriot. Das Bild zeigt den Moment, in welchem die Flugmaschine an das Drahtseil anfliegt. Gaubert und Fourny. Auf dem Flugfelde von Buo gingen am vergangenen Montag die ersten Experimente vor sich, welche folgendes Resultat hatten : Fourny, auf Maurice Farman-Zvveidecker, konnte fünf von zehn Projektilen in den vorgezeichneten Kreis lancieren, und Gaubert brachte auf derselben Flugzeugtype das gleiche Verhältnis (zwei von vier) zustande. Erwähnt sei noch ein Flug Paris—London und zurück, den Gilbert auf einem Morane-Eindeeker ausführte, und zwar ohne jeden Zwischenfall. Einen nicht immer glücklichen Verlauf nahm der Flug Levasseurs auf einem Nieuport-Wasserflugzeug, mit einem Passagier an Bord, wobei er die Reise Paris—London—Rotterdam—Amsterdam—Berck—Paris vollbrachte. Am 2. Juli flog er von Paris nach London, wo er ziemlich zurückgehalten wurde, weil ihm, wie wir berichtet haben, die dortigen Behörden wegen Nicht befolgung der Fliegervorschriften große Schwierigkeiten bereitet und sogar seinen Apparat beschlagnahmt hatten. Am 9. Juli flog er nach Rotterdam ab. worauf er sich entschloß, von dort bis Sankt Petersburg zu fliegen und dann auf dem Luftwege nach Paris zurückzukehren. Er flog bis Amsterdam und am 15. von dort nach Emden. Atmosphärische Umstände verhinderten ihn, von Emden so bald abzufliegen, und inzwischen erhielt er die Aufforderung, nach Paris heimzukehren, um an dem Rennflug Paris—Deauville teilzunehmen. Am Sonnabend flog Le-vasseur von Emden ab und gelangte zwei Stunden spät< r nach Amsterdam, wo er sich verproviantierte. Dann kam er bis Ostende und von dort bis Berck, wo er angesichts des Strandes ins Meer stürzte, aus dem er aber glücklicherweise nebst seinem Passagier von herbeieilenden Fischerbooten herausgefischt werden konnte. Schließlich kehrte er über Rouen nach Paris zurück, wo er auf der Seine, in der Nähe von Issy-les-Moulineaux, glatt landete Levasseur hat bei dieser Luftreise mehr als 2000 km über dem Wasser zurückgelegt. Interessant verlief ein in Marseille veranstaltetes Match Garros-Brindejonc des Moulinais, aus dem durchweg Brindejonc als Sieger hervorging. Beide Flieger haben bei einem Höhenfluge innerhalb 10 Minuten eine Höhe von 2500 Meter zu erreichen vermocht. Interesse erregte hier der von Chevillard ausgeführte Flug über dem Sound. Nachdem der Flieger in Malmö erfolgreiche Schauflüge veranstaltet hatte, flog er von dort nach Kopenhagen, wobei er den dänischen Prinzen Axel, einen Vetter des Königs, als Passagier an Bord hatte. Chevillard steuerte dabei einen Henri Farman. Aber auch dem vom Königlichen Aero-Klub von Spanien organisierten Flugmeeting von San Sebastian, das in der Zeit vom 21. bis 28. September vor sich geht, sieht man mit lebhaftem Interesse entgegen. Gelegentlich dieses Meetings geht ein nationaler Wasserflugzeugbewerb und ein internationaler Flugmaschinen bewerb vor sich. Die Apparate müssen von Fliegern gesteuert werden, die von der Internationalen Aeronautischen Vereinigung anerkannt sind. Den Nennungen, die bis zum 1. September eingehen No. 17 „ F L Li (J S P Ü R T. Seite 623 müssen, ist für jeden Apparat ein Nennungsgeld von 1500 Pesetas beizufügen, doch kommt dieser Betrag in folgender Weise wieder zur Rückerstattung: 500 Pesetas jedem Flugzeug, das einen Flug von mindestens 10 Minuten vollbracht haben und weitere 200 Pesetas für jeden Tag des Bewerbes, an dem das Flugzeug einen Flug von gleich langer Dauer zu Wege gebracht haben wird. Die Apparate, die nicht bis zum 19. Septembei' in San Sebastian sind, verlieren das Anrecht auf Rückerstattung des Nennungsgeldes. Nun fragt sich hier alle Welt, wo jetzt eigentlich der diesjährige Gordon Bennett-Pokal vor sich gehen wird, nachdem das festgesetzte offizielle Programm des organisierenden Aero-Club de France durch den Deperdussin-Skandal in die Brüche gegangen ist Es ist erinnerlich, daß dieser „generöse" Millionenschwindler dem Aero-Club „sein" Aerodrom der Champagne zur Verfügung gestellt und außerdem einen „Preis" für ein gleichzeitiges Meeting in Höhe von 100.000 Frcs. offeriert hat, allerdings ohne dem Ei suchen des Aero-Club, den Betrag zu deponieren, nachzukommen. Nun ist über alle „Unternehmungen" des Gauners der Konkurs verhängt und fragend blicken sich die „maßgebenden" Stellen an: wo werden wir unser Gordon Bennett abhalten? Freilich, der Konkursverwalter hat das Aerodrom zur Verfügung gestellt, aber man traut sich noch nicht recht, dieses Angebot zu akzeptieren, denn die Sache ist doch, wie man in Berlin sagt, „zu sengerig!" Dem zu erwartenden starken internationalen Besuch gegenüber würde man doch in einer etwas heiklen Position sein Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen, aber inzwischen hat Herr Deutsch de la Meurthe in die Tasche gegriffen und hat die von Deperdussiu „gestifteten" 100.000 Francs bezahlt, damit man sich wenigstens nicht gar zu sehr blamiert. ..... Rl. Französisches Wassermaschinen-Rennen Paris-Deauville und Wasserflugzeug-Wettbewerb der französischen Marine. (Ingenieur Oskar Ursinas.) Am 24. August beginnt der Rennflug für Wasserflugzeuge Paris-Deauville. Dieser vom Aero-Club de France veranstaltete Flug ist mit 40 000 Frs. Preisen dotiert, international und nur offen für zweisitzige Maschinen. Der Fluggast kann durch 70 kg Gewicht ersetzt werden. Die Nennunglist: für den Wettflug ergab folgendes Resultat: 1. Nieuport (Flieger Weymann) 7. Borel (Flieger Geo Chemet) 2. Nieuport (Flieger Levasseur) 8. Bathiat - Sanchez (Flieger 3. Deperdussin (Flieger Prevost) Molla) 4. Deperdussin (Flieger Janoir) 9. Breguet (Flieger Bregi) 5. Deperdussin (Flieger Devienne- 10. Aeroyacht Borel (Flieger Scoffier) Divetain 6. Leveque (Flieger X . .) Der eigentliche Marine-Wettbewerb ist national und beginnt am 25. August. Hierfür sind Preise von insgesamt 100 000 Frs. ausgesetzt, wovon 50000 Frs. von der Marine und 50000 Frs. vom Aero-Olub de France aufgebracht wurden. Der Wettbewerb besteht aus einer Vorprüfung und dem Hauptwettbewerb. Die Flugzeuge inklusive Motor müssen in Frankreich von einem französischen Konstrukteur und einer französischen Firma gebaut sein. Nur Einzelteile dürfen vom Ausland bezogen werden. Die Bedingungen schließen sich im großen ganzen denjenigen, wie sie den Wettbewerben von Heiligendamm und am Bodensee zugrunde lagen; an. Man sieht, daß hier unsere deutsche Organisation Schule macht. Für den Hauptwettbewerb wird unterschieden nach fluß- und seetüchtigen Maschinen und sogenannten Ufermaschinen. Die Bedingungen hierfür sind sehr schwer. Der Verlauf dieser Veranstaltung ist für den gesamten internationalen Wasserflugzeugbau von größter Bedeutung. Ich werde über den Ausgang dieses Wettbewerbs sowie auch über die einzelnen Bestimmungen, die ihm zugrunde liegen und die heute noch fortgesetzt geändert werden, noch ausführlich berichten. 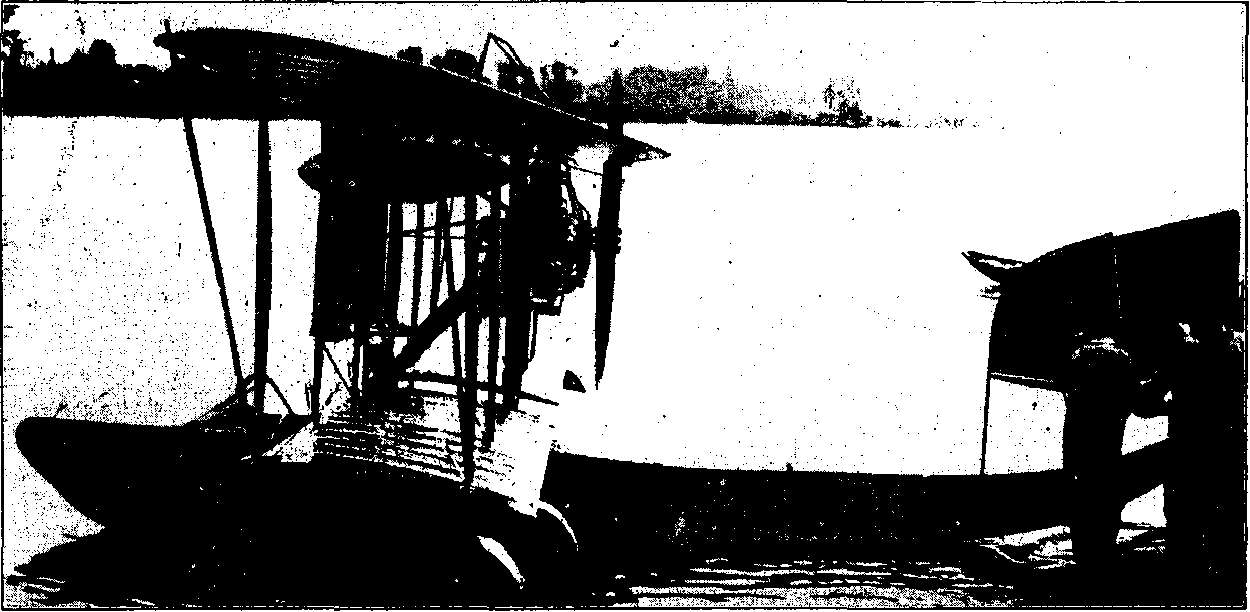 Marine-Wettbewerb von Deaaville. Aero-Yacht Boret, Typ Denhaut. 1 Für den Marine-Wettbewerb haben 7. (Flieger (Flieger T. Wey- Maurice Farman Renaux) Maurice Farman Gaubert) Nieuport (Flieger C. mann) Nieuport (Flieger Levasseur) Caudron(FliegerReneCaudron) 6. Caudron (Flieger Gaston Caudron 15. Leveque (Flieger Ueber die teilnehmenden Apparate Lage einiges mitzuteilen. 9. 10. 11. 12. 13. 14. gemeldet: Bathiat - Sanchez (Flieger Molla) Breguet (Flieger Moineau) Breguet(Fliegerde Montalent) Deperdussin (Flieger Prevost) Deperdussin (Flieger Janoir) Borel (Flieger Geo Chemet) Monoplan Dussot (Flieger Aug. Dussot) Astra (Flieger de Lambert) X . . .) bin ich schon heute in der Borel bringt außer seinem bekannten Eindecker seine verbesserte Aeroyacht Borel, Typ Denhaut. Dieser Wasser-Zweidecker, ein fliegendes Boot, besitzt eine Gesamtlänge von 7,3 m. Das obere Tragdeck hat eine Spannweite von 10 m, das untere von 6,4 m und die ganze Maschine eine Höhe von 2,5 m. Der Tragfläoheninhalt beträgt 20 qm, das Gewicht der Maschine leer 350 kg, mit Betriebsstoff und Passagier 550 kg. Zum Antriebe dient ein 80 PS luftgekühlter Anzani-Motor. 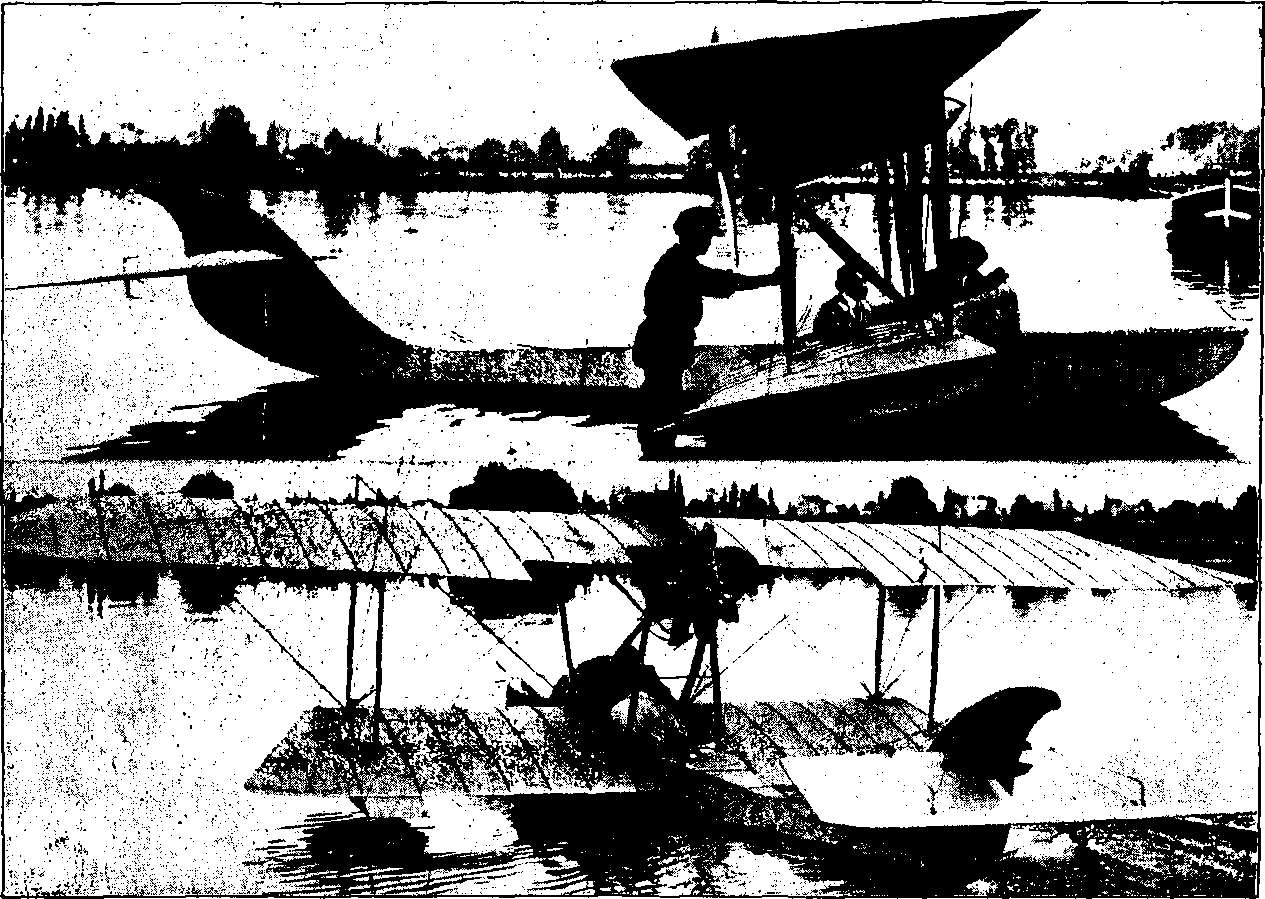 Marine-Wettbewerb von Deauville. Fliegendes Boot von Leveque. Wie die nebenstehende Abbildung erkennen läßt, zeigt die gesamte Formgebung eine sehr gute Linienführung. Insbesondere wirkt sehr schön die Formgebung des hinteren Seitensteuers und dessen Verbindung mit dem Rumpf. Eine erhebliche Verbesserung ist durch das Anbringen eines besonderen Setzbordes zum Schutze der Insassen getroffen. Diese Anordnung des Setzbordes ist äußerst wichtig^ Leveque bringt gleichfalls ein fliegendes Boot mit den bekannteu Verbesserungen Zum Betriebe dient ein 120 PS wassergekühlter Salmson-Motor. Das-Seitensteuer ist, um es aus dem Bereich des Kielwassers zu bringen, sehr hoch angeordnet. Um eine große seitliche Schwimmstabilität zu gewährleisten, sind unter dem unteren Tragdeck zu beiden Seiten je zwei Hilfsschwimmer vorgesehen. Einstellung in die Marine-Fliegerabteilung.*) Nach den Allerhöchst genehmigten „Organisatorischen Bestimmungen für die Marine-Fliegerabteilung" geschieht die Ergänzung des Personals der Marine - Fliegerabteilung vorläufig aus anderen Marineteilen und zwar möglichst durch Uebernahme von Freiwilligen. Ausgebildete Flieger (Flugzeugführer) dagegen können jederzeit als Ein- oder Mehrjährigfreiwillige bei der Marine-Fliegerabteilung nach Ermessen dieses Marineteils innerhalb der Grenzen des Bedarfs bezw. des Etats eingestellt werden. Die gesetzliehe Dienstzeit für Mehrjährigfreiwillige der Kaiserlichen Marine beträgt 3 Jahre. Anforderungen an die Körperbeschaffenheit sind: Kräftiger Körperbau, gesunde, scharfe, farbentüchtige Augen, gutes Gehör, kleinstes Maß 1,57 m (ausnahmsweise auch darunter). Meldungen mit Lebenslauf, Schul-, Lehr- und sonstigen Zeugnissen, Fliegerzeugnis, Berechtigungsschein zum einjährigfreiwilligen Dienst (von der Prüfungskommission für Einjährigfreiwillige auszustellen) bezw. Meldeschein zum einjährigfreiwilligen Dienst (vom Zivil Vorsitzenden der Ersatzkommission zu erbitten) sind an das Kommando der Marine-Fliegerabteilung in Putzig bei Danzig zu richten. Aerztliche Untersuchung erfolgt nach der Meldung auf Anordnung der Marine-Fliegerabteilung entweder in Putzig oder bei den Bezirkskommandos, je nachdem der Aufenthaltsort des Freiwilligen dem Standorte der Marine-Fliegerabteilung oder dem Standorte des Bezirkskommandos näher liegt. Deperdussin. (Von unserem Pariser Korrespondenten.) Die Verhaftung des bekannten Pariser Flugzeug-Konstrukteurs Deperdussin, welche am Dienstag der letzten Woche erfolgt ist, hat hier geradezu als Sensation gewirkt, nicht nur wegen der Person, sondern vor allem auch wef.en des Umfangs der ihm zur Last gelegten Schwindeleien. Bei dem Namen, den Deperdussin bisher in industriellen und Fliegerkreisen auch des Auslands genoß, und bei dem großen Interesse, welches der Fall im Inla de und im Auslande begreiflicherweise hervorruft, erscheint es angebracht, den „Fall Deperdussin", schon weil er nicht als solcher, sondern vielmehr als „Typ" zu betrachten ist, etwas näher zu beleuchten. Deperdussin ist die rechte Abenteurer-Natur. Ehemals Angestellter in einem der großen Seidenhäuser der Rue des Jeuneurs in Paris, vordem sogar, wie behauptet wird, Kaffeehauskellner in Belgien, unternahm der gewiegte Schwindler vor etwa zehn Jahren eine Seiden-Einkaufsagentur, zu der er sich die erforderlichen Mittel von einem hiesigen Finanzinstitut geben ließ. Er lieferte an sämtliche hiesigen großen Warenhäuser und erzielte Umsätze bis zu fünfzig und sechzig Millionen im Jahr. Der enorme Verdienst, der dem Abenteurer damit zufiel, genügte bald seinen ausschweifenden Lebensbedürfnissen nicht mehr und er begann den großen Schwindel, der ihn nunmehr dorthin gebracht hat, wo er hingehört: er fälschte jahrelang die Bestellscheine der Warenhäuser und erhob auf diese Weise fortlaufend Millionenbeträge, ohne aber den vorgespiegelten Einkauf zu besorgen. Wie es möglich ist, daß der Mann dieses Manöver so *) Hiermit erledigen sich sämtliche diesbezüglichen Anfragen. Dieselben werden daher schriftlich jetzt nicht mehr beantwortet. lange Jahre fortsetzen konnte, ohne daß das „Finanzinstitut" dessen gewahr wurde, ist eine bisher ungelöste Frage, die übrigens auch für uns hier nicht in Betracht kommt. Uns beginnt der Fall erst von dem Moment an zu interessieren, wo Deperdussin sich dem neu entstehenden Flugwesen zuwandte, wo er Flugzeug-Konstrukteur wurde. Der plötzliche und rapide Aufschwung, den das moderne Flugwesen, zumal zuerst in Frankreich genommen hat, mußte naturgemäß alte jene Elemente anlocken, welche glauben, bei einer neuen industriellen und kommerziellen Aufwärtsströmung auch ihr Schäfchen scheren zu können. Es ist schon bei mehr als einer Gelegenheit offenbar geworden, daß gerade die französische Flugzeugindustrie einer gründlichen Sichiigung bedarf und daß gewisse störende Elemente ausgemerzt werden müssen, welche der Bewegung als hemmende Bleikugeln nachhängen. Zum Teil vollzieht sich ja die Entwicklung auf ganz natürlichem Wege: eine große Anzahl jener „Konstrukteure", welche mit tausend Hoffnungen in den weiten Ozean des Flugwesens hinausgeschifft waren, haben inzwischen die Segel gestrichen, zu ihrem und des Flugwesens Nutzen. Deperdussin aber, weil er nicht ein unglücklicher Spekulant, sondern ein geriebener Schwindler war, hatte jene alle Uberleben, hatte sich länger als jene halten können, denn der skrupellose Mann wußte immer wieder neue Kapitalien zu finden, immer wieder Gelder heranzuschaffen, Um Löcher zu verstopfen und sich dem Arm der Gerechtigkeit zu entziehen. Er war dabei nicht wählerisch, er nahm dazu sogar auch gestohlene-Gelder . . . Der bekannte. Großschwindler Duez, dem von der französischen Regierung die Liquidation der Klostergüter Ubertragen worden war und der dabei viele Millionen unterschlagen hat, ging, als er fühlte, daß der Krug nicht länger zum Brunnen gehen kann, daß er ins Zuchthaus wandern muß zu seinem „Freunde" Deperdussin und übergab ihm * eine der gestohlenen Millionen, damit er sie in seiner Flugzeugfabrikation nutzbringend anlege und hm nach Verbüßung seiner Strafe natürlich wieder zurückerstatte. Später soll Duez sogar noch eine zweite Million hergegeben haben. Deperdussin war nicht nur ein „Finanz"-Genie, er war in erster Reihe auch Lebenskünstler, und es mutet eigenartig an, wenn man hört, in welch raffinierter Weise er alle die Millionen (es sind im ganzen vierzig Millionen, die er gestohlen hat!) benutzt hat. Er kaufte sich gleich drei Schlösser, hielt sich drei Automobile, richtete Sanatorien und Institute ein, mietete sich mehrere Pariser Wohnungen, in denen er ebenso viele „Freundinnen" unterhielt, und nebenbei war er ein sittsamer und glücklicher Familienvater, der seit zehn Jahren verheiratet war und sich besten Umgangs erfreute. Deperdussin baute in der Rue des Entrepeneurs (nomina sunt omina) eine ziemlich umfangreiche Flugzeugfabrik, in der er durchschnittlich 200 Arbeiter beschäftigte, zog tüchtige und bekannte Ingenieure und Flieger wie V e d r i n e s > Prevost, Vidart, u. a. m., zu sich heran und installierte mehrere Flugterrains namentlich in der letzten Zeit das Flugfeld in der Champagne, in der Nähe von Reims, das allgemein als eine mustergiltige Installation und sicherlich als eines der schönsten Flugfelder der Welt betrachtet wird. Immer höher stieg er auf der Leiter des Erfolges. Er baute seine bekannten Eindecker, welche von tüchtigen Fliegern mit teilweise sehr gutem Erfolge in allen Bewerben gesteuert wurden, wurde Lieferant der Heeresverwaltung, welche einige spezielle Deper-dussin-Luftgeschwader schuf, und nahm in der einschlägigen Industrie ohne Zweifel mit den hervorragendsten Platz ein. Er war Mitglied des Automobil-Club de France, Vorstandsmitglied des Aero-Club de France, in dem er eine große Rolle spielte, und vor einiger Zeit wurde er sogar von der französischen Regierung zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Deperdussin hat sich in erster Reihe durch seinen affektierten Chauvinismus in die Höhe gebracht. Er war ein glühender Deutschenhasser und seine albernen Pronunziamentos in der französischen Presse, in denen er erklärte, daß er auf seinen Flugplätzen keinen Deutschen mehr zulasse, weil sie alle nur als „Spione" hierherkämen, sind noch in frischer Erinnerung, ebenso daß unter seiner Anleitung und Förderung der verschrobene Hetz-Chauvinismus des kleinen Vedrines, eines bedeutungslosen und nichtssagenden Mechanikers, den Deperdussin durch eine ihm gefällige Presse zum „Nationalheros" stempeln ließ, geradzu psychologische Formen annahm. Später freilich haben sich die beiden „Unzer trennlichen" wieder getrennt und sich gegenseitig in der unsaubersten Weise befehdet. Er war es auch, der, in Gemeinschaft mit einem anderen Großfabrikanten in einem bekannten Boulevardblatt die Kampagne gegen deutsche Waren und gegen alle Deutschen in Szene setzte. Am bezeichnendsten ist, daß dieser Mann bis zum letzten Augenblick in den maßgebendsten sportlichen und Interessenvereinigungen eine führende Rolle spielen konnte. Besonders charakteristisch nicht nur für den entlarvten Schwindler, sondern mehr noch für den hiesigen Aero-Club, nächst dem Automobil-Club de France, sicherlich hier die einflußreichste und sportliche Vereinigung, ist nachfolgender Vorgang: Das vorjährige Rennen um den klassischen Gordon Bennett-Pokal für das Flugwesen wurde bekanntlich in den Vereinigten Staaten von einem französischen Flieger gewonnen. Nach den Bestimmungen des Reglements dieses Bewerbs muß nun der Pokal in jedem Jahre in demjenigen Lande bestritten werden, dem der Sieger des vorhergehenden Jahres angehört. Dem Aero-Club de France fiel also die Pflicht zu, für dieses Jahr den Gordon Bennett-Pokal zu organisieren. Man suchte und prüfte, fand aber keinen Flugplatz, welcher sich für dieses internationale Rennen, für welches i icht nur eine starke Beteiligung von Fliegern sondern auch ein großer Zustrom von Interessenten und Neugierigen erwartet wird, geeignet hätte. Da trat Deperdussin in die Bresche. Er hatte kurz zuvor sein großes Aerodrom der Champagne fertiggestellt und dieses bot er dem Aero-Club für die Veranstaltung des Flugrennens an. Aber damit nicht genug, der großherzige Förderer des Flugwesens bot gleichzeitig dem Aero-Club de France eine Summe von 100.000 Francs an, die im Zusammenhange mit dem Gordon Benrfett in einem gleichzeitig zu organisierenden Flugmeeting zur Bestreitung gelangen sollten. Der Aero-Club acceptierte nur zu gern dieses opferwillige Anerbieten, verlangte aber gemäß den Satzungen des Aero-Clubs, daß die gestiftete Summe noch vor Ausschreibung des Bewerbs bei einer Bank deponiert oder sontwie sichergestellt werde. Das war schon etwas schwieriger. Deperdussin verreiste zunächst und der Aero-Club wartete geduldig auf seine Heimkehr. Endlich erschien er wieder in den Salons des Aero-Clubs, wie immer freudestrahlend und selbstbewußt. Man erinnerte ihn daran, daß der Betrag von 100.000 Francs immer noch nicht hinterlegt sei, worauf Deperdussin einen Pack Aktien einer bekannten wurmstichigen Gesellschaft hervorzog und sie als Garantie anbot. Auch das acceptierte der Aero-Club, ohne sich Uber dieses eigenartige Gebahren eines Mannes, der derartige Preise „stiftete", Gedanken zn machen. Just in jenen Tagen erfolgten dann pikante Enthüllungen über den Stand jener Gesellschaft, was zur Folge hatte, daß der Verkaufswert der Aktien auf ein Nichts zurückging. Man stellte den Spender darob zur Rede und dieser versprach, sofort andere „Garantien" zu beschaffen. Bei diesem Versprechen blieb es, nach wie vor ging der Mann im Aero-Club ein und aus, nach wie vor entzückte er seine bescheidenen Zuhörer mit „soeben erlebten allerliebsten Abenteuern", aber Geld brachte er nicht und der Aero-Club merkte immer noch nichts. Er merkte so wenig, daß er, auf eine diesbezügliche Anfrage des zuständigen Ministeriums, sogar die Ernennung Deperdussins zur Ehrenlegion befürwortete. Und während dieser Zeit erzählten es sich die Spatzen auf den Dächern, daß der „große Konstrukteur", der warmherzige Patriot, der millionenbegabte Gönner und Förderer ein ausgefeimter Spitzbube sei, daß er die Millionen, die er hinauswarf, so lange er sie hatte, anderen durch Fälschungen und Diebereien abgenommen hatte, daß dieser Abenteurer in Brüssel vorher Ausrufer vor einer kinematographischen Bude gewesen ist, wo er sich die überzeugende Suade, mit denen er seine armen Opfer zu betören pflegte, angelernt hat. Und der Aero-Club merkte immer noch nichts. Warum wir auf diesen Sachverhalt etwas näher eingegangen sind? Es ist, um zu zeigen, welche Gefahr der neuen und noch mit großen Schwierigkeiten kämpfenden Industrie aus solchen Abenteurern und Schmarotzern, die sich in sie eingeschlichen haben, droht und welche Unsinnigkeit es ist, wenn die zuständigen Vereinigungen ein derartiges wurmstichiges Element aus Furcht vor dem Skandal und aus einem gewissen Gefühl der Solidarität (natürlich im besten Sinne gemeint) heraus so lange wie möglich zu „halten" suchen. Im Gegenteil, solche Elemente müssen rechtzeitig ausgemerzt werden, damit sie nicht allzu großes Unheil anrichten. Jetzt steht nun das französische Flugwesen vor einem Rätsel. Was wird geschehen ? Die hunderte von Arbeitern mit ihren Familien, die zahlreichen Ingenieure, Flieger, und sonstigen Hilfskräfte sehen sich brotlos. Freilich scheint die Fabrik gut beschäftigt zu sein und eine schöne Lieferung für die Heeresverwaltung ist noch in der Arbeit. Das ist wohl auch der Anlaß, weshalb Gerüchte im Umlauf sind, wonach die Gläubiger Deperdussins seine Flugzeugfabrikation, allerdings unter anderem Namen, weiter betreiben wollen. Wie dem auch sei, der Vorfall hat seine Schatten auf die gesamte Industrie für Flugmaschinen geworfen und sie schwer geschädigt, so daß die wahren Folgen vor der Hand nicht abzusehen sind. Fast alle diejenigen, die in Frankreich sich mit der Herstellung von Flugzeugen beschäftigen, sind ehemalige Fachleute, Ingenieure, Sportsleute, denen eigene Kapitalien nicht in nennenswertem Umfange zur Verfügung stehen. Der Vorfall Deperdussin wirJ eine Beunruhigung in diejenigen Kreise tragen, die bisher mit ihrem Kapital die junge Industrie gefördert und ermöglicht haben, denn viel ist bisher noch nicht verdient worden und die Konstrukteure werden in den meisten Fällen zufrieden sein, wenn sie bei ihrer Fabrikation selbst leben und das Kapital der anderen verzinsen können. Damit sich die junge Industrie weiter entwickeln kann, braucht sie Ruhe und Vertrauen und beides wird durch den skandalösen Zwichenfall Deperdussins für lange Zeit wohl geschwunden sein. Rl. Das Curtiss-Flugboot als Sportmaschine. Clenn H. Curtiss, der Konstrukteur des bekannten fliegenden Bootes, veranstaltet ab t. Sept. in Paris im Hotel Continental, eine kleine Flugzeug-Ausstellung, um Interessenten sein fliegendes Boot vorzuführen. In sportlicher Hinsicht hat Curtiss in Amerika einen ausgezeichneten Erfolg gehabt. Mc. Cormik, der Schwiegersohn Rockefellers, benutzt sein fliegendes Boot fast täglich, um von seinem Hause am Lage Forest nach seinem Büro in Chicago zu fliegen. Die geringe Gefahrenmöglichkeit des Flugbootes hat dem amerikanischen Wasserflug-snort viele Anhänger zugeführt. Vor kurzem fand in Amerika ein Wettbewerb über 1000 Meilen statt. Von den sechs gestarteten Fliegern vollendeten J. B. R. Verplanck und Beckwith Hävens erfolgreich die Reise von Chicago nach Detroit, an welchem Be- stiminungsort sie am 18. Juli eintrafen. Sie sollten von Chigago um den Michigan See herum, durch die Straße von Mackinac, über den See Huron, die Bay Laginaw und den See St. Clair nach der Sladt Detroit fliegen. Der Weg betrug mehr als tausend Meilen und die Strecke war eine Wildnis. Es lagen nur ein paar kleine Dörfer am Weg, die jedes 50 bis 100 Meilen von einander entfernt waren. Eine Stunde nach dem Start erhob sich ein heftiger Sturm auf dem Michigan See, der alle Maschinen, bis auf eine, zwang Schutz zu suchen. Hävens und Verplanck vollführten die erste Strecke ohne Unfall, und legten die 55 Meilen bis Michigan City in genau 55 Minuten zurück. Am anderen Morgen durchflogen sie die 120 Meilen bis Macatawa Birg in nicht ganz 2 Std. Größtenteils hielten sie sich 10 Fuß über dem Wasser, jedoch gelegentlich stiegen sie höher, um die wilde Scenerie genießen zu können. In Nocatawa wurden sie von Boy Francis von San Francisco überholt, ebenso von Martin von Los Angeles, der nicht weit hinter diesem war. Martin hatte eine gewöhnliche Wasserflugmaschine eigener Bauart. 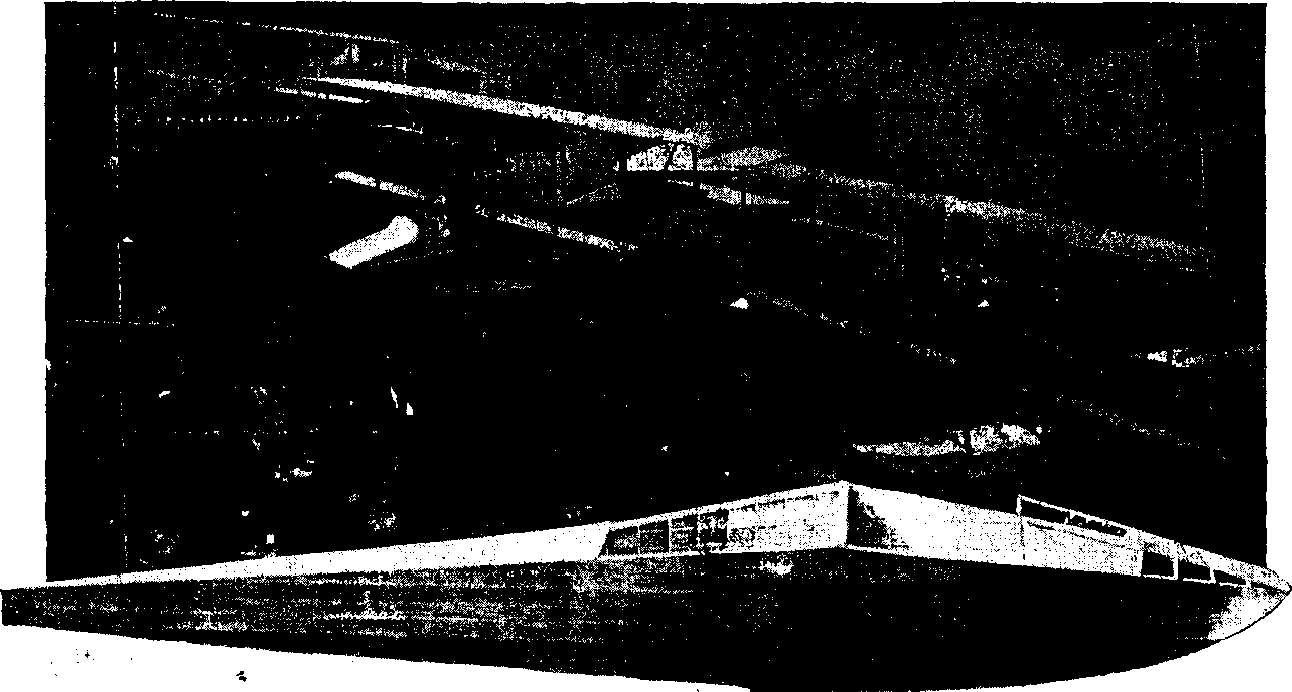 Aus der Curtiss-Wasserfliegersdiule. Am Strand die Sdialmasdiinen, im Vordergrand ein Gleitboot aus Cedernholz im Rohbau. Am 3. Tag flogen Hävens und Francis nach einem Dorf an der Westküste von Michigan, 45 Meilen von Alacatawa entfernt. Hier mußten sie 3 Tage einen Sturm abwarten. Als sie endlich starten konnten, gingen die Wogen so hoch, daß sie über das schwere Flugboot Hävens weggingen. Francis und Martin zerbrachen ihre Propeller und gaben die Fahrt auf. Hävens flog 168 Meilen von Pentwater nach Charleroix am 6. Flugtag. Um seine verlorene Zeit wieder einzuholen, flog er am nächsten Tage 300 Meilen von Charleroix nach einem Punkte nahe bei Bay City an der Saginavo Bay. Dort wurden sie wieder für einen Tag durch den Sturm aufgehalten. Am 9. Tag starteten sie von Bay City nach Port Huron, eine Entfernung von mehr als 200 Meilen längs einer öden verwüsteten Küste. 75 Meilen hinter Bay City kamen sie in einen dichten Nebel. Sie waren an einem Punkt „Aux Barques", eine der gefährlichsten Stellen der Binnen-Seen Amerikas-Sie stiegen zu einer Höhe von 1500 Fuß, und flogen eine Stunde, ohne Land oder Wasser zu sehen. Sie hatten ihre Orientierung verloren und keine Ahnung, in welcher Richtung sie flogen. Durch die Schönheit der Landschaft gefesselt, vergaßen sie die Benzinpumpe zu betätigen, und wurden auf die Maschine erst aufmerksam, als der Motor stehen blieb. Sie hatten Benzin in einem Hilfsbehälter, aber es blieb keine Zeit, es anzulassen. Hävens vollführte durch die Nebelbank einen Gleitflug. Glucklicherweise waren sie über dem See und nicht allzuweit der Küste entfernt. Längs der Küste folgend, fanden sie ein kleines Fischerdorf, wo sie ihren Motor wieder in Ordnung brachten. Sie befanden sich nur noch 80 Meilen von Detroit entfernt, welche Strecke sie am andern Tag ohne Unfall zurücklegten. Hävens und Verplanck durchflogen, trotz Häfen und schlechter Landungsplätze die 1020 Meilen in 18 Stunden Flugzeit. Das außerordentliche an ihrem Flug ist die Tatsache, daß beide keine Berufspiloten und im Ueberlandfliegen noch unerfahren sind. M. Verplanck ist ein Farmer aus dem Staat Newstock und Hävens ist ein Freund von ihm, der, obwohl er schon viel geflogen ist, noch nie außer Sicht seines Hangars kam. Beide erklärten sich so entzückt von ihrem Ueberwasserflug, daß sie beabsichtigten, denselben bis Buffalo am Ende des Erie-Sees und möglicherweise über den Ontario-See nach New-York zurück fortzusetzen. Preisausschreiben der National-Flugspende für Fernflüge. Der Verwaltungsausschuß der National-Flugspende hat beschlossen, für Fernflüge, die in der Zeit vom 15 September bis 31. Oktober 1913 als Tagesleistung — d. h. in der Zeit von Mitternacht bis zur Mitternacht des folgenden Tages — mit oder ohne Fluggast ausgeführt werden, Preise nach Maßgabe folgender Bestimmungen auszusetzen: 1. Die Fernflüge müssen von Fliegern deutscher Staatsangehörigkeit auf Flugzeugen, die einschließlich ihres Motors in Deutschland hergestellt sind, ausgeführt werden. An dem Wettbewerbe können sich mit Genehmigung der Heeres- und Marine-Verwaltung Militärflieger beteiligen. Die — gegebenenfalls auch nachträgliche — Genehmigung der zuständigen Stelle ist in jedem einzelnen Falle nachzuweisen. 2. Es müssen als Tagesleistung mindestens 1000 Kilometer, und davon mindestens 500 Kilometer in einer Richtung zurückgelegt werden. Der Flug kann außerhalb Deutschlands begonnen und beendet werden. 3. Für die sechs weitesten Flüge werden ausgesetzt: 60 000 Mark als 1. Preis 50 000 „ » 2. „ 40 000 „ „ 3. „ 25000 „ „ 4. „ 15 000 „ „ 5. „ 10000 „ „ 6. „ 4. Wird der zur Zeit weiteste Fernflug von Paris nach Caceres mit einer Länge von 1600 km durch innerhalb dieses Wettbewerbes ausgeführte Fernflüge Ubertroffen, so wird für den weitesten Flug ein Nationalflugpreis von 100000 M. verliehen. Die übrigen Preise fallen in der angegebenen Reihenfolge den folgenden 6 weitesten Flügen z.U. 5. Zwischenlandungen sind freigestellt Seite 632 „FLUGSPORT." Nc. 17 6. Die durchflogene Strecke wird nach der Luftlinie zwischen dem Ort des Abfluges und dem Landungsort oder sonstigen Punkten berechnet, deren Ueber-fliegen in einwandsfreier Weise (siehe auch Ziffer 9) nachgewiesen wird. 7. Der Flug muß mit demselben Flugzeug durch denselben Flieger ausgeführt werden. Ein Wechsel des Fliegers, des Flugzeuges oder des Motors innerhalb der zu wertenden Tagesleistung ist nicht gestattet. Führt derselbe Flieger mehrere Fernflüge mit demselben oder mit einem andern Flugzeug aus. so wird nur sein weitester Flug bewertet. Werden von verschiedenen Fliegern auf demselben Flugzeug Fernflüge ausgeführt, so wird jeder einzelne Flug selbständig gewertet. 8. Die Preise werden den Besitzern der Flugzeuge ausgezahlt. 9. Aus Preisen, die auf Flugzeugen der Militärverwaltung erflogen sind, werden den Siegern Ehrenpreise gewährt und die persönlichen Auslagen erstattet, der Rest der Militärverwaltung für die Kaiser Wilhelm Luftfahrer-Stiftung zur Verfügung gestellt. 10. Zum Nachweis der zu wertenden Flugleistungen sind Bescheinigungen über Zeit und Ort des Abflugs, Zeit und Ort der Landung — auch jeder Zwischenlandung — sowie gegebenenfalls des Ueberfliegens kontrollierter Punkte beizubringen. Die Bescheinigungen können von jeder einwandfreien Persönlichkeit, jedoch nicht von einem etwa mitgenommenen Fluggast ausgestellt werden. Auch ist das Barogramm des zuvor geprüften und versiegelten Barographen beizufügen. Die Auszahlung eines Preises erfolgt nur, wenn der Nachweis über die Ausführung des Fernfluges nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen vollständig erbracht wird. Die Entscheidung steht mit Ausschluß des Rechtswegs dem Verwaltungsausschuß der National-Flugspende zu. 11. Die sonstigen von der National-Flugspende ausgeschriebenen Preise bleiben von diesem Ausschreiben unberührt. Berlin, den 7. August 1913. Der Verwaltungsausschuß der National-Flugspende.  Flugtechnische Rundschau. Inland. Flugfilhrer-Zeugnisse haben erhalten: No. 463. Arns, Eugen, Techniker, Kevelaer, geb, am 28. Januar 1895 zu Kevelaer, für Eindecker (Strack), Flugfeld Holten, am 11. Juli 1913. No. 464. Weidner, Paul, Obermonteur, Qörries bei Schwerin i. M, geb. am 26. Januar 1886 zu Pürschen, Kr. Glogau, für Eindecker (Fokker), Flugplatz Görries, am 15 Juli 1913. No. 465. Worbtl, Hermann, Ingenieur, Charlottenburg, geb. am 14. Aug. 1863 zu Breslau, für Zweidecker (Wright), Flugplatz Johannisthal, am 21. Juli 1913. No. 466. Ehrhardt, Paul, Heidelberg, geb. am 21. Januar 1889 zu Saarbrücken, für Eindecker (Etrich), Flugplatz Johannisthal, am 22. Juli 1913. No. 467. Schröder, Bartholomäus, Leutnant, 7. bayer. Inf.-Regt., Johannisthal, geb. am 28. Juli 1889 zu Bamberg, für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 22. Juli 1913. No. 468. Sielrott!. Arthur, Leutnant, Fußart.-Regt. Nr. 20, Johannisthal, geb. am 1. Juni 1885 zu Gäbersdorf (Kr. Striegau), für Zweidecker (Wright), Flugplatz Johannisthal, am 22. Juli 1913. No. 469. Minster, Friedrich, Leutnant, Inf.-Regiment No. 41, geb. am 1. Dezember 1888 zu Osterode, für Zweidecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal am 22. Juli 1913 No 470. Schwandner, Heinrich, Leutnant, 5. bayr. Inf.-Regt!, Niederschöneweide, geb. am 9. April 1889 zu Speinshardt (Oberpfalz), für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 29. Juli 1913. No. 471. Roesch, Rudolf, Leutnant, 10 bayr. Inf.-Reg, Niederschöneweide, geb. am 11. Mai 1893 zu Konradshofen, für Eindecker (Albatros-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 29. Juli 1913 Von den Flugplätzen. Vom Flugplatz Friedrichshafen. Am 11. Aug. legten zwei Nationalflugspenden-Schüler, Dr. jur. Koesteri Gesandschaftsattche aus Heidelberg und Schiffsingenieur Dahm aus Altona in bester Form ihre Fliegerprüfung und sofort daran anschließend ihre Feldfliegerprüfung auf einem Wasserdoppeldecker Friedrichshafen mit 100 PS Argusmotor über dem Bodensee ab. Das Wetter war schön, wennschon in der erreichten Höhe von rund 600 m stark böig. Hervorzuheben ist, daß von beiden Schülern dank der umsichtigen Ausbildung durch den Ingenieur-Flieger Gsell während ihrer ganzen 14 bezw. 20 Flugtage umfassenden Ausbildung kein Bruch gemacht worden ist. Es ist die erste Feldfliegerausbildung auf Wasserflugzeugen. Vom Flugplatz Habsheim. Vorige Woche führte der Fluglehrer der Automobil- und Aviatik Akt.-Ges. der Flieger Fall er mit seinem Vater und seiner Mutter, ersterer 69, letztere 61 Jahre alt, einen Ueberlandflug aus. Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß diese alten Leute, unseres Wissens bisher wohl die ältesten Fluggäste, so viel Schneid zeigten, um von der Schönheit eines Fluges sich selbst zu überzeugen.  [Flieger Fallerjnitjseinen Eltern als Fluggäste. j'u Ferner zeigt eine weitere Abbildung den neuen Aviatik-Pfeildoppeldecker mit 6 Zyl. Mercedes-Motor, den Lt. Geyer mit Erfolg beim ostpreußischen Rundflug benutzte. Der Apparat stellt die gleiche Type dar, welche die Aviatik jetzt nach Metz und Darmstadt zu liefern hat und auf welcher Ingold in Gotha den I. Preis erhielt. Vom Flugplatz Johannisthal. Die Feldpilotenprüfung erfüllten: Am 6. August Alb. Dering auf Luft-Verkehrs-Doppeldecker, System Schneider, Lt. Wuthenowauf Albatros-Doppeldecker, Lt. Schwandner, bayr. Inf.-Rgt., auf Albatros-Eindecker. Am 7. August Flieger Ballod auf Melli Beese Taube. Am 12. August Ing. Richwitz auf 70 PS Fokker Argus-Eindecker. Flugplatz Oberwiesenfeld. Am 4. August erfüllte der Flugschüler Gustav Schachenmayr die Bedingungen zur Erlangung des Flugzeugführerzeugnisses auf einem Otto-Doppeldecker in bester Form. Die gleiche Prüfung legte am 13 August der Schüler Schmitt ebenfalls auf einem Otto-Doppeldecker in einer Höhe von 150 m mit Erfolg ab. Zu gleicher Zeit bestand der Flieger Schachenmayr seine Feldpilotenprüfung durch einen einstündigen Ueberlandflug nach Freising und zurück in einer Höhe von 900 m (Militärische Flüge. Ueberlandflüge der bayrischen Militär-Flieger. Von Schleißheim nach Regensburg über Freising. Landshut flog am 28. Juli Lt. Behl mit Oberlt. Mayr 1. Inf.-Regt, als Beobachter und benötigte zu der 120 Kilometer langen Strecke 1 Stunde 15 Minuten. Höchsthöhe 105 m. Desgleichen flog Lt. Schlemmer 18. Inf-Rgt. mit Oberlt. Steger über Straubing nach Regensburg. Einen Rundflug durch Bayern mit Abstecher nach Darmstadt unternahm am 30. Juli Lt. Henneberger mit Oberlt. Mayr als Beobachter auf Otto-Doppeldecker mit 100 PS Mercedes. Die erste Etappe Schleißheim—Würzburg mußte des starken Nebels wegen nach Kompaß geflogen werden. Im Maintal zwecks Orientierung Gleitflug aus 1800 m. 7:55 vormittags Landung auf Exerzierplatz Würzburg. Dje 240 km lange Strecke wurde in 2 Stunden 35 Minuten zurückgelegt. Abends 7:20 Weiterflug nach Aschaffenburg über Spessart. Landung daselbst 7:55 auf Exerzierplatz. Flugzeit 60 Kilometer in 30 Minuten. Am 31. Juli Weiterflug nach Darmstadt, Landung 7:15 abends in Griesheim, Flugzeit 42 Kilometer in 21 Minuten. Am 1. August früh 5:03 Rückflug nach München über Odenwald, Nördlingen, Donauwörth, Landung in Schleißheim 8:30 vormittags. Flugzeit 290 Kilometer in 31/« Stunden bei starkem Seitenwind. Größte erreichte Höhe 1450 Meter. Ein weiteren Rundflugdurch Bayern wurde am 7. August von Oberlt. Sorg, II. Bayr. Jäger-Bat. als Beobachter unter Verwendung von mehreren Maschinen der einzelnen Stationen ausgeführt. Der Abflug erfolgte von Schleißheim vormittags 5:20 auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor. Führer der Maschine war Lt. Behl vom 9. Inf.-Regt., welcher den Apparat zum Truppenübungsplatz bringen mußte. Am gleichen Tage abends 6 Uhr flog Oberlt. Sorg mitFliegerlt. Moos-maier auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Mercedes-Motor nach Würzburg, wo sie abends 8 :06 landeten. Am 9. Aug. flogen Lt. Moosmaier und Oberlt. Sorg als Beobachter vormittags 6:35 in Würzburg ab, und landeten 7:32 in Aschaffenburg, wo sie vom dortigen Offizierskorps unter den Klängen der Militärkapelle empfangen wurden. Abends Rückflug ab Aschaffenburg 6:30, an WUrzburg 7:15. Die Flieger gerieten auf dieser Strecke in so dichte Nebelschichten, daß sie zeitweise infolge Dunkelheit die Karte nicht mehr lesen konnten- Die Landung erfolgte in einem Gleitflug aus 1200 m Höhe. Am 12. Aug. flog Lt. Moosmaier mit Oberlt Sorg vormittags 7:45 wieder von WUrzburg ab und landete 8:15 in Schleißheim. Die Flugzeit für die 230 km lange Strecke betrug 2 Stunden. Nürnberg wurde in einer Höhe von 2000 m überflogen. 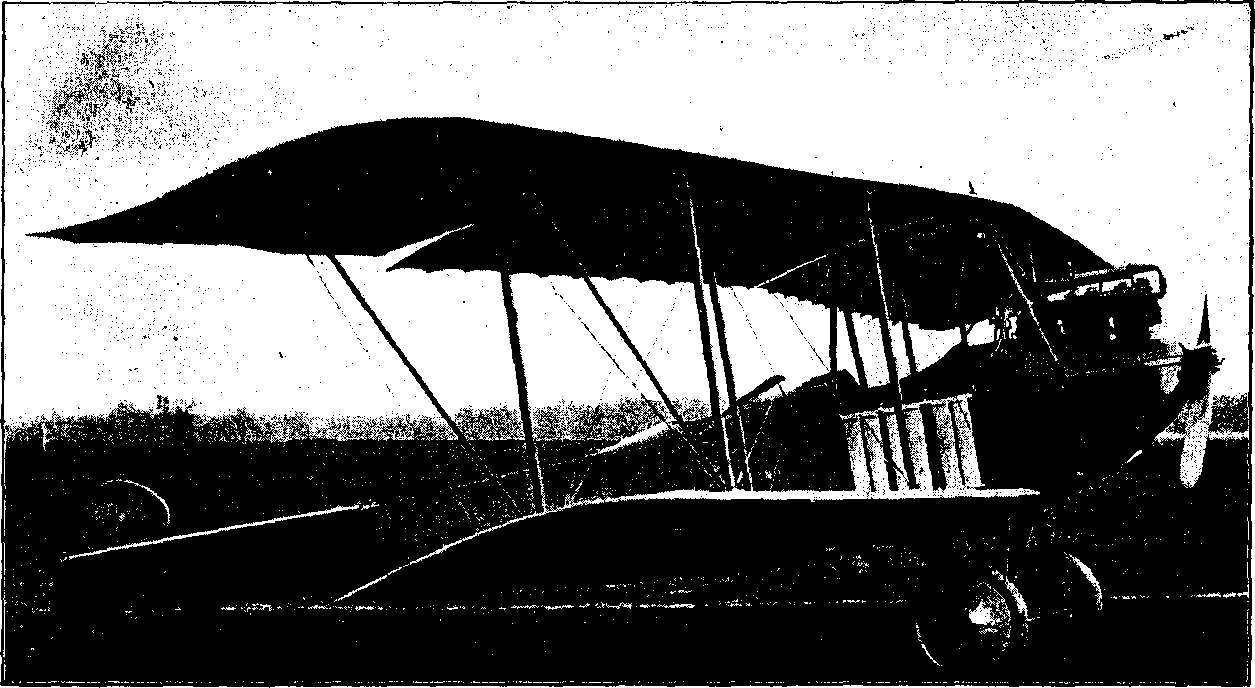 Der neue Aviatik-Pfeil-Doppelde&er. Von Hamburg nach Norderney flogen am 5. August die Fliegeroffiziere Oberleutnant Steffen mit Leutnant Cahlenberg und Leutnant v. Hiddessen mit Leutnant Weyer auf Albatros-Doppeldecker. Die Flieger waren um 5 Uhr morgens in Hamburg aufgestiegen, Uberflogen die Elbemündung, den Jadebusen und landeten glatt 7 : 30 in Norderney. Die Feldpilotenpriifuna; erfüllten Lt. K e m p t e r von der Schleißheimer Militärflugstation, sowie Lt. d L. Herrn. S c h e i n e r. Letzterer als erster bayrischer Reserveoffizier dieses Truppenteils. Von Kiel-Uebersee-Swinemünde flog am 15. August Vollmöller auf Albatros-Wasser-Eindecker. Vollmöller flog 4 : 22 nachm. mit Fluggast im Kieler Hafen ab und wasserte 7 :30 vor Swinemünde. Die Entfernung betrug 270 km. Der Höhenrekord mit zwei Pluggästen des Fliegers V. Stoffler (Aviatik-Pfeil-D. D. 100 Argus) am 13. Juli 1913 auf dem Flugplatz in Kiel aufgestellt, ist von der Flugzeug-Abteilung anerkannt worden. Die erreichte Höhe betrug 1740 m. Zu einem Fernflug startete Max Schüler auf einem Ago-Doppeldecker mit 100 PS Mercedes-Motor am 14. August. Als Beobachter fungierte der Offiziers-Flugschüler Lt. Krüge'. Als Ziel war zunächst Gotha in Aussicht genommen. Schüler startete 4 Uhr morgens mit 250 1 Benzin, 50 kg Oel und Gepäck für sich und seinen Fluggast. Bei strömendem Regen in der Nähe von Barwyn a. d. Elbe wurde eine kurze Zwischenlandung gemacht. Bei dem Weiterflug gerieten die Flieger wieder in schwere Gewitterwolken. Die elektrischen Entladungen waren so stark, daß der Kompaß sich wie ein Karussel drehte und jede Orientierung unmöglich machte. Die Flieger mußten daher unter den zuckenden Blitzen bei Eisleben landen, wo sie das Gewitter vorüber ziehen ließen. Nach einem nochmaligen Start wurde in der Gegend von Naumburg 7:30 abends bei völliger Dunkelheit gelandet. Man ließ das Flugzeug des Nachts im Freien stehen und startete am nächsten Tage 5:30 vormittags nach dem Flugstützpunkt Weimar. Berlin-In^terburg. Am 8. August startete der Flieger Friedrich auf einem Eindecker der Sport-Flieger G. m. b. H.. um 4:30 in Johannisthal mit Oberlt. Zimmermann als Fluggast zu einem Fernflug. Die Flieger erreichten das 210 km entfernte Schneidmühl bereits um 6:20, von wo sie um 8 Uhr wieder starteten und 10:57 in Königsberg landeten. Die Orientierung erfolgte lediglich nach einem Kompaß. Die reine Flugzeit, abgerechnet den Aufenthalt in Schneidmühl, betrug 4 Std. 52 Min. Am Nachmittag flog Friedrich um 5:59 nach dem 85 km entfernten Insterburg. Um 7:05 flog er von dort wieder nach Königsberg zurück, das er bei einbrechender Dunkelheit 8 Uhr abends erreichte. Friedrich gewann somit die 4000 Mark-Rente der National-Flugspende, die vorher der Ago-Flieger Max Schüler mit seinem Flug Chemnitz-Wien dem Harlan-Flieger Reichelt, bekannt durch seinen Flug nach Posen, abgenommen hatte. Die Gesamtllugstrecke des Fluges von Friedrich beträgt 713 km. Fritz Rössler stieg am 10. August auf dem Flugplatz Bork auf einem 30/45 PS Grade-Eindecker mit Fluggast zu einem Ueberlandflug nach Brück auf, Uberflog die Stadt in ca. 300 m Höhe und suchte in steilem Kurvengleitflug auf einer Wiese vor der Stadt zu landen. Hierbei hat er, wie es scheint, die Maschine zu spät abgefangen und stürzte tödlich ab. Wettbewerbe. Der Nennungsschluß für den Völkerschlacht-Erinnerungsflug (Verbandsfliegen), welcher von dem Leipziger Verein für Luftfahrt am 23. und 24. August auf dem Flugplatz der Leipziger Luftschiffhafen und Flugplatz-Aktiengesellschaft in Leipzig-Eutritzsch veranstaltet wird, hat besonders günstige Resultate ge eiligt. Nicht weniger als 14 Nennungen liegen nunmehr vor, es sind dies die folgenden: Gustav Otto Flugzeugwerke München, Flieger Raimund Breton Fliegerschule Martha Behrbohm, Leipzig, 2 Grade-Eindecker Harlan-Werke Johannisthal 2 Harlan-Flugzeuge, Flieger Krieger, Kohnert Deutsche Flugzeugwerke Leipzig, Flieger Oskar Roempler, Heinrich Oelerich Allgemeine Fluggesellschaft Berlin, Flieger Schiedeck Aviatik A.-G. Mülhausen-Elsaß, Flieger Victor Stoeffler Emil Jeannin Johannisthal, Flieger Alois Stiploscheck Komet-Flugzeugwerke Altenburg, Flieger Tibelsky Hermann Reichelt Johannisthal, Harlan-Eindecker Erich Schmidt, Leipzig, Sachsen-Doppeldecker Hermann Pentz Leipzig, Grade-Eindecker Paul Schwand! Johannisthal, Grade-Eindecker Otto Toepfer Johannisthal, Grade-Eindecker Die Preise der Gelsenkirchener Jubiläums-Flugwoche, 45 000 Mark, wurden wie folgt verteilt: Krumsieck (Gotha-Taube) 9488 M., Linnekogel (Rumpler-Eind.) 7998M., V. Stöftler (\viatik) 6843 M. Stiploscheck (Jeannin) 5606 M, Weyl (Otto-D.-D.) 4441 M, Beck (Kondor) 3062 M., Schlatter (Deutschland-D.) 2567 M., Krie.er (Harlan) 2102 M„ Friedrich (Etrich) 1026 M., Sablatnig (Union-Bomhardt-D.-D.) 352 M., Miiruu (Grade) 59 M. — Insgesamt wurde 4898 Minuten, gleich 81 Stunden 38 Minuten geflogen. Die längste Gesamtflugzeit hatte Stiploscheck mit 717 Minuten. Stiploscheck erzielte außerdem im Rennen über 20 Kilometer mit 11 Minuten 52 Sekunden die beste Zeit. Der Höhenrekord des Rumpier-Fliegers Linnekogel ist mit 4220 Metern bestätigt. Aeroplanfurnier Gotha. Für das diesjährige vom Luftfahrer-Verein Gotha in Gemeinschaft mit dem Kaiserlichen Aero-Club veranstaltete Aeroplanfurnier hatten gemeldet: 1. Ernst Stoeffler (Albatros-Doppeld. 100 PS Sechszyl. Mercedes). 2. Schiedeck (A. F. G.-Taube, 85 PS Vierzylinder Mercedes). 3. Charles Ingold (Aviatik-Pfeil-Doppeld., 100 PS Vierzylinder Argus). 4. Herbert Kohn ert (Harlan-Eind. 100 PS Argus; Harlan-Eind. 70PS Argus) 5. Otto Beck (Kondor-Eind. 100 PS Sechszyl. Mercedes). 6. Alfred Henning (Schwade-Doppeld. 73 PS Stahlherz; Schwade-Doppel- decker, 100 PS Stahlherz). Reserve: Paul Schwandt (Grade-Eind. 25 PS). Sämtliche Flieger, sogar die Reserve-Flieger, erschienen flugfähig am Start. Es war alles ausgezeichnet organisiert, nur das Wetter nicht, denn es regnete in Strömen. Bereits am Samstag vormittag besuchte Herzog Carl Eduard mit dem Prinzen von Wales den Flugplatz der Gothaer Waggonfabrik und besichtigte deren Erzeugnisse. Ernst Stoeffler mit Redakteur Kauders als Fluggast war auf dem Boxberg auf seinem 100 PS Albatros-Mercedes-Doppeldecker aufgestiegen und landete vor den Toren der Gothaer Waggonfabrik. Nachmittags 4 Uhr sollte auf dem Boxberg die Einweihung des Totalisators erfolgen. Das Wetter war das denkbar ungünstigste Ein böiger Wind peitschte schwere Nebelwolken über den Flugplatz, für den Bombenwurfwettbewerb ein wirklich nicht günstiges Wetter. Herzog Carl Eduard nebst Gemahlin besichtigten sehr eingehend die Flugapparate. Um 4:51 meldete sich Ernst Stoeffler mit  Aeroplanturnier Gotha. Fol. Teiigmann Herzog Carl Eduard (X) und die Herzogin. Kapitänlt. Berthold zum Start. Mit großer Geschicklichkeit gelang es ihm, die stampfende Maschine vom Boden wegzubringen. In 500 m Höhe überflog er das Zielviereck dreimal und warf 5 Bomben, wobei es Kapitänlt ßerthold gelang, zwei Geschosse ins Ziel zu bringen. Stoeffler erhielt somit als einziger Flieger den ersten Tagespreis von 1500 Mark. Da nur ein Flieger startete, konnte der Totalisator nicht in Betrieb genommen werden. Infolge des ungünstigen regnerischen Wetters beschloß die Oberleitung, Vorsitzender Kommerzienrat Kandt, für den 17, Aug. die Flugvorführungen abzusagen. Der 18. August begann mit dem Wettbewerb im Bomben werfen. Es starteten Stoeffler auf Albatros-Mercedes-Doppeldecker, Ingold auf Aviatik-Pfeil-Doppeldecker mit Lt. Heinrichshofen als Fluggast, Kohnert auf Harlan-Eindecker und Beck auf Kondor-Eindecker. Ingold mit Lt. Heinrichshofen gelang es, von 3 Bomben zwei in das Ziel hinabzuwerfen. Der Totalisator funktionierte heute zum erstenmale und zahlte 19:5. An dem Schnelligkeitswettbewerb nahmen sämtliche 7 Flieger teil und zwar Henning und Schwandt für den Wettbewerb der Flugzeuge unter 80 PS, während die anderen Flieger für die Formel 100 PS starteten. Als Ziel diente der 12 km entfernte Aussichtsturm im Thüringer Wald. Kohnert mußte unterwegs infolge Motordefekts niedergehen Beck auf Kondor geriet in die Wolken und konnte das Ziel nicht sehen. Er schied demnach auch aus. Die beste Zeit erzielte Ingold auf Aviatik-Pfeil-Doppeldecker, die zweitbeste Stoeffler auf Albatros-Mercedes-Doppeldecker. Der Totalisator zah te 22:5 für Sieg, 10, 11:10 auf Platz Es ist schade, daß die Veranstaltung unter der ungünstigen Witterung so zu leiden hatte. Man hat das Gefühl, daß sich der Gothaer Flugplatz infolge des großen Interesses seiner hohen Gönner des Herzogs Carl Eduard und des Prinzen von Schleswig-Holstein-Glücksburgsowie des sportfreudigen Publikums in Zukunft typisch entwickeln wird. Rundflug um Berlin. An dem am 30. und 31. August stattfindenden Rundflug werden voraussichtlich mi destens 25 Flugzeuge teilnehmen. Bisher haben gemeldet: 1. Josef Sablatnig. (Union - Pfeil- 18. X. (Otto-Doppeldecker). Doppeldecker, System Bomhardt). 19. Viktor Stoeffler (Aviatik-Pfeil- 2. Josef Su w el ack (Kondor - Ein- Doppeldecker). 3. Äeck (Kondor-Eindecker). »ϖ Ch- In «<" d (Aviatik-Eindecker). 4. W. Rosenstein (Gotha-Taube). 21. Colombo (Föhn-Eindecker). 5. Linnekogel (Rumpler-Taube). 22. R. Boehm (Albatros-Eindecker). 6. KarlKrieger(Harlan-Eindecker). 23. Ernst PI. Stoeffler (Albatros- 7. Leo Roth (Harlan-Eindecker). Doppeldecker). 8. H. Kohnert (Harlan-Eindecker.) 24. Dipl -Ing. Thelen (Albatros- 9. W.Kießling(Ago-Doppeldecker). Doppeldecker). 10. Alois Stiploscheck (Jeannin- 25. HellmuthHirth(Albatros-Doppel-Taube), decker). 11. F. LaitschJL. V. G.-Eindecker). 26. Hans Vollmoeller (Albatros- 12. R. Janisch (L. V. G.-Doppel- Eindecker). decker). 27. Otto de Ball od (M. B.-Taube). 13. M. Schul er (Ago-Doppeldecker). e8 K ■ M h s (Luftfahrzeufr-Pfeil- 14. A. F ri e d r i c h ZEtrich-Taube). 28' n'nnelrierkeri 15. Richard Schmidt (Torpedo-Ein- ^ "0PPelaeckei> decker). ^ Bruno Langer (Luftfahrzeug- 16. Weyl (Otto-Doppeldecker). Pfeil-Doppeldecker). 17. Otto Stiefvater (Jeannin-Stahl- 30. Paul F i e d I e r (Luftfahrzeug-Pfeiltaube). Eindecker). Am 30. Aug. umfliegen die Bewerber bekanntlich einmal Berlin und am 31. Aug. zweimal Der Weg, welcher von den Fliegern genommen wird, ist folgender: Flugplatz Johannisthal, Klarahöhe bei Lindenberg, Flugfeld Schulzendorf, Kaserne zwischen Bornstedt und Eiche, Luftschiffhafen Potsdam, Flugplatz Johannisthal. Bei jeder Runde muß je eine Wendemarke auf Klarahöhe, auf dem Flugfelde Schulzendorf, bei der Kaserne zwischen Bornstedt und Eiche und dem Luftschiffhafen Potsdam außen umflogen werden. Der Ostpreußische Rundflug nahm programmäßig am 9. Aug. seinen Anfang. Leider war ein großer Teil der Flieger nicht erschienen. Es meldeten sich folgende Apparate zum Start: C i vil f 1 i eger: A. Stiploscheck auf Jeannin-Stahllaube mit Argus 100 PS (Fluggast Lt. v. Falkenhayn). J. Suwelack auf 100 PS Kondor-Mercedes-Eindecker (Fluggast Oberlt. Schettler). Kühne auf Albatros-Mercedes-Eindecker (Fluggast Oberlt. Nordt). Friedrich auf 100 PS Etrich-Mercedes-Taube (Fluggast Oberlt. Zimmermann). Caspar auf 100 PS Gotha-Mercedes-Taube (Fluggast Lt. Plagemann). Militärflieger: Oberlt. Hantelmann auf 100 PS Rumpler-Mercedes-Taube (Fluggast Lt. Zimmer-Vorhaus). Lt. v. Eckenbrecher auf 100 PS Jeannin-Argus-Stahltaube (Fluggast Lt. v. Schroeder). Lt. Geyer auf Aviatik-Pfeil-Doppeldecker, (Fluggast Oberlt. Prins). Lt. Pretzen auf Albatros-Mercedes-Taube (Fluggast Oberlt. Felmy). Lt. Mahncke auf 100 PS L.-V.-G.-Mercedes-Doppeldecker (Fluggast Lt. Bernhardt). Die 5 Privatflieger führten nachmittags gegen 6 Uhr den vorgeschriebenen Viertelstundenflug aus. Kühne auf Albatros-Mercedes-Eindecker machte einen Fernflug nach Tapiau. Stiploscheck auf Jeannin-Argus-Stahltaube erzielte die längste Flugdauer mit 38 i, Minuten, die zweitlängste Kühne. Caspar erreichte mit seiner Gotha-Mercedes-Taube eine Höh- von 2200 m. Für die erste Etappe des Rundfluges starteten am 19. Aug. vormittags 5:32 Friedrich auf Etrich-Mercedes-Taube, 5:36 Suwelack auf Kondor-Mercedes-Eindecker, 5:43 Stiploscheck auf Jeannin-Argus-Stahltaube und 5:45 Kühne auf Albatros-Eindecker. Caspar auf Gotha-Mercedes-Taube, der etwas verspätet startete konnte erst 9:51 abfliegen. Die Flieger hatten Wehlau als Kontrollstation zu passieren. Als erster traf ein in Insterburg Suwelack 6:53. Hiernach folgten Friedrich 6:55, Stiploscheck 7:04, Kühne 7:50 und Caspar 11:22. Von den Offiziersfliegern, welche unter ungünstigen Witterungsverhältnissen starteten, erreichten Alienstein: Lt. Mahncke auf L.-V -G.-Mercedes-Doppel-decker, Lt. Geyer auf Aviatik-Pfeil-Doppeldecker, Lt. Pretzen auf Albatros-Mercedes-Taube und Lt. von Eckenbrecher auf Jeannin-Argus-Stahltaube. Die erzielten Zeiten sind: Lt. Geyer 2 Std. -2, Lt. Pretzen 2 Std. 6, Lt. von Eckenbrecher 2 Std. 24 und Lt Mahncke 6 Std. 35 Für den Nachmittag waren in Insterburg noch Schauflüge angesetzt, bei denen Caspar auf Gotha-Mercedes-Taube sich die Preise holte. Für den 11. August war für die Offiziersflieger eine Aufklärungsübung angesetzt, die jedoch infolge des sehr unsichtigen Wetters ausfiel. Die Offiziere starteten daher direkt nach Insterburg. Es wurden folgende Zeiten erzielt: Lt. Pretzell 10:21:32; Lt. Mahncke 10:37:27; Lt. Geyer 10:42 : 26 und Oberlt. Hantelmann 10 : 50:04. Lt v. Eckenbrecher hatte weniger Glück; er stürzte in der Gegend von Klein-Gnie auf halbem Wege etwa aus 200 Meter Höhe ab ohne Schaden zu nehmen. Die Civilflieger starteten am 11. Aug von Insterburg nach Alienstein. Der Start erfolgte morgens gegen 6 Uhr. Allenstein erreichten: Friedrich auf 100 PS Etrich-Mercedes-Taube und Caspar auf 100 PS Gotha-Mercedes-Taube. Am Ende des zweiten Tages waren noch im Wettbewerb 3 Privat- und 4 Offiziersflugzeuge. Die Aufklärungsübung am 12. Aug., Insterburg—Tilsit, 100 km, wurde von Lt. Mahncke, Oberlt. Hantelmann, Lt. Pretzell und Lt. Geyer tadellos erledigt. Am gleichen Tage fand in Allenstein ein Bombenwurf-Wettbewerb statt, bei dem Kühne mit Oberlt. Nordt auf Albatros-Doppeldecker einen Treffer und Caspar auf Gotha-Taube mit Lt. Plagemann ebenfalls einen Treffer erzielte. Am 13. August hatten die Civilflieger von Allenstein nach dem 150 km entfernten Königsberg zu fliegen. Es wurden folgende Zeiten erzielt: Friedrich auf Etrich-Taube 1 Std. 40, Caspar auf Gotha-Taube 1 Std. 43 und Kühne auf Albatros-Eindecker 1 Std. 44. Die Offiziersflieger starteten trotz des Regenwetters 7:30 von Insterburg nach Königsberg. Es flogen Lt. Mahncke auf L.V.G.-Doppeldecker, Lt. Pretzell auf Albatros-Taube und Oberlt. Hantelmann auf Rumpier-Taube. Der letzte Flugtag, der 14. August, brachte endlich etwas besseres Wetter. Auf dem Pragramm &tand ein Flug über Pillau nach Königsberg zurück. Pünktlich 5 Uhr morgens wurde der Start freigegeben. Sämtliche Flieger erledigten die Aufgabe ohne Zwischenfall. Es starteten: Oberlt. Hantelmann mit Oberlt. Zimmer-Vorhaus um 6:02, Lt Mahncke mit Lt. Bernhardt um 6:05, Lt. Geyer mit Lt. Prins um 6:08, Lt. Pretzell mit Oberlt. Felmy 6:15, Kühne mit Oberlt. Nordt um 6:12; Friedrich mit Oberlt. Zimmermann um 6.23, Caspar mit Lt. Plagemann um 6:26. Die für die Bewertung maßgeblichen Flugzeiten waren: Zivilflieger: Kühne (100 PS Albatros-Mercedes-Taube) 47 : 28. Friedrich (100 PS Etrich-Mercedes-Taube) 53:13. Caspar (100 PS Gotha-Mercedes-Taube) 58:05. Offiziere auf Heeresflugzeugen: Oberlt. Hantelmann (100 PS Rumpier-Mercedes-Taube) 55:22. Lt. Mahncke (100 PS L.-V.-G.-Mercedes-Doppeldecker) 59:05. Lt. Geyer (100 PS Aviatik-Mercedes-Doppeldecker) 1:03:05. Lt. Pretzell (100 PS Albatros-Mercedes-Taube) 1:06:32. Abends fand in der Stadthalle von Königsberg ein Festmahl statt, während welchem die Preise verteilt wurden. Von den Offiziersfliegern erhielt den ersten Preis (Kaiserpreis) für die beste Zeit in allen Etappenflügen Lt. Pretzell (100 PS Albatros-Mercedes-Taube), den zweiten Preis (Preis des Kriegsministeriums) Lt. Geyer (100 PS Aviatik-Mercedes-Doppeldecker) Von den Zivilfliegern erhielt für die beste Gesamtflugzeit den ersten Preis (Preis der Nationalflugspende 12000 M.j der Flieger Alfred Friedrich (100 PS Etrich-Mercedes-Taube), 35 Gutpunkte, den zweiten Preis (8000 M. aus der Beihilfe des Kriegsministeriums), der Flieger Kühne (100 PS Albatros-Mercedes-Taube), 15 Gutpunkte. Der dritte Preis (5000 MO fiel an Caspar (100 PS Gotha-Mercedes-Taube). Von den Begleitern der Offiziersflieger erhielt den ersten Photographiepreis Lt. Prins (Begleiter Lt. Geyers), während der erste Preis dieser Konkurrenz für die Zivilflieger an Oberlt. Zimmermann fiel, der mit Friedrich geflogen war. Dem Harlantlieger Roth wurde ein Ehrenpreis zuerkannt. Verschiedenes. Personal-Aenderungen in derFlugzeug-Abteilung. Essind ausgeschieden: Der Vorsitzende der Abteilung, de la Croix, Kapitänleutnant a. D. Kaiser, Schmal. An Stelle des Herrn de la Croix hat den Vorsitz zunächst der stellvertretende Vorsitzende der Abteilung, Hauptmann a. D. Blattmann, übernommen. Von der Konvention der Flugzeugfabrikanten ist Direktor Zeyßig an Stelle des Direktors Schmal in Aussicht genommen. Der Flugstützpunkt Koburg wurde am 6. August in Anwesenheit des Herzogspaares und des Generalmajors Messing eröffnet. Zehn Militärflugzeuge, darunter Major Siegert, waren auf dem Luftwege eingetroffen, von denen acht an dem Flugrennen um den Ehrenpreis des Herzogs teilnahmen. Den Preis errang Leutnant Joly auf einer Gothataube. 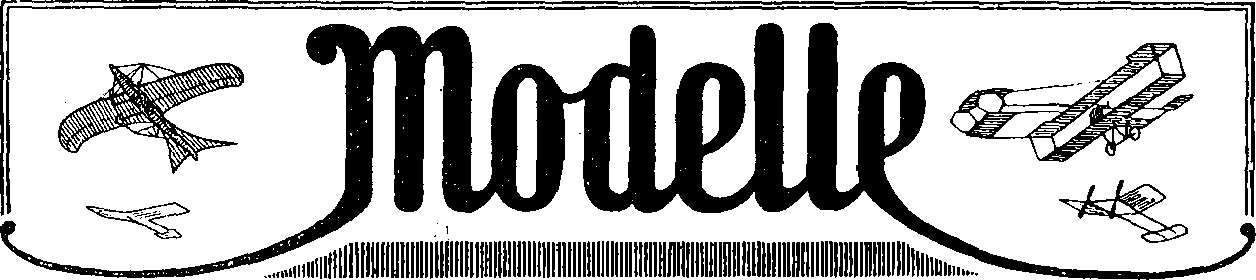 Eindecker-Modell Woellenstein. Die erreichbare Fluglänge des mövenartigen Modells schwankt zwischen 120—150 m bei einer Flughöhe von 5—6 m, und einem Gewicht von 2,5 kg. Zur Bespannung der Flügel, des Schwanzes und des Seitensteuers dient dünner Aeroplanstoff. Die Flügelträger (5X10 mm), sowie ein Teil des Rumpfes bestehen aus Pitchpineholz. Das kräftig gebaute, mit 0,2 mm dickem Stahldraht verspannte Fahrgestell besteht aus Aluminium-Rohr von 6 mm Durchmesser, in welches zur Verstärkung Holzstäbchen eingeschoben sind. Die Räder des Fahrgestells sind aus gedrehtem Erlenholz gefertigt. Das Fahrgestell sowie die Eindecker-Modell Woellenstein. Flügelholme sind am Rumpf in Aluminium-Gußschuhe eingeschoben. Der Rumpf des Modells, bzw. oie Karosserie besteht aus Aluminium-Rohr, von 0,2 mm Wandstärke und ist hinten mit Stoff überzogen. Die Schleifkufen aus Bambus-Rohr laufen am Ende in einen Stahldraht aus. Die 2 Spannsäulen aus Aluminium-Rohr, mittels denen die Flügelenden nach oben gezogen sind, sind unterhalb der Tragfläche als Kufen ausgebildet. Die Flügel verspan nung besteht aus Stahldraht, die oben durch kleine Spannschrauben nachstellbar ist. Höhen- und Seitensteuer sind durch Hebel verstellbar. (Siehe „Flugsport" Nr. 10, 1913 Seite 384) Der Antrieb des Modells erfolgt durch eine 50 cm „Normal-Centralschraube", die durch einen 3 Cylinder-Preßluft-Motor von Otto Ackermann angetrieben wird. Mittels Fußluftpumpe wird die Flasche gefüllt und der Ventilhahn geöffnet, worauf der Motor zu arbeiten anfängt. Das Modell erhebt sich nach kurzem Anlauf in die Höhe und sobald der Motor etwas nachläßt, erfolgt ein langer gestreckter Gleitflug, der das Modell ruhig auf den Boden setzt. Frankfurter Flugmodell-Verein. Alle diejenigen Mitglieder, die sich an der Modell-Ausstellung und dem Modell-Wettfliegen in Darmstadt beteiligen, müssen die Anmeldebogen genau ausgefüllt bis spätestens Donnerstag, den 4. September an Herrn Fritz Wittekind, Frankfurt a. M., Eppsteinerstr. 26 einsenden. Die Vorprüfung findet Sonntag, den 7. September statt, jedoch ist der Ort noch nicht festgelegt. Zur Zeit findet in Frankfurt die Kriegsmarine-Ausstellung im alten Sencken-berginnum statt und wird unseren Mitgliedern ein Vorzugspreis von 30 Pfg. statt 60 Pfg. gewährt. Die Karten sind nur durch unsere Geschäftsstelle zu erhalten und müssen umgehend bei dieser bestellt werden, andernfalls keine Ermäßigung mehr eintreten kann, Die nächste Mitglieder - Versammlung findet Donnerstag, 4. September abends 8 V« Uhr im „Stadtgarten" statt. Tages - Ordnung. 1. Kassenbericht. 2. Besprechung einer Ausstellung. 3. Verschiedenes. In der Zeit vom 14.—20. September ds. Js. veranstaltet der Berliner Modellflugsport-Club in Berlin eine Modell-Ausstellung mit anschließendem Wettfliegen und wurden wir von dem „B. M. C." aufgefordert, uns an seiner Veranstaltung zu beteiligen. Die Bedingungen und Anmeldebogen sind von unserer Geschäftsstelle zu beziehen. Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an den Vorsitzenden Fritz Wittekind, Frankfurt a. M, Eppsteinerstrasse 26. Der Berliner Modellflugsport-Club veranstaltet vom 14. bis einschließlich 20. September eine Ausstellung und daran anschließend am 21. Sept. ein Wettfliegen. Außer Ehrenurkunden stehen 100 Mk. Geldpreise zur Verfügung. Besonders sollen Preise für Wasserflugzeug-Modelle vorgesehen werden. Interessenten können Anmeldescheine und Bedingungen von der Geschäftsstelle des Berliner Modellflugsport-Clubs, Charlottenburg, Nehringsfr. 32, beziehen. No. 17 JiPLUG[SPOR T.' Seite 643 Deutsche Fachausdrücke im FIugzeug-Modeübau. In der Literatur wurden bisher bei Beschreibungen in Bezug auf Modellbau für ein und denselben Bestandteil eines Modells verschiedene Bezeichnungen angewandt; so z. B. findet man sehr häufig das Wort „Motorstab". Bei einigem Nachdenken kommt man zu der Ueberzeugung, daß dieses Wort nicht das bezeichnet, was eigentlich damit gemeint ist In letzter Zeit findet man mehrere dieser unzutreffenden Bezeichnungen. Um nun dahin zu wirken, daß auch !m Modell-Flugwesen, das sich immer mehr und mehr verbreilet und entwickelt, einheitliche deutsche Ausdrücke gebraucht werden, bringen wir nachstehend verzeichnete Bezeichnungen heraus, mit der Bitte an die verehrl. Modell-Flugvereine und Modellbauer, uns in dieser Richtung hin tatkräftig zu unterstützen. Wir wollen in unserem Modellflugwea'en nur sinngemäße deutsche Ausdrücke in Anwendung bringen. Als deutsche Fachausdrücke bringen wir zunächst folgende: Qummiantrieb (nicht Gummimotor) Umdrehungen (nicht Touren) Spannkörper (nicht Motorstab, Spann- Rumpf oder Körper (nicht Chassis) leiste Tragfläche, Tragdeck Gummistrang = ein Gummifaden Schwanzfläche, Dämpfungsfläche Luftschraube (nicht Propeller? Richtungsfläche (nicht Stabilisie- Schraubenwelle rungsfläche) Endbaken Höhensteuer, Seitensteuer Steigung der Schraube Verwindung (nicht Gauchissement) Zugschranbe, Druckschraube Tragflächenbelastung linksläufig, rechtsläufig. Tragflächeninhalt Es empfiehlt sich, bei größeren Modellen die Belastung in Quadratdezimeter und bei kleineren inJ,Quadratzentimeter anzugeben. Wir hoffen nun, daß diese Zeilen dazu beitragen werden, daß die genannten Ausdrücke Gemeingut^unserer deutschen Modellbauer werden. Frankfurter Flugmodell Verein. Literatur.*) Almanach de l'Aviation pour 1913. 128 Seiten. (Französischer Text) Preis Frs. 1.50. Diese Schrift ist in der üblichen Form der populären Volkskalender geschrieben und enthält in gemeinverständlicher kurzer gedrängter Weise die Entwicklung der Flugmaschinen unter Berücksichtigung der Versuche mit Schrauben-und Schwingenfliegern. Meteorologische Ausbildung des Fliegers von Dr. Franz Linke, geb. Mk. 1.70. Verfasser hat mit der Herausgabe dieses Büchleins einem großen Bedürfnis abgeholfen. Die Meteorologie ist für den Flieger eine der Hauptwissenschaften Das vorliegende Lehrbuch ist in der Hauptsache für die Flugschüler als Leitfaden bestimmt und im Auftrag und mit Unterstützung des Kuratoriums der Nationalflugspende entstanden Der Inhalt belehrt den Fluginteressenten über die meteorologischen Instrumente des Fliegers, die Luftbeweguhgen und Zerstörungen, die Wetterkunde und Wetterdienst, kurz über das Wichtigste, was der Flieger unbedingt wissen muß, in gemeinverständlicher Form. Deutsches Luftrecht von Hermann Weck, Rechtsanwalt in Charlottenburg. Berlin, Carl Heymanns Verlag 1913, 328 Seiten. In dem vorliegenden Buche ist zum erstenmale der Versuch einer systematischen Behandlung des Luftrechts gemacht. Verfasser geht zunächst auf die Grundlagen des neuen Rechts, dessen Eigentümlichkeiten und die Technik insoweit ein, als es für den Leser des Buches zum Verständnisse erforderlich und für den Gesetzgeber auf diesem neuen Gebiete notwendige Voraussetzung ist. Nach einem kurzen Ueberblick über die Geschichte dieser neuen Materie wird zunächst das „Recht der Atmung" behandelt. Die Ausführungen des Verfassers, die häufig auf neue Gesichtspunkte hinweisen, sind sehr lesenswert, dürften aber mehr den Verwaltungsbeamten und Juristen als die Leser dieser Zeitschrift in- *) Sämtliche besprochenen Bücher können durch die Expedition des „Flugsport" bezogen werden. teressieren. Auch die folgenden Kapitel „Dingliche Rechte an der Luft und am Luitraum" und „Nachrichtenverkehr in der Luft" (hier besonders bemerkenswert die Ausführungen über die Funkenschrift und deren völkerrechtliche Regelung) können als grundlegende Arbeiten des Verfassers auf diesem Gebiete bezeichnet werden, eignen sich aber nicht zu einer eingehenden Besprechung im „Flugsport". Umsomehr verdient der sechste und weitaus umfangreichste Teil über die „Luftfahrt" Beachtung für Konstrukteure und Flieger, die Aufschluß Uber rechtliche Fragen auf dem Gebiete des Luftrechts oder über die geplante Neuregelung desselben wünschen. Es wird nämlich liier zum erstenmale der Text des z. Zt. dem Bundesrat vorliegenden Entwurfes des Luftgesetzbuches mitgeteilt. Es wäre sehr zu wünschen, wenn auch Männer der Praxis sich zu demselben in eingehender Weise äußerten. Es sei hervorgehoben, daß die in diesem amtlichen Entwurf fast durchweg zu Tage getretene Erkenntnis von der Bedeutung der Luftfahrt eine endgültige Regelung erhoffen läßt, die sowohl von den Fliegern und Luftschifführern als der Allgemeinheit als gerecht empfunden wird. Die Ausführungen des Verfassers gehen aber weit über den Rahmen des amtlichen Entwurfes hinaus. Es sind hier vor allem Fragen auf dem Gebiete des Stempelrechts, Strafrechts, Gewerberechts, der Sicherheitspolizei, des Versicherungsrechts und des Bürgerlichen Gesetzbuchs, welche den Praktiker in erster Linie interessieren werden. Es muß besonders anerkannt werden, daß der Verfasser überall seine Ansicht in klarer und bestimmter Weise zum Ausdruck gebracht hat und auf unsre besonderen deutschen Verhältnisse in bemerkenswerter Weise Rücksicht genommen hat. Das Werk kann zur Anschaffung nur empfohlen werden; es scheint berufen, bei den bevorstehenden Beratungen des III. Kongresses des internationalen juristischen Comites für das Flugwesen bereits eine besondere Rolle zu spielen. Revue Generale de l'Aeronautique mllitaire theorlque et pratique. Librairie Aeronautique Paris. Preis 1,50 Frs. Die monatlich in französischem Text erscheinende Broschüre gibt einen umfassenden Ueberblick über den jeweiligen Stand der französischen Flugtechnik. Bemerkenswerte ausländische Flugzeuge werden ebenfalls besprochen. Die Broschüre ist mit Hand- und Maßskizzen sowie Illustrationen reichhaltig ausgestattet und verdient das Interesse des Laien und Fachmannes. SSV. R. (Berichtigung) Die Formel für die Druckmittelpunktsbestimmung lautet: d = (0,2 + 0,3. sin «) ϖ b. R. W. Die Rippen von verwindbaren Tragdecken sind im allgemeinen höher und stärker dimensioniert. Da dieselben bei der Verwindung schraubenförmig auf Torsion beansprucht werden, sind die äußeren Kanten der durchgehenden Hölzer stark abgerundet, um ein Einreisen des Holzes und Durchscheuern der Bespannung zu verhindern. Die Holme bestehen meist aus Stahlrohr mit Holzfütterung, sodaß die Rippen sich leicht auf dem Holm drehen können. Um das Verrücken derselben zu verhindern, sind bei letzter Aus-führungsform arretierende Splinte vorgesehen, z. B. bei den Bristol- und Caudron-Eindeckern. Bei Vierkantholmen von Holz werden die Rippen leicht angestiftet und mit leimgetränktem Bindfaden oder Band festgehalten. Dasgleiche Verfahren wird auch zur Befestigung der Rippenklötzchen angewendet. Die Hinterkante der Rippen wird von einem Draht oder einer durchgehenden Leiste gefaßt, wobei zu berücksichtigen ist, daß im ersteren Falle die äußersten Rippen des Tragdecks durch Versteifungen oder dgl. Verstärkungen, wegen der auftretenden Drahtspannungen abgefangen werden müssen, um sie gegen Abbrechen zu sichern.  Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.) No .17 „FLUGSPORT." Seite 645 Firmennachrichten. Flugzeugfabrik mit Fliegerschule in Speyer. Mit den Pfalz-Flugzeugwerken Luenz-Albatros, Q. m. b. H., in Speyer, Geschäftsführer A. Eversbusch aus Neustadt a. H. und Rieh Kahn aus Mannheim wird ein Vertrag abgeschlossen, wonach an diese Firma zum Zwecke der Errichtung einer Flugzeugfabrik die der Stadt gehörige erforderliche Fläche unweit der bestehenden, insbesondere den Militärfliegern zur Verfügung stehenden Flugzeughalle des pfälz. Luftfahrtvereins Speyer am Rheindamme abgegeben wird. Da die Firma auf dem Flugplatze Speyer auch eine Fliegerschule betreiben will, beschließt der Siadtrat ferner, die Gräben am Rande des Exerzierplatzes einzuebnen, das angrenzende Terrain nur mit Gras oder Klee bebauen zu zu lassen und alle den Fliegerschulbetrieb störenden Pappeln zu fällen. Berichtigung. Lt. Siber, Inf. Regt 25, Piloten-Patent Nr. 236, ist in unserer Tabelle „Deutsche Flieger" irrtümlich mit einem Kreuz versehen. Wir bitten, diese Notiz in der Tabelle zu streichen. Lt. Siber war nach seinem Sturz in Sonnewalde nach zwei Monaten wieder dienstfähig und ist seit dem 1. Febr. 1913 wieder geflogen. Expadltlon-iter ■ * _ m A — Expedition der a°artM. üleine Anzeigen Die zwelgespaltene Millimeter-Zelle kostet 25 Pfennig. Kleine Anzeigen können nur bei gleichzeitiger Einsendung des Insertions-betrages Aufnahme finden. Eingehende Offerten haben deutlich sichtbar betr. Chiffre zu tragen, da die Inserenten geheim gehalten werden Geprüft. Pilot! Schweizer, deutsch, französisch und englich sprechend, mit Ein- und Zweidecker vertraut, mit guten Fachkenntnissen, sucht Engagement in einer Flugzeugfabrik als Flieger und Konstrukteur. Gell Offert unter M. B. 1157 an die Expedition dieses Blattes. Flugapparat mit 100 PS Argus (Stundenflug) auch einzeln verkäuflich. Ang. unt. „Argus" an Rudolf Mosse, Potsdam. (1156) Ein 4 Zyl. luftgekühlter Haake - Motor 40- 50 PS, mit Propeller für 100 Mk. zu verkaufen. Gefl. Anfr. unt. 1152 an die Exped. erb. Teilhaber mit gutem 50/70 ps Flugmotor f. Flugzeug gesucht. Anfragen an (1159) Hugo Kunze, Niederlungwitz i. Sa. Von grösserer Flugschule ausserhalb Berlins wird zum sofortigen Eintritt ein FLUGLEHRER gesucht. Es ist erwünscht wenn derselbe in der Ausbildung bereits gute Resultate erzielt hat. Offerten mit Gehaltsansprüchen unter 1142 an die Geschäftsstelle d. Blattes.  Jllustrirte No. 18 technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnement: 3. September für das gesamte To^Zllu .eis. h*. i „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef. 4557 Amt I. Oskar UrsitlUS, CivilingenieuF. Tel.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14 tägig. — ■ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ===== Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet Oie nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 17. September. Michel, schlafe nicht! Wer die französischen Tageszeitungen in letzter Zeit etwas verfolgt hat, mag verschiedentlich mit Genugtuung gelesen haben, wie man urplötzlich beginnt, die Fortschritte des deutschen Flugwesens in den Himmel zu heben. So erhebt man zur Zeit gegen den Aero-Club de France die schwersten Anschuldigungen, er habe sich nicht um die Industrie bekümmert und nichts getan, um derselben neue Arbeitsgelegenheit zuzuführen. Er sei daran schuld, daß das deutsche Flugwesen das französiche eingeholt habe. Der „Matin" hat natürlich die Vorzüglichkeit dieses Reklamemittels erkannt und seine Taktik in der Propaganda in das Gegenteil umgeändert. Der „Matin" bringt u. a. am 1. September einen im Verhältnis zu früheren Aufsätzen geradezu überschwenglichen Lobesartikel über das deutsche Flugwesen. Es heißt darin u. a., daß die Organisation des Flugwesens im Heeres- und Marinedienst vollkommen sei und daß es an nichts fehle. Daß alles bis auf das geringste organisiert sei. Wie es mit unserem Marine-Flugwesen aussieht, wollen wir hier nicht näher erörtern. Wir möchten nur mit allen Mitteln auf die Gefährlichkeit dieser Taktik hinweisen, die gefährlicher ist als die frühere, wo Frankreich die Popularität des französichen Flugwesens fortgesetzt in den Himmel hob. Es ist zu hoffen, daß dieser Warnungsruf nicht ungehört verhallt. Die gleiche Taktik wird auch jenseits des Kanals geübt. Hierzu eine kleine Illustration. Es kommt von ungefähr ein deutscher Fachmann nach England, um sich die englischen Wasserflugmaschinen anzusehen. Ein englischer Offizier, der ihm sehr befreundet ist, schildert nun in freundschaftlicher Weise die große Rückständigkeit der englischen Militär- und Marineluftfahrt. Er sagte ihm u. a.: „Wofür brauchen Sie noch Flugmaschinen? In Deutschland haben Sie ja die vorzüglichen Zeppeline mit großem Aktionsradius und mit drahtloser Telegraphie. Für uns Engländer ist es klar, daß die Zeppeline den Flugmaschinen bei weitem überlegen sind. Ein Zeppelin braucht nur fortgesetzt über der Nordsee zu kreuzen und den Stand Und Aufmarsch unserer Flotte drahtlos nach Berlin zu übermitteln, um jederzeit über den Stand zu orientieren." — — — Der deutsche Fachmann war befriedigt und zog nach Berlin. —■ Nun, wir haben ja Marine-Luftschiffe. — — Michel, schlafe nicht! Gib Mittel für Marineflugzeuge. Paris-Deauville und der Flugmaschinen-Wettbewerb der französischen Marine. (Ingenieur Oskar Ursinus) Paris —Deauville, Ende August 1913. Die Wettbewerbe von Deauville halte ich für die bedeutendsten des Jahres 1913. In der Beteiligung, abgesehen von dem Fernflug Pecq—Deauville, waren sie national, ein reiner Marine-Wettbewerb. Andererseits waren sie in der Beteiligung der Zuschauer und Interessenten, abgesehen von Deutschland, im weitesten Sinne international. Und das ist das allerwichtigste. Mit diesem Wettbewerb hat sich Frankreich einen Riesenvorsprung gegenüber anderen Ländern geschaffen. Von den verschiedensten Nationen sind auf Grund des Wettbewerbs Bestellungen erfolgt, sodaß einige Firmen für die nächste Zeit im Wasserflugmasehinenbau gut beschäftigt sind. Der gute Beschäftigungsgrad in der französischen Flugzeugindustrie und deren finanzielle Kräftigung bedeutet für die französische Marine eine nicht zu unterschätzende Reserve, die wir in Deutschland leider nicht besitzen.- Es ist hier nicht der Ort, diesen Gegenstand, schon dem Ausland gegenüber, zu besprechen. Man sieht eben, die Franzosen verstehen es besser wie wir. Für den Wettbewerb suchte man sich nicht einen entlegenen Winkel heraus, sondern man geht in das fashionabelste Seebad und macht den internationalen Besuchern das Leben so angenehm wie möglich. Man zeigt die Größe Frankreichs auf dem Gebiete des Marine-Flugwesens in den schillerndsten Farben. Der Erfolg ist da. Die Franzosen haben längst gelernt, mit der Geheimniskrämerei zu brechen. Für sie ist das wichtigste, Flugmaschinen zu verkaufen und für die Marine das wichtigste, fortgesetzt Reserven in der Industrie in Fabrikation zu haben. Andererseits bietet die hohe See, weitab vom Strand, genügend Gelegenheit zu Versuchen, die man nicht sehen lassen will. Die französische Flugzeugindustrie hat im ersten Halbjahr 1913 für ca. 16 Millionen Francs Flugzeuge nach dem Ausland verkauft. Bei uns kommt noch nicht einmal eine Million zusammen. Hier müssen wir einsetzen. Das ist mit das wichtigste, was wir von 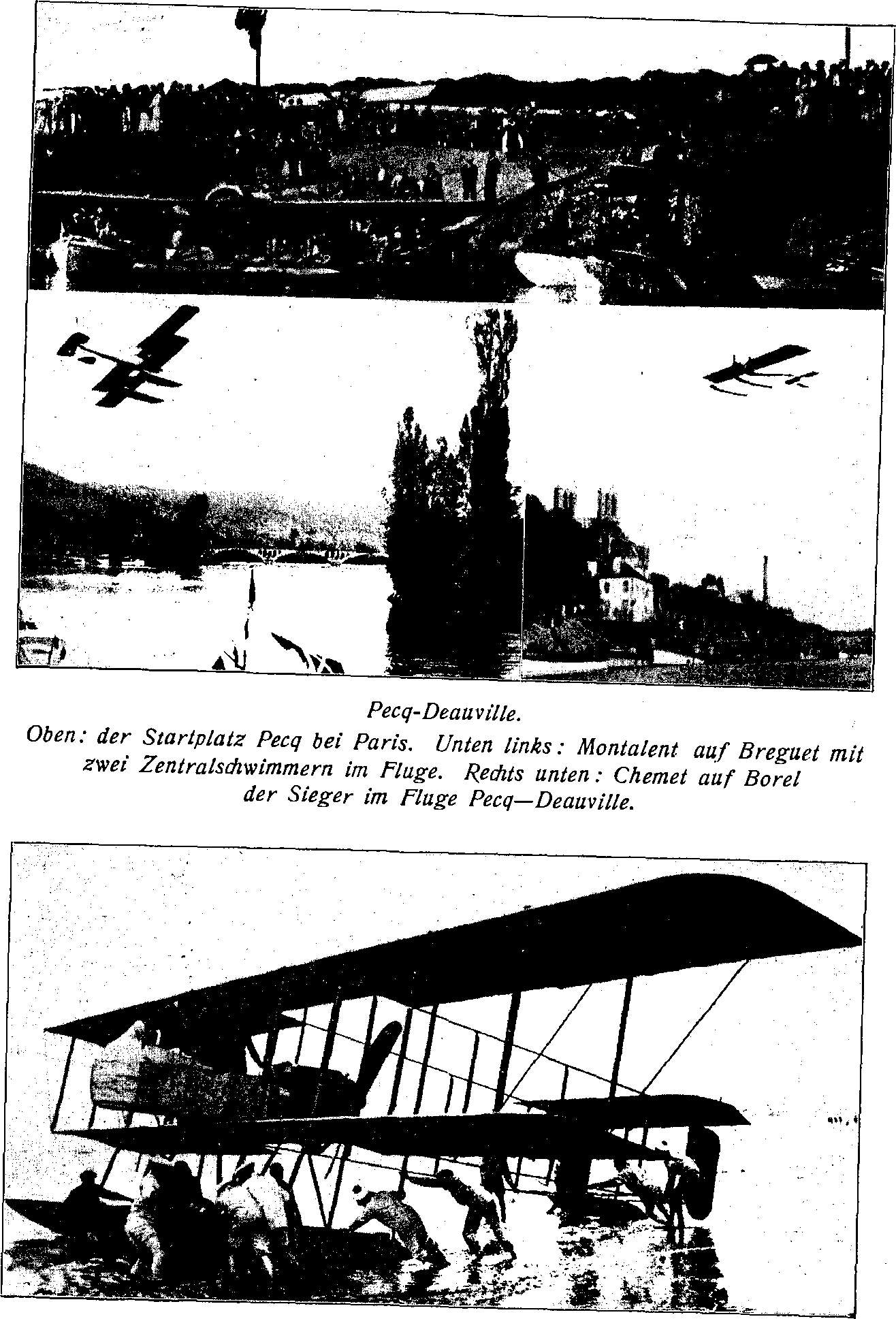 Deaaville. Renaax auf M. Farman mit 120 PS 12 Zyl. Renault-Motor, dem Wettbewerb von Deauville, oder richtiger gesagt von dem Flugzeugmarkt von Deauville, gelernt haben. Bei der Wahl des Ortes für den nächstjährigen deutschen Wasserflugzeug-Wettbewerb sollte man in dieser Hinsicht sehr vorsichtig sein und sich nicht etwa durch vorhandene Flugplätze, wo nur untergeordnete Interessen in Frage kommen, beeinflussen lassen. Fernflug Pecq—Deauville. Bei dem vom Aero-Olub organisierten und am i4. Aug. zwischen Pecq bei Paris und Deauville stattgefundenen Fernflug, welcher dem Laufe der Seine mit ihren vielen Windungen folgte, mußten 24 Kontrollstationen umflogen werden. Der Wettbewerb war international und offen für zweisitzige Flugmaschinen, bei denen der Fluggast durch Gewicht von 70 kg ersetzt werden konnte. Die Preise betrugen 40000 Frs. Jedes Flugzeug mußte beim Start mit einem selbstregistrierenden Höhenmesser, Kompaß, Anker von 5 kg Gewicht und mit 25 m Tau versehen sein. Ferner mußten Flieger und Fluggast Schwimmkleider tragen. Die Ziellinie befand sich an der Seine-Mündung bei Deauville. Die Maschinen, die die Ziellinie fliegend erreicht hatten, mußten dann vor Deauville auf das Meer herunter gehen. Am 24. August, bei wundervollem Wetter, wurden vormittags 8; 30 Uhr die Maschinen vom Start gelassen. (Die teilnehmenden Apparate sind in der Tabelle auf S. 657 u. 658 mit ihren Abmessungen ersichtlich). Als erster startete Weymann auf Nieuport-Gnom 8 : 29, der, nachdem er die vorgeschriebenen 500 m auf dem Wasser schwimmend zurückgelegt hatte, abwasserte und bald am Horizont verschwand. Um 8 : 30 folgte Levasseur auf Nieuport mit 160 PS Gnom, 8:48 nach einem Fehlstart Prevost auf Deperdussin-Gnom. Es folgten weiter Janoir auf Deperdussin mit 160 PS Gnom 8: 42, Chemet auf Borel Eindecker mit 100 PS Gnom 9:7, Molla auf Leveque-Gnom nach einem zweiten Start 9 : 12. Rugere auf Bathiat-Sanchez brachte nach zweimaligem Start seine Maschine nicht vom Wasser und gab auf. 9 : 20 startete Montalent auf Breguet, hiernach 9 : 25 Divetäin auf Borel Aero-Yacht. Molla auf Leveque hatte unterwegs Bezinrohrbruch und mußte 10:30 nochmals von Pecq starten. Die gestarteten Apparate flogen sämtlich mit Fluggast. Chemet auf Borel machte unterwegs eine Zwischenwasserung. Molla, zerschlug sich beim Anwässern den Schwimmer, den er unterwegs ausbessern mußte. Levasseur mußte infolge Magnet- und Düsenverstopfung bei Rouen niedergehen. Bei Rouen ereignete sich leider auch ein bedauernswerter Unfall. Motalent mit seinem Mechaniker als Fluggast auf Breguet-Doppeldecker stürzte aus 100 m Höhe, wo sich die Maschine plötzlich überschlug, tödlich ab. Weymann auf Nieuport verflog sich in einen toten Seinearm und zerschlug sich die beiden Flügel an den überhängenden Bäumen. Er demontierte die abgerissenen Flügel und fuhr so auf dem Wasser ohne Flügel bis nach Deauville. Die besten Zeiten erzielten : Chemet auf 100 PS Nieuport-Gnom 3 Std. 48 Min., Levasseur auf 160 PS Nieuport-Gnom 7 Std. 28 Min., Molla auf 100 PS Leveque-Gnom 8 Std. 46 Min., Janoir auf 160 PS Deperdussin-Gnom 10 Std. 11 Min. Gegen Levasseur wurde Protest eingelegt, da er eine Kontrollstation nicht richtig überflogen hatte. * * * 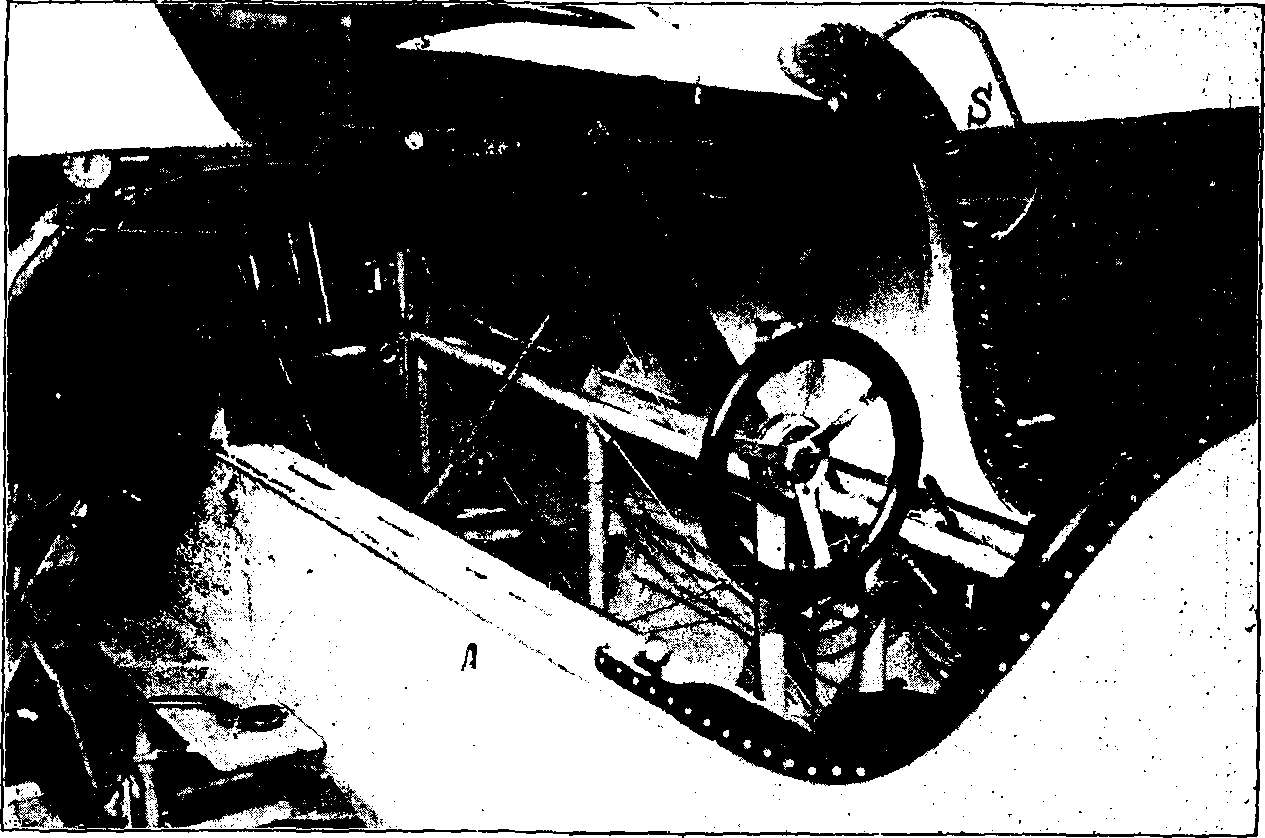 Deauville. Der aufgeklappte Rumpfoberteil beim Breguet-Doppeldecker. Links vor dem Fluggastsitz T Tachometer, M Manometer, dazwischen die Schaugläser für Benzin und Oel. In dem hochgeklappten Rumpfteil S Windschutzscheibe, K Kartenrollapparat, Ii registrierendes und feststellbares Barometer. 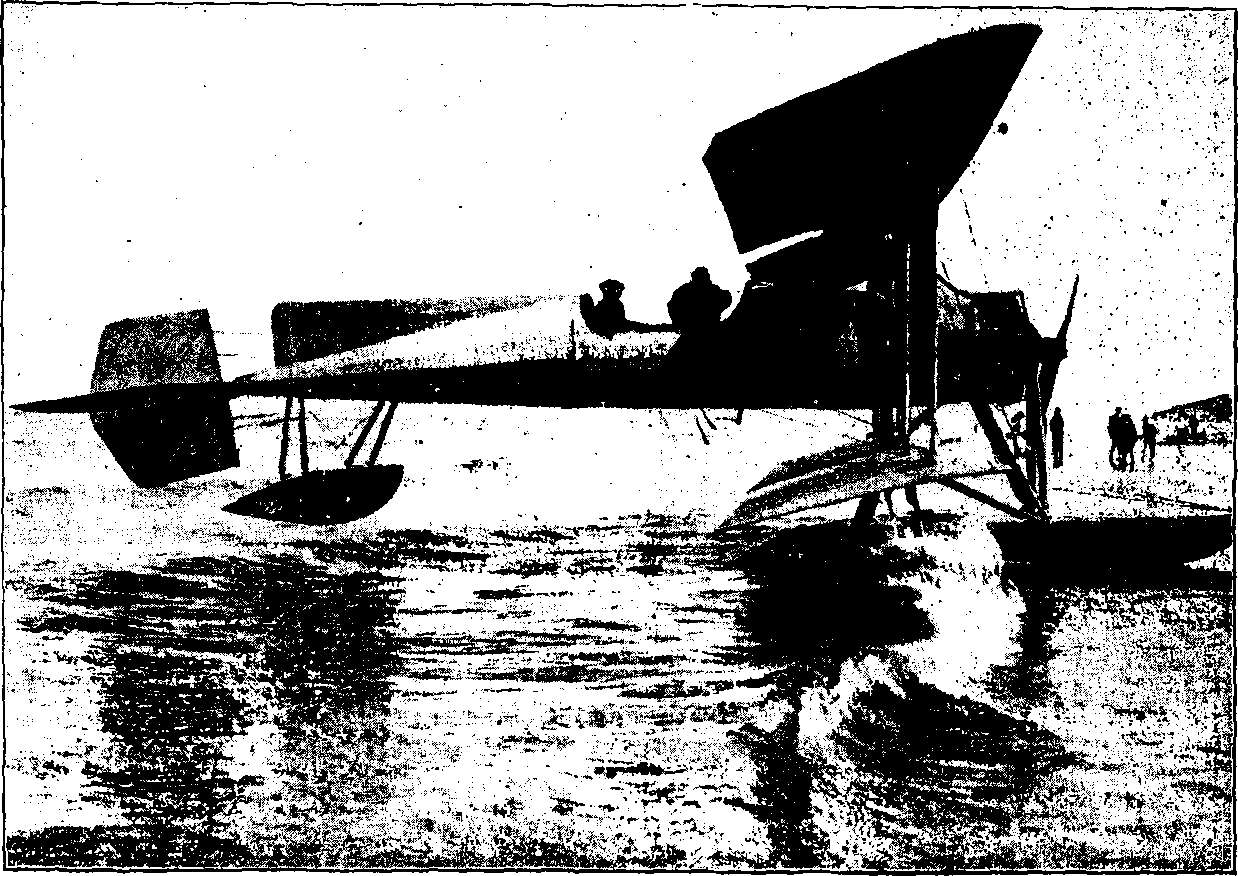 Deauville. Bregi auf Breguet-Doppeldecker mit 200 PS Salmson-Motor während des Ausscheidungs- Wettbewerbs. Die Bedingungen des Marine-Wettbewerbs, der vom Marine - Ministerium und vom Aero - Olub de Franee veranstaltet wurde, waren folgende. Der Wettbewerb bestand aus Vorprüfungen und dem Hauptwettbewerb. An Preisen waren 100.000 Francs ausgesetzt. Für die Vorprüfungen waren folgende Bedingungen aufgestellt: Alle Flugzeuge incl. Motor müssen in Frankreich von einem französischen Konstrukteur oder einer französischen Firma gebaut sein. Nur gewisse Teile dürfen aus dem Ausland bezogen werden. Die Maschinen müssen folgende Konstruktionsbedingungen aufweisen: a) Zwei Sitze, einen für den Führer und einen für den Fluggast. b) Dem Fluggast muß es möglich sein, das Meer nach unten durch eine Oeffnung, welche einen Gesichtswinkel von 30° zuläßt, beobachten zu können. c) Der Gebrauch von Aluminium für Kraft übertragende Teile ist nicht gestattet. Ferner müssen diese durch ein Schutzmittel vor jeder Veränderung bewahrt bleiben. Zugelassen ist das Aluminium für das Motorgehäuse. d) Das Ankurbeln des Motors muß vom Sitz des Flugzeugführers oder vom Sitz des Fluggastes aus gehandhabt werden können. e) Die Zufuhr von Benzin und Oel muß selbsttätig vor sich gehen können, ohne daß der Flugzeugführer oder Fluggast diese durch Handkraft nachzupumpen brauchen. f) Die Schwimmer müssen gegen das Eindringen von Wasser geschützt sein. g) Der Motor muß gegen Einflüsse des Wassers und Wassernebel durch eine Haube geschützt sein. Feiner sind besondere Vorsichtsmaßregeln gegen Kurzschluß zu treffen. h) Der Magnetapparat ist wasserdicht einzuschließen, ferner müssen möglichst Räder und Hebel unmagnetisch sein. Bestimmungen über die Flugbereitschaft. Das Gewicht des Flugzeugführers und des Fluggastes muß auf 80 kg ergänzt werden und zwar nur durch Ballast, welcher nicht selbt zum Betrieb des Fluges nötig ist (Blei oder Sand) nicht durch Proviant, Süßwasser, Lebensmittel usw. Die Anwesenheit eines Fluggastes ist nicht unbedingt nötig. Außerdem müssen sich in der Maschine Betriebsstoffe, Oel und Benzin für 4 Stunden Flugzeit und folgende Instrumente befinden: ein Kompaß, Tourenzähler, Geschwindigkeitsmesser, ein registrierender Barometer, ein Rollkartenbehälter (25X35 cm), ein Marineglas, ein knker von mindestens 5 kg Gewicht mit einem Kabel von mindestens 40 m Länge. Die Vorprüfungen bestanden aus folgenden 10 Einzelprüfungen: 1. Geschwindigkeitsprüfung. Man mißt die mittlere Geschwindigkeit der Maschine während der ersten halben Stunde eines Fluges, der vom Meere aufsteigend ausgeführt wird. Zu diesem Zweck muß die Maschine eine Meile in der Windrichtung hin und zurück fliegen. Die so bestimmte mittlere Geschwindigkeit darf nicht weniger wie 45 Seemeilen (1 Seemeile = 1,852 km) in der Stunde betragen. Diese Prüfung kann wiederholt werden 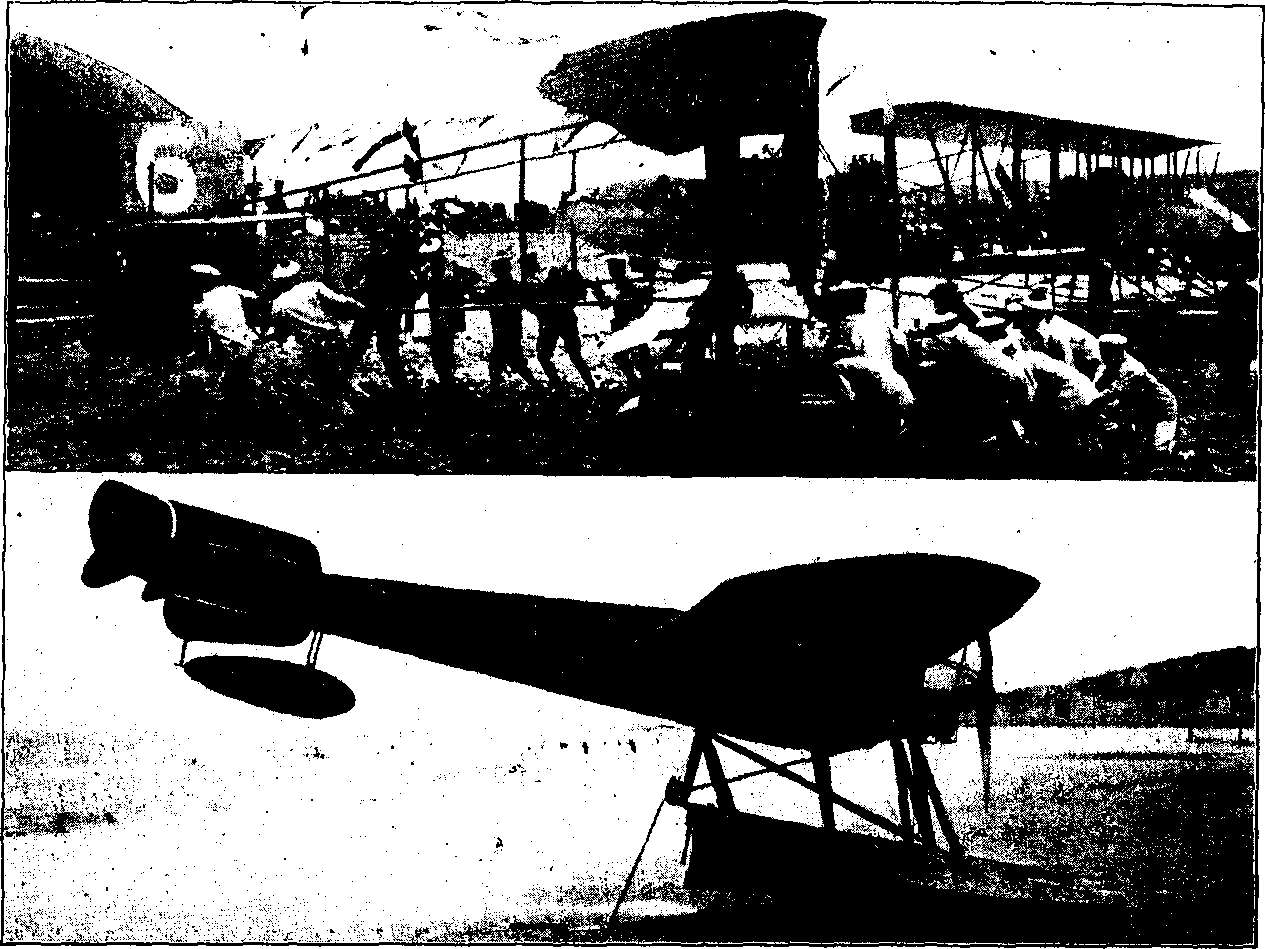 Deauville. Oben links: der Caudron-Zweldeder mit vorn liegendem 100 PS Anzani. Rechts im Hintergrund der große Caudron mit hinten liegendem 200 PS Anzani. Darunter: der Nleuport-Elndecker mit 160 PS Gnom-Motor.' 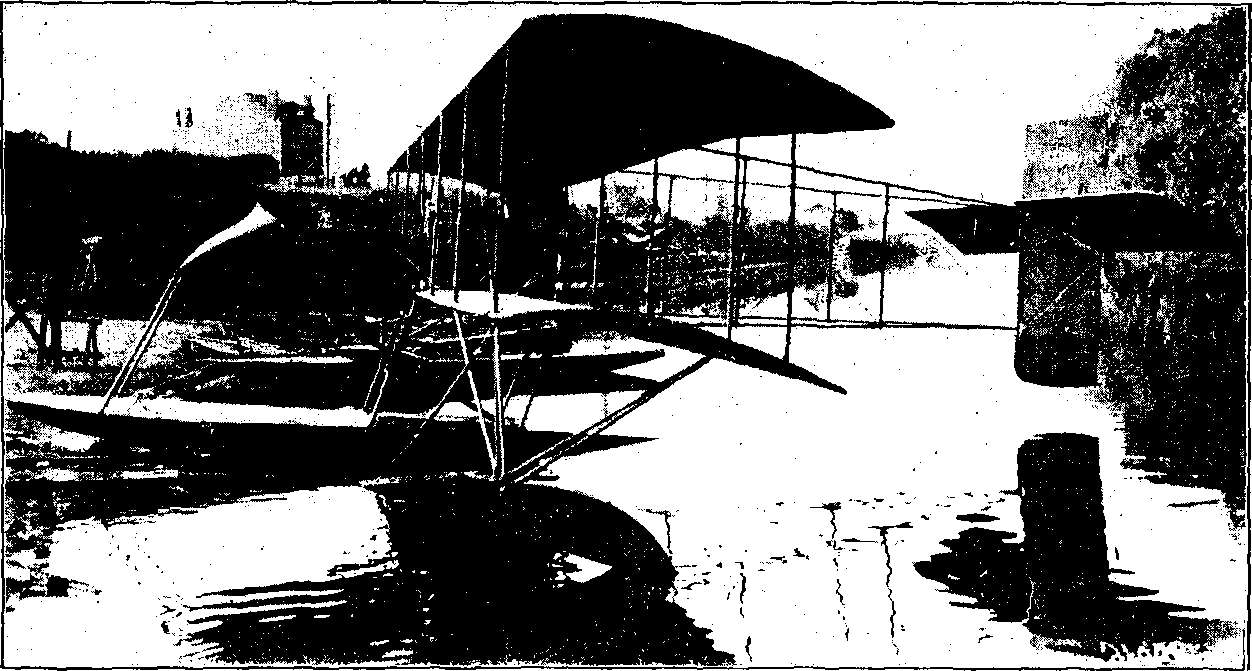 Paris—Deauville. Doppeldecker Bathiat-Sanchez mit 160 PS Gnom-Motor. 2. Bestimmung des Aktionsradius. Der in 1 vorgeschriebene Flug kann ohne zu wassern fortgesetzt werden, bis seine Gesamtdauer wenigstens 1 Stunde erreicht hat. Die Maschine muß in unmittelbarer Nähe der sportlichen Leiter und des Startplatzes niedergehen. Der Verbrauch des Motors an Benzin und Oel wird nach diesem Versuch festgestellt. 3. Eine 8 beschreiben um zwei Bojen, die 400 m von einander entfernt sind. 4. Bei höchstens 10 m Wind ein Viereck mit einer Diagonale von mindestens einer Meile zu umschwimmen. 5. Bei einem mittleren Wind von 10 m in der Sekunde 10 Minuten auf dem Wasser liegen bleiben. 6. Das Flugzeug muß sich selbsttätig in Wind steilen. Um feststellen zu können, ob diese Bedingung auch richtig erfüllt wird, wird der Apparat am Schwanz mit Rückenwind durchs Wasser gezogen und dann, nachdem er befreit ist, sich selbst überlassen. Jeder Apparat, der sich bei diesem Versuch überschlagen hat, scheidet aus. 7. Die Flugzeuge mit voller Belastung müssen 2 Abflüge und 2 Wasserungen ausführen. Hierbei muß der Wellengang 1 m Höhe betragen. 8. Nach diesen Proben müssen die Flugzeuge 1 Stunde lang vor Anker auf dem Wasser liegen. Danach werden die Schwimmer besichtigt und die Apparate, bei denen sich die Schwimmer als nicht ganz wasserdicht erweisen, können ausgewiesen werden. 9. Bei Windstille muß das Abwassern mit vorschriftsmäßiger Belastung nach höchstens 400 m erfolgen. Die Prüfungen 3—7 können dreimal wiederholt werden. Für jede dieser Proben wird die Kommission eine entsprechende Zeit anweisen. Für die Prüfung 7 wird die Kommission die Wasserungspunkte angeben. Für die Prüfungen 3-7 darf bei flugbereiten Maschinen eine Verminderung um 30 kg Ballast stattfinden. 10. Die flugbereiten Maschinen müssen in höchstens 25 Minuten eine Höhe von 500 m erreicht haben. Als Zeit gilt der Augenblick, wo der Apparat abwassert. Dieser Versuch kann dreimal wiederholt werden. Der Hauptwettbewerb. Diejenigen Maschinen, welche die Vorprüfungen in befriedigender Weise erfüllt haben, sind zu dem Hauptwettbewerb zugelassen und müssen folgenden Bedingungen genügen: 1. Flug über 180 Seemeilen. Nur solche Maschinen können Preise erhalten, die in weniger als 8 Stunden eine Strecke von 180 Seemeilen zurückgelegt haben. Hierbei wird die Kommission hauptsächlich die Seetüchtigkeit berücksichtigen. 2. Abwassern bei bewegtem Meer. An dem von der Kommission gewählten Tage muß das Flugzeug mit vorschriftsmäßiger Belastung, begleitet von einem Torpedoboot, eine Reihe von Abflügen und Wasserungen bei bewegtem Meere vornehmen. Ein Mitglied der Kommission oder der Befehlshaber des Torpedobootes kontrolliert die Stärke des Windes und die Wellenhöhe. Die Kommission bewertet die Leistungen der Apparate unter sich, indem sie gleichermaßen den Zustand des Meeres uud des Windes, die Anzahl der Flüge und die Leichtigkeit des Abwnsserns in Betracht zieht. 3. Geschwindigkeits-Unterschiede. Auf einer von der Kommission gewählten langen Strecke sind zwei aufeinander folgende Flüge zweimal hin und zurück auszuführen. Bei dem erstenmal ist eine Maximal- und bei dem zweitenmal eine Minimalgeschwindigkeit zu erzielen. Die Höhe, in der der Apparat fliegt, darf vom Eingang bis zum Ausgang der Strecke 50 m nicht übersteigen. Die Höhe wird durch geeignete Instrumente kontrolliert. Die Bewertung erfolgt nach dem Wert V5 -v5, wobei V den mittleren Wert der Maximalgeschindigkeit und v den mittleren Wert der Minimalgeschwindigkeit darstellt. Es werden nur solche Apparate bewertet, bei denen der Unterschied zwischen V und v mindestens 7 sec/m beträgt. 4. Geschwindigkeitsprüfung;. Diese Prüfung mit vorschriftsmäßiger Belastung wird als Rundflug Uber eine Strecke von 250 Seemeilen mit einer bestimmten Anzahl von Zwischenwasserungen und Kontrollstationen ausge-  Dcauville. '^Deperdussin mit 2001PS 18 Zyl. Gnom-Motor.  Deauville. H. Farman flog während des Wettbewerbs mit seinem neuen Wasserdoppeldecker mit 80 PS Onöme-Motor außer Kpnkurrenz. führt. Der gewählte Rundflug wird je nach seiner Ausdehnung ein- oder mehrmals wiederholt. Die erste Etappe, an der sich eine Kontrollstation befindet, ist ungefähr 110 Meilen entfernt. Es werden hier zwei Serien von Preisen verteilt: a) für die Geschwindigkeit, die auf der ersten Etappe von 110 Meilen ohne Wasserung erreicht wurde, b) für die mittlere Geschwindigkeit des ganzes Fluges von 250 Meilen. Im Falle der Wasserung, (während der ersten Etappe darf nicht gewassert werden) dürfen Ausbesserungen nur durch Mittel erfolgen, die sich an Bord der Maschine befinden. Zu diesen Versuchen kann dreimal gestartet werden, jedesmal an einem anderen von der Kommission bestimmten Tage. 5. Dauerprüfung. Die Flüge für die Geschwindigkeitsprüfungen (Art 4) werden gleichzeitig für den größten Dauerflug ohne Zwischenwasserung angerechnet. Zu diesem Zwecke ist es den Bewerbern erlaubt, jene Flüge, die in dem geschlossenen Rundflug des Art 4 beschrieben sind, noch über 250 Seemeilen auszudehnen. In diesem Falle brauchen die Maschinen an den Etappenstationen nicht zu wassern, sondern dürfen in einer Höhe von 100 m einen Kreis beschreiben, damit ihr Vorbeifliegen kontrolliert werden kann. Hat ein Flugzeugführer eine Kontrollstation erreicht und glaubt, nicht mehr genug Betriebsstoff bei sich zu haben, um die nächste Kontrollstation erreichen zu können, so darf er angesichts der Kontrollbehörde so lange Kreise beschreiben, bis seine Vorräte an Betriebsstoff erschöpft sind. Die Länge des Fluges, die diesen Kreisen gleichkommt, wird berechnet nach der Zeit, die die Maschine in der Luft verbracht, nachdem sie die Kontrollstation überflogen hat, vorausgesetzt, daß die Maschine dieselbe mittlere Geschwindigkeit von ihrem Start an beibehalten hat. Beträgt die Flugdauer mehr wie die Entfernung zwischen den beiden Stationen, so wird trotzdem nur diese Entfernung gerechnet. Die Wasserung muß angesichts der Sportleiter erfolgen. N. B. Die Bewerber müssen die Kontrollstationen in einer immer kontrollierbaren Höhe Uberfliegen. Preis der drahtlosen Telegrafie. Für Seemaschinen, die mit Apparaten für drahtlose Telegrafie ausgestattet sind, sind Preise reserviert. Sie werden gemäß der Art, wie sie eingebaut sind, der Wirkung und der Sendkraft der Apparate verteilt. Die Sendkraft muß mindestens 50 Seemeilen betragen. Preise. Die 100000 Frs. Preise, die durch 1000 Frs. besonders für die drahtlose Telegrafie vermehrt sind, werden auf folgende Art verteilt: 1. Fluß- und seetüchtige Maschinen: Dauerprüfung (25 000 Frs.): Schnelligkeit auf 250 Meilen (15 000 Frs.): Abflug bei bewegtem Meer (15 000 Frs.): Preis für drahtlose Telegrafie (3 000 Frs.): 2. sogenannte Uf er m asch i n en : Abflug von einer Plattform oder einem festen Terrain (8 000 Frs.): Zusammenklappen (5 000 Frs.) : Auseinanderklappen und Abflug (5000 Frs.): Der Betrag jedes nicht gewonnenen Preises wird der Dauerprüfung (250 Meilen-Flug aufgeschlagen, dessen 3 Preise im Wert dieser letzteren erhöht werden.
No. 18 „FLUGSFORT." Seite 656 Atüea/uf der Maschinen, die am Wettbewerb teilgenommen haben, durch das Ma<rine-Mvnisterium. Das Marine-Ministerium wählt unter den genannten Maschinen 2 seetüchtige Apparate, von denen es erachtet, daß sie am besten seinen Bedürfnissen entsprechen und welche den Bedingungen und Vorprüfungen des Wettbewerbes ge- 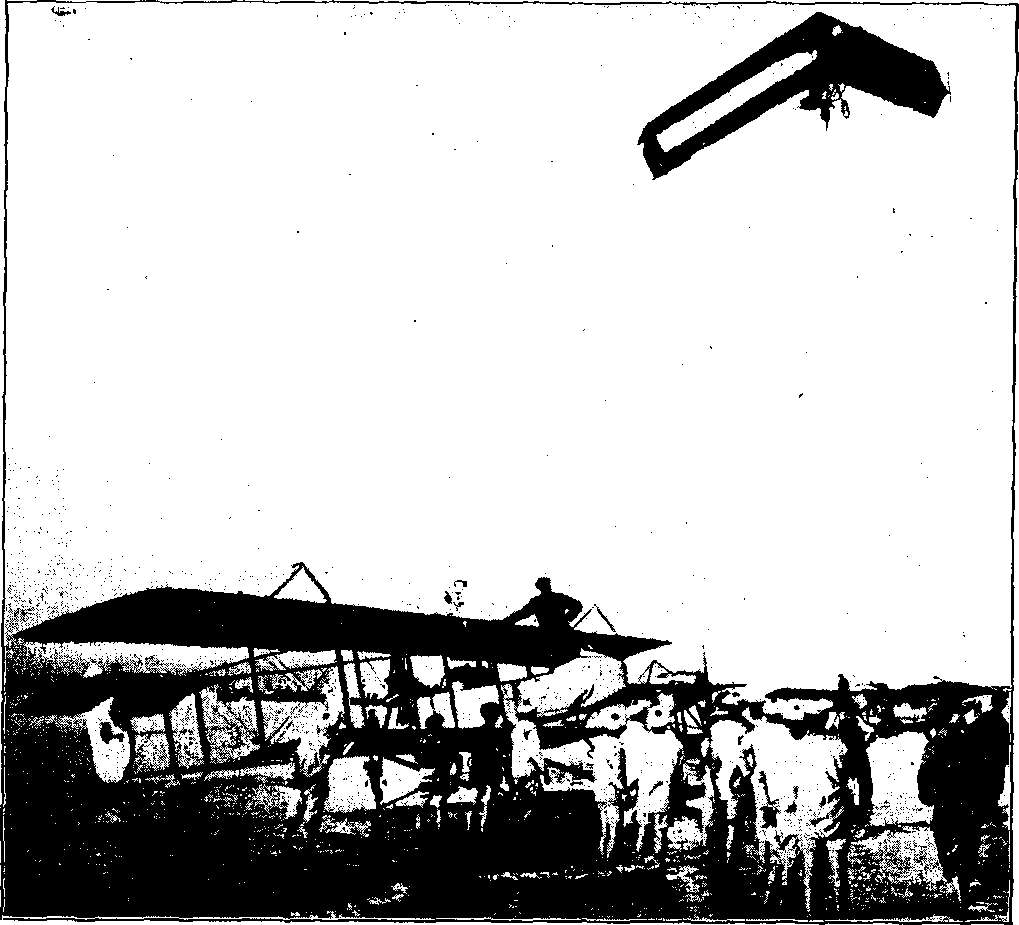 Deauville. Kommandant Felix auf Nieaport-Dunne-Doppeldecker im Fluge. Unten: Henry Farman auf Henry Farman- Wasserdoppeldecker außer, Konkurrenz.  Deauville. Molla auf Leveque. nügten wie auch die Ergebnisse des Bewerbes und die von den Bewerbern erhaltenen Preise verteilt sein mögen. Die erste Maschine wird mit 60,000 Frs., die zweite mit 50,000 Frs. angekauft. I. Flug Paris
Deauville.
Seite 659 ^LUGSPORT^ No. 18 Konstruktive Einzelheiten. Die in Deauville vertretenen Wassel maschinen zeigten keine prinzipiellen Neuerungen. Die konstruktiven Veränderungen zeigten sieh in der Hauptsache in der Verstärkung der -Konstruktionen und überall in der Vergrößerung des Schwimmer-Deplacements. Daß die Konstruktions-Bedingungen der Ausschreibung sich an den Maschinen zeigten, ist selbstverständlich. So hat beispielsweise, um das Drehen der Maschine in den Wind oder selbsttätige Liegenbleiben im Wind zu gewährleisten, Breguet oberhalb des hinteren Rumpfteils eine Kielfläche, Nieuport eine solche unterhalb des Schwanzes angebracht. Ebenso hat Deperdussin am Schwanzende eine größere Kielfläche vorgesehen. Ferner sah man den Rumpf bei mehreren Maschinen nach unten durchbrochen und mit Cellonscheiben versehene Rumpfteile, um das vorgeschriebene Gesichtsfeld zu gewinnen. Maurice Farman war mit zwei Maschinen vertreten. Nr. 1 wurde von Renaux gesteuert und besaß einen 120 PS 12 Zyl. luftgekühlten Renault-Motor. Beide Maschinen waren mit je zwei Haupttragschwimmern und einem kleinen Hilfsschwimmer zur Unterstützung des Schwanzes ausgerüstet. Die Haupttragschwimmer zeigten verhältnismäßig außerordentlich große Abmessungen und Deplacement. Sie erschienen fast etwas zu groß. Später ließ Farman ein paar kleinere Schwimmer von England kommen, um einen kürzeren Anlauf im Wasser zu erhalten. Die Schwimmer waren mittels Gummischnüren elastisch an den Kufen aufgehängt. Der zweite Apparat von Farman, von Gaubert gesteuert, besaß einen 120 PS wassergekühlten Salmson-Motor. Nieuport war mit zwei normalen Eindeckern 3 und 4 mit je einem 160 PS Gnom-Motor vertreten. Bemerkenswerte Aenderungen zeigten die Nieuport-Maschinen nicht. Caudron Freres hatten eine kleine und eine große Maschine in die Konkurrenz entsandt. Die kleine Maschine Nr. 5 war der gleiche Typ, wie er für die englische Marine in mehreren Exemplaren geliefert worden ist. Sie besitzt einen vorn liegenden 100 PS luftgekühlten Anzani-Motor, zwei Haupttragschwimmer und zwei kleine Stützschwimmer zur Unterstützung des Schwanzes. Hinter der Stufe sind in einer Aussparung die Laufräder angeordnet. Dieser Typ wurde in einer ähnlichen Ausführung bereits in Flugsport Nr. 17 auf Seite 616 und Tafel XXII ausführlich beschrieben. Die Anordnung eines Fahrgestells bewährte sich in Deauville auf dem flach ansteigenden Sandstrand ausgezeichnet. Während andere Maschinen für das Zuwasser- und Anlandbringen oft Stunden benötigten, fuhr Caudron spielend mit eigener Motorkraft, ohne mit den verhältnismäßig schmalen Rädern einzusinken, an Land. Es zeigte sich so recht, wie hilflos eine Wassermaschine ohne Fahrgestell ist. Für das Zuwasserbringen sah man immer 20 bis 25 Hilfsmannschaften angestrengt arbeiten. Bei flachem Strand und sehr starker Dünung sowie bei Einsetzen von starkem Seegang kann unter Umständen der Fall eintreten, daß eine Maschine zerschlagen wird. Der Caudron-Zweidecker Nr. 6 besaß entgegen dem vorbeschriebenen einen hinten liegenden 200 PS Anzani-Motor, indessen kein Fahrgestell. Die Schwanzträger waren nach hinten durch einen weiteren Längsträger verstärkt. Die Breguet-Doppeldecker Nr. 8 und 9 besaßen 200 PS Salmson-Motoren, einen sehr großen Mittelschwimmer und zur Erhaltung des Gleichgewichts zwei abgefederte seitliche Stützschwimmer. Ebenso diente zur Unterstützung des Schwanzes ein kleiner gekielter Hilfsschwimmer. (S. d. Abbildung.) Die Anordnung von Führer- und Gastsitzen ist aus der beistehenden Abbildung ersichtlich. 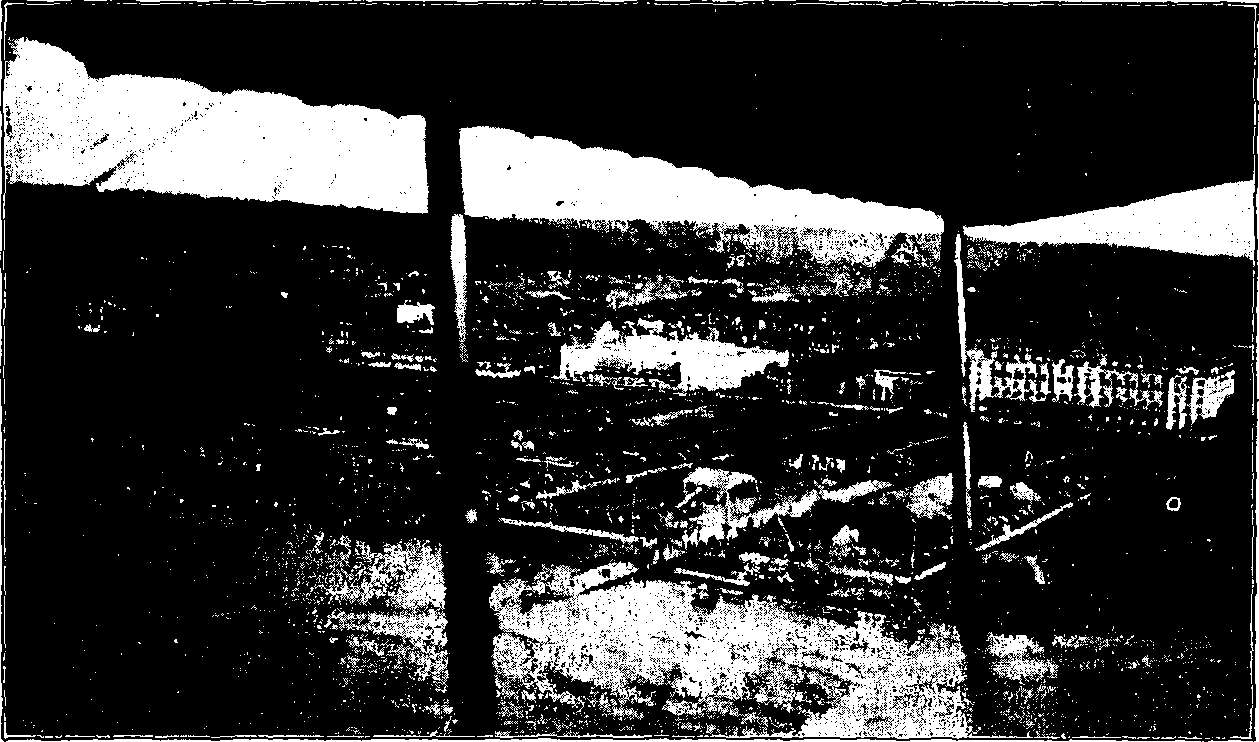 Ansicht auf Deauville. Im Vordergrund die Zeltanlage, im Hintergrund links das Kasino, rechts Hotel Royal. Borel, der Sieger von Tamise, konkurrierte mit seinem von Chemet gesteuerten Eindecker mit 100 PS 9 Zyl. Gnom-Motor. Dieser Eindecker ist in seinen Hauptformen den Lesern dieser Zeitschrift von Monaco und späteren Beschreibungen bekannt. Der Eindecker Dussot, ein kleines fliegendes Boot und zwar nur mit einem Haupttragdeck, gesteuert von Auguste Dussot, war mit einem 100 PS Anzani-Motor ausgerüstet und für Hochseezwecke viel zu. schwach konstruiert. Nr. 14, ein Eindecker der Astra, war nicht erschienen. Nr. 15, ein Doppeldecker Leveque, wurde von Molla gesteuert, und besaß einen 120 PS Salmson-Motor. Das Boot dieses neuen Hochsee-Leveque war erheblich vergrößert und verstärkt. Zum Schutze bei brechender Seen war vor den Sitzen noch ein Aufbau aus Cellonfenstern angeordnet. Die seitliche Stabilität wurde durch zwei abgefederte Stützschwimmer, die sich in der Mitte der unteren Tragdecke befanden, erhalten. Zur Reserve für noch stärker auftretende Kippmomente in seitlicher Richtung waren an den Tragdeckenenden, direkt mit den Tragdecken verbunden, noch zwei weitere Hilfsschwimmer vorgesehen. Ferner wären noch einige Maschinen vom Fernflug Pecq —Deauville, die am Marine - Wettbewerb nicht teilnahmen, zu erwähnen, darunter die sogenannte Aero-Yacht von Borel, welche bereits in der letzten Nummer des „Flugsport" beschrieben wurde, sowie der Doppeldecker von Bathiat-Sanchez (vergl. die Abbildung S. 652.) Dieser Doppeldecker, (kam in Pecq nicht vom Wasser los), besitzt einen hinten liegenden 160 PS Gnom-Motor, einen Hauptmittelschwimmer und zur Unterstützung der seitlichen Stabilität zwei kleine Hilfsschwimmer. * * * Der Verlauf des Marine-Wettbewerbs von Deauville. Am ersten Tag, dem 25. Aug. vormittags, erfolgte die Abnahmeprüfung der Maschinen. Sämtliche anwesenden Maschinen sollen den Bedingungen a-g (Seite 651) entsprochen haben, denn sie wurden alle zugelassen. Die Prüfungskommission war nicht engherzig! Das Meer befand sich in einer wunderbaren Verfassung. Es wehte eine leichte Brise von ungefähr 10 Meter in der Sekunde. Die Wellenhöhe betrug noch nicht ganz '/» Meter. Als erste starteten für die Vorprüfungen die beiden Breguet-Zweidecker, gesteuert von Moineau und Bregi. Sie vollführten die 8 um die zwei 400 m voneinander entfernten Bojen und bestanden dann die Ankerungs- und Dichtigkeitsprüfung während einer Stunde, sowie das Abfliegen vom Wasser mit höchstens 400 m Anlauf. Ferner schwamm die 8 Rene Caudron auf Caudron. Am Nachmittag machte Moineau auf Breguet die Höhenprüfung und stieg in 7 Min. 30 Sek. auf 520 m Höhe. Chemet auf Borel erledigte die 8 und die Schwimmprüfung. Das kleine fliegende Boot von Dussot machte seinen ersten Versuch, wobei sich der Apparat Uberschlug, den Flieger mit ins Wasser ziehend. Durch herbeieilende Boote wurde der Flieger Bossanot gerettet. Zweiter Tag, 26. August. Bei windstillem, strahlend schönem Wetter startete als erster Molla auf Leveque zu dem Höhenflug. Er erreichte 500 m in weniger als 25 Minuten Die Zeit muß aber annähernd so viel betragen haben. Das genaue Resultat konnte man nicht erfahren. Levasseur aufNi:uport machte die 8 und den Abflug mit höchstens 400 m. Prevost auf Deperdussin mit 200 PS Gnom erledigte den Achtenflug. Bregi auf Breguet kam von Havre angeflogen und machte den Höhenflug, indem er 500 m in 8 Min. 10 Sek. erreichte. Molla, der noch die Stundenprobe der Verankerung und einen Abflug vom Wasser ausführte, kam infolge der Windstille sehr schwer vom Wasser ab. „Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten u. Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XXIII. Ponnier-Zweidecker. 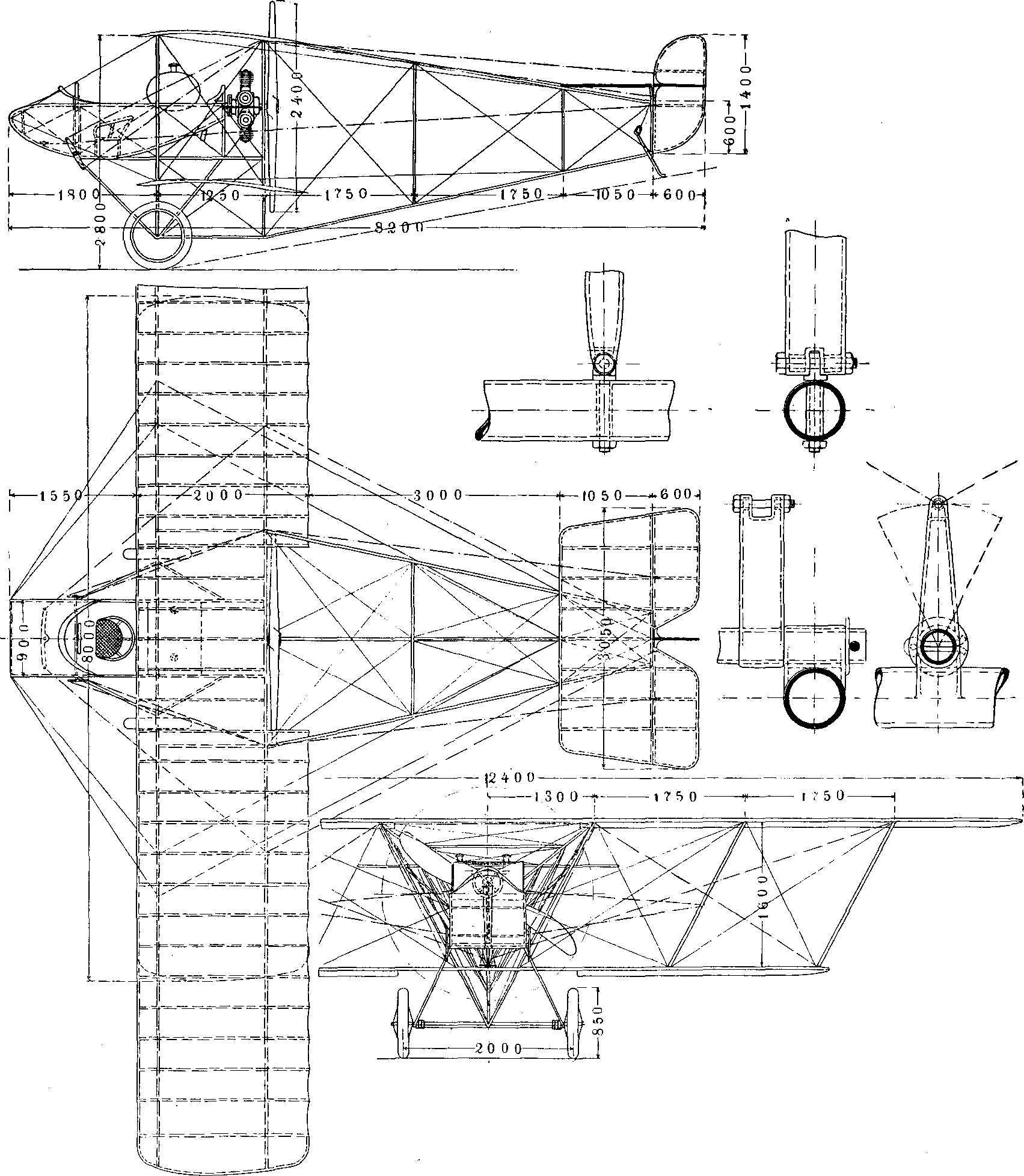 Nachbildung verboten. Nachmittags vollführte Chemet auf 100 PS Borel-Qnom den Stundenflug um den Minimal-Aktionsradius (Prüfung 2), ebenso Bregi auf Breguet. Renaux auf Farman konnte mit seinen Riesenschwimmern, die im Wasser einen zu großen Widerstand verursachten, nicht hochkommen. Er entschloß sich, die Schwimmer abzunehmen und durch die alten von Monaco zu ersetzen. Ebenso erging es Caudron, welcher die Räder abnahm, um an Gewicht zu sparen. Rene Caudron hatte mit seiner 200 PS Maschine Pech. Beim Abwassern überschlug sich der Apparat und verschwand im Meer. Dritter Tag, 27. August. Infolge des außerordentlich günstigen Wetters, der Wind wehte mit 4-5 Sek/m., beeilten sich die Konkurrenten, ihre Vorprüfungen zu erledigen. Renaux hatte seine alten Schwimmer inzwischen bekommen. Die Maschine kam jetzt nach 200m mit Leichtigkeit vom Wasser ab. Gaubert, welcher keine Schwimmer zum Auswechseln hatte, hat sich an die englische Admiralität gewandt, ihm von einem gelieferten Apparat die Schwimmer zu leihen, die am nächsten Tage eintretfen sollten. Eine kleine Ueber-raschung gab es des Nachmittags, als HenryFarman, von Boulogne kommend, mit seinem neuen Wasser-Zweidecker eintraf. Dieser Apparat ähnelt in seinem äußeren Aufbau der normalen Militärmaschine, besitzt zwei Schwimmei und einen 80 PS Gnom-Motor. Das Gewicht der Maschine soll 400 kg be-Deativille. tragen. Ueberraschend Kommandant Felix erscheint während des Wettbewerbs war das schnelle Los-von Deauville mit seinem Nieuport-Danne-Zweidecker. kommen vom Wasser Farman startete mit dieser Maschine bei 6 m Wind und kam bereits nach ca. 20 m vom Wasser weg. Später führte er Flüge mit Fluggast aus, wobei die Maschine ca. 70 m Anlauf benötigte, (S. Abb. S. 654.) Weiter erschien noch der Kommandant Felix mit seinem neuen Nieuport-Durine-Zweidecker vom Rennplatz kommend und führte mehrere Flüge über dem Wasserflugplatz aus. Brindejonc des Moulinais und Audemars unterhielten durch ihre bekannten Sturz- und Aufsehen erreuenden Kurvenflüge das Publikum. vierter Tag, 28. August. Die Vorprüfungen waren von den meisten Fliegern erledigt, bis auf die Prüfung Abfliegen bei bewegtem Meer. Trotzdem am Nachmittag noch immer prächtiges Wetter herrschte und die Wellen noch nicht 3/4 m hochgingen, wurde diese Vorprüfung freigegeben. Sämtlich? Prüfungen  haben, bis auf die vorerwähnte, bestanden: Bregi, Renaux, Molla, Chemet und Moineau. Die Schwimmer für Gaubert von der englischen Marine waren eingetroffen und wurden in den Farman-Apparat eingebaut. Die Resultate, die damit erzielt wurden, waren sehr gut. Caudron zeigte die leichte und schnelle Demontierbarkeit seiner Maschine und den schnellen Aufstieg vom Lande. Er brauchte für das Demontieren 15 Minuten. Gegen Henry Farman, der, um für seine Maschinen Reklame zu machen, außer Konkurrenz flog, wurde von den Konkurrenten Protest eingelegt. Farman mußte daher seine Maschine außerhalb des Flugplatzes unterbringen. Am fünften Tag, den 29. August, hatten, außer Levasseur und Weymann, sämtliche Flieger die Vorprüfungen erfüllt. Nachmittags begann der Hauptwett-bewerb. Wie aus den Ausschreibungen hervorgeht, haben die Wettbewerber zunächst einen Flug um ein Pylon von 10 Seemeilen Entfernung, das sind 18,520 km, auszuführen. In diesem einen Flug können die Bedingungen Geschwindigkeit, Ausdauer etc. auf einmal erbracht werden. Als erster startete 1:22 Molla auf Leveque mit Betriebsstoff für 5'A, Stunden. Er benötigte für die ersten 100 Meilen 2 Std. 6 Min. Um 2:15 startete Moineau auf Breguet mit 200 PS Salmson-Motor und brachte die 100 Meilen in 2 Std. 4 Min. 30 Sek. hinter sich; 3:15 Chemet auf Borel, welcher 17 Sek. mehr benötigte in der Runde als Moineau. Weymann auf Nieuport machte 4:30 einen Höhenflug, wobei er 500 m in 13 Min. erreichte. Ferner vollführte er die Abflug- und Wasserungsprüfung. Er hat somit auch die sämtlichen Vorprüfungen bestanden. Resultate des Hauptwettbewerbs am 5 ten Tage. Molla auf L6veque: die 100 Seemeilen in 2:4:59»/, „ 180 „ „ 4:6:39 „ 250 „ „ 5:24:14*/s Molla hat bei der 21. Runde gewassert, zusammen also 388,920 km über dem Meer zurückgelegt ohne zu wassern, was ein Weltrekord bedeutet. Er hat dann seinen Flug fortgesetzt und 25Runden geflogen. Bregi auf Breguet: die 100 Seemeilen in 1:57; 13'/, Er wasserte bei der 12. Runde nachdem er in 2 : 20:21 222,240 km zurücklegte. Chemet auf Borel: die 100 Seemeilen in 2:2:30 Er wasserte nach der 14. Runde, und flog in 2 : 52:10 259,028 km. Moineau auf Breguet: die 100 Seemeilen in 1 :51 :4*/s „ 180 „ „ 3:21:33 Moineau wasserte nachdem er 333,760 km zurückgelegt hatte. Die beiden Breguet mußten aufhören wegen Rohrbruches. Chemet war zu spät aufgestiegen und konnte bis zur bestimmten Zeit seinen Flug nicht beenden. 6ter Tag 30. August. Am Vormittag stieg Levasseur auf seinem Nieuport noch einmal zur Beendigung seiner Vorprüfungen auf, jedoch war er nach einer halben Stunde durch eine Magnetpanne genötigt zu wassern, wodurch er von dem Hauptwettbewerb ausscheidet. Am Nachmittag startete Weymann, dessen Schwimmer defekt wurden, Prevost hatte einen Ventilbruch, Chemets Zündung versagte, und Gaubert mußte nach zurückgelegten 250 Meilen herunter wegen Mangel an Betriebsstoff. Die kürzeste Zeit hat Prevost auf den 100 Meilen, er hätte wohl den ersten Preis zu beanspruchen, jedoch hat er die 180 Meilen, die man fliegen muß, um irgend einen Preis erhalten zu können, nicht durchflogen. Moineau hatte den ganzen Tag an seinem Kühler repariert. Um sein Flugzeug als sogenannte Flußmaschine qualifizieren zu lassen, hat Caudron zum zweiten Mal den Abflug von einer Plattform von 35 Metern jedoch ohne Erfolg versucht. Stand der verschiedenen Hauptwettbewerbe. Geschwindigkeitspreis über 100 Seemeilen (10000 Fr. Preis) 1. Moineau auf Breguet in 1 :51 Mittlere Geschwindigkeit bei 250 Seemeilen (15000 Fr. Preis) 1. Molla auf Leveque in 5:24:14 4/5 2. Renaux auf Farman in 5 : 27 : 38 '/r, 3. Gaubert auf Farman in 5: 36 : 3 Folgende Maschinen haben die 100 Seemeilen durchflogen: 1. Prevost (Deperdussin-Gnom) 1 :48 :20 »/, 2. Moinsau (Breguet-Salmson) 1 : 51 :4 J/s 3. Bregi (Breguet-Salmson) 1 :57:13 "b 4. Chemet (Borel-Gnom) 2:2:30 5. Molla (Leveque-Salmson) 2:5:59J/s 6. Renaux (Farman-Renault) 2: 13:30 '/„ 7- Gaubert (Farman-Salmson) 2:17:23"., Die offiziellen Angaben vom 6. Tag für den Dauerpreis 25 000 Fr. Renaux begann seinen Flug um 8 Uhr 30, durchflog die 100 Seemeilen in 2:13:30%, die 250 Meilen in 5:27:38 '/5 und die 300 Meilen zum Dauerpreis in 6 : 40 : 25. Gaubert begann seinen Flug um 10 Uhr 45, durchflog die 100 Meilen in 2:17:23, die 250 Meilen in 5:36:3=/5 und setzte seinen Flug fort zum Dauerpreis. Am 7. Tag, 31. August herrschte Sturm. Die Torpedoboote und Kreuzer blieben im Hafen, da deren Führer annahmen, daß bei Sturm nicht geflogen werde. Endlich am Nachmittag hatte sich der Sturm etwas gelegt, daß die Torpedos hinausfahren und ihre Bojen verankern konnten. Chemet startete als erster für den Dauer- und Schnelligkeitspreis. Das Meer war noch immer sehr bewegt, die Wellenhöhe betrug 1,50 m. Fast gleichzeitig mit Chemet geht Moineau ebenfalls ab. Prevost auf Deperdussin, der sich auch hinausgewagt hatte, erlitt einen Unfall. Die hohen Wellen schlugen ihm die Schwimmer weg und der Apparat, der sich bald gänzlich umschlug, wurde an den Strand geworfen. Renaux machte indessen seine Abwasserungspriifungen. Er machte 7 Abflüge vom Wasser in guter Verfassung. Molla hatte dasselbe versucht jedoch ohne Erfolg. Chemet überschreitet schon die 180 Meilen. Er wollte die Dauerprüfung machen, jedoch bemerkt er, daß er leider vor Schluß der Veranstaltung nicht fertig wird. So bricht er seinen Flug früher ab und versucht noch für die Abwasserungsprüfnng zu starten, auch dieser Versuch mißlang. Resultat. Geschwindigkeitspreis über 100 Meilen 1. Moineau auf Breguet Motor Salmson 200 PS in 1.51 : 42'., 7l00 Fr. 2. Chemet auf Borel Motor Gnom in 2:3:53 .7000 Fr. 3. Molla auf LeVeque Motor Salmson in 2:5:592/5 4 Renaux auf Farman in 2:13:30 Mittlere Geschwindigkeit über 250 Meilen. 1. Molla auf Leveque Motor Salmson 130 PS in 5 : 24 : i44/5 10000 Fr. 2. Renaux auf Farman Motor Renault in 5:27:38'/5 5000 Fr. 3. Gaubert auf Farman Motor Salmson in 5: 36: 3=/5 Dauerprüfung 25000 Fr. Preis. 1. Renaux auf Farman Motor Renault j totes Rennen bei ^ Mej|en 2 Gaubert auf Farman Motor Salmson I Prüfung für Flußmaschinen (6000 Fr. Preis). Caudron auf Caudron, Motor Anzani. Es gelang ihm auf einer Ablaufbahn nach 33 m hochzukommen. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Wie wir in unserer neulichen Besprechung der Reorganisationspläne des französischen Flugwesens im „Flugsport" als bestimmt vorauszusagen in der Lage waren, ist nunmehr offiziell die Ernennung des Generals der Artillerie Bernard zum neuen Chef des französischen Militärflugwesens bekannt gegeben worden. General Bernard, der durch Verfügung des Ministerrats vom 24. August zur Disposition des Kriegsministers gestellt worden ist, wird unverzüglich eine Inspektionsreise antreten, um sich durch Augenschein zu überzeugen, wie die Einheiten und sämtliche Dienstzweige des Luftschiffahrtswesens funktionieren. Ueber das Ergebnis seiner Feststellungen wird alsdann der General mit dem Kriegsminister eingehend konferieren, um die Maßnahmen zu erwägen, welche im Interesse einer Neuorganisierung des Flugwesens und eines sicheren und regelmäßigen Betriebs des Flugwesens zweckmäßig erscheinen. Diese Vorberatungen sollen vor Zusammentritt des Parlaments beendet sein, welchem sogleich bei Beginn der Session die Forderung beträchtlicher Kredite vorgelegt werden soll. Schon jetzt ist ein neuer frischer Zug im Militärflugwesen zu verspüren, das offenbar mit großem Vertrauen auf die demnächstige Umgestaltung der Dinge an die Arbeit geht. Namentlich ist die Beteiligung der Flieger-Geschwader an den großen Manövern im Südwesten Frankreichs mit großem Eifer betrieben worden. Jede der beiden Armeen wird drei Luftgeschwader zur Verfügung haben, deren jedes aus sechs Flugzeugen mit allem erforderlichen Automobil- und Reparaturmaterial ausgerüstet sein wird. Der Armee des Generals Pau sind zugeteilt: ein Geschwader Bleriot (Infanteriehauptmann Jacquet), ein Geschwader Maurice Farman (Artilleriehauptmann de Saint-Quentin), ein Henri Farman Geschwader. Der Armee des Generals Chomer: ein Geschwader Deperdussin (Infanteriehauptmann Aubry), ein Geschwader Breguet (Rittmeister Massot), ein Geschwader Nieuport. Am vergangenen Sonntag haben alle diese Flugeinheiten ihre Standquartiere verlassen und sich auf dem Luftwege, in Tagesetappen von mindestens 150 km in das Manöverfeld begeben. Das Flugfeld von Villacoublay war am Montag, den 25. Aug., der Schauplatz eines schweren Unfalls, dem zwei Menschen zum Opfer fielen. Als dort der Leutnant Sensever, einer der glänzendsten und vielversprechendsten Militärflieger Frankreichs, mit einem Sappeur an Bord, Flugversuche anstellte, stürzte er aus 100 Meter Höhe ab. Beide Insassen des Flugzeugs waren auf der Stelle tot. Leutnant Sensever hatte sich, wie erinnerlich, bei den Manövern der letzten beiden Jahre in hervorragendem Maße ausgezeichnet. Interessante Pfeü-Lanzierungs-Versuche hat dieser Tage zu Villacoublay der Hauptmann Sazerac de Forge mit einem von ihm erfundenen Apparat angestellt, anscheinend mit befriedigendem Erfolge, denn die Versuche sollen dieser Tage in Gegenwart einer Militärkommission wiederholt werden. Mit besonderer Energie betreibt man gegenwärtig hier die Anlage zahlreicher neuer Landungsterrains und sogar der Präsident der Republik hat gelegentlich seiner kürzlicheil Reise in Commercy eine Rede gehalten, in der er einen zündenden Appell an das ganze Land in diesem Sinne aussprach. „Indem wir unseren Militärfliegern die Zwischen andungen erleichtern und ihnen ihre Ermüdung mildern, tragen wir in wirksamer Weise zur nationalen Verteidigung bei, nützen wir in hohem Maße den Interessen des Vaterlandes." Am letzten Sonntag sind wieder zwei neue Landungsterrains, die von Langres und von Saint Dizier, eröffnet worden, an deren Installation das National-Komitee für das Militärflugwesen mitgewirkt hat. Auch bezüglich des französischen Marineflugwesens ist eine wichtige Entschließung der Regierung zu verzeichnen. Es soll ein kompletter Dienst von Flugzeugstationen am Mittelländischen Meere eingerichtet werden und der Marineminister hat in der Kammer ein Gesetz eingebracht, durch welches er zu den nötigen Ausgaben autorisiert wird. Es werden vorläufig 13,600,000 Francs für diesen Zweck verlangt, die auf die Etatsjahre 1913, 1914 und 1915 verteilt werden sollen. Hierbei sei noch eine Meldung erwähnt, welche „La France Militaire", die bedeutendste französische Militär-wochensehrift, von einem Inspektionsfluge bringt, welchen der Deputierte Girod, der Sekretär der parlamentarischen Kommission mit dem Hauptmann Bares ausgeführt hat. Es wurden dabei mit großer Aufmerksamkeit die Witterungs- und Temperaturveränderungen beobachtet, wobei interessante Feststellungen gemacht wurden. Als die beiden Flieger sich am letzten Mittwoch in 500 Meter Höhe befanden, konnten sie, trotz eines zeitweise ziemlich dichten Nebels, alles wahrnehmen, was auf der Erde vorging. Dagegen haben die Bewohner der in Frage kommenden Gegenden übereinstimmend erklärt, daß sie den Motor des Apparats zwar gehört, aber das Flugzeug nicht gesehen haben. Hieraus ergibt sich, daß bei gewissen atmosphärischen Voraussetzungen ein Flugzeug beobachten kann, ohne selbst gesehen zu werden, daß es also seine Mission erfüllen, ohne daß es beschossen werden kann. Auch im Zivilflugwesen ist es in letzter Zeit wieder ziemlich lebhaft zugegangen. Am letzten Mittwoch flog Leo van Steyn auf einem Henry Farman-Zweidecker von Etampes nach Holland, ohne Zwischenlandung, wobei er nach sechsstündigem Fluge auf dem Rennfcld von Duinkyk, etwa 15 km vom Haag entfernt, landete. Besonders interessant waren die Kämpfe um die bedeutenden ausstehenden Bewerbe, namentlich um den Pommery-Pokal, dessen Anwartschaft gegenwärtig bekanntlich Brindejonc des Moulinais mit seinem denkwürdigen Fluge Paris - Warschau, 1400 km, besitzt. Vier Flieger sind es, die ihm die Trophäe streitig machen wollen : Janoir, Guillaux, Letort und Jensen. Janoir, der am 6 August von Etampes abgeflogen war, hat am 18. August glücklich Petersburg erreicht, und zwar in folgenden Etappen: 6. August: Etampes—Berlin 11. August: russ. Grenze-Riga 8. August: Berlin—Seelow 13. August:Riga—Pskow 9. August: Seelow-russ. Grenze 18. August: Pskow— Sankt Petersburg er hat also die Strecke Etampes—Sankt Petersburg, 2600 km hinter sich gebracht. Guillaux kam bis Brakel, in der Nähe von Hamburg und legte dabei 1375 km zurück. Daß der Franzose bei seiner Landung in Deutschland, weil er nicht im Besitze der durch das deutsch-französische Abkommen vorgeschriebenen Papiere war, von den Behörden festgehalten und später entlassen worden ist, wissen die Leser aus der Tagespresse. Weniger bekannt wird ihnen sein, daß Guillaux infolge dieses selbstverschuldeten Abenteuers sich in der französischen Presse in heftigen Schmähungen der deutschen Behörden ergeht. Natürlich wird das nicht verhindern, daß er bei seiner nächsten Landung in Berlin wieder „im Triumph" auf den Schultern über das Flugfeld von Johannisthal getragen und in allerhand würdelosen Ueberschwenglichkeiten gefeiert werden wird .... Letort kam bis Danzig, 1300 km; auch er empfindet das Bedürfnis, sich zum „Märtyrer'1 zu machen und er berichtet deshalb allerhand unsinniges Zeug an die leicht zugängliche Tagespresse. Nachdem er die tatkräftige Hilfe, welche ihm deutsche Soldaten bei der Landung und Unterbringung seines Flugzeugs geleistet haben, als etwas geradezu selbstverständliches so nebenher erwähnt, schildert er im Tone der Kolportageromane, wie er in seinem Hotel um Mitternacht von zwei bärtigen Gensdarmen heimgesucht wurde, welche sein Gepäck und seine Briefschaften durchsuchten. Dann habe man ihn an die Landungsstelle „geschleppt", wo er von einem „Militärrichter" vernommen wurde, und endlich habe man ihn um 5 Uhr morgens wieder freigelassen. Diese Mätzchen erhöhen natürlich in den Augen der naiven Leser die Gloriole der französischen Flieger, die sich wegen ihrer „germanischen Abenteuer" fleißig „interviewen" lassen. Jensen flog von Valenciennes ab und nahm 230 Liter Benzin und 46 Liter Oel an Bord seines Clement-Eindeckers, 60 PS Clerget-Motor, mit sich. Um 5 Uhr früh erfolgte der Abflug; Jensen passierte nacheinander Lüttich, Köln, Hildesheim und Magdeburg. Als er sich in etwa 60 km Entfernung von Berlin befand, wurde er von ziemlich heftigen Winden am schnellen Vorankommen gehindert. Er erkannte, daß es ihm nicht möglich sein wird, bis Sonnenuntergang mehr als 1400 km zu durchmessen, deshalb bog er bei Luckenwalde nach Süden ab, passierte Dresden und landete schließlich in Peterswald in Böhmen. Die großen Weitflüge, die um die sechste und letzte Prämie des Pommery-Pokals ausgeführt worden sind, stellen sich demnach augenblicklich wie folgt dar: 10. Juni: Brindejonc des Moulinais. Paris — Warschau, 1400 km 2. August: Gilbert, Paris — Caceres, 1300 km 3. „ Gnillaux, Paris —Zamora, 1160 km 7. „ Janoir, Paris—Berlin, 900 km 10. „ Seguin, Biarritz Bremen, 1350 km 23. „ Letort, Paris—Danzig, 1350 km 23. „ Guillaux, Paris—Brakel, 1375 km 24 „ Jensen, Valenciennes —Peterswald, 750 km, wobei noch zu bemerken ist, daß Jensen mit seinem 10 stündigen ununterbrochenen Fluge einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Einen interessanten Versuch um den Michelin-Pokal hat am letzten Montag Fourny unternommen, den die Lorbeeren seines Rivalen Cavelier offenbar nicht schlafen lassen. Auf einem Maurice Farman-Zweidecker hat er auf der gleichen Rundstrecke, Etampes — Gidy, seine Runden begonnen, die er seitdem trotz strömenden Regens mit unermüdlicher Ausdauer fortsetzt. Bis heute hat er an sechs Tagen je 7 Runden, also je 788,480 km, demnach im ganzen 4730#80 km zurückgelegt und es heißt, daß er fest entschlossen ist, die von Cavelier vorgelegte Leistung zu drücken. Zahlreiche Versuche sind auch um den Michelin-Luftzielscheiben-Preis unternommen worden namentlich am letzten Sonntag zu Buc. Die größte Anzahl von Bomben vermochte Gaubert auf einem Zweidecker Maurice Farman in den Zielkreis zu lancieren, nämlich 6 von 15. Auch der Rundflug um Paris um den Pokal Deutsch de la Meurthe ist von Helen in Angriff genommen worden. Bekanntlich verlangt dieser Bewerb, die Strecke Saint Germain, Senlis, Meaux, Melun, Saint Gerlmain, 200 km, ohne Zwischenlandung in kürzester Zeit zu durchfliegen. Der Bewerb läuft mit dem 31. Oktober ab. Im letzten Jahre machte sich Helen zum Sieger, und zwar mit einer mittleren Geschwindigkeit von 126 km die Stunde. In diesem Jahre muß deshalb, gemäß dem Reglement, eine Mindestgeschwindigkeit von 136 km, also 10 km mehr, realisiert werden. Bis jetzt hat Helen bei seinen Versuchen diese Voraussetzung nicht zu erfüllen vermocht. Das lebhafteste Interesse aber wendet man dem bevorstehenden Gordon Bennett-Pokal für Flugzeuge, dessen Organisation mancherlei Wirrnisse und sogar eine recht peinliche Krise im Aero-Club de France hervorgerufen hat, zu; über die interessanten Vorgänge „hinter den Kulissen" wird in der nächsten Nummer des „Flugsport" eingehender berichtet werden. Inzwischen hat der Königliche Aero-Club von Großbritannien die Beteiligung der englischen Flieger Hamel und Valentines am Gordon Bennett angemeldet, das bekanntlich am 29. September vor sich gehen wi:d. Die „große Neuheit", die gemunkelt wird, ist die Wiederkehr Santos Dumont's zur Fliegerkarriere und zwar will der bekannte Pionier des Flugwesens in Zukunft einen Morane-Eindecker steuern. Man spricht hier auch viel von dem interessanten Experiment, das der bekannte Forscher Amundsen mit der Nutzbarmach nug der Flugmaschine für die Polarforschung unternehmen will. Er läßt in San Francisko zwei Spezial - Wasserflugzeuge konstruieren, deren jedes einen 100 PS Motor haben und imstande sein wird, sich sowohl auf dem Wasser als auch auf dem Eise fori zubewegen. Sobald die „Fram" im Eise stecken bleibt, wird deren Kapitän Doxrud, der gleichzeitig das Fliegerdiplom besitzt, den Forscher auf einem der Apparate nach dem Pol zu führen versuchen Amundsen hat die feste Zuversicht für das Gelingen seines Plans und hofft, daß während der günstigen Jahreszeit die Kälte keinen allzu empfindlichen Einfluß auf den Motor ausüben wird. Zu erwähnen ist noch, daß das Militärflugwesen bei den großen belgischen Manövern in bisher ungekanntem Umfange zur Verwendung kommen soll. Jeder der manövrierenden Parteien wird ein Geschwader von je vier Flugzeugen (zweisitzigen Zweideckern) zugeteilt werden, und der Major Mathieu, der Chef des Militärflugwesens, wird der Manöverleitung beigegeben; ebenso wird ein von Hespel gesteuerter Moräne-Kindecker, 50 PS Gnom, mit drahtloser Telegraphie ausgerüstet, zur Verfügung der Leitung stehen. Ferner erweckt der bevorstehende große russische Militärbewerb hier großes Interesse. Das Programm, dessen Bestimmungen freilich vielfach scharf kritisiert werden, sieht folgende wesentlichsten Bedingungen vor: 1. Die Flugzeuge müssen zweisitzig sein; 2. die Nutzlast muß bei 100 PS. 340 kg betragen und für je eine Pferdekraft mehr oder weniger kommen je 2 kg in Zurechnung oder Abrechnung; 3. die Flughöhe von 500 Metern muß in weniger als 12 Minuten erreicht werden; 4 die Fluggeschwindigkeit muß mehr als 80 km die Stunde betragen; 5. das Flugzeug muß sich auf weniger als 90 Meter vom Boden erheben; 6. es muß innerhalb weniger als 50 Meter landen können; 7. Abflug und Landung müssen auch auf Ackerfeldern und auf Wiesen mit hohem Gras erfolgen können. Ferner müssen die Apparate zahlreichen sehr präzisen Anforderungen mit Bezug auf ihre Sichtbarkeit, auf ihre leichte Auseinandernehmbarkeit und auf die Möglichkeit des Bombenauswerfens entsprechen. Ausländische Flugzeuge sind zugelassen, doch unterliegen die von diesen realisierten .Resultate einer Verringerung um lU°/0. Kl. Der Ponnier-Zweidecker. (Hierzu Tafel XXIII.) Ponnier, der bekannte Konstrukteur des Hanriot-Eindeckers, konstruierte einen Doppeldecker, welcher wesentlich von den bekannten Ausführungsformen abweicht. Das Fahrgestell ähnelt dem von Euler, besitzt aber eine geteilte Kadachse, an deren Enden zwei 850 mm hohe Räder sitzen. Die Gummiringe liegen innerhalb der Fahrgestellstreben. Der Rahmenbau besteht aus Stahlrohr, ist autogen geschweißt und trägt den in der Mitte der Haupttragflächen angeordneten Motorrumpf. Derselbe ist in der Seitenansicht schuhartig geformt. Vorn befindet sich der Führersitz und die Steuerungsanlage, in der Mitte der kombinierte ovale Betriebsstoffbehälter von insgesamt 200 1 Inhalt. Der hintenliegende 70 PS Gnom-Motor ist 2 mal gelagert und treibt eine Luftschraube von 2,4 m Durchmesser an. Die Tragflächen sind nieuportartig profiliert weisen eine außerordentliche Verwindbar-keit auf und sind in der Mitte ausgespart. Die Vertikalstreben aus ovalem Stahlrohr stehen nicht wie sonst senkrecht, sondern sind schräg nach außen geneigt, wodurch die an den Flügelenden erforderlichen Auslegerstützen bei der anderthalbdeckerartigen Tragdeckenanordnung in Wegfall kommen. Die in der Nähe des Motorrumpfes befindlichen Streben laufen unterhalb der Tragdecken im Gelenkpunkte der Radachse zusammen. Das Oberdeck hat 12,4 m Spannweite und 24 qm Tragfläche. Das Unterdeck dagegen nur 8 m Spannweite und 15 qm Tragfläche, sodaß die Gesamttragfläche 39 qm beträgt Die Streben befestigung an den Tragdeckenholmen ist aus der Detailzeich1 nung der Tafel rechts oben zu ersehen. Das Strebenende greift gabelartig über den Kopf einer Oesenschraube und wird mittels eines Schraubenbolzens gelenkig festgehalten. Damit das Stahlrohr durch die Oesenschraube nicht zusammengedrückt werden kann, ist eine diagonale Stahlrohrversteifung eingeschweißt Die Steuerung ist die bei uns eingeführte Militärstcuerung. Bemerkenswert ist hierbei die Funktion der Verwindung. Von dem Handrad wird mittels Seilzüge eine Hebelwelle betätigt, die auf der Oberseite des unteren Tragdecks zweimal gelagert ist. An der Lagerstelle des hinteren Holmes ist ein einarmiger Hebel auf die Welle geschweißt. Am Ende dieses Hebel (siehe Tafel-Detail rechts unten) befindet sich ein Bolzen, an dem die Verwindungsseile ähnlich wie beim Nieuport-Eindecker angreifen. Diese Hebelanordnung soll den Vorteil haben, daß sie dem Apparat automatische Stabilität verleiht. Wird auf der einen Seite das Tragdeck von einer Böe getroffen; so gibt das Tragdeck nach, und vergrößert auf der anderen Seite der Maschine automatisch den Einfallswinkel des Tragdecks, sodaß die Maschine immer horizontal bleibt. Die Schwanzfläche ist mit der Haupttragfläche dmvh einen dreieckigen Stahlrohrgitterträger von ähnlicher Ausführungsart wie beim Dornereindecker verbunden. Das Rahmenwerk des Gitterträgers ist gleichfalls autogen verschweißt. Am verjüngten Ende desselben befindet sich die 5 qm große Schwanz-flache. Hiervon entfallen 2 qm auf das Höhensteuer und 3 qm auf die Dämpfungsfläche. Zwischen den Höhensteuerklappen befindet sich das 0,7 qm große Seitensteuer. Zur Unterstützung des Schwanzes ist eine Kufe angeordnet, die gabelartig über das untere Stahlrohr des Gitterträgers greift und. mittels Gummiringe ahgefedert ist. ' Die Geschwindigkeit der Maschine soll bei einem Gewicht von 400 kg 120 km pro Stunde betragen. Aus den englischen Flugzentren. Der erste Versuch für den von der Daily Mail ausgeschriebenen Preis von 5000 Sterl. für einen Flug um England in 72 Stunden, über dessen Einzelheiten wir schon in letzter Nummer berichteten, endete, wie wir voraussagten, mit einem Fiasko. Ursprünglich hatten sich für diesen Flug vier Teilnehmer gemeldet, darunter auch Colonel Cody, der bei einem seiner Probeflüge vor kurzem sein Leben einbüßte. Der Zweite. Gemeldete, Radley, mußte wegen Schwierigkeiten mit seinem 150 PS Sunbeam-Motor, oder auch wie andere sagen, wegen finanziellen Schwierigkeiten vom Wettbewerb zurücktreten, und von den beiden Uebriggebliebenen, Hawker und F. K Mc Clean, startete am Samstag als einziger Hawker auf einem Sopwith-Wasserdoppeldecker mit 100 PS Green-Motor. Mc. Clean sagte noch in letzter Stunde ab, weil sein 100 PS Green-Motor noch unausprobiert war. Der Sopwith-Doppeldecker wurde von der Oberleitung abgenommen und plombiert. Tansende von Schaulustigen sammelten sich Samstag in aller Frühe an der Küste der Bucht von Southampton an. Der Flug sollte kurz nach 6 Uhr beginnen. Indessen erfolgte der Start Hawkers von Netley aus erst um 11 Uhr 47 Minuten, begleitet von seinem österreichischen Mechaniker Kauper bei denkbar günstigstem Wetter. Er * hätte um diese Zeit vielleicht schon in Scarborough sein können, wenn er in den frühen Morgenstunden seine Reise angetreten hätte. Wir Zuschauer die auf der Club-Jacht „Enchantress" dem Start beiwohnten, hatten Gelegenheit, zwei Wasserflugzeuge der britischen Marine zu sehen, die sich zu Hawkers Start eingefunden hatten. Es waren ein Borel Eindecker (Marinewasserflugzeug 83)jjmit Leutnant Travers am Steuer, und ein Sopwith - Flugboot, geführt von Leutnant Spencer Grey, mit einem 100 PS Austro-Daimler Motor. Namentlich letzteres zeigte sowohl im Wasser wie in der Luft hervorragende Stabilität; es machte entschieden einen seetüchtigeren Eindruck als irgend ein Wasserflugzeug, das bisher zu sehen war. Gegen 11 Uhr wurde Hawker, der sich mit großer Schnelligkeit von Cowes her näherte, gesichtet. Sein mit zwei großen Schwimmern versehenes Flugzeug wasserte dicht bei der „Enchantress". Um 11 Uhr 47 Minuten flog Hawker dann nach Ramsgate, der ersten Kontrollstation ab, 12 : 43 passierte er ßrighton in großer Höhe, um 1: 03 Eastbourne, um 1 : 40 Folkestone, um 1 : 55 überflog er den Hafen von Dover und erreichte Ramsgate um 2: 10, eine halbe Stunde früher, als man ihn erwartete, von einer zahlreichen Menge begrüßt. Er hatte die 143 englische Meilen betragende Strecke in 143 Minuten zurückgelegt, also eine Meile in der Minute. Während sein Flugzeug von den mit der Kontrolle beauftragten Beamten des Royal Aero Clubs untersucht  Rundflug am England. Der Sopwith- Wasserdoppeldea\er, gesteuert von Hawker, vor dem Start in Netley. wurde, führte der Flieger Salmet auf einem Morane-Saulnier-Wasserflugzeug mehrere Schauflüge aus. Nach Ablauf der vorgeschriebenen Wartezeit von einer halben Stunde stieg Hawker wieder auf und flog in der Richtung von Broadstairs davon. In Yarmouth, der zweiten Kontrollstation, wo er um 4: 30 eintraf, wurde ihm wieder ein begeisterter Empfang zuteil, und hier verblieb er. Er mußte den Weiterflug auf Anraten seines Arztes aufgeben. Sein Gesundheitszustand machte vollständige Ruhe notwendig. Der Flieger zeigte alle Symptome eines Sonnenstichs. Groß war die Enttäuschung in Scarborough, der dritten Station, als bekannt wurde, daß der Flieger am Samstag abend dort nicht mehr eintreffen werde. Viele Besucher, denen die Nachricht nicht mitgeteilt wurde, hielten bis gegen Mitternacht am Strande aus und warteten dort auf den neuen Nationalhelden. Da das Reglement gestattet, die Führer zu wechseln, Seite 673 „FLUGSPORT." Nr. 18 so hatte der Erbauer, Mr. Sopwith, den in England sehr gut bekannten australischen Flieger Sydney Pickles engagiert, der den Flug zu Ende führen sollte. Am Sonntag durfte nach Landessitte nicht gestartet werden. Um nun die 100.000 Mark zu gewinnen, mußte der Flieger von Montag bis Mittwoch nachmittag rund 2100 km durchfliegen, was mehr als unwahrscheinlich schien. Am Montag morgen 5 :25 wagte Pickles den Weiterflug. Die See ging sehr hoch und die Wellen schlugen zeitweilig in den Rumpf und den Motor. Die Maschine sauste auf dem Wasser dahin, halb in den Wellen vergraben und plötzlich stockte der Motor. Der Apparat trieb südwärts ab und wurde schließlich von einem Boot ins Schlepptau genommen und in den Hafen zurückgebracht. Damit hatte der erste Versuch zur Umfahrung Englands auf einem Wasserflugzeuge ein klägliches Ende erreicht. Großes Aufsehen erregt hier ein offener Brief des Marquis Tullibardine, einem Mitglied des Royal Aero Club Legislation Com-mitee, der nähere Angaben darüber enthält, wie das britische Kriegsministerium konsequent dem britisc hen Marineleutnant Dünne jede Unterstützung zur Entwicklung seines schwanzlosen Flugzeuges verweigerte, sodaß der Offizier gezwungen war, seine Erfindung im Auslande zu verwerten. Jetzt hat die französische Militärbehörde den Typ angekauft. Das Kriegsministerium hat sich nunmehr entschlossen, die Werkstatt des verunglückten Fliegers Colonel Cody mit sämtlichem Zubehör anzukaufen, die Cody Fl ugmaschinen werden in Zukunft von den Königlichen Flugzeugwerken angefertigt. An ,den in der nächsten Woche stattfindenden irischen Manövern wird die 2. Sektion des Royal Flying Corps (Militaery Wing) zu Montrcjse, teilnehmen. Transportwagen und Advancepartie sind im Laufe der letzten Woche nach Linierick, dem Manöver-Hauptquartier, abgegangen, um Schuppen dortselbst zu errichten. Die Fliegertruppe wird sich in diesen Tagen auf dem Luftwege nach dort begeben. H. M. S. „Hermes", Mutterschiff für das Marineflugwesen, verließ Sheerneß am 10. August mit drei Wasserflugzeugen an Bord, und wird in nachstehender Reihenfolge den Marineflugstationen einen Besuch abstatten, um auf hoher See die Verwertung von Wasserflugzeugen auszuprobieren; Scapa Flow am 22. Aug., Cromarty am 3. Sept., Peterhead am 6. Sept., Dundee am 10. Sept., Queensferry am 12. Sept., Blyth am 18 Sept, Scarborough am 24. Sept., Crimsby am 25. Sept., Yarmouth am 27. Sept , Harwich am 30. Sept., und kehrt am 3. Oktober nach Sheerneß zurück. Der vor einigen Wochen von den Königlichen Flugzeugwerken konstruierte Wass er d oppeld ecker ist nunmehr in den Besitz der Marine übergegangen. An Stelle des 70 PS. Renault-Motor soll späterhin ein lOOPS.-Motor eingebaut werden. Am 21. Aug. flog der Marineleutnant Vernon mit Fluggast auf Marineflugzeug 42 (Short) in 35 Minuten von Leven, N. B., nach Dundee und kehrte am Abend wieder nach seinem Ausgangspunkt zurück. An demselben Tage flog Major Gordon mit Leutnant Rüssel auf Marineflugzeug 86 (Borel) von Leven nach St. Andrews und zurück. In dem bekannten Badeorte Brighton veranstaltet seit einigen Tagen der französische Flieger Beaumont, (Leut. Conneau) Schauflüge auf seinem D o n n e t-Le v eque-Fl u gb oo t. Er überflog den englischen Kanal von Boulogne nach Newhaven und setzte von dort seine Reise nach Brighton fort. Für Samstag, den 13. Sept., organisieren die International Correspond ence School of London und der Aero Club von England einen Wettflug Paris - London, der für Apparate aller Systeme offen ist. Zur Verfügung stehen ein erster Preis von 12 500 Francs und ein zweiter von 6250 Francs. Ferner fällt dem zuerst ans Ziel kommenden Flugzeuge englischer Konstruktion ein Spezialpreis von 2500 Francs zu. Ein Flieger-Derby gelangt am 20. Sept. auf dem Flugplatze zu Hendon zur Entscheidung. Die Teilnehmer starten von Hendon und werden London in einem Kreise vo < etwa 160 km Umfang umfliegen. Zu berühren sind dabei folgende Punkte: Kempten Park, Epsom, "West Turrock, Epping und Hertford. Ziel ist wiederum Hendon. Ungefähr 20 der bekanntesten Flieger Englands, darunter auch Spratt, der Deperdussin-Flieger, auf einem Westpbahl-Eindecker, haben bereits für das „Derby" gemeldet. Einen neuen Distanzrekord mit Pluggast stellte dieser Tage der englische Armeeflieger Captain C. A. H Long-croft auf einem „BE2" Typ Doppeldecker, konstruiert von den Königlichen Flugzeugwerken, mit 120 PS Renault-Motor auf, indem er mit einem Fluggast vom Militärflugplatz zu Farnborough nach der hoch im Norden Schottlands gelegenen Flugstation Montrose flog. Er legte die 530 Meilen betragende Strecke in 73/4 Stunden zurück und verbesserte somit den von Leutnant Canter aufgestellten Rekord um erhebliches. Nachdem am Montag, den 26 Aug. der Flieger Mc. Clean wegen Motordefekt endgültig aus der Konkurrenz für den engl. Rundflug ausschied, trat Hawker um 5 : 30 nochmals als einziger Flieger in die Schranken, um den 5000 Sterl. Pres der Daily Mail an sich zu reißen Das Wetter war zum Fliegen wie geschaffen und die See lag rnhig. Am Montag legte er die Strecke Netley—Beadnell zurück, woselbst er die Nacht über verblieb; am Dienstag erreichte er Oban, wo Motordefekt ihn zwang, länger zu verweilen, als seineZeit erlaubte. Erst am nächstenMorgen konnte er seine Reise von hieraus fortsetzen, auf der Höhe von Lame versagte der Motor abermals und machte eine Notwasserung nötig. Beim Anwässern kam der Apparat so hart auf, daß ein Schwimmer leck wurde. Um 11 Uhr (irische Zeit) waren die Reparaturen so weit vorgeschritten, daß er seinen Flug wieder aufnehmen konnte. Der Flieger näherte sich l.'ublin, der 7. Kontrollstation. Auf der Höhe von den Skerries, einem bekannten Badeorte, vier Meilen nördlich von der Rettungsstation Portraine (Donabate), ungefähr 15 Meilen von Dublin entfernt, angekommen, brach plötzlich die linke Hälfte der oberen Tragfläche nach oben hin ab, der Apparat überschlug sich und stürzte aus einer Höhe von 50 m in die Tiefe. Die beiden Insassen wurden aus dem Apparat herausgeschleudert und fielen einige Meter von der Maschine entfernt in flaches Wasser. Die Besatzung der Rettungsstation, die die Ankunft des Doppeldeckers durch Gläser beobachtete, setzte sofort ein flinkes Motorboot aus und nahm die Flieger, welche ohne erhebliche Verletzungen davongekommen waren, in er- schöpltem Zustande auf. Der erheblich beschädigte Apparat konnte erst nach eingetretener Ebbe geborgen werden. So mißglückte auch der zweite Versuch dieser unerschrockenen Flieger, England zu umsegeln. Die Daily Mail oder deren Direktoren, mit Lord Novthcliffe an der Spitze, haben sich nunmehr entschlossen, Hawker einen Trostpreis von 1000 Lstrl. zuzusprechen. * * * Zeittafel von Hawkers Flug, geführt vom Aero-Club.
Konstruktive Einzelheiten. Zur schnellen Montage benötigt man bei den Verspannungsorganen leicht lösbare Spannschrauben. Die in Abb. 1 dargestellte Spannschraube der Firma Binet in Paris stellt in dieser Hinsicht eine einfache Lösung dar. Das Mutterstück a der Spannschraube ist hakenartig ausgebildet. Im Haken selbst befindet sich eine Sperrklinke b, die wie eine Messerklinge in das Mutterstück a eingelegt werden kann. Zum Arretieren der Klinke b wird der King c über das widerhakenartige Ende derselben geschoben, worauf der Widerhaken in eine entsprechende Nute des Banges c einschnappt. Damit der Sicherungsring c nicht an dem Mutterstück a abwärts rutschen kann, ist dasselbe' mit einem Anschlagbund d versehen. Zum Festhalten der Spannschraube an der Befestigungsstelle ist die Oese e vorgesehen. Dieselbe bleibt stets mit der Befestigungsstelle verbunden, während die Spannschraube mit dem Verspannungssorgan in Verbindung bleibt. Bei der Demontage wird der ßing c gelüftet, die Sperrklinke b herausgeklappt und aus der Oese e herausgezogen, wodurch die Verbindung gelöst ist. Eine einfache Befestigungsart von Verspannungsorganen an Tragflächenholmen ist aus Abb. 2 zu ersehen. Durch den Flügelholm geht vertikal eine Oesenschraube, die auf der Oberseite mittels Oesenmutter festgehalten 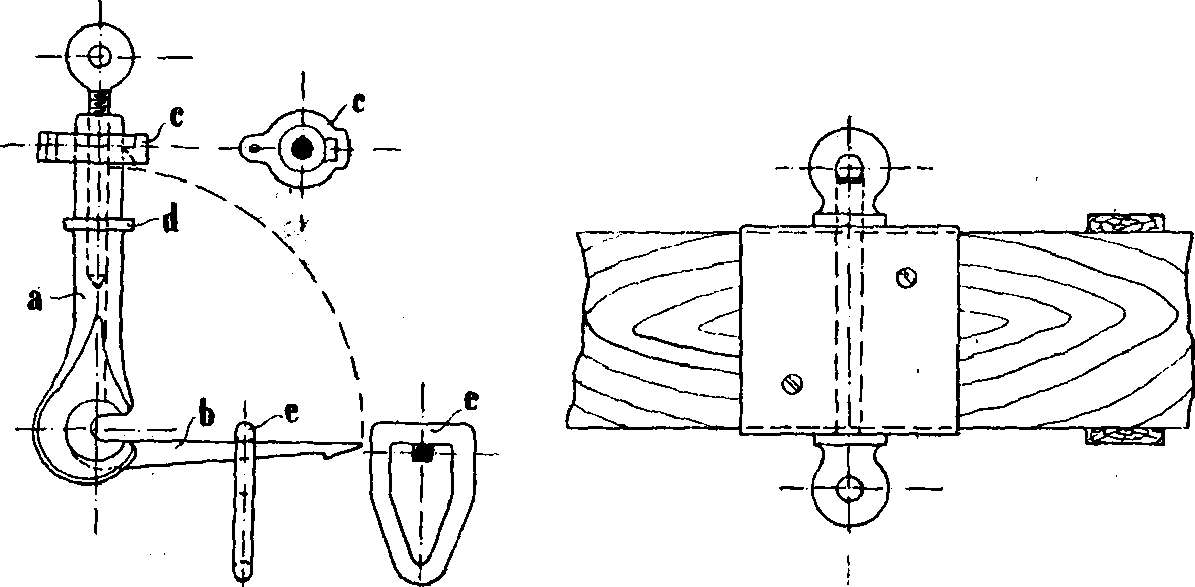 Abb. 1 «CSUB* Abb. 2 wird. Die durchbohrte Stelle des Flügelholms wird mit einer Stahlblechhülse armiert, damit sich dieJOesenschraube nicht in das Holz einarbeiten kann. Die Oesenmutter kann gegen Lockerung durch 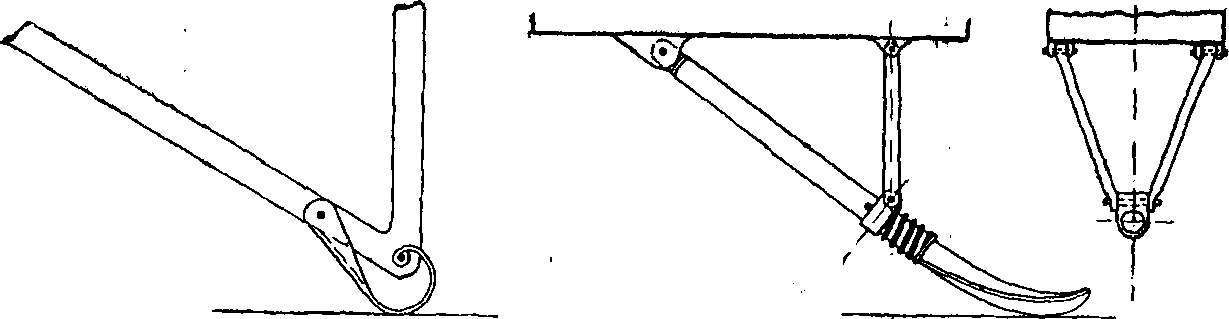 Abb. 3 Abb. 4 einen Splint oder Drahtstift gesichert werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die Stoffbespannung der Tragflächen in ganz geringem Maße verletzt wird. Um die vielfach verwendeten starren Schwanz- und Fahrgestellkufen elastisch zu machen, verwendet man z. B. beim Antoinetteapparat eine freitragende Blattfeder. Dieselbe erfüllt in unvollkommener Weise ihren Zweck. Wie aus Abb. 3 zu ersehen ist, wird der Schleifkufenlöffel zu einer Spiralfeder umgewandelt, die durch zwei Bolzen festgehalten wird. Diese einfache Ausführung ist sehr elastisch und gestattet eine schnelle Montage. In Abb. 4 ist eine Schleifkufe dargestellt. Dieselbe besteht aus einem Stahlrohrschaft, über welchen eine Druckfeder und eine Führungsschelle geschoben ist. Von der Schelle aus gehen zwei gelenkig befestigte Stahlrohrstützen nach dem Rumpf, welche die Druckfeder beim Aufsetzen der Kufe zusammendrücken. Damit die Schelle nicht nach oben gleiten kann, ist ein Anschlagstift vorgesehen. Die Reibung der Schelle verzehrt eine gewisse Kraft, sodaß die Druckfeder nicht den vollen Stoß auszuhalten hat. Gegenüber den Kufen mit Gummiringabfederung hat die vorliegende Ausführung den Vorteil, daß beim Brechen der Feder der von ihr gestützte Apparatteil nur um eine geringe Entfernung dem Erdboden näher kommt, während sich bei der Gummiringabfedeiung die Entfernung zwischen Apparat und Erdboden ganz bedeutend verkleinert, sodaß schon geringe Unebenheiten und Hindernisse einen beträchtlichen Schaden verursachen können. Der Rundflug um Berlin. Der diesjährige Rundflug um Berlin war ein voller Erfolg. Von 19 Fliegern vollendeten am 30. August 17 die 102 km messende erste Runde. Die beiden anderen Flieger vollendeten noch am nächsten Tage die erste Runde. Am Sonntag starteten 21 Flugzeuge, wovon 19 glatt die Strecke durchflogen. Alle drei Runden beendeten 15 Flieger. Dieses Resultat ist als ein ganz hervorragendes zu bezeichnen. Am Samstag, den 30 Aug., dem 1. Flugtag, wurde morgens 3:30 der Start freigegeben. Es flogen ab: Schüler auf Ago-Doppeldecker, Mercedes 100 PS; Victor Stoeffler auf Aviatik-Pfeil-Doppeldecker,Mercedes 100 PS; Boehm auf Albatros-Benz 100 P5; Ernst Stoeffler auf Albatros-Mercedes 100 PS; Janisch auf L.V. Q.-Doppeldecker Syst. Schneider, Mercedes 100 PS; Friedrich auf Etrich-Taube, Mercedes 95 PS, Stiefvater auf Jeannin-Stahltaube, Argus 100 PS; Vollmöller auf Albatros-Taube, Mercedes 100 PS. Sämtliche Flieger flogen mit Fluggast, Stiefvater sogar mit 2 Offizieren. Inzwischen trafen bereits wieder die ersten Flieger auf dem Flugplatz ein Victor Stoeffler, Schüler, Boehm und Ernst Stoeffler. Ferner starteten: Dipl.-Ing, Thelen auf Albatros-Doppeldecker, Argus 100 PS; Krieger auf Harlan-Eindecker Rex-?implex 95 PS; Weyl auf Otto-Doppeldecker, Argus 100 PS; Linnekogel auf Rumpler-Eindecker, Mercedes 100 PS; Langer auf Luftfahrzeug-Pfeil-Doppel-decker, Argus 100 PS; Baierlein auf Otto-Eindecker, Argus 100 PS; Stiploscheck auf Jeannin-Stahltaube, Argus 130 PS; Kießling auf Ago-Doppeldecker, Argus 100 PS; Ingold auf Aviatik-Doppeldecker 6 Zyl. Benz 100 PS ; Reichelt auf Harlan-Argus 95 PS und Beck auf Kondor - Eindecker, Mercedes 95. PS. Sämtliche abgeflogenen Flieger bis auf Ingold, welcher bei Bernau und Janisch, der bei Potsdam gelandet waren, trafen auf dem Flugplatz wieder ein Die beste Zeit für die erste Runde erzielte Baierlein mit Oberlt. von Linsingen als Fluggast auf Otto-Eindecker mit 1 Stunde 35 Min. Am Sonntag-, dem zweiten Flugtag, trafen vormittags Janisch und Ingold auf dem Flugplatz ein. Nachmittags begann der Start für die vorgesehenen zwei Runden. Es flogen hintereinander ab: Victor Stoeffler, Krieger, Ernst Stoeffler, Vollmöller, Kießling, Schüler, Boehm, Theten, Friedrich, Janisch, Reichelt, Ingold, de Ballod, Linnekogel, Weyl, Stiploscheck, Langer, Stiefvater, Baierlein, Fiedler und Beck-Kaum daß die letzten Maschinen den Platz verlassen hatten, so erschienen am Horizont schon wieder die ersten abgeflogenen Flieger und landeten, um Benzin und Oel einzunehmen, Wasser nachzufüllen und von neuem für die zweite Runde zu starten. Auf der Strecke waren liegen geblieben Boehm und de Ballod. 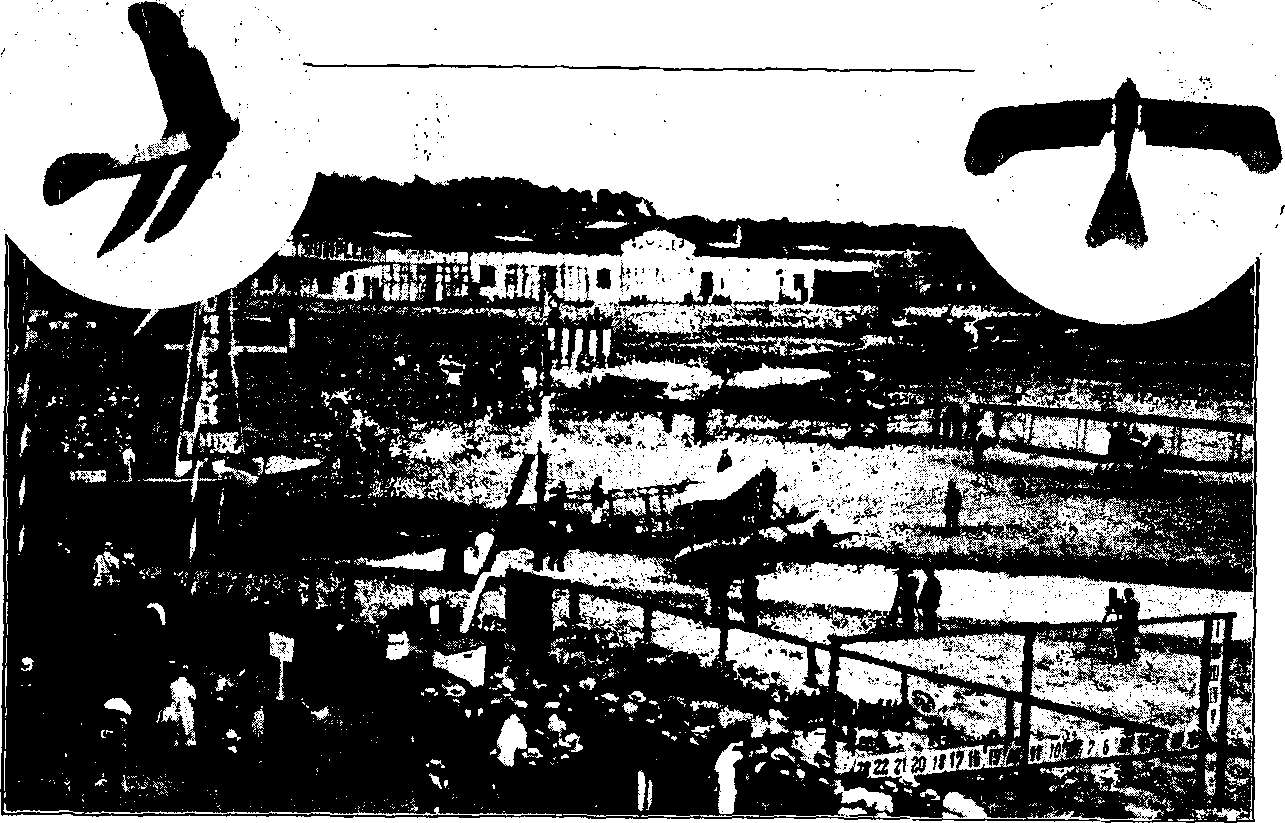 Randflug um Berlin. Der Start in Johannisthal, oben links: Luftfahrzeug-Pfeildoppeldecker in der Kurve. Rechts: Beck auf Kondor. Unter den Tragdecken befinden sich zum besseren Erkennen zwei große schviarz-vieiß-rote Ringe. In der zweiten Runde blieben liegen Janisch und Ernst Stoeffler, die nach Behebung einiger kleiner Motordefekte weiterflogen. Die beste Zeit für die drei Runden erzielte Baierlein auf Otto-Eindecker Argus 100 PS. Alle drei Runden haben 15 Flieger beendet. Sie erzielten folgende Zeiten: A. Baierlein (Otto-Argus-Eindecker), Passagier Oberlt. v Linsingen, l.Rundel :00:35 ; 2. Runde 0:55:05 ; 3 Runde 0:56:14. Gesamtflugzeit 3:01 :54. Linnekogel (Rumpler-Mercedes-Eind. 100 PS), Passagier Lt. Müller, 1. Runde 1 :08:23 ; 2. Runde 0:58:17; 3. Runde 57:39. Gesamtflugzeit 3:19 :28, Victor Stoeffler (Aviatik-Mercedes-Doppeld. 100 PS), Passagier Ing. Schmidt, 1:05:01, 1:03:03, 1:04:24 = 3:27:28. H. Vollmoeller (Albatros-Mercedes-Taube 100 PS), Lt. Freund, 1 :05: 25 1:04:06, 1:03:17=-3:27 :48. Dipl.-lng. R. Thelen (Albatros-Mercedes-Doppeld.), 1:12:13, 1:01:35 1 :01:32 = 3:30:20. Seite 679 „FLUGSPORT. No. 18 Langer (Luftfahrzeug-Pfeil-D.-D. 100 PS Mercedes) 1:13:45; 1:07:30; 1:04:14 - 3:40:29. Otto Beck (Condor-Mercedes-Eind. 100 PS) 1:19:40; 1:07:48; 1:03:08 = 3:45:36. M. Schüler (Ago-Mercedes-D.-D. 100 PS), Remus, 1:13:15; 1:10:20 1:09:22 =3:47:57. W. Kießling (Ago-Argus-D.-D. 100 PS), 1:19:12; 1:09:00; 1:09:51 = 3:53:03. W e y 1 (Otto-Argus-D.-D.) 1:21:42; 1:20:17; 1 08:11 =4:05:10. A. Friedrich (Etrich-Mercedes-Taube 100 PS), Oberl. Zimmermann, 1:25:00, 1:13:34; 1:12:00 = 4:05:34. E Stoeffler (Albatros-Mercedes-D.-D. 100 PS) Kp.-Lt. Berthold 1 :05:20, 1:03:03, 1:44:38 = 4:08:22. A. S tiplosch eck (Jeannin-Argus-Stahltaube, 100 PS) Lt. v. Falkenhayn, 1:04:54, 0:57 : 54. 1:00:44 = 4:14 : 32. Reichelt (Harlan-Argus-Eind., 100 PS) Allers; 2:13:25; 1:13:42; 1:12:58 = 4:55:35. K. Janisch (L. V.■ G.-Mercedes-D.-D. 100 PS), 15:00:30 ; 0:55:26; 1:46:01 = 17 : 51 : 57. Luftgeschwader und Armeekorps. Die französische Heeresverwaltung hat vor kurzem die Bestimmung getroffen, daß die aeronautischen Einheiten der Armee der Autorität derjenigen Militärgouverneure oder Korpskommandanten unterstellt sein sollen, innerhalb deren Machtbereich sie stationiert sind. Die inredestehenden Einheiten umfassen Flugzeug Geschwader oder Geschwadergruppen, ■ sowie einen oder mehrere Lenkballons. In Ausführung dieser Bestimmung haben die Korpskommandeure bzw. die Militärgouverneure einen höheren Offizier bestimmt, welcher die Aufgabe hat, durch Vermittlung der Gruppenkommandanten die Verwaltung, die Disziplin und die Mobilisierung der innerhalb ihres Befehlsbe eichs stationierten aeronautischen Einheiten zu kontrollieren. Ebenso üben mit Bezug auf den Außendienst und auf die taktische Ausbildung der Fliegeroffiziere von jetzt ab die Korpskommandeure anstelle des permanenten Inspekteurs des Militärflugwesens ihre Autorität aus, allerdings mit der einzigen Einschränkung, daß sie sich dabei an die besonderen Instruktionen seitens des Kriegsministers zu halten haben. Auf den ersten Blick erscheint diese bedeutsame Neueruig innerhalb des französischen Militärflugwesens eine gute, und tatsächlich haben die Mehrzahl der Flieger und Offiziere, die sich mit dem Militärflugwesen befassen, diese Neuorganisation, da sie ihnen logisch erscheint, mit Genugtuung begrüßt. Andere wieder halten die getroffene Maßregel für verfrüht, wenigstens soweit die Flugzeuge dabei in Frage kommen. Indessen wird dem Grundprinzip, wonach die Fliegereinheiten den Armeekorps zugeteilt werden, im allgemeinen kein erheblicher Widerspruch entgegengesetzt. Und doch wird man sich nicht verhehlen dürfen, daß die hier besprochene Neuorganisation nur dann einen gewissen Wert und einen Vorzug haben kann, wenn man auch wirklich versteht, sie in zweckmäßiger Weise praktisch zur Anwendung zu bringen. Es wird sich dabei in erster Reihe um organisatorische Geschicklichkeit handeln. Wir lesen beispielsweise in der „Defense Nationale", 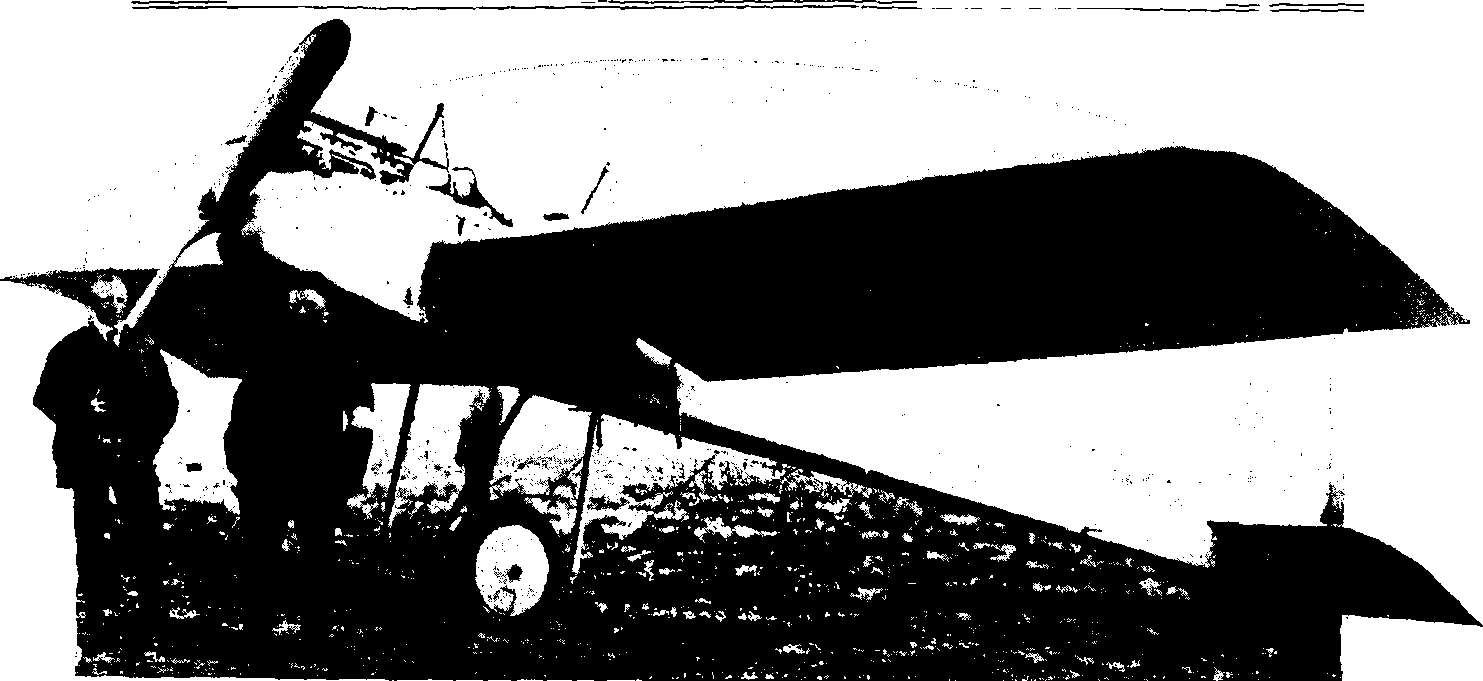 Rundflug um Berlin. Baierlein auf Otto-Eindedier, Sieger vom Rundflug. Links daneben sein Fluggast Oberlt. von Linsingen.  Rundflug um Berlin. Stiplosäieck auf Jeannin-Stahltaube, zweiter im Rundflug um Berlin mit seinem Fluggast Lt. von Falkenhayn (Sohn des Kriegsministers) der wohl angesehensten Militärfachschrift in Frankreich, zu dieser Frage folgende Bemerkungen: Die Maßnahmen, wie sie die Heeresverwaltung getroffen hat, scheinen klug zu sein. Sie haben zum wesentlichen Ziel, die General-Inspektion zu einem Teile von der erdrückenden Aufgabe zu entlasten, die ihr bisher ausschließlich obgelegen hat. Sie erfordern indessen bei ihrer praktischen Anwendung ein großes Maß von Klugheit und Umsicht, besonders was das Flugwesen anbelangt. Man kann zum Beispiel fragen, ob es logisch ist, ganze Luftgeschwader, denen ihr ganzes umfangreiche Material zu folgen haben wird, an jedem Manöver, das innerhalb eines Armeekorps ziemlich häufig veranstaltet wird, teilnehmen zu lassen. Da es hierbei sich nur um einen simulierten Feind handelt, werden die bei dieser Gelegenheit unter diesen Voraussetzungen vorgenommenen Flieger-Rekognoszierungen gegenstandslos sein müssen. Dagegen läuft man Gefahr, die Flieger-Einheiten und ihr überaus delikates Material unverhältnismäßig schnell abzunutzen, aus dem einfachen Grunde, um sich die eitle Genugtuung zu gewähren, darzutun, daß die Flugzeuge unter Bedingungen, die denen eines Ernstkrieges ähnlich sind, zu fliegen imstande sind. Dieser Beweis braucht aber nicht mehr erbracht zu werden, und es wird angebrachter sein, diese neue Waffe, die wohl wenigst „robuste" Waffe, in allen denjenigen Fällen zu schonen, wo ihre Verwendung nicht eine wirklich interessante oder neue Probe darstellen soll. Durch diese Auslassungen des erwähnten Blattes wird in der Tat die ganze Frage an dem richtigen Punkte angefaßt Man hat die Fluggeschwader den Korpskommandeuren, den zukünftigen Armeeführern gegeben, damit sie sich während der Jahre ihres aktiven Kommandos mit dieser Waffe vertraut machen können, damit sie lernen sollen, diese delikate und wichtige Waffe, welche das Flugzeug darstellt, auf die zweckmäßigste Weise zu verwenden. Man hat auch gewollt, daß dadurch, daß die Flugzeuge häufiger zusammen mit der Infanterie, der Artillerie, der Kavallerie und dem Genie manövrierten, die „fünfte Waffe" sich darüber klar wird, worin ihre Taktik besteht, was man von ihr verlangt und was sie zu leisten imstande ist; daß eine enge Verbindung zwischen allen jenen Waffengattungen entstehe, indem der Flieger das Bewußtsein von seiner Nützlichkeit erlange und der Soldat, der das Flugzeug Uber seinem Kopfe sieht, Vertrauen zu ihm habe. Wenn ober diese Verwendungsart der Flugzeuge auch bei anderen Manövern als gelegentlich der großen Herbstmanöver rationell und von wirksamen Nutzen sein soll, dann müssen die in Aktion tretenden Truppen wirklich zahlreich sein. Man wird auch hierbei nicht übertreiben dürfen und etwa bei jeder Garnisonsübung ein oder zwei Flugzeuge zur Mitwirkung heranziehen dürfen. Auf diese Weise wird man genau das Gegenteil von dem erreichen, was man bezweckt: man wird ohne nennenswerten Nutzen für die gemeinsame Instruktion der Chefs, der Flieger, der Beobachter und der Truppe, das Personal überanstrengen, sowie das Material ermüden und vorzeitig abnutzen. Diese Bedenkliclikeit in der neuen Maßnahme der französischen Heeresverwaltung wird an verschiedenen Stellen heute schon empfunden und gewisse Stellen gehen sogar noch weiter und geben einer anderen Befürchtung lebhaften Ausdruck: je mehr Chefs in Zukunft über die Flugzeuge eine Autorität haben werden, umso schwerer wird es den Fliegern sein, die Anforderungen, die von verschiedenen Seiten an sie herantreten werden, zu erfüllen. Aber das ist wohl übertrieben, denn diejenigen, denen die Verwendung der Flugzeuge obliegt, werden sich in der Praxis voraussichtlich sehr bald Rechenschaft davon geben, daß sie mit gegebenen Möglichkeiten zu rechnen und nicht unerfüllbares zu fordern haben. Abgesehen von den vorstehend kurz skizzierten Einwendungen wird man aber die neue Verordnung der französischen Heeresverwaltung als eine sehr geschickte anzusehen haben: sie wird dazu beitragen, das Flugwesen in der Armee ganz beträchtlich fortzuentwickeln, denn jetzt erst tritt das bisher abgesonderte Flugwesen in den Rahmen der Heeresorganisation ein. Die Reglementierung der französischen Flug-Meetings. Der französische Minister des Innern gibt soeben eine Verfügung bekannt, welche, unter Annullierung aller bisherigen Bestimmungen mit Bezug auf Fliegermeetings und sonstige Schauflugveranstaltungen, deren neue Reglementierung bezweckt. Die neue Verordnung bestimmt, daß die Autorisation für Flugzeug- und Wasserflugmeetings seitens des betreffenden Präfekten erfolgt, sofern nur ein Departement bei der Veranstaltung interessiert ist, andernfalls seitens, des Ministers des Innern selbst. Nachdem sie sich der Zustimmung des Ministers versichert haben, werden die Präfekten die Autorisation erteilen können, aber die Organisatoren der inredestehenden Veranstaltungen müssen sich zur Einhaltung der nachfolgenden Vorschriften verpflichten: 1. Das Flugfeld muß derart beschaffen sein, daß man auf ihm ein Viereck von mindestens 400 Metern Länge abstecken kann, welches ausschließlich für die Evolutionen der Flugmaschinen bestimmt ist; 2. Das Terrain, wenigstens das an eine Seite dieses Quadrats anstoßende Terrain, muß von allen Hindernissen frei und so beschaffen sein, daß es auf eine als hinreichend angesehene Tiefe von 200 bis 300 Meter für das Publikum unzugänglich gemacht werden kann; 3. Das innerhalb des Quadrats gelegene Terrain muß vor allen Dingen in einem solchen Zustande sein, daß es von einem Automobil befahren werden kann; 4. Der für das Publikum bestimmte Raum muß außerhalb des für die Evolutionen der Flugzeuge reservierten Quadrats angelegt werden. Auf dem Flugterrain muß, zwanzig Meter vor der Grenze des für das Publikum bestimmten Terrains, eine Barriere errichtet oder Seile gezogen werden, die frei sichtbar sind und vor allen Dingen eine große Festigkeit aufweisen, so daß ein gegen sie anrollendes Flugzeug von ihnen aufgehalten werden kann ; Mit Bezug auf die Wasserflugzeuge, die auf Wasserläufen oder am Strande evolutionieren, ist folgendes bestimmt worden: 1. Wenn Wasserflugzeuge auf einem Flusse manöverieren sollen, so muß dieser Wasserlauf auf eine Länge von 500 Metern eine gewisse Breite aufweisen, die nicht weniger als 100 Meter betragen darf. Der Fluß muß auf eine Länge von 500 Meter frei von jedem Hindernis sein und er muß während der Dauer der Flugzeug-Evolutionen für jeden Schiffsverkehr gesperrt werden können; 2. Das Terrain, welches an den auf einem der Flußufer vorgesehenen Platz angrenzt, sowie der Wasserlauf selbst, stromaufwärts und stromabwärts von dem reservierten Platz am Ufer, müssen frei von allen Hindernissen und so beschaffen sein, daß sie auf eine hinreichende Tiefe, die aber nach jeder Richtung nicht weniger als 250 Meter betragen darf, für das Publikum gesperrt werden können. Und was die Wasserflugzeuge an der Seeküste betrifft, so gelten für diese die nachfolgenden Beslimmungen; 1. Die in Aussicht genommene Stelle muß frei von allen Hindernissen sein und auf eine Ausdehnung von wenigstens 500 Meter Länge und 500 Meter Breite während der Evolutionen der Wasserflugmaschinen für jeden Schiffsverkehr gesperrt werden können; 2. Wenn das Meer, der See, oder der Hafen durch einen sanft abfallenden sandigen Strand abgeschlossen ist, so muß dieser Strand auf eine Tiefe von wenigstens 100 Meter in den für die Flugzeug-Evolutionen reservierten Raum mit eingezogen werden. Zu diesem reservierten Teile des Strandes darf das Publikum keinen Zugang haben; 3. Kahne und Wasserfahrzeuge aller Art, welche in die Nähe des Flugraums zugelassen sind, müssen die Küste oder eine der Seiten des für die Evolutionen reservierten Raums entlang gehalten werden, so daß dieser Raum stets 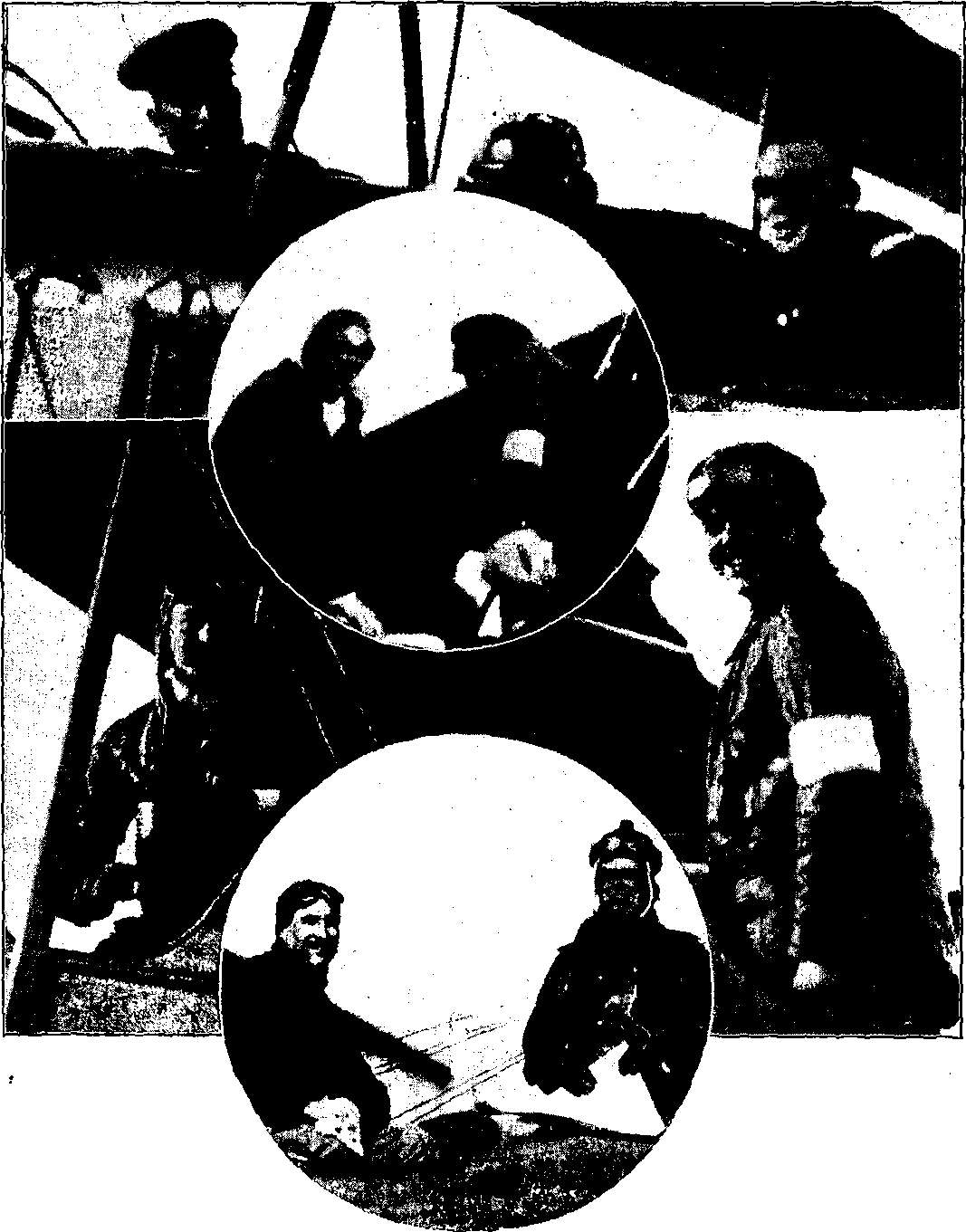 Rundflug um Berlin. Oben rechts: Victor Stoeffler auf Avialik-Doppeldecker. Rechts darunter: Ernst Stoeffler auf Albatros-Doppeldecker. In der Mitte: Sc/iäler auf Ago-Doppeldecker erzählt von seinem Fluge. Unten: Beck auf Kondor-Eindecker mit Hauptmann Kockein. auf zwei aneinanderstoßenden Seiten und auf eine Tiefe von 200 bis 300 Meter frei gehalten bleibt. Es wird andererseits aufs nachdrücklichste darauf hingewiesen, daß sowohl zu Lande, als auch zu Wasser der für die Flugevolutionen reservierte Raum durch eine solide Barrifere oder durch sichtbare Seile abgesteckt sein muß. Jeder Aufenthalt im Innern des abgesteckten Raums wird allen anderen Personen als den Fliegern selbst, den Mechanikern, Sportkommissaren oder Zeitnehmern, unbedingt zu verbieten sein.  Rßndflug um Berlin. Luftfahrzeugbau-Eindecker, Flieger Fiedler. Endlich muß der jedesmalige Abflug eines der Flugzeuge durch ein Signal angekündigt werden. Es wird zum Schlüsse gesagt, daß einstweilen, und zwar solange bis die Verwaltung sich über die Erteilung der Wasserflugzeugführerzeugnisse und der Geschicklichkeitsdiplome schlüssig geworden sein wird, diese Dokumente durch das Zeugnis und die Lizenz, wie sie von dem Aero-Club erteilt werden, ersetzt werden sollen Es geht daraus also hervor, daß diejenigen Flieger, welche in Frankreich öffentliche Flugvorführungen veranstalten wollen, im Besitze sowohl des Patents als Flugzeugführer, als auch der von der Aeronautischen Sportkommission erteilten Lizenz sein müssen. Rl.  Inland. Flugführer-Zetignisse haben erhalten: No. 472. Ziegler, Albert, Techniker, Johannisthal, geb. am 10. April 1888 zu Feketehalom, für Eindecker (Melli Beese), Flugplatz Johannisthal, am 2. Aug. 1913. No. 473. Wlodarski, Bruno, Halensee bei Berlin, geb. am 31. Dez. 1893 zu Berlin, für Eindecker (Grade), Flugplatz Bork, am 5. August 1913. No 474. Schreiner, Max, Leutnant i. Inf.-Regt. Nr. 60, Johannisthal geb. am 28. August 1885 zu Homburg, für Eindecker (Etrich-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 6. August 1913. No. 475. Fick, Max, Bork, Post Brück (Mark), geb. am 26. Juli 1895 zu Potsdam, für Eindecker (Grade), Flugplatz Bork, am 6. August 1913. No. 476. Schlegel, Oswald, stud. ing., Charlottenburg, geb. am 31 Dez. 1893 zu Weißenfels a. S., für Eindecker (Grade), Flugplatz Bork, am 6. August 1913. No. 477. Wuthenow, Kurt, Leutnant i. Ulanen-Regt. Graf Dohna, Johannisthal, geb. am 15. April 1889 zu Alienstein, Ostpr., für Zweidecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 6. August 1913. Mo. 478. Künne, Kurl, Mainz-Gonsenheim, geb. am 22. Februar 1892 zu Düsseldorf-Gerresheim, für Eindecker (Grade), Flugplatz Großer Sand b. Mainz, am 7. August 1913. No. 479. Scheiner, Hermann, Druckereibesitzer, Würzburg, geboren am 14. September 1877 zu WUrzburg, für Zweidecker (Otto), Flugplatz Schleißheim» am 9. August 1913. No. 480. Enskat, Fritz, Ingenieur, Berlin-Schöneberg. geb. am 9. April 1883 zu Insterburg, für Zweidecker (L.V.G), Flugplatz Johannisthal, am 9. Aug. 1913. No. 481. Rieseler, Walter, Bork, Post Brück (Mark), geb. am 3. Dez. 1890 zu Burg bei Magdeburg, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 9. Aug. 1913. Von den Plugplätzen. Auf dem !lugplatz Drosselberg bei Erfurt machte der Flugschüler der Nationalflugspende Hozakowski seine Fliegerprüfung auf einem Schwade-Doppeldecker mit 80 PS Schwade-Stahlherz-Rotationsmotor. Vom Jflugplats Madel bei Magdeburg. In der Fliegerschule von Schulze erledigten am 24. August Friedrich Hucke, Roitsch und W. Mann die Flugzeugführerprüfung, ferner am 27. August Josef Weiß seine Feldpilotenprüfung. Weiß flog in mehreren Schleifen über den südlichen Teil von Burg, und dann gegen Osten bis nach Genthin. Die erreichte Höhe betrug 1300 m. Er landete nach einem Fluge von 1 Stunde 10 Min. im Gleitflug aus 300 m Höhe. Am gleichen Tage erledigte die Flugzeugführerprüfung der Schulze-Schüler Röder. Am 28. August startete für die Feldpilotenprüfung der Flieger W. Mann, welcher 1100 m Höhe erreichte. Die Flugdauer betrug 1 Stunde 2 Min. Landung im Gleitflug aus 250 m Höhe. Flugp latx Ob err Viesenfeld. In der letzten Woche bestanden die Flugschüler Oesterreicher und Scheuermann ihre Flugzeugführerprüfung auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor in tadelloser Form in einer durchschnittlichen Höhe von 150 m. Iii ig platz Fi ichheim. Seit einigen Tagen herrscht in Puchheim wieder reges Leben. Der bekannte bayeriche Herrenflieger Otto Lindpaintner trainiert sich zur Zeit für die großen Ueberlandflüge, zu denen die Nationalflugspende anspornt. Als Motor benutzt er den neuen 100 PS Stahlzylinder Rapp-Motor, der, in Milbertshofen hergestellt, in seinen täglichen 1 - 2stündigen Flügen die vollste Anerkennung auch dieses Fliegers erzielte. Der gestrige Flug führte Lindpaintner von Puchheim nach München, Freising-München-Ammersee-Puchheim. /Militärische Flüge. ^ Flug Schleißheim-Gotha. Lt. Henneberger mit Oberlt. Meyer als i Fluggast flog am 19 August abends in 2l/s Stunden von Schleißheim nach Coburg. %. Die Entfernung betrug 240 km. Am 20. August morgens überquerten die Flieger über den Wolken in 1400 m Höhe den Thüringer Wald in der Richtung nach Gotha. Die Wolkenschcht betrug 100 m Höhe. Sie landeten bei Wandersleben 10 km südöstlich von Gotha. Flug: Schleißheim Nürnberg. Lt. Behl von der bayrischen Militär-Fliegerstation Schleißheim mit Oberlt. Steger flog am 26. Aug. abends in einer Stunde von Grafenwöhr bis Nürnberg und am nächsten Morgen die Juraberge in 1150 m überfliegend bei böigem Wetter in 50 Minuten nach Schleißheim zurück. V. Stöfflers Fernflug Mülhausen—Insterborg 1200 km. Einen bemerkenswerten Rekordflug hat Viktor Stöffler ausgeführt. Er war am 26. August vorm. auf dem Flugplatz Habsheim bei Mülhausen im Elsaß auf einem Aviatik-Doppeldecker aufgestiegen, um sich um die große Prämie der Nationalflugspende zu bewerben, die bekanntlich für den längsten Ueberlandflug an einem Tage eine monatliche Rente von 4000 Mark verspricht. Um 5 Uhr 45 Min. früh war der Flieger gestartet. Er landete in Johannisthal, nach einer Zwischenlandung in Alten-Grabow, um 4 Uhr 10 Min. Die reine Flugzeit für die 700 Kilometer lange Strecke betrug 7 Stunden 15 Min. Bereits kurz nach 5 Uhr warf er seinen Motor wieder an, und um 5 Uhr 27 Min. erhob er sich zum Weiterflug nach Osten it die Lüfte. Nach einer etwa zweistündigen Flugzeit ging der Aviatikflieger Viktoi Stöffler um 7 Uhr 30 Min. vierzig Kilometer vor Insterburg glatt nieder. Die Entfernung Mülhausen—Berlin—Insterburg beträgt etwa 1200 Kilometer, sodaß dieser Flug die größte Leistung darstellt, die von einem deutschen Flieger an einem Tage ausgeführt worden ist Damit ist auch der Flug des Fliegers A. Friedrich vom 8. August weit überboten, sodaß bisher Stöffler der erste Anwärter auf den Preis der Nationalflugspende ist. Friedrich flog damals Berlin— Schneidemühl—Königsberg—Insterburg—Königsberg, insgesamt ungefähr 715 Kilometer. Auf dem Bodensee flog auf einem Wasserflugzeug mit 3 Fluggästen der Flieger Ingenieur Robert Gsell von Manzell nach Romanshorn und zurück, sowie Manzell-Meersburg-Konstanz und zurück. Die Flüge wurden mit einer Wassermaschine des Flugzeugbau Friedrichshafen mit vollem Betriebsstoff, Land-und Wassereinrichtung in 200 m Höhe ausgeführt. Die Nutzlast betrug hierbei 500 kg. Trotzdem war der Wasserstart sehr kurz. Anschließend hieran unternahm am 28. August Gsell einen Ueberlandflug mit zwei Fluggästen von Friedrichshafen nach St. Gallen und zurück, wobei ein Hügelzug von 800 m Uberflogen werden mußte. Die erreichte Höhe betrug 1400 m. Der verwendete Wasser-Renndoppeldecker des Flugzeugbau Friedrichshafen besaß einen 140 PS N. A. G.-Motor. Der Fliegerlt. Schmidt vom 148 Inf.-Reg, Bromberg ist am 22. August 7 Uhr morgens auf einem Bristol-Eindecker mit 50 PS Gnom-Motor tödlich abgestürzt. Ursache: Gleitllug, vollaufender Motor, Flügelbruch.  Seite 687 „ r' L ü G S P 0 R T. No. 18 Wettbewerbe. Eine interne Wasserflugzeugprüfung fand am 21. August in Putzig statt, bei der es sich um den Ankauf der imBoden-see-Wettbewerb siegreich gewesenen Apparate durch die Marine-Verwaltung handelte. Im Landstart erzielte Schüler auf Ago = Doppeldecker mit 130 Meter den kürzesten Anlauf, Thelen auf Albatros-Doppeldecker brauchte 155 und Hirth auf Albatros-Eindecker 220 Meter. Die Maschinen mußten dann nach einem kurzen Fluge auf das Wasser niedergehen, dort an einer Boje verankern und mit abgestelltem Motor 30 Minuten lang liegen bleiben. Dann mußte der Motor wieder vom Führersitz aus angeworfen und vom Wasser aus gestartet werden. Dabei brauchte Schüler 125 und Hirth 175 Meter Anlauf. Bei der Höhenprüfung erreichte Schüler in 22 Minuten 900 Meter, Hirth in 18 Minuten 600 und Thelen stieg nur auf 300 Meter. In der Schnelligkeitsprüfung siegte Schüler mit 17 Minuten 20 Sekunden vor Thelen (18:35) und Hirth (18:55). Einen daran anschließenden Start und eine Landung von und auf bewegtem Wasser (Danziger Bucht) absolvierten alle drei Teilnehmer, sodaß die Marineverwaltung voraussichtlich den Ago - Doppeldecker und auch den Albatros - Doppeldecker, wenn er noch nachträglich den Wasserstart und die Höhenprüfung erfüllt, ankaufen dürfte. Am 23. und 24. August fand bei herrlichstem Wetter die bedeutendste diesjährige Leipziger Flugveranstaltung statt. Der Besuch war sehr rege. Es starteten : Stiploscheck auf Jeannin- tahltaube, Schwandt auf Grade, Breton auf Otto-Doppeldecker, Ingold auf Aviatik-Doppeldecker, G'asser auf D. F. W.-Doppeldecker und Oelerich auf D. F. W.-Doppeldecker. Für den ersten Tag waren Früh- und Dauerpreise, sowie Preise für den kürzesten An- und Auslauf ausgesetzt. Nachmittags kamen mehrere Offiziersflieger von Döberitz, die an dem am 24. Aug. vorgesehenen Flug um den Völkerschlacht-Erinnerungspreis teilnahmen. Für diesen Preis war eine besondere Kriegslage ausgegeben worden Ferner fanden nachmittags wieJer Wettbewerbe um den Dauerpreis und den Preis für den kürzesten An- und Auslauf statt. Die größte Höhe erreichte Ingold mit 2350 m. Es erhielten von den Offiziersfliegern: Ankunftspreis: 1. Ltn. Reuß mit Oberltn. Nordt, Ehrenpreis der Leipziger Flugplatz-A.-G. 2 Ltn. Bonde mit Ltn. Müller. Völkerschlacht-Erinnerungspreis: 1. Ltn. Reuß mit Oberltn. Nordt, Ehrenpreis des Königs Friedrich August von Sachsen. 2. Ltn. Bonde mit Ltn. Müller, Ehrenpreis der Stadt Leipzig. 3. Ltn. Wiegand mit Ltn. v. Osterroth. Schnelligkeits-Wettbewerb. 1. Ltn. Reuß mit Oberltn. Nordt, Ehrenpreis der „L. N. N.". 2 Ltn. Meyer mit Ltn. Freiherrn v. Werthern. Höhenpreis: 1. Ltn. Bonde mit Lt. Müller, 1900 Meter. Von den Z i vil f 1 i e ge rn erhielten: Frühpreis. Der Preis wird geteilt zwischen Stiploscheck (Jeannin-Stahltaube), Gasser (D F. W.-Doppeldecker), Ingold (Aviatik-D.-D.) und Breton Otto-D.-D.). Dauerpreis. Ingold 5 Std. 22 Min. 58 Sek., Stiploscheck 5 Std. 21 Min. 41 Sek., Breton 3 Std. 31 Min 57 Sek., Gasser 3 Std. 7 Min. 22 SeK., Oelerich (D. F. W.) 2 Std. 55 Min. 25 Sek.. Schwandt 1 Std. 59 Min. 20 Sek. Kürzester Anlauf. Eindecker. 1. Schwandt (Grade) 64 Meter. 2. Stiploscheck 73,5 Meter. — Zweidecker. 1. Ingold 61,5 Meter. 2. Breton 104,4 Meter. 3. Oelerich 121,6 Meter. Kürzester Auslauf. Eindecker. 1. Schwandt 32 Meter. 2. Stiploscheck 114,2 Meter. - Zweidecker. 1. Oelerich 59,5 Meter. 2. Breton 88,8 Meter. 3. Gasser 91 Meter. Die Flugtage in Leipzig.  Patentwesen. Flugzeug mit selbsttätiger Stabilisierung.*) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Flugzeug mit selbsttätiger Stabilisierung durch einen beweglichen Passagiersitz. Bei diesem Flugzeug sind neben den üblichen seitlichen Stabilisierungsflächen mittels eines Universalgelenkes befestigte Flächen angeordnet, die bei seitlicher Neigung des Flugzeuges infolge ihrer Verstellung durch den Passagiersitz nach oben und unten das seitliche Abgleiten erschweren und bei Längsneigungen infolge ihrer Verstellung nach vorn bezw. hinten die Wirkung der Höhensteuerung unterstützen. Auf der Zeichnung ist eine Ausführungsform des Flugapparats schematisch dargestellt, und zwar zeigt: Abb. 1 » 2 n 3 » 4 Pfeilrichtung eine Seitenansicht, eine Vorderansicht, einen Grundriß und einen Schnitt nach der Linie x-x der Abb. 1 mit Ansicht in ; Führersitz, Motor usw, sind in dieser Abbildung fortgelassen. der Abb. 1 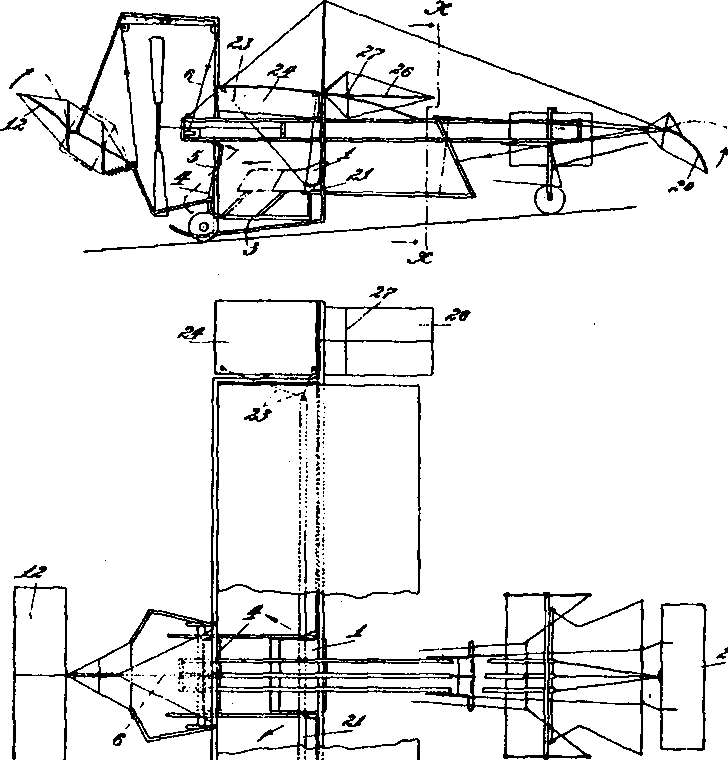 Abb. 3 Der zur Aufnahme von zwei Personen dienende Passagiersitz 1 ist durch einen nach vorn sich erstreckenden Arm 3 gelenkig mit einem bei 5 drehbar im Gestell des Flugzeuges gelagerten Rahmen 4 verbunden, dessen Schwingungen unter Vermittlung eines Seilzuges 6 das vordere Höhensteuer 12 verstellen. In ähnlicher Weise wird durch diese Verschiebung des Passagiersitzes ein hinteres Höhensteuer 20 verstellt. Die Lagerung des Passagiersitzes ist derart, daß er sich auch seitlich ungehindert verschieben kann (s. Pfeile in Abb. 2 und 4). Eine mit dem Passagiersitz 1 verbundene Stange 21 erstreckt sich in der Querrichtung des Apparats bis annähernd unter die Enden der Haupttragfläche 22. An den Enden dieser Stange 21 ist je eine oben in zwei Arme auslaufende Stütze 23 angelenkt, die eine an der Haupttragfläche 22 angelenkte, nach allen Richtungen drehbare Stabilisierungsfläche 24 enthält. An jeder Seite des Passagiersitzes 1 ist ferner ein Seilzug 25 angeschlossen, der zu einer zweiten seitlichen Stabilisierungsfläche 26 führt, die hinter der Fläche 24 angeordnet ist und sich um die Achse 27 dreht. Diebeide'n Flächen 26 stehen wie üblich durch einen nicht gezeichneten Seilzug derart miteinander in Verbindung, daß wenn die eine durch ihren Seilzug 25 angezogen wird, sie die andere Fläche 26 in entgegengesetztem Sinne bewegt. Neigt sich infolge eines seitlichen Luftstoßes das Flugzeug z. B. nach links, so verschiebt sich der Passagiersitz in der Pfeilrichtung (Abb. 2), wodurch *) D. R. P. No. 260557 Max Meister, Zürich (Schweiz). Seite 689 No. 18 die linke Fläche 24 aufwärts, die rechtseitige abwärts gedreht wird; ersteres geschieht auch mit der rechtseitigen hinteren Stabilisierungsfläche 26, die ihrerseits die linksseitige Fläche 26 abwärts zieht. Die Flächen 24 verhindern in diesem Falle also das seitliche Abgleiten. Werden sie dagegen gemeinsam mit 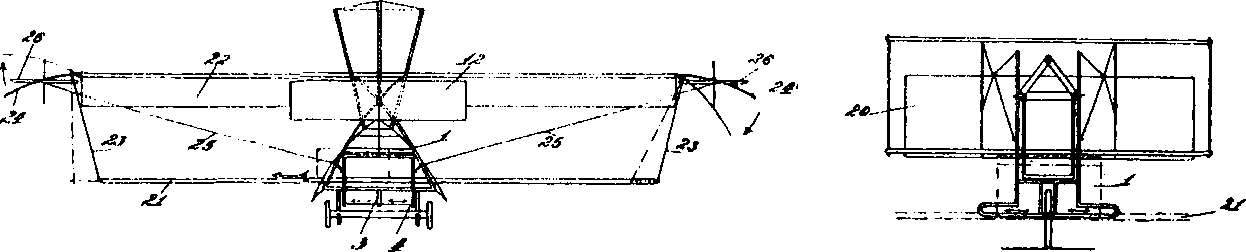 Abb. 2 Abb. 4 dem vorderen und hinteren Höhensteuer verstellt, so unterstützen sie dadurch, daß sie sich schräg zur Flugrichtung stellen, diese Steuer. Die Verschiebung des Passagiersitzes kommt auch dann zur Geltung, wenn sich das Flugzeug, wie in Abb. 3 durch seitlich des ersteren angebrachte Pleile angedeutet ist, schräg zur Längsachse neigt. Da die Flächen 24 nur an einer Stelle, und zwar durch Universalgelenk mit der Haupttragfläche 22 verbunden sind, können sie sich bei einer solchen Sc rägstellung des Flugzeuges in einer zur Längs- und Querachse des letzteren schräg stehenden aufwärts oder abwärts drehen. Patent-Anspruch: Flugzeug mit selbsttätiger Stabilisierung durch einen beweglichen Passagiersitz, dadurch gekennzeichnet, daß neben den üblichen seitlichen Stabilisierungsflächen mittels eines Universalgelenkes befestigte Flächen angeordnet sind, die bei seitlicher Neigung des Flugzeuges infolge ihrer Verstellung durch den Passagiersitz nach oben und unten das seitliche Abglei:en erschweren und bei Längsneigungen infolge ihrer Verstellung durch den Passagiersitz die Wirkung der Höhensteuerung unterstützen. Steuervorrichtung für Flugzeuge und dergl.*) Die Steuerruder der Flugzeuge werden, um die Umstellung derselben zu erleichtern, gewöhnlich so angeordnet, daß die Achse, um welche sich das Ruder dreht, in der Mitte oder etwas vor der Mitte der Ruderfläche liegt. Diese Ruder las sen sich indessen doch unter gewissen Windverhältnissen nur schwer verstellen.' Den Gegenstand der Erfindung bildet nun eine Einrichtung, mittels welcher s'ch die. Steuerruder leichter bewegen lassen. Die Erfindung besteht darin, daß durch irgend eine Uebertragung eine Luftschraube mit verstellbaren Flügeln mit dem Steuerruder gekuppelt wird, welche die Kraft zum Verstellen des Ruders liefert. Die verstellbaren Flügel der Luftschraube werden von der Steuerpinne oder dergl. aus verstellt. Für gewöhnlich stehen dieselben so, daß der Fahrtwind die Luftschraube nicht dreht. Werden die Flügel jedoch umgestellt, so bewirkt der Fahrtwind eine Umdrehung der Luftschraube in der einen oder in der anderen Richtung und dadurch eine entsprechende Verstellung des Steuers. Die Zeichnung stellt eine Ausführungsform der Erfindung dar und zwar zeigt: Abb. 1 eine Seitenansicht und Abb. 2 eine Stirnansicht der Vorrichtung. Die Schraubenflügel 31 sind an den an der Welle 33 angebrachten Armen 32 drehbar befestigt. Wenn der Steuernde den Steuerhebel 34 verstellt, wird diese Bewegung durch die auf der Welle verschiebbare Hülse 36 und das Gestänge 37, 38 auf die Schraubenflügel 31 übertragen. Wenn der Handhebel 34 in die mit II bezeichnete Stellung geführt wird, so werden die Blätter 31 verstellt, und der Winddruck versetzt die Welle 33 in Drehung. Das Seil 40 wird dadurch auf die Welle oder auf eine an derselben befestigte Scheibe einerseits auf- und anderseits abgewickelt und dadurch das Steuerruder 41 umgestellt. Anstatt des Seiles 40 können auch andere Mittel verwendet werden, um das Ruder umzustellen, z. B. Schnecken oder Zahnradgetriebe. *) D. R. P No. 259353 Halvor Gaara in Bö, Telemarken, Norwegen. Das Verhältnis zwischen dem Winkel, um welchen der Handgriff 34 von seiner Mittelstellung aus bewegt wird, und der Anzahl von Umdrehungen der Welle 31, ist zweckmäßig immer das gleiche. Um dies zu erzielen, ist es erforderlich, daß die Schraubenflügel selbsttätig in die unwirksame Stellung zurückgeführt werden, sobald die Welle die betreffende Anzahl von Umdrehungen ausgeführt hat, welche der Verstellung des Handgriffs entspricht. Diese selbsttätige Zurückführung in die Ruhestellung kann, wie das in der Technik bereits bekannt ist, von der Steuervorrichtung selbst bewirke werden, und zwar kann dies in verschiedener Weise geschehen. In Abb. 1 ist eine solche Ausführung durch gestrichelte Linien angedeutet. Das untere Ende 42 des Handhebels 34 ist an dem Seile 40 befestigt. Wenn der Handgriff 34 in die Stellung II gebracht wird, wird die Hülse 36 verstellt und die Welle 35 in Drehung versetzt. Wird II Al.li. I 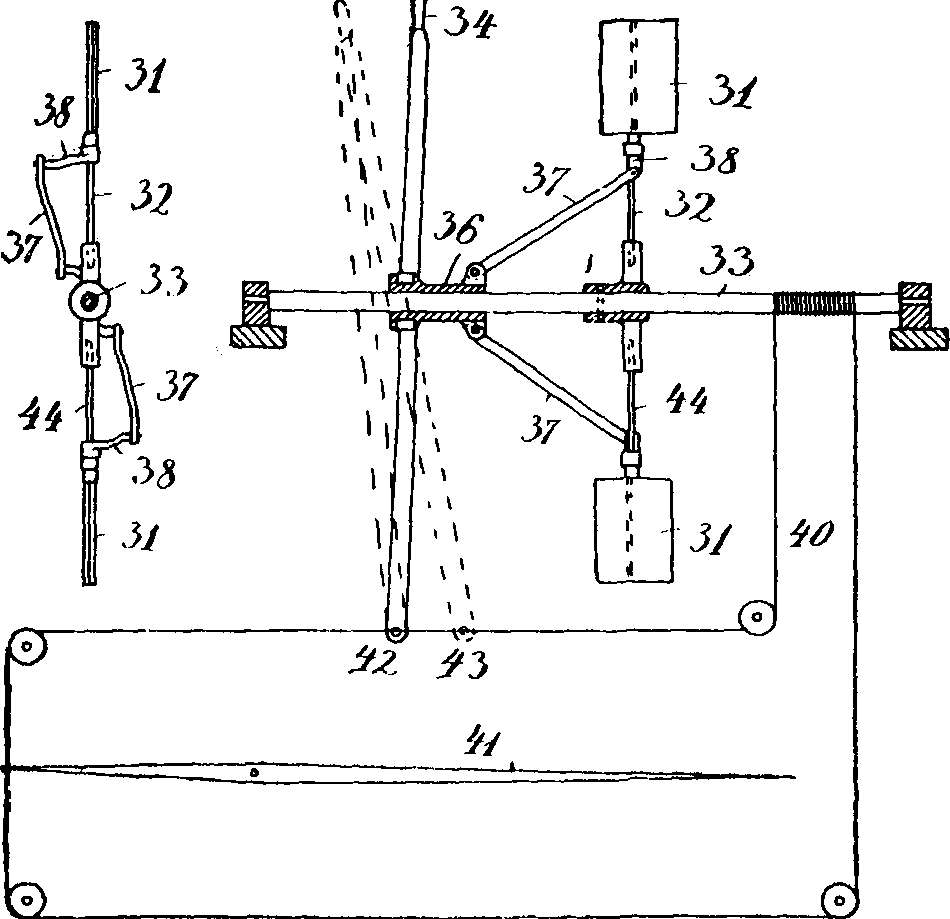 Abb. 2 darauf der Handgriff in der Stellung II festgehalten, so wird das untere Ende des Armes vom Punkte 42 bis zum Punkte 43 verschoben, wodurch die Hülse 36 und damit ebenfalls die Schraubenflügel in die Ruhestellung zurückgeführt werden. Patent-Anspruch. Steuervorrichtung für Flugzeuge und dergl., bei welcher der Fahrtwind zum Verstellen der Steuer benutzt wird, dadurch gekennzeichnet, daß in die Steuerleitung eine mit verstellbaren Flügeln versehene Luftschraube eingeschaltet ist, deren Flügel von dem Steuernden derart verstellt werden können, daß ein Winddruck auf der einen oder anderen Seite derselben entsteht, zum Zwecke, die Luftschraube in der einen oder ider anderen Richtung zur Umstellung des Steuers in Umdrehung zu versetzen. Flugzeugsteuerung mit zwei Steuerhebeln.*) Die neueren Flugzeuge sind meistens mit zwei Steuerungen versehen, so daß sowohl der Führer als sein Begleiter oder Schüler abwechselnd steuern können. Für Kriegs- und Lehrzwecke ist diese Einrichtung sehr zweckmäßig. Sie kann *) D. R. P. No. 260556, Harlan-Werke, G. m. b. H., in Johannisthal b. Berlin. jedoch sehr gefährlich werden, wenn die beiden Steuerungen gleichzeitig und entgegengesetzt bedient werden. Der letztere Umstand hat schon zu schweren Unfällen Anlaß gegeben. In solchen schwierigen Lagen muß der erfahrene Führer imstande sein, die Führung des Flugzeuges augenblicklich allein zu übernehmen, ohne daß ihm von der zweiten Steuerung die geringsten Schwierigkeiten gemacht werden können Durch die Erfindung wird dieses voll und ganz errecht. Die Zeichnung zeigt die neue Anordnung, welche wegen ihres geringen Gewichtes und ihrer Kleinheit jedem Flugzeuge und jeder Steuerung angepaßt werden kann, in Abb. 1 in gekuppeltem und Abb. 2 in entkuppeltem Zustande. Von dem Hauptsteuerhebel laufen die für Höhen-, Seiten- und Quersteuerung bestimmten Drahtzüge 4, 5, 6 o. dgl. um die Rollen a,, b„ c, und von dort zu den Steuern. Diese Rollen stehen, wie Abb. 1 zeigt, wiederum mit je einer Rolle a, b, c in Eingriff, deren Drahtzüge 1, 2, 3 nur zu dem zweiten Steuerhebel führen, Es können daher die Steuer von dem zweiten Steuerhebel aus nur solange bedient Abb. 1 Abb. 2 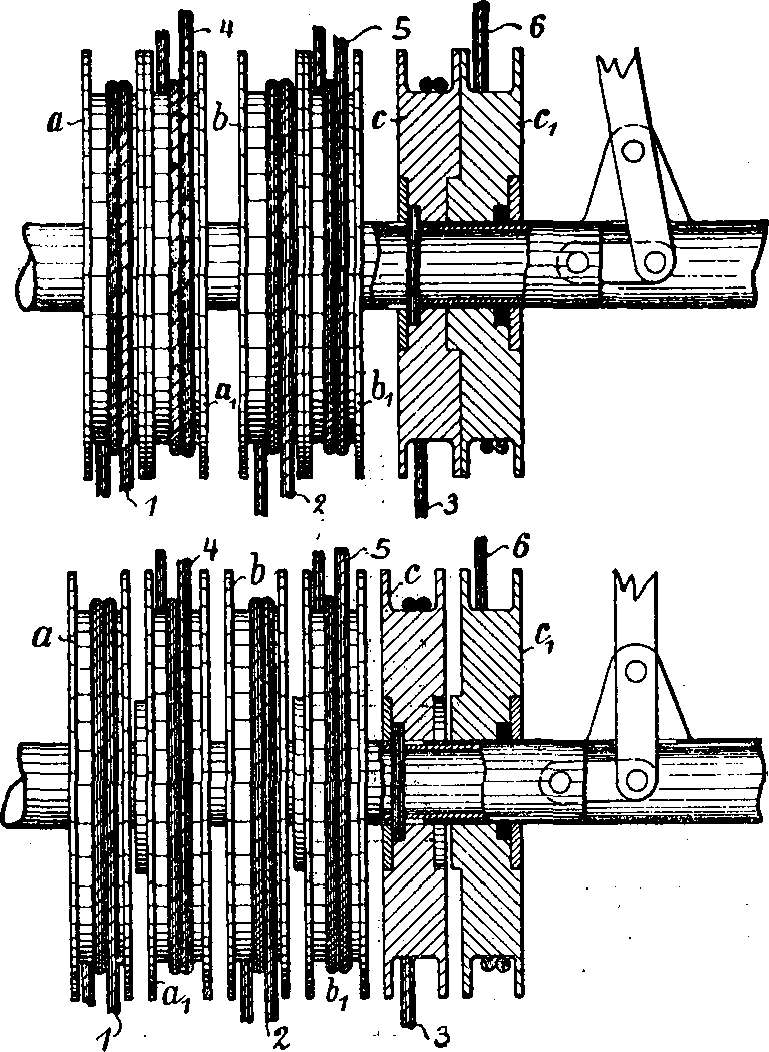 werden, wie die Rollen a mit a,, b mit b, und c mit c, gekuppelt sind. Vermittels einer Hebelvorrichtung o. dergl. ist nun der Führer, wie aus Abb. 1 und 2 leicht ersichtlich, zu jederzeit imstande, die drei Rollenpaare gleichzeitig außer Eingriff zu bringen und so die eine Steuerung vollkommen auszuschalten. Patent-Anspruch: Flugzeugsteuerung mit zwei Steuerhebeln, dadurch gekennzeichnet, daß die die Steuer verstellenden Seile über Rollen laufen, mit denen von dem zweiten Steuerhebel aus drehbare Rollen durch Bewegen eines Hebels gekuppelt oder von denen sie entkuppelt werden können. Verschiedenes. Verschärfung der Bestimmungen für die Ausstellung des internationalen Flngzeugführerzeugnisses Vom 1. Januar 1914 ab tritt an Stelle der bisher vorgeschriebenen Mindesthöhe von 50 Meter eine solche von 100 Meter, ferner muß der Schüler aus dieser Höhe im Gleitflug landen. Deutschland hat noch weiter angeregt, den Nachweis einer bestimmten Zahl von Alleinflügen vor Ausstellung des Patentes zu verlangen, jedoch fand dieser Vorschlag wegen der Umständlichkeit der Kontrolle keine Mehrheit bei der F A. J. 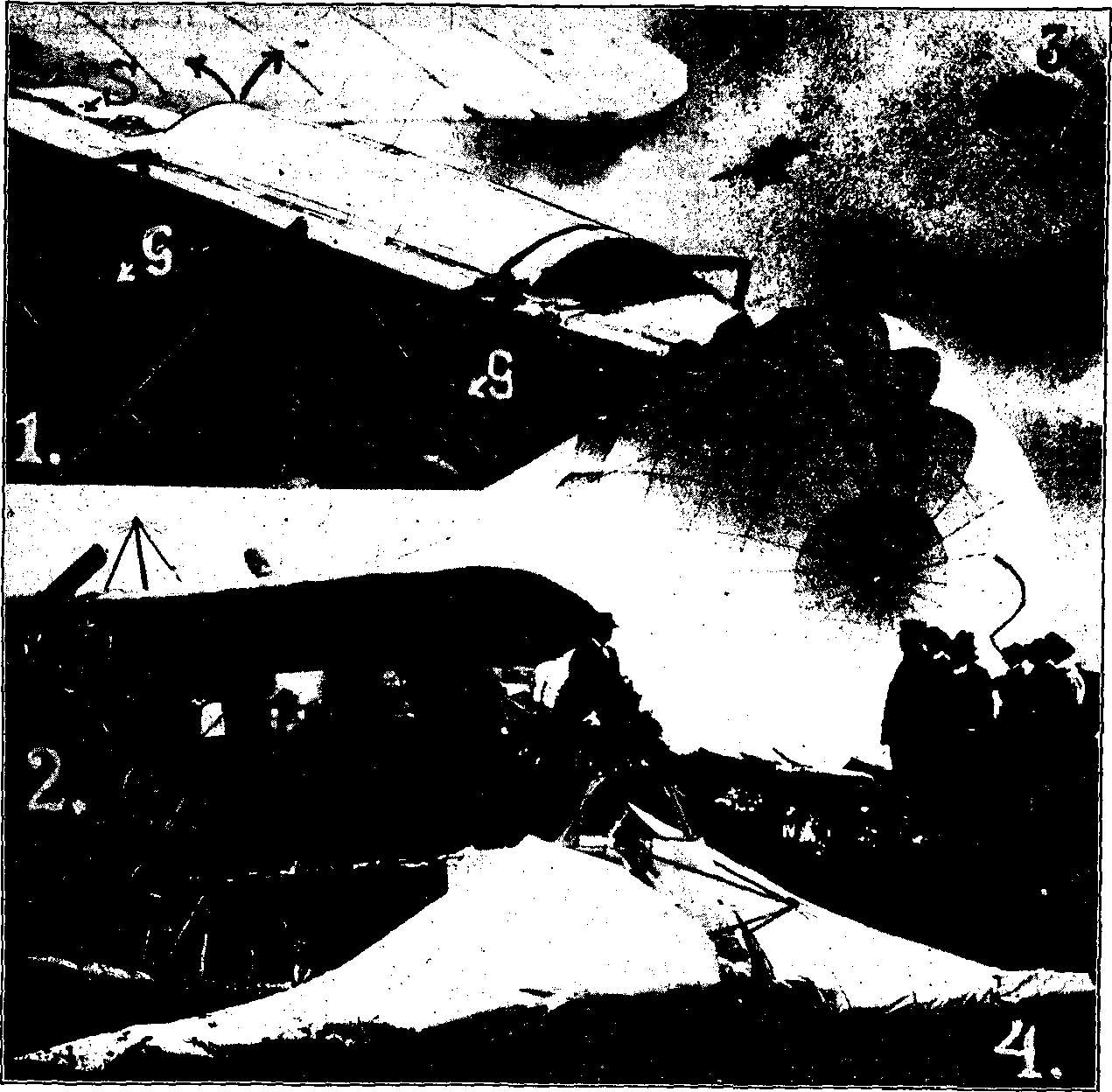 Fallsdiirmversuche aus der Flugmasdiine. 1. Der Fallschirm ist auf den Oberteil des Rumpfes gelegt und wird durch zwei Klappen festgehalten, die beim Auslösen durch die Gummischnure O gezogen, seitlich in der Richtung der Pfeile auseinander klappen. Die Seile S sind am Rücken des Fliegers befestigt. 2 zeigt den Versach einer Auslösung des Fallschirms bei Wind auf der Erde. 3. Der Moment des Absturzes. 4. Der abgestürzte Bleriot-Eindecker. Seite 693 „FLU GS P 0 K TV No. 18 Standorte der Fliegertruppen, Die Fliegertruppen sind eingeteilt wie folgt: Inspektion der Fliegertruppen Berlin, Fliegerbataillon Nr. 1, Stab, l.und 2. Kompagnie Döberitz und Artilleriefliegerstation Jüterbog, 3. Königlich Sächsische Kompagnie Zeithain. Das 1. Fliegerbataillon ist dem Gardekorps zugeteilt. Fliegerbataillon Nr. 2: Stab und 1. Kompagnie Posen, 2. Kompagnie Graudenz, 3 Kompagnie Kö n i g sb e rg i. Pr. Das 2. Fliegerbataillon ist dem 5 Armeekorps zugeteilt. Fliegerbataillon Nr. 3: Stab und 1. Kompagnie Köln, 2. Kompagnie Hannover, 3. Kompagnie Darmstadt. Das 3. Fliegerbataillon ist dem 8. Armeekorps zugeteilt. Fliegerbataillon Nr. 4: Stab und 1. Kompagnie St raß burg i. Eis., 2. Kompagnie Metz, 3. Kompagnie Frei-bürg i. B. Der Sturz des Flugzeugmonteurs bei einem Probefluge ist als Betriebsunfall zu beurteilen. In anerkennender Würdigung des gefahrvollen Berufes, der sich in den Dienst der Luftschiffahrt stellenden Techniker hat jetzt das Reichsversicherungsamt im Anschluß an den tödlichen Sturz des Obermonteur V. anerkannt, daß der Unfall eines Monteurs bei einem Fluge, an dem er zwecks Prüfung des Motors teilgenommen hat, als Betriebsunfall anzusehen sei. Der Entscheidung lag folgender Tatbestand zugrunde: Der bei einer Flugzeug-Gesellschaft angestellt gewesene Obermonteur V., der kurze Zeit vor Beginn seines öffentl. Rundflugs mit dem Flieger Sch. auf einem Flugzeug seiner Gesellschaft aufgestiegen war, hat infolge Absturzes zusammen mit Sch. den Tod gefunden. Die Witwe und ein Kind des V. haben Anspruch auf Hinterbliebenenrente erhoben. Die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik hat die Bewilligung der Rente abgelehnt. Dagegen hat das Schiedsgericht den Hinterbliebenen die begehrte Entschädigung zugesprochen. Den Rekurs der Berufsgenossenschaft, die vor allem geltend macht, der Unfall habe sich bei einer Sportfahrt ereignet, hat das Reichsversicherungsamt zurückgewiesen und zwar aus folgenden Gründen: V. war bei dem Zusammenstellen von Luftfahrzeugen versichert. Diese Tätigkeit beschränkt sich nicht auf die Arbeit in der Werkstatt; die Fahrzeuge müssen, ehe sie ihrem Zwecke dienen können, auch in der Luft auf ihre Brauchbarkeit geprüft werden, und V. mußte sich auch dieser Tätigkeit widmen, da ja die Brauchbarkeit eines Flugzeugs wesentlich vom Motor abhängt, dessen Prüfung dem Monteur zufällt. Dies ergibt auch die Aussage des Direktors G. der Fluggesellschaft, der bezeugt, daß V. den Motor des Flugzeugs, das der Flieger Sch. beim deutschen Rundflug führen wollte, auf seine Betriebsdauer und Leistungsfähigkeit ausprobieren sollte. V. war gerade deshalb dazu bestimmt worden, weil er ein tüchtiger Motorkenner war und kurz vorher das Einbauen einer neuen Zündung in den Motor geleitet und beaufsichtigt hatte. Aus denselben Gründen war er auch dazu ausersehen, Sch. auf dem deutschen Rundflug zu begleiten. V. nahm also ein Betriebsinteresse wahr, als er mit Sch. flog. Der Beweis dafür, daß bei dem unglücklichen Fluge eine rein sportliche Betätigung vorgelegen habe, ist in keiner Weise erbracht worden. Denn selbst wenn anfangs ein Höhenflug von 1600 bis 1700 Meter in Aussicht genommen gewesen wäre, so würde doch damit noch kein Beweis für die nachher getroffenen Vereinbarungen oder Entschließungen und die Beteiligung des V. an diesen erbracht sein. V. hat die Fahrt nicht aus reiner Neigung zum Sport unternommen, sondern vornehmlich im Betriebsinteresse. Mag man auch eine gewisse Sportneigung annehmen, so liegt doch jedenfalls eine gemischte Tätigkeit vor, die verschiedenen Zwecken diente, und der eine von diesen, der auf die Förderung des Betriebs gerichtet ist, gewährt den Versicherungsschutz. Bei dieser Sachlage hätte sich V., selbst wenn die Fahrt schließlich über den von vornherein gesetzten Betriebszweck hinausgegangen sein sollte, noch nicht außerhalb des Betriebes gestellt. Das Flugwesen ist noch in der Entwicklung begriffen; es stellt an den Wagemut der sich ihm widmenden Personen hohe Anforderungen. Will die Flugzeugindustrie zur Vervollkommnung ihrer Fahrzeuge gelangen, so muß sie auch mit dem Wagemut der Flieger und ihrer Begleiter rechnen, und diesem Gesichts-nunkte muß man auf versicherungsrechtlichem Gebiete bei der Begrenzung der Betriebstätigkeit der Flugzeugindustriebetriebe bis zu einem gewissen Grade Rechnung tragen; durch eine so engherzige Begrenzung des Begriffs der Betriebstätigkeit würde man ein wesentliches Betriebsinteresse außer acht lassen. Wo hier die Grenze zu ziehen ist, muß die Prüfung der näheren Umstände des Einzelfalls ergeben. Jedenfalls fehlt im vorliegenden Falle ein Anhalt dafür, daß V. durch Tollkühnheit die Grenzen der dem Versicherungsschutz unterworfenen Tätigkeit in dem Maße überschritten hätte, daß ein Zusammenhang mit seiner Betriebstätigkeit nicht mehr als vorliegend angesehen werden kann, oder daß er dem Flieger Sch. die Zustimmung zu einem derartigen tollkühnen Vorgehen gegeben hätte. Aus diesem Grunde muß angenommen werden, daß im vorliegenden Fall ein Betriebsunfall vorliegt, sodaß der Witwe und dem Kinde des V. die verlangte Hinterbliebenenrente zuerkannt werden muß. (Urteil des Reichsversicherungsamts vom 13. März 1912.) Das Programm der Luftfahrerschule Berlin-Adlershof (Staatl. subventionierte techn. Fachschule, Leitung: Hauptmann Neumann) für Oktober 1913/14 ist erschienen und von der Direktion (Adlershof, Radickestr. 10) kostenlos zu beziehen. Die neuen einjährigen Lehrgänge sowohl in der Luftschiff-, wie in der Flugzeugabteilung beginnen Mitte Oktober. Anmeldungen bis 15. September. Die mit allen neuzeitlichen technischen Erfordernissen (Werkzeugmaschinen mit elektrischem Einzelantrieb) eingerichtete Lehrwerkstätte für Flugzeugbau, Motorenbetrieb, Holz- und Metallbearbeitung, autogene Schweißung ist in Betrieb genommen. Der Lehrkörper weist wie bisher die besten Namen auf und hat sich durch Hinzutreten der Herren Dipl.-Jng. Dorner, Dr. Hermann Elias und Jng. Gabriel noch weiter vergrößert. Die theoretisch-wissenschaftliche und die praktische Ausbildung gehen in beiden Abteilungen Hand in Hand und bezwecken die Ausbildung von technischen Büro- und Betriebsbeamten für die Luftfahrzeug-Industrie und -Betriebsunterr.ehmungen, für verwandte Industriezweige und für sonstige Stellungen im Betriebs- und Stationsdienst der Luftfahrzeuge, sowie die Vorbildung technischen Bedienungs- bezw. Führerpersonals für Luftschiffe und Flugzeuge. Junge militärtaugliche Leute, die in der Luftschiffer- oder Fliegertruppe zu dienen sich verpflichten, erhalten besondere Vergünstigungen. Ausbildung zum Piloten im fliegenden Flugzeug erfolgt nicht. Die Luftfahrerschule genießt lebhafte Förderung u. a. durch das Reichsamt -des Innern und die Kgl. Preuß. Ministerien des Handels, des Krieges und der öffentlichen Arbeiten, Behörden, die auch im Kuratorium vertreten sind. Alles in allem hat die vom Deutschen Luftflotten-Verein 1909 gegründete Anstalt eine sehr erfreuliche und schnelle Entwicklung genommen und aer Industrie und dem Heere bereits eine große Anzahl bestens bewährter junger Leute zugeführt. Erfolgreiche Versuche mit dem Ponnet-Fallschirm zur Rettung aus der Flugmaschine. Ponnet in Paris hat einen Fallschirm konstruiert, welcher auf dem oberen Teil des Rumpfes der Flugmaschine in einem aufklappbaren Futteral untergebracht wird. Die Seile des Fallschirms führen nach dem Rücken des Führers. Im gegebenen Moment klappt das Futteral (s. die Abbildung) auf, und der Schirm wird durch einen besonderen Mechanismus entfaltet. Der Flieger soll aus der Maschine gehoben und langsam zur Erde gleiten können. Dieses Experiment wurde vor einigen Tagen durch den Bleriot-Flieger Pegoud bei ziemlich windigem Wetter ausgeführt. Pegoud stieg bis zu einer Höhe von 300 m, entfaltete dann den mitgenommenen Fallschirm, der eine Oberfläche von angeblich 70 Quadratmetern hat, überließ einfach seine Flugmaschine sich selbst und hängte sich an den Fallschirm. Die Flugmaschine machte allerlei Wendungen, stieg etwas, und sank dann zur Erde. Beide Apparate fielen ungefähr zur gleichen Zeit. Der Fallschirm geriet zuerst an einen Baum, aber Pegoud konnte sich an demselben ohne Mühe festhalten. Seine Flugmaschine wurde nur an ihrem Vorderteil beschädigt. Beängstigend war es, als sich die Seide des Fallschirmes schon blähte, während Pegoud sein Flugzeug noch nicht verlassen hatte, denn die Gefahr war groß, daß der Vorderteil des Flugzeuges sich in den Fallschirm verwickeln könnte. Es ist wohl kaum anzunehmen, daß ein derartiger Fallschirm ein geeignetes Mittel ist, um den Flugmaschinenunfällen zu begegnen. Die meisten Flugunfälle ereignen sich in der Nähe der Erde. In diesem Falle wird sich der Fallschirm nicht mehr entfalten und den Unfall nicht vermeiden können. Berichtigung. Im „Flugsport Nr. 17 Seite 624 und 625 sind die Unterschriften unter den Abbildungen verwechselt worden. Es muß auf Seite 624 heißen: „Fliegendes Boot von Leveque" und auf Seite 625: „Aeroyacht Borel, Typ Denhaut". 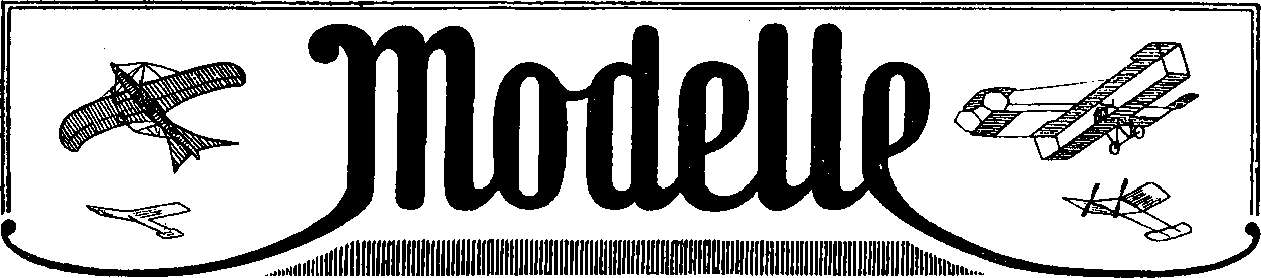 Spannleiste mit Doppelschrauben-Antrieb. Zur Ausführung von Rennmodellen, bei denen es besonders auf geringes Gewicht, geringen Luftwiderstand und große Motorstärke ankommt, kann ri an die in beistehender Abbildung ersichtliche Spannleiste mit Erfolg anwenden. Bei derselben kommt ein Zweischraubensystem zur Anwendung. Oberhalb und 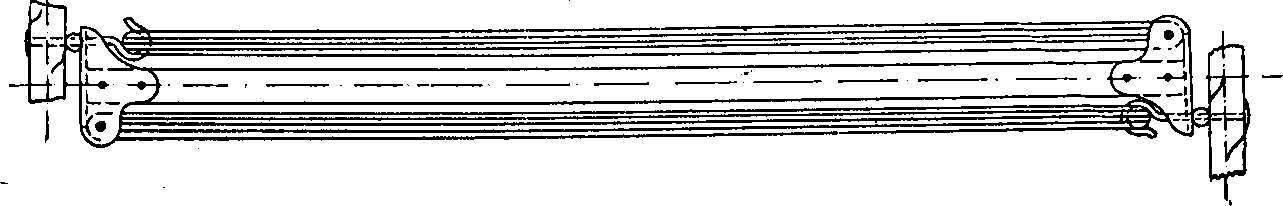 Spannleiste mit Doppelschrauben-Antrieb unterhalb der etwa 1 Meter langen Leiste befinden sich die beiden Gnmmiantriebe, von denen der eine eine Zugschraube, der andere eine Druckschraube antreibt. Zur Befestigung des Schraubenlagers und der Gummistränge dient ein U-förmig um das Stabende gelegtes Blech, das mit demselben zweimal vernietet ist. Da sich die Spannungen der Gummistränge einander aufheben, ist in vertikaler Richtung eine Durchbiegung der Leiste ausgeschlossen Es ist daher nur erforderlich, dieselbe in der horizontalen Ebene zu verstärken, wodurch auch ein Durchknicken nach dieser Richtung hin vermieden wird. Die Gewichtsverminderung bezüglich des V-förmig angeordneten Doppelgummiantriebes beträgt ca. 60"/0. Zur Aufhebung des Drehmomentes muß die eine Luftschraube rechtsläufig, die andere linksläufig aufgezogen werden. Flugzeugmodellausstellung. Auf dem Flugplatz Gelsenkirchen-Essen-Rotthausen findet vom 21 -28. Sept. ds. Jahres eine FluKzeugmodell-Ausstellung statt, die erste ihrer Art im Rhein.-Westf. Industriebezirk. Es sollen in der Hauptsache selbslgefertigte Modelle von Jünglingen und Schulern auch von Erwachsenen gezeigt werden, um das Interesse für den Modellsport und damit für das gesamte Flugwesen zu heben. Außerdem sind Flugzeugmodellfabriken zur Ausstellung von fertigen Modellen, Modellniotoren, Einzel- und Zubehörteilen zugelassen. Eine weitere Abteilung der Ausstellueg umfaßt die gesamte einschlägige Literatur über das Flugwesen, Bilder, Pläne und Zeichnungen, Flugzeuge und Flugplätze betreffend, u. a. m. In Anschlüsse an die Ausstellung sind für Sonntag den 28. September große M o d e 11 f lugwe 11 b e w e r b e vorgesehen, für die einejAnzahl von Ehrenpreisen und größere Geldpreise zur Verfügung stehen. Frankfurter Flugmodell-Verein. Die Ausscheidungsprüfung für das Darmstädter Modelitliegen findet Sonntag den 7. September in Darmstadt statt. Unsere Mitglieder, die sich daran beteiligen, bekommen die Eisenbahnfahrt III. Klasse von den Veranstaltern vergütet Alles Nähere auf der Monatsversammlung am 4. ds. Mts. und müssen bis dahin auch die Anmeldungen mitgebracht werden.  Jllustrirte No 19 technische Zeitschrift und Anzeiger «„„1.».ℜ,.: 17. September für das gesamte isla. jahm. u. „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef. 4557 Amt l. Oskar Ursinus, Civilingrenieur. Tel.-fldr.-. Urslnus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 1. Oktober. Internationaler Luftverkehr. In den letzten Tagen hat man von den Fliegern verhältnismäßig, wenig gehört. Im Stillen rüsten sie sich für die großen Fernflüge. Es sind in der Zeit vom 15. September bis 31. Oktober 300000 Mark aus der Nationalflugspende zu gewinnen. Die Tagesleistung muß mindestens 1000 km betragen, wovon mindestens 500 km in einer Richtung zurückzulegen sind. Außer den großen Preisen für die weitesten Flüge ist ein Nationalpreis von 100000 Mark für denjenigen Flieger reserviert, welcher den Weltrekord in der Distanz schlägt. (S. die Ausschreibungen in Flugsport Nr. 17 Seite 531 ff.) Zwei Flieger haben bereits große Fernflüge ausgeführt. Friedrich sitzt in London und sucht nach weiteren Strecken. Reichelt ist dieser Tage von Paris zurück nach Deutschland gestartet. Die Flieger, welche in Frankreich in der Richtung auf Rußland abfliegen, haben die meisten Chancen, da die Winde in dieser Richtung vorherrschen. Um diese Chancen ausnutzen zu können, empfiehlt es sich, sich irgend wo in Frankreich festzusetzen. Diejenigen Flieger, die in Paris abfliegen, müssen schon nach Rußland hinein Eine andere vorzügliche Flugstrecke ist die von Bordeaux nach Insterburg, ca. 2000 km. Wer schon in Frankreich geflogen ist, wird bestätigt finden, daß dortselbst die Verhältnisse günstiger sind als in Rußland. Es ist schade, daß diese Fernflugstrecken nicht organisiert sind. Den Fliegern würden durch Schaffung von geeigneten Flugstationen die Fernflüge außerordentlich erleichtert. Die vorhandenen Orientierungsmitte], Karten etc., wie sie die Flieger zum großen Teil besitzen sind recht mangelhaft. So flog ein Flieger vor einiger Zeil, nach einer gewöhnlichen Eisenbahnkarte, die er einem Kursbuch entnommen hatte. Es wäre wirklich an der Zeit, eine Fernflugroute, und zwar die meistbeuützte in der oben angedeuteten Richtung, auszuarbeiten Die Zeit der ersten Flugstraße wird nicht mehr fern sein. Für das Flugzeug ist in dieser Hinsicht noch gar nichts geschehen. Finden internationalen Verkehr ist diese Frage von größter Bedeutung. Die ausländischen Flieger wissen dann, daß sie die genaue Route genommen haben und geraten weniger in Gefahr, verbotene Zonen zu überfliegen und sich dadurch Unannehmlichkeiten auszusetzen. Friedrich auf Etrich Mercedes Taube Berlin—Paris—London. Friedrich auf Etrich-Taube mit 100 PS Mercedes - Motor mit Dr. Elias als Fluggast verließ am 5. Sept. 5: 26 vormittags das Flugfeld Johannisthal. Bereits 7 : 55 landete Friedrich in Hannover, um Benzin und Oel einzunehmen. Um 9 : 16 stieg er wieder auf und erreichte 11 : 30 Gelsenkirchen. Auf dieser Strecke mußten die Flieger dauernd in 500 m Höhe in dichtem Nebel nach dem Kompaß fliegen. Um 1: 3 starteten die Flieger zum Fluge nach Brüssel. Sie erreichten das Flugfeld Berchem-Saint-Agathe 3 : 26. Nach kurzem Aufenthalt startete Friedrich wiederholt, um möglichst nahe an Paris heranzukommen. Sie passierten bei stürmischem Wetter Möns und mußten, um sich zu orientieren, bei Bruay im Departement Nord niedergehen. Es regnete in Strömen. Der Weiterflug mußte daher auf den nächsten Tag verschoben werden. Trotz des dichten Nebels und Rögens flog Friedrich mit Dr. Elias am nächsten Tage um 1 Uhr mittags weiter. Um sich zu orientieren, mußten sie \>e>i Guise und dann nochmals gegen 4 Uhr bei Senlis Landungen vornehmen. Hier bewährten sich die neugeschaffenen Ausweise, welche nach einem Uebereinkommen zwischen Deutschland und Frankreich eingeführt wurden, vorzüglich, so daß man die Flieger unbehelligt weiter ziehen ließ. Endlich erreichten sie Paris, das sie in einer Höhe von ca. 200 m in dichten Nebelschwaden überflogen. Die Landung erfolgte im Gleitfluge in Villacoublay, wo gerade ein Wohltätigkeitsschaufliegen stattfand. Die französischen Flieger bereiteten den deutschen Kollegen einen warmen Empfang. Von den Vertretern der dortigen Gemeinde wurden sie mit einem Ehrentrunk begrüßt. Am 8. Sept. flog Friedrich mit seinem Konstrukteur Etrich als Fluggast, begleitet von mehreren franzö sischen Fliegern, von Villacoublay nach Issy-les-Moulineaux, dem bekar nten Flugplatz bei Paris, wo er im Gleitfluge landete. In den nächs ten Tagen zeigte sich Friedrich durch mehrere Flüge über Paris und umkreiste einmal den Eiffelturm. Am 13. Sept. vormittags 11 : 40 startete Friedrich mit Etrich als Fluggast zu einem Flug nach London. Um 1:15 erreichten die Flieger Calais, wo sie landeten, um sich für die Ueberfliegung des Kanals näher zu informieren. Nach Einnahme von einer Stärkung und nochmaliger Revision der Maschine sollte eben der Start beginnen, als ein Abgesandter des Bürgermeisters erschien, und Ausweis-scheine forderte. Trotzdem die Flieger, gemäß der mit Frankreich getroffenen Vereinbarungen, alle nötigen Ausweispapiere besaßen, verloren sie dadurch 2 Stunden. Um 4 :10 erfolgte der Start zum Ueber-  Alfred Friedrich flog auf Eiridi-Taube mit 6 Zyl. Mercedes-Motor von Berlin nach Paris und London. fliegen des Kanals. Die Flugzeit bis zu dem Moment als die Flieger England unter sich sahen, betrug 23 Minuten. In schnellem Fluge ging es gegen London, wo sie 5 : 26 auf dem Flugplatz Hendon bei London landeten. Reichelt auf Harlan-Argus, Berlin—Paris. Reinheit flog Sonntag, den 7. Sept., mittags 1 Uhr 30 Min. auf Harlan 100 PS Argus - Eindecker mit seinem Neffen Hähnel als Gast von Berlin ab, war 5 Uhr 45 Min. nachmittags in Wanne, flog anderen Tags morgens um 7 Uhr weiter über Brüssel nach Paris—Creteil wo er um 12 Uhr 14 Min. glatt landete. Da Reichelt sich aber auch gleich um die Rente der National-Flugspende für größte Entfernung bewerben wollte, startete er bereits nach 16 Min. wieder und flog um 12 Uhr 30 Min. von Paris ab, um schon 1 Uhr 23 Min. in Pontault bei Varize, 150 km südwestlich von Paris, zu landen, wo Reichelt von Gendarmen angehalten wurde und dann am nächsten Morgen nach dem Flugfelde Villacoublay weiterflog, wo er seinen Flug beendete. Reichelt hat eine bewundernswerte Zähigkeit. Ist er doch einer der Aeltesten. Man denke an die Zeit während der ILA, wo er den Gleitflughügel herunterrutschte. Ueber seinen Flug Wanne —Paris gab er folgende Schilderung; „Wir hatten in Wanne für sieben Stunden Benzin und Oel mitgenommen. Außerdem hatten wir zahlreiche Kleidungsstücke usw. an Bord, sodaß die Maschine sehr stark belastet war und wir uns nur langsam in die Höhe erheben konnten. Im Ruhrgebiet hatten wir mit heftigen Böen zu kämpfen, die uns oft bis auf 20 Meter herunterdrückten und bisweilen die Maschine so stark aus dem Kurs brachten, daß wir im Kreise flogen. Auch in Belgien wurden wir über den Ardennen immer wieder gegen die Erde gedrückt, sodaß jeden Augenblick die Gefahr bestand, in Baumwipfel oder dergleichen hineinzufahren. Mein Kompaß funktionierte zeitweise so schlecht, daß er eine gerade entgegengesetzte Richtung anzeigte. Ich nehme an, daß dies daiauf zurückzuführen ist, daß wir über zahlreiche Eisenwerke und -Lager geflogen sind. Sobald wir nach Frankreich hineingeflogen waren, ging es besser. Ohne Zwischenfall erreichten wir nach etwa fünfstündigem Flug Paris, das wir in der Ferne liegen sahen. Da ich aber den Flug noch weiter ausdehnen wollte, setzten wir die Reise in westlicher Richtung fort." Reichelt hat insgesamt 1200 km, hiervon über 1000 km in geradem Luftwege durchflogen und somit richtig wieder die Rente der National-Flugspende für größte Entfernung gewonnen. Reichelt hat erst vor ganz kurzer Zeit durch seinen Flug Kiel—Berlin—Posen in etwas über 3 Stunden Mk. 4600.— aus der National - Flugspende gewonnen. Bei seinem jetzigen Flug Berlin—Paris errang er sich ebenfalls mehrere Preise, und zwar durch den Flug Berlin — Wanne, den er in 4 Stunden 15 Min. zurücklegte Mk. 1500. -- und durch den Weiterflug von Wanne über Brüssel nach Paris-Oreteil den er in 5 Stunden 14 Min. absolvierte, weitere Mk. 1500.—. Die Flugzeuge im Kaisermanöver 1913. Die Kaisermanöver sind beendet Die Bedeutung der Flugzeuge in den Manövern ist durch die ausgezeichneten Erfolge endlich erkannt. Die teilnehmenden 36 Flugzeuge bestanden zur Hälfte aus Eindeckern: Albatros, Jeannin, Rumpier und zur anderen Hälfte aus Doppeldeckern : Albatros, Aviatik und L V. G. Die je 18 Flugzeuge gemischten Systems (Ein- und Doppeldecker) bestanden aus drei Abteilungen Die Abteilung des V. Armeekorps, die blaue Partei, stand unter dem Kommando der Hauptleute Geerdtz, Grad e und Goebel, die der roten Partei, VI. Armeekorps, unter dem Kommando der Hauptleute Wagenführ, von Poser und von Oertzen. Zur Verwendung gelangten lediglich Argus- und Mercedes-Motoren. Die Aufgaben wurden von den Flieger-Offizieren in geradezu hervorragender Weise erledigt. Die Kaisermanöver haben gezeigt, daß das Flugzeug keine Schönwetter-Maschine mehr ist. Vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein sah man die Maschinen über den Stellungen umherschwirren. Die Mannschaften wurden durch das Erscheinen der Flugzeuge ganz erheblich beschäftigt, galt es doch, sich vor diesen in allen möglichen Stellungen zu verbergen, was nur in No- 19 _^FL_UGSPOET.''_Seite 700 den seltensten Fällen gelang. Die staunenden, neugierigen, weißen Gesichter machten, wenn auch der Körper langgestreckt auf dem Boden lag, den Fliegern die Aufgaben manchmal sehr leicht. Im Ernstfalle wird es nicht anders sein. 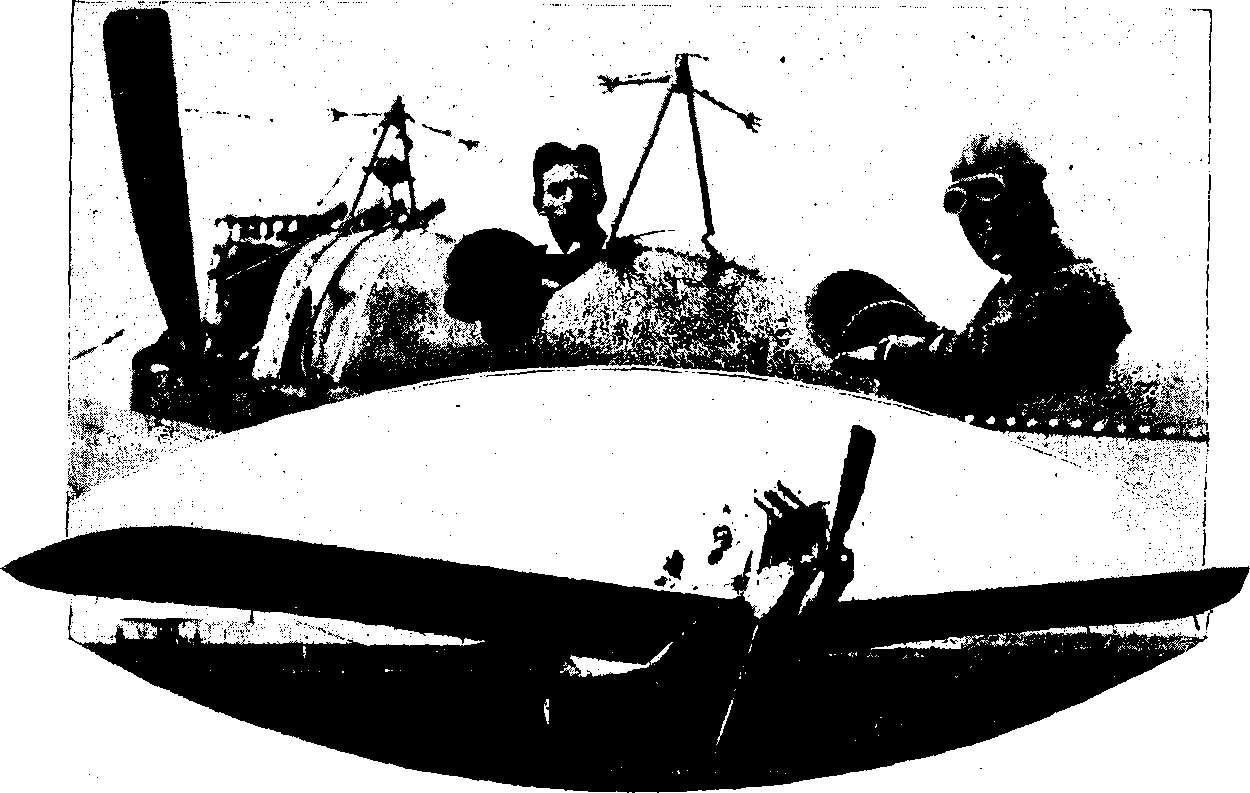 Fernflug Berlin—Paris. Reidielt mit tiähnel als Flaggast auf Harlan-Eindecker mit 100PS Argus-Motor. Sehr gut bewährten sich die L. V. G.-Doppeldecker. Lt. Carganico stieg mit voller Belastung am ersten Manövertage in 27 x/s Minuten auf 2000 m Höhe. Die Erkundungsaufgabe wurde in glänzender Weise gelöst. Hervorzuheben ist, daß Unfälle, abgesehen von einigem Kleinholz, verursacht durch das wenig nachsichtige Publikum, nicht zu verzeichnen sind. Unsere Militärs können mit den Erfolgen des Flugzeugs zufrieden sein. Es ist hier nicht der Ort, über die Einzelheiten zu berichten. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Die an anderer Stelle besprochenen eigenartigen Vorgänge innerhalb des hiesigen Flugwesens nehmen naturgemäß die ganze Aufmerksamkeit aller beteiligten Kreise für sich in Anspruch und es hat den Anschein, als ob die latente Krisis im Aero-Club de France nicht ohne einschneidende Folgen auf die ganze zukünftige Gestaltung der Dinge bleiben werde. Nur ein Ereignis vermochte die Franzosen auf einen Augenblick von jenen Vorgängen abzulenken und ihnen ein unverhohlenes Erstaunen zu entlocken: es war das der Flug zweier deutscher Flieger von Berlin nach Paris, der hier ungefähr die Wirkung ausgeübt hat, als ob der Blitz in die Seite 701 „FLUGSPORT." Hammel heerde schlägt. Noch vor wenigen Tagen konnte ein hiesiges vielgelesenes Blatt den Berliner Rundflug mit der höhnischen Bemerkung abspeisen, daß „die deutschen Flieger sich mit einem kleinen, nichtssagenden Rundflug um Berlin amüsieren, der gegenüber den Weittlügen der Franzosen nichts als ein harmloses Karoussel-Spiel sei" und daß trotz wiederholter Ankündigungen „noch kein Deutscher den Mut gehabt habe, den Flug von Berlin nach Paris zu wagen." Nun haben gleich zwei deutsche Flieger auf einmal dieses von den Franzosen begehrte Wagnis unternommen und ihr Erfolg ist hier den Leuten stark in die Beine gefahren. Es muß anerkannt werden, daß beide Flieger, Friedrich und Reichelt, hier eine recht sympatische Aufnahme gefunden haben, wenngleich sie auch nicht „im Triumph über die Flugbahn getragen" und auch nicht in feierlichen Banketts und mit schwulstigen Ansprachen „gefeiert" worden sind. Als Friedrich, der eigentlich in Issy landen wollte, infolge des Nebels nach Villacoublay geriet, fand dort gerade ein vom Gemeinderat organisiertes Flugfest statt. Die anwesenden Zuschauer bereiteten dem deutschen Flieger und seinem Begleiter, wohl mehr aus einem gewissen sportlichen Empfinden heraus, einen sympatischen Empfang, für den Friedrich durch einige Bahnrunden quittierte. Als dann Friedrich am Donnerstag sich von Villacoublay nach Issy begab, flog er über Paris hinweg und die Zeitungen brachten in spaltenlangen Ergüssen die sensationelle Nachricht, daß ein deutscher Flieger über Paris dahingeflogen sei, wobei sie natürlich nicht unterließen, hervorzuheben, daß dies das erste Mal sei, daß dies passiert, während die Franzosen seit langem schon den Flug nach Berlin als einen „Spaziergang" ansehen. Auch Reichelt und sein Begleiter fanden einen guten Empfang und namentlich die Behörden waren den deutschen Fliegern gegenüber, die freilich alle durch das neue deutsch-französische Abkommen verlangten Bedingungen gewissenhaft erfüllt hatten, zuvorkommend. Eine große Anzahl Interessenten hatte sich nach Issy begeben, um dort die „Taube" fliegen zu sehen. Durch Vermittlung von Audemars, der in verwandtschaftlichen Beziehungen zum Ministerpräsidenten Barthou steht, hatte Etrich, der inzwischen hier eingetroffen war, in der Tat die Erlaubnis zum Fliegen erhalten: Issy ist in der Tat Militärterrain und nachdem Friedrich dort gelandet war, bedurfte es zahlloser Formalitäten, ehe er autorisiert wurde, wieder abzufliegen. Uebrigens haben sich mehrere französische Flieger, wie Audemars, Guillaux, Letort, durch „witzige" Inschriften auf den Flügeln des im Park von Clement-Bayard untergebrachten Flugzeugs verewigt. Man liest da: „Grüße Deinen Kaiser von mir" oder „Ein Gruß Frankreichs an die Annektierten". Man weiß nicht, was man mehr bewundern soll: die Geschmacklosigkeit dieser Leute oder die Gutmütigkeit Friedrichs, der sich das gefallen ließ..... Viel Interesse erregt hier Fourny's Dauerflug um den Michelin-Pokal mit dem er, wie schon in voriger Nummer berichtet, den von Cav9lier aufgestellten Rekord von 7096 km zu schlagen unternommen hat. Der ausdauernde Farmanflieger, welcher einen Zweidecker Maurice Farman, Motor Renault, steuert und die gleiche Rundstrecke (Etampes— Gidy) gewählt hat, auf der Cavelier seine täglichen Runden vollbracht hat, legte seit dem 25. August täglich sieben oder acht Runden zurück und hat bis einschließlich 12. September 13560,800 km hinter sich gebracht! Und er kreist immer noch. Wie es heißt, will er die 20000 km zu erreichen suchen. Dagegen hat die am vergangenen Sonnabend begonnene letzte Bewerbsperiode um den Luftzielscheiben-Preis Michelin keine besonders nennenswerten Resultate gebracht. Es beteiligten sich daran die Hauptleute Leclerc, Sazerac de Forge, Leutnants Dieter-  Die Flugzeuge im- Kaiser-Manöver 1913. S. M. beobachtet die aufklärenden Flugzeuge. len, Varcin, Lussigny, sowie die Flieger Desmoulins, Derome, Marquis de Lareinty-Tholozan, Coursan und Chemel. Bekanntlich handelt es sich bei diesen Versuchen darum, aus 200 m Höhe 15 sphärisch geformte Bomben von 15 cm Durchmesser und und je 7,100 kg Gewicht in einen auf der Erde vorgezeichneten Zielkreis von 20 m Durchmesser zu lancieren. Die Versuche hatten auf den Flugfeldern von Nancy, Chalons, Chartres, Buc, Croix-d'Hins, Pau, La Vidamee und Etampes stattgefunden. Eigentümlicherweise wird jetzt bekannt, daß die bisherige An- nähme, daß Brindejonc des Moulinais mit seinem bekannten Fluge von Paris über Berlin nach Warschau die Anwartschaft auf den Pomraery-Pokal erlangt habe, eine irrige war. Der geographische Dienst der französischen Armee, dem die Flugleistungen um diese Trophäe zur Homo-logierung übergeben worden waren, hat nunmehr die Erklärung abgegeben, daß die von Brindejonc des Moulinais zurückgelegte Entfernung nur 1382,600 km betrage, während die von Guillaux vollbrachte Distanz Biarritz-Brackel (bei Hamburg) ein Ausmaß von 1386,700 km habe, sodaß also Guillaux offiziell als gegenwärtiger Anwärter auf die Trophäe zu gelten hat, für die übrigens jetzt auch noch Helen, Ohemel und de Marnier starten zu wollen scheinen, während Gilbert die Absicht kundgegeben hat, auf der Strecke VÜlacoublay-Bordeaux und zurück um das Kriterium des Aero-Clubs sich zu bewerben. Qebrigens hat dieser Tage der Ministerpräsident Barthou in Begleitung seines Kabinettchefs das Flugfeld von Moräne in Villacoublay besucht und dort sämtliche Einrichtungen auf das eingehendste besichtigt. Santos Dumont führte ihm gleichzeitig seine neueste Erfindung vor, ein kleines, von einem Automobil zu steuerndes Flieger-Lehrgestell, auf welchem der Flugschüler sich in allen bei der Steuerung eines Flugzeugs erforderlichen Bewegungen trainieren kann. Beim Abschied meinte der Ministerpräsident: „Ich sehe, daß man hier arbeitet und zwar an einem Werk, das wir mit allen Kräften zu fördern entschlossen sind." Das von Pegoud ausgeführte Purzelbaum-Experiment, von dem an anderer Stelle eingehend die Rede ist, ist in den Zeitungen viel besprochen., worden. Wie es heißt, soll Lt. Nesterow in Rußland, der ein ähnliches Experiment auf dem Flugplatz zu Kiew vorgenommen hat, sich sogar mehrere Male in der Luft überschlagen haben. Zwar weniger akrobatenhaft, aber unendlich praktischer und bedeutungsvoller ist die Tätigkeit, welche das französische Militärflugwesen in den jetzigen Manövern entfaltet. Es herrscht in zuständigen Kreisen nur eine Stimme darüber: das Flugwesen leistet geradezu ausgezeichnetes; namentlich tun sich die Geschwader von Beifort, Etampes und Lyon hervor. Auch bei schlechtestem Wetter haben die Flieger nicht nur die ihnen zugewiesenen Standplätze rechtzeitig zu erreichen vermocht, sondern auch wahrhaft bewundernswerte Leistungen an Aufklärung und Beobachtung vollbracht. Bei einer großen Flugzeug-Parade, welche der General Pau über die seiner Armee zugeteilten Geschwader abgehalten hat, kargte er mit dem Lobe für die Flieger nicht. Uebrigens ist aus den Manövern ein interessanter Vorgang, ein Kampf von Flugmaschine gegen Lenkballon zu berichten. Der der Armee des Generals Ohomer zugeteilte Lenkballon „Adjutant Vincenot" kam am letzten Donnerstag in die von der Nordarmee besetzte Gegend, um zu rekognoszieren, und überflog die Stadt Agen. Sofort wurde ein Flugzeug, von dem Unteroffizier d'Auteroche gesteuert, zu seiner Vertreibung ausgesandt. Es war dies ein Flugzeug vom Geschwader Epinal. D'Auteroche erhob sich vom Flugplatz in Agen und vermochte mehrere Male den Lenkballon zu überfliegen und zahlreiche fiktive Bomben auf ihn herabzuwerfen. Der Schiedsrichter entschied, daß im Ernstfalle der Lenkballon durch das Flugzeug vernichtet worden wäre und der „Adjutant Vincenot" wurde aus dem Manöver zurückgezogen. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß der von der Generalinspektion des Militärflugwesens zurücktretende General Hirschauer zum Kommandeur der Ehrenlegion ernannt worden ist. Vorher hat er noch eine bedeutungsvolle Entscheidung getroffen: auf seine Veranlassung hat der Kriegsminister den Flugzeugkonstrukteuren die Mitteilung zugehen lassen, daß vom 1. Oktober 1914 ab die Ausbildung von Militärfliegern nur auf Militärflugplätzen erfolgen soll, worüber die Konstrukteure natürlich nicht erfreut sind. Auch mit dem Marine-Flugwesen soll es nun schneller vorangehen. Der Kreuzer „Foudre" ist nach seiner Umgestaltung als Manöverschiff des Marineflugwesens in den Hafen von Toulon zurückgekehrt, wohin auch drei Torpedoboote aus Rochefort und zwei Automobilvedetten, die dem Flugwesen zugeteilt worden sind, gekommen sind. Die Marine wird die beiden besten Apparate aus dem Meeting von Deauville erwerben und ein neuer Schuppen von 60 Meter Länge und 20 Meter Breite wird noch vor Ende dieses Jahres errichtet werden. Demnächst soll eine größere Anzahl von Offizieren nach dem Marine-Flugzentrum von Toulon beordert werden. Auch der Minister der Marine hat sich dieser Tage nach Toulon begeben, um die dortigen Anlagen eingehend zu besichtigen. Uebrigens haben die Konstrukteure dieser Tage eine Versammlung abgehalten, um sich über ihre berechtigten Forderungen gegenüber dem Militärflugwesen auszusprechen Eine besondere Sitzung am nächsten Freitag soll dieser Frage gewidmet werden. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde Breguet zum Präsidenten, Alfred Leblanc zum Vicepräsidenten, Robert Savary zum Schriftführer gewählt. Dieser Tage ist auch viel von einem interessanten Fusionsprojekt gesprochen worden, zu dem die Krisis im Aero-Olub sicherlich den ersten Gedanken eingegeben hat. Einflußreiche Männer sind am Werke, die Verschmelzung der Association Generale Aeronautique mit der Ligue Nationale Aerienne durchzuführen, die sich beide bisher nicht gerade in freundlicher Weise gegenübergestanden, sondern mit allen Mitteln bekämpft haben, um sich ihre jeweilige Einflußsphäre nicht kürzen zu lassen. Da angesichts der Vorgänge im Aero-Club nun eine wirklich große und großzügige Interessenvertretung des Flugwesens fehlt, scheint man dieses Projekt als einen Ausweg anzusehen. Bis zu dessen Verwirklichung aber dürfte nach Lage der Dinge noch manche Schwierigkeit zu überwinden sein. Inzwischen beginnt die Ligue Nationale Aerienne wieder mit ihren unentgeltlichen Unterweisungskursen für Flugschüler, für welche Kurse das Kriegsministerium selbst das Programm festgesetzt hat. Zum Schlüsse noch ein Wort von dem nächsten Internationalen Aeronautischen Salon, der bekanntlich am 5. Dezember seine Pforten öffnet und bis zum 25. Dezember dauern wird. Das Organisations-Comite hat wiederum die „glückliche" Idee gehabt, die ausgestellten Apparate „nach ihrem praktisch erprobten Werte" zu klassieren. Der Raum unter der großen Kuppel des Mittelschiffes (als Ausstellungsgebäude kommt natürlich wieder das Grand Palais in den Champs Elysees in Betracht) wird für solche Aussteller reserviert, welche Flugzeuge konstruiert haben, die mindestens 100 km ohne Zwischenlandung über Land geflogen sind. Eine zweite Kategorie von Ausstellungsständen ist für solche Aussteller bestimmt, deren Apparate mindestens 30 km auf einem Flugfelde oder übt;^ Land zurückgelegt haben. Eine dritte Kategorie umfaßt endlich alle übrigen Aussteller, deren Flugzeuge bestimmte Voraussetzungen licht erfüllt zu haben brauchen. Wir haben diese Idee der Schulklassen-Einteilung bereits früher an dieser Stelle bekämpft und wir wissen, daß die ausländischen Flugzeugkonstrukteure in dieser Beziehung mit uns einer Meinung sind; Eine lebhafte Beteiligung des Auslandes am diesjährigen Salon dürfte demnach kaum zu erwarten sein. Rl. Pegoud's Rückenflüge. Der französische Flieger Pegoud ist den Lesern des „Flugsport" durch seine waghalsigen Fallschirmversuche von der letzten Nummer her bekannt. Um zu beweisen, daß seine Flugmaschine, wenn sie durch eine Windböe auf den Rücken zu liegen kommt, wieder in die normale Lage zurückzukehren vermag, führte Pegoud am 1. Sept. folgendes Experiment aus: Es war ein heiterer und windstiller Spätsommermorgen, als Pegoud um 6 Uhr sein Flugzeug aus dem Schuppen ziehen ließ. Ein leichter Frühnebel lagerte über dem Flugfelde. Nachdem er alle Steuerungen seiner Maschine mit großer Sorgfalt geprüft hatte, nahm Pegoud lächelnd auf dem Flugzeug Platz, befestigte selbst die Riemen, die ihn auf seinem Sitze festhielten und gab endlich, als eben die Sonne ihre ersten Strahlen aussandte und die Nebelschleier zerriß, das Zeichen zum Start Der Apparat erhob sich alsbald in die Luft und als er eine Höhe von 1000 Metern erreicht hatte, begann der vertikale Abstieg. Man sah dann, wie sich der Apparat mit der Spitze nach unten der Erde näherte, wie er nach und nach eine direkt vertikale Stellung einnahm und wie er sich schließlich umkehrte, um in dieser außergewöhnlichen Lage, also die Landungsräder nach oben, während etwa 25 Sekunden eine Strecke von 150 bis 200 Meter zurückzulegen. Man konnte genau die Luftschraube sehen, die sich nur langsam drehte, da der Motor auf verlangsamten Gang eingestellt war. Die wenigen Zuschauer dieses angsterregenden Fluges verfolgten atemlos die gefährliche Stellung des Fliegers, den man, den Kopf nach unten, sehr gut erkennen konnte. Nach wenigen Sekunden, die wie eine Ewigkeit schienen, stellte sich das Flugzeug von neuem auf die Spitze, drehte sich alsdann in seine normale Lage zurück und landete schließlich nach einem schönen Schwebefluge glatt mitten auf dem Flugfelde. Pegoud hatte in der Luft ein Riesen-S beschrieben. Natürlich wurde der tollkühne Flieger bei seiner Landung von den Anwesenden enthusiastisch begrüßt und beglückwünscht. Pegoud äußerte sich zu seinem Experiment wie folgt: „Die Empfindung, die ich hatte, als ich mit dem Kopf nach unten flog, war eine seltsame, aber keine unangenehme, denn das Flugzeug stampfte ganz und gar nicht. Ich habe sehr langsam manövriert, um die Maschine nicht allzu heftigen Beanspruchungen auszusetzen, aber ich hätte mich viel schneller wieder in die normale Lage zurückrichten können.. Mit den breiten Riemen, die mich am Sitze festhielten, war i^'i sehr bequem installiert, so daß ich die Steuerungen völlig un-gc^indft handhaben konnte." Bleriot hatte natürlich die denkbar weitesten Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um einer Katastrophe vorzubeugen, dennoch aber war er, wie er im Privatgespräch selbst zugab, in einer unbeschreiblichen Angst gewesen. Er verspricht sich von dem Experiment sehr viel, weil er meint, daß nur das Flugzeug, das gegen das Kentern geschützt ist, die völlige Flugsicherheit gewährt. Diese Nachricht von diesem ersten Versuch und seinem Ergebnis hatte die maßgebenden Stellen des französischen Militärflugwesens in dem Maße interessiert daß aus dem Kabinett des Kriegsministers alsbald eine Aufforderung eintraf, das Experiment, zu dem eine militärische Sonderkommission abgeordnet werden sollte, am darauffolgenden Tage zu wiederholen. Zu diesem zweiten Versuche, der am Dienstag früh, gleichfalls in Juvisy, vor sich ging, hatte sich auch eine Anzahl Interessenten aus Flieger- und industriellen Kreisen eingefunden. Diesmal hüllte ein dichter Nebel das Flugfeld ein, während sich um den historisch gewordenen Apparat eine dichte Gruppe diskutierend drängte. Es ist ein gewöhnlicher Serien-Eindecker von 18 Quadratmeter Tragfläche, mit einem 50' PS Gnom-Motor, an dem die vorerwähnten Aenderungen vorgenommen worden sind. Pegoud, ein junger Mensch von 24 Jahren, ist natürlich der Held des Tages, er wird von allen Seiten mit Fragen bestürmt. Auffällig ist seine unerschütterliche Ruhe, die ja wohl auch hauptsächlich zum Gelingen seines Wagnisses beigetragen hat. Endlich, gegen 10 Uhr, legte sich der Nebel und der Himmel erglänzte in wolkenloser Bläue. Scherzend nahm Pegoud auf seiner Maschine Platz, und um 10 Uhr 15 erhob diese sieh in die Lüfte Zahllo.se angsterfüllte Blicke folgten ihm; jetzt hat er die 500 Meter überschritten, noch eine elegante Wellenlinie, und er erscheint mitten über dem Felde. Und nun beginnt langsam der Abstieg. Man erkennt, sehr wohl das Manöver des Fliegers: während etwa 200 Meter stellt sich das Flugzeug auf die Spitze, dann dreht sich der Apparat und bleibt, die Puäder in der Luft, im Schwebefluge. Pegoud erscheint hoch in der Luft wie ein schwarzer Punkt: es ist die schwarze Lederweste, die er angelegt hat und die sich so deutlich abhebt. Durch das' Fernglas sieht man, wie der Kopf Pegouds nach unten schwebt; man erkennt auch deutlich, wie der Flieger einen Arm hin und herschwenkt, wahrscheinlich, um die unten Harrenden zu grüßen. Dieser Schwebeflug hat bei dem zweiten Experiment nngefähr 25 Sekunden gedauert, was etwa einer Flugdistanz von 600 bis 1000 Meter entsprechen dürfte. Dann geht der Apparat wieder in 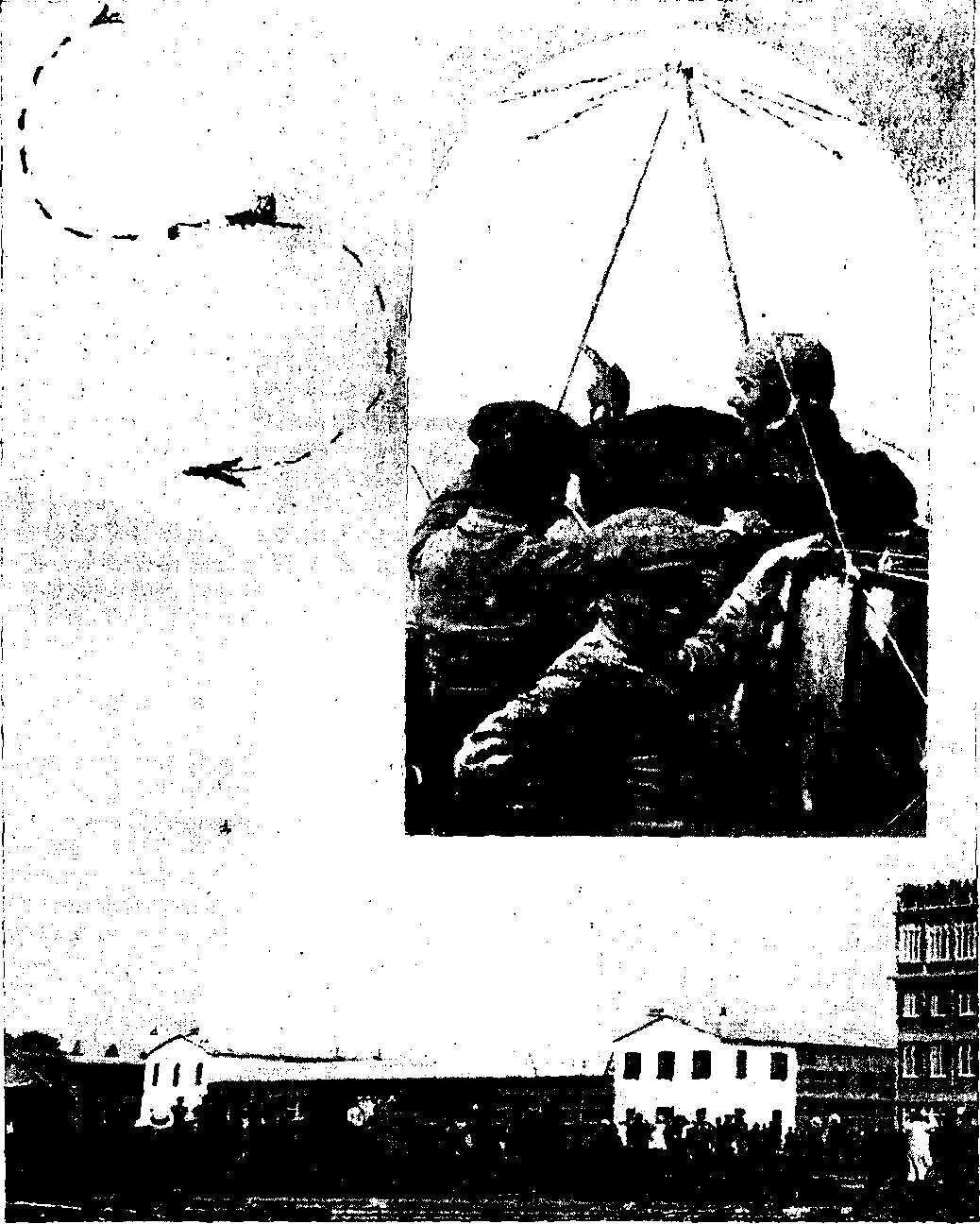 Die Rückenflüge von Pegoud. Oben links: Originalauf nähme des auf dem Racken fliegenden Bleriot-Eindeckers. Oben rechts: Pe'goad, welcher sich mittels Gurte am Sitz festgeschnallt hat. die vertikale Abstiegstellung zurück und diese erscheint jetzt noch beängstigender als das erste Mal. In 400 Meter Entfernung vom Boden funktioniert der Stabilisator und der Eindecker nimmt seine normale Flugstellung ein. Das Publikum applaudiert und schreit und gestikuliert, während Pegoud seine Abstiegspiralen in der Luft fortsetzt, um endlieh zu landen. Pegoud hat uns durch dieses Experiment nichts neues bewiesen. Eine den Stabilitätsbedingungen entsprechende Flugmaschine muß automatisch wieder in die normale Lage zurückkehren können. Bereits Alig flog bei seinem Todessturz eine Zeit lang auf dem Rücken und wäre sicher wieder auf dem Erdboden gelandet, wenn seine obere Verspannung genügend stark konstruiert gewesen und nicht gerissen wäre. Ebenso wurde vor einiger Zeit ein französischer Offiziersflieger auf einer Deperdussin-Maschine durch eine Windböe auf den Rücken geworfen. Die Maschine kehrte von selbst wieder in die normale Lage zurück und landete ohne Beschädigung. Ein Bristol-Eindecker ist sogar auf dem Rücken gelandet, ohne die Maschine zu beschädigen. 1 Aus all diesen Vorgängen zeigt sich, daß wir die Sicherheit in der Flugmaschine selbst suchen müssen und nicht andere Hilfsmittel, wie Fallschirme, die weitere Gefahrenmöglichkeiten in sich bergen, verwenden sollen. Das Experiment ist von Pegoud zweimal mit Absicht ausgeführt worden. Hoffentlich findet es keine Nachahmung. Die Flieger werden ohnehin oft genug in die Lage kommen, gezwungenermaßen dieses Experiment auszuführen. Jedenfalls wird es für die Flieger, welche in eine derartige Lage kommen sollten, eine große Beruhigung sein, noch mit Sicherheit die Landung durchführen zu können. Aus den englischen Flugzentren. Farnborough, den 13. September. Seit einigen Tagen entfaltet das Royal Flying Corps eine äußerst lebhafte Tätigkeit. Man trifft die nötigen Vorbereitungen für die am 20. September auf der Laffans Piain in der Nähe von Farnborough beginnenden großen Herbstmanöver. Auf Motorwagen eingerichtete Reparaturwerkstätten, sowie Wagen mit Ersatzteilen für Flugmaschinen sind bereits nach dem Manövergelände abgegangen. Nach den vom Kriegsministerium herausgegebenen Bekanntmachungen sollen in den kommenden Manövern die verschiedenen Flugzeugsektionen in folgender Weise zur Verwendung gebracht werden: Mit der braunen Macht: 3. Flugzeugsektion R. F. C. Military Wing (Upavon) unter dem Kommando von Major Brooke-Popham. 4 Flights = 12 Maschinen. Mit der weißen Macht: Das Hauptquartier, R. F. C. Military Wing (Farnborough) 1. Flugzeugsektion R. F. C. Military Wing (Farnborough) 4 Flights = 16 Maschinen „BE" und H. Farman Typen. Eine Flugzeugabteilung von der Marinestation zu Eastchurch, R. F. C. Naval Wing (Eastchurch) 2 Flights = 8 Maschinen, Sopwith und Short Landmaschinen. Eine Flugzeugabteilung von der 5. Sektion R. F. C. Military Wing (Aldershot) 3 Flights = 12 Maschinen, Avro und M. Farman Typen. Kommando Major Higgins. Eine Flugzeugabteilung von der 4. Sektion R.F. C. Military Wing (Netheravon) \% Flight = 6 Maschinen Breguet Typ. Kommando Major Raleigh. Die 2. Sektion R. F. C. Military Wing zu Montrose nimmt an den großen Manövern nicht teil, sie ist, wie wir schon in voriger Nummer berichteten, den irischen Manövern, die in der Umgebung von Limerik abgehalten werden, zugeteilt. Die Flugapparate der braunen Macht tragen zur Erkenntlichkeit auf der unteren Seite der Tragflächen schwarze' und weiße Streifen. Sämtliche Flugmaschinen sind, nachdem nach den vielen Fliegerabstürzen mit Kindeckern in den vorjährigen Manövern ein Verbot erlassen wurde, welches alle Eindecker aus dem Gebrauche in der Armee ausschied, Doppeldecker, mit Ausnahme einer Bleriofc-Maschine auf Seiten der braunen Macht. Alle Maschinen sind mit Apparaten für drahtlose Telegrafie ausgerüstet. Zur Vermeidung von Unfällen sind ferner vom südlichen Armee-Hauptquartier (Aldershot) an die Truppen folgende Instruktionen ergangen: 1. Ein Flugzeug muß mit abgestelltem Motor landen 2. Da ein Flugzeug beim Landen einer» offenen und übersehbaren Platz benötigt und der Hauptpunkt der Landungsgefahr darin liegt, daß sich Truppen zerstreut vor der Fluglinie des Apparates bewegen, seien folgende Maßnahmen zu beachten : 3. Vereinzelte Truppen haben sich sofort bei Ankunft einer Flugmaschine nach einem bestimmten Punkte, einem Baume oder einem Hause zu begeben, oder sich in Truppen anzusammeln und stehen zu bleiben, um dem ankommenden Apparat eine möglichst leichte Landung zu gewähren. 4. Sollte es jedoch vorkommen, daß eine Flugmaschine sehr niedrig fliegt, sodaß Truppenteile in Gefahr schweben von derselben getroffen zu werden, sollen sich die Soldaten flach auf den Erdboden werfen, um wenigstens der Schraube zu entgehen. 5. Weiße Tuchstreifen in Form eines T auf dem Erdboden ausgebreitet, bedeuten einen Landungsplatz und haben sich Truppen in einem Umkreise von mindestens 100 m von demselben entfernt zu halten. 6. Truppenteile haben sofort nach Ankunft einer Flugmaschine den Landungsplatz zu räumen, da die Möglichkeit vorhanden ist, daß der ersten weitere Maschinen folgen werden. Die Königlichen Flugzeugwerke haben abermals einen neuen Doppeldecker-Typ fertiggestellt, der den Namen BE 1 (Eeconnoiting Experiment!) erhalten hat. Auch die Marineabteilung des R. F.C. hat sich kräftig weiter entwickelt und fast täglich gelangen neue Wasserflugmaschinen zur Ablieferung. Die Zahl der qualifizierten Marineflieger beläuft sich nunmehr auf 184, während weitere 114 bereits den ersten Kursus der Flugschulen in Eastchurch und Upavon absolviert haben. Leider sind in der letzten Zeit auch wieder eine Anzahl Maschinen zertrümmert worden. So wurde das Sopwith-Flugboot des Marinefliegers Leutnant Spencer Grey ein Opfer der Wellen, als es während der Nacht des 7. Sept. in Shoreham , in der Nähe von ßrighton vor Anker lag. Ein heftiger Wind hatte sich in den Nachtstunden aufgemacht und als man am Morgen das Flugzeug mit Hilfe von Motorbooten an das Ufer bringen wollte, wurde es von den Wellen buchstäblich zerschlagen. Ein anderer Unfall ereignete sich auf der Höhe von Cromarty. Ein zum Mutterschiff für das Marineflugwesen H. M. S. Hermes gehöriger Short-Doppeldecker befand sich auf einem Fluge in der Umgebung von Cromarty. Nachdem Leutnant ßowhill, der Führer des Flugzeuges, die dort vor Anker liegenden Schlachtschiffe H. M. S. Lion und H. M. S. Prinzeß Royal einige Male umkreist hatte, brach plötzlich ein Steuerungszug. Der Apparat neigte sich nach vorn über und fiel ins Wasser. In einigen Minuten waren Motorboote und Dampfbarkassen an der Stelle angelangt und fischten den unverletzt gebliebenen Flieger aus dem Wasser. Am 8. September begleitete der erste Lord der Admiralität, Winston Churchill, den Marineflieger Leutnant Spencer Grey auf einem längeren Fluge in der Umgebung der Marineflugstation Calshott. Die Maschine war ein Sopwith-Wasser-doppeldecker. Am nächsten Tage ist dann die Gattin Winston Churchill dem Beispiel ihres Gar«m gefolgt und hat erst allein und dann in Begleitung eines Offiziers einen Aufstieg in einem Wasserflugzeug unternommen. Frau Churchill äußerte sich ganz begeistert über ihre Eindrücke während des Fluges. Die Admiralität hat bei der Firma A. V. Roe weitere Wasserflugzeuge in Auftrag gegeben, ebenso ist der mysteriöse Leutnant X, der bereits vor nicht allzu langer Zeit mit einem 100 PS Gnom Avro -Wasserdoppeldecker für die deutsche Marine einige Probeflüge ausführte, nach hier zurückgekehrt und verhandelt mit der Firma für Lieferung weiterer Flugzeuge. Die deutsche Avro-Maschine flog vor kurzem nach Helgoland, wo ihr die Schwimmer weggeschlagen wurden. Mit einem von der Grahame White Aviation Co. Ltd., zu Hendon konstruierten neuen Doppeldecker wurden vor einigen Tagen glänzende Flüge ausgeführt. Der riesige Apparat, der sich durch seine gewaltigen Dimensionen den Namen „Air-Char-a-bancs" erworben hat (Luft-Omnibus), hat Sitzgelegenheit für 5 Fluggäste und erreichte unter der Führung des bekannten Fliegers Claude Grahame White bei seinem ersten Aufstiege in wenigen Minuten eine Höhe von 600 m. Der Motor ist ein 90 PS Austro-Daimler und treibt eine Garuda-Schraube direkt an. Da die Maschine nur für den Passagiertransport konstruiert ist, und nicht als schnelle Maschine in Betracht gezogen werden darf, — es ist hauptsächlich auf große Tragkraft abgesehen — ist die höchste Geschwindigkeit nur 45 Meilen in der Stunde. Eine noch verwegenere Leistung als die des französischen Bleriot-fliegers Pegoud vollführte am 10 Sept. der englische Flieger Kemp von den Königlichen Flugzeugwerken zu Farnborough auf einem B. E.-Doppeldecker, allerdings gegen seinen Willen. Bei einem Versuchsfluge mit der neuen Maschine blieb in 600 m Höhe der Motor stehen, der Flieger verlor die Herrschaft über seinen Apparat und dieser stürzte in die Tiefe. In der Luft überschlug er sich nicht weniger als viermal. Kurz über dem Boden konnte Kemp die Maschine wieder aufrichten, und dann ohne jeglichen Schaden landen. So unwahrscheinlich dies klingt, so ist es dennoch nichts neues. Im vorigen Jahre wurde der Bristol-Flieger Pixton auf der Salisbury-Ebene, als er sich auf einem Bristol-Doppeldecker in großer Höhe befand, von einer "Windhose erfaßt, die den Apparat umlegte, der Apparat überschlug sich einige Male und landete dann, mit dem Anfahrgestell in der Luft, auf dem Rücken, ohne daß die Maschine arg beschädigt wurde, oder der Flieger irgendwelche Verletzungen erlitt. Zwischen dem sich augenblicklich in Europa befindenden amerikanischen Flieger und Flugbootkonstrukteur Clenn Curtiß und dem englischen Flugbootkonstrukteur S. T. Sopwith wird demnächst, wenn Curtiß der englischen Admiralität sein Flugboot vorführt, in der Nähe von der Insel Wight ein Flugbootrennen zum Austrag gebracht werden, dem man in hiesigen Fachkreisen mit großem Interesse entgegensieht. M-B-Monoplace Boutard. (Hierzu Tafel XXIV.) Durch die Militärbedingungen, welche das Mitführen eines Fluggastes verlangen, haben unsere deutschen Flugmaschinen sich in einer besonderen Richtung entwickelt. Den einsitzigen Sportmaschinen hat man verhältnismäßig wenig Beachtung geschenkt Die Flugschule Melli Beese G. m. b. H. in Johannisthal hat neuerdings eine kleine leichte taubenartige Sportmaschine, ausgerüstet mit einem luftgekühlten Rotationsmotor, herausgebracht. Diese Maschine wiegt in flugfertigem Zustand mit Betriebsstoff für 4 Stunden nur 380 kg. Die Spannweite bis zu den äußersten Flügelenden mißt 10,80 m, die größte Höhe bis zur obersten Spannturmspitze 2,85 m. Das Gesamttragflächenareal beträgt 16 qm, die spezifische Flächenbelastung 24 kg. Die drei äußersten Rippen der Tragflächen sind wie bei Taubenflügeln nach oben gebogen. Die seitliche Gleichgewichtserhaltung erfolgt durch Verwinden der Tragdecken und zwar wird der ganze hintere Flügelholm, welcher in Scharniergelenken schwenkt, bewegt. Die Vorspannung ist durchweg durch Bowden-Kabel von hoher Festigkeit bewirkt. Der Motorrumpf hat einen viereckigen Querschnitt. Vorn befindet sich ein dreimal gelagerter Gnom-Motor, der größtenteils von einer Aluminiumhaube eingekapselt ist. Dahinter sind die mit Schaugläsern versehenen Betriebsbehälter, ein Kartenroi] apparat, ein Kompaß und ein Tourenzähler in leicht übersichtlicher Weise angeordnet. In der Mitte ist in dem gepolsterten Ausschnitt der Rumpfkarosserie ein Führersitz nebst Militärsteuerung vorgesehen. Hinten schließt sich an das verjüngte Rumpf ende eine fächerförmige Schwanzfläche an, deren verwindbares Ende als Höhensteuer dient. Oberhalb und unterhalb der Schwanz-flache sind zwei kleine Seitensteuer angebracht, die der Maschine einen .Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten u. Flugtechn. Vereine 1913 M-B-Monoplace Boutard. Tafel XXIV. 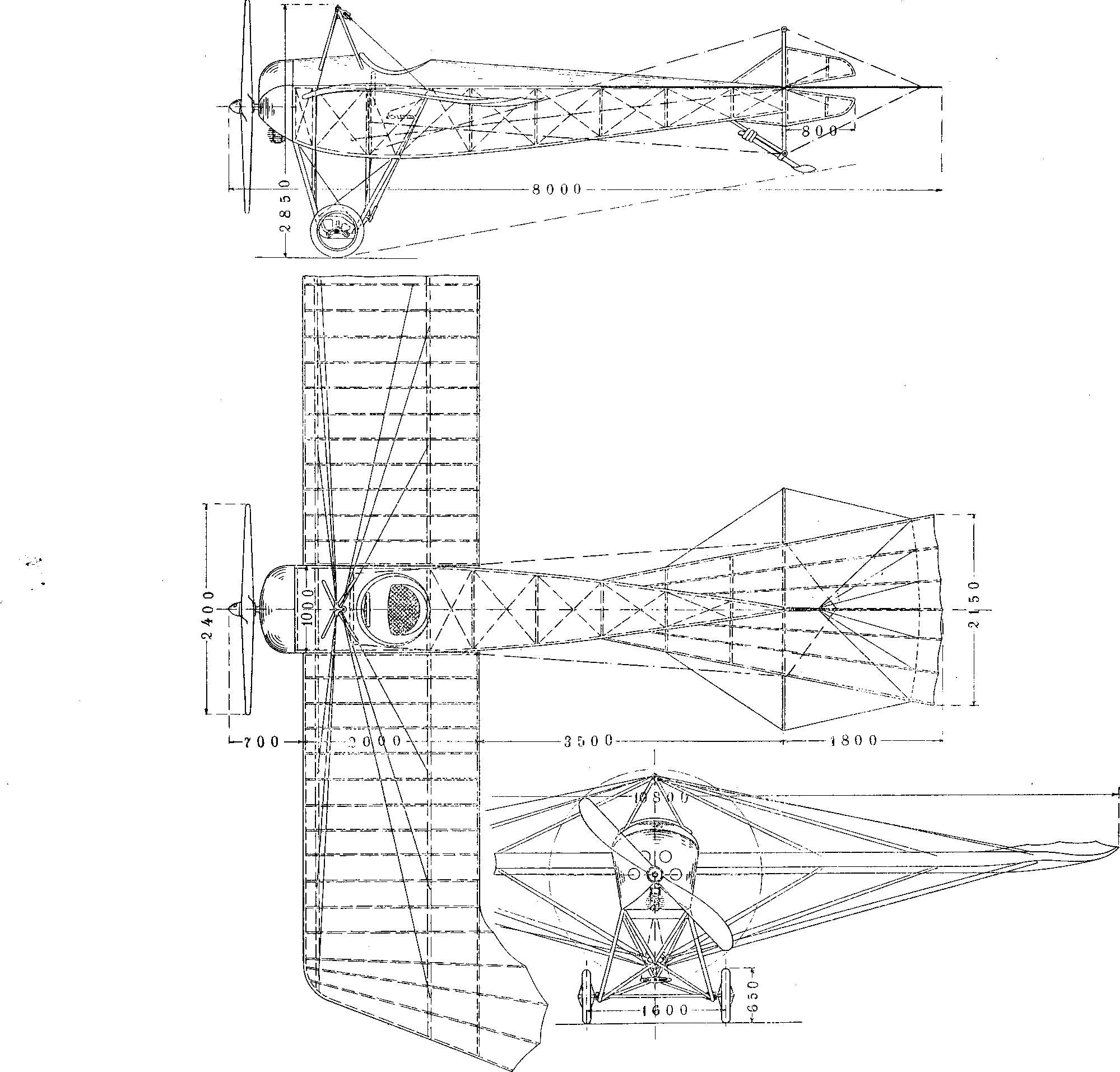 Nachbildung verboten. vollendeten Abschluß verleihen. Zur Unterstützung des Schwanzes ist eine abgefederte Löffelkufe angeordnet. Das Fahrgestell ist aus nahtlosem Stahlrohr hergestellt. Die Streben desselben laufen auf zwei kurzen Kufen zusammen, an denen die Radachse mittels Gummiringe aufgehängt ist. Auf jeder Seite der Eadachse sind 8 Eundgummiringe angebracht. Ferner sind zur Entlastung der Gummifederung zwei Druckfedern vorgesehen. Die Achse bewegt sich in einem vertikalen Führungsschlitz. Der Felddrachen System Luden Frantzen ist ein Kastendrachen Hargrav'scher Bauart von 6,8 m Spannweite, 5,2 m Länge, 2,4 m Höhe und 39 qm Flächeninhalt. Das Gewicht des kompletten Drachen beträgt 65 kg. Sein Gerüst besteht aus 40 mm starken Bambusstangen mit Hanfseilverspannung. Zum besseren Transport können die langen Stangen durch Lösen von Muffenverbindungen in handliche Stücke zerlegt werden. Die Bespannung besteht aus wasserdichter Leinwand, die zu diesem Zwecke besonders imprägniert ist. 5 m unterhalb der Tragflächen laufen zwölf 7 mm starke Hanfseile in einen Bing zusammen, von dem eine starke Stahltrosse zu einer Motorwinde führt, wie dieselbe zum Festhalten von Fesselballons benutzt wird. An dem Bing hängt gleichfalls die Gondel des Beobachters. Unter den zwei unteren Längsstäben sind 4 Stahlbügelkufen angebracht, um ein sanftes Aufsetzen auf den Boden zu ermöglichen. Statt der Bügelkufen können auch je nach dem Verwendungszweck Räder oder Schwimmer angebracht werden. Der Flugwinkel des Drachen beträgt 5 Grad. Der Drachen eignet sich besonders für tropische Zwecke, wo der Fesselballon infolge des großen Gasverlustes und des schwierigen Gasersatzes nicht mitgeführt werden kann. Deutsch-Französisches Abkommen über den Luftverkehr. Nach den am 26. Juli zwischen dem Staatssekretär des Auswärtigen Amts v. Jagow und dem Botschafter der französischen Republick Cambon aus-etauschten Noten zur Regelung des Luftverkehrs zwischen Deutschland und rankreich gelten nunmehr für den Verkehr von deutschen Luftfahrzeugen nach Frankreich die folgenden Bestimmungen. 1. Bestimmungen für den Verkehr von deutschen Luftfahrzeugen nach Prankreich. I. Aus deutschem Gebiete kommende Luftfahrzeuge, die der Militärverwaltung gehören oder unter deren Insassen sich Militärpersonen in Uniform befinden, dürfen nur auf Einladung der französischen Regierung französisches Gebiet überfliegen oder dort landen Doch wird diesen Luftfahrzeugen im Falle der Not der Aufenthalt auf französischem Gebiete nicht untersagt werden. Um derartige Fälle möglichst zu „FLUG S P OJRTV' vermeiden, wird die deutsche Regierung den Luftfahrern geeignete Weisungen erteilen; diese Weisungen werden der französischen Regierung mitgeteilt werden. Sollte ein Luftfahrzeug, das der Militärverwaltung gehört oder unter dessen Insassen sich Militärpersonen in Uniform befinden, über französisches Gebiet verschlagen werden, so hat es das Notsignal zu geben, das in den weiter unten erwähnten, der deutschen Regierung mitzuteilenden Bestimmungen vorgeschrieben ist, und sobald als möglich zu landen. Unmittelbar nach der Landung hat der Führer des Luftfahrzeugs die nächste französische Zivil- oder Militärbehörde zu benachrichtigen und unter Beifügung von Ausweispapieren seinen Namen, Vornamen und Wohnort sowie seine militärische Stellung anzugeben; etwaige Begleiter haben die gleichen Angaben zu machen. Die mit der Angelegenheit befaßte Behörde hat die nötigen Ueberwachungsmaßnahmeu zu veranlassen, um jeder Veränderung oder Vernichtung der Gegenstände oder Urkunden zu verhindern, die sich an Bord befinden oder die die Insassen mit sich führen; auch hat sie, sofern sie eine Zivilbehörde ist, unverzüglich die nächste Militärbehörde zu benachrichtigen. Die benachrichtigte Militärbehörde hat, gegebenenfalls unter Mitwirkung der Zivilbehörde, mit allen geeignet scheinenden Mitteln eine Untersuchung vorzunehmen, die jedoch lediglich bestimmt ist, festzustellen, ob die Berufung auf einen Fall der Not berechtigt ist oder nicht. Einer solchen Untersuchung dürfen sich die Insassen des Fahrzeugs nicht widersetzen Wird auf Grund dieser Untersuchung anerkannt, daß der Fall der Not vorliegt, so hat die Militärbehörde dem Offizier, der das militärische Personal des Luftfahrzeugs führt, das Ehrenwort darüber abzuverlangen, daß weder er selbst noch ein anderer Insasse des Luftfahrzeugs auf oder über französischem Gebiete eine Handlung begangen hat, durch welche die Sicherheit Frankreichs berührt werden könnte (Aufzeichnungen, photographische Aufnahmen oder Zeichnungen, Absendung von Funkentelegrammen usw). Hierauf wird dem Luftfahrzeug gestattet, in seinen Heimalsstaat zurückzukehren. Die Rückkehr darf unter den von der Militärbehörde festgesetzten Bedingungen auf dem Luftweg erfolgen. Ist die Rückkehr nicht sofort ausführbar, so kann während des Aufenthalts des Luftfahrzeugs in Frankreich gegen das Fahrzeug und seine Insassen keine Maßnahme getroffen werden, die nicht aus Gründen der Staatssicherheit oder der öffentlichen Gesundheit geboten ist oder die Abwendung einer unmittelbaren Gefahr von Personen oder Sachen bezweckt. Wird ein die Landung des Luftfahrzeugs rechtfertigender Fall der Not nicht festgestellt, so wird die Sache der Gerichtsbehörde übergeben und die französische Regierung entsprechend benachrichtigt. Die deutsehe Regierung wird der französischen Regierung die Unterscheidungsmerkmale der Luftfahrzeuge mitteilen, die der Militärverwaltung gehören oder vor der Abnahme durch die Militärverwaltung während einer Probefahrt mit Militärpersonen in Uniform besetzt werden sollen. Die Unterscheidungsmerkmale müssen auch während des Fluges und auf große Entfernung sichtbar sein II. Außerhalb der nach den französischen Vorschriften verbotenen Zonen können aus Deutschland kommende Luftfahrzeuge, die weder der Militärverwaltung gehören, noch Militärpersonen in Uniform zu ihren Insassen zählen, unter folgenden Bedingungen französisches Gebiet Uberfliegen und darauf landen : 1. Das Luftfahrzeug muß mit einem von der zuständigen deutschen Behörde oder durch sie ermächtigten Gesellschaft ausgestellten Zulassungsschein und einem Zeugnis über die Eintragung in ein deutsches Register versehen sein. Es hat d e u t Ii ch e Merkm al e zu führen, durch die es auch während des Fluges unterschieden werden kann; 2. Der Führer muß im Besitz eines von der zuständigen deutschen Behörde oder durch sie ermächtigten Gesellschaft ausgestellten Führerscheins sein; 3. Der Führer und jeder Begleiter müssen die Nachweise über ihre Staatsangehörigkeit, ihre Person und ihre militärische Stellung mit sich führen; 4. Der Führer muß mit einem von dem französischen diplomatischen oder konsularischen Vertreter ausgestellten Reiseschein versehen sein, der auf Grund 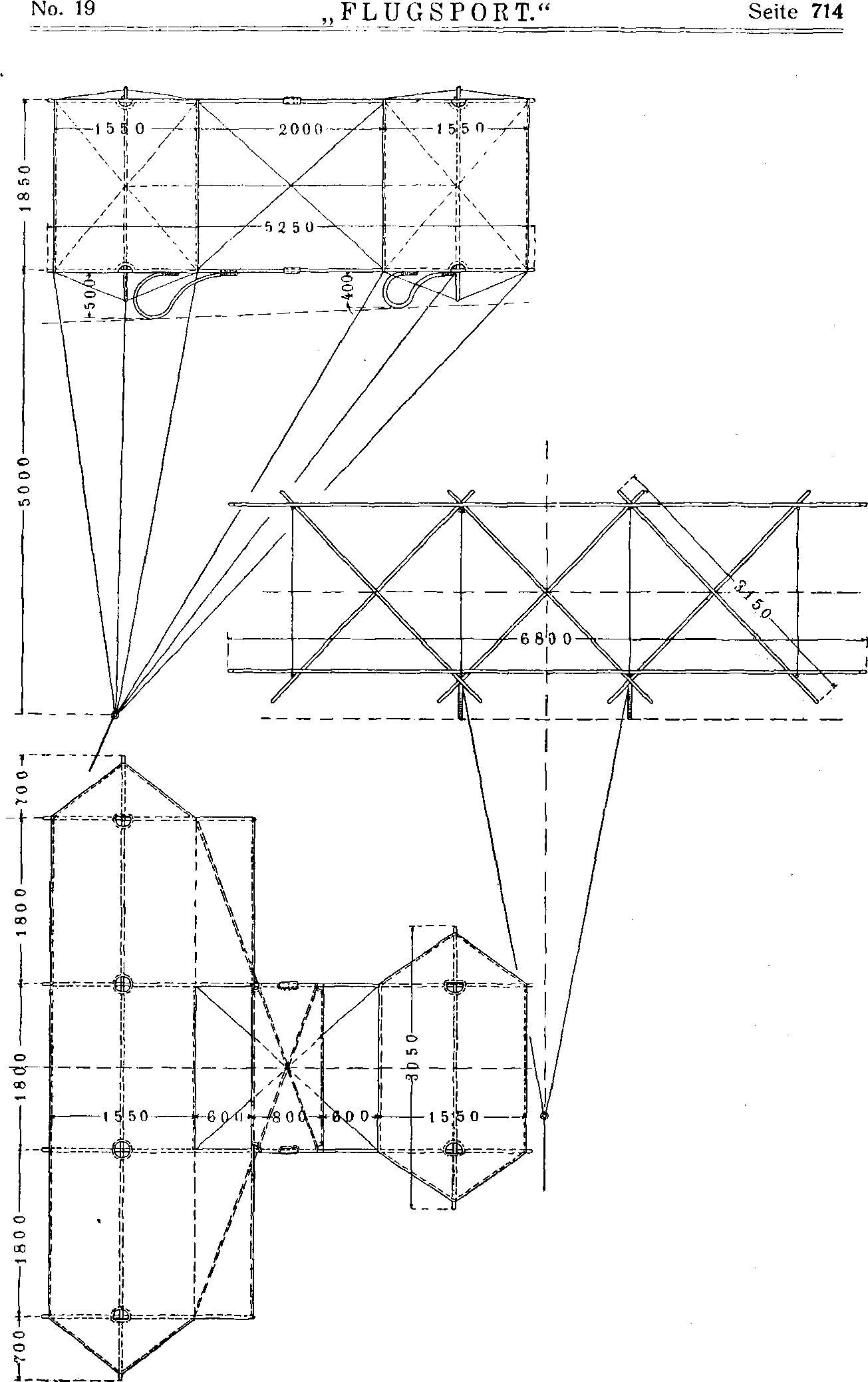 Der Felddrachen System Lucien Frantzen. der Nachweise über das Flugzeug und die Besatzung, sowie nach Maßgabe des Reiseziels erteilt wird. Solche Luftfahrzeuge und ihre Insassen haben sich den allgemeinen französischen Gesetzesvorschriften, den französischen Zollvorschriften und den Sondervorschriften über den Luftverkehr in Frankreich zu unterwerfen; der Zulassungsschein und der Führerschein haben indes, wenn das Luftfahrzeug und der Führer aus Deutschland kommen, dieselbe Geltung wie die entsprechenden, in Frankreich ausgestellten Zeugnisse. Aus Deutschland kommenden Luftfahrzeugen, die weder der Militärbehörde gehören noch Militärpersonen in Uniform zu ihren Insassen zählen, darf im Falle der Not der Aufenthalt auf französischem Gebiete nicht versagt werden, auch wenn sie den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen; sie haben jedoch in solchem Falle sobald als möglich zu landen und sich bei der nächsten Zivilbehörde zu melden. Im übrigen finden auf die Behandlung dieser Luftfahrzeuge die französischen Vorschriften Anwendung. III. In jedem Falle, wo ein aus Deutschland kommendes Luftfahrzeug in Frankreich landet, haben die französischen Behörden, gegebenenfalls im Einvernehmen mit dem Insassen, nach Möglichkeit die zum Schutze des Fahrzeugs und zur Sicherung der Insassen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Die französische Regierung wird der deutschen Regierung unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit alle auf den Luftverkehr sich beziehenden Vorschriften mitteilen. Vorstehende Bestimmungen gelten unter der Bedingung der Gegenseitigkeit. Sie treten außer Kraft, sobald die französische Regierung der deutschen Regierung eine entsprechende Mitteilung macht. Für die aus Frankreich nach Deutschland gelangenden Mili'är- und Privatluftfahrzeuge gelten entsprechende Bestimmungen. Dieses Abkommen tritt mit dem 15. August ds. Js. in Kraft. 2. Bestimmungen über die Ausstellung der Zulassungsscheine und Kennzeichnung der Luftfahrzeuge für den deutsch-französischen Luftverkehr. 1. Die Ausstellung der Zulassungsscheine erfolgt auf Antrag des Halters des Luftfahrzeuges, gemäß Verfügung des Reichskanzlers vom 2. August 1913, I. A. 7101, vom Deutschen Luftfahrerverband. 2. Der Antrag ist vom Halter des Luftfahrzeuges auf vorgeschriebenem Formular (Anlaga 1, Form. A und C) an den Deutschen Luftfahrer-Verband zu richten unter Beifügung einer Ausstellungsgebühr von 10 M. 3 Der Deutsche Luftfahrer-Verband veranlaßt danach durch einen bestellten Sachverständigen die Abnahme des Luftfahrzeuges. Bei der Abnahme hat der Sachverständige 1. das Luftfahrzeug daraufhin zu prüfen, ob es den an seine Sicherheit berechtigterweise zu stellenden Anforderungen entspricht; 2. folgende Identitätsangaben festzustellen : a) für Fr ei ba 11 o n e: 1. Firma, die die Ballonhülle hergestellt hat, 2. Fabriknummer der Hülle, 3 Material der Hülle, *)4. Durchmesser der Hülle am Aequator in Metern. *)5. Inhalt der Hülle in Kubikmetern, b) für Flugzeuge: 1. Firma, die das Flugzeug hergestellt hat, 2. Fabriknummer des Flugzeugs, 3. Art und Marke des Flugzeugs, *) Für die Angaben zu Ziffer a, 4 und 5 und b, ll genügt eine Bescheinigung der Firma, die die Ballonhalle bezw, den Motor hergestellt hat. 4. Spannweite des Flugzeugs in Metern (mit zwei Dezimalstellen), 5. Länge des Flugzeugs über alles in Metern (mit zwei Dezimalstellen), 6. Art der Steuerung: a) Steuerungsorgane, b) Betätigungsorgane. 7. Bei Wasserflugzeugen Art und Anzahl der Schwimmkörper, 8. Firma, die den Motor hergestellt hat, 9. Fabrikationsnummer des Motors, 10. Art des Motors: a) Arbeitsverfahren, b) Anzahl und Anordnung der Zylinder, c) Kühlung, *)11. Bremspferdestärke des Motors. 4. Nach der Abnahmeprüfung hat der Sachverständige bei ordnungsmäßiger Beschaffenheit das Luftfahrzeug mit Abnahmestempel zu versehen und das Prüfungsergebnis in eine Abnahmebescheinigung (Anlage 2, Form. A und C) einzutragen. Der Abnahmestempel ist anzubringen bei Freiballonen auf der Hülle nahe beim Füllansatzring und am Aequator unter der Reißbahn; bei Flugzeugen auf dem vorderen Holm jedes Tragflügels nahe am Rumpf und auf zwei Hauptlängsträgern des Rumpfes an sichtbarer Stelle. 5. Innerhalb 24 Stunden nach erfolgter Abnahmeprüfung ist die Abnahmebescheinigung unter Beifügung der Firmenbescheinigungen zu Ziff. 3 a) 4 und 5 bezw. b) 11, oder wenn das Luftfahrzeug nach Ansicht des Sachverständigen nicht den an seine Sicherheit zu stellenden Anforderungen entspricht, ein ausführlich begründetes Gutachten hierüber von dem Sachverständigen an den D. L. V. einzureichen. 6. Bei ordnungsmäßigem Befunde der Abnahmebescheinigung erfolgt alsdann sofort die Ausstellung des Zulassungsscheines und Zustellung an den Antragsteller durch den D. L. V. Die erforderlichen handschriftlichen Angaben auf Seite 1-4 des Zulassungscheines sind in deutscher Sprache mit lateinischen Schriftzeichen einzutragen. 7. Die Gültigkeit der Zulassungscheine erlischt für Freiballone spätestens nach Ablauf eines Jahres, für Flugzeuge nach Ablauf von 3 Monaten vom Datum des Abnahmestempels, oder sobald eine der in dem Zulassungsschein enthaltenen Identitätsangaben infolge von Veränderung des Luftfahrzeuges oder eines Teiles desselben nicht mehr zutreffend ist. 8 Wird auf Grund des Gutachtens des Sachverständigen die Ausstellung des Zulassungsscheines versagt, so verfällt die Ausstellungsgebühr von 10 M. Wird die Abnahmeprüfung außerhalb des Wohnsitzes des Sachverständigen vorgenommen, so sind die hierdurch entstehenden Kosten vom Antragsteller dem Deutschen Luftfahrer-Verband zu ersetzen. Sie werden folgendermaßen berechnet : a) Reisekosten: Eisenbahnfahrten II. Kl., Dampferfahrten 1. Kl., andere Beförderungsmittel sinngemäß; b) Tagegelder: ohne Uebernachten 15 M, mit Uebernachten 25 M. 9. Der auf dem Zulassungsschein eingetragene Name bezw. das Erkennungszeichen des Luftfahrzeuges ist vom Antragsteller in schwarzer, bei Freiballonen auch roter Balkenschrift, deren Schrifthöhe mindestens 65 cm und deren Strichstärke mindestens 10 cm beträgt, auf dem Luftfahrzeug anzubringen, und zwar bei Freiballonen: unterhalb der Mitte der Ballonhülle; bei Flugzeugen: an der unteren Seite der beiden (unteren) Tragflügel so, daß das Erkennungszeichen in der Flugrichtung und zwar auf dem rechten Tragflügel umgekehrt zu dem auf dem linken Tragflügel steht. Berlin, den 11. August 1913. Freiherr v. d. Goltz. Anlage 1. Form. C. Antragsformular. Auf Grund des deutschfranzösischen Abkommens vom 26. Juli 1913 über den Verkehr mit Luftfahrzeugen und auf Grund der Verfügung des Reichskanzlers vom 2. August 1913, I. A. 7101. beantrage ich die Ausstellung eines Zulassungsscheins für den Verkehr nach Frankreich für nachstehend bezeichnetes Flugzeug. Art und Marke des Flugzeugs:........ Besitzer:...................... Fabrikmarke des Motors:............ Stärke des Motors:............... Das Flugzeug befindet sich abnahmefertig in Ort:......................... Nähere Bezeichnung des Standorts:..... ...............Straße Nr....... ist beisrefüfft Die Ausstellungsgebühr von 10 Mark fo,gt mit Anweisung. Unterschrift:.................... Genaue Adresse:................ An den Deutschen Luftfahrer-Verband, Berlin W, Nollendorfplatz 3. Anlage 2. Form. C. Abnahmebescheinigung für die Ausstellung eines Zulassungsscheines für Flugzeuge für den Verkehr nach Prankreich. Auf Grund der Bestimmungen des D. L. V. vom 11. August 1913 über die Ausstellung der Zulassungsscheine, Zfr 3, wird bescheinigt, daß das durch die nebenstehenden, von mir festgestellten Angaben beschriebene Flugzeug den an seine Sicherheit berechtigterweise zu stellenden Anforderungen entspricht und daß seiner Zulassung zum Luftverkehr technische Bedenken nicht entgegenstehen. Die Bescheinigung der Fabrik über die Bremspferdestärke des Motors ist beigefügt. Das Datum des Abnahmestempels ist:............. Die Abnahmestempel sind angebracht:............. .......den.........., . . Der vom D. L. V. bestellte Sachverständige: 1. Firma, die das Flugzeug hergestellt hat:........... 2. Fabriknummer des Flugzeugs:................. 3. Art und Marke des Flugzeugs:................ 4. Spannweite des Flugzeugs in m (mit 2 Dezimalstellen): . . . 5. Länge des Flugzeugs über alles in m (mit 2 Dezimalstellen: . 6. Art der Steuerung: a) Steuerungsorgane:.................... b) Betätigungsorgane:.................... 7. Bei Wasserflugzeugen Art und Anzahl der Schwimmkörper: 8. Fabrik, die den Motor hergestellt hat:............ 9. Fabrikationsnummer des Motors:............... 10. Art des Motors: a) Arbeitsverfahren:.................... b) Anzahl und Anordnung der Zylinder:......... c) Kühlung:.......................... *)11. Bremspferdestärke des Motors:................ *) Laut beiliegender Bescheinigung der Firma: 1. Seite. 2. und 3. Seite: DEUTSCHES REICH (DEUTSCH-FRANZÖSISCHER LUFTVERKEHR) ZULASSUNGSSCHEIN für das umseitig beschriebene Flugzeug: DI Gültig bis zum ........................ ^ ... r « i des Ausgestellt auf Antrag in...............................................................Straße Nr............ Eingetragen in das Flugzeugregister des Deutschen Luftfahrer-Verbandes unter Nr. r —^= Berlin, den ......................................................19........... Deutscher Luftfahrer-Verband. (Stempel) Beglaubigt, Berlin, den..................................... 19-....... Königliches Polizei-Präsidium. (Stempel) *) Bei Personen ist die Staatsangehörigkeit, bei Firmen oder Vereinen die juristische Form mit Ort und Nummer der gerichtlichen Eintragung anzugeben.
4. Seite. Bescheinigung des französischen Konsulats. Sonstige Eintragungen und Bemerkungen. Aenderungen in der Stellenbesetzung der Fliegertruppe. Zum Inspekteur der Fliegertruppen ist Oberst v. Eberhardt jetzt Kom. d. 8. Thür. Inf. Reg. 153 ernannt, Adjutanten sind Hauptmann Wilberg und Oberleutnant Förster. Flieger-Batallion Nr. 1. Kom.: Maj. (ohne Patent) Qundel, jetzt in der Versuchs-Abt. d. Mil. Verkehrswesens Beim Stabe: Hauptm. Wagen führ jetzt b. Stabe d. Fliegertruppe. Kompagnie Chefs: Hauptm. Grade, jetztin der Fliege truppe; Hauptm. v Oertzen, jetzt Hauptm. ohne Patent in der Fliegertruppe. Oberleutnant: Vogel v Falckenstein, jetzt in d. Fliegertruppe. Leutnants: Coerper, v. Scheele, Blüthgen, Engwer, Fink, jetztin d. Fliegertruppe. Zur Dienstleistung bis 31. Dezember 1913überwiesen: Wiegandt, K. W. Lt. im Fils. R. Kaiser Franz Joseph von Oesterreich, König von Ungarn (4. Württ.) Nr. 122, bis 30. September 1913 zur Dienstl. bei d. Fliegertruppe. — St. Arzt Pieper, jetzt bei d Fliegertruppe. Flieger-Bataillon Nr. 2. Kom : Maj. Roethe, jetzt Kom. d. Fliegertruppe Beim Stabe: Maj. (ohne Patent) Kuckein, jetzt Hauptm. und Komp.-Chef im 1. Ermländ. Inf. R. Nr. 150. Komp.-Chefs: Hauptm Bartsch, jetztin d. Fliegertruppe, unter Belassung in dem Kommnado. zur Dienstl. b. Kr. Min ; Hauptm. v. Poser und Groß-Nädlitz, jetzt in d. Fliegertruppe; Hauptm. (ohne Patent) Lölhöffel v. Löwensprung, jetzt Oberlt. im 8. Thür. Inf. Reg. Nr. 153. Oberleutnants: Donnevert, jetzt im 1. Unt. Elsäss. Feldart. R. Nr. 31 ; Mühl ig-H off ma nn, jetzt im Großherzogl. Mecklenb. Jag. B.Nr 14. Leutnants: Boeder, jetzt im Magd. Pion. B. Nr. 4; Siber, jetzt im Inf. R. von Lötzow (1. Rhein.) Nr. 25; Funck, jetzl im Füs. R. Graf Roon (Ostpr.) Nr. 33; Canter, Mahncke jetzt in d. Fliegertruppe. — St. Arzt Dr. Rohrbach, jetzt Ob. Arzt beim Kür. R. Kaiser Nikolaus I. von Rußland (Brandenb.) Nr. 6. Flieger-Bataillon Nr. 3 Kom.: Maj. (ohne Patent mit einem Dienstalter vom 31. Mai 1912). Friede), jetzt Hauptm. im Niederschi. Pion B. Nr. 5. Beim Stabe: Haupt. Kirch, jetzt Komp.-Chef im Füs. R. Fürst Karl Anton von Hohenzollern (Hohenzpll.) Nr. 40. Kompagnie-Chefs: Hauptm. Goebel, jetzt in der Fliegertruppe; Hauptm. v. De wall, jetztin d. Fliegertruppe; derselbe erhält ein Patent seines Dienstgrades mit Rangierung unmittelbar hinter Hauptm. Vogeler im Telegr. B. Nr. 5; Hauptm. (ohne Patent) Keller, jetzt Oberlt. in d. Fliegertruppe. Oberleutnants : H ant el m ah n, jetzt in der Fliegertruppe, von Beaulieu, jetzt im Füs. R General-Feldmarschall Graf Blumenthal (Magdebg.) Nr. 36; Hö pker, jetzt im 4. Magdeb. Inf. R. No. 67; Jo I y jetzt in d. Fliegertruppe Leutnants: Kastner, Schnii ck'äly, Reinhardt, jetzt in d. Fliegertruppe. — St. Arzt Dr. Braune, jetzt Ob. Arzt beim Großherzogl. Mecklenb. Feldart. R. No. 60. Flieger-Bataillon No. 4. Kom.: Maj. Siegert, jetzt b. Stabe d. Fliegertruppe. Beim Stabe: Hauptm. Haehnelt, jetzt Komp,-Chef im 4. Niederschles. Inf. R. Nr. 51. Kompagnie-Chefs: Hauptm. Genee, jetzt b. Stabe des 1. Unter-elsäss. Inf. R. Nr. 132; Hauptm. Hildebrand, jetzt Hauptm. ohne Patent in d. Fliegertruppe; Hauptm. (ohne Patent) Ba re n d s, jetzt in d. Fliegertruppe. Oberleutnant: Keller, jetzt im 5. Westpr. Inf. R. Nr. 148. Leutnants : Q eyer, jetzt im 6. Thür.Inf.R. Nr. 95; Pr et z e 11, jetztim 1. Unterelsäss. Inf. R Nr. 132; Carganico, Weyer, jetztin d. Fliegertruppe; S c hu lz, jetztim 1. Lothr Pion. B. Nr. 16; Kö hrjetzt im Telegr. B. Nr. 3. - Stabsarzt Prof. Dr. Möllers, jetzt Bats-Arzt des II. B Gren. R. König Friedrich der Große (3. Ostpr.) Nr. 4. — Verkehrsoffiz. von PI. in Posen: Hauptm. Reiff, jetzt in d. Versuchs-Abt. des Mil. Verkehrswesen Beim Verkehrsoffiz. v. PI. in Posen: Oblt. Schreiber; jetzt im Eisenb. R, Nr. 1. — Verkehrsoffiz. v. PI. in Neubreisach: Maj. (ohne Patent) Flaskamp, jetzt Hauptm. b. Stabe d. Telegr. Bats. Nr. 3. Beim Verkehrsoffiz. v. PI. in Neubreisach. Lt. Naumann, jetzt im Eisenb. R. Nr. 2. No. 482. Schachenmayr, Gustav, Gefreiter im 1. Schweren Reiterregiment, 4 Eskadron, München, geb. am 5. Februar 1888 zu Koffern bei Kempten, für Zweidecker (Otto), Flugfeld Oberwiesenfeld, am 14. August 1913. No. 483. Strang, Paul, cand. ing., Cleve, Bez. Düsseldorf, geboren am 8. Sept. 1884 zu Calcar, Kr. Cleve, für Eindecker (Albatros-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 14. Aug. 1913 No. 484. Huber, Alphons, Charlottenburg, geb. am 9. Mai 1890 zu Hamburg, lür Eindecker (Wenskus), Flugplatz Johannisthal, am 10 August 1913. No. 485. Weiß, Friedrich, Burg b. Magdeburg, geb. am 31. Januar 1892 zu Lübeck, für Eindecker (Schulze), Flugfeld Madel bei Burg, am 16. Aug. 1913. No. 486. Henkel, Hans, stud. ing., Johannisthal, geb. am 20. Dez. 1892 zu Frankfurt a. M., für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 16. Aug. 1913. No. 487. Rheinländer, Franz, Berlin SO., geb. am 9. Okt. 1891 zu Berlin, für Eindecker (Melli Beese), Flugplatz Johannisthal, am 20. Aug. 1913. No. 488. Schützenmeister, Otto, Ingenieur, Adlershof, geb. am 12 Sept. 1889 zu Höfgen b. Grimma, Sa., für Eindecker (Etrich-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 20 Aug. 1913. No. 489. Dörfler, Adam, Burg b. Magdeburg, geb. am 22. August 1892 zu Weißmain (Oberfranken), für Eindecker (Schulze), Flugfeld Madel bei Burg, am 16. August 1913. No. 490. Franki, Wilhelm, Johannisthal, geb. am 20. Dezember 1893 zu Hamburg, für Eindecker(Melli-Beese-Taube), Flugplatz Johannisthal am 16. Aug. 1913. No. 491. Moerschel, Richard Erich, Neukölln, geb. am 19. Aug. 1895 zu Potsdam, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 21. Aug. 1913 No. 492. Küppers, Kurt, stud. ing., Johannisthal, geb. am 2. Dez. 1894 zu Essen, für Zweidecker (Luft-Verkehrs-Gesellschaft Farman), Flugplatz Johannisthal, am 22. Aug. 1913. No. 493 Dahm, Heinrich, Altona—Bahrenfeld, geb. am 10. Mai 1883 zu Altona, für Wasserzweidecker (Friedrichshafen), Flugplatz Bodensee, am 22. August 1913. No. 494. Thelen, Otto, Leutnant i. Inf.-Regt. 137, Hagenau i. Eis., geb. am 26. Okt. 1892 zu Berlin, für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 26. August 1913. No. 495. Schmidt, Adolf, München, geb. am 1. Juni 1892 zu Nohfelden in Oldenbu, g, für Zweidecker (Otto), Flugfeld Oberwiesenfeld, am 27. Aug. 1913.  Rundschau. Inland. Flug/ührer-Zeugnisse haben erhalten: Seite 721 „FLUGSPOftT." Nr. 19 No. 496. von Keußler. Otto, Johannisthal, geb. am 7. Dez. 1888 zu Schwanenhufg, Livland, für Eindecker (Harlan), Flugplatz Johannisthal am 28. Aug. 1913. No. 497. ; Mann, Willy, Burg b. Magdeburg, geb. am 20. Juni 1895 zu Neundorf bei Suhl, für Eindecker (Schulze), Flugfeld Madel bei Burg, am 28. Aug. 1913. Von den Flugplätzen. Vom Flugplatz Johannisthal. Die Feldpilotenprüfung haben bestanden: am 2. September Regierungsbaumeister Aust auf Ago-Doppeldecker; am 8. Sept. Lt. Haupt vom Feldart.-Regt. 74 auf Albatros Mercedes-Taube und am 12. Sept. Walter Krause auf Albatros-Mercedes-Taube. Flugplate Oberwiesenfeld. Am 12. September bestanden die Schüler der Nationalf lugspende O es t e r-reicher, Scheuermann und Schmidt ihre Feldfliegerprüfung auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor in einer durchschnittlichen Höhe von 1500 m. Der Flieger Schmidt führte daran anschließend tinen 2 Stundenflug um die Prämie der Nationalflugspende aus. Sämtliche Schüler haben ihre Ausbildung von dem Fluglehrer der Fliegerschule Otto, Georg Schöner erhalten und ihre beiden Prüfungen in tadelloser Weise bestanden. Vom Schwade-Flugplate Drosselberg bei Erfurt. Der Schüler Hozakowski bestanl am 8. Sept. auf Schwade-Doppeldecker mit 80 PS Schwade-Stahlherz-Rotationsmotor die Feldpilotenprüfung. Am 13. Sept. erfüllten die Bedingungen zur Erlangung des Flugzeugführerzeugnisses die Flugschüler stud. ing. Tille und Vollrath sowie Ingenieur Schulte sämtlich auf Schwade-Doppeldeckern mit 80 PS Schwade-Stahlherz-Rotationsmotor. Vom Flugplate Teltow. Ihre Doppeldecker-Pilotenprüfung bestanden am 14. Sept. auf Union-Pfeil-Doppeldeckern die früheren Grade-Flieger Haussier und Kanitz. {Militärische Flüge. Die III. Flugzeugführerprüfung bestand am 29. Aug. der sächsische Oberlt. .D ie tze vom Train-Btl. 19 durch einen Flug Posen-Wohlau—Posen mit einer Zwischenlandung bei Rawitsch. Beobachter war Lt. Neumann vom Inf.-Reg. 103. Die Strecke von 265 km wurde in einer durchschnittlichen Höhe von 1200 m zurückgelegt. Von Döberitz nach Kolberg flog am 30. Aug. Lt. Giesche von der Metzer Fliegerstation, zur Zeit Döberitz> mit Lt. Geibel als Beobachter. Der Exerzierplatz der Stadt Kolberg wurde nach 3 Stunden erreicht. Am 1. September erfolgte der Rückflug nach Döberitz. Für die 300 km lange Strecke, wurden 3'/2 Stunden benötigt. Von Darmstadt nach Gelnhausen flog bei strömendem Regen am 7. Sept. Lt. von Hidd essen mit Major Siegert, dem Kommandeur der Metzer Fliegerstation, um an den Manövern teilzunehmen. Einen Flug über dem Starnberger See führte am 6. Sept. Lt. Hai ler. auf einem Wasser-Doppeldecker der Otto-Flugzeugwerke aus. Lt H a il e r landete nach '/> Stunde vor den Schuppen. Von Köln nach Gotha flog am 9. Sept. Lt. von Lehmann mit Fluggast auf einer Rumpler-Taube Die Flieger starteten um 3 Uhr und landeten in Gotha um 5:30 Uhr. Am 11. Sept. 10 Uhr vormittags erfolgte der Weiterflug nach Döberitz. Jfliiye mit Wasserflugzeugen de?- Marine. Für die diesjährigen Flottenmanöver waren die Flugzeuge D 12 und D 15 befohlen. Der D 12, ein englischer Avro-Doppeldecker,, flog am 3. Sept. 4:15, gesteuert von Oberlt. z. S. Langfeld mit Fregattenkapitän Gygas, dem Leiter der Wilhelmshavener Station, von Wilhelmshaven nach Helgoland, das sie um 7:12 erreichten. Am 15. September flogen die beiden Doppeldecker nach Cuxhaven zurück. Der neue Nieuport-Wasser-Anderthalbdedter Einen neuen Dauer-Weltrekord mit 3 Fluggasten in 3 Std. 11 Min. 40 Sek. stellte der Flieger Gseil auf einem Marine-Wasserflugzeug-Doppeldecker des Flu zeugbau Frieririchshafen am 2. Sept. auf. Gsell flog um 3:33 nachmittags mit seinen 3 Fluggästen ab und wasserte um 6:44:14 vor Manzell. Das Gewicht der 4 Insassen betrug 289,9 kg Otto Stiefvater, der seine Jeannin-Stahl-Taube am 13. September nach F r e i-burg i. B. hatte transportieren lassen, führte am Vormittag des 14. mehrere Passagierflüge über der Stadt und dem Exerzierplatz aus. Ferner vollendete er mit seiner Schwester als Passagier einen Ueberlandftug nach seinem Heimatsort Mühlheim, wo er sein Elternhaus in engen Spiralen mehrmals umkreiste. Dann flog er nach Badenweiler, wo er über dem Großherzogl. Palais als Huldigung für den Landesfürsten mehrere Schleifen flog Darauf begab er sich nach Freiburg zurück. Stiefvater will nach Königsberg starten. Einen Flug auf den Feldberg im Schwarzwald unternahm am 11. Sept. der Aviatik=Flieger Arthur Faller auf einem Aviatik-Doppeldecker. Erstieg um 6 Uhr in Mühlhausen auf und erreichte den 1493 m hohen Feldberg um 6 : 15 Uhr. Lübbe beabsichtigte am 14. September von Johannisthal nach Paris zu fliegen. Bei Rheine i. Westf., nachdem er 500 km zurückgelegt hatte, mußte er infolge Motordefektes niedergehen. Am andern Tage versuchte er weiter zu fliegen, mußte jedoch wieder im Gleitfluge landen, wobei er in eine Eichenwaldung geriet und den Apparat beschädigte Lt. von Eckenbrecher und Lt. Prinz sind am 4. Sept. auf einer Taube tödlich abgestürzt. Dr. Oskar Ringe wurde am 9. Sept. in der Luft von einem Herzschlag betroffen. Die Maschine stürzte führerlos mit laufendem Motor ab. Der Flieger Senge, der Chefpilot der Aristoplanwerke in Wanne, wurde am 8. Sept. bei der Landung nach einem Ueberlandflug von Gelsenkirchen nach Wanne aus der Maschine geschleudert und tödlich verletzt. . Ein Einweihungsfliegen anläßlich der Eröffnung des Flugstützpunktes Bautzen findet in der Zeit vom 17. bis 20. September statt. Ausland. Das neue Wasserflugzeug von Nieuport. Die Nieuport-Werke haben einen Wasserdoppeldecker, Anderthalbdecker, herausgebracht, der von den bisherigen Nieuport'schen Erzeugnissen erheblich abweicht. Der Motor, ein 110 PS Salmson, ist, um ein freies Gesichtsfeld zu erhalten, hinter den Tragdecken angeordnet. Links und rechts des Hauptrumpfes befinden sich fischbauchähnliche Tragkörper, an deren hinteren Enden Höhen- und Seitensteuer befestigt sind. Die ganze Maschine wird durch zwei Nieuport-Schwimmer in der ^bekannten Ausführung getragen. Die Spannweite des ■ Oberdecks beträgt 15 m, die Gesamtlänge der Maschine 7 m, der Tragflächeninhalt 40 qm. Riesendoppeldecker Sikorsky. Wie wir bereits früher mitteilten, hat Sikorsky auf dem Militärflugplatz bei St. Petersburg einen Riesendoppeldecker versucht und ist mit diesem 1 Std. 54 Min. mit 7 Fluggästen geflogen. Dieser Doppeldecker besitzt bei 28 m Spannweite 120 qm Tragfläche. Die vier Argus-Motoren sind paarweise hintereinander zu beiden Seiten des Rumpfes angeordnet. (S. die nebenstehende Abb) Führer- und Gastsitze sind vollständig eingekleidet Von Paris nach Berlin in 11 Stunden ohne Zwischenlandung flog am 13. September der französische Flieger Auguste Seguin auf einem Farman-Renndoppeldecker mit 80 PS Gnom-Motor. Seguin hatte ursprünglich die Absicht, bis Petersburg zu fliegen, mußte jedoch infolge heftigen Gegenwindes aufgeben. Am 15. September 6:53 startete Seguin zum Rückfluge nach Paris, mußte jedoch in Göttingen wieder infolge Gegenwindes eine Zwischenlandung vornehmen. Der erste rumänische Flieger Aurel Vlaicu, unseren Lesern von seinem eigenartigen Plugapparat her bekannt, ist am 13. September im Distrikt Prahova tödlich abgestürzt. Wettbewerbe. Die Ausschreibung für die Johannisthaler Flugwettbewerbe vom 28. September bis 5. Oktober ist soeben in zwei Teilen erschienen. Zum ersten Mal kommen in Johannisthal in der Herbstflugwoche Formelwertungen zur Anwendung. Es ist zu erwarten, daß diese Formel den Anfang zu einer weitgehenden wissenschaftlichen Wertung der Leistungen bilden wird. Die Erfahrungen haben bisher stets gezeigt, daß ganz ungleiche Eigenschaften, die eigentlich gar nicht miteinander in Vergleich hätten gestellt werden können, miteinander in Wettbewerb treten. I. Preise des kö n igl. preußischen Kriegsministeriu ms. 16250 M. Es werden nur Flugzeuge zugelassen, die in allen Teilen, einschließlich des Motors, deutschen Ursprungs sind. Die um die nachstehenden a—e ansge- schriebenen Einzel Wettbewerbe konkurrierenden Flugzeuge und Führer müssen in einer Vorprüfung, die vor oder nach erfolgter Anmeldung, aber unbedingt vor dem Start zu einem der Wettbewerbe a—e abgelegt werden muß, eine Anzahl konstruktiver Bedingungen erfüllen. 1. Deutsches Material und Fabrikate in allen Teilen. 2. Guter Sitz für Führer und Beobachter, leichte Verständigung zwischen beiden; Steuerorgane für den Führer. 3. Für die Besatzung wird möglichst großer Windschutz, bequemer Sitz und völlige Armfre heit verlangt. Die Karosserie muß genügend Raum zum Einbau einer Abwurfvorrichtung unJ Unterbringung von Abwurf-bomben, sowie zum unbehinderten Photographieren besitzen. 4. Möglichst automatische Stabilität und mühelose Betätigung der Steuerorgane, 5. Abweichungen von der Militärsteuerung bedürfen besonderer Abmachungen 6. Uebersichtliche Anordnung der Instrumente (Barometer, Barograph, Kompaß, Tourenzähler, Stoppuhr). Prüfungsmöglichkeiten für den Benzin-und Oelstand durch den Führer im Fluge^muß vorhanden sein.  Der Riesendoppeldedier Sikorsky. 7. Eigengeschwindigkeit von mindestens 90 km. Bei dieser oder größerer Geschwindigkeit muß ihre Herabsetzung während des Fluges bis auf 75 km möglich sein, ohne die Flugfähigkeit zu beeinträchtigen, d. h. in wagerechter Lage geradeaus fliegen zu können. 8. Größte Breite: 14,50 m Größte Länge: 12 Größte Höhe: 3,50 „ mit Rücksicht auf die Unterbringung. 9. Betriebsstoff für 4 Stunden. 10. Motorstärken nicht über 100 PS. Abweichungen unterliegen der Genehmigung der Heeresverwaltung. Bei gleichwertigen Leistungen werden Flugzeuge mit schwächeren Motoren bevorzugt. 11. Sichere und gefahrlose Unterbringung der Betriebsstoffbehälter. (Ueber oder hinter der Besatzung sind ausgeschlossen.) 12. Anlaßvorrichtungen bezw. Andrehvorrichtung. 13. Spielraum für Propellerspitze nicht unter 45 cm vom Boden. 14. Steigfähigkeit mindestens 800 m in 15 Minuten. 15 Anlauf bis höchstens 100 m auf ebenem Boden (Startmannschaflen, gestattet). Auslauf höchstens 70 m; Wendigkeit auf dem Boden. 16. Nutzlast (außer Betriebsstoffen, Instrumenten und Werkzeug) von mindestens 200 kg. (Führer und Beobachter sind hierin enthalten). 17. Gleitflug aus 500 m Höhe (mit Rechts- und Linkskurven) mit abgestellter Zündung. 18. Schnelles Zusammensetzen und Zerlegen, als Norm gilt mit 5 Mann Montage 2 Stunden, Demontage 1 Stunde, leichte Verladefähigkeit auf Eisenbahnwagen und Landfahrzeugen. Profilfreiheit für Eisenbahn- und Straßentransport.1 19. Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse. 20. Leichte Auswechselbar keit einzelner Teile (z. B. Fahrgestell). 21. Eine Einrichtung zur vorübergehenden Dämpfung des Motorgeräusches. Bei allen Bewerbungen um die Preise des Kriegsministeriums müssen die Flugzeuge außer Betriebsstoffen für 4 Stunden, ferner außer den Instrumenten und Werkzeugen eine Nutzlast von 200 kg tragen. In dieser Last sind Führer und Beobachter enthalten. a) Preis für den kürzesten Anlauf = 3000 M. I. Preis 2000 M., II. Preis 1000 M. Anläufe über 100 m werden nicht bewertet. b) Preis für den kürzesten Auslauf = 3000 M, I. Preis 2000 M. II, Preis 1000 M Ausläufe über 70 m werden nicht bewertet. c) Preis für die größte Steigfähigkeit = 3000 M. I.Preis 2000 M., II. Preis 1000 M. für jeden Bewerber, der in der kürzesten Zeir800 m Höhe über dem Flugplatz erreicht. Eine Zeit über 15 Minuten wird nicht bewertet d) Wettbewerb um den größten Unterschied zwischen der größten und kleinsten Ges c h wi nd igk ei t = 4250 M. I. Preis 2500 M. II. Preis 1250 M., III. Preis 500 M. Die Bewerber haben auf ein und demselben Flugzeug, (einschließlich Motor und Propeller) zwei Rundflüge von je 30 Kilometer Länge auszuführen. Die Geschwindigkeit beim schnellem Fluge muß mindestens 90 Kilometer pro Stunde, die Geschwinüigkeil beinr langsamen Fluge darf höchstens 70 Kilometer pro Sluride betragen"; ' '' ' e)Pr ei sfürdie höchste Tr a g'f ä h igk e i t, 3000 M. I. Preis 2000 M., II. Preis 1000 M., für denjenigen, der mit der größten Nutzlast unter Aufwand der geringsten Motorleistung 800 m Höhe in höchstens 15 Minuten erreicht. Eine Nutzlast einschließlich Führer und Fluggast unter 200 kg „wird nicht bewertete Dasjenige Flugzeug erhält den ersten Preis, dessen Quotient den höchsten Wert erreicht, worin t = Zeit in Sekunden, Q = Nutzlast einschließlich Fütirer und Fluggast, N die nach dem Zylinderinhalt berechnete Mo:orenleistung ist. Die Pferdestärke N der Motoren wird unter Zugrundelegung einer den sportlichen Leitern einzureichenden Bescheinigung über den Motoren-zylinder-Inhalt V wie folgt berechnet: . 1. Vier-Takt-Motoi en mit ruhenden Zylindern und Wasserkühlung N = 11,0 V P3; 2 Vier-Takt-Motoren niit umlaufenden Zylindern und Luftkühlung N = 7,0 V PS; 3. Zwei-Takt-Motoren mit ruhenden Zylindern und Luftkühlung N = 10,5 V PS. 11 Dauerpreis 16 000 M. Täglich werden 2000 M unter die Bewerber im Verhältnis der Zahl der geflogenen vollen Minuten verteilt. Es kommen indessen nur diejenigen Flüge in Anrechnung, bei denen eine erreichte Höhe von 100 m einwandfrei nachgewiesen wird und die mindestens 10 Minuten gedauert haben. Es kann kein Bewerber in diesem Wettbewerb täglich mehr als 1000 M gewinnen. Die Gewinne der Mitbewerber werden in gleichem Verhältnis gekürzt. III. Der längste Einz elf lug von mindestens 2'/a Stunden Dauer, 1750 M und Ehrenpreis des K. A C. Dieser Flug kann auch außerhalb der für die Wettbewerbe vorgeschriebenen Zeit begonnen werden, darf aber nicht später als 30 Minuten nach Ablauf der für die Wettbewerbe angesagten Flugzeit beendet werden. IV. Ehrenpreis des Berliner Vereins für Luftschiffahrt Wert 500 M. Für die größte in der für die Wettbewerbe festgelegten Zeit erreichten Höhe, mindestens 2000 m. V. Rennen, 10000 M. Von dieser Summe ist ein Teil für Eindecken ein Teil für Zweidecker bestimmt und zwar im Verhältnis der Zahl der von der sportlichen Leitung in sämtlichen Rennen als gestartet anerkannten Eindecker und Zweidecker. Es ist gestattet, daß .Flugzeuge sowohl als auch Führer, die am Geschwindigkeitsrennen (a) teilgenommen haben, nochmals im Vorgaberennen (b) starten dürfen. a) Geschwindigkeitsrennen. Innerhalb der Zwei- und Eindecker werden- je 2 Unterklassen nach Motorenstärke gebildet, eine, deren Motoren bis zu 80 PS, die andere, deren Motoren mehr als 80 PS haben. Die Preisverteilung wird innerhalb der Unterklasse (nicht Gruppe) vorgenommen, und zwar erhält in jeder Unterklasse die Hälfte der gestarteten Bewerber, die das Ziel passiert haben (von 3 Bewerbern 2, von 5—3, von 7—4) Preise; der verfügbare Betrag wird so geteilt, daß jeder besser Gewertete das Doppelte wie sein Hintermann erhält. b) Vorgaberennen. Dasjenige Flugzeug, das mit der geringsten Antriebsleistung 'unter Entwicklung der größten Geschwindigkeit die größte Nutzlast trägt, wird vor den anderen begünstigt unter Zugrundelegung folgender Formel: In dieser Formel bedeuted t die theoretische Flugzeit in Sekunden für eine Strecke von a km, welche ein Flugzeug mit der Motorleistung von N errechneten Pferdestärken und einer Nuizlast (Gewicht des Führers, des Fluggastes und mitgeführten Ballastes) von Q kg benötigt. Die längste theoretische Flugzeit gibt die Grundlage für die voraussichtliche Dauer des Rennens. Die Differenzen, welche zwischen den einzelnen theoretischen Flugzeiten liegen, ergeben die Vorgabezeiten. Die Hälfte der gestarteten Bewerber, die das Ziel passiert haben, erhält Preise, und zwar jeder besser gewertete das Doppelte wie sein Hintermann. VI. Montage-Wettbewerb, 6000 M. 1. Preis 3000 M, 2. Preis 2000 M, 3, Preis 1000 M für denjenigen Bewerber, der für Montage und Demontage nach einem Fluge die kürzeste Zeit braucht. Gewertet wird diejenige Zeit, welche verlief vom Beginn der Montage bis zum Beginn des Fluges und vom Augenblick der Landung bis zum Abtransport von der Montagestelle. VII. Phot ographie-We11bewerb. Preis des Kaiserlichen Aero-Clubs 2000 M. Für diesen Wettbewerb erscheinen noch besondere Bestimmungen. Nennungen müssen bis zum 20. September 1913, 6 Uhr abends bei der Geschäftsstelle Berlin, Potsdamerstr. 112 eingegangen sein, und zwar schriftlich oder telegraphisch, in welchem letzeren Falle eine schriftliche Bestätigung der Meldung unter dem gleichen Datum unbedingt erforderlich ist. (Postaufgabestempel.) Nachnennungen sind.nicht statthaft. Der zweite Teil enthält die Ausfuhrungsbestimmungen. Ein italienischer Wasserflugzeug-Wettbewerb findet in der Zeit vom 2. bis 5. Oktober statt. Der Hauptwettbewerb besteht aus einem zweitägigen Wettfluge. Am ersten Tage haben die Flieger von Como über Bellagio, Lecco, Lodi, Cremona nach Pavia, eine 230 km lange Strecke in 14 Stunden, und am zweiten Flugtage über Pallanza und Varese zurück nach Como, 140 km in 10 Stunden zu durchfliegen. Am'5. Oktober findet ein Auf Stiegwettbewerb statt. Die Fluggeschwindigkeit muß mindestens'80 km in der Stunde betragen. Die Marine beabsichtigt, erfolgreiche Apparate anzukaufen. Als Grundpreis für einen. ca, 80 pterdigen Apparat ist 40 000 Lire angesetzt. An Geldpreisen stehen insgesamt 50000 Lire zur Verfügung. 2. Zweidecker, t=21 a 1. Eindecker, t=20a 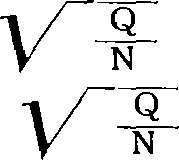 Patentwesen. Flugzeug mit seitlich stufenförmig übereinanderliegenden verstellbaren Tragflächen.*) Es sind bereits Flugzeuge bekannt, bei welchen die Tragflächen in eine Reihe einzelner Teilflächen aufgelöst sind, die stufenartig übereinanderliegen. Gemäß vorliegender Erfindung sollen diese Teilflächen jedoch zu einer einzigen Fläche zusammengelegt werden können. Die Stellung der beiden Tragflächen ist schräg nach oben gerichtet, um durch diese Anlehnung an den Bau des Vogelkörpers eine große Stabilität zu erhalten. Ferner bildet einen Gegenstand der Erfindung die Anordnung einer Vorrichtung, durch welche die einzelnen Klapprahmen verriegelt oder freigegeben werden können, je nach dem herrschenden Bedürfnis. Auf der Zeichnung ist ein schematisches Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Abb. 1 ist eine Ansicht von vorn, wozu Abb. 2 eine Draufsicht mit abgebrochenem Steuerschwanz ist. Mit a ist der Motor bezeichnet, welcher in einem besonderen Gerüst b tief unterhalb des eigentlichen Flugzeugkörpers angebracht ist. Der Flugzeugkörper besteht aus zwei schräg nach oben angeordneten Rahmen d und e, welche, wie aus Abb. 1 ersichtlich ist, zu einander parallel gestellt sind. 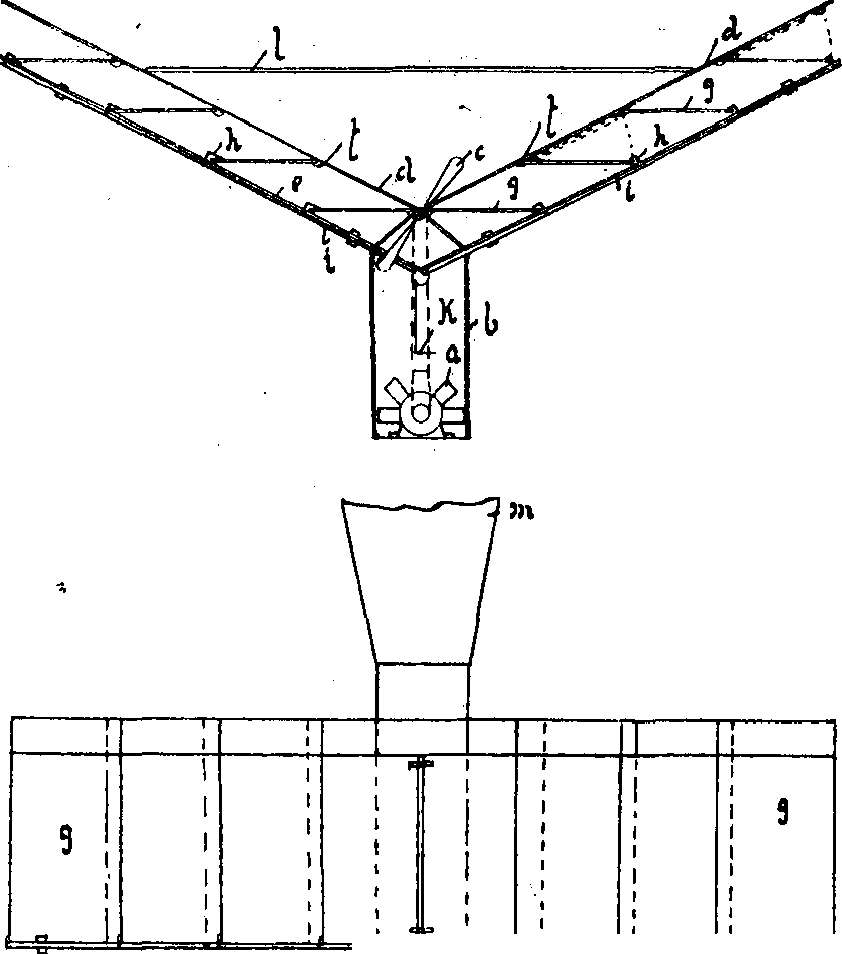 Abb. 1 Abb. 2 Die Tragfläche ist in eine Reihe Einzelflächen zerlegt, die stufenartig übereinander angeordnet sind. Hierbei sind die einzelnen Flächen g jedesmal bei f drehbar und gelenkig am oberen Rahmen d angeschlossen, so daß sie um diesen Punkt f eine Schwingbewegung auslühren und eine Stellung einnehmen können, wie auf der rechten Seite der Abb. 1 angegeben. Hierdurch soll erreicht werden, daß beim Uebergang in den Gleitflug eine in sich geschlossene Tragfläche entsteht. Bei der in Abb. 1 gezeichneten Stellung sind die einzelnen Teilflächen g durch Haken oder Verriegelungsvorrichtungen h festgehalten, die ihrerseits an *) D. R. P. No. 259 108 Reinhold Klämbt und Paul Schulze in Berlin. einer in der Längslichtung beweglichen Schiene i sitzen, welche durch den in der Nähe des Führersitzes befindlichen Handgriff k gesteuert wird. Dieser Griff k ist z. B. exzentrisch mit einer Schwingscheibe verbunden, an welcher die beiden Schienen i angelenkt sind. Die Verriegelungsvorrichtungen sind außerdem durch eine Feder oder eine automatisch wirkende Ausklinkvorrichtung so beeinflußt, daß sie auch bei Eintritt eines plötzlichen, außerwöhnlich hohen Druckes auf die untere Seite der Teilflächen selbsttätig aoslösen Patent-Ansprüche. 1. Flugzeug mit seitlich stufenförmig Ubereinanderliegenden verstellbaren Tragflächen, dadurch gekennzeichnet, daß die mit dem Rahmen drehbar verbundenen einzelnen Teilflächen durch Aufklappen nach oben sich zu einer genieinsamen geschlossenen Haupttragfläche vereinigen lassen, um eine mit Bezug auf das Flugzeug schräg nach oben gerichtete Haupttragfläche zu bekommen. 2 Ausführungsform der Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei zu großem Winddruck auf die Unterseite der Einzelflächen eine an sich bekannte, z. B. unter Federdruck stehende Ausklinkvorrichtung in Wirksamkeit tritt, welche die selbsttätig erfolgende Herstellung der geschlossenen Haupttragfläche ermöglicht. Flugzeug.*) Die Erfindung betrifft ein Flugzeug, dessen Flügel in bekannter Weise die Form von krummlinigen, symmetrisch zur Mittelachse angeordneten Dreiecken aufweisen und nach vorn ausladen. Das neue Flugzeug unterscheidet sich von den bekannten dieser Art dadurch, daß die vorn ausladenden, dreieckigen Flügel nach dem Mittelteil auslaufende Kanäle besitzen, an deren vorderen Enden herausschiebbare Hilfsflächen sich befinden. 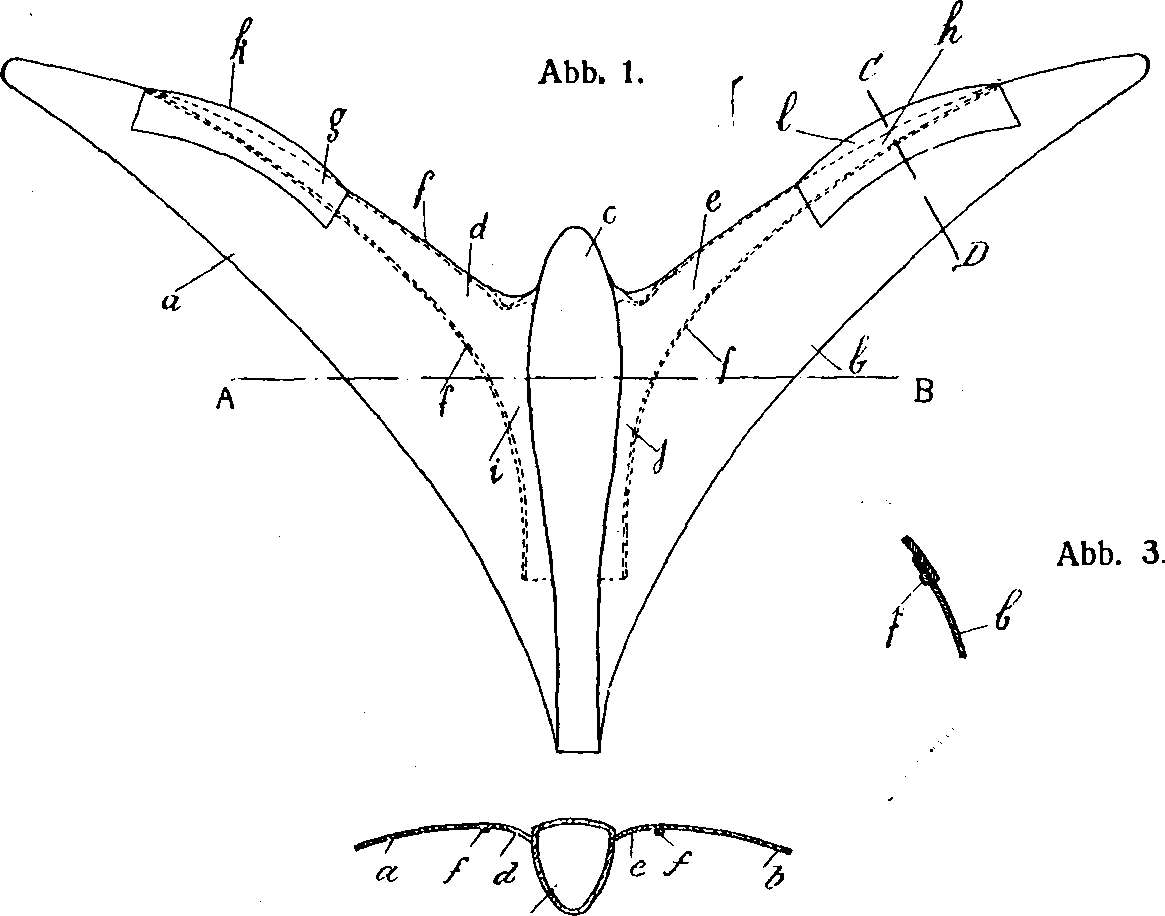 Abb. 2. Nach vorn ausladende Tragflächenenden an sich sind bereits bekannt. Auch verschiebbare Hilfsflächen an den Vorderkanten der Tragflächen anzubringen, ist bereits bekannt. Durch die Verwendung herausschiebbarer Hilfsflächen vor den nach dem Mittelteil auslaufenden Kanälen läßt sich jedoch dns Flugzeug gut im Gleichgewicht D. R. P. Nr. 263556 Dr. Joseph Cousin in Pertuis, Vaukluse, Frankreich. halten, weil durch die Veränderung der Eintrittsöffnung der Kanäle mehr oder weniger Luft gezwungen wird, unter den Flügeln gegen das Stoßzentrum des Flugzeuges zu strömen. Auf der Zeichnung ist der Gegenstand der Erfindung in einer Ausführungsform dargestellt und zwar zeigen: Abb. 1 eine Draufsicht des Flugzeuges, Abb. 2 und 3 einen Schnitt nach Linie A—B und C—D der Abb. 1 Die beiden Flügel a und b haben die Gestalt von zwei krummlinigen Dreiecken, die symmetrisch mit dem eiförmigen Rumpf c verbunden sind. Jeder Flügel zeigt auf seiner Unterseite einen Längskanal d und e, der außen am Vorderrande des Flügels beginnend und dem Rande folgend mehr oder weniger schräg zur Mitte des Rumpfes c verläuft. Diese Luftleitungskanäle können durch Aushöhlung der Flügel in ihrer Flugrichtung oder durch Stäbe f gebildet werden. An der Lufteintrittsseite g und h der Kanäle sind die bekannten gekrümmten Hilfsflächen k,l beweglich angeordnet, die beim Herausschieben der Luft den Eintritt versperren können Die Flächen erweitern oder verengen den Querschnitt der Kanäle und zwingen so die Luft mehr oder weniger gegen den Mittelpunkt des Flugzeuges abzufluten, sie bilden also gewissermaßen die Einlaßschützen für die Kanäle, die der Führer regelt und bewegt gemäß den Anforderungen der Gleichgewichtslage und Schnelligkeit des Flugzeuges. Pat ent - Ansp ruch. Flugzeug, dadurch gekennzeichnet, daß die nach 'vorn ausladenden, dreieckigen Tragflächen (a, b) mit nach dem Mittelteil auslaufenden Kanälen (d, e) versehen sind, an deren vorderen Enden aus der Tragfläche herausschiebbare Hilfsflächen (k, 1) sich befinden. Fahrgestell für Flugzeuge.*) Das Fahrgestell von Flugzeugen hat zwei Funktionen zu erfüllen, die teilweise miteinander in Widerspruch stehen. Es hat einmal beim Anlaufen zusammen mit den übrigen Teilen des Flugzeuges als selbständiges Fahrzeug zu dienen und soll ferner beim Landen die im Flugzeug vorhandene lebendige Kraft auf gefahrlose und sichere Art vernichten helfen. Für den ersteren Fall, beim Anlaufen müssen die Räder des Fahrgestelles in der Nähe des Schwerpunktes des Flugzeuges angeordnet sein, damit dieses 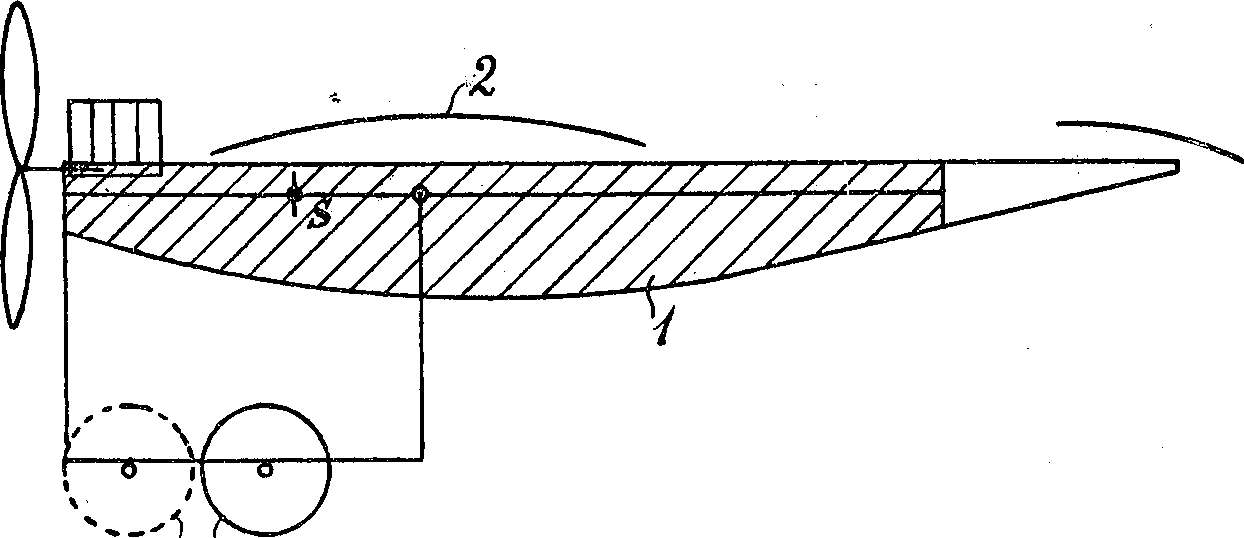 3 sich möglichst horizontal bewegt und beim Anstellwinkel Null der Flügel nach kurzer Zeit große Laufgeschwindigkeit erhält. Beim Landen dagegen berühren die Räder den Boden zuerst, und hat der darüber liegende Schwerpunkt das Bestreben, seinen Weg fortzusetzen. Deshalb *) D. R. P. Nr. 260183, E. Rumpier Luftfahrzeugbau G. m. b. H. in Berlin-Johannisthal. ist das Kippen des Flugzeuges beim Landen eine sehr häufige Erscheinung, die sich nur durch große Geschicklichkeit des Fliegers beseitigen läßt. Nach der vorliegenden Erfindung werden die Laufräier derart in der Richtung der Flugzeugachse verschiebbar angeordnet, daß sie beim Anlaufen in der Nähe des Schwerpunktes, beim Landen dagegen beträchtlich weiter nach vorn liegen. Auf diese Weise wird das Ueberkippen des Flugzeuges mit Sicherheit vermieden. Es sind zwar schon nach vorn ausschwingbare Laufräder bekannt, jedoch sollen diese beim Landen eingezogen werden, damit sie deh'Boden nicht berühren. Die Erfindung ist auf der Zeichnung schematisch 'dargestellt. Es sind 1 der Flugzeugkörper, 2 die Tragfläche, 3 die Laufräder, und zwar mit ausgezogenen Linien in der Anlauf-, mit punktierten Linien in der Landungsstellung gezeichnet. Die Bewegung der Räder oder ihrer Achse kann durch Seile, Hebel oder dgl. erfolgen. Patent-Anspruch. Fahrgestell für Flugzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß die Räder derart in der Längsachse des Flugzeuges verstellbar angeordnet sind,, daß sie sich beim Anlaufen in der Nähe des Schwerpunktes, beim Landen dagegen beträchtlich weiter nach vorn befind n. Flugzeug mit zwei gleichachsig und unmittelbar hintereinander angeordneten Propellern.*) Die Anordnung zweier Motoren und zweier Luftschrauben zum Antrieb eines Luftfahrzeuges zur Aufrechterhaltung des Betriebs beim Versagen eines der vier Teile ist bereits bekannt geworden Die Propeller laufen dabei gleich-achsig. Wenn nun einer der Motoren mit seinem Propeller derart verbunden ist, daß dieser bei ständig laufendem Motor nach Belieben entweder im Sinne der Vorwärtsbewegung, oder der Rückwärtsbewegung angetrieben oder auch abgekuppelt werden kann, so ergibt sie - eine Anordnung, die das Landen des 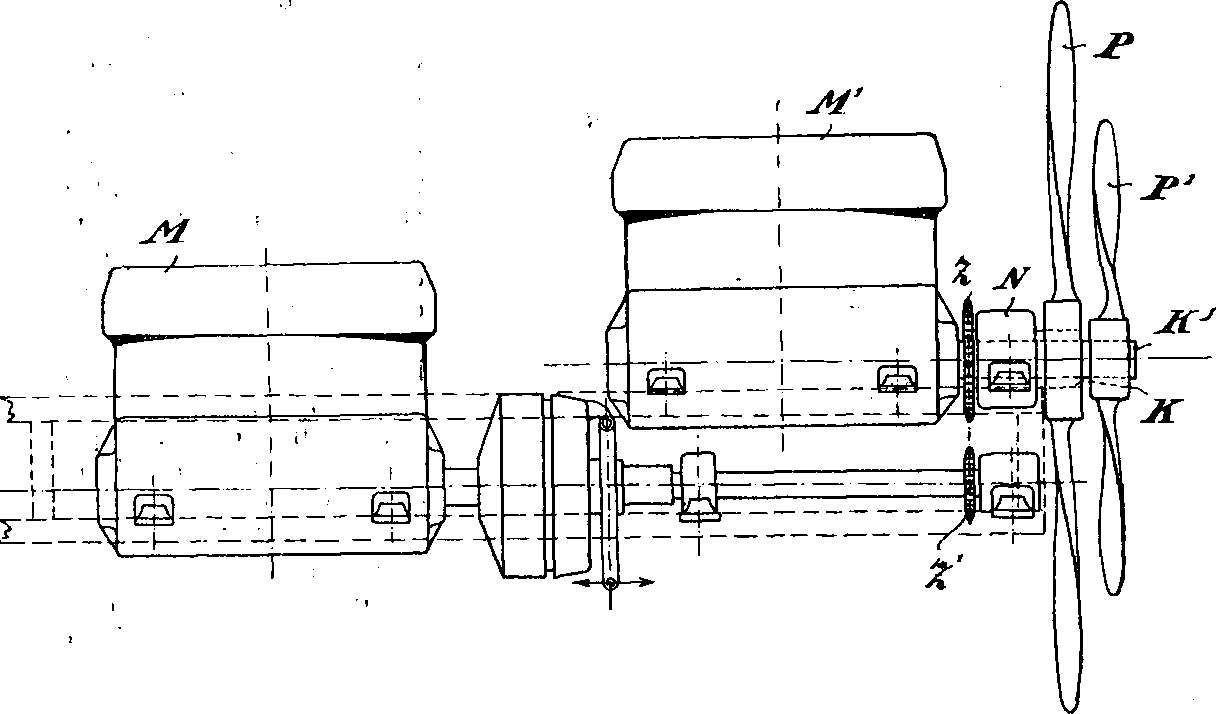 Flugzeuges erleichtert Soll nämlich ein Flugzeug landen, so ist man gewöhnlich gezwungen, es nach abgestelltem Propeller bis zum Stillstand rollen zu lassen. Ein Rückwärtslaufen des Motors mit seinem Propeller ist bei den üblichen Motoranlagen nahezu unausführbar. Mit der neuen Anordnung kann das Landen nun wie folgt vorgenommen werden : Zuerst wird der. eine der Motoren samt seinem Propeller abgestellt, und es wird mit dem zweiten Motor weitergeflogen. Nunmehr kann auch der zweite *) D. R. P. Nr. 263059 Boris Loutzkoy in Berlin. Propeller abgestellt werden, so daß das Flugzeug sich im Gleitflug dem Erdboden nähert. Während dieser ganzen Zeit ist die Möglichkeit gegeben, den ersten Motor und Propeller für Rückwärtsgang vorzubereiten, ihn „dazu klarzumachen". Sobald nun das Flugzeug'den Erdboden erreicht, kann durch Rückwärtslaufen dieses ersten Motors mit seinem Propeller gebremst werden. In der Zeichnung ist die neue Anordnung dargestellt; der eine Motor ist dabei mit seinem Propeller durch ein Wechselgetriebe verbunden, Die beiden Motoren M M1 treiben ihre Propeller P P1 an, und zwar M1 seinen Propreller unmittelbar, M den seinen mittelbar über Zahnräder Z Z1. Die Geschwindigkeiten können dabei zweckmäßig so gewählt werden, daß der kleinere Propeller schneller als der größere läuft. Die Achsen K K1 laufen zueinander gleichachsig und sind in dem Lager N gelagert. Ein Wechselgetriebe ist zwischen dem Motor M und seinem Propeller eingeschaltet, sodaß der Propeller in der einen wie auch in der anderen Richtung laufen kannn. Patent-Anspruch: Flugzeug mit zwei glechachsig und unmittelbar hintereinander angeordneten Propellern, von denen jeder unabhängig vom anderen durch einen besonderen Motor angetrieben wird, dadurch gekennzeichnet, daß einer der Motoren mit seinem Propeller derart verbunden ist, daß dieser bei ständig laufendem Motor nach Belieben entweder im Sinne der Vorwärtsbewegung oder der Rückwärtsbewegung angetrieben oder abgekuppelt werden kann. des Abb. 1 Flugzeug - Fahrgestell, dessen Streben in der Mittelebene Rumpfes angreifen.*) Die Erfindung bezieht sich auf ein Fahrgestell für Flugzeuge und betrifft insbesondere solche bekannten Fahrgestelle, deren Streben in der Mittelebene des Flugzeugrumpfes angreifen. Bei den bekannten Fahrgestellen dieser Art ragt stets eine Führungsstange, FUhrungssäule oder dergleichen tn den Flugzeugrumpf hinein, um letzteren gegen das Fahrgestell seitlich abzustützen. Der Nachteil dieser Ausbildung besteht aber darin, daß der betreffende Teil des Flugzeugrumpfes, in welchem die Stange, Säule oder dergleichen geführt ist, somit auch die Stange oder Säule selbst, außerordentlich ungünstigen Beanspruchungen, insbesondere auf Knickung ausgesetzt ist, wenn der Rumpf bei einer unsanften Landung seitlich schleudert. Die Erfindung bezweckt, diese Nachteile zu beseitigen. Zu diesem Zwecke ruht gemäß der Erfindung der Flugzeugrumpf seitlich lose auf den unter seinem Kiel befestigten Scheiteln der Fahrgestellstreben auf und wird hierbei gegen das Fahrgestell durch von diesem zum Rumpf führende Drahtseile abgestützt. Nach der Erfindung dient also das Fahrgestell lediglich zum Tragen desFIug- 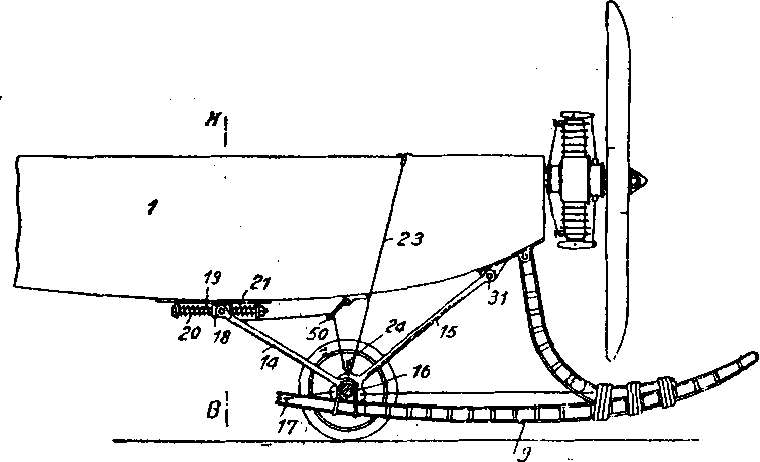 *) D. R. P. Nr. 263284. Max Oertz, Neuhof bei Hamburg. 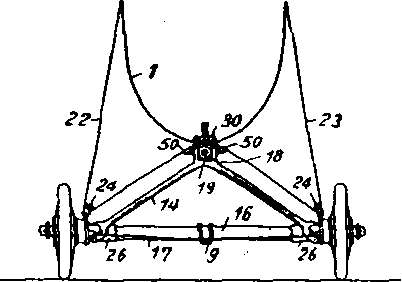 zeugrutnpfes, während die Abstutzung des letzteren ausschließlich durch die vom Fahrgestell zum Rumpf führenden Drahtseile bewirkt wird. Die schädlichen Beanspruchungen, wie sie bei den bekannten Fahrgestellen auftreten, werden also durch die neue Verbindung des Flugzeugrumpfes mit dem Fahrgestell auch bei unsanfter Landung vermieden. Der Erfindungsgegenstand ist in den beistehenden Abbildungen in zwei Ausführungsbeispielen dargestellt, welchen ein Flugzeug mit bootsförtnigem Rumpf zugrunde gelegt ist. Abb. 1 ist eine Seitenansicht des einen Ausführungsbeispiels. Abb 2 ist eine Ansicht von unten. Abb. 3 ist ein Schnitt nach Linie A—B der Abb. 1. Abb. 4 veranschaulicht in Seitenansicht das andere Ausführungsbeispiel, und Abb. 5 ist ein Schnitt nach Linie C—D durch Abb. 4. Bei dem Ausführungsbeispiel nach Abb. 1 bis 3 besteht das Fahrgestell aus zwei starren Winkelstützen 14 und 15. Die freien Schenkel beider Stützen sitzen auf der Radachse 16 vermittels der Buchsen 26, 26 und werden an einem Auseinandergehen durch das Seil 17 verhindert, welches die freien Enden der Strebe 15 über das hintere Ende der Kufe 9 hinweg miteinander verbindet. Der Scheitel der Strebe 15 ist unterhalb des Kieles 30 des Flugzeugrumpfes 1 bei 31 drehbar befestigt. Der Scheitel der Strebe 14 ist ebenfalls unterhalb des Kieles 30 des Flugzeugrumpf es; 1 drehbar mit der Hülse 18 verbunden, welche sich auf dem Bolzen 19 zwischen den Federn 20 und 21 hin und her bewegen kann. Die seitliche Abstutzung Abb. s des Rumpfes 1 gegenüber dem Fahrgestell erfolgt lediglich durch die Drahtseile 22 und 23, welche von der oberen Kante des Rumpfes 1 nach unten durch die an den Buchsen 26,26 befestigten Scheiben 24,24 und von hier durch die unter- Abb. 4 halb des Kieles 30 des Flugzeug- e rumpfes 1 befestigten Scheiben | 50,50nach dem Scheitel der Strebel4 führen, an welcher sie einzeln vermittels des Ringes 51 befestigt sind. Findet eine unsanfte Landung statt, so wird infolge der beschriebenen Verbindung des Rumpfes mit dem Fahrgestell letzteres zunächst den Stoß vorzüglich aufnehmen, ferner wird aber auch jede gefährliche insbesondere Knickbeanspruchung der Verbindung von Fahrgestell und Rumpf vermieden, weil die Abstützung des letzteren lediglich durch die Drahtseile 22, 23 erfolgt. Bei dem Ausführungsbeispiel nach Abb. 4 und 5 besteht das Fahrgestell aus den beiden Winkelstreben 14' und 15'. Jede dieser Streben ist an der Biegungsstelle In üblicher Weise durch Gummizüge 27 an der Radachse 16' des Fahrgestells federnd aufgehängt. Das vordere Ende jeder Strebe 14', 15' ist drehbar bei 40 unterhalb des Kieles des Flugzeugrumpfes befestigt, das hintere freie Ende jeder dieser Streben ist ebenfalls drehbar unterhalb des Kieles des Flugzeugrumpfes 1 befestigt, und zwar in einem Scharnier 28. Dieses At,b- 5 ist bei 41 drehbar unter dem Kiel des Flugzeugrumpfes befestigt und^gegen den letzteren durch die elastische Zwischenlage 42 federnd abgestützt. Die Winkelstreben
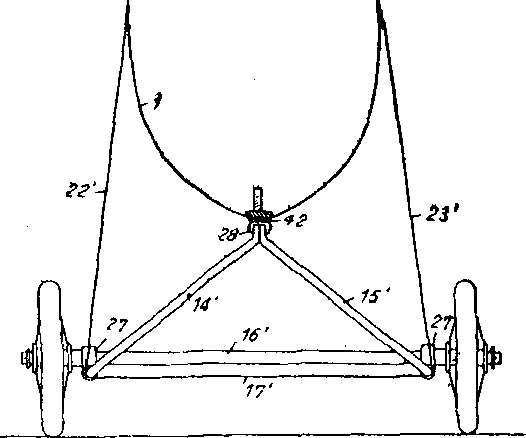 14', IS' werden durch das an ihnen befestigte Drahtseil 17': an einem seitlichen Ausweichen verhindert. Die Abstützung des Rumpfes 1 gegen das Fahrgestell erfolgt durch die beiden Drahtseile oder dergl. 22' und 23', welche einerseits mit dem Rumpf 1 und andererseits mit den Streben 14', 15' verbunden sind. Auch bei dieser Ausfiihfungsform wird das bei der vorerwähnten Ausfiihrungs-form beschriebene vorteilhafte Verhalten der Fahranordnung beim Landen erzielt. Für beide Auslührungsformen ist noch hervorzuheben, daß sich die von den Streben 14, 15 bezw. 14', 15' erlittenen Stöße nahezu in der Längsrichtung des Rumpfkieles fortpflanzen, also von letzterem außerordentlich günstig aufgenommen werden. Statt der dargestellten Ausführungsform mit zwei Winkelstreben könnte man auch eine einzige Winkelstrebe anwenden, welche von der Radwelle nach oben führt und mit ihrer Spitze, wie jede (1er Streben 14, 15 bezw. 14', 15', in der Mittellinie des Rümpfbodens angreift. Es würden dann anßer den Seitenstütz-seilen 22, 23 bezw. 22, 23' noch weitere Drahtseile vorgesehen werden müssen, welche von dem Radgestell nach vorn und hinten an den Boden des Rumpfes führen, um das Radgestell gegen diesen abzustutzen. Diese Drahtseile würden beispielsweise ungefähr in der Richtung der Streben 14 und 15 der Abb. 1 zu laufen haben. Patent-Anspruch. Flugzeug-Fahrgestell, dessen Streben in der Mittelebene des Rumpfes angreifen, dadurch gekennzeichnet, daß der Rumpf auf den unter seinem Kiel befestigten und nur bis zu diesem reichenden Scheiteln der Fahrgestellstreben aufruht und hierbei gegen das Fahrgestell durch von diesem zum Rumpf führende Drahtseile abgestutzt wird. Verschiedenes. Dritter Internationaler Kongreß für Luftrecht zu Franfurt a. M. Vom 25. bis 27. September 1913 findet in den Räumen der Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften zu Frankfurt, Jordanstrasse 17, der dritte Kongreß für Luftrecht statt. Erster Tag: Donnerstag, den 25. September. Vormittags 9 Uhr: Oeff entliche Eröffnungssitzung. (Anzug. Ueberrock) 1. Eröffnung des Kongresses durch den Ehrenpräsidenten, Seine Excellenz Staatsminister a. D. Otto von Nentig, Berlin. 2. Begrüßungs - Ansprache des Herrn Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am1 Main und des Herrn Rektors der Akademie für Sozial-und Handelswissenschaften. 3. Ansprache des Präsidenten des Comite juridique international de l'aviation 4. Wissenschaftlicher Vortrag des Herrn Qeheimrat Prof Dr. Zitelmann, Bonn. Vormittags 11 Uhr: Erste geschäftliche Sitzung des Kongresses. 1. Feststellung der Anwesenheitsliste und Bildung des Bureaus. 2. Bericht des Delegue international. 3. Beratung des Code international de l'air, Buch II, Zivilrecht^ insbesondere die Haftpflicht der Luftfahrer. Fortsetzung der Beratungen des Qenfer-und des Pariser-Kongresses. Mittags 1 Uhr: Gemeinsames Frühstück (Einladung des Deutschen Nationaldelegierten.) Nachmittags 4 Uhr: Fortsetzung der Beratungen. Abends 9 Uhr: Bierabend. (Einladung des Frankfurter Vereins für Luftfahrt. und des Frankfurter Flugsportclubs. Anzug beliebig.) Zweiler Tag: Freitag, den 26. September. Vormittags 9l|s und Nachmittags 3% Uhr: 1 Fortsetzung der Beratungen. 2. Satzungsänderungen. 3. Schluß - Ansprachen. Mittags 1 Uhr: Gemeinsames Frühstück (Einladung der Stadt Frankfurt a M.) Abends 8 Uhr: Festessen u im Frankfurter Hof. (Anzug: Frack)' Preis des trockenen Couverts 8 Mark. Dritter Tag: Samstag, den 27. September.' Besichtigung des Luftschiffhafens zu Frankfurt am Main, der Frankfurter Euler-Flugzeugwerke und sonstiger Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ausflug zum Römerkastell Saalburg bezw an den Rhein. Die deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft hat bei günstigem Wetter eine Fahrt mit einem Zeppelin - Luftschiff zu Ehren der Kongreßteilnehmer in Aussicht gestellt. Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an das Sekretariat, Frankfurt am Main, Neue Mainzerstraße 76,11. ϖ 1 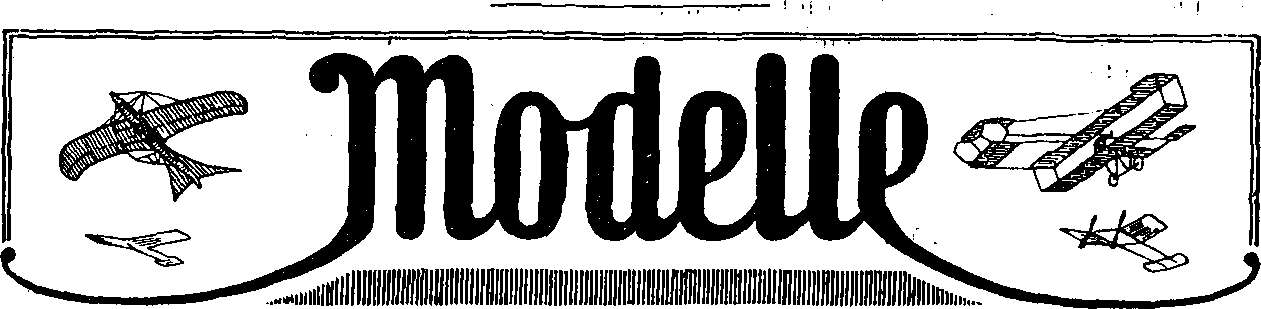 Das Behle-Schraüberilager dürfte den Wünschen der Modellbauer entsprechen, da es eine bedeutende Qummiersparnis und Vergrößerung der Flugweite ermöglicht. Die Hakenwelle a ist mit einem aufgelöteten Ah-■1 schlagbund versehen, an den sich die Lagerschale b leicht anlehnt. An dem einen Ende derselben ist eine rechteckige Platte zur Lager-^«■> befestigug aufgelötet, an dem d anderen dagegen befindet sich der Laufkranz für die Kugeln. Mittels des Lagerkonus c werden die Kugeln in dem Laufkranz b festgehalten. Zur Sicherung des Konus ist die Gegenmutter d auf der Schraubenwelle a aufgeschraubt. Die Gummiersparnis beträgt ca 30°/o- Frankfurter Flugmodell-Verein. Am Sonntag den 7. September fand in Darmstadt die 'Vorprüfung für das im Oktober vom Darmstädter Verein für Luftfahrt e. V. veranstaltete Modellwettfliegen statt, an dem sich 6 Mitglieder des Frankfurter Flugmodell-Vereins 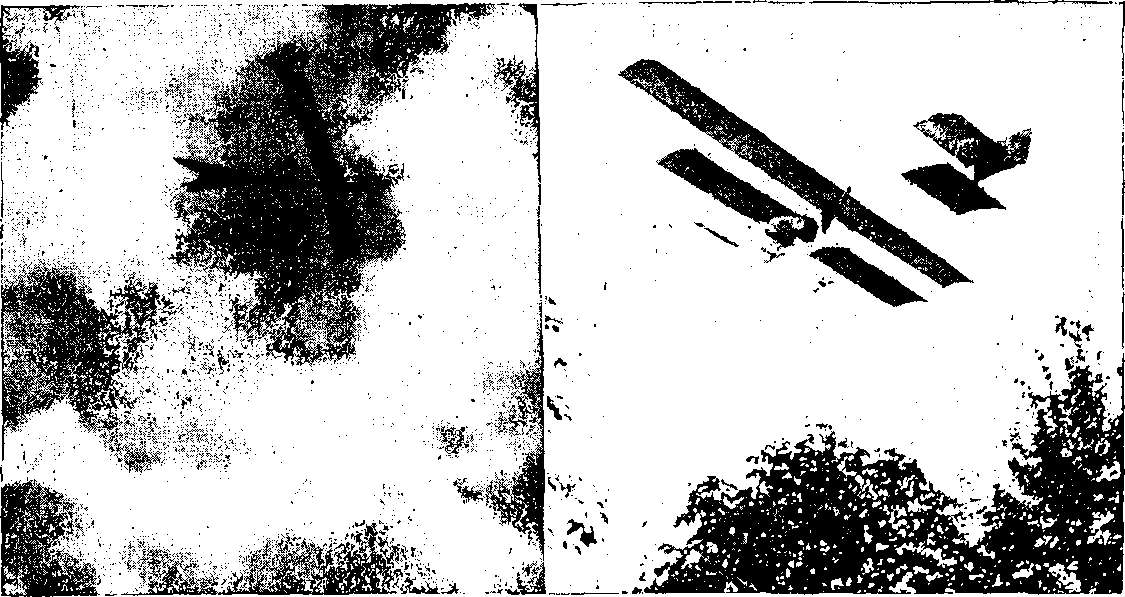 Links: Eindecker-Modell Specht Frankfürt (M) im Lluge. Rßchts: Doppeldecker-Modell Ky/iecinski in Hohensalza von 1,4 m Spannweite im Flage, 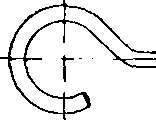 mit insgesamt 10 Modellen beteiligten. Am Start waren erschienen: W. Ripper (3 Eindecker, darunter ein „Ententyp"), Adolf Jäger (2 Eindecker), Karl Jäger (2 Eindecker, darunter ein „Ententyp"), Theodor Specht (1 Eindecker), Fritz Wittekind (1 Eindecker) und C. Weiss (1 Eindecker). Die Prüfung fand bei der denkbar ungünstigsten Witterung bei Regen und 6 Sek.-Meter Wind statt, trotzdem wurden gute Resultate erzielt. Die beste Leistung hatte Specht zu verzeichnen bei Bodenstart mit 76 m; dann folgten Karl Jäger mit 71 und 46 m, Ripper mit 55, 39 und 25 m und Adolf Jäger mit 54, 45, 27 und 25 m. Bei dem am Sonntag den 14. d. Mts. stattgefundenen Uebungsfliegen erzielten trotz schlechten Wetters W. Ripper, A. und K. Jäger, Kopietz und le Dous schöne Flüge. Besonders interessant verliefen die Versuche von Kopietz mit einem schwanzlosen Eindecker, sowie mit einem Tandem-Eindecker mit je einer Zug- und Druckluftschraube. Donnerstag den 18. d. Mts. findet im „Caf6 Hauptwache" eine zwanglose Zusammenkunft statt, zu der alle Mitglieder höfl. eingeladen sind. Neue deutsche Fernflüge. Habsheim—Warschau. Viktor Stoeffler auf Aviatik flog am 16. Sept. um 12:30 auf dem Habsheimer Flugplatz mit 430 kg Benzin ab und landete ohne Unterbrechung um 8 : 30 30 km entfernt von Warschau. Für die annähernd 1200 km lange Flugstrecke benötigte Stoeffler 8 Stunden. Diese Leistung ist bisher noch nicht erzielt worden. Freiburg—Königsberg. Stiefvater auf Jeannin stieg am 16. Septbr. vorm. 4 : 30 in Freiburg auf, machte 11 :20 in Gotha eine Zwischenlandung, flog um 12 : 30 weiter und erreichte nach einer Zwischenlandung in Elbing 6 : 35 abends Königsberg. _ Literatur.*) Das hohe Ziel. Roman von Wilhelm Rubiner. Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Berlin. Preis geh. Mk. 4.- geb. Mk. 5. - Der Techniker wird sagen „nur ein Roman". Jedoch wichtig und lesenswert für alle diejenigen, die glauben, im Flugwesen große Reichtümer erringen zu können. Man findet viele Skizzen und Bilder, die nicht erfunden sind, die den Eingeweihten als Vorgänge bei der Entwicklung des Flugwesens bekannt sind. Der Verfasser Wilhelm Rubiner führt uns mitten hinein in die Kreise der Flieger und Flugzeugkonstrukteure, mitten hinein in die Vielgestaltigkeit einer jungen aufstrebenden Fabrik, in der die Apparate erfunden und erbaut werden, die den Menschen durch die Lüfte tragen. Mit großer Gestaltungskraft entrollt er das Schicksal zweier Fabrikanten, die umgeben von wirtschaftlichen Krisen ihr Unternehmen mit ungeheuren Schwierigkeiten zu halten suchen, bis sie schließlich doch der Macht des Großkapitals weichen müssen. Der eine von ihnen, Erhard Höfer, wird zum Helden des Romans. Da es ihm nicht vergönnt ist, die eigene Fabrik zu halten, stellt er seine ganze Kraft in fremde Dienste und sucht durch neue geniale Konstruktionen seiner Firma zu nützen. Aber wie im Leben gerade die Besten häufig vom Mißgeschick verfolgt werden, so ist Höfer in seinen Projekten nicht immer glücklich, Enttäuschung folgt auf Enttäuschung, Fehlschlag auf Fehlschlag. Und in dem Augenblick, da er dem Ziel seiner Wünsche endlich ganz nahe ist, und mit einem von ihm konstruierten Flugzeug den Probeflug wagt, wird er fast das Opfer eines feigen Anschlags auf sein Leben. Der Flieger. Ein Buch aus unseren Tagen. Roman von Leo Adelt. Preis geh. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.— Ein in sprachlicher Hinsicht sauberes und selbst für Verwöhnte zu empfehlendes Erzeugnis. Das Buch ist von einem Kenner des Flugwesens geschrieben. Für denjenigen, welcher die Entwicklung unserer Technik mitgemacht hat* werden die in die Schilderungen hinein geflochtenen Skizjen von Lilienthal, Santos-Dumont und der später folgenden besonders interessieren. *) Sämtliche besprochenen Bücher können durch die Expedition des „Flugsport" bezogen werden.  Jllustrirte No 20 technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnemem: 1. Oktober für das gesamte TSZl^u mmi „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef.4557 Amt I. Oskar UrsinUS, CivillngenieuP. Tel.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz8. Erscheint regelmäßig 14tägig. : Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdrnck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 15. Oktober. Organisationsfragen. Wir haben jetzt in Deutschland Flugmaschinen, die etwas leisten. lOOtausende von Kilometern sind durchflogen. Die vorhandenen Maschinen befinden sich zum größten Teil im Besitze der Heeresverwaltung und im Besitze der Industriellen. Das ist das deutsche Flugwesen. — Ferner spricht man von Flugtechnik und von einem Flugsport. Der Flugsport im Sinne des Wortes wird nur von den Firmen ausgeübt. Andererseits versteht man unter Flugsport auch die Betätigung von interessierten Kreisen neben der eigentlichen Fliegerei. Einen Flugsport von Amateuren, Herrenfliegern, genau genommen im Sinne des Wortes, gibt es- nicht; Die Entwicklung jeder neuen Sache, so auch das Flugwesen, erfordert Bestimmungen und , nicht zum letzten reichsgesetzliche Regelung. In Frankreich wurde die Regelung in erster Linie den verschiedenen Organen privater Eatur, Vereinen, übertragen. Das Flugwesen besteht in Frankreich aus den Militärfliegern und der' Flugindustrie. Beide sind von einander abhängig. Die Interessen mögen jedoch nach verschiedenen Eichtungen sich verlaufen. Die Regelung der militärischen und andererseits der wirtschaftlichen Fragen der Industrie machte eine Zentralinstanz erforderlich. Es scheint jedoch, als ob in Frankreich die Regelung der Fragen in befriedigendem Sinne für beide Seiten nicht gelöst worden ist. Jedenfalls sprechen die letzten Vorgänge im Aero-Olub de France, das gegenseitige Befehden der Vereine unter sich, nicht dafür. Ob sich eine befriedigende Lösung der Regelung des Luftverkehrs in Frankreich auf diese Weise noch durchführen läßt, möchte man bezweifeln, da die Interessen zu verschieden sind. Die Interessen der Heeresverwaltung mögen ja natürlicherweise von einzelnen Vereinen, Freunden die mit früheren Offizieren etc. gewohnheitsmäßig in engerem Verkehr stehen, deren Wünschen entsprechend vertreten werden. Auf der anderen Seite steht die Interessen-Vertretung der Chambre Syndicale, die richtig genommen den obigen nicht subordiniert, sondern cordiniert ist. Denn von der wirtschaftlichen Lage der Industriellen hängt die ganze Lebensfähigkeit des Flugwesens überhaupt ab. In Frankreich ist man in einer Sackgasse, in der man ■wohl umkehren muß. Wenn auch verschiedene Persönlichkeiten die Situation durch Ueberredungskünste zu retten versuchen, so wird die französische Flugindustrie an dem dürren Ast dieser Vereius-organisation keine genügende Stütze finden können. Im Gegensatz hierzu hat sich das deutsche Flugwesen in den letzten Wochen günstiger, zielbewußter entwickelt. Wirtschaftliche Interessen können eben nicht durch Organisationen von Mitgliedern, die gezwungen sind, private Interessen zu vertreten, wahrgenommen werden. Die Entwicklung des Flugwesens überhaupt setzt, wie bereits erwähnt, eine Entwicklung der Flugindustrie voraus. Und nach dieser einfachen Logik' hat man seit Jahren vergeblich gesucht, trotzdem wir in anderen Industriezweigen diesen Weg auch bereits gegangen waren. Die Entwicklung und der Fortschritt in dieser Hinsicht setzten ein mit der Nationalflugspende. Ks ist ein Verdienst Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen, daß er seinerzeit kurzer Hand mit dem Reichsamt des Innern die Organisation für die Nationalflugspende und alles, was wir jetzt besitzen, schuf. In welcher glänzenden Weise die Nationalflugspende gewirkt hat, beweisen die Erfolge. Die Industrie hat sich willig in den Dienst der Sache unter dieses Regime gestellt und diesmal alles das erfüllt, was wir Jahre lang von ihr erhofften. Von vielen ist das hohe Ziel, Flieger zu werden, erreicht worden! Viele Flugzeugfabriken, denen die Kraft zu versagen begann, sind gestärkt worden! Und als jetzt noch in den letzten Tagen die großen Preise für die Fernflüge ausgesetzt wurden, flogen programmäßig verschiedene Flieger nach Westen, Osten, Norden und Süden und erzielten großartige Leistungen. Die Heeresverwaltung verfügt heute durch das Ergebnis der Nationalflugspende über einen Stamm von Reservefliegern für den Ernstfall, welche die von der Heeresverwaltung gestellten Anforderungen an die Fähigkeit eines Militärfliegers erfüllen und wir werden noch sehr fleißig auf dem beschrittenen Wege weiter gehen müssen, um eine genügende Anzahl brauchbarer Militärflieger im Ernstfalle zur Verfügung zu haben. Es liegt in der Natur dieser Sache, daß ihre Zahl nie zu groß werden kann. Eine große Zahl gut ausgebildeter Flieger gibt der Industrie ferner die Möglichkeit, ihre Erzeugnisse weiter zu entwickeln und zur Verwendung zu bringen. Hoffen wir, daß sich das deutsche Flugwesen unter solchen Gesichtspunkten, frei von allem unnützen Ballast, auf diesem nunmehr beschrittenen Wege, auf dem sieh keine hindernden Zwischeninteressen bewegen, weiter entwickelt. Euler-Wasser-Dreidecker. Der Wasserflugmaschirie mit zwei Schwimmern ist nach oben hin, wenn sie seetüchtig bleiben soll, eine Grenze gezogen. Die Erfolge der neuesten Maschinen von Farman und Avro beruhen in erster Linie auf dem geringen Gewicht. Nur dadurch ist es möglich, eine Wassermaschine bei Seegang aus dem Wasser zu bringen. Wenn indessen die Leistungsfähigkeit der Wasserflugmaschine inbezug auf den Aktionsradius und das Tragvermögen vergrößert werden soll, so läßt sich dies ökonomisch bei der Zweischwimmer-Maschine nicht mehr durchführen. Der einzige Weg. der den Kon strukteuren vorgezeichnet ist, ist die" Konstruktion der Einschwimmer Maschine. Pnorbei ist Bedingung, um eine große seitliehe Stabilität zu erzielen, den Schwerpunkt möglichst tief zu legen. Die großen Motorleistungen und hiermit verbundenen größeren Gewichte bedingen ein größeres Tragflächenareal. Alle diese Gesichtspunkte kommen in der Konstruktion des neuen Euler-Dreideckers verschiedentlich zum Ausdruck. Dieser Wasser-Dreidecker besitzt drei Tragdecken, von denen das Oberdeck eine Spannweite von 14 m, das mittlere Deck eine Spannweite von 10 m und das Unterdeck eine Spannweite von 8 m besitzt. Die oberen seitlichen Tragdeckenenden können durch einige Handgriffe nach unten geklappt werden, sodaß die Spannweite um 4 m reduziert werden kann. Die oberen Tragdecken sind gegen das untere nach vorwärts gestaffelt. Der hinter den Tragdecken liegende 100 PS Gnom-Motor ist durch das rückwärts liegende untere Tragdeck gegen abgehende Bugwasser geschützt. Das Benzinreservoir faßt ca. 150 1 und ist, um den Schwerpunkt möglichst tief zu halten,  in das Gleitboot verlegt. Von diesem Hauptbenzinreservoir führt ein Benzinrohr nach dem Ueberlauf-Benzinreservoir in der Höhe des Rotationsmotors. Um das lästige Druckaufpumpen auf das Hauptbenzinreservoir zur Benzinzufuhr zu vermeiden, ist am hinteren Teil des Gleitbootes ein besonderes Luftreservoir, in welchem komprimierte Luft enthalten ist, vorgesehen. Aus diesem wird durch das Reduzierventil automatisch Luft in das Hauptbenzinreservoir geführt 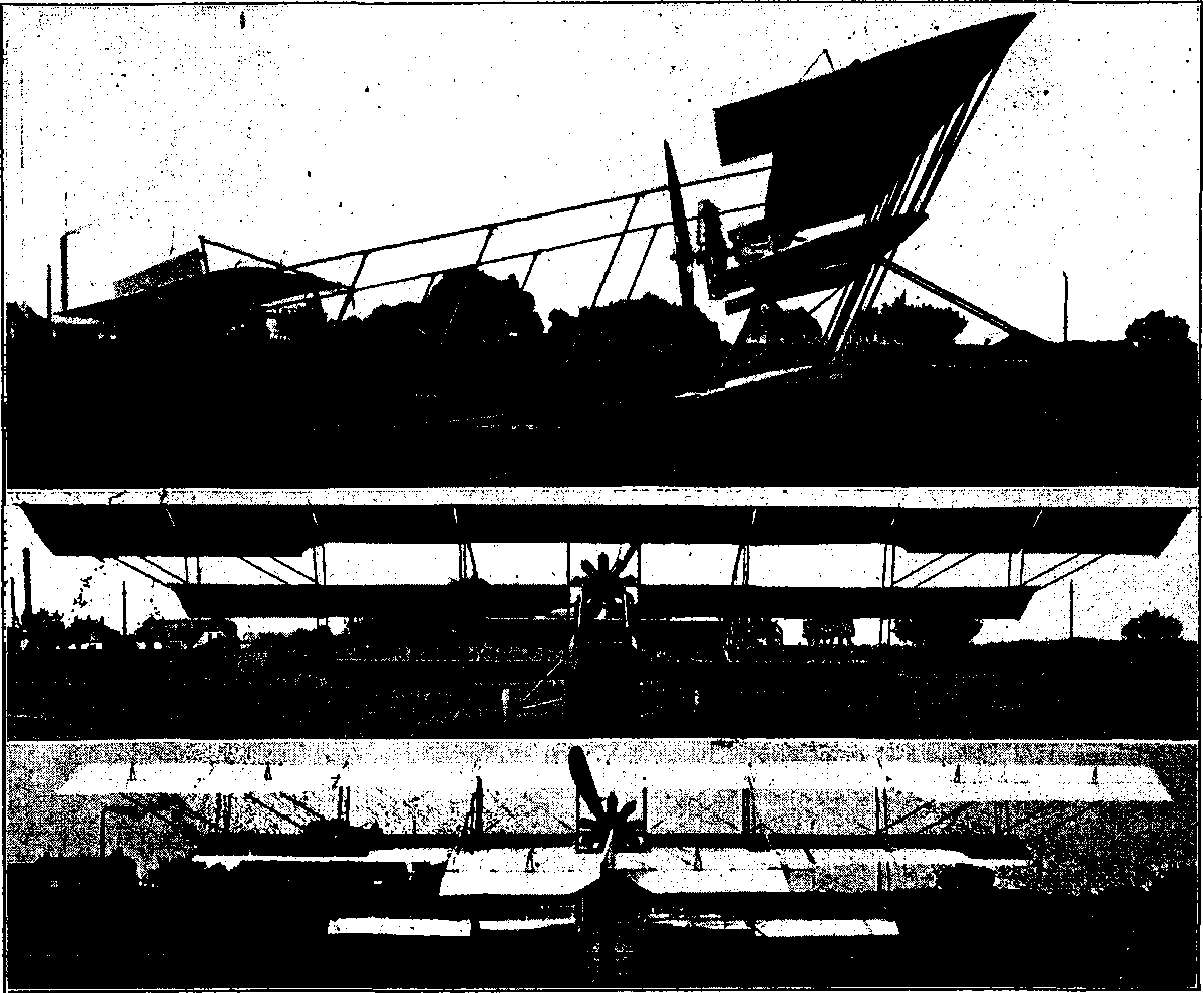 Eu/er-Wasser-Dreidedber. (Seiten-, Vorder- und Hinteransicht.) und hält dieses unter einem bestimmten Druck. Das Luftdruckreservoir ist so groß bemessen, daß fortgesetzt das Hauptbenzinreservoir unter Druck steht Ein Nachpumpen mittels Hand ist somit nicht erforderlich. Das Höhen- und Seitensteuer ist durch Streben mit den Tragdecken verbunden. Die Kräfte werden also nicht durch das Gleitboot übertragen. Das Gleitboot von 7 m Länge und 1 m Breite ist stufenförmig ausgebildet. Der schwanzförmige Teil hinter der Stufe ist wasserdicht verkleidet. Der Führersitz befindet sich vor dem Gastsitz. Neben dem Führersitz ist das hochziehbare, sehr einfache und robuste Fahrgestell angeordnet, welches sich bei mehreren Landflügen bereits sehr gut bewährt hat. Der Nieuport-Wasser-Anderthalbdecker. Auf Grund der in Monaco und Deauville gemachten Erfahrungen konstruierte die Firma Nieuport einen Anderthalbdecker, der den speziellen Wünschen der französischen Heeresverwaltung inbezug auf freien Ausblick, geschützte Lage der Luftschraube und Anordnung von Reserveschwimmern für den Fall des Kenterns in vollkommenster Weise entspricht. Die Maschine ruht auf zwei Schwimmern der 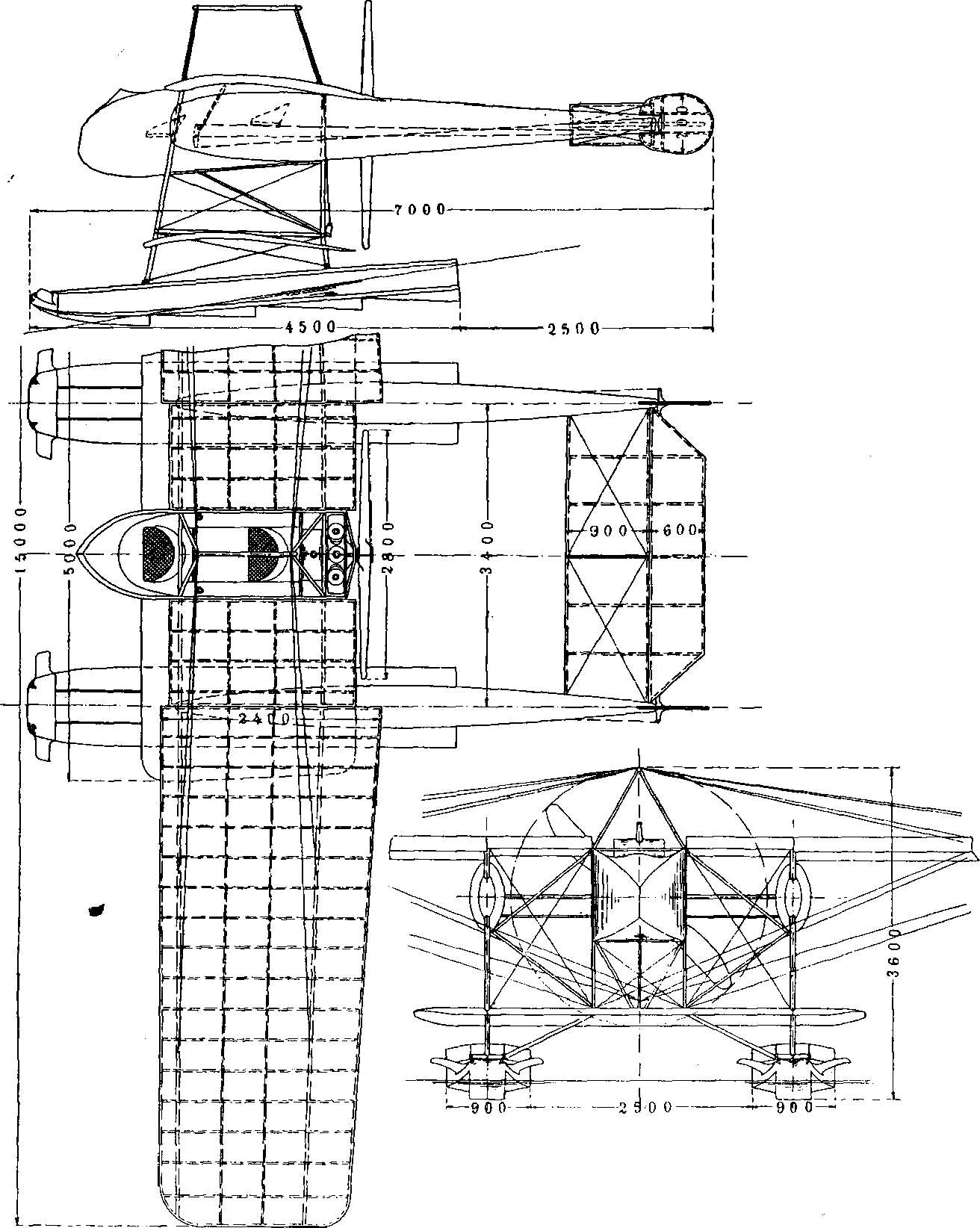 Der Nieuport- Wasser-Anderthalbdecker. nieuportsohen Ausführungsart, die in ihrem Deplacement bedeutend vergrößert und zur Sicherheit gegen Leckwerden in wasserdichte Zellen unterteilt "worden sind. Eine kräftige Stahlrohrversteifung verbindet die Schwimmer mit den Tragflächen. Das Unterdeck besitzt eine Spannweite von 5 m, ist 10 qm groß und weist ein bleriot-ähnliches Profil auf. Ueber dem Deck befindet sich der Motorrumpf und die 30 qm große Haupttragfläche. Der Motorrumpf verjüngt sich ziemlich scharf nach vorn, ist teilweise mit Blech verkleidet und gestattet ein bequemes Ein- und Aussteigen der Insassen. Vorn befindet sich der Beobachtersitz, dahinter der Führersitz und am Ende des Rumpfes ist ein 110 PS Salmsonmoter eingebaut, der eine Luftschraube von 2,8 m Durchmesser antreibt. Zu beiden Seiten und im Rücken des Führersitzes sind die Betriebsstoffbehälter angeordnet. Die Steuerung ist die bekannte Nieuportsteuerung. die eine geringfügige Abänderung für die Betätigung des Höhensteuers erfahren hat. Von dem bekannten Steuerhebel wird eine horizontal zum Führersitz gelagerte Welle angetrieben, die in beiden Monocoquerümpfen endigt. Hier befinden sich zwei doppelarmige Steuerhebel, von denen die Höhensteuerseile nach der Schwanzfläche führen. Die Seitensteuerseile sind gleichfalls in den Rümpfen untergebracht. Die Haupttragfläche hat eine Spannweite von 15 m. Der mittlere Teil derselben, zu beiden Seiten des Motorrumpfes, hat das gleiche Profil wie das Unterdeck und ist stets mit dem Maschinengestell fest verbunden. Die daranstoßenden Ansatzflächen verjüngen sich trapezartig nach außen und sind an jedem Flügelholm zweimal mittels Drahtseil verspannt. Am verjüngten Ende der Monocoquerümpfe ist eine rechteckige Dämpfungsfläche angeordnet, an die sich eine trapezartige Höhensteuerfläche anschließt. Die beiden Seitensteuer umfassen oben und unten die Rumpfenden und sind aus autogen geschweißten Stahlrohrrahmen mit wasserdichter Stoffbespannung hergestellt. Als hauptsächliches Konstruktionsmaterial ist in ausgiebigstem Maße nahtloses Faconstahlrohr angewendet worden. Auf eine leichte Montage der Schwimmer und Tragflächen, sowie schnelle Lösbarkeit der Verspannungsorgane ist besonderer Wert gelegt. Sämtliche Metallteile sind gegen Seewasser unempfindlich. Der Wasser-Zweidecker Breguet. Einschwimmertyp von Deauville. (Hierzu Tafel XXV.) Zu den interessantesten Wasserflugzeugen, die in Deauville vertreten waren, gehört der Einschwimmertyp von Breguet. G-egenüber dem Monacotyp zeigt die vorliegende Konstruktion einige Verbesserungen. Die Maschine ruht auf einem abgefederten Mittelschwimmer, der ein Deplacement von 2550 1 hat. Seine Länge beträgt*4,5 m, seine Breite 1,6 m und seine grösste Höhe 0,45 m. Ueber dem Mittelschwimmer befinden sich die anderthalbdeckartig angeordneten Tragflächen. Das Oberdeck ist bei 15,5 in Spannweite 30 qm und das Unterdeck bei 11,50 m Spannweite 18 qm gross, so dass der Gesamtflächeninhalt 48 qm beträgt. Zwischen den zwei mittleren Vertikalstreben ist der tropfenförmig gestaltete Motorrumpf angeordnet. Derselbe trägt vorn einen 200 PS 14 Zyl. Salmson-Mo-tor, der eine Luftschraube von 2,8 m Durchmesser antreibt. Hinter dem Motor befindet sich ein Betriebsstoffbehälter, dessen Inhalt für einen Vierstundenflug ausreicht. Die Sitze sind hinter dem Betriebsstoffbehälter angeordnet und zwar liegt der Führersitz vorn, der Begleitersitz dahinter. Die Steuerung ist die bekannte Breguetsteuerung, die in „Flugsport" Nr. 20 Jahrgang 1911 eingehend beschrieben und konstruktiv dargestellt wurde. Die kreuzförmig angeordnete Schwanzfläche ist wie früher mittels Kardangelenk am verjüngten Motorrumpfende gelenkig befestigt und wird durch kraftige Zugfedern elastisch mit demselben verbunden. Damit die Maschine sich selbsttätig in den Wind stellt, ist auf der Oberseite des Rumpfendes eine Dämpfungsfläche angebracht. Zur Unterstützung des Schwanzes dient ein bootartig geformter Stützschwimmer. Besonders bemerkenswert sind die abgefederten Hilfsschwimmer unter den Tragflächen. Dieselben bilden einen von vier sphärischen Flächen begrenzten Hohlkörper von je 260 1 Wasserverdrängung Diese Schwimmerforra erübrigt die sonst erforderlichen Tastbrettchen und vereinigt hierbei die für den Luftwiderstand und Wasserdruck günstigste Formgebung. Die leere Maschine wiegt 1000 kg, dio Nutzlast dagegen 450 kg, so dass das Fiuggewicht mit Werkzeugen und sonstigen kleinen Re-servefceileu für Motor und Maschine insgesamt 1500 kg beträgt. Johannisthal. Die deutschen Flieger haben ihre großen Ueberlandflüge unterbrochen Alles eilt nach Berlin zur Flugwoche Man hält die Flugwoche, wo 34 Flieger um 50000 Mark streiten, für wichtiger als die Ueberlandflüge. Seit 8 Tagen herrscht indessen in Deutschland ein strahlend schönes Wetter. Der leichte Nordostwind in den letzten Tagen war außerordentlich günstig für Fernflüge, wo die Flieger gezwungen sind, bis nach Spanien hinein zu gehen. So verstreicht die kostbare Zeit, ganz abgesehen, von der günstigen Wetterlage, wie sie wohl kaum wiederkehrt! So sitzt alles in Berlin, um eben dabei zu sein! Viktor Stoeffler flog am 26. Sept. 7 Uhr vormittags bereits von Warschau auf seinem Aviatik-Mercedes-Pfeil-Doppeldecker ab und landete 11 :10 auf dem Flugplatz Johannisthal. Er erreichte mit einem kräftigen Rückenwind eine Geschwindigkeit von zeitweise 150 km. Ebenso sitzt Alfred Friedrich, nachdem er seinen Rundflug Berlin-Paris-London-ßerlin beendigt hat, mit seiner Etrich-Mercedes-Taube in Johannisthal. Von Hellmuth Hirth hat man in letzter Zeit verhältnismäßig wenig gehört. Er hat für den italienischen Wasserflug-Wettbewerb den Älhatros-Eindecker, welchen er am Bodensee steuerte, gemeldet.  Netter Ago-Pfeil-Doppeldecker. Am 26. Sept. gab es eine Ueberraschung. Bruno Langer startete um 8:58 vormittags auf einem Luftfahrzeug-Pfeil-Doppeldecker mit 100 PS Mercedes-Motor. Er hatte diese Maschine für einen Dauerflug besonders herrichten lassen und mit einem Riesenbenzin-gefäß versehen. Der 100 PS Mercedes-Motor arbeitete wie ein Uhrwerk. Langer landete nach 9 Stunden 1 Minute 57 Sek. Mit dieser Leistung hat er den bisherigen Dauerrekord, welcher von Viktor Stoeffler auf Aviatik-Pfeil-Doppeldecker gehalten wurde, geschlagen. Er erhält als „unangenehme" Beigabe 9000 Mark Prämie und 2000 Mark Rente der National-Flugspende. W- ■ '.  Colombo auf Föhn-Eindecker. Der gleiche Tag brachte leider auch einen Todessturz, der vielleicht hätte vermieden werden können. Oberlt. z. See a.D. Schulz stürzte auf einem Court-Eindecker tödlich ab. Sehr wichtig ist hier eine Aeußerung Lindpaintners, wonach das Flugzeug aus ca. 30 m sehr schwankend herunter gekommen ist. Lindpaintner hatte den Eindruck, als ob der Flieger rasch landen wollte, weil irgend etwas an der Maschine in Unordnung geraten sei. In ca. 3 m Höhe über dem Boden sah er deutlich, wie die Flügel blitzschnell nach hinten klappten. Eine Berührung mit dem Boden war in diesem Moment noch nicht erfolgt. Nach der Anschauung von Lindpaintner ist der Sturz durch einen Verspannungsbruch herbeigeführt worden. Andere Flieger äußern sich in ähnlicher Weise.  Der neue L.- v. Q.-Einde&er mit 6 Zyl. Mercedes-Motor. Für die Berliner Herbstflugwoche standen in der Liste beim Meldeschluß am 28. Sept. 19 Firmen, 34 Flieger und 41 Flugzeuge, darunter 23 Eindecker. Es hatten gemeldet: Dipl.-Ing. Robert Thelen,| 2 Albatros-Ernst St o effl er, 90PA^l(!eck' ' I 1 Albatros-Reinhold B o e h m, | Eindecker Gustav N e s 11 e r, A. F. G.-Eindecker Wilhelm Franke, Karl Krieger, Harlan - Eindecker Herbert Kohnert, „ „ Gruner, „ „ Franz Rheinländer, 1 M.B.-Taube Albert Colombo, 2 Zieske-Eindecker Paul Fiedler, 1 Luftfahrzeug-Stahltaube Ludwig Kammerer, Wright-Doppeid-Hermann Wrobel, „ „ Jos. Sablatn igl Willy Kanitz, 4 Union-Pfeil-Doppeld. Gustav Häus ler Alois Stiploscheck, 1 Jeannin-Taube Franz Reit er er, Etrich-Taube Alfred Friedrich, Etrich-Taube Viktor S t o e f f I e r, 1 Aviatik-Pf eil- Doppeldecker Charles I n g o 1 d, 2 Aviatik-Eindecker Hans Rover, 1 Röver-Eindecker O. E. Lindpaintner, 1 Ago-Doppeld. Franz Typelsky, 1 Komet-Doppeld ^1 ^Ch"Ieri4AKo-Doppeldecker Wilh. Kießling,},. „ Richard Remus,}1 Ago-Doppeldecker Robert Janisch, 3 L V.G-Eindecker Albert Rupp, L. V. G-Doppeldecker Felix i.aitsch, , „ Erich Schröter,) ] Sommer-Max Trau twei n,l Eineinhalbdecker Bruno Hanuschke, 1 Hanuschke-Eind. Paul Schwandt, 2 Grade-Eindecker Auch einige neue Typen sind vertreten. Es ist zu nennen: der neue Ag o-P f eil-D oppeldeck er mit 100 PS Mercedes-Motor, welcher sich durch besonders saubere Arbeit auszeichnet. (S. die nebenstehende Abb.), ferner der Föhn-Eindecker, der von Colombo gesteuert wird. Sehr bewundert wird die saubere Arbeit der L. V. G.-Typen, der bekannten Ein- und Doppeldecker (S. die Abb ) 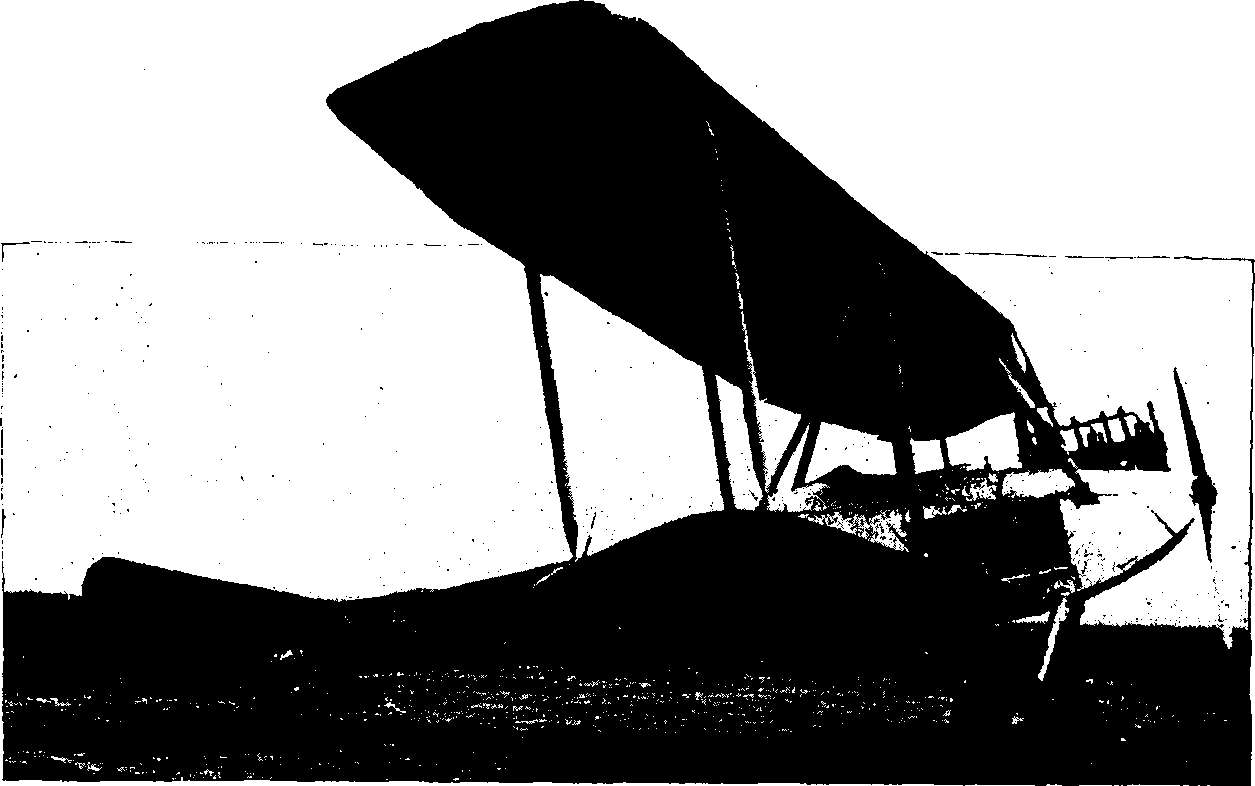 L.-V.-Q.-Doppetdecker, neuer Typ, 6 Zyl. Argus-Motor. Fokker ist mit einem neuen Rumpf-Eindecker Militärtyp herausgekommen. Wie die Abb. erkennen lassen, sind die Prinzipien des alten Apparates, abgesehen von der Bauart des Rumpfes und Schwanzes, beibehalten.  Der neue Fokker-Eindecker. Am Samstag, den 27. Sept., erfolgte die Abnahme der Maschinen. Abends fanden die mit Spannung erwarteten Leuchtfeuer-Versuche — eine Abwechslung ist auch ganz nett — statt. Auf dem Flugplatz sind drei verschiedene Leuchtfeuer-Einrichtungen auf je einem Turm montiert. Auf dem Turm an der Versuchsanstalt Adlershof befindet sich ein sogenanntes rotierendes Pintsch-Feuer, auf dem anderen Turm, der auf dem neuen Schuppenplatz steht, ein aufblitzendes Bamag-Feuer. Mit diesem werden Leuchtblitze mit der für Johannisthal gewählten Zahl 1—2 — 3 wiedergegeben. Mit diesem Blinkfeuer kann man selbstverständlich auch in jeder Weise telegrafische Zeichen geben. Auf einem anderen Turm auf der Seite des 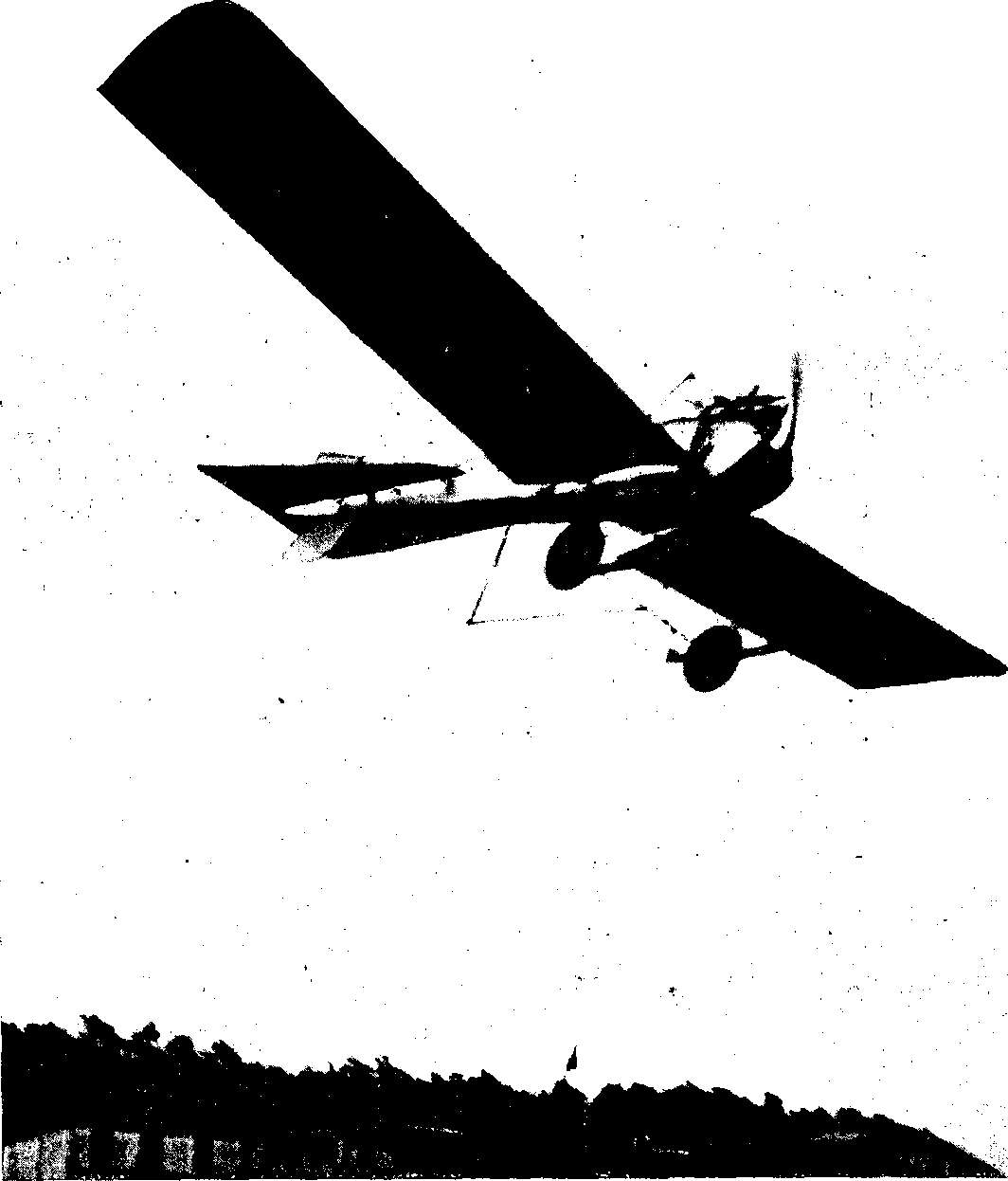 Der neue Fokker-Eindecker im Fluge. alten Schuppenplatzes ist ein Scheinwerfer der A. E. G. montiert' welcher einen Riesenleuchtkegel in jeder Richtung, so auch senkrecht und nach oben, werfen kann. Abends waren diese Orientierungsfeuer in Betrieb. Der Wright-Flieger K. H. Bernius befand sich bei einbrechender Dunkelheit noch in der Luft. Ferner wurden noch verschiedene andere Lichtsignale probiert, Fallschirmraketen, Magnesiumfeuer usw. Um dem Flieger bei der Landung die Nähe des Bodens anzuzeigen, waren zwei Linien rote und grüne Lichter am Rande des Fingplatzes aufgestellt. Aus grosser Höhe sieht der Flieger die beiden Reihen grüne und rote Lichter übereinander. Sobald er in die Nähe des Bodens kommt, rücken diese beiden Reihen zusammen, so dass die rote Reihe in die grüne kommt. Dieses Lichtzeichen soll jedoch schwer erkenntlich gewesen sein. Am 28. Sept dem ersten Flugtag blies ein strammer Wind. Die Flieger verhielten sich daher abwartend. Als erster startete Reiterer auf Etrieh-Mercedes-Taube ohne Fluggast zu einem Höhenflug. Hiernach folgten Stiploscheck auf 120 PS Jeannin-Argus-Taube, Rupp auf 100 PS L. V. G.-Mercedes-Eindecker, Fiedler auf 100 PS Luftfahrzeug-Mercedes-Taube, Viktor Stoeffler auf 100 PS Aviatik-Mercedes-Pfeil-doppeldecker und Josef Sablatnig auf Union-Pfeil-Doppeldecker mit 120 PS Austro-Daimler, letzterer mit zwei Fluggästen. Sablatnig erreichte 2100 m Höhe, womit er einen neuen deutschen Höhenrekord aufstellte. In dem Rennen der Eindecker mit Motoren über 80 PS erzielte Stiploscheck auf 120 PS Jeannin-Argus-Stahltaube 11 Min. 15 Sek und Fiedler auf 100 PS Luftfahrzeug-Mercedes-Taube 15 Min. 23 Sek. In dem Dauer-Wettbewerb wurden folgende Zeiten erzielt: P. V. Stoeffler (100 PS-Aviatik-Mereedes D.-D.) 2 Stunden; Stiploscheck (120-PS-Jeannin-Argus-Taube) 1:14; Reiterer (100-PS-Etrich-Mercedes) 58 Min.; Ernst S toef f ler (100-PS-Albatros-Mer-cedes-D.-D.) 42 Min.; A Rupp (100-PS-L. V. G.-Mercedes-D.-D ) 34 Min.; Fiedler (Luftfahrzeug-Mercedes-Taube) 24 Min.; W. Kießling (Ago-Argus-D.-D.) 18 Min.; M. Schüler ( Ago-Mercedes-Pfeil-D.-D.) 16 Min.; Sablatnig ( 25-PS-Union-Austro-Daimler-Pfeil); Schulz (Etrich-Argus), R. Thelen (lOO-PS-Albatros-Mercedes-D.-D.) je 14 Min.; Remus (lOO-PS-Ago-Argus-D.-D.) 13 Min. Aus den englischen Flugcentren. London Aerodrome. Hendon, 29. Sept Der Flieger Friedrich der Sportflieger G. m. b. H., dessen Flug Berlin—Paris vor einiger Zeit in der deutschen Flugwelt mit besonderer Genugtuung aufgenommen wurde, hat am Sonnabend den 13. Sept. die Strecke Paris—London mit seinem Apparat durchflogen und damit als erster deutscher Flieger die Kanalenge zwischen Calais und Dover passiert. Er langte um 5 :26 auf dem hiesigen Flugplatz zu Hendon an, woselbst gerade das allwöchentliche Croß-Country-Race abgehalten wurde. Die Engländer, denen die harmonische Form des Etrich'schen-Flug-zeuges vollständig unbekannt war, waren über dieses unverwartete Erscheinen sehr erstaunt. Bei den später ausgeführten Schauflügen gab Friedrich seine bekannten Sturzflüge zum besten, bei welchen er aus oa. 300 m in 4 bis 5 Sekunden abstieg. Die Leistungen des deutschen Fliegers haben in den hiesigen Fachkreisen vollste Anerkennung gefunden. In einer mit ihm geführten Unterredung äußerte sich der Flieger über seine Luftreise folgendermaßen: „Bei meinem Abflug in Issy-les-Moulineaux hatten sich die bedeutendsten französischen Flieger eingefunden u. a. Garros, Audemars, Moräne, Voisin, Guillaux und Bpsano, die meinen Apparat mit Blumen schmückten und mir gute Reise wünschten. Ich muß offen gestehen, daß mir sowohl in Paris wie auch hier in London ein überaus herzlicher Empfang zuteil wurde. Es herrschte ein starker Südwestwind, so daß die französischen Flieger nicht an meinen Abflug glauben wollten. Da vormittags der Flugplatz zum Fliegen nicht freigegeben ist, staltete ich mittags um 11:45 mit meinem Fluggast Igo Etrich, und flog direkt über Paris immer nur nach dem Kompaß steuernd, ans Meer nach Calais, welches ich um 1:15 erreichte. Ich hatte also die 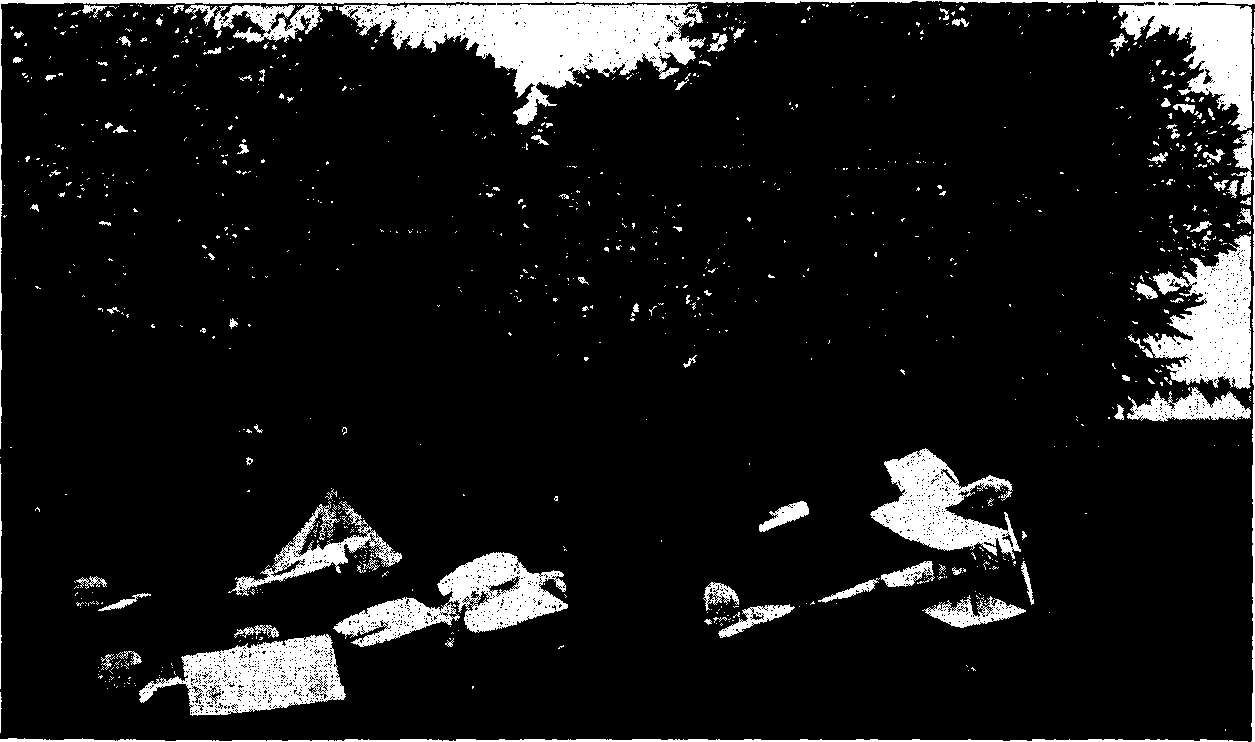 Aus den englischen Herbstmanövern 1913. Ein Flight Flugmaschinen im Manöver-Gelände in der Nähe von Aldershott. Rechts im Hintergrund die Zelte des Heerlagers. 220 km lange Strecke Paris-Calais mit einer Stundengeschwindigkeit von ca. 150 km durchflogen. Da das Wetter unsichtig war, landete ich hier, um vorerst Nachrichten über die Wetterlage im Kanal von Dover einzuholen, auf dem Platze, von wo aus Bleriot den ersten Kanalflug unternahm und ausführte. Doch hier erging es uns — das erste Mal in Frankreich — von Seiten der überaus eifrigen Behörden recht schlecht. Trotzdem unsere Papiere in Ordnung waren und wir die Erlaubnis nach England zu fliegen vom englischen Konsulat in Paris erhalten hatten, wurden wir hier über drei Stunden festgehalten, bis schließlich die Polizei uns freigab. Während dieser Zeit hatte sich auf der Wiese eine große Menschenmenge eingefunden, die uns gerade nicht mit Liebenswürdigkeiten bedachte. Die Gendarmen konnten dann auch nicht verhindern, daß sich eine Anzahl junger Burschen an den Apparat heranmachte und mit allerlei chauvinistischem Unsinn beschmierte. (Der Apparat glich mehr einer Schiefertafel als einem Flugzeug). Um 4 Uhr traf dann glücklich die Erlaubnis zur Weiterreise ein. Die Wetternachrichten aus Dover lauteten nicht ungünstig. So starteten wir um 4 : 15 über den 40 km breiten Kanal nach London. Der Wind kam hier direkt aus West,^so daß ich scharf gegenhalten mußte, um nicht auf das offene Meer hinausgetrioben zu werden. Ungefähr 8 Minuten schwebte ich in einer Höhe von 1500 m über dem Wasser, ohne Land oder Schiffe zu sehen und dies waren die unangenehmsten, denn abgesehen von einer Motorpanne, können schon einige Kilometer Abtrift zum Verhängnis werden, da ich keinerlei Vorsichtsmaßregeln getroffen hatte. Es begleitete mich weder ein Boot, noch waren auf der Strecke Rettungsboote stationiert. Nach 23 Minuten hatten wir wieder festes Land unter uns und flogen ohne Zwischenlandung nach London. Am 17. Sept. um 3 :45 stieg er mit seiner 100 PS Etrich-Merce-des-Taube zum Rückfiuge auf, abermals von Etrich begleitet, und flog nach Folkestone und von dort in 1500 m Höhe nach Calais, wo er um 5:20 glatt landete. Friedrich hat also die Strecke Hendon-Calais in einer Stunde 35 Minuten zurückgelegt, wobei er sich lediglich nach dem Kompaß richten mußte, da er ständig von Nebel umgeben war. Beim Fluge nach England war Friedrich nicht in Calais selbst, sondern in der Nähe der Stadt bei Baraques gelandet, wo ihm die oben erwähnten Schwierigkeiten bereitet wurden. Friedrich gedachte, am nächsten Tage seine Heimreise anzutreten, die er ja auch inzwischen vollendet hat. Nur wenige Monate sind ins Land gegangen, seit die Welt staunend aufsah zu den Riesenflügen der französischen Rekordjäger. Nun sind auch deutsche Flieger in die Reihen der „Herren der Luft" getreten. Im Mutterlande des Flugwesens landeten deutsche Flugzeuge; auch nach hier, dem meerumspülten Albion, trug Friedrichs Taube ihren kühnen Führer und und seinen Fluggast -- Deutschland in der Luft voran, das sei unser Losungswort. Möge es bald erfüllt sein. Der Weg ist gewiesen, viele werden ihn gehen. Im hiesigen Hippodrom, einem Variete, fand unter großer Beteiligung namhafter Künstler eine Matinee statt, deren Ertrag als Grundstock einer „Cody-Gedächtnis-Stiftung" verwendet werden wird, zur Erinnerung an den kürzlich abgestürzten bedeutenden Förderer des englischen Flugwesens. Ueber 2000 Besucher stellten sich ein, die bis zu 20 Pfund Sterl. für einen Platz bezahlten. Beliebte Schauspielerinnen verkauften Programme und , erzielten einen Betrag von 14000 Mark. Auf dem Wege der Versteigerung wurden Billets angeboten, die zu einem Passagierflug auf einem selbstgewählten Flugzeuge des Flugfeldes in Hendon berechtigten. Diese Billets wurden bis zum Preise von 600 Mark hinaufgetrieben. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Ueberreichung der goldenen Medaille der Aereal League (engl. National-Flugspende) an den Sohn des Verstorbenen, Leon Cody, „für die verdienstvollen Flugleistungen des Jahres". Eine sonderbare Wette wurde vor einigen Tagen zwischen den beiden Flugzeug-Konstrukteuren Handley-Page, dem Erbauer des automatisch-stabilen Handley-Page-Eindeckers, und Pemberton BilJing, einem Konstrukteur im Dienste einer großen Flugzeug-Fabrik, zum Austrag gebracht. Obwohl beide schon seit Jahren Flugzeuge konstruieren, hatte bis zum Tage keiner das Fliegerzeugnis des Royal-Aero-Clubs erworben. Die Wette ging nua darauf hin, daß beide in 24 Stunden das Zeugnis zu erlangen gedachten. Diese fast unmöglich erscheinende Leistung wurde dann am nächsten Morgen in aller Frühe im Beisein bedeutender Fachleute auf dem Flugplätze zu Brooklands von Pemberton ßilling auf einem alten M. Farman Apparat vollbracht. Da niemand dem Wettlustigen eine gute Maschine anvertrauen wollte, mußte er mit dem alten „Box-Kite", wie man in England die veralteten Typen getauft hat, vorlieb nehmen. Begleitet von dem Fluglehrer der Vickers Flugschule, Barnwell, machte der Schüler zuerst: einige Rundflüge, alsdann stieg er allein auf und gewann seine Wette glänzend, zum Staunen der Zuschauer, die alle Augenblicke darauf rechneten, daß die Maschine auf sie herunter fallen würde. Handley-Page, der auf seinem Eindecker auf dem Flugplatze zu Hendon seine Wette zu gewinnen versuchte, gab schon nach einigen Sprüngen mit der Maschine als geschlagen auf. Auch die holde Weiblichkeit nimmt in letzter Zeit am Fliegen allgemeines Interesse. Ein bekannter Londoner ßühnenstern, Miß Ruth Vincent, hat sich der Fliegerlaufbahn gewidmet und übt täglich auf einem M. Farman-Doppeldecker in Hendon. Die eifrige Schülerin gedachte in kurzer Zeit mit ihrem Apparate über London zu erscheinen, um Zuckerbomben auszuwerfen, wenn sie nicht der „Home-Secretary", Mr. Mc. Kenna, an ihrem Vorhaben gehindert hätte. In einem von ihm herausgegebenen Gesetze verbietet er das Fliegen über London in einem Umkreise von 4 Meilen, wobei Charing-Croß als Mittelpunkt angegeben ist. Das Gesetz trat an demselben Tage, an welchem Miß Vincent durch die Zeitungen ihr Vorhaben bekannt gab, ohne jede vorherige Bekanntmachung in Kraft. Das Militärflugwesen macht augenblicklich eine Periode durch, von der viel zu erwarten ist. Der König inspizierte dieser Tage während der großen Manöver die verschiedenen Flugzeugsektionen und äußerte sich lobend über die bis jetzt erzielten Resultate von der Verwendung von Flugzeugen in den Manövern. Die Marineabteilung des Royal-Flying-Oorps übte in der letzten Zeit fleißig Nachtflüge. In den hellen Mondnächten war die ganze Flugzeugsektion Sheerneß zuweilen stundenlang in der Luft, wobei den Fliegern von den Scheinwerfern der Mutterschiffe in der Orientierung geholfen wurde. Eine neue Station ist in Southwick im Bau begriffen, während die Station Cromarty nach dem günstiger gelegenen Fort George verlegt werden soll. So wird England in kurzer Zeit von einem Gürtel von Wasserflugstationen umgeben sein, wie schon der Marineminister Churchill in den Frühjahrsdebatten bekannt gegeben hatte. Damit sie sich nach dem englischen Muster richten können, ist einer japanischen Militär-Studien-Kommission die Erlaubnis erteilt worden, die Centrai-Flieger-Schule zu Upavon zu besichtigen, um die Organisation des Royal-Flying-Corps näher kennen zu lernen. Daß England damit bezweckt, die eventuell seitens der japanischen Armee zu bestellenden Flugzeuge für seine Industrio zu gewinnen, ist unschwer zu erraten. Zur Förderuug des Flugwesens in Indien hat der Fürst Maharad jah of Eewa der indischen Offiziers-Flieger-Schule zu Sitapur zwei Maschinen zum Geschenk gemacht, die von den Bristol-Werken demnächst zur Ablieferung gelangen werden. Das seinerzeit schon im „Flugsport" bekanntgemachte „Derby der Lüfte" wurde am Sonnabend den 20. September bei nicht gerade glänzenden Wetterverhältnissen zum Austrage gebracht. Nachdem es die Nacht vorher ununterbrochen geregnet hatte, klärte sich das Wetter einigermaßen auf, um von einem scharfen West-Wind begleitet zu werden. Trotzdem sammelte sich in den frühen Nachmittagsstunden eine große Menschenmenge auf dem Flugplatze an, deren Zahl um 3 Uhr bereits auf 25000 Personen angewachsen war, während in Hertford, der letzten Kontrollstation, über 10000 Personen die Ankunft der Flieger erwarteten. Für das über einen Umkreis von 94% englische Meilen auszutragende Rennen waren folgende Flieger und Maschinen gemeldet: Nation Apparat und Motor Frankreich 120 PS Austro Daimler 5 Sitzer Grahame White DD. Frankreich 70 PS Renault M. Farman DD. Schweiz 60 PS Anzani Oaudron DD. England 50 PS Gnom Bleriot E. England 80 PS Gnom H. Farman DD. Amerika 80 PS Gnom Bleriot E. England 80 PS Gnom Bleriot E. England 80 PS Gnom Avro DD. England 80 PS Gnom Sopwith DD. Frankreich 50 PS Le Rhone Morane-Saulnier E. England 80 PS Le Rhone Morane-Saulnier E. England 120 PS Austro Daimler Martinsyde E. Deutschland 45 PS Anzani Oaudron E. Irland 110 PS Anzani Deperdussin E. England 80 PS Gnom Morane-Saulnier E. Name 1. L. Noel 2. P. Verrier 3. E. Baumann 4. G. L. Temple 5. L. Hall 6. W. L. Brock 7. B. 0. Hucks 8. F.P.Raynham 9. H. Hawker 10. P. Marty 11. R. Slack 12. H. Barnwell 13. E.O.Frank'l 14. Leut. Porte 15. G. Hamel Von den Gemeldeten starteten jedoch nur die Nummern: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, während die anderen noch in den letzten Minuten aus der Konkurrenz ausschieden. Für Nummer 13, eine kleine aber sehr schnelle Maschine, war der Wind zu stark und konnte ein anderer Apparat nicht mehr beschafft werden. Als erster startete um 4 Uhr, der vorgeschriebenen Zeit, E. Baumann, gefolgt von den anderen Fliegern in Abständen von einer-Minute. Baumann erreichte als erster Kempten Park, hart hinter ihm Verrier, und Brock. Kurz hinter der ersten Station erlitt Baumann eine Motorpanne und gab auf. In der zweiten Etappe überholte Raynham, auf Avro die anderen Flieger und passierte als erster Epsom, gefolgt, von Brock und Hucks. Er erreichte die dritte Station West-Thuro, , woselbst ihn Hamel überholte, letzterer erhielt einen Vorsprung und ging, nachdem er bei Hertford eine scharfe Kurve genommen hatte, um 5 : 15 : 49 als Sieger durchs Ziel und wurde mit großen Ovationen empfangen. Hamel, der schon im vorjährigen Aerial-Derby als Sieger aus der Konkurrenz hervorging, erhält den von der Daily Mail ausgeschriebenen Preis von 4000 Mark in bar und einen Gold-Pokal im Werte von 500 Mark. ,,Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten u. Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XXV. Wasser=Zweidecker Breguet Einschwimmertyp. 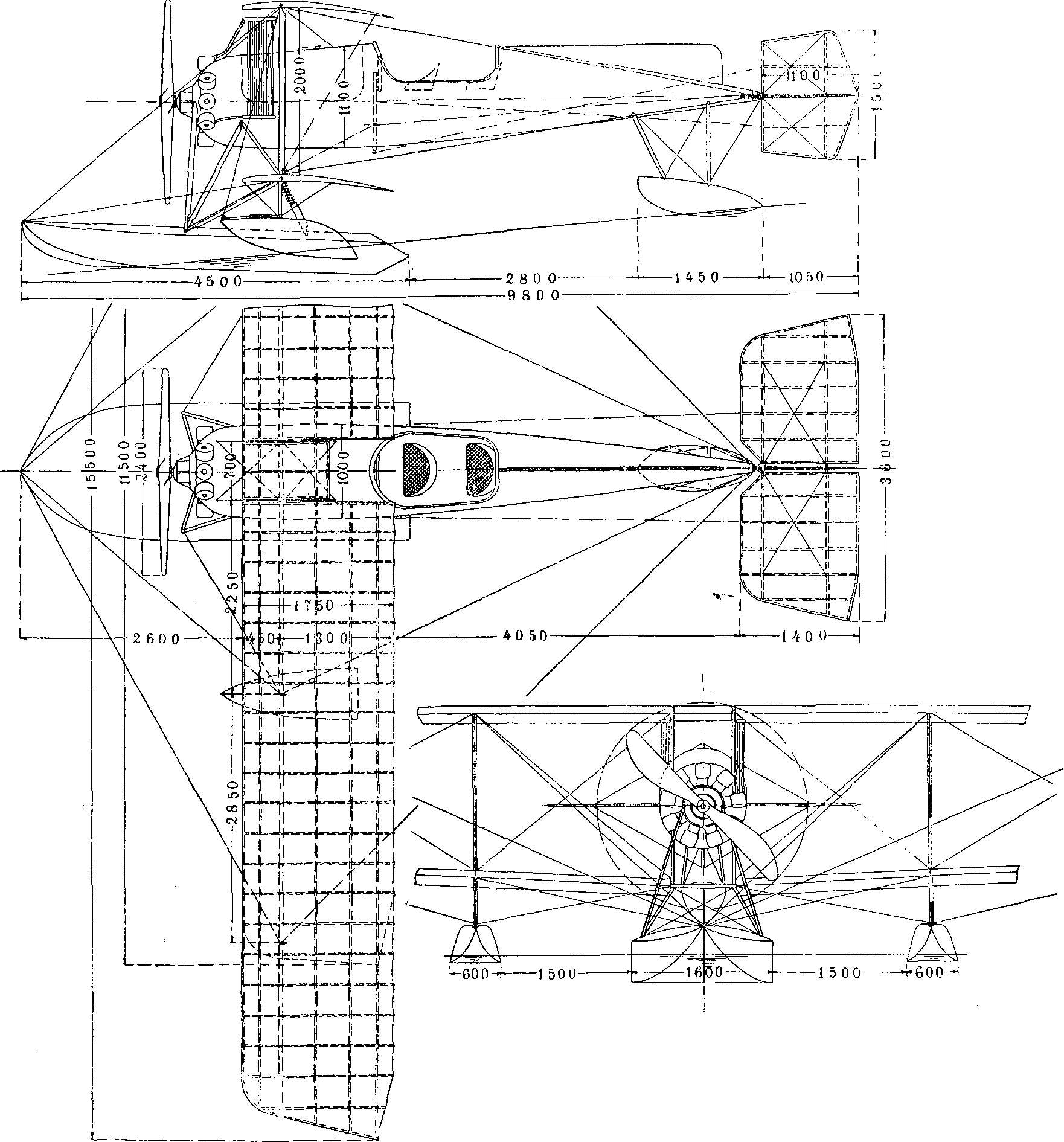 Nachbildung verboten.
Porte hatte in der dritten Etappe Motordefekt, und mußte aufgeben. In Verbindung mit dem Aerial-Derby gelangte ein versiegeltes Handicap zur Entscheidung, bei welchem es sich um Preise von: 1. Preis 2000 M., 2. Preis 1500 M. und 3. Preis 500 M., handelte. Die Resultate waren 1. Huoks, 2. Hawker und 3. Raynham. Um nicht hinter den Veranstaltungen und Preisausschreiben der Nachbarländer zurückzustehen, haben die verschiedenen Zeitungen abermals ein großes Rennen der Lüfte vorgesehen, welches in Verbindung mit dem Naval und Military Meeting am 27. September zur Ausführung gelangt. Die drei Staaten England, Frankreich, und Amerika sind mit je einem Ein- und einem Doppeldecker vertreten und zwar England: Hamel auf Morane-Saulnier Eindecker und Grahame "White auf G. W -Doppeldecker. Frankreich: Marty auf Morane-Saulnier Eindecker und Verrier auf M. Farman Doppeldecker. Amerika: Brock auf Bleriot-Eindecker und Beatty auf Wright- Doppeldecker. Preise in Höhe von 500, 800 und 1000 Pfund Sterl. kommen zur Verteilung. Am 22 9. stellte der Fluglehrer der Grahame "White Aviation & Co. zu Hendon auf dem neuen Doppeldecker, genannt „Char-a-bancs" einen neuen engl. Rekord auf, indem er mit 7 Fluggästen, unter denen sich auch der Konstrukteur, Claude Grahame White, befand, 17 Min. 35 Sek. in der Luft verweilte. Lord. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Alles hat einmal sein Ende; sogar der Dauerflug Fournys, von dessen Beginn wir berichtet haben, hat sein Ende gefunden. Dreiundzwanzig Tage hintereinander hat der unermüdliche Flieger auf seinem Zweidecker Maurice Farman seine Runden auf der bekannten Rundstrecke zurückgelegt, 158 mal hat er den Weg von Etampes nach Gidy und zurück nach Etampes gemacht, ebenso oft hat er, wie das Reglement vorschreibt, vor den Kommissaren gelandet, um sich seine Runde bescheinigen zu lassen, und das Fazit dieser bewundernswerten Ausdauer und Geduld ist, daß Fourny nicht weniger als 15989,600 Kilometer totalisiert und dadurch sich zum Anwärter auf den Michelin - Pokal gemacht hat. Eigentlich waren es sogar 16090 km, aber nur die oben angegebene Distanz wird offiziell anerkannt, weil nur diejenigen Runden in Berechnung kommen, bei denen der Flieger die mittlere Stundengeschwindigkeit von 50 km erreicht hat. Mit dieser Flugleistung, die Fourny übrigens in einer wirklichen Flugzeit von 201 Stunden 16 Minuten 213/5 Sekunden vollbracht hat, ist natürlich diejenige Caveliers, der seinerzeit 7396,320 km in neun Tagen hinter sich gebracht hatte. Jetzt wollen einige andere Flieger, wie Fischer und Duval, ersterer auf einem Henri Farman, letzterer auf einem Deperdussin, versuchen, Fourny die Trophäe streitig zu machen. Freilich, die ersten Versuche dazu waren nicht besondi-rs erfolgreich. Die von uns schon früher in Aussicht gestellte Entscheidung, daß Guillaux, und nicht Brindejonc des Mouliuais, Anwärter auf den Pommery - Pokal geworden, ist nunmehr offiziell bestätigt: Die von Guillaux zurückgelegte Distanz Biarritz—Brockel ist mit 1386,670 km, die von Brindejonc des Monlinais durohflogene Distanz Villacoublay— Warschau mit 1382,550 km endgültig berechnet worden. An diesem Resultat ändert natürlich der hübsche Flug Seguins von Paris nach Berlin, ohne Zwischenlandung, in 11 Stunden 30 Min. nichts, denn diese Distanz mißt nur 950 km. Es heißt aber, daß Seguin noch einmal versuchen will, Guillaux die Palme zu entreißen. Im Militärflugwesen wird flott weiter gearbeitet. Die Resultate, die dieses in den Manövern ergeben hat, werden von allen beteiligten Instanzen anerkannt und rühmend hervorgehoben. So hat der Chef der einen Armee, der General Pau, einen Tagesbefehl erlassen, in dem er ausführt, daß ihn dieLeistungen der Flieger geradezu in Erstaunen versetzt haben. Jeden Morgen um spätestens 10 Uhr habe er gewußt, wo sich der Feind befand und welche Vorbereitungen er traf Die Dienste, welche das Flugwesen geleistet habe, sind unberechenbar und die Flieger verdienen Jlür ihren Wagemut das höchste Lob. Das Militärflugwesen sei heute eine wirkliche Waffe, die innerhalb der Armee eine überaus wichtige Rolle spiele, die sie in bewundernswerter Weise erfülle. Der neue Leiter des französischen Flugwesens General Bernhard, hat nunmehr seine Besichtigungsreisen begonnen, wobei er die Anlagen auf den einzelnen Flugplätzen aufs eingehendste inspiziert. In Pau fand bei dieser Gelegenheit eine Parade von 39 Flugzeugen statt, die recht imposant gewirkt hat. Ferner werden die Installationen von Militärflugplätzen und Landungsterrains ununterbrochen fortgesetzt. Am vergangenen Sonntag fand die Einweihung des großen Flugplatzes von Sezanne statt, bei der der Kriegsminister offiziell vertreten war und mehrere Militärflieger sind autorisiert worden, Flugevolutionen vorzunehmen. Noch viel wichtiger ist die Anlage einer großen Militärstation in Dunkerque wo gleichfalls am Sonntag die feierliche Eröffnung eines bedeutenden Flugstützpunktes vorgenommen wurde, zu welcher Gelegenheit der Kriegsminister die Luftgeschwader von Maubeuge und Douai abkommandiert hatte. Auch das Marine - Flugzentrum von Frejus bei Toulon ist schon in voller Tätigkeit und zahlreiche Flugzeuge evolutionieren dort täglich. Dagegen haben die im Hafen von Bizerta vorgenommenen kombinierten Versuche mit Flugzeugen und Unterseeboten infolge ungünstigen Wetters bisher keine abschliessenden Resultate ergeben, sodass sie in den nächsten Tagen fortgesetzt werden sollen. Noch vor seinem Rücktritt hat der General Hirschauer soeben die neuen Bedingungen für das Militärflieger-Zeugnis bekannt gegeben, die vom 1. Januar 1914 ab in Kraft treten sollen. Danach haben die Bewerber folgende Proben abzulegen: 1. einen Flug von wenigstens einstündiger Dauer in einer Höhe von 1000 Metern; 2. auf einem Flugfelde eine Landung im Schwebefluge, mit angehaltenem Motor, aus wenigstens 500 Meter Höhe und innerhalb einer Entfernung von weniger als 200 Meter von einem vorher festgesetzten Punkte; 3. ein theoretisches Examen, wie es bisher schon fixiert war; 4. folgende drei Ueberlandflüge: a) einen Dreieckflug von wenigstens 200 km mit ein und demselben Flugzeug innerhalb höchstens 48 Stunden auszuführen, mit zwei obligatorischen Zwischenlandungen an vorher festgesetzten Punkten (die kleinste Seite des Dreiecks darf nicht unter 20 km lang sein), b) ein Flug von wenig- » stens 150 km in gerader Linie mit vorher angegebener Flugstrecke, ohne Zwischenlandung, c) ein Flug zwischen Sonnenauf- und -unter-gang ein und desselben Tages, mit ein und demselben Apparat, von wenigstens 150 km in gerader Linie, mit vorher angegebener Flugstrecke und einer fakultativen Zwischenlandung. Alle diese Flüge sind ohne Begleitpersonen auszuführen. Der 1000 Meter Höhenflug kann mit irgend einem der vorstehenden Bewerbe verbunden werden. Natürlich nimmt jetzt das soeben begonnene Flug-Meeting von Reims ein grosses Interesse für sich in Anspruch, wenn auch die ganze Veranstaltung unter den vorausgegangenen Streitigkeiten in erheblichem Masse leidet Am 27. 9. fanden zunächst die französischen Ausscheidungsläufe für das Gordon Bennett statt, bei denen sich folgende drei Flieger für den Entscheidungslauf am Montag qualifizierten (die Strecke führte über zehn Bahnrunden, also 100 km): 1. Prevost(Deperdussin, 160PSGnom)in31:22:2 (mittl.Geschw.191 km) 2 E.Vedrines(Ponnier,160PSGnom)in 32: 28 (mittl.Geschw. 184,800 km 3. Gilbert (Deperdussin, 160 PS Rhone) in 33:45:4 (mittl.Geschw. 178km Hierbei hat Prevost folgende neue Geschwindigkeits-Weltrekorde aufgestellt: 10 km: Prevost, 27. Sept. 1913, Eeims 3:09:1 (bish. Rekord: Prevost, 3:20:1) 20 km: Prevost, 27. Sept. 1913, Reims 6:17:4 (bish. Rekord: Prevost, 6:40:1) 30 km: Prevost, 27. Sept. 1913, Reims 9:25:4 (bish. Rekord: Prevost, 10:02 ) 40 km: Prevost, 27. Sept. 1913, Reims 12:32:4 (bish. Rekord: Prevost, 13:23 ) 50 km: Prevost, 27. Sept. 1913, Reims 15:40:4 (bish Rekord: Prevost, 16:43 :3) 100 km: Prevost, 27. Sept. 1913, Reims 31:22:2 (bish. Rekord: Prevost, 33:30:2) Auch bei Gelegenheit des diesjährigen Gordon Bennett hat es Jules Vedrines verstanden, sich wieder in aller Leute Mund zu bringen. Er ist zu den Zeitungen gegangen und hat sich bitter beschwert, daß es ihm, dem vorjährigen Sieger und „dem sicheren Sieger auch in diesem Jahre", unmöglich gemacht sei, in dem Gordon Bennett zu starten. Moräne, der ihm einen Apparat liefern sollte, hat seine Zusage zurückgezogen, weil er sein Flugzeug nicht auf dem Flugfelde eines De-fraudanten starten lassen wolle. Seine persönliche Anmeldung habe der Aero-Club zurückgewiesen, weil nur Anmeldungen seitens der Konstrukteure zulässig seien. Und Vedrines schimpft und wettert, daß er, der „berufenste Vertreter der französischen Farben" nicht imstande sei, das Gordon Bennett zu gewinnen, und alle Welt lacht über die, wie üblich, schwulstigen Redensarten des kleinen Mechanikers, die natürlich wortgetreu abgedruckt werden..... Uebrigens haben dieser Tage die Vorstandsneuvvahlen im Aero-Club de France stattgefunden, bei denen Deutsch de la Meurthe zum Präsidenten wieder gewählt wurde, während die Herren Leon Barthou, Soreau und Balsan zu Vizepräsidenten, Georges Besancon zum Schriftführer und Granet zum Sohatzmeister erkoren wurden. Zu Mitgliedern des Vorstandes wurden dann noch Major Ferrus, Robert Esnault-Pelterie, Tissandier, Leblanc und Rousseau gewählt; Einen interessanten Verlauf nahm das Flugmeeting von San Sebastian, das am vergangenen Sonntag sein Ende erreicht hat. Der Totalisations-bewerb der Flugdauer ergab das Resultat: 1. Renaux (Maurice Farman, Renault), 2. Carbery (Moräne, Gnom) der Bewerber der Totalisation der Fluganzahl: 1. Renaux, 2. Audemars (Moräne, Gnom); der Lancierüngsbewerb: 1. Carbery, 2. Renaux; der Seetüchtigkeits-bewerb: 1. Audemars, 2. Chemet (Borel, Gnom). Der Geschwindig-keitsbewerb ist annulliert worden. Viel Aufmerksamkeit wendet man hier auch dem „Großen Preis der Italienischen Seen" zu, der in der Zeit vom 5. bis 8. Oktober zur Bestreitung gelangt und zu dem sich acht Flieger haben einschreiben lassen: Hirth(Albatros), Garros i(Morane), Legagneux (Moräne), Ruggiere (Sanchez), Chemet (Borel), Dauoourt (Borel), Maicon (Caudron), Molla (Leveque). Die hauptsächlichsten^ Bewerbe, die dabei vor sich gehen, sind: ein Rennen in zwei Etappen, das sich wie3 folgt verteilt: 1. Tag: (G. Oktober) Como—Bellagio Lecoo — Lodi — Cremona—Piacenza— Pavia, 230 km; 2. Tag (7. Oktober): Pavia—Pallanza - Varese — Como, 140 km. Dieses zweitägige Rennen spielt sich auf Seen und Flüssen ab, nur mit einer einzigen Unterbrechung, nämlich der 20 km langen Strecke zwischen dem Varese-See und dem Como-See, die über Land z-j durchfliegen ist. Außerdem findet eine Reihe von Bewerben für Höhenflüge, für Aufstieggeschwitidigkeit u. s. w. statt. Zum Schluß sei noch ein sensationelles Experiment erwähnt, welches der bekannte Erfinder Moreau, ein ehemaliger Schriftsetzer, dieser Tage zu Melun vorgenommen hat und mit dem er den von der Ligue Nationale Aerienne ausgesetzten Preis für automatische Stabilisierung gewonnen hat. Das Reglement dieses Preises verlangte, daß der Flieger während zwanzig Minuten, bei einem "Winde von mehr als 5 Metern in der Sekunde in der Luft sich bewegen kann, ohne ein einziges Mal an den Steuerungen zu rühren. Moreau hat nun wirklich gezeigt, daß das mit seinem System ausgestattete Flugzeug ohne Hilfe des Fliegers in der Luft segeln kann. Es war 6% Uhr, als Moreau am letzen Mittwoch zu Melun den bekannten Militärflieger, Marineleutnant Lafont, an Bord seines Flugzeugs nahm. Lafont war von der Ligue als offizieller Kommissar bestellt worden. Der Eindecker erhob sich auf 80 Meter Höhe und kreiste während einer halben Stunde über dem Flugfelde. Der Apparat stampfte und rollte unter den heftigen Windstößen, denn es ging ein Wind von mehr als 15 Meter in der Sekunde. Aus dem Berichte des Leutnants Lafont ergibt sich, daß das Flugzeug sich zeitweilig so stark überneigte, daß Lafont dem Flieger zurief, die Steuerung zu gebrauchen, denn er fürchtete, daß Moreau, um den ausgesetzten Preis zu gewinnen, sich zu Tollkühnheiten hinreissen lasse. Aber Moreau behielt die Arme über der Brust gekreuzt, und der Apparat richtete sich stets wieder von selbst in die normale Lage hoch. Schließlich landete Moreau glatt, von den wenigen geladenen Zuschauern stürmisch beglückwünscht. Es heißt, daß die französische Regierung nunmehr auf den Mann aufmerksam geworden ist und die Absicht habe, seine Erfindung für den Staat zu erwerben,—? Rl. Im Wasserflugzeug von Friedrichshafen über Amsterdam nach Hamburg. Eine schöne Leistung hat Ingenieur Dahm auf einem Wasserdoppeldecker des Flugzeugbau Friedrichshafen F. F. 9, mit 135 PS. N. A. G.-Motor, mit seinem Monteur als Begleiter ausgeführt. Am 20. Sept. vormittags 4:30 Uhr startete Dahm von Friedrichshafen, verlor jedoch bei Schaffhausen durch den dichten Nebel die Orientierung und wasserte auf dem Rhein. Infolge dieses Zeitverlustes kehrte er nach Manzell zurück. Am gleichen Tage, 10 Uhr vormittags, startete er zum zweitenmal, wasserte 1:40 in Kehl um Benzin und Oel einzunehmen und sofort wieder abzufliegen. Um 7:30 erreichte Dahm Köln, wo er unter grosser Begeisterung des Publikums auf dem Rhein wasserte. Am 22. Sept. 9:45 vormittags flog Dahm von Köln wieder ab und erreichte Amsterdam um 1:50, von wo aus er um 3 Uhr wieder weiter flog Er passierte den Zuider-See, überflog um 6 Uhr Borkum und wasserte 6:45 bei Emden. Der Weiterflug von Emden erfolgte am 23. Sept. vormittags 9:30. Um 11:30 wurde Cuxhaven überflogen und 12:45 wasserte Dahm bei Altona auf der Elbe, von wo er auf dem Wasser nach dem Hafen fuhr. Der verwendete Wasserdoppeldecker des Flugzeugbau Friedrichshafen ist der gleiche, welchen Gsell anlässlich des Wasserflug-Wettbewerbes am Bodensee benutzte. Damals erreichte bekanntlich Gsell bei der Konkurrenz mit Hirth bei dem zweiten, leider nicht zu Ende geführten Flug eine noch grössere Geschwindigkeit als Hirth. Gsell hätte sicher den grossen Preis vom Bodensee gewonnen, wenn ihn nicht der Zündkerzendefekt gezwungen hätte, bei der zweiten Kunde niederzugehen. Der 135 PS 6 Zyl. N. A. G.-Motor hat während des Fluges ausgezeichnet gearbeitet. Stoefflers Flug nach Warschau. Victor Stoeffler gab über seinen Fernflug Mülhausen—Warschau am 16. September, folgende Schilderungen: Auch zu diesem Fluge benutzte ich den bewährten schnellen Aviatik-Pfeil-Doppeldecker, mit 100 PS Mercedes, der mich kurz vorher nach Schneidemühl gebracht hatte Den prachtvollen Vollmond wollte ich nicht ungenutzt vorübergehen lassen und traf umfassende Vorbereitungen für eine Nachtfahrt. Eine kleine elektrische Batterie sorgte für die Beleuchtung des Führerstandes sodaß ich seelenruhig meine Instrumente beobachten und die Karte studieren konnte. Eine elektrische Handlampe von großer Kerzenstärke sollte zu Signalzwecken dienen Ich wollte damit die verschiedenen Stationen in Süddeutschland, die mir mit Scheinwerfern den Weg zeigten, verständigen, daß sie ihre Aufgabe gelöst. Auf einen Passagier verzichtete ich diesmal. Statt dessen nahm ich 400 1 Benzin in dem vergrößerten Reservoir und 30 Kilo Oel mit. Das sollte mir für 10 Stunden bis Graudenz genügen, wo neue Vorräte bereit gehalten wurden. Um 12:20 Uhr nachts startete ich auf dem Flugplatz Habsheim. Prachtvoll überflutete der Vollmond Täler und Höhen. Hell blitzten die Sterne. Ruhe überall. Nach einer Runde hatte ich 500m Höhe und zog gen Osten. Wo wird diese Reise hinführen? Der Wind stand im Rücken und trotz der großen Belastung ging die Fahrt flott. Rechts verriet mir bald ein Lichtschein Freiburg, unter mir starrten tiefschwarz des Schwarzwalds ewig grüne Tannenforsten. In kaum 1000 m Höhe kam ich darüber. 1:45 Uhr tauchte Stuttgart auf und bald sah ich auch die Scheinwerfer, die mächtige Lichtkegel unermüdlich gegen den Nachthimmel warfen. Ich winkte mit meiner Handlampe ein Signal, daß ich den Weg gefunden, und einen Abschiedsgruß. Bamberg war auch rasch da. Der Main gab mir hier ein untrügliches Mal. Wunderbar war bisher die Fahrt. Hier und da flammte ein Licht in den Dörfern auf, Feuer loderten. Was mögen die Leute gedacht haben, diese kleinen Erdenbürger ? Ich kann verstehen, daß ihnen diese Erscheinung da oben am nächtlichen Firmament eine kleine Furcht einjagte. Weit war in der Stille das Rattern des Motors hörbar, meterlang schlugen aus dem Auspuff die Flammen. Da kam ihnen wohl der Gedanke an eine Hexe, die auf den Blocksberg reitet oder gar an eine überirdische Naturerscheinung. Denn wenige vielleicht nur kannten ein Flugzeug aus eigener Anschauung - - - Langsam schob sich dann eine Wolkenbank zwischen Apparat und Erde. Schauerlich schöne Bilder folgten. Losgelöst von all dem Erdentreiben sauste ich dahin. Unter mir brauten die Nebelschwaden und tosten auf und nieder wie das wilde Meer. Ich vergass, wo ich war Nie kam mir der Gedanke, dass unter mir ein grosses Nichts liegt, in dem Tod und Verderben lauern. Kaum konnte ich mein Erstaunen meistern. Nur aufnehmen wollte ich diese Bilder trunkenen Auges und so restlos, dass sie mir nimmer entschwinden Und diese wunderbare Ruhe. Den Motor hörte ich nicht mehr arbeiten. Nur die Instrumente zeigten mir, dass ich vorwärts kam. Erst gegen 5 Uhr rüttelten mich einige Böen aus meinem grossen Reich der Träume in die rauhe Wirklichkeit. Ich wusste, dass ich jetzt in der Nähe der Elbe war und zur Bestätigung meiner Vermutung blinkten vereinzelte Lichter, die bald . zu einem unermesslichen Meer ver- 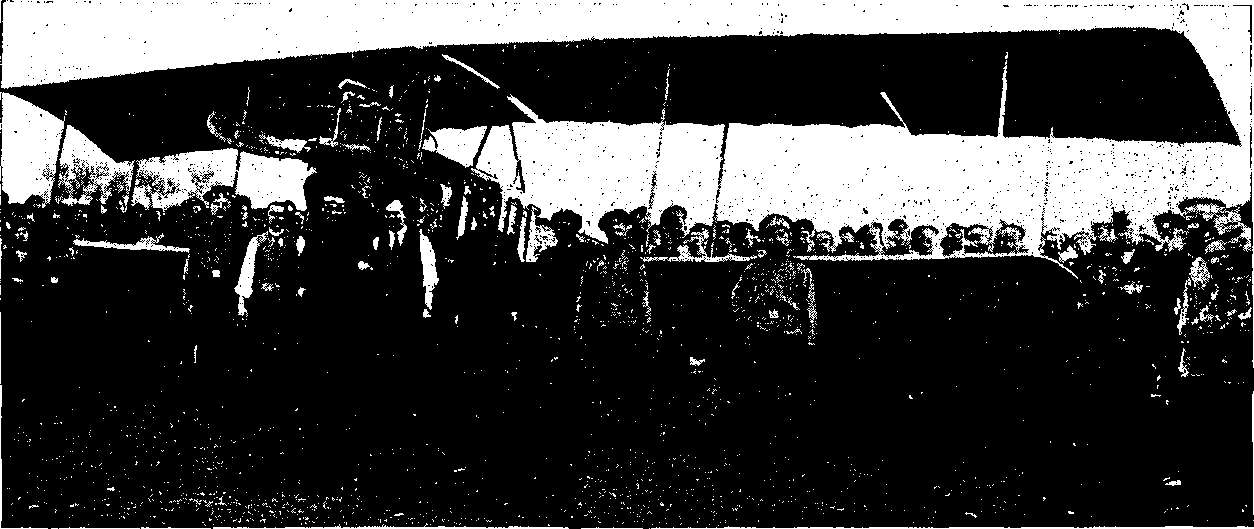 Victor Stoeßlcr unter militärischer Bewadiung bei Warschau. schwammen Dresden. In 472 Stunden hatte ich die 550 km lange Strecke zurückgelegt. Ich war zufrieden - - - Und schon fesselten mich neue Szenerien. Wieder trennte mich eine Wolkenbank von dem Land. Gleichzeitig brach im Osten die junge Sonne durch Ein leuchtendes Morgenrot begleitete ihren Siegeszug und legte sich auf die graue sterbende Nacht. Rot in allen Nuancen leuchtete die Welt. Grau rot, dann blau mit rot, vom zartesten Rosa und Lichtblau bis zum ϖ tiefsten Violett und über das ganze war ein dünner Schleier reines Gold gebreitet. Und dann vereinigte sich all das verschiedene Kolorit zu einer einzigen Farbensymphonie. Rot, Blau, Violett und Gold flössen zusammen . . . Das Fliegen ist so wunderbar. Nun möchte ich nur noch den Pinsel führen können, um all diese Schönheit auf der Leinwand festzuhalten. Bis 8 Uhr früh dauert diese Pracht. Dann ist für eine kurze Spanne der Ausblick offen. Ich bin über einer weiten montonen Ebene. Provinz Posen oder Westpreussen ? . . . Rasch türmen sich vor mir Cyrrhuswolken zu stattlichen Bergen. Ich zaudere lange. Darüber hinweg oder mitten durch? Ich entschliesse mich für das letztere. Und nach Minuten schon bin ich unsichtbar. In einer grossen feuchten Tarnkappe verschwunden. Rapid springt der Barograph nach unten. 2000 - 1500-1000-500-300 Meter Höhe. Immer noch ein Wolkenmeer, das jeden Ausblick unterbindet. Es wird ungemütlich. Kritisch Wo soll ich hin? Reichen die Wolken wirklich so tief oder ist es Nebel ? Ich habe nur noch 200 m Höhe. Aber gleichzeitig öffnet sich eine Spalte. Ich sehe eine Stadt mit breiten schönen Strassen. Posen kann es nicht sein, das kannte ich von früher. Also landen. Der einzige Ausweg um mich zu orientieren. Ein günstiger Platz ist da. Ich bekomme noch heftige Böen, dass der Doppeldecker wie ein Blatt Papier schaukelt. Aber schliesslich werde ich Meister. Ich freue mich schon, dass ich raseh Leute finde, die mir Auskunft geben können. Aber, o Schreck, die verstehen mich nicht. Sie haben eine unglaubliche Sprache. Also bin ich in Russland. Die Passangst hat sich schon eingestellt. Mit Riesenschritten naht eine Uniform. Ich bin schneller, sitze im Nu wieder recht, höre im letzten Augenblick noch den Landungsort und gebe Vollgas. Ehe der freundliche Diener des Gesetzes ein Wort gesagt, sause ich an ihm vorbei. Er macht ein langes Gesicht und ich lache mir ins Fäustchen. Ich war bei Warschau und habe 1150 km in 8 Stunden geschafft. Dann fliege ich zurück, um nach Deutschland zu kommen. Aber der Kom-pass streikt. Im dichten Nebel der mich umfängt, verliere ich konstant die Orientierung. Immer wieder sehe ich die russische Stadt. Ich lande nochmals, steige wieder auf und nach einer halbstündigen Irrfahrt gehe ich wieder nieder. Ich bin bei Kutnow. Ein deutscher Rittergutsbesitzer nimmt mich gastfrei auf. Er hatte mich vor einer Stunde schon gesehen. Das waren über 100 km Verlust für mich. Er zeigt mir auch *die Weichsel. Wohl finde ich die Richtung nach dem Wiederaufstieg, aber loider komme ich auch diesmal nicht weit. Das Benzin ist zu Ende und so muss ich zum vierten Mal in Russland landen. Ich bin bei der Gouvernementsstadt Plock. Gerade habe ich meine Betriebsstoffe ergänzt, da ist auch das Verhängnis da. Russische Gendarmen halten mich fest. Ein Parlamentieren ohne Ende hebt an. Endlieh komme ich mit dem Chefgendarmen, der auch französisch spricht, überein und um 5 Uhr darf ich weiter fliegen, nachdem mich vorher Graf Losch zu Tisch geladen. Ich will Kiew noch heute erreichen. Aber statt des erwarteten Vollmondes zieht Nebel auf. Gegen 7 Uhr erfolgt wegen Dunkelheit die fünfte Landung bei Pruschkow. Da Warschau, wie mir gesagt wurde, nur noch 15 Kilometer weg liegt, starte ich sofort wieder und bin dann auch nach wenigen Minuten über dem Flugplatz, auf dem ich sehr glatt landete. Der Empfang war ausserordentlich herzlich. Besonders der Automobilklub gab sich alle Mühe. Auf dem Bankett wurde ich in langen Reden gepriesen. Ai ch der Gendarmeriechef war hier sehr zuvorkommend Die Passangst ist vorbei und für keinerlei Belästigungen auf meinem Rückflug ist mir alle Garantien geboten. Wenn es doch nicht noch anders kommt. Ob ich mit meinem Flug zufrieden bin ? Gewiss. Wenn ich auch infolge des misslichen Wetters nicht den französischen Rekord von 1386 km gedrückt habe, ist es mir doch gelungen, den grössten Ueberlandflug, den bisher ein Flieger ohne Zwischenlandung zurückgelegt hat, an mich zu reissen und so zu zeigen, dass unsere einheimische Motoren- und Flugzeugindustrie auf einem hoffnungsvollen Wege ist. Denn möglichst unabhängig von der Erde im Vertrauen auf das Material, möglichst grosse Strecken im Nonstop-Flug zu bewältigen, ist doch das erstrebenswerte Endziel aller kriegsmässigen Flugkunst. Gordon-Bennett Flug Reims 1913. Reims, den 29. Sept. 1913. Ohne den Wettbewerb um den Coup Gordon-Bennett wäre dieses Jahr ein Meeting von Reims nicht möglich gewesen. — — Den Fachmann interessierten nur die „ Kanonen" für den Gordon-Bennett, die Deperdussins und der Ponnier. Riesenmaschinen, eigentlich müßte es heißen: geflügelte Riesen-Motoren. Die Tragdecken sind auf eine lächerlich kleine Spannweite zusammen geschrumpft. Die Flugmaschine besteht in der Hauptsache aus einem Motor mit einem Propeller, woran sich auf der rückwärtigen Seite zur Verringerung des Luftwiderstandes ein tropfenförmiger Rumpf anschließt, an dem . zu beiden Seiten ein paar degenerierteFlügelst\impf e sich befind en. Neben der großen Motorleistung ist eben die Verringerung des Luftwiderstandes die Hauptfrage. Alles was Luftwiderstand verursachte, mußte beseitigt werden. Während des Wettbewerbs wurden dem Fernstehenden manchmal lächerlieh erscheinende Aenderungen vorgenommen. So entfernte man Schraubenmuttern, versah Schraubenköpfe und Schamierver-bindungen mit tropfenförmigen Ausgängen, kleine Hebelchen mit komplizierten Luftabführungsrippen u. v. a. Die Geschwindigkeits- 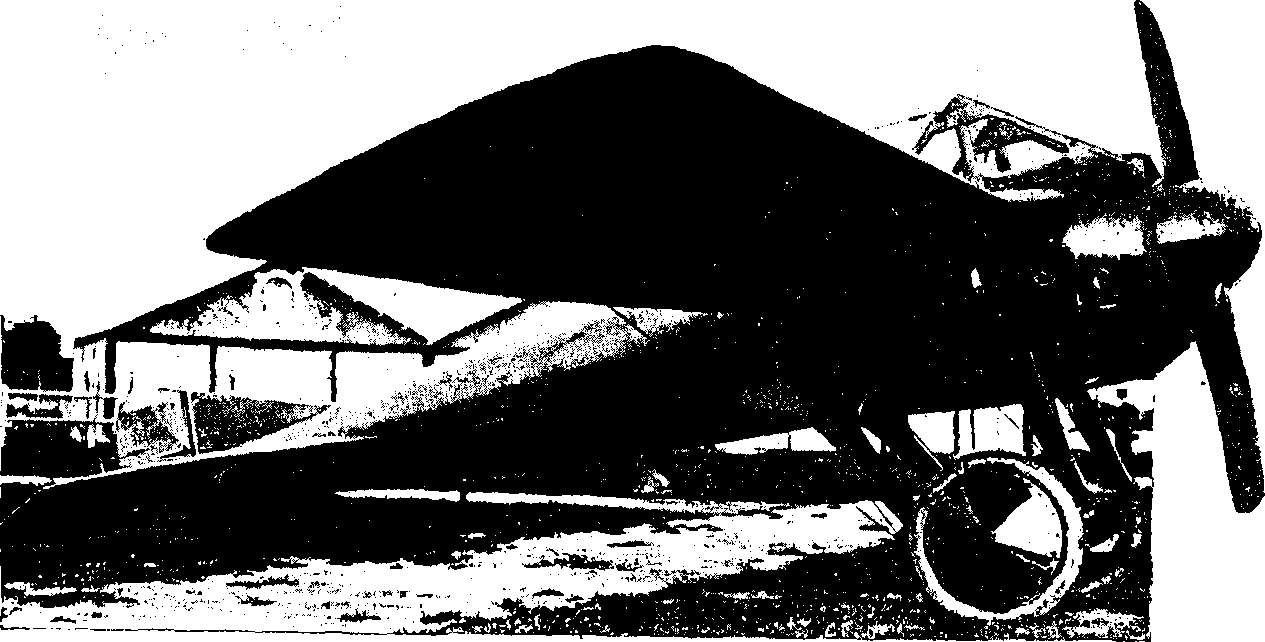 Deperdussin-Renneindecker für den Coup Qordon-Bennet in Reims. zunähme, die durch diese Veränderungen erzielt wurde, war verschiedentlich sehr augenscheinlich. Der von Prevost gesteuerte Deperdussin-Eindecker besaß einen 160 PS Gnom-Motor, während der von Gilbert gesteuerte mit einem 18 Zyl. 160 PS Le Rhone-Motor ausgerüstet war. Der Ti agfläclieninhalt betrug 9 qm, das Leergewicht 450 kg. Um den durch den Kopf des Führers verursachten Luftwiderstand zu verringern, ist auf dem Oberteil des Rumpfes hinter dem Führersitz ein tropfenförmiger Ansatz aufgesetzt. (S. die Abbildung, Start von Prevost.) Der von Emile Vedrines gesteuerte Eindecker Ponnier besaß nur 8 qm Tragfläche und ein Leergewicht von 325 kg.^Zum Betriebe diente ein 160 PS Gnom-Motor. Wenn man die Geschicklichkeit der Flieger berücksichtigt, so war es für die Fachleute bereits vorher klar, daß der Wettbewerb, wenn nicht besondere Unfälle eintreten, sich zwischen diesen drei 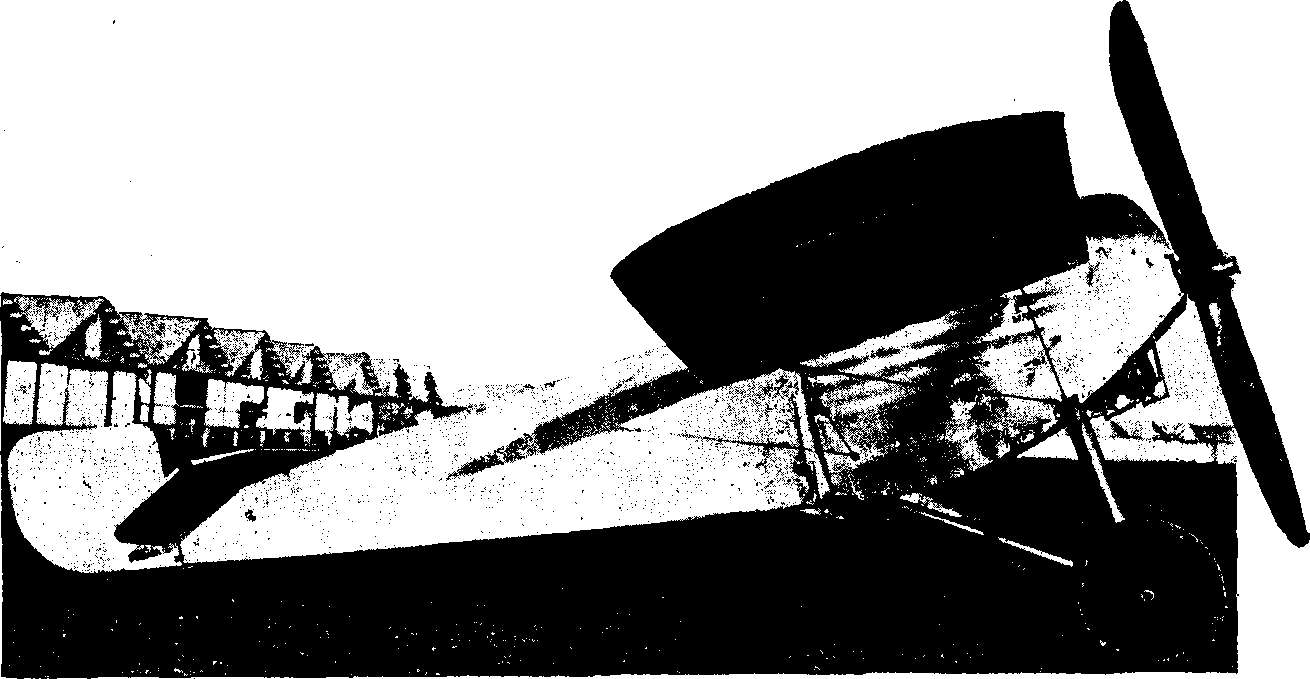 Renneindecker Ponnier für den Coup Gordon-Bennet in Reims. Maschinen abspielen muß. Die Maschinen brauchten selbstverständlich einen sehr langen Start und Auslauf von ca. 1 km. Die Landungsgeschwindigkeit taxiere ich auf ca. 100 km. Ein solches Rennen konnte eben nur auf einem Felde wie Reims bestritten werden. Am 27. September begannen zunächst die Vorprüfungen, d. h. die Ausscheidungen der französischen Flieger für den Gordon-Bennett. Um 8 Uhr meldete sich Prevost zum Start. Sein Flug war prächtig anzusehen. Er vollendete seine zehn Runden von je 10 km ohne Zwischenfall und führte dann eine wunderbare Landung aus. Seine Gesamtflugzeit von 100 km in 31 Min. 22 Sek, ergibt eine mittlere Geschwindigkeit von 191 km. Er flog seine Runden so regelmäßig, daß die größte Zeitverschiedenheit bei den Runden nur 2% Sek. betrug. Um 8:15 startete Gilbert auf Deperdussin Motor Le Rhone 160 PS, man erwartet ungeduldig die Vollendung der ersten Runde um die Zeiten zu vergleichen. Doch schon bald bemerkte man, daß er langsamer als Prevost war. Seine Runde erforderte 14 Sek. Zeit mehr. Doch er verbessert sich noch in seinen nächsten Runden und hat bei der Gesamtflugzeit von 33 Min. 4575 Sek. nur 2 Min. 20 Sek. mehr als Prevost. Rost auf Deperdussin Gnom 100 PS startet um 9 Uhr. Er war jedoch viel langsamer und braucht zu den 100 km 37 Min. 40 Sek. und hat nur eine mittlere Geschwindigkeit von 158 km.  Coup Gordon-Bennet in Reims. Oben links: Pre"vost auf seinem Deperdussin-Renneindecker im Fluge, rechts: Emil Vedrines auf Ponnier-Eindecker im Fluge, darunter: Prevost startet auf seinem Renneindecker Deperdussin mit 160 PS Gnom. Man beachte die Luftabführung hinter dem K\opfe des Führers. Espanet auf Nieuport 80 PS Gnom. Er wollte trotz seiner geringen Motorstärke die Zeit von Rost einholen, doch verflog er sich bei der zweiten Runde und brach den Flug ab. Vedrines auf Ponnier 160 PS Gnom war für Prevost ein scharfer Konkurrent. In der ersten Runde hat er nur 8 Sek. mehr als Prevost und bei der Gesamtflugzeit beträgt der Unterschied nur 1 Minute. Seine mittlere Geschwindigkeit beträgt 185 km. Resultate der Vorprüfungen: 1. Prevost auf Eindecker Deperdussin Gnom-Motor 160 PS (100 km in 31 Min. 22'Ii See.) 2. Vedrines auf Eindecker Ponnier, Gnom-Motor 160 PS. (100 km in 32 Min. 28 See.) 3. Gilbert auf Eindecker Deperdussin Motor Le Rhone 160 PS (100 km in 33 Min. 454/6 See.) Des Nachmittags fand der "Wettbewerb im Langsamfliegen, an welchem 14 Maschinen teilnahmen, statt. Die Bewerber mussten zunächst eine Geschwindigkeitsprüfung über eine Runde von 10 km ablegen, bei dem sie eine Mindestgeschwindigkeit von 90 km zu erreichen hatten. Erst hiernach wurden sie zu der Prüfung für das Langsamfliegen zugelassen. Bei dem Langsamfliegen mussten 2 km in einer durchschnittlichen Höhe von 50 m zurückgelegt werden. Hierbei erzielten die geringsten Durchschnittsgeschwindigkeiten: 1) Jerome auf Breguet-Salmson 51,479 km, 2) Gaston Caudron auf Cau-dron 60 PS Anzani 57,538 km, 3) Legagneux auf Morane-Saulnier-Gnom 58,421 km, 4) Rene Caudron auf Caudron 60 PS Anzani 60,064 km, 5) Gilbert auf Morane-Saulnier-Le-Rhöne 63,456 km, 6) Prevost auf Deperdussin 160 PS Gnom 66,908 km, 7) Vergnieault auf Goupy 100 PS Anzani 71,235 km und 8) Moineau auf Breguet 160 PS Gnom 72,276 km. Bei dem Höhenwettbewerb wurden folgende Resultate erzielt: (Flieger allein) 1. Parmelin Deperdussin Le Rhone 80 PS auf 3441 m 2. Legagneux Moräne Saulnier Gnome 80 PS auf 3409 m 3. Crombez Deperdussin Gnome 80 PS auf 1 626 m (Flieger mit einem Fluggast) 1. Gilbert Moräne Saulnier Le Rhone 160 PS auf 4348 m 2. Brindejonc des MoulinaisMoraneSaulnierGnome80 PS auf 3108 m 3. Garros Moräne Saulnier Gnome 80 PS auf 2819 m ■* (Flieger mit 2 Fluggästen) . 1. Moinau Breguet Gnome 140 PS auf 1562 m 2. Bonnier Nieuport Gnome 100 PS auf 1360 m Der zweite Tag, der 28. September, begann mit dem Wettbewerb um das Langsamfliegen, über 2 km in gerader Linie, hin und zurück, wobei die Höhe von 50 und die mittlere Geschwindigkeit von 65 km nicht überschritten werden durfte. Es erzielten: 1. Moineau auf 140 PS Breguet-Gnom 48,223 km 2. Caudron auf Caudron 60 PS Anzani 57,408 km 3 Cailleaux auf Goupy 80 PS Anzani 60,280 km Am Nachmittag fand ein Ueberlandfliegen über 105 km um 3 Pylonen statt. Um 4 Uhr starteten nebeneinander fast in derselben Sekunde 7 Zweidecker, von denen sofort Caudron die Führung übernahm. Es erzielten: 1. Rene Caudron auf Caudron 60 PS Anzani 1 : 35 : 51 2. Gaston Caudron auf Caudron 60 PS Anzani 1 :52: 38 3. Vergniault auf Goupy 100 PS Anzani 2 :05 : 43. '/3 Stunde später starteten 7 Eindecker. Hiervon erzielten: 1. Rost Deperdussin, 100 PS Gnome 1 : 7 : 18 2. Prevost Deperdussin 78 PS Le Rhone 1 : 19 : 10 3. Parmelin Deperdussin 80 PS Gnom 1 : 25 : 05 4. Espanet Nieuport 80 PS Gnom 1 : 27 : 38 5. Gilbert Moräne 80 PS Gnom 1 : 31 : 15 Verschiedene Wettbewerber starteten für den Höhenflug und versuchten, den alten Höhenweltrekord zu drücken. Gilbert erreichte 5795 m Höhe. 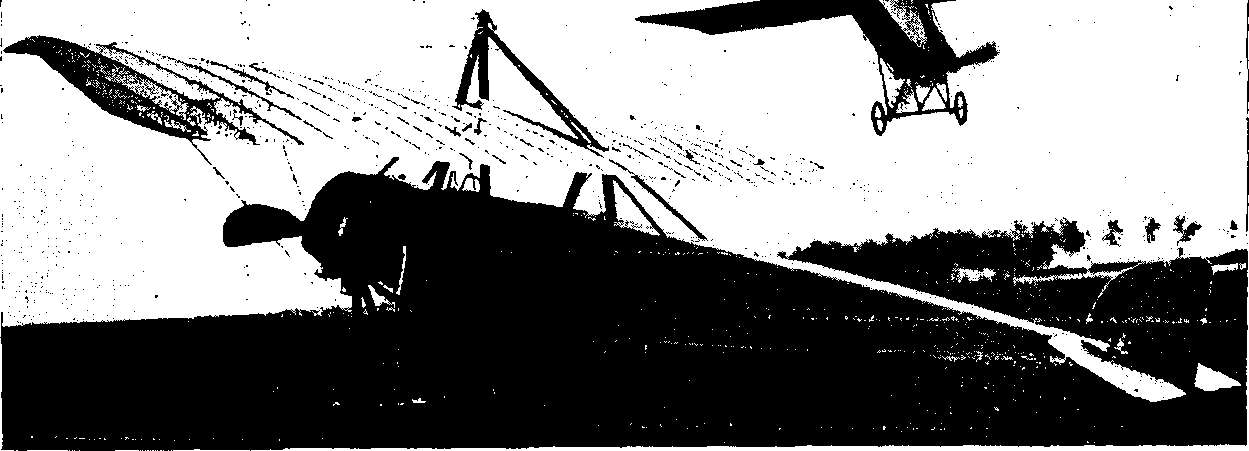 Ftugwodie Reims. Der von Qarros gesteuerte Santos-Damont-Eindedier gebaut von Moräne. Am 29. September fand das Gordon-Bennet Rennen statt. Der Engländer Hamel nahm nicht teil. Prevost (Frankreich) legte die 200 km mit einer mittleren Geschwindigkeit von 201 km zurück und brachte hiermit den Gordon-Bennett Pokal 1914 an sich. Die zweitbeste Geschwindigkeit 198 km erzielte Vedrines (Frankreich), die dritte Gilbert 192 km (Frankreich) und vierte Crombezi 172 km (Belgien) Der 800 km Flug von Garros über das Mittelmeer. Zu den erfolgreichsten und ältesten Fliegern gehört unzweifelhaft der kühne Garros, der trotz ungünstiger Chancen am 24. Sept. von Toulon nach Bizerta flog. Der von ihm benutzte Morane-Saulnier Eindecker bewährte sich auch diesmal glänzend. Ohne die Maschine mit Schwimmern für den Fall einer Wasserlandung zu versehen, vollzog sich um 5 Uhr 45 früh der Start und Garros erreichte in kurzer Zeit eine Höhe^von 2500 m, welche er bis Bizerta innehielt. Die Flugroute führte längs der Ioseln Corsika und Sardinien, wo er zwischen 7 und 8 Uhr gesichtet wurde. Um 11 Uhr erschien der zierliche Eindecker am Horizont von Cagliari der Südspitze von Sardinien, von wo er die Richtung nach Bizerta nahm und landete dortselbst stürmisch begrüßt um 1 Uhr 40. Hier stellte sich ein geringfügiger Motordefekt heraus, der den Weiterflug nach Tunis beträchtlich verzögerte. Im Benzinreservoir b fanden sich nur noch 5 1 Betriebsstoff, die nur für wenige Minuten ausgereicht hätten. Gegen 6 Uhr nachmittags war die Maschine wieder startbereit und Garros versuchte auf dem kürzesten Weg Tunis zu erreichen, wo er seit ll Uhr morgens mit Spannung erwartet wurde. Aber die hereinbrechende Dunkelheit und ein ßenzinbehälterdefekt zwangen ihn 25 km von Tunis entfernt niederzugehen. Am folgenden Tage gelangte Garros um 7 Uhr 15 nach Tunis und ließ seinen Apparat auf dem Dampfer Manouba nach Marseille transportieren. Die Gesamtflugzeit betrug 6 Std. 55 Min., was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 115 km pro Stunde entspricht. Flugtechnische gps^ Rundschau. Inland. Flugjiihrer-Zeugnisse haben erjialten: t No. 498. Strauch, Willy, Ingenieur, Berlin, geb. am 2. August 1880 zu Jüterbog, für Eindecker (Grade), Flugplatz Grade, Bork, am 1. September 1913. No. 499. Hammer, Fritz, Ingenieur, Johannisthal, geb. am 6. Dez. 1888 ' zu Berlin, für Eindecker (Harlan), Flugplatz Johannisthal, am 2. September 1913- No. 500. von Mises, Richard, Professor Dr. Edler, Straßburg, geb. am 19. April 1883 zu Lemberg (Oesterreich), für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 2. September 1913. No. 501. Sedlatzek, Kurt, Berlin, geb. am 24. April 1893 zu Berlin, für Zweidecker (Original-Farman der L.V.G.), Flugplatz Johannisthal, am 2. Sept 1913. No. 502. Lindner, Oskar, stud. ing., Flöha i. S, geb am 15. Okt. 1893 zu Flöha, für Eindecker (Grade), Flugplatz Bork, am 3. Sept. 1913. No. 503. Mikulski, Karl, Leutnant im Inf-Rgt. 14, Bromberg, geb. am 24. Januar 1889 zu Rzegnowo, Kr. Gnesen, für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 3. September 1913. No. 504. Scheuermann, Erich, München, geb. am 4. März 1888 zu München, für Zweidecker (Otto), Flugfeld Oberwiesenfeld, am 6. September 1913. No. 505. L'edlolf, Kurt Otto, Niederschöneweide, geb am 20. Dez. 1891 zu Chemnitz, für Eindecker (M. B-Taube), Flugplatz Johannisthal am 6. Sept 1913. No. 506. Nischwit/, August, Johannisthal, geb. am 31. August 1892 zu Mainz, für Eindecker (Fokker), Flugplatz Johannisthal, am 6. September 1913. No. 507. Röder, Hei mann, Burg b. Magdeburg, geb.. am 14. Nov. 1892 zu Dresden, für Eindecker (Schulze), Flugfeld Madel b. Burg, am 6 Sept. 1913. No. 5C8. Kruse, Johannes, Kiel, geb. am 22. Juni 1894 zu Kiel, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 6. September 1913. No. 509. Mayweg, Hermann, stud. med, Hagen i. W , geb. am 5. Juli 1890 zu Hagen i. W., für Eindecker (Harlan), Flugplatz Johannisthal, am 11. Sept. 1913. No. 510. von Hahn, Bugen, Johannisthal, geb. am 7. August 1892 zu Bachtschisarai (Rußland), für Eindecker (Ruinpier), Flugplatz Johannisthal, am 11. September 1913. _ Die Feldpilotenprüfung haben bestanden: Am 19. September in Frankfurt a. M. Karl Lang auf Eulerdoppeldecker 80 PS Gnom. Am 20. September auf dem Fuhlsbütteler Flugplatz der Flieger Otto Hammer auf Gotha-Taube. Am 23. September in Frankfurt a. M. August Spachholz auf Eulerdoppeldecker 80 PS Gnom. Am 24. September in Johannisthal Ing. Otte auf Albatros-Mercedes-Taube. Otte flog eine Stunde in 1000 m Höhe. Ferner fünf der Firma Rumpier von der National-Flugspende zugewiesene Flugschüler: Ing. Mees, C. Nolting, Ing. Heyer, May und stud. mach Zentzy tzky. Am 25. September in Johannisthal Flieger Brei tbei! auf Ago-Doppel-decker 70 PS Mercedes. Auf dem Flugplatz Habsheim der National-Flug-spenden-Schüler Renatus T h e i 11 e r. Am 26. September in Johannisthal der National-FIugspenden-Schüler Behling auf Ago 70 PS Mercedes. Am 27. September in Frankfurt a. M. Günther von Ploez auf Eulerdoppeldecker 80 PS Gnom. _ Von den Flugplätzen. Auf dem Goedeclter-Flugplatz erfüllten die Fliegerprüfung Ernst Hess, stud ing aus Chemnitz, Ltn. a. D. Kuhlmann aus Darmstadt, L. Schwahn, stud. med. aus Heidelberg und Leopold Ansiinger aus Freiburg i. B. auf 70 PS Mercedes-Goedecker-Taube. 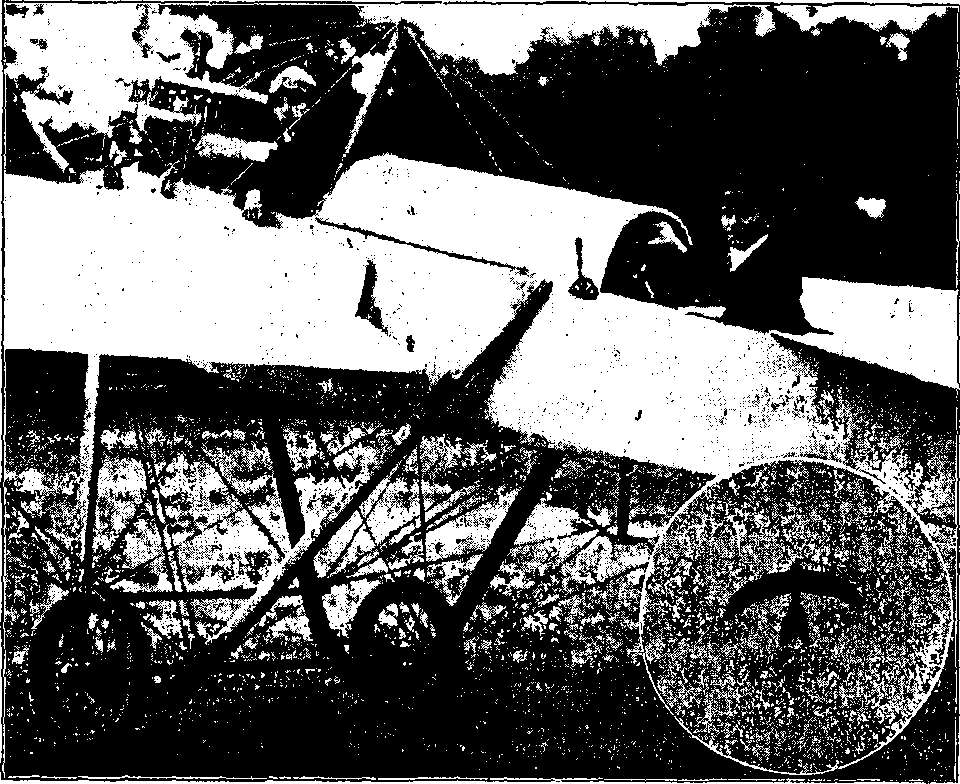 Sdtäfer auf seinem Pfeil-Eindecker. Rechts unten der Apparat im Fluge. Auf dem Jblugplats Magdeburg machte der Flieger Onigkeit mit seinem selbstkonstruierten Eindecker, mit einem 70 PS R. A. W.-Motor am 19. September einen Stundenflug um den Preis der National-Flugspende. Der Flieger blieb im ganzen 65 Minuten in der Luft und erwarb sich somit einen Preis von 1000 M. Vom Flugplatz llebstovle bei Frankfurt. Auf dem Rebstöcker Flugplatz flog am 19. September der Flieger Albert Schäfer auf einem Eindecker Konstruktion Qrebe-Schäfer eine Stunde um die Prämie der National-Flugspende, Er startete um 5 : 05 und landete 6: 8 : 43 und gewann hiermit 1000 Mark. Wie die beistehende Abbildung zeigt, besitzt der Eindecker eine eigentümliche sichelförmige Tragdeckengestaltung. Zum Betriebe dient ein 100 PS Argus-Motor. Schäfer beabsichtigt, sich noch um weitere Preise der Nationallugspende zu bewerben. Vom FlugpUitz Wanne. Auf dem Flugplatz Wanne absolvierte am 19. September der Flieger Basser einen Dreistundenflng um den Preis der National-Flugspende, womit ihm der Betrag von 3000 M. zufällt. Das Flugzeug ist ein „Taubentyp" des Ing. Schuhmacher mit einem 70 PS R. A. W-Motor der Rheinischen Aerowerke in Düsseldorf. Es ist dieses der erste Dreistundenflug, welcher auf dem Flugplatz Wanne seit seinem Bestehen aufgeführt wurde. Basser startet demnächst mit demselben Flugzeug um die neuen Preise der Nationalflugspende für Ueberlandflüge /Vlllitärische Flüge. Von Bautzen nach Leipzig flog am 21. September Lt. Clemens mit Oberlt. Walther als Beobachter auf D. F. W.-Doppeldecker, welcher den Namen „Oberlausitz" führt, wo er auf dem Mockauer Flugplatz landete. Von Johannisthal nach Swinemünde flog am 26. September Lt. Döring mit Lt. Deckmann auf L. V. Q.-Doppeldecker in 2 Stunden 30 Min. Von Danzig nach Magdeburg flog am gleichen Tage Lt von Scheele Von Gotha nach Wels in Oberösterreich flog am 22 September der Flieger Martin König mit Lt. Bohne auf einer 100 PS Gotha-Argus-Taube. Er beabsichtigte ursprünglich nach München zu fliegen. Unterwegs geriet die Maschine in einen dichten Nebel, wodurch jede Orientierung erschwert wurde. Ein starker Ostwind setzte ein und trieb das Flugzeug über die österreichische Grenze, wo die Flieger auf dem Exerzierplatze zu Wels an der Traun glatt landeten. Die Maschine wurde während der Nacht militärisch bewacht. Von Mülhausen (Elsaß) nach Leipzig flog am 26. September Ingold auf Aviatik-Eindecker 100 PS Argus-Motor in 6 Stunden. Er flog in Mülhausen um 6 Uhr morgens ab und landete um 12 Uhr mittags in Leipzig auf dem Flugplatz Mockau. Gegen 4 Uhr ist er nach Johannisthal aufgestiegen, wo er 4'/2 Uhr eintraf. _ Flüge mit Wasserflugzeugen der Marine. Am 15. September flog Oberlt. z. S. Langfeld auf Avro-Doppeldecker mit 80 PS Gnom-Motor um 2:45 nachmittags, sowie Lt. z. S. Schiller auf Ago-Doppeldecker mit 100 PS 6 Zyl. Argus-Motor von Helgoland nach Kuxhaven. Der englische Avro-Doppeldecker hat sich während der Flottenmanöver bei hoher See ausgezeichnet bewährt. Die See ging teilweise so hoch, daß der Flieger, wenn er im Wellental war, nicht über die Wellenberge hinwegsehen konnte. Ausland. Henri Farmans Unfall. Vorige Woche brachten die Tageszeitungen eine Nachricht, wonach Henri Farman mit seiner Frau als Fluggast abstürzte und schwer verletzt sein sollte. Diese Nachricht ist nicht zutreffend. Farman hat nur einige Abschürfungen erlitten und kann bereits das Krankenhaus wieder verlassen. Das Flugzeug Moreau mit automatis hem Stabilisator hat am 24. Sept. den von der Luftschiff-Liga gestifteten Preis auf einem Flugplatz bei Paris an sich gebracht. Der Stabilisator dieses Flugzeuges ist. wie unseren Lesern aus der Beschreibung im „Flugsport" No. 17 Jahrgang 1912 bekannt ist, ein sogenanntes Pendelstabilisator. Die Maschine soll in 80 m Höhe bei starkem Wind mehrere Rundflüge, ohne daß die Steuer berührt wurden, ausgeführt haben. Von Landskrona über Malmö nach Stralsund flog am 24. September vormittags der schwedische Flieger T h u I i a. Es ist dies der erste Flieger, welcher von Schweden nach Deutschland geflogen ist.  Fallers Flug nach dem Feldberg. (Vergleiche Notiz in Nr. 19) Verschiedenes. Preise für Landungen auf dem Dresdner Flugplatze. Eine Einrichtung, die in Fliegerkreisen mit großer Freude begrüßt werden wird, hat der städtische Flugplatz in Dresden-Kaditz getroffen. Vom 23. September ab erhält jeder Flieger, der auf dem Kaditzer Flugplatze eine glatte Landung vornimmt, einen wertvollen Preis ausgehändigt, der auf Wunsch auch in Geld ausgezahlt werden wird. Der Flieger muß am Landungstage mindestens 50 km in gerader Luftlinie zurückgelegt und wie schon erwähnt, eine glatte Landung auf dem Dresdner Flugplatze vollzogen haben. Jeder Flieger kann den Preis nur einmal gewinnen. Bis jetzt sind 10 gleichwertige Preise ausgeworfen, die gegebenenfalls noch vermehrt werden. Die Preise stehen bis 3 Tage vor der offiziellen Eröffnung des Dresdner Flugplatzes zur Verfügung. Die Eröffnung wird voraussichtlich Ende Oktober stattfinden und noch genau bekannt gegeben werden. Der Dresdner Flugplatz liegt etwa 5 km westlich Dresdens zwischen den Dörfern Kaditz und Uebigau direkt an der Elbe. Er ist sofort zu erkennen an der im Bau befinj liehen Luftschiffhalle, die sich dicht südlich des eigentlichen Flugplatzes befindet. Der Mittelpunkt des Landungsplatzes ist vom 25. dieses Monats ab durch einen großen mit weißen eingelassenen Kacheln hergestellten Kreis gekennzeichnet. Nach Möglichkeit wird in einer Ecke des Flugplatzes stets ein 15 m langer Pfeil ausgelegt sein, der die Windrichtung kennzeichnen soll. Der Pfeil wird so ausgelegt, daß er mit der Spitze gegen den Wind fliegt Für Unterkunftsmöglichkeiten der landenden Flugzeuge wird in einigen Tagen gesorgt sein. Voherige telefonische Anmeldung nimmt gern entgegen und zu näherer Auskunft ist die Verwaltung des städtischen Flugplatzes Dresden an der Kreuzkirche 18, Telefon 25511 (Nebenstelle) gern bereit. Eine Fahrt im führerlosen Flugzeu?. Man liest sehr häufig, daß infolge Versagens des Motors ein Flugzeug abgestürzt ist, daß aber auch einmal das Gegenteil der Fall sein kann, nfimlich daß durch ein zu promptes Arbeiten des Motors ein Fluggast in Gefahr kommen kann, konnte man neulich auf einem niederrheinischen Flugplatz beobachten. Ein Flieger war mit seiner Taube zu mehreren Passagierflügen aufgestiegen, um einen neuen Motor der Rheinischen Aerowerke auszuprobieren, wobei er 3'/, Stunden in der Luft blieb. Als er schließlich in schönem Gleitflug vor seinem Schuppen landete, drosselte er den Motor ab und stieg aus, um etwas aus dem Schuppen zu holen, während eine Dame, welche den Flug als Passagier mitgemacht hatte, in dem Flugzeug blieb. Durch eine unvorsichtige Bewegung geriet sie an den Stellhebel des Flugzeuges, den sie unvorsichtigerweise herumstellte, sodaß der Motor nun mit voller Tourenzahl lossprang und das Flugzeug über den weiten Flugplatz raste. Nachdem die junge Dame sich von ihiem ersten Schreck erholt hatte, war sie geistesgegenwärtig genug, den Motor zum Stillstand zu bringen, konnte es aber nicht mehr hindern, daß das Flugzeug mit großer Wucht gegen eine Galle fuhr und hier einen Teil der Wand zersplitterte, wobei auch ein Teil des Flugzeuges in Trümmer ging. Die Dame ist mit dem bloßen Schreck davongekommen. Der Dunne-Zweidecker wurde in Frankreich verbrannt, um Konstruktionsgeheimnisse zu wahren. Diese Nachricht, welche von vielen Tageszeitungen gebracht wurde, wird jeden Fachmann etwas befremdet haben. Sie entspricht selbstverständlich nicht den Tatsachen. Der fragliche Zweidecker von Dünne war eine ganz alte Maschine, die schon viele Flüge hinter sich und auch bereits in Deauville im Wasser gelegen hatte Die Tragflächen waren so defekt, daß sie sogar als Schulmaschine nicht mehr zu verwenden war. Man nahm daher den Motor heraus und steckte die Zelle, um den unnützen Transport nach den Werkstätten in Paris zu vermeiden, einfach in Brdnd. Patentwesen. Doppeldecker mit versetzten Tragflächen. *) Die vorliegende Erfindung bezweckt, für einen Zweidecker eine selbststabile Flächenanordnung zu erreichen. Sie besteht darin, daß man das untere Tragdeck gegenüber dem oberen nicht nur nach hinten verschiebt, wie es bei den Staffeideckern bereits bekannt ist, sondern es auch unter einem kleineren Anstellwinkel anordnet, wie das obere. Bisher ist es nur bekannt, bei einem Doppeldecker mit nicht gegeneinander versetzten Tragflächen die äußeren Enden der oberen Tragfläche stärker zu neigen als diejenigen der unteren. Natürlich können auch bei der Verwindung der Flächen gestaffelter Doppeldecker ähnliche Neigungswinkelverhältnisse eintreten, aber ebenfalls nur in einzelnen Teilen der Tragflächen. Bei der vorliegenden Erfindung dagegen handelt es sich um die normale Stellung der gesamten Flächen. Dabei ist es für den Gegenstand der vorliegenden Erfindung vollständig belanglos, wie die Tragdecks nach Profil und Grundriß entworfen sind, ob Motor, Propeller und Höhensteuer vor oder hinter dem Flugführer angeordnet sind, ob die Spannweite des oberen Tragdecks größer ist als die des unteren, ob ferner für die Verwindung Ober- und Unterdeck oder nur eines von beiden verwendet wird und andere Fragen der Durchführung im einzelnen. Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist einzig und allein die An- *) D. R. P. Nr. 260049. Wilhelm Blank in Dresden. Wendung des Prinzips der Winkeldifferenz auf die Haupttragzelle eines Staffel-deckers zum Zweck der Längsstabilisierung. Abb. 1 zeigt die Seitenansicht eines Ausführungsbeispieles der Erfindung. Abb. 2 stellt den 2ugehörigen Grundriß dar. In Abb. I und 2 bedeutet o das obere und u das untere Tragdeck. Motor und Sitze können innerhalb der Tragflächenzelle, die Steuer vor oder hinter derselben angeordnet werden. Abb. 1 Abb. 2 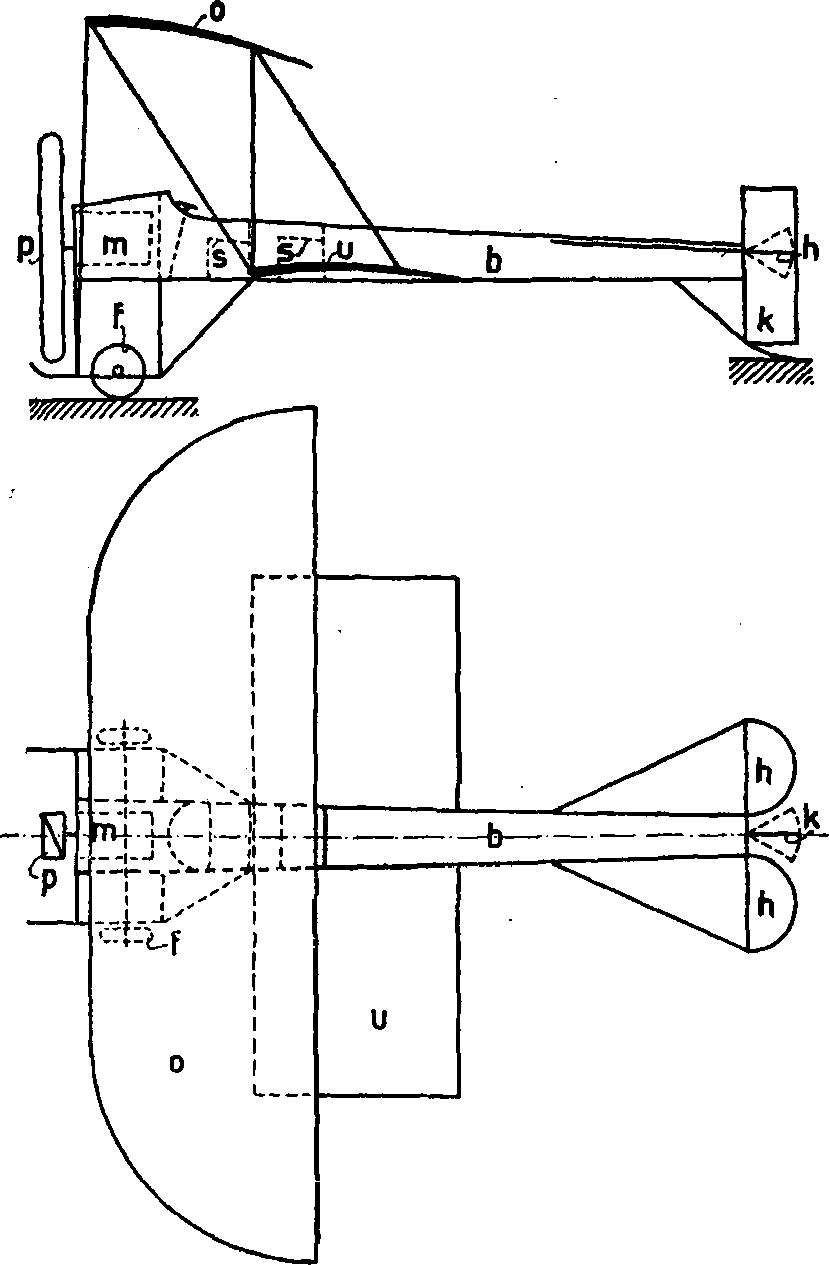 Patent-Anspruch: Doppeldecker mit versetzten Tragflächen, dadurch gekennzeichnet, daß das untere gegenüber dem oberen nach hinten verschobene Tragdeck zugleich unter einem kleineren Anstellwinkel angeordnet ist, zum Zweck, die selbstwirkende Längsstabilisierung ganz oder teilweise in die Tragzelle zu verlegen. Spannband für Flugzeuge.*) Die an Stelle der Spanndrähte verwendeten Spannbänder von Flugzeugen erleiden während des Fluges Erschütterungen, die zur Folge haben, daß die Spannbänder sich nicht immer mit der schmalen Kante in die Flugrichtung ein- *) D. R P. Nr. 259024. Wwe. Jeanne Marie Anna Denieport, gen. Nieu-port, geb. Loubens in Suresnes, Frankreich. stellen, sondern der Flugrichtung ihre volle Fläche bieten, wodurch die Vorwärtsbewegung des Flugzeuges verlangsamt wird. Um diesem Uebelstand abzuhelfen, werden gemäß der vorliegenden Erfindung die Spannbänder mit kleinen Ansatzflächen versehen, die parallel zur Flugrichtung des Apparates verlaufen und eine Art Befiederung der Spannbänder bilden. Auf der Zeichnung ist eine Ausführungsform der Erfindung dargestellt, und zwar zeigt Abb. 1 einen Teil eines Flugzeuges perspektivisch mit Spannbändern gemäß der Erfindung. Abb. 2 und 3 zeigen ein Stück eines Spnnn-bandes in zwei verschiedenen Ansichten. Abb. 1 I I 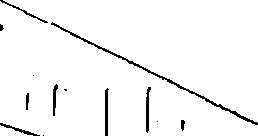 Abb. 2 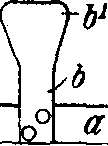 V7 Abb. 3 Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind die metallenen Bänder a mit kleinen Ansatzplatien b versehen, die an die Bänder angenietet sind und am hinteren Ende eine Verbreiterung b1 besitzen Die Form der Ansatzplatten könnte selbstverständlich auch eine andre sein. Patent-Anspruch: Spannband für Flugzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß dasselbe mit Ansatzflächen versehen ist, durch die es beim Fluge in die Windrichtung gestellt wird. Landungs- und Fahrgestell für Flugzeuge.*) Es ist bekannt, daß gerade die Fahr- und Landungsgestelle von Flugzeugen außerordentlich stark beansprucht werden, insbesondere wenn der Flieger genötigt ist, auf stark unebenem Boden, z. B. einem frisch beackerten Feld zu landen. Die Fahrgestelle bisheriger Bauart bilden zumeist mit dem Flugzeugrumpf ein starres Ganzes. Die Streben oder Füße des Landungsgestelles sind dabei nichts anderes als Verlängerungen gewisser Teile des Rumpfes und bestehen mit diesen Teilen aus einem Stück. Infolgedessen übertragen sich alle Beanspruchungen des Fahr- und Landungsgestelles unvermindert auf diese Teile, und die Verlaschungen und die Verbindungsstellen des Flugzeugrumpfes werden sehr bald ■ 2 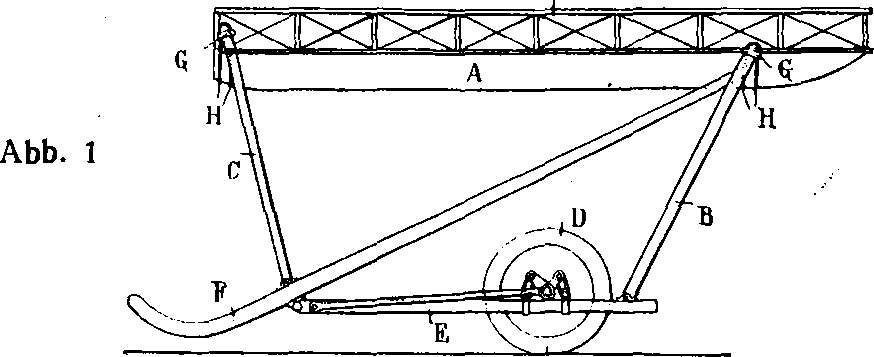 - '2 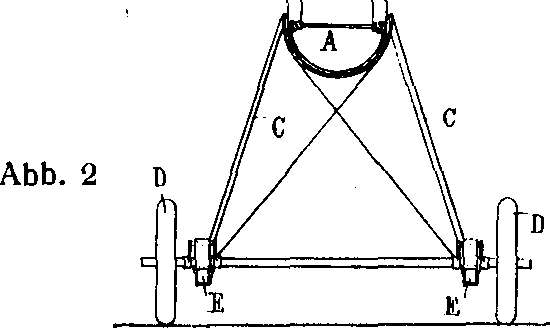
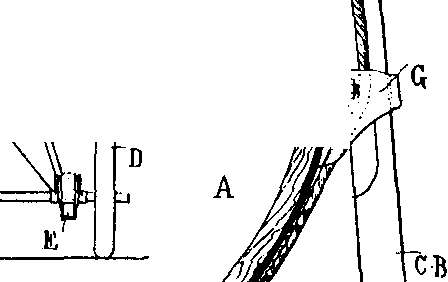 Abb. 3 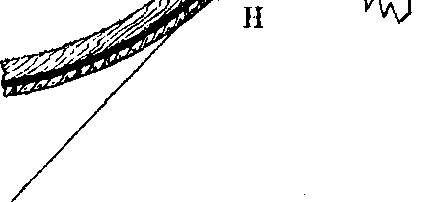 locker bezw. ganz zerstört. Die starre Verbindung zwischen Landungsgestell und Rumpf bezw. die Einteiligkeit beider Körper hat ferner zur Folge, daß beim Bruch des Landungsgestelles das ganze Flugzeug auf längere Zeit unbrauchbar wird. Für Ueberlanaflüge bedeutet dies einen erheblichen Mangel. Die Erfindung schafft dadurch Abhilfe, daß das Landungs- und Fahrgestell vom Flugzeugrumpf vollständig unabhängig gemacht ist' oder ein Gestell für sich bildet, das am Flugzeugrumpf gleitbar geführt und durch den Rumpf unterfangende Gurte, Seile o. dergl. gehalten ist. Auf der Zeichnung zeigt: Abb. 1 eine Seitenansicht des Vorderteiles eines Flugzeuges und Abb. 2 einen Querschnitt nach 2—2 der Abb. 1. Abb. 3 veranschaulicht in größerem Maßstabe die Verbindung des Fahrgestells mit dem Flugzeugkörper. A ist der Flugzeugkörper; B und C sind die Stützen des Fahrgestelles, das mit Rädern D versehen ist. Diese Räder sind an den Kufen E elastisch befestigt. Außerdem sind noch die Stoßfänger F vorhanden. *) D. R. P. Nr. 263427 Armand Jean Auguste Deperdussin in Paris. Abb. I 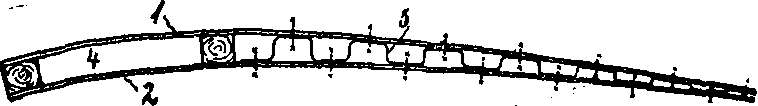 -3 Erfindungsgemäß sind die Stützen B und C in Muffen Q des Flugzeugkörpers A gleitbar geführt. Das Oberende der Stützen B, C ist mit einer Rinne versehen, in der ein den Flugzeugkörper A unterfangendes Seil H liegt. Die Einzelheiten der Erfindung können beliebig abgeändert ausgeführt sein, wie denn überhaupt die aus der Zeichnung erkennbare Ausführungsform des Fahrgestelles sowie die muldenförmige Ausbildung des Rumpfes nicht den Gegenstand der vorliegenden Erfindung bilden, denn wesentlich für diese ist lediglich die Unabhängigkeit desFahrgestelles vom Rumpf und seine Gieitführung und Lagensicherung durch unter dem Rumpf liegende Seile o. dgl. Patent-Anspruch. Landungs- und Fahrgestell für Flugzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß es aus einem vom Flugzeugrumpf A unabhängigen Rahmen besteht, der am Rumpf gleitbar geführt und durch den Rumpf unterfangende Gune, Seile o. dgl. H gehalten ist. _ Federndes Spant für Flugzeuge.*) Es sind Spanten für Flugzeuge bekannt, bestehend aus einem Obergurt und Untergurt und aus diese Gurte verbindenden Zwischengliedern in einer solchen Anordnung, daß entsprechend der Verbiegung des Spants die beiden Gurte gegeneinander verschoben werden können. Zu diesem Zweck sind die Verbindungsglieder beispielsweise als starre, zweiarmige Hebel ausgebildet, an deren einem Arm der Untergurt, am anderen Arm der Obergurt befestigt ist, derart, daß durch Schrägstellen dieses Hebels vom Führersitz aus die Ver-schiebun der Gurte stattfindet. Die Federung dieser Spanten wird lediglich durch die Elastizität der beiden Gurte bewirkt Demgegenüber betrifft die vorliegende Erfindung ein Spant, dessen Federung neben der Elastizität der Gurte vor allem durch die Elastizität der Zwischenstücke bewirkt wird, die, zwischen den beiden Gurten eingeschaltet, gleichzeitig deren Verbindung bewirken. Fünf Ausführungsbeispiele der Abb. Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6 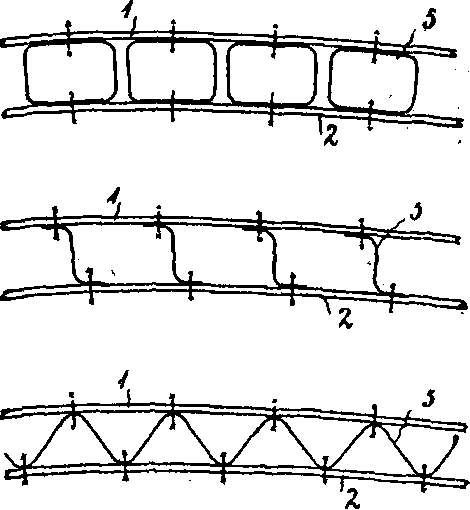 Erfindung sind auf der Zeichnung in sechs Abbildungen dargestellt. *) D. R. P. Nr. 263 546 E. Rumpier, Luftfahrzeugbau G. m. b. H. in Berlin-Johannisthal. Abb. 1 und 2 zeigen einen Spant von der Seile und von oben gesehen, während die übrigen Abbildungen andere Ausführungsformen der elastischen Zwischenglieder darstellen. In den Abbildungen sind 1 der Obergurt, 2 der Untergurt des Spants 3 Querträger. Das Spant hat soweit es zwischen den Querträgern fest eingespannt ist, in üblicher Weise einen festen Steg 4, während die Gurte an den freien elastischen Enden durch federnde Zwischenclieder 5 verbunden sind. Die Zwischenglieder haben bei der ersten Ausführungsform wellenförmige, rechteckartig, bei der letzten Ausführungsform wellenförmige dreieckartig zusammengesetzte Gestalt. Bei der Ausführungsform nach Abb. 3 und 4 sind sie als geschlossene Ringe von rundem oder viereckigem Querschnitt ausgebildet während sie bei der Ausführungsform nach Abb. 5 Z-förmigen Querschnitt besitzen, Patent-Ansprüche. 1. Federndes Spant für Flugzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Ober- und Untergurt auf die ganze Länge oder auf einzelne Strecken elastische Verbindungsstücke zwischengeschaltet sind, die eine leichte und gleichmäßige Verschiebung der Gurte gegeneinander gestatten. 2 Ausführungsform des Spants nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die elastische Verbindung durch ein fortlaufendes welltnförmiges Stahlband gebildet ist. 3. Ausführungsform des Spants nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die elastische Verbinduug durch einzelne geschlossene Ringe oder Z- oder U-förmig gestaltete Zwischenelemente erfolgt. Fahrgestell für Flugzeuge.*) Die Erfindung betrifft ein Fahrgestell für Flugzeuge, bestehend aus einem dreieckigen Rahmen, der mit seitlichen Rädern und einer zwischen diesen liegen- 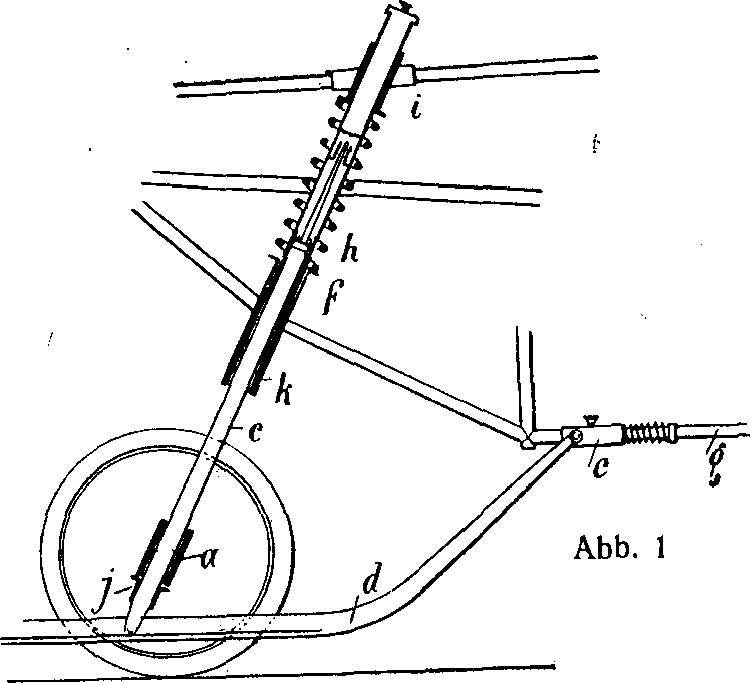 den, abgefedert gleitenden und an ihrem Unterende eine Landungskufe tragende Mittelstütze versehen ist. Die Erfindung besteht in der besonderen elastischen Anordnung der Kufe, die einerseits an der Mittelstütze und andererseits an einer auf einem Längsträger des Gestelles abgefedert verschiebbaren Hülse gelenkig befestigt ist. Die Zeichnung zeigt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung. Dabei ist Abb. 1 eine Seitenansicht der am Vorderteil eines Flugzeuges angebrachten Vorrichtung, während Abb. 2 eine Ansicht von vorn auf die Vorrichtung darstellt. Die Vorrichtung besteht aus einem Wagen, der von der Achse a und zwei Rädern gebildet wird und der durch zwei Streben b mit der Hülse f verbunden *) D. R. P. 249 760. Robert Esnault-Pelterie in Billancourt, Frankreich, ist. Diese ganze Vorrichtung wird nach unten hin auf einem Schaft c und nach oben hin in einem Rohr k, das fest mit dem Gestell des Flugzeuges verbunden ist, geführt. Am unteren Ende des Schaftes c ist die Kufe d angelenkt, die mit ihrem hinteren Ende an einer auf einem Hauptträger g des Apparatgestelles abgefedert verschiebbaren Hülse gelenkig befestigt ist. Das Apparatgestell hängt elastisch auf einer Schraubenfeder h, die sich auf eine Hülse f auflegt. Diese Schraubenfeder stützt sich andererseits auf einen festen Punkt oder einen Wulst i, der mit dem Apparatgestell fest verbunden ist. Der Schaft c, auf dem der Wagen geführt wird, stützt sich mit seinem oberen Teil wenn 'der Wagen sich mit einem Stoß aufsetzt, gegen einen beliebig konstruierten hydropneumatischen Puffer. Ein Wulst j, der fest mit dem Schaft c verbunden ist, bildet eine Hubbegrenzung für die Hülse a der Achse und hält die Gleitschiene in ihrer normalen Lage. Die Vorrichtung wirkt wie folgt: Wenn der Apparat am Boden hinfährt, hängt er elastisch vermittels der Feder h auf dem Wagen. Bei einer Landung des Apparates stößt der Wagen gegen den Boden und schiebt sich dabei bis hinter die untere Kante der Schiene d zurück. Letztere trägt alsdann den Apparat und drückt vermittels des Schaftes c die hydro-pneumatische Vorrichtung zusammen, wodurch «sie den Stoß vollständig auffängt. Die Kufe wird dabei mit ihrer Hülse e gegen die Wirkung der auf dem Hauptträger g angeordneten Feder gleichzeitig* etwas rückwärts bewegt. Da die Kufe d im Schaft c angelenkt ist, so kann sich die Kufe parallel zur Längsachse der Vorrichtung verstellen. Die durch diese Anordnung erzielte Nachgiebigkeit hat zur Folge, daß der sonst so häufige Bruch der Landungskufe vermieden wird. Patent-Anspruch: Fahrgestell für Flugzeuge, bestehend aus einem dreieckigen Rahmen, der mit seitlichen Rädern und einer zwischen diesen liegenden, abgefedert gleitenden; an ihrem Unterende eine Landungskufe tragenden Mittelstutze versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Kufe einerseits an der Mittelstutze und andererseits an einer auf einem Längsträger des Gestelles abgefedert verschiebbaren Hülse gelenkig befestigt ist. Steuerung für Luftfahrzeuge, bei der zu beiden Seiten der Längsachse Klappenpaare angeordnet sind.*) Die Erfindung betrifft eine Steuerung für Flugzeuge, bei der zu beiden Seiten der Längsachse Klappenpaare angeordnet sind. Von den bekannten Steuerungen dieser Art unterscheidet sich der Erfindungsgegenstand dadurch, daß die untere Klappe jedes Paares derart mit der oberen verbunden ist, daß beim Oeffnen der ersteren gleichzeitig ein Oeffnen der oberen Klappe stattfindet, wobei jedoch die obere Klappe, unabhängig von der anderen, auch eine stärkere Neigung zwecks Stabilisierens erhalten kann. Auf der Zeichnung ist die neue Steuerung in einem Ausführungsbeispiel dargestellt. 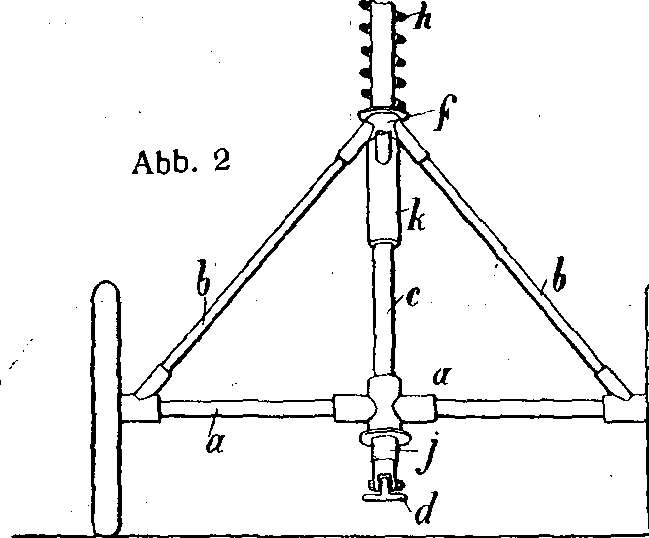 *) D. R. P. Nr. 255161. Wilhelm J. Hoffmann in Charlottenburg. Zu beiden Seiten der Längsachse des Flugzeuges sind Klappen a und b um eine gemeinschaftliche Achse c drehbar angeordnet. Die beiden Klappen sind miteinander durch ein über eine am oberen Deck vorgesehene Rolle c geführtes Drahtseil k verbunden Die untere Klappe b trägt einen Arm b2, an den ein nach dem rührersitz führendes Drahtseil h» angreiit, sodaß beim Anziehen dieses Drahtseiles die Klappe b nach unten, und vermittels des Drahtseiles h die obere Klappe nach oben gezogen wird, wodurch ein Bremsen des Flugzeuges auf dieser Seite bewirkt wird. An einem Arm b3 der oberen Klappe a greift ein ebenfalls nach dem Führersitz führendes Drahtseil h' an, sodaß es möglich ist, durch Anziehen dieses Seiles die Neigung der Klappe a zu vergrößern, und 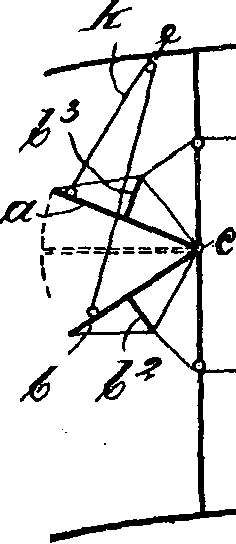 IL -y- zwar unabhängig von der Klappe b, die der Luftzug stets nach oben zu drücken sucht, daran aber durch das Drahtseil h2 gehindert wird. Dadurch wird die Seilenstabilisierung des Flugzeuges ermöglicht. Das Drahtseil k hat den Vorteil, daß eine gleichmäßige Bewegung der Klappen gesichert ist, was sonst nicht gut möglich wäre, weil die obere Klappe mit ihrem Gewicht ihrer Einstellung entgegenwirkt, während die untere Klappe ihre Einstellung noch unterstützt. Das Zurückführen der Klappen erfolgt durch den Luftzug. Man kann das Drahtseil k so bemessen, daß, wenn die untere Klappe durch den Luftzug in die wagrechte Lage gebracht ist, die obere Klappe etwas nach oben geklappt festgehalten wird, um gegebenenfalls dadurch die Stabilität zu erhöhen. Patent-Anspruch: Steuerung für Luftfahrzeuge, bei der zu beiden Seiten der Längsachse Klappenpaare angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die untere Klappe jedes Paares derart durch einen Seilzug mit der oberen verbunden ist, daß beim Oeffnen der unteren Klappe gleichzeitig ein Oeffnen der oberen Klappe stattfindet, wobei die obere Klappe aber auch unabhängig von der unteren zwecks Stabilisierens eingestellt werden kann. 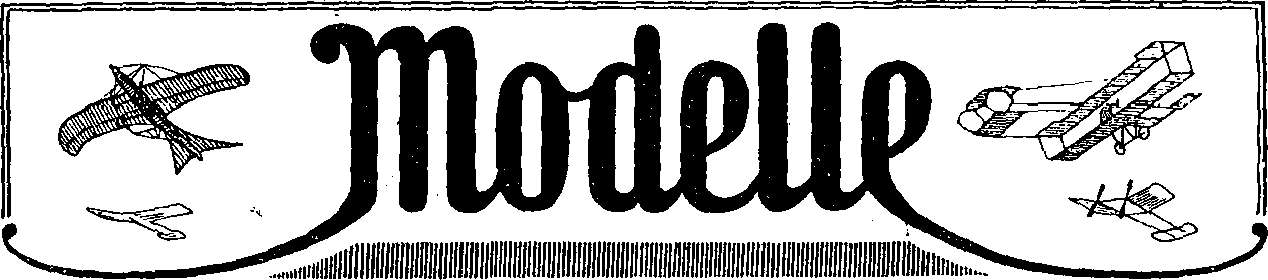 Das Wilkinson-Eindecker-Modell wurde auf der Olympia-Ausstellung ausgestellt und fiel durch seine gediegene Bauart und mustergiltige Formgebung auf. Der tropfenförmig gestaltete Rumpf bestehr aus poliertem Aluminiumblech, ist an seinem größten Querschnitt 10 cm dick und hat an dieser Stelle Emaillitfenster. Die Sitze und Steuerungen sind nebeneinander angeordnet. Vorn befindet sich ein 8-Zylinder Preßluftmotor, der eine Luftschraube von 26 cm antreibt. Im verjüngten Rumpfende ist der Preßluftbehälter eingebaut. Das Fahrgestell besteht aus einer weitvorragenden Kufe, die zum Schutze des Propellers dient. Die Radachse ist aus einem 2 mm 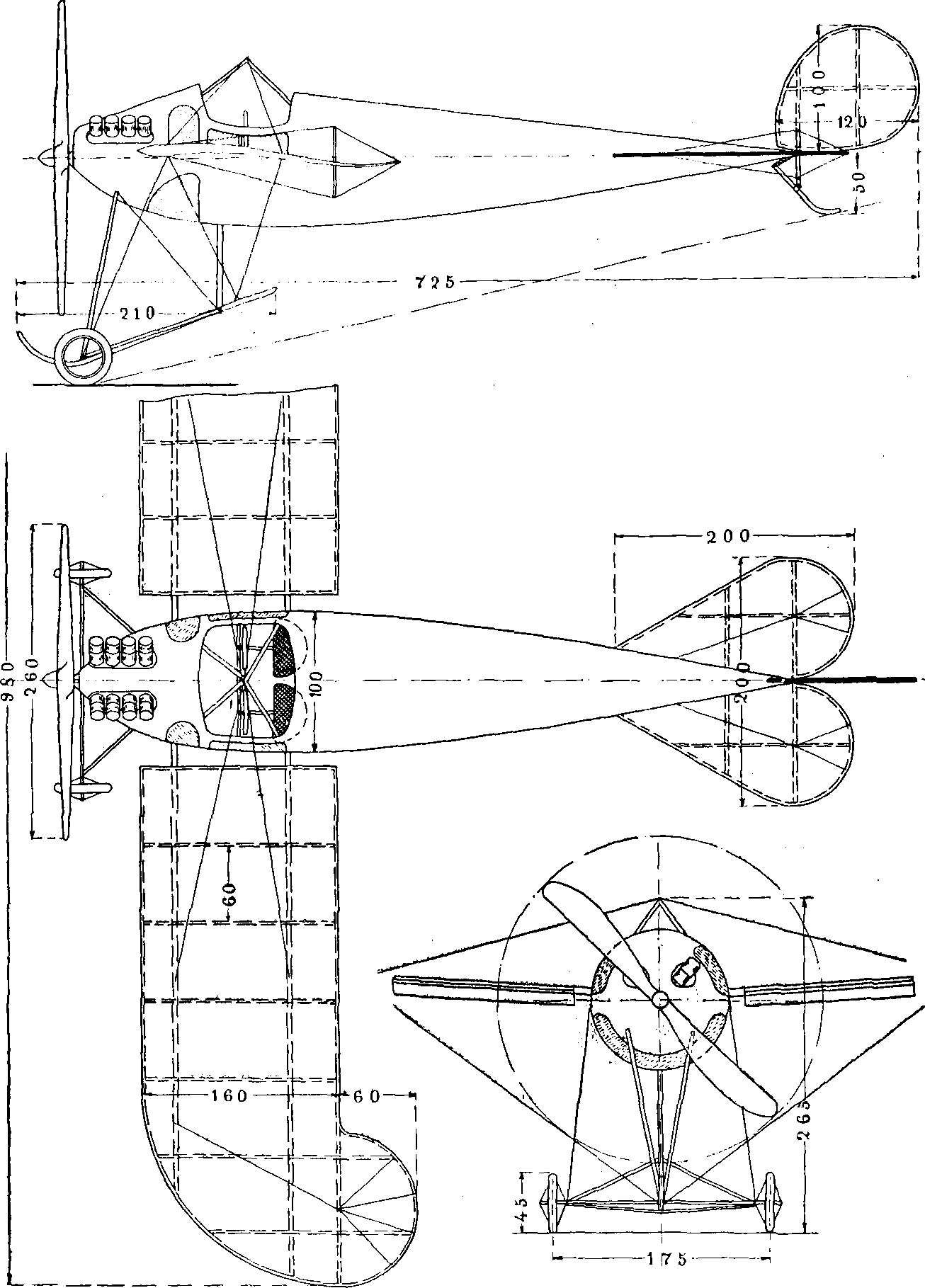 Das Wilkinson-Eindecker-Modell. dicken Strahldraht hergestellt und wird noch durch ein starkes Gummiband von untenher verspannt Die Tragflächen besitzen eine Spannweile von 98 cm, haben ein nieuportartiges Profil und sind an ihren Enden zanoniaartig ausgebildet. Die ganze Länge des Modells beträgt 72,5 cm, die größte Höhe 26,5 cm und seine Flugweite 160-180 m. Flugzeugmodell-Ausstellung auf dem Flugplatze Gelsenkirchen-Essen-Rotthausen. In der am Sonntag den 21. September eröffneten Ausstellung von Flugzeugmodellen ist eine erfreuliche Menge wertvollen Materials enthalten, das erst jetzt, in der Ubersichtlichen Anordnung auf den mit blaugrauer Jute bespannten Tischreihen, recht zur Geltung kommt, während sich in der Vorbesichtigung die Fülle des Gebotenen bei weitem nicht übersehen ließ. Gleich am Eingange fällt das große, sehr präzise gearbeitete Patentmodell von Foppal, Essen, ins Auge; der Erbauer, ein gereifter Mann, arbeitet schon seit Jahren an einer patentierten Vorrichtung, die eine mühelose Veränderung des Tragflächen-Anstellwinkels vom Führersitz aus bezweckt und die an dem 2 m spannenden Modell recht anschaulich ausgeführt is. Außerdem interessiert unter den Schaumodellen hauptsächlich eine von einem Sekundaner, A. Monzlinger, stammende Nachbildung des Kondor-Eindeckers, bei der vor allen Dingen Wert auf eine genaue Durchführung sämtlicher Steuerungsorgane gelegt worden ist. Zur gleichen Kategorie gehört der Wright-Doppeldecker allerältesten Systems von F. Spielemann, Crefeld, mit Startschiene und Startturm; auch bei diesem Modell sind alle Einzelheiten mit viel Liebe und Sorgfalt ausgearbeitet; sogar die komplizierte Flächen-verwindung des Wright'schen Systems ist genau nachgebildet und es ist sehr lehrreich, zu sehen wie die Brüder Wright in ihren Anfängen ohne Laufräder mittels der Startschiene und des Fallgewichtes ihren Start mit sehr kurzem Anlauf ausführen konnten. Zu erwähnen sind ferner noch die entzückend gearbeiteten Präzisionsmaschinchen von Franke, Chemnitz und Schiewekamp, Essen. Die meisten Besucher, vor allem die angehenden jugendlichen Konstrukteure, fühlen sich indessen immer wieder zu dem Stande von M Braune, Leipzig, hingezogen ; die Miniatur-Benzinmotore sehen allerdings auch wundervoll aus. Die übrigen gewerbsmäßigen Aussteller A. Loh de, Gelsenkirchen, J. Kochs, Gelsenkirchen, Bär & Co, Gelsenkirchen, A Springorum, Gelsenkirchen haben auch erkleckliches geleistet; am rührigsten scheint der Konstrukteur K1 eim ent r äge r mit seinen Eka-Modellen zu sein, der unermüdlich seine Preßluftmotoren und Kurvenflieger einer begeisterten Knabenschar im Betriebe vorfuhrt. Noch in letzter Stunde sind eine Anzahl Anschauungsmodelle von Ingenieur H. Schüssler, Berlin, eingetroffen, die das Innere des Flugzeugmotors und seine Arbeitsweise höchst geschickt veranschaulichen Frankfurter Flugmodell-Verein. (Geschäftsstelle: Eppsteinerstr. 26.) An dem am Sonntag dem 21. September stattgefundenen Uebungsfliegen beteiligten sich: R i p p e r (Eindecker mit Pressluft-Motor), Klein (eine „Ente", Rumpf-Eindecker und ein schwanzloser Eindecker), Koch (2 Eindecker), Lamm (Eindecker), Kämmerer (Fokker-Eindecker), Specht (Pfeil-Eindecker), Co11 in (Eindecker mit Preßluftmotor) und Zilch (Pfeil-Eindecker). Donnerstag den 2. Oktober findet im „Stadtgarten" die Mitgliederversammlung statt und wird um zahlreiches Erscheinen gebeten. Literatur.*) Hillsbuch für den Flugzeugbau. Von Dipl.-Ing. O. L. Skopik. 212 S. mit 44 Abbildungen im Texte. Preis elegant geb. Mk" 6.— Das Buch enthält die wichtigsten Formeln zur Berechnung des Luftwiderstandes der Gleichgewichtserhaltung, des Auftriebs etc. Ferner die Grundbedingungen zur Anordnung der Steuerorgane und gibt in der Hauptsache einige *) Sämtliche besprochenen Bücher können durch die Expedition des „Flugsport" bezogen werden. theoretische Betrachtungen über das Verhalten des Flugzeuges in den verschiedenen Lagen. Ausführlich ist die Kreiselwirkung und ihr Einfluß auf das Flugzeug behandelt. Vogels Karte des Deutschen Reichs und der Alpenländer im Maßstab 1 : 500000. Neu bearbeitet und erweitert unter Leitung von Prof. Paul Langhans, 33 Blatter in Kupferstich. Lieferung I: enthaltend die Blätter Berlin und Wien. Preis M. 3.— Die Abnahme der ersten Lieferung verpflichtet zum Kauf des vollständigen Kartenwerkes. Einzelne Blätter kosten M. 2.—. Gotha, Justus Perthes' Geographische Anstalt. Ein vorzügliches Kartenwerk erscheint zur Zeit bei dem bekannten Verlag Justus Perthes in Gotha und zwar ist es eine Neuauflage und Erweiterung von Dr. Vogels Karte des Deutschen Reichs und der Alpenländer. Dieses Werk erscheint anläßlich der Jahrhundertfeier der Befreiung der deutschen Stämme von der Fremdherrschaft in einer besonders vorzüglichen Ausstattung Die neue Karte umfaßt das Wohngebiet aller deutschen Stämme Mitteleuropas von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt Besonders hervorzuheben ist, daß die Karte nach den neuesten topographischen Vermessungen und wissenschaftlichen Landesforschungen ausgeführt ist. Sie wird daher auch für die Flieger, die speziellere Orientierung wünschen, von großem Interesse sein. Eine Probekarte, enthaltend je die Hälfte der Blätter Wien und Berlin, wird jedem Interessenten auf Wunsch kostenfrei zugesandt. Die Anschaffung können wir daher nur bestens empfehlen. Expedition der ■ 9 _ _ M m ExpBdltlon dar rriÄM. Kieme Anzeigen fää;. Die zweigespaltene Millimeter-Zeile kostet 25 Pfennig. Kleine Anzeigen können nur bei gleichzeitiger Einsendung des Insertions-betrages Aufnahme finden. Eingehende Offerten haben deutlich sichtbar betr. Chiffre zu tragen, da die Inserenten geheim gehalten werden. 2 Bosch Magnete D U V für 4 Cyl. 60° V-förmig Motor 1 Dto. D ü 4 auch f. Anzani-Motor 3 Cyl. umzuändern billig. Roy, Brandenburg a. Havel 3 Zyl. Flugmotor, neu u. ganz, tadellos mit Propeller, spottbillig abzugeben. («„ Hallesche Flugzeug-G.tn.li.il., Halle Neuartig, schnelle äuß. stabil. Stahlrohr» Passagier - Taube mit neuem absol. zuverl. erstklass. 50)60 PS Motor umständehalb, sofort zu 4500 Mark zu verk. Gefl. Off. K M. U. 104 an Rudolf Mofse, Köln. (1206 Welte fÄMÄr Jässt 20 jähr jungen Mann zum Piloten ausbilden ? Letzterer fliegt zu Gunsten des Gebers. Gefl Off. sub 1209 an d. Exped. Flieser! Schutzhelm ist der einzige, der von der französischen, russischen, englischen, italienischen, türkischen, schwedischen und norwegischen Armee offiziell eingeführt wurde. Hüten Sie sieb vor Nachahmungen. Verlangen Sie von Ihrem Lieferant die Marke ROOLD. Größte Auswahl in kompletten Flieger-Ausrüstungen. ROOLD 50 fimu de la firand Armee. Paris. Bitte gratis Katalog zu verlangen. Jung. Mechaniker, gelernt. Maschinenschlosser, 19 Jahre, sucht Stellung im Flugzeugbau Off. u. Nk. 153 an Rud. Mosse, Neukölln, Berlinerst'-. 41. (1207  Jllustrirte No. 21 technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnement: 15- Oktober für das gesamte '£££Zu i9i3. jatirg. u. PI Unwesen" proJahr' unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef.4557 ftmt I. Oskar UrsJnUS, Civilingenieur. Tel.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. ■ : Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. - - , Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 29. Oktober. Sollen wir uns noch flugsportlich betätigen ? Es ist schon oft gesagt worden: „Einen Flugsport gibt es nicht." Hätten wir kein Militärflugwesen so wäre es anders. Man fördert die Entwicklung des Flugwesens nicht, wenn man den Flugsport nicht unterstützt. Die Betätigung im Flugsport bei einem Vergleich mit anderen Sportgebieten unterscheidet sich ganz wesentlich. Es ist daher verfehlt mit anderen Sportgebieten Analogien herbeizuführen und nach diesem Muster zu arbeiten. Sogar die bisherige Betätigung im Flugsport kann nicht maßgebend sein. Ganz abgesehen davon, daß der Flugsport als solcher die Flugtechnik und das gesamte Flugwesen in seinen Anfängen erst existenzfähig gemacht hat. In Deutschland hat sich in der Hauptsache die reine, schwere Militärmaschine ausgebildet. Das Militär braucht eben die Maschinen wie sie jetzt sind für seine Zwecke. Das Militär war der Hauptabnehmer im vergangenen Jahre. Die Heeresverwaltung hat sich eine ganze Anzahl von Offiziersfliegern ausgebildet, so daß sie auf die Hülfe der Civilflieger nicht angewiesen ist. Gerade letztere Tatsache fühlt man immer mehr hovaus. Dies muß auch im Interesse des Flugwesens einmal gesagt werden, damit andere Mittel im Interesse der weiteren Entwicklung des Flugwesens nutzbar gemacht werden können. Wenn man die Flugtechnik systematisch fördern will, und das ist das Wichtigste worauf wir hier aufmerksam machen wollen, so müßten die neuesten technischen Errungenschaften, die neuesten Maschinen in freien Wettkämpfen gezüchtet werden. Unsere Fluginaschine als solche bedarf noch sehr der Vervollkommnung. Vielleicht werden sogar durchgreifende Prinzipienänderungen in nicht zu weiter Ferne liegen. Die jetzigen deutschen Flugmaschinen, wie sie serienweise in den Fabriken hergestellt werden, sind eben große, schwere Militärmaschinen, die sich der Einzelne, wenn er wirklich einmal zu seinem Privatvergnügen fliegen will, nicht leisten kann Sie erfordern neben hohen Anschaffungskosten zu ihrer Wartung und Erhaltung nicht unerhebliche Aufwendungen. Es ist begreiflich, wenn die Industrie, um sich Absatz zu schaffen, zunächst die Typen für die Heeresverwaltung baute. Die großen Flugzeug-Industriellen besitzen alle ein festes Arbeitsprogramm. Die Anzahl der Industriellen, welche für Lieferungen an die Heeresverwaltung in Frage kommen, ist festgelegt-Ferner existiert noch eine große Anzahl von jüngeren Flugzeug-Unternehmungen, die mit ihrer Existenz kämpfen. Für solche wäre es sicher eine dankbare Aufgabe, sich mit dem Bau von Sportmaschinen zu befassen. Wir verstehen hier unter Sportmaschinen leichte Eindecker von geringsten Gewichten mit kleineren Motoren nicht über 50 PS , die in der Hauptsache von den Sporttreibenden selbst im alleräußersten Falle unter Zuhülfenahme eines Monteurs bedient werden können. Man muß sagen, daß verschiedene Flugzeugkonstrukteure, wie Grade, wenn sie mehr Glück gehabt hätten, auf dem beschrittenen Wege Erfolge erzielt haben würden. Die Heeresverwaltung konnte diese kleinen Maschinen nicht verwenden, daher der Rückschlag. Daß nebenbei erwähnt, die Züchtung der Sportsmaschinen auch für die Heeresverwaltung nicht bedeutungslos sein wird, ist selbstverständlich. Bis jetzt richtete man sich im Flugwesen bei allen Wettbewerben nach den Wünschen der Heeresverwaltung. Diese sind jetzt in hohem Maße erfüllt. Man wünscht zurzeit von dort verhältnismäßig wenig. Wir müssen es daher mit einer freien Entwicklung des Flugsportes versuchen. Sicher ist, daß ein Wettbewerb mit kleinen Sportmaschinön nicht über 50 PS alle die kleineren Firmen auf den Plan bringen würde. Die vielfach aufgeworfene Frage: Wie geben wir unseren Sport - Fliegern Gelegenheit sich weiter auszubilden und zu betätigen ? beantwortet sich dann von selbst. Das Cooke'sche Flugboot. Die Weldone B. Cooke Aeroplane Company von Sandusky, Ohio hat vor einiger Zeit einen Wasser-Doppeldecker, ein typisch fliegendes Boot herausgebracht. Der Motor ist vor den Sitzen der Insassen im Boot gelagert und treibt unter Verwendung einer Gelenkkotte eine vor den Tragdecken liegende Holzschraube von 3 m Durohmesser, 3,5 m Steigung und 600 Umdrehungen pro Minute an. Das von der Davis Boat Works Comp, in Sandusky gebaute Gleitboot ist vorn kielförmig ausgebildet, während die untere Seite sich nach hinten gleitbootförmig verflacht. Die Bootshaut besteht an der Seite aus 2 Lagen von kreuzweise vernagelten 3 mm starken Cedernholz-Fournieren. Zwischen den beiden Oedernholzlagen befindet sich eine Oeltuchzwischenlage. Die untere Seite besitzt zwei 8 mm kreuzweise vernagelte Oedernholz-Platten. Der Bootskörper ist 8,4 m lang am Vordersteven 1,5 m und am Hintersteven 1,2 m breit. Ungefähr 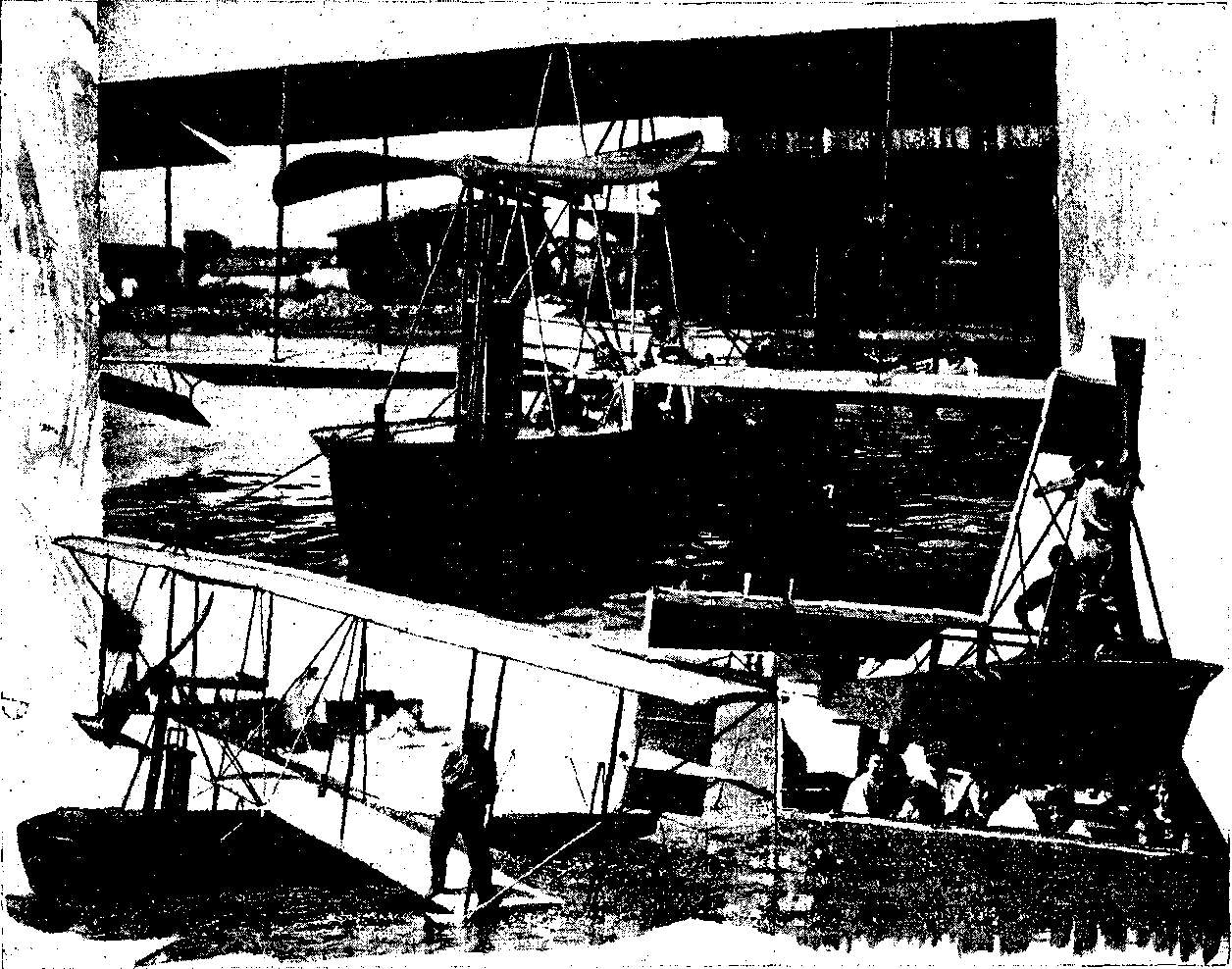 Das Cooke'sdie Flugboot. in der Mitte des Bootes ist eine Stufe von oa. 20 cm Tiefe vorgesehen. Der Bootskörper ist in 4 wasserdichte Schotten eingeteilt. Die Schotten sind so groß bemessen, daß eine einzelne Schotte die Maschine noch über Wasser halten kann. Hinter dem Motor befinden sich außer dem Sitz für den Führer noch Sitzgelegenheiten für 5 Personen. Das Gesamtgewicht der betriebsfertigen Maschine beträgt 680 kg. Die Nutzlast soll 316 kg betragen. Die Spannweite des oberen Decks beträgt 13,5 m, die des Unterdecks 9 m. Die Gesamttragfläche 46 qm. An den Enden der unteren Tragdecken befinden sich kleine Hilfsschwimmer, welche einen Auftrieb von 90,6 kg erzeugen. Die Schwanzfläche besitzt eine Oberfläche von 3,6 qm, das Höhensteuer 1,7 qm. Sport-Eindecker Deicke. Der Sport-Eindecker von Deicke ist eine Musterarbeit wie man sie bei Amateuren selten findet. Die Konstruktion zeigt gegenüber den üblichen Ausführungsformen recht erhebliche Abweichungen und bildet einen Typ für sich. Mit großem Geschick hat Deicke eine 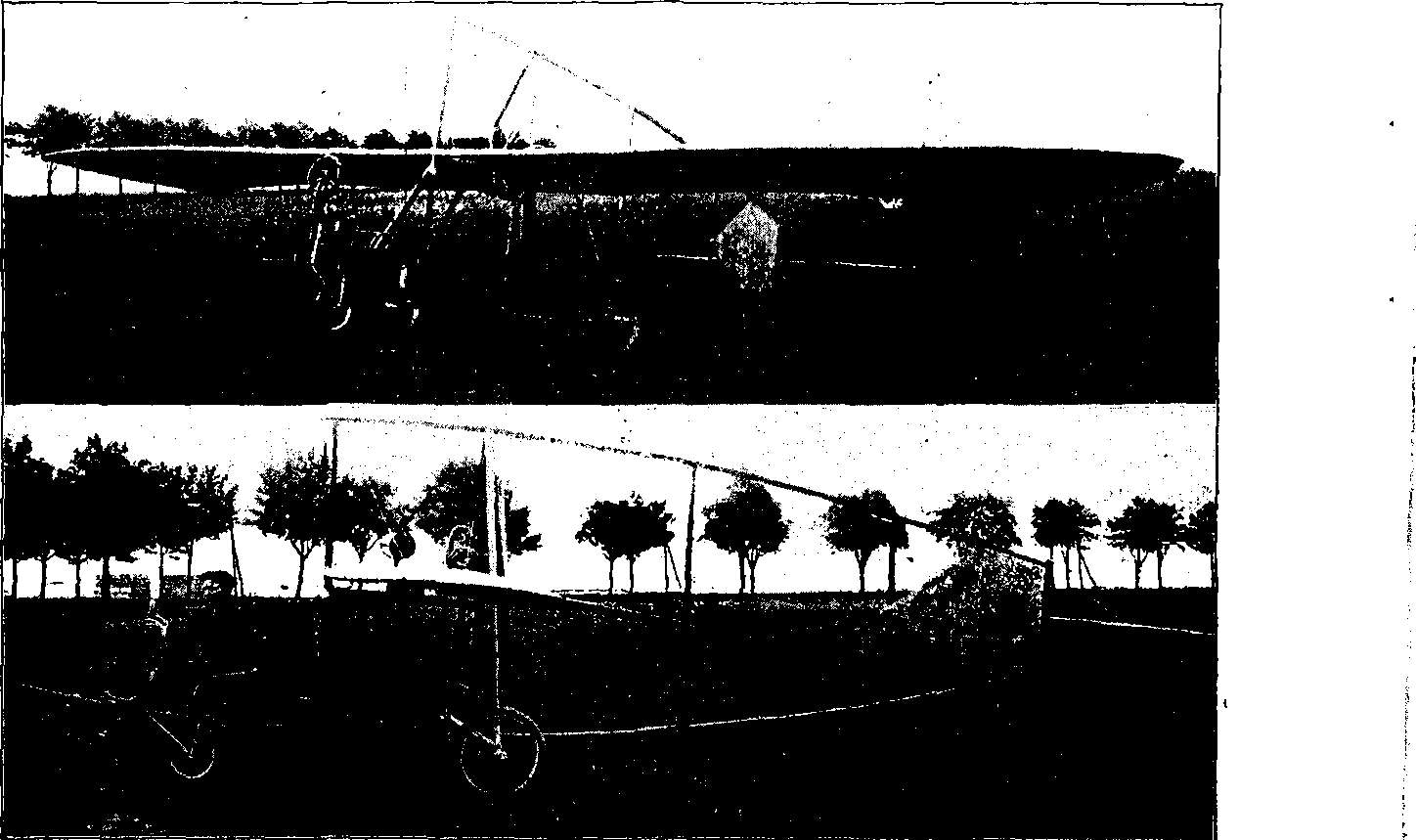 Sport-Eindedter Deitke; Vorder- und Seitenansicht. 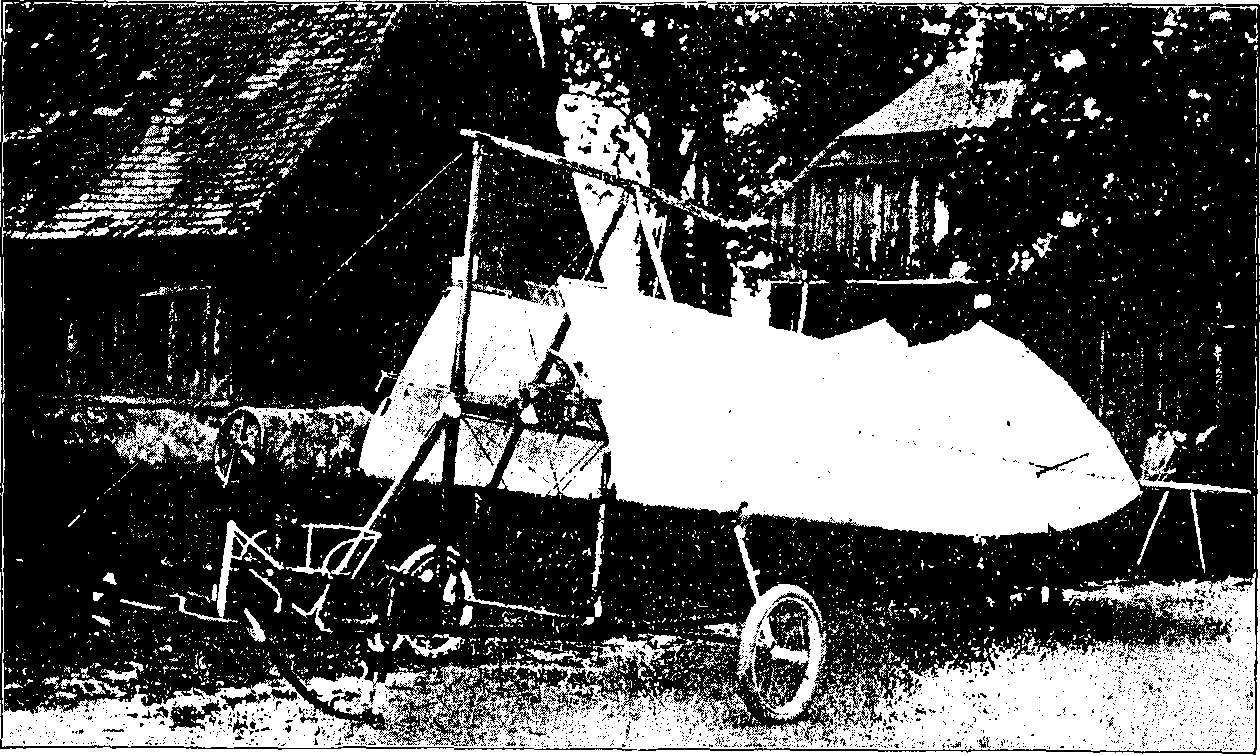 Sport-Eindecker Deicke in transportbereitem Zustande (Ansicht schräg von vorn) Flugmaschinen-Konstruktion geschaffen, wie sie mit den einfachsten Mitteln gebaut werden kann. Bemerkenswert ist die einfache Ausführung sämtlicher Einzelteile. Der Sport-Eindecker ist in der beistehenden Abb. dargestellt. Er besitzt bei 10,25 m Spannweite und 1 m Tragdeckentiefe 10 qm Tragfläche. Das Leergewicht be-trägtl40 kg komplett; in flugbereitemZustan-de, Benzinstoff für 1 Stunde 200 kg. ZumBe-trieb dient ein kleiner 12 PS Anzani-Motor. Deicke hat bereits im Jahre 1911 mit dieser Maschine sehr schöne Kreisflüge in 5 m Höhe ausgeführt. Zu erwähnen ist vor allen Dingen die überaus leichte Zusammenlegbarkeit und Transportfähigkeit der Maschine. In zusammengelegtem Zustande be- ansprucht dieselbe Sport-Eindecker Deiche in zusammengelegtem, einen Raum von 2,30 m transportbereitem Zustande (Vorderansicht) Breite u. 8,5 m Länge. Die Tragdecken werden beim Transport an die beiden Fahrgestellstreben links und rechts des Motors angelegt, (siehe die Abb.) Der Motor befindetsich hinter den Tragdecken. Die Stoßkufe des Fahrgestelles bildet gleichzeitig einen Teil des Trägers zur Verbindung mit den Steuerorganen, 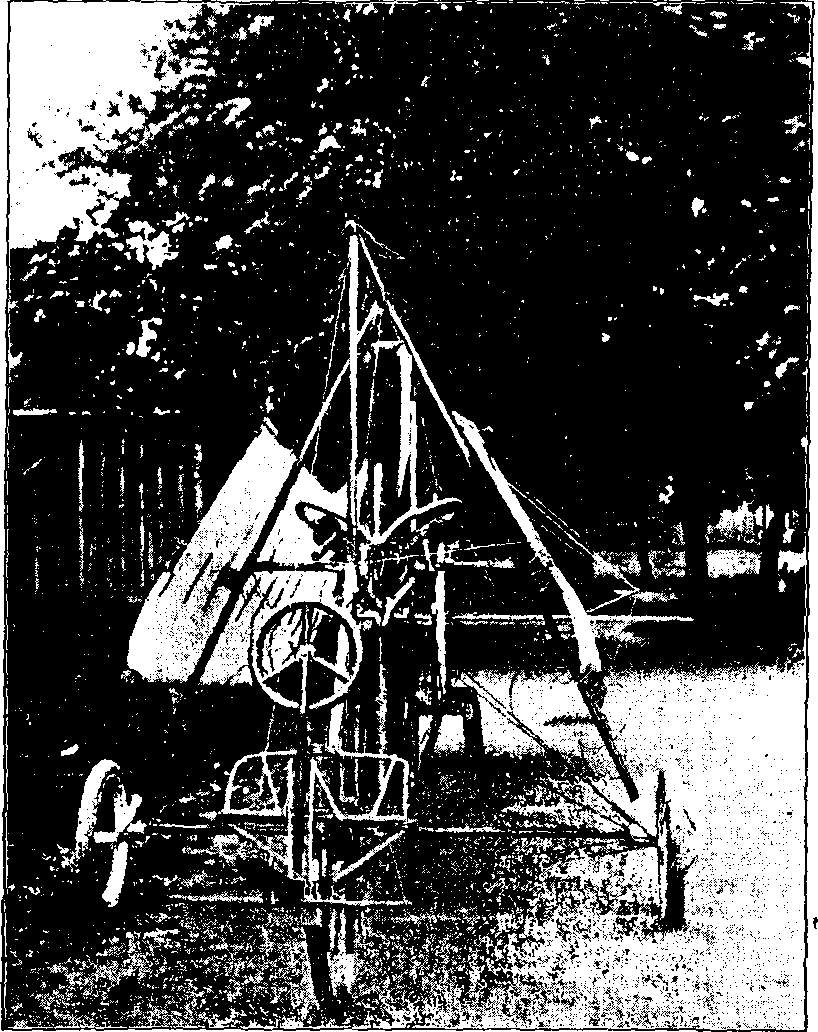 Sport-Eindecker Deicie im Grundriß, Seiten- u. Vorderansicht. Höhen- und Seitensteuer. Hinter einer dreieckigen Dämpfungsfläche befindet sich das Seitensteuer, das durch Fußpedal eingestellt wird. Das dahinter befindliche Höhensteuer wird durch Abdrücken und Anziehen der öteuersäule betätigt. Die Kufe ist sehr weit nach vorn verlängert und trägt den Führersitz. Ein Ueberschlagen der Maschine kann bei einiger Vorsicht daher kaum noch stattfinden. Der Deicke-Sporteindecker ist ein typisches Beispiel wie man mit den geringsten Mitteln ein Flugzeug mit hinter den Tragdecken liegendem Motor wirklich praktisch, äußerst leicht und doch sehr solide bauen kann. Der Ponnier-Renneindecker. Eine der aussichtsreichsten Maschinen im diesjährigen Gordon-Bennett-Rennen für Flugzeuge war der von der Firma Ponnier (früher Hanriot) herausgebrachte Eindecker. Derselbe zeichnete sich ganz besonders durch leichtes Gewicht und gedrungene Bauart aus. Die Tragflächen sind nieuportartig profiliert und verjüngen sich trapezartig nach außen. (Siehe beistehend abgebildetes Profil.) Jeder Flügelholm wird im Gegensatz zu den anderen Maschinen nur einmal durch ein Stahldrahtseil festgehalten. Die 8 qm großen Decks besitzen eine Spannweite von nur 7,2 m und sind V-förmig um 2,5 Grad nach oben gestellt. 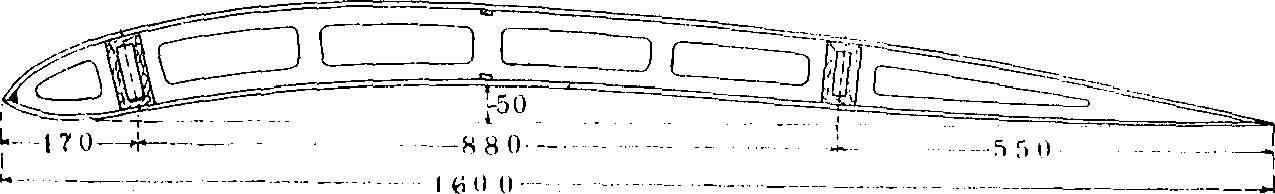 Der Motorrumpf ist in der Seitenansicht fischleibartig geformt und verläuft ziemlich scharf nach hinten. Vorn ist ein zweimalig gelagerter 160 PS Gnom-Motor eingebaut. Derselbe treibt eine Luftschraube von 2,2 Meter Durchmesser an. Eine Aluminiumblechhaube verdeckt zur Hälfte den Motor und dient in seiner Fortsetzung bis hinter den Führersitz als Rumpf-bekleidnng. Auf der Oberseite des verjüngten Rumpfendes ist eine 2 qm große, freitragende Schwanzfläche aus autogen geschweißtem Stahlrohrrahmen angebracht. Ihre äußeren Ausschnitte sind um eine gemeinschaftliche Achse drehbar. Das gleichfalls aus Stahlrohrrahmen hergestellte 0,4 qm große Seitensteuer überragt ein wenig das Rumpfende und schließt mit demselben harmonisch ab. Eine blattfederartige Schleifkufe von geringem Luft widerstand unterstützt hinten den Rumpf. Die Maschine wurde im Gordon-Bennett-Rennen von Vedrines gesteuert und erreichte bei einem Gewicht von 325 kg eine Maximalgeschwindigkeit von 197 km pro Stunde. Die Geschwindigkeit wäre sicher noch größer gewesen, wenn Vedrines die Kurven nicht zu weit genommen hätte. Renneindecker Ponnier 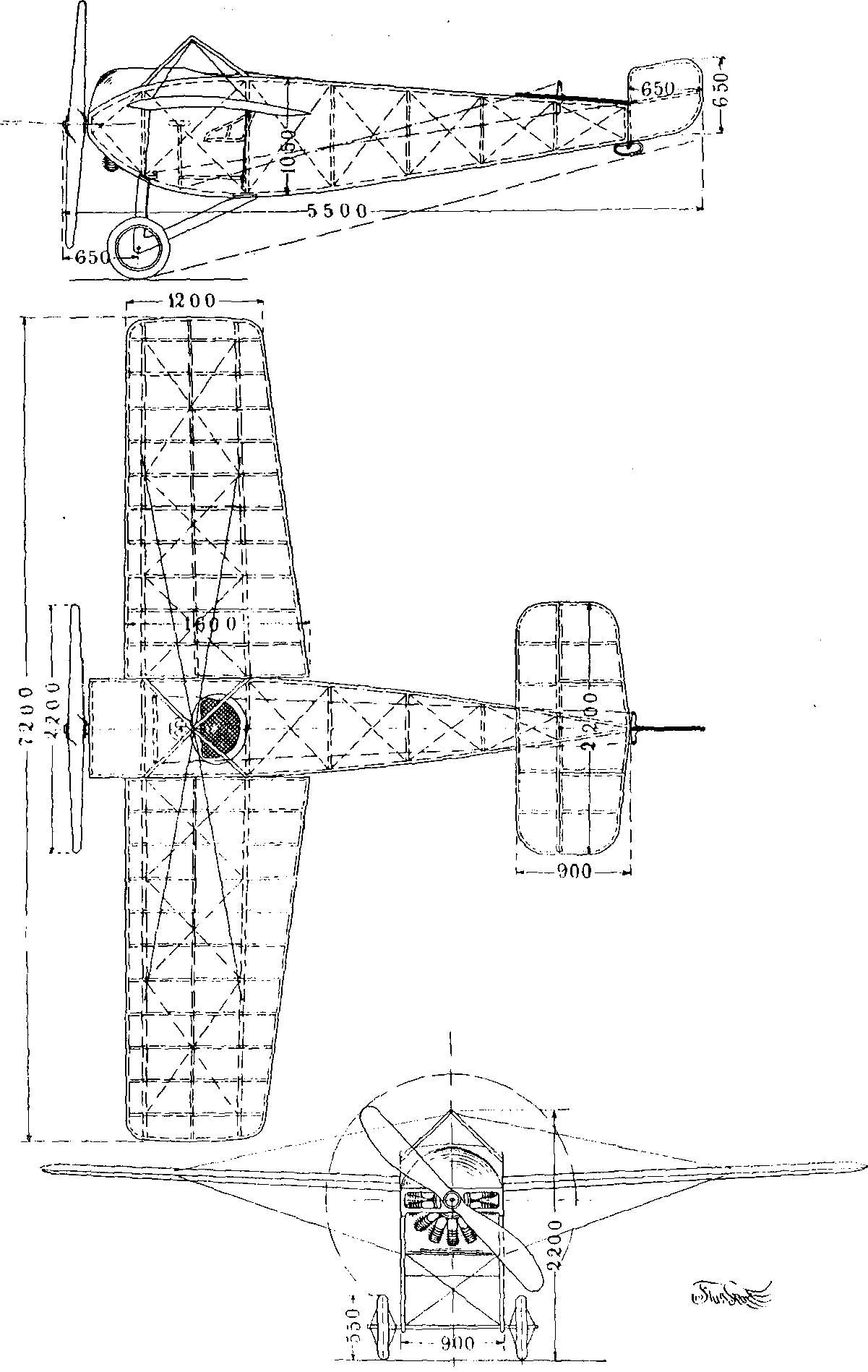 {<- - 120 0--' Nachbildung verboten. Der Riesen-Doppeldecker von Sikorsky. (Hierzu Tafel XXVI). In vorliegender Zeitschrift" ist bereits vor Jahren auf die Bedeutung des Baues von Großflugmaschinen hingewiesen worden. Wenn man aus Sicherheitsgründen und um große Lasten zu heben Maschinen mit mehreren Motoren bauen will, so muß man mit größeren Eigengewichten rechnen. Hierbei muß natürlich gleichlaufend eine Vergrößerung der Tragflächen stattfinden. Die Flug-Ingenieure haben sich bisher verhältnismäßig wenig mit dem Bau von Großflugmaschinen beschäftigt. Vielleicht mag es auch daran gelegen haben, daß die Militärverwaltung der Entwicklung der Flugmaschine in dieser Hinsicht kein Interesse entgegenbrachte. Die Erfolge des Riesen:Doppeldeckers Sikorsky haben gezeigt, daß der Weg des Baues von Großflugmaschinen sehr wohl gangbar ist. Bei den Versuchen mit dem Riesen-Doppeldecker von Sikorsky haben die außerordentlich hohen Stabilitätseigenschaften überrascht. Gewichtsverschiebungen im Fluge bis zu 70 kg waren von untergeordneter Bedeutung. Die 120 qm großen Tragflächen sind anderthalbdeckerartig angeordnet. Hiervon entfallen 66 qm auf das Oberdeck und 54 qm auf das Unterdeck. Die Spannweite des Oberdecks beträgt 28,2 m, die des Unterdecks 22,8 m. Auf letzterem ist die 400 PS Argus Motoren-Anlage im zweiten und vierten Felde der Tragzelle aufmontiert. Dieselbe setzt sich aus 4 einzelnen 100 PS Motoren zusammen, von deren ein jeder mit separatem .Kühler, Betriebsstoffbehälter und Tourenzähler ausgerüstet ist, sodaß eine Panne auf die benachbarte Maschinenanlage nicht übergreifen kann. Etwas schwierig gestaltet sich der Gleichgang der Motoren, der jedoch in Kürze durch Anwendung von Kegelrad- oder Kettentransmissionen in Verbindung mit geeigneten Kupplungen erreicht werden dürfte. Die Hintereinanderschaltung je zweier Motorenaggregate hatte nicht den gewünschten Erfolg, obwohl die Druckschrauben der hinteren Motoren eine größere Steigung hatten, als die Zugschiauben der vorderen. Jeder Motor sitzt auf einem verkleideten Konsol, das um Motorlänge aus der Tragzelle hervorragt. Das Fahrgestell besteht aus einem stark verstrebten Unterbau von 4 Kufen. Zwischen den beiden äußeren Kufen laufen 4 tandemartig angeordnete Räderpaare. Zur Aufnahme der Landungsstöße sind starke Gummischnurabfederungen vorgesehen, zwischen den Mittelstreben der Haupttragzelle ist der langgestrekte Kabinenrumpf eingebaut. Derselbe bildet vorn eine ogival verjüngte Plattform, die sich zur Aufstellung von Scheinwerfern und Maschinengeschützen eignet. In der Mitte des Rumpfes befindet sich eine mit Cellonscheiben verkleidete Kabine, deren Räumlichkeiten für acht Personen ausreichen. Die Insassen des Flugzeuges sind daher gegen Witterungs- einflüsse vollkommen geschützt. Durch eine Mitteltür in der Vorderwand der Kabine kann man auf die Plattform gehen. Die Führersitze befinden sich in der vordersten Sitzreihe, aber außerhalb der gefährlichen Luftschraubenebene. Etwas davor sind zwei Handradsteuerungen, Kompaße, Rollkarten, Tourenzähler etc. in leicht übersichtlicher Weise angeordnet. An der Rückwand der Kabine befinden sich Apparate für drahtlose Telegrafie, deren Antenne gleichmäßig über die ganze Maschine verteilt ist. Am hinteren Ende des verjüngten Rumpfes befindet sich eine 12 qm große Schwanzfläche. Hiervon entfallen 7 qm auf das Höhensteuer und 5 qm auf die Dämpfungsfläche. Auf letzterer sind im Abstände von 6 m zwei 0,6 qm große Scitensteuer angebracht, die trotz ihrer geringen Fläche, infolge des langen Hebelarmes recht wirksam sind. Zur Unterstützung des Schwanzes ist eine starre Schleifkufe angebracht. Das Gewicht der Maschine beträgt im Fluge 3200 kg und erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 90 km pro Stunde. Nach einem Anlauf von ca. 200 m verläßt die Maschine den Boden. Als Konstruktionsmaterial gelangt Holz, Stahlrohr und emaillierter Baumwollstoff zur Verwendung. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Man kommt hier wirklich aus den Sensationen nicht heraus. Wenn schon die an dieser Stelle eingehend besprochenen Kämpfe um die endgiltige Zuteilung des Pommery-Pokals einige Sensationen gebracht hatten, denn es waren bei dieser Gelegenheit einige Flugleistungen erzielt worden, welche zu den besten bisher realisierten gehören, folgt jetzt eine neue, die allerdings anderer Art ist. Wie erinnerlich, war nach den beiden großartigen Fernflügen, welche Brindejono des Moulinais und Guillaux ausgeführt hatten, dieser letztere als Sieger erklärt worden, weil die von ihm zurückgelegte Entfernung um rund 4 km größer war als diejenige, welche Brindejonc mit seinem Fluge von Paris nach Warschau hinter sich gebracht hatte. Jetzt stellt sich nun heraus, daß Guillaux ein kleines „Versehen" unterlaufen war, indem er nicht, wie er berichtet hatte, in Brackel, etwa 50 km von Hamburg, sondern in Brokel, das etwas westlich von Bremen liegt, gelandet war. Brindejonc hatte in alkr Stille eine Untersuchung eingeleitet und die Angaben seines Rivalen einer ,,Nachkontrolle" unterzogen, wobei sich der eben erwähnte Tatbestand herausgestellt hat, den sich der energische Brindejonc übrigens von den Bürgermeistern der beiden in Betracht kommenden deutschen Städte hat bescheinigen lassen. Nun ist wieder Brindejonc des Moulinais der Sieger im Pommery-Pokal, wenigstens bis auf weiteres. Denn die Gegenseite stellt natürlich alles auf, um den peinlichen Eindruck, welchen diese „Verwechslung" hervorgerufen hat, zu verwischen. Es scheint aber, als ob das hier so beliebte „corriger la fortune" in diesem Falle schmählich versagt hat, im Gegensatz zu dem „Grossen Preis der Italienischen Seen" von dem an anderer Stelle dieser Nummer die Rede ist und wo man es verstanden hat, unseren Landsmann Hirth um die Frucht seines schönen Sieges zu bringen. Auch das bisherige Resultat des Michelin-Pokals sucht man noch in letzter Stunde zu ändern. Namentlich hat Guggenheim, auf einem Henri Farman, auf der bekannten Rundstrecke Etampes—Gidy — Etampes versucht, die bekannte Fourny'sche Leistung zu überbieten. Aber schon nach zwei Tagen gab er den mit großem Tamtam in Szene gesetzten Versuch auf, nachdem er 1.821,600 km hinter sich gebracht hatte. Die Sensation des Pegoud'schen Experiments, sich in der Luft mit seinem Bleriot-Eindecker zu überschlagen, ist von diesem und von anderen, welche die Lorbeeren des Bleriot-Fliegers nicht ruhen ließen, wiederholt worden, und am Mittwoch voriger Woche hat Pegoud sogar in Buc seine ursprüngliche Leistung noch übertroffen, indem er sich mit seinem Flugzeug achtmal überschlagen hat. Nur wenige Personen befanden sich an jenem Morgen auf dem Flugfelde, als Pegoud gegen 9 Uhr seinen Apparat aus dem Schuppen ziehen ließ. Nur etwa ein Dutzend Offiziere und einige Journalisten waren zugegen. Um 10 Uhr nahm der Flieger auf dem Eindecker Platz, wo er sich in solider Weise festbinden ließ. Der Motor wird angedreht, das Flugzeug rollt davon und erhebt sich ziemlich schnell bis auf 800 Meter. Jetzt sieht man, wie das Flugzeug sich auf die Spitze stellt, sich vollständig überschlägt und während 1 Minute 3 Sekunden (es erscheint das wie eine Ewigkeit) mit den Rädern in der Luft dahinfliegt, wobei es mit Leichtigkeit zahlreiche Kurven beschreibt. Jetzt stellt der Flieger sein Tiefensteuer auf Abstieg : der Apparat schießt nach unten, richtet sich plötzlich vertikal hoch und beschreibt nun ein kompletes „looping the loop". Und ohne Unterlaß steigt Pegoud in die Höhe, überschlägt sich, läßt sich wieder herab und wiederholt * dieses Experiment nicht weniger als achtmal. Mit ängstlicher Spannung verfolgt man die Waghalsigkeiten Pegouds und man fragt sich, ob die Sache nicht ein tragisches Ende nehmen wird. Aber Pegoud scheint seiner Sache sicher, und schließlich landet er glatt und wohlbehalten. Uebrigens hat dieser Tage Ohanteloup mit einem Caudron-Zweidecker eine neue Variante dieses Schaustücks gefunden : er drehte sich in Douai auf einem Flügel in der Luft um und richtete sich von derselben Seite wieder hoch. Als Ohanteloup sich in 1000 Meter Höhe befand, sieht man sein Flugzeug sich nach einer Seite überneigen, dann, die Flächen perpendikulär zum Boden, nach unten gleiten. In diesem Moment richtet sich der Apparat hoch, schwebt während einiger Sekunden so dahin und nimmt dann seine normale Lage ein. Chai akteristisch für diese Fliegerkunststücke ist die Tatsache, daß Pegoud jetzt in einem Pariser Spezialitätentheater, das nur der allerleichtesten Muse geweiht ist und namentlich von den Fremden, die sich in Paris nicht langweilen wollen, besucht wird, allabendlich . . . Vorträge über sein „Luft-looping the loop" hält ! Eine weitere Sensation war das unvorhergesehene Landen eines deutschen Offiziersfliegers in Boulogne jener Vorfall, dessen Einzelheiten wohl aus der Tagespresse bekannt sind. Die Sache nahm den üblichen Verlauf, die gesamte hiesige Presse redete sich in eine gewaltige Aufregung hinein und beschimpfte und verhöhnte das deutsche Flugwesen, dem derartige „Irrfahrten" neuerdings ziemlich häufig passieren. Man konstatierte mit Genugtuung, daß das neue deutsch-französische Luftabkommen zum ersten Male von deutscher Seite verletzt worden ist und verlangte mit dem üblichen Redeschwall die „energischsten Maßnahmen" usw. Die französische Regierung verfuhr ja mit dem deutschen Flieger noch ziemlich glimpflich, denn als die herbeizitierten Sachverständigen erklärt hatten, daß „force majeure nicht ausgeschlossen" sei, gab man dem Flieger seine volle Freiheit, allerdings unter der Bedingung, daß er mit seinem Flugzeuge nicht auf dem Luftwege, sondern per Eisenbahn dorthin zurückkehre, wohin sie beide gehören. Soweit wäre alles recht schön und normal gewesen. Aber nun kommt das eigentümliche Nachspiel: In einer Gastwirtschaft des Dorfes Neufchätel, wo die unfreiwillige Landung erfolgt war, hatten sich die militärischen und Zivilautoritäten mit dem Leutnant Steffen, sowie dem aus Bou-logne herbeigeeilten deutschen Konsul Busch und einer Schar von Journalisten zusammengefunden, um den glimpflichen Abschluß des „Zwischenfalls" nach alter Sitte zu „begießen". Dabei hielt Herr Busch eine Ansprache, in der er seinen „tiefgefühltesten" Dank für die Aufnahme abstattete, welche sein Landsmann in Frankreich gefunden habe. Der deutsche Offizier sei „gerührt von den Höflichkeiten und Aufmerksamkeiten, mit denen man ihn umgeben habe, und eben noch habe er ihm, dem Konsul, eine Bemerkung gemacht, die er ohne Zusatz wiedergeben wolle: Ich weiß nicht, ob ein französischer Offizier, der sich in Deutschland verirrte, dort in ebenso galanter nnd herzlicher Weise behandelt werden würde .... Daß ein deutscher Konsul im Auslande eine solche Bemerkung, selbst wenn sie Herr Steffen ihm gegenüber getan hat, öffentlich zum besten gibt, ist doch wohl ein starkes Stück. Es übersteigt das das Verständnis aller derjenigen, die nicht die gleiche diplomatische Schulung besitzen, wie jener deutsche Konsul. Aber an der Wirkung dieser „Rede" konnte man deren Verkehrtheit erkennen. Die Presse stimmte geradezu einen Hexensabbat an über das „Geständnis eines deutschen Diplomaten" und wir werden dieses Zugeständnis des Herrn Konsuls noch lange zu hören bekommen. Nun bereitet sich wieder eine neue Sensation vor: Rene Quinton, der Präsident der Ligue Nationale Aerienne, arbeitet seit mehreren Monaten schon an der Organisation zweier großer Fernflüge, welche sich zwischen zwei Kontinenten von Paris nach Kairo, von Paris nach dem Persischen Golf abspielen sollen. Der erste dieser Flüge soll schon am 20. dieses Monats unternommen werden, und zwar durch den bekannten Flieger Daucourt, den die Ligue Nationale für diesen Zweck gewonnen hat. Der Abflug wird am 20. Oktober von Issy les Moulineaux erfolgen; die Strecke führt über Schaffhausen, München, Wien. Die Ueber-querung Deutschlands soll, wenn irgend möglich, ohne Zwischenlandung erfolgen (wahrscheinlich schon eine Folge der Rede des Konsuls Busch); dann führt die Strecke die Donau hinab, nach Belgrad und Bukarest, von dort, unter Vermeidung Adrianopels, nach Kon- stantinopel. Von der türkischen Hauptstadt geht es weiter nach Koniah, Alexandrette, Jerusalem, Jaffa, Port Said und schließlich nach Heliopolis, vor den Toren von Kairo. Die ganze Strecke hat ein Ausmaß von 6000 km. Am Donnerstag fand zu Ehren dieser Veranstaltung ein von der Ligue in den Räumen des Automobilklubs veranstaltetes Bankett statt, zu dem die diplomatischen Vertreter Frankreichs in Smyrna und Beyruth geladen waren. Die Regierung hat ihre sämtlichen Vertreter in den in Betracht kommenden Gegenden angewiesen, den Flug durch tatkräftige organisatorische Mitwirkung zu fördern und zu unterstützen. In der vergangenen Woche sind bereits von Marseille aus große Vorräte von Benzin und Oel per Schiff nach Konstantinopel, Jaffa und Beyruth abgeschickt worden. Diese drei Städte gelten als Verpflegungszentren und haben ihrerseits die einzelnen Verproviatierungsstationen, wie Skutari, Alep, Damaskus, Jerusalem und Port Said mit Betriebsstoff zu versorgen. Die einzelnen Etappen bei diesem Fluge sollen durchschnittlich 300 km betragen. Uebrigens hat die Internationale Aeronautische Vereinigung schon jetzt die neuen Bedingungen für das Gordon Bennett 1914 festgesetzt, wobei sie die von Weymann vertretenen Ansichten zu den ihren gemacht hat. Darnach sollen zur Teilnahme am Gordon Bennett nur solche Flugzeuge qualifiziert sein, welche vorher folgenden Ausscheidungsprüfungen genügt haben: Jeder Flieger wird eine geradlinige Strecke, hin und zurück, von etwa 2 km zurückzulegen haben, ohne Kontakt mit dem Boden und in einer Höhe von weniger als 3 Metern. Die auf dem Hin- und Rückflug realisierte Geschwindigkeit wird nicht über 70 km die Stunde betragen dürfen. Jeder Bewerber wird das Recht zu drei Versuchen haben. Von dem Augenblick an, wo die Ausscheidungsprüfungen beginnen, darf keine Veränderung an den Flugzeugen vorgenommen werden, doch können mit Zustimmung und unter der Kontrolle der Sportkommissare Reparaturen vorgenommen werden. Nur in vollem Fluge dürfen die Bewerber die Besegelung ändern, unter der Bedingung freilich, dass sie während des Fluges den Apparat wieder in seinen ursprünglichen Zustand zuiückversetzen können. Endgültiger Sieger in dem Bewerb wird derjenige Flieger sein, welcher, nachdem er diesen Ausscheidungsprüfungen genügt hat, die Flugstrecke von 200 km auf einer Bahn von mindestens 5 km in der kürzesten Zeit zurückgelegt haben wird. Ein interessantes Vorkommniss ist noch zu melden, das von der Art Zeugnis gibt, wie man hier das Flugwesen zu fördern bestrebt ist. Der bekannte Erfinder Moreau unternahm dieser Tage mit seinem selbststabilisierten Apparat über der Stadt Melun einen Schauflug, während gerade die Stadtverwaltung im Rathause eine Sitzung abhielt. Die Stadtväter waren von dem schönen Flug so iinpressionniert, dass sie beschlossen, dem Flieger bei seiner Landung die Summe von 1000 Francs zu zahlen, zu welchem noch der bekannte Senator Monier noch den gleichen Betrag beisteuerte. Man kann sich die Freude des landenden Fliegers über diese völlig unerwartete Zuwendung denken. Vom französischen Militärflugwesen sind einige interessante Vorkommnisse zu berichten. Mit dem neuen Chef, dem General Bernard, scheint eine völlig neue Richtung zur Geltung kommen zu sollen, wie in einem nächsten Spezialartikel des näheren dargelegt werden soll. Inzwischen werden immer neue Militärfliegerstationen eingerichtet und erst dieser Tage fand die feierliche Eröffnung der Station von Chaumont statt, wo ein großartiges Militärlandungsterrain installiert worden ist. Man hatte zur Feier des Tages ein Fliegermeeting veranstaltet, an dem auch einige Zivilflieger teilnahmen. Viel besprochen wird der gleichzeitige Rundflug zweier Offiziere durch Frankreich Es handelt sich dabei um die Leutnants ßroccard und Morel, die beide, von Mourmelon abfliegend, in umgekehrter Richtung durch Frankreich flogen und schließlich in Mourmelon wieder zusammentrafen, ohne daß ein Zwischenfall vorgekommen wäre. Leutnant ßroccard war auf einen Deperdussin, 60 PS Rhone-Motor, über Lyon, Montelimar, Montpellier, Beziers, Narbonne, Carcassone, Toulouse, Villefranche, Agen, Bordeaux, Angers, Caen, Deauville, Dieppe, Le Crotoy, Calais, St. Omer, Valenciennes, Douai, Vervins zurück nach Mourmelon; Leutnant Morel über Orleans, Poitiers, Angouleme, Bordeaux, Marmande, Agen, Castelsarrazin, Montauban, Toulouse, Carcas-sonne, Narbonne, Montpellier, Montelimar, Bourg, Chälons-sur-Saone, Dijon, Chaumont nach Mourmelon geflogen. Auch einige Unfälle sind aus dem Militärflugwesen zu melden: Ein Feldwebel flog am Samstag von Reims nach Sezanne, mit zwei Begleitern an Bord seines Apparates. Dieser stürzte ab, der Flieger wurde getötet, seine beiden Begleiter schwer verletzt. Auch in Chaumont ereignete sich ein Todessturz, dem ein Sappeur zum Opfer fiel, der dort an einem Flug-feste teilnahm. Und auch in Pau stürzte ein Militärflieger, namens ßremot, aus 20 Meter Höhe ab und erlitt sehr ernste Verletzungen. Zwei interessante Versuche sind dieser Tage unternommen worden. Im Lager von Chalons hat Weyman ein neues gepanzertes Flugzeug vorgeführt, das er selbst nach eigenen Ideen konstruiert hat. Das Flugzeug, welches die vorschriftsmässige Panzerung hat, wie sie die französische Heeresverwaltung neuerdings verlangt, hat eine Länge von 5,80 Metern, die Flügel haben eine Spannweite von 8,90 Metern, Die Tragfläche mißt 20 Quadratmeter. Zum Antrieb dient ein 60 PS Motor Der Apparat kam auf 25 Meter vom Boden ab und da es, trotz seiner Panzerung nur 318 kg wiegt, stieg es mit großer Geschwindigkeit auf 1000 Meter Höhe. Gleichfalls im Lager von Chälons wurden soeben Versuche mit einem aus dem letzten Pariser aeronautischen Salon bekannten Mitrailleusen-Flugzeug begonnen, die großartige Resultate ergeben haben. Vorn vor der Haube ist eine Mitrailleuse aufmontiert. Das Flugzeug nimmt 1000 Kugeln an Bord, welche die Mitrailleuse entweder nach einander oder aber automatisch in Form eines Feuerregens auf 3000 bis 4000 Meter abschiessen kann. Diese Versuche sollen fortgesetzt werden Rl. Seite 7.92 „FLUGSPORT." Nr. 21 Aus den englischen Flugcentren. Die englischen Herbstmanöver sind beendigt. Man ist mit den Resultaten, die bei der Verwendung der Flugzeuge erzielt worden sind, sehr zufrieden. Auf beiden Seiten haben in diesem Jahre die Flugzeuge eine hervorragende Rolle gespielt und die von ihnen zurückgebrachten Meldungen und Beobachtungen sind in vielen um nicht zu sagen in den meisten Fällen von bestimmendem Einfluß auf die Entscheidungen der oberen Führer gewesen. Es muß an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden, daß gerade die diesjährigen Manöver einen Wendepunkt in den bisherigen Anschauungen bilden. Beschränkte sich nach der landläufigen Ansicht die Tätigkeit der Flugzeuge bisher auf die frühen Morgenstunden und die Zeit um Sonnenuntergang herum, so sah man in den diesjährigen Manövern zum ersten Male in England die Riesenvögel den ganzen Tag über bei Wind und Wetter am Himmel kreisen. In teilweise bedeutender Höhe überflogen sie das Schlachtfeld, stellten Anmarsch oder Verbleib des Gegners fest und landeten schon nach kurzer Abwesenheit wieder in der Nähe der absendenden Kommandostelle, zur mündlichen Berichterstattung, oder sie kehrten direkt in ihren Flugzeughafen zurück, um von dort aus ihre Beobachtungen telephonisch weiterzugeben. Zur Unterscheidung trugen die Flugapparate der braunen Macht, wie schon in letzter Nummer ausführlich beschrieben, an der j unteren Tragfläche schwarze und weiße Streifen. In kleineren Höhen ! hat sich diese Art Kennzeichnung ganz gut bewährt, in größeren j Höhen und bei trüben Wetter jedoch, konnte man auch bei | schärfster Beobachtung von den Streifen nichts mehr erkennen. Schon die ersten Tage begannen mit Rekognoszierungsflügen der Luft- : geschwader der weißen und braunen Macht, von denen die letztere i unter dem Kommando von General Sir John French stand, und viel j weniger Flugzeuge zur Verfügung hatte, als die verteitigende weiße Macht. Es handelt sich bekanntlich um den Versuch einer Invasionsarmee in England einzudringen und deren Abwehr. Gleich bei Eröffnung der Feindseligkeiten entspann sich ein interessanter Kampf zwischen Luftschiff und Plugmaschine. Einem Farman-Doppeldecker und einem Bleriot-Eindecker der braunen angreifenden Macht gelang es, das zur weißen Macht gehörige Luft- j schiff „Delta" von oben zu fassen Die Flugzeuge bewegten sioh so s schnell, daß sie nach Ansicht der Schiedsrichter von den Maschinengewehren des Ballons nicht getroffen werden konnten. Nach der Entscheidung der Kommission galt der Lenkballon als zerstört und wurde außer Gefecht gesetzt. In den Morgenstunden hatte die verschwindend kleine Zahl der Flieger der Invasionsarmee bereits die ganze feindliche Stellung erkundet. Zu spät trat ihnen das überlegene Luftgeschwader des Verteidigers entgegen, die Flieger des Angreifers entzogen sich den Blicken der Verfolger in dichtem Wetter. Das auf dem Flugplatze zu Hendon in Verbindung mit dem Naval- und Mititäry-Meeting zum Austrag gebrachte International-Air-Contest für welches England, Frankreich und Amerika mit je einem Ein-und einem Doppeldecker angemeldet waren, wurde von England ge- wonnen. In der letzten Zeit hat man hier auf die Stabilität der Flugmasohinen ein besonderes Augenmerk gerichtet und auch gute Resultate erzielt. So flog der Flieger Verrier auf einem Maurice Farman-Doppeldecker mit einem Fluggast 5 Minuten, ohne die Kontrollhebel zu berühren. Flieger und Fluggast standen mit erhobenen Händen im Rumpfe des Flugzeuges was aus umstehend wiedergegebener Fotografie deutlich ersichtlich ist. Eine andere tollkühne Tat vollbrachten zwei Mechaniker der Grahame White Aviation Co., als der Besitzer Grahame White bei ziemlich starkem Winde mit 8, 9 und 10 Fluggästen neue Rekorde auf seinem Riesen-Doppeldecker aufstellte. In Höhe von 200 m sahen die Zuschauer plötzlich zwei Personen aus dem Rumpfe des Doppeldeckers herausklettern und sich auf den unteren Tragflächen entlang  Ein Passagierflug auf den Tragdeckenenden, aufgenommen vom Rumpf während des Fluges auf dem 5 sitzigen Grahame White-Doppeldecker. nach dem äußersten Ende derselben begeben, um auf diesem luftigen Platze ihren Flug zu Ende zu führen. Grahame White hat übrigens indem er mit 10 ffluggästen über 25 Minuten in der Luft verweilte, einen neuen Weltrekord aufgestellt. Nachdem bereits Amerika und in letzter Zeit Frankreichs Aero Club Schwierigkeiten gegenüber gestanden hat, ist nunmehr auch über den englischen Royal Aero Club eine Krisis hereingebrochen, die mit dem Ausscheiden zweier hervorragender Mitglieder ihren Anfang nahm. Wie erinnerlich flog Brindejonc des Moulinais um die Pfingstzeit dieses Jahres mit der Absicht von Bremen nach London, um an dem Wettbewerb um die Giessler Trophy teilzunehmen. Er machte sich bei diesem Fluge unwissentlich einer Gesetzesübertretung schuldig, indem er nicht, wie in den damals veröffentlichten neuen englischen Luftgesetzen angegebenen Stelle landete, sondern direkt bis London durchflog, dieses überquerte und in Hendon landete. Am nächsten Tage nahm er an dem Rennen Teil und gewann. Wegen Nichtbeachtung der Gesetze hatte sich der Flieger vor dem Richter zu verantworten und wurde freigesprochen. Während er jedoch an dem Rennen teilnahm, entzog ihm da Comite des Royal Aero Club die Licenz für den Be-werb. Dem Flieger wurde jedoch von der Grahame White Aviation Co., der Preis, den er ehrlich gewonnen hatte, ausgehändigt. Der Royal Aero Club verlangt nun, daß dem zweiten Gewinner der Preis ausgehändigt werden soll. Als Protest haben nun Grahame White und Richard Gates, Grahame White's General Manager, ihre Mitgliedschaft niedergelegt und wie aus guter Quelle mitgeteilt wird, haben Grahame White und Gates die meisten Mitglieder auf ihrer Seite, die ebenfalls ihr Mitgliederschaft aufgeben werden, falls der Sache nicht bald beigelegt wird. Erfolgreiche Experimente wurden dieser Tage mit einem neuen Doppeldecker, welcher mit einem Maxim-Schnellfeuer-Gewehr ausgerüstet ist, angestellt. Die Maschine ist von den Königlichen Flugwerkzeugen zu Farnborough konstruiert worden und erinnert im allgemeinen an die bekannte „BE"-Type. Die Tragflächen haben große Aehnlichkeit mit den der erwähnten Type, während der Schwanz dem der Henry Farman-Maschinen nachgebaut ist. Der Rumpf, mit dem Maschinengewehr auf einem Drehgestell angebracht, springt sehr weit nach vorn vor, dem Beobachter damit einen möglichst freien Ausblick nach allen Seiten gewährend. Man darf immerhin annehmen, daß die Maschine mit der in der letzten Olympia-Ausstellung identisch ist Der in letzter Zeit vielbesprochene Wettbewerb um den von der englischen Michelin Reifen Company gestifteten British Empire Michelin Cup No. 3 endete mit einem Fiasko. Allerdings war nur ein Flieger gemeldet und zwar Hawker auf 100 PS Sowith-Green-Doppeldecker. Der Flieger, welcher schon beim Flug Rund um England abstürzte, hatte abermals einen Unfall, als er am Morgen des 8. Oktober von Brooklands Aerodrome aus startete. Er erreichte bei strömendem Regen einige Hundert Meter Höhe, als er plötzlich in eine absteigende Windströmung geriet, die ihn bis auf ganz geringe Höhe herunterdrückte. Er war gezwungen zu landen und zerbrach dabei die Maschine. Der Wettbewerb besteht aus einem Fluge von einem Umfange von 290 Meilen, die innerhalb 24 Stunden zurückgelegt sein müssen, wobei noch die höchste Geschwindigkeit in Betracht kommt. Die' Maschine muß All British Manufacture und muß ferner mit einem in Großbritannien gebauten Motor ausgerüstet sein. Am letzten fehlt es, obwohl die Engländer sehr gute Flugmaschinen konstruiert haben, ist es ihnen bis jetzt noch nicht gelungen, einen brauchbaren Flugmotor zu konstruieren Eine mysteriöse Geschichte beschäftigte vor einiger Zeit die gesamte englische Presse. In Bridlington Bay in der Nähe der Marine- rt", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XXVI. Riesen-Doppeldecker Sikorsky. 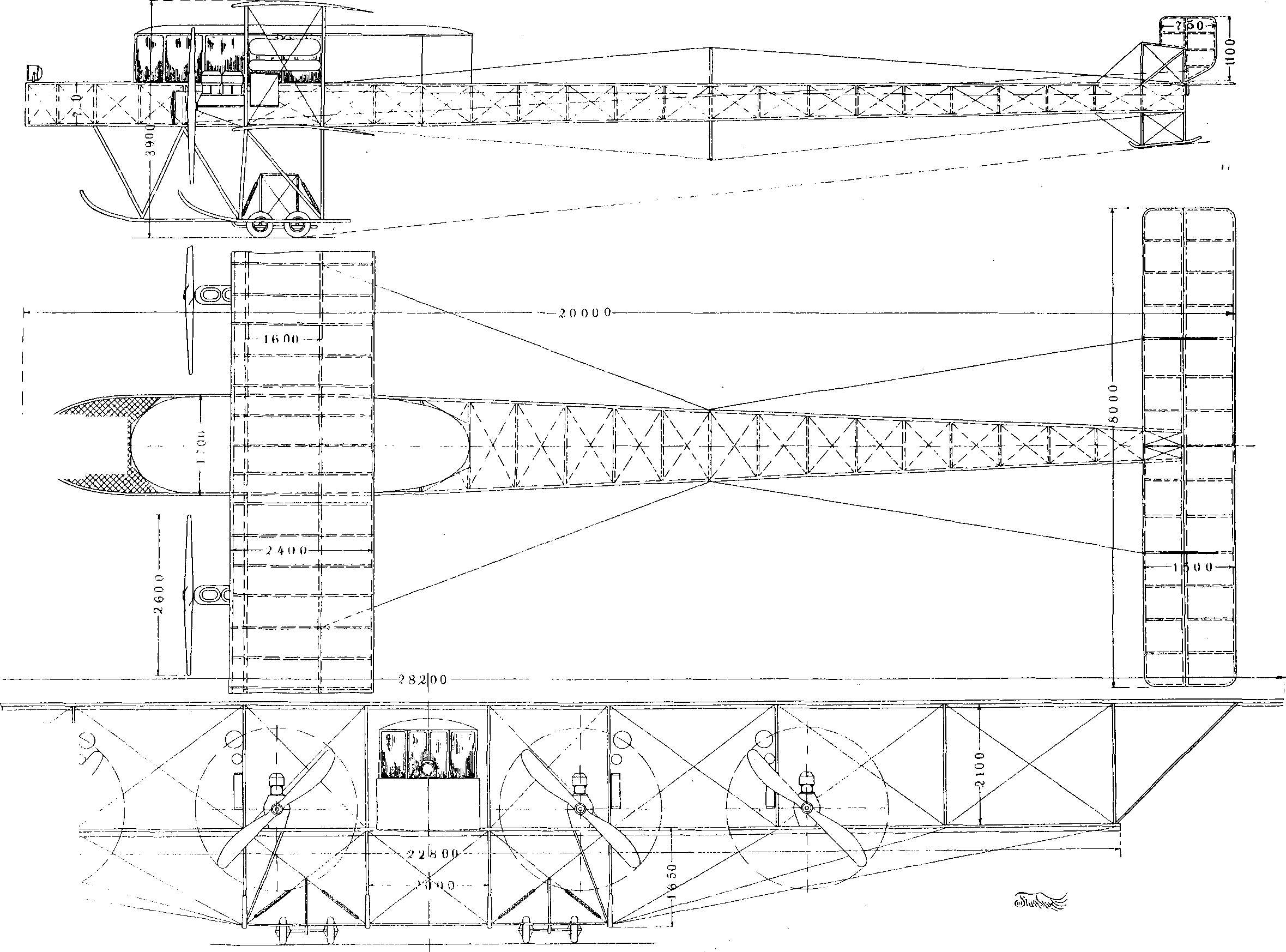
Nachbildung verboten. flugstation Filey wollten Einwohner ein, "Wasserflugzeug, gesehen haben, welches dann plötzlich in der hochgehenden See verschwand i Die Zeitungen verfehlten natürlich nicht, darauf hinzuweisen, daß die geheimnisvolle Maschine vielleicht eine deutsche sein könne und die englische Angst faßte von neuem Fuß. 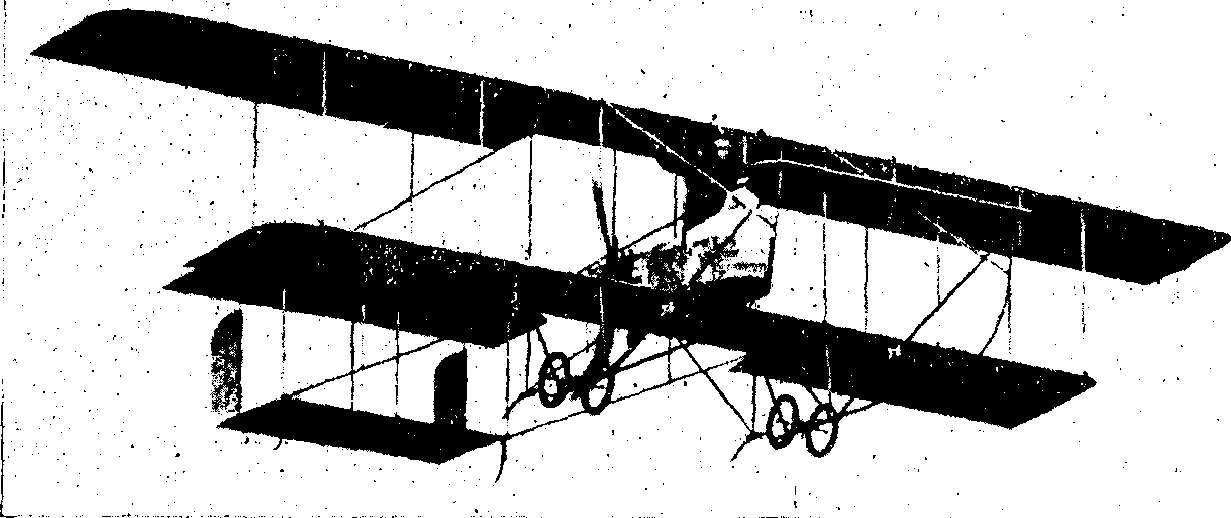 Verrier mit Fluggast auf einem Maurice Farmann-Doppeldecker fliegt 5 Minuten mit losgelassenen Händen. So lächerlich diese Andeutung auch klingt, £fand^sie doch genügend Glauben. Der Flug des Ingenieurs Dahin vom Flugzeugbau Friedrichshafen scheint den Engländern in den .Kopf gestiegen zu sein. Vielleicht hat er während seines Fluges einen Abstecher nach 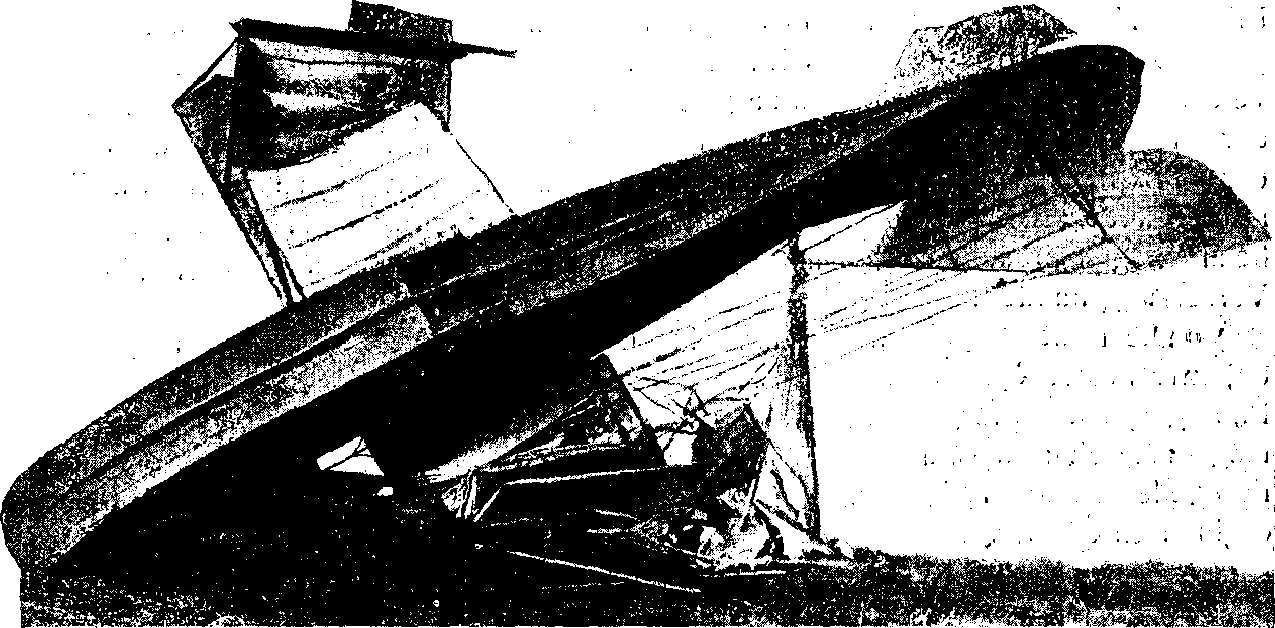 Ein Curtiss-Flugboot, ... . > ■welches auf dem Lande niedergehen muffte und sicfi umschlug, ohne daß das Boot zertrümmert wurde. In der Abbildung ist sehr gut die Konstruktion der unteren Seite des Bootes zu erkennen. ...... . , . '*ϖ' England gemacht ? Der Hauptzweck, den die englische Presse hierbei' > verfolgt, ist, das Interesse des Publikums für das Flugwesen zu gewinnen und „der Zweck heiligt die Mittel". Später stellte sich jedoch heraus, daß das geheimnisvolle "Wasserflugzeug ein von Leutnant Courtney gesteuerter Short-Wasserdoppeldecker der englischen Marine war, und zwar Flugzeug Mr. 20. Leutnant Courtney hatte den Befehl erhalten, eine Torpedoboot-Flottille, die auf der Höhe von Filey "Uebungen ausführte, aufzusuchen. Er flog von Dover aus an der Küste entlang bis nach Bridlington und von dort aus auf die offene See. In einer soeben herausgegebenen Liste beläuft sich Englands Flugzeugindustrie, Import und Export folgendermaßen: August 1911 1912 1913' Import . . Lstl. 2,873 . . Lstl. 8,559 . . Lstl. 17,903 Export . . „ 2,153 . . „ 1,342 . . „ 2,805 Re-Export . . „ 266 . . „ 2,040 . . „ 510 8 Monate, enden mit dem 31. August. 1911 1912 1913 Import . . Lstl. 35,389 . . Lstl. 46,964 . . Lstl. 164,984 Export . . „ 14,020 . . „ 11,957 . . „ 26,651 Re-Export . „ 9,262 . . „ 4,111 . . „ 8,351 Lord. Biegen sich die Tragflächen nach hinten? Nebenstehende Abbildung zeigt einen 60 PS Deperdussin-Eindecker, den der Flieger Normann Spratt in einem Geschwindigkeits-Handicap auf dem Flugplatze zu Hendon flog. Das Bild ist mit einer Anzahl konvergierender Linien versehen. Bei näherer Betrachtung des Bildes sieht man, daß die Vorderkante der Tragflächen keine vollkommen gerade Linie bildet, sondern dass die der Tragflächen nach hinten gebogen erscheint. Es wäre nun wirklich interessant zu wissen, ob sich tatsächlich die Tragflächen durch die Beanspruchung beim Fliegen jzurückgebogen haben, oder ob es sich hier um eine photographische Verzeiitihg handelt. Die Photographie wurde mit einem Schlitzverschluss und einem Goerz objektiv bester Qualität aufgenommen. Die Aufnahme kam so zustande, daß der Photograph der Flugmaschine in ihrem Fluge mit dem Apparate folgte, um ein möglichst scharfes Bild des Apparates zu bekommen. Wie man sieht, ist auch infolgedessen der Hintergrund des Bildes verwischt Daß die Aufnahme gut ist, ergibt sich aus der Klarheit der Details der Flugmaschine und der Schärfe des Bildes. Die Objektivöffnung war etwa 6,5 und die Expositionszeit etwa '/„oo Sekunde. Die Verzerrung, die man in der Regel bei Aufnahmen mit dem Schlitzverschluß von schnellfahrenden Wagen oder dergleichen erhält, besteht z. B. in elliptischer Form der Räder. Das Oberteil des Wagens stürzt nach vorn. Bei der Flugmaschine würde eine ähnliche Verzerrung dann da sein, wenn die Maschine mit stehender Kamera aufgenommen wäre und sie würde sich darin zeigen, daß die eine Flügelspitze weiter vorsteht wie die andere. Und zwar so, daß die zuletzt belichtete Flügelspitze, in diesem Falle also die obere des Apparates, weiter nach links vorstehen müßte, wie die untere Flügelspitze. Man würde in diesem Falle, wenn man konvergierende Linien auf dem Bilde zöge, die obere Fliigelspitze links von der Begrenzungslinie und die untere Flügelspitze rechts von der Begrenzungslinie sehen müssen. Auf diesem Bilde liegen aber beide Flügelspitzen rechts von der Begrenzungslinie, die Vorderkante des Flugzeuges müßte also dann konkav er- L scheinen, statt konvex, wie es hier auf dem vorliegenden Bilde zu sehen ist. Es scheint also, daß dieseVerzerrung für dieses Bild nicht in Frage kommt. Wenn jedoch die Maschine steht, so ist der vordere Längsträger der Tragfläche gerade und die Vorderkante bildet auch eine gerade Linie. Der stumpfe Winkel, den die vordere Tragflächenkante auf dem Bilde zeigt, ist also bei stehendem bezw. ruhendem Apparat nicht vorhanden. Wie man auf dem Bilde ferner sieht, liegen auch die Oesen für die Spannkabel nicht in einer geraden Linie, sondern die äußersten Oesen treten nach rückwärts zurück. Daraus könnte man schließen, daß die ganze Tragfläche rechts und links sich nach hinten gebogen hat. Die Photographie wurde von einer Wendemarke aus aufgenommen und der auf den Beschauer gerichtete Flü-Biegen sich die TragMdien nach hinten ? gei des Apparates befand sich nicht ganz 3 m vom Objektiv entfernt. Die Spitzen der unteren Tragflächen befinden sich auf dem Negativ etwa 1 Zoll vom Rande der Platte Man kann also sagen, daß das ganze Bild sich im Zentrum der Platte befindet. Im Augenblick, wo der Photograph das Bild aufnahm, hatte der Flieger gerade angefangen, sich von seinem Sitz aufzurichten, und aus der Stellung seiner Hände auf dem Steuerrade kann man schließen, daß er gerade die auf den Beschauer gerichtete Tragfläche nach unten verstellt hat, um einen größeren Anstellwinkel zu erzielen-Wenn die in der Photographie von den Tragflächen gezeigte Kurve von einem Zurückbiegen der Tragflächen herrührt, so muß der Betrag in natura annähernd 3—4 Zoll an den Spitzen der Flächen sein. Dieses Maß ergibt sich aus einem maßstäblichen Vergleich zwischen der Photographie und dem Originalapparat. Es wäre sicherlich äußerst in eressant, die Ansichten der Konstrukteure, Flieger und erfahrener Photographen ans dem Leserkreis des „Flugsport" hierüber zu hören. Seite 798 „FLUGSPORT.' No. 21 Johannisthal. Die Herbstflugwoche ging am 5. Oktober bei regnerischem Wetter zu Ende. Von den außerordentlichen Flugleistungen während der Flugwoche sind vor allen Dingen die neuen Weltrekorde zu erwähnen. Die meisten Weltrekorde brachte Sablatnig an sich, und zwar den deutschen Höhenrekord mit 2 Fluggästen am 29. September, am 30. September den Höhenweltrekord mit 3 Fluggästen am 1. Okt. den Höhenweltrekord mit 4 Fluggästen. Er erreichte bei dem letzten Fluge 1000 m in 15 Min. 1800 m in 30 Min. und befand sich bei 36 Min. in 2080 m Höhe von wo ab er den Gleitflug ansetzte. Am .3. Oktober brachte Sablatnig den 3. Höhen Weltrekord an sich, er stieg mit 5 Fluggästen,- Gewicht 401 kg ausschließlich Führer auf 1000 m. , Interessant war der Montagewettbewerb bei welchem die für den Transport fahrtbereiten Flugzeuge eine Torschablone von 3 m Breite und 3,75 m Höhe zu durchfahren hatten. Die Flugzeuge wurden von einem Automobil durch das. Tor gezogen. Hierauf wurde durch ein besonderes Signal idas Zeichen zur Montage gegeben. Nach Beendigung der. Montage, schloß sich ein Flug von 10 Min. Dauer an. Der L.' V. G.-Eindecker .besaß einen eigenen Transportwagen. Der Röver-Eindecker hatte die Flügel zu beiden Seiten der Fahrgestelles und. Rumpfes befestigt; zum Transport diente ein gewöhnliches Automobil. , Der Harlan-Eindecker wurde von einem Lastautomobil gezogen. Die kürzeste Zeit der Montage erreichte Rover mit 8 Min. 42; Sekunden. , Die Resultate der Flugwoche sind folgende: Wettbewerb Ia = Kürzester Anlauf. 1." Thelen 70,84 tri : 2. E. Stoeffler 92,67 m Ferner beteiligten sich noch Kiesling, Lindpairitner, V. Stoeffler, Krieger, Stiploscrieck, Rupp, ohne daß es ihnen gelang, einen Anlauf unter 100 m auszuführen. Wettbewerb lb = Kürzester Auslauf. 1. Rupp 50,95 m 3. E. Stoeffler 64,25 m 2. V. Stoeffler 61,80 m Ingoid, Thelen, Krieger gelanges nicht, einen Auslauf unter 70 m auszuführen. Wettbewerb Ic = Steigfähigkeit. 1. Thelen 7 Min. 36 Sek.' 3. (auiscli 13 Min. 6 Sek 2. E.Stoeffler 12 Min. 12 Sek.- . , 4..'Kießling über 15 Minuten 5. Stiploscheck kann nicht gewertet werden, da er die Höhe nicht inner- . halb der für die Wettbewerbe vorgeschriebenen Zeit erreichte. Wettbewerb ld = Unterschied zwischen der kleinsten und größten Geschwindigkeit. 1. Rupp 68,75 km/Std. 102,00 km'Std. = 33,25 km'Std. Differenz. 2. Thelen 70,5 km/Std. 105 50 km/Std. = 35,00 km/Std. Differenz. 3. Krieger 57,2 km/Std. 89,9 km/Std. = 32,70 km/Std Differenz . . Das Kgl. Preuss. Kriegsministerium soll gebeten werden Thelen den 2. Preis und Krieger den \ Preis zuzusprechen, da das Preisgericht der Ansicht ist, daß die Leistungen der beiden Genannten wahrscheinlich innerhalb der. vom Kriegsministerium vorgeschriebenen Grenzen liegen. Begründung: Die Genauigkeit auch der als bestgefündene Methode nämlich der mittels summierender Anemometer vorgenommenen Messung ist keine derartige, daß bis auf 1 1 richtige Werte einwandfrei festgestellt werden, können. . , Ferner bewarben sich noch E. Stoeffler und Lindpairitner, konnten jedoch nicht gewertet werden, da ihre Leistungen sich nicht innerhalb der vorgeschriebenen anforderurigen hielten. Im Dauerwettbewerb wurden folgende Gesamtflugzeiten erzielt:
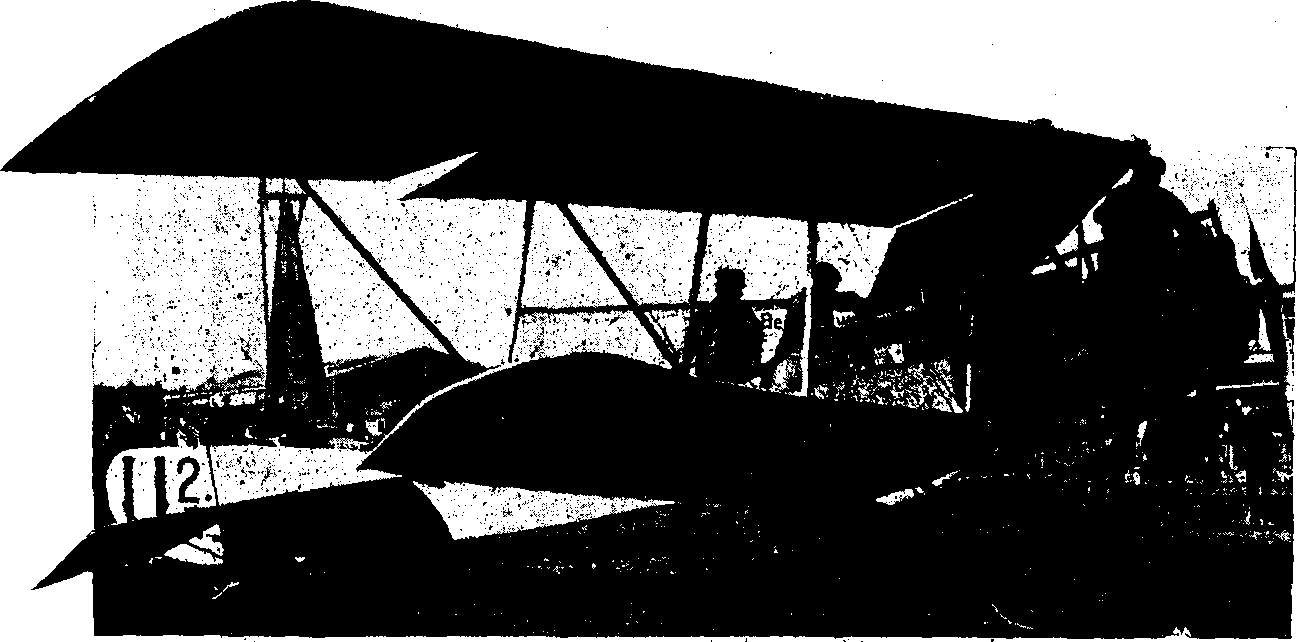 Der Union-Pfeil-Doppeldecker, mit v/elchem Sablatnig dießöhen-Weltrekorde mit mehreren Fluggästen aufstellte,. Wettbewerb III - Längster Einzelflug. 1. Remus am 4. 10. 4 Std. 55 Min. Ehrenpreis des K. 'K.. C. und 2. Gruner am 1.10. 3 Std. 21 Min. , Wettbewerb IV = Größte Höhe. 1. Stiploscheck am 4. 10. 4070 m Ehrenpreis des Berliner V. f. L. 2. Fiedler am 2. 10. 3900 m a) Geschwindigkeitsrennen. I. S c h w e r e E i n d e c k e r. 1. Laitsch 10 Min. 254/5 Sek. 3. Krieger 13 Min. 41 Vio Sek. 2..Ingold 11 Min. 263/5 Sek 4. Reiterer 15 Min. 47'/5 Sek. unplaziert blieben: Stiploscheck und Fiedler, weil sie.die Ziellinie nicht passiert haben; Kohnert, weil er die Wendemarke nicht gerundet hat. II. Schwere Doppeldecker. 1. Janisch 11 Min. 143/„, Sek. 4. Kießling 12 Min. 33'/,,, Sek. 2. Lindpaint er 11 Min. 59 '/,„ Sek. 5. Remus 12 Min. 57 Sek. 3. V. Stoeffler 12 Min. 32 '/,„ Sek. 6. Schüler 13 Min 7'/,0Sek. Nicht gewertet wurden: E Stoeffler, weil er die Wendemarke nicht richtig gerundet hat und Thelen weil er eine falsche Wendemarke gerundet hat. III. Leichte Doppeldecker. 1. Wrobel 16 Min. 35 Sek. 2. Kammerer 29 Min. 28'|,„ Sek. Der Ehrenwanderpreis Seiner König!. Hoheit des Prinzen Friedrich Leopold wird iir dieses Jahr der Firma Luftverkehrsgesellschaft A.-G. in Johannisthal zuge- . prochen. Der Führer Laitsch erhält ausschreibungsgemäß einen Erinnerungspreis. Seite 800 „FLUGSPORT." No. 1 b) Vorgaberennen. 1. Laitsch 30. 9. 11 Min. 25 Sek. 1. V. Stoeffler 2. 10. 12 Min. 11% Sek. 2. Lindpaintner30.9. 13 Min. 25»U Sek. 2. Thelen 2. 10. 13 Min. 123|ä Sek. 3. Stiploscheck 30. 9. 13 Min. 29 Sek. 3 Krieger 2 10. 14 Min. 501 Sek. 4. Kießling 30. 9. 24 Min. 48% Sek 1. Ingold 5. 10 14 Min. 51 % Sek. 5. Schwandt 30. 9. 27 Min. 24% Sek. 2. Wrobel 5, 10. 16 Min. 42'!,,, Sek. 3. Kammerer Wettbewerb VI == Montage. 1. Laitsch 12 Min. 16 Sek. 2. Rover 16 Min. 29 Sek.  Vom Montage-Wettbewerb in Johannisthal. Der L. V. G.-Eindetker passiert das Profil. Praktische Anwendung des Durchsackens. Genau so wie beim Reiten macht sich in der Fliegerei die Kunst der hohen Schule bemerkbar. Man stellt sich auf den Kopf, fliegt Schleifen, läßt den Apparat seitlich abrutschen und sich überschlagen, u. a. m. Neuerdings ist ein neues interessantes Experiment vorgeführt worden und zwar ein senkrechter Abstieg aus ca. 1000 m Höhe. Der Vicomte Guy de Loynes d'Autroche, der zurzeit in der französischen Armee seiner Militärpficht genügt und der Militäraviation zugeteilt ist, nahm an den Herbstmanövern mit einem Maurice Farman-Doppeldecker teil. Als er während dieser Manöver über eine ihm zugedachte Aufgabe und zwar eine Bombe über einen bestimmten Punkt zu lancieren, nachdachte, kam ihm der Gedanke, daß der Punkt am besten zu treffen sei, wenn die Flugmaschine in der Luft stillstehe, oder wenigstens mit seinem Apparat sich genau in vertikaler Richtung den Boden nähere. Ohne sich lang zu besinnen, stellte er den Motor ab und brachte den Apparat in wagerechter Richtung dem Boden näher, und stellte den Motor wieder an. Die Möglichkeit dieser Versuche wurde von Fach- leuten und selbst von Maurice Farman nicht geglaubt. D'Autroche wiederholte vor einer Zuschauermenge bei 20 m Wind daher nochmals den Versuch und stieg auf ungefähr 1000 m. Man hörte plötzlich wie das Brummen des Motors verstummte, die Maschine sich in den Wind stellte, die Geschwindigkeit verlor, und in horizontaler Lage langsam zur Erde durchsackte. D'Autroche wiederholte dieses Experiment mit Passagier, was tadellos gelang. Maurice Farman erklärte nach dem Experiment, daß dasselbe vollständig ungefährlich sei, man müsse sich nur gegen den Wind stellen den Motor abstellen und in ungefähr 60 m vom Boden entfernd den Motor wieder anstellen. III. Internationaler Kongreß für Luftrecht Frankfurt a. M. Der III. internationale Kongreß für Luftrecht, welcher für den 25, 26. und 27. September von dem Comite juridique international de l'aviation nach Frankfurt a. M. einberufen war, war äußerst stark besucht. Vertreten waren Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Oesterreich, Italien und die Schweiz. Frankreich hatte außer dem Präsidenten des Comites, Herrn Busson Billaut, avocat ä la cour, ancien bätonnier, als Vertreter entsandt die Herren: 1. Delayen, avocat ä la cour, Vice-president, Paris; 2. Jouffre de Lapradelle, professeur ä la faculte de droit de Paris Rapporteur general; 3. Reymond, senateur, membre du Comite directeur; 4. A. Henry-Couannier, professeur, du droit, membre du Comite; 5. T alamon, avocat ä la cour de Cassation de droit de Paris; die Schweiz hatte zwei Vertreter, die Herren Dr. Brennwald, avocat, Zürich Dr. Edmond Pittard, avocat, Geneve; Oesterreich ebenfalls zwei Vertreter, die Herren Dr. Otto Chevalier de Komozynski-Oszcynski au ministere de Vienne, Dr. Chevalier de Roskowski, professeur, Lemberg und die übrigen Länder je einen Delegierten entsandt. Von den deutschen Mitgliedern des Comites waren außer dem deutschen Nationaldelegierten Gerichtsassessor Dr. Alex Meyer, Frankfurt a. M. und verschiedenen sonstigen Frankfurter Mitgliedern des Comites, ca. 20 erschienen, u. a. Geheimrat Prof. Dr. Zitelm ann, Bonn; Geheimrat Prof. Dr. Meurer, Würzburg; Amtsgerichtsrat Bodenheim, Melle (Hannover), Justizrat Niemeyer, Essen, Vizepräsident des Comites; Dr. Schrenk, Stuttgart; Rechtsanwalt Weck, Berlin; Dr. Feist, Elberfeld; Dr. Carlo Andreae (Direktor der Delag) Das Ehrenpräsidium des Kongresses hatte an Stelle des plötzlich erkrankten Staatsministers, Exzellenz Dr. O. von Hentig, der bekannte Nationalökonom und derzeitige Rektor der Universität München, Unterstaatssekretär a. D. Professor Dr. Georg von Mayr übernommen. Die feierliche öffentliche Eröffnungssitzung fand im Beisein zahlreicher Richter, Anwälte, Luftfahrer mit ihren Damen am Donnerstag, den 25. September, vormittags 9 Uhr, in der Aula der Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften statt. Es nahmen die Spitzen sämtlicher Zivil- und Militärbehörden teil ϖ u. a. bemerkte man den kommandierenden General des XVIII. Armeekorps, Exzellenz' von Schenck; Generalleutnant Exzellenz von Pluskow, Oberbürgermeister Voigt, Oberlandesgerichts-Präsident Geheimer Oberjustizrat Dr. Spahn, Oberstaatsanwalt Geheimer Oberjustizrat Dr. Huperts, den Präsidenten der Handelskammer Geheimer Kommerzienrat Andreae und den neuen Rektor der Akademie Professor Dr. Wachsmuth u. a. m. Im Auftrage des Reichskanzlers war Geheimer Regierungsrat Dronke vom Reichsjustizamt als Vertreter der Reichsbehörden erschienen. Justizrat Dr. Niemeyer, der Vorsitzende der deutschen Abteilung,~eröffnete den Kongreß mit einer französischen Ansprache, in welcher er kurz die Ziele des Comite juridique international l'aviation darlegte und Herrn Unterstaatssekretär Dr. von Mayr bat, das Ehrenpräsidium des Kongresses zu übernehmen. Dr. von Mayr begrüßte darauf in deutscher und französischer Sprache die Versammlung. Er gab seiner: Freude Ausdruck, den Ehrenvorsitz des Kongresses führen zu dürfen und hob hervor, daß er auch als Nationalökonom für die Bestrebungen des Kongresses das größte Interesse habe. Er wies besonders auf die Arbeiten des Kongresses als eine wichtige Friedensarbeit hin, indem er die gegenseitige Verständigung der Völker zur Schaffung eines gleichartigen internationalen Rechtes aufs neue unterstützte. Im Namen des Reichskanzlers begrüßte daraufhin Herr Geheimrat Dronke die Vertreter der verschiedenen Nationen zu ihrer Tagung auf deutschem Boden, indem er darlegte, die Reichsregierung erkenne die bedeutsamen Arbeiten des Comite juridique voll an und freue - ich, daß die Arbeiten des Comite in diesem Jahre in Deutschland stattfänden. Als Vertreter der Stadt Frankfurt a. M. sprach Oberbürgermeister Voigt. Er gab einen rechtshistorischen Ueberblick Uber die Bedeutung der Schaffung eines internationalen Luftrechts ' und betönte unter Anführung des berühmten Werkes von Savigny „Ueber den Beruf unsrer Zeiten zur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft", daß die Rechtswissenschaft immer mit der Zeit gehen müsse. Die Stadt Frankfurt empfinde es als besondere Ehre, den ersten Kongreß auf deutschem Boden empfangen zu dürfen und entbiete er deshalb im Namen der Städtischen Behörden wie auch im Namen aller Frankfurter Teilnehmer seinen Gruß. Als Vertreter der Frankfurter Justizbehörden begrüßte Oberlandes-gerichts-Präsident Dr. Spahn die Versammlung. Er wies besonders auf die Be-7 uti: s. einer internationalen Regelung des Luftrechts hin und fügte dann im -auic der Ansprache hinzu, daß er sich ganz besonders freue, die Versammlung in Frankfurt a M: „dem Herzen Deutschlands", begrüßen zu dürfen, ein Wort, auf das in späteren Tischreden während des Kongresses noch oft angespielt wurde und das zu einem geflügelten Wort zu werden scheint. Nachdem noch der Rektor der Akademie Dr. Wachsmuth, die Versammlung begrüßt hatte, dankte der Präsident des Comite Busson-Bilfaut in "längerer Rede. Er führte etwa folgendes aus: Er empfinde es als eine besondere Qenugtung, daß das Comite in diesem Jahre seine Arbeiten in Frankfun. weiterverfolgen dürfe, dieser Stadt, welche durch ihre Arbeitskraft und ihre führende Stellung in der Handelswelt weithin berümt sei. Es sei dem Comite eine besondere Ehre, daß es den Code de l'air, dieses Monument, in welchem sich das Recht, dje Philosophie und selbst die Poesie zu vereinigen scheine, in diesen Mauern weiter aufbauen dürfe, in welchen der berühmte Rechtslehrer Savigny und der unsterbliche Dichter Goethe geboren seien. Nachdem der Redner dann kurz der zahlreichen Opfer der Luftfahrt gedacht hatte, fuhr er ungefähr wie folgt fort: Es liege natürlich in erster Linie den Konstrukteuren und der Erfahrung der Piloten ob, zu erreichen, daß die Zahl der Unglücksfälle sich vermindere und die Gefahren, die die Luftfahrt mit sich bringe, immer kleiner würden. Aber es sei auch Pflicht des Gesetzgebers, einzugreifen und bestimmte Vorsichtsmaßregeln aufzustellen. Und sogar hiermit sei seine Aufgabe nicht erfüllt. Eine ungeheure neue Welt' habe si.h dem menschlichem Tätigkeitsdrang eröffnet. Die Normen, welche die alte. Erde,, den alten Ozean beherrschten seien ohnmächtig geworden. Mehr noch als auf dem Meer verwischten sich die Grenzen zwischen Privateigentum1 und Staaten. Das Privatrecht und das internationale Recht erforderten gebieterisch neue Regeln, deren Feststellung umso schwieriger sei, als sie nicht von . der Erfahrung getragen werden könnten. Deshalb hätten, ausgehend von dem gleichen Gedanken, Juristeh aller Länder dieses Comite gebildet, welches heute in.:So festlicher; Weise in Erscheinung trete. Aus diesen sich alljährlich1 wiederholenden Zusammenkünften entstünden aber auch neue Beziehungen, neue Freundschaften, von denen de verschiedenen Länder nur Vorteil haben könnten, Indem man einander besser kennen lerne, lerne man sich auch urhsomehr schätzen. Und indem alle der Prüfung unterbreiteten Aufgaben zur gewünschten Ueberein-stimmung geführt würden, würde, sicherlich nicht nur dem Recht, sondern der Menschheit überhaupt ein Dienst erwiesen. Nach dieser mit besonderem Beifall aufgenommenen Ansprache hielt Geheimrat Prof, Dr Zi te 1 m.ann .einen einstündigen wissenschaftlichen Vortrag über die Bedeutung des Luftsrechts. Um nicht frühere Erzeugnisse der Kongreß' arbeiten zu wiederholen, noch den Beratungen des Kongreßes vorzugreifen, gab der Redner lediglich einen Ueberblick Uber sämtliche Fragen, welche der Rechts- Wissenschaft durch die Entwicklung der Luftfahrt gestellt sind. Er rollte in hochinteressanter Auswahl die mannigfaltigsten Rechtsfragen auf und zeigte die Wege welchen die Gesetzgebung zu folgen habe. Hierbei berührte er sowohl das Kriegsrecht, das öffentliche Recht wie das Privatrecht. Den fesselnden Vortrag illustrierte er durch zahlreiche Beispiele, teilweise humoristischer Art. Am Schluß des Vortrags kam Geheimrat Zitelmann auf die Frage der internationalen Gestaltung des Luftsrechts. In fesselnder Ausführung schilderte er den einst belächelten Gedanken eines Weltrechts, der mit der Schaffung eines Welt-wechselrechts erst kürzlich seine erste Anerkennung gefunden hat und wies auf die große Vorzöge eines Weltluftfahrtrechts hin, das den Verkehr unendlich erleichtern und den Frieden festigen würde, wenn es auch wohl nicht unmittelbar zu diesem Ergebnis kommen würde, so sei doch wohl der Gedanke eines solchen Weltluftfahrtrechts nicht allzu „hochfliegend". Der äußerst geistvolle Vortrag des Geheimrats Zitelmann fand den lebhaften Beifall der Versammlung, dem der Vorsitzende Dr. von Mayr noch persönlich Ausdruck verlieh.--— Unmittelbar nach Schluß der Eröffnungssitzung traten die Kongreßteilnehmer zu den internen Beratungen zusammen, welche in der Fortsetzung der Beratungen des vom Comite in Ausarbeitung begriffenen internationalen Code de l'air bestanden. Während auf dem Pariser Kongreß 1911 und dem 2. Kongreß in Genf 1912 das öffentliche Recht, der Luftfahrt Gegenstand der Erörtungen gewesen war, stand auf der Frankfurter Tagesordnung das Privatrecht der Luftfahrt zur Beratung, und zwar als 1. Punkt: „Die privatrechtliche Natur des Luftraums". Zu dem vom Pariser Präsidial-Comite vorgeschlagenen Artikeln waren verschiedene Aenderungsvorschläge eingegangen, u. a. von Prof. Dr. Karl Neumeyer, München, Dr. Goldfeld, Hamburg und Gerichtsassessor Dr. Alex Meyer, Frankfurt a. M. Nach einer Debatte, an welcher fast alle Mitglieder des Kongreßes teilnahmen und in welcher zum Teil sehr widerstreitende Meinungen zum Ausdruck kamen, wurde grundsätzlich die Gewährung eines Durchfahrtsrechts für Luftfahrzeuge angenommen, sodaß niemand auf Grund seines Eigentumsrechts der Fahrt eines Luftfahrzeugs über seinem Grundbesitz widersprechen kann, es sei denn, die Fahrt sei für den Grundeigentümer mit anerkannten Unzuträglichkeiten verbunden. Das Durchfahrtsrecht steht also den Luftfahrern zu, wenn nicht eine objektiv anzuerkennende Unzuträglichkeit den Grundeigentümer zum Verbot berechtigt. Jeder Mißbrauch des Passagerechts soll den Urheber zum Schadenersatz verpflichten. Nach Erledigung dieses Punktes wurde zur Erörterung der sehr umstrittenen Haftpflichtfrage übergegangen, welche zu mehrstündigen teilweise sehr lebhaften Debatten führte und den Rest der Kongreßtagung ausfüllte. Justizrat Dr. Niemeyer hielt u. a. eine Fortbildung des geltenden Schadenersatzrechts in Abweichung von der Verschuldungshaftung überhaupt für unzweckmäßig. Im Gegensatz hierzu befürwortete die französische Gruppe, ähnlich wie es der Entwurf des französischen Luftfahrtgesetzes tut, die Annahme der unbeschränkten „theorie du risque", derzufolge der Luftfahrer für alle Schäden haften soll, einschließlich der durch höhere Gewalt entstandenen Die Mehrheit der Versammlung trat dem unbesondere von Geheimrat Dr. Meurer und Gerichtsassessor Dr. Alex Meyer vertretenen Standpunkt einer beschränkten Gefährdungshattung bei und beschloß, in Anlehnung an das deutsche Automobilrecht die Einführung einer solchen. Als in Anspruch zu nehmende Person wurde der „Halter" des Fahrzeugs bestimmt. Durch diesen Beschluß dürfte der deutsche Begriff „Halter" zum erstenmale internationalisiert worden sein, ein nicht zu unterschätzendes Ergebnis. Die französische Uebersetzung des Wortes stieß anfangs auch auf Schwierigkeiten, schließlich einigte man sich auf den Ausdruck „detenteur". Die angenommenen Beschlüsse lauten im einzelnen: Buch II. Kapitel I. Von der privatrechtlichen Natur des Luftraums. Livre 11. Chapitre I. De la propri6t6 du dessus. Kapitel 1. Von der privatrechtlichen Natur des Raumes Art. 25. Nul ne peut ä raison d'un droit de propriöte s'opposer au pas-sage d'un aeronef dans des conditions qui ne presentent pour lui aucun in-convenient appreciable. Niemand kann sich auf Grund eines Eigentumsrechts der Fahrt eines Luftfahrzeuges Uber seinem Grundbesitz widersetzen, sofern dies derart geschieht, daß die Fahrt nicht mit anerkannten Unzuträglichkeiten für den Grundeigentümer verbunden ist. Art. 26. Tant abus du droit de Jeder Mißbrauch des Durchfahrtsrechts passage donne ouverture contre son verpflichtet den Urheber zu Schaden-auteur responsable ä une action en ersatz. dommages-interets. Chapitre 2. De la reparation du dommage cause par un aeronef. Art. 27. La reparation d'un dorn- Kapitel I Die Haftpflichtfrage, mage cause par un aeronef soit aux Werden durch ein Luftfahrzeug auf personnes, soit aux biens, qui se trou- der Erdoberfläche Personen verletzt vent ä la surface incombe au detenteur otjer Sachen beschädigt, so ist der de l'aeronef, outre le droit de la per- Halter des Luftfahrzeuges zum Ersatz sonne lesee de s'addresser ä celui qui des entstandenen Schadens verpflichtet, est responsable d'apres le droit com- Das Recht des Verletzten, die nach all-mun gemeinem bürgerlichem Recht verant- wortliche Person in Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt. Art. 28. Le detenteur tenu ä la Dem zum Schadensersatz verpflich-reparation du dommage cause, a un teten Halter steht ein Regreßanspruch recours contre l'auteur responsable gegen den nach allgemeinem bürger-d'apres le droit commun. liehen Recht verantwortlichen Urheber des Schadens zu. Art. 29. En cas, oü le dommage Ist der Schaden ganz oder teilweise serait dü en tout ou en partie du fait auf ein Verhalten des Verletzten zurück-de la personne lesee, le juge pourra zuführen, so kann der Richter den Halter prononcer l'exoneration totale ou ganz oder teilweise von der Schadenspartielle du detenteur. ersatzpflicht befreien. Art. 30 Le detenteur peut apposer Der Halter kann den Einwand der l'exception de la force majeure. „höheren Gewalt" geltend machen. Art. 31. Les prescriptions de l'ar- Die Vorschriften des Ait. 27 finden ticle 27 ne sont pas appricables si, du keine Anwendung, wenn zur Zeit des moment de l'aicident la personne lesee Unfalls der Verletzte oder die be-ou la chose endommagee etaient trans- schädigte Sache durch das Fahrzeug portees par l'aeronef ou encore si la befördert wurden oder der Verletzte personne lesee etait occupee elJe- bei dem Betriebe des Fahrzeugs tätigwar. meme ä la manoeuvre de 1'appareil. In der Frage der gemeinschaftlichen Tragung der Schäden waren die deutsche und die östereichische Gruppe, von ersterer insbesondere Geheimrat Zitelmann der Ansicht, daß eine Haftpflichtversicherung für Luftfahrzeuge organisiert werden müsse und beantragten, daß der Kongreß beschließen möge, daß das Comite direcleur diese Frage für den nächsten Kongreß studiere. Der Kongreß beschloß diesem Antrage gemäß. Nach Beendigung des Geschäftsstoffes des Kongresses schloß Untcrstaats-sekrätar Prof. von Mayr den Kongreß mit einer Schlußansprache, in welcher er den einzelnen Herren für ihre rege Mitarbeit dankte; insbesondere gedachte von Mayr auch des berühmten, kürzlich verstorbenen Völkerrechtslehrers Geheimrat Prof von Bar, eines eifrigen Mitgliedes des Comite und bedauerte ferner die Abwesenheit des Präsidenten des französischen Staatsrats Marguerie und des berühmten Luftrechtlehrers Dr. Paul Fauchille sowie anderer durch ihre berufliche Tätigkeit am Erscheinen verhindert gewesener bekannter Persönlichkeiten. Präsident Busson-Billaut dankte Herrn von Mayr für die Uebernahme und geschickte Führung des Vorsitzes. Neben der Arbeit nahmen die Kongrt ßteilnehmer an verschiedenen, ihnen zu Ehren veranstalteten Festlichkeiten teil. Am ersten Tage mittags fand bei dem deutschen Nationaldelegierten Dr. Alex Meyer ein Frühstück statt. Abends folgten die Gäste einer Einladung des Frankfurter Vereins für Luftfahrt und des Frankfurter Flugsportklubs zu einem Bierabend und wurden von den Vorsitzenden der beiden Vereine, Herrn Geh Kommerzienrat Jean Andreae und Herrn Konsul H. G. von Passavant begrüßt. Freitag Mittag waren die Kongreßteilnehmer Gäste der Stadt Frankfurt in den ehrwürdigen Räumen des Römers, wo sie von dem Oberbürgermeister Voigt herzlich willkommen geheissen wurden. Freitag Abend vereinigte endlich ein Festmahl die Kongreßteilnehmer im Frankfurter Hof. Hierbei brachte der Unterstaatssekretär von Mayr ein Hoch auf die Souveräne der beteiligten Länder aus. Der Präsident des Comite juridique dankte in längerer formvollendeter Rede den Vertretern der Behörden, welche den 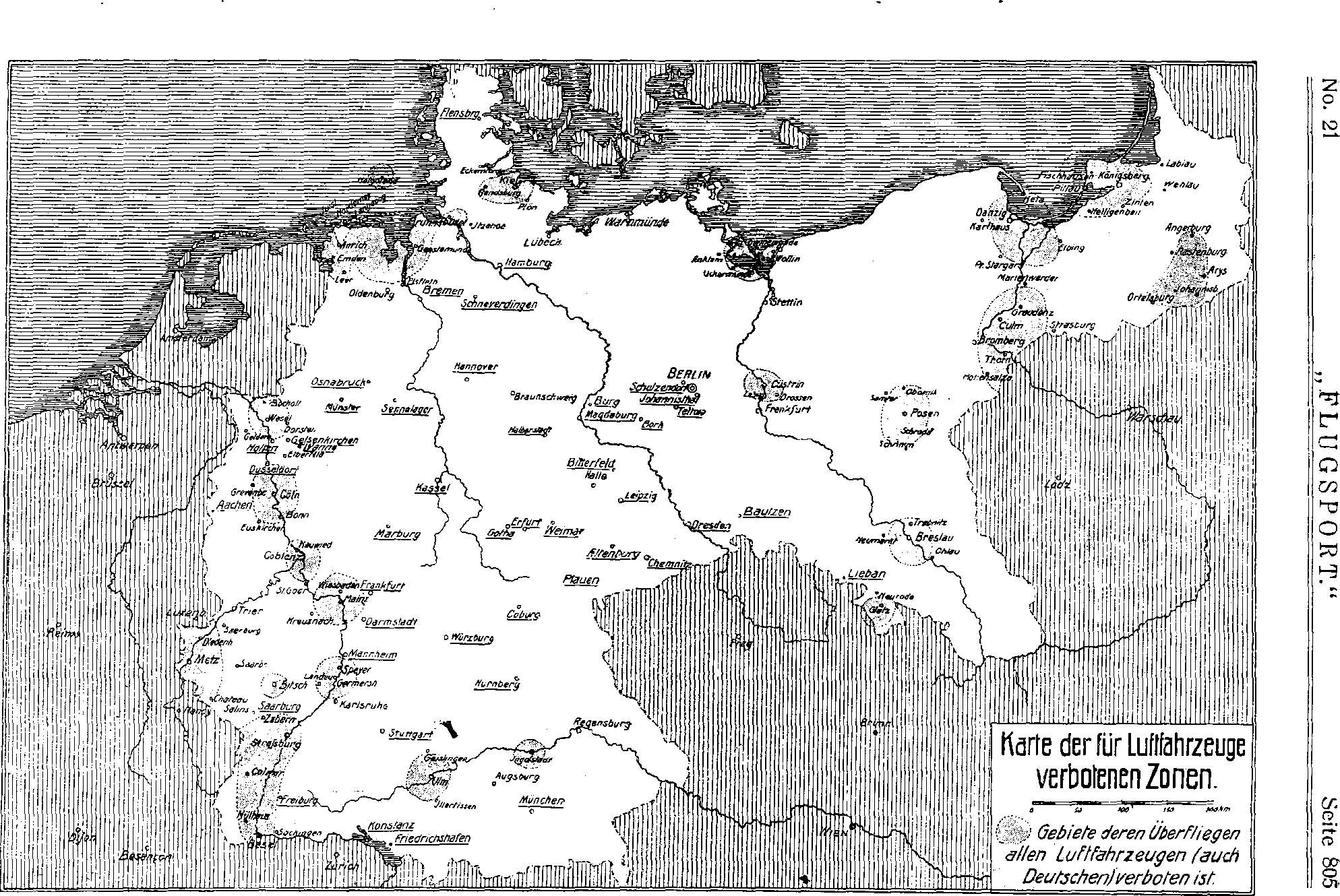 Die unterstrichenen Orte außerhalb der verbotenen Zonen bieten Unterkunftsmöglichkeiten für Flugzeuge: (Flugplätis u. s. w.) Die Militärfliegerstationen sind nicht eingezeichnet. Kongreß begrüßt hatten, sowie allen Herren, welche sich um 'das Gelingen des Kongresses bemüht hatten. Die in meisterhaftem Französisch vorgetragene Rede entfesselte einen Sturm der Begeisterung. Justizrat Niemeyer sprach daraufhin auf die ausländischen Gäste, der Präsident des deutschen Luftfahrerverbandes, Generalleutnant Exzellenz von der Goltz auf die Arbeiten des Kongresses und Oberlandesgerichts-Präsident Dr. Spahn auf das Comite juridique international de l'aviation und dessen Präsidenten Busson-Billaut. Samstag der 27. war zu Exkursionen vorbehalten. Zunächst folgten die Kongreßteilnehmer einer Einladung der Deutschen Luftschiffahrt A.-G. (Delag) zu einer Zeppelinfahrt, welche sich bis nach Offenbach, Homburg erstreckte und mit ihrer Belastung mit 26 Insassen eine Rekordfahrt darstellte. Anschließend hieran begaben sich die Kongreßteilnehmer auf Einladung des Herrn August Euler in dessen Flugzeugwerke und besichtigten diese unter dessen Führung. Anschliessend hieran gab Herr Euler den Kongreßteilnehmern ein Frühstück. Nachmittags fand ein Ausflug auf die Saalburg und in den Taunus statt. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die bedeutsame Tagung des III. Luftrechtkongresses die gesetzgebenden Faktoren bei Schaffung eines Luftrechtgesetzes beeinflussen wird. No. 511. Theiller, Renatus, Mülhausen i. Eis., geb. am 13. Sept. 1894 zu Mülhausen, für Zweidecker (Aviatik-Pfeil), Flugfeld Habsheim, am 12. Sept. 1913. No. 512. Schulz, Heinrich, Johannisthal, geb. am 17. Mai 1888 zu Neu-Lübbenau, Kr. Beskow, für Eindecker (Etrich), Flugplatz Johannisthal, am 12. September 1913. No. 513. Engelhorn, Fritz, stud. ing., Mannheim, geb. am 25. März 1892 zu Mannheim, für Eindecker (Grade), Flugplatz Bork, am 12. September 1913. No. 514." Ernst, Werner, Regierungsbaumeister a. D., Charlottenburg, geb. am 26. Dezember 1882 zu Kirchbrak (Braunschweig), für Zweidecker (Ago), Flugplatz Johannisthal, am 15. Sept. 1913. No. 515. Oesterreicher, Albert, Göppingen, geb. am 1. Februar 1890 zu Mühlen, für Zweidecker (Otto), Flugfeld Oberwiesenfeld, am 15. September 1913. No. 516. Behling, Alfred Berlin NO. 55, geb. am 18. Dezember 1691 zu Pölitz, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 15. September 1913. No. 517. Sido, Franz, Leipzig-Gohlis, geb. am 22. August 1884 zu Karlsruhe, für Zweidecker (Deutsche Flugzeugwerke), Flugfeld der Deutschen Flugzeugwerke, am 15. September 1913. No. 518. Haase, Gerhard, Bethel/Bielefeld, geb. am 1. August 1893 zu Brüggen, für Zweidecker (LV.G., System Schneider), Flugplatz Johannisthal, am 15. September 1913. No. 519. Reiterer, Franz, geb. am 31. Januar 1889 zu Kindberg, (Steiermark), für Eindecker auf Grund des österreichischen Zeugnisses 106, am 16. Sept. 1913. No. 520. Qruner, Gotthard. Chemnitz, geb. am 24. Mai 1880 zu Dippel-diswalde, für Eindecker (Harlan), Flugplatz Johannisthal, am 17. Sept. 1913. No. 521. Hozakowski, Sigismund, Thorn, geb. am 6. Juni 1891 zu Thorn, für Zweidecker (Schwade), Flugfeld Drosselberg bei Erfurt, am 17. Sept. 1913 Flugtechnische 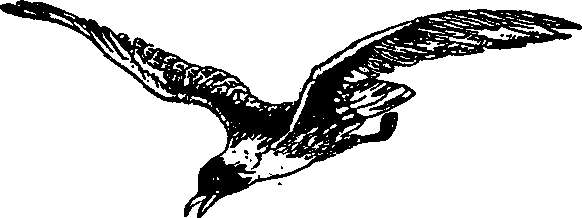 Rundschau. Inland. Flugführer-Zeufjnisse haben erhalten: No. 522. Krug, Michael, Leutnant im 18. Bayer. Inf.-Regt., geboren am 20. Dezember 1886 zu Kulmbach in Bayern, für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 18. September 1913. No. 523. Remuß, Richard, Berlin-Oberschöneweide, geb. am 25. Aug. 1892 zu Pr.-Friedland, für Zweidecker (Ago1, Flugplatz Johannisthal, am 19. Sept. 1913. No. 524. Hucke, Friedr., Burg b. Magdeburg, geb. am 25. Sept. 1888 zu Aken a. Elbe, für Eindecker (Schulze), Flugfeld Madel bei Burg, am 19. Sept. 1913- No. 525. Thomessen, Thomas, Oberleutnant z. S. der Kgl. Norwegischen Marine, Horten i. Norw., gtb. am 3. Dezember 1882 zu Larwik i. Norw., für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 19. September 1913. No. 526. Hebart, Karl, Benk, Bez. Bayreuth, geb. am 18. Sept. 1895 zu Ermershausen (Unterfrank), für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 20. Sept. 1913. No 527. Nestler, Gustav, Lahr i. Baden, geb. am 6. Februar 1892 zu Lahr i. Baden, für Eindecker (M.-B.-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 20. Sept. 1913. No. 528. Krause, Walter, stud. ing., Adlershof bei Berlin, geboren am 15. August 1893 zu Leipzig, für Eindecker (Albatros), Flugfeld Johannisthal, am 22. September 1913. No. 529. von Ploetz, Günther, cand. jur., Charlottenburg, geboren am 8. April 1889 zu Magdeburg, für Zweidecker (Euler), Flugplatz der Eulerwerke, am 22. September 1913. No. 530. Lang, Karl, Stückhauser!, Kr. Lauterbach, geb. am 24. Juli 1893 zu Stockhausen, für Zweidecker (Euler), Flugplatz der Eulerwerke, am 22. Sept 1913. No. 531. Mutti, Alfred, Quedlinburg, geb. am 26. Sept. 1893 zu Groß-Paschleben, Kr. Kothen, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 22. Sept. 1913. No. 532. Stockhausen, Johann, Paderborn, geb. am 19. Sept. 1876 zu Dahme, Kr. Jüterbog, für Zweidecker (Deutschland), Flugplatz Gelsenkirchen, am 22. September 1913. No. 533. Spacbholz, August, stud. ing., Konstanz am Bodensee, geb. am 15. August 1891 zu Wollmatingen, für Zweidecker (Euler), Flugplatz der Eulerwerke, am 25. September 1913. Fluystützpunlzt Bautzen (Königreich Sachsen). Am 14. September 1913 erfolgte die Einweihung des ersten Sächsischen Flugstützpunktes in Bautzen durch den ersten Vorsitzenden des Königlich Sächsischen Vereins für Luftfahrt, Generalleutnant z. D. von Laffert und den Oberbürgermeister der Stadt Bautzen Dr. Kaeubler. Der Flugstützpunkt liegt im Südwesten unweit der Stadt auf einem eigens dazu von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellten Gelände und ist 500 m lang und 200 m breit. In der Mitte ist der Streifen auf 300 m verbreitert, so daß in jeder Richtung gut gelandet und abgeflogen werden kann. An dieses eigentliche Fluggelände schließt sich unmittelbar und hindernisfrei noch weiterer für Fliegerlandungen günstiger Boden an. Die 80 m große Halle, die durch zwei 20 m breite Schiebetore zu Öffnen ist, enthält einen 40 m langen Flugzeugschuppen, der 13 m tief und 5 m hoch ist. Sie ist mit elektrischer Lichtanlage versehen. Auf dem Dache des Gebäudes, das außer der Halle noch eine Fliegerwerkstätte, eine feuersichere Benzinniederlage und eine Pförtnerwohnung birgt, ist in 4'/, m großen weißglänzenden Lettern in einer Länge von 70 m die Inschrift: „Flugstützpunkt Bautzen" angebracht. Der Flugstützpunkt ist also von den Fliegern aus bedeutender Höhe und weithin sichtbar. Mit der Einweihung des Flugstützpunktes, die in Gegenwart einer vieltausendköpfigen Menge erfolgte, begann die Bautzener Flugwoche des Königlich Sächsischen Vereins für Luftfahrt, deren Organisations-Ausscluiß u. a. angehörten: Ihre Durchlaucht die Fürstin von Hanau, Generalleutnant von Laffert, Generalleutnant Edler von der Planitz, Kreishauptmann von Craushaar, Amtshauptmann Dr. v. Pf 1 ugk , Graf und Edler Herr zurLippe-Biesterfeld-Weissenf eld, Kammerherr Dr. von N os ti tz-Wal 1 wi t z, Oberbürgermeister Dr. Kaeubler, Stadtverordnetenvorsteher Rechtsanwalt Dr. Herrmann, Stadtrat Droscha. Die sportliche Leitung der glänzend verlaufenen Flugwoche lag in den Händen der Herren Major von Funcke, Hauptmann Verworner und Dr. jur. von Schimpf f. Bereits am 15. September 1913 konnte der Flugstützpunkt seine praktische Bedeutung als Landungsplatz für Ueberlandflieger erweisen, als auf ihm Lt. Clemens mit Beobachter Oberleutnant Walther, auf einem militärischen Fluge von Posen nach Leipzig, durch Sturm und Regen zu einer Notlandung gezwungen wurden. _ Von den Flugplätzen. Von dem Flugplatz Leipzig. Der Flieger Gass er führte am 29. September auf einem D. F. W.-Doppel-decker einen 3 Stundenflug aus. Der Start erfolgte morgens 5:58 mit Lt. v. Pos er als Beobachter. Nachdem Gasser in 15 Minuten 800 m Höhe erreicht hatte, flog er nach Halle und zurück und dann weiter Uber die Städte Cöthem Bernburg, Landsberg, Bitterfeld. Infolge des dichten Nebels verlor der Flieger die Orientiernng und mußte 9:06 bei Seeben, Bez Halle, auf einem Rübenfelde zwecks Orientierung niedergehen. Der Rückflug nach Leipzig erfolgte abends bei starkem Gegenwind. Flugplatz Oberwiesenfeld. Eine beachtenswerte Leistung vollbrachte am 1. Oktober der Flieger Georg Schöner auf einem Otto-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor Schöner stieg morgens 8 : 10 mit einem Fluggast auf, um sich um die Stundenprämien der Nationalflugspende zu bewerben. Der Flieger flog Uber Freising, Moosburg nach Landshut, wandte sich dann über Pfaffenhofen, Weilheim nach Murnau und steuerte alsdann dem Ammer- und Starnbergersee zu. Gegen ijt\2 Uhr taf der Flieger wieder auf Oberwiesenfeld ein, landete jedoch noch nicht, sondern flog noch eine große Schleife nach Freising und wieder zurück Inzwischen hatte sich der morgens harmlose Ostwind zu hefligen Mittagsböen verstärkt, welche stellenweise die Stärke von 18—20 Sekundenmetern erreichten, und daher hohe Anforderungen an den Führer stellten. Schöner traf zum zweitenmale um 12:10 auf Oberwiesenfeld ein, wo alsdann um 12 : 20 die glatte Landung erfolgte — Der Flug erfolgte größtenteils über den Wolken in einer durchschnittlichen Höhe von 1400 m; die höchste erreichte Höhe betrug Uber Murnau 1800 m; die zurückgelegte Strecke etwa 450 km. — Schöner ist somit der erste Flieger, welcher auf Oberwiesenfeld einen 4 Stundenflug ausführte und hat für seine Leistung einen Preis von 6000 M. aus der Nationalflugspende zu erwarten. Am selben Tage unternahm auch der Flieger Erich Scheuermann auf einem Otto-Doppeldecker einen in gleicher Weise ausgeführten 4 Stundenflug, der gleichfalls der 6000 M.-Prämie der Nationalflugspende galt. Vom, Jiodeusee. 7 Stunden mit einem Fluggast um einen Dauerpreis der Nationalflugspende flog am 10. Oktober der Feldpilot Paul Ehrhardt aus Saarbrücken, der erst am 22. September d Js. seine Pilotenprüfung auf einem Wasserdoppeldecker des Flugzeugbau Friedrichshafen bestanden hatte. Ehrhardt flog von 10:27 vormittags bis 5 : 27 nachmittags ohne Zwischenwasserung. Die größte erreichte Höhe war 1450 m. Die Nutzlast des Flugzeuges betrug 441 Kilo, davon die beiden Flieger mit 159 Kilo und 282 Kilo Betriebsmaterial. Das Abwassern erforderte trotz der großen Belastung nur 20 Sekunden. Zum Betriebe diente ein 135 PS N A. G.-Motor mit Reschke-Schraube. Ehrhardt hat damit den deutschen Rekord im Flug mit einem Fluggast geschlagen und den Weltrekord im Hug mit einem Fluggast, der auf sieben Stunden 45 Minuten steht, nahezu erreicht. Fernßilge. Döberitz - Hamburg—Döberitz. Am 29. September 3:47 vormittags flog Lt. v. Hi dessen mit Oberlt. Drexel in Döberitz ab und landete 5:42 auf dem Flugplatz Fuhlsbüttel bei Hamburg. Der Rückflug erfolgte am 1. Oktober. Von Darmstadt nach Straßburg flog am 6. Oktober der Fliegersergeant Trübbel von der Darmslädter Fliegertruppe mit Lt. Müller als Beobachter. Der Rückflug erfolgte am gleichen Tage nachmittags. Die Flugdauer betrug hierbei nur 2 Stunden. 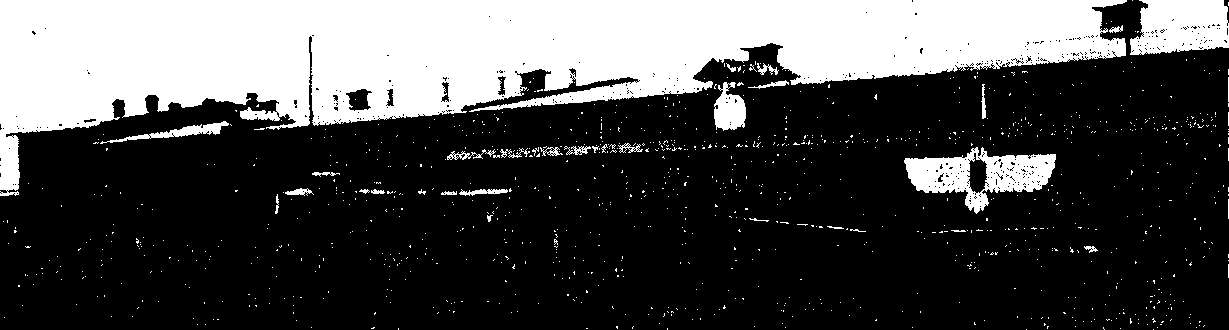 Flugzeughallen vom '^Flugstützpunkt Baatzen'JS Seite 807) Von Berlin nach Kopenhagen flog am 12. Oktober Reiterer auf 100PS Etrich-Mercedes-Taube. Reiterer stiegt.8 : 22 auf dem Flugplatz Johannisthal mit Hauptmann Neu mann als Beobachter auf, überflog 10:45 Rostock in großer Höhe, weiter die Ostsee und landete auf dem Flugplatz bei Kopenhagen um 12: 44. Reiterer sowie sein Beobachter wurde von der dänischen Militärverwaltung aufs lebhafteste begrüßt. Hierauf führte Reiierer nochmals einen Höhenflug in 1400 m Höhe aus. Seine Leistung wurde von der dänischen Aeronautischen Gesellschaft durch Ueberreichung eines Ehrenbechers gewürdigt. Von Königsberg nach Berlin flog am 12. Oktober Freindt auf Jeannin-Stahltaube mit 100 PS 6 Cyl. Argus. Der Start in Königsberg erfolgte 7:45 vorm. Nach erfolgter Zwischenlandung in Küstrin um 12:00 zwecks Aufnahme von Benzin, erfolgte der Weiterflug 3:00 nachm. Johannisthal wurde 3:56 erreicht. Von Berlin nach Weimar flog am 12. Oktober Gruner auf Harlan 100 PS Argus. Weimar wurde nachmittags 3 Uhr nach einer Zwischenlandung in Coswig erreicht. Wettbewerbe. Der italienische Wasserflugzeug-Wettbewerb. In der Zeit vom 3. bis 8. Okt. fand an den Oberitalienischen Seen ein Wasserflugzeug-Wettbewerb statt. Am 5. Okt. begannen die Vorprüfungen, bei welchen die Flugzeuge in 30 Min. auf 500 m Höhe steigen mußten, ferner war ein Höhenflug von 1000 m Höhe auszuführen. Die Hauptprüfung bestand aus einem Geschwindigkeitsflug über zwei Etappen. Die Flugprobe der 1. Etappe am 6. Okt. führte Uber Lecco, Treverico nach der Adda-Mündung, dem Po entlang über Cremona, Piazenza nach Pavia. Von den für den Geschwindigkeitsflug eingetragenen Wettbewerben starteten: Chemet (Borel) Hirth (Albatros) Landini (S. I. A.) Garros (Moräne Saulnier) Leon Moräne (Moräne Saulnier) Fischer (Henri Farman-Doppeldecker) Divetain (Borel) Für die 230 km lange Strecke benötigte Leon Moräne (Moräne Saulnier) 1:57:31 Chemet (Borel) 2:23:33 Hirth (Albatros) 2 : 03 : 44 Fischer (Farman) 2:45:15 Am 7. Oktober war der Startplatz in einem undurchdringlichen Nebel gehüllt. Es starteten : Chemet (Borel) 7 :59: 9 H. Hirth (Albatros) 8:51 :54 Leon Moräne (Morane-Saulnier) Fischer (H. Farman) 8:57:54 8:21 :53 Die 2. Etappe wurde zurückgelegt wie folgt: Hirth in 1:28 : 06-1 Fischer in 1 :49: 42-1 Garros in 1:41 :57-3 Dieses außerordentlich günstige Resultat hat begreiflicherweise unsere westlichen Nachbarn in große Erregung versetzte. Umsomehr da Hirth nur eine 100 PS starke Maschine verwendete im Gegensatz zu Garros mit einem 160 PS Motor. Die von Hirth verwendete Maschine ist die unsern Lesern bekannte siegreiche Albatros-Maschine vom Wasserflug Bodensee. Es war die einzige Maschine, die ein Fahrgestell besaß. Leider brachte Hirth sich durch eine Unvorsichtigkeit selbst um seine Chancen. Statt auf 500 m, flog er 800 m hoch. Hier ging ihm das Benzin aus, so daß er im Gleitflug vor der Ziellinie niedergehen mußte. Der Preis wurde daher von der Sportleitung nicht Hirth sondern Garros zugesprochen. In der Begründung wurde ausgeführt, daß Hirth entgegen den Bestimmungen in der Nacht vorher seinen linken Schwimmer an seinem Apparat gewechselt habe. Ferner habe Hirth den Höhen-Prüfungsflug wegen Benzinmangels im Gleitflug vor der Ziellinie aufgeben müssen. Ein Bayrischer Militärflug-Wettbewerb findet in der Zelt vom 19. bis 20. Oktober statt. Zugelassen sind Offiziere der deutschen Armee und Marine und Unteroffiziere des Kgl. Bayr. Fliegerbataillons. Die Teilnehmerzahl ist auf 22 Offiziere und 6 Unteroffiziere beschränkt. Patentwesen. Flugzeug mit schwingbaren Tragflächen.*) Für die Flugzeuge sind bereits mehrfach Konstruktionen mit schwingbaren Tragflächen vorgeschlagen worden, einmal, um den Platzbedarf der Maschine im Schuppen, auf der Straße usw. durch Zusammenklappen der Tragflächen zu vermindern und im besonderen auch, um beim Fluge die Verstellung der Tragflächen für die Steuerung der Maschine nutzbar zu machen. Im letzteren Falle tritt eine Lagenänderung des sogenannten Druckmittelpunktes zum Systemschwerpunkt ein, die ein Kippen der Maschine zur Folge hat, das in besonderen Fällen allerdings zur Höhensteuerung der Maschine unmittelbar beabsichtigt ist, im allgemeinen aber eine gefährliche Begleiterscheinung bildet. Diesen Uebelstand beseitigt die Erfindung durch eine solche schwingbare Anordnung der Tragflächen, daß unabhängig von der jeweiligen Stellung der Flächen die erwähnte Verlegung des Druckmittelpunktes zum Systemschwerpunkt *)D. R. P. 254 704. Edmond de Marcay und Emile Moonen in Paris. No. M „FLUGSPORT." Seite 811 nicht eintritt, das Gleichgewicht also erhalten bleibt. Dieser Fortschritt wird durch die besondere Lagerung der Schwenkachsen erreicht, die an der Maschine so angebracht sind, daß sie schräg nach vorn unten aufeinander zulaufen. Abb. 1 Abb. 2 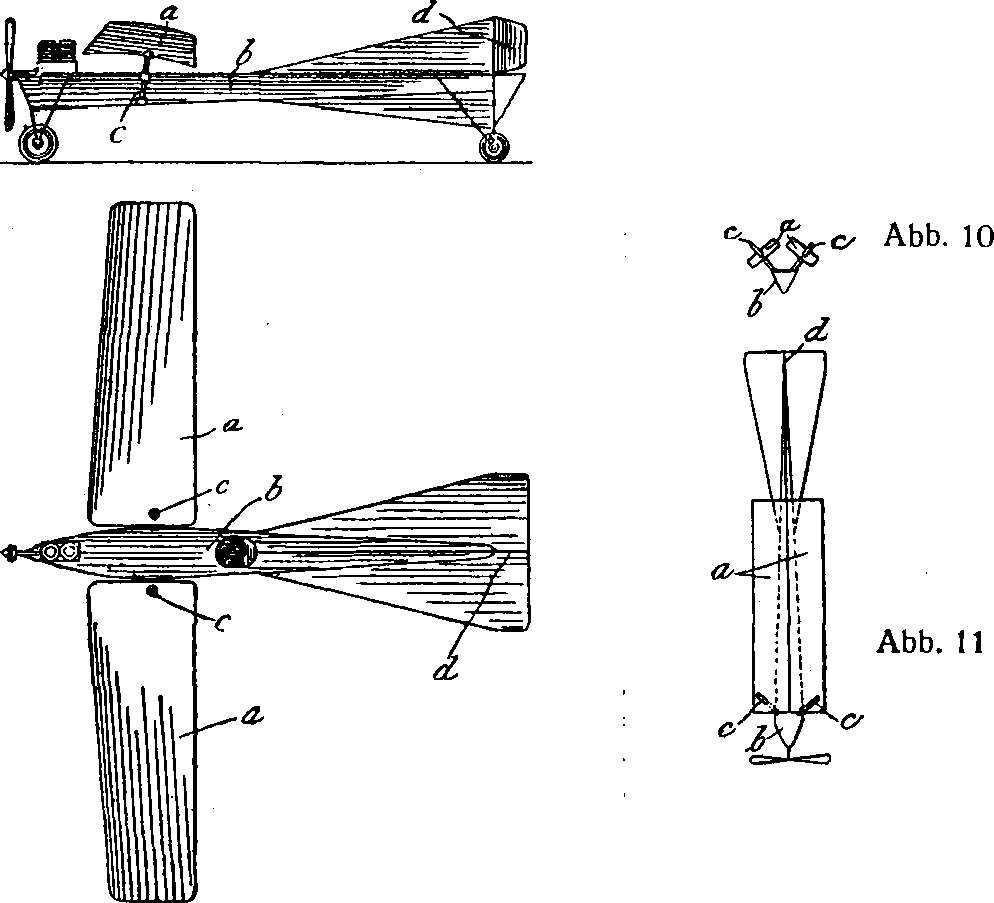 Abb. 3, 4, 5, 6 u. 7 Werden bei dieser Anordnung die Tragflächen nach vorn verstellt, so nimmt bei richtiger Wahl der Achsenlagerung auch die Neigung der Flächen derart zu, daß die durch die Vermehrung der Tragflächenneigung und durch die Verschiebung der Tragflächen nach vorn hervorgerufene Verlegung des Druckmittelpunktes so groß ist, daß bei der durch das Vorwärtsschwh:gen der Tragflächen zugleich hervorgerufenen Verlegung des Schwerpunktes nach vorn das Gleichgewicht gewahrt wird. Bei RUckwärtsschwingen der Tragflächen wird ihre Neigung geringer, und es tritt die vorbeschriebene Wirkung ein, nur daß die Bewegung der Druckmittelpunkte an den Tragflächen entgegengesetzt den oben beschriebenen gerichtet ist. Auf der Zeichnung ist die Erfindung in einem Ausführungsbeispiel an einem Eindecker dargestellt und zwar zeigt Abb. 1 die Flugmaschine von der Seite gesehen, die Abb. 2 und 3 den Grundriß und die Vorderansicht hierzu und Abb. 4 und 5, 6 und 7, 8 und 9, 10 und 11 paarweis zusammengehörende schematische Ansichten, in denen die Flugmaschine von vorn und oben gesehen in vier verschiedenen Stellungen ihrer Tragflächen dargestellt ist. Die Tragflächen sind an dem Gerüst mittels Achsen befestigt, und zwar so, daß die Flächen nicht, wie bisher üblich, normal zu ihnen stehen, sondern mit ihnen einen Winkel bilden, der dadurch entsteht, daß die Schwingachsen c zur senkrechten Mittelebene des Flugzeuges schräg nach vorn unten aufeinander zulaufen. In der Flugrichtung gesehen, bilden die Schwingachsen also ein V, dessen Spitze nach unten und vorn gerichtet ist. Die Neigung der beiden Achsen und die Anordnung der Flügel an ihnen ist im übrigen derart, daß die letzteren in ihrer üblichen normalen Neigung und Stellung zur Flugrichtung stehen und die eine Tragfläche in der Verlängerung der anderen liegt. Hierdurch wird, wie eingangs beschrieben, erreicht, daß sich die Flügel a bei einem gemeinsamen Ausschwingen zwecks Höhensteuerung nach vorn unter einer größeren Neigung zur Flugrichtung einstellen bezw bei einem Ausschwingen nach hinten unter geringerer Neigung/ wofür im ersten Fall die Abb. 4 und 5, im zweiten Fall die Abb. 6 und 7 als Darstellung in Betracht kommen. Verstellt man die eine Tragfläche zwecks Stabilisierens nach vorn und die andere nach hinten (Abb. 8 und 9), so stellt sich die erstere mit einer größeren die letztere mit einer geringeren oder evtl. sogar negativen Neigung hinsichtlich der Flugrichtung ein. Wenn man schließlich die Tragflächen vollständig nach hinten schlägt, so kann man, wie dieses die Abb. 10 und 11 veranschaulichen, ein ganz enges An-einanderlegen der Flügel erreichen. Zweckmäßig verbindet man die Tragfläch'n auch noch mit einem Richtungssteuer, wie dieses beispielsweise in den Abbildungen bei d dargestellt ist. Patent-Anspruch. Flugzeug mit schwingbaren Tragflächen, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwingachsen der Tragflächen schräg nach vorn unten aufeinander zulaufen, so daß beim Schwingen nach vorn die Schräglage der Tragflächen sich vergrößert, beim Schwingen nach hinten aber sich verkleinert. Rumpf für Flugzeuge.*) Die Erfindung betrifft einen Rumpf für Flugzeuge, der einen möglichst geringen Stirnwiderstand hat. Zu dem Zwecke sind zunächst bekannterweise Führer, Motor und alles zum Betriebe Notwendige in einem fisch- oder torpedo-förmigen Körper eingeschlossen. Zur weiteren Verminderung des Luftwiderstandes und zur Erzielung eines stabilisierenden Querschnittes sind flossenförmige Hohlkörper an denselben angesetzt, die als Fahrgestell ausgebildet sind, bezw. die Umhüllung eines solchen bilden. Auch können die Flossen, in einem passenden Abstände voneinander angeordnet und entsprechend groß gewählt, zur Aufnahme der Beine der Insassen dienen, um zu erreichen, daß die Insassen schon bei geringer Rumpfhöhe in einem vollständig geschlossenen Räume sitzen. Abb. 1 zeigt einen Längsschnitt, Abb. 2 einen Querschnitt durch den Rumpf nach Linie A-B der Abb. 1. *) D. R. P. Nr. 264 379. Max Winckelmann, in Kiel. Das Wesen der Erfindung ändert sich nicht, wenn die beiden Flossen zu einer denselben Zwecken dienenden vereinigt werden Abb. 1 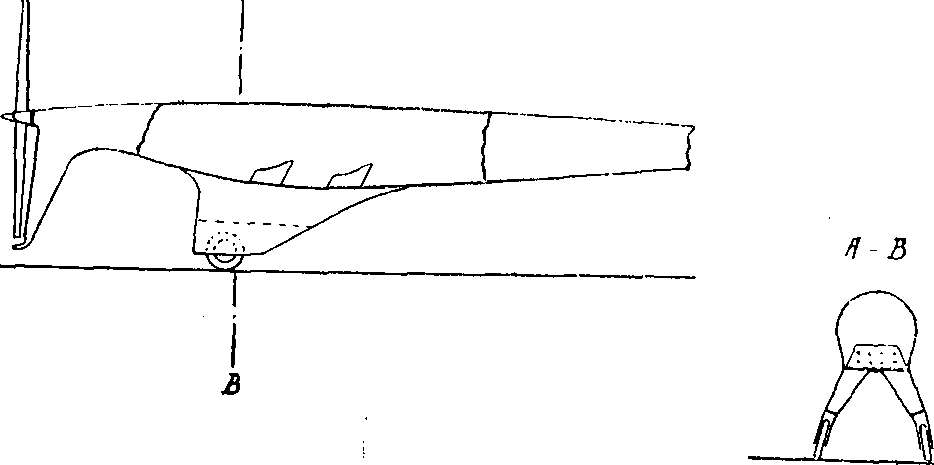 Abb. 2 Patent-Anspruch. Rumpf für Flugzeuge," dadurch gekennzeichnet, daß an denselben flossen-förmige Hohlkörper von beliebiger Form angesetzt sind, die als Fahrgestell ausgebildet sind, bezw. die Umhüllung eines solchen bilden, und die auch zugleich zur Aufnahme der Beine der Insassen dienen können. Aus federartigen Einzeltragflächen zusammengesetzte Tragfläche für Flugzeuge.*) Der Gegenstand der Erfindung betrifft eine elastische Tragfläche für Flugapparate, welche aus einzelnen federartig ausgebildeten Tragflächen in bekannter Art zusammengesetzt ist. Die Erfindung besteht in der Konstruktion der Einzeltragflächen. In Abb 1 ist eine solche Einzeltragfläche von unten gesehen^ dargestellt; a ist die Tragfläche, die von einer aus Uhrfederstahlband hergestellten Mittelrippe getragen wird, welche aus dem senkrechten Steg a' und dem horizontalen Steg a" besteht, welche beiden Stege durch Niete b in einfacher T-Trägerform Abb. 1 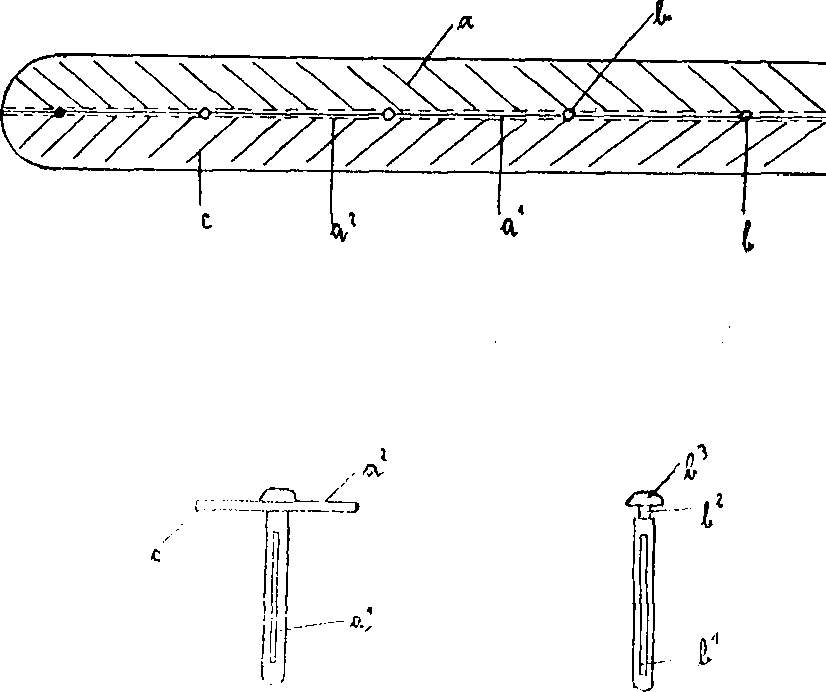 l Abb. 2 a Abb. 2 b *) D. R P. Nr. 2(i3?32. Max Richter in Berlin. miteinander verbunden sind. Die Niete b 'Abb. 2 a und 2b) neben schmale Schlitze b', durch welche der senkrechte Steg a' gesteckt ist, während der Schaft b" durch ein in den horizontalen Steg a" gebohrtes Loch ragt und oberhalb a" zum Nietkopf b'" ausgebildet ist. Durch diese Konstruktion ist eine widerstandsfähige und glexhzeitig sehr elastische Mittelrippe der Tragfläche geschaffen. Ferner ist die Elastizität der Mittelrippe noch dadurch erhöht, daß die in den Nieten befindlichee Schlitze b' es gestatten, daß der senkrechte Steg a' beim Durchbiegen der Mittelrippe sich in dem Schlitz b' verschieben kann. Die Stoffbespannung einer jeden Einzeltragfläche wird durch hochkant in den Stoff eingelegte Querrippchen c, die im Winkel von etwa 45" zu der Mittelrippe liegen, unterstützt. Diese Querrippchen c sind ebenfalls aus Uhrfederstahlband hergestellt. Im Gegensatz zu dem bisher angewandten und bekanten Konstruktionen, Querrippchen in flacher Anordnung in den Stoff einzulegen, sind, wie schon oben erwähnt, die Querrippchen c hochkant in den Stofl eingelegt, um die Stoffbespannung straffer zu machen, da die im Winkel stehenden Querrippchen dirch ihre Federkraft den Tragstoff spannen. Patent-Anspruch: Aus federartigen Einzeltragflächen zusammengesetzte Tragfläche für Flugzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittelrippe der Einzeltragflächen aus zwei T-förmig zusammengesetzten Uhrfedet Stahlbändern, die sich gegeneinander verschieben können, gebildet wrd, wobei der Stoff außerdem durch hochkant gestellte, schräg zur Mittelrippe liegende Querrippchen aus Uhrfednrstahlband gehalten wird. 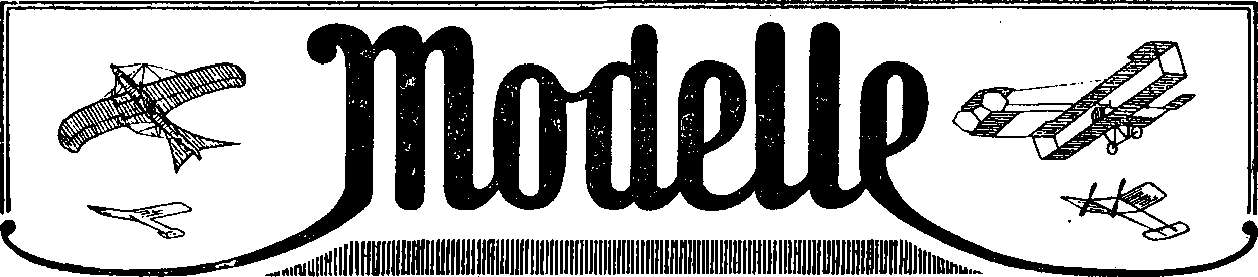 Wölbung von Tragflächen für Modelle. Vielen von denen, die sich mit dem Bau von Flugmodellen beschäftigen, werden beim Bau von Tragflächen, die Herstellung einer Wölbung Schwierigkeiten gemacht haben. Viele werden nun, um diese Schwierigkeit zu umgehen, die Flächen ganz einfach (d. h. ohne Wölbung) hergestellten Gewiß können auch diese Modelle, \yenn sie sonst richtig konstruiert sind, fliegen, aber die Verminderung der Flugweite wird eine ganz beträchtliche sein. Es kann sich aber auch darum handeln, genaue Copien von großen Flugmaschinen herzustellen, und dann macht es einen schlechten Eindruck, wenn die Flächenwölbung unberücksichtigt gelassen wird. Wie baut man aber Tragdecken mit Flächenwölbung? Manche machen es zum Anfange so, daß sie die Wölbung durch entsprechendes Spannen von Fäden erreichen. Das ist aber unpraktisch, da sich diese Fäden leicht lockern und die Wölbung verloren geht. Um Tragdecken mit dauernder Wölbung zu erhalten, verfährt man auf folgende Art und Weise: Man zeichnet auf einen Bogen Papier den man auf Holz (Reißbrett) befestigt hat, in natürlicher Größe die Form des Flügels. Dieser ist in Abb. I als Rechteck (A, B, C, D) gezeichnet. Zur Versteifung wird man Spieren aus Holzdraht verwenden, die in ihrer Richtung parallel zu den beiden schmalen Seiten sind, und deren Anzahl man beliebig wählt. Diese zeichnet man in der gewünschten Lage ein. (Abb. 1 a a', b b', c c', dd', e e'). Zur Versteifung, besonders aber zur Wölbung ist ein parallel zu den beiden langen Seiten führendes Holz notwendig, das man als Gerade im Umfange des 2. Drittels einzeichnet. (Abb. 1 E F) Abb. 2 zeigt, wie die Tragdecke von der Schmalseite D A aus, aussehen soll. Ebenso würde sie natürlich aussehen bei einem Querschnitte durch a'a, b b, c'c, d'd, e'e und C B. (Abb 1) Abb. 2 zeigt also die Form dieser Spieren und zugleich auch einige zur Konstruktion bei jeder Spiere notwendige Hilfsmittel, nämlich die hier als Rechtecke erscheinenden Holzstäbe P und Q, von denen P = E F ist und Q darunter liegt und die Nägel N. Der Holzstab Q dient dazu die untere Spiere x zu zwingen, je nach der Stärke von Q, einen mehr oder weniger großen Bogen nach oben zu beschreiben. Auf diesem Bogen x befindet sich die zweite Gerade (Holzstab) P, die die obere Spiere y zwingt einen noch größeren Bogen nach auswärts zu beschreiben Die Spieren sind aus Holzdraht und werden durch die Nägel N, die sich also am Anfang und am Ende von ihnen befinden, festgehalten, bis sie mit den Hölzern D C, A B nnd P = E F fest verleimt sind. Mit Q darf aber keine Spiere verleimt werden, ebenso wenig wie mit den Nägeln N bei jeder der Spieren. Wenn der Leim fest ist, wird der Holzstab Q einfach heruntergenommen und die Nägel N, die eingeschlagen wurden, um die Spieren die sich
a b 1 d e 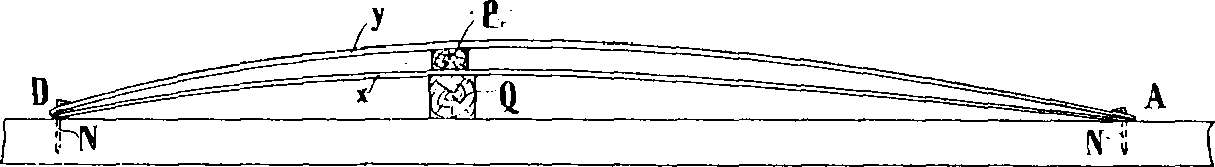 Wölbung von Tragßädien für Modelle. einer Krümmung widersetzten, in ihre Lage zu zwingen, mit einer Zange herausgezogen. Der Leim an allen Verbindungsstellen muß sehr fest sein, am besten und billigsten ist es, man nimmt Tischlerleim. Ist der Leim trocken, so wird die Tragdecke ihr Profil nicht ändern. Will man bei Flugmodellen die Festigkeit der Tragdecken erhöhen, so leimt man in den in Abb. 1 sichtbaren Rechtecken Stücke von Holzdraht so ein, daß sie die Diagonalen in diesen bilden. (Siehe Abb. 1 Rechteck D E H a'). Für die Spieren habe ich es für vorteilhaft gefunden Holzdraht [das ist 1-2 mm starkes Holz) zu verwenden. Für E F = P und für A kann such stärkeres Holz benutzt werden. Zur Bespannung kann man dünnes Papier (von der Qualität des Flühstückpapiers) nehmen. Ist dieses aufgeleimt, so überstreiche man es mit Wasser, so daß es sich sehr straff zusammenzieht L. R. Lehmann, Chemnitz. Eine Flugzeugmodell-Ausstellung veranstaltete in der Zeit vom 9. bis 12. Oktober der Verein für Luftfahrt (E. V.) Darmstadt. Die Ausstellung hat wider Erwarten eine sehr große Ausdehnung angenommen und zwar zeigte das Programm 260 Nummern. Ferner noch 40 Ausstellungsobjekte und Stände von an dem Modellwcsen interessierten Firmen. Unter den 260 Modellen befanden sich ganz hervorragende Arbeiten. Es würde zu weit fuhren die Einzelheiten aufzuführen. Den ersten Preis für das am saubersten ausgeführten Modell erhielt Schmid in Bischofsheim. Für die originellste Idee Ell, Rastatt. Herr Prof. Gutermuth Vors. des Preisgerichtes wies in seiner Schlußansprache mit Recht auf die große Bedeutung des Modellflugwesens hin. In der Flugtechnik sind noch große Auigaben zu lösei es ist daher erforderlich, daß sich unsere Jugend schon frühzeitig mit der umfangreichen schwierigen Materie befaßt. Ferner trägt das Modellwesen dazu bei Interesse für das Flugwesen in weitesten Kreisen zu erwecken. Flugzeugmodell-Ausstellung und Wettfliegen Gelsenkirchen-Essen-Rotthausen. In der Zeit vom 21.—28. Sept. hielt die Westd. Fluggesellschaft,  Von dem Modellv/ettfliegen in Gelsenkirchen. Die Wettbewerber mit ihren Modellen am Start. 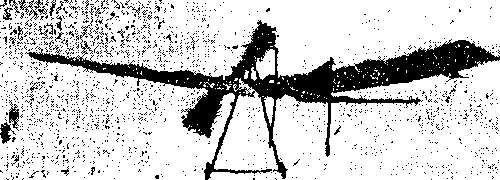 Von dem Modelhvettfliegen in Gelsenkirdien. Start des E. K,- A. Modells eine reich beschickte Flu^zeugmodell-7' Ausstellung ab, die ca. 320 Nummern V aufwies, unter denen sich rund 160 flugfähige Modelle befanden. In der Mehrzahl waren solche Modelle ausgestellt, die von Knaben und Jünglingen angefertigt waren. Die flugfähigen Modelle besaßen' größtenteils Gummitnotore, auch waren eine Anzahl mit Preßluft- und Kohlensäuremotoren vorhanden. Die Ausstellung war untergebracht in einer 80:15 großen hell erleuchteten Halle Der Besuch war ein recht guter und zeigte das große Interesse, das in hiesiger Gegend für den Flugsport voi "landen ist. Den Schluß der Ausstellung bildete ein Modellwettfliegen, das bei scharfem Ostwinde nachmittags 3 Uhr seinen Anfang nahm und bis zum Dunkelwerden dauerte. Die besten Leistungen fielen auf:T od t-Gelsenkirclien,Bonstert-Dorsten, W R e th e 1-Essen, K. H e r-doj o st-Gelsenkirchen, Biermann-Essen, K 1 uge-Bochum, Manns-Bochum. Für die besten Flüge waren Ehrenpreise und 600M. an Geldpreisen ausgesetzt. Während die mit Gummimotoren angetriebenen Modelle recht gute Leistungen aufzuweisen hatten, gelang es keinem der mit Motoren versehenen Flugzeuge die vorgeschriebene Mindesthöhe von 30 m zu überfliegen. Frankfurter Flugmodell-Verein. Da das Gelände an der Rosenausstellung bebaut wird, können dorten keine Uebungsflüge mehr stattfinden. Zu diesem Zweck steht uns nun das Gelände zwischen Festhalle und Polizeipräsidium an der Hohenzollernstraße zur Verfügung. Das erste Uebungsfliegen findet Sonntag den 19. Oktober vormittags ab 8 Uhr statt. Die Mitglieder haben jedoch nur gegen Vorzeigung der Mitgliedskarte Eintritt Bei der Modellausstellung in Darmstadt erhielt Kopietz einen Ehrenpreis. Ferner erhielten Diplome: Specht, May, David, Wittekind, le Dous, Collin, Rompel, Welkoborsky, Kitzinger. Adolf Jäger, Carl Jäger, Fischer-Stuttgart, Koch, Wamhoff-Osnabrück und Ripper. Verschiedenes. In der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, Adlershof werden seit einiger Zeit interessante Belastungsprüfungen von Flugzeugflügeln mittels besonderer, hierfür geschaffener Einrichtungen durchgeführt. Die Wichtigkeit solcher Versuche haben verschiedene schwere Unfälle der letzten Zeit deutlich gezeigt und sie werden immer nötiger in dem Maße, als die Technik mit den wachsenden Anforderungen an nutzbare Tragfähigkeit bestrebt sein muß, das Eigengewicht der Konstruktionen möglichst zu vermindern. Man verfährt dabei so, daß man die Flugmaschine auf den Rücken legt, den Rumpf unterstützt und die frei nach ;außen ragenden Flügel mit Sandschüttung so belastet, wie es dem Luftdruck im Fluge entspricht. Man steigert diese Belastung dann immer weiter bis der Bruch eintritt. Während des Vorganges geben die zunächst auftretenden Deformationen die sorgfältig gemessen werden, schon wichtige Fingerzeige für die Beanspruchung der einzelnen Konstruktionsglieder, Verspannungen usw. So erhält man ein wertvolles Erfahrungsmaterial, auf das man später noch bei der Beurteilung anderer Konstruktionen zurückgreifen kann und das gesicherte Grundlagen für eine rationelle Konstruktionslehre gibt. Nur auf diese freilich recht kostspielige Weise kann es gelingen, möglichste Leichtigkeit mit unbedingter Sicherheit zu vereinigen. Die theoretische Berechnung allein vermag gegenüber dem komplizierten und vielgliedrigen Aufbau der Flügel nicht die volle Sicherheit zu geben. Der Verein Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller verlegt seine, für seine Zwecke räumlich zu klein gewordenen Geschäftsräume von der Potsdamerstraße 121 H nach der Straße Unter den Linden 12 in den Neubau des Bankhauses Bleichröder. Literatur.*) Vogels Karte des Deutschen Reichs und der Alpenländer im Maßstäb 1:500 000, ausgeführt in Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neu bearbeitet und erweitert unter Leitung von Prof. Paul Langhans. 33 Blätter in Kupferstich. Lieferung 2: enthaltend die Blätter Hamburg und Triest Preis M. 3.—. Eine Probekarte, enthaltend je die Hälfte der Blätter Berlin und Wien wird Interessenten auf Verlangen kostenfrei zugesandt. Die Luftfahrt Ihre wissenschaftlichen Grundlagen und technische Entwicklung Von Dr. Raimund N i m f U h r in Wien. Dritte Auflage (15—22. Tausend), bearbeitet von Dr. Fritz Huth in Berlin. Mit 53 Abbildungen. 8. 1913. Geh. M. 1.—, in Leinwand geb. M. 1.25. Empfehlenswert zur Einführung in die Luftfahrt. *) Sämtliche besprochenen Bücher können durch die Expedition des „Flugsport" bezogen werden. Seite 818 „FLUGSPORT." Personalien. Generalmajor Schmiedecke jetzt Kommandeur der 2. Eisenbahn-Brigade in Hanau erhielt den Roten Adlerorden 1. Klasse mit Eichenlaub. Ltn Müllerkowsky Flugzeugführer bei der Marineflugstation, Putzig soll nach seiner Ausbildung als Fliegeroffizier zum Gouvernement Kiaulschou übertreten. 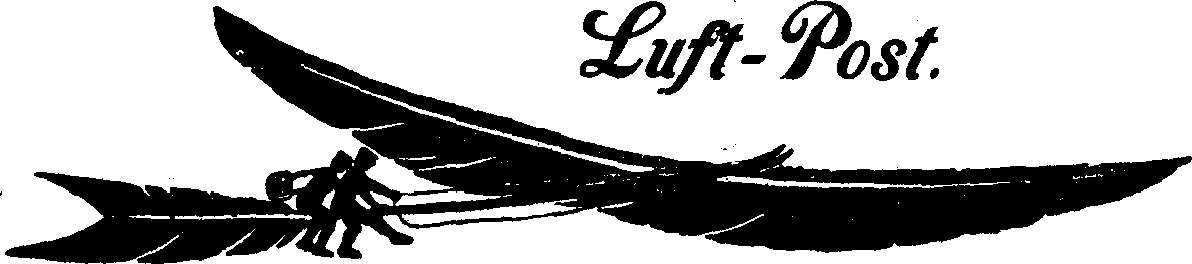 Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.) Neuhaas. Der Kreiselkompas ist von Anschütz & Co. erfunden worden und wird elektrisch angetrieben. Sein Gewicht beträgt 6 kg und die Umdrehungszahl des Rotationskompasses 20000 Umdrehungen pro Minute. Die Einführung wird durch den hohen Preis von 20000 M. bedeutend erschwert.  Letzte Nachrichten. Stoeffler legt 2150 km in einem Tag zurück. Eine hervorragende Leistung ist am 14. Oktober von Viktor Stoeffler auf einem Aviatik-Doppeldecker 100 Merc. ausgeführt worden. Er stieg in der Nacht um 12:06 in Johannisthal auf, landete in Posen 2:55 Uhr, flog um 6:45 weiter nach Mülhausen, das er ,1:20 Uhr mittags erreichte. Bis dahinwaren 1150 km zurückgelegt. Um den Weltrekord zu drücken fehlten noch 250 km. Stoeffler flog daher sofort wieder ab nach Darmstadt und landete 5:55 Uhr dortselbst. Hiermit war Brindejons Leistung um 20 km überboten. Stoeffler flog 5:57 wieder nach Mülhausen, wo er 7:15 Uhr landete 7:35 flog er wieder ab nach Darmstadt uud überflog Darmstadt um 10 Uhr, wo er von der Fliegerstation kontrolliert wurde; flog zurück nach Mülhausen und landete 11:55 Uhr bei Schlettstadt, also kurz vor Mitternacht, um sich seinen Flug durch die dortige Behörde bestätigen zu lassen. Mit diesem Flug hat Stoeffler einen Weg von 2150 km zurückgelegt. ^Dfe vereßrf. Sieger bitten wir ergebenst bei Berichten über Flugleistungen, Ueberlandfllige etc. den Datum sowie die Zeit ob vor- oder nachmittags ausführlich angeben zu wollen. Wir mußten in vielen Berichten die Zeiten herauslassen, da in denselben die genauen Angaben fehlten. Hochachtungsvoll Redaktion den „lluysport". Jllustrirte No. 22 technische Zeitschrift und Anzeiger 29. Oktober für das gesamte VoVtbwuS umaNj. „Flugwesen" pro,,hr/ unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Teief. 4557 nmt i. Oskar Ursinus, Civilingenieur. Tel.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag »Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. : Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 12. November. Was hat uns die Nationalf lugspende genützt? Lassen wir zuerst die maßgebendste SportpresseFrankreichs urteilen. „L'Auto" vom IS. Oktober schreibt: „Es scheint beschlossene Sache zu sein, daß die Flieger von jenseits des Rheins über uns triumphieren wollen. Ohne Trommel und Trompeten hat einer ihrer besten Piloten 2000 Kilometer zurückgelegt. Sicherlich zeigt dieser riesige Fernflug, daß die deutsche Fliegerei die Periode des Tastens überwunden hat. Ich kenne noch nicht den wunderbaren Apparat — einen Zweidecker — noch den Motor, der darin arbeitete, die solche Leistungen vollbringen ließen Man kann sich aber nur verbeugen vor diesem Erfolg einer Industrie, die leider nicht die unsrige ist." Das „Aero" vom 16. Oktober schreibt: „Nach einer langen, sehr langen Periode des Tastens scheint die Flugtechnik in Deutschland endlich in die praktische Periode übergegangen zu sein. Vor nur 8 Monaten wagten deutsche Offizier- und Privatflieger kaum 3 bis 400 Kilometerflüge. Heute kann Deutschland ernten, da es gesät hat. Das Blut der Helden hat den Boden gedüngt. Lange Luftreisen sind vollführt worden, man fliegt dort bei Nacht. Die Piloten sind kühn, und angesichts unserer Virtuosen vollführen sie Heldentaten. Wodurch ist dieser Eifer der deutschen Piloten hervorgerufen ? Unserer Ansicht nach ist es ganz natürlich ; die Preise der Nationa'flugspende treibt die einzelnen Piloten dazu, sich an Kühnheit gegenseitig zu überbieten. Die Flugtechnik bei unseren Nachbarn wird durch Markstücke ermutigt. Die langen Luftreisen multiplizieren sich in Deutschland und bald wird das Reich nicht mehr groß genug sein für die Reisen der Vögel jenseits des Rheins. (Flug Friedrich und Reichelt nach Paris, Stoeffler von Johannisthal nach Warschau, Hirth an den oberitalienischen Seen.) Gestern noch gelang einem deutschen Flieger eine wunderbare Leistung. Stoefflers Flug von 2200 km. Es ist dies ein Rekord und es gehört sich, daß man den Vollbringer desselben beglückwünscht. Durch diese wunderbare Reise stellt sich der deutsche Pilot unter die besten Flugmenschen jenseits des Rheins und man kann ihn nur dazu beglückwünschen." So sind wir in kurzer Zeit bescheiden und deutsch in den Besitz der größten internationalen Leistungen gekommen, außerdem sind 140 Feldpilotenprüfungen unter der Nationalflugspende vor sich gegangen. Zweckentsprechende Organisationen auf allen Seiten verbürgten diese Erfolge. — Wem gebührt der Dank? Dem geschäftsführenden Kuratorium der National-Flugspende, welches in bisher nicht dagewesener Weise, in enger Fühlungnahme mit den ersten Sachverständigen, verstanden hat, den richtigen Weg zu beschreiten. Die deutsche Flugzeugindustrie arbeitete mit großer Schaffensfreude gerne unter diesem Regime, ohne daß sich während dieser sicher nicht leichten Arbeit nach irgend einer Seite Beschwerden bemerkbar machten. Hierbei hat sich wieder bestätigt, daß in unserer Zeit alles, was auf Einzelbestrebungen hinausläuft, unfruchtbar ist. Nur eine feste Organisation aller in Betracht kommenden Faktoren mit gemeinschaftlichen Interessen konnte so schnell und mit so großen Erfolgen arbeitan und den deutschen Fliegern und Flugzeugindustriellen Gelegenheit geben ihre hohe Leistungsfähigkeit zu zeigen. Das deutsche Volk mag die oben angeführten Urteile unseres in der Aviatik leistungsfähigsten Nachbarn als öffentliche Quittung für seine Opferfreudigkeit betrachten. Dank unseren Fliegern! Dank unserer Flugzeugindustrie! Dank dem Kuratorium der Nationalf lugspende! Dank für das schöne Urteil Frankreichs! Stand der Flugleistungen um die Nationalflugspende: 2160 km Viktor Stoeffler (Aviatik) am 14 Oktober 1470 km Schlegel (Gotha-Mercedes-Taube) am 22. Oktober 1450 km Referendar Caspar (Hansa-Gotha-Taube) am 15. Oktober 1330 km Thelen (Albatros) am 14. Oktober 1200 km Viktor Stoeffler (Aviatik) am 16. September 1150 km Stiefvater (Jeannin-Stahl-Taube) am 16. September 1000 km (ca.) Werner W1 n t i n g (Rumpier 100 PS Mercedes-Taube) am 17. Oktober.  Viktor Stoeffler's Weltrekordflug. 2160 km in 24 Stunden. Der deutsche Rekordiiieger Paul Viktor Stoeffler hat sich über seinen denkwürdigen Flug von einem befreundeten Journalisten befragen lassen und folgende lebendige Schilderung gegeben. Was ich angefangen, pfleg9 ich durchzuführen. Ich wollte den französischen Rekord überbieten. Mit meinem Flug nach Warschau langte es nicht. Also mußte eine größere Reise unternommen werden. Leider konnte ich, infolge meiner Verpflichtungen auf der Johannisthaler Flugwoche, die damaligen schönen Tage nicht ausnützen. Doch ließen die Wettervorhersagen noch immer Hoffnung übrig. Dienstag um Mitternacht steht die Aviatik-Maschine startbereit. Benzin habe ich 445 Liter an Bord, der Motor ist gründlich im Schuß, Karten, Instrumente sorgfältig revidiert. Ich fühle mich äußerst gut aufgelegt und bin gewillt das Letzte an das Gelingen dieses Fluges zu setzen. Es kann nicht fehlgehen diesmal. Ich will ... . Die Wetternachrichten aus der europäischen Südwestecke mit den bösen Tücken des Biscayagolfes sind schlechter als ich erwartet. So muß ich den beabsichtigten Flug nachBiarritz und Lissabon aufgeben. * 12,05 Uhr ist der brave Mercedes auf vollen Touren, Los gehts! Rußland entgegen. Ich suche gleich große Höhen auf. Unter mir liegen die weiten Forsten der Mark, nur hin und wieder von Seen durchbrochen. In ruhiger Fahrt gehe ich darüber weg. Keine Böe rüttelt mich auf. Nur der russische Ost macht mir zu schaffen. Ganz bös heult er um meinen Doppeldecker und läßt das Sausen des Propellers zu einem infernalischen Geheul auswachsen. Außerdem spottet er dem dicken Wollzeug, in das ich mich eingemummt habe und sticht bis auf die Haut. Sonst wäre dieser Anfang der Reise ein Ideal gewesen. So ein wundervolles märchenhaftes Dahingleiten über das weite schlafende Land! Posen habe ich nach zwei Stunden erreicht. Ich wollte den Flugplatz ohne Landung überfliegen, aber die Kälte zwang mich doch auszusetzen und mich etwas zu erholen. Ich finde liebenswürdige Aufnahme, betaste meinen Mercedes und komme auch wieder zur Wärme. Nach knapp halbstündiger Pause bin ich schon wieder über der ostdeutschen Residenz und steuere mit Rückenwind Berlin zu. Wesentlich besser fliegt es sich so. Unter mir huschen Dörfer und Städtchen, Wälder und Felder mit einer erfreulichen Geschwindigkeit weg. Nach kaum zwei Stunden kündet ein riesiger Lichthaufen am Nachthimmel Groß-Berlin. Also wären die ersten 500 Kilometer so ziemlich erschöpft. Vivant sequentes! Doch was ist das? Täusche ich mich? Nein, der Motor arbeitet unregelmäßig. Ich beuge allen Eventualitäten vor. Gleitflug. Glück habe ich, Ich finde einen passenden Landungsplatz und ebenso sehneil auch den „Krankheitsherd" meines Motors. Ein unwesentlicher Magnetdefekt. Der Schaden ist rasch geheilt. Und froh steuere ich Johannisthal zu, wo ich kurz nach fi Uhr meinen Freunden die Hand schütteln kann. * Langsam zwingt sich die Herbstsonne durch die Morgennebel. Frische Winde bewegen dieses Trugmeer, reißen da und dort eine Lücke und dann erhasche ich schnell ein klein Stückchen der „Unterwelt". Ich steuere direkt auf Halle zu. Es liegt ganz im Nebel, aber ich fühle die Nähe an den schaukelnden Bewegungen der Maschine. Auf und ab rollt sie. Die Vertikalböen machen mir bös zu schaffen. So geht es eine gute Weile. Der Thüringer Wald hat seine Mucken. Als ob mich die sagenhaften Waldgeister zu sich holen wollten, reißt es mich oft mit unsichtbaren Riesenhänden nach unten. Und wieder andere, die besonders fidel sind, werfen mich hoch. Ein wahres Fangballspiel . . . Herrlich ist jetzt die Sonne erstanden und hat die ganze Welt vergoldet. Da wachen die Lebensgeister wieder auf, die unter dem Druck der Nacht und der Kälte beinahe abgestorben sind. Jung ist der Mut und der zähe eiserne Wille ist im Nu wieder da. Ein üppiger Garten breitet sich jetzt, das Frankenland, beim weinfrohen Würzburg überquere ich den Main. Im Schwabenland wird die Sache gemütlich. Ich steuere direkt auf die Hauptstadt zu und genieße nun Bilder erhabenster Schönheit. Klar breiten sich vor mir die Alpen, schneegekrönt. Jede Zacke, jeden Gipfel kann ich erkennen. Von Bern bis weit nach Tirol. Es ist doch etwas bequemes um eine solche Alpenaussicht vom Flugzeug aus. Da braucht es kein Gekraxel und der Führer ist auch überflüssig . . . Ueber Stuttgart fang ich ein paar Glockenschläge auf. Mittagsgeläut. Guten Appetit, meine Herrschaften . . . Mir knurrt auch der Magen. Doch dauert es noch etwas, bis ich ihm seinen Gefallen getan habe. Vor mir liegt noch ein böses Stück Weg. Der Schwarzwald mit seinen Schluchten. Da lauern immer hinterlistige Winde. Ich schraube mich möglichst hoch und komme auch gerade noch mit einem „blauen Auge" darüber weg. Doch ist die Unbill rasch vergessen. Vor mir leuchtet schon der Rhein und bald sichte ich auch Mülhausen und den lieben Habsheim er Flugplatz Wieder daheim. * Festlicher Willkomm in Habsheim! Vier Wochen bin ich jetzt von da weg, seit ich nach Warschau abgeflogen bin. Es gibt allerlei zu erzählen. Aber ich bin nicht recht dazu aufgelegt. 2000 Kilometer will ich schaffen Ich dränge, würge hastig mein Essen herunter, ein Schluck Kognak, damit die Lebensgeister wieder „auf Touren" kommen. Dann geht es weiter. Servus! Durch das liebe Elsaß. Nach Darmstadt. Genau kenne ich diese Route. Allein und in lieber Gesellschaft bin ich schon darüber hinwog geflogen Freundlich lachen mir die kleinen Weindörfer im Kranz der Reben und herbstlichen Wälder entgegen. Die kenne ich alle. Und jetzt werden die Erinnerungen mit Macht wach. An all die Jugendstreiche der Sturmund Drangjahre. So verstreicht die Zeit. An Colmar bin ich rasch vorüber. Links winkt schon die Hohkönigsburg, aufrecht und trutzig. Schlettstadt. Und dann schält sich aus Rauch und Dunst die Vaterstadt. Straßburg, du wunderschönes Nest. Wie ich dich liebe und glücklich bin. Zur Begrüßung gehe ich im Spiralgleitflug auf 200 Meter nieder, begrüße das Vaterhaus und zolle auch den Eltern den Dank, die schon da unten tief unter Cypressen und Tannen ruhen.....Die Straßburger sind alle auf den Beinen. Sie haben erfahren, daß ich unterwegs bin und reagieren stürmisch auf meine Grüße. Unmittelbar hinter der Stadt schneide ich den Rhein und steuere über Karlsruhe, Rastatt auf Darmstadt zu. Rechts der Odenwald ist mir ein sicherer Führer. Links bauen sich schwere Dunstwände auf, Mannheim und Ludwigshafen, die süddeutschen Industriezentren. Holter, dipolter zwängt sich der Neckar durch den Berg, zwischen Heidelbergs ehrwürdigen Häusern und seinem epheuumsponnenen Schloß .... * Brindejonc ist geschlagen. Ueber 1400 Kilometer liegen hinter mir. Freudig haben mich die Fliegeroffiziere in Darmstadt begrüßt. Sie kannten mich alle von früher und freuten sich herzlich mit mir. Nur eine Minute blieb ich bei ihnen. Dann zog ich wieder davon. Nochmals Mülhausen entgegen. Vom Rhein zieht schwerer Nebel auf und vermählt sich rasch mit den Wolken am Himmel. Unsicher leuchtet hier das Abendrot. Erst später bricht es machtvoll durch. Ergreifend ist der Abschied dieses Tages, dem ich ja eine besondere Bedeutung geben wollte. Zäh ringt er mit der Nacht und überläßt ihr nur unwillig das Regiment .... Unten flammen Feuer auf. Der Polygon in Straßburg. Sie haben also an mich gedacht. 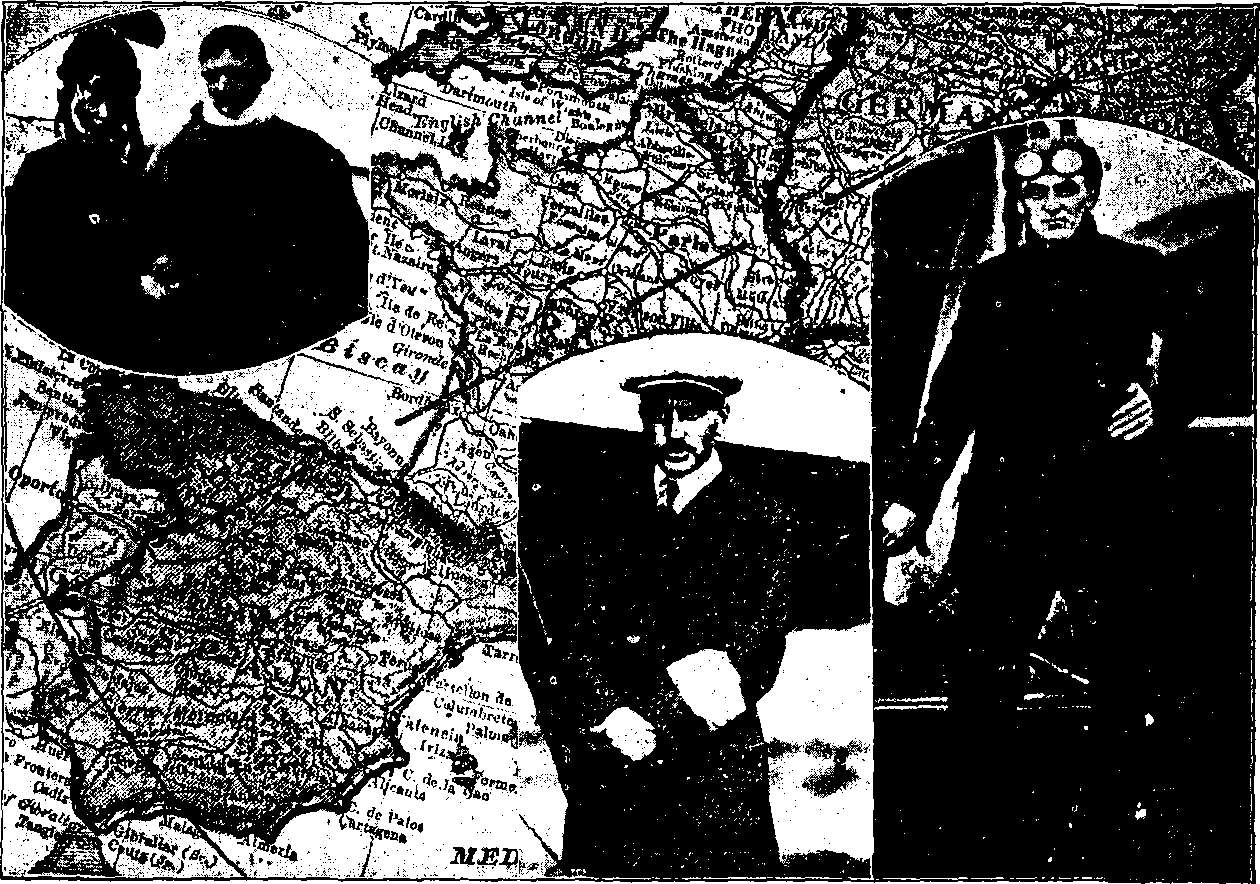 Die großen Fernflüge im die Nationalflugspende. Der von Viktor Stoeffler zurückgelegte Weg von 2160 km entspricht einer Entfernung von Berlin bis in die Mitte von Portugal bezvi. Malaga (Siehe die Klarte.), Von rechts nach links V. Stoeffler, Ing. Schlegel und Ref. Caspar mit Frau. Herzlichen Dank. Denn die Orientierung ist jetzt nicht einfach. Der Mond hat sich zurückgezogen. Wenig nnr kann ich sehen. Höchstens den Rhein oder den Kanal. Aber es genügt zur Not, denn außerdem winken neue Flammensäulen von Mülhausen her. * loh lande nicht. Ich begnüge mich mit einem verabredeten Lichtsignal. Nun wissen sie da unten, daß die Rekordreise weiter geht. Ich habe dieses Mal eine schwere Fahrt. Aus den Vogesentälern kommen böse Winde, die mich ungestüm hin und her werfen und immer mehr verhängt sich der Himmel. Mechanisch gebrauche ich die Steuerung. Die Beine sind ziemlich gefühllos und reagieren nur mit Mühe. Und doch muß ich .... Darmstadt habe ich überflogen. Zum letzten Mal. Es genügt. Nun auf schnellstem Wege nach Hause. Ich kann es kaum erwarten. Ich fiebere vor Verlangen. Mitternacht naht heran. Kurz vorher lande ich in Schlettstadt zur Kontrolle. Sie dauert nur Minuten, aber sie kommt mir wie eine Ewigkeit vor .... Und dann leuchten nochmals die Benzinfeuer von Habsheim. Gleitflug aus 1500 Meter Höhe. Der Rekordversuch ist gelungen. Ich kann mich nur schwer sammeln und eine Auslese aus diesen Erlebnissen erzählen. Die Glückwünsche nehme ich ganz mechanisch entgegen. Die furchtbare Kälte und das Stillsitzen in der engen Karosserie haben mich stark erschöpft. Dazu die Freude .... Ich hatte nicht gedacht, daß ich nahezu 24 Stunden hindurch fliegen könnte und alle Sinne restlos anspannen. Doch es ist möglich geworden. Eiserner Wille kann viel. Ich bin glücklich über die Leistung und werde sie überbieten, wenn von einer Seite ein gefährlicher Angriff erfolgen sollte. Ref. Caspar fliegt 1650 km in 24 Stunden. Schon bei Anbruch der Nacht herrschte am 14. Oktober ein ungewöhnliches Treiben auf dem Flugplatz in Fuhlsbüttel. Caspar wollte um 12 Uhr Nachts aufsteigen, um sich um die großen Preise der National-Flugspende zu bewerben. In freundlichem Entgegenkomnen hatte der Hamburger Verein für Luftfahrt, der Verein für Motorluftfahrt in der Nordmark, Altona, das Hamburger Regiment und die Hamburger Feuerwehr ihre Unterstützung zugesagt, da zur nächtlichen Orientierung Absperrungen, eine Fackelallee und Feuer vorgenommen werden mußten. Von 9 Uhr an erfolgte die Aufstellung der Soldaten zwischen dem Flugplatz Fuhlsbüttel und Friedrichsgabe. Der Flugplatz war durch Feuer und die Scheinwerfer der Ballonhalle hell erleuchtet. Als Sportzeugen hielten auf dem Flugplatz Fuhlsbüttel, Hartogh und Vering vom Hamburger Verein für Luflfahrt und in Friedrichsgabe Capitän z. S. Pohl und Diplom-Ingenieur Jürgensen vom Verein für Motorluftfahrt in der Nordmark Wacht. Kurz vor 12 Uhr stieg Caspar auf und verschwand sofort in dem nächtlichen Dunkel. Es war für die Schüler der Flugschule, der Centrale für Aviatik, deren es jetzt über 20 sind und für die zahlreich versammelten Freunde der Centrale für Aviatik, ein unvergeßlicher Anblick, die regelmäßig wie ein Uhrwerk alle Viertelstunde erscheinende Silhouette der Hansataube zu beobachten. Ueber 6 Stunden blieb Caspar, der sich erst eben von seinem schweren Sturz erholt hatte, in der Luft und landete vollständig frisch, nachdem er annähernd 600 Kilometer zurückgelegt hatte. Es gab nun einen kurzen Aufenthalt, da der Tourenzähler gebrochen war, dann stieg Caspar's schon öfter erprobter Begleiter, u. A. in der Kieler Flugwoclie und beim Ostpreußischen Rundflug, Lt. Plagemann vom 163. Infanterie-Regiment mit in die, mit neuen Betriebsstoffen versehene Hansataube ein, und es ging in den Morgennebel hinein nach Breslau zu. Der Apparat trug ungefähr 350 kg Nutzlast, für einen Eindecker eine ganz außergewöhnliche Leistung. Lange hörte man nichts von den beiden Fliegern und war schon, da allmählig von allen Seiten Unglücksnachrichten von Fliegern und von dem L. 2, eintrafen, in großer Sorge, als schließlich am Spätnachmittage bekannt wurde, daß Caspar kurz nach 3 Uhr in Breslau gelandet war. Caspar hatte auf seinem Fluge unerwartet Gegenwind getroffen und entschloß sich daher, unterwegs, da sonst das Benzin bis Breslau nicht gereicht hätte, zu einer Zwischenlandung in Döberitz. Dort brach ein Pneumatik, wodurch die Flieger zu einem 2 stündigen Aufenthalt genötigt wurden und die Chancen für die Ueberbietung der Leistung Stöffler's, die sie sich fest vorgenommen hatten, verloren gingen. Gegen 12 Uhr wurde der Flug nach Breslau durchgesetzt Während der ganzen Strecke von Hamburg nach Breslau herrschte so diesieges Wetter, daß die Flieger kaum über 200 Meter hoch gehen konnten und in dieser gefährlichen Art wurde der Flug vollendet. In Breslau wurde neuer Betriebsstoff aufgenommen und zu einem weiteren Flug nach Liegnitz und wieder zurück nach Breslau, wobei die Stadt überquert, wurde, gerüstet und durchgesetzt. Am Abend trat in Breslau solch dichter Bodennebel auf, daß an einen Weiterflug zunächst nicht zu denken war. Doch gab Caspar die Hoffnung nicht auf und stieg trotz Nebels um 3/i 10 Uhr Abends noch einmal auf, um bei Fackel und Feuerbeleuchtung nochmals ca. 200 Kilometer zurückzulegen. Es w,jr während dieses letzten Fluges in der Luft solch klarer Mondenschein, daß Caspar, ohne seine elektrische Beleuchtung zu brauchen, die Uhren ablesen konnte. Nur auf der Erde lag dichter Nebel. Kurz nach 12 Uhr landete er dann unter den Glückwünschen der Mitglieder des Schlesischen-Aero-Clubs. Er hatte ebenfalls wie Stöffler, den französischen Weltrekord um ca. 100 km Uberboten, dessen Ueberbietung man für einen Deutschen mit einem deutschen Apparat und einem deutschen Motor noch vor einer Woche für unmöglich gehalten hat. Caspar war, trotzdem er 17—18 Stunden in der Luft war, noch vollständig frisch. Der fünfsitzige Grahame-White-Doppeldecker. (Hierzu Tafel XXVII). Im Laufe der letzten Zeit hat sich die englische Flugzeugindustrie wiederholt durch leistungsfähige Wasser- und Landflugmaschinen hervorgetan. Ganz besonders rührig zeigte sich in dieser Hinsicht die Grahame-White Aviation Co., die mit ihrem neuesten Typ, einem fünfsitzigen Flugzeug, mit Elfolg in die Oeffentlichkeit getreten ist. Der Gesamtaufbau zeigt im großen und ganzen die. Richtlinien der Henry Farman'schen Konstruktionen. Das Fahrgestell ist nach dem Zweikufensystem ausgebildet, dessen Verstrebungen günstig profiliert und sorgfältig verspannt sind. An jeder Kufe ist ein, mittels Gummiringe abgefedertes Räderpaar angebracht. Eine besondere Strebe führt nach der Mitte der Kufe, verhindert ihre übermäßige Durchbiegung und nimmt den Landungsstoß vorteilhaft auf. Die Tragflächen sind 52 qm groß. Hiervon entfallen 41,75 qm auf das Oberdeck und 30,25 qm auf das Unterdeck. Die Spannweite des Oberdecks beträgt 18,ti m. Durch Herablassen der nach rückwärts geneigten Ausleger, kann der Raumbedarf der Maschine um 5 m verringert werden. Die Stabilisierungsklappen sind zwangläufig miteinander verbunden. Zwischen den mittleren Tragdeckstreben ist der fiinfsitzige Motorrumpf angeordnet. Er verjüngt sich nach dem Führersitz zu, der durch einen Windschirm geschützt ist. Hinter ihm befinden sich 4 paarweise angeordnete Begleitersitze. Am Ende des Rumpfes ist auf einem gitterträgerartigen Konsol ein 120 PS Austro-Daimier aufmontiert, der eine Luftschraube von 2,8 m Durchmesser antreibt. Der Betriebsstoff ist in zwei Behältern von 40 1 Inhalt untergebracht. Dieselben haben einen elliptischen Querschnitt und sind an den vorderen Tragdeckstreben zu beiden Seiten des Rumpfes befestigt. Ein sorgfältig verspannter Gitterträger, der sich nach hinten etwas verjüngt, verbindet die Haupttragflächen mit der Schwanzzelle. Ihr Gesamtflächeninhalt beträgt 16 qm. Hiervon entfallen 4 qm auf das Höhensteuer. Die 3 Seitensteuer sind an den hinteren Zellenstreben befestigt. Jede Steuerfläche ist 1,15 qm groß. Zur Unterstützung des Schwanzes sind zwei abgefederte Schleifkufen vorgesehen, die in Stahlrohrgabeln geführt werden. Die Maschine wurde von dem französischen Flieger Noel wiederholt mit Erfolg gesteuert und entwickelte mit einer Höchstbesatzung von 10 Personen 80 km in der Stunde. Fliegendes Boot Bossi. Dieses fliegende Boot von dem italienischen Ingenieur Enea Bossi besitzt einen Haupt-MitteJschwimmer, der in seiner Ausführungsform sich von den bisher üblichen unterscheidet. Bei den bisherigen 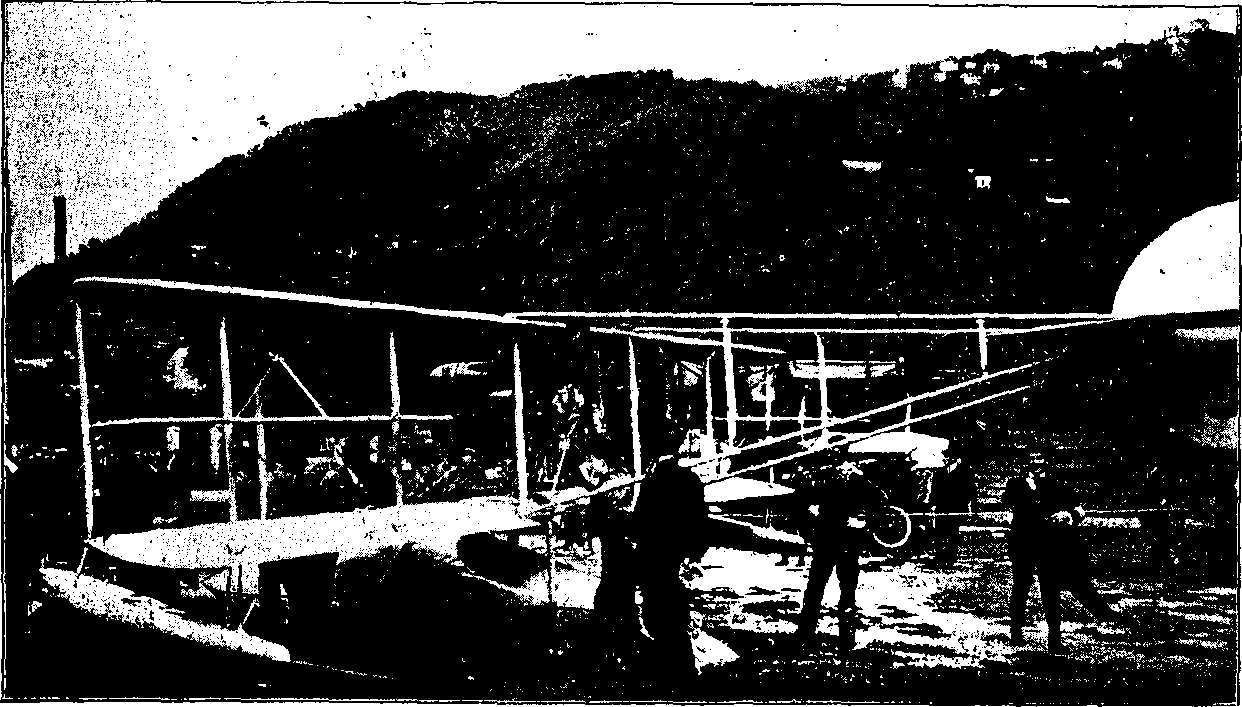 Fliegendes Boot Bossi. Konstruktionen der fliegenden Boote von Löveque und Curtiß konnte unter ungünstigen Verhältnissen durch überkommende Seeon das Boot leicht versacken. Um diesen Nachteil zu vermeiden hat Bossi einen von allen Seiten. geschlossenen Hauptschwimmer vorgesehen, auf den eine oben offene Karosserie aufgesetzt ist. Diese Anordnung hat ferner noch den Vorteil, daß, wenn der Hauptschwimmer in allen Teilen leck wird, der obere Teil d. i. die Karosserie, als Schwimmkörper, die Maschine noch über Wasser halten kann. Die seitliche Stabilität wird durch 2 Hülfsschwimmer mit nach hinten angesetzten Fühlbrettern gesichert. Höhen- und Seitensteuer befinden sich hinter den Tragdecken. Die seitliche Stabilität beim Fliegen wird durch 2 Hauptsteuerflächen ähnlich wie bei Curtiß erhalten. Zum Betrieb dient ein hinter den Tragdecken angeordneter 80 PS luftgekühlter Anzani-Motor Dieses fliegende Boot wurde von Deroye gesteuert. Der neue Doppeldecker Voisin. In den Werkstätten von Voisin, Bilancourt bei Paris ist neuerdings ein Doppeldecker herausgekommen, dessen Konstruktion von den bisher übliehen Ausführungsformen abweicht, auffallend ist die robuste Durchführung der Einzelteile. Man erkennt sofort, daß die Maschine in erster Linie für Kriegszwecke bestimmt ist. Der Doppeldecker besitzt eine Spannweite von 15 m. Das Höhen- und Seitensteuer befindet sich hinter den Tragdecken und ist mit zwei sehr starken Trägern gegen die Zelle verspannt. Die ober- und unterhalb 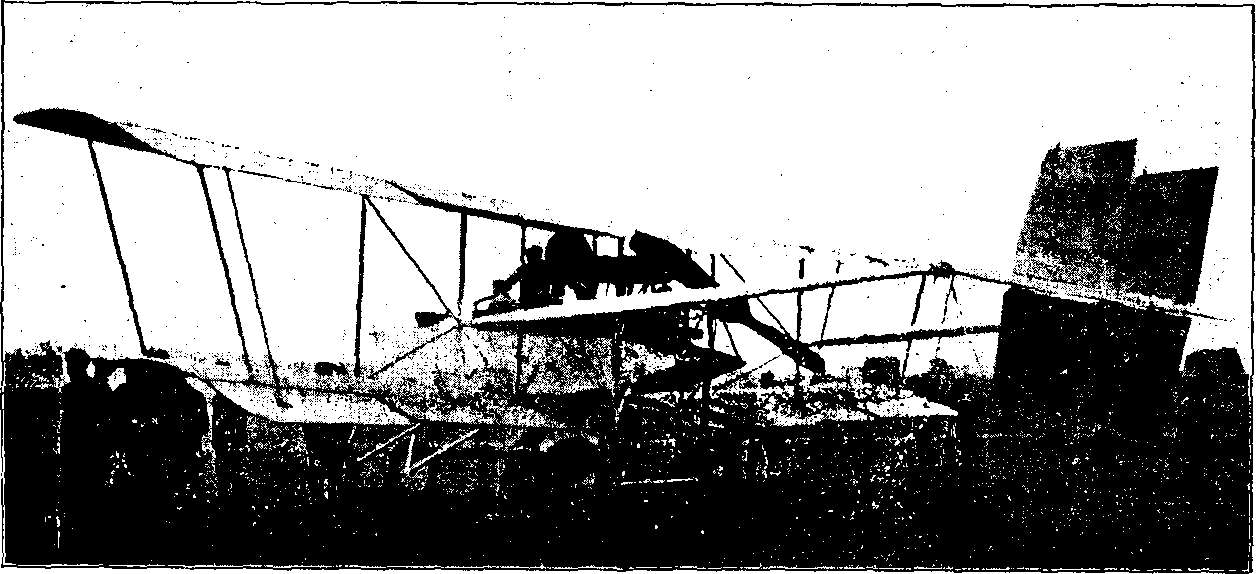 Neuer Voisin-Doppeldeäzer. Ansicht schräg von hinten. des Höhensteuers befindlichen Seitensteuer machen die Bewegungen des Höhensteuers mit. Um ein Ueberschlagen der Maschine auf unebenem und weichem Gelände möglichst zu verhindern, sind vor den Tragflächen zwei Stoßräder vorgesehen Vor dem Führer- und Insassensitz befinden sich keinerlei Orgaue, welche das Gesichtsfeld behindern können; ferner ist vor den Sitzen Raum für ein Maschinengewehr vorgesehen. Im hinteren Teil des Rumpfes befindet sich ein 200 PS Clerget-Motor, der unter Zwischenschaltung einer Gelenkkette 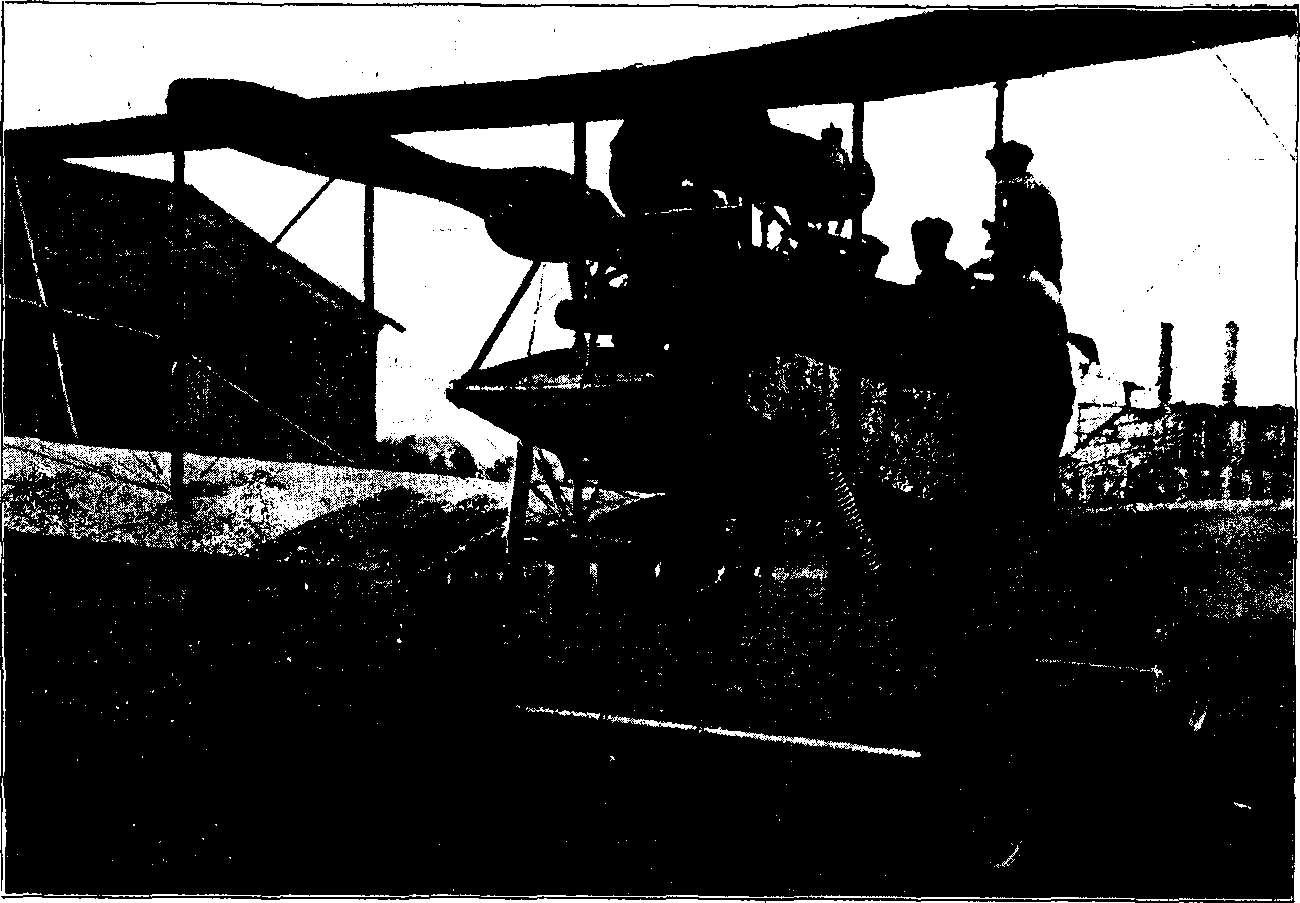 Neuer Voisin-Doppeldecker. Ansicht von hinten auf die Motoren-Anlage. eine Holzschraube von 2,3 m Durchmesser antreibt. Um den Auslauf' möglichst zu verkürzen sind die Haupttragräder mit Bandbremsen versehen. Das Gewicht der betriebsfertigen Maschine beträgt 1300 kg. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Im Augenblick, wo ich meinen Bericht beginne, kommt mir ein interessantes Dokument unter die Augen: Die exakte Rechnungslegung über französische Nationalspende zu Gunsten des Militärflugwesens welche die Gesamtsumme von nicht weniger als 6.114.846.89 Francs eingebracht hat. Die Art, wie der wesentliche Teil dieses Geldes seitens des Comitös repartiert worden ist, bietet manches interessante Charakteristikum: Es wurden 3.221.832,74 Francs zur Anschaffung von 208 Flugzeugen für das Heer verwendet, während weitere 71.872,20 Francs dem Marineflugwesen überwiesen worden sind. Für Zwecke der Sicherung des Marineflugwesens wurden ausgegeben: 40 718,25, die dem National-Coinitc, 17000 Francs, die der Staatskasse, und 221.793 Francs, die der „Union für die Sicherheit im Flugzeug" überwiesen worden sind, insgesamt also 280.111,25 Francs. Zur unentgeltlichen Ausbildung von Flugschülern wurden insgesamt 424.066,90 Francs verausgabt, während 1,957.044,95 Francs für die Anlage von 69 Fliegerlandungsstationen verwendet wurden. Wie man sieht, ist hier mit dem gesammelten Gelde ein gutes Stück Arbeit getan worden. Daß das französische Militärflugwesen dem der größte Teil des Geldes zugewendet worden ist, aber auch etwas leistet, ist aus dem regelmäßigen Meldungen von hier hinreichend ersichtlich gewesen. Jetzt hat es sich wieder auf einem gänzlich neuen Gebiete bewährt: es handelte sich dabei um den ersten offiziellen Versuch einer regelmäßigen Luft-Postbeförderung den der fransösische Minister der öffentlichen Arbeiten und der Post dieser Tage vornehmen ließ. Man hatte bemerkt, daß die französiche für Südamerika bestimmten Dampfschiffe seit langer Zeit schon nicht mehr die kontinentale Post zur Beförderung erhalten und nahm richtig an, daß die lange Verzögerung in der Ueberweisung der Postsachen an die Dampfer die Ursache hiervon sei. In der Tat geht die ganze nach Südamerika bestimmte Post an die Pariser Zentrale und wird von hier aus auf umständlichem Ueberweisungswege an die jeweilig abfahrenden Dampfer expediert. Im Ministerium wurde nun ein Plan ausgearbeitet, der die Verwendung des modernsten Transportmittels für den angebebenen Zweck ins Auge faßte und dieser Tage wurde nun der erste offizielle Versuch unternommen, für den die Heeresverwaltung den Offiziersflieger, Leutnant Eollin, zur Verfügung stellte. Um 67a morgens schon fanden sich neben zahlreichen offiziellen und geladenen Persönlichkeiten der Postminister auf dem Flugfelde zu Villacoublay ein, wo ihm Oberst Bouttieaux, den Leutnant Eollin vorstellte. Kurz darauf traf aus Paris im Automobil der Postsack im Gewichte von 10 kg ein und Leutnant Eollin nahm sofort auf seinem Eindecker den Abflug vor. Etwa 50 m rollte das Flugzeug dahin, dann erhob es sich in die Luft, Eollin beschrieb in 400 m Höhe einen Kreis um das Flugfeld und entfernte sich alsdann in der Eichtung auf Poitiers. Infolge eines leichten Motorendefekts landete Eollin zuerst in Vendome, wo eine schleunige Notreparatur vorgenommen und dann der Flug fortgesetzt wurde. Um 2 Uhr 14 Minuten landete der Offizier mit seiner Last in der Nähe von Pauillac, dem Abgangshafen des Dampfers; dort wartete schon ein Automobil, das die Postsachen an Bord des Dampfers beförderte. Das Experiment glückte vorzüglich, denn auf dem hier versuchten Wege wird es möglich sein, der Post, die nach 6 Uhr von Paris abgeht, eine Verspätung von zwei Wochen zu ersparen, denn während sie sonst auf den nächsten abgehenden Dampfer warten mußte, wird sie auf dem Luftwege noch das Schiff zu erreichen imstande sein. Es soll nun der Dienst regulär installiert werden, und zwar will man Civil-flieger dazu heranziehen, was für diese, die in der Tat vielfach „notleidend" sind, eine schöne Erwerbsquelle ergeben wird. Das Militärflugwesen hat andererseits einige schwere Unfälle zu verzeichnen. In Epinal stürzte der bekannte Leutnant Garnier, der als einer der tüchtigsten Fliegeroffiziere in Frankreich galt, aus 30 m Höhe ab und wurde auf der Stelle getötet. Der mit an Bord befindliche Sappeur fand gleichfalls seinen Tod. Ebendaselbst wurde auch ein Unteroffizier aus 800 m Höhe mit seiner Maschine in die Mosel geschleudert und getötet. Bemerkenswert ist dabei, daß der Unteroffizier das Experiment Pegouds, das Luft-Looping the Loop, nachahmen wollte, was aber das erwähnte tragische Resultat hatte. Viel besprochen wird hier ein gelungener Rekognoszierungsflug, der ein aus sieben Flugzeugen bestehendes Luftgeschwader von Saint-Cyr aus unternahm und der soweit günstig verlief, mit Ausnahme eines Landungsunfalls, der einem Serganten zugestoßen ist, dessen Zweidecker zerstört wurde Es wird noch mit einigen "Worten auf die Versuche Flugmaschine mit Unterseeboot zurückzukommen sein, die unlängst in Bizerta auf Veranlassung des Admirals Amelot unternommen worden sind und die in mehrfacher Hinsicht allgemeineres Interesse erwecken. Das Sahara-Geschwader unter Leutnant Reimbert befand sich in der Nähe von Bizerta, um dort Uebungsflüge vorzunehmen, als es von dem Admiral für eine gemeinschaftliche Uebung zwischen Flugzeug und Unterseeboote herangezogen wurde. Alle Kommandanten der Unterseeboote mußten als Beobachter an Bord eines der Flugzeuge Platz nehmen, um sich auf diese Weise aus eigener Anschauung von der Sichtbarkeit der Unterseeboote von der Flugmaschine aus und von der Zweckmäßigkeit der verschiedenen Navigationstiefen der Unterseeboote Rechenschaft zu geben. Auf diese Weise sollte festgestellt werden, welche Manöver die Unterseeboote auszuführen haben, um von der Höhe möglichst wenig sichtbar zu sein Nach den Resultaten, welche dieses improvisierte Experiment ergeben hat, macht man in der hiesigen Presse dem Marineministerium den Vorwurf, daß es nicht gleichartige Versuche für alle ihm unterstehenden Einheiten angeordnet hat, denn angeblich soll sich aus den jetzt gemachten Erfahrungen eine völlig neue Orientierung der Unterseeboot-Taktik ergeben. Nun hat auch die permanente Kommission für das Lnftfahrwesen ihre Sitzung abgehalten, die lediglich dem neuen vom Generalstabe unterbreiteten Projekt einer französischen Luftkarte gegolten hat. Bekanntlich setzte als Folge der von Deutschland herausgegebenen Luftkarte mit den „verbotenen Zonen" hier in Frankreich eine wüste Agitation ein, welche jene Luftkarte als eine „Provokation Frankreichs" bezeichneten und der deutschen Regierung den Vorwurf machte, daß sie aus Aerger darüber, daß „ihre Flieger keine nennenswerte Flugleistung zu vollbringen imstande sind, den französischen Fliegern weite Fernflüge nach dem Osten unmöglich machen will," und was dergleichen dummes Zeug mehr ist. Man forderte eine entsprechende Gegenmaaßregel, und die Regierung fügte sich und ließ ein neues Projekt ausaibeiten, das nun von der Kommission unverändert angenommen worden ist. Nachdem die neue Verordnung von zuständigen Ministern unterzeichnet worden ist, wird sie dem Ministerium des Auswärtigen zugehen, damit sie, wie die hiesige Presse eigentümlicherweise übereinstimmend zu berichten weiß, auf diplomatischem Wege .... der deutschen und der österreichischen Regierung bekannt gegeben werde. Das angenommene Projekt bestimmt, daß es verboten ist, 1. eine Zone zu überfliegen, welche innerhalb eines Radius von 10000 Metern um Festungen und befestigte Plätze, sowie um eine Anzahl besonders aufgeführter Ortschaften liegt; 2. über eine Gegend zu fliegen, in der sich ein militärisches oder Marine - Etablissement (Instruktionsfeld, Schießfeld usw.) befindet, oder wo Schieß- und andere Uebungen vorgenommen werden. Die „verbotenen Zonen" in Frankreich sind, vom Mittelländischen Meere aus gerechnet, folgende; Toulon, Nizza, Besancon, Albertville, Morez, Pontanlier, Epinal-Belfort-Luneville, Nancy-Toul-Verdun-Montmedy, Mezieres, Givet, Valenciennes, Dunkerque, Cher-bourg, Brest, Lorient, la Rochelle-Rochefort Das ist also die erste praktische Folge des deutsch-französischen „Luft-Abkommens". Daß man die Spitze dieser neuen Maßnahme auch gegen Oesterreich richtet, hat darin seinen Grund, daß man hier jetzt auf die Wiener Regierung nicht gut zu sprechen ist, weil sie dem soeben begonnenen Flugunternehmen Paris—Kairo durch ihr Verbot der Ueberfliegung Süd-Ungarns anscheinend große Schwierigkeiten bereitet hat, denn nun wird man einen Teil der Flugstrecke, für welche die Verproviantierungsorganisation berechnet war, abändern müssen. Der französische Botschafter soll nach Ein-  Sopwith-Doppeldecker der englischen Marine mit 100 PS Anzani-Motor. (Anmerk. d. Red. Der englische Bericht ist infolge eines Flugunfalls unseres englischen Korrespondenten ausgeblieben.) treffen Daucourts in Wien mit den zuständigen Behörden über die neue Route sich ins Einvernehmen setzen Inzwischen ist Daucourt auf seinem Borel-Eindecker, mit seinem Freunde Boux an Bord, am Dienstag früh von Issy abgeflogen. Es war ein „großer Tag" für Issy. Außer dem Direktor des aviatischen Dienstes im Ministerium des Auswärtigen hatten sich alle französischen Konsuln in den von dem projektierten Fluge berührten klein asiatischen Ortschaften eingefunden, diejenigen von Kairo, von Jerusalem, von Smyrna, von Beyruth, von Bagdad etc. Dazu kamen zahllose offizielle Persönlichkeiten, sowie Flieger und Konstrukteure. Daucourt steuert auf diesem Fluge einen Zweisitzer, Militärtyp, der Marke Bore], der für eine Nutzlast von 370 kg berechnet ist. Der Motor ist ein 80 PS Gnom. Mit dieser Maschine will Daucourt den 5 300 km-Flug zu vollbringen versuchen. Der Anfang ist freilich nicht gerade vielversprechend. Nachdem Daucourt um Tis Uhr abgeflogen war, wurde er um 9 Uhr von Chaumont signalisiert. Um 12 Uhr landete er in Beifort, wo er sich verproviantierte und wo ihm der Chef der dortigen militärischen Fliegerstation, Hauptmann Jacquet, einen freundlichen Empfang bereitete. Am selben Tage langten die beiden „Luft-Weltreisenden" noch in Schaffhausen an, nachdem sie mit ihrer ersten Etappe 410 km zurückgelegt hatten. Seitdem liegen sie aber in Schaffhausen, wo sie angeblich durch ungünstiges Wetter zurückgehalten werden. Es hat den Anschein, als ob die Sache doch nicht so einfach ist, wie man sie hier hinzustellen beliebt hat (natürlich nur für französische Flieger!). Weniger „sensationell", aber dennoch beachtenswert sind zwei andere Flugleistungen, welche dieser Tage französische Flieger vollbracht haben: Garros flog übrigens einer besonderen Anregung des Postministers folgend, der anscheinend wieder ein neues Postbeförderungsprojekt vorbereitet, in sechs Stunden von Marseille nach Paris wobei er auf seinem Morane-Eindecker 200 Liter Benzin und 50 Liter Oel mitgenommen hatte. Garros realisierte bei diesem Fluge eine durchschnittliche Stundengeschwindigkeit von 108 km, denn die Strecke von Marseille über das Ehonetal, über Lyon, Moulins und Nevers stellt eine Entfernung von 650 km dar. Vor seinem Abfluge aus Marseille wurde er von dem dort auf der Durchreise befindlichen Präsidenten der- Eebublik empfangen, der ihm persönlich ankündigte, d'aß er im Hinblick auf seinen großartigen Flug über das Miitelrneer zum Eitter der Ehrenlegion ernannt werden soll. Die gleiche Ehrung soll übrigens auch Legagneux zuteil werden. Der zweite interessante Flug war derjenige, den Seguiu um das ' Kriterium des Aero-Club de France | unternommen hat, und wobei der bekannte erfolgreiche Flieger die Strecke Paris-Bordeaux und zurück, eine Entfernung von 1040 i km, auf seinem Zweidecker Henri Farman in 13 Stunden 5 Minuten hinter sich gebracht hat. Nach anderen Meldungen hat die Flugdauer 13 Stunden 27 Minuten betragen, sodaß Seguin damit einen neuen Welt-Dauerrekord aufgestellt hätte; doch wird wohl erst die offizielle Homologierung dieser .Fingleistung abzuwarten sein. Der Zweidecker hatte einen 80 PS Gnom-Motor zum Antrieb. Auch ein neuer Versuch des Fliegers Helen um den Michelin-Pokal ist zu erwähnen Helen hat am letzten Mittwoch auf der Rundstrecke von Etampes, die ein Ausmaaß von 106,600 km hat, seine Runden begonnen und an jedem der ersten drei Tage 533 km zurückgelegt, sodaß er in diesem Augenblick eine Distanz von 1.599 km zu verzeichnen hat. Er steuert einen Nieuport-Eindecker, 80 PS Gnom. Wie erinnerlich beträgt die beste Leistung, die bisher für den Michelin-Pokal vorgelegt ist, 15989,200 km; diese Distanz hat Fourny während seines denkwürdigen Fluges von 31 Tagen hinter sich gebracht. Auch der Michelin-Zielscheiben-Preis wird demnächst wieder auf die Tagesordnuug kommen: die Aviations-Kommission des Aero-Club de France hat beschlossen, daß die nächsten Versuche um diesen Preis in der Zeit vom .12. bis 20. November stattfinden sollen. Bei dieser Gelegenheit hat die Kommission, dem Vorschlage ihres Mitglieds Rousseau folgend, beschlossen, die Aufstellung eines Internationalen Flug-Kalenders in Erwägung zu ziehen. Jetzt ist auch eine entgiltige Entscheidung bezüglich des Pommery-Pokals ergangen. Die Sportkommission der Ligue Nationale Aerienne hat in ihrer neulichen Sitzung entschieden, daß Brindejonc das Moulinais gegenwärtiger Anwärter auf diese Trophäe ist. Die Kommission hatte den Flieger Guillaux aufgefordert, vor ihr zu erscheinen, um eine Aufklärung seines bekannten „Irrtums" bezüglich des Ortes seiner Landung zu geben. Guillaux hat es vorgezogen, nicht vor der Kommission zu erscheinen. Es wurde beschlossen, bevor entgiltige Maßregeln gegen den genannten Flieger ergriffen werden, ihn nochmals zu berufen. Bis auf weiteres aber ist Guillaux von der Teilnahme an einem Bewerb der Ligue Nationale ausgeschlossen. Nun hat, wie hier behördlich bekannt gegeben wird, das Flugzeug eine ganz besondere Nutz Verwendung gefunden, nämlich als Zollhinterziehungs-Maschine. Wie nämlich verlautet, hat man entdeckt, daß schon seit einiger Zeit ein schwunghafter Zollschmuggel zwischen Belgien und Frankreich betrieben wird, und zwar vermittelst Flugmaschinen. Diese fliegen in der Nähe der belgisch-französischen Grenze ab, beladen mit Tabak, Spitzen und sonstigen Waren und begeben sich nach einem vorher festgesetzten Ort im Departement Pas de Calais, wo wegen der Nähe der Meeresküste die Zollaufsicht eine schwächere ist. Die Flieger landen nicht. Sie kreisen während einiger Augenblicke um ein vereinbartes Terrain und werfen dann, wenn ihre Komplizen zur Stelle sind, die Waren über Bord. Die Zollverwaltung ist entschlossen, strenge Maßregeln gegen diese Art von Schmuggel zu ergreifen, doch fragt man sich mit Recht, worin diese Maßregeln bestehen werden, da ja eine Grenzwache im Aeroplan bisher noch nicht eingerichtet ist. Vorläufig hat man die Zollbeamten mit mächtigen Ferngläsern versehen, mit denen sie den Horizont nach Schmugglern absuchen sollen. Und dann? Schließlich seien noch einige Flugversuche erwähnt, welchen die Sicherung des Maschinenfluges zur Grundlage dient. Der bekannte Erfinder Moreau hat dieser Tage einen Flug von Melun aas ausgeführt, wobei er 200 km ohne Berührung der Steuerhebel zurückgelegt hat, um die Vorzüglichkeit seines automatischen Stabil-sierungssystems zu erweisen. Wie verlautet, wird der Hauptmann Couade in der nächsten Zeit Versuche mit einem von ihm konstru-irten Fallschirmsystem unternehmen. Dieser Fallschirm hat 200 qm er ist aus Seide, und wie es heißt, außerordentlich leicht. Er soll auf einem gegenwärtig im Bau begriffenen Eindecker von 500 kg angebracht werden. Couade will mit seinem System so wohl den Flieger als auch das Flugzeug retten und zwar aus einer Höhe von nur 100 m bei einem Absturz von 50 m Geschwindigkeit. Interessanter erscheint noch die Meldung, daß Hauptmann Couade auch an einem eigenartigen Bremssystem für Flugzeuge arbeitet, das dazu bestimmt ist, die Geschwindigkeit der schnellen Flugmaschinen im Augenblick der Landung zu verlangsamen. Die ersten Versuche mit den Couade'schen Erfindungen werden mit Genehmigung des Kriegsministers vom Pariser Eiffelturm aus stattfinden. Wir kommen später noch darauf zurück. Kl. Automatische Kuppelung. Ein flüchtiger Blick auf die Ursachen der vielen Flugunfälle zeigt, daß ein großer Teil derselben auf ein Versagen des Motors und den sich hieraus ergebenden Folgen zurückzuführen ist Mit Recht wurde daher seinerzeit die Frage aufgeworfen, ob es nicht zweckmäßig sei, das Flugzeug mit zwei Motoren auszustatten, um dadurch die Möglichkeit eines Unfalles durch Versagen des Motors auszuschließen ; als Folgeerscheinung dieser Annahme ergab sich die Doppelmotorenanlage. Für den Sportflieger, der nicht mit einer auf Kosten der Sicherheit filigran gebauten Maschine nach Preisen hastet, sondern der sich am freien Fluge zu ergötzen sucht und für die, welche auf einen möglichst sicheren Flug Wert legen, ist nachstehend beschriebene Kupplung geschaffen, die einen Unfall wegen Versagen des Motors ausschließen soll. Es handelt sich hier ebensfalls um eine Doppelmotorenanlage, doch sind nicht beide Kraftquellen gleichzeitig in Tätigkeit; diese sind durch die Kupplung verbunden, welche im Falle des Versagens einer die andere zur Arbeitsleistung heranzieht und gleichzeitig die erste vollkommen ausschaltet. Die Kupplung besteht aus folgenden Teilen: a, a', mit je einem Motor verbundene Zahnräder; sie sind mit der Welle nicht starr verbunden, sondern gleiten auf derselben (Kugellager b, b'). Beide Zahnräder tragen in o, o' je einen Hakenkranz. d einem hohlen Prisma, das an beiden Enden Einschnitte (Hakenkränze) o", c'" zur Aufnahme der Hakenkränze c, c' der Zahnräder trägt; außerdem besitzt das Prisma an der Innenseite Ausnehmungen (Abb. 3), welche die entsprechenden Erhebungen w der Welle W aufnehmen; dieses Prisma kann an der Welle in der Längsrichtung gleiten, wodurch seine Hakenkvänzo c", c'" mit den Hakenkränzen c, ,,Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten u. Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XXVII. Grahame-White-Doppeldecker mit 5 Sitzen. 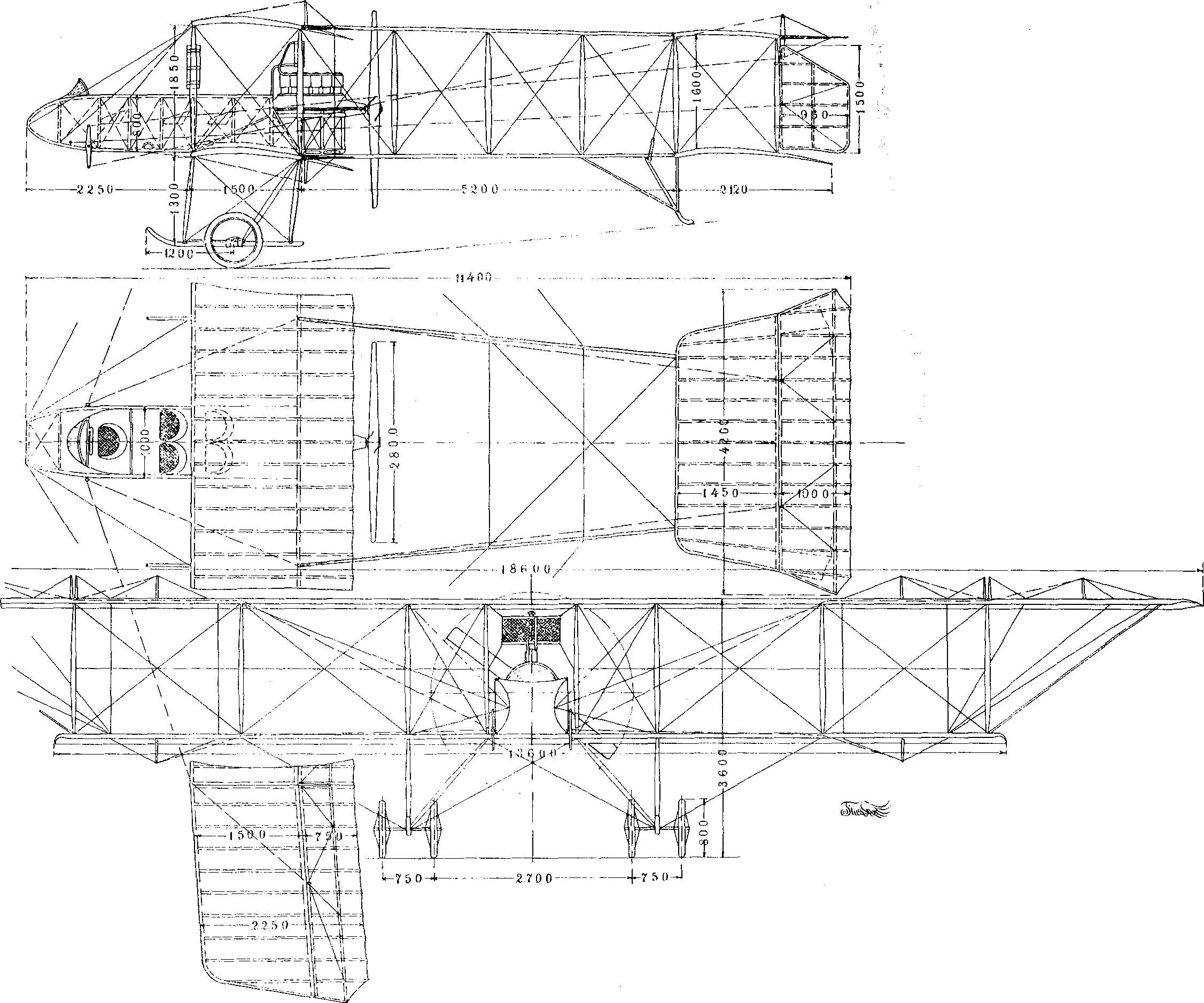 Nachbildung verboten 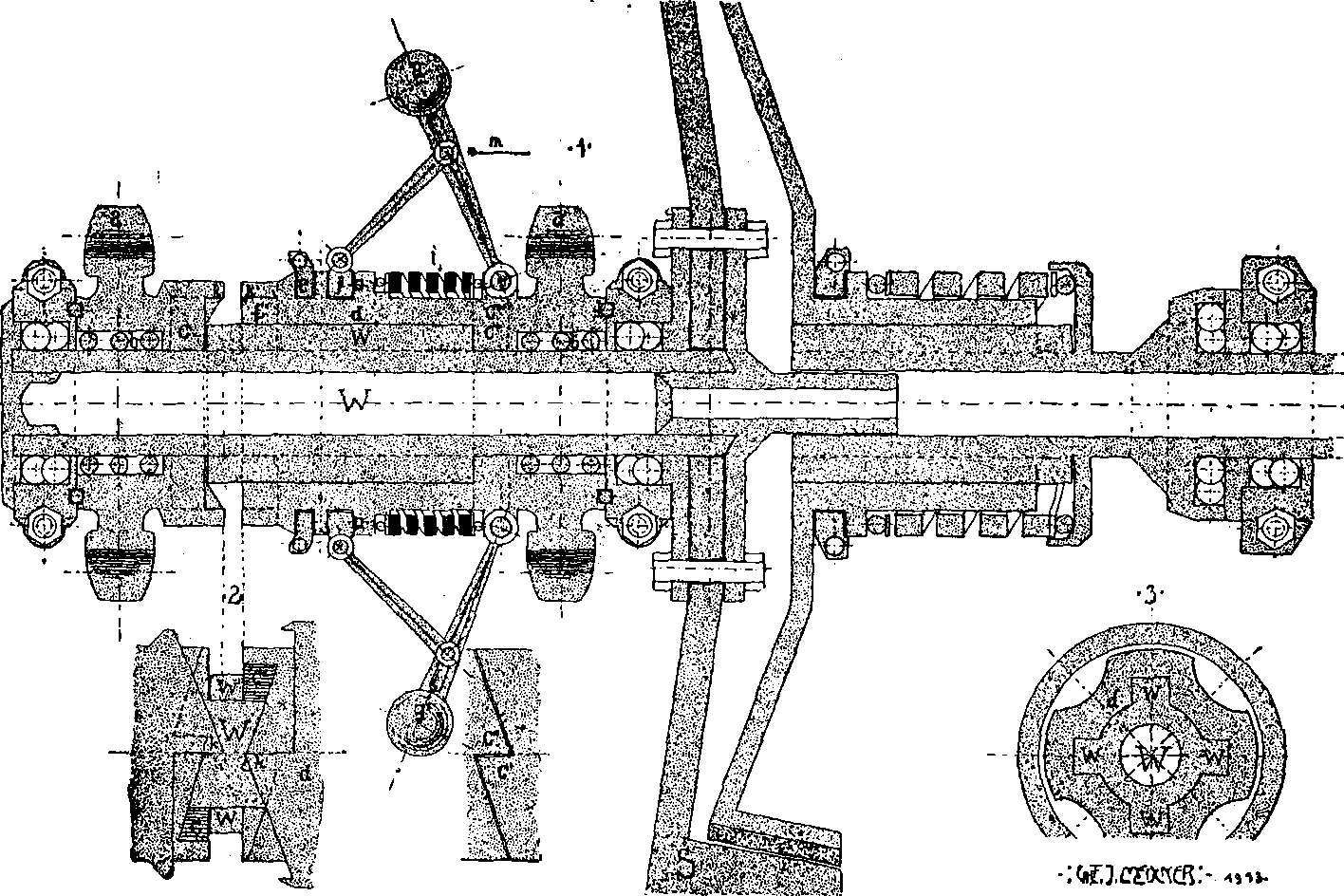 des Zahnrades a' werden auch die beiden Körper g, g' in Rotation versetzt und dadurch ihre Fliehkraft in der Richtung m äußern, wobei die Spannkraft der Feder i überwunden wird; der mit a' verbundene Motor treibt nun unter Vermittlung des Prismas d die Welle W und somit auch die Schraube. Stellt nun der erste Motor die Arbeitsleistung ein, so hört die Zentrifugalkraft auf, die Federspannung kommt frei zur Wirkung c' der Zahnräder in Eingriff kommen können und dadurch die Kraft von den Zahnrädern a, a' auf die Welle W bezw. Schraube übertragen wird. e einem Ring, mit dem man das Prisma von Hand aus mit einem oder dem andern Zahnrad unter Vermittlung der Hakenkränze in Eingriff bringen kann. f ebenfalls einem nicht mit dem Prisma starr verbundenen Ring, der es gestattet, die Zentrifugalkraft der beiden Körper g, g', die mit dem Zahnrade a' in h gelenkig verbunden sind, auf das Prisma einwirken zu lassen. i einer Druckfeder. Die Wirkungsweise ist nun folgende: Zunächst wird das Prisma manuell mittels des Ringes e gegen das Zahnrad a' geschoben, wodurch der Zahnkranz c'" des Prismas mit dem Hakenkranze c' des Zahnrades a' in Eingriff kommt. Nun wird der an a' gekuppelte Motor angeworfen; durch die Drehung und wird nun das Prisma auf der Welle zum Zahnrade a schieben und dort mit dem Zahnkranze c in Eingriff bringen. Vorderhand wird nun das Prisma die punktierte Stellung (Abb. 2) einnehmen und das Zahnrad a vermittels der Hakenkränze k, k', infolge der im Schwungrade S angesammelten Energie, unterstützt durch die rotierende Schraube den zweiten Motor anwerfen; sobald dieser nun anspringt, wird das Prisma vollends mit dem Hauptzahnkranz c des Rades a in Eingriff kommen und der Zweck der Kupplung erscheint hiermit erreicht. Das Anspringen des zweiten Motors kann noch durch geeignete Anwendung einer Dekompressionsvorrichtung, Anlaßzündung u. dgl. bedeutend erleichtert werden. Es soll durch vorliegende Zeichnung nur das Prinzip einer selbsttätigen Kupplung (Federkraft gepaart mit Zentrifugalkraft) dargestellt werden, denn ob Zahnkränze oder ein anderes Dispositiv zur Ueber-tragung der Motorkraft von den Rädern unter Vermittlung des Prismas auf die Welle verwendet werden, ist bedeutungslos. Ing. Raoul J. Hofmann. Ein unangenehmer und beinahe unerläßlicher Konstruktionsteil des Flugzeugbaues ist der Spanndraht; die vielen Unglücksfälle, die durch sind, kennen wir zur Genüge; ob aber diese Zufälle in ungenügender Dimensionierung oder durch unrichtiges Spannen ihre Begründung finden, ist durch einwandsfreie Tatsachen noch nicht festgestellt worden; es wäre auch unmöglich, daß nach einem Sturze solche Kontrolle durchgeführt werden kann. Es war daher nichts naheliegenderes als jene Stelle, an welcher der Draht die Bruchgrenze überschritten hat, einen dickeren bezw. einen zweiten Draht einzuschalten Die Folge davon war besonders bei älteren Neukonstruktionen eine mit Spanndrähten übersäte Flugmaschine, welche dadurch nicht besonders wenig schädliche Stirnwiderstände besaß und daher einen unsicheren Flug erzielte. Man war von den Bestrebungen geleitet, die Anzahl der Spanndrähte zu vermindern oder diese durch Stahl-Kabeln, -Bänder oder -Rohre zu ersetzen; wenn auch der Ersatz teilweise gelang, so finden wir trotzdem genug Stahldrähte im Flugzeugbau, welche uns veranlassen, eine neue Vorrichtung zum genauen Spannen der Flugmaschine näher zu erörtern. Das Spannen und dessen Güte ist mehr von der Genialität als von dem Willen und der Aufmerksamkeit des durchführenden Organes abhängig; man war daher gezwungen, fähige Leute dafür herauszufinden, denn ein Anlernen war beinahe ausgeschlossen. Die Grundlage einer neuen Spannmethode bildet die Schwingungszahl bezw. die Tonhöhe des in der Flugmaschine eingespannten Drahtes; die Tonhöhe kann mit einer Stimmpfeife, die Schwingungszahl selbst mit einem Resonnanzschwingungsmesser gemessen werden wobei die erstere Methode die beste ist. V. I. M. Das Spannen der Drähte. Reißen eines 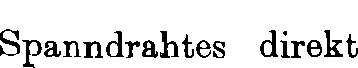 oder indirekt verursacht worden 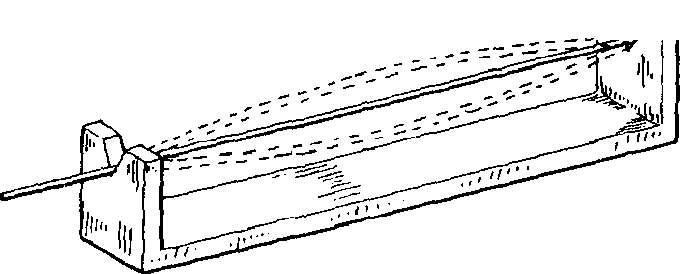 Abb. I Aus der Physik ist uns bekannt, daß der auf gleiche Länge eingespannte Draht dieselbe Tonhöhe besitzt, wenn die spez. Spannung in kg/qcm gleich ist. Da aber die Spanndrähte in der Flugmaschine verschiedene Länge besitzen, so würde man verschiedene Tonhöhen, bezw. viel zu tiefe Tonhöhen erhalten, KJ-s^s*** weiter würden die Töne durch die eingeschlossenen Spannschlösser nicht rein sein. Dieser Umstand führt uns zu der Vorrichtung, welche in Abb. 1 dargestellt ist, die eine fixe Stützlänge besitzt. Die Drähte können in der Flugmaschine nicht mit gleicher spez. Spannung beansprucht werden, dafür spricht die Erfahrung, wie auch die verschiedenartigen Beanspruchungen im Fluge, wie auch auf dem Stande; bei Anwendung der oben erwähnten Vorrichtung, welche mit mäßigem Drucke an den Draht angelegt wird, ist ein gutes Gehör erforderlich wie eine verstellbare Stimmpfeife Einfacher ist die Anwendung einer Vorrichtung laut Abb. 2, welche mit einem verstellbaren Stützwinkel und Millimeterteilung versehen, eine gleiche Tonhöhe ermöglicht. Um der Beanspruchung der einzelnen Elemente in der Flugmaschine jener bei dem Fluge auftretenden gleichzukommen, kann die Aufstellung der Flugmaschine nicht mehr auf den Rädern selbst sondern auf zwei oder mehreren Stützpunkten, wie Abb 3 darstellt, erfolgen. Der Vorgang ist folgender: Es werden durch geschickte Leute — etwas Theorie ist von Nutzen — die Flugmaschinen nach der üblichen Methode gespannt, jeder Draht erhält eine Nummer und die für die gleiche Tonhöhe entsprechende Distanz der Vorrich-— tung in mm; dies bildet die Grundlage derKon-tro 11-Karte laut Abb. 4. Mit einem geschickten Werkmeister wird mittels einer Stoppuhr (System Taylor) die Kontrolle durchgegangen, dabei die Reihenfolge, welche vorher bestimmt und auf der Karte vermerkt worden ist, eingehalten, die dazu notwendige Zeit in Hundertstel-Minuten notiert; diese Arbeit muß öfters gemacht werden, bis sich keine Un- 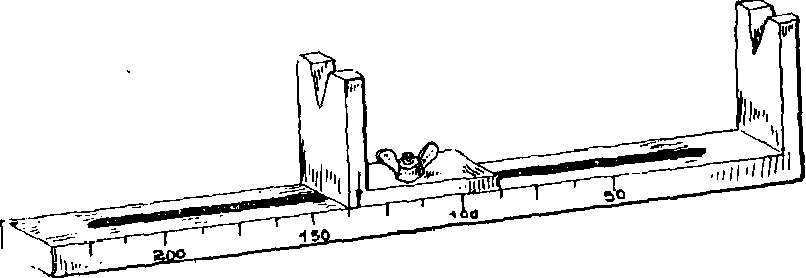 Abb. 2 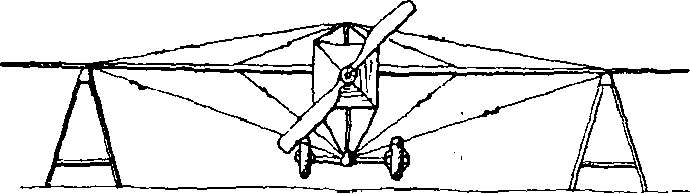 Abb. 3 regelmäßigkeiten ergeben, dabei werden aber eine Menge Hilfswerkzeuge (Messwerkzeuge), z. ß. zur Einhaltung der Tragflächenneigung, notwendig sein. Hierbei darf selbstverständlich nicht die reine Arbeitszeit angenommen werden, sondern es muß ein mindestens 100°/« Zeitzuschlag erfolgen, um kleine Zwischenfälle überholen zu können. Diese Arbeit soll und muß nachgeprüft werden, man muß selbst hier und da an der Maschine einenFehlermachen und bei Nichtbe-achten seitens des Kontrolleurs diesem empfindliche Strafe ei teilen, oder bei Wiederholung — Leichtsinn — mit Entlassung vorgehen, da durch die kleinsten Fehler das größte Unglück geschehen kann. Für jeden Apparat werden solche Kontroll-Karten ausgegeben, welche jedem Flieger verabreicht werden, damit von diesem die Nachkontrolle ausgeübt werden kann. Dadurch werden nicht nur viele Unglücksfälle, sondern auch unzählige Brüche vermieden. 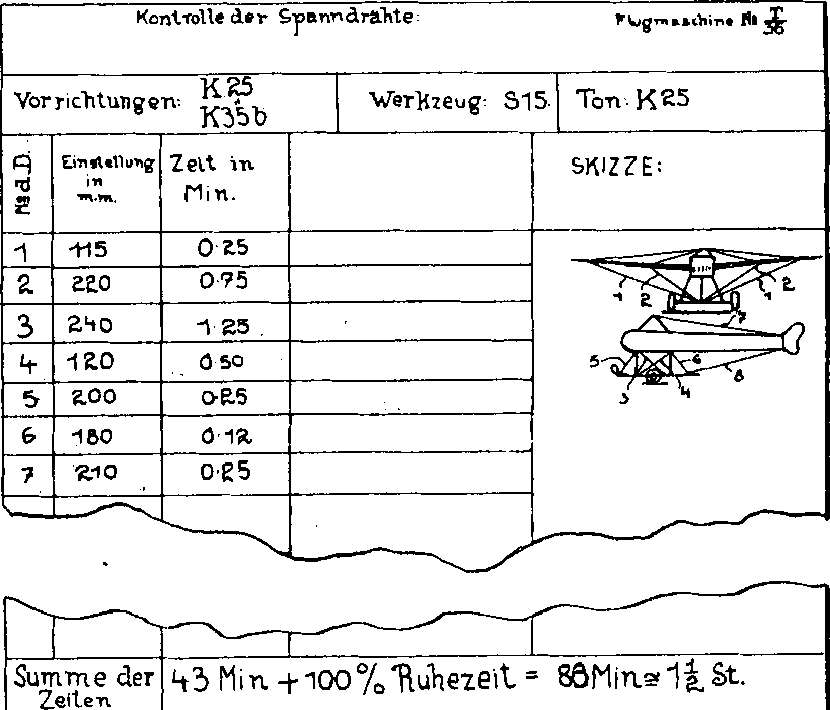 Abb. 4 Korvettenkapitän Behnisch f. Durch den Untergang des „L. II" ist auch das deutsche Flugwesen in tiefe Trauer versetzt worden. Unter den 28 Opfern, welche ihr Leben fürs Vaterland einsetzten, befand sich auch der Korvettenkapitän Behnisch, Decernent für das gesamte Luftfahrwesen im ßeichs-marineamt. Korvettenkapitän Behnisch stand im 40. Lebensjahre und war als Sohn des verstorbenen Direktors der Görlitzer Maschinenbau-Akt.-Ges., Adolf Behnisch in Görlitz geboren. Öchon von frühester Jugend auf zeigte Behnisch für das Maschinenwesen, vielleicht noch angespornt durch das geistige Familienleben, ein hohes Interesse. Es war daher begreiflich, daß er in der Marine Karriere machte. Er trat 1891 in die Marine ein, wurde Navigationsoffizier auf der Kaiseryacht S. M. S „Hohenzollern", später Kommandant des Kanonenbootes „Panther" an der westafrikanischen Küste. Zu Anfang ds. Jahres wurde ihm dann das schwierige Amt eines Decernenten für Luftfahr- Nu. 22__„FLUGSPORT."_Seite_839 wesen im Reichsmarineamt übertragen. In der kurzen Zeit seiner Tätigkeit hatte er es verstanden sich die Sympathien aller Kreisen und Persönlichkeiten zu erwerben und die Aufgaben mit großem Geschick zu lösen. Durch sein liebenswürdiges, äußerst vornehmes  Korvettenkapitän Behnisdi f Decernent für Luftfahrviesen im Reichsmarineamt. Wesen und durch seinen zielbewußten, klaren Blick hat man ihm überall großes Vertrauen entgegengebracht. Seine Tätigkeit im Reichsmarineamt berechtigte zu den größten Hoffnungen. Weitere Flüge um die Nationalflugspende. Schlegel fliegt 1470 km. Eine Glanzleistung vollbrachte am 22. Oktober Schlegel auf einer Gotha-Mercedes-Taube mit Ltn. Schartow als Beobachter. Schlegel startete 12: 16 Uhr vormittags in Gotha und legte bis Tagesanbruch, indem er zwischen Gotha und Mülhausen i. Thür, hin und her flog, 550 km zurück. Um 7:40 Uhr verließ er Gotha und flog in der Richtung nach Johannisthal, welches er um 11 Uhr erreichte. Nach Aufnahme von Betriebsmaterial erfolgte der Weiterflug nach Königsberg, wo er bereits um 3:47 landete. Hierauf beabsichtigte Schlegel nach Inster-burg weiterzufliegen. Die Flieger gerieten hierbei in so dichten Nebel, daß sie die Erdoberfläche nicht mehr erkennen konnten. Zudem versagte der Kompaß, und so steuerten diese planlos im Nebel umher. Als das Wetter für einige Minuten günstiger wurde und die Flieger auf kurze Entfernung wieder sehen konnten, bemerkten sie die Ostsee unter sich. Schlegel machte sofort Kehrt und erreichte nach 20 Minuten wieder die Küste bei Labiau. Die Strecke Gotha-Berlin-Königsberg-Labiau beträgt 920 km, so daß Schlegel also mindestens 1470 km absolviert hat. Thelen fliegt 1330 km. Thelen auf Albatros-Doppeldecker mit Kapitän-Ltn. Berthold als Beobachter startete am 14. Oktober um 12 :31 Uhr in Johannisthal und landete um 5 :55 bei der Kpnigsberger Ballonhalle. Um 7 Uhr erfolgte nach Einnahme von Betriebsstoff der Weiterflug in der Richtung auf Stettin, wo die Flieger 12:45 Uhr landeten. Um 2.20 Uhr erfolgte der Start nach Königsberg, welches sie abends 8:30 erreichten. Die Gesamtflugstrecke beträgt 1330 km. Am 13. Oktober flogen Breton und Janisch auf L. V. G.-Doppeldecker in J ohannisthal ab und landeten nach einer Entfernung von 900 km bei Marienbourg in Belgien. Breton, der steuerte, hatte sich über dem Ruhrgebiet verflogen, da er in Nebel kam und der Kompaß versagte. So irrten beide zweieinhalb Stunden im Nebel umher, bis sie schließlich in besseres Wetter kamen und einen freien Landungsplatz fanden. Sie landeten unbeschädigt und erfuhren zu ihrem Schrecken, daß sie sich in Belgien befande,n. Da sie nun von ihrer vorgezeichneten Route zu weit abgekommen waren und auch zu viel Zeit verloren hatten, gaben sie den Weiterflug auf, nachdem sie 750 km ohne Unterbrechung in der Luft zurückgelegt hatten. Breton ließ den Doppeldecker abmontieren und kehrte mit der Eisenbahn nach Berlin zurück. Einer der günstigsten Flugtage war der 14. Oktober. An diesem Tage starteten wie bekannt Stoeffler und Thelen. Weiter flog in Johannisthal Reichelt auf Harlan-Eindecker mit Hänel als Beobachter in der Richtung nach Frankreich ab. Reichelt startete um 12.11 Uhr und erreichte nach ca. 5 Stunden die Rheingegend. Hier ließ in 2000 m Höhe der Motor nach, so daß Reichelt niedergehen mußte. Der Mond war inzwischen untergegangen und alles stockfinster. Die Landung erfolgte auf einem kleinen Bauernhäuschen, welches wie der Apparat, in Trümmer ging. Am gleichen Tage startete Langer auf L. V. G.-Doppeldecker um 2: 43 Uhr zu einem Flug nach Insterburg, bei heftigem Gegen- wind von oa. 25 Sek.-Meter unter strömendem Hegen und landete schließlich in Dreidorf, da sein Benzinvorrat vollständig erschöpft war. Für die 200 km lange Strecke benötigte er infolge des starken Gegenwindes 8 Stunden» Am 17. Oktober startete um die National-Flugspende Werner Wietig auf Rumpler-Taube 12:36 Uhr vormittags Infolge des starken Nebels verirrte er sich und geriet in die Gegend von Nürnberg, wo er um 10 Uhr eine Zwischenlandung vornahm. Nach Einnahme von Benzin flog er um 11 Uhr weiter und landete 11:30 Uhr in Würzburg. Von hier aus versuchte der Flieger nach Westen zu kommen, wurde jedoch abgetrieben und mußte bei Stendal landen, wo er seinen Apparat beschädigte. Am 17. Oktober flog Friedrich auf Etrich-Eindecker um 1:3 Uhr von Johannisthal ab und kehrte infolge des zu starken Nebels wieder zurück, wo er um 2 Uhr in Johannisthal landete. Um 6:15 startete er in der Richtung nach Osten und erreichte Bromberg gegen 11 Uhr. Er stieg dann wieder auf. und flog nach Elbing, Insterburg, Königsberg, Tilsit, Haidekrug südlich von Memel. dann wieder zurück nach Tilsit, Insterburg und Königsberg, wo er um 4 Uhr nachmittags landete. Die Fahrt war sehr schwierig, da Friedrich dauernd im Nebel flog. Die zurückgelegte Strecke ist 940 Kilometer. Am 18. Oktober startete Lübbe auf Rumpler 100 PS Mercedes-Taube um 12:15 Uhr vormittags in Wanne und erreichte 4:15 Uhr den Johannisthaler Flugplatz, der in dichten Nebel gehüllt war. Trotz der vorhandenen Orientierungs - Benzinfeuer irrte sich der Flieger in der Entfernung des Terrains und beschädigte sein Fahrgestell. Im Wasserflugzeug von Friedrichshafen nach Düsseldorf flog am 15. Oktober der Flieger Ehrhardt auf einem Doppeldecker des Flugzeugbau-Friedrichshafen. Ehrhardt startete 12:30 Uhr in Friedrichshafen für einen Fernflug um die National-Flugspende, machte um 4 Uhr eine Zwischenwasserung in Mannheim, flog um 8 Uhr 30 Min. weiter, passierte 10:15 Mainz und landete bei Bonn. Am 21. Oktober flog er, nachdem er an der Maschine einige Reparaturen vorgenommen hatte, von Bonn weiter und wurde bei Reißholz in der Nähe von Düsseldorf durch eine Fallböe auf den Rhein zur Wasserung gezwungen. Infolge der ungünstigen Witterung wurde die Maschine abmontiert. 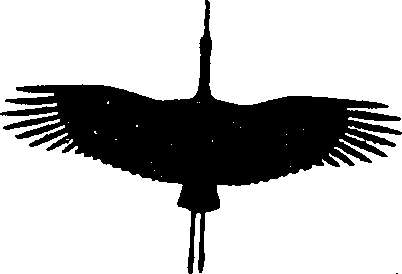 Verbotszonen und erlaubte Luftfahrstraßen. Als Ergänzung der beiliegenden Karte werden nachstehend die Bezirke der Verbotszonen sowie die erlaubten Luftfahrstraßen näher bezeichnet. Deutschland Für Luftfahrzeuge aller Art ist das Ueberfliegen folgender Zonen verboten : 1. An den Grenzen: an der Nordsee Ost-Friesland von der holländischen Grenze bis Brunsbüttelkoog einschließlich Helgoland. An der Ostsee das Gebiet zwischen Rendsburg, Kieler Bucht und Plön; SwinemUnde im Umkreise von 50 km ; die Umgebung von Danzig bis Heia, Pr.-Stargard und Elbing (etwa 100 km Umkreis um Danzig) Königsberg im weiten Umkreise von etwa 120 km; an der Ostgrenze das Gebiet zwischen Angerburg, Johannisburg und Orteisburg; das Gebiet zwischen Marienwerder und Hohensalza ausschließlich Bromberg. Ferner Glatz im Umfang von etwa 30 km. An der Westgrenze: von Basel etwa 120 km hinauf bis Zabern über Straßburg, Colmar mit Einschluß des rechtsrheinischen Gebietes, die Umgegend von Metz auf eine Entfernung von Norden bis Süden von 100 km und 50 km Breite. 2. Innerhalb des Reiches; im Westen Wesel im Umkreis von 25 km, Cöln auf 20—30 km nördlich bis Düsseldorf, südlich bis Euskirchen und Bonn ; Coblenz auf etwa 15 km von St. Goar bis unterhalb Coblenz; Mainz und Wiesbaden auf etwa 50 km im Umfang; Bitsch auf 10 km Umkreis, Speyer und Germersheim auf etwa 25 km nördlich Man iheim, südlich Karlsruhe gerade freilassend, Ulm im Umkreise von 25 km nördlich Geislingen, südlich Illertissen freilassend, Ingolstadt im Umkreise von 30 km; im Osten Qlogau im Umkreis von etwa 30 km; Breslau im Umkreis von 50 km, Posen im Umkreis von etwa 50 km und Cüstrin im Umkreis von etwa 20 km. England und Schottland. Nachstehende Plätze sind in einem Umkreis von 3 geographischen Meilen nach jeder Richtuug hin für Luftfahrzeuge unbedingt verboten. Stadt Kirkwall (Kirkwall Town). Insel Flotta (Island of Flotta). Stadt Thurso (Thurso Town), Landzunge Cromarty (Cromarty Neß). Pier von Invergordon (Invergordon Pier): in der Nähe von Inferneß. Station für drahtlose Telegraphie Aberdeen (Aberdeen Wireleß-Station). Stadt Montrose (Montrose Town) Feste Broughty-Ferry (Broughty Ferry Castle). Insel Inchkeith (Inchkeith Island). Werft von Rosyth (Rosyth Dockyard). Pitfirrane-Park (Pitfirrane-Park). Forth-Brücke (Förth Bridge; bei Edinburgh. Tyne-Mündung, Leuchtti.rm am nördlichen Pier (Tynemouth, North Pier Lighthouse). Eisenbahn-Station Elswick (Elswick Railway Station) bei Newoastle. Station für drahtlose Telegraphie Cleethorpes (Cleet-horpes Wireleß Station) bei Grimsby. Eisenbahnstation Louth (Louth Railway-Station). Wroxham Broad (Norfolk) (Broad = weite seichte, oft sumpfige Wasserfläche) bei Norwich. Eisenbahnstation Weedon (Weedon Railway-Station). Norlhamptonshire. Landspitze Landguard, Wellenbrecher (Felixtowe), Landguard Point, Breakwater (Felixtowe). Kai von Parkeston (Parkeston Quay). Station für drahltose Telegraphie Ipswich (Ipswich Wireleß-Station). Kirche von Shoe-buryneß (Shoeburyness-Church). Fort Tilbury (Tilbury-Fort) Eisenbahnstation Purfleet (Purfleet Railway Station). Mündung des Barking-Flusses (Barking Creek Mouth). Eisenbahnstation Waltham Abbey (Waltham Abbey Railway-Sta-tion). Eisenbahnstation Enfield Lock (Enfield Lock Railway Station). Werft von Chatham (Chatham Dockyard). Landungsplatz Teapot (Teapot Hard). Pachtgut Chattenden (Chattenden-Farm). Allerheiligen-Kirche (Allhallows Church). Lärmturm auf der Insel Grain (Grain Martello Tower) (NB. Martello-Türme oder Lärm-Türme, mit Kanonen besetzt, wurden s Zt, an den Küsten in England gebaut, um einer Landung Napoleon I. zu begegnen). Werft von Sheerneß (Sheerneß Dockyard): an der Themse. Feste Dover (Dover Castle). Fort Archcliffe (Arch-cliffe Fort): am Kanal bei Dover. Eisenbahnstatition Lydd (Lydd Railway-Station). Station Newhaven, Hafen Jetty (Newhaven Station, Harbour Jetty), Fort Cumber-land (Fort Cumberland). Spithead, insbesondere der Raum zwischen einer Linie von Lee-on-Solent Pier nach Wootton Point und einer Linie von Southsea Castle nach Seaview Pier. Werft von Portsmouth (Portsmouth Dockyard). Eisenbahnstation Cosham (Cosham Railway Station). Eisenbahnstation Fareham (Fareham Railway Station). Ctiiver-KIippe, Marine-Signahtation (Culver Cliff Naval Signal .Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten und Flugtechn, Vereine 1913. Tafel XXVIII. Karle der für Luftfahrzeuge verbotenen Zonen bezw. der Onfällpforren. I Gebiete, deren Überfliegen allen Luflfahr- S=====:==^>^y»y J'° zeugen verboten ist. Sl^illEllfMW^''" jr* Einfallpforten " i- ... - «.ϖϖa.-.-.T.."v;"i: Krtsfidnid 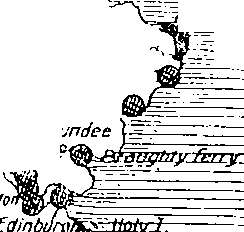 ''"jm-fr.ifsS Absrdee, 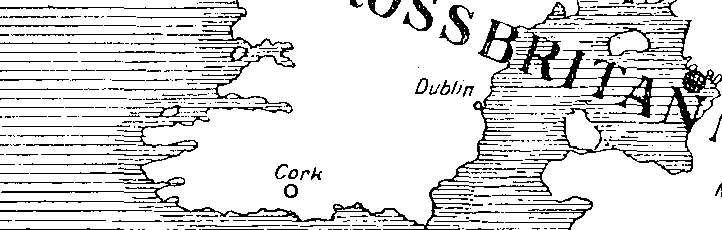 Tynemoutli Newcästle "~ 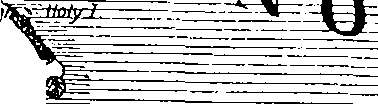 __i_L „ x  oCo/mbra  KonstentinopeT No.22 „FLUGSPORT." ___Seite 843 Station). Leuchtturm auf den Needles (Needles Ligthouse). Docks von Southamp-ton (Southampton Docks). Marchwood-Park (Marchwood Park): in Southampton. Feste Hurst (Hurst Castle) am Solent. Kirche von Osmington (Osmington Church). Pier von Weymouth (Weymouth Pier): in Portland, Zuchthaus von Portland (Portland Confict Prison). Eisenbahnstation Turnchapel (Turnchapel Railway Station). Eisenbahnstation Plymstock (Plymstock Railway-Station). Werft von Keyham (Keyham Dockyard). Werft von Devonport (Devonport Dockyard). Eisenbahnbrücke von Saltash (Saltash Railway Bridge). Landspitze Penlee (Penlee Point): bei Plymouth und Devonport. Insel Thorn Hafen von Milford (Thom Island Milford Hafen). Station für drahtlose Telegraphie Pembroke (Pembroke.Wireleß Station). Eisenbahnstation Old Milford (Old Milford Railway Station). Vorgebirge St. Ann (St. Ann's Head): bei Milford. Stadthaus von Barrow-in-Furness (Barrow-in-Furness Town Hall i Eisenbahnstation Stevenston (Stevenston Railway Station) Pier von Qreenock (Greenock Pier), so viel von Loch-Long als nördlich von einer Linie liegt, die genau in östlicher Richtung von Knap Point gezogen ist, Eisenbahnstation Carrickfergns (Carrickfergns Railway Station). Landspitze Grey (Grey Point). Insel Spike (Spike Island). Werft von Haulbowline (Haulbowline Dockyard): am Fort öf Clyde. Folgende Teile der Küstenlinie sind für die Einfahrt von Luftfahrzeugen in das Vereinigte Königreich freigegeben: Von Fraserburgh bis zum Ythanfluß (Ythan-River). Von Holy Island bis Newbiggin. Von Sutton (Lincolshire) bis Holkham (Norvolk). Von Stansgate Abbey on the Blackwater bis Burnham-on-Crouch. Von Margate bis Walmer Von Rye bis Eastbourne. Von Hove bis Bognor. Von Bridport bis Dawlish. Auszug aus dem vom Staatssekretär unter dem 1. März 1913 auf Grund der Luftfahrt-Gesetze vom Jahre 19tT (1 u. 2 Geö. 5. Kap. 4) und vom Jahre 1913 (2 u. 3 Geo. 5. Kap. 22) erlassene Vorschriften. IV. Flugzeugen die nach England kommen, sind folgende Bedingungen unterworfen. Der Führer eines Flugzeuges hat vor dem Antritt einer Reise nach dem Vereinigten Königreich dnm Ministerium des Innern (Home office) eine Anzeige zu übersenden, in der erstens der in Aussicht genommene Landungsplatz, der innerhalb eines der vorgeschriebenen Landungsbeziike liegen muß, zweitens die ungefähre Ankunftszeit und drittens sein eigener Name und seine Staatsangehörigkeit angegeben sind. Die Anzeige, die als Brief oder Telegramm Ubersandt werden kann, muß so zeitig erstattet werden, daß sie das Ministerium des Innern wenigstens 18 Stunden vor dem Eintreffen des Flugzeuges im Vereinigten Königreich erreicht. 3. Keine Person, die in einem Luftfahrzeug in dem Vereinigten Königreich eintrifft, darf mitführen oder zulassen, daß in dem Luftfahrzeug mitgeführt werden: a) Waren, deren Einfuhr durch das Zollgesetz verboten ist. b) Waren, von denen bei der Einfuhr nach dem Vereinigten Königreich ein Zoll erhoben wird. Ausgenommen sind geringe Mengen, die am Abfahrts-plntz an Bord genommen worden sind, weil sie für den Gebrauch der in dein Luftfahrzeug beförderten Personen während der Reise notwendig sind. c) Photographische Apparate Brieftauben, Sprengstoffe oder Feuerwaffen. d) Postsachen. 4. Der Führer eines Luftfahrzeuges soll, nachdem die Landung bewirkt ist, a) der zuständigen Amtsperson dies persönlich anzeigen und, wenn es sich um ein Luftschiff handelt, ihr den Klarierungsbrief vorlegen; b) einen An-knnftsbericht in der im vierten Anhang vorgeschriebenen Form ausfüllen und der zuständigen Amtsperson übergeben. 5. Der Führer des Luftfahrzeuges darf seine Reise erst fortsetzen, nachdem er von der zuständigen Amtsperson einen Erlaubnisschein erhalten hat, für den, wenn es sich um ein Luftschiff handelt, eine Gebühr von 3 Lstrl., und wenn es sich um ein Flugzeug handelt, eine Gebühr von 1 Lstrl. zu entrichten ist. 6 Er soll auf seiner weiteren Reise, sofern er nicht durch die Bestimmungen des Erlaubnisscheines davon befreit ist, die folgenden Bedingungen erfüllen: a) Wenn es sich um ein Luftschiff handelt, soll wenigstens e i n, von der zuständigen Amtsperson genehmigter britischer Vertreter in dem Luftfahrzeug mitgenommen werden. b) Es dürfen keine photographische Apparate, keine Apparate für drahtlose Telegraphie, keine Brieftauben, Sprengstoffe und Feuerwaffen mitgeführt werden. c) Es dürfen keine Postsachen mitgeführt werden. d) Die Reise ist innerhalb der Zeit und unter Einhaltung des Weges, der in dem Erlaubnisschein angegeben ist, auszuführen. e) Der Flugführer hat sein Zeugnis mitzuführen und es auf Verlangen vorzuzeigen. f) Das Luftfahrzeug soll, bevor es das Vereinigte Königreich verläßt, in einem der vorgeschriebenen Landungsbezirke landen und der zuständigen Amtsperson Anzeige erstatten. g) Wenn eine der Bestimmungen des Erlaubnisscheins infolge eines Unfalles, wegen ungestümen Wetters oder aus einer anderen unvermeidlichen Ursache nicht erfüllt werden kann, soll das Luftfahrzeug, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet, auf den Erdboden niedergehen und der Führer sofort durch Telegramm dem Ministerium des Innern Anzeige erstatten. Befreiungen von diesen Bedingungen dürfen nicht gewährt werden, es sei denn mit vorheriger Genehmigung des Ministerium des Innern. Der Ausdruck „zuständige Amtsperson" bedeutet eine Amtsperson, die von einem Staatssekretär für die Zwecke dieser Verordnung bestellt ist. Der Führer des Luftfahrzeuges muß durch telegrafieren an das Ministerium des Innern oder sonstwie den Namen und Wohnort der Amtsperson ermitteln, der er Anzeige zu erstatten hat, es sei denn, daß die zuständige Amtsperson in dem Klarierungsbrief bezeichnet ist. V. F remd 1 ä ndische Marine- und Armee-Luf tf ah rzeu ge. Fremdländische Marine- oder Armee-Luftfahrzeuge dürfen keinen Teil des Vereinigten Königreichs oder dessen Territorialgewässer Uberfliegen und landen außer auf ausdrückliche Einladung oder mit vorher erhaltener ausdrücklicher Erlaubnis der Regierung Seiner Majestät. Derartige Luftfahrzeuge sollen diejenigen Befreiungen genießen und denjenigen besonderen Bedingungen unterworfen sein, die in der Einladung oder in der Erlaubnis angegeben sind. VI. Britische Marine- und Armee-Luftfahrzeuge. Die vorhergehenden Bestimmungen finden keine Anwendung auf Marineoder Armee-Luftfahrzeuge, die Seiner Majestät gehören oder im Dienste Seiner Majestät verwendet werden. VII. Britische Luftfahrzeuge, die nach dem Vereinigten Königreich zurückkehren. Die durch die vorhergehende Vorschrift Nr. IV festgesetzten Bedingungen, die von Luftfahrzeugen zu erfüllen sind, welche von Plätzen außerhalb des Vereinigten Königreichs kommen, finden keine Anwendung auf ein Luftfahrzeug, das seine Reise vom Vereinigten Königreich aus begonnen hat und dorthin zurückkehrt, vorausgesetzt, daß a) der Eigentümer, der Führer und die Besatzung britische Untertanen sind j b) dem Ministerium des Innern vor oder unmittelbar nach dem Antritt der Ausreise Anzeige erstattet wird. c) die Heimreise innerhalb 30 Tagen nach der Abfahrt aus dem Vereinigten Königreich erfolgt; d) wenigstens 18 Stunden vor dem Eintreffen das Ministerium des Innern die Anzeige von der Heimreise erhält, in welcher der in Aussicht genommene Landungsplatz (der in einem der vorgeschriebenen Landungsbezirke liegen muß) und die ungefähre Ankunftszeit angegeben sind. VIII. Befreiungen. Der Staatssekretär kann, aus besonderen Gründen, Personen, die hierfür durch die Admiralität, das Kriegsministerium oder ein anderes Staatsdepartement empfohlen werden, gänzliche oder teilweise Befreiung von den vorhergehenden Vorschriften bewilligen. IX. Vorbehalt. Keine Bestimmung in den vorhergehenden Vorschriften soll so ausgelegt werden, als wenn durch sie einer Person, die ein Luftfahrzeug steuert, ein Recht zum Landen auf einem Platz gleichsam wider den Eigentümer des Geländes oder andere daran beteiligte Personen verliehen würde, oder als wenn durch sie die Rechte oder die Rechtsmittel einer Person inbezug auf eine durch ein Luftfahrzeug verursachte Verletzung der Person oder des Eigentümers berührt würden gez.: R. Mc. Kenna, Einer der Haupt-Staatssekretäre Seiner Majestät. Ministerium des Innern, Whitehall, den 1. März 1913. Vierter Anhang. Form des Ankunftsberichts. Name und die etwaige Registrierungs-Nummer des Luftfahrzeuges........ Beschreibung des Luftfahrzeuges, Typ, Pferdestärke der Maschinen, Raumgehalt der Hülle, Alter der Hülle und der Maschine, Stärke der Besatzung, Zahl der Passagiere, Natur der Ladung, einschließlich des persönlichen Gepäcks und der persönlichen Habe jeder Art, die befördert werden, Menge des Betriebsstoffes oder der sonstigen flüssigen Feuerung, die sich an Bord befindet, Raumgehalt der Feuerungsbehälter........ Name, Staatsangehörigkeit und Wohnort des Eigentümers............... des Führers................. der Besatzung................ Name, Beruf und Wohnung der etwaigen Passagiere . . . . "........ Abfahrtsplatz................. Bestimmungsort und Weg............ Zweck der Reise............... Dauer der Reise............... Nummer des Zeugnisses des Piloten........ Anmerkung. Wer ein Luftfahrzeug in Zuwiderhandlung gegen die vorhergehenden Vorschriften steuert hat nach Schuldigerklärung eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten oder Geldstrafe von 200 Pfund Sterling oder sowohl Gefängnisstrafe als auch Geldstrafe verwirkt. Ein Luftfahrzeug, das einen Verbotenen Bezirk überfliegt oder zu überfliegen versucht, ebenso ein von einem Platze außerhalb des Vereinigten Königreichs kommendes Luftfahrzeug, das einen verbotenen Teil der Küstenlinie Uberfliegt oder zu überfliegen versucht oder unterläßt, die in der vorhergehenden Vorschrift Nr. 111 in Hinsicht auf die Landung festgesetzten Bedingungen zu erfüllen, wird gemäß § 2 des Luftfahrt-Gesetzes vom Jahre 1913 und den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen angeschlossen. Wenn eine Person in einem Luftfahrzeug irgendwo eines Aktes der Spionage in den Grenzen der Bestimmungen des § 1 des Gesetzes, betreffend die amtlichen Geheimnisse, vom Jahre 1911 sich schuldig macht, hat die Zuchthausstrafe von sieben Jahren verwirkt. Verzeichnis britischer Konsularbeamten, denen durch das Auswärtige Amt die nach Ziffer IV (1) d e r V o rs ch r i f t en vom 1. März 1913 erforderliche Ermächtigung erteilt ist. Statutarische Vorschriften und Verordnungen, 1913, Nr. 243. Luftfahrt. Vom Staatssekretär unter dem 1. März er 1 assene B e s t i m mu ngen, betreffend die Signale und das Einschreiten gemäß § 2 des Luftfahrt-Gesetzes vom Jahre 1913 (2 und 3 Geo. 5. Kap. 22). Auf Grund der mir durch § 2 des Luftfahrt-Gesetzes vom Jahre 1913 erteilten Befugnisse erlasse ich hierdurch die folgenden Bestimmungen : 1. Die Amtsperson, die gemäß dem besagten Paragraphen Signale zu geben und einzuschreiten hat, soll ein durch königliches Patent angestellter Offizier der Marine oder der Armee Seiner Majestät sein 2. Signale, die zu geben sind, wenn ein Luftfahrzeug einen der verbotenen Bezirke überfliegt oder zu überlliegen versucht, oder wenn ein von einem Platze außerhalb des Vereinigten Königreichs kommendes Luftfahrzeug einen verbotenen Teil der Küstenlinie überfliegt oder zu überfliegen versucht oder unterläßt, eine der vom Staatssekretär mit Bezug auf das Landen auf Grund des besagten Gesetzes erlassenen Vorschriften zu erfüllen, sind folgende: Bei Tage: dreimaliges Abfeuern — in Zwischenräumen von nicht weniger als zehn Sekunden — eines Geschosses, das beim Zerspringen Rauch entwickelt. Bei Nacht: dreimaliges Abfeuern — in Zwischenräumen von nicht weniger als zehn Sekunden — eines Geschosses, das rote Sterne oder rote Lichter zeigt. 3. Nachdem ein solches Signal gegeben ist, soll das Luftfahrzeug unvorzüglich auf dem nächsten geeineten Platze landen; mit der Maßgabe, daß, wenn es sich einem verbotenen Bezirke nähert oder Uber einem solchen fliegt, es beim Niedergehen nicht weiter gegen den Bezirk oder in dem Bezirk vordringen soll. 4. Wenn ein Luftfahrzeug wegen ungestümen Wetters, Nebels Maschinenbruchs oder aus einer anderen unvermeidlichen Ursache außerstande ist, auf das Signal hin zu landen, so soll es folgendes Signal geben: Bei Tage : Von der Stelle aus, wo es am klarsten von unten gesehen werden kann, Zeigen einer roten dreieckigen Flagge mit zwei schwarzen Kugeln, die vertikal übereinander angeordnet sind. Bei Nacht: Winken mit einem weißen Licht unter gleichzeitiger Auslöschung der Seitenlichter, und so bald als möglich auf dem nächsten geeigneten Platz im Vereinigten Königreich landen. gez.: R. Mc. Kenna, Einer der Haupt - Staatssekretäre Seiner Majestät. Ministerium des Innern, Whitehall, den 1. März 1913 Oesterreich- Ungarn. Verbotene Zonen: 1. Die italienischeGrenzeist gesperrt bis auf einen Streifen am Blockenpaß von 40 km Breite und einem Streifen zwischen Görtz an dem lsonzo und Diavaco bei Tri est. Die Sperrzone reicht in Tirol bis an den Lauf der Etsch und Rienz, in Kärnten nach Norden an die Drau bis Villach, im Osten bis an den Lauf des lsonzo. Am Adria-tischen Meer: der Küstenstrich an der italienischen Grenze. Triest, Pola, ganz D alm at i e n. 2. Die ganze r uss isch e Grenze. Die Sperrzone umfaßt ganz G a 1 i z i e n. Rußland. Das Ueberfliegen der russischen Gebiete ist unbedingt verboten, gemäß einer Mitteilung der russischen Regierung an den Herrn Reichskanzler. Das erste Verbot erstreckte sich bis zum 14. Juli 1913, wurde jedoch verlängert bis zum 14. Januar 1914. Hcluveiz. Das Ueberfliegen schweizerischen Gebiets ist nicht verboten. Sobald jedoch ein Luftfahrzeug landet, werden, falls keine Zollbeamten zur Stelle, von den Kantonal-Amtspersonen Erhebungen über Herkunft, Art, besondere Erkennungszeichen des Flugzeuges, Person des Eigentümers oder Führers angestellt und an die eidgenössische Oberzolldirektion in Bern weitergemeldet. Diese entscheidet, ob das Fahrzeug wieder aus dem Lande ausgeführt werden soll oder nicht, Befinden sich unter den Insassen des Luftfahrzeugs Militärpersonen in Uniform, so wird das schweizerische Militärdepartement benachrichtigt und die Weitereise des Luftfahrzeugs solange verhindert, bis vom Militärdepartement die Erlaubnis hierzu ejngeht. No. 22 FLUGSPORT." Seite 847 Flugtechnische 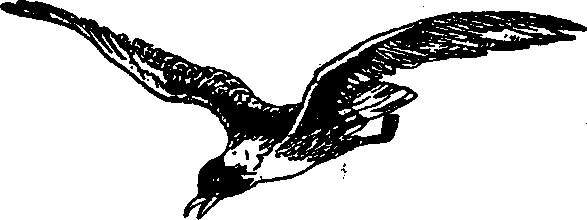 Rundschau. Inland. Flug/iihrer-Zeugnisse haben erhalten: No. 534. Koester, Dr. jur., Attache bei der badischen Gesandschaft, Berlin W. 9, geb. am 1. Juni 1883 zu Mannheim, für Wasserzweidecker (Friedrichshafen), Flugplatz Bodensee, am 26. September 1913. No. 535. Heß, Ernst, Mainz-Gonsenheim, geb. am 8. Januar 1893 zu Wiesbaden, für Eindecker (Goedecker), Flugplatz Großer Sand, am 26. Sept. 1913. No. 536. Kuhlmann Leopold, Leutnant a. D., Mainz-Gonsenheim, geb. am 24. August 1888 zu Cöln, für Eindecker (Goedecker), Flugplatz Großer Sand, am 26. September 1913. No. 537. Schmidt, Karl, Johannisthal, geb. am 30. Juni 1893 zu RUdigers-hagen, Kr. Worbis, für Eindecker (Harlan), Flugplatz Johannisthal, am 26. Sept. 1913. No. 538. Berthold, Kapitänleutnant, Putzig (Westpr.), Marine-Flieger-Abteilung, geb. am 1. Febr. 1885 zu Berlin, für Zweidecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 26 September 1913. No. 539. Ditzuleit, Ernst, Görries bei Schwerin, geb. am 28. Febr. 1892 zu Bühl in Baden, für Eindecker (Fokker). Flugplatz Görries bei Schwerin, am 27. September 1913. No. 540. Thiele, Wilhelm, Halstenbek, Kr. Pinneberg in Holstein, geb. am 18. Januar, 1891 zu Elberswalde, für Eindecker (Grade), Luruper Exerzierplatz Altona-Bahrenfeld, am 27. September 1913. No. 541. Roitsch, Paul, Burg bei Magdeburg, geb. am 13. Juni 1888 zu Görlitz, für Eindecker (Schulze), Flugfeld Madel bei Burg, am 29. Sept. 1913. No. 542. Hammer, Otto, Hannover, geb. 5. Oktober 1892, für Eindecker (Golha-Taube), Flugfeld Hamburg-Fuhlsbüttel, am 29. September 1913. No. 543 Otte, Reinhold, Ingenieur, Bln.-Lichterfelde W., geboren am 16. Dezember 1888 zu Hamburg, für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 29. September 1913. No. 544. Nolting, Wilhelm, stud. ing., Herne (Westf.), geboren am 28. Februar 1893 zu Herne, für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 30. September 1913. No 545. Bernins, Karl, Heinz Berlin W. 57, geb. am 26. Dezember 1886 zu Niedernhausen bei Darmstadt, für Zweidecker (Wright), Flugplatz Johannisthal, am 30. September 1913. No. 546. Schnell, Heinrich, Leutnant i. bayer. Inf.-Rgt. Orff, Geimersheim, geb. am 21. Dezember 1888 zu Mauchenheim (Pfalz), für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 30. September 1913. No 547 Paiberg, Hermann, Ingenieur, zurzeit Lindenthal bei Leipzig, geb. am 21. Dezember 1884 zu Osnabrück, für Zweidecker (Deutsche Flugzeugw.), Flugplatz Lindenthal, am 30. September 1913. No. 548. Schwann, Ludw., Mainz-Gonsenheim, geb. am 31. August 1892 zu Straßburg i. Eis., für Eindecker (Goedecker), Flugplatz Großer Sand, am 30. September 1913. No. 549. Denicke, Kail August, Erfurt, geb. am 22. August 1892 zu Bremen, für Zweidecker (Deutsche Flugzeugwerke), Flugfeld der Deutschen Flugzeugwerke, am 1. Oktober 1913. No. 550. Linke, Bernhard, Altenburg, geb. am 22. September 1894 zu Altenburg, S.-A., für Eindecker (Deutsche Flugzeugw.), Flugfeld der Deutschen Flugzeugwerke, am 2. Oktober 1913. No. 551. May, Richard, stud. rer. techn., Posen, geb. am 6. Sept. 1890 zu Posen, für Eindecker (Rumpier-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 2. Okt. 1913. No. 552. Mees, Leo, Metz-Sablon, geb. am 29. Februar 1888 zu Metz, für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 2. Oktober 1913. No. 553. Meißner, Georg, Monteur, Berlin-Wilhelmsberg, geboren am 10. April 1894 zu Nebra a. Unstrut, Kr. Querfurt, für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 3. Oktober 1913. No. 554. Iwan, Richard, Niederwürschnitz i. Erzgebirge, geboren am 15. April 1890 zu Dresden, für Zweidecker (Deutsche Flugzeugw.), Flugfeld der Deutschen Flugzeugwerke, am 4. Oktober 1913. No. 555. Vollrath, Walter, stud. ing, Erfurt, geb. am 2. Februar 1889 zu Altona, für Zweidecker (Schwade), Flugplatz Drosselberg, am 6. Okt. 1913. No. 556. Gruner, Bruno, Neurode in Schles., geb. am 7. August 1885 zu Neurode, für Zweidecker (Schwade), Flugplatz Drosselberg, am 6. Okt 1913. No. 557. Degener, Werner, Bln.-Lichterfelde, geb. am 20. Mai 1887 zu Berlin, für Zweidecker (Ago), Flugplatz Johannisthal, am 6. Oktober 1913. An,eiϖkannte Mekoiϖde. Vom Deutschen Luftfahrer-Verband sind folgende Höchst-Flugleistungen anerkannt worden: Deutscher Dauerflug-Rekord mit 3 Fluggästen dem Flieger Gsell ausgeführt am 3. September mit 3: 11 : 14 Std. auf Doppeldecker des Flugzeugbau-Friedrichshafen. Deutscher Dauerrekord ohne Fluggast dem Flieger Langer ausgeführt am 26. September mit 9 : 1 : 57 Std. auf Pfeil-Doppeldecker der Luftfahrzeug G. m. b. H. Deutsclie Höhenrekords dem Flieger Sablatnig auf Union-Pfeil-Doppeldecker ausgeführt am 28. September mit 2 Fluggästen 2040 Meter „30 „ „3 „ 2830 „ „ 1. Oktober „ 4 „ 2080 „ „4. „ „5 „ 890 „ Pegoud's Sturzflüge in Deutschland. Am Samstag und Sonntag veranstaltete ein rühriger Unternehmer aus Oesterreich auf dem Flugplatz Johannisthal Sturzflüge. Der Flugplatz Johannisthal hatte einen Besuch aufzuweisen, wie noch nie zuvor. Das Geld wanderte in die Tasche des österreichischen Managers und wohl nur zu einem Teil in die Tasche des mutigen Franzosen. Auch in Dresden soll Pegoud seine Kunststückchen, für welche er 20000 Mark erhält, zeigen. Mit verschiedenen anderen Flugplatz-Verwaltungen wird zurzeit unterhandelt. Die Flugplatz-Verwaltung Wanne hat ein derartigesAn-erbieten abgelehnt, mit der Begründung, daß sie das Geld lieber deutschen Fliegern zukommen lassen werde. Bravo ! Von den Plugplätzen. Auf dem, Flugplatz Cöln-Merheitn flog Otto Heller auf einem Eindecker der R. Hoos-Flugzeugwerke und Fliegerschule 1:57 : 20 Std. um die Nationalflugspende mit einem 50 PS Anzani-Motor. Er erhielt demnach 1000 Mark aus der Nationalflugspende. Wenn ihm das Benzin nicht vorzeitig ausgegangen wäre, wären es 2000 Mark gewesen. In diesem Falle kostet das Liter Benzin 1000 Mark. Pe'goud's Rücke nfliige in Berlin-Johannisthal. Jblagplatz Oberwiesenfeld. Bereits in der letzten Nummer berichteten wir über die Vier-Stundenflüge um die Nationalflugspende von SchönerundScheuermann, auf Otto-Doppeldecker. Ferner haben um die Nationalflugspende geflogen : Schmidt 5 Stunden. Schachenmayr 4 Stunden, Moosmeier 3 Stunden, Weingärtner 4 Stunden und Weyl 3 Stunden. Der Gesamtbetrag, welcher aus der Nationalflugspende gewonnen wurde, beträgt somit 35000 Mark Die Ausbildung, sowie die Erledigung der militärischen Ueberlandflüge vollzog sich ohne jeden Unfall. Sämtliche Flugschüler und Flieger führten den Ueberlandflug mit Fluggast aus. Lt. Geyer fliegt 1100 Kilometer in 16 Stunden. Eine außerordentlich gute Flugleistung hat der Fliegerleutnant Geyer mit Lt. Kreitz als Beobachter auf einem Aviatik-Doppeldecker ausgeführt. Die Flieger stiegen am 15 nachts um 12 Uhr auf dem Flugplatz Habsheim auf und erreichten nach einer kurzen Zwischenlandung in Staßfurt vormittags 8:5 Uhr Johannisthal. Nach Aufnahme von Betriebsstoff erfolgte gegen 11 Uhr der Weiterflug nach Königsberg. Gegen 6 Uhr landeten die Flieger in Marienwerder. Wettbewerbe. Militär-Flugwettbewerb München 1913. 19. 20. und 21. Oktober. An dem vom Bayr. Aeroklub mit Unterstützung des Münchner Vereins für Luftschiffahrt, des Königl. Bayr. Automobilklubs und des Allgemeinen Deutschen Automobilklubs organisierten Militär-Flugwettbewerb nahmen folgende Militärflieger teil: Oblt. Hey der (Beob. Oblt. von N egelein) Albatrostaube 100 PS Mercedes Lt. Dörring ( „ Oblt. von Nordt) L.V.G.-Doppeld.lOO PS Lt. Schulz ( „ Lt. von Dassel) L.V.G.-Doppeld.lOOPS Lt. Hailer ( „ Lt. d. R. Jung) Otto-Doppeld. 100PS Lt. Götz ( „ Oblt. Ho Imberg) Lt. Em rieh ( „ Oblt. Mair Lt. Sc h I emme r( „ Oblt. Jäg erh uber) „ „ Lt. De mmel ( „ Lt. Vogel ey) „ „ Lt. Walz ( „ Oblt. Rutz Oblt. Erhard ( „ Oblt. Könitz) Lt. Behl ( „ Obl". Leonhard Lt. Moosmeir ( „ Oblt. Haberfj „ „ Unter-Off Selmer Otto-Doppeldecker 100 PS Argus Unter-Off. Munkert „ Unter-Off. S ö 11 n e r Unter-Off. Ey sei ein „ „ „ ,; Unter-Off. Scholl Die Veranstaltung wurde leider durch die ungünstige Witterung stark beeinträchtigt. Der Wettbewerb begann am Sonntag nachmittags mit einer Meldeabwurf-Konkurrenz; hieran anschließend fand der Notlandungswettbewerb statt, offen nur für Offiziersflieger. Hierbei mußten die Flugzeuge in einem abgegrenzten Viereck von 100:150 m mit abgestelltem Molor landen. Die Flüge verliefen zur vollsten Zufriedenheit und ohne jeden Unfall. Infolge des einbrechenden Nebels mußten die Flugveranstaltungen gegen Uhr abgebrochen werden. Am Montag den 20. d. M. herrschten wiederum die gleichen ungünstigen Witterungsverhältnisse, sodaß der Beginn der Fluge, der auf 8 Uhr morgens angesetzt war, von Stunde zu Stunde verschoben werden mußte. Kurz nach 12 Uhr machte Lt. Hailer einen Probeflug, um festzustellen, ob es ratsam sei den militärischen Aufklärungsflug nach Augsburg zu unternehmen. Die Beobachtungen des Fliegers ließen es jedoch empfehlenswert erscheinen, den Flug ganz abzusagen. Dagegen wurde ein Notlandungswetlbewerb der Fliegerunteroffiere eingeschaltet, der nach seinen Anfang nahm. Nach diesem Notlandungs-wettbewerb, der glatt verlief, schloß sich nach 1 Uhr der Höhenfltigweltbewerb der Unteroffieziere an. Auch am Dienstag den 21. Oktober verhinderte vormittags undurchdringlicher Nebel die volle Entfaltung der Leistungsfähigkeit unserer Offiziersflieger. Erst gegen 1 Uhr konnte an einen Aufstieg gedacht werden. Lt. Götz unternahm alsdann einen Probeflug, um zu sehen, wie die Nebelverhältnisse in der Höhe sind, er meldete jedoch, daß schon von SO m Höhe der Flugplatz nicht mehr zu sehen wäre, daß es jedoch gegen Süden zu heller sei. Auf diese Nach" rieht hin wurde ein neuer Wettbewerb organisiert; die Aufklärungsübung nach Augsburg wurde aufgegeben und an ihre Stelle trat ein Schnelligkeitsdreieckflug. — No 22 „FLUGSPORT." Seite 85\ Die Aufgabe bestand darin, vom Start des Flugplatzes aus in kürzester Zeit nach Dietersheim, Lohhof, wieder zurück zum Flugplatz Oberwiesenfeld zu fliegen. Die einfache Strecke betrug rund 45 km. — In rascher Reihenfolge starten sodann die Flieger und waren dann in nördlicher Richtung verschwunden. Alle zurückkehrenden Flieger erzählten, daß der Nehel sehr tief lag und sie bei den Wendemarken bis 3 m herabfliegen mußten. Der Flug gehöre zu den schwierigsten, die sie je zurückgelegt. Während der Flüge war noch aus Köln auf dem Luftwege eine Rumpier-Taube angekommen, die Oblt. Kolbe führte und dessen Passagier Hauptmann S etil t et us war. Die Offiziere hatten beabsichtigt, an der Konkurrenz teilzunehmen und den Luftweg Köln - Trier - Metz Straßbnrg—Ulm gewählt. Sie mußten in Ulm wegen starken Nebels niedergehen, stiegen am nächsten Tage auf landeten aber aus demselben Grunde am Montag nachmittag in Pasing und flogen erst am Dienstag nach Oberwiesenfeld.  Der neue Hanusthke-Eindecker. Vorder- und Hinteransidit. Rechts in der Mitte, Hanuschke. Während des Schnelligkeitsfluges der Offiziere führten zwei der Unteroffiziersflieger, deren Barographen am Montag die Höhenmessungen nicht ganz richtig angezeigt hatten, noch ihre Höhenkonkurrenzflüge durch, wobei Unteroffizier Söllner die ansehnliche Höhe von 2200 m erreichte. Die Preisverteilung fand am Dienstag abend in den vornehmen Räumen des Kgl. Bayr. Automobilklubs statt. Das Ergebnis des Militär-Flugwettbewerbes lautet: Meldeabwurf-Konkurrenz: Oberlt. Schlemmer und Oblt. Jä g erhübe r: Preise des Bayer. Aeroklubs: Oblt. Walz und Oblt. Rutz: Preise des Kgl. Bayer. Automobiklubs; Lt. Em e rieh und Oblt. Mair: Preise des Kgl. Münchener Vereins für Luftschiffahrt; Lt. Moosmeier und Oblt. Haberl: Preise des Allgern. Deutschen Automobilklubs; Lt. Götz: Preis des Herrn Ziegler; Oblt. Holmberg: Preis des Geheimrats Prof. Dr. Linde; Lt. Schulz: Preis des Kommerzienrats Probst; Lt. v. Dassel: Preis des Kommerzienrats Aust. Notlandungs-Wettbewerb: Oblt. Erhard: Preis des Grafen Pappenheim; Lt. Emeri ch: Preis des Majors Czermak und des Dr. Freiherrn v. Hirsch; Lt. Hai ler: Preis des Herrn Zachmann; Lt. Behl: Preis des Herrn Hopf (Nürnberg); Lt. Moosmeier: Preis des Bayerischen Aeroklubs. Schnelligkeits-Wettbewerb: Preise des Kriegsministeriums erhielten: Oberlt. Erhard und Oberlt. Freiherr v. Könitz. Lt. Hai ler und Lt. d. R. Jung, Lt. Emerich und Oblt. Mair, Lt. Götz und Oblt. Holmberg. Preise für die Gesamtleistung: Oblt. Erhard: Ehrenpreis Sr. k. H. des Prinz-Regenten; Oblt. Freiherr v. Könitz: Preis des Prinzen Rupprecht; Lt. Emerich: Preis des Prinzen Leopold; Oblt. Mäir: Preis des Prinzen Heinrich; Lt. Hailer: Preis des Prinzen Georg; Lt. d. R. Jung: Preis des Prinzen Konrad; Lt. Götz: Preis des Prinzen Alfons; Oblt. Holmberg: Preis des Bayer. Aeroklubs. U n t e r of f i zi er-Wet tbe w e rb: Unteroffiziere Söllner, Scholl und Eißelein: Preise des Kriegsministeriums; Unteroff. Selm er: Preis von der Inspektion des Ingenieurkorps; Unleroff. Mu nkert: Preis des Bayerischen Aeroklubs. Verschiedenes. V. Internationale Luftfahrzeug-Ausstellung Paris 1913. Durch eine jüngst im „Journal Officiel" veröffentlichte Verordnung des Präsidenten der Französischen Republik sind, wie die „Ständige Aüsstellnngskommission für die Deutsche Industrie" im Anschluß an frühere Informationen mitteilt, die Räume der vom 5.-25. Dezember 1913 im Grand Palais des Champs-Elysees zu Paris stattfindenden „V. Internationalen Luftfahrzeug-Ausstellung" als Zollzwischenlager erklärt worden. Die für die Ausstellung bestimmten Gegenstände werden daher nach den für den Durchgangsverkehr geltenden Bestimmungen ohne Zolluntersuchung an der Grenze unmittelbar nach den Austellungsräumlichkeiten geleitet. Die Ausstellungsdrucksachen können an der Geschäftsstelle der Ständigen Ausstellungskommission (Berlin NW. 40, Roonstr. 1) eingesehen werden. Die Einweihung des Flugplatzes Dresden fand am 26. Oktober in Anwesenheit des Königs Friedrich August bei prachtvollem Wetter statt. Ein Flug Berlin —Breslau 1914 beabsichtigt der Schlesische Aero-Club zu veranstalten. 4 Ein neuer Plugplatz bei Brandenburg a./Havel soll demnächst errichtet werden. Deutscher Fliegerbund. Am 20. Oktober fand im Hotel Frankfurter Hof, Frankfurt a. M. die IV. ordentliche Bundesversamlung des Deutschen Fliegerbundes statt. Von den vertretenen Vereinen sind zu nennen: der Frankfurter Flugsport-Club, der Württeinbergische Flugsport-Club, der Nürnberger Verein für Luftfahrt und Flugtechnik und der Frankfurter Flugtechnische Verein. Auf Antrag des Präsidiums wurde der Beschluß gefaßt, den Deutschen Fliegerbund aufzulösen. Der Fliegerbund hat seine Aufgabe, nämlich die Erweckung eines größeren Interesses für das deutsche Flugwesen, erfüllt. Bekanntlich organisierte der im Jahre 1910 als Kartell der rein flugsportlichen Vereine im Deutschen Luftfahrer-Verbande gegründete Deutsche Fliegerbund den 1. Ueberlandflug Frankfurt—Mainz—Mannheim, später den 1. deutschen Wasserflugzeugwettbewerb in Heiligendarnm und den 1. Bombenwurfwettbewerb in Gotha. Das Präsidium hat seit der Gründung Prinz Albert zu Schleswig-Holstein-Glücksburg geführt. Der Lindenthaler Flugplatz-Verein hat mit der Leipziger Luftschiffhafen und Flugplatz Akt.-Ges. einen Vertrag abgeschlossen, wonach der Lindenthaler Flugplatz-Verein gegen Erstattung einer Abfindungssumme sich auflöst. ____liJK 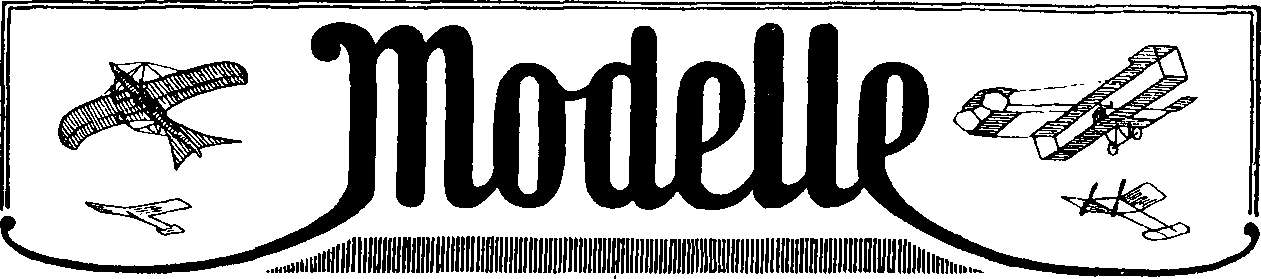 Das Bowick-Eindecker-Modell kann infolge seiner übersichtlichen Konstruktion mit ganz geringen Hilfsmitteln hergestellt werden. Statt des sonst üblichen Motorstockes ist ein fischleibartiger Rumpfbau vorgesehen, der aus 6 mm starken Hickoryleisten zusammengesetzt und mittels Seidenfäden verspannt ist. In dem dreieckigen Rumpf befindet sich ein starker Gummiantrieb. Derselbe besteht aus zehn 6 mm starken Gummi" strängen von rechteckigen Querschnitt. Die hiervon angetriebene Mahagoniluftschraube hat einen Durchmesser von 30 cm und eine Steigung von 35 cm. Zu ihrem Schutze ist das Fahrgestell möglichst weit nach vorn verlegt. Die aus 1,5 mm starken Stahldraht hergestellte Radachse trägt an ihren Enden zwei 5 cm große Laufräder. Dicht neben derselben laufen die vier Fahrgestellstreben spitz auf der Radachse zusammen. Sie bestehen aus dem gleichen Material wie die Rumpleisten. Die 160 qcm großen Tragflächen sind mit Rohseide bespannt. Das freitragende Ende der nach Wright gewölbten Rippen ist elastisch. Jeder Tragflächenholm wird nur einmal von unten und oben durch ein dünnes Bowden-drahtseil verspannt. Am Ende des veriüngten Rumpfes befindet sich die dreieckige Schwanzfläche. Dieselbe ist mit einstellbaren Höhensteuerklappen versehen, zwischen denen ein aufwärts geschweiftes Seitensteuer angebracht ist. Eine leichte Schleifkufe unterstützt den Schwanz. Das Modell erreicht bei einem Gewicht von 400 gr eine Flugweite von 140—160 Metern. Frankfurter Flugmodell-Verein. (Geschäftsstelle: Frankfurt a. M, Eppsteinerstr. 26.) Am Sonntag den 19. d Mts. wurde unser neuer Modellflugplatz an der Festhalle zum ersten Male in Betrieb genommen. Die Beteiligung war eine sehr rege. Am Start erschienen W. May (Pfeil-Eindecker), H. Klein (Eindecker „Ente", Rumpf-Dreidecker), Koch (Eindecker), Paul David (Pfeil-Dreidecker), Ropietz (Eindecker), Karl und Adolf Jäger (Eindecker), Zilch (Eindecker), Lamm (Eindecker „Ente"), Ripper (Eindecker „Ente"). Besondere Beachtung fand der Pfeildoppeldecker von David, welcher in schönen Gleitflügen landete. Ripper führte mit seiner „Ente" einige wohlgelungene „Pegoud"fliige aus. Die nächste Mitglieder-Versammlung findet Donnerstag den 6. November im „Stadtgarten" statt. Uebungsflüge werden jeden Sonntag Vormittag zwischen S und 12 Uhr auf dem Gelände an der Festhalle abgehalten und wird hierbei um recht zahlreiche Beteiligung gebeten. Der Dresdener Modellflug-Verein veranstaltet am 3. November ein Modellwettfliegen in kleinem Maßstabe, wozu zahlreiche und wertvolle Preise zur Verfügung stehen. Ferner findet im Mai 1914 eine Ausstellung mit darauffolgendem Wettbewerb statt. Anmeldungen und Auskunft durch Carl Schindler, Dresden A, Uhlandstraße 27. 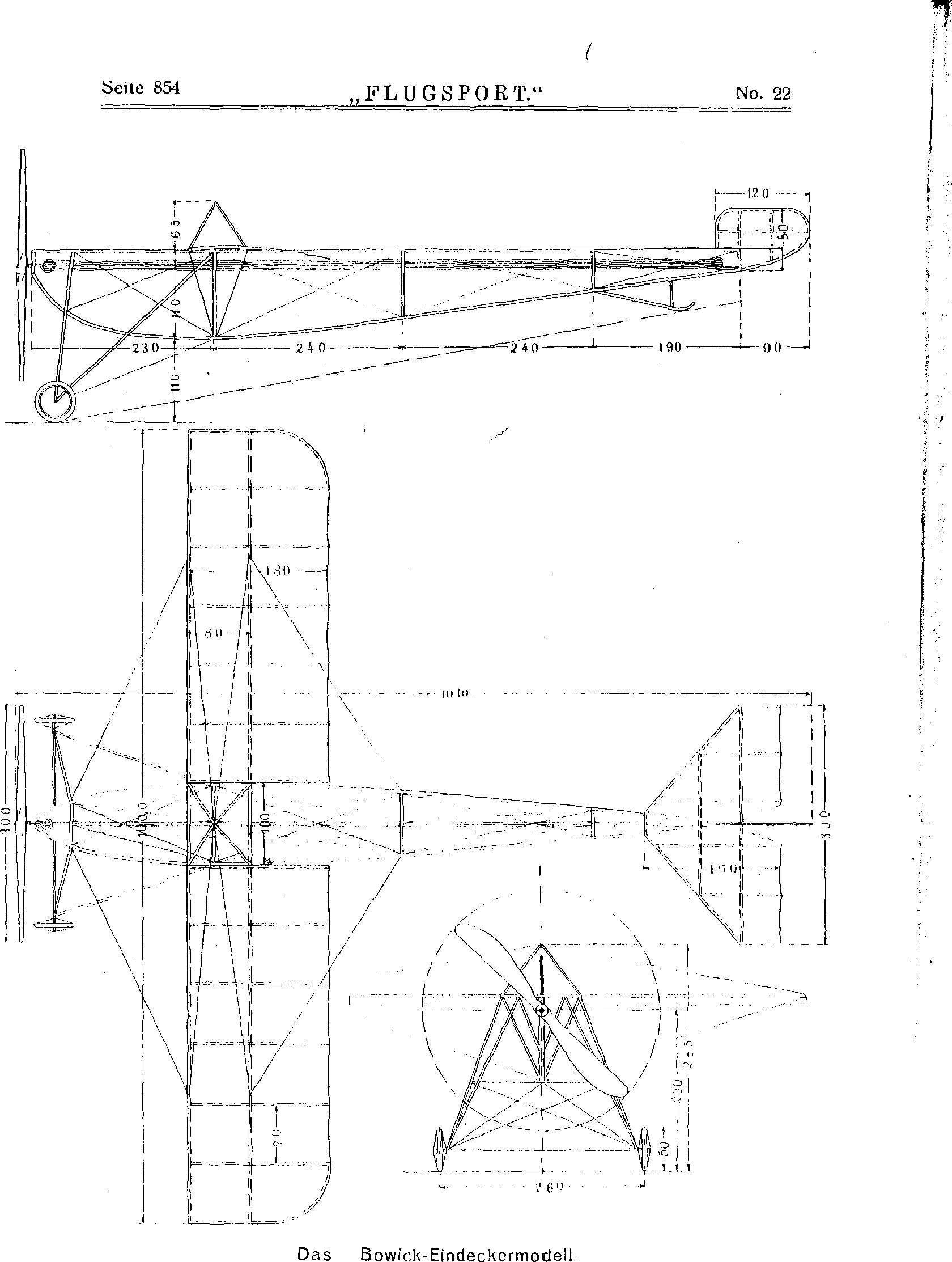 ( Modell-Flugsport-Club Herne. Bei dem am Sonntag den 19 Oktober veranstalteten Uebungsfliegen erzielten das Eindeckermodell Q. K. 19 die besten Resultate. Die erreichten Fluglängen betrugen 51 und 62 m bei Handstart. (Wegen des schlechten Terrains konnte kein Bodenstart erfolgen). Am Sonntag, den 26 Oktober fand aus Anlaß des einjährigen Bestehens des M -F.-C. ein gemeinsames Preisfliegen statt Die Geschäftsstelle des M.-F.-C. befindet sich Herne, Goethestrasse 17, Schriftwart Arthur Kamien. 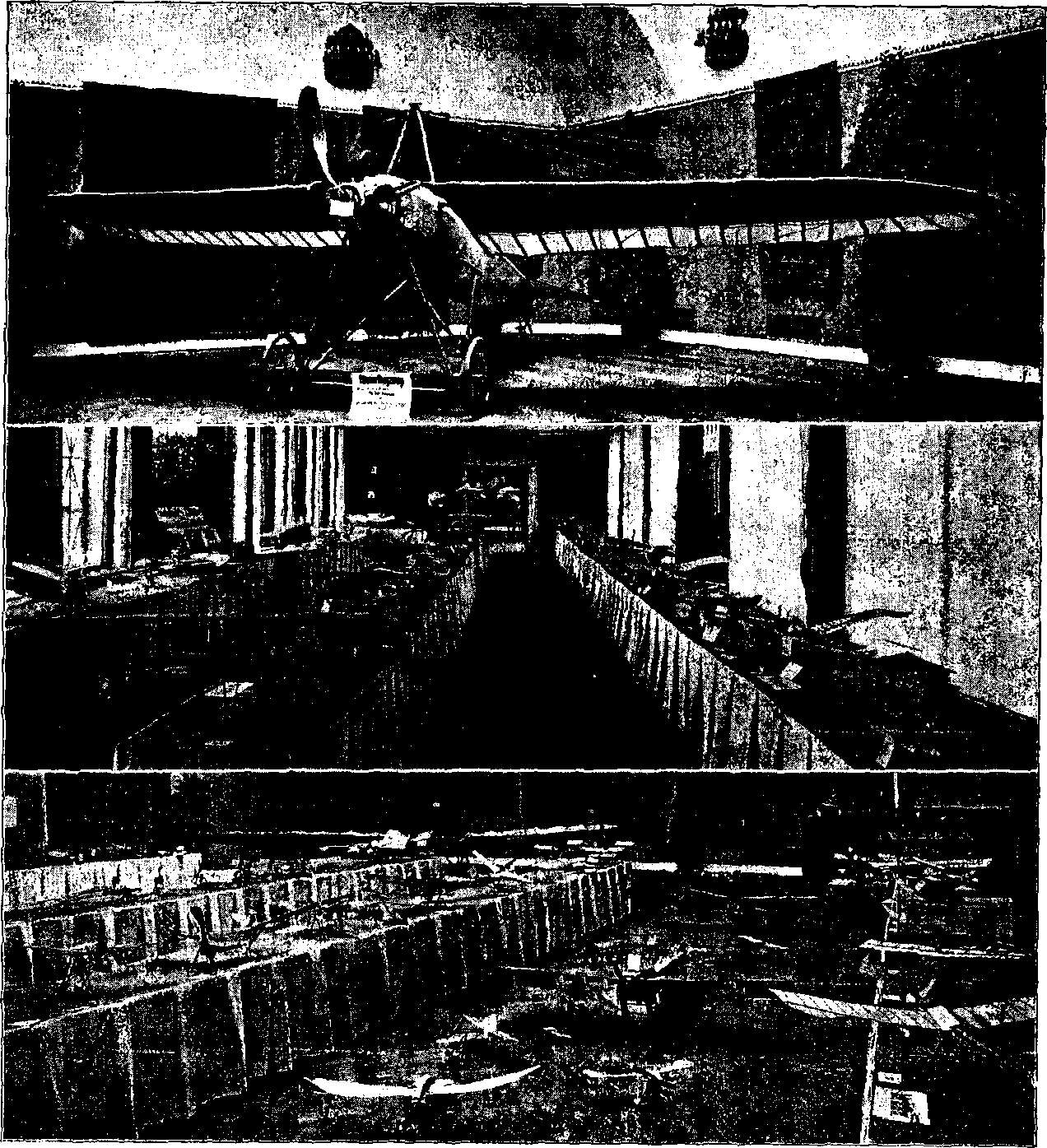 Von der Darmstädter Modell-Ausstellung. Oben: Eindecker mit 30 PS R,. A. W.-Motor, erbaut von der Sport-Abteilung des Vereins für Luftfahrt. Unten: Ansichten in Saal 2 und 3 der Ausstellungsräume. Personalien. Infolge der ausgezeichneten Leistungen der Flieger und Beobachter im letzten Kaiser-Manöver sind noch folgende Orden6auszeichnungen verliehen worden: Den Roten Adlerorden IV Klasse erhielten: Wagenführ, Hauptmann beim Stabe des Flieger-Bataillons Nr. 1, Grade, Hauptmann und Kompagniechef im Flieger-Bataillon Nr. 1. Letzte Fernflüge. Am 27. Okt. flog Oberltn. Castner mit Ltn. Böhmer auf Albatros - Mercedes - Taube von Cöln über Johannisthal nach Posen. Die Offiziere brachten 710 km hinter sich. Am 27. Okt. starteten in Johannisthal Ernst Stoeffler der jüngere von den fliegenden Brüdern mit Ing. Seekatz auf Albatros-Doppeldecker 100 PS Mercedes in der Absicht nach Frankreich zu fliegen. Die Flieger passierten in großer Höhe Westfalen, das Industriegebiet. Nach einer Zwischenlandung hinter Hagen in der Nähe von Dortmund zwecks Aufnahme von Betriebsstoff landeten die Flieger nachmittags 4 Uhr in Cöln auf dem Militär-Flugplatz. Infolge des Gegenwindes kam Stoeffler nur langsam vorwärts. Nach einem kurzen Aufenthalt in Cöln startetn die Flieger zum Weiterflug nach Frankreich. Wie die letzten Nachrichten verlauten landeten dieselben in Laon. Am 28. Okt. startete Kühne auf 100 PS Albatros-Mercedes-Taube 12:45 Uhr vormittags. Kühne hatte einen Riesen-Benzin-Tanks eingebaut, welcher für 9 Stunden Betriebsstoff faßte. Leider setzte nach 3 stündigem Fluge ein Vergaserbrand ein, der den Flieger zwang bei Groß-Almerode im Sturzflug zu landen. Das Flugzeug verbrannte und Kühne kam mit einigen Verletzungen davon. Ferner startete in Johannisthal-Felix Laitsch auf 100 PS L. V. G.-Mercedes-Doppeldecker mit Passagier, in der Absicht nach Frankreich zu fliegen. Ueber den Verlauf liegen noch keine Nachrichten vor. Patentwesen. Aus einzelnen Flügeln bestehender Propeller, insbesondere für Flugzeuge, bei welchem Drähte o. dgl. zur Erhöhung der Festigkeit verwendet sind.*) Aus verschiedenen nicht näher zu erörternden Gründen ist man davon abgekommen, die einer hohen Zentrifiigalbeanspruchung unterworfenen Propeller *) D. R. P. Nr. 2B0829. Hellmuth Hirth in Berlin. für Luftfahrzeuge aus den die größte Festigkeit besitzenden Metallen (z. B. Stahl) herzustellen, und verwendet vorzugsweise Propeller aus Holz. Bei diesen nun besteht die Gefahr des Spitterns, besonders wenn das Holz nicht homogen genug ist. Ganz besondere Schwierigkeiten treten auf, wenn es sich um Propeller mit verstellbarer Flügelneigung handelt, bei welchen der Propeller aus mindestens drei Teilen, zwei Flügeln und einer Nabe, bestehen muß, und wobei eine genügend sichere und den Flügel möglichst wenig schwächende oder ungünstig beeinflussende Befestigung (ohne scharfe Einschnitte) an der Propellernabe erreicht werden sollte. Diesen Forderungen ist nun gemäß der Erfindung durch eine neuartige Armierung der Propellerflügel genügt. In die aus Holz bestehenden Propellerflügel, welche bekanntlich aus einzelnen Brettchen zusammengeleimt werden, sollen nämlich Drähte, Seile, Bänder o. dgl. von hoher Festigkeit eingebettet Abb. 1 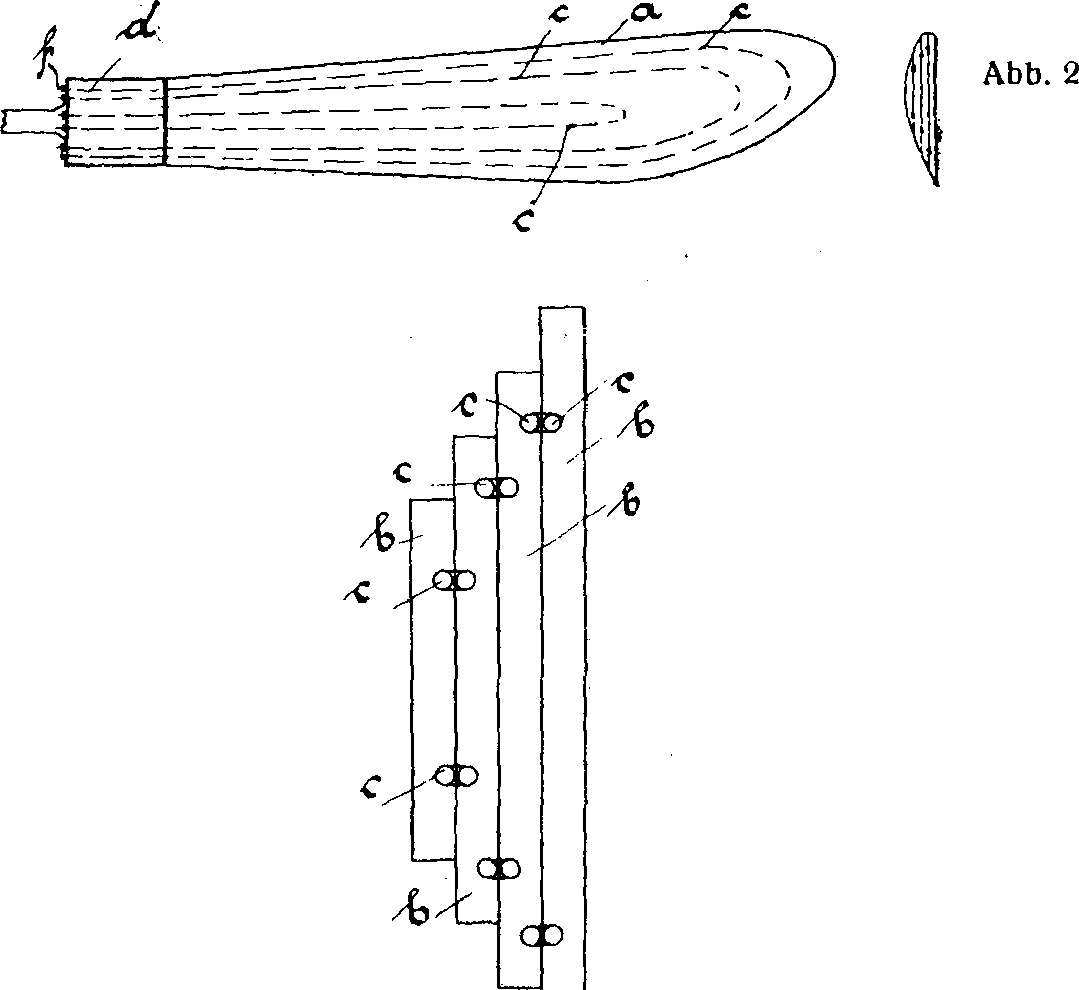 Abb. 3 werden, und zwar sollen diese vor dem Verleimen in seitlich in die Brettcheri eingearbeitete Nuten gelegt werden, so daß sie dann nach dem Zusammenfügen der Brettchen nicht nur vollständig eingeschlossen und geschützt sind und die Flügeloberfläche glatt und homogen lassen, sondern auch zur Verankerung der Flügel in ihren Fassungen zur Verfügung stehen und nach dem Einlegen straff gezogen werden können, wie unten näher erläutert ist. Hierdurch unterscheidet sich der Gegenstand der Erfindung von den bereits bekannten Flügelkonstruktionen, bei welchen die Propellerflügel entweder aus einem stoffüberzogenem Drahtgerippe oder aus Holz mit einer nachträglichen und natürlich eine rauhe, auch bei nachträglichem Verkleben unhomogene Oberfläche ergebenden Drahtumwicklung bestehen. Ein Ausführungsbeispiel zeigt die beiliegende Zeichnung, und zwar stellt Abb. 1 einen Propellerflügel in Richtung der Propellerwelle gesehen, Abb 2 denselben in radialer Richtung gesehen dar. Abb. 3 ist ein schematischer Querschnitt (in teilweise übertriebener Darstellung) durch einen noch nicht fertig modellierten Flügel, Es ist angenommen, der Propeller a werde in der üblichen Weise aus mehreren Holzbrettchen b lamellenartig zusammengefügt bezw. verleimt. In jedes der Brettchen ist nun vor dem Verleimen seitlich mindestens je eine seinen Umrissen ungefähr folgende Nut eingearbeitet, und in diese schleifenförmige Nut ist je eine Schleife aus Stahldraht c gelegt. Durch das Aufeinanderleimen der Lamellen b werden die Nuten verschlossen, so daß die Lage der Drähte gesichert ist. An seiner Wurzel ist der Flügel in eine Hülse d aus geeignetem Metall gesteckt und durch dieselbe irgendwie mit der Propellerwelle verbunden, etwa über eine Vorrichtung, welche es gestattet, die Flügel in der Nabe zu drehen. Dabei dienen die Enden der Drahtschleifen zum festhalten des Flügels in der Hülse Sie sind z. B. durch den Boden der Hülse hindurchgeführt und mittels auf sie aufgeschraubter Muttern f o. dgl. straff gezogen und befestigt. Es genügt im allgemeinen, daß in jeder Lamelle nur auf einer Seite eine Nut vorgesehen wird, man kann jedo.'h auch gemäß Abb. 3 in jeder Lamelle von beiden Breitseiten aus Nuten einarbeiten und endlich die einander zugekehrten Nuten aufeinanderlegen. In diesem Fall ist es möglich, ein- und dasselbe Band in zwei benachbarte Lamellen eingreifen zu lassen, wodurch eine Art Verdübelung der Lamellen erreicht wird. Patent-Ansprüche: I. Aus einzelner Flügeln bestehender Propeller, insbesondere für Flugzeuge, bei welchem Drähte o. dgl. zur Erhöhung der Festigkeit verwendet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Flügel aus Lamellen zusammengebaut sind, um welche vor dem Zusammenbau die Drähte o. dgl. in Schleifen derart gelegt sind, daß sie mittels der Schleifenenden nachträglich straff gezogen werden können. II. Propeller nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die o. dgl. derart zwischen den Lamellen angeordnet sind, daß sie nach dem Zusammenfügen der Lamellen zwischen diesen vollständig bis zur bpannvorrichtung eingeschlossen sind. Fahrgestell für Flugzeuge.*) Die Erfindung betrifft ein Fahrgestell für Flugzeuge, deren Gleitkufen, Laufräder oder dergl. mittels einer allseitig schwingbaren Stange mit dem Fahrzeuggestell verbunden sind. Gegenüber bekannter Einrichtungen, bei welchen die Verbindungsstange ziemlich wagrecht angeordnet und mit ihrem einen Ende an den Fahrzeugrumpf angelenkt ist, besteht das Eigenar ige des vorliegenden Fahrgestelles darin, daß de Stange bei nahezu senkrechter Anordnung in ihrem mittleren Teile zugleich allseits drehbar und achsial verschiebbar am Rumpfgestell gelagert und an dem in das Gestell hineinragenden oberen Ende mittels elastischer Glieder mit den Längsbalken des Gestelles verbunden ist. Hierdurch wird bei zugleich erhöhter Beweglichkeit, Federung und Widerstandsfähigkeit der wesentliche Vorteil erzielt, daß die elastischen Glieder anstatt auf der äusseren Seite im Innern des allseits geschlossenen Fahrzeugrumpfes untergebracht werden können. Diese Anordnung der elastichen Glieder ist günstig, weil diese dann einerseits nicht zur Erhöhung des Fahrwiderstandes beitragen und anderseits gegen Aufspritzen des vom Motor abgeschleuderten Oeles geschützt sind. Die beim Landen auftretenden Stösse werden hauptsächlich durch die senkrecht angeordnete Verbindungsstange Ubertragen. Eine besonders zweckmässige AusfUhrungsform kennzeichnet sich dadurch, dass diese Stange oberhalb der Stelle, an welcher die Verstrebungen der Radachse angreifen, unterteilt und im oberen Teile weniger widerstandsfähig ausgebildet ist, derart, daß der viel- *) D. R. P. Nr. 264254 Soc ete „Zodiac" in Puteaux, Frankreich. güedrige untere Teil des Fahrgestelles bei zu hartem Aufsetzen geschont und die Bruchstelle vorkommendenfalls in das leichter zu ersetzende obere Stück der Verbindungsstange verlegt ist. Der Erfindungsgegenstand ist auf beiliegender Zeichnung in einem Ausführungsbeispiele veranschaulicht und zwar zeigen : Abb. 1 Die Seitenansicht des Fahrgestelles, Abb. 2 Die Rückansicht desselben, bezw. einen Schnitt nach 2—2 der Abb. 1, Abb. 3 und 4 ein Glied des Verbindungsgelenkes in grossem Maßstabe herausgezeichnet, und zwar in zwei aufeinanderfolgenden Stufen seiner Herstellung. Bei der in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsform besteht das Fahrgestell im wesentlichen aus einer nahezu senkrecht angeordneten Stange a, an deren unterem Ende das Räderwerk, zweckmäßig ein auf einer gemeinschaftlichen Achse c sitzendes Laufräderpaar b, angebracht ist. Die Achse desselben ist mit dem unteren Ende der Stange a fest verbunden und mit derselben durch ein Paar Streben d versteift. Die Stange a wird zweckmäßig zweiteilig ausgeführt; der eine, und zwar der untere Teil, welcher in den Zeichnungen eigentlich mit a bezeichnet ist, wird sehr widerstandsfähig ausgebildet, der andere und zwar der obere, welcher mit a1 bezeichnet ist, ist weniger widerstandsfähig, sodass bei übermässigen Landungsstössen stets der obere, leichter zu ersetzende Teil zerbricht. Die Stange a ist ungefähr in ihrer Mitte am Fahrzeugrumpf sowohl schwingbar als auch drehbar, und verschiebbar gelagert Zu diesem Zweck ist sie durch ein beispielsweise aus weichem Material, etwa Holz bestehendes, außen kugelförmiges Gelenkstück e hindurchgeführt, welches seinerseits in eine Abb. 1 Abb. 2 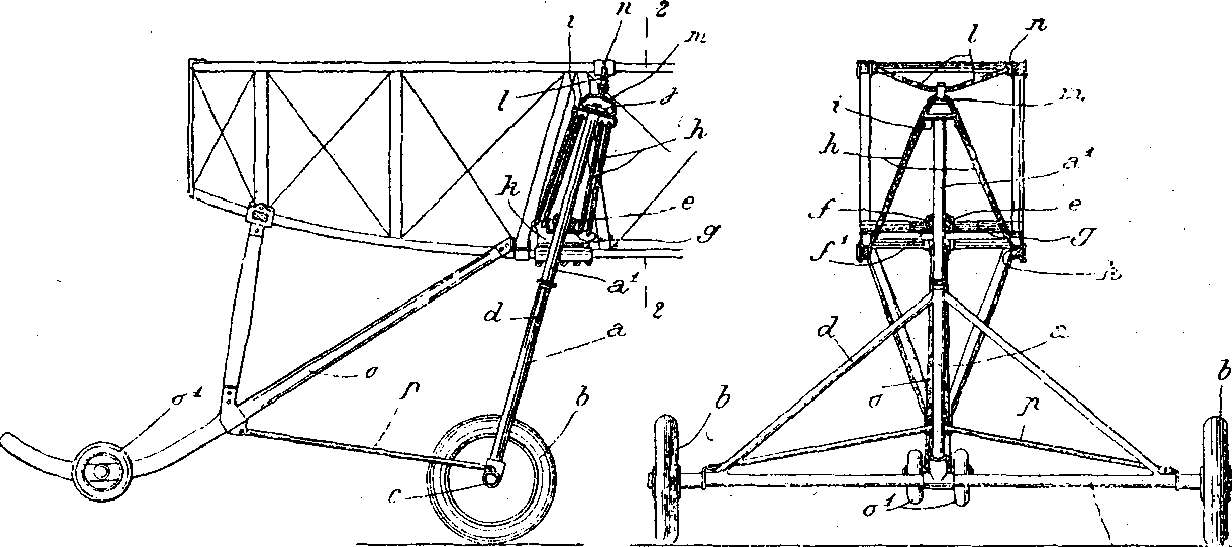 Abb. 3 Abb. 4 kugelförmig gehöhlte Lagerschale f eingesetzt ist. Das etwas elastische Gelenkstück e liegt sowohl an der Stange a als auch an der Lagerschale f ziemlich fest an, sodass die einzelnen Teile der Lagerung bei Bewegung des Fahrgestelles unter Üeberwindung einer gewissen, jedoch mäßigen Reibung aufeinander gleiten. Die Lagerschale f ruht auf einer Querstrebe g des Gestelles, die in der Mitte eine der Stange a genügenden Spielraum gewährende Oeffnung besitzt. Die Lagerschale f umschließt das Gelenkstiick e nicht allseitig, sondern nur auf zwei Seiten und wird zweckmäßig aus zwei Teilen zusammengesetzt, welche man erhält, wenn man einen mit einem Befestigungsflansch f1 veisehenen sphärischen Ring nach zwei zueinander senkrechten Ebenen durchsägt; (Abb. 3 und 4) je zwei der auf diese Weise erhaltenen Viertel bilden ein Lagergehäuse für das Gelenkstück e. Oberhalb ihrer Lagerung ist die Stange a durch elastische Glieder mit dem Fahrzeugrumpf verbunden. Da das obere Ende der Stange in das Innere des Rumpfes hineinragt, so befinden sich diese in der gebräuchlichen Weise aus Gummischnüren bestehenden Glieder ebenfalls im Innern des Fahrzeugrumpfes, wo sie gegen schädlische Einwirkung des vom Motor abspritzenden Ueles geschützt sind und keinen Fahrwiderstsnd verursachen. Die Befestigung der elastischen Glieder erfolgt zweckmässig in der aus der Zeichnung ersichtlichen Anordnung. Die Stange a trägt am oberen Ende ein mit seinem Schenkel nach abwärts gerichtetes U-förmiges Eisenstück i und ausserdem einen Bügel m, welche Teile gemeinsam durch die Schraube j befestigt sind. An das U-förmige Verbindungsstuck i ist ein Satz elastischer Glieder h angeschlossen, deren andere Enden mit den beiden unteren Längsbalken des Rumpfgestelles verbunden sind; sie greifen zweckmäßig an besonderen, geeignet gestalteten Befestigungsstücken k an, die im vorliegenden Falle zugleich zur Auflagerung der Querstrebe g dienen. Zweckmäßig reicht die Stange a bis nahe an die obere Seite des Rumpfgestelles, sodass die Glieder h ziemlich steil gerichtet sind, also in der Rückansicht (Abb. 2) das Aussehen eines umgekehrten V haben. Der erwähnte Bügel m dient zum Durchziehen eines weiteren elastischen Gliedes I, dessen beide Enden mit den beiden oberen Längsbalken des Fahrzeugrumpfes verbunden sind und zwar liegen die Verbindungsstellen nicht genau oberhalb der Befestigungsglieder k, sondern sie sind etwas zurückversetzt, sodaß die Stange a in der Normalstellung etwas nach hinten geneigt ist. Das elastische Glied 1 hat in der Rückansicht das Aussehen eines aufrechten flachen V Die Glieder h dienen zum Tragen des Fahrzeuges; sie fangen die Lan-dungsstösse auf, soweit sich dieselben als Längsverschiebungen, Drehungen oder Querschwingungen der Stange a geltend machen. Das Glied I wirkt den in der Längsrichtung erfolgenden Ausschlägen der Stange entgegen und bildet zugleich eine Begränzung sowie Dämpfung für ihre Schwingungen nach erfolgter Landung. Die beschriebene Anordnung ist nicht nur zur elastischen Lagerung von Laufrädern, sondern gegebenenfalls auch für die Lagerung von Gleitkufen anwendbar. Auch kann das beschriebene Fahrgestell in Verbindung mit besonderen Gleitkufen benutzt werden, was gemäß dem in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel zweckmäßig in folgender Weise erfolgen kann: Vor dem Fahrgestell befindet sich in bekannter Weise eine geneigte Strebe o, die an ihrem unteren Ende kufenförmig gekrümmt und zweckmäßig mit einem Hilfsräderpaar o 1 versehen ist. Diese Strebe ist durch zwei Zugstangen p mit der Radachse c derart verbunden, daß die letztere um einen gewissen Betrag um die Längsachse der Stange a schwingen kann. Bei dem Zeichnungsbeispiel dient eine einzige Stange a zur Verbindung des Fahrgestelles mit dem Fahrzeugrumpf. Selbstverständlich läßt sich das Fahrgestell mehrteilig ausführen, wobei dann ieder Teil desselben mittelst einer besonderen Stange, gemäß der Erfindung an das Rumpfgestell angeschlossen werden kann. Gegebenenfalls können auch zwei der in der Zeichnung veranschaulichten Einrichtung und zwar symmetrisch zur Längsachse des Fahrzeuges angeordnet sein. Patent-Ansprüche. 1. Fahrgestell für Flugzeuge, deren Gleitkufen, Laufräder oder dergl. mittels einer allseits schwingbaren-Stange mit dem Fahrzeuggestell verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Stange a bei nahezu senkrechter Anordnung in ihrem mittleren Teile zugleich allseitig drehbar und achsial verschiebbar am Rumpfgestell gelagert und an dem in das Gestell hineinragenden oberen Ende mittels elastischer Glieder h, 1 mit dem Längsbalken des Gestelles verbunden ist. 2. Fahrgestell nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daß die das Räderwerk mit dem Fahrzeug verbindende Stange a oberhalb der Stelle, an welcher die Verstrebungen d der Radachse c angreifen, unterteilt und im oberen Teile weniger widerstandsfähig ausgebildet ist, derart, daß der vielgliedrige untere Teil des Fahrgestelles bei zu hartem Aufsetzen geschont und die Bruchstelle vorkommendenfalls in das leichter zu ersetzende obere Stück a' der Verbindungsstange a verlegt ist. Jllustrirte No. 23 technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnement: 12. November für das gesamte 1913. Jahrg. 1. „FlU^WeSdl" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef.4557 nmtl. Oskar UrsinUS, CivilingenieuF. Tel.-Adr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. _1 Erscheint regelmäßig 14tägig. — , , , z Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ■ - Der Nachdruck nnserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 26. November. Hülfsmittel für die Ausführung von Nachtflügen. Bei den Flügen um die National-Flugspende, wo es sich darum handelte, innerhalb eines Tages einen möglichst großen Fingweg zurückzulegen, waren die Flieger gezwungen, die Nacht zur Hülfe zu nehmen. Ganz abgesehen davon, daß das Fliegen in der Nacht infolge der ruhigeren Luft weniger Steuerarbeit erfordert, bereitet die Orientierung bei völliger Dnnkelheit außerordentliche Schwierigkeiten, Diejenigen Flieger, welche bei ihren Nachtflügen unter Mondscheinbeleuchtung fliegen konnten, waren gegenüber den anderen im Vorteil. Die Hauptgefahrmöglichkeiten liegen indessen in den Notlandungen. So sind verschiedene Flieger, die teils die Orientierung verloren hatten, oder durch Motordefekte gezwungen waren niederzugehen, aufs Geradewohl in pechschwarzer Finsternis, bei der sich nichts erkennen ließ, gelandet. In den meisten Fällen war ein Bruch des Fahrgestells die unausbleibliche Folge. Von vielen Seiten werden die Nachtflüge als Spielerei mit dem Menschenleben verdammt. Es fragt sich nun, gibt es Mittel und Wege diese Gefahrmöglichkeiten zu beseitigen? Diese Frage ist entschieden mit Ja zu beantworten. Die Aufgabe besteht zunächst darin, dem Flieger, wenn er sich orientieren oder zur Landung schreiten will, das Gelände zu beleuchten. Man muß sich wundern, daß in dieser Hinsicht die zur Verfügung stehenden Hülfsmittel noch nicht angewendet wurden. Es gibt Fallschirm-Raketen, die auf bequeme Weise vom Flieger abgeschossen werden können, womit er zwei bis drei Minuten das unter ihm befindliche Gelände tageshell beleuchten kann. Hat er nun einen geeigneten Landungsplatz gefunden, so kann er eine zweite Rakete loßschießen und unter dieser Beleuchtung die Landung ausführen. Es wäre wirklich eine dankbare Aufgabe und sicher auch ein gutes Geschäft für eine Feuerwerks-Fabrik sich mit dieser Sache näher zu befassen und eine bequeme, sicher funktionierende Einrichtung in gedachtem Sinne auf den Markt zu bringen. "Wie gesagt, es existieren bereits genügend derartige Feuerwerkskörper und handelt es sich nur darum, durch den praktischen Gebrauch die Flieger von der Großartigkeit dieses Hülfsmittels zu überzeugen und damit vertraut zu machen. Die Beschaffung von solchen Einrichtungen wird dann die Gefahrmöglichkeiten der Nachtflüge mit einem Schlage auf ein Minimum reduzieren und die Folge davon wird sein, daß die Flieger dann in erhöhtem Maße Nachtflüge infolge der besseren Luftverhältnisse ausführen. Der Deperdussin-Renneindecker. T^p 1913. Bei dem diesjährigen Reimser Gordon-Bennett-Rennen spielten die Deperdussin-Flugzeuge mit die Hauptrolle. Die von Prevost gesteuerte Maschine zeigt geg6n die vorjährige einige bemerkenswerte Abänderungen, welche nicht unwesentlich zur Erhöhung der Geschwindigkeit beitrugen. Die 9 qm grossen Tragflächen sind in ihren Umrissen etwas libellenartig geformt und besitzen eine Spannweite von 8,6 m bei einer Flächentiefe von nur 1,25 m. Die innersten Rippen des Tragdecks am Rumpf sind nach vorn etwas verlängert, sodass ein keilförmiger Flächenansatz entsteht, der die Luftführung "wesentlich begünstigt. Die Verspannung erfolgt an jedem Flügelholm 2 mal von unten und oben, durch starke Stahldrähte. Der tropfenförmig aussen glatte Rumpf zeigte eine gute Formgebung. Vorn ist ein 160 PS Gnommotor eingebaut, der eine Luftschraube von 2,2 m Duchmesser antreibt. Das innere Drittel des Schraubenkreises wird durch eine rotierende Blechkappe von parabolischer Form bedeckt, die zur Vervollständigung des vorderen Rumpfteiles erforderlich ist. Die den Motor umgebenden Blechverkleidungen sind mit runden Oeffnungen, um einen intensiven Luft-Wechsel zu erzielen, versehen. Das Fahrgestell zeigt die bekannte Deperdussin-Konstruktion. Die Uebergänge von den Kufen in die Streben und von diesen in den Rumpf werden durch eingeleimte Holzklötzchen mit entsprechenden Abrundungen erreicht. An dem Kufengestell ist die Radachse mittels Gummischnüren aufgehängt. Die Spurweite der Räder beträgt 1,5 m. Die 650 mm grossen Räder sind zur Verringerung des Luftwiderstandes mit einer Renneindecker Deperdussin. Typ 1913. 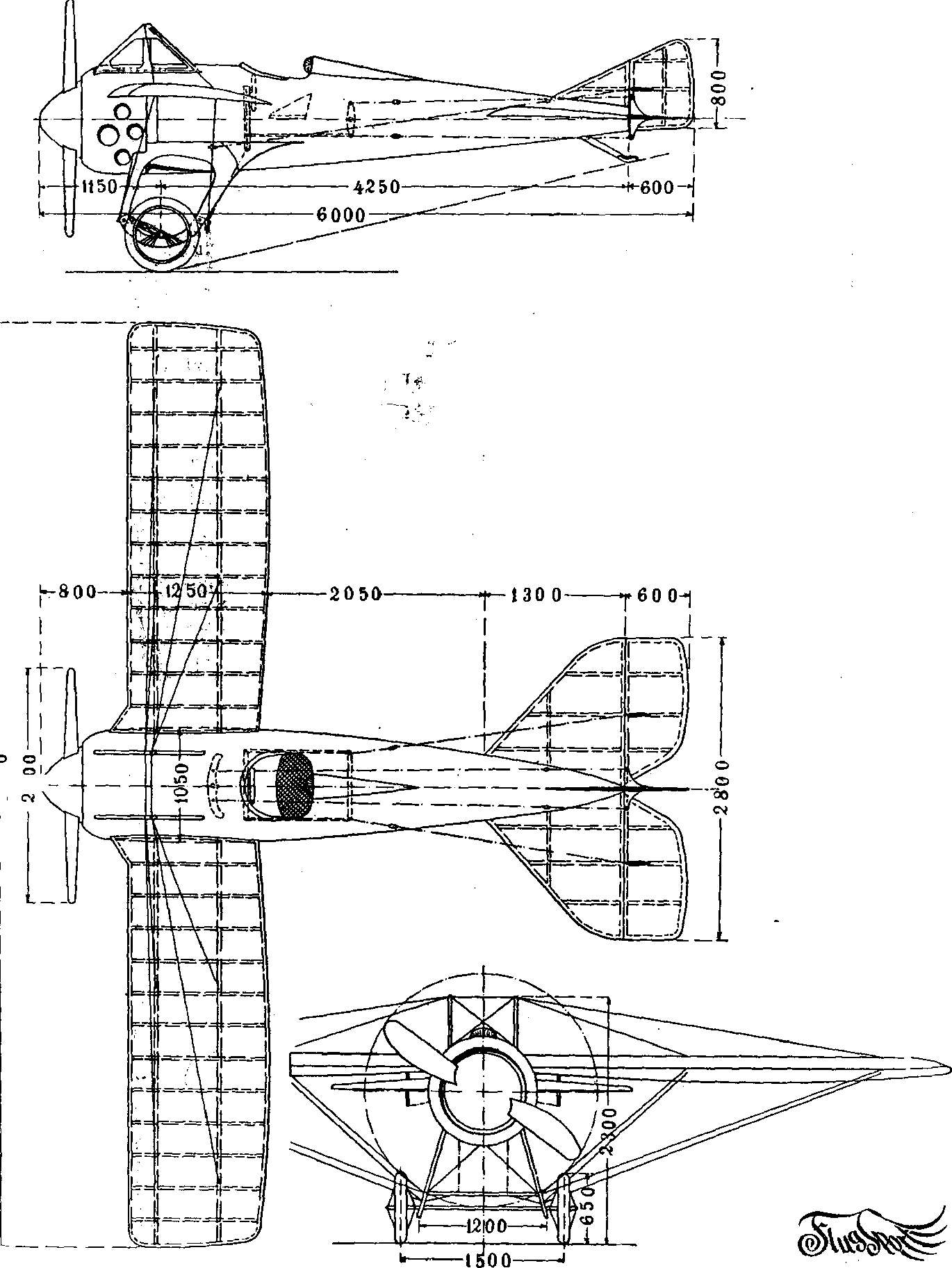 Speichenverkleidung versehen, die nur eine verschnürbare Oeffnung zum Aufpumpen der Bereifung freiläßt. Am verjüngten Rümpfende sind die Steuerungsorgane, Höhen- und Seitensteuer angebracht. Die freitragend angeordnete Dämpfungsfläche ist 3 qm groß, während die daranschliessenden Höhensteuerklappen nur 1,5 qm Flächeninhalt haben. Zwischen den Höhensteuerklappen befindet sich das 0,45 qm große Seitensteuer. Das hinterlastige Gewicht der Maschine wird durch eine freitragende Schleifkufe, deren abgekrümmtes Ende mit einem Blechbeschlag versehen ist, getragen. Die Steuerung ist die bekannte Deperdussin-Steuerung wie sie im „Flrgsport" No. 21 Jahrgang 1911 eingehend behandelt und dargestellt wurde. Bemerkenswert ist der auf der Oberseite des Rumpfes angebrachte tropfenförmige Ansatz, welcher mit einem Nackenpolster versehen ist. Dieser Aufbau soll den Luftwiderstand vermindern, der von dem Kopfe des Fliegers hervorgerufen wird. Andererseits soll aber auch die sorgfältige Polsterung den Stoss beim Start beträchtlich vermindern. Das Gewicht der Maschine beträgt 450 kg, wobei eine Höchstgeschwindigkeit von 203,850 km erreicht wurde. Der Sturzflugapparat von Pegoud (System Bleriot.) (Hierzu Tafel XXVIII) Die von Pegoud mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit ausgeführten Sturzflüge vurden in letzter Zeit viel besprochen. Die hierbei benutzte Maschine ist teilweise aus der 80 PS-Type hervorgegangen, teilweise sind mit Rücksicht auf das neue Betätigungsgebiet entsprechende konstruktive Aenderungen vorgenommen worden. Der Konzentrierung der Massen um den Druckmittelpimkt ist in weitgehendstem Maße Rechnung getragen. Die Tragflächen sind etwas V-förmig nach oben gerichtet und der 80 PS-Type entnommen. Bei einer Spannweite von 10,4 m und einer Flächentiefe von 2,2 m besitzen sie 19 qm Flächeninhalt. Jeder Flügelholm is-zweimal von unten und oben mittels Drahtseil verspannt. Die Drahtseilösen werden nicht wie sonst üblich mittels der bekannten Drahtseilklemme gebildet, sondern es wird ein Kupferrohr über die Drahtseilenden geschoben und schraubenförmig aufgedreht, wodurch eine bedeutend solidere Oese entsteht. Profil und Umrißformen sind die gleichen geblieben wie früher. Zur Aufnahme des Rückwärtsdruckes beim Sturzfluge ist ein lose gespannter Stahldraht angebracht, der von dem Fahrgestellrahmen nach dem ersten Verspannungspunkt des hinteren Flügelholms führt. Das Fahrgestell zeigt bekannte Ausführungsform; es besteht aus einem Rahmen werk, das mit Stahldrähten und Stahlbändern sorgfältig verspannt ist. Um zwei starke vertikale Stahlrohre sind zwei Räder schwenkbar gelagert. Jedes Rad ist durch ein abgefedertes Stützdreieck, bestehend aus einer Flihrungsgabel und zwei Stoßstangen, mit dem Fahrgestellrahmen derartig verbunden, daß sich die Räder nach jeder Richtung hin einstellen können. Dies ist besonders bei Landungen mit Seitenwind von großem Vorteil. Der viereckige Rumpf besteht aus Eschenholzleisten und weist in seiner Verspannuug kein einziges Spannschloß auf. Der Zusammenhalt der einzelnen Fachwerke wird durch die bekannten BleriotstoIIcn erreicht. Dieselben gelangen in zwei verschiedenen Größen zur Anwendung. Vorn ist im Rumpf ein doppelt gelagerter 50 PS Gnom-Motor eingebaut, der eine Luftschraube von 2.3 m Durchmesser und 1.5 m Steigung antreibt. Das Befcstigungsblech für die vordere Motor-lagernng tritt etwas aus dem Fahrgestellrahmen hervor und begünstigt 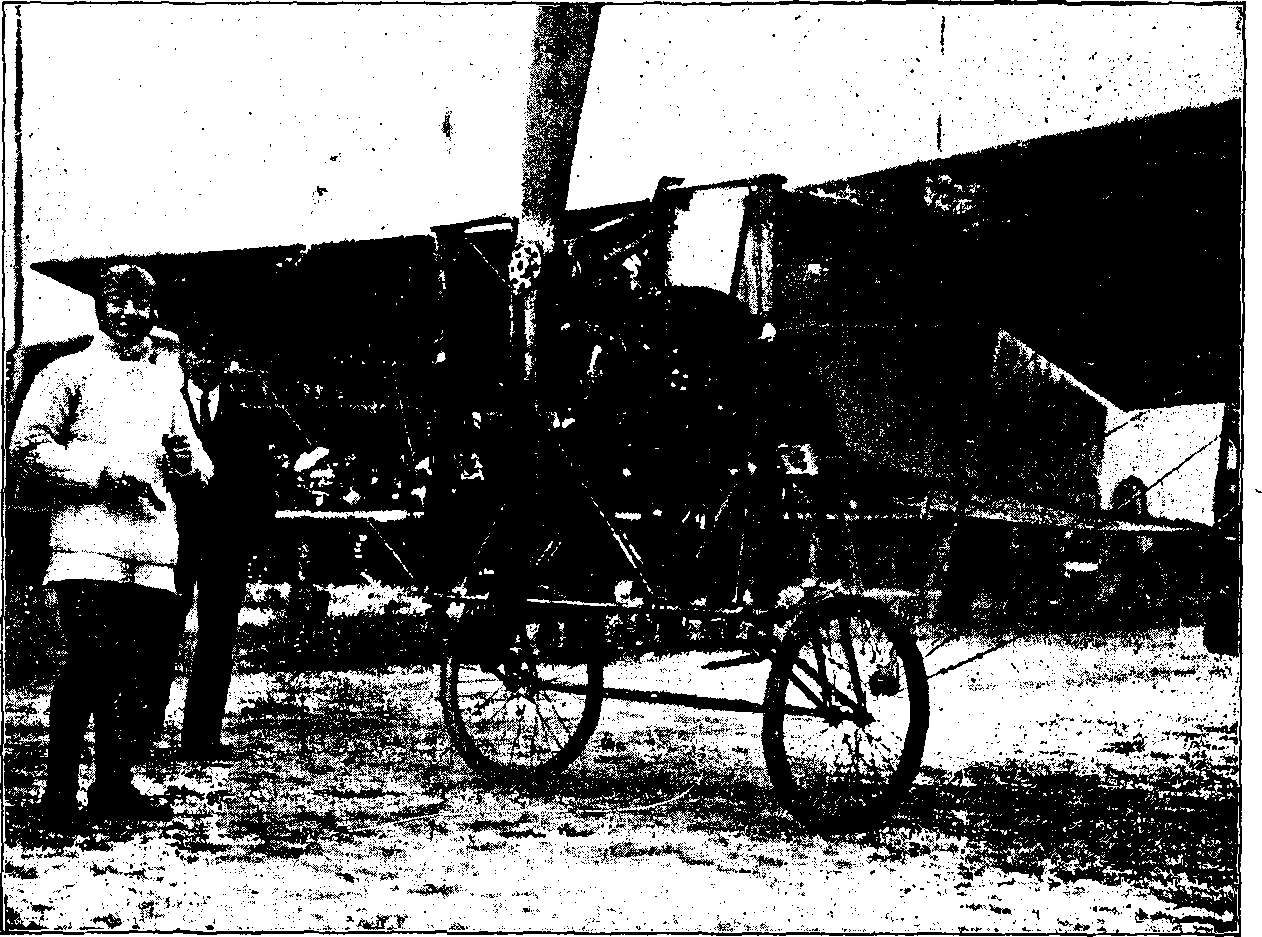 Pe'goud vor seinem Bleriot-tindecker. den Wirkungsgrad der Luftschraube Seitlich und oben ist der Motor mit Spritzblechen umgeben, damit der Flieger vor dem Ool-regen geschützt ist. Die Fortsetzung dieser Verkleidung ist teilweise karosserieartig ausgebildet In der Nähe des Schwerpunktes ist der unter Druck stehende Betriebsstoffbehälter eingebaut. Die Druckluft wird von einer Handpumpe, die sich rechts neben dem Führersitz befindet, erzeugt. Im Innern des Behälters befindet sich eine biegsame Abflußleitung, die in jeder Fluglage dem Motor Betriebsstoff zuführt. (S. nebenst. Abb.) In der Detailzeichnung bedeutet a 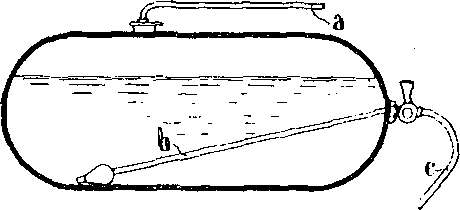 die Druckluftleitung zur Handpumpe b die mit einem Anguß versehene biegsame Abflußleitung und c die nach dem Motor führende Zuleitung. Dicht hinter dem Betriebsstoffbehälter befindet sich der Führersitz nebst der erforderlichen Anschnallvorrichtung. Letztere besteht aus einem starken Riemennetz, das den Flieger gegen Herausfallen schützt. Am keilförmig verjüngten Rumpfende ist ein 0,8 qm großes Seitensteuer angebracht. Besondere Beachtung verdient die unter dem Rumpf angebrachte Schwanzfläche. Die 2 qm große Dämpfungsfläche ist nach unten gewölbt und wird durch vier Stahlrohre mit dem Rumpf verbunden. Das daranschließende Höhensteuer ist nach oben gewölbt und an seinen nach außen vorspringenden Teilen mit aufgenieteten Aluminiumbeschlägen versehen. Die gesamte Anordnung der Steuerungsorgane gewährleistet eine große Wendigkeit des Apparates und gestattet ein leichtes Aufrichten aus der Rückenlage in den normalen Flug. Der hinten allseitig offene Rumpfbau fördert diese Eigenschaften ganz bedeutend, da die Luft beim Ueberschlagen bequem hindurch kann. In der Mitte des Rumpfes zwischen Haupttragfläche und Schwanzfläche befindet sich eine säbelartig geschweifte Stützkufe. Dieselbe ist beweglich gelagert und mittels Gummischnüre abgefedert. Besondere Beachtung verdient der bedeutend erhöhte Verspannungsmast für die Befestigung der oberen Verspannungsorgane. Derselbe erhebt sich ca. 1,3 m über den Rumpf und ist nach allen Seiten sorgfältig verspannt. Die obere Flügelverspannung erhält durch ihn eine bedeutend günstigere Lage und verhindert ihre Ueberlastung. Das Gewicht der Maschine in betriebsfertigem Zustande mit 60 1 Benzin und 20 1 Oel beträgt 350 kg, wobei eine Geschwindigkeit von ca. 100 km pro Stunde erreicht wird. Wie führt Pegoud sein Looping the loop aus? Pegoud sucht zunächst große Höhen ca. 700 m auf; fliegt eine kurze Zeit horizontal, um eine möglichst große Geschwindigkeit zu erhalten, gibt plötzlich dem Höhensteuer einen starken Ausschlag, so daß die Maschine senkrecht sich aufbäumend nach oben steigt, und in die Rückenlage kommt. Hiernach fliegt Pegoud eine kurze Strecke horizontal, neigt sich ein wenig nach irgendeiner Seite und geht mit den nach unten geneigten Flügeln halb abrutschend im Sturzflug nieder und kommt so wieder in die horizontale Lage. Die anderen von Pegoud ausgeführten Flugkunststücke, wie enge Kurven, wobei die Tragflächen senkrecht stehen, Betätigung der Steuersäule mit den Füßen, bedürfen wohl hier keiner weiteren Erklärung. Im Gegensatz zu der Ausführungsweise von Pegoud's Flügen seien die Rückenflüge von Chevillard die am Samstag und Sonntag in Juvisy ausgeführt wurden, beschrieben. Chevillard läßt seine Maschine nicht nach vorn, sondern seitlich über die Tragdeckenenden überschlagen. Er führte die Experimente in sehr geringer Höhe, 100 —150 m, manchmal noch weniger, aus. Er fliegt gegen den "Wind und betätigt die Schräglagesteuerung so stark, daß die Tragdecken des Henri-Farmann-Doppeldeckers 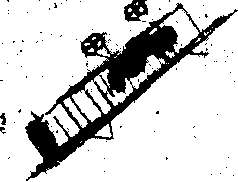 senkrecht zur Erde stehen. Die Maschine dreht sich dann noch weiter, so daß das Fahrgestell nach oben zu liegen kommt Durch weitere Betätigung der Schräglagesteuerung dreht sich die Maschine wieder in die horizontale Lage zurück, sodaß eine volle Drehung um die Längsachse (Motorachse) ausgeführt wurde. Chevillard hat sich bei seinen Versuchen 8—10 mal um seine horizontale Achse gedreht. 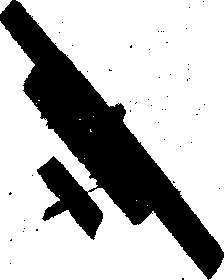 Chevillard's Rüdtenßüge. Unten: Chevillard in fast senkrechter Flügellage im Begriff über das linke Tragdeckenende auf den Rücken zu drehen. Oben: Chevillard im Räckenflug. Französische Gastfreundschaft. Von Fr. Wm. Se ekatz. Als Passagier von Ernst Stoeffler auf dem Flug Berlin—Paris halte ich es im allgemeinen Interesse für meine Pflicht, alle die verschiedenen Momente auf unserer Reise zu beleuchten, die ein grelles Licht auf das Benehmen unserer westlichen Nachbarn werfen. Derartige Dinge darf man nicht verschweigen! Am letzten Montag dem 27. Oktober waren wir mit unserem Albatros-Doppeldecker mit 100 PS Mercedes-Motor in Johannisthal gestartet. Von allem Anfang hatten wir mit starkem Gegenwind zu kämpfen, der uns bei unserer Rückfahrt von so großem Nutzen gewesen wäre, wenn uns nicht am letzten Tage des Oktobers das Schicksal im Park von Versailles erreicht hätte. Am ersten Tage flogen wir bis Oöln und am folgenden Tag hofften wir Paris zu erreichen, aber es kam anders und davon wollen die folgenden Ausführungen berichten. Laon. Wegen Benzinmangels waren wir genötigt am Dienstag, den 28. Oktober, eine Zwischenlandung vorzunehmen und landeten um 2 Uhr nachmittags am Fuße der Bergstadt Laon, dem Sitz des Prä-fekten vom Departement Aisne in Nord-Frankreich. Es war eine tolle Fahrt: Gegenwind und nochmals Gegenwind, für 100 km hatten wir 3 Stunden gebraucht. Fest entschlossen am gleichen Tage noch weiterzufliegen, fuhr Stoeffler auf einem zweirädrigen Karren, bespannt mit einem Pferd, sofort znr Stadt, um Benzin einzukaufen, während ich bei dem Apparat zurüokblieb. In der Nähe unserer Landungsstelle war ein Exerzierplatz, auf dem Infanteristen vom 45. Infanterie-Regiment übten. Es dauerte gar nicht lange, als eine Abteilung von 25 Soldaten unter Führung eines Offiziers erschienen. Ohne mich zu fragen ließ der Leutnant um den Apparat eine Postenkette aufstellen — selbstverständlich mit aufgepflanztem Bajonett — und hielt, seinem Benehmen nach zu urteilen, die Manipulation für selbstverständlich. Als wir uns, nachdem Stoeffler mit Benzin zurückgekehrt war, anschickten, die Tanks zu füllen, kam ein Unteroffizier und verbat es uns. Ein Offizier forderte uns auf mit nach der Präfektur zu kommen. Wir machten dem Herrn klar, daß wir heute noch weiter wollten und daß wir vor einem Rennen ständen, wo jede Sekunde kostbar sei. Selbstverständlich zeigten wir unsere Papiere vor: Abnahmeschein unserer Maschine für den Fernverkehr Luftabkommen, Bescheinigung des französichen Konsulates in Berlin über unseren beabsichtigten Flug nach Paris und unsere Militärpässe. Mit der größten Gleichgültigkeit gab uns der Offizier zur Antwort, daß ihm damit nicht gedient sei, wir müßten zur Präfektur. Ich muß noch hervorheben, daß wir auch nicht in einer verbotenen Zone gelandet waren. Also wieder auf unseren zweirädrigen Karren, der Apparat blieb unter Obhut der Soldaten und im kurzen Trapp dem Serpentinenweg nach Laon hinauf. Der Offizier gab uns auf seinem Fahrrad das Geleite. Unterwegs begegnet uns ein Auto! Es hielt sofort an: Der Stadtkommandant, ein Oberst vom 29. Artillerie-Regiment und zwei Herren der Präfektur bitten uns, mit naeh der Landungsstelle zu fahren. Der Apparat wird untersucht, wir zeigen wieder unsere Papiere vor, es hilft nichts, wir müssen von unserer Weitfahrt absehen und fahren nun zur Bürgermeisterei von Laon. Hier setzen sich die fünf Herren l1^ Stunden lang hin, studieren sämtliche Reglements und offizielle Mitteilungen über die Landung von ausländischen Fliegern, fragen hin und her und wissen zum Schluß überhaupt nicht, was sie mit uns machen sollen. Endlich kommt der Erlöser in Person eines Zollbeamten, der erklärt, daß wir nach einem Gesetz, das am Sonnabend den 25 Oktober dieses Jahres in Kraft getreten ist, verpflichtet sind, unsere Maschine zu verzollen. Am Dienstag den 28. Oktober waren wir in Laon gelandet. Sofort allseitige Zustimmung — mit Ausnahme von uns. Laut einer Tabelle rechnet uns der Beamte, nachdem er uns nach dem Gewicht des Motors und Apparates gefragt hatte, vor, daß wir den Betrag von 180 Frs. an Zoll zu entrichten hätten. „Für was haben wir denn das deutsch-französische Luftabkommen ?", ist unsere Antwort, „wir bezahlen nichts." „Gut, dann bleibt der Apparat hier", sagte ein Herr von der Präfektur. Also zur Kasse hieß die Parole ! Man stellt uns eine Quittung aus und versichert uns, daß der Betrag nach unserer Rückkehr von dem französischen Konsulat in Berlin retourniert wird. Endlich frei und nun zuerst eine innere Stärkung. Es war mittlerweile 8 [Ihr abends geworden und wir hatten seit 12 Stunden noch nichts gegessen. Nein, der Präfekt wünscht die Herren noch zu sprechen. Zuerst natürlich eine halbe Stunde Wartezeit. „Meine Herren, sie sind das erste Opfer des deutsch-französischen Luftabkommens, es tut uns furchtbar leid, daß wir sie so lange aufgehalten haben, aber unser Reglement ist seit einigen Tagen erst in Kraft und Sie waren die ersten Flieger, die das Gesetz betraf. "Wir waren natürlich noch nicht so eingearbeitet und deshalb haben sich die Verhandlungen so in die Länge gezogen. Jetzt aber, wo Sie den Zoll bezahlt haben, werden Sie durch Vorzeigen dieser Quittung in Frankreich nie mehr aufgehalten werden, Sie können dann machen, was sie wollen." Mit diesen Worten begrüßte uns der Präfekt von Laon, selbstverständlich mit der größten Höflichkeit und dem dauernden Lächeln des echt französicheu Beamten, Jetzt war es neun Uhr geworden! Die Behörde hat uns also in Laon 7 Stunden aufgehalten! Auf der Präfektur hatte man uns ein Schreiben mitgegeben, daß jetzt der Apparat frei sei und nachdem der wachhabende Offizier von dem Inhalt Kenntnis genommen, gestattete er uns dann endlich, am späten Abend unsere Tanks mit neuem Betriebsstoff zu füllen. Am Abend durften wir noch für das Automobil, das die Präfektur bestellt hatte, 20 Frs. Miete bezahlen. Montigny. Der zweite Akt spielt 80 km vor Paris, wo wir ebenfalls eine Zwischenlandung wegen Benzinmangels vornehmen mußten. Die Dorfbewohner waren Uns sehr hilfreich, die Maschine war nach kurzer Zeit wieder startfähig. Der Bürgermeister bat uns noch so lange za warten, bis die telefonisch gerufenen Gendarmen unsere Papiere kontrolliert hätten. Sie kamen, prüften unsere Pässe, untersuchten den Apparat, schrieben, telefonierten und telegrafierten und machten uns klar, daß erst der Präfekt die Genehmigung zum Weiterflug erstatten müsse. Die uns mit so hoher Bedeutung übergebene Quittung vom Präfekten von Laon hatte gar keinen Wert: Ohne unseren Präfekten können wir nichts machen, war die Antwort der Gendarmen. Die Zeit verging und es begann zu dämmern. Die Erlaubnis zur Weiterfahrt kam und kam nicht. Jetzt hatten wir genug! Wir telegrafierten sofort an den deutschen Botschafter in Paris und nach 3ji Stunden kam ein Gendarm aus dem Dorf herangesprengt und rief uns schon von weitem zu: „Messieurs, vous pouvez partir!" Lautes Bravorufen des Publikums war die Antwort. Eins freute uns : die Zuschauer hatten ständig für uns Partei ergriffen und bedrängten dauernd die Gendarmen uns doch frei zu lassen. Hier in Montigny haben wir der Behörde 4 Stunden Aufenthalt zu verdanken. Abends um l\tl Uhr sind wir denn bei vollständiger Dunkelheit in Villacoublay gelandet. Der Chefpilot von Moräne, Liger und einige Monteure waren die Zeugen unserer Landung. „Heute hat hier niemand geflogen", sagte Liger, „es war zu schlechtes Wetter. * So war das Entgegenkommen der französischen Behörde. Ich möchte unsere in Frage kommenden Korporationen bitten, zu veranlassen, daß diese Uebelstände, wie wir sie erleben mußten, beseitigt werden, denn während eines Wettbewerbes auch noch mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen, ist wirklich zu viel. Wir haben 11 wertvolle Stunden verloren und was das heißt, wollen die Franzosen scheinbar nicht wissen. Nicht besser als die Behörde haben sich die französischen Zivilflieger gezeigt. Welche Aufnahme haben bei uns Audemars, Daucourt, Brindejonc, Letort und andere erfahren. Man freute sich über die schönen Leistungen, verschonte die Flieger vor allen behördlichen Unannehmlichkeiten, trug sie im Triumph über den Platz und ärgerte sich im Stillen, daß man selbst noch nicht derartige Flüge erreicht hatte. Die deutsche Gastfreundschaft schien denn auch den französischen Fliegern zur Selbstverständlichkeit geworden. Nie werde ich es vergessen, wie zwei deutsche Flieger eigenhändig eine Ventilfeder an dem Ehönemotor von Letort einsetzten. Es war bei seiner zweiten Nonstopfahrt Paris —Berlin. Und was tat Letort? Er sorgte für sein leibliches Wohl, kümmerte sich um seinen Apparat überhaupt nicht und fand ihn trotzdem bei seiner Ankunft mit neuem Betriebsstoff versehen und startbereit. Außer Audemars haben wir in Paris niemand gesprochen, es waren aber auch Letort und andere da, die es nicht für nötig fanden uns wenigstens zu begrüßen. Ueber dieses sonderbare Verhalten der französischen Flieger habe ich mir oft den Kopf zerbrochen. Wir verlangen Anerkennung der Leistung, wer sie aufgestellt hat ist einerlei! Das habe ich gemerkt: Die Franzosen sehen, welche großen Fortschritte wir in letzter Zeit erreicht haben, sie bewundern unsere Apparate, staunen über ihre große Leistungsfähigkeit und exakte Arbeit, erkennen ihren Stillstand und beneiden unseren Fortschritt. Und eins schien den Franzosen unbegreiflich: Das Fliegen in der Nacht. Wie oft sah ich in den großen Pariser Zeitungen den Ueber-druck. Er fliegt in der Nacht! Bitterer Haß, hervorgerufen durch unsere Erfolge, spricht aus allem, was die Franzosen uns gegenüber tun. Wir haben sie jetzt eingeholt und das wissen sie ganz genau ! Nie werde ich den Ausspruch eines französischen Fliegeroffiziers vergessen, der beim Betrachten unseres Apparates in Villacoublay mit gedämpfter Stimme zu seinen Kameraden sagte : C'est une machine de guerre .... Der Ponnier-Anderthalbdecker. Die französischen Ponnier-Flugzeugwerke, früher Hanriot, haben einen neuen Militär-Anderthalbdecker herausgebracht, bei dem sämtliche Teile aus Stahlrohr hergestellt sind. Der 70 PS Gnom befindet sich in der Mitte, zwischen den beiden Tragflächen..  Der Militär-Doppeldecker Ponnier (Seitenansicht). Für die beiden Insassen sind gekuppelte Steuerungsorgarie vorgesehen. Die hinten befindlichen Steuerorgane, 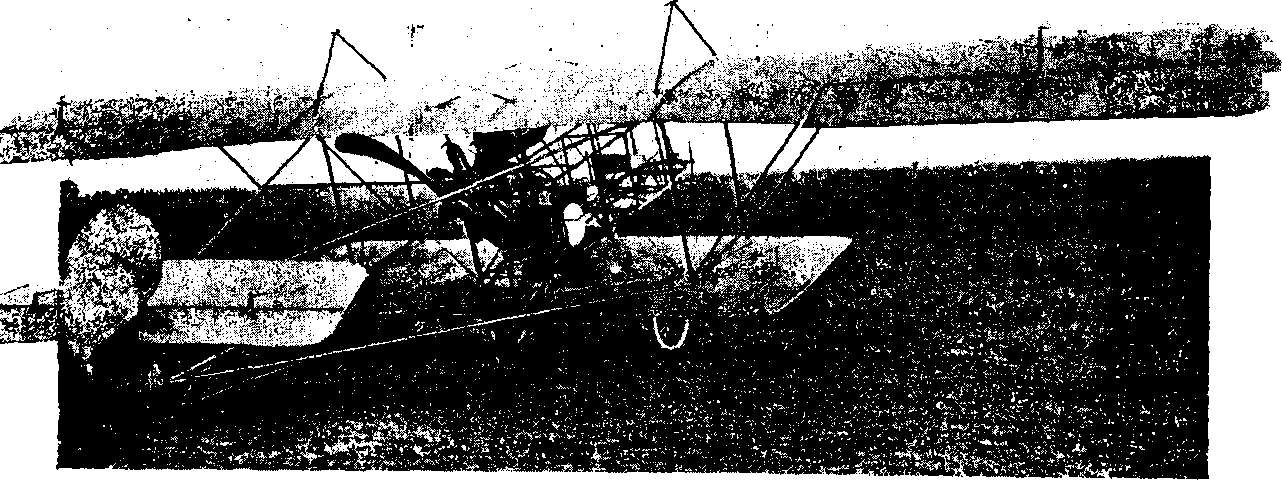 Militär-Doppeldedier Ponnier {Ansicht von hinten). Höhen- und Seitensteuer, werden durch zwei Stahlrohr-Gitterträger, die nach hinten dreieck-förmig zusammenlaufen, gehalten. Der Militär-Anderthalbdecker besitzt 12 m Spannweite. Die Gesamtlänge der Maschine beträgt 7 m. Der neue Maurice Farman-Zweidecker. Maurice Farman hat einen neuen Zweidecker mit hinten liegendem Höhensteuer herausgebracht. Durch den Wegfall vorn liegender Höhensteuer sind auch die großen charakteristischen Kufen in Weg- 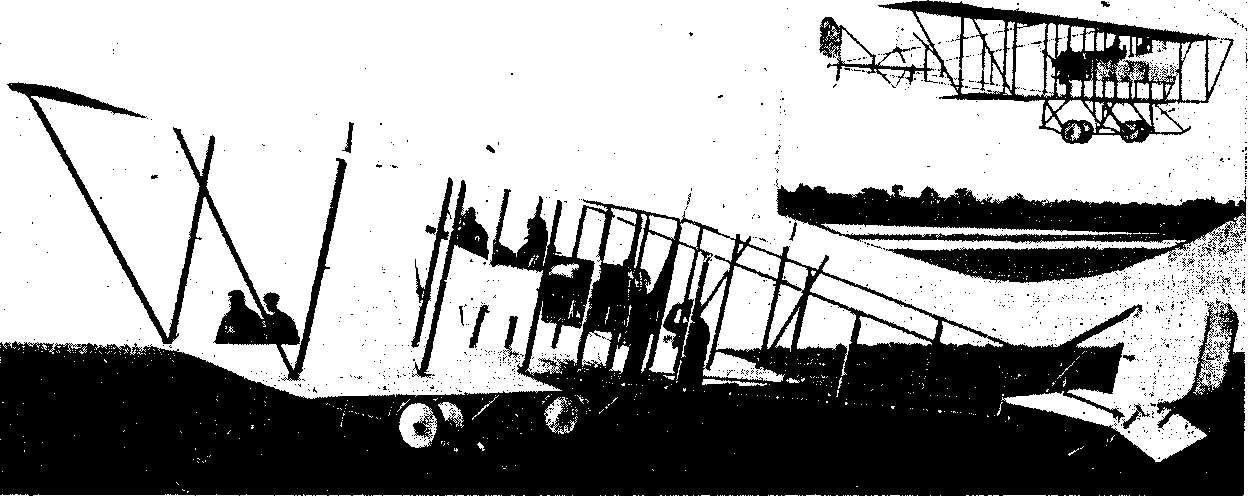 Der'neue Maurice Farman-Doppeldecker. fall gekommen. Der Zweidecker besitzt 17,5 m Spannweite, 64 qm Tragfläche. Die Gesamtlänge beträgt 9 m; das Gewicht 600 kg. Die Maschine erreicht mit einem 80 PS luftgekühlten Renault-Motor 105 km Geschwindigkeit. Die Ausführung des Höhen- und Seitensteuers geht aus der beistehenden Abbildung sehr deutlich hervor.  Der neue Maurice Farman-Doppeldecker im Fluge. No. 23 „FL_UGS_PORT^_ Seite &7S> Das Fahrgestell besteht aus zwei Kufen, an denen je ein Räderpaar in bekannter Weis© mittels Gummiringen aufgehängt ist. Ein Teil des hinterlastigen Gewichtes beim Anfahren und Landen wird durch die rückwärts sporenartig gekrümmten Kufen des Fahrgestells aufgenommen. Weiter befinden sich hinter dem Höhensteuer im Schwanz noch zwei Brems und Stützkufen. Eindecker der Fluzeugwerke Würzburg. Der Flieger Hans Zahn bei den Flugzeugwerken Würzburg hat vor kurzem einen Renn-Eindecker herausgebracht, der bei seinen Versuchsflügen sehr gute Resultate erzielte. Der Eindecker besitzt 9,6 m Spannweite, 18 qm Tragfläche. Die Gesamtlänge mißt 6,10 m. Die Ausführungsform erinnert, än die bewährte Konstruktion von Moräne Saulnier. Das Fahrgestell und sämtliche Betätigungsorgane sind aus Stahlrohr hergestellt. Das Gesamtgewicht incl. Flieger und Betriebsstoff für eine Stunde beträgt 375 kg. In diesem Apparat hat zum erstenmal der 50 PS SylveMotor der Bayrischen Motoren-und Flugzeug-Werke seine Leistungsfähigkeit bewiesen. 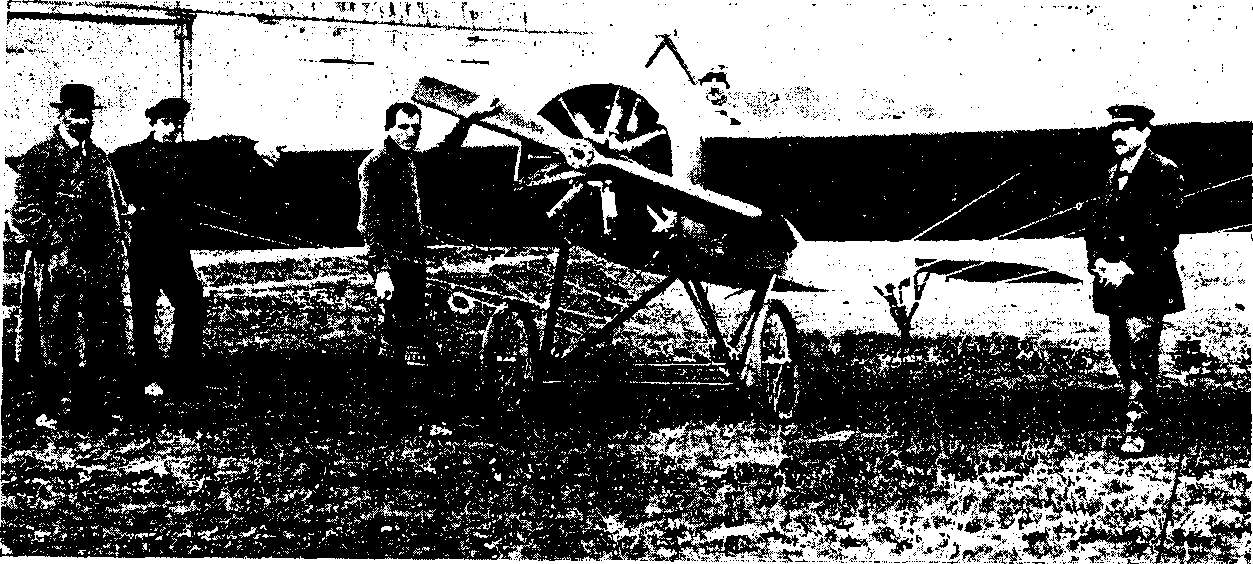 Eindecker der Flugzeug-Werke Würzburg, mit Sylve-Motor. Am 18. Oktober geriet die Maschine durch einen unglücklichen Zufall in eine senkrechte Lage. Die Zuschauer hatten das Gefühl, daß die Maschine unbedingt nach hinten abrutschen müsse. Der Motor, welcher seine 1100 Touren durchhielt, zog die Maschine senkrecht mit dem Schwanz nach unten in die Höhe. Durch ein gewagtes Manöver gelang es dem Führer die Maschine in 150 m Höhe in normale Lage zu bringen und zu landen. Schlegels Flug um die großen Preise der National-Flugspende. Nachdem mein erster Flug um einen Preis der National-Flugspende, der von Freiburg ausging, infolge des undurchdringlichen Nebels in der Nähe von Halle sein unfreiwilliges Ende fand, entschloß ich mich, trotzdem auch in der Nacht vom 22. Oktober der Boden keineswegs nebelfrei war, doch zum zweiten Versuche und startete kurz entschlossen nachts 12:05 Uhr. Der Start gelang gut. Schaurig und schön waren die Eindrücke während meines 53/4 stündigen Nacht-Pendelfluges. Der Mond stand im letzten Viertel, die Nacht war klar und sternenhell und unter mir zogen ab und zu tiefschwarze Nebelschwaden, die die Luft heftig beunruhigten und die Erde von Zeit zu Zeit unsichtbar machten. Solange der Himmel unbedeckt war, wäre eine Notlandung möglich gewesen, denn ich konnte Häusergruppen, Bäume und Felder gut unterscheiden. Neben der Beobachtung der Instrumente und besonders des Kompasses blieb mir noch eine Menge Zeit übrig, um mich mit meinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Ich mußte mir Mühe geben, nicht die schrecklichsten Kombinationen aufkommen zu lassen und nicht an all die Möglichkeiten zu denken, die beim Versagen des Motors eintreten könnten. Ich hatte nur einen Wunsch und e'in Ziel, daß der Motor durchhielte und daß es bald Tag werden möchfe. Noch voll von den tiefsten Eindrücken freute ich mich dann, als endlich die Uhr 3/46 zeigte und ich zur Landung schreiten konnte. Noch mehr freute ich mich aber auf den kommenden Tag. Ich war überzeugt, daß der Tagesflug für mich nach diesen Nachtstrapazen nur noch Freude und eine Spielerei bedeuten könnte. Nach Einnahme von Betriebsstoffen und sehr reichlichem Imbiß startete ich bei hellem Sonnenschein um 7:45 Uhr nach Berlin. Ich flog mit Rückenwind ab und hatte die angenehmste Beleuchtung und die Sonne im Rücken. Kilometer weit war daher die Erde sichtbar. Unterwegs wurde ich besonders über Tälern von Winden heftig geschüttelt. Fall- und Sonnenböen machten mir sehr zu schaffen, trotzdem aber stand bereits nach 2 Stunden 10 Minuten meine gute „Gotha-Taube" auf dem Johannisthaler Flugplatz und schon 11:05 Uhr war ich wieder unterwegs mit Richtung Königsberg. Es war mir bekannt, daß ich zwischen 5 und 600 m Hohe den besten und stärksten Rückenwind hatte und ich hielt mich deshalb auf der ganzen Route in dieser niedrigen Höhe. Mit 125 Stundenkilometer-Geschwindigkeit eilten wir nach Königsberg und landeten dort glücklich um 3/44 Uhr. Schon 4:25 Uhr war meine Maschine wieder startbereit und ich hatte die Absicht zwischen Königsberg und Insterburg bis nachts 12 Uhr Pendelflüge auszuführen. Leider überraschten mich abends um 5 Uhr am Wusensee Nacht und Nebel. Ich sah die Unmöglichkeit der Duichführung meines Planes sofort ein. Meinem Beobachter gab ich Weisung, Richtung Königsberg zu nehmen. Leider verhinderten wieder Nacht und Nebel jeden Ausblick nach unten. Wir verloren jede Orientierung und ich flog nur noch dem Gefühle nach. Hiermit hatte eine Irrfahrt in des Wortes wahrster Bedeutung begonnen. Von nachmittags 5 Uhr bis 6:20 Uhr habe ich nur ein- mal noch die Erde unter mir gesehen und zwar in dem Augenblick, als wir über dem Kurischen Haff schwebten. Kreuz und quer sind wir geflogen, bald über Land, bald über Wasser, aber Königsberg konnten wir nicht finden. In dieser kritischen Lage habe ich für mein bißchen Dasein keinen Pfennig mehr gegeben und ich kakulierte wie ein guter Kaufmann: Je länger du oben bleibst, desto länger lebst du noch. Ich suchte und suchte unaufhörlich, aber immer nur sah ich unter mir die schwarze unheimliche Tiefe. Schließlich wurde mir die Situation doch unhaltbar, es ging mir wie einem Schwerkranken, der endlich ein Ende haben möchte und ich entschloß mich, auf gut Glück zu landen. Dieser Entschluß war wohl der schwerste, den ich je in meinem Leben gefaßt habe. Ich beleuchtete meinen Höhenmesser und stieg auf 100 m herab. Dann löschte ich alle Lichter an Bord aus, verweilte einige Zeit in dieser Höhe, mit einem Ruck schaltete ich Motor und Zündung aus und steuerte den Apparat so flach wie irgend möglich in die schauerliche Tiefe. Nach wenigen Augenblicken krachte es und dann wußte ich nichts mehr. — — Dankbar muß ich in dieser Stunde, da ich wieder Genesender bin, an meine gute „Gotha-Taube" denken, die mir in so hervorragender Weise zum Siege verhalf. Im Zeitraum von 10 Tagen hatte ich mit ein und derselben Maschine, trotz Wind und Wetter über 2600 km zurückgelegt. Ruhig und sicher zog sie ihren Weg und ihrer großen Stabilität und solider Bauart ist es wohl zu verdanken, daß bei der harten Landung, die ich auf gut Glück ausführen mußte, mein Beobachter unverletzt blieb und ich mit einem allerdings etwas heftigen Nasenstüber davon kam. Besonders wohltuend bei all diesen Gefahren, denen ich glücklich entgangen bin, hat mich die Anteilnahme und Hülfeleistung aller Beteiligten berührt. Bei Start und Landung sowohl in Gotha, wie in Johannisthal und Königsberg las ich aus aller Augen nur beste Wünsche für mich. Insbesondere ließ Herr Kommerzienrat Kandt, der mir die famose „Gotha-Taube" zur Verfügung stellte, sich nicht nehmen, meinen Start mit vorzubereiten und die ganze Nacht bis zu meinem Abfluge nach Berlin auf dem Flugplatze zu verweilen. Ernst Schlegel. Die Fernflüge der National-Flugspende. Was uns die Nationalflugspende genützt hat, haben die Leistungen der Flieger bewiesen. Die Leser der vorliegenden Zeitschrift können dieselben beurteilen. Es wäre wirklich Energievergeudung, etwa die vorzüglichen Leistungen, die für sich sprechen, noch rühmen zu wollen. Andererseits sollen alle Leser dieser Zeitschrift mitwirken, die von verschiedenen Seiten verbreiteten fälschlichen Meinungen aufzuklären. Wir nehmen daher auch Veranlassung, eine von dem Kurato rium der National-Flugspende uns zugegangene Erklärung über die Ausschreibungen der 300000 Mark-Preise nachstehend zu veröffentlichen. Das Ergebnis der von der National-Flugspende ausgeschriebenen Fernflüge wird von der öffentlichen Meinung mit Eecht als uneingeschränkter Erfolg des deutschen Flugwesens betrachtet. Es sind Flüge ausgeführt worden, die noch vor kurzer Zeit als ein .Ding der Unmöglichkeit in Deutschland angesehen worden wären. Victor Stoffler hat mit einem Flug von mehr als 2100 Kilometern den bisher bestehenden Weltrekord geschlagen. Daneben hat noch eine Reihe anderer Flieger die Mindestentfernung der Ausschreibung von 1000 Kilometern übertroffen. Es werden daher voraussichtlich sämtliche ausgesetzte Preise zur Verteilung gelangen. Trotz dieses erfreulichen Ergebnisses der Ausschreibung sind nachträglich aus Fliegerkreisen gegen die Verwaltung der National-Flugspende eine Reihe von Vorwürfen erhoben worden, die darin gipfeln, daß die Ausschreibung unsachgemäß gewesen sei. Die Einwendungen werden zwar durch den Erfolg selbst widerlegt und sind auch zum Teil in der Presse von vornherein zurückgewiesen worden. Immerhin haben sie eine solche Verbreitung in der Oeffentlich keit erfahren, daß das Kuratorium der National-Flugspende Wert darauf legt, den Sachverhalt klarzulegen. 1. Das Unsachgemäße der Ausschreibung, bei der übrigens maßgebende Sachverständige auch aus den Kreisen der Militär- und Civil-flieger mitgewirkt haben, wird zunächst darin erblickt, daß die Fernflüge in eine Jahreszeit gelegt worden seien, in der die Tage bereits kurz waren und die Flüge daher zum Teil in der Nacht ausgeführt werden mußten. Dabei wird der Stand der Flugtechnik und ihre Entwicklung im Laufe dieses Sommers übersehen. Bei Beginn der Arbeiten des Kuratoriums wäre es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, durch eine Ausschreibung Leistungen zu fordern, wie sie jetzt erfolgt sind. Eine solche Ausschreibung wurde erst möglich, nachdem der Boden für Leistungen dieser Art durch eine sachgemäße und systematische Fortentwicklung des deutschen Flugwesens vorbereitet war, wie dies im Laufe des Sommers geschehen ist. Als dann im Juni und Juli dieses Jahres den deutschen Fliegern und der deutschen Industrie durch die gewaltigen Leistungen der französischen Äsviatiker ein neuer Ansporn gegeben worden war, ist die Ausschreibung unverzüglich erfolgt. Die Flüge mußten jedoch auf die Zeit nach dem 15. September verschoben werden, weil im Monat August die deutsche Fliegerwelt und die deutsche Industrie durch die Vereins-Wettbewerbe, die Offiziere aber durch das Manöver zu sehr in Anspruch genommen waren. Im übrigen wird die Zeit vom 15. September bis Ende Oktober von einer Reihe maßgebender Sachverständiger aus meteorologischen Gründen für Flugleistungen als besonders geeignet angesehen, Allerdings waren bei den durch die Ausschreibung gestellten Anforderungen Nachtflüge unvermeidlich. Dies lag aber durchaus in der Absicht der Ausschreibung. Das Flugzeug muß im Ernstfalle auch in der Nacht verwendbar sein. Ueber diese Verwendbarkeit Erfahrungen zu sammeln, war gerade ein wesentlicher Punkt, der die ungewöhnliche Höhe der Preise rechtfertigt. Auch kann die vom militärischen Standpunkt unerläßliche Forderung der Nachtflüge gar nicht in einer mil- ,,Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten u. Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XXVIII. Sturzflugapparat von Pegoud (System Bleriot). 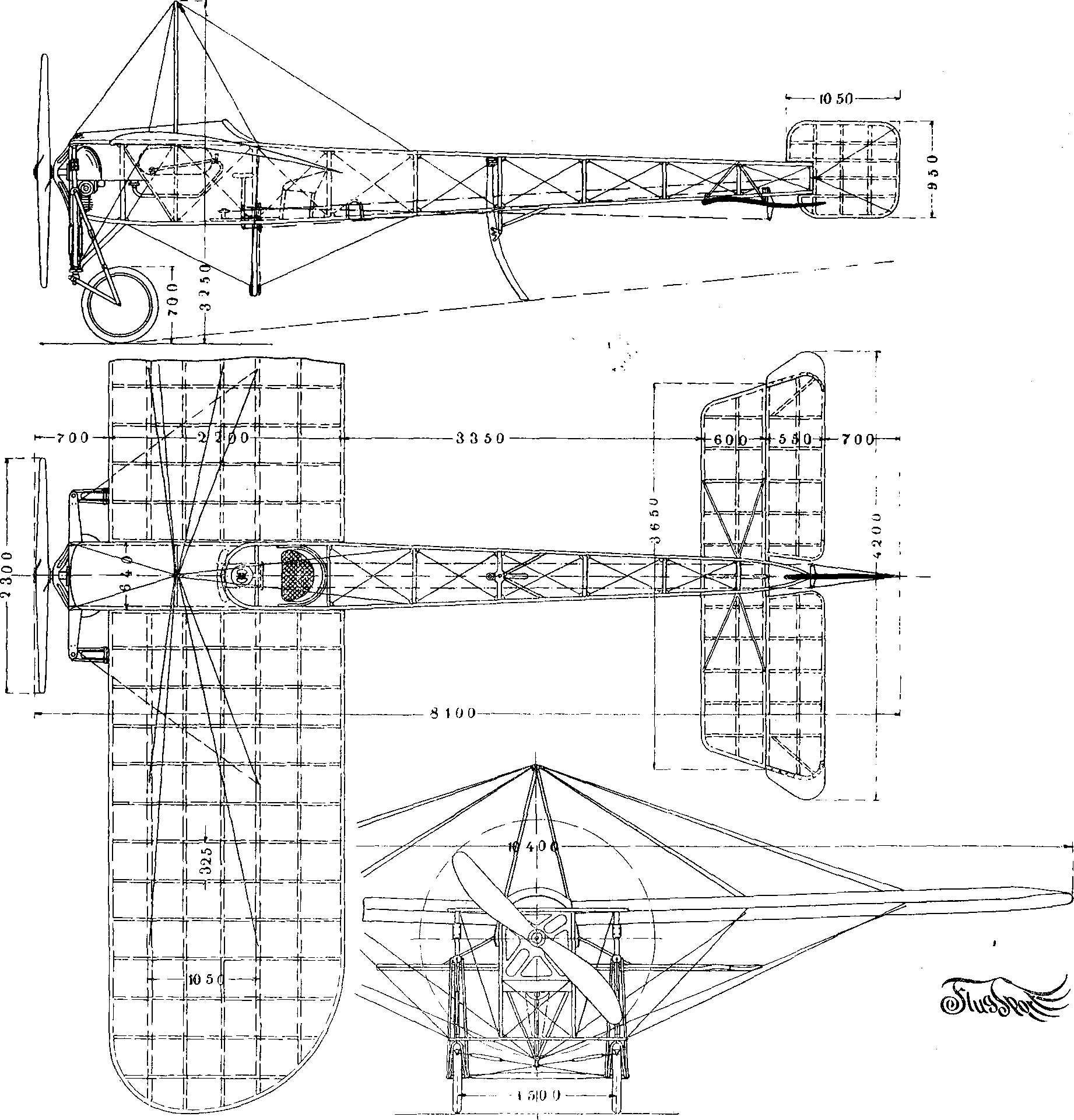 Nachbildung verboten. deren Form, als im Wege einer Ausschreibung gelöst werden, da hierbei kein Zwang besteht, sondern jedem Einzelnen überlassen bleibt, ob er sich beteiligen will und kann, 2. Es ist ferner behauptet worden, daß die Ausschreibung etwas Unmögliches gefordert habe: Denn für den besonderen Preis von 100000 Mark sei eine Mindestentfernung von 1600 km in einer Richtung vorgeschrieben. Hierfür reiche Deutschland nicht aus, während das Ueberfliegen des Auslands, insbesondere Frankreichs und Rußlands, gesetzlich verboten sei. Auch dieser Einwand trifft nicht zu. Zunächst handelte es sich nicht um 1600, sondern um 1380 km, da die zu übertreffende Strecke von Paris nach Caceres nur 1380 km beträgt, wie erst nach der Ausschreibung einwandfrei festgestellt worden ist. Diese Strecke in Deutschland in einer Richtung — das heißt lediglich ohne umzukehren — zu durchfliegen ist durchaus möglich. Vor allem aber sollten die Fernflüge überhaupt nicht auf Deutschland beschränkt werden. Eine besondere Bestimmung der Ausschreibung sieht vielmehr vor, daß die Flüge im Auslande begonnen und beendet werden konnten. Wenn das Ueberfliegen der russischen Grenze verboten ist, so bildet dies eine Ausnahme, die als besonderes Hindernis nicht anerkannt werden kann; Frankreich gegenüber galt- seit Mitte August das deutsch-französische Abkommen, und das übrige Ausland stand für die deutschen Flüge von vornherein offen. Oesterreich hatte sogar seine verbotenen Zonen für die Fernflüge freigegeben. 3. Besonderes Aufsehen scheint der Vorwurf gemacht zu haben, daß die Ausschreibung durch nachträglichen Beschluß des Verwaltungsausschusses der National-Flugspende in einer Weise geändert worden sei, derzufolge die Auszahlung des ersten Preises an Stoeffler unmöglich geworden sei. Zunächst ist festzustellen, daß ein solcher nachträglicher Beschluß nicht erfolgt ist und gar nicht erfolgen konnte, da eine einmal erfolgte Ausschreibung sich bis zum Ablauf des in der Ausschreibung gesetzten Termins nicht mit Rechts Wirkung abändern läßt. Die Geschäftsstolle der National-Flugspende hat lediglich auf telegraphische Anfrage eine unverbindliche Auskunft dahin erteilt, daß nach ihrer Auffassung der Flug um den 100000 Mark-Preis die Strecke von Paris nach Caceres übertreffen müßte und daher im vorbezeichneten Sinne in einer Richtung zu erfolgen habe. Bei dieser Auskunft, die vorbehaltlich der Entscheidung des Verwaltungsausschusses erfolgte, wurde davon ausgegangen, daß nach dem Sinn und Wortlaut der Ausschreibung bei dem 100000 Mark-Preis zunächst zweifellos an einen Flug in einer Richtung gedacht war; Die Ausschreibung hatte den allgemeinen Zweck, große deutsche Leistungen hervorzurufen. Daneben aber bestand der Wunsch, die größte französische Leistung zu übertreffen. Darum wurden für die besten Fernflüge sechs Preise ausgesetzt, unabhängig davon aber ein besonderer Preis für das Uebertreffen der aus drücklich benannten Strecke von Paris nach Caceres aus der Reihe der übrigen Preise durch besondere Bestimmung herausgehoben. Daz,u kam, daß der Geschäftsstelle von der Absicht, Pendelflüge auf kurze Strecken, z. B. zwischen Döberitz und Johannisthal auszuführen, Mitteilung gemacht war. Solche Pendelflüge wären aber keine Fern- flüge gewesen und hätten weder dem Sinn der Aussehreibung, noch dem Ansehen des deutschen Flugwesens entsprochen. Konnte die Auskunft der Geschäftsstelle hiernach nur im vorstehenden Sinne ausfallen, so darf auf der anderen Seite nicht vergessen werden, daß der Verwaltungsausschuß bei seiner endgiltigen Entscheidung durchaus frei ist, einer veränderten Sachlage Rechnung zu tragen. Die Sachlage hat sich aber dadurch verändert, daß zwar ein Flug in einer Richtung von mehr als 1380 km nicht stattgefunden hat, wohl aber die Leistung des Fliegers Stoeffler eine ganz außerordentliche und unerwartete ist, die besonderer Würdigung bedarf. Der Verwaltungsausschuß kann nunmehr dem Flieger Stoeffler den ersten Preis von 60000 Mark zuerkennen und ihm daneben eine Ehrengabe von 40000 Mark gewähren oder aber — und dies würde den Wünschen und Interessen der anderen Preisträger besser entsprechen — Stoeffler den 100000 Mark-Preis und den anderen Siegern der Reihe nach die anderen Preise zu zuteilen. In welcher Weise der Verwaltungsausschuß sich schlüssig machen wird, ist der auf Ende des Monats festgesetzten Sitzung vorbehalten, bis zu der hoffentlich alle Unterlagen vorliegen werden. Uebrigens muß festgestellt werden, daß die Angriffe ausschließlich aus dem Lager derjenigen kommen, die bei der Ausschreibung nichts verloren haben, nämlich der Civilflieger (und zwar zumeist derjenigen, die nicht geflogen sind). Sie beklagen die tödlichen Unfälle : Civilflieger sind nicht verunglückt. Sie verurteilen den Verlust an Flugzeugen: Die Industrie, die allein den Verlust zu tragen hat, hat das Opfer willig im Interesse des Erfolges auf sich genommen. Der Erfolg aber ist in letzter Linie dafür entscheidend, ob die Ausschreibung imsachgemäß gewesen ist oder nicht. Daß ein großer Erfolg erzielt und das deutsche Flugwesen mit einem Schlage in die vorderste Reihe gerückt worden ist, wird selbst im Auslande anerkannt. Wäre es da nicht bosser, sich statt dem Kuratorium, das niemals für sich in Anspruch genommen hat, unfehlbar zu sein, seine schwierige Aufgabe durch müßigen Streit über die eine oder andere Bestimmung zu erschweren, uneingeschränkt des Erfolges zu freuen? * Zusammenstellung der Fernflüge. 14. Oktober: P. V. Stoeffler (100 PS Aviatik-Mercedes-Doppeldecker) Johannisthal—Posen—Johannisthal—Mülhauseni.E.— Darmstadt— Mülhausen i.E.— Darmstadt—Sehlettstadt, 2150 Kilometer. 22. Oktober: E. Schlegel (100 PS Gotha-Mercedes-Taube) Gotha— MUhlhausen i. Th —Gotha—Johannisthal—Königsberg i. Pr.— Labiau, 1510Kilometer Beobachter Ltn. Schartow. 17. Oktober: W. Caspar (100 PS Gotha-Mercedes-Taube) Pendelflug zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg—Döberitz—Breslau—Liegnitz Breslau, 1440 Kilometer Beobachter Ltn. Plagemann. 14. Oktober: Dipl.-Ing R. Thelen (100 PS Albatros-Mercedes-Doppeldecker) Johannisthal — Königsberg - Stettin - Königsberg, 1330 Kilometer. Beobachter Kpt.-Ltn. Berthold. 16 September: P. V. Stoeffler (100 PS Mercedes-Doppeldecker) Mülhausen i. E.—Warschau, 13C0 Kilometer. 16 Oktober: Alfred F r i e d ri ch (100 PS Etrich-Mercedes-Taube) Pendelflug Johannisthal—Teltow, Johannisthal—Bromberg—Elbing - Königsberg—Inster-burg—Tilsit- Heidekrug—Königsberg, über 1120 Kilometer. 16 September: O. Stiefvater (100 PS Jeannin-Argus-Stahltaube) Freiburg i. B. — Gotha — Berlin — Elbing — Königsberg, 1150 Kilometer. Beobachter Oberltn. Zimmermann. 16. Oktober: Werner Wieting (100 PS Rumpier-Mercedes - Eindecker) Berlin - Würzburg - Nürnberg—Döberitz, über 1000 Kilometer, Strecke steht noch nicht fest, da im Nebel verirrt. 16. Oktober: Ltn. Geyer (100 PS Aviatik-Mercedes-Doppeldecker) über 1000 Kilometer mit Beobachter. 27. Oktober: Oberltn. Kastner (100 PS Albatros-Mercedes-Taube) Köln —Düsseldorf-Johannisthal - Posen, 1250 Kilometer. Beobachter Ltn. Boehmer. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Die Frage, welche die hiesigen Fliegerkreise seit einiger Zeit aufs lebhafteste beschäftigte und die einen nicht unbeträchtlichen Widerstreit der Meinungen hervorrief, die Frage nämlich: Brindejonc oder Guillaux hat nun endlich ihre endgiltige Lösung gefunden, die einem Teile als außerordentlich hart, dem größeren Teile aber als wohlverdiente Sühne erscheint. Wie erinnerlich, hatte Brindejonc des Moulinais durch seinen Flug von Paris nach Warschau die Anwartschaft auf den Pommery-Pokal an sich gebracht, als nach einigen Tagen Guillaux der Welt zu wissen gab, daß er die Brindejonc'sche Leistung um etwa 50 km überboten hätte. Diese Behauptung belegte der findige Franzose mit einem bürgermeisterlichen Attest aus einer deutschen Stadt, welches seine Landung daselbst bescheinigte. Es ist schon berichtet worden, daß Guillaux den Ortsnamen auf diesem Attest in einem Buchstaben abgeändert und so einen Ort angegeben hatte, der in der Tat seine Flugleistung über diejenige Brindejoncs erhoben hätte. Durch eifrige Nachforschungen Brindejoncs, der sich seinen wohlerworbenen Lorbeer nicht durch derartige Manöver entreißen lassen wollte (denn inzwischen war die Bewerbsfrist für den Pokal abgelaufen) ergab sich, daß Guillaux, da es ihm auf eine andere Weise nicht möglich war, einfach ,,corriger la fortune" geübt hatte, um sich zum Sieger zu machen. Natürlich kam die Sache vor die Aeronautische Sportkommission, aber der vorgeladene Guilleaux kam nicht. Er hatte inzwischen überall verlauten lassen, daß ein „bedauerlicher Irrtum" seinerseits vorläge. Aber die Kommission, welche die Dokumente in der Hand hatte, ließ sich nicht täuschen und forderte den Flieger nochmals vor ihr Forum. Jetzt kam er und machte in bemitleidenswertem Tone geltend, daß er den Schritt bedauere und daß er in einer Anwandlung von „Wahnsinn" gehandelt haben müsse. Die Kommission, welche geneigt schien, den Flieger auf Lebenszeit zu disqualifizieren, ließ sich durch die ßeue des Fälschers „mildernde Umstände" abringen und sprach die Suspendierung Guillaux's auf die Dauer von zehn Jahren aus. Uebrigens ist noch am letzten Tage, der von der Bewerbsfrist geblieben war, ein Versuch unternommen worden, durch einen geschickten Coup Brindejonc die Palme zu entreißen, und beinahe wäre es gelungen. Gilbert flog am vergangenen Freitag auf seinem Deperdussin-Eindecker, 160 PS .Rhone-Motor, von Villacoublay um ^9 Uhr ab, mit 300 Liter Benzin im Reservoir, und wandte sich gen Osten. Um 10 Uhr passierte er Verviers, 325 km von Paris, dann war nichts mehr von ihm zu hören, bis endlich am Abend die Meldung eintraf, daß er um 1 Uhr 45 in Pütnitz in Pommern gelandet sei. Er hatte 1050 km in 5:15:00 zurückgelegt. Der Pommery-Pokal ist also endgültig in Brindejoncs Hände gefallen. Der Stifter dieses Preises hat bereits einen neuen Pommery - Pokal für 1914 ausgesetzt, mit der Maßgabe, daß die Trophäe wiederum drei Jahre lang in halbjährlichen Prämien zu bestreiten ist und daß der Gewinner der letzten Halbjahresprämie endgiltiger Sieger und Besitzer der Trophäe bleibt. Das Reglement erfährt nur die eine Abänderung, daß die Bewerber von jetzt ab zwei volle Tage für ihre Flüge haben werden. Wenn Gilbert das geplante Husarenstückchen um den Pokal mißglückt ist, so kann er sich damit trösten, daß er zwei Tage vorher den Rundflug um Paris gewonnen hat. Er legte die 200 km Flugstrecke Villacoublay - Senlis— Meaux—Melun—Saint Germain - Villacoublay in 1 : ]3 : 25-2 zurück, so daß er eine mittlere Geschwindigkeit von 163,450 km realisiert hat. Auch der Michelin - Pokal hat zu Differenzen und Aufregungen geführt. Bekanntlich ist Fourny gegenwärtig mit seinen 15000 km Anwärter. Nun versuchte Helen, gleichfalls auf der Rundstrecke Etampes-Gidy, diesen Rekord anzugreifen und mit großer Regelmäßigkeit legte er auf seinem Nieuport-Eindecker tätlich seine 533 km zurück, so daß er am letzten Donnerstag bereits die frühere Leistung Caveliers (7696,320 km) gedrückt und am Freitag 8528 km hinter sich gebracht hatte. Aber an demselben Tage entschied die Sportkommission, daß die an den ersten neun Tagen zurückgelegten Distanzen wegen Reglements Verletzungen nicht giltig seien, sodaß sich die von Helen bis dahin geflogene Distanz auf 3731 km verringerte. Aber Helen scheint nicht entmutigt zu sein, denn er setzt seine Runden fort. Großes Aufsehen erregte hier auch der nächtliche Absturz Ernst Stoefflers im Park von Versailles als er, mit seinem Begleiter an Bord, nach glücklich zurückgelegtem Fluge Berlin - Paris sich anschickte, von hier aus einen Weitflug nach Rußland zu unternehmen. Stoeffler hatte beschlossen, am letzten Freitag von Villacoublay abzufliegen, woselbst sein Flugzeug untergebracht war. Um 1 Uhr 30 in der Nacht traf er mit seinem, Begleiter auf dem Morane-Flugfeld ein und setzte seinen Apparat in Bereitschaft. An einer der Streben brachte er eine kleine rote Laterne an, die ihm in der herrschenden Finsternis die Neigung seines Flugzeuges anzeigen sollte. Zur Beleuchtung des Kompasses waren elek- trische Lampen vorgesehen, die gleichzeitig auch den Tourenzähler, sowie alle Kontrollapparate erkennbar machen sollten. Es war 3 Uhr 30 Min., als sich Stoeffler auf seinem schönen Albatros-Zweidecker in die Luft erhob und in der dunklen Nacht sich schnell entfernte. Kurz nach dem Abflug aber bemerkte Stoeffler, daß die Beleuchtung nicht funktionierte, so daß er den Kompaß nicht zu lesen vermochte. Er kreiste mehrere Male über Versailles und schickte sich schließlich an zu landen, und zwar an einer weiß schimmernden Stelle, die eine Wiese sein konnte: es war das bekannte Latone-Bassin neben dem Versailler Schloß. Die Landung hätte trotzdem geglückt, wenn nicht das Flugzeug die Baumwipfel der den sogenannten „Grünen Teppich von Versailles" umsäumenden Allee gestreift hätte, wodurch der Absturz verursacht wurde. Stoeffler blieb zum Glück ohne jede Verletzung, sein Begleiter erlitt leichte Kniewunden. Aber das schöne Flugzeug kam schlecht dabei fort. Nur der Motor, die Reservoire und das Tiefensteuer blieben heil. Daß übrigens Stoeffler auf seinem Hinwege von Johannisthal nach Paris in Montigny, wo er eine Landung vorgenommen hatte, Gegenstand völlig willkürlicher Chikanen seitens der Polizei gewesen ist, daß er, trotzdem seine Papiere vollkommen in Ordnung waren, drei Stunden lang zurückgehalten worden ist, dürfte schon bekannt geworden sein. Und das in demselben Augenblick, wo die hiesige Presse nicht müde wird, in spaltenlangen Artikeln den Triumphzug Pegouds durch Deutschland zu schildern, bei dem ihm das ganze Volk unerhörte Ovationen darbringe. Die Kommission des Aero-Clubs hat in ihrer letzten Sitzung beschlossen, den endgiltigen Schluß der Nennungsliste für den Michelin-Zielscheiben-Preis vorzunehmen, auf der sich jetzt folgende Bewerber befinden: Coursin, Fourny, Gaubert, Hauptmann Leclerc, Leutnant Sallier, Unteroffizier Vandelle. Die Versuche finden vom 12. bis 20 November aus mindestens 1000 m Höhe auf dem Fluge von Chälons statt. Das französische Militärflugwesen setzt seine stille Trainierungsarbeit fort, und in der letzten Zeit sind wieder mehrfache sehr interessante Eekognoszierungsflüge unternommen worden, von denen namentlich der eine viel beachtet wurde: das Geschwader Nr. 7, das in Verdun stationiert ist, hat, einem vom Kriegsministerium entworfenen Programm zufolge, einen Etappeuflug von 900 km, und zwar von Verdun nach Mourmelon, Mezieres, Maubeuge, Douai, Arras, Amiens, Sissonne, Keims, Bar-le-Duc zurück nach Verdun, ausgeführt, wobei das aus fünf Flugzeugen bestehende Geschwader stets zusammenblieb. In Reims ereignete sich dieser Tage ein schwerer Unfall: Ein Feldwebel stürzte aus 100 m ab und wurde auf der Stelle getötet. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß durch eine soeben erlassene Verfügung des französischen Kriegsministeriums die Dienstzeit-Vergütung an Flieger neu geregelt worden ist. Danach werden dem Inhaber des Militär- Fliegerzeugnisses zwölf Monate Dienstzeit angerechnet. Außerdem werden ihm für die Leistung gewisser Dienste je drei Monate vergütet, so für die Ausführung einer großen Luftreise für die Teilnahme an den Herbstmanövern, für eine spezielle Dienstperiode (Ausbildung von Beobachtern, verschiedene Experimente) und endlich für einen sechsmonatlichen Dienst als Chef-Flieger. Die Ligue Nationale Aerienne hat die telegraphische Meldung erhalten, daß das Militär-Luftgeschwader von Biskra, das sich gegenwärtig in Tunis befindet, in Kürze einen Plug von Norden nach Süden durch ganz Tunis unternehmen werde, und zwar von Tunis nach Ghadames. Später soll die Strecke von Colomb Bechar nach In Sa Iah folgen, so daß die von der Ligue Nationale ausgeschriebene und geförderte große Luftstrecke von Colom Bechar nach Tim buktu alsdann geschlossen wäre. Die Lorbeeren Pegouds scheinen den bekannten Flieger Chevillard nicht schlafen zu lassen, denn er kündigt an, daß er an diesem Sonntag in Juvisy „noch viel großartigeres'1 vollbringen werde. Jene Mode der Luft-Akrobatik scheint also ansteckend zu wirken. TJebrigens wird es von Interesse sein, daß das Flugfeld von Juvisy demnächst eingeht das sogenannte „TJnglücks-Flugfeld" soll bebaut werden. Zu erwähnen sind noch die fortgesetzten Versuche, welche Weymann gegenwärtig zu Mourmelon mit einem neuen gepanzerten Flugzeug vornimmt, welches nach Plänen des Hauptmanns Couade konstruiert worden ist. Das Flugzeug, ein Eindecker, war zuerst mit einem 70 PS Gnom-Motor versehen, doch soll jetzt ein solcher von 80 PS aufmontiert werden. Der Apparat, der die von der französischen Heeresverwaltung vorgeschriebene Panzerung aufweist, hat eine Länge von 5,80 m; die Flügel haben eine Spannweite von 8,90 m und die Gesamtfläche hat ein Ausmaß von 20 qm. Drei Konstruktionsdetails sind bezüglich-.des inredestehenden Flugzeugs zu erwähnen: 1. ein Rohr vereinigt das Fluggestell mit den hinteren Steuerflächen vermittelst starrer Steuerungen; 2. Federsplinte gestatten das schnelle Auseinandernehmen und Wiederzusammensetzen des Apparates; 3. ein besonderes Gestell ist vorgesehen, auf welchem der Motor, der Magnetapparat und die Oelpumpen placiert sind, so daß das Auswechseln des Motors und seiner Zubehörteile in leichter und schneller Weise bewerkstelligt werden kann. Die ersten Versuche mit diesem Flugzeug haben nicht das gebracht, was man von ihm erwartet hatte. Hauptmann Couade will auf Veranlassung der Militärbehörden einige Aenderungen vornehmen und dann sollen die Versuche mit dem Apparat fortgesetzt werden. Spassig ist, wie der unvermeidliche Vedrines von dem übrigens schon an anderer Stelle die Rede ist, wieder von sich reden macht. Man hat ihn wiederholt gefragt, wann und wohin er nun von Nancy aus, wo er sich immer noch befindet, zu fliegen gedenke. Von Tag zu Tag kündet er immer wieder seinen „unmittelbar bevorstehenden Abflug an. „Das Projekt, das ich realisieren will, wird umso besser glücken, und umso größere Sensation erregen, je tieferes Stillschweigen ich mit Bezug darauf wahre. Ich kann mein Geheimnis nicht verraten. Ich studiere jetzt noch alle Einzel- heiten dieses Projekts, und sobald das Wetter günstig dafür sein wird, werde ich es auszuführen unternehmen. Aber da ich dazu ein absolut günstiges Wetter brauche, kann mein Abflug ebenso gut in einer Stunde wie in 14 Tagen erfolgen." Hoffentlich plant der „bedeutende Mann" nicht etwa, schon jetzt sein Vorhaben, Berlin dem Erdboden gleichzumachen und Deutschland mit einem Schlage zu vernichten, wahr zu machen. Zwei interessante Nachrichten kommen aus den Vereinigten Staaten, über die man hier begreiflicherweise viel spricht. Die erste besagt, daß Orville Wright sein Vorgehen gegen die Gesellschaft Herring-Curtiss fortsetzt und zwar wegen Nachahmung seiner Maschinen. Er will jetzt einen Schadenersatzanspruch in Höhe von 20 Millionen Mark geltend machon. Selbstverständlich bestreitet die Herring-Curtiss-Gesellschaft ihrerseits die Berechtigung dieses Anspruchs und es heißt, daß die Angelegenheit vor den höchsten Gerichtshof in den Vereinigten Staaten, vor die „supreme court" kommen wird. Noch interessanter ist ein Interview, welches Glenn H. Curtiss, der soeben von einer Reise durch Europa in die Heimat zurückgekehrt ist, einem Mitarbeiter des New-York Herald" gewährt hat und in dem er sich über den Stand des Plugwesens in Europa geäußert hat. Curtiss hat Deutschland, Frankreich, England, Rußland und Italien besucht und meinte u. a.: „In militärischer Beziehung hat das Flugwesen in Europa einen außerordentlichen Aufschwung und eine sehr schnelle Entwicklung erfahren. Aber vom sportlichen Standpunkt läßt diese Entwicklung sehr viel zu wünschen übrig. Frankreich ist den anderen Nationen bei weitem voraus, aber Deutschland, Rußland und namentlich England arbeiten mit großer Energie daran, den Franzosen die Suprematie der Luft zu entreißen. Ich persönlich bezweifle, daß ihnen das gelingen wird. Was die Wasserflugmaschinen anbelangt, so glaube ich, daß im nächsten Jahre England allen übrigen Nationen die Spitze bieten wird. Großbritannien, das die Meere beherrscht, scheint entschlossen zu sein, auch auf diesem Felde die Hegemonie an sich zu bringen." . . . Rl. Aus den englischen Flugcentren. „Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonnen'f So auch diesmal. Viel Interesse beanspruchen die Enthüllungen in Verbindung mit der „Royal-Aero-Club" Krisis. Wie schon berichtet, forderte der Club die Grahame White Aviation Co. auf, die von Brindejonc des Moulinais gewonnene Giessler Trophäe nochmals, nachdem der Flieger, bereits im Besitze des Preises, disqualifiziert wurde, an den zweiten Sieger Brooks zu überreichen, was die Company entschieden verweigerte und den Austritt verschiedener Mitglieder aus dem Club zur Folge hatte. Brooks flog damals einen Deperdnssin-Eindecker, und die britische Deperdussin-Company geriet bekanntlich kurz nachdem die Schwindeleien von Armand Deperdnssin aufgedeckt waren, in Konkurs. Hätte nun Brooks den Preis an sich gebracht, so wäre doch sicher der größere Teil des Preises in den Besitz der Company übergegangen und hätte vielleicht die eingegangene Firma noch eine kurze Frist über Wasser gehalten. Es besteht kein Zweifel, daß die Streitigkeiten auf diesen Umstand zurückzuführen sind. Vielleicht haben die Creditoren ein Anrecht auf den Preis? Es ist entschieden interessant, zu wissen, zu welchem Ende diese Schieberei noch führen wird. In der Militär-Centrai-Flieger-Schule sind in letzter Zeit verschiedene Veränderungen vorgenommen worden. So sind, nachdem nun endlich der in den vorjährigen Herbstmanövern an Eindecker erlasssene Bann, welcher sämtliche Eindecker aus dem Gebrauche in der Armee ausschied, aufgehoben wurde, wieder Eindecker-Typen eingeführt. Major Fulton ist zum Inspektor des gesamten Flugmaschinenmaterials ernannt worden. Das Kriegsministerium hat ferner in der Nähe von Montrose, in Schottland, einen großen Komplex Länder angekauft, um auf demselben ein grosses Militär-Aerodrom zu errichten. Nach Fertigstellung desselben wird die im Westen von Montrose stationierte 2. Sektion des Royal Flying Corps nach dem neuen Platze verlegt werden, wo alsdann zu der aus 24 Flugmaschinen bestehenden Sektion noch weitere 12 Maschinen hinzukommen. Interessante Experimente wurden dieser Tage auf der Salisbury-Ebene mit einer neuen, von der Cotton Powder Company erfundenen Flugzeug-Bombe ausgeführt, mit welcher nach Meldungen der War Office glänzende Resultate erzielt worden sein sollen. Die charakterischen Eigenschaften dieser neuen Erfindung sind folgende: 1. Die Bombe kann nur beim Fluge automatisch gebraucht werden, sie explodiert nicht, wenn sie von einem anderen Geschoss getroffen wird, oder wenn der Flieger beim Landen hart auf den Boden stösst, 2. Wie auch geworfen, fällt immer Spitze nach unten. 3. Ist für den Handgebrauch, sowohl auch für eine Federkanone konstruiert. 4. Durchschlägt eine 6 cm dicke Panzerplatte. 5. Explodiert bei dem geringsten Stoss, auch beim Aufschlagen auf eine Wasserfläche. Auf Veranlassung der Admiralität errichten die Flugmaschinen-Werke Gebrüder Short zu Eastchurch, Isle of Sheppey in der Nähe von Rochester, unweit der grossen Kriegsschiffstation Chatham, eine neue Wasserflugzeug-Fabrik. Damit gehen die seinerzeit von der Admiralität aufgestellten Bedingungen zwecks Beschaffung von Wasserflugzeugen für die Marine langsam in Erfüllung. Mit dem aufgestellten Programm wird in weitgehendem Masse für die Zukunft Vorsorge getroffen, ein Verfahren, welches sicherlich nicht unberechtigt ist. Die Frage des Marineflugwesens stellt heute vor einem Wendepunkt und dürfte sich die Admiralität im Laufe der nächsten Jahre von selbst entschliessen, ihr Programm, die Schaffung einer Flotte von 200 Flugzeugen zu revidieren und die Zahl zu vergrössern, sobald die konstruktive und praktische Entwicklung der Wasserflugzeuge mit Erfolg als fünfte Waffe in die Marine In allererster Linie kommt es natürlich darauf an, in welchem Maße die englischen Konstrukteure der neuen Seewaffe eine prominente Stellung schaffen können. Die Bestimmungen der englischen Admiralität lassen erkennen, daß das Wasserflugzeugproblem eine günstige Lösung erfahren kann. Der vorgezeichnete Weg drängt zunächst auf eine möglichste Vereinfachung der Wasserflugmaschinen hin. Curtiss hat, nachdem er sein Boot der englischen Admiralität vor Augen führte, dasselbe der neu gegründeten Privatgesellschaft Brighton überlassen. DieBritish - and Colo-nial-Aeroplane-Company, kurzweg Bristol-Werke, hat ein neues, ihr erstes Wasserflugzeug fertiggestellt, welches von Fliegern der Marine geführt, in der NähevonPembroke-Dock sich zufriedenstellend bewährt hat. Die Marine zeigt ein lebhaftes Interesse für diesen Apparat. Auch der neukonstruierte Samuel White Navyplane hat Beweise seiner Tauglichkeit gezeigt und werden wohl in nächster Zeit ähnliche Apparate für die Marine gebaut werden. Wie sehr den Engländern die Entwicklung des Wasserflugwesens am Herzers liegt, geht daraus lebhaft hervor, beweisst, dass sie sich einzugliedern vermögen.  dass der Marineminister Winston Churchill den ihm untergebenen Fliegern mit guten Beispiel vorangeht und fast täglich von einer der Flugstatioiien aus, stundenlange Flüge ausführt. Am 2. Okt. flog er von der Marineflugstation Cromarty aus mit Leutnant Spencer Grey auf einem Sopwith-Wassdoppeldecker bis zu einer Höhe von 1000 m. Am 9. Okt. erreichte er eine Höhe von 2000 m. Am 22. Okt. wurde bei seinem Fluge mit Commander Samson, die von ihm geführte Maschine, ein Short-Apparat, beim Anwässern vollständig zertrümmert. Das konnte jedoch den ersten Lord der Admiralität nicht davon abhalten, schon am nächsten Tage von der Station Isle of Sheppey aus, einen weiteren Flug zu unternehmen. Am 25. Okt. sah man ihn abermals eine Short-Maschine besteigen, um von der Station Eastchurch mit Commander Samson nach Southampton zu fliegen. Am 31. Okt. fand in Farnborough in seiner Gegenwart eine Inspektion des gesamten Flugmaterials statt, wobei die zur Armee gehörigen Lenkballone offiziell in den Besitz der Admiralität übergingen. Zu gleicher Zeit wurde dem Marineminister eine neue von den Königlichen Flugzeugwerken hergestellte Maschine vorgeführt, die unter dem Namen I. C. 2 bekannt geworden ist. Der Apparat ist ein Doppeldecker-Typ ähnlich den BE Typen, hat im Gegensatz zu denselben jedoch nur einen Sitz und erreichte unter der Führung des Fliegers Havilland bei Wind und Regen eine Geschwindigkeit von 91 Meilen und gilt als schnellste Maschine Englands. Auch das Privatflugwesen ist trotz anhaltend schlechten Wetters und vorgerückter Saison noch immer ein äußerst lebhaftes. So fand auf dem Flugplatze zu Hendon ein Morane-Speed-Handicap statt, welches mit einem Siege für Hamel endete. An dem Rennen nahmen folgende Flieger teil: Hamel, Slack, Grahame White und Marty, alle auf 80 PS Le Rhone Morane-Saulnier-Eindeckern. Der bekannte Major Felix führte ebenfalls dieser Tage den ersten der beiden für die englische Militärverwaltung bestimmten Dunne-Doppeldecker durch die nötigen Probeflüge. Man hat jedoch hier die Flüge dieses seinerzeits so viel gepriesenen, absolut gebrauchssicheren Apparates ziemlich kühl aufgenommen. Augenzeugen konnten beobachten, daß Major Felix selber Schwierigkeiten in der Handhabung der Maschine hatte, welche nebenbei noch ängstigend hinterlastig ist. Sofort nach Anwerfen des Motores schnellt der vordere Teil des Apparates in die Höhe und während des Fluges hängt der hintere Teil der Tragflächen stark nach unten. Bei der ersten Landung kam die Maschine so hart auf, daß die unter den Flügelspitzen angebrachten Springkufen zerbrachen und die Tragflächen selber stark beschädigt wurden. Damit hätte die von englischer Seite so hoch in den Himmel erhobene Theorie des Leutnants Dünne einen herben Stoss erlitten. Am 5 November fand in Hendon das erste diesjährige Nachtfliegen mit Feuerwerk und Luftkrieg statt. zu welchem eine grosse Menschenmenge erschienen war. Für Sonnabend den 8. November ist ein Fernflug London-Brigthon und zurück vorgesehen. Die Flieger starten um 11 Uhr vormittags und werden gegen 2 Uhr zurückerwartet. Preise bis in Höhe von Lstr. 200 sind ausgesetzt. Die Society of Motor-Manufakturers and Traders hat dem Royal-Aero-Club Nachricht zukommen lassen, dass sie die nächste Internationale Flugzeug-Ausstellung 1914 vom 16. — 21. März in den Räumen der Olympia abhalten wird. Lord. Fernflüge.*) Am 27. Oktober brachte Alfred Friedrich 753 km hinter sich. Er startete 8:28 Uhr vormitags in Gelsenkirchen, von wo aus er mit einer Zwischenlandung in Johannisthal um 1 Uhr weiter flog. 4:30 Uhr wurde er in Bromberg gesichtet. Infolge des zunehmenden starken Nebels landete er gegen 5 Uhr auf dem Bromberger Militär-Flugplatz, wo er den Flug aufgab. Oberlt. Kastner mit Lt. Böhmer flogen am 27. Oktober auf Albatros-Mercedes-Taube von Cöln über Düsseldorf nach Johannisthal und von da nach Posen. Die Gesamtflugstrecke beträgt 1250 km. Am 29. Oktober flogen sie von Posen nach Breslau und am 30. Oktober von Breslau nach Wien. Am 31. Oktober traten die Flieger ihre Rückreise nach Deutschland an. Lt. Pfeifer von der Cölner Fliegerstation mit Lt. Rohde als Beobachter flogen am 27. Okt. von Cöln über Gera, wo sie 1:30 Uhr eine Zwischenlandung ausführten, von da nach Böhmen und landeten gegen 5 Uhr in Budweis. Von da flogen die Flieger am 28. Okt. um 11 Uhr vormittags wieder ab und landeten 4:30 nachmittags auf dem Militärflugfeld in Wiener-Neustadt. Der Rückflug nach Deutschland erfolgte am 31. Oktober. Oberlt. Joly mit Oberlt. Gissot flogen in Cöln am 27. Okt. ab, machten gleichfalls in Gera eine Zwischenlandung, flogen weiter nach München und erreichten am 29. Okt. um 1:55 Uhr mittags den Flugplatz Wiener-Neustadt. Am 31. Oktober flogen die Flieger wieder zurück nach Deutschland. Lt. Carganko mit Lt. z S. Friedberg als Beobachter flogen am 27. Okt. auf L. V. G.-Mercedes Doppeldeckerum 6:15 Uhr in Johannisthal ab und landeten in Königsberg 10: 15 Uhr. Nach kurzem Aufenthalt flogen die Flieger nach Graudenz weiter. Die Gesamtflugstrecke beträgt 700 km. Von hier aus flogen die Flieger über Breslau nach Wien, wo sie ihren Doppeldecker den österr. Fliegeroffizieren vorführen. Ferner stellte Laitsch am 28. Okt. einen Wellrekord durch einen Ueberlandflug mit Beobachter in 9'|2 Stunden auf. Laitsch flog auf seinem L. V. G.-Doppeldecker mit 100 PS Mercedes. 6 : 40 Uhr vormittags in *) In Ergänz ng unserer Berichte in der letzten Ncimmei. Johannisthal ab in der Richtung nach Rußland. An der russischen Grenze war indessen der Nebel so stark, daß Laitsch beschloß umzukehren und nach Königsberg zu fliegen. Er landete in Königsberg 4 : 10 Uhr. Der Dauer-Weltrekord im Ueberlandflug wurde bisher von Gilbert mit 8 Std. 25 Min. gehalten. Die gesainte von Laitsch durchflogene Strecke betrug 810 km. Am 30. Oktober startete Krieger auf einem Albatros-Renneindecker mit 6 Zyl. Benz-Motor in Johannisthal zu einem Fluge nach Paris, mußte jedoch bei Kronau ca. 30 km vor Hannover infolge Wasserrohrbruch niedergehen. Die photographische Abbildung rasch bewegter Gegenstände durch Schlitzverschlußapparate. Zu dem Artikel „Biegen sich die Tragdecken nach hinten?" in No. 21 dieser Zeitschrift. Die Verzerrung, die rasch bewegte Gegenstände im photographischen Bilde zeigen, machen sich dann besonders störend geltend, wenn aus diesem auf die gegenseitige Lage der einzelnen Teile Schlüsse gezogen werden sollen. Da gerade die Flugterhnik ein reiches Feld für derartige Bestimmungen bietet, glaube ich, daß eine kurze Erörterung dieser Frage umsomehr allgemeines Interesse hat, als der oben angeführte Aufsatz geradezu ein Schulbeispiel hierfür darstellt. Das wesentliche des Schlitzverschlusses besteht darin, daß er die photographische Platte nicht auf einmal belichtet, sondern sie sozusagen in parallele Streifen teilt, die nacheinander belichtet werden. Hierdurch entsteht der Vorteil, daß für die Zeit der Belichtung die ganze Objektivöffnung zur Verfügung steht, während sie beim Zentralverschluß in der Zeit des Auf- und Zugehens teilweise abgeblendet ist. Während aber beim letzteren alle Teile des Gegenstandes gleichzeitig zur Abbildung kommen, daher ihre gegenseitige Lage beibehalten, wenn auch entsprechend der Expositionszeit mehr oder weniger unscharf werden, tritt beim Schlitzverschluß eine Verschiebung der oben und unten im Bilde gelegenen Teile ein, weil sie nicht gleichzeitig abgebildet werden, und sich der Gegenstand inzwischen weiterbewegt hat. Gerade vertikale Linien bleiben wohl gerade, werden aber in der Bewegungsrichtung oder entgegen derselben umzufallen scheinen, je nachdem der Schlitzverschluß zuerst die untere oder obere Bildpartie belichtet, demnach, da das Bild im Apparate auf dem Kopfe steht, sich von oben nach unten oder umgekehrt abrollt. Horizontale, zur Bildebene parallele Linien werden richtig abgebildet. Ueber die Abbildung aller übrigen Geraden geben die Regeln der Perspektive Aufschluß. Alle zur Bildebene senkrechten Linien werden bekanntlich so abgebildet, daß sie in dem sog. Fluchtpunkt zusammenlaufend erscheinen, der im Bilde dort liegt, wo die optische Achse des Objektivs die Platte trifft. In Abb. 1 sind F der Fluchtpunkt und die zusammenlaufenden Strecken ab bis a' b' die Bilder der Tragflächenvorderkante, wie sie sich bei neunmaliger Aufnahme auf derselben Platte darstellen würden. Um die Strecke a a' sei die Tragflächenkante weitergerückt, während der Schlitzverschluß das Bild derselben von oben bis unten oder unigekehrt bestrichen habe. Diese Strecke ist in der 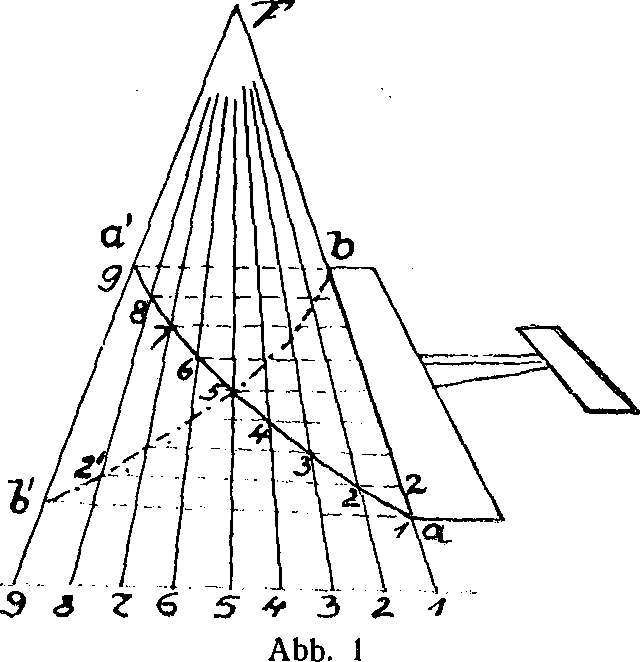 Abbildung natürlich der Deutlichkeit wegen sehr Ubertrieben. Demnach wird der Punkt 1 in a oder b', der Punkt 2 in 2 oder 2' usw. der Punkt 9 in b' oder a' abgebildet, je nach dem der Schlitzverschluß nach unten oder oben rollt. Da in dem angeführten Aufsatze von einem Nach vornstürzen der Oberteile schnellfahrender Wagen gesprochen wird, so müßte die Krumme a a' die Abbildung der Tragflächenvorderkante entsprechen, wie sie eben auch das Bild zeigt. Hierbei wurde einstweilen angenommen, daß der Apparat bei der Aufnahme in Ruhe war. Etwas anders wird die Abbildung, wenn man, wie in dem gegebenen Falle, dem Flugzeug mit dem Apparate folgt. Bei einem geradeaus vorbeifliegenden Flugzeug kann man aber nur einem Punkte derart folgen, daß sich derselbe auf ein nnd derselben Stelle der Platte durch längere Zeit abbildet. Nehmen wir an, es wäre dies mit der Mitte der Tragflächenvorderkante gelungen. Diese Schwenkung hat zur Folge, daß die Tragflächenkante nicht mehr senkrecht zur Platte bleibt, sondern Platte und Kante eine sich fortwährend ändernde Neigung zueinander bekommen. Dies stellt sich im Bilde derart dar, daß der Fluchtpunkt nicht mehr im Punkte F fest bleibt, sondern entgegen der Flugrichtung wandert, (Siehe die Punkte 12 3-9 oben in Abb. 2). Die fächerförmig angeordneten Linien a b' bis 7 5. a' b in Abb. 2 zeigen wie sich die Tragflächenkante nacheinander abbilden würde. Sinngemäß mit dem früher gesagten muß also auch hier das krumme Bild a a' oder b b' entstehen je nach der Bewegungsrichtung des Verschlusses, also in unserem Falle die Krümme a a', wie sie auch das Bild zeigt. Nur in dem Falle, als das Flugzeug um die als Aufnahmsstandpunkt gewählte Wendemarke einen Kreis beschrieben hätte, wäre es wenigstens vorstellbar, durch' Folgen mit dem Apparate ein unverzerries Bild zu erhalten. Wie groß in dem vorliegenden Falle die Krümmung elwa werden kann, läßt sich unschwer schätzen. Nimmt man die Breite des Verschlußschlitzes groß mit 1 cm an, so muß es bei der angegebenen Belichtungszeit von Vi.ℜ Sekunde einen Zeitraum von "/,„„„ Sek. gedauert haben, bis das 11 cm hohe Bild der 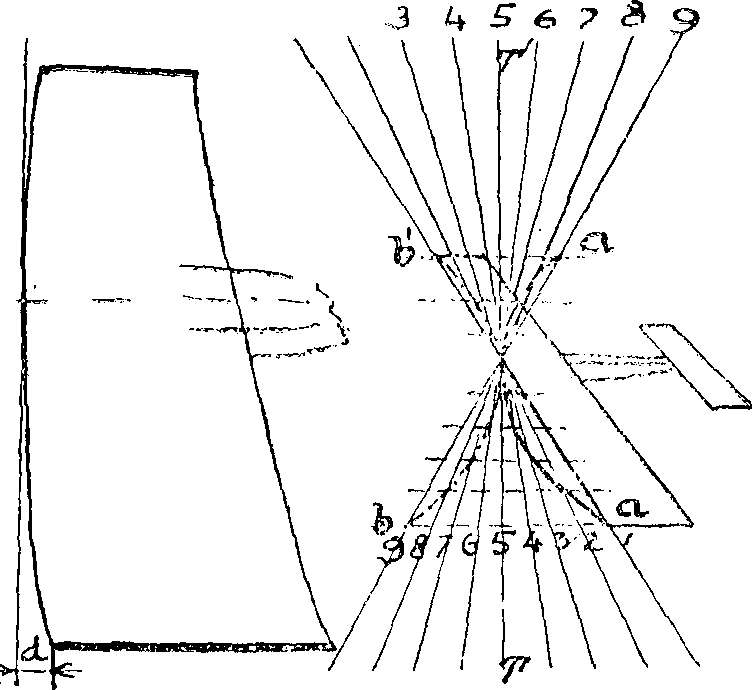 Abb. 2 Tragfläche bestrichen wurde. Die Flugzeugmitte liegt im perspektivischen Bilde rund '/s der ganzen Bildhöhe über der zugekehrten Kante. Es hat also etwa '/1000 Sek. gedauert bis das Kantenbild aus der Stellung 1—1 in 5 - 5 gekommen ist. Nehmen wir die Tragflächenbreite mit 2 m an, so entsprechen in der Entfernung der zugemendeten Kante 3 cm Bildgröße 1 m in Wirklichkeit. Bei einer vorgenommenen Fluggeschwindigkeit von 30 m/Sek. (annäh 100 km/St.) wurde in Viooo Sek. 3000 X '/iooo = 21 cm zurückgelegt, was im Bilde etwa 6 mm entspricht. Um diesen Betrag also das zugekehrte Ende gegen eine an die Kantenmitte gelegte Tangente zurückstehend erscheinen. Wie die in Abb. 2 links nach diesen Dimensionen in verkleinertem Maßstab gezeichnete Krümmung zeigt, stimmt sie mit derjenigen in der Aufnahme recht gut überein. Trotzdem bin ich jedoch der Ansicht, daß sich die Tragfläche auch tatsächlich nach hinten biegt, da sie ja ihren ganzen Slirnwiderstand zu erleiden hat, und gerade in dieser Richtung nicht starr verspannt werden kann. No. 558. Mendt, Willy, Ingenieur, Braunschweig, geb. am 4. Nov. 1890 zu Braunschweig, für Zweidecker (Farman), Flugplatz Halberstadt, am 10. Okt. 1913. No. 559. Hillmann, Wilhelm, Halberstadt, geb. am 20. Mai 1886 zu Mülheim (Ruhr), für Eindecker (Bristol), Flugplatz Halberstadt, am 10. Oktober 1913. No. 560. Wimmer, Eduard, Leutnant im k. b 2. Inf.-Regt, München, geb. am 10. April 1885 zu Wegscheid bei Passau, für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz-Johannisthal, am 11. Oktober 1913. No. 561. Meyer, Ludwig, Gelsenkirchen, geb. am 30. Juli 1893 zu Gelsenkirchen, für Zweidecker (Deutschland), Flugplatz Gelsenkirchen, am 11. Okt. 1913. No. 562. Tille, Walter, cand rer. elec, Karlsruhe, geb. am 14. Okt. 1891 zu Nassau a. L., für Zweidecker (Schwade), Flugplatz Drosselberg, am 11. Okt. 1913- No. 563. Schulte, Norbert, Ingenieur, Erfurt, geb. am 30. Januar 1889 zu Anröchte, Kr. Lippstadt i. W., für Zweidecker (Schwade), Flugplatz Drosselberg, am 11. Oktober 1913. No. 564. Sonntag. Bruno, Leipzig, geb. am 16. Januar 1894 zu Leipzig, für Zweidecker (DFW.), Flugfeld der Deutschen Flugzeugwerke, am 14 Okt 1913. No. 565. Haller, Martin, Schönblick bei Woltersdorf, geb. am 19. März 1895 zu Friedrichshagen, für Eindecker (Jeannin-Stahltaube), Flugplatz Johannisthal, am 14. Oktober 1913. No. 566. Ansiinger, Leopold, Mainz-Gonsenheim, geb. am 13 April 1891 zu Freiburg i. Br., für Eindecker (Goedecker), Flugplatz Großer Sand bei Mainz, am 14. Oktober 1913 No. 567. Breitbeil, Otto, stud. ing., Johannisthal, geb. am 27. April 1890 zuMiillheim (Baden\ für Zweidecker (Ago), Flugplatz Johannisthal, am 14. Okt. 1913. No. 568. Winter, Heinz, Berlin, geb. am 12. Oktober 1889 zu Türkheim, für Zweidecker (AEG.), Flugplatz der AEG., am 17. Oktober 1913 Ing. F . L e j e u n e. Flugtechnische 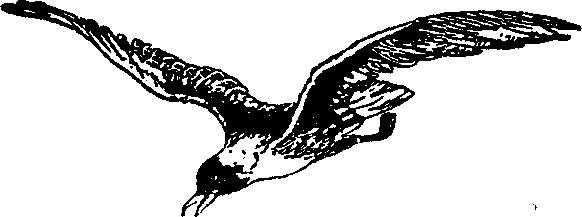 Rundschau. Inland. Flugjiihrer-Zeugnisse haben erhalten: No. 569. Jlling, Oskar, Leutnant k. b. Inf -Leib-Regt., München, geb. am 21. August 18S7 zu München, für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 20. Oktober 1913. No. 570 Malchow, Hans, stud. rer. techn., Zehlendorf, geb. am 8 März 1893 zu Berlin, für Eindecker (Jeannin-Stahltaube), Flugplatz Johannisthal, am 20. Oktober 1913. No. 571. Lange, Hans, Leipzig, geb. am 15. August 1894 zu Leipzig, füi Zweidecker (Sachsen), Flugfeld Lindenthal, am 21. Oktober 1913. No. 572. Grunow, Otto, Alt-Glienicke, geb. am 26. März 1892 zu No-wawes, Kr. Teltow, für Zweidecker (Wright), Flugplatz Johannisthal, am 22. Oktober 1913. No 573. von Ht?rff, Erwin, Gotha, geb. am 17. August 1890 zu Pretoria, für Eindecker (Taube), Flugplatz der Gothaer Waggonfabrik, am 22. Okt. 1913. No. 574. Gollnick, Leo, Elektromonteur, Rottstock bei Brück (Mark), geb. am 26. Februar 1887 zu üroß-Long, Kr. Schwetz, für Eindecker (Grade), Flugfeld Grade, Bork, am 22. Okt. 1913. Wichtige BeUarmtmachutig des U. L. V. 1. Bestimmungen für die Abnahme der Flugprüfungen auf dem Flugplatz Johannisthal. 1. Die Abnahme von Flugprüfungen erfolgt durch die amtlichen Flugprüfer des Deutschen Luftfahrer-Verbandes. 2. Der Antrag auf Abnahme einer Flugprüfung ist von der ausbildenden Firma schriftlich für den amtlichen Flugprüfer im Bureau des Platzinspektors (Post- und Sanitätsgebäude) im Winter bis 5 Uhr, im Sommer bis 6 Uhr nachmittags abzugeben. 3. Spätestens hierbei sind einzureichen: a) ein polizeiliches Führungszeugnis (von der Zeit des Antrags mindestens ein Jahr zurückreichend) oder die Erklärung des Vorstandes eines Luftfahrer-Vereins oder vorgesetzten Stelle über die persönliche Geeignetheit des Bewerbers zum Flugzeugführer, b) ein ärztliches Zeugnis nach den polizeilichen Vorschriften für Kraftwagenführer, c) zwei unaufgezogene Photographien d) Ausweis über die gezahlte Anmeldegebühr (siehe Ziffer 4). 4. Für jede Anmeldung ist seitens der Firma eine Gebühr von 5 M. zu entrichten. Um die Zahlungsweise der Anmeldegebühr zu vereinfachen, steht es den ausbildenden Firmen frei, einen größeren Betrag auf der Geschäftsstelle des D. L. V. zu hinterlegen, wofür den einzelnen Firmen ein Konto eingerichtet wird, andernfalls ist die Gebühr von 5 M. für den einzelnen Fall an den Platzinspektor, Herrn Gruschka, zu zahlen. 5 Bei ordnungsgemäßem Befund der Unterlagen nach Ziffer 3 bestimmt der amtliche Flugprüfer im Einvernehmen mit derFirma Tag und Stunde der Prüfung. 6. Die Flugschüler haben beim Prüfungsflug auf jeder Seite Flugzeugs je eine rote Flagge in der Größe von 40x60 cn an der am besten sichtbaren Stelle zu führen. 7. Diese Bestimmungen treten am 1 Novembet in Kraft. Bestimmungen über die Kontrolle von Flugleislungen auf dem Flugplatz Johannisthal. 1. Die Kontrolle und Bescheinigung aller Flugleistungen auf dem Flugplatz Johannisthal, die einer solchen nach den Flugsportbestimmungen des Deut- sehen Luftfahrer-Verbandes und nach den Bestimmungen der National-Flugspende oder nach besonderen Ausschreibungsbestimmnngen bedürfen, obliegt den amilichen Flugprüfern des D. L. V. für den Flugplatz Johannisthal. 2. Diese Flüge können jederzeit, auch am Tage der Ausführung selbst, bei den amtlichen Flugprüfern direkt oder im Bureau des Platzinspektors (Post-und Sanitätsgebäude) angemeldet werden. 3. Diese Bestimmungen treten am 1. November in Kraft. Der Präsident des Deutsehen Luftfahrer-Verbandes. Freiherr von der Goltz. 2. Nach Mitteilung derNational-Flugspende können bei Einreichung von Protokollen über Prämienflüge nach Ziffer II der Bestimmungen Uber die Zuverlässigkeitspreise der National-Flugspende auch Karten im Maßstab 1:200 000 an Stelle der bisher ausschließlich geforderten 1:100000 beigefügt werden.__ Von den Flugplätzen. Vom Flugplatz Johannisthal. Die Flugleistungen auf dem Johannisthaler Flugplatz im Oktober 1913 waren folgende: Es wurde au 31 Tagen von 162 Fliegern geflogen. Die größte Summe der Flugzeiten und die meisten Aufstiege hatte Ball od auf Jeannin-Taube mit 26 Stunden 4 Min. und 344 Flügen. Gesamtzahl der Flüge betrug 4732 und Gesamtdauer 509 Stunden 32 Min. Die Pilotenprüfung bestanden 25 Flieger. Ueberlandflüge vom Flugplatz wurden 53 ausgeführt. Es ereigneten sich sieben nennenswerte Flugzeugbeschädigungen, so daß bei 4732 Flügen ein Prozentsatz von 0,15 zu verzeichnen ist. Flugplatt; Leipzig. Das Hauptrestaurant des Flugplatzes Leipzig-Mockau ist vor wenigen Tagen vollendet und seiner Bestimmung übergeben worden. Einfach und vornehm in der Außen-Architektur, zweckmäßig und behaglich in seiner inneren Einrichtung repräsentiert sich der schmucke und gefällige Bau neben dem Haupteingang an der Eutritzsch-Dübener Staatsstraße Das Erdgeschoß enthält einen durch Freitreppen zugängigen in lichten Farben gehaltenen Saal mit eingebauter Veranda, die durch hohe Fenster einen guten Ueberblick nach dem Platz gewährt. Nach der Straßenseite schließt sich ein als Balkon ausgestatteter Vorgarten an. Das Erdgeschoß enthält weiterhin die großen und gemütlich eingerichteten Wirtschaftsräume, im ersten Stockwerk befinden sich zwei Klubzimmer mit Terasse und Balkon, die einen unvergleichlichen Blick über den ausgedehnten Platz gestatten, desgleichen Uebernachtungsräume für Flieger-Offiziere und Zivil-Flugführer. Der Leipziger Platz erhält damit einen Vorzug vor allen anderen deutschen Flugplätzen; er besitzt das erste Flieger-Hotel, ein Fliegerheim im besten Sinne des Wortes. Auch auf dem Platze selbst sind in letzter Zeit größere Bauten ihrer Vollendung entgegengeführt worden. Die erste Flugzeughalle ein langgestreckter in Eisenbeton ausgeführter Bau von 196 m Länge und 16 m Tiefe ist ihrer Bestimmung übergeben und bietet Raum für 20 Flugzeuge. Alle Schuppen sind mit elektrischem Licht und Dampfheizung versehen. Gasser führt in Leipzig einen 5 Siujidenl'lug um die National Plugspende aus. Er startete am 27. Oktober um 7:44 morgens mit Fluggast und flog sechsmal die Strecke Leipzig—Halle—Bitterfeld—Leipzig ab und landete 12 : 05 Uhr auf dem Leipziger Flugplatz. Der Flieger gewann mit diesem Fluge 7500 Mark.__ Ausland. Der Flug von Paris nach Kairo, welchen der Flieger Daucort mit Roux als Begleiter angetreten hat, scheint sich doch länger auszudehnen, als wie beabsichtigt war. Die Flieger flogen am 21. Oktober von Paris nach Sens, am 23. Oktober von Sens nach Schaffhausen, am 25 Oktober von Schaffhausen nach Stein, am 8. Okiober von Stein nach Augsburg, am 29. Oktober von Augsburg nach München, am 31. Oktober von München nach Wien nnd von hier Uber Crajova nach Bukarest. Nach den letzten Nachrichten ist Daucort bei Podima am Schwarzen Meer südlich von Cap Malatra gelandet, Verschiedenes. Luftschrauben-Gleitboot Öelcke Der durch seinen kleinen Sport-Eindecker bekannte Konstrukteur Deicke hat ein kleines Gleitboot für Sportzwecke konstruiert, das durch einen 4 Zyl. 4 PS Motorrad-Motor angetrieben wird. Die 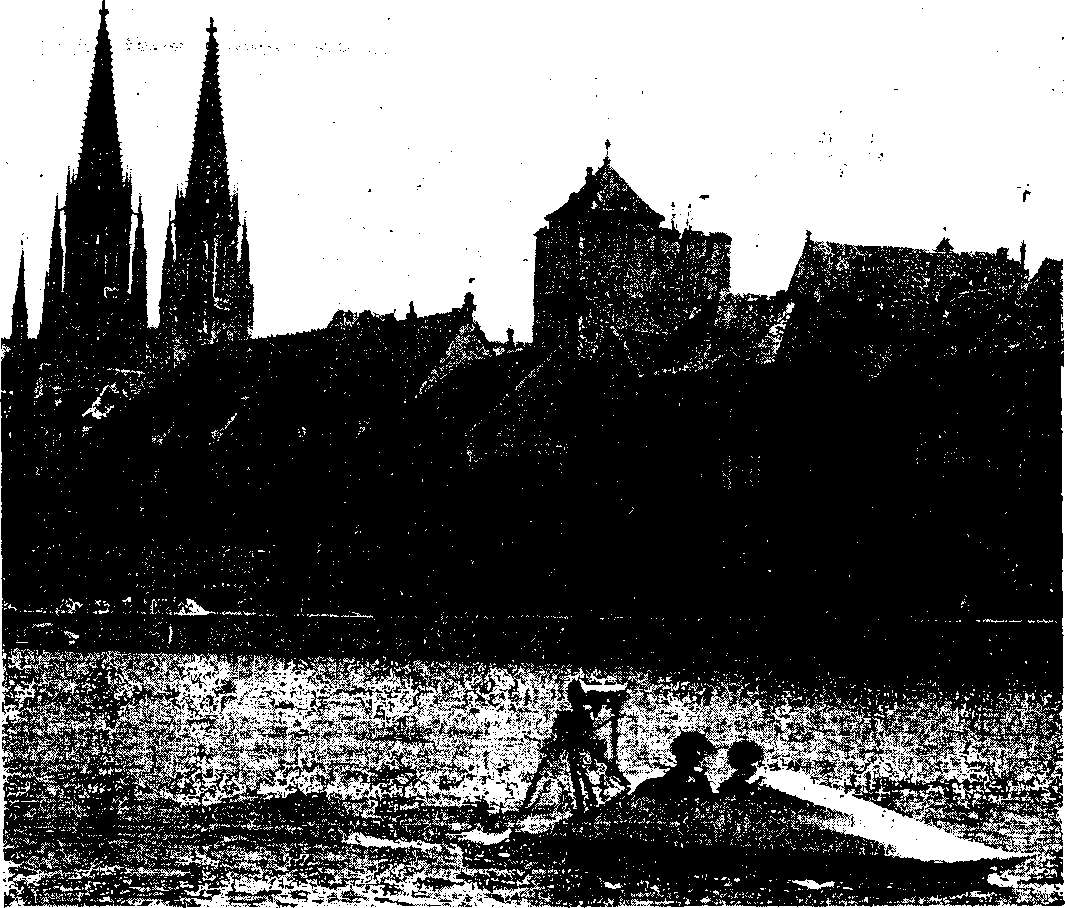 Luftschrauben- Gleitboot Deicke. Luftschraube von 1,2 m Durchmesser sitzt direkt auf der Achse des hochgebauten Motors. Der Schraubenzug beträgt 24 kg Dieses kleine Gleitboot erzielte auf der Donau bei Regensburg ca. 25 km Geschwindigkeit, Patentwesen. Fahrgestell für Flugzeuge.*) Den Gegenstand der vorliegenden Erfindung bildet ein Fahrgestell für Flugzeuge, dessen Laufradachse als Blattfeder ausgebildet und mit einer mittleren Längskufe starr verbunden ist. Zur Verhinderung des Biegens der Enden der die Laufradachse bildenden Blattfeder ist an diesen Enden ein Federblatt umgekehrt befestigt, welches sich auf die Hauptfeder stützt In der Zeichnung ist die Vorrichtung nach der Erfindung beispielsweise in einer Ausführungsform und in Anwendung an einem Eindecker dargestellt. 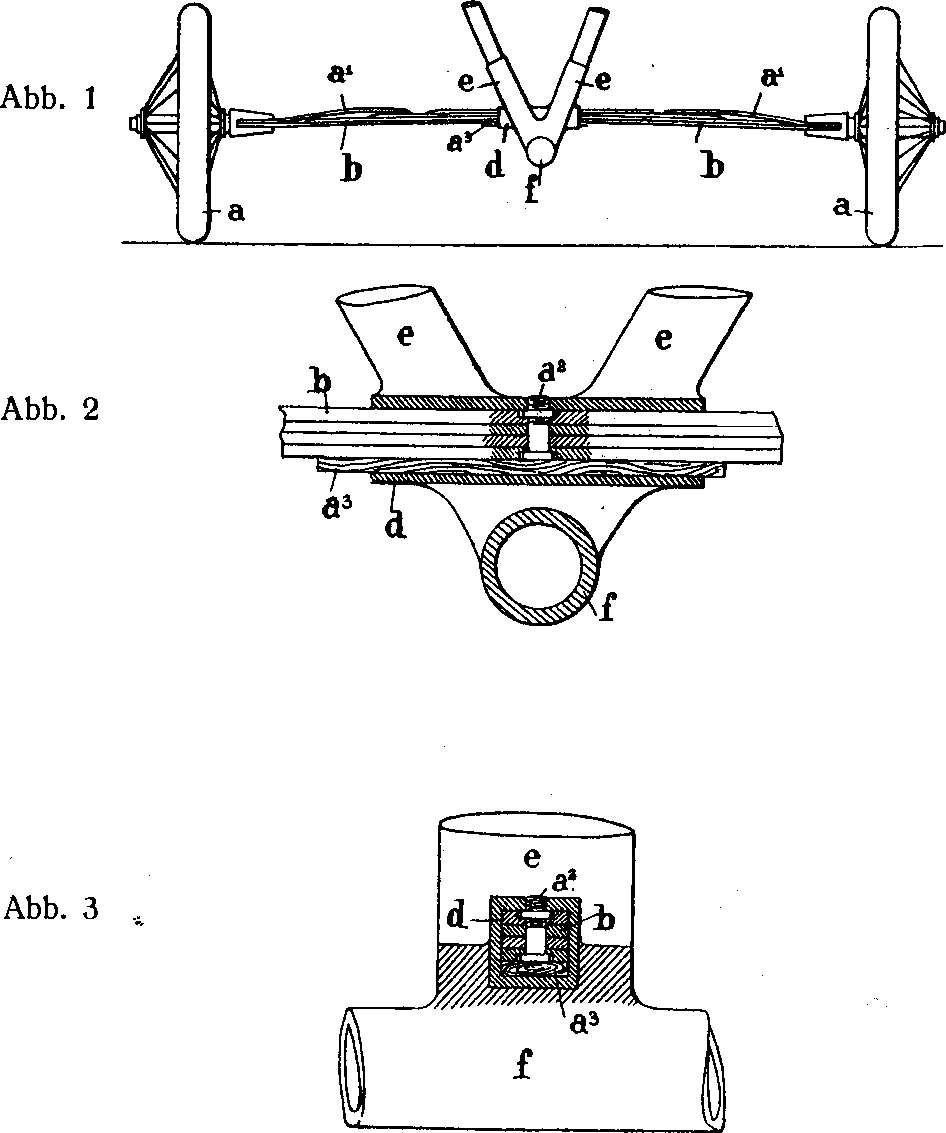 Abb. 1 zeigt das Fahrgestell in Vorderansicht. Abb. 2 veranschaulicht die Verbindung der Welle mit dem Rahmen der Flugmaschine. Abb. 3 ist ein Schnitt durch Abb. 2. Die Laufräder a sind an den beiden Enden der als Blattfeder ausgebildeten Laufradachse b drehbar angeordnet. Diese Achse ist mit einer zentral angeordneten Kufe f starr verbunden. Um zu verhindern, daß sich die Enden der die Laufradachse bildenden Feder b biegen, ist an dieser ein Federblatt a1 umgekehrt angeordnet, welches also in umgekehrten Sinne wirkt wie die Feder b. Die durch die Blattfeder b gebildete Achse wird in eine Büchse d von quadratischem Querschnitt eingelegt, die quer zu den Röhren e angeordnet ist, die das Traggestell für die Maschine bilden. Diese Röhren e sind an ihrem unteren Ende mit einer die Landungskufe bildenden Röhre f zu einem Ganzen verbunden. Die Welle b wird durch einen Zapfen a2 und einen Keil a3 in der Büchse d befestigt. *) D. R. P. Nr. 264643. Edouard Denieport in Suresne, Frankreich. Pat e n t-An s p r üc h e: 1. Fahrgestell für Flugzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß die Laufradachse als Blattfeder ausgebildet und mittels einer mittleren Längskufe starr verbunden ist. 2. Fahrgestell nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß an den Enden der die Laufräder tragenden Feder ein Federblatt umgekehrt befestigt ist, welches sich auf die Hauptfeder stützt. Flugzeugrumpf mit Flügelstümpfen.*) Die Erfindung betrifft einen Flugzeugrumpf mit Flügelstümpfen. Sie besteht darin, daß um die innen durch ringförmige Rippen gehaltenen Längsrippen des Rumpfes außen halbe Ringe herumgelegt sind, deren Enden in Uebergangs-kurven abgebogen und zu Stümpfen für die Aufnahme der anzusetzenden Tragflächen ausgebildet sind. Bei den bisher bekannten Konstruktionen wurden bei Eindeckern nach Art des vorliegenden Flugzeuges die Flügel nicht unmittelbar an den Rumpf angesetzt, sondern es waren hierzu noch besondere mittlere 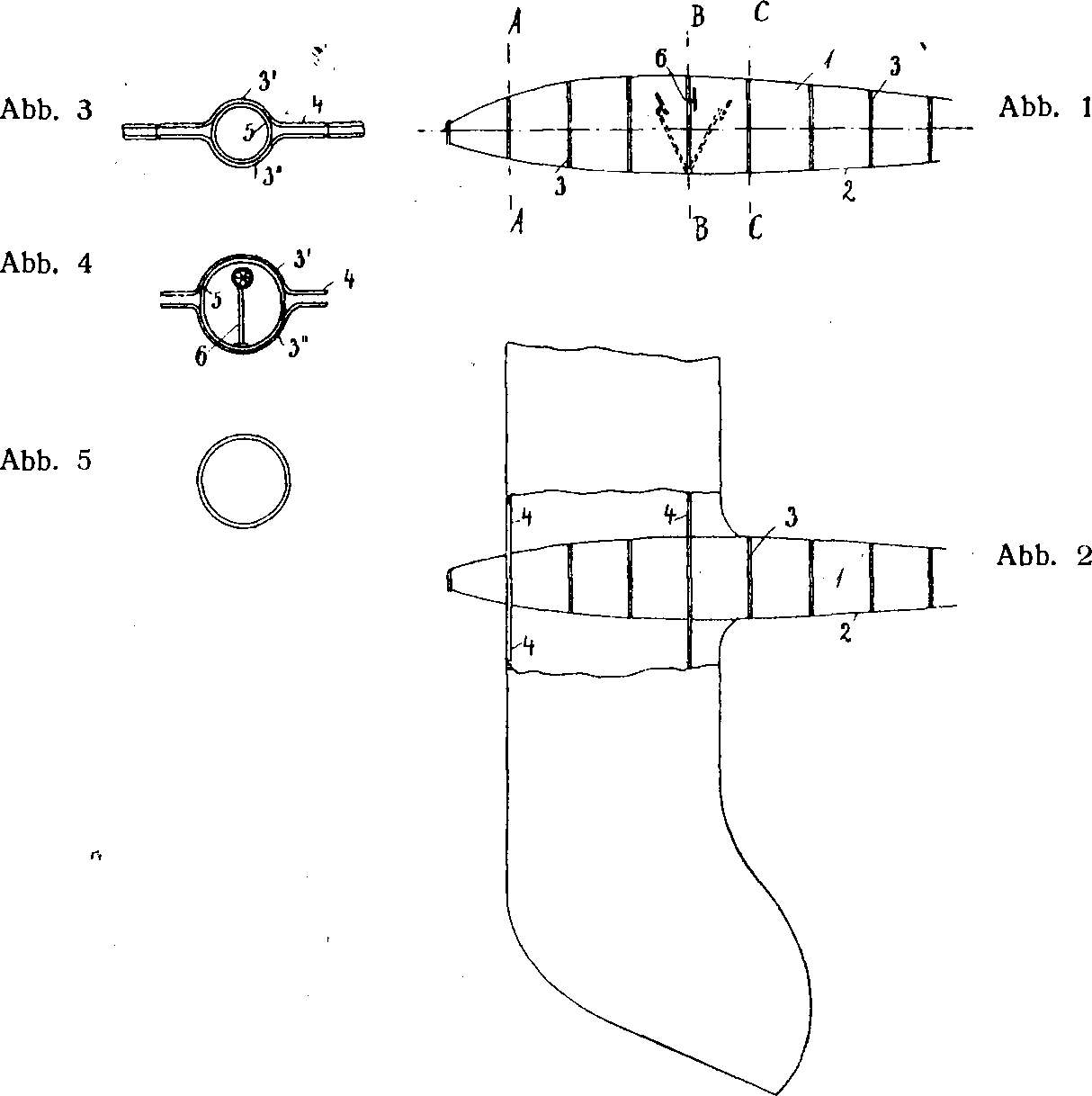 Tragflächen erforderlich, die auf den Rumpf aufgesetzt und an die erst die Flügel angesetzt wurden. Hierdurch wurden besondere Verbindungsstücke erforderlich und entstanden Ecken, die einerseits eine Erschwerung der Konkstruktion und eine Vergrößerung des Gewichtes herbeiführten und anderseits keinen glatten, *) D. R. P. Nr. 26551B, E Rumpier, Luftffihrzeugbau;G. m. b, H in Berlin-Johannisthal. abgerundeten und Luftwirbel vermeidenden Uebergang zwischen Rumpf und Flügel ermöglichten. Bei der vorliegenden Erfindung wird der unmittelbare Anschluß und der wirbellose Luftweg durch die besondere Ausbildung der Gurte allein erreicht. Die Erfindung ist auf der Zeichnung in fünf Abbildungen dargestellt. Abb. 1 zeigt ein Flugzeug von der Seite, Abb. 2 von oben, Abb. 3 ist ein Schnitt nach A—A, Abb. 4 ein Schnitt nach B—B und Abb. 5 ein Schnitt nach C-C der Abb. 1. Der Flugzeugkörper I ist in bekannter Weise aus Längsgurten 2 und Quergurten 3 zusammengesetzt. Die Quergurte haben die aus Abb. 5 ersichtliche Gestalt eines geschlossenen Ringes. An den Stellen, die zum Anschluß der Flügel dienen, sind die Quergurte jedoch aus einem Ober- und Untergurt 3', 3" zusammengesetzt. 3' und 3" verlängern sich über die Seiten des Rumpfes hinaus in die seitliche Ansätze 4, die als Querstreben für die Flügelstümpfe dienen und demnach als Ober- und Untergurte der Tragflächen ausgebildet sind. Um diesen geteilten Quergurten wieder die Festigkeit der anderen angeschlossenen Quergurte zu geben, sind sie durch einen in sich geschlossenen Ring 5 miteinander verbunden. Die Steuersäule 6 des Flugzeuges muß bekanntlich um einen ziemlichen Betrag vorwärts und rückwärts geschwenkt werden können. Hieran würden sie bei der gewöhnlichen Ausbildung des Flugzeugkörpers durch die Quergurte gehindert werden oder eine Unterteilung derselben erforderlich machen. Derselbe Mißstand würde i.i gewissem Grade auch bei sonstigen Konstruktionsteilen auftreten, die einen hohen Ausbau bedingen, beispielsweise bei den Benzinbehältern o dgi. Um diesen Nachteil :zu beseitigen, werden der Obergurt oder der Untergurt oder beide an denjenigen Stellen des Rumpfes, an denen sich solche bewegten oder einen höheren Ausbau bedingenden Konstruktionsteile befinden, so ausgebildet, daß sie auch diese Teile umfassen. Solch eine Stelle ist in der Abb. 4 dargestellt, und man erkennt im Vergleich zu Abb. 3 und 5, daß der Obergurt 3" so weit hinaufgeführt wjrd, daß er über die Steuersäule 6 und das mit ihm verbundene Steuerrad hinweggeht. Patent-Anspruch: Flugzeugruinpi mit Flügenstümpfen, dadurch gekennzeichnet, daß um die innen durch ringförmige Rippen gehaltenen Längsrippen des Rumpfes außen halbe Rin e herumgelegt sin'1, deren Enden in Uehergangskurven abgebogen und zu Stümpfen für die Aufnahme der anzusetzenden Tragflächen ausgebildet sind. Flugzeug.*) Die Erfindung betrifft ein Flugzeug, bei welchem die Flügel auf einem Pendelkörper mittels Universalaufhängeh gelagert sind, und bezweckt die Schaffung eines selbsttätigen Widerstandes gegen seitliches Abgleiten. Zu diesem Zweck sind die Flügel mit dem Seitensteuer zwangläufig verbunden, und zwar derart, daß bei Neigungen um die horizontale Längsachse das Seitensteuer nach der sich hebenden Seite gelegt wird. Außerdem sind gemäß der Erfindung an den äußeren Flügelenden in der Längsrichtung laufende drehbare Klappen angeordnet und mit dem Gestell derart zwangläufig verbunden, daß die Klappen auch bei Neigungen in annähernd horizontaler Lage gehalten werden, so daß sie immer einen Widerstand gegen seitliches Abgleiten bilden. Die Erfindung ist auf der Zeichnung in einer schematischen Ausführung schaubildlich dargestellt, und zwar von der Rückseite der Maschine aus gesehen. In der Zeichnung bedeutet a und b die aneinander zugeordneten Flügel, welche als Ganzes durch die Buchsen a1 achsial an dem Rückgrat c befestigt sind. Dite Außenkanten dieser Flügel tragen die scharnierartig befestigten Klappen d und e, welche derart mit dem Gestell zwangläufig verbunden sind, daß sie bei Neigungen des Flugzeuges immer in einer im wesentlichen horizontalen Lage gehalten werden. Wenn also der Flügel a in angehobener Stellung *) D. R. P. Nr. 265 141. Robert Mc. Mullan in Fremantle, Westaustralien. ist, so befindet sich die Klappenfläche d in der Tiefstellung, so daß die Unterfläche des Flügels geschützt wird. Die entgegengesetzte Wirkung trifft bezüglich des andern Flügels b zu. Die Achsen der Klappen d und e tragen einen drehbaren donpelarmigen Hebel f, dessen obere Enden mittels der Spanntaue g2 fest mit der Mastspitze g verbunden sind. Die unteren Enden sind durch das Tau h, welches über die Rolle h1 läuft, miteinander verbunden. Die Rolle h1 ist am unteren Ende des schwingenden Rahmens j befestigt, welcher bei j1 drehbar an der Unterseite der Gondel j2 sitzt. Die doppelarmigen Hebel f bewirken das Heben und Senken der Klappen d und e. Die Flügel werden gegenseitig durch das Tau k abgesteift, welches über die Rolle k1 läuft, die in dem Mast g befestigt ist. Die Flügel werden ferner durch die unteren Taue m und m1 versteift, welche bei m2 fest mit dem schwingenden Rahmen oder Arm j verbunden sind. Dieser schwingende Rahmen ist mit Dämpfungsfedern m* versehen, welche zwischen dem Rahmen und der Gondelunterseite angeordnet sind. Die Flügel bewegen sich gemeinsam miteinander und in gegenseitiger Abhängigkeit achsial auf dem Längsträger c. 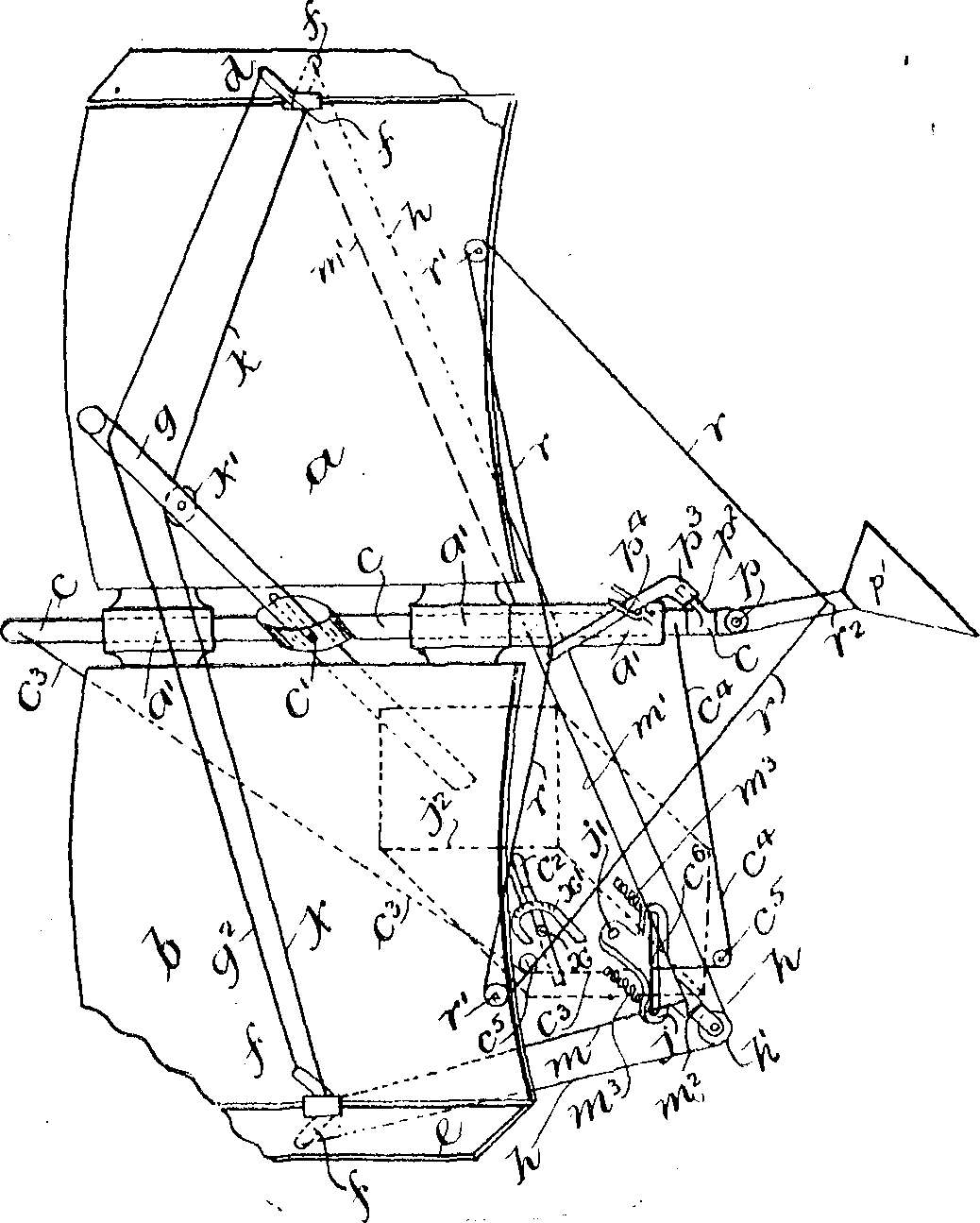 An dem Heck desselben ist bei p das Seitensteuer p1 drehbar befestigt, dasselbe ist mit den Flügeln a, b derart zwangläufig verbunden, daß es sich bei Neigungen des Flugzeuges um die horizontale Längsachse nach der sich hebenden Seite legt. Zu diesem Zweck trägt der Längsträger c einen vertikalen Zapfen p2, welcher vor dem Drehpunkt p des Seitensteuers p1 angeordnet ist, und auf welchem der Hebel p3 sich dreht. Dieser ruht zwischen den Zinken einer auf der Muffe a' der Flügel a,b vorgesehenen Gabel p» und ist durch Seile r, welche über Rollen r1 laufen, mit den Flügeln a, b zwangläufig verbunden. Das Seitensteuer folgt also dem ansteigenden Flügel und hat infolgedessen das Bestreben diese selbsttätig in eine Gleichgewichtsstellung zu bringen. Um eine Verstellung des Seitensteuers ohne gleichzeitige Flügelneigung vorzunehmen, kann erforderlichenfalls noch ein besonderes, von dem Flieger zu bewegendes Seitensteuer angeordnet werden; das Seitensteuer p1 wird in diesem Falle lediglich durch die Flügel a, b zwangläufig bewegt. Der Längsträger c ist bei c' stehbar an dem Mast oder Pendel g befestigt und erhält seine Vorwärts- und Rückwärtsradial-bewegung durch den von dem Flieger bewegten Steuerhebel c2 und die Taue cn und c1, welche an den vorderen und hinteren Enden des Längsträgers befestigt sind. Diese Taue laufen über die Rollen c\ Der schwingende Rahmen ist mit dem offenen Schlitz c6 versehen, so daß das Hintertau c* eine Freiheit in seiner Bewegung erhält. Der Hebel c2 ist bei x drehbar gelagert und arbeitet mit dem genuteten Quandranten x1 zusammen, so daß er in beliebiger Stellung festgehalten werden kann. Infolge der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung kann durch eine Drehung des Hebels c! jede gewünschte Flächenneigung erzielt werden, was den Abflug erleichtert, da der Flieger jederzeit die Tragfläche horizontal oder schräg stellen kann. Pat en t-Ans p ruch. Flugzeug, dadurch gekennzeichnet, daß die auf einem Pendelkörper mittels Universalaufhängung gelagerten Flügel mit dem Seitensteuer derart zwangläufig verbunden sind, daß bei Neigungen um die horizontale Längsachse das Seitensteuer nach der sich hebenden Seite gelegt wird, und daß außerdem an den äußeren Flügelenden in der Längsrichtung laufende drehbare Klappen angeordnet und mit dem Gestell derart zwangläufig verbunden sind, daß die Klappen auch bei Neigungen in annähernd horizontaler Lage gehalten werden und somit einen Widerstand gegen seitliches Abgleiten bilden. Spannschloß mit einem aus zusammengebogenem, an den Enden mit Gewinde versehenem Draht bestehendem Schraubenbolzen.*) Die Erfindung bezieht sich auf ein Spannschloß, welches in bekannter Weise einen aus zusammengebogenem, an den Enden mit Gewinde versehenem Draht bestehendem Schraubenbolzen besitzt. Derartige Spannschlösser für Kabel o dgl, insbesondere bei ihrer Verwendung, z. B. an Flugfahrzeugen müssen nicht nur leicht und widerstandsfähig sein, sondern auch an der Grenze ihres elastischen Widerstandes sich ausdehnen können, ohne zu brechen. Gemäß der Erfindung wird eine beträchtliche Ausdehnung des Spannschlosses dadurch erreicht, daß der Draht unterhalb der Oese schraubenförmig zusammengedreht und an seinen Gewindeenden verschweißt ist. Auf diese Weise ist der Gefahr eines Bruches bei auf den Flügel des Aeroplans wirkenden Ueberdruck sehr wirksam gesteuert. Auf der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand in zwei beispielsweisen Ausführungsformen dargestellt. Das Spannschloß besteht in bekannter Weise aus zwei mit Rechts- und Linksgewinde versehenen Bolzen i, i' mit Oese k, k1 die durch eine Mutter o mit entsprechendem linken und rechten Innengewinde verbunden werden, sodaß sich bei der Drehung dieser Mutter in einem oder anderen Sinne die beiden Bolzen einander nähern oder voneinander entfernen. Wie Abb. 1 zeigt, sind die beiden Drahtschenkel i, i1 nach Bildung der Oese k bei 1 schraubenförmig umeinander gewunden, ehe sie sich mit ihren ebenen Flächen gegeneinander legen. Hierbei hat zweckmäßig der die Oese bildende Teil des Drahtes runden Querschnitt, während die Drähte i, i1 unter der Oese und der Schraubenwindnng halbkreisförmigen Querschnitt erhalten und mit ihren gegeneinander gekehrten ebenen Flächen verschweißt oder verlötet werden. Bei außergewöhnlicher Beanspruchung werden che Spiralen 1 sich strecken, sodaß die Angriffspunkte einen größeren Abstand erhalten und . somit ein Brechen der Spannvorrichtungen bei augenblicklicher Ueberlastung vermieden ist. *) D. R. P. Nr. 265 668. Leonhard Charles Delvigne in Paris. 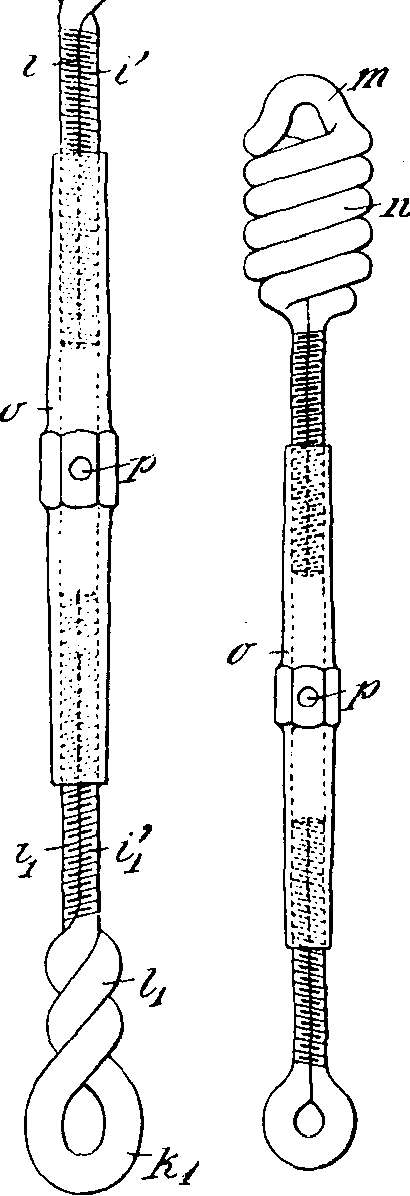 Abb. 1 Abb. 2 Man kann diese Spiralwindungen auch wie Abb. 2 zeigt, direkt als Schraubenfedern n ausbilden, indem man die Drahtschenkel nach Bildung des Kopfes m mit einem bestimmten lichten Durchmesser schraubenförmig führt. Dieser Durchmesser wird sich nach der Elastizität des Drahtes richten, damit die Feder nur bei einer vorher bestimmten Belastung nachgibt Gibt man der Feder eine hinreichende Länge, d. h. eine mehr oder weniger große Anzahl von Windungen, so läßt sich für die Spannvorrichtung jede beliebige Belastungsgrenze bestimmen, sodaß sich die Flügel in weitgehendem Maße deformieren können, ohne daß die Gefahr des Bruches eintritt. Patent-Anspruch. Spannschloß mit einem aus zusammengebogenem, an den Enden mit Gewinde versehenem Draht bestehenden Schraubenbolzen, dadurch gekennzeichnet, daß der Draht unterhalb der Oese schraubenförmig zusammengedreht und an seinen Gewindeenden verschweißt ist. Personalien. Korvettenkapitän Halm ist zum Vorstand der Abteilung für Luftfahrwesen im Reichsmarineamt an Stelle des mit dem „L. II" ums Leben gekommenen Korvettenkapitän Behnisch ernannt worden. Dipl. lng. C. Eberhardt hat eine Dozentur für Flugtechnik an der technischen Hochschule in Darmstadt übernommen. Querträger zur Aufnahme die Befestigungshaken für selben sitzt auf dem Spannweite, und 9 Modelle. Das Freelan Doppeldecker Entenmodell, zeichnet sich durch besonders einfache Bauart und verhältnismäßig große Tragflächen aus Ein 90 cm langer Motorstab von 12 mm Stärke bildet den Längsträger des Modells. An dem einen Ende desselben befindet sich ein T-förmig angeordneter der beiden Schraubenlager, an dem anderen sind den Gummiantrieb angebracht. Dicht hinter dem-Längsträger eine verschiebbare Kopffläche von 32 \ cm cm größte Flächentiefe. Annähernd in der Mitte be- findet sich ein eigenartiges Fahrgestell, dasselbe besteht aus 2 dünnen, nach außen gerichteten Bambusstäbchen, die von vorn her duich 2 kürzere abgestützt werden An den Enden der großen Fahrgestellstreben sind zwei 22 mm große Rädchen mittels U-bügelartig gebogener Stahldrahtachse befestigt. Auf diese Weise können die Rädchen allen Unebenheiten nach jeder Richtung hin ausweichen, da die federnden Bambusstäbchen sehr nachgiebig sind. Einige cm hinter dem Fahrgestell sind die nach vorn gestaffelten Tragflächen in andert-halbdeckerartiger Anordnung angebracht. Dieselben verjüngen sich etwas nach außen. Die Spannweite des Oberdecks beträgt 70 cm, die des Unterdecks nur 47 Va cm. Zur Unterstützung der Schraubenlager ist eine leichte Bambusschleifkufe angebracht. Das Modell wird von 2 Gummiantrieben in Bewegung gesetzt. 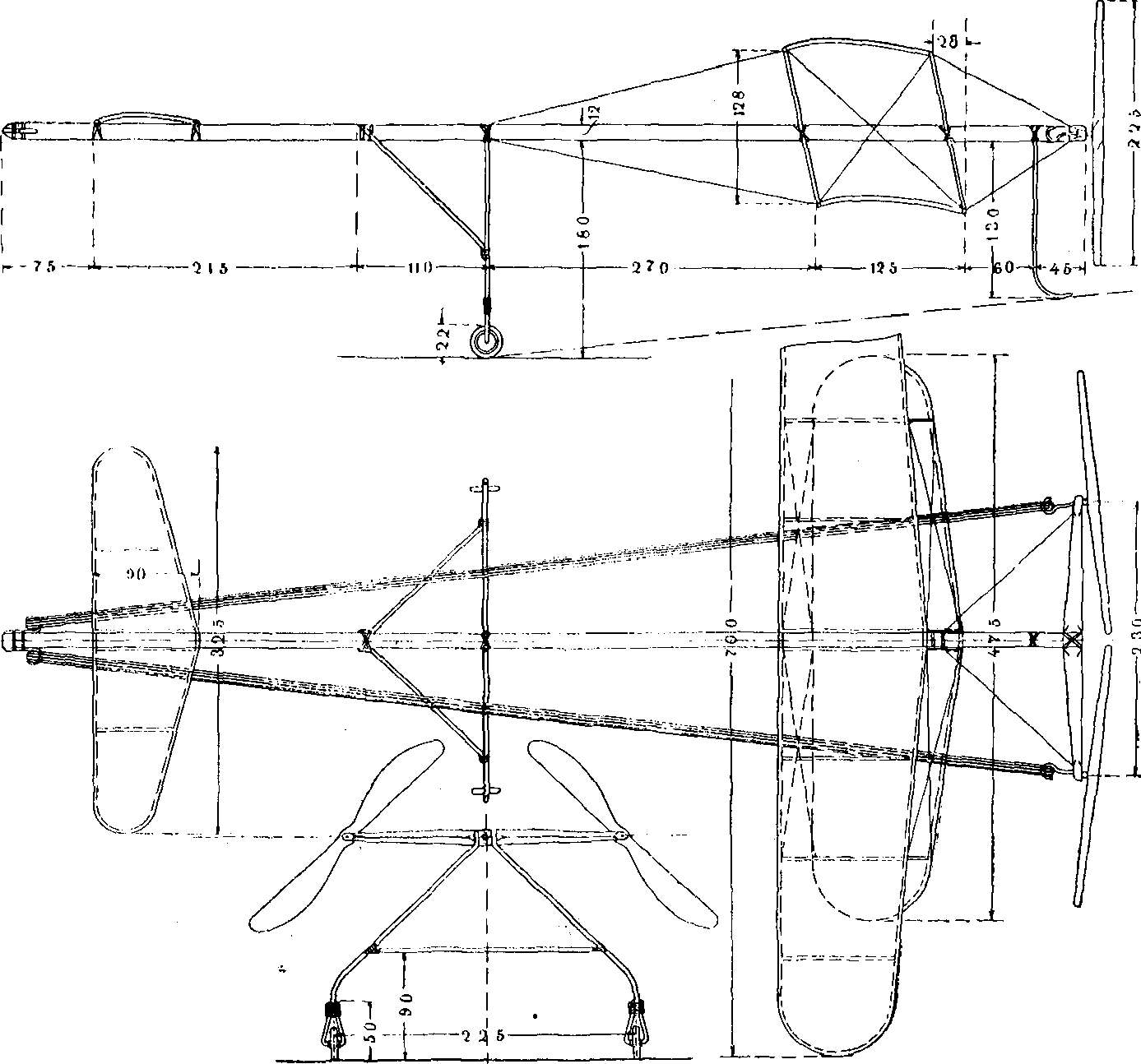 Das Freelan Doppeldecker-Entenmodell. Jeder Gummiantrieb besteht aus 14 Gummisträngen von je 3 mm Stärke, der eine Luftschraube von 22cm Durchmesser antreibt. Mit diesem Modell wurde auf Long Island der Dauerweltrekord aufgestellt, wobei die größte Flugzeit bei etwas Seewind 170 Sekunden betrug. Frankfurter Flugmodell-Verein- (Geschäftsstelle: Frankfurt a. M, Eppsteinerstr. 26.) Am Sonntag, den 9. ds. Mts. fand das Uebungsfliegen auf dem Sportplatz an der Forsthausstrasse statt, bei welchen einige Preise ausgeflogen wurden. Am nächsten Sonntag findet das Uebungsfliegen wieder an der Festhalle statt. Für diesen Tag ist ein Preis für Etappenflüge gestiftet. Zu den „Pßgoud-Flügen", die am 14 und 16. ds. Mts. auf der hiesigen Rennbahn stattfinden, erhalten unsere Mitglieder 20 "/„ Ermäßigung. Näheres ist hierüber durch die Geschäftsstelle zu erfahren. Literatur.*) Flugzeug-Modellbau. Von Civil-Ing. P L. Bigenwald. 178 Seiten mit 158 Abbildungen und Konstruktionszeichnungen, 20 Tabellen und 4 Konstruktionstafeln im Text. Preis eleg. geb. Mk. 4.—. In letzter Zeit hat das Interesse für den Flugmodellbau rapid zugenommen. Die im letzten Jahr veranstalteten Flugmodell-Ausstellungen und Flugmodell-Wettbewerbe erfreuten sich überall einer sehr umfangreichen Beteiligung. Das vorliegende Buch kam daher gerade zur rechten Zeit um den vielen Anfängern im Modellbau eine Anleitung zu geben und in dieses Gebiet einzuführen. Es enthält eine große Anzahl der wichtigsten Flugzeugmodelle, praktische Winke und Ratschläge, überhaupt alles das, was der Modellbauer wissen muß. Uhlands Kalender für Maschinen-Ingenieure, 1914. Bearbeitet von F. Wilcke, Ingenieur, Preis: In Leinenband 3 M—, in Lederband 4.—. Verlag Alfred Kröner, Leipzig. Dieser in technischen Kreisen bekannte und viel verwendete Kalender hat in seinen letzten Jahrgängen auch die Luftfahrt berücksichtigt. Es ist sehr zu bedauern, daß die Redaktion von der sonst üblichen Bearbeitung dieses Gebietes in diesem bewährten Taschenbuch abweicht. Wir haben wohl selten eine unsachgemäßere Beschreibung über Flugmaschinen gelesen, wie in vorliegendem Kalender. Nachstehend einige wörtliche Stichproben Flugmaschinen (schwerer als Luft). Praktischer Wert zweifelhaft. Hauptnachteil: stürzen sofort zu Boden, sobald der Motor versagt; können nur schnell fliegen; Tragkraft 1 bis 7 Personen. Handgleitflieger: Lilienthal. Tragdecke bildet ein- oder mehretagige Flächen, welche schräg gegen den Wind eingestellt werden. Motorgleitflieger (sog. Drachenflieger). Zurzeit am besten entwickelt. Bekannt: Zweidecker: Wright, Voisin, H. Farman, Curtiß, Albatros, Mars u. a.; je 2 wagerechte Flächen rechteckig mit 2 bezw. 1,4 m Abstand. Gewicht des Wrightschen Apparates 450 kg Motoren bis 100 PS. Flügelumläufe bei Wright 450, bei den übrigen 1200 in der Minute. Eindecker: Blöriot, Leva-vasseur, Esnault-Pelterie, Rumpler-Taube, Mars-Eindecker etc. eine Fläche; Gewicht des Blöriotschen Apparates 340 kg, die anderen 460 bezw. 500 kg. Motoren 20-100 PS; Umlaufzahl in der Minute 1400 bezw. 1200. Schrauben aus Holz hinter den Tragflächen, oder aus Metall vorn sitzend: Flügelzahl von 2-2,6 m Durchmesser. Jntergestell, Schlittenkufen oder Räder ; ja sogar beides zusammen, Hoffentlich nimmt die Redaktion Veranlassung für das nächste Jahr sich einen geeigneteren Mitarbeiter, von denen es viele gibt, für dieses Kapital zu beschaffen. Es wäre schade, wenn der Ruf dieses sonst ausgezeichneten Taschenbuches auf diese Weise leiden würde. 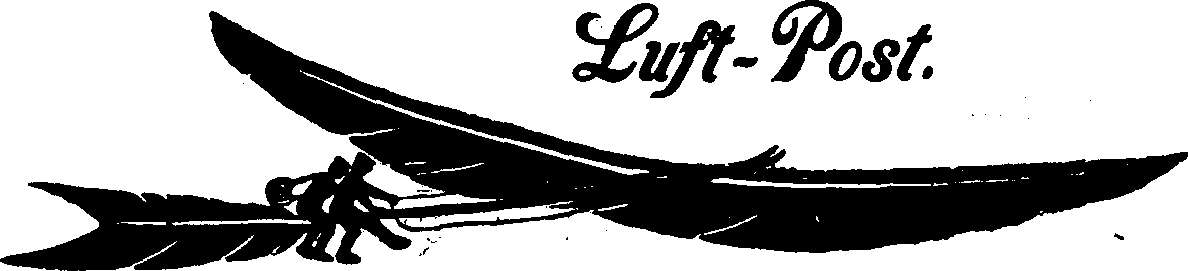 _Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.) '"'ea" M S. i. B. Im nachfolgenden teilen wir Ihnen die gewünschten Adressen mit und bemeken daß unsere Rekordtabelle nach der F. A. I. ausgearbeitet worden ist. 1. Societe Des Moteurs Gnome Paris, Rue de la Boetie 3. 2. Moteurs D'aviation Anzani Paris Boulevard de Courbevoie 112. 3. Moteurs „Le Rhone" Sociötö Annonyme. Montreuil-Sous-Bois (Seine) Rue Lebour 36. 4. Aeroplanes Deperdussin Paris, Rue des Entrepeneurs 19. 5. Avions Ponnier Reims, Rue de Neufchätel 145. *) Sämtliche besprochenen Bücher können durch die Expedition des F lugsport" bezogen werden.  JUustrirte No. 24 technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnement: 26. November für das gesamte VSSSr" 1913. Jahrs. V. «vnraoan" pro Jahr. „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef. 4557 Amt I. Oskar UrsinUS, Civllingfenieur. Tel.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. - 1 ■ ■ = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. - - = Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 10. Dezember als Spezial-Nummer „Pariser Salon". Die Verstaatlichung des Flugmaschinenbaues und deren Folgen. In Frankreich beabsichtigt die Militärbehörde ihre Flugmaschinen selbst zu fabrizieren und zwar nicht nur die Flugzeuge, sondern auch deren Hauptaubehörteile, die Motoren und Propeller. Es ist begreiflich, wenn die französische Flugmaschinen-Industrie gegen dieses Vorhaben energisch Front macht. Zunächst muß man sich fragen, kann der Staat selbst Flugmaschinen bauen? Diese Frage kann man mit Ja beantworten; aber man frage nicht wie! Ein betriebsfähiger Apparat aus der Privat-Industrie kann immer mehr oder weniger gut kopiert werden. Ob man indessen billiger fabriziert und der staatliche Betrieb sich rentabler gestaltet, wird jeder Eingeweihte mit Nein beantworten. Ferner wird, jetzt kommt das wichtigste, in demjenigen Staat der seine Flugmaschinen selbst fabriziert die Entwicklung des Flugwesens gewaltsam aufgehalten. Derjenige Staat mit der eignen Fabrikation, wird durch denjenigen, wo die Industrie durch gegenseitige Xonkurrenz sich zu überbieten sucht, bald im Nachteil und erledigt sein. Bis hierher sind die wirtschaftlichen Gesichtspunkte außer Acht gelassen. Durch ein Militär-Flugzeug-Monopol wird derjenige Staat nicht nur die vorhandenen Werte vernichten, sondern dem Lande eine dauernde Einnahmequelle, bestehend aus den Auslandsund Privatlieferungen verschließen. Auch wird dann die Zeit bald kommen müssen, wo der selbst Flugmaschinen bauende Staat, um seine Flugmaschinen auf der Höhe zu halten, doch wieder auf die inzwischen entwickelte Privat-Flugindustrie anderer Länder angewiesen ist und schließlich dort kaufen muß. Eine weitere nicht unwichtige Frage ist die des Motors. Wer liefert die Motoren? Meistenteils Fabriken der Automobil-Industrie, die auf Grund ihrer langjährigen Erfahrungen diese Leistungen vollbringen konnten und noch größere Leistungen vollbringen werden. Die Flugmaschine mit ihren Einzelteilen ist noch nicht so entwickelt, daß man auch nur im entferntesten einen solchen Gedanken ernst nehmen könnte. Man vergleiche nur die sich überstürzenden Verbesserungen im Flugmaschinenbau in den letzten 3 Jahren. Uns sind die Vorgänge in Frankreich noch nicht ganz verständlich. Als Grund wird angegeben, daß die Offiziersflieger zu den von den französischen Flugzeug-Fabrikanten gelieferten Apparaten kein Vertrauen hätten. Nun muß man sich folgendes vorstellen. Sämtliche Flugzeuge werden doch bevor sie zur Ablieferung gelangen, von Offizieren der Militär-Verwaltung abgenommen. Wenn diese Apparate richtig abgenommen werden und die die Abnahme überwachenden Persönlichkeiten dieser Aufgabe gewachsen sind, so müssen wichtige Fehler aufgedeckt werden. Werden sie es nicht, so wird wohl den Flugzeugen, die von den Militärbehörden gebaut werden, (von den vorerwähnten Sachverständigen) noch weniger Vertrauen entgegen zu bringen sein. Man will doch nicht etwa den Industriellen zumuten, daß sie Sabotage betreiben. — Es liegt im Interesse eines jeden Flugzeug-Lieferanten um weitere Lieferungen zu bekommen, nur das beste und betriebssicherste zu liefern. Der vorsichtige Beobachter muß auf Grund logischer Folgerungen zu der Anschauung gelangen, daß die von den franz. Militärbehörden betriebene Campagne vielleicht in etwas ganz anderem zu suchen ist. Doch besitzen wir in Deutschland genügend einsichtige Männer, die sich durch diese Vorgänge nicht auf das Glatteis führen lassen. — — Johannisthaler Brief. Im neuen Militär-Etat 1914 werden vom 1. April 1914 ab nachgefordert: Verstärkung des Uebungs- und Unterrichtsfonds der Verkehrstruppen um M. 2169 000, Verstärkung des Fonds zur Instandhaltung des Feldgerätes der Verkehrstruppen um M. 2 545 000, beides bedingt durch die Ausdehnung des Luftfahrwesens. Auf Anfrage im Kgl. Preußischen Kriegsministerium wurde unserem flugtechnischen Mitarbeiter erklärt, daß die Summe von M. 2 169000 und M. 2 545 000 für alle Zwecke des Luftfahrwesens angefordert werden, daß diese Beträge nach Bewilligung zur freien Verfügung der Generalinspektion des Militär-Verkehrswesens stehen und sowohl für die Militär-Lenkluftschiffahrt als auch für die militärische Fliegerei Verwendung finden werden. Die ebenfalls zum 1. April 1914 beantragte Einrichtung eines Presse-Referates in der Ministerial-Abteihing des Kriegsministeriums, bestehend aus 1 Stabsoffizier, 1 Hauptmann als vortragenden Räten, 1 Registrator, 1 Kanzlei-Sekretär entspricht einem von der Presse vielfach geäußerten, auch von der flugtechnischen Berichterstattung empfundenen Wunsche nach einer Zentralstelle, die den Verkehr des Kriegsministeriums mit der Presse regelt. Das Referat besteht bereits provisorisch und untersteht gegenwärtig Herrn Major Deutelmoser, der es sehr zuvorkommend verwaltet. Die neu einzurichtende photogrammetrische Abteilung bei der Landesaufnahme wird sich mit allen in dieses ein-von in dieses Gebiet schlägigen Fragen praktisch beschäftigten, also auch mit der^ Prof Sasser-Darmstadt und Th. Scheinpflug-Wien festgebildeten Aero-Photogrammetrie. der photographischen Karte und photographischen Transformation. ~'' Es ist dringend zu wünschen, daß die deutschen Fiugzeugfabriken gegenüber der Lenkluftschiffahrt bei der end-giltigen Verteilung der Summe von ca. 4,6 Millionen nicht zu kurz kommen. Mit einer Million Mark ist in der Mili- tär-Lenkluftschif fahrt verhältnismäßig wenig (wir erinnern an den Z 1 und Z 2), in der Militär-Fliegerei sehr viel getan. Der Flieger Linne-k o g el, der eben von schwerem Sturz genesen, hat am 22. November durch einen Flug mit dem neuen Rumpier-Marine-Eindecker mit Fluggast über und rund um Berlin bewiesen, daß er noch den alten Schneid hat. Der Sportflieger Reiterer, der mit liptm. Neumann von Johannisthal nach Kopenhagen in 4a Stunden ohne Zwischenlandung flog.  Linnekogel bewarb sich durch diesen Flug, der sich über zwei Stunden erstreckt, um eine Dauerprämie der Nationalflugspende. Es war der erste Flug eines Wasserflugzeuges über der Reichshauptstadt. Demnächst beabsichtigt der Flieger auf dem Rumpler-Marine-Ein-decker nach Putzig zu starten. Der diesmalige Flug ging vom Müggelsee der Spree nach auf Spandau zu, dann südlich über den Wannsee zurück nach dem Müggelsee, von dort wieder, ohne zu landen, nach Köpenick und zurück. Das Wetter war ziemlich böig und diesig. Ueber Berlin wurde in ca. 1000 m Höhe, sonst im Durchschnitt in 500 m Höhe geflogen. Die Linie des Barographen zeigte fortwährend starke Höhen-Unterschiede durch Fallböen. Der Rumpler-Marine-Eindecker lag trotzdem stabil in der Luft. Die Länge des Apparates beträgt 10,2 m, die Spannweite 14,5 m, die ganze Fläche 34 qm, Gewicht mit Führer, Passagier und Betriebsstoff für 4 Stunden beträgt ca. 1000 kg. Die beiden Schwimmer sind ohne Stufe gebaut, jeder 4 m lang, 80 cm breit, 40 cm hoch. Die Entfernung des einen Schwimmers vom andern beträgt 3 m. In einem Rumpler-Flugzeug ist ein 70 PS Mercedes-Motor mit hängenden Cylindern eingebaut worden, was sich auf das Beste bewährt. Der Führer hat eine sehr gute Uebersicht über das Terrain, ebenso der Mitflieger. Die neue Type Kavallerie-Eindecker der Ago-Flugzeugwerke ist auf den Wunsch der Militärbehörde nach einem kleinen zerlegbaren Eindecker für Fern-Aufklärung zur Unterstützung der Kavallerie entstanden. Der Eindecker hat 10 m Spannweite, 6,5 m Länge, 120 PS Motor, ca. 150 km pro Stunde Geschwindigkeit. Die Anordnung der abnehmbaren Flächen ist den Ago-Flugzeug-werken patentamtlich geschützt. Wir werden noch eingehender auf diese Type zurückkommen. Aviatik - Pfeil - Rumpfdoppeldecker, Militärtyp 1913. (Hierzu Tafel XXX.) Bei dem Wettkampf um die National-Flugspende traten die vorzüglichen Eigenschaften der Aviatikmaschinen ganz besonders zu Tage. Der von Viktor Stoeffler siegreich durch das Rennen geführte Doppeldecker weicht im wesentlichen von den Ursprungs-Konstruktionen der A. & A., Mülhausen ab, so daß es sich lohnt, etwas näher auf diesen Typ einzugehen. Die Tragflächen sind anderthalbdeckerartig angeordnet und etwa 2 Grad nach hinten gestellt. Die Verspannung besteht aus gespleissten Stahlkabeln, die eine größere Sicherheit gewähren, als die mit Drahtseilklemmen versehenen Verspannungsorgane. Die verwendeten Spannschlösser sind durch ein T>. E G. geschützt. Das Oberdeck besitzt eine Spannweite von 14,5 m, das Unterdeck eine solche von 10,8 m und die Flächentiefe beider beträgt 1,85 m, wobei ein Gesamtflächeninhalt von 45 qm erreicht wird. Das Unterdeck ist ca 4 Grad nach oben gestellt, um die Seifcenstabilität und den Kippwinkel zu vergrößern. Zwischen das Unterdeck ist der langgestreckte Motorrumpf eingeschoben. Derselbe läuft vorn torpedoartig zu, ist bis hinter den Führersitz mit einer Blechverkleidung versehen, und verjüngt sich alsdann konisch nach der Schwanzfläche. Die seitlichen Stoffbahnen am Rumpf werden durch eine ablösbare Verschnürung festgehalten, um erforderlichen Falls bequem in das Innere gelangen zu können. Vorn befindet sich ein 100 PS 6 Cylinder Mercedes, der eine Luftschraube von 2,6 m Durehmesser antreibt. Der tiefste Punkt der Schraubenperipherie liegt noch 450 mm über dem Erdboden. Hinter dem Motor ist der Begleitersitz angeordnet, über welchem sich ein mit Schaugläsern versehenes Hilfsreservoir befindet.  Friedrich auf Etridi-Taube. Zur Kühlung des Motors sind zu beiden Seiten in leicht zugänglicher Weise zwei Hazet-Kühler montiert, deren Zu- und Ableitung auch von dem Flugzeugführer während der Fahrt auf seine Betriebssicherheit hin kontrolliert werden kann. Hinter dem Begleitersitz befindet sich der Führersitz und vor demselben die bekannte Militär-Handrädsteuerung, nebst allen erforderlichen Orientierungshilfsmitteln. Das Fahrgestell besteht aus zwei Stahlrohrkufen. Die durchgehende Radachse ist mittels Gummiringe elastisch mit denselben verbunden und trägt an ihren Enden zwei 700 mm große Räder, die zur Verringerung des Luftwiderstandes mit einer Speichenverkleidung verseheu sind. Die Fahrgestell-Streben werden von starken Faconstahlrohren gebildet, die oben und unten in autogen geschweißten Schuhen stecken. Gegen seitliche Beanspruchung ist nur eine einzige Diagonalverspannung vorgesehen. Auf der Oberseite des konisch verjüngten Rumpfes ist eine halbkreisförmige Dämpfungsfläche von 3,5 qm angeordnet, an die sich zwei kleinere halbkreisförmige Höhensteuerklappen von insgesamt 1,5 qm Flächeninhalt anschließen. Das 0,75 qm große Seitensteuer bildet einen harmonischen Abschluß des Rumpfes und überragt denselben auf der Oberseite. Zur Unterstützung des hinterlastischen Gewichtes dient eine starre Schleifkufe, welche unter dem Einfluß der Belastung federnd nachgibt. Sämtliche Steuerflächen sind aus autogen geschweissten Stahlrohrrahmen hergestellt. Die Imprägnierung sämtlicher Stoffteile der Maschine geschieht durch Bestreichen mit Aviatollack. Das Leergewicht der Maschine beträgt 650 kg. Bei einer Nutzlast von 200 kg und mit einem Betriesstoffvorrat für 4 Std. kann die Maschine in 15 Min. 800 m Höhe erreichen. Die normale Geschwindigkeit beträgt hierbei 100 km pro Stunde. Der Bleriot-Wasser-Eindecker. Bleriot hat sich noch verhältnismäßig wenig mit dem Wasser-flugmaschinenbau befaßt. Auf den Wettbewerben hat er sich bisher nie sehen lassen. Andererseits glaubte man in Fachkreisen, daß er an einer besonderen Konstruktion eines Wasserapparates im Geheimen arbeite. Vor einiger Zeit hat sich nun dieser Wasser-Eindecker von Bleriot an der Oeffentlichkeit gezeigt. Mancher wird über diese Wassermaschine etwas enttäuscht sein. Ist es doch weiter nichts als ein normaler Bleriot, von 10,4 m Spannweite, der auf Tellierschwimmer gesetzt ist. Die Abfederungsgabeln vom Fahrgestell sind beibehalten, dadurch werden die rückwärtigen Enden der Schwimmer elastisch abgefedert. Unter dem hinteren Seitensteuer ist ein kleiner , Hilfsschwimmer angebracht, welcher die Ausschläge des Seitensteuers mitmacht und gleichzeitig als Wassersteuer wirkt. Zum Betriebe dient ein 80 PS Rhöne-Motor. Das Leergewicht des Flugzeuges beträgt 350 kg. Wenn schon dieser Wasser-Eindecker in der Entwicklung der Wasserflugzeuge als solche verhältnismäßig nichts neues bietet, dürfte diese Konstruktion von einem anderen Gesichtspunkte aus betrachtet, auch Vorteile bieten. Durch Beibehaltung des normalen Abfederungsgestells ist es möglich, jede Landmaschine innerhalb einer Stunde zu einem Wasser-Flugzeug umzumontieren. Bei der Verwendung der Flugmaschinen an der Küste könnte immerhin im Kriegsfalle eine derartige Konstruktion eine große Rolle spielen, wenn es sich darum handelt, möglichst schnell eine größere Anzahl Wasserflugmaschinen, falls solche nicht vorhanden sind, zu beschaffen. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten. Der gewissenhafte Chronist, dem die Schilderung der Vorgänge im französischen Flugwesen obliegt, sieht sich heute einem „embarras de richesse" gegenüber, von so ungewöhnlichem Umfange, daß er in der Tat nicht weiß, wo er beginnen und wo er enden soll. Die Franzosen sind eben ein eigenartiges Volk. Erst gefielen sie sich darin, die gesammte Kulturwelt durch die rapiden Fortschritte ihrer Leistungen in Bahn- und Ueberlandflügen in Erstaunen zu setzen. Als man „auch jenseits der Berge" zu fliegen anfing, verlegte man das Ziel seiner Ambitionen in weite Fernen und schuf die Weitflüge nach irgend einer entfernten Kapitale, dann die Flüge von Hauptstadt zu Hauptstadt und schließlich mußte es gar ein europäischer Rund-flug sein, der von dem Können der französischen Flieger, von ihrem unternehmenden Mut und von dem Organisationsgeist für derartige 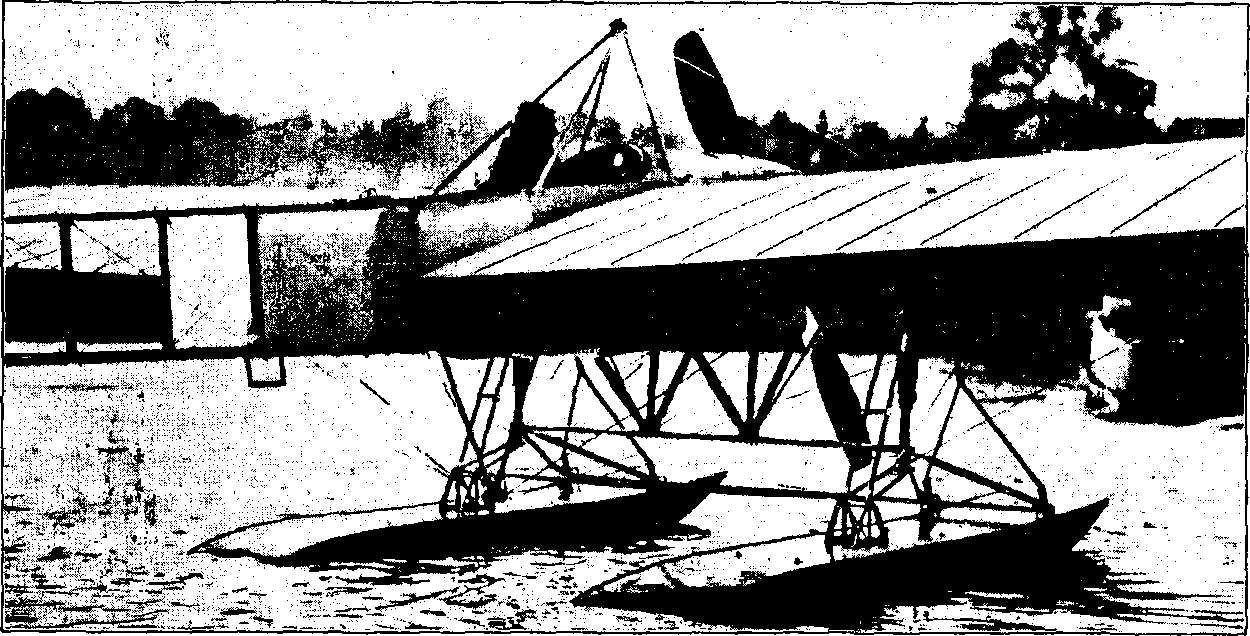 Bleriot-Wasser-Eindecker AnsidU schräg von hinten. (S. 907) Veranstaltungen Zeugnis abzulegen hatte. Wie oft maßten wir es hier lesen, daß jetzt so und so viele Franzosen nach der deutschen Hauptstadt geflogen seien, daß aber noch kein deutscher Flieger den Weg nach Paris zurückzulegen vermocht hat Und dann eines schönen Tages wurde der Wunsch unserer guten Freunde in Frankreich erfüllt ! Deutsche Flieger segelten auf dem Luftwege nach dem Seinebabel, wo sie freilich nicht „im Triumph über die Flugbahnen getragen", nicht auf bestellten oder improvisierten Banketten und Teeabenden in gastfreundlich überschwenglischer Weise gefeiert, sondern nach Kräften chikaniert wurden. Aber zu denken gab es den Franzosen doch: derartige Erfolge ihrer Rivalen mußten der aufmerksamen Welt gegenüber das beliebte Bild von der „französischen Hegemonie der Luft" verblassen machen. Deshalb mußte man stärkere Nuancen suchen; und man fand sie. Europa ist plötzlich für den französchen Tatendrang nicht mehr groß genug, es „lohnt nicht mehr", die „kurzen europäischen Promenaden" zu machen: nach anderen Weltteilen ging das Ziel der Luftreisen, die neuerdings mit geradezu er- ■schreckender Mannigfaltigkeit in Szene gesetzt wurden. Zwar ist in diesen Fällen der "Wille flinker, als das Können, und mancher mit peinlichster Sorgfalt und mit großem Brimborium organisierte Flug nach dem anderen Weltteil nimmt einen recht hinkenden Verlauf. Aber das ist egal! Die Bombenreklame ist da, die Zeitungen bringen tägliche Meldungen über die mehr oder weniger mißglückten Stoßetappen, und der Zweck ist erfüllt. Mehrere solcher Flüge zu gleicher Zeit sind unternommen worden. Daucourt und Roux, die von Paris nach Kairo gestartet sind, lagen nahezu eine Woche in Konstantinopel fest und warteten auf besseres Wetter, bis sie endlich am letzten Sonnabend die Reise wieder aufnahmen. Sie gelangten aber nur bis zu der kleinasiatischen Stadt Adabasar, in der Nähe des Schwarzen Meeres, wo sie angeblich durch Regen und Kälte zurückgehalten werden. Der Flieger Bonnier war auf einem Nieuport-Eindecker, 100 PS Gnom, von Villacoublay gestartet, um den phantastischen Flug Paris-Bagdad zu unternehmen. Nach mehreren Etappen( Villacoublay—Nancy,Nancy— Karlsruhe, Karlsruhe—Würzburg, Würzburg-Plattling) erreichte er am vergangenen Freitag Wien, von wo er dann über Budapest bis nach Arrad gelangte. Diese letzte Etappe (Budapest—Arrad, eine Distanz von 260 km, hatte Bonnier, der von seinem Mechaniker begleitet war, in 3 Stunden zurückgelegt. Jetzt läßt Nieuport erklären, daß Bonnier nicht die Absicht habe, bis nach Bagdad vorzudringen. Wahrscheinlich sind die Trauben zu sauer. Und dann ist noch ein dritter Weltteil-Flug organisiert worden, der Flug von Paris nach dem Persischen Golf für den die Ligue Nationale Aerienne den bekannten Flieger Seguin gewonnen hatte. Am 5. Dezember sollte der Start erfolgen, und von Marseille aus hat man bereits 1500 Liter Benzin und 400 Liter Oel nach Tripolis, Alep und Bagdad verschifft. Andererseits ist die türkische Regierung durch Vermittlung des französischeu Botschafters in Konstantinopel angegangen worden, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, zum Schutze Seguins und zur Förderung seines Planes. Inzwischen aber hat Seguin auf dem Flugfelde von Buc einen schweren Unfall erlitten, als er bei einem Abstieg aus beträchtlicher Höhe in etwa 20 m Entfernung von der Erde mit seinem Flugzeug abstürzte, wobei er und sein an Bord befindlicher Mechaniker ernstlich verletzt wurden. Da vorläufig an eine Wiederherstellung Seguins nicht zu denken ist, sucht die genannte Liga, einen anderen Flieger für den in allen Einzelheiten vorbereiteten Flug zu interessiereu; bisher ohne Erfolg. Am letzten Freitag haben auch mehrere Flieger versucht, das Kriterium des Aero-Club de France an sich zu bringen, welches bekanntlich einen Flug von Paris nach Bordeaux und zurück, oder umgekehrt verlangt. Letort und Gobe suchten vergeblich den bisherigen Rekord, der Seguin gehört, zu drücken, sie mußten infolge starken Nebels den Flug unterbrechen. Nur Gilbert vermochte auf seinem Moräne Eindecker, 80 PS Rhone-Motor die Strecke Bordeaux—Paris, etwa 500 km, in 3 Stunden 55 Min. mit 20 Minuten Aufenthalt in Poitiers, zu fliegen. Und nebenher machen sich die hiesigen Flieger nach einander daran, die Pegoud'schen Akrobatenflüge nachzuahmen oder noch zu überbieten. Chevillard, Hanouille, Hucks, ja sogar Garros machen jetzt den „looping the loop", und neuerdings haben sich noch Perreyon und Domenjoz zu ihnen gesellt. Jetzt fliegt also alles auf dem Kopf, nur finden nicht alle soviel klingenden Lohn und soviel Ehren dafür, wie Pegoud, der sich jetzt in Deutschland sehen läßt, wie überhaupt man hier diese Art von Flügen in ernsten Flieger- und Konstrukteurkreisen recht abfällig beurteilt. Auch das große Publikum interessiert sich für diese Flüge ganz und gar-nicht und die Sturzflieger führen hier ihre Purzelbäume vor einigen  Bleriot- Wasser-Eindetker kurz vor dem Abwassern. (S. 907) wenigen persönlichen Freunden aus. Uebrigens reklamiert jetzt die Firma Nieuport in einer Zuschrift an die Presse für sich die Ehre der Priorität des „looping the loop". Ein Nieuport-Eindecker sei das erste Flugzeug gewesen, mit dem der russische Flieger Nesterow sich in der Luft überschlagen habe. Leider wird in diesem Communique nicht gesagt, ob das seinerzeit freiwillig geschah. Und während so seine Kollegen, teils mit dem Kopf, teils mit den Rädern nach unten, Lorbeeren suchen, kreist noch immer der unermüdliche Helen auf der Rundstreoke Etampes—Cidy, um den Fourny'schen Rekord um den Michelin-Pokal zu überbieten. Seit dem 31. Oktober hat er täglich 533 km hinter sich gebracht, sodaß er jetzt bereits die stattliche Zahl von 11 726 km zu verzeichnen hat. Noch acht Tage Ausdauer, und er wird Fourny mit seinen 15 988,200 km erreicht, ja sogar gedrückt haben; natürlich konnten alle diese Flugtaten den „unvergleichlichen" Vedrines nicht kalt lassen. Daß er etwas großartiges, unerhörtes im Schilde führe, hatten wir bereits gemeldet ; wenigstens er selber hatte es angekündigt, und alle "Welt fragte sich erstaunt, was nun noch kommen sollte: etwa ein Flug um die Erde ohne Zwischenlandung. Vedrines wäre alles zuzutrauen. .Jetzt ist das Mysterium, mit dem der „Nationalheld" seine Vorbereitungen in Nancy, wo man ihn wegen Ueberfliegens verbotener Zonen festgenommen hatte, umgab, gelüftet. Am letzten Donnerstag ist der „große" Vt'drines von Nancy abgeflogen, nachdem ihm der französische und der deutsche .Kriegsminister, die er um die Erlaubnis, über verbotene Zonen fliegen zu dürfen, rundum abgesagt hatten: er erklärte, er wolle nach Paris fliegen, schlug auch wirklich die Richtung nach dort ein. Als er aber in beträchtlicher Höhe, war, kehrte er um und flog gen Deutschland, das er freilich verächtlich liegen ließ. Er landete in Wysotchan, in der Nähe von Prag, hat also die 650 km von Nancy bis dorthin, in Begleitung eines Mechanikers, ohne Zwischenlandung zurückgelegt. Eine anständige Leistung, die aber nicht an diejenige Jensens heranreicht, welcher von Yalen-ciennes bis Peterswald, in Böhmen, eine Entfernung von 7'iü km, ohne Zwischenlandung geflogen ist. Jetzt hat Yedrines, der inzwischen in Wien eingetroffen ist, erklärt, daß er seinen ursprünglichen Plan, nach Petersburg zu fliegen, aufgebe und daß er nach Konstantinopel sich richten werde Tant de bruit pour une omelette .... Dieser Tage fanden auch neuerdings Versuche um den Michelin-Zielscheibenpreis statt, die keinen günstigen Verlauf nahmen. Fünf Bewerber hatten sich auf dem Plugfelde von Jlnurmelon eingefunden. Derome. Breguet-Zweidecker, vermochte nicht eine der Wurfbomben, die ein Gewicht von 2'2,f> kg hatten und aus einer Höhe von lOtH) m herabzuschleudern waren, ins Ziel zu bringen, Gaubert auf Zweidecker Maurice Farman, placierte eines der Geschosse und errang den zweiten Preis, und Fourny. gleichfalls Maurice Farman, brachte zwei Bomben in den Zielkreis und klassierte sich als erster. Der Hauptmann Leclerc. sowie ein zweiter Militärflieger, gaben nach einigen mißglückten Versuchen den Wettbewerb auf. Einige interessante Neuigkeiten aus dem französischen Militärflugwesen sind zu berichten. Zunächst handelt es sich um die endgiltige Bestätigung der von der Heeresverwaltung beschlossenen Neuorganisation durch das Parlament, das die Schaffung einer besonderen Ministerialabteilung für Flugwesen, sowie die dazu erforderlichen Kredite nahezu einstimmig votiert hat. Tm Senat hat die parlamentarische Gruppe für das Flugwesen sogar einen kräftigen Vorstoß unternommen, indem sie auf Antrag des bekannten Senators und Fliegers Reymond beschlossen hat, eine eingehende Diskussion über das gesamte Militärflugwesen auf eine der nächsten Tagesordnungen zu setzen. Bekanntlich geht es den Herren immer noch nicht schnell genug, sie wünschen ein lebhafteres Tempo in der Entwicklung des Flugwesens und seiner Organisation. Der Kriegsminister hat ein Rundschreiben an die Korpskommandeure gerichtet und sie darauf hingewiesen, daß in Zukunft die Militärflieger nur solche Personen an Bord ihrer Apparate nehmen dürfen, die ihrerseits mit besonderen Autorisationen versehen sind. Zuwiderhandlungen sollen aufs strengste bestraft werden. Ferner ist bestimmt worden, daß die Offiziersflieger, die das Militärfliegerzeugnis besitzen, eine Jahreszulage von 3 600 Francs die Fliegereleven eine tägliche Vergütung von 5 Francs erhalten sollen. Wir sind ferner in der Lage, zu melden, daß in naher Zukunft Dijon ein grosses Militär-Flugzentrum werden wird. Die erforderlichen Arbeiten werden sehr bald in Angriff genommen werden, sodaß die Inbetriebnahme der ganzen Installation für den 1. April in Aussicht steht. Dijon wird nicht weniger als zehn komplette Luftgeschwader erhalten. Das französische Flugwesen hat wieder einen schweren Verlust erlitten; einer seiner tüchtigsten Offiziersflieger, der Hauptmann de Lagarde, zum Flugzentrum von Reims gehörig, flog von dort dieser Tage ab und begab sich nach Villacoublay. Er stellte, dort angekommen, die Zündung ab und näherte sich der Erde, als sich plötzlich das Schwanzstück seines Apparates in die Höhe hob und der Eindecker vertikal mit grosser 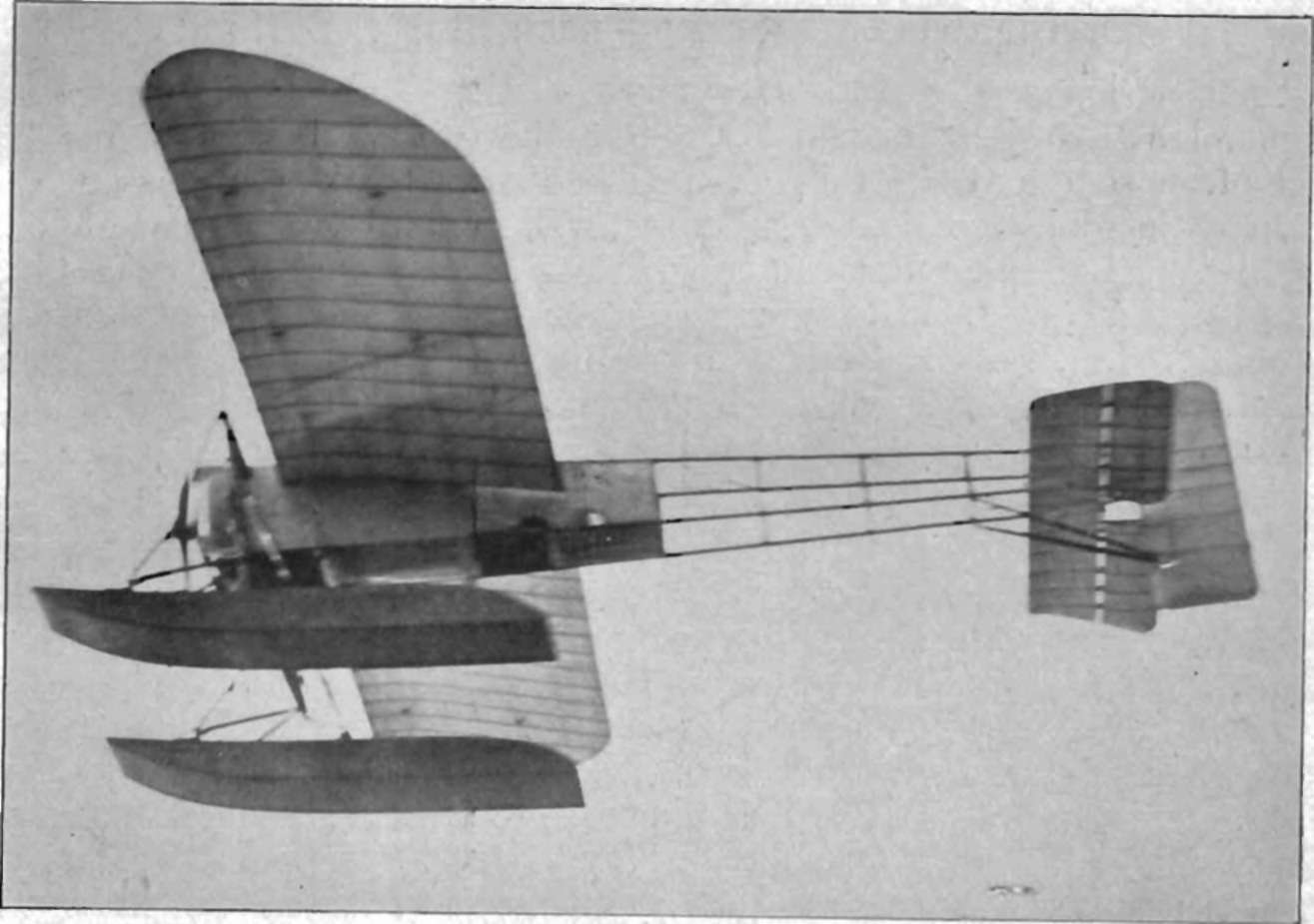 Bleriot- Wasser-Eindecker im Fluge. (S. 907) Heftigkeit auf den Boden stieß. Hauptmann de Lagarde ist auf der Stelle getötet worden. Interessante Einzelheiten werden nun auch bezüglich der neuen Reglements für den Pommery- und Michelin-Pokal bekannt. Die Ligue Nationale Aerienne beschäftigt sich gegenwärtig mit den neuen Bestimmungen für den Pommery-Pokal für 1914, 1015 und 1916. Nach der neuen Formel werden, wie wir berichtet haben, die Konkurrenten zwischen Sonnenaufgang des einen und Sonnenuntergang des folgenden Tages, also während etwa 3K Stunden, einen Flug in gerader Linie auszuführen haben. Wie es heißt, will aber die Liga alle Nachtflüge untersagen, sodaß die offizielle Flugzeit sich auf ungefähr 28 Stunden beschränkte. Dieses unerwartete Verbot der Nachtflüge begründet die Liga mit den zahlreichen Unfällen, die in Deutschland bei den Versuchen von Nachtflügen um den Nationalpreis vorgekommen seien. Dort habe das Reglement den Flug von Mitternacht bis Mitternacht gestattet. Diese Stellungnahme der Liga ruft begreifliches Befremden hervor, zumal unzweifelhaft die Rolle der Flugzeuge im Kriege sich auch auf die Nacht auszudehnen haben wird. "Was den Michelin-Pokal betrifft, so wird dieser im nächsten Jahre auf einer Rundstrecke durch Frankreich von mindestens 3000 km zu bestreiten sein. Die Strecke wird zahlreiche Kontrollstationen haben und die Bewerber können den Flug von irgend einer dieser Stationen beginnen, müssen aber die ganze Rundstrecke bis zu ihrem Ausgangspunkte zurücklegen. In diesem Falle werden also Nachtflüge gestattet sein, denn, selbst eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 150 km angenommen, werden die Bewerber 20 Stunden brauchen, um die Strecke zurückzulegen. Grosses Intesesse bringt man hier auch dem internationalen Sternflug nach Monte Carlo entgegen, welchen der Internationale Sporting-Club von Monako im kommenden Frühjahr organisiert Der Bewerb wird vom 1. bis 15. April offen sein und die folgenden sieben Luftstrecken umfassen, die sämtlich die gleiche Kilometerzahl aufweisen und auch die gleiche Anzahl von Landungen vorsehen, sowie die gleichen Distanzen über dem Festland für Landflugzeuge und über dem Meere für Wasserflugzeuge. Der Bewerber muß selbst die ganze Strecke zurücklegen, entweder auf einem gemischten Apparat oder auf zwei Apparaten derselben Marke. Die sieben nach Monte Carlo führenden Strecken sind wie folgt festgesetzt: 1. London—Monte Carlo, mit Landungen in Calais, Dijon, Toulon 2. Brüssel—Monte Carlo, welcher die Strecke 1 in Calais erreicht 3. Paris—Monte Carlo über Angers, Toulouse, Toulon 4. Gotha—Frankfurt—Monte Carlo über Dijon und Toulon 5. Madrid—Monte Carlo über Bilbao, Toulouse, Toulon 6. Wien —Monte Carlo über Agram, Venedig, Genua 7. Rom —Monte Carlo über Turin, Venedig, Rom, Genua Der Abflug kann in der Zeit vom 31. März bis zum 14. April erfolgen, die Ankunft in Monte Carlo vom 1. bis 15. April. An Preisen sind ausgesetzt: 25000 Francs für die beste Zeit unter allen sieben Flugwegen; 10000 Francs für die beste Zeit unter allen sieben Flugwegen für einen Apparat, der mehr als 25 Quadratmeter Besegelung hat; 5000 Francs jedem Flieger, der auf seinem Flugwege die beste Zeit erzielt hat, usw. Der Bewerb ist international. Rl. Aus den englischen Flugcentren. Der Mariueminister Winston Churchill führte in seiner Rede während der Festlichkeiten an Lord-Mayors-Tage über das englische Flugwesen folgendes aus: „Selbst in der Eroberung der Luft haben wir in der letzten Zeit gewaltige Fortschritte gemacht. Mit charakteristisch englischem Stolz sind wir vorgegangen. Das britische Marineflugwesen, wenn auch noch in den Anfangsstadien, wie alles auf diesem Gebiete kriegerischer Operationen, hat bereits eine Stufe erreicht, welche es an die Spitze aller Nationen auf dem Gebiete des Wasserflugwesens stellt. In einer bemerkenswert kurzen Zeit ist unser Naval-Aeroplane-Service zu einem erstklassigen geworden. Das ist jedoch nicht alles. Ich bin speziell zu dem Zveck hierher gekommen, um vor versammelter Menge darauf hinzuweisen, daß nicht nur dieser eine Punkt, 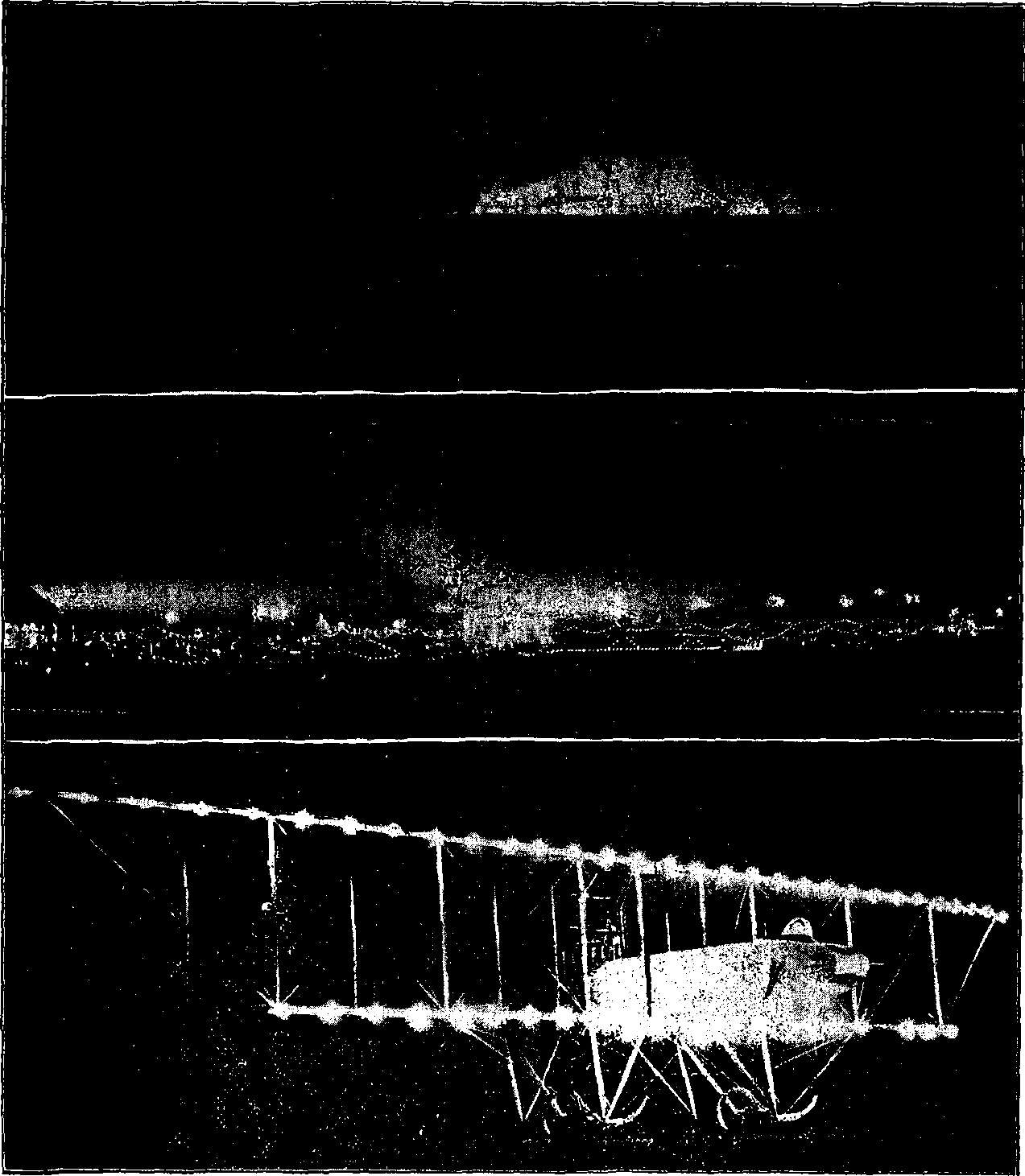 Von den Nachtflügen auf dem Flugplatz zu Hendon. Oben: ein durch Bombenwurf in Brand gestecktes Kriegsschiff auf dem Flugplatz Hendon. In der Mitte der illuminierte Flugplatz Hendon. Unten der Graham White fünf sitzige Doppeldecker, Sieger im Rennen der Nacht, die Entwicklung und der Ausbau des Marineflugwesens für die Sicherheit des Landes von großer Bedeutung ist, der Friede ist nur dann gesichert, wenn wir uns neben der Vorherrschaft auf dem Wasser auch noch die Vorherrschaft in der Luft aneignen. Frankreichs Genius und Deutschlands unermüdlich schaffender Geist haben auf dem Gebiete des Militärflugwesens Resultate erzielt, mit welchen wir uns zu messen vorläufig nicht imstande sind. Um nun aus dem uns bevorstehendem Kampfe um die Weltherrschaft in der Luft als Sieger hervorzugehen, ist es vor allen Dingen nötig, daß das Kriegsministerium und die Admiralität Hand in Hand arbeiten. Kein Opfer, sei es noch so groß, darf gescheut werden, das gesteckte Ziel zu erreichen. Das schärfste, Auge, die sicherste Hand, das unerschrockenste Herz muß in den Dienst dieser Sache gestellt werden, damit wir erreichen, was wir auch sicher erreichen werden, das oberste Kommando und die Perfektion der Kriegsführung in der Luft, welche in der Zukunft ein unentbehrliches Element, nicht nur in der Stärke der Marine, sondern auch zur Sicherheit des Weltfriedens sein wird. Im Hinblick auf die sehr befriedigenden Erkundungsergebnisse, welche! unsere Marineflieger bei den letzten großen1 Flottenmanövern auf zu-: weisen hatten, welche namentlich im rechtzeitigen Sichten und Makieren herannahender Unterseeboote gipfelten, wurde beschlossen längs der ganzen englischen Süd- und Ostküste einen Gürtel von Wasserflugstationen zu errichten. Diese aviatischen Stützpunkte sollen ähnlich den bestehenden Torpedobootsstationen der territorialen Küstenverteidigung in gut geschützten Buchten mit Abständen von 60—80 Seemeilen voneinander aufgestellt, durch Telephonanlagen miteinander verbunden, und mindestens mit 3 Wasserflugzeugen in jeder Station ausgestattet werden. Durch das Zusammenwirken der Flugzeugrekog-noszenten und den zur Abwehr feindlicher Landungs- und Angriffsversuchen berufener Torpedoboots verbänden der Verteidigungsbezirke, wird es uns möglich sein, jedem Invasionsversuch mit Erfolg begegnen zu können. Die Mittel zur Installation werden noch vor Abschluß dieses Geschäftsjahres, (Das neue beginnt im März 1914.) flüssig gemacht werden. Vorerst kommen 30 Stationen zur Verwendung, die speziell bei den Kriegshäfen und im Kanal dichter beisammen liegen werden. Bis jetzt haben wir bereits 10 solcher Stationen."...... Die Frage des Marineflugwesens scheint somit einer äußerst günstigen Lösung nahe gebracht zu sein. Wenn man bisher an der Brauchbarkeit der Wasserflugzeuge als einer fünften Waffe moderner Kriegsführung zweifelte, und den Ausbau einer Luftflotte ziemlich optimistisch gegenüberstand, spielt die Rede das Marineministers darauf an, daß im kommenden Rechnungsjahre 1914 — 1915, die doppelte Summe von den in diesem Jahre bewilligten Ausgaben zur Förderung des Flugwesens vorgeschlagen werden soll, und wenn vorgeschlagen, auch als bewilligt angesehen werden kann. Stillstand ist Rückschritt. Churchill hat bewiesen, daß er vorwärts strebt. England in der Luft voran, ist das Losungswort. Es ist zu hoffen, daß auch unser Marineministerium recht bald eine gründliche Revidierung in seinem festgelegten Programm, der Beschaffung von 50 Wasserflugzeugen, vornimmt. Ein großes Wasserflugzeug stellt die unter Kontrakt arbeitende Flugzeugfabrik Gebrüder Short für die Admiralität her. Man erwartet, daß die für fünf Insassen berechnete Maschine, welche zwei Green Motoren, von großer Stärke erhalten wird, eine Fahrtdauer bis zu 24 Stunden werde erreichen können. Soweit das Marineflugwesen. Die Armee-Abteilung des Royal Flying Corps sorgte in letzter Zeit für Gesprächsstoff. Unter den Fliegern war eine allgemeine Unzufriedenheit ausgebrochen. Es handelte 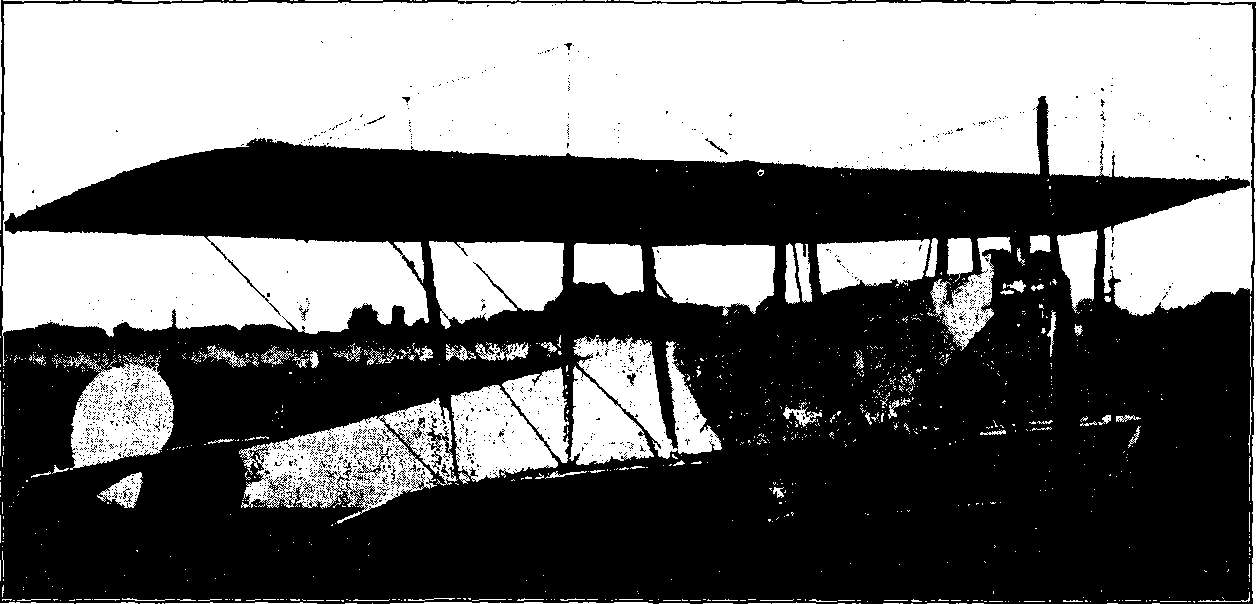 Engl. Flanders-Doppeldecker mit SO PS Isaacson-Rptations-tAotor. sich um die neue Uniform des Fliegerkorps. Der Störenfried war jedoch nicht die Uniform selber, sondern die Kopfbedeckung, die der der Zuchthäußler in den englischen Staatsgefängnissen verzweifelt 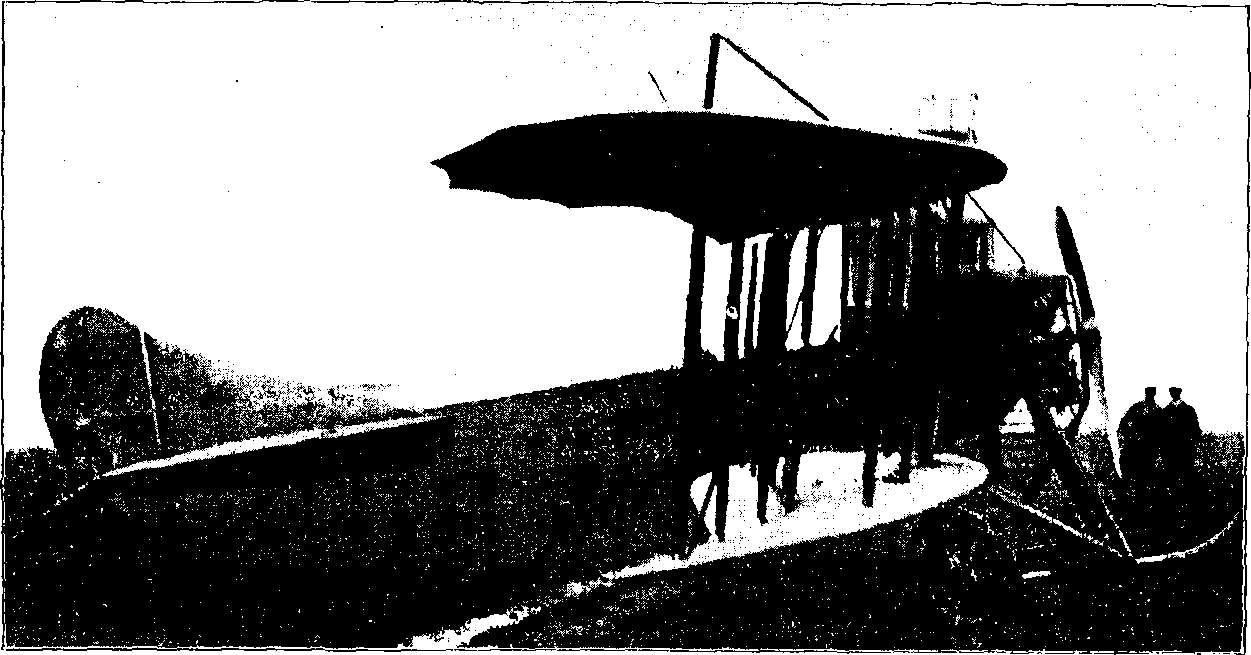 Engl. Handlay-Page-Doppeldecker mit 100 PS Anzani-Motor. ähnlich sieht und an die sich folgende heitere Episode knüpft. Am Abend des ersten Tages nach Anwendung der neuen Uniform fuhren zwei Fliegeroffiziere auf ihren Rädern vom Flugplatz zu Farnborough aus nach den in einiger Entfernung gelegenen Kasernen. Auf halbem Wege wurden die im schnellen Tempo dahinsausenden Flieger von Gendarmen aufgehalten, die annahmen, es mit ausgebrochenen Sträflingen zu tun zu haben. So schnell die neue Uniform auf der Bildfläche erschien, so schnell ist sie nunmehr auch wieder von derselben verschwunden. Zur allgemeinen Zufriedenheit der Fluginteressenten sind nun endlich die Streitigkeiten in Royal Aero Club als beendigt anzusehen. Der Club hat zu Gunsten der Grahame White Aviation Company entschieden und der Gießler Preis bleibt wie zuvor in den Händen des rechtmäßigen Gewinners Brindejonc des Moulinais. Das Hendon-Brighton-Hendon-Air-Hace endete mit einem Siege Pierre Verrier's auf einem Maurice Farman Doppeldecker. Die für den British-Empire-Michelin-Cup No. 3. festgesetzte Zeit, die eigentlich schon am 15. Oktober abgelaufen war, wurde auf Veranlassung der Micheiin Company bis zum 30. November verlängert. Der Preis, Pokal und 500 Lstr. in bar, gilt für einen Non-stop Geschwindigkeitsflug über eine Entfernung von nicht weniger denn 279 englische Meilen, auf einer in England konstruierten Maschine mit englischem Motor. Hawker, der Sopwith-Flieger machte am 19. Nov. abermals einen Versuch, mußte aber, nachdem er bereits 270 Meilen in genau 5 Stunden zurückgelegt hatte, wegen Motordefekt aufgeben. Ein anderer Flieger, Carr, startete an demselben Tage auf dem neuen Grahame White 5 Sitzer Doppeldecker und legte die 279 Meilen in S1^ Stunden zurück und ist somit Anwärter auf den Preis. Der Motor ist derselbe 100 PS Green, mit welchem der verunglückte Oberst Cody im vorigen Jahre den großen Preis des Kriegsministeriums gewann. Wie aus der Tagespresse wohl schon zur Genüge bekannt sein dürfte, gelang es dem englischen Flieger B. C. Hucks, die Kunstflüge Pegoud's nachzuahmen. Nach seinen eigenen Aussagen hat er sich im Ganzen 21 mal in der Luft überschlagen. Am 18. traf er wieder in London ein, und wurde ihm bei seiner Ankunft ein „Looping-the-loop" Empfang zuteil. Freunde trugen ihn vom Eisenbahn-Kompartment Kopf nach unten durch die sich zur Begrüßung angesammelte Menge zum wartenden Automobil. Hucks will dieser Tage vor dem englischen Publikum seine Poickenflüge wiederholen. Ein anderer Flieger, Temple, sucht Hucks bei diesen ,,Upside-down Experimenten" zuvorkommen. Um sich mit der nach unten hängenden Position vertraut zu machen, hängt er täglich fünf Minuten lang in einem Stuhle festgebunden, von der Decke seines Flugzeugschuppens. Auf eine ihm gestellte Frage antwortete der junge Flieger: „Ich muß noch vor Hucks auf dem Bücken fliegen, sonst ist das Interesse des Publikum's bereits verflogen". Ob es ihm jedoch gelingen wird, ist eine andere Frage. Nachdem das Kriegsministerium seit längerer Zeit dem Doppeldecker als Militär-Flugzeug den Vorzug gegeben hat, hat sich die Industrie nach dieser Linie hin weiter entwickelt. So wurden dieser Tage auf dem Flugplatz Hendon mit einem neuen von der Firma „Flugsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten u. Flugtechn. Vereine 1913. Mviatik Pfeil-Rumpf-Doppeldecker. Militärtyp 1913. Tafel 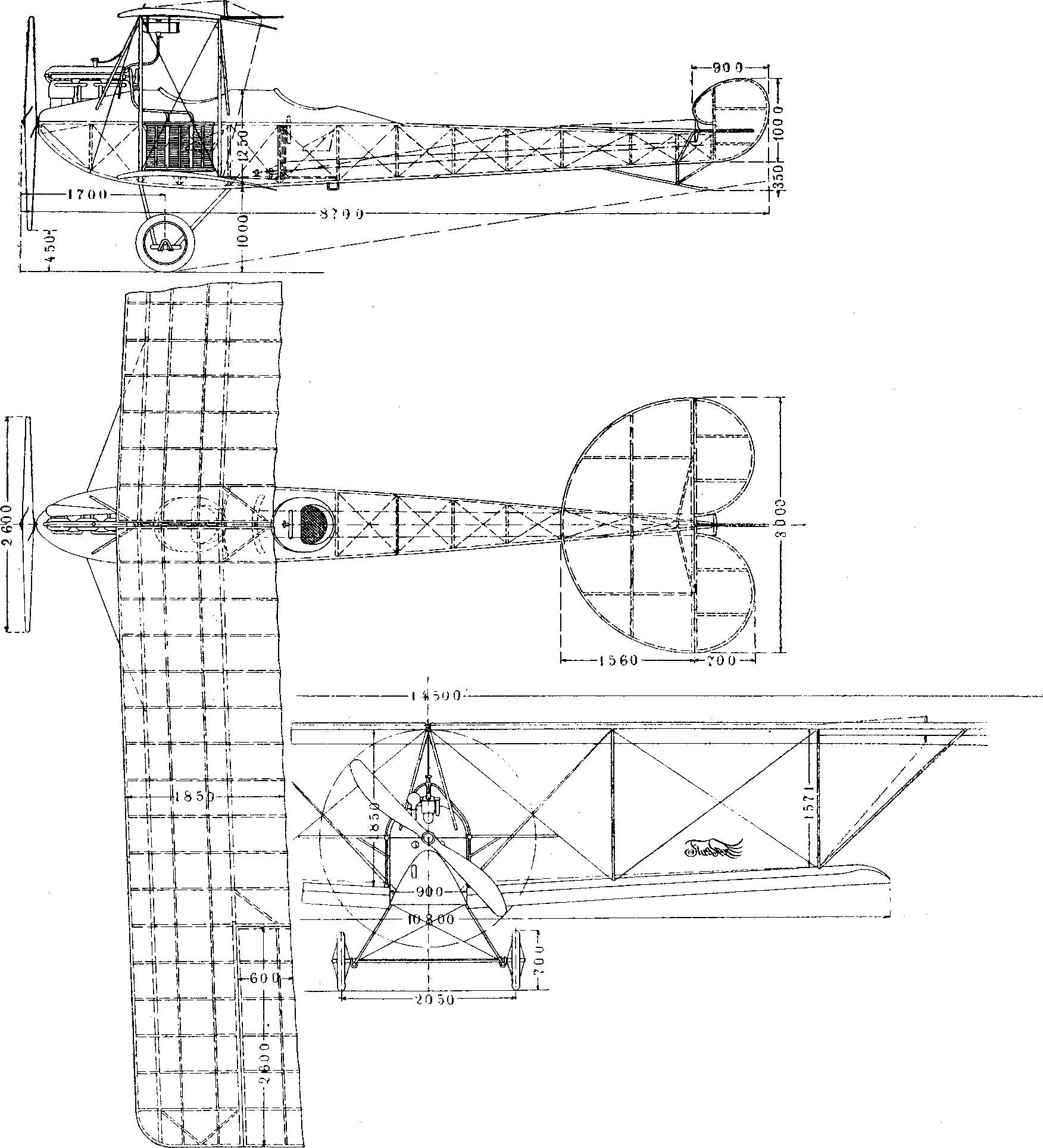 Nachbildung verboten. Handley-Page konstruierten Doppeldecker Probeflüge ausgeführt, die von guten Resultaten begleitet waren. Dieser Apparat ist der erste Doppeldecker der Firma, die durch ihre Eindecker bereits einen Namen errungen hat. Charakteristisch sind die sichelförmigen Tragflächen. Der Apparat, der für die Hull-Aviation-Company bestimmt ist, wird von einem 100 PS Anzani-Motor getrieben. Eine andere neue Maschine ist der von der Firma Flanders erbaute Doppeldecker. Der Name Flanders dürfte in Deutschland noch nicht vergessen sein. Der Konstrukteur Howard Flanders beschuldigte bekanntlich die Königlichen-Flugzeug-Werke im vorigem Jahre, daß dieselben seine Patentrechte verletzt hätten. Viele Einzelheiten des soviel gerühmten ,,BE" Typs, sind tatsächlich von einer älteren Flanders-Konstruktion adoptiert. Der neue Doppeldecker unterscheidet sich von andern Bauarten hauptsächlich durch sein sehr niedriges Anfahrgestell und seinen tiefen Körper. Als Triebkraft dient ein 80 PS Issacson-Radial-Motor, der erste englische Rotationsmotor. Wie wir schon in der vorigen Nummer berichteten, wurden mit dem neuen, für die Militärverwaltung bestimmten Dunne-Doppeldecker keine guten Resultate erzielt. Der Apparat ist nunmehr vollständig abmontiert und wird jedenfalls für längere Zeit von der Bildfläche verschwinden. Lord. Der Bombenwurf-Wettbewerb in Döberitz. Der Wettbewerb, für welchen das Kriegsministerium hohe Preise ausgesetzt hatte, begann am 12. November, Zugelassen waren nur reichsdeutsche Flieger mit Flugzeugen die incl. Motor in Deutschland hergestellt waren. Für den Wettbewerb hatten gemeldet: Albatros-Werke, Führer Ernst Stoeffler.lOOPS Albatros-Mercedes-Doppeldecker. Luftfahrzeug-Ges. m. b. H., Führer Fiedler, 100 PS Roland-Mercedes-Taube. Ago-Flugzeugwerke, Führer B r e i t b e i I, Ägo-Pfeildoppeldecker. Ago-Flugzeugwerke, Führer Kiessling, mit hinten liegendem 6 Zyl. Argus-Motor. E. Rumpier, Luftfahrzeugbau, Führer Linnekogel, Rumpler-Taube mit 70 PS Mercedes-Motor mit hängenden Zylindern. Harlan, Führer Krieger, Harlan-Pfeil-Taube, 100 PS Mercedes. Aviatik, Mülhausen, Führer I n g o I d, Aviatik- Pfeil - Rumpfdoppeldecker, 100 PS Mercedes. Die Veranstaltung hatte unter der Ungunst des trüben regnerischen Wetters sehr zu leiden. Bei den am 1. Tage stattgefundenen Probewürfen machte man die unangenehme Erfahrung, daß die Projektile sich sehr tief in die Erde eingruben, so daß sie unauffindbar blieben. Es wurde nun vorgeschlagen die Geschosse kenntlich zu machen. So versah Schauenburg, der einen A. E. G -Doppeldecker steuerte, seine Geschosse mit langen roten Bändern. Dieses Mittel versagte jedoch auch, da die Bänder mit in die Erde hineingerissen wurden und die Löcher sich wieder nach oben schlössen. Krieger und Ingold bestrichen ihre Geschosse mit roter Lackfarbe, die auf der Erdoberfläche verbleiben sollte. Die Bedingungen, fünf Bomben innerhalb einer Stunde aus 700 bis 1000 m Höhe in ein 80 X 80 m grosses Ziel zu bringen, wurde von keinem der Flieger erfüllt. Die besten Resultate erzielte Schauenburg mit 2 Bomben, Ingold, Krieger und Stiefvater je 1 Bombe. Da keiner der Flieger die Bedingungen erfüllte, beschloß das Kriegsministerium Trostpreise auszusetzen. Einfache Konstruktion ; möglichst wenig Einzelteile ; das sind Hauptgesichtspunkte, die bei der Konstruktion von Militärmaschinen zu berücksichtigen sind. Ing. Baumbach hat sich von diesen Gesichtspunkten ausgehend einen Eindecker konstruiert der in nachstehendem kurz beschrieben ist. Der aus nahtlosem Stahlrohr hergestellte Motorrumpf hat vier- bezw. rechteckigen Querschnitt. Die Streben sind nicht wie üblich mit den Längsträgern autogen verschweißt, sondern lösbar verbunden. Ein Durchbohren der Längsträger und somit eine Schwächung des Materials fällt durch die verwendete Verbindungsvorrichtung fort. Sämtliche Rohre, Streben sowie Längsträger, sind in kurzer Zeit auswechselbar. Im vordersten Teil des Rumpfes ist der Motor vollkommen eingekapselt untergebracht. Durch zwei seitliche Türen am Motorraum ist der Motor zugänglich. Vorn abgeschlossen ist der Rumpf durch einen geeignet geformten und durchbrochenen Kühler. Direkt hinter dem Motorraum befindet sich der Raum für die Insassen mit den notwendigen Instrumenten und Steuerungsvorrichtungen. Die Sitze sind nebeneinander geordnet, wodurch eine schnellere und bessere Verständigung zwischen Führer und Beobachter ermöglicht wird. Der Rumpf ist bei bequemer Sitzmöglichkeit so hoch gehalten, daß nur die Köpfe heraussehen. Unter den Sitzen befindet sich ein größeres Benzingefäß, das 150 kg Benzin aufnehmen kann. Aus diesem Oefäß fließt unter Druck das Benzin in ein höheres, kleineres Gefäß und von hier nach dem Vergaser. Der Motor kann vom Führersitz aus angekurbelt werden. Das Fahrgestell wird durch zwei kräftige Stahlrohrbügel gebildet, die durch starke Spannseile mit dem Rumpf verspannt sind. Auf den Bügeln ist die Radachse in Gummiringen federnd gelagert. Die Ttagflächen besitzen eine Spannweite von 12 m und eine Breite von 2,25 m. Ihr Flächeninhalt mißt 24 qm. Sie sind unten mit dem Fahrgestell und oben mit zwei Stahlrohrdreiecken verspannt. Das vordere Spanndreieck ist zwecks besserer Aussicht schmäler. Die äußersten Rippen der Tragflächen sind länger gehalten und leicht nach oben gebogen. Während der vordere Holm fest mit dem Rumpf verbunden ist, ist der hintere zwecks Verwindung der Fläche zur Erhaltung der Seitenstabilität gelenkartig am Rumpf befestigt und nach oben und unten verziehbar. Die Schwanzflächen haben Dreiecksform und einen Inhalt von 2,40 qm. An ihren Enden sind drehbar in Scharnieren die Höhensteuer angebracht. Zwischen den Höhensteuern ist gleichfalls in Scharnieren drehbar das Seitensteuer angeordnet. Die Höhen- und Seitensteuer haben je einen Flächeninhalt von 0,80 qm. Der Schwanz wird getragen von einer kräftigen Kufe. Die Steuerung ist die übliche Militärsteuerung mit doppelten Steiierzügen. Der gleiche Rumpf findet auch Verwendung bei Doppeldeckern. Baumbach-Eindecker.  Was man in Rußland von den Militärflugzeugen verlangt. Rußland macht bekanntlich große Anstrengungen um sein Militärflugwesen zu entwickeln um gegen andere Mächte nicht zurückzustehen. Der größte Teil des Bedarfes wird schon jetzt von russischen Firmen, die von der Regierung in jeder Weise unterstützt werden, gebaut. Vor kurzem sind nun die Veröffentlichen der Kaiserl. Nikolaus-Kriegs-Akademie im Militär-Wochenblatt erschienen, von denen wir im nachstehenden das Wissenswerte wiedergeben. 1. Unterbringung an bestimmter Stelle. a) Am Basisort. Die besten vom permanenten Schuppen sind zerlegbare aus Wellblech mit nach allen Seiten zu öffnenden Toren. Ist die Basis unzureichend gesichert, so kann man sich mit hölzernen Schuppen nach dem Muster der Offiziers-Flicgerschule der Abteilung für Luftschiffahrt des Flottenvereins oder transportablen Schuppen französischen Systems behelfen. b) Bei wechselndem Standpunkt kommen in Betracht: 1. Transportable französische Schuppen. 2. Zelte, Modell Bessano. 3. Behelfsmäßig gebaute 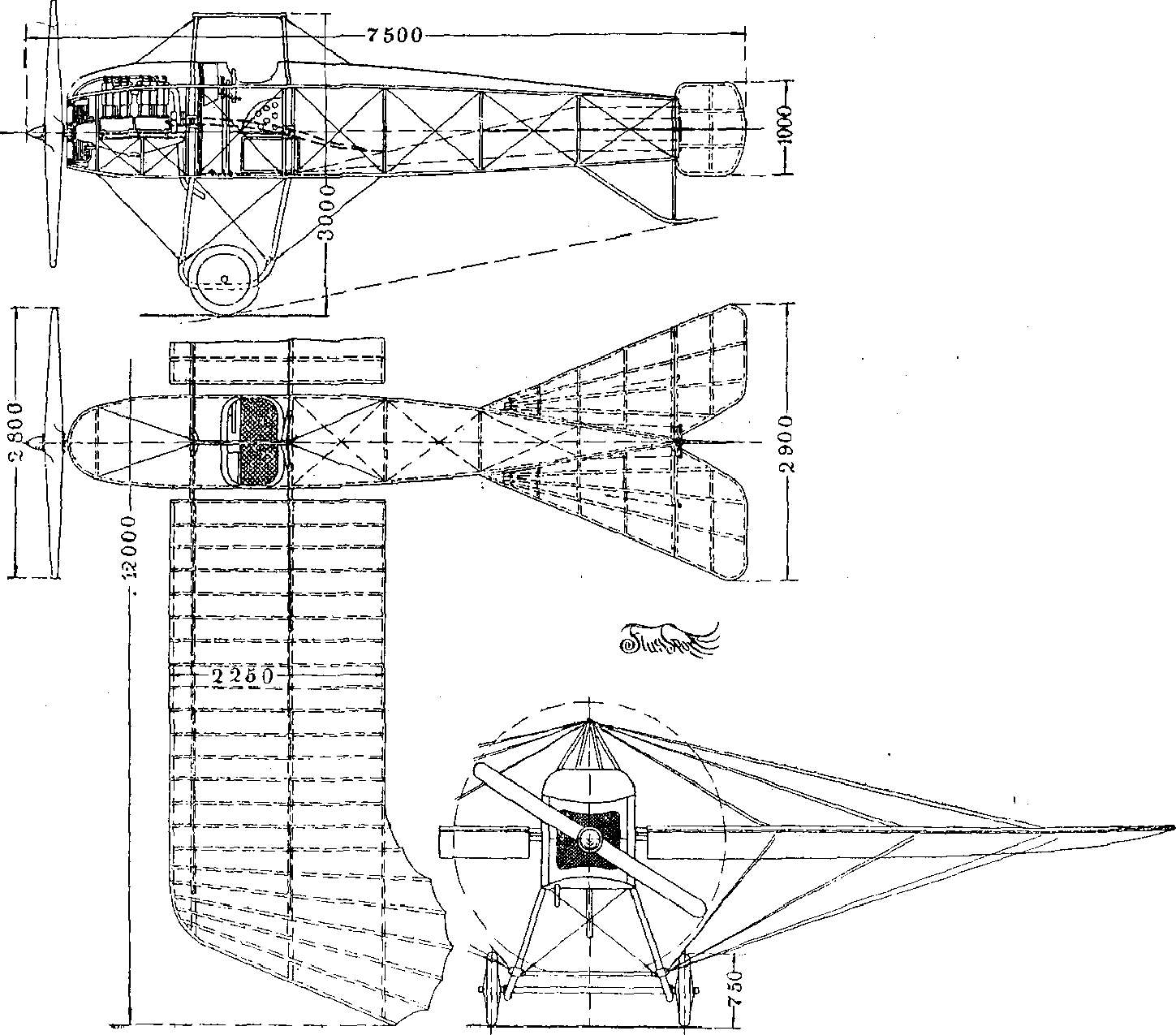 |_ .—50 0 0--4 Der Baumbach-Eindecker. Schuppen. 4. Aufstellung unter freiem Himmel. Zu 1. Haben sich in den Mannövern 1911 unbrauchbar erwiesen. Zu 2 Sind leicht zu transportieren, auf-und abzubauen, wurden aber bei statkem Winde bisweilen umgeworfen oder fortgerissen. Zu 3. Der Bau verlangt Uebung, ist ziemlich teuer und nur bei längerem Verweilen an einer Stelle angezeigt. Zu 4. ist bei richtiger Befestigung des Flugzeuges nach Art der Fliegerschule der A. f. L. des Fl.-V, die beste, weil einfachste und feldmäßigste Art. 2. Transport, a) Mit der Eisenbahn; b) auf Kraftwagen; c) auf Dampfschiffen ; d) mittels Pferden. Zu a) Für jedes Flugzeug des Farman-Typs sind erforderlich 2 offene Waggons oder für 2 Flugzeuge 3. Für je 2 Blfiriot, Nieuport oder Moräne 1 Waggon. Für Werkstattautomobil oder Lastkraftwagen je 1 Waggon; für 2 leichte Kraftwagen 1 Waggon. Für Benzin und Oel 1 gedeckter Güterwagen. Für Zelte leichten Typs 1 gedeckter Guterwagen, für Reserveteile ebenfalls. Für Offiziere und Manschaften je 1 Wagen. Flugzeuge vom Typ Farman A werden in zerlegtem Zustande, in Kisten, Bleriot, Nieuport und Moräne ebenfalls in zerlegtem Zustande, die Flügel stehend an den Seiten des Flugzeugkörpers befestigt, transportiert, FHr den Eisenbahntransport einer Farman-Abteilung (nach dem Projekt der Fliegerschule der A.f. L. des Fl.-V.) sind also erforderlieh; 21 offene und 3 gedeckte Güter- und 2 Personenwagen. Für eine Abteilung aus Flugzeugen eines der anderen Typen : 9 offene und 3 gedeckte Güter- und 2 Personenwagen. Es ist erwünscht, für den Bahntransport von Fliegerabteüungen besondere Züge mit erfahrenen Maschinisten und guten Lokomotiven zu bestimmen, um unnötige Stöße und Erschütterungen zu vermeiden. Zu b) Ist auf nicht chaussierten Straßen sehr schwierig. Auf einen Lastkraftwagen mit Anhänger kann man verladen : 1 Farman (in Kisten) oder 2 Eindecker mit abgenommenen Flügeln; Bessano-Zelte je 3 auf jeden Anhänger. Die Transportart ist sehr kompliziert. Zu c) Wird, wenn irgend möglich zu vermeiden sein. Zu d) Für 1 Flugzeug Farman A sind 2 Wagen erforderlich, 1 drei- oder vierspännniger für den Körper, 1 zweispänniger für den Schwanz. Für einen Eindecker genügt ein entsprechendes hergerichtetes Fuhrwerk. Von dea weiter behandelten Punkten (Lieferung von Benzin und Oel, Abflug- and Landeplatz, Zusammensetzen des Flugzeuges, Verteilung der Flieger nach Flugzeugen) verdient Erwähnung, was 3. über das Studium des Operationsgebietes gesagt wird: „Der Chef des Stabes des Armeekorps ist verpflichtet, noch im Frieden dem Führer der Abteilung den nach dem Mobilmachungsplan in Betracht kommenden Operationsrayon anzugeben. Das ist nötig, damit die Flieger das Gelände in dem bestimmten Gebiete kennen lernen, und damit Spezial-Fliegerkarteu rechtzeitig angefertigt werden können. Liegt das Armeekorps im Grenzgebiet, so müssen die Flieger an die Grenze kommandiert werden. Als Fliegerkarte eignet sich eine im Maßstabe 5 Werst auf einen Zoll (2,54 cm) angefertigte." 4. Auf k lärun g. Es sind folgende Punkte zu berücksichtigen: Die Zahl der Werst des Aufklärungsweges ist um 25 v. H. zu verringern gegen das Produkt von Fluggeschwindigkeit und Höchstzahl der Flugstunden. Die Tagesleistung eines Fliegers soll fünf bis sechs Stunden Flugzeit nicht übersteigen. Aus diesen Angaben bestimmt sich die Länge des Aufklärungsweges für einen Farman oder zweisitzigen Bleriot: 200 Werst, und für einen Nieuport oder Renn-Bleriot: 270 Werst. Außer in besonders wichtigen Fällen ist stets nur die Hälfte der Flieger gleichzeitig zu entsenden und nur mit wichtigen Aufträgen. Ein Flieger darf nur eine Aufgabe erhalten. Die Aufträge sind möglichst am Abend für den nächsten Morgen, für Abendflüge zwei bis drei Stunden vorher zu erteilen. Ein Flieger kann aus 800 bis 1000 m Höhe nach beiden Seiten 3 bis 4 Werst übersehen, also beträgt die Breite des Aufklärungsstreifens eines Fliegers G bis 8 Werst Wichtige Aufklärungsaufträge sind an zwei Flieger zu geben, und der zweite ist frühestens 5 Minuten nach dem erst abzusenden." Es folgen nun Hinweise für die Art der Auftragserteilung. „Um stets in gefahrloser Höhe zu fliegen, soll sich der Flieger auf der Karte im Zuge seines Weges an verschiedenen Stellen die Höhenzahlen des Geländes eintragen (da der Höhenmesser nur die Höhe über Normalnull angibt). Der Flieger soll eine schußsichere Höhe spätestens bis zum Verlassen des Unterbringungsraumes der eigenen Truppen erreicht haben. Den Aufenthaltsort des Feindes kann der Flieger nach folgenden Merkmalen auffinden: Aufstellung von Geschützen in der Unterkunft oder im Gefecht; die Zahl von Infanterietruppenteilen läßt sich bestimmen nach der Zahl der Maschinengewehr-Kompagnien, nach den Fahnen, Patronenwagen, Feldküchen und den einzelnen Teilen der Marschkolonne, wenn auch wahrscheinlich bei Beobachtung durch Flugzeuge die Truppenteile ihre vorschriftsmäßigen Abstände nicht innehalten werden (?!). Nach der Zahl der Geschütze im Gros kann man ungefähr auf die Stärke der ganzen Kolonne schließen. Auch die Stärke der Infanteriereserven kann man oft aus der Zahl der Patronenwagen bestimmen i die Stellungen der Artillerie aus dem Aufstellungsort der Protzen und Munitionswagen. Den Platz von Stäben verraten Beobachtungsleitern, Antennenmasten und offen aufgestellte Flugzeuge Eine Anhäufung von Fuhrwerken an irgendeinem Punkte oder einer Station läßt mit Sicherheit darauf schließen, daß sich in der Nähe eine stärkere Abteilung aufhält oder eintreffen wird. Befestigungsanlagen, selbst nach dem Feinde zu gut maskiert, sind von oben stets deutlich sichtbar. Lenkluftschiffe und Drachenballons sind auf mehrere 10 Werst deutlich erkennbar und locken den Flieger an. Zu ihnen hinzufliegen und diese ungelenken, schwerfälligen Giganten zu vernichten und dadurch den Gegner moralisch und materiell empfindlich zu schädigen, ist für den Flieger eine neidenswerte Aufgabe." No. 575. Boehm, Alfred, Schlosser, Johannisthal, geb. am 15 Sept. 1888 zu Alienstein (Ostpr.), für Eindecker (Jeannin-Stahltaube), Flugplatz Johannisthal, am 28 Oktober 1913. No. 576. Schmidt. August, Kaufmann, Johannisthal, geb. am 21. Mai 1893 zu Lügumkloster, für Efndecker (Jeannin-Stahltaube), Flugplatz Johannisthal, am 28. Oktober 1913. No. 577. Rieger, Georg, Chauffeur, Burg b. Magdeburg, geb. am 24. Juli 1893 zu Unterbachern, für Eindecker (Schulze), Flugplatz Madel, am 28. Okt. 1913. No. 578. Culin, Helmut, Hamburg, geb. am 18. Sept. 1895 zu Hamburg, für Eindecker (Hansa-Taube), Flugplatz Hamburg-Fuhlsbüttel, am 28. Okt. 1913. Flugtechnische 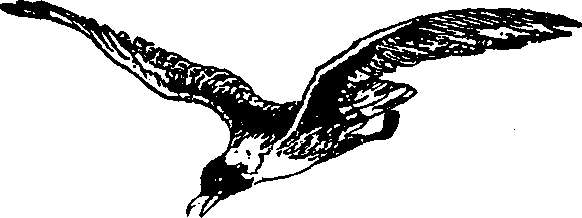 Rundschau. Inland. Fliujfiilwer-Zeugnisse haben erhalten: No. 579. Hartmann, Kurt, Kaufmann, Johannisthal, geb. am 21. August 1894 zu Nordhausen, für Eindecker (Jeannin-Stahltaube), Flugplatz Johannisthal! am 1. November 1913. No. 580. Roosen, Richard, Kaufmann, Johannisthal, geb. am 11. Januar 1875 zu Buenos Aires (Argentinien), für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 3. November 1913 No. 581. Oppermann, Paul, Adlershof b. Berlin, geb. am 20. Dez. 1882 zu Leipzig, für Eindecker (Harlan), Flugplatz Johannisthal, am 3. November 1913. No. 582. Höhndorf, Walter, Ingenieur, Berlin-Schöneberg, geboren am 10. November 1892 zu Prützke (Kr. Zauch-Belzig), für Eindecker (Etrich-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 3. November 1913. No. 583. Lübbert, Rudolf, Kaufmann, Hamburg, geb. am 29. Sept. 1888 zu Hamburg, für Eindecker (Hansa-Taube), Flugplatz Hamburg-Fuhlsbüttel, am 4. November 1913. Der Prinz Heinrich-Flug 1914 findet vorbehaltlich der Genehmigung durch den D. L.-V. in der Zeit vom 17. bis 25. Mai statt Der Flug ist in der Hauptsache ein Zuverlässigkeitsflug, bei dem die Gesamtflugzeit den Ausschlag geben soll. Schwache Motoren erhalten eine Vorgabe, ebenso solche Flugzeuge, die absichtlich mit einer höheren Belastung als der vorgeschriebenen Normalbelastung fliegen, während umgekehrt solche Flugzeuge, die absichtlich weniger als die vorgeschriebene Belastung mitnehmen, einen Zuschlag zur Flugzeit erhalten Der Zuverlässigkeitsflug gliedert sich in eine erste Periode von rund 700 km und eine zweite von rund 1000 km Länge. Jede dieser beiden Perioden kann an einem einzigen Tage erledigt werden, zum Aufschließen der Nachzügler und der auf der Strecke liegengebliebenen Flugzeuge sind für jeden der beiden Perioden zwei weitere Tage vorgesehen, die dann für die früher angekommenen Flieger Ruhetage sein werden. Der Zuverlässigkeitsflug ist vorläufig mit folgendem Programm in Aussicht genommen: I. Teil. (Verfügbare Zeit von Sonntag, 17. Mai, bis Dienstag 19. Mai) — Abflug in Darmstadt, Flug über Mannheim, Pforzheim, Straßburg, Speyer, Mannheim; Landen in Frankfurt. Abflug von Frankfurt über Koblenz, Köln, Wiesbaden; zweites Landen in Frankfurt (700 km) II. Teil. (Verfügbare Zeit von Mittwoch, 20. Mai, bis Freitag 22. Mai) Abflug in Frankfurt, Flug über Gießen, Kassel, Braunschweig; Landen in Hamburg. Abflug von Hamburg, Flug über Hannover, Minden, Herford, Bielefeld, Münster, Osnabrück, Bremen. Landen wieder in Hamburg. An den Zuverlässigkeitsflug schließt sich eine strategische Aufklärungs-iibung an, deren Erledigung zum Prinz Heinrich-Flug gehört; diese beginnt am 23. Mai in Hamburg und führt über eine Meldesammelstelle in der Gegend von Münster nach Köln. Damit ist der eigentliche Prinz Heinrich-Flug 1914 zu Ende. Montag, 25 Mai, finden dann noch taktische Aufklärungsübungen bei Köln statt, die wohl zur Ausnutzung des für den Prinz Heinrich-Flug zu erwartenden starken Aufgebotes von Militär- und Zivilfliegern angeschlossen worden sind. Weltrekord mit zwei Fluggästen, 6 St. 16 Min. 30 Sek. Flugzeugführer Hans Sch i r r m e is t e r stelte am 12 d Mts. auf einem Wasserdoppeldecker des Flugzeugbau Friedrichshafen Type FF 15 einen Dauer-Weltrekord mit zwei Fluggästen auf. Er flog mit zwei seiner Flugschüler, Krämer und Habich, um 10 Uhr 6 Min 30 Sek. vormittags von der Flugwerft in Manzell ab, umrundete acht Mal den Bodensee, wobei er eine Höhe von 1480 Meter über dem Meeresspiegel er- reichte. Er landete um 4 Uhr 23 Min. nachm. infolge eintretender Dämmerung wieder in der Werft des Flugzeugbau Friedrichshafen, wobei er 75 Kilo Benzin zurückbrachte, das für mehr als zwei Stunden Flug noch gereicht hätte. Die gesamte Flugzeit betrug demnach 6 Stunden 16 Min. 30 Sek. Den Weltrekord hielt bisher Faller mit 3 Stunden 15 Min. 30 Sek., der daher mit 3 Stunden 1 Minute geschlagen wurde. Das Flugzeug, Type Bodenseeflugwoche, ist mit einem 135 PS N. A G. Motor ausgestattet und führte bei dem Rekordflug 452 kg Nutzlast mit, wonach das Gesamtgewicht bei einem Eigengewicht von 860 kg 1312 kg betrug. Es flog die 690 km lange Strecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 110 km pro Stunde. Wichtig für Wasserflugzeuge. Im Bezirk der Ober-Postdirektion Frankfurt a. M. wird der Rhein an zwei Stellen durch oberirdische Reichs-Tele-graphenli ni en gekreuzt. Es befinden sich: 1. rechtsseitig 10 m unterhalb des Kurhauses Aßmannshausen, linksseitig etwa 20 m unterhalb des Schlosses Rheinstein, 6 Drähte in 40 bis 50 m über dem Wasserspiegel. 2. Rechtsseitig etwa 700 m unterhalb des Dorfes Ehrenthal über einem auf der Insel „Ehrentaler Wert" stehenden eisernen Gittermast nach dem linken Rheinufer 8 Drähte in etwa 40 m Höhe über dem Wasserspiegel. Da in letzter Zeit wiederholt Wasserflugzeuge den Strom entlanggeflogen sind, weist die Ober-Postdirektion auf die Gefahren hin, denen die Flieger durch diese Leitungen ausgesetzt sind, wenn sie deren Lage nicht kennen. Von den Flugplätzen. Vom Flugplatz Oberwiesenfeld. Am 12. November unternahm der Flieger WeyI anläßlich der Landeshuldigung für König Ludwig III einen Huldigungsflug über München. Der Flieger erreichte auf seinem Otto-Doppeldecker eine Höhe von über 2500 m und umkreiste mehrere Male die Residenz. Nach einer Flugdauer von über IV, Stunden landete Weyl im Gleitfluge wieder glatt auf dem Flugplatz Oberwiesenfeld. Am gleichen Tage absolvierte der Flieger Baierlein auf einem Otto-Doppeldecker einen 4-Stundenflug um die Prämie der Nationalflugspende. Vom Fokker-Muyplatz Görries bei Schwerin. Wie wir bereits früher berichteten, haben die Fokker-Werke ihren Betrieb nach Görries bei Schwerin verlegt. Vor einigen Tagen ist nun der neue Fokker-Eindecker, welcher zur Gleichgewichtserhaltung mit Verwindungsklappen versehen ist, ausprobiert worden. Der neue Typ hat sich ausgezeichnet bewährt. Fokker hat bereits mehrere längere Ueberlandflüge von Schwerin aus ausgeführt. Auf dem Flugplatz Warnemünde werden zurzeit Planierungsarbeiten vorgenommen und hölzerne Schuppen für den in diesem Jahre geplanten Wasserflugmaschinen-Wettbewerb errichtet. Von Straßburg nach Döberitz flog am 21. d. Mts. Lt. Geyer mit Major Siegert als Beobachter auf einem Aviatik-Doppeldecker. Die 570 km (Luftlinie) lange Strecke Straßburg—Döberitz wurde in 4 Std. 23 Min. bewältigt. Ausland. Wie Curtiss über das deutsche Flugwesen denkt. Clenn H. Cuttiss, der bekannte Flugmaschinen-Konstrukteur, einer der ältesten Flieger (französisches Pilotenpatent Nr. 2), war vor einein Monat in Europa, um seine Wasserflug-Ma- schinen bei den verschiedenen Mächten unterzubringen. Nach Amerika zurückgekehrt, hat er sich über den Stand und die Entwicklung des deutschen Flugwesens geäußert, daß in militärischer Beziehung die Entwicklung der Flugtechnik in Europa ein überaus schnelles Tempo eingeschlagen habe, daß dagegen die sportliche Bedeutung und die sportliche Ausnutzung des Flugzeugs in Europa viel zu wenig gewürdigt werde. „Noch ist Frankreich", meint Curtiss, „den anderen europäischen Nationen an Konstruktionspraxis und in die Augen springenden Erfolgen voraus, aber Deutschland und England sind nach meiner Ansicht auf dem besten Wege, den Vorsprung Frankreichs einzuholen. Namentlich auf dem Gebiete des Wasserflugzeugbaues macht England die größten Anstrengungen, der gewollten Hegemonie auf dem Meere auch die Hegemonie in Wasserflugzeug-Konstruktionen und Wasserflugzeug-Praxis zuzugesellen." Curtiss erwähnt sodann auch die von langer Hand vorbereitende Arbeit der deutschen Konstrukteure, die sich von internationalen Wettbewerben zurückgehalten hätten, bis sie Vollwertiges der ausländischen Konkurrenz an die Seite zu stellen hätten. — Wie erinnerlich hat auch Curtiss wegen Lieferung eines Wasserflugzeuges mit unserer Marine unterhandelt. Der Ankauf ist jedoch unterblieben. Rußland errichtet an der deutschen Grenze Fliegerstationen. Seit langer Zeit im Betrieb ist die Fliegerstation Grodno. Neuerdings wurde die Station Libau fertiggestellt. Die russischen Flugzeugfirmen sind zurzeit sehr stark beschäftigt. U. a. hat die Flugzeug-Fabrik Russobaltique, Riga vor kurzem 22 Eindecker an die russische Armee zur Ablieferung gebracht. Von den Oesterreichischen Militärflugplätzen. Der Wiener-Neustädter Flugplatz ist als Militärflugfeld von der Heeresverwaltung gepachtet worden. Auf dem Flugfeld sind Fliegerkasernen zur Unterbringung der Mannschaften errichtet. Die Kaserne ist zurzeit mit 100 Mann belegt, deren Kopfstärke noch erhöht werden soll. Ferner ist Oesterreichs größte Fliegerstation in Pischamend auf eine Kopfstärke von 170 Mann erhöht worden. Hiervon entfallen 100 Mann zur Reparatur der Flugzeuge, während die übrigen 70 Mann zu der Mannschaftspilotenschule kommandiert sind. Verschiedenes. Schutzüberzugmasse für Holz, Metall, etc. Um einen elastischen feuer_ wasser- und säurebeständigen Ueberzugsstoff aus Wasserglas, kohlensaurem Kalk" u. Asbest u. dgl. zu erhalten wird ein Wasserglas verwendet, das einen großen Ueber-schnß an freiem Alkali hat. Zu diesem Wasserglas wird dann eine geeignete Säure oder sauer reagierende Substanz hinzugesetzt, und zwar alles in einer solchen Menge, daß eine breiartige plastische Masse entsteht, die, gegen die Einwirkung der Luft geschützt sich während längerer Zeit plastisch erhält. Nach vielen Versuchen hat sich ergeben, daß für die Zwecke der Erfindung ein Wasserglas von mindestens 6 Prozent freiem Alkali erforderlich ist. Dieses Wasserglas wird in bekannter Weise durch Zusammenschmelzen von Kieselsäure und Alkali oder durch direktes Lösen einer Mischung von Kaliumhydroxyd und Natriumhydroxyd in den gangbaren Polysilikat herstellt. Die besten Ergebnisse werden mit einem Wasserglas erhalten, das die beide Alkalihydroxyde und nicht nur eines derselben enthält. Zu dem so erhaltenen Wasserglas wird eine dazu geeignete Säure, zum Beispiel Schwefelsäure, oder sauer reagierende Stoffe (Verbindungen), zum Beispiel Zinksulfat, Eisensulfat, Aluminiumsulfat usw., hinzugesetzt. Die hydrolisierteSäure wird zunächst durch die Alkalien gesättigt, sodann werden die betreffenden Oxydhydrate gebildet, die teils in der alkalischen Flüssigkeit gelöst, teils in derselben suspendiert vorhanden sein werden. Ein derartiges Wasserglas, mit Asbest, Kreide oder anderen ähnlichen Füllstoffen versetzt, bildet eine plastische Masse, die, unter Luftabschluß aufbe- wahrt, sich während längerer Zeit unverändert plastisch erhalten wird, während dieselbe Masse, der Einwirkung der Luft ausgesetzt, in kurzer Zeit zu einer harten, elastischen, säure-, feuer- und wasserbeständigen Masse erhärtet. Wird dagegen das gewöhnliche Wasserglas (Polysilikat) ohne den vorerwähnten Ueberschuß an Alkali benützt und ihm die gleiche Menge von Säure oder sauer reagierenden Stoffen zugesetzt, so wird man keine plastische Masse erhalten, indem die Säure oder sauer reagierende Stoffe momentan jede Kieselsäure ausscheiden und eine körnige, pulverartige, nicht zusammenhängende Masse bilden wird. Es ist zwar bekannt, ähnliche Massen oder Mörtelgemische mit Säure zu behandeln; teils werden aber diese Zusätze zur Imprägnierung, teils zur Erhärtung und Fixierung des im voraus fertigen Produkts und nicht, wie gemäß der vorliegenden Neuerung, in der Masse selbst und in solcher Weise verwendet, daß die Masse ihre Plastizität behält und sich viele Monate aufbewahren läßt, ohne ihre Eigenart zu verlieren. Die in der vorgenannten Weise mit präpariertem Wasserglas hergestellte Masse kann entweder durch Auflegen in dicken Schichten oder in dünnen UeberzUgen durch Anstreichen mit Pinseln oder dazu geeigneten Apparaten aufgetragen werden. Das Mengeverhältnis der verschiedenen Stoffe kann jedem Verwendungszweck angepaßt werden, indem die erhärtende Masse, dur Einwirkung der Luft ausgesetzt, an sich hart und elastisch wird und daher als ein ganz dünner Ueberzug verwendet werden kann. Die 5. Ausstellung füi Luftfahrt, der sogenannte Pariser-Salon findet in der Zeit vom 5. bis 25. Dezember im Grand-Palais (Champes Elys^es) statt. An dem Aufbau der Ausstellung wird bereits eifrig gearbeitet. Wie verlautet, sollen verschiedene interessante neue Maschinen zur Ausstellung gelangen. Wir werden in der nächsten Nummer noch ausführlich über den Salon berichten. 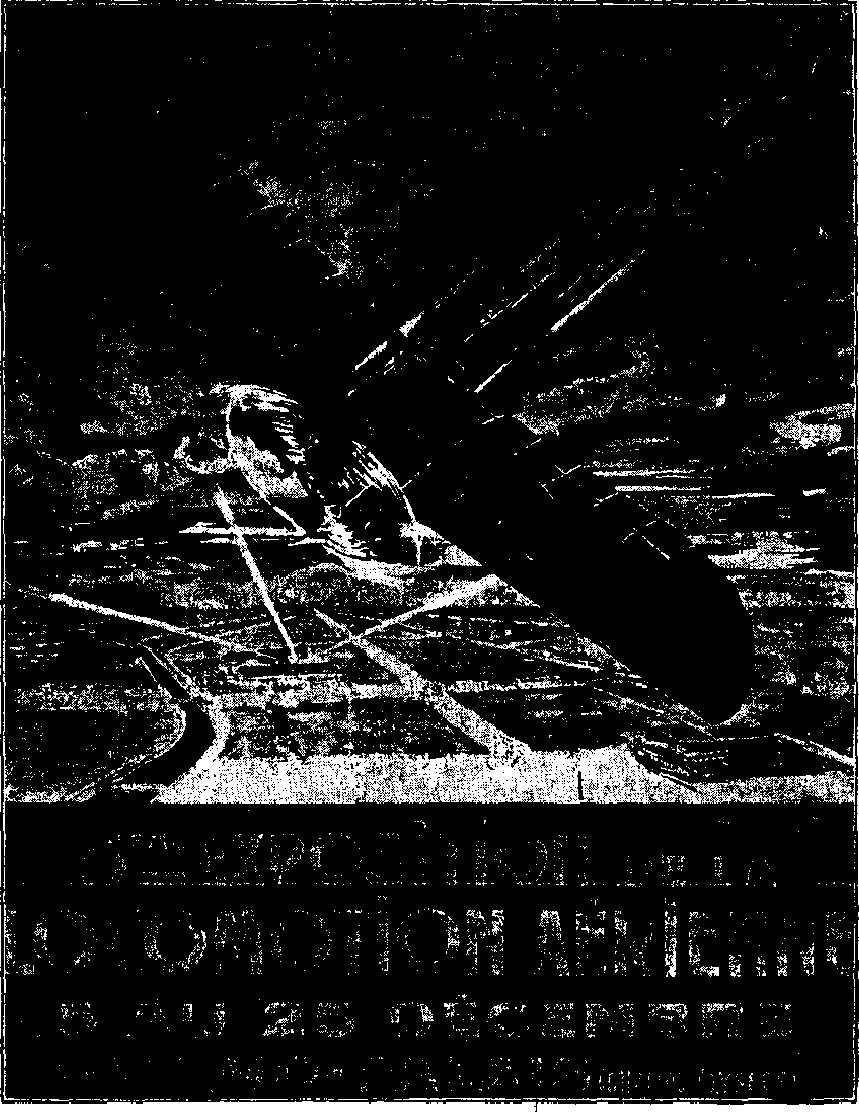 Plakat des diesjährigen Pariser Salon Patentwesen. Flugzeug.*) Es ist bereits vorgeschlagen worden, Tragflächengerüst und Fahrgestell eines Flugzeuges als getrennte Teile auszuführen. Die vorliegende Erfindung betrifft einen nach diesen Gesichtspunkten ausgebildeten Zwei- und Mehrdecker, dessen Fahrgestell zu Zwecken des Transports oder der Verpakung leicht von den Tragflächen getrennt werden kann, ohne daß es selbst oder die Tragflächen demontiert zu werden brauchen, und das später ebenso mühelos wieder fest mit den Tragflächen verbunden werden kann. Dieses wird dadurch erreicht, daß sowohl Anfahrgestell als auch Tragflächen ein in sich geschlossenes Ganzes bilden, derart jedoch, daß das Tragflächengerüst vorn in der Mitte geöffnet ist, so daß das Anfahrgestell hineingeschoben werden kann. Der hintere Teil des Anfahrgestelles legt sich auf die hinteren Hölzer des Tragflächengerüstes auf und wird mit mindestens einer von diesen durch Schrauben verbunden. Vorn ist auf jeder Seite der obere Rand des Anfahrgestells mit durch Schrauben oder Bolzen befestigten, nach oben führenden Metallstangen mit dem oberen Teil des Tragflächengerüstes verbunden; von dem untersten vorderen Holze des Tragflächengerüstes führen ferner zwei durch Schrauben oder Bolzen befestigte Metallstangen auf jeder Seite nach oben und unten zu einer Stange des Anfahrgestells und machen die Verbindung zu einer völlig festen und sicheren. Liegt, z. B. bei Dreideckern, die untere Tragfläche tiefer als der Boden des Anfahrgestells, so ist in letzteres ein in den Ausschnitt der unteren Tragfläche passendes Flächenstück eingebaut, das mit der Tragfläche selbst in bekannter Weise durch Verschnürung verbunden wird, wenn das AnfahrgesteJI an dem Flächengerüst befestigt ist. Will man nun das Anfahrgestell von den Tragflächen trennen, so braucht man nur die Schrauben oder Bolzen zu lösen, vermittels deren der hintere Teil des Anfahrgestells und die oben beschriebenen, die vordere Verbindung herstellenden Metallstangen an dem Tragflächengerüst befestigt sind; gegebenen-fa'ls ist auch die Verschnürung des am Anfahrgestell sitzenden Flächenteiles mit der untersten Tragfläche zu lösen. Das Anfahrgestell kann dann ohne weiteres aus dem Tragflächengerüst nach vorn hinaus geschoben werden. Soll der Apparat wieder montiert werden, so wird das Anfahrgestell von vorn in das Flächengerüst hineingeschoben, und die oben bezeichneten Schrauben oder Bolzen werden befestigt. Die Zeichnung zeigt eine Ausführungsform der Erfindung für Dreidecker. Abb. 1 ist die Ansicht der Anordnung in Höhe der untersten Tragfläche, und zwar von oben gesehen; b sind die vorderen Hölzer dieser Tragflächen, u ist das hintere Holz, auf dem v, der hintere Teil des Anfahrgestells a, aufliegt, d ist das in das Anfahrgestell eingebaute Flächenstück, e die Verschnürung zwischen diesem Stück und der Tragfläche, c sind die nach den Rädern führenden vorderen Streben des Anfahrgestells. f ist die diese Streben mit den unteren Hölzern des' Flächengerüstes verbindende Metallstange. Abb. 2 zeigt die Anordnung von vorn gesehen. Die Buchstaben haben die gleiche Bedeutung wie in Abb. 1. g sind die von den unteren Hölzern des Flächengerüstes nach oben zu dem Anfahrgestell führenden Metallstangen, h die vorderen Hölzer der mittleren Tragfläche, i die den oberen Teil des Anfahrgestells mit dem Flächengerüst verbindenden Metallstangen. Abb. 3 zeigt die Verbindung der Metallstangen f, g, h, i mit dem Flächengerüst in vergrößertem Maßstab k ist die Schraube, mit der i an dem Holz h des Flächengerüstes, 1 die Schraube, mit der die Stangen f und g an dem Holz b des Flächengerüstes befestigt sind. Wird nun die Verbindung des hinteren Teiles des Anfahrgestells mit dem hinteren Flächenholz u bei v gelöst, werden die Schrauben k und 1 herausgenommen und wird die Verschnürung e aufgemacht, so kann das Anfahrgestell a aus dem Flächengerüst b, h hinausgeschoben werden. Umgekehrt kann der Apparat ebenso leicht montiert werden. Patent-Ansprüche. 1. Flugzeug, dessen Tragflächengerüst einerseits und Rumpfgerüst sowie Fahrgestell andererseits in sich geschlossene und voneinander unabhängige Teile *) D. R. P. Nr. 267 072. August Euler in Frankfurt a. M.-Niederrad. bilden, dadurch gekennzeichnet, daß das nach vorn ausladende Fahrgestell von vorn in das Tragflächengerüst eines Doppel- oder Mehrdeckers hineingeschoben wird, von dessen vier Hauptholmen nur der vordere untere in der Mitte zerteilt und auf die Breite des Fahrgestells ausgeschnitten ist, während die übrigen Holme als durchgehende Stangen ausgebildet sind und auf dem Fahrgestell aufliegen. Abb. 1 I 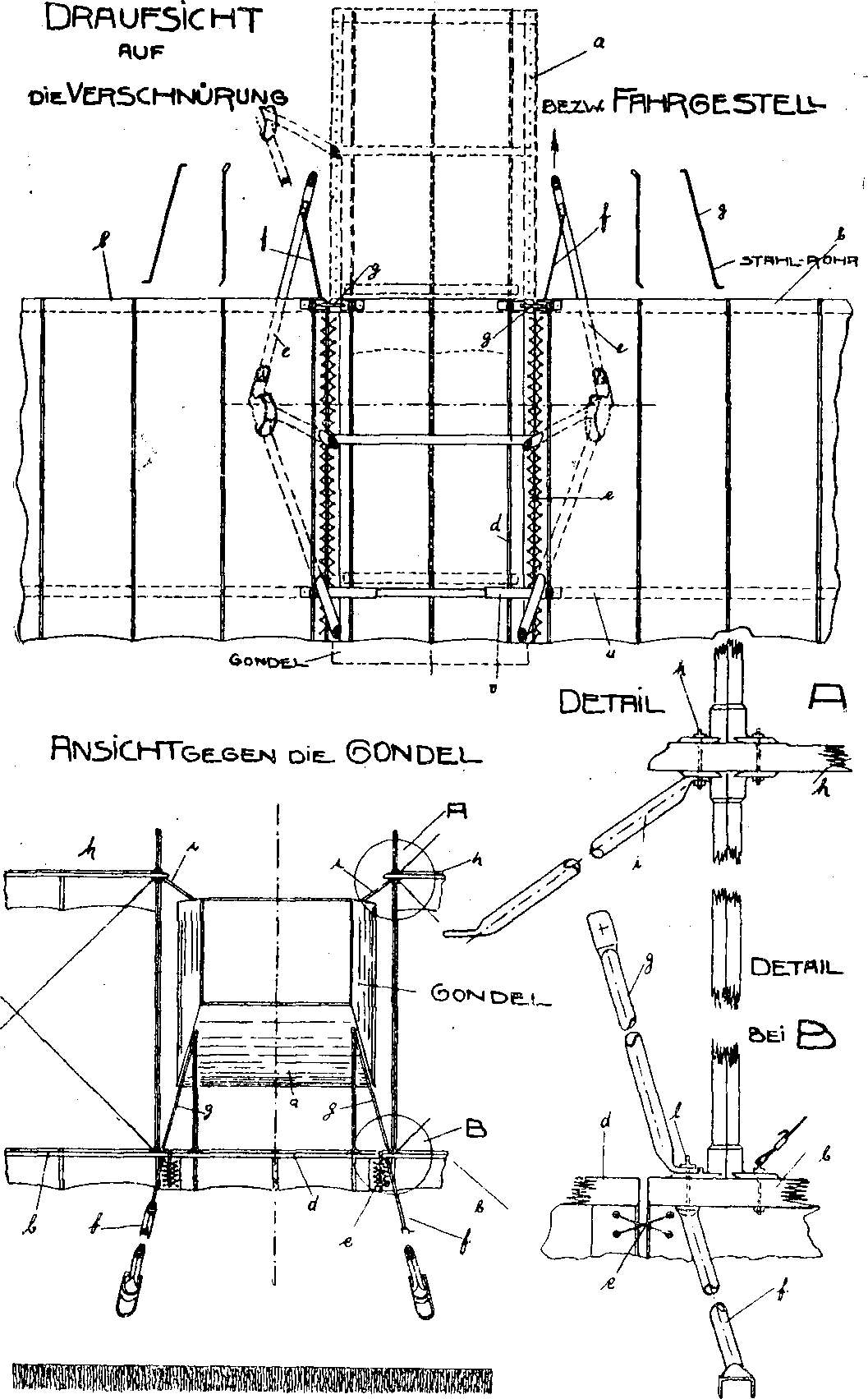 Abb. 2 2. Ausführungsform des Flugzeugs nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in das Anfahrgesteil ein dem Ausschnitt den unteren Tragflächen entsprechendes Flächenstück eingesetzt ist, das nach Befestigung des Anfahr-gestells am Flächengerüst mit der unteren Tragfläche in bekannter Weise verschnürt wird. Spannschloß für Luftfahrzeuge*) Die Erfindung betrifft ein Spannschloß für Halteseile, die nach Bedarf zn lösen und wieder zu befestigen sind, es ist insbesondere zur Anwendung für Haltedrähte oder sonstige Spannverbindungen von Luftfahrzeugen bestimmt. Die Erfindung bezweckt, das Lösen und Wiederschließen der Spannverbindungen zu erleichtern, so daß diese Verrichtungen schneller als bisher vorgenommen werden können; insbesondere soll sie die Wiederbefestigung ermöglichen, ohne daß es erforderlich ist, die Spannung der Seile, Drähte usw. von neuem zu regeln, ein Umstand, der für die Spannverbindungen von Luftfährzeugen von großer Bedeutung ist Es sind bereits karabinerhakenartige Befestigungsschlösser für Seile, Ketten usw. mit einem umlegbaren Haken, der durch einen übergeschobenen Ring oder dergleichen geschlossen gehalten wird, bekannt. Ferner ist vorgeschlagen worden, bei derartig ausgebildeten Kettenschlössern das freie Ende des umlegbaren Hakens in eine Nut des mit Gewinde versehenen festen Gliedes des Schlosses zu legen und durch eine Ueberwurf-mutter zu halten. Gemäß der Erfindung finden diese bekannten Vorrichtungen bei der Befestigung der Halteseile bei Flugzeugen neben der gebräuchlichen Vorrichtung zur Regelung der Spannung jedes Seiles oder dergleichen Verwendung, und zwar richtet sich die Erfindung ai*f eine besondere Form dieses Hakens und der zum Schließen dienenden Verschraubung. Der Erfindungsgegenstand ist auf beiliegender Zeichnung veranschaulicht und zwar zeigt: Abb. 1 in Ansicht die Vorrichtung zur Regelung der Spannung, sowie das zu derselben hinzugefügte Spannschloß bei geschlossener Verbindung. Abb. 2 die gleichen Teile bei gelöster Verbindung. Abb. 3 in größerem Masstabe einen Querschnitt nach 3—3 durch den zum Spannschloß gehörigen Haken. Die Spannverbindung besteht aus einem Draht a, welcher zur Regelung seiner Spannung mit einer oder mehreren der bei b veranschaulichten Vorrichtungen versehen ist; diese ist bezw. sind an geeigneter Stelle des zu diesem Zweck unterteilten Drahtes a eingeschaltet. Der eine Teil dieses Drahtes greift an einer Oese, einem Ring oder dergleichen c an und ist mit dem anderen Teil a1 durch ein als Hakenhebel ausgebildetes Glied d verbunden. Dieses Glied wird gemäß der Erfindung "so ausgebildet, wie in der Zeichnung veranschaulicht ist. Das Glied d erhält dabei die in der Zeichnung dargestellte oder eine ähnlich gekrümmte Form, welche ermöglicht, daß sein freies zweckmäßig geradlinig gestaltetes Ende beim Umklappen in die Gebrauchslage neben dem Draht a zu liegen kommt. Um die Befestigung des freien Endes des Gliedes d bewirken zu können, ist dasselbe mit einer Nut d1 derart versehen, daß der Spanndraht a auf eine gewisse Länge in diese eingelegt werden kann. In das freie Ende ist weiterhin ein Gewinde eingeschnitten, auf welche sich eine über den Draht a gestreifte Schraubenmutter e, zweckmäßig eine Flügelschraube, aufdrehen läßt. Wenn man eine mit einem derartigen Spannschloß versehene Verbindung, deren Spannung in der erforderlichen Weise geregelt ist, lösen will, so hat man nur nötig, die Schraube e von dem freien Ende des Hakens d abzuschrauben, daß der letztere niedergeklappt werden kann, worauf man denselben aus der Oese des Hakens c herausziehen kann. Beim Schließen des Spannschlosses ist umgekehrt der Haken zunächst in die letztere Oese hineinzuschieben und in die Höhe zu klappen, wobei die eigentümliche Form der Krümmung und die Gestalt des freien Endes des Hakens ermöglicht unter Ausübung einer kräftigen Hebelwirkung den durch die Spannung des Drahtes verursachten Widerstand zu überwinden. Wenn die Nut dl von etwas geringerer Tiefe ist, als der Durchmesser oder die Dicke des Spanndrahtes beträgt, so ist zur vollständigen Befestigung der Schraube e eine besondere Schraubensicherung nicht nötig, weil diese durch ,) D. R P. No. 266645 Jose Luis Sanchez-Besa in Paris. den Spanndraht selbst gebildet wird, welcher beim Aufschrauben bezw. nach dem Aufschrauben der Mutter e eine gewisse Klemmwirkung ausübt. Patent-Anspruch. Spannschloß für Luftfahrzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß außer der üblichen zur Spannungsregelung dienenden Schraubhülse (b) oder dergleichen lediglich ein an sich bekannter als Spannhebel benutzbarer Verschlußhaken (d) angeordnet ist, welcher am Ende des zu verspannenden Zugorgans (a) eingehängt Abb. 1 Abb. 2 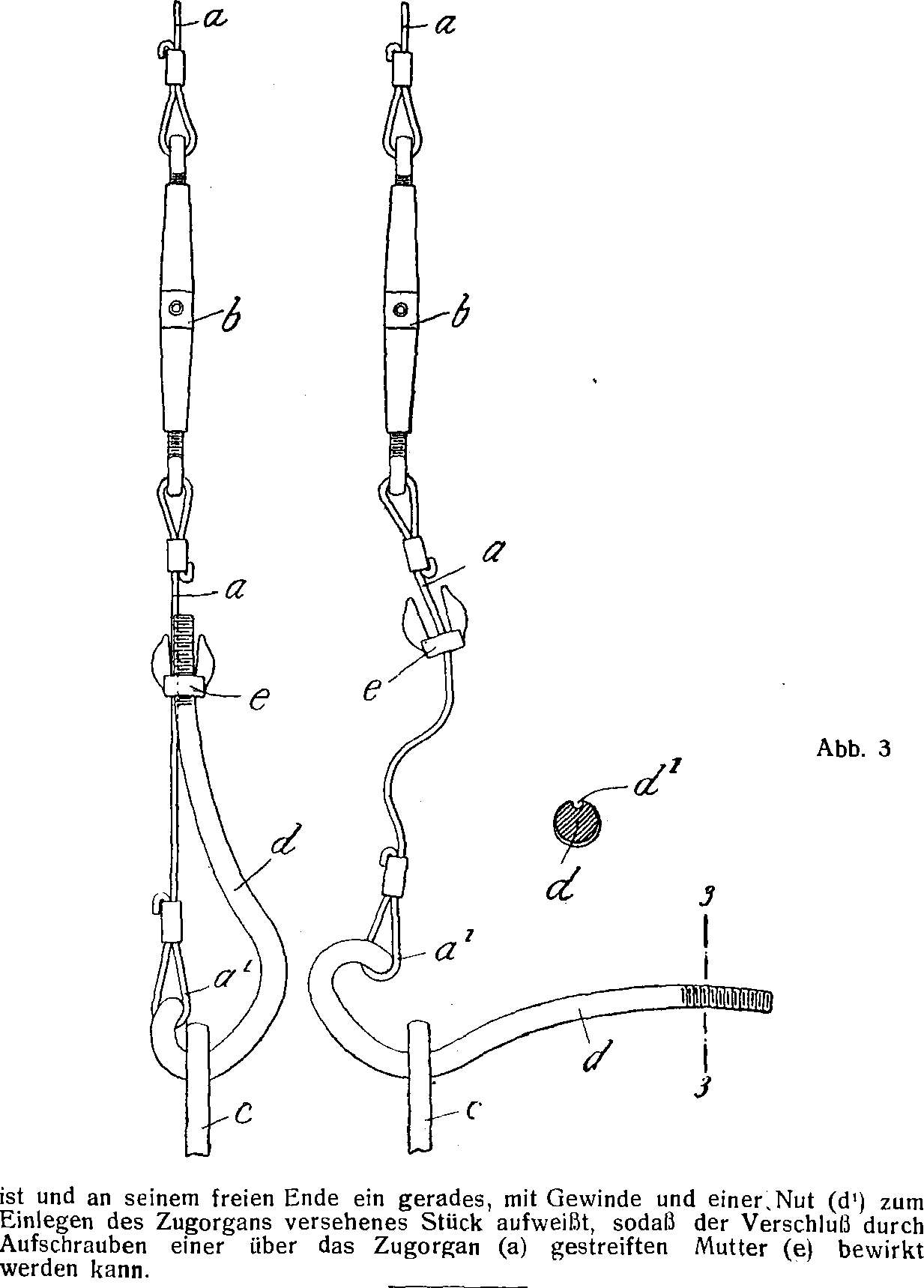 Flugzeug.*) Um bei Flugzeugen die Längs- und Querstabilität zu erhalten oder wiederherzustellen, ist es allgemein notwendig, mechanische Vorrichtungen zu bedienen. Mit Hilfe dieser Vorrichtungen ist es jedoch nicht immer möglich, allen äußeren, das Gleichgewicht störenden Einwirkungen in der gewünschten Weise zu begegnen, namentlich dann nicht, wenn Böen auftreten, denen gegenüber die mechanischen Vorrichtungen zu träge sind. Zweck der Erfindung ist, ein Flugzeug zu schaffen, daß in sich, d. h. zufolge seiner Bauart, stabil ist und zufolge dieser Eigenschaft das Bestreben hat, von selbst die Gleichgewichtslage aufrecht zu erhalten, oder sofort in sie zurückzukehren. Nach den Erfahrungen und Versuchen des Erfinders (bei der noch bestehenden Unsicherheit der Gesetze über das Verhalten in der Luft bewegter Körper ist man auf solche hauptsächlich angewiesen) besitzt ein Flugzeug dann die erwähnte Eigenschaft, wenn es gleichzeitig drei Merkmale aufweist, 1. eine V-Stellung der Tragflächen nach oben, 2. eine V-Stellung der Tragflächen nach hinten und 3. Lage des Schwerpunktes Uber dem Auftriebsdruckmittelpunkt. Der Beweis hierfür läßt sich indirekt führen. Es läßt sich nämlich mit einer Zuverlässigkeit nachweisen, daß ein Flugzeug beim Fehlen eines dieser Merkmale die Eigenschaft eigener Stabilität nicht besitzt. Besitzt ein Apparat nur das Erste der genannten Konstruktionsmerkmale, nämlich bei tiefliegenden Schwerpunkt, V-Stellung der Tragflächen nach oben, so könnte diese höchstens insoweit günstig auf die Stabilität des Flugzeuges einwirken, als dieses sich senkrecht abwärts bewegt oder sinkt, Die V-Stellung der Tragflächen nach hinten allein bei tiefliegendem Schwerpunkt sollte einen hohen Grad von Stabilität erwarten lassen, da bei einer Böe die getroffene Tragfläche eine Bremsung erfährt und dadurch das Flugzeug die zum Ausgleich der Böe erforderliche Kurve von selbst einschlägt. Damit indessen der Apparat aus dieser Kurve wieder von selbst in Gleichgewicht und Richtung komme, sind die beiden weiteren, oben angegebenen Konstruktionen erforderlich. Der hochliegende Schwerpunkt für sich allein würde die Stabilität nur stören, weil er besonders in Kurven und im Gleitfluge beständig ein Kippmoment hervorbrächte. Bei einem Flugzeug, welches bei tiefliegendem Schwerpunkt V-Stellung der Tragflächen nach oben und hinten besitzt, wird in der Kurve durch die Zentrifugalwirkung des mehr oder minder tiefliegenden Schwerpunktes die Stabilität vernichtet oder stark herabgesetzt. Beim üeradeausfliegen konnte ein derartiges Flugzeug immerhin einige Stabilität zeigen, somit es nämlich aus der einer Böe entgegenwirkenden Kurve trotz des tiefliegenden Schwerpunktes wieder in Gleichgewicht und Richtung zu kommen vermag. Ein Flugzeug, welches die V-Stellung der Tragflächen nach oben und hochliegenden Schwerpunkt aufweist, dem aber die V-Stellung nach rückwärts fehlt, würde nicht von selbst aus der von einer Böe verursachten Schrägstellung in die normale Lage zurückkehren, weil- es sich nicht im Windstoße drehen und dadurch die gesenkte Tragfläche aufrichten könnte. Gibt man endlich einem Flugzeug die V-Stellung der Tragflächen nach hinten und den hochliegenden Schwerpunkt, aber nicht auch V-Stellung der Tragflächen nach oben, so ist ein seitliches Abrutschen und ein Durchdrehen des Flugzeuges in der Kurve und mithin auch bei einer Böe unvermeidlich. Dagegen haben Versuche einwandfrei ergeben, daß bei gleichzeitiger Anwendung der genannten drei Merkmale eine vollkommene Stabilität des Flugzeuges sowohl in der Kurve wie Böen gegenüber erzielt wird. Gerät ein gemäß der Erfindung gebautes Flugzeug durch einen Windstoß in eine Schräglage, so erfährt die getroffene gehobene Tragfläche eine Bremsung; dadurch kommt das Flugzeug in seitliche Schieben und richtet sich infolge der V-Stellung der Tragflächen nach hinten wieder auf. Die V-Stellung der Tragflächen nach oben und der hochliegende Schwerpunkt spielen hier dieselbe Rolle, wie bei einer Kurve, *) D. R. P. Nr. 265515. Anthony Hermann Gerard Fokker in Johannisthal bei Berlin. insofern auch ein seitliches Abrutschen verhütet wird, und die Zentrifugalbeschleunigung erst nach Vollendung der Kurve wieder eine richtende Kraft ausübt. Die Zeichnung zeigt den Gegenstand der Erfindung in schematischer Weise an einem Ausführungsbeispiel, und zwar in Abb. 1 von vorn und in Abb. 2 von oben. Aus der Abb. 1 ergibt sich die V-Stellung der Tragflächen a und b nach oben. Die aus dieser Abbildung ersichtliche Verstrebung und Versteifung des Gestelles bildet keinen Teil der Erfindung. Das Merkmal der V-Stellung der Tragflächen nach hinten zeigt Abb. 2. Die auftreibenden Kräfte greifen mit ihrer Resultierenden in der V-förmig gebrochenen Linie c-d an. Denkt man sich die angreifenden Kräfte für jede Tragfläche in einem Punkt vereinigt, so ergeben Abb. 1 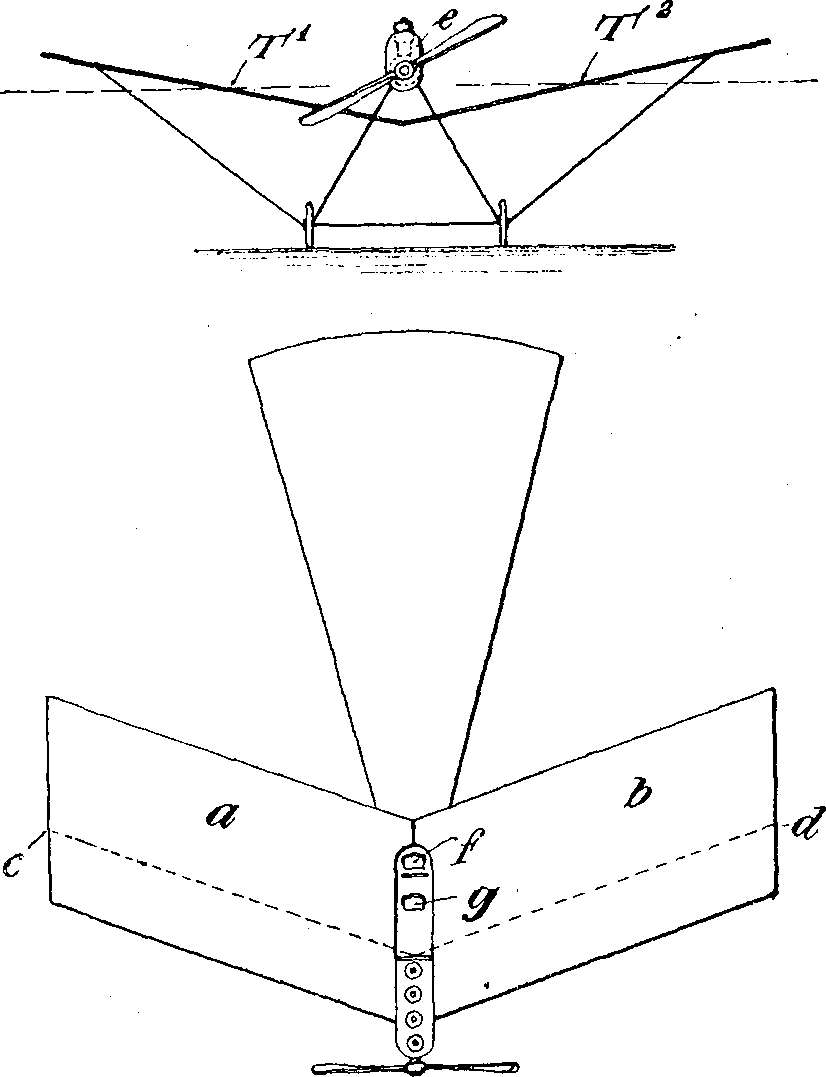 Abb. 2 sich die Auftriebsdruckmittelpunkte T1 und T2 deren Verbindungslinie in Abb. 1 eingetragen ist Wie aus dieser Abb. ersichtlich, liegt der Schwerpunkt (der Motor e) dem oben unter 3 genannten Merkmale entsprechend oberhalb dieser Linie. Flieger und Fahrgast befinden sich in gleicher Höhe auf den hinter dem Motor befindlichan Sitzen f und g. Die Erfindung ist nicht auf eine bestimmte Gestalt der Tragfläche beschränkt. Notwendig ist nur, daß die Druckmittelpunktlinien selbst V-förmig verlaufen Patent-Anspruch: Flugzeug, dadurch gekennzeichnet, daß die von der Längsachse ausgehenden Auftriebspunktlinien aufwärts und rückwärts verlaufen und der Schwerpunkt annähernd in dem bezw. über den geometrischen Schwerpunkt der Flügel liegt. Flugzeug mit einem vorderen, gemeinsam mit dem Schwanzteil zu verstellenden Propeller.*) Gegenstand der Erfindung ist ein Flugzeug, welches infolge eigenartiger Gliederung und Bewegung der Glieder leichte und rasche Anpassung des Auftriebes an die mitgeführte Last, der Fluggeschwindigkeit an die örtlichen Verhältnisse, z. B. beim Landen usw., in bisher nichtmöglicher Weise erlaubt. Zum leichteren Verständnis mögen folgende Erläuterungen vorausgeschickt werden- Eine Flugmaschine kann im allgemeinen nur für eine gewisse bestimmte Last vorteilhaft bemessen oder eingestellt sein, denn durch die Einstellung der Tragfläche gegenüber dem Propeller einerseits und den Stabilisierungsflächen anderseits ist die mitzuführende Last und zugleich die Fluggeschwindigkeit bestimmt. Man ist wohl in der Lage, sogar ein vielfaches der normalen Last zeitweise mitzuführen wenn man bei einem gewöhnlichen Flugfahrzeug das Höhensteuer entsprechend verstellt. Allein der Führer hat dann dauernd einen verhältnismäßig hohen Druck am Höhensteuer zu Uberwinden, wodurch die Steuerung wesentlich erschwert ist. Es ist daher schon vorgeschlagen worden, die Tragflächen gegenüber dem Flugzeuggestell zu verstellen. Eine solche Verstellung ist jedoch praktisch sehr schwierig auszuführen, was leicht einzusehen ist, wenn man bedenkt, an wie vielen Stellen und durch wie viele Teile jene ausgedehnten Flächen mit dem Gestell verbunden sein müssen. Jede Einrichtung zur Veränderung der Lage jener Flächen gegenüber dem Gestell würde übrigens die Betriebssicherheit bedeutend herabsetzen. Gemäß der Erfindung ist nun €ine leichte Anpassung der Flugmaschine an die verschiedensten Bedingungen, auch während des Fluges selbst, dadurch ermöglicht, daß die Tragflächen mit dem eigentlichen Flugzeugkörper ein für allemal in der richtigen Lage verbunden bleiben, jedoch der mit den Stabilisierungsflächen ausgestattete Teil einerseits und der die Propellerwellenlager und zweckmäßig auch den Motor selbsttragende Teil anderseits gemeinsam derart gegenüber dem eigentlichen Flugzeugkörper verstellbar gemacht sind, daß diese beiden Teile bei der Verstellung annähernd parallel bleiben. Da die Stabilisierungsflächen sich stets in die Flugrichtung (also im wesentlichen horinzontal) einstellen, so ergibt sich als Wirkung der Verstellung, daß die Tragflächen sich mehr oder weniger gegenüber der Fahrtrichtung (bezw. der Horizontalen) aufrichten, und dies wird erreicht, ohne daß die Tragflächen an dem sie tragenden Teil (welcher zweckmäßig auch den Führer- und Passagiersitz usw. aufnimmt), verstellbar angebracht sein müssen. Wichtig ist nun, daß trotz der Verstellung der Stabilisierungsflächen der Propeller nicht in4 einer anderen Richtung wirkt als in der durch jene Flächen vorgeschriebenen Fahrtrichtung, denn nur so kann die beste Leistung aus Propeller und Motor herausgeholt werden. Dies ist sowohl für den Dauerflug mit großer Last sehr bedeutungsvoll als auch für den Aufstieg bei beschränktem Anlaufplatz. Aus diesem Grunde werden gemäß der Erfindung nicht nur die Stabilisierungsflächen verstellt, sondern stets auch die Propellerwelle (am besten zusammen mit dem Motor) so nachgestellt, daß sie im wesentlichen parallel den Stabilisierungsflächen bleibt. Das läßt sich in einfacher Weise bei entsprechend gegliedertem Flugzeug durch eine entsprechend kinematische Verbindung der beiden zu verstellenden Teile erreichen. Ein Ausführungsbeispiel ist in der beiliegenden Zeichnung dargestellt. Mit a ist der eigentliche Körper der Flugmaschine bezeichnet. An ihm sind die Tragflächen b mit den erforderlichen Verspannungen, das Fahrgestell mit Rädern c und Kufen d befestigt und der Führer- bezw. auch der Passagiersitz angeordnet Ferner ist an ihm mittels eines geeigneten Gelenkes e mit Motor f mit Zubehör angelenkt, derart, daß der Motor zusammen mit seiner den Propeller g tragenden Welle h um das Gelenk e gegen die Horinzontale gehoben oder gesenkt werden kann. Ein ähnliches Gelenk befindet sich bei i zwischen dem Hauptteil a und dem hinteren Teil k des Gestelles Vom Motor aus gehen Züge 1 und m zweckmäßig über Rollen o. dgl. n auf den Verspannungsstützen o für die Tragfläche b zu dem hinteren Gestellteil k, *) D. R. P. Nr. 266327 Hellmuth Hirth in Johannisthal. welche derart wirken, daß sie letztere heben, wenn der Motor und Propeller gesenkt wird und umgekehrt. Im einzelnen kann die Ausführung der Flugmaschinen in verschiedener Richtung abgeändert werden. Wesentlich für die Erfindung ist die neue und eigenartige Gliederung der Flugmaschine, welche ihr eine bisher unerreichte Anpassungsfähigkeit gibt Soll z. B. eine größere Last als normal befördert werden, so kann die Maschine in einfacher Weise dazu befähigt werden, wenn der Motor und Propeller gesenkt und das hintere Gestellteil gehoben wird. Dann stellen sich die Stabilisierungsflächen im wesentlichen horinzontal ein, und die Propellerachse bleibt, wie es am vorteilhaftesten ist, den Stabilisierungsflächen parallel, während der eigentliche Körper der Flugmaschine mit den Tragflächen sich nach vorn aufrichtet und einen größeren Auftrieb erzeugt Die gleiche Einstellung mit gleicher Wirkung gestattet beim Aufstieg einen sehr kurzen Anlauf bei voller Ausnutzung des Motors. 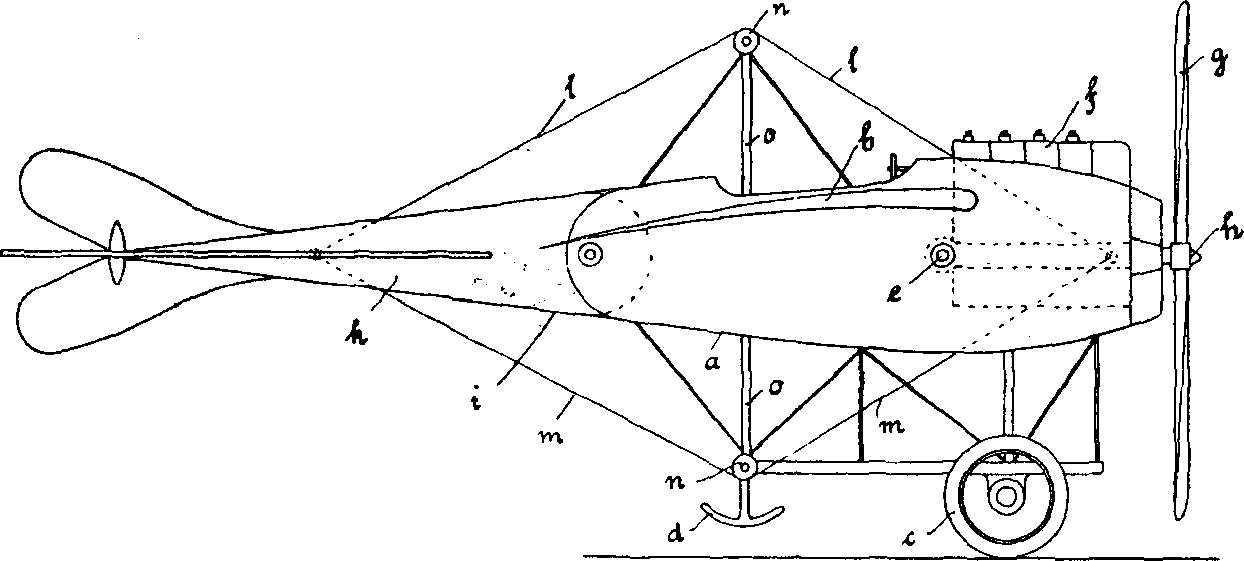 Umgekehrt kann durch Anwendung der Erfindung der Auslaufweg beim Landen stark vermindert werden, indem durch die vorhin genannte Einstellung der Flugmaschine die Tragflächen schräg gestellt werden und die Leistung des Motors soweit herabreguliert wird, das gleichwohl die Flugmaschine sich langsam senkt Dadurch wird bei noch arbeitendem Motor die Fluggeschwindigkeit bedeutend herabgesetzt, während bisher die Geschwindigkeit praktisch unveränderlich war. Patent-Ansprüche: 1. Flugzeug mit einem vorderen, gemeinsam mit dem Schwanzteil zu verstellenden Propeller, dadurch gekennzeichnet, daß die Propellerachse und der Schwanzteil bei der Verstellung annähernd parallel bleiben. 2. Flugzeug nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Verstellung durch einen Seilzug o. dgl. erfolgt, der in an sich bekannter Weise über die Verspannungsstützen des Tragdeckes geführt ist. Propellerflügel*) Bisher kommen bei Flugzeugen hauptsächlich zweiflügelige Holzpropeller ohne Flügelverstellung in Anwendung. Diese Propeller haben verschiedene bekannte Mängel. Der Zweck der vorliegenden Erfindung ist, einen Propeller beziehungsweise Propellerflügel aus Blech einfach und billig herzustellen, welcher insbesondere auch die bekannte vorteilhafte Höhlung auf der Druckseite aufweist und weiterhin die leichte Anbringung einer Versteilvorrichtung ermöglicht. Es kommen zu diesem Zweck auch bekannte Herstellungsverfahren und Vorrichtungen in Anwendung, so das Uebereinanderlegen von einzelnen Blechen zur Verstärkung der Flügel nach der Nabe zu. Ferner, da die Flügel zwecks genauer Einstellung und Aenderung verstellbar sein sollen, wird in bekannter Weise der Flügel so f) D. R. P. Nr. 265024. Adolf König in Charlottenburg. angeordnet, daß seine Längsachse einen Winkel mit der tangential liegenden Gelenkachse bildet. Der Propeller ist in den Abbildungen 1 bis 3 dargestellt, seine Herstellung geschieht folgendermaßen: Aus einem annähernd nach einem Zylindermantel gebogenen Blech (Abb. 4) werden die nach Berechnung aufgezeichneten Stücke a, b, c oder auch mehr Abb. 2 Abb. 3 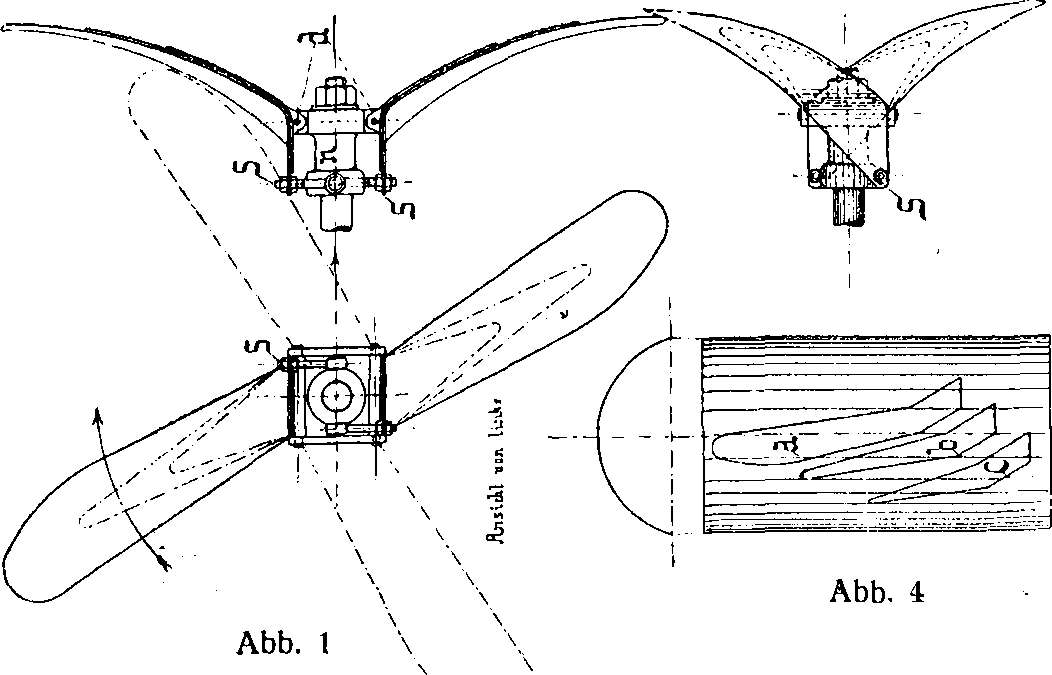 i Stücke herausgearbeitet, aufeinandergelegt und durch Kantenschweißung, Lötung oder Nietung verbunden. Da die Stücke demselben Walzblech entnommen sind, passen sie genau aufeinander und bilden einen kräftigen, nach der Nabe zu auf der Rückseite verstärkten Flügel, der auf der Vorderseite, d. h. der Druckseite, eine glatte, im Querschnitt konkave und schraubenförmige Fläche hat Der Flügel erhält außerdem die aus Abb. 2 ersichtlich günstige, nach der Saugseite vorgebogene rückwärts geschwungene Form. (Die Abbildungen stellen die Flügel verkürzt dar, weil sonst die Nabenkonstruktion nicht genügend deutlich ersichtlich wäre.) Der Flügel ist, wie aus Abb. 4 ersichtlich, aus dem Mantelblech so ausgeschnitten, daß die Mantellinien einen Winkel mit der Flügellängsachse bilden, wodurch die gewünschte Steigung erreicht wird. Die Abb. 5 stellt einen Flügel in Ansicht mit darunter gezeichneter Projektion in Richtung der Mantellinien dar. Diese Projektion ergibt den kreisförmigen Querschnitt einer Zylinderfläche. Darunter sind die nach einem Kreisbogen geschnittenen Querschnitte O. 1. II. III. IV. mit ihren Projektionslinien gezeichnet. Der nach vorstehender Beschreibung hergestellte Flügel eignet sich noch besonders zur Verwendung der in Abb 1 bis 3 dargestellten Stellvorrichtung. Die Flügel werden in bekannter Weise, wie Abb. 1 zeigt, parallel zu einem Radius, d. h. winklig an der tangential zur Nabe liegenden Gelenkachse befestigt. Der Winkel a (Abb. 5), welchen die Flügellängs-Abb. 5 achse mit der tangential liegenden Gelenk- 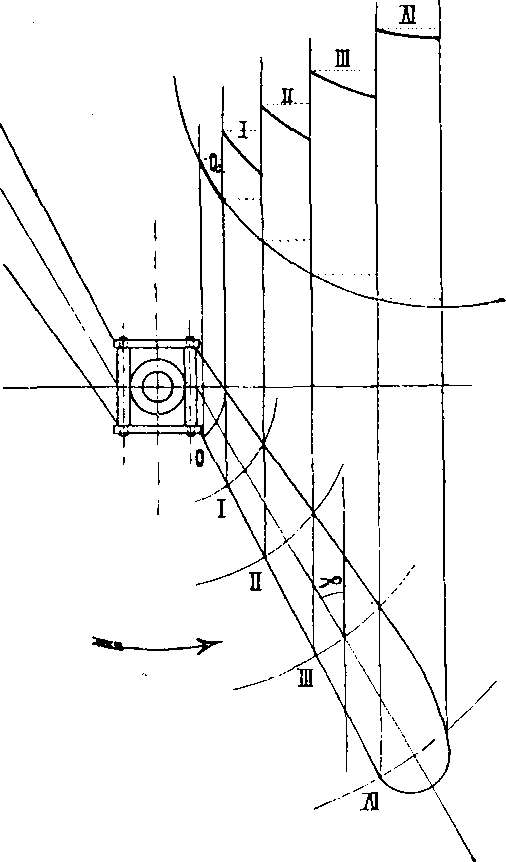 achse bildet, soll im Sinne der Propellerumdrehung gemessen spitz sein, damit der Flügel die gewünschte Form und Höhlung auf der Druckseite bekommt. Wenn man den so angeordneten Flügel nach vorn oder rückwärts neigt, so wird dadurch die Steigung vergröße t beziehungsweise verringert Um diese Neigung praktisch zu erreichen, erfolgt die Flügelbefestigung und Verstellung folgendermaßen: Das an der Nabe n liegende zugespitzte Ende der Flügel wird so weit umgebogen daß es parallel der Nebenachse zu liegen kommt. Dieses Ende bildet ein Dreieck (s Abb. 3) dessen Spitze bei s vermittels einer Stellschraube an dem einen Nabenende befestigt ist. Mit der, dieser Spitze gegenüberliegenden Seite des Dreiecks wird der Flügel an der andere Seite der Nabe bei d drehbar befestigt, wie aus den Abb. 1 bis 3 ersichtlich ist. Dabei kommt ^die Flügelmittellinie in bekannter Weise in tangentiale Lage zur Nabe. Durch die Schraube s können die Flügel verstellt bezw. genau eingestellt werden. Die Flügel lassen sich bei dieser Konstruktion sehr leicht von der Nabe lösen und durch neue ersetzen. Patent-Ansprüche: 1. Propellerflügel, dadurch gekennzeichnet, daß er aus dem Ausschnitt einer Zylindermantelfläche besteht, deren Mantellinien einen Winkel mit der Flügellängsächse bilden. 2. Propellerflügel nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß der Winkel, welchen die Mantellinien mit der Flügellängsachse bilden, im Sinne der Propellerumdrehung gemessen spitz ist, um dem Flügel die gewünschte Höhlung nach der Druckseite und Wölbung nach der Saugseite zu geben. 3. Propellerflügel nach Anspruch 1 und 2 mit gelenkiger Befestigung des Flügels in der Weise, daß die Flügellängsachse einen Winkel mit der tangential liegenden Gelenkachse bildet, dadurch gekennzeichnet, daß der Flügel annähernd in einer Mantellinie, welche die Gelenkachse enthält, umgebogen ist und mit einer Stellschraube an der Nabe befestigt wird. Schwimmer für Wasserflugzeuge mit Wassertragflächen.*) Bekannt ist die Verwendung von Wassertrag'rlächen an Schwimmern von Wasserflugzeugen, wobei diese Flächen entweder starr oder aus elastischem Material sind. Neu ist die Verwendung solcher Wassertragflächen, die weder starr noch aus elastischem Material sind, sondern vollkommen weich, und nur mit Hilfe einer besonderen federnden Spannvorrichtung gezwungen werden, stets zu einer bestimmten Form und in eine bestimmte Lage zurückzukehreu. Solche Flächen haben den Vorzug, daß sie sich in weit größerem Maße als bisher bekannte Ausführungen den stets wechselnden Druckverhältnissen unterhalb des Schwimmers in elastischer Weise anpassen, und sind daher geeignet, den Anlauf wesentlich zu verkürzen und beim Niedergehen auf das Wasser zu verringern. Ein Ausführungsbeispiel dieser Erfindung ist schematisch in Abb. 1 in der Seitenansicht und in Abb. 2 im Schnitt gezeigt, wobei a ein Schwimmer ist, dessen bei b beginnende Stufe c eine Stofffläche ist. Diese Stofffläche ist rechts und links an den unveränderlichen Scharnierhebeln d und an den federn ausziehbaren Hebeln e befestigt, so daß die Dreiecke d e f sich entsprechend den Druckverhältnissen unter dem Schwimmer elastisch deformieren können. Je größer der Druck auf die Wassertragfläche beim Anfahren wird, um so mehr spannt sich die Fläche c flach und kommt in die Lage c1; beginnt nun das Flugzeug sich vom Wasser abzuheben, so saugt sich letzteres stets mehr odei weniger an den untersten Wassertragflächen fest; im gegebenen Falle kann sich aber die Wasser-tragfläche diesen Verhältnissen sehr weit anpassen, indem sie schließlich die Form c* annimmt, bei welcher das Wasser sich am leichtesten von ihr löst. Ein anderes Ausfiihrungsbeispiel zeigt Abb. 3 schematisch im Querschnitt, wobei g der Schwimmer ist, der an Seilen h und gelenkigen Streben i die weiche Wassertragfläche k trägt; oberhalb des Schwimmers g ist in die Seilleitung Ii ein Gummizug 1 eingeschaltet der stets bestrebt ist, die Fläche k geradezuspannen; wird k zufolge wechselnder Druckverhältnisse unterhalb des Schwimmers zu verschiedenen Formänderungen gezwungen, so bewirkt der Gummi- *) D. R. P. Nr. 267 071. Anthony H. G. Fokker, in Johannisthal b. Berlin. zug I in elastischer Weise stets eine Wiederkehr von k in die Normallage, nämlich zu einer ebenen Form (im Schnitt zu einer geraden) Es können natürlich auch mehrere derartiger Wassertragflächen an einem Schwimmer befestigt werden. Abb. 1 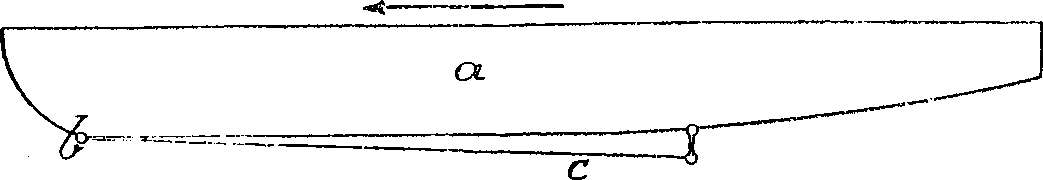 Abb. 2 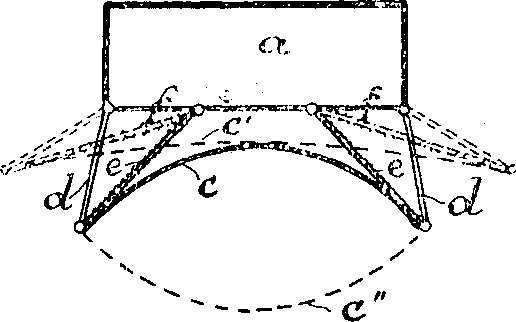 Abb. 3 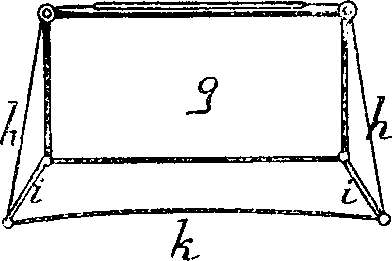 Patent-Anspruch. Schwimmer für Wasserflugzeuge mit Wassertragflächen, dadurch gekennzeichnet, daß letztere aus unstarrem, nicht elastischem Material hergestellt und an federndem Spannvorrichtungen befestigt sind.  Das Handstartmodell Cruver eignet sich infolge seiner Einfachheit ganz besonders für Anfänger im Modellbau. Als Längsversteifung dienen zwei Hikoryleisten von 5X1mm Stärke, die als Schwanzflächengerüst ausgebildet sind. Zum Schutze des Propellers ist 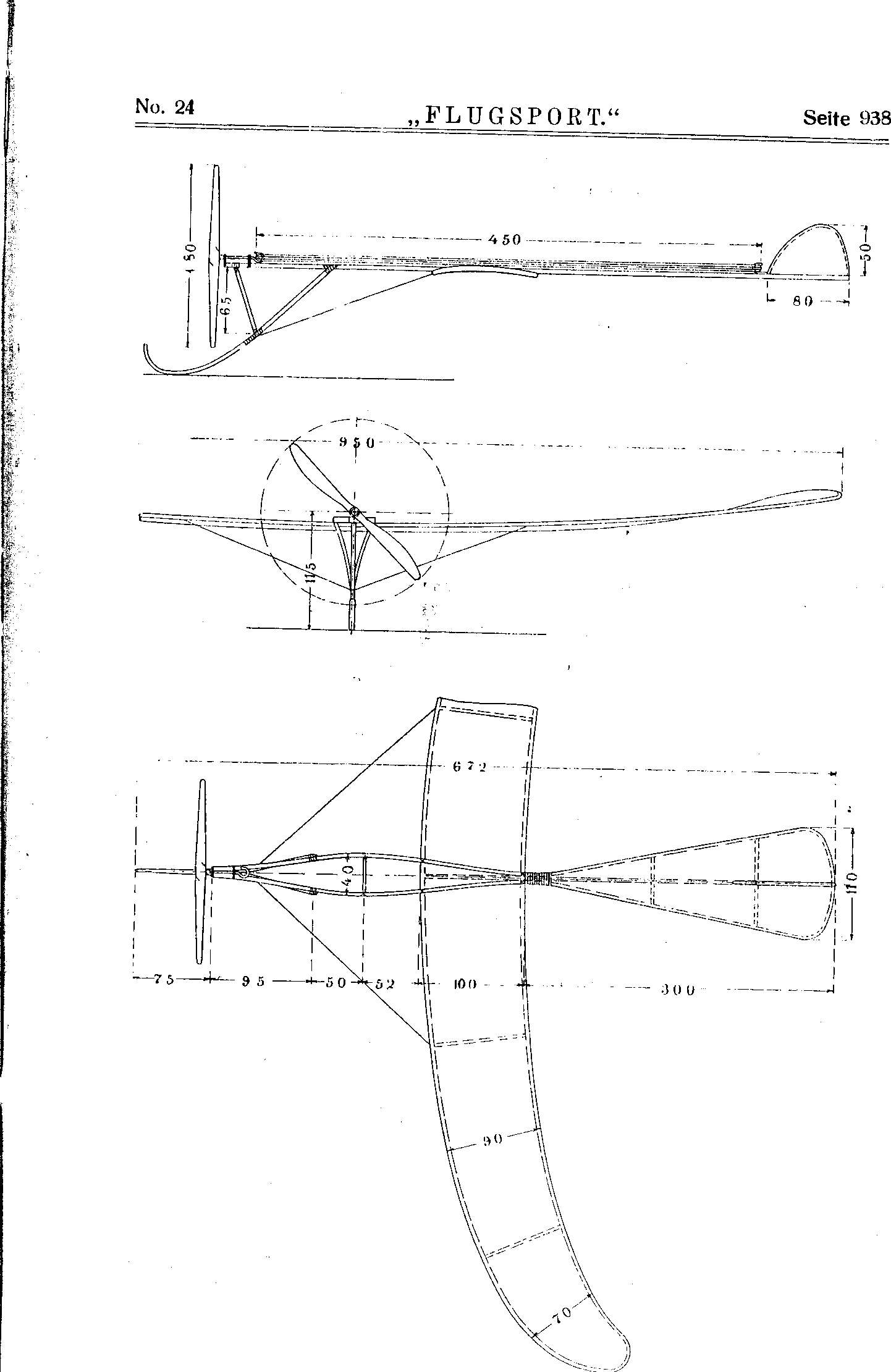 Das Handstartmodell Cruver. Seite 941 „FLUGSPORT." Nr. 24 in d. Königin Elisabeth Gardegren.-Rgt. Nr. 3, Pfeifer im 5. Westf. Inf.-Rgt. Nr. 53, in das Flieger-B. Nr. 1, Grade, Hauptm im Flieger-B. Nr. 1, unter Enth. von d. Stellung als Komp. Chef z. Stabe des Bataillons übergetreten. Württemberg. Zur Dienstleistung überwiesen: Palmer, K. W. Oberlt. im Gren.-Rgt. König Karl (5. Württ.) Nr. 123, Reuß, K. W. Lt. im Württ. Pion.-B. Nr. 13, -beide vom 1. Oktober 1913 ab auf ein Jahr nach Preußen kommandiert für diese Zeit d. Fheger-B. Nr. 4, Krauße D'Avis, K. W. Lt. im Drag.-Rgt. Königin Olga (1. Württ) Nr. 25, kommandiert vom 1. Oktober 1913 ab auf acht Monate nach Preußen, für diese Zeit d. Flieger-B. Nr. 3. Bayern. Zum Oberstleutnant wurde ernannt Major Engelhardt, Insp. d. Mil. Luft- und Kraftfahrwesens. Sachsen. Zum K. P. Fliegerb. Nr. 1 kommandiert wurden Sommer, Lt. im 10. Inf.-Rgt. Nr. 134, Bonde, Lt. im 11. Inf.-Rgt. Nr. 139, - auf ein Jahr, Müller. Lt. im 11 Inf.-Rgt. Nr. 139, auf acht Monate, unter Rückwirkung vom 1. Okt. 1913. 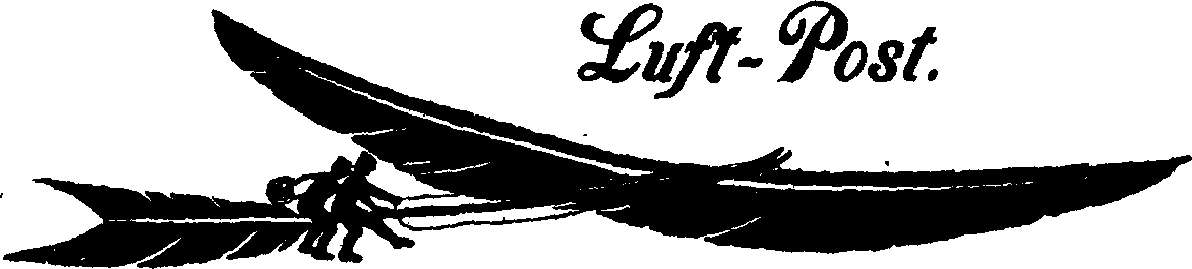 Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.}^ ■ -' ' E. E. Das Löten von Aluminiumröhren ist sehr kompliziert und für den Modellrumpfbau nicht zu empfehlen. Die Lötstellen bei nahtlosen Röhren und gepreßten Aluminiumteilen, die infolge der mechanischen Bearbeitung eine bedeutende Widerstandsfähigkeit e.halten haben, werden weich und verlieren ihre Festigkeit. Es empfiehlt sich, anstatt der Lötstellen Nietverbindungen anzuwenden, die bedeutend stabiler sind. Literatur.*) Drei Jahre deutschen Plugsports, von Ernst Schaerowitz, Preis 1.(50 M; 99 Seiten. Dieses Buch enthält in gedrängter Kürze die wichtigsten flugsportlichen Ereignisse in Deutschland von 1912. Denjenigen, welchen es nicht vergönnt war, den Flugsport von Anfang seiner Entwicklung zu verfolgen, wird dieses Buch manche Aufklärung geben Avialischs Götterdämmerung, von Dr. Raimund Nimführ in Wien zu beziehen durch den Kommissionsverlag Lehmann & Wentzel, Wien, Kärntnerstr. 30. Auf dem Titelblatt steht: Ein Weckruf zur Bekämpfung der Hemmung und Ausbeutung der aviatischen Wissenschaft und Forschung im Dienste eines geldgierigen Kapitalisten- und skrupellosen Spekulantentums Diese Broschüre sollte auch bei uns in Deutschland als Spiegelbild dienen. Eine Kritik der das Flugwesen förderwoltenden Faktoren würden hierzulande der guten Sache sicher viel nützen. *) Sämtliche besprochenen Bücher können durch die Expedition des „Flugsport" bezogen werden.  Jllustrirte No. 25 technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnement 10. Dezember für das gesamte 1913. Jahrg. V. „Flugwesen" Kreuzband M. 14 Postbezug M. 14 pro lahr. unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Teief.4557nmti. Oskar Ursinus, Civiling-enleur. Tei.-fldr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14tägig. ■ ■ : Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. r Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten11 versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 22. Dezember. Pariser Salon. Civ.-Ing. Oskar Ursinus. Programmmäßig wie immer wurde am Freitag den 5. er. in Gegenwart des Minister-Präsidenten Poincare, vormittags 10 Uhr der diesjährige Pariser-Salon, die V. Intern. Ausstellung für Luftfahrt, eröffnet. Der Ausstellungsraum des Grand-Palais glich trotz der breiten Flächen der großen Vögel mehr einem Blumengarten. In der Ausstattung haben die Veranstalter keine Kosten gescheut. An den Ecken der Ausstellungsstände befanden sich große, Adler tragende Säulen, mit Vogelflügeln und entsprechenden Aufschriften der Aussteller. Diese gleichmäßige Anordnung der Firmennamen, wirkte sehr wohltuend auf das Auge und paßte gut zu den Blumen-Dekorationen. Die Anzahl der Aussteller ist gegen das Vorjahr recht bedenklich zusammengeschrumpft. Auf den Galerien befanden sich die bei Ausstellungen üblichen Verkaufsstände, die mit der Ausstellung nichts zu tun haben. Was bietet der Salon ? Ist er dem vorjährigen gleichwertig ? Entgegen der in einigen Tageszeitungen gebrachten Mitteilung, sei von vornherein darauf hingewiesen, daß der diesjährige Salon dem vorjährigen in nichts nachsteht. Im Gegenteil. Im Vorjahre waren in viel umfangreicherem Maße künstlieh herausgeputzte Ausstellungsmaschinen zu sehen, als diesmal. Die betreffenden Aussteller haben eingesehen, daß mit Bluffen nichts zu machen ist. Man verlangt Leistungen. Die Maschinen werden bei ihrer Abnahme wohl eingehender probiert als ein Automobil, das in die Hände des Käufers übergeht. Für den technisch interessierten Beobachter, ist es nicht schwer zu erkennen, wie diese Prüfungen nicht ohne Einfluß auf die gesamte Konstruktion der Flugmaschine geblieben sind. An den im Salon ausgestellten Maschinen liest man fast allerorts „Type Militaire" und wenn das nicht daran steht, deutet ein hervorlugendes Maschinengewehr darauf hin, daß das Ding für Kriegszwecke bestimmt ist. Sport-Maschinen sieht man verhältnismäßig wenig. Nur vereinzelt kann man lesen „Type Populaire" und hier und da sieht man ein für den Krieg nicht brauchbares Rennungetüm. Dennoch glaubt man in Frankreich fest an den Flugsport. In letzter Zeit spielen sich in Frankreich hinter den Kulissen Vorgänge ab, die in militärischem Interesse den Sport zu heben sich zur Aufgabe gestellt haben. Ueber die Einzelheiten soll später noch ausführlich berichtet werden. Konstruktive Einzelheiten vom, Pariser Salon. In konstruktiver Hinsicht zeigen die Maschinen gegen den vorjährigen Salon allerlei Verbesserungen, und zwar in der Hauptsache solche, die sich in der Praxis als unbedingt nötig erwiesen haben. Man sieht, die Zeit des Fühlens und Tastens ist vorbei. Es ist interessant zu beobachten, wie selbst an neuen Typen bei der Konstruktion streng die Grundprinzipien des modernen Flugmaschinenbaues berücksichtigt sind. Gerade diese Erkenntnis unterscheidet den modernen Flugmaschinenbau von dem vor 2 und 3 Jahren. Diese Erkenntnis ist in Frankreich hervorgegangen aus dem innigen Zusammenarbeiten der Theorie mit der Praxis. Frankreich hat aber auch die Männer dazu. Autodidakten wie bei uns würde man auf Frankreichs Lehrstühlen nicht dulden. Auch auf diesen kurz gestreiften Punkt soll nochmals im Interesse des deutschen Flugwesens zurückgekommen werden. Man muß sich wundern, daß trotz der geringen wissenschaftlichen Unterstützung der Firmen in Deutschland noch so hervorragendes von der Industrie geleistet worden ist. In nachstehendem sollen zunächst die wichtigsten konstruktiven Einzelheiten der* einzelnen Aussteller beschrieben werden. Bleriot zeigt auf seinem Stand neben der bekannten Militärtype eine neue Mililärmaschine mit tropf enförmigem Rumpf. S. Abb. 1. Der Raum für den Beobachter befindet sich hinter dem Führersitz und zwar liegt der 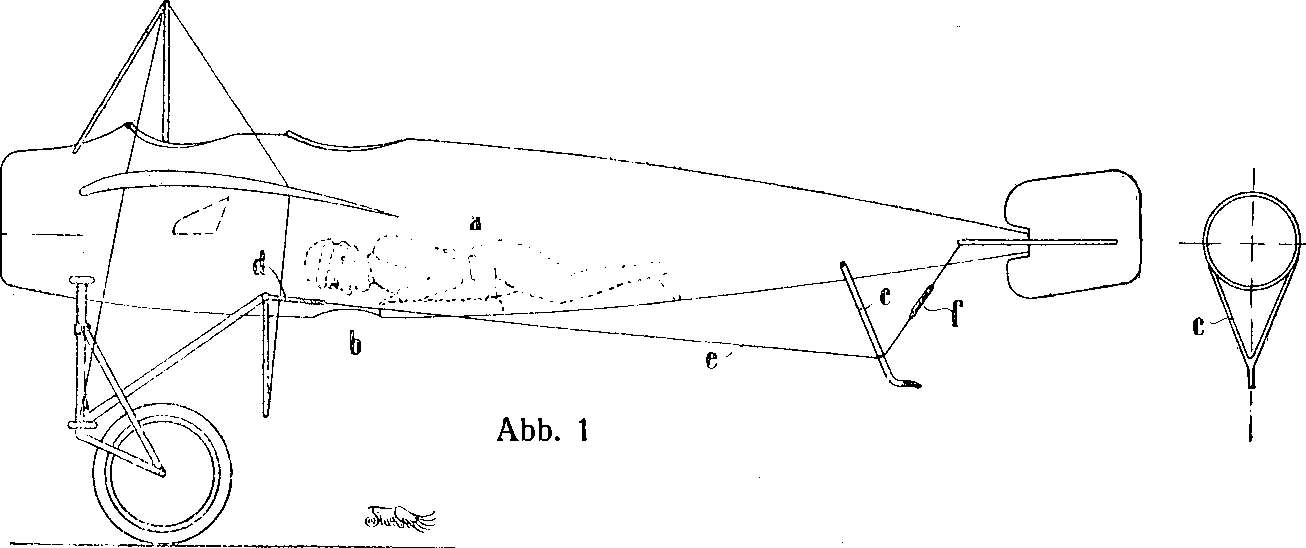 Beobachter a lang gestreckt im Hinterteil des Rumpfes auf einem gepolsterten Kissen mit dem Gesicht am Beobachtungsfenster b. Durch dieses Fenster, das eine ausgezeichnete Beobachtung gestattet, können auch Bomben geworfen werden. Das Hauptfahrgestell ist etwas gedrungen gehalten, ähnlich wie bei der früheren Populärtype. Zur Unterstützung des Schwanzes dient eine gabelförmig am Rumpf angreifende Stahlrohrschleifkufe c, die durch einen Gummizug d unter Vermittlung des Seiles e abgefedert ist. Die Lage des Schleifsporns wird durch einen weiteren abgefederten Zug f in seiner Lage gehalten. Die vorerwähnte Ausführungsform der hinteren Schleifkufe ist vorteilhafter als eine andere von Bleriot, die auch ausgestellt war, siehe Abb. 2, bei der die Beanspruchung durch das Rumpfende übertragen wird. Diese Schleifkufe besteht aus einem Stahlrohr a, das im Rumpf befestigt ist. Am unteren Ende des Stahlrohres ist bei b, nach allen Seiten schwingbar, die Schleifkufe c gelagert. Die Abfederung wird durch Gummiringe d bewirkt. Das Hängenbleiben des hinteren Sporns scheint bei Bleriot zu Unzuträglichkeiten und Rumpfbrüchen Veranlassung gegeben zu haben. Auch bei der normalen Militärtype hat Bleriot 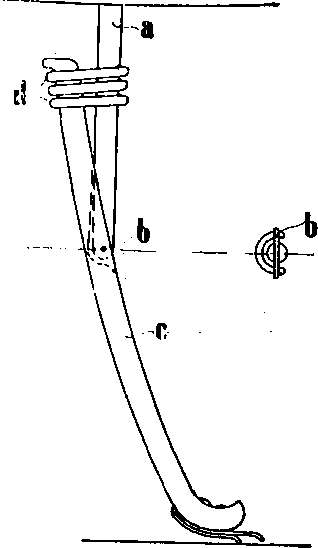 Abb, 2 Abb. 3 eine besondere *~ Einrichtung getroffen, damit etwaige harte Beanspruchungen des Rumpfes bei Hängenbleiben an festen Hindernissen vermieden werden. Der Schleifsporn a Abb. 3 schwingt um den durch Stahlrohre abgestützten Punkt b. Die Abfederung für leichte Stöße wird durch Gummiringe c bewirkt. Zur Aufnahme von harten Beanspruchungen dient die Pufferfeder d, die unter Vermittlung des Seiles e die LagersteJle b entlastet. Weiter sieht man auf dem Stand von Bleriot etwas unglaubliches: einen Zweidecker. Bleriot baut also auch Zweidecker. Er ist eben Geschäftsmann geworden. Dieser' Zweidecker ähnelt in seinen Ausführungsformen der normalen, modernen Farman Type. Zum Betriebe dient ein 80 PS Gnom. Nur das Fahrgestell zeigt eine andere Ausführung. Wir werden auf diese Konstruktion später ausführlicher zurückkommen. Die Gebrüder Caudron zeigen einen Wasserzweidecker mit 100 PS 9 Cylinder Gnommotor, der unter Vermittlung eines Stirnräderpaares im Verhältnis 1 : 2 eine Schraube von 3 m Durchmesser antreibt. Statt der bisherigen zwei nebeneinander liegenden Seitensteuer ist ein großes Seitensteuer angeordnet worden. Die Schwanzgitterträger verlaufen nach hinten nach dem Seitensteuer im Grundriß gesehen in der neuerdings vielverwendeten bekannten Dreiecksform. 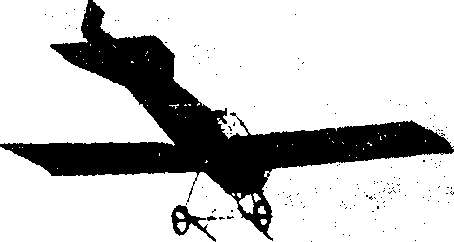 Eindecker de Beer im Fluge. Eindedter von Clement Bayard. Die Schwimmerkonstruktion mit den hinter der Stufe in die Schwimmer eingelassenen Laufrädern sind denLesern des Flugsport bekannt. Weiter sehen wir i auf dem Stand eine Normallandmaschine, Militärtype von 11 m Spannweite, die durch3 £ihre leichte Bauart auffällt. «."K'si^j 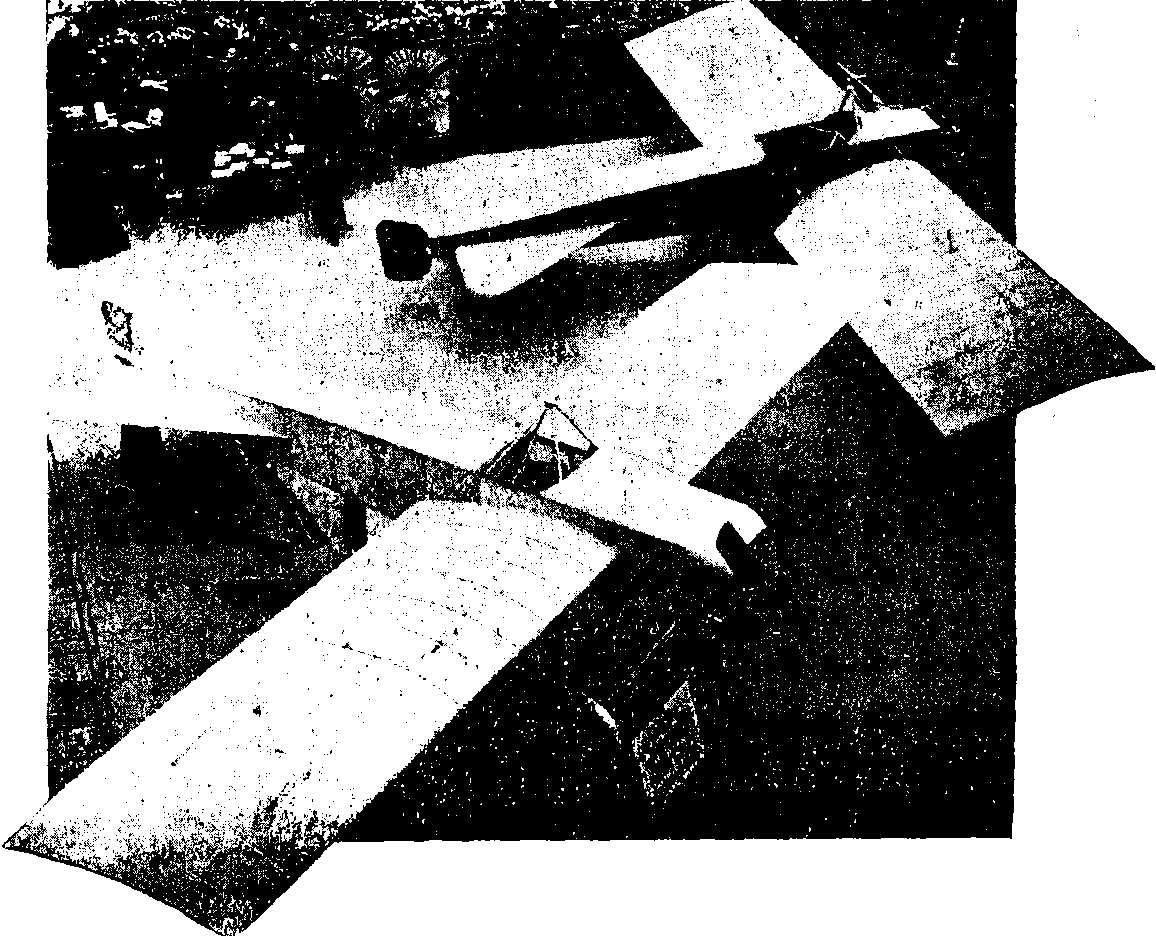 Stand Ratmanoff. Rechts oberi'der Eindecker de Beer. Als Führung der Drahtseile für Steuerzüge, für die früher und zwar mit Erfolg Rohrführungen verwendet wurden, findet man im Salon neuerdings wieder vorherrschend die Rollenführung angewendet. Einen der Hauptnachteile, das Herausspringen des Drahtseiles aus der Rille, vermeidet Caudron durch Anwendung von besonderen Seilführungen. Daseinfache und schöne Detail von Caudron ist in Abb. 4 dargestellt. Das auf der Rolle a liegende Seil b wird durch entsprechend große Löcher c geführt. Das Lagerböckchen b ist mit den Seilführungen aus einem Stück hergestellt. 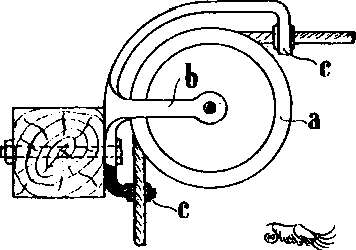 T Abb. 4 Die von den Farmans ausgestellten Maschinen lassen gegen die früheren Jahre eine außerordentlich saubere Werkstattarbeit erkennen. Neben einem großen Wasserzweidecker Typ Deauville verdient eine neue Landmaschine von Henry Farman besondere Beachtung. Entsprechend den Wünschen 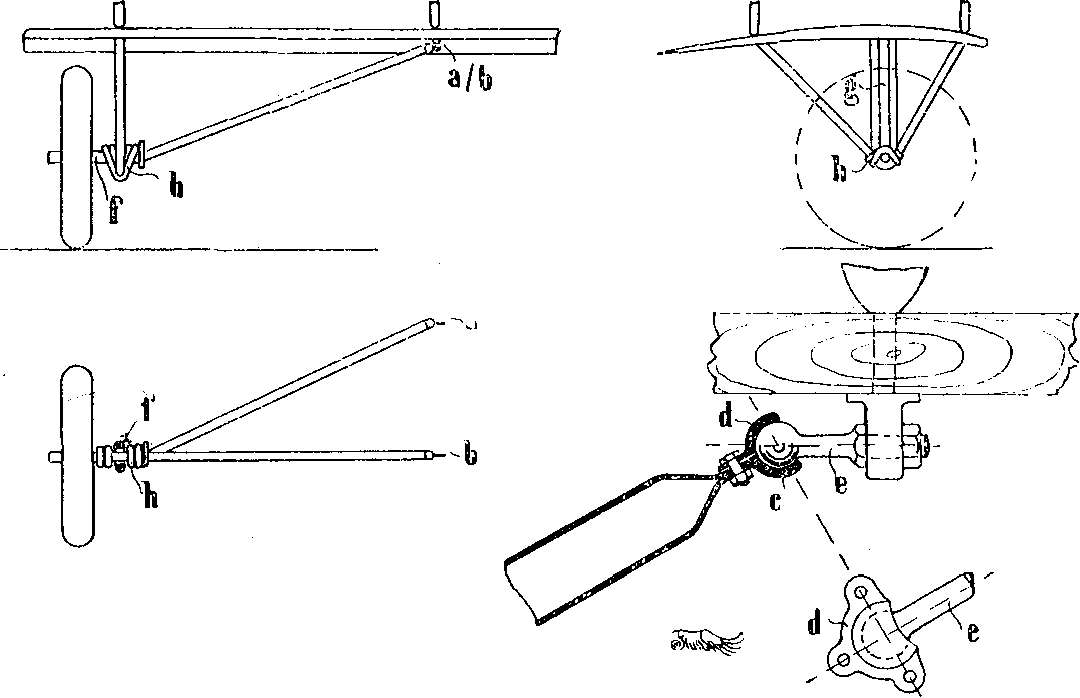 Abb. 5 der französischen Heeresverwaltung ist der Führersitz vor und der Motor hinter den Tragdecken angeordnet Der Führer hat nach vorn, nach unten, nach den Seiten und nach hinten oben ein ausgezeichnetes Gesichtsfeld. Das untere Tragdeck von 4 m Spannweite befindet sich sehr nahe am Erdboden. Der 100 PS Gnommotor, Monosoupape, befindet sich fast in gleicher Höhe wie das 12 m messende Oberdeck. Neuartig an dem Farman-Anderthalbdecker ist das Fahrgestell. S. Abb 5. Dasselbe besteht aus 2 Rädern, von denen jedes einzelne für sich an einer Halbachse gelagert ist. Die Halbachse ist an der Unterseite der Tragdecke bei a und b in Kugelgelenken gelagert. Das Kugelgelenk wird aus zwei Kugelpfannen c und d und den Kugelzapfen e gebildet. Die Kugelpfanne c ist in das flachgedrückte Stahlrohrende eingepreßt. Die beiden Kugelpfannen werden durch drei Schrauben von 4 mm zusammengehalten. Das andere, das Laufrad tragende. Ende der Halbachse f wird in den Schlitz g geführt und ist an Gummizügen aufgehängt. Um das Undichtwerden der schweren Benzin- und Oelgefäße bei harten Landungen zu vermeiden, hängt Farman die Reservoirs elastisch auf. Siehe Abb. 6. Auf den Gummipuffern a ruhen die "Winkel b, an 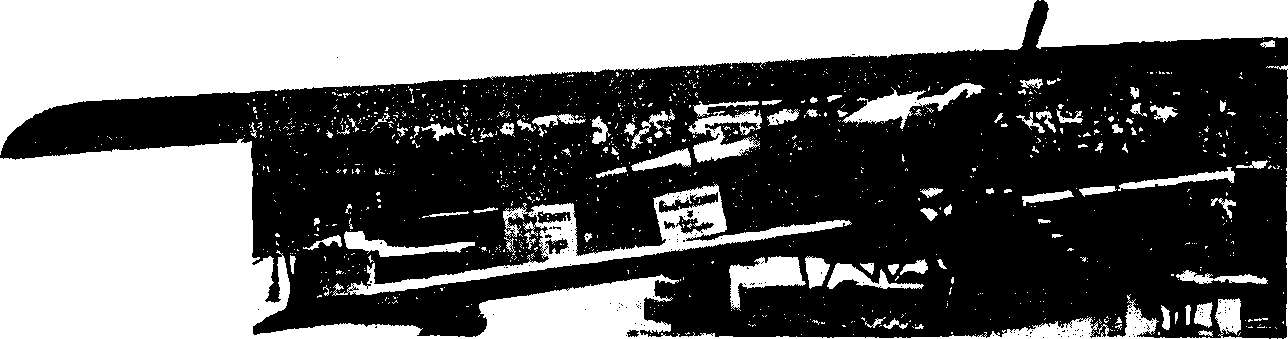 Zweidecker Paul Schmitt. denen die Stahlbänder c befestigt sind. Um eine härtere Elastizität der Gummipuffer zu erzielen, werden dieselben durch Schlauchschellen d und e verstärkt. Auch unterhalb des Gefäßes sind Gummipuffer vorgesehen. Die von Clement Bayard ausgestellten Eindecker zählen zu den saubersten des Salons. Der Beobachtersitz befindet sich hinter dem Führersitz. 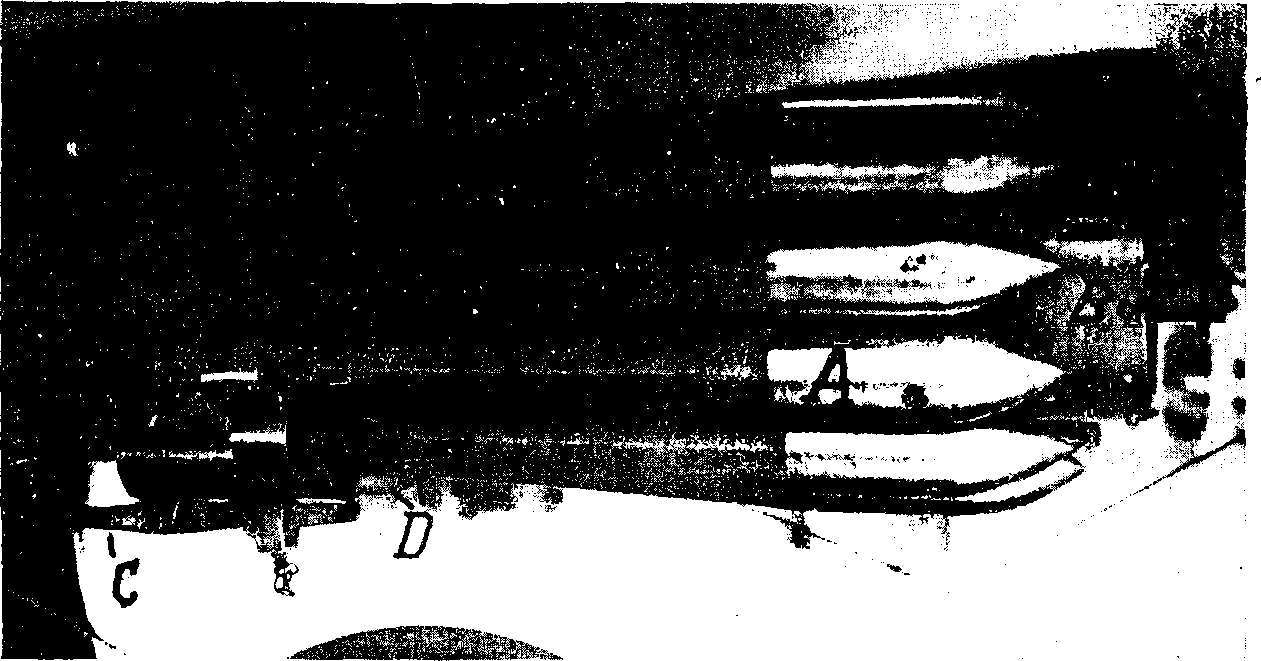 Torpedo-Lanciereinrichtung für 12 Torpedos im Bristol-Zweidecker. Vor dem Höhensteuer ist keine Dämpfungsfiäche vorgesehen. Der Rumpf besteht aus Stahlrohren und ist vorn sehr weit nach unten geführt. An dem unteren Endo des Rumpfes greift die Ver-spannung an. Ferner führt von dem unteren Ende, des Rumpfes nach unten eine Strebe, an der die Halbachsen angreifen. Zu beiden Seiten der Halbachsen im Grundriß gesehen befinden sich zwei falsche Achsen, an denen mittels Gummiring in der Nähe der Räder die Halbachsen aufgehängt sind. Sämtliche Verspannungsorgane und Befestigungsstellen sind sehr solid konstruiert. Um beispielsweiseeine Abscheerung der Urahtr seilschlaufen zu vermeiden, sind dieselben statt um Blechkauschen um Stahlrollen gelegt. Siehe die Abb. 7. Den Wünschen des Militärs, eine möglichst große Differenz in der Geschwindigkeit zu erzielen, Rechnung tragend, haben mehrereKonstrukteure Maschinen mit verstellbaren Tragdecken 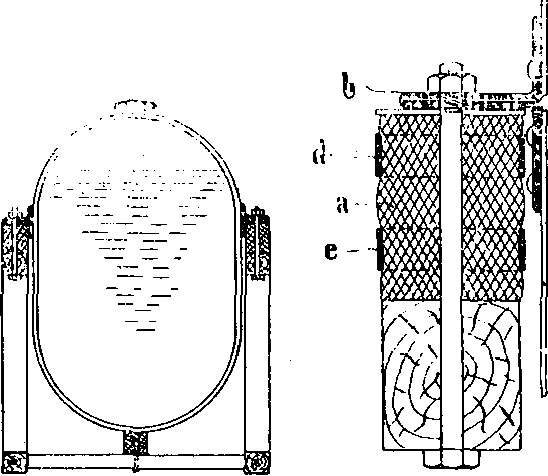 Abb. 6 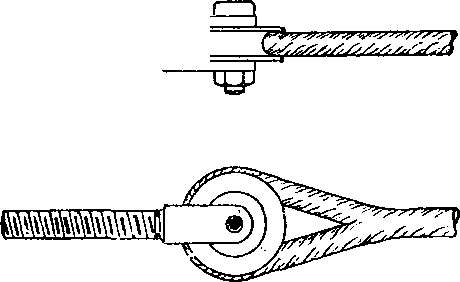 ausgestellt. Auf dem Stand von Ratmanoff ist ein Eindecker de Beer ausgestellt, dessen Prinzipien an Hand der beistehenden schematischen Skizze kurz beschrieben werden soll: S.Abb.8. Der Eindecker besitzt 18 qm Tragfläche und wiegt mit 10 Zyl. 80 PS Ä.nzani, 320 kg. Die beiden Tragdecken sind um den vorderen Holm, der im Druckmittelpunkt liegt, von einander unabhängig drehbar Durch eine besondere Steuereinrichtung können die Neigungswinkel der Tragdecken gleichmäßig vergrößert und verkleinert werden. , Sie können aber auch mit derselben Steuereinrichtung wechselseitig verstellt werden, d. h. ungleiche Neigungswinkel erhalten. Die gleichzeitige Vergrößerung der Neigungswinkel beider Tragdecken ist bei sanftem Landen nötig, (kurzer Auslauf) während die gleichmäßige Verkleinerung der Neigungswinkel erforderlich ist beim Anlauf und bei größter Geschwindigkeit. Die ungleiche Einstellung der Tragflächenneigungswinkel hingegen ersetzt die Tragflächenverwindung. Für die Einstellung der Tragflächenwinkel und des Höhensteuers S dient eine Steuersäule A B, die bei A um ein Kugelgelenk schwingt und die nach 4 Seiten frei bewegt werden kann. Die Punkte D und E geben die Bewegung, unter Vermittlung von zwei Schubstangen E F und D H und zweiarmigen Hebeln F Cr und H J, drehbar um C bezw. C', zur gleichzeitigen Vergrößerung bez W.Verkleinerung derTragdeckenneigungs winkel und auch zur wechselseitigen Einstellung dieser Tragdeckonneigungswinkel. Der Hebel A B stellt, wenn er nach vorn oder hinten gedrückt wird, unter Vermittlung der Schubstange K L das Höhensteuer S ein. Die Schraube M erlaubt für irgend einen Winkel der Tragdecken das Höhensteuer S in der Fluglinie zu halten. (Vergleiche die gestrichelte Stellung.) Die Verstellung der Tragdecken, um große Geschwindigkeitsunterschiede und geringen Auslauf etc. zu erhalten, ist auch an einem Abb. 7 Doppeldecker Paul Schmitt versuchtworden. S. Abb. 9 Die Zelle des^Doppeldeckers ist bei a drehbar aufgehängt. Die Einstellung der Zelle geschieht mittels Handrad unter 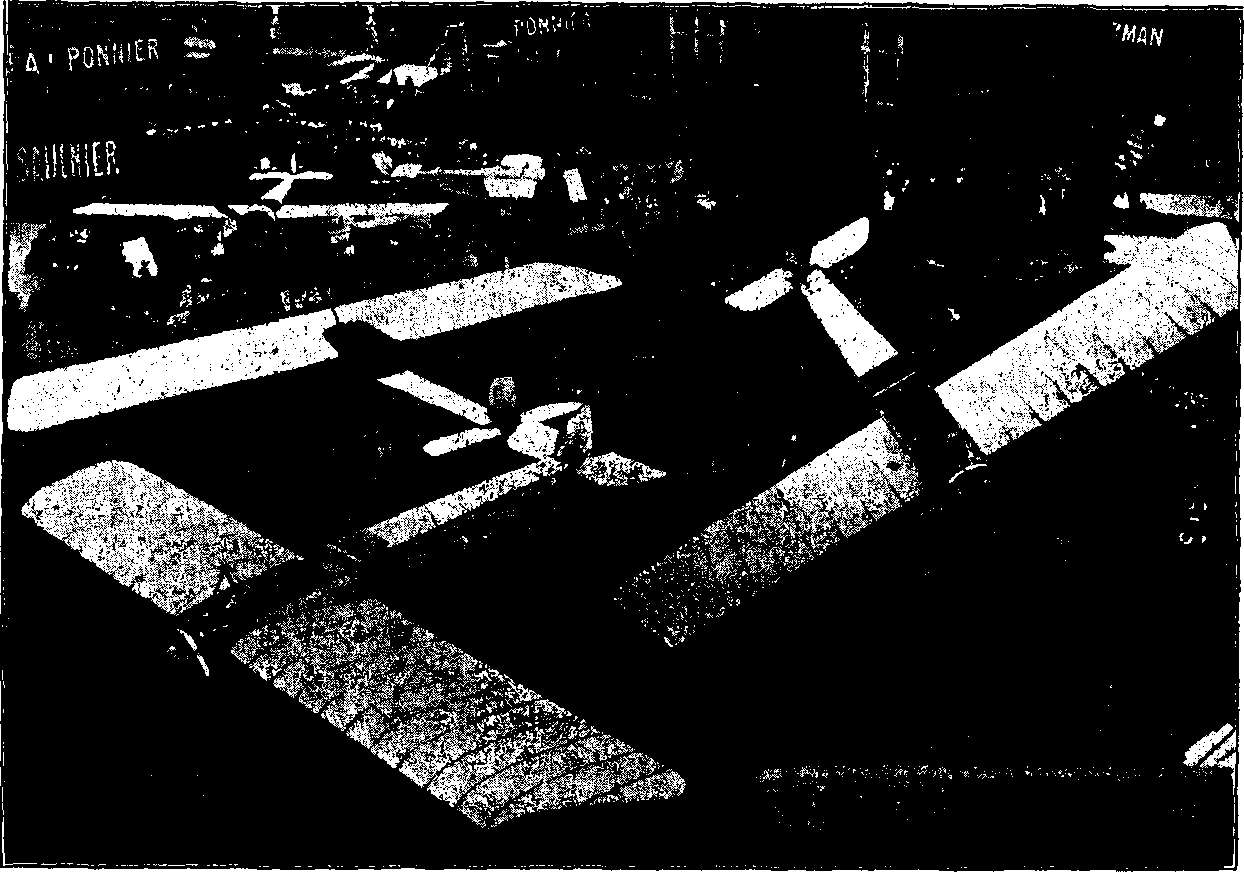 Moräne Saülnier 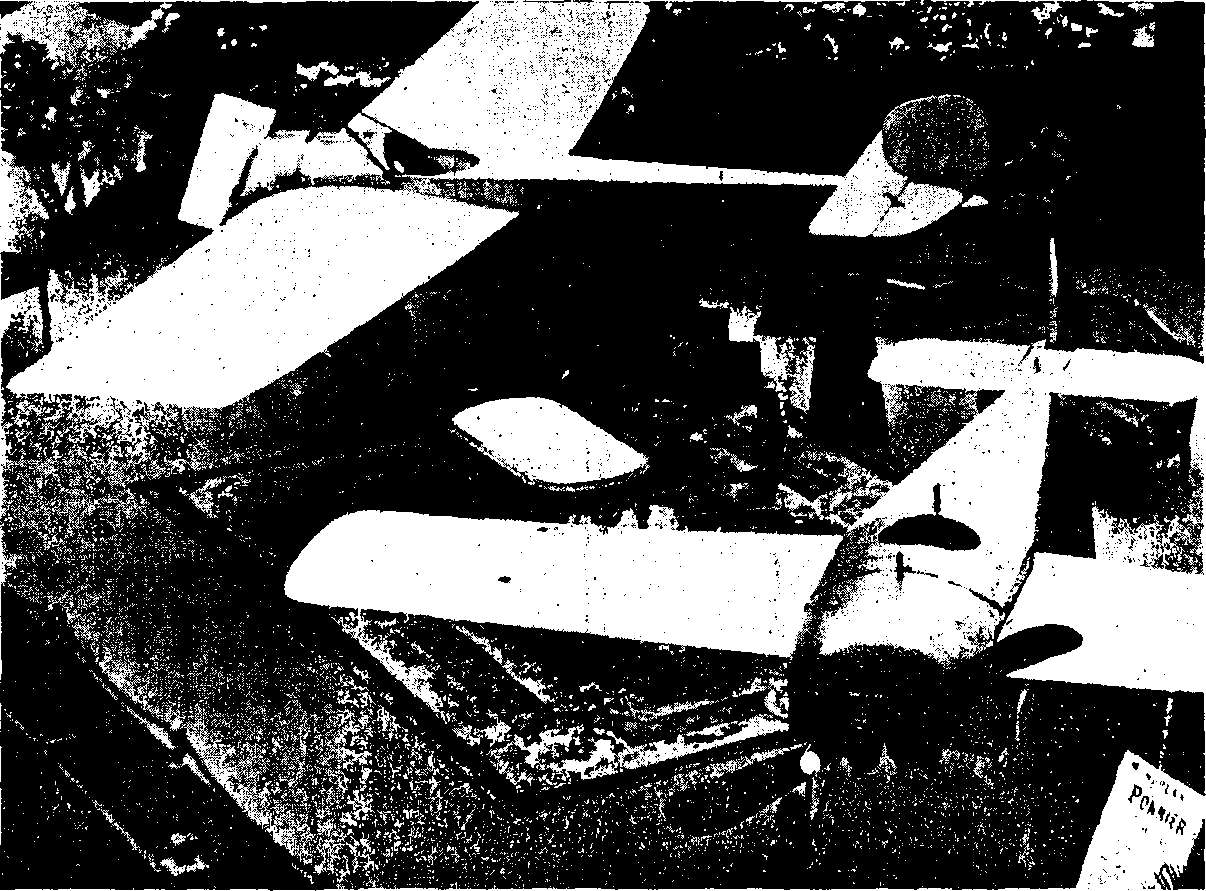 Ponnier. Rechts unten: Die Rennmaschine von 6 m Spannweite. Vermittlung einer Gewindespindel b der Streben c die an der Zelle bei d angreifen. Um außer einer feinen Einstellung eine Einstellung in größeren Grenzen zu ermöglichen, sind zwei hintereinander liegende Handräder, die die Gewindespindel b mit verschiedenen Uebersetzungen antreiben, vorgesehen. Die Maximalgeschwindigkeit der Maschine soll 120 und 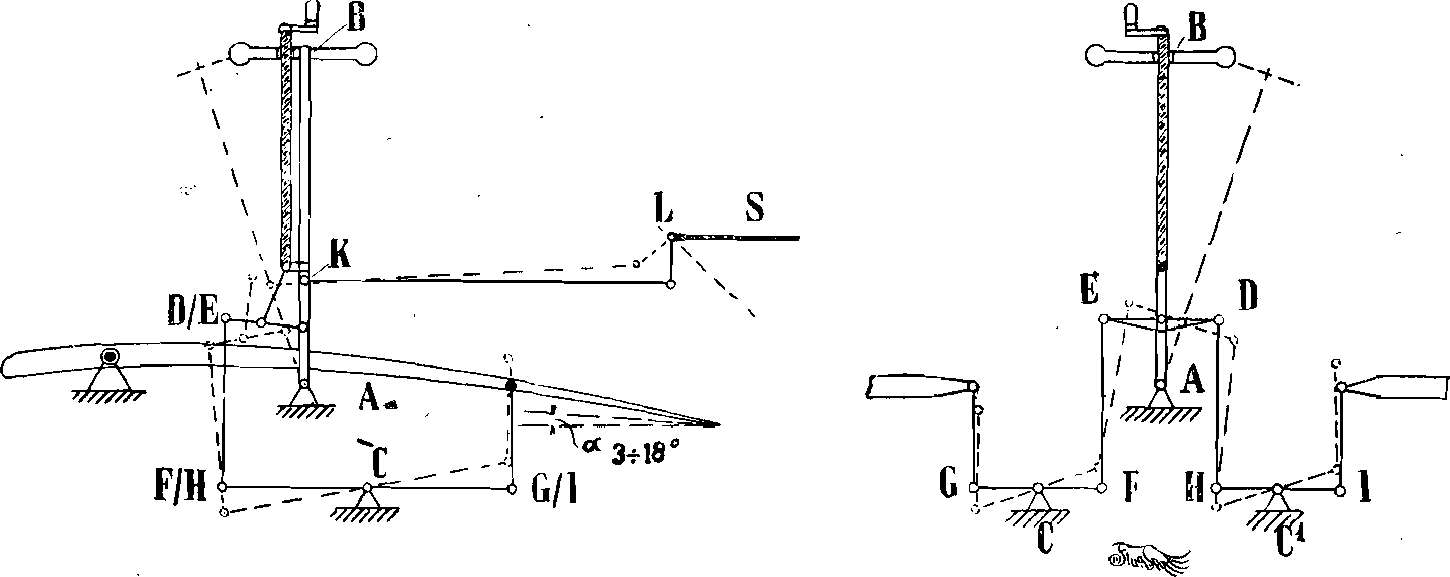 Abb. 8 die Minimalgeschwindigkeit 30 km pro Std. betragen. Der Doppeldecker hat bei 17,5 m Spannweite 49 qm Tragfläche. Das Gewicht beträgt mit 350 1 Betriebsstoff 1100 kg. Zum Betriebe dient ein 160 PS Gnommotor. Die englischen Bristolwerke sind mit einem sehr schönen Kriegsdoppeldecker vertreten. . Besonders interessant an diesem Doppeldecker ist eine Bombenlanciereinrichtung. Die torpedoförmigen Bomben A werden unter dem vorderen Rurnpf-teil hinter der vornliegenden Schraube in einem Trommelmagazin B 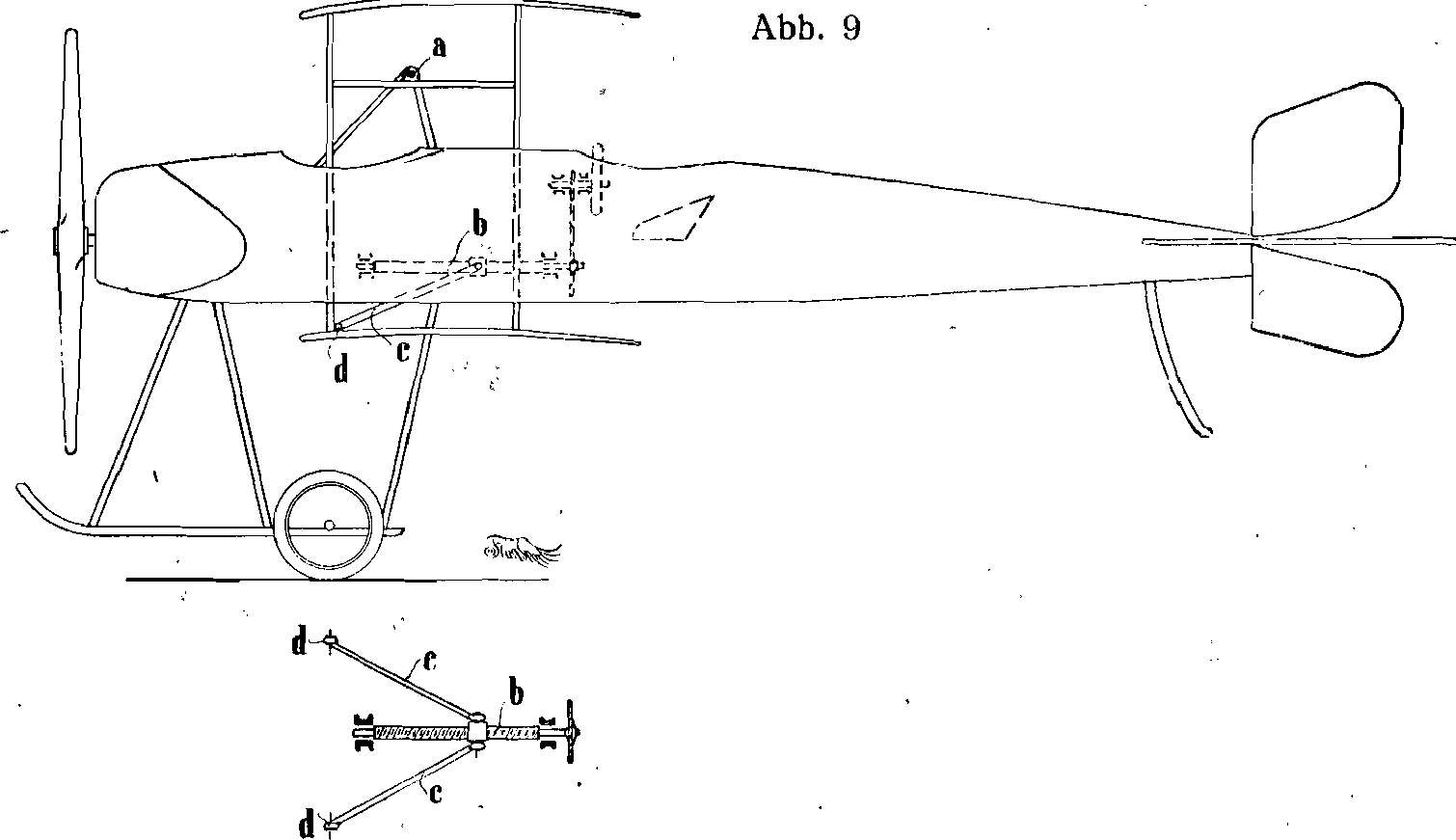 festgehalten. Am hinteren Teil des Magazins befindet sich die mittels Drahtseilzug betätigte Auslösvorrichtung C. Die Bomben werden so ausgelöst, daß sie die gleiche Geschwindigkeit erhalten, wie die Maschine. Um einer Explosionsgefahr bei harten Landungen etc. vorzubeugen, ist folgende sinnreiche Einrichtung getroffen. Am hinteren Ende der torpedoförmigen Bomben befinden sich kleine propellerartige Kielflächen, die der Bombe beim Fallen eine drehende Bewegung erteilen. Nachdem das Torpedo eine bestimmte Anzahl Umdrehungen 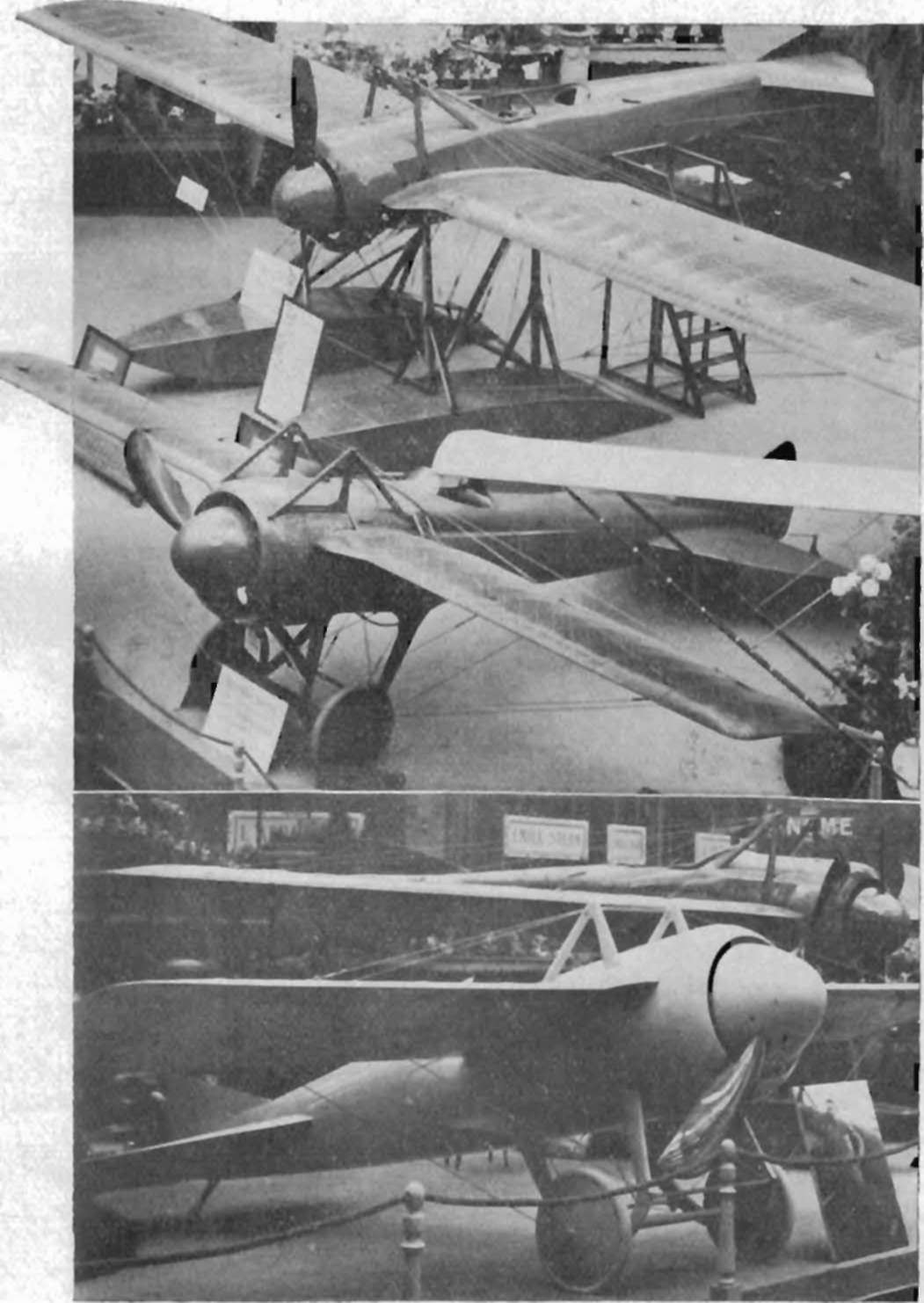 Deperdussin. Oben: Wasser-Eindecker Typ Deauvile. In der Mitte: der von Gilbert in Reims gesteuerte Renneindecker. Unten : neuster Renneindecker.' ausgeführt hat, löst sich innerhalb desselben eine Sicherung aus, die dann gestattet, daß beim Aufschlagen der Bombe dieselbe explodiert. Solange also das Torpedo auf diese Weise nicht entsichert ist, kann es nicht explodieren. Das Magazin faßt 12 Torpedos, die in 31 Sek. lanciert werden können. Ebenso ausgezeichnet durchgebildet sind die Zieleinrichtungen. Der Beobachtersitz liegt vor dem Führersitz. Vor dem Beobachtersitz befindet sich über der langen Motorhaube eine Visiereinrichtung bestehend aus Kimme und Korn, um die Flugrichtung zn bestimmen. Ferner ist rechts vom Beobachtersitz ein Zielfernrohr von außerordentlicher Helligkeit angebracht sowie die nötigen Höhen- und Geschwindigkeits-Meßinstrumente, die mit empirisch ge-aichten Skalen versehen sind. Es braucht nur die Skala nach den von den Instrumenten abgelesenen Daten eingestellt zu werden. Sobald im Gesichtsfeld des Zielfernrohrs das Objekt erscheint, erfolgt die Auslösung. Damit der Beobachter dem Führer die Flugrichtung anzeigen kann, ist ein besonderer Signalapparat vorgesehen. Vor dem Beobachter befinden sich im Kreise angeordnet ca. 8 Druckknöpfe. Diese Druckknöpfe sind mit einer analogen Anzahl kleiner elektrischer Glühlampen verbunden, die sich auf dem Instrumentenbrett des Führes befinden. 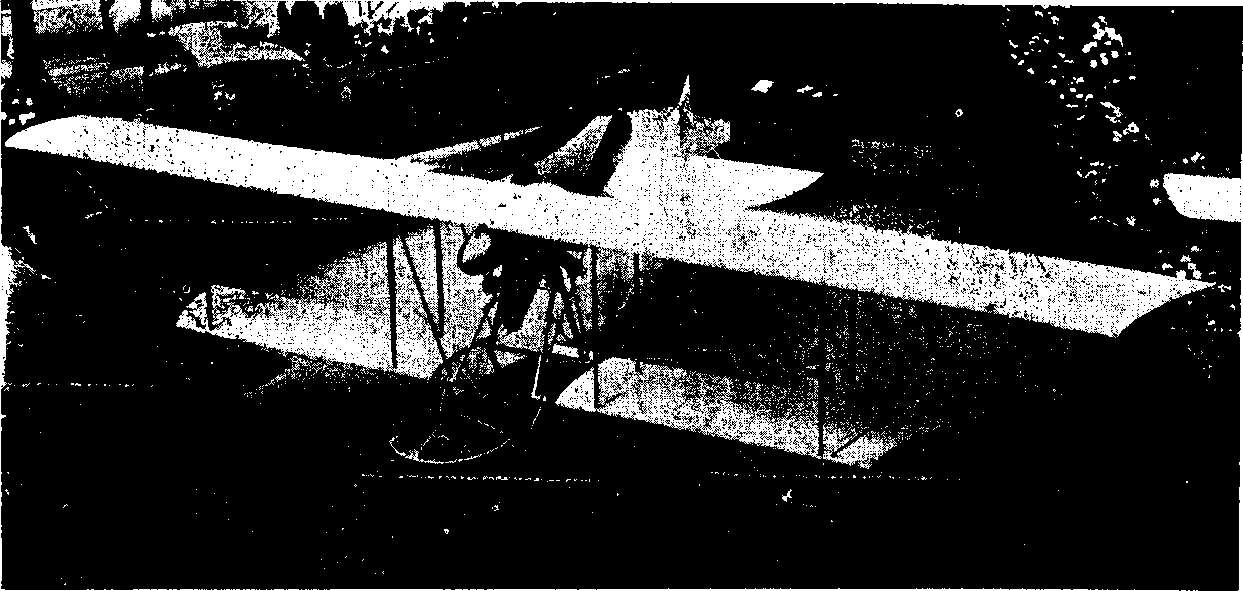 Fliegendes Boot der Franco-British-Avtation. Soll die Maschine nach links gehen, so drückt der Beobachter den am weitesten links gelegenen Knopf, um die entsprechende Glühlampe beim Führer zu beleuchten. Soll die Maschine beispielsweise nach rechts unten gehen, so drückt er auf den rechts unten gelegenen Knopf und beleuchtet die beim Führer analog angeordnete Lampe. Die Bristolwerke sind mit die größte Flugzeugfabrik Englands, sie arbeiten mit einem Kapital von 6,25 Mill. Fr. Wie den Lesern vorliegender Zeitschrift bekannt, hat Morane-Saulnier einen neuen Typ mit tiefliegendem Schwerpunkt herausgebracht. Bei diesem Eindecker mit normalen Moräne Saulnierrumpf ist das Tragdeck 50 cm über dem Rumpf montiert. Der Führer erhält durch diese Anordnung ein ausgezeichnetes Gesichtsfeld. Er kann von hinten über die Tragdecken alles über sich beobachten und unter den Tragdecken alles unter sich befindliche. Dieser Eindecker hat im Flug eine außerordentliche Stabilität gezeigt und läßt sich sogar noch leichter steuern, wie die normale Type. Vorliegende Maschine hat eine Spannweite von 12 m und wiegt 350 kg. Zum Betriebe dient ein 80 PS Monosoupape. Hinter dem Führersitz ist eine fotografische Kamera mit nach unten gerichtetem Objektiv eingebaut. Durch einen Schnurzug vom Führersitz aus läßt sich dieselbe bequem bedienen. Weiter sehen wir auf dem Stand von Moräne Saulnier die bekannte Eindeckertype, mit welcher Audemars und Brindejonc zu wiederholtem Male vorzügliche Leistungen vollbrachten. 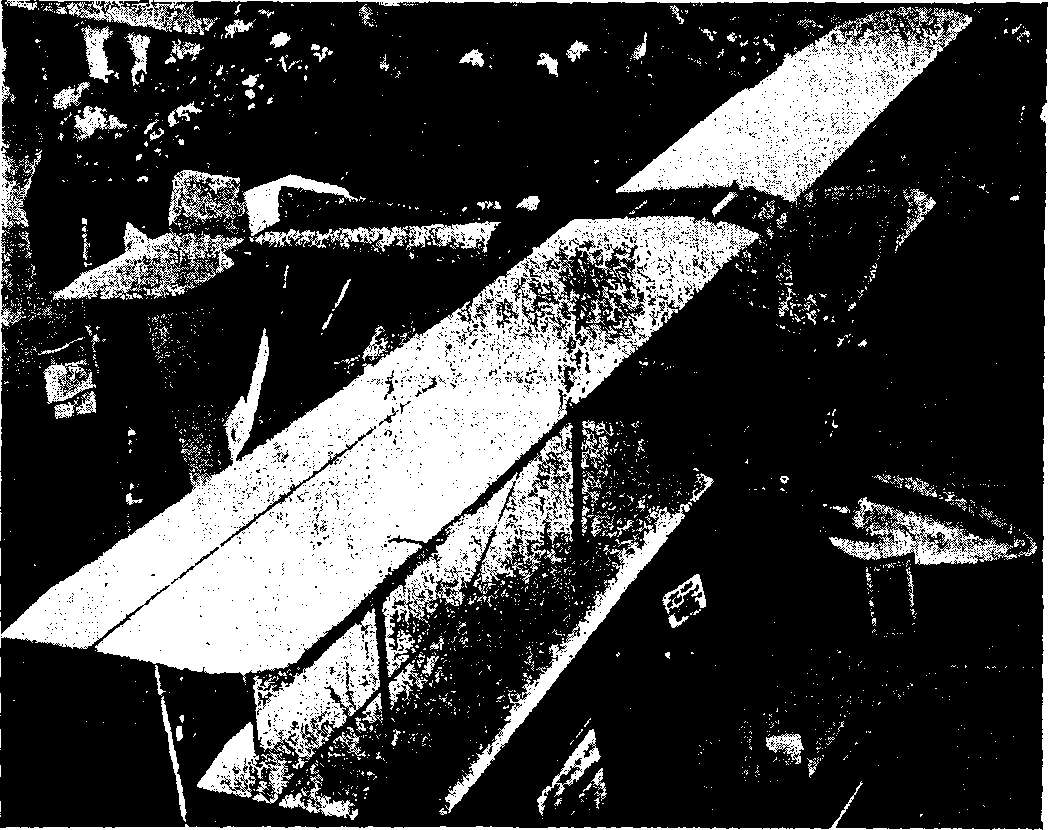 Bregnet Wasser-Doppeldecker, Typ Deauville. 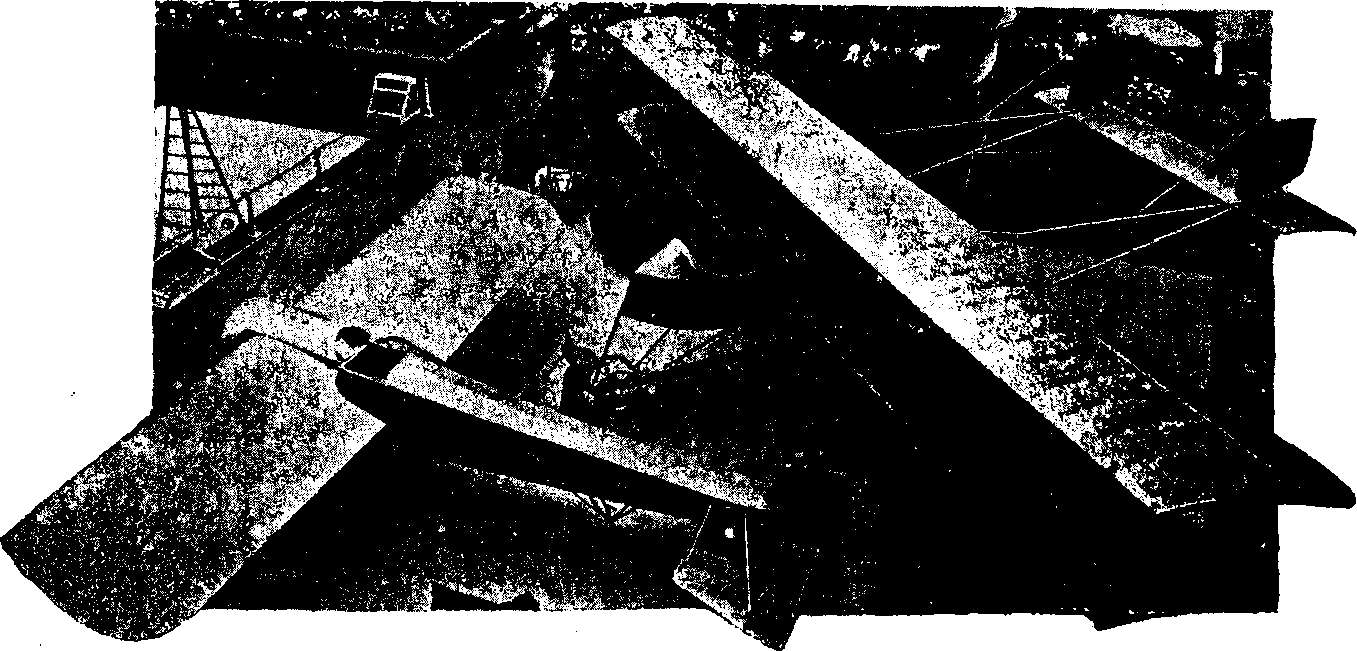 Bathiat-Sandiez, Ein- und Doppeldecker. Der von Reims anläßlich des Gordon Bennett-Rennen bekannte Ponnier-Eindecker ist in einer Ausführung vertreten. Dieser Apparat von nur 6 m Spannweite besitzt 7 qm Tragfläche. Die Gesamtlänge beträgt 5,45 m. Mit dem 160 PS Gnom wiegt der kleine Eindecker 325 kg. Bei späteren Probeflügen hat diese Rennmaschine 230 qm pr. Std. realisiert. Auf dem Stand von Deperdussin befinden sich außer der bekannten Wassermaschine Typ Deauville und der in Reims siegreich von Gilbert gesteuerten Rennmaschine, ein weiteres weiß lackiertes Renn-Ungeheuer, welches dem Typ von Reims ähnelt. Die Einzelheiten sind bereits mehrfach besprochen worden. Franco-British-Aviation. Außer der bekannten Type von Deauville, die ohne Tragdecken ausgestellt ist, sehen wir eine neue Wassermaschine. Diese Maschine hat bei 10,5 m Spannweite des Oberdecks 22 qm Tragfläche. Die Gesamtlänge beträgt 8,03 m. Der Preis Ers. 40000 Die Konstruktion des Rumpfes läßt erkennen, daß die Firma bei ihren Versuchen fortgesetzt mit den Schwierigkeiten des Seeganges zu kämpfen hatte. Man sieht an der vorderen Seite des Gleitbootes Wasserabweichflächen und zum Schutze der Insassen einen mit Oellonfenstern verkleideten Setzbord angeordnet. Zum Betriebe dient ein 100 PS Gnom. Auch bei Breguet findet man bei der Wassermaschine am vorderen Teil des Schwimmers besondere Abweichfläohen zum Schutze des Propellers angeordnet. Bathiat Sanchez zeigt einen Militär-Doppeldecker in Stahlrohr-Ausführung. Das Fahrgestell besteht aus 2 abgefederten Haupttragrädern. Zwischen den Rädern befindet sich eine lange Stoßkufe an derem vorderen Ende 2 Stoßräder angeordnet sind. Auch Goupy bekannt durch seine Staffelung der Tragdecken, ist mit zwei Doppeldeckern vertreten. Bemerkenswert ist der kleine Doppeldecker von nur 6 m Spannweite und 6 m Länge. Das Gewicht beträgt 295 kg. Mit einem 80 PS Gnom entwickelt dieser Apparat eine Geschwindigkeit von 130 km. Esnault Pelterie der seine Fabrikation im letzten Jahre eingeschränkt hatte, ist wieder mit seinem „Roten Teufel" vertreten. Die Stahlkonstruktion von Esnault Pelterie ist den Lesern vorliegender Zeitschrift bekannt. Die Konstruktionen von Borel in Land- und Wassermaschinen sind gleichfalls mehrfach im „Flugsport" ausführlich beschrieben worden. Der ausgestellte Wassereindecker von Borel zeigt keine wesentliche Aenderungen, nur daß die hintere Strebenbefestigung am Schwimmer elastisch ausgeführt ist. Originell ist der neue Torpedo-Militär-Eindecker. Bei diesem Eindecker befindet sich der Rotationsmotor hinter dem Führersitz im Rumpf. Der Motor treibt unter Vermittlung einer Transmission die hinter dem Schwanz befindliche Schraube an. Die Anordnung er- No. 25 „FLUGS POET." Seite 956 innert an die Konstruktion von Tatin, nur daß die Tragflächendurchbildung eine andere ist. Vor dem Führersitz ist ein Maschinengewehr montiert, Sehr umfangreich hat Nieuport ausgestellt. Wir sehen auf dem Stand von Nieuport die bekannten 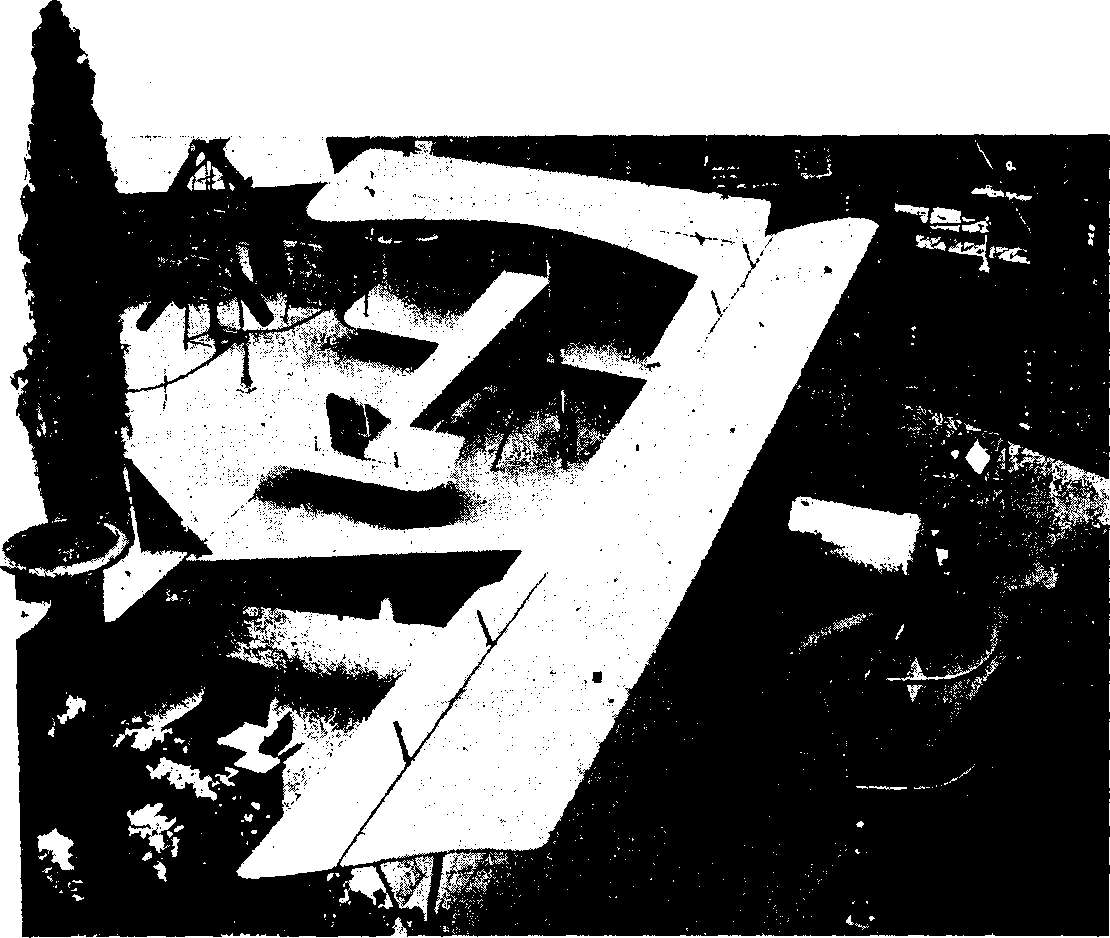 üoupy. Oben: der kleine Doppeldecker von 6 m Spannweite. 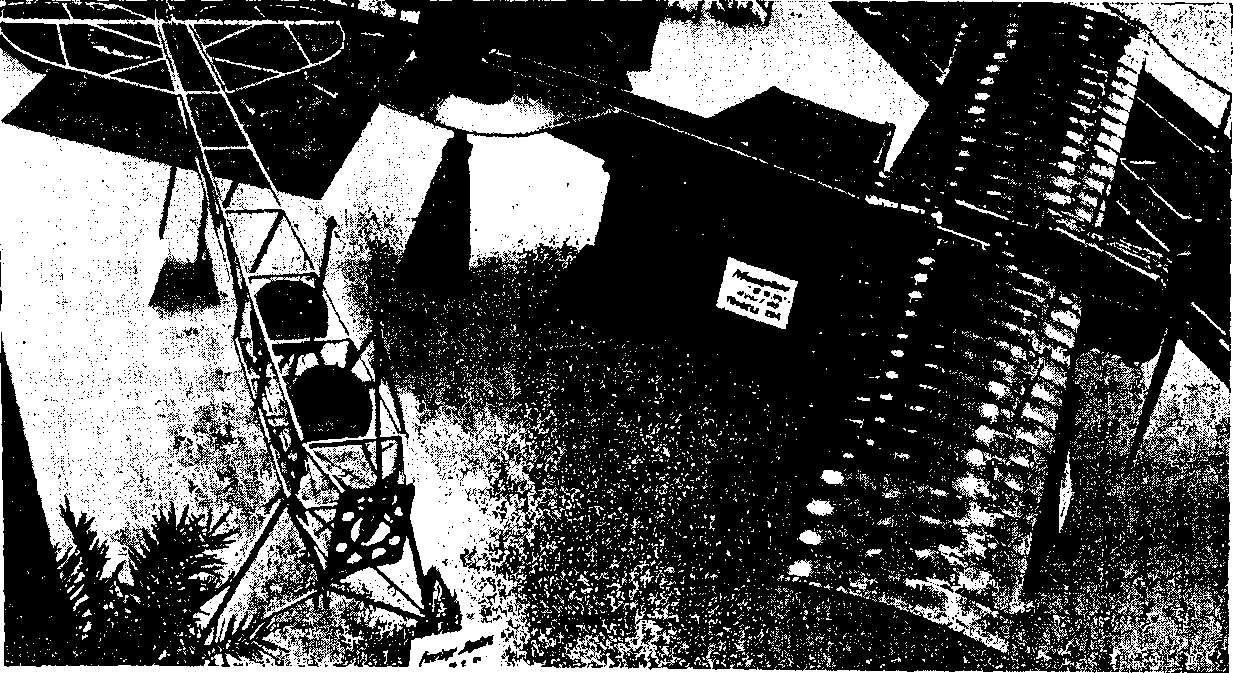 Esnault Peltene. erfolgreichen Konstruktionen, u. a. den Apparat von Helen, mit welchem er den Rekord von Fourny um dem Michelin-Preis drückte, bei dem er in 39 Tagen (ca. 533 km) 20895 km zurücklegte. Ferner sehen wir einen wesentlich neuen Typ ähnlich dem Apparat von Moräne Saul-nier. Nieuport hat bekanntlich die Lizenz des Dunne-Zweideckers erworben. Ein solcher Zweidecker, der unseren Lesern bekannt ist, ist gleichfalls ausgestellt. Besonders bemerkenswert ist ein Eindecker, bestimmt für militärische Zwecke, bei dem Führer- und Beobachtersitz nebeneinander liegen. Die Abb. auf Seite 960 zeigt einen Blick von oben in den Insassenraum. An der rechten Seite ist ein Hotchkiss-Maschinengewehr montiert. * i Die Flugmotoren im Salon. Auch die Entwicklung des Motorenbaues schreitet parallel mit der Entwicklung der Flugmaschinen in Frankreich vorwärts. Die Erfindertätigkeit hat gegen das Vorjahr noch zugenommen. Man sieht i auf einigen kleinen Ständen verschiedene neue Motoren-Konstruktionen in Erstlingsausführung, über deren Zukunft man nichts weissagen kann., Jedenfalls sind sehr gute Ideen dabei.*) Die bisherige Bevorzugung verschiedener Motorenkonstruktionen durch Heer und Marine und; der gute Geschäftsgang der letzten Jahre kommt in der reichhaltigen Ausstattung einzelner Stände zum Ausdruck. Es sind dies der wassergekühlte Salmson - Motor der luftgekühlte Renault - Motor und der bekannte Rotationsmotor von Gnom. Der Clou der Motoren im Salon ist der Monosoupape, Einventilmotor Gnom. Dieser Motor, der seinen Vorgängern äußerlich fast gleicht, besitzt kein Einlaßventil. Die Luft wird durch das gesteuerte Auslaßventil angesaugt < und erhält nach Beendigung der Ansaugperiode durch Kanäle in der Nähe der Cylinderbefestigung das Benzingas zugeführt. Hiernach schließt sich das Auslaßventil; es erfolgt die Kompression, die Explosion und der Auspuff durch das Auspuffventil. Durch das Ansaugen von kalter Luft durch das Auslaßventil wird dasselbe auserordentlich intensiv gekühlt. Eine der Hauptverbesserungen beim Monosoupape ist der mittels Handrad verstellbare Ventilhub. Man kann während des Betriebes vom Führersitz aus die Gaszufuhr durch Veränderung des Ventilhubes in geradezu wunderbar einfacher Weise regulieren. Diese Konstruktion bedingt selbstverständlich einen auserordentlich geringen Benzinverbrauch gegen früher. Durch Wegfallen des Ansaugventiles ist gleichzeitig der bisherige üebelstand: das Herausschleudern des Oeles durch die Zentrifugalkraft vermieden. Der Oelverbrauch ist demnach bei dem Einventilmotor ebenfalls ein geringerer. *) Nach einer Mitteilung der Ausstellungsleitung finden, zufolge einer Verfügung des französischen Handelsministers, die Bestimmungen des Gesetzes vom 13. April 1908 und der Verordnung vom 17. Juli desselben Jahres, betreffend den zeitweiligen Schutz des gewerblichen Eigentums auf Ausstellungen, auf die zu der Ausstellung zugelassenen patentfähigen Erfindungen, Zeichnungen und Modelle, sowie auf die Fabrik- und Handelsmarken Anwendung. gsport", Organ der Flugzeug-Fabrikanten u. Flugtechn. Vereine 1913. Tafel XXXI. Albatros-Militär-Doppeldecker. 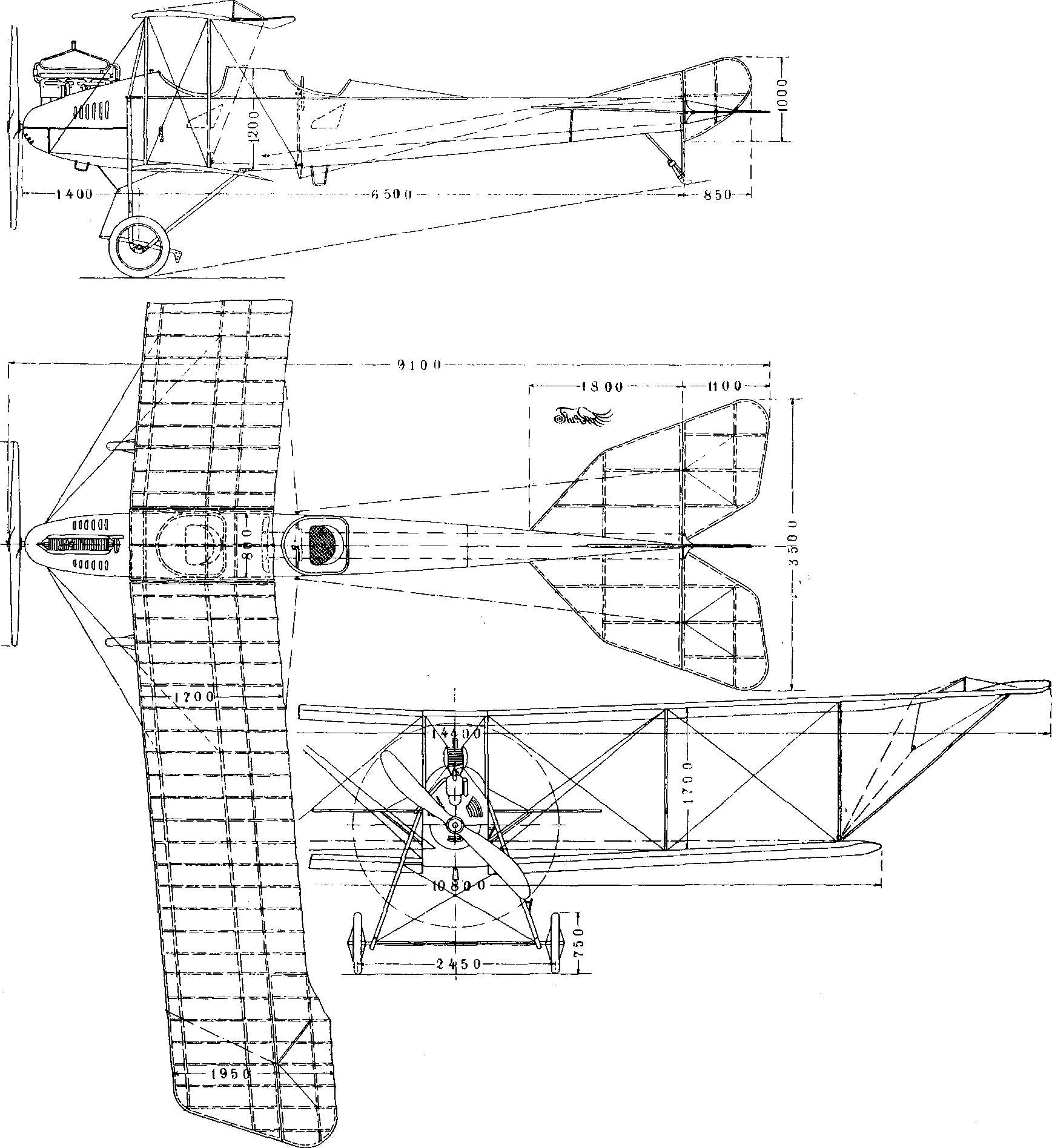 Nachbildung verboten. Gnom arbeitet schon seit Jahren an der Ausgestaltung dieser Konstruktion. Auf dem Ausstellungsstand sind 4 verschiedene Versuchsmotoren zu sehen. Nebenstehende Abbildung zeigt den 100 PS. 9 Zylinder Einventilmotor (Monosoupape). (Fortsetzung folgt.) Johannisthaler Brief. (Von unserem Johannisthaler Korrespondenten.) Regen und Sturm! Unter diesen Wetterzeichen standen die letzten Wochen. Es ist also kein Wunder, wenn das Knattern der Motore, das Rauschen der Propeller hier in diesen Tagen wenig oder garnicht gehört wurde. Einige Neu-Konstruktionen, wie der Ago-Eindecker, der Hanuschke-, der Westphal-Eindecker, die noch im Stadium der Probeflüge stehen, warten günstigere Witterung für weitere Ausflüge ab. Die L. V. G. baut an einem neuen Eindecker, den der tüchtige Konstrukteur Ing. Schneider — wie das bei ihm 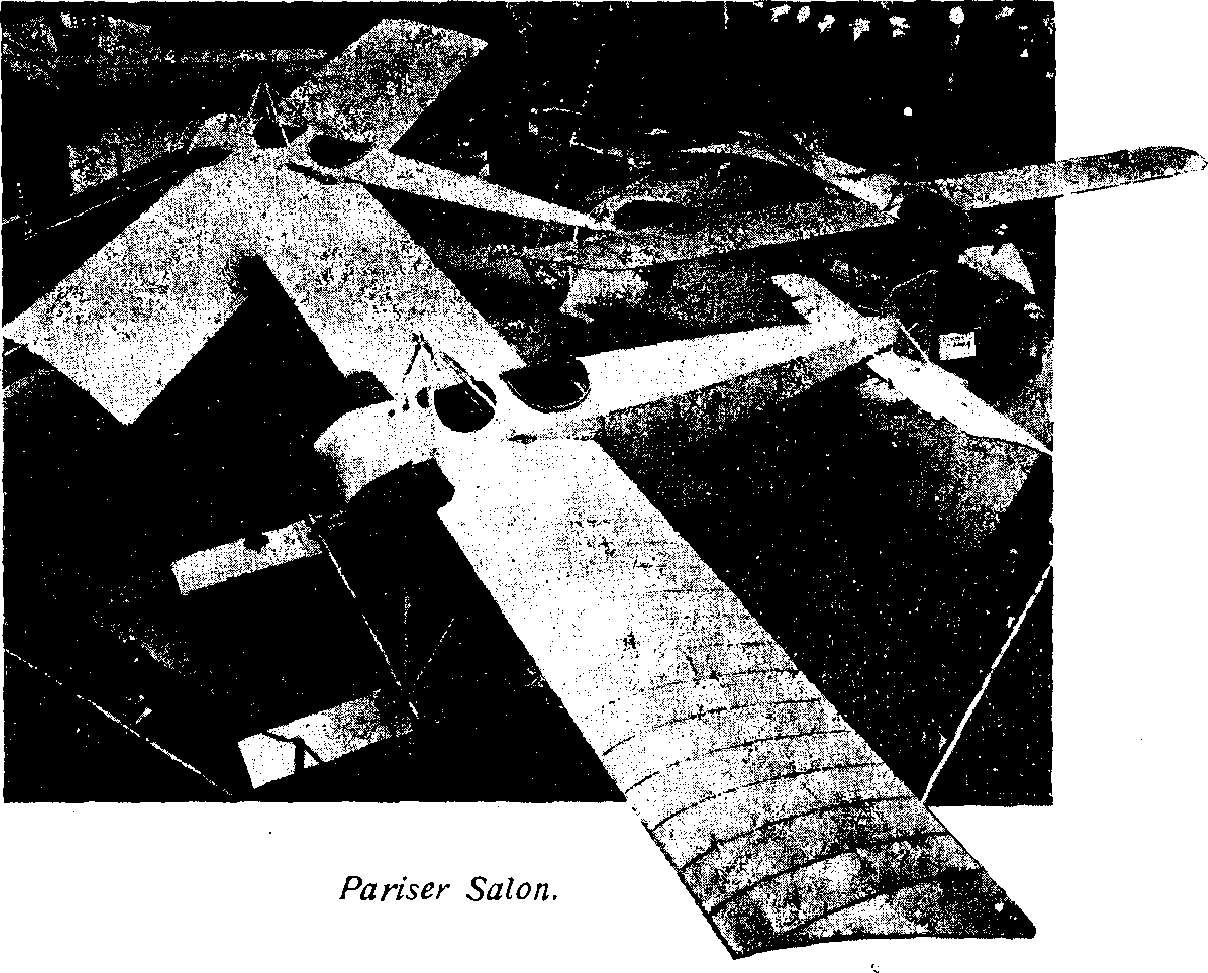 Barel. Links oben: Militär-Eindecker. Rechts oben: Eindecker mit Propeller am' Schwänzende. Unten: Wassermasdilne Typ Deaaville. gang und gäbe ist — nicht eher aus der Fabrik herausläßt, als bis er vom Flugplatz weg flott und sicher in sein Element taucht, die sonst übliche Sprungperiode einfach übergehend, Flieger Krieger construiert an einem eigenen Eindecker, die Albatros-Werke bauen ein combiniertes Wasser- und Landflugzeug, (Typen, Hirn- uu<J lk»i»|Mi>lertKi-> Iii. Marine^wccko. \>m fliegende A lliai.ros .B(jqI wird nebenher weil.ci «crvollkommnet. Die Deutsche VerHiiehsari.siali für J/tiftrl'ahii, in .Atllersliol vergrößert ihre Khiricli hingen bedeutend. i;'r<if, Ing. 1-tüixJeoiaon bereuet dort schon alles für die nächste M<itoren-Prüfung Mim KaitteiprciH 1914 vor. Die Lnftreisen der h'ran/osen nach dem Orient haben hier anfeuernd gewirkt Einig« deutsche Flieger, so Wieting (Rumpler-Ein-i lecker j Krieger (Harlai' tiiwleeker und eig. Emuecker-Constrnktioii) scheinen nicht übel Lust zu haben, im Süden ihre Leistungen zn zeigen. Der „Bund Deutscher Flugzeugführer" wartet noch immer auf die Antwort seitens des „Deutschen iaiftfahrer-Verbandes". Wie erinnerlich, hat der Bund an den vD. L.-V." die Bitte gerichtet, in allen Kommissionen, welche den Flugsport angehen, seine Repräsentanten zuzuziehen. — lieber allen Sonder-Interessen muß immer der Wunsch stehen, dem großen Ganzen. - Der deutschen Fliegerei, dein deutschen Flugsport — zu dienen, und wenn die Parteien nicht allzu streng auf ihren Prinzipien fußen, sondern auch mal einen Pflock zurückstecken, dann läßt sich mit dem nötigen guten Willen auf allen Seiten auf jeden Fall Greifbares erreichen. — Der „Reichsflug-Verein" hatte am 28. November eine außerordentliche Generalversammlung. In dieser wurde der langjährige Flug-zeug-Construkteur Prof. .Reißner, früher Aachen jetzt Berlin zum I. Vorsitzenden erwählt. Der Reichsflug-Verein wird also nunmehr von von einem tüchtigen Verfechter des „Systems schwerer als die Luft" geleitet. Die Begründung des Major v. Parseval dahingehend, daß der Verein viele Mitglieder deshalb verloren habe, weil er keine eigene Zeitung, mehr habe, sondern die „Deutsche Luftfahrer-Zeitschrift" halten müsse, dürfte nicht ganz stichhaltig sein. Es sind andere Gründe- für diese Austritte maßgeblich gewesen, die besser ~~J' unerörtert bleiben. —- Interessant war es, zu konstatieren, daß bei einer vom Reichsflug verein unter ca. 800 Mitglieder veranstalteten Rundfrage, welches Organ offiziell werden sollte, 339 Antworten eingingen. Von diesen lauteten: 108 Stimmen für die Zeitschrift für ,Flugtechnik u. Motorluftschiffahrt' 63 ,. ,, ,, ,, ,, den „Motor" 101 „ ,, „ „ „ ,. „Flugsport" (i7 ., „ „ ,, „ die ,Deutsche Luftfahrer-Zeitschrift' Trotzdem wurde von der Versammlung ein im Hinblick auf die kleine Mehrheit von 7 Stimmen eingebrachter Antrag, die Umfrage an die Mitglieder zu wiederholen und hinsichtlich entgegenkommender Bedingungen für den Bezug des „Flugsport" mit dem Verlag zu verhandeln, kurzer Hand übergegangen. ----- — — Helmuth Hirth hatte nach seiner Rückkehr vom Italienischen Wasserflug-Wettbewerb einen Urlaub angetreten. Dieser Tage ist er erst davon in Johannisthal wieder eingetroffen. Es hat den Anschein, als ob mit unserem Flugmeister etwas vorgeht, man weiß nur nicht recht was. - - Der „Verein Deutscher Motorfahrzeug-Industriellen" tritt bereits mit aller Gründlichkeit in die Vorarbeiten zu den auf seiner letzten Versammlung beschlossenen Ausstellungen ein. Anmeldungen gehen FLUGSPORT." Seite mi schon jetzt ans den Industrie-Kreisen zahlreich ein und dürften auch für die beabsichtigte flugtechnische Separat-Ausstellung nicht spaylicher einlaufen. Es ist unter allen Umständen notwendig, daß wir, 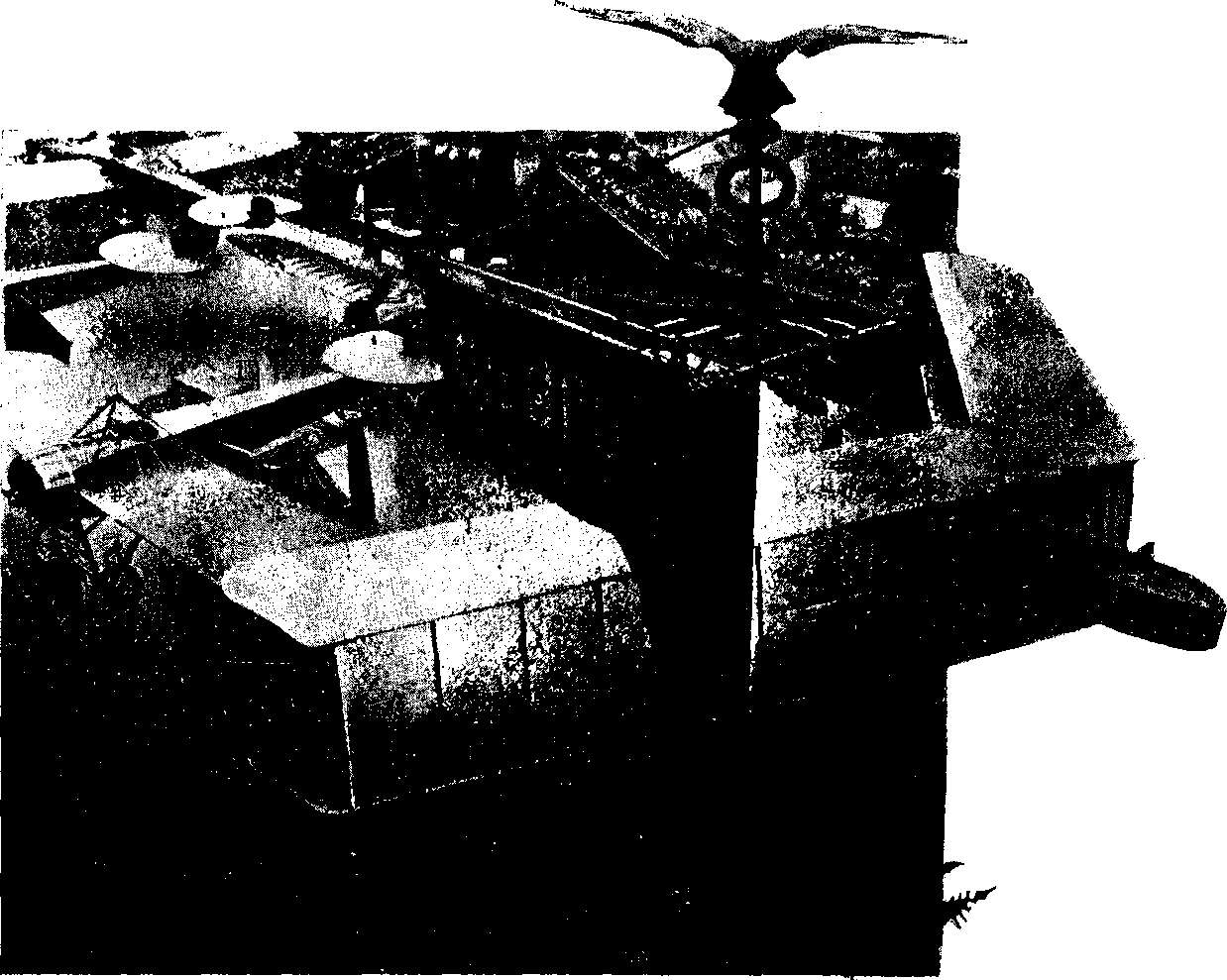 Pariser Salon. Nicaport Rechts der Dunne-Zweidecker. o .__ 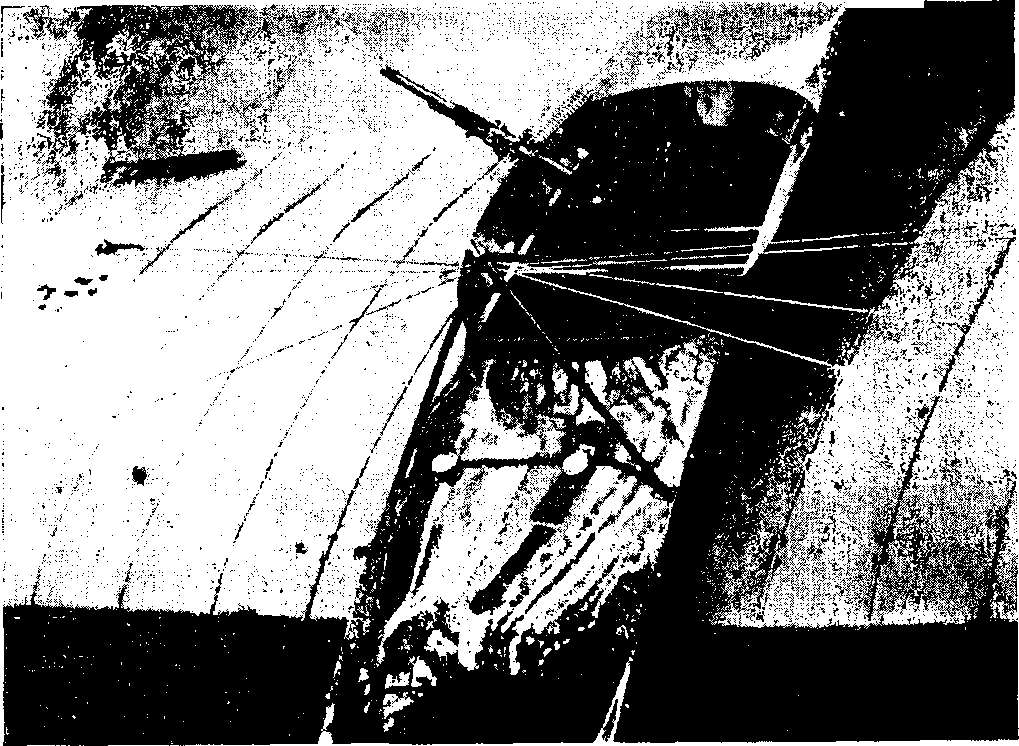 Pariser Salon. Masdiinengewehranordnung im Militär-Nieuport-Eindecker. nachdem die großen Flüge der Nationalflugspende die Erzeugnisse unserer nationalen Flugzeug-Industrie als durchaus konkurrenzfähig auf dem internationalen Markt erwiesen haben, in einem reichen Gesamtbild unser gesamtes Können dem In- und Ausland vor Augen führen. — Der Ostmarkenflug, der von Breslau über Posen, Königsberg und Danzig gehen soll, ist am 28. November in einer Sitzung der Delegierten der Ostgruppe des D. L. V. beschlossen worden. In Thorn, Bromberg, Schneidemühl, Graudenz, Allenstein und Insterburg sind Kontrollstationen vorgesehen. Was der zu einer ständigen Jahres-Veranstaltung gewordene Prinz Heinrich-Flug jetzt schon dem Westen des Vaterlandes ist, das möge der Ostmarkenflug dem Osten dasselbe werden! Geheimrat Aßmann, der verdienstvolle Leiter des Observatoriums Lindenberg wendet seine große Erfahrung der Ausgestaltung eines zweckmäßigen Netzes von Leuchtfeuern für die Luftfahrt zu. Die geplante Vergrößerung des Verkehrs- und Baumuseums (Eisenbahnwesens, Sammlungen des Wasserbaus, Hochbaus) der Reichs-haüptstadt läge es nahe, auch den neuesten Verkehrsmitteln, den Flugzeugen, eine gesonderte Abteilung zu widmen. Wir haben noch keine einzige große öffentliche Sammlung, welche die Entwicklungsphasen der deutschen Flugtechnik zeigt. Wohl existieren einige kleine instruktive private Modell- etc. Sammlungen, aber sie sind natürlich nicht so lückenlos und geordnet zu gestalten, wie ein Museum, das der Staat finanziert und unterhält. Die größte Zahl der Aufstiege hatte im Monat November auf dem Flugplatz Johannisthal der Fluglehrer der Sportflieger G. m. b. H. Reiterer (Etrich-Taube). Die längste Flugzeit erzielte Fluglehrer Hans auf L.-V.-G. mit 26 Std. 1 Min. Die Gesamtzahl der Flüge betrug 4325, die Gesamtdauer der Flüge 450 Std. 33 Min. Das sind bemerkenswerte Zahlen. Im November 1911 wurden auf dem Flugplatz 1051 Flüge mit einer Gesamtdauer von 139 Std. 20 Min. unternommen. Auf nieine Anfrage wurde mir im Preuß. Kriegsministerium ausdrücklich erklärt, daß die von einer Korrespondenz verbreiteten Nachrichten über einen von der Militär-Verwaltung beabsichtigten Bau von Flugzeugen in eigener Regie unwahr seien. Dies zur Beruhigung allzu ängstlicher Gemüter. Pariser Brief. Von unserem Pariser Korrespondenten.; Wenn auch die Vorbereitungen zu der großen jährlichen Heerschau des Flugwesens, zum Pariser Salon, die interessierten Kreise außerordentlieh stark in Anspruch genommen haben, wenn auch die Aufmerksamkeit gerade in diesem Jahre, aus mehrfachen Gründen, auf diese Manifestation der Flugzeugindustrien konzentriert war, hat man dennoch nicht unterlassen, den täglichen Nachrichten über den Stand der grossen Weltflüge entgegenzusehen, jenen Meldungen, die umso spärlicher wurden, je schwieriger sich die projektierten Luftreisen gestalteten und je un- wahrscheinlicher es wurde, daß das ersehnte Ziel des Flugunternehmens in Wirklichkeit erreicht werden wird. Nachdem Daucourt in Koniah abgestürzt ist, entspann sich zwischen der Ligue Nationale Aerienne und den französischen Vertretern in der Türkei ein lebhafter Üepeschenwechsel, in dem seitens der letzteren der Fortsetzung des Fluges entschieden widerraten wurde. Natürlich paßt das der Liga recht wenig, denn sie möchte sich die gute Reklame die sie durch die kostspielige Organisation schon im voraus recht hoch bezahlt hat, nicht entgehen lassen. Jetzt heißt es neuerdings, dass Daucourt 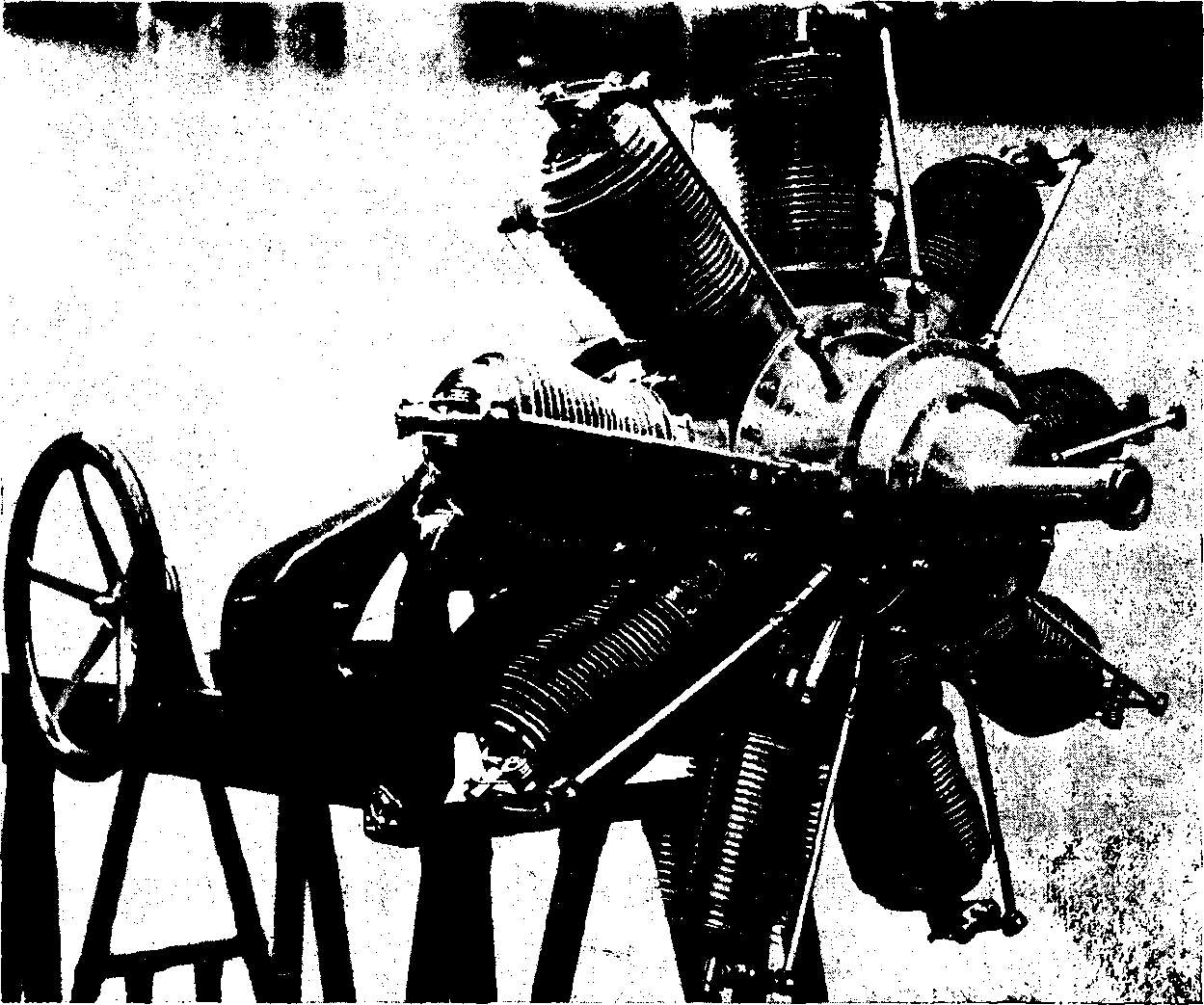 Pariser Salon. Der neue Einventil (Monosoupape) Gnome Links: Das Stellrad zur Veränderung des Ventilhubes. und Roux telegraphisch um Nachsendung eines neuen Flugzeugs gebeten haben, um ihre Reise fortsetzen zu können. Es scheinen sich aber gewisse unüberwindliche Schwierigkeiten zu ergeben, da sich niemand findet, welcher das Risiko der zweiten Maschine übernehmen will. Auch von ßonnier, der auf einem Nieuport-Eindecker einen Tourenflug unternommen hat, dessen Ziel er selber nicht geahnt hat, hört man wieder; er hat die Karpathen übersetzt und wollte sich nach Bukarest begeben, erlitt aber in der Nähe von Crajova einen Unfall, den er selbst auf das Konto des Nebels setzt. Am letzten Freitag ist Bonnier nun wirklich in Bukarest eingetroffen und dort hat er erklärt, daß er nach Kairo weiterfliegen wolle. Für den „großen Vedrines" haben die Tageszeitungen wieder eine stehende Rubrik ein- gerichtet: im Triumphator-Stil meldet der kleine Mechaniker von jeder Ortschaft aus, die er nach widerholten vergeblichen Versuchen mit Ach und Krach endlich erreicht, seinen „großartigen Erfolg" und jedesmal giebt er dabei ein neues „Projekt" zum besten. Am vorigen Dienstag verließ er Wien und langte nach einer mühseligen Reise in Belgrad an, wo er der Oeffentlichkeit verkündete, daß er beim Ueber-fliegen der Festung Peterwardein von ungarischen Soldaten beschossen wurde, was ihn gezwungen habe, auf 3000 Meter Höhe zu gehen. Von Belgrad flog Vedrines nach Sofia, von wo er telegraphierte: „Ich habe mich länger als eine Stunde mit dem König unterhalten." Ueb-rigens hat Vedrines den König Ferdinand mit der gewiss beruhigenden Versicherung begrüßt: „Sir, ich bringe Ihnen den Frieden!" Von Sofia ging Vedrines am Freitag früh wieder ab und richtete sich bei starkem Rückenwind nach Philippopel. Er soll dabei 160 km in 40 Minuten zurückgelegt haben. Er passierte Adrianopel, näherte sich den Dardanellen und landete abends nach 5 Uhr auf dem Flugplatz von San Stefano bei Konstantinopel. Noch romantischer ist eine Weltreise, die soeben Marc Pourpre unternimmt, und zwar von Kairo nach Chartum und zurück und wieder ist es die Ligue Nationale Aerienne, welche diesen Flug organisiert. Pourpre, den sie mit der Mission betraut hat, ist in der vergangenen Woche bereits von Marseille nach Port Said abgefahren, wohin auch sein Flugzeug nachgeschickt worden ist. Von Port Said will Pourpre nach Kairo fahren, wo der Start für seinen phantastischen Flug erfolgen soll, und zwar wahrscheinlich am 15. ds. Mts. Sein Flug solb ihn über Alexandrien, Assuit, Luksor, Assuan, Uadi, Haifa, Abu Pfaiped, (nach Ueberquerung der nubischen Wüste), Berber nach Chkrtum. führen. Die gesamte projektierte Strecke hat ein Ausmaß von 4,400 km, also genau die Entfernung von Paris nach dem Nordpol. Und während sich so ein Teil der französischen Flieger draußen in der Gottes weit mehr schlecht als recht herumquält, grassiert hier das '* , Sturzflugfieber immer noch fort und es giebt bald keinen Piloten mehr, der noch den Kopf oben behält und sich mit dem normalen Fliegen begnügt. Dex große Meister Pegoud ist nun auch, mit Ehren und Schätzen beladen, heimgekehrt und hat bereits auf dem Flugfelde von Buc eine kleine Separatvorstellung gegeben, zu der sich aber nur wenige Neugierige eingefunden hatten Ausserdem hat er sich in der Sorbonne bei einem Vortrage über das Flugwesen den Zuhörern „vorführen" lassen. Die übrigen Sturzflieger sind andauernd bei der Arbeit, zum Teil hier, zum Teil auswärts. Hanouille macht seine „looping the loop"-Flüge in Buc, Chanteloup produziert sich in Amsterdam, Huoks in London, und Chevillard zeigte seine Sturzflugkunst in Antwerpen, wäre dabei aber beinahe das Opfer eines schweren Unfalls geworden. Als er vor einer zahlreichen Menge seine Flugexperimente ausführte und sich eben mit dem Flugzeug in der Luft überschlug, blieb jilötz-lich der Motor stehen, sodaß der Apparat zur Erde stürzte, wo er in Trümmer ging'. Chevillard selbst erlitt dabei mehrfache Verletzungen, von denen einige, wie die letzten Nachrichten lauten, ziemlich bedenklich sein sollen. Wenn schon dieser „Sturzflug" nicht ganz programmmäßig verlaufen ist, so ist noch von einem anderen No. 25 F lj 1J (J S P 0 K T." Seiten S*U unfreiwilligen Sturzflug zu melden, der den bekannten Flieger Kost betraf, der aber einen glücklichen Verlauf nahm. Das Abenteuer Kost's ereignete sieh auf dem Flugfelde von Etampes, wo der Flieger im Begriff war. den bisherigen Höhenrekord (den Perreyon mit 5 8511 Metern inne hatte) anzugreifen. Als Rost in ungefähr 4 500 Meter Höhe war, sah er sich plötzlich von einem Wirbelwinde erfaßt. Er verlor vollständig die Kontrolle über sein Flugzeug, welches, zuerst heftig geschüttelt, in gefährlicher Weise zu schwingen begann, um schließlich mit der Spitze nach unten sich der Erde zu nähern. Je näher aber das Fingzeug der Erde kam, desto weniger heftig wurden Keine Bewegungen und in 800 Meter Höhe konnte Rost, nachdem er sich mit seinem Apparat unfreiwillig zweimal überschlagen hatte, Herr über die 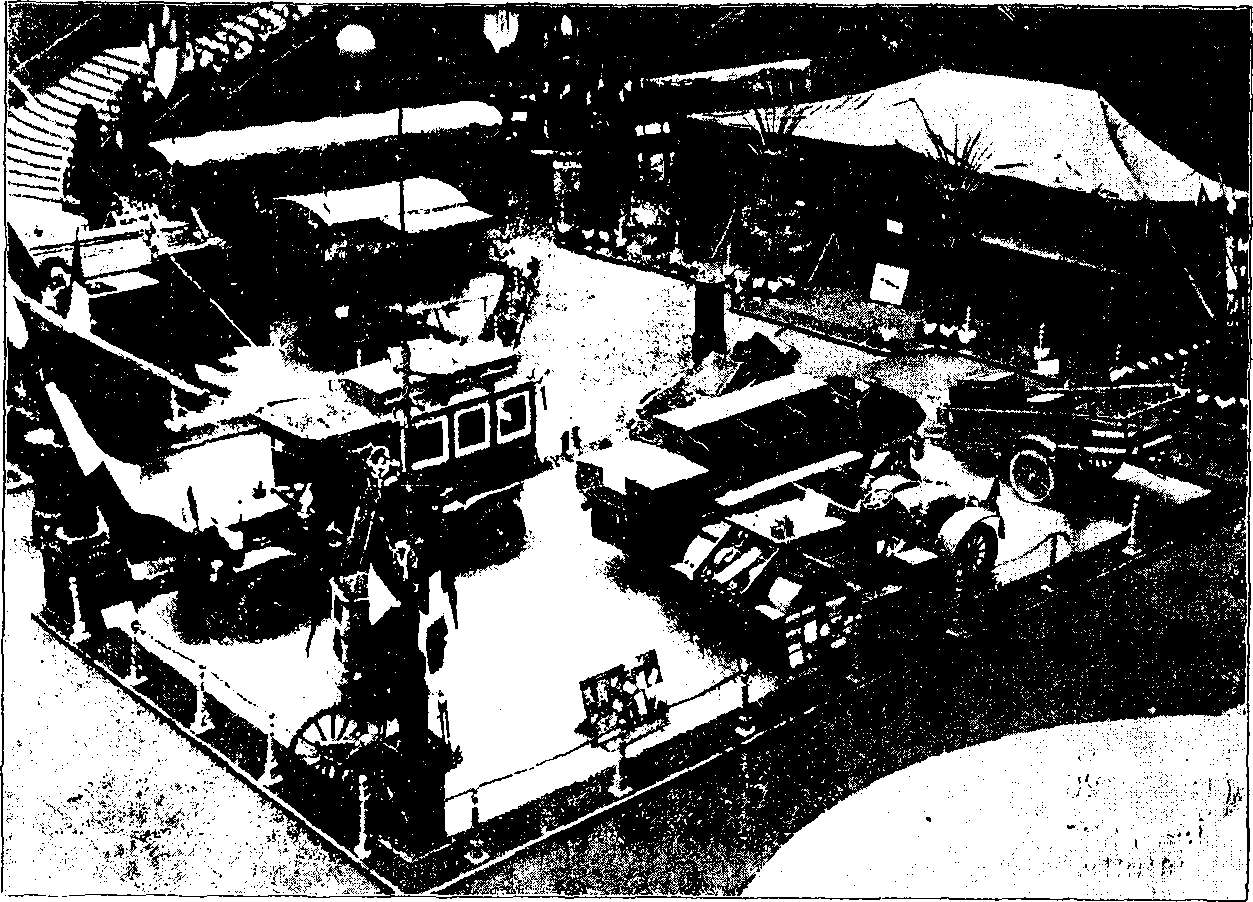 Pariser Salon. Stand der französischen Heeresverwaltung. Maschine werden. Der Vorgang wurde vom Flugfelde aus beobachtet und man schwebte Augenblicke lang in großer Furcht um das lieben de« Fliegers, der aber aus diesem ungewollten Sturzflug Abenteuer völlig unversehrt hervorging. Unglücklicher erging es dem bekannten IMcViot sehen Ohof Piloten Perreyon, einem der besten Flieger, welcln Frankreich besaß. Es ist beklagenswert und man. könnte es fast ai> eine Ironie des Schicksals bezeichnen, auf welche Weise dieser w Miolit.e Flieger sein .Leben eingebüßt bat. Kr, der so oft in. hefl.i/.-v.i) Slnini geflogen war, der (loa Hohem ekord mit fiSöO Metaro »itf-vv.NieHt. Im),, der in Italic», auf der Strecke Turm -Korn --Trin'n, iilmr du- <','.■ I'.i Iii'lleben A {»Minine.n liinwr«.;', den Wrli.-■ S.'^.ss;ei;ie''~äv"k< n..! >,nl I ϖ'DU km -im'Magen hatte, er mul.lie anf ;lern gtswolmtwi PlngfcM entern windstillen sonnigen Tag«, wenige Meter vom I Soden entfernt. am Schlüsse eines bis dahin normal verlaufenen Abstieges infolge heftiger Landung sein Leben einbüßen, indem der Motor ihn erdrückte. Perreyon versuchte einen zweisitzigen Eindecker, der einen Vierzehnzylinder 100 PS Gnom-Motor zum Antrieb hatte. Viel Glück mit ihrem Wiedereintritt ins Flugwesen hatte die Baronin de Laroche, die vielgeprüfte, die sich von ihrem letzten Automobilunfall, bei dem Gabriel Voisin sein Leben einbüßte, wieder erholt zu haben scheint. Sie startete kürzlich um den Femina-Pokal und vermochte dabei auf ihrem Zweidecker Maurice Farman mit einer Leistung von 323,500 km den weiblichen Distanzrekord aufzustellen, der bisher mit 200 km Madame Pallier gehörte. Wie erinnerlich, tat die Baronin Raymonde de Laroche am 8. Juli 1910 in Reims im Verlaufe des dortigen Meetings einen furchtbaren Sturz, der sie zwang, zwecks ihrer Wiederherstellung dem Fliegen zu entsagen. Später erlitt sie den erwähnten Automobilunfall, von dem sie sich noch nicht ganz erholt hat. Trotzdem kehrte sie wieder auf den Flugplatz zurück, und wie gesagt mit beachtenswertem Erfolge. Unter großen Ehrungen ist dieser Tage die endgiltige Zuteilung des Pommery-Pokals an Brindejonc des Moulinais erfolgt. Zu diesem Zwecke hatte die Lique Nationale Aerienne ein großes Bankett veranstaltet, zu dem zahlreiche offizielle und bekannte Persönlichkeiten aus Industrie und Handel erschienen waren. Der Stifter des Pokals, der Marquis de Polignac überreichte dem siegreichen Flieger die Trophäe persönlich. Ein häßlicher Streit scheint sich nun wieder um den Michelin-Pokal zu entspinnen; anscheinend geht kein französischer Bewerb mehr ohne einen solchen ab. Wie berichtet, hatte es Helen unternommen, gegen den von Fourny aufgestellten Rekord zu diesem Pokal (15,989,200 km) zu starten und er wählte dazu dieselbe ötrecke: Etampes—Gidy—Etampes. Helen hatte während 30 Tagen aus der genannten Strecke eine Gesamtdistanz von nicht weniger als 16096,600 km hinter sich gebracht, und zwar ist das die offizielle Zahl, denn in Wirklichkeit sind es nahezu 21 000 km die er durchflogen hat; aber die Flüge der ersten Tage sind wegen Verstoßes gegen das Reglement als ungültig erklärt worden. Mit dieser grandiosen Leistung galt Helen allgemein als Sieger des Michelin-Pokals, denn es war ausgeschlossen, daß in der kurzen Zeit bis zu Ende dieses Jahres ein anderer Flieger noch besseres vollbringen konnte. Fourny verhielt sich völlig ruhig und ließ nichts verlauten. Erst als Helen, der eigentlich noch weiter seine Runden fortsetzen wollte, durch das eingetretene Nebelwetter veranlaßt wurde, endgiltig aufzugeben und sich mit der obigen, offiziell anerkannten Zahl zu begnügen, trat Fourny mit einem Protest hervor, den er offenbar von langer Hand vorbereitet hat. Er behauptet, daß seine „Runde" mehr als 101,200 km gemessen habe (das ist das Ausmaß der Runde, die Helen innehielt) und daß er somit gegen seinen Rivalen noch einen Vorsprung von 200 km habe. Dieser Vorfall erregt hier das peinlichste Aufsehen. Man begreift nicht, daß die Kommissare des Aero-Club sich einer solchen Nachlässigkeit haben schuldig machen können und andererseits wird allseitig das Auffällige besprochen, daß Fourny mit seinem Einspruch so lange gewartet hat bis Helen zu fliegen aufgehört hat, sodaß es zu spät wäre, die Sache zu reparieren. Jedenfalls wird die Angelegenheit noch sehr viel Staub aufwirbeln, denn es fehlen nicht Stimmen, die von einer verwerflichen „Schiebung" sprechen, jzu der sich die verantwortlichen 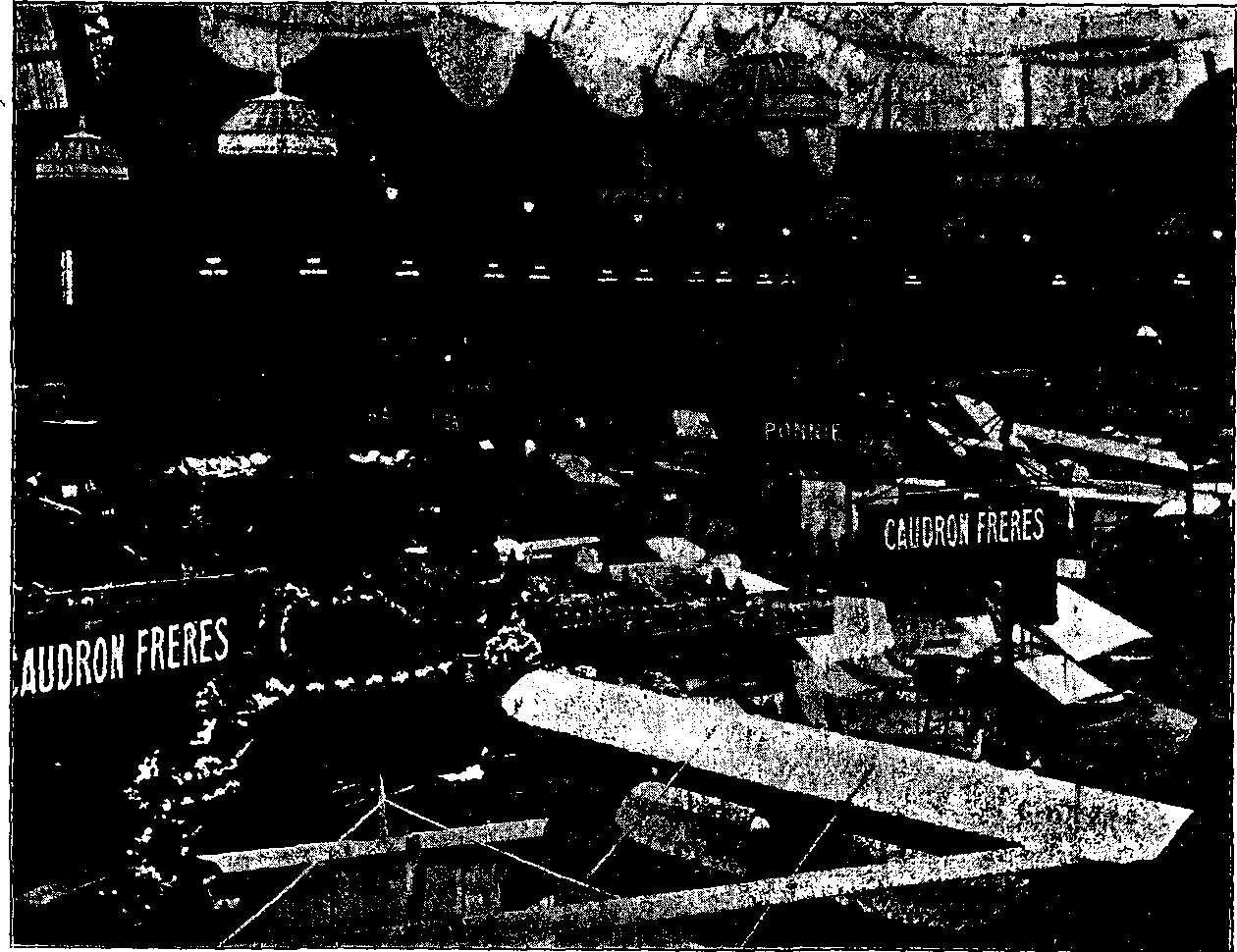 Pariser Salon. Blick in den rechten Flügel. Personen hergegeben, indem sie das Maß der Flugstrecke absichtlich falsch angegeben haben. Natürlich sind das nur leere Vermutungen, für die sich wohl schwerlich ein Beweis wird beibringen lassen, aber solche Vorgänge, wie dieser und wie derjenige gelegentlich des Pomery-Pokals, sind allerdings geeiguet, die Freude der Flieger an der Teilnahme an solchen Bewerben empfindlich herabzudämpfen. Das Originellste ist, daß man ernstlich davon spricht, daß Helen, falls in der Tat festgestellt wird, daß die ihm angegebene Flugstrecke nicht das offiziell angegebene Maß hat und er deshalb des Michelin-Preises verloren gehen sollte, den Aero-Klub regreßpflichtig machen will, und es besteht kein Zweifel, daß in diesem Falle der Klub verurteilt werden wird, den Preis an Helen aus seiner Tasche zu bezahlen. Jedenfalls sind diese Vorkommnisse charakteristisch: . . . . Es sei daran erinnert, daß die diesjährigeuLeistungen um den MichiJin-Pokal recht ansehnliche waren. Es flogen am 24. April .... Duval 864 km 16.—18. Juni . . . Cavelier 2,109 „ 29. Juli bis 6. August Cayelier 7,096 „ 25. Aug. bis 16. Sept. Fourny 15,989 „ 21.—22. Sept. . . Fischer 910 „ 23.-25. Sept. . . . Duval 1,922 „ 24.-25. Sept. . . . Fischer 1,113 „ 5.-7. Okt. . . . G-ugenheim 1,821 ,. 22—30. Okt. . . . Helen 4,797 „ 31. Okt. bis 30. Nov. Helen 16,096 „ die bisherigen Sieger diese Trophäe waren: 1908 Wilbur Wrighl., 1909 Henry Farman, 1910 Tabuteau und 1031 Helen. Auch in das französische Militärflugwesen wird demnächst neues Leben kommen. Nicht nur, daß der neue Che f'j der General Bernard, umfassende Oi'ganisationspläne hegt, die dem Militärflugwesen einen neuen Elan geben sollen, auch der Senat will demnächst auf Anregung des auch als Flieger bekannten Senators Reymond in öffentlicher Diskussion die angeblichen Mißstände im Flugwesen, sowie die Mittel zu deren Abhilfe beraten. Man erwartet hier einige recht anregende Debatten. Das Programm des neuen Chefs ist folgendes: Strenge Trennung des Flugwesens von der Luftschiffahrt; Aufhebung der drei Gruppen von Versailles, Reims und Lyon, welche durch zwei große Flugzentren in Reims und Dijon ersetzt werden sollen. Jedes dieser beiden Zentren wird ein Spezial-FIieger-Regiment mit vollständiger Atelier-Einrichtung erhalten : Autonomie der Luftgeschwader mit Bezug auf die Verwaltung; gleichmäßige Type aller Militärflugzeuge, um auf diese Weise homogene Geschwader zu bekommen und das Material zwischen sämtlichen Geschwadern auswechseln zu können ; Errichtung eines Zeutral-Etablissements in dar Gegend von Bourges; Errichtung dreier großer Fliegerschulen in Pau, Avord und Reims, mit einer höheren Schule in Saint-Cyr; Verringerung der Chefs, Aufstellung einer Spezialtaktik für die neue Waffe. Zum Schlüsse sei noch ein Projekt des Aoro-Club de France erwähnt, das hier ziemlich große Bewegung hervorruft, schon weil man den Plan als undurchführbar oder als unzweckmäßig bekämpft. Es handelt sich nämlich um einen großen Wassert! ugzeugbewerb für welchen der Aero-Club die Strecke von Dunkeri]ue nach .1-jiuivil.z, die französischen Küsten entlang, in Aussicht genommen hat. .Die Konstrukteure und Flieger widersprechen dieser Idee fast durchweg, weil sie die projektierte Strecke als viel zu lang und zu schwierig ansehen. Sie plädieren für eine andere Strecke, vielleicht eine Runcl-strecke im Kanal, mit Etappen an der französischen und an der englischen Küste, oder eine Strecke wie Bordeaux-Biarvitz oder Boulognc-Saint Malo, diese letztere mit Etappen in Ha vre, Üeauvillc, Cherbourg und üinard. Interessant, ist, <la(.i der Vertreter clor Konstrukteure in einer Sitzung des Aero-Club, die clor Beratung dieses Projekts gewidmet war, sieh dahin geäußert hat, daß die Konstrukteure sich gern an „einer Demonstration von "Wasserflugzeugen", nicht aber an einem Bewerb beteiligen wollten, der an diese Art von Maschinen Anforderungen stelle, die sie noch nicht zu erfüllen imstande seien. Rl. Aus den englischen Flugcentren. Auf dem Gebiete des Flugwesens, namentlich des Marine-Flugwesens, hat sich die englische Presse großes Stillschweigen auferlegt. Von Zeit zu Zeit erschienen in den hiesigen Tageszeitungen kurze Nachrichten, wonach die Flugzeugwerke Gebr. Short ein großes "Wasserflugzeug für die Marine konstruieren. Es ist bekannt, daß die Short-"Werke nur für die Marine Flugzeuge bauen und sich an Konkurrenzen fast garnicht beteiligen. Erst jetzt nachdem diese Maschine bereits nach gutverlaufenen Probeflügen wieder verpackt worden ist und sich auf dem "Wege nach Aegypten befindet, dringen weitere Einzelheiten derselben an die Oeffentlichkeit. Halbamtliche Mitteilungen lauten, daß der Flieger Mc. Olean versuchen wird, mit diesem Apparat den Nil hinaufzufliegen. Sollten sich die Versuche bewähren, so wird man demnächst auch in Alexandrien Stationen für Wasserflugzeuge errichten. Wäre diese Expedition rein sportlicher Natur, so würde sicher die Presse ebenso wie in Frankreich die Reklametrommel eifrig in Gang gesetzt haben. — — Aus was für einem Grunde sollten auch die Sörth-Werke eine Maschine nach dem Nil schicken, hat England nicht Wasser genug, um ein Wasserflugzeug auszuprobieren ? Es verhält sich hier ebenso, wie bei den vorgeschlagenen Schiffbauferien seitens des englischen Marineministers. Heute so, und morgen gerade das Gegenteil, aber es wird ruhig weitergebaut. Auf dem neuen Short-Apparate ist ein Schnellfeuergewehr kleinen Kalibers aufgestellt, ähnlich dem, mit welchem Major Lewis vor einigen Tagen auf der Salisbury-Ebene von einem Farman-Doppeldecker aus Schießversuche machte, die sehr befriedigend ausfielen. Es gelang dem Major aus 12 Schüssen 10 ins Ziel zu bringen. Soviel bekannt ist, unterscheidet sich die Maschine nicht wesentlich von den Short-Konstruk-tionen. Die Tragflächen haben 23 m Spannweite und können nach einem neuen patentierten Verfahren der Firma nach hinten an den Gitterträger zurückgeklappt werden. Der Flugzeugkörper springt weit nach vorn vor und hat Sitzgelegenheit für vier Personen. Der Raum kann natürlich auch für den Transport von Munition verwendet werden, was sehr warscheinlich klingt. Hinter den Sitzen ruht auf einem Unterbau ein 200 PS Motor. Die Maschine wiegt mit Führer und drei Fluggästen sowie Betriebsstoff für einen 4 stündigen Flug 1800 kg. Nachdem Sikorsky mit seinem Riesendoppeldecker bereits erstaunliche Resultate erzielt hat, scheinen sich auch die englischen Flugzeugkonstrukteure dem Großflugmaschinenbau zuzuwenden. So bauen die Sopwith-Werke eine Wasserflugmaschine, die den Dimensionen der russischen Maschine wenig nachsteht. Der Doppeldecker hat eine Spannweite von 27 m und erinnert an die Konstruktion des Sopwith-Flugbootes. Motor, Sitze und Betriebsstoff sind jedoch nicht wie bei dem Flugboote, im Boote selber untergebracht, sondern zwischen den Tragflächen, wo ein Flugzeugkörper, ähnlich der Sikorsky-Konstruktion mit eingeschlossener Kabine, angebracht ist. Die Kraft zum Betrieb dieser Maschine wird durch zwei 120 PS Austro-Daimler-Motoren erzeugt, die im hinteren Teile des Rumpfes nebeneinander aufgestellt, durch eine Kettentransmission eine vier-flügelige Druckschraube antreiben. Neben dem Führersitz befindet sich der Sitz des Telegraphisten für drahtlose Telegraphie. Der Telegraphenapparat wird nicht durch die großen Motoren der Maschine, sondern durch einen kleinen an der Außenseite der Kabine angebrachten Motor betrieben. Die Schwimmkörper die diesen Apparat tragen, sind zwei sieben Meter lange Boote, die auch beim Sopwith-Flugboote Verwendung fanden. Die Probeflüge dürften in diesen Tagen vor sich gehen und sieht man denselben in hiesigen Fachkreisen mit großem Interesse entgegen. Auch die Marineverwaltung interessiert sich lebhaft für diese Konstruktion. Einen herben Verlust hat die Marineflug-Abteilung durch den Tod des Flight-Commandeurs Capitain Wildmann-Lushington erlitten, der am 2. Dez. auf dem Flugplatze der Marine zu Eastchurch (Isle of Sheppey) mit einem M. Farman-Doppeldecker abstürzte. Es war der Flieger, welcher den Mariherninister das Fliegen erlernte und denselben stets begleitete. Oaptain Longcroft von der 2. Squadron des Royal Flying Corps Militaery Ming zu Montrose der erst kürzlich einen Rekord aufstellte, indem er einen Non-Stop-Flug von Farnborough nach Montrose ausführte, hat sich abermals hervorgetan, indem er einen Non-stop Recordflug Montrose—Farnborough Portsmouth—Farnborough ausführte. Er flog um 9 Uhr morgens von Montrose ab, passierte York um 11 Uhr, flog von hier über Farnborough direkt nach Portsmouth drehte dort um und landete in Farnborough um 4:10. Die zurückgelegte4 Strecke betrug 1040 km. Der Apparat war ein „BE"-Doppeldecker No. 218 konstruiert für die Militärverwaltung nach deren Entwürfen von der Bristol Aeroplane Co. Der Apparat ist ein gewöhnlicher Doppeldecker mit 70 PS Renault-Motor. Als Fluggast begleitete Capt. Longcroft Ltn. Col. Sykes, von der Militärkommission für das Flugwesen. Zu melden ist ferner, daß Louis Bleriot auf dem Flugplatze zu Brooklands bereits Schuppen erworben hat, um dortselbst eine regelrechte Flugzeugfabrik zu errichten, um den vielen Anfragen seitens englischer und colonial-englischer Flieger nachkommen zu können. Der General-Manager der Bleriot-Werke Mr. Norbert Chereau, gab mir die Information, daß Bleriot selber die neue Abteilung für längere Zeit leiten will. Auch die „Deutschen Flugzeugwerke" haben einen Schuppen gemietet und unter der Aufsicht des Managers Herrn Cecil Kny ist ein D.F.W.-Doppeldecker liier eingetroffen, der demnächst von Herrn Roempler geflogen werden wird. Bekannt sein dürfte schon durch die Presse, daß es dem jungen Flieger Temple gelang, noch vor Rucks Pegoud's Rückenflüge zu No 2b „FLUGSPORT." Seite 970 wiederholen. Hucks gab auf dem Flugplatze zu Hendon Demonstrationen, die aber mit einem Fiasko für die Veranstalter, die Grahame White Aviation Co endete. Die Zahl der Zuschauer war verschwindend klein, man scheint hier anders zu denken^ wie in Deutschland! — —  #4 Auslden engl. Flugcentren. Oben: Avro Doppeldecker. Unten: Qrahame White-Sport-Anderthalbdecker „Lizzie" Die englischen Flugzeug-Industriellen haben sich in letzter Zeit äußerst rührig gezeigt, Die Avro-Werke traten mit einem neuen Militärtyp-Doppeldecker an die Oeffentlichkeit, der 128 km Geschwindigkeit in der Stunde entwickelt. Grahame White hat ebenfalls eine weitere Maschine zusammengestellt. Diesmal eine einsitzige Sportmaschine. Aus der obenstehenden Abbildung ist ersichtlich, daß der Apparat der Moräne Saulnier-Konstruktion nachgeahmt ist. Hier sind jedoch nicht nur wie beim Santos-Dumont-Bindecker die Tragflächen höher gelegen, sondern unter dem Rumpfe noch eine kleine Fläche angebracht, sodaß ein Anderthalbdecker entstanden ist. Auch die Sopwith Werke haben neben dem Wasserflugzeug noch einen kleinen Sportdoppeldecker herausgebracht, der sich unter der Führung von Hawker als eine sehr brauchbare Maschine erwiesen hat. Der Apparat hat zwei nebeneinander angeordnete Sitze und erregte durch seine nette Ausführung Interesse. England will eben nicht hinter den anderen Staaten zurückstehen. Lord. Der neue Albatros Militär-Doppeldecker. Auf Grund langjähriger Erfahrungen im Flugzeugbau haben die Albatros -Werke eine neue Militär - Maschine herausgebracht. Der Fachmann erkennt auf den ersten Blick, daß es sich um ein Serienfabrikat handelt, bei welchem alle Details auf das sorgfältigste durchkonstruiert sind. Auf eine möglichst automatische Stabilität wurde der größte Wert gelegt. Dieselbe wurde durch die Kombination der anderthalbdeckerartigen Tragdeckenanordnung in Verbindung mit verwundenen Flügenden des Oberdecks erreicht. Die Tragflächen sind 39 qm groß, mit Drahtseil verspannt und für Transportzwecke leicht abnehmbar eingerichtet. Das Oberdeck hat eine Spannweite von 14,4 m und das Unterdeck eine solche von 10,8 ni. Um die Wetterbeständigkeit zu erhöhen und die Luftreibung zu vermindern, ist die Tragflächenbespannung emailliert. Die Stabilität der Tragzelle wird außerdem noch durch die V-Stellung der Tragflächen beträchtlich gehoben. In das geteilte Unterdeck ist der 800 mm breite Motorrumpf von torpedoartiger Form eingeschoben. Vorn befindet sich ein teilweise mit einer Aluminiumblechhaube verdeckter 100 PS 6 Zylinder Mercedes, der von einem Windhoff-Scheitelkühler gekühlt wird. Auf der Schraubenwelle sitzt eine Luftschraube von 2,7 m Durchmesser. Hinter dem Motor unter der gewölbten Blechhaube sind die Hilfsreservoire für Benzin und Oel untergebracht. Dieselben können vom Fluggast jederzeit kontrolliert werden. Im Rücken desselben sind die Hauptresevoire zwischen Begleiter- und Führersitz eingebaut. Vor demselben befindet sich eine Militärhandradsteuerung nebst den erforderlichen Orientierungshilfsmitteln. Der Motorrumpf weist keine einzige Verspanhung in seinen Längswänden auf. Dieselbe wird durch eine Sperrholzbeplankung ersetzt, wodurch der ganze Aufbau eine ganz bedeutende Festigkeit erreicht, ohne die von der Verspannung hervorgerufenen Materialbeanspruchungen in Kauf nehmen zu müssen. Am konisch verjüngten Rumpfende sind die Steuerflächen für Höhen-und Seitensteuer angebracht. Die Dämpfungsfläche ist etwas tragend angeordnet und besitzt 2,6 qm Flächeninhalt. An dieselbe schließen sich die beiden Höhensteuerklappen von insgesamt 2,4 qm an, sodaß der Gesamtflächeninhalt der Schwanzfläche 5 qm beträgt. Das 0,8 qm große Seitensteuer ist zwischen den Höhensteuerklappen angebracht und überragt an der Ober- und Unterseite das Rümpfende. Zur Unterstützung des hinter- lästigen Gewichtes ist eine kleine mit Gummiringen abgefederte .Schleifkufe angebracht. Das Fahrgestell ist sehr kräftig und einfach ausgeführt. Auf jeder Seite des Rumpfes befinden sich zwei profilierte Holzstreben, die unten in einem gemeinsamen Stahlblechschuh endigen. An demselben ist die Radachse mi II eis endloser Gummischnüre elastisch aufgehängt. Die Begrenzung Albatros-Militär-Doppeldecker. der Achsendurchfederung wird durch zwei an den Stahlblechschuhei» befestigte Drahtseilbügel bewirkt. In der Mitte der Radachse ist eine Hebelbremse angebracht, die von den Insassen zur Verkürzung des Auslaufs betätigt werden kann. Das Leergewicht der Maschine ohne Betriebsstoff beträgt 630 kg. Mit 170 1 Benzin, 20 1 Oel und 2 Insassen wird ein Gesamtgewicht von 950 kg erreicht, wobei die Maschine eine Maximal-Geschwindig-keit von 110 km pro Stunde entwickelt. Die Auslaufsstrecke beträgt bei "Windstille 40, der Anlauf 60 m. Der Rumpler-Wasser-Eindecker. Rnmpler hat unter Verwendung seiner Normalien für Landmaschinen einen Marine-Eindecker herausgebracht. Derselbe besitzt 2 Schwimmer von 4 m Länge, die in einem Abstand von 3 m unter Vermittlung von 4 Hanptstreben mit dem Rumpf verbunden sind. Die Schwimmer sind 40 cm hoch und 80 cm breit. Zur Unterstützung des hinterlastigen Gewichtes sind unter dem Schwanz zu beiden Seiten der Schleifkufe 2 kleine Hilfsschwimmer angeordnet. Die Maschine besitzt bei 14,5 m Spannweite 34 qm Tragfläche. Die Gesamtlänge beträgt 10,2 m. Zum Betriebe dient ein 100 PS 6 Zylinder Mercedes-Motor Die Maschine wiegt mit Führer, Beobachter und Betriebsstoff für I Stunden 980 kg. Es ist dies die gleiche Maschine, mit welcher Linnekogel den bereits gemeldeten Flug über Berlin ausführte. Seite 973 FLUGSPORT. No. 25 7J Neuer Rumpler-Eindecker. Seit einiger Zeit wird in einem Rumpler-Eindecker ein 70 PS Mercedes-Motor mit hängenden Cylindern ausprobiert. Der Einbau des Motors und die sich ergebende günstige Anordnung geht aus den Abb. Seite 976 hervor. Die, bei einer Umkehrung des Motors wesentlichste technische Schwierigkeit, die Regulierung der Oelung ist in bester Weise derart gelöst, daß jedem einzelnen Lager und jedem Zylinder durch besondere Leitungen genau so viel Oel zugeführt wird, als notwendig ist. Auch bei längeren Flügen hat die neue Oelung zu keiner Beanstandung geführt. Es hat sich aber herausgestellt, daß der Motor wesentlich weniger Oel verbraucht, als ein Motor mit oben angeordneten Cylindern. Für den Flieger bedeutet die neue Anordnung einen erheblichen Fortschritt. Er hat einen freien Ausblick nach vorn und seine Brille, wird nicht wie bisher durch Oel, Wasser und dergleichen bespritzt. Doch nicht nur für den Flieger ist dies, sei es bei Start, bei der Landung, oder zur Orientierung von großer Wichtigkeit; auch dem Fluggast nutzt fast noch mehr die neue Anordnug, vor allem auch, wenn er aus der Flugmaschinen fotografieren will. Zweiffellos wäre der hängende Zylinder bei einer heftigen Landung leichter einer Beschädigung ausgesetzt. Die Rumpler-Werke haben ihn deshalb mit einem schützenden Eisenrahmen umgeben, dersichbishergut bewährt hat. Nr. 584. Dietrich, Richard, Mannheim, geb. am 28. März 1894 zu Mannheim; für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 8. November 1913. Nr. 585. Hoefig, Walter, Düsseldorf-Stockum, geb. am 18. Januar 1889 zu Hamburg, für Eindecker (Kondor), Flugplatz Gelsenkirchen, am 8. November 1913. Nr. 586. Neubauer, Richard, Berlin N., geb. am 5. Juli 1893 zu Berlin; für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 10. November 1913 Nr. 587. Bruno, Max, Mainz, geb. am 9. Mai 1891 zu Berlin; für Zweidecker (A. E. G.), Flugfeld Teufelsbruch bei Nieder-Neuendorf, am 11. November 1913. Nr. 588. Müller, Ernst, Oberlt. z. S., Putzig b. Danzig, geb. am 11. März 1889 zu Rendsburg; für Zweidecker (L. V. G.), Flugplatz Johannisthal am 12. November 1913. Nr. 589. Schröder, Friedrich Karl, Hamburg, geb. am 16. November 1881 zu Lehnin; für Eindecker (Hansa-Taube), Flugplatz Hamburg-Fuhlsbüitel, am 12. November 1913. Flugtechnische 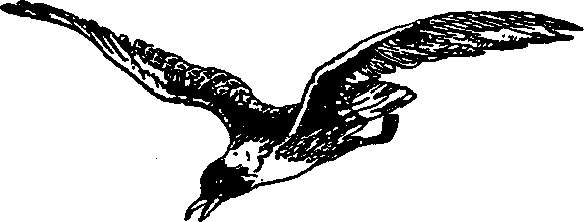 Rundschau. Inland. Flugfilhrer-Zeugnisse haben erhalten: Nr. 590. v. Weiher, Rieh., Eberswalde, geb. am 24. Oktober 1890 zu Charlottenburg; für Eindecker (Hansa-Taube), Flugplatz Hamburg-Fuhlsbüttel, am 12. November 1913. Nr. 591. Hellerscheidt, Hans, Mechaniker, Berlin-Baumschulenweg, geb. am 5. Dezember 1889 zu Berlin ; für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 12. November 1913. Nr. 592. Anders, Gerhard, Bln.-Lichterfelde, geb. am 23. August 1895 zu Kottbus; für Eindecker (Jeannin-Stahlhaube), Flugplatz Johannisthal, am 12 November 1913. Nr. 593. Michalowitz, Curt, Johannisthal, geb. am 17. Juli 1891 zu Berlin; für Eindecker (Jeannin-Stahlhaube), Flugplatz Johannisthal, am 15. November 1913. 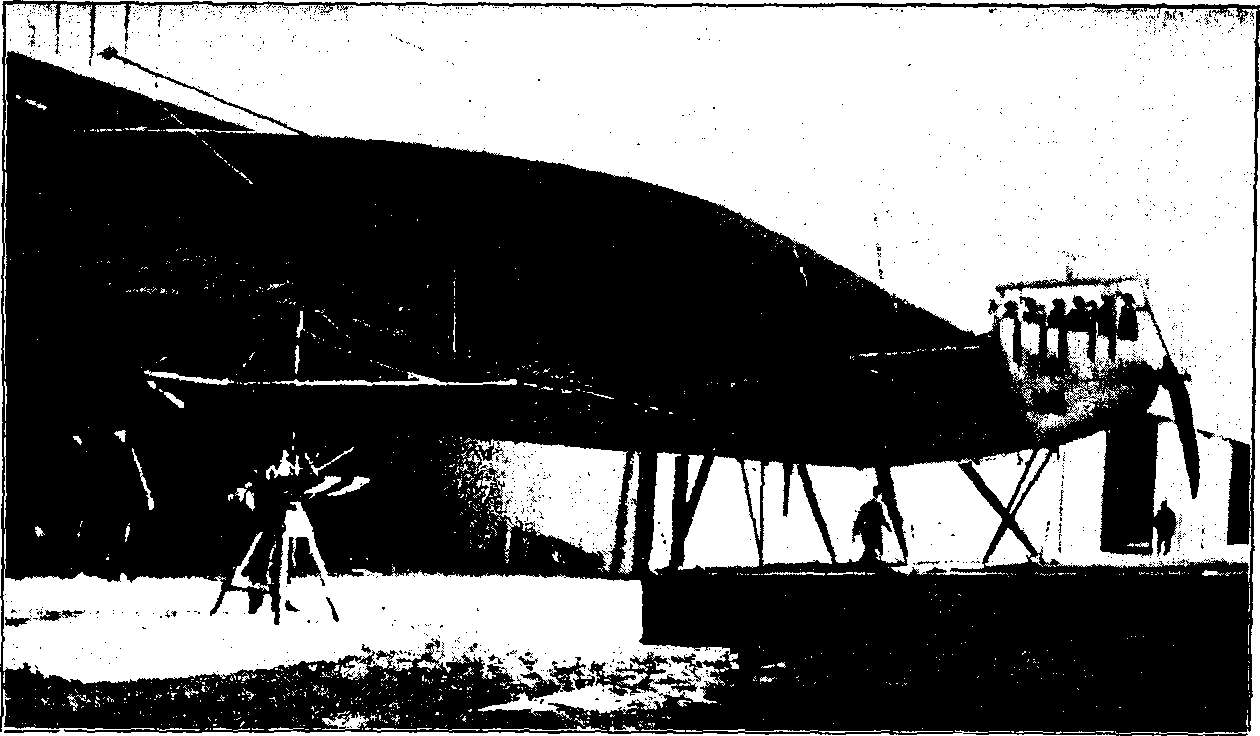 Rampler-Marine-Eindecke). (S. 972) Nr. 594. Ziegler, Günther, Johannisthal, geb. am 9. Februar, 1892 zu Deutsch-Lissa; für Zweidecker (L. V. G.), Flugplatz Johannisthal, am 15. November 1913. Nr. 590. Kulich, Erich, Techn., Johannisthal, geb. am 21. September 1889 zu Neukölln, für Zweidecker (L. V. G.), Flugplatz Johannisthal, am 15. Nov. 1913. Nr. 596. Steffen, Franz, Ingenieur, Neumünster, geb. am 20. Februar 1887 zu Gaarden; für Eindecker (Steffen-Falke), Flugplatz Neumünster, am 15. November 1913. Nr. 597. Meiß, Heinrich, Mainz-Gonsenheim, geb. am 26. Januar 1893 zu Würzburg; für Eindecker (Goedecker-Taube), Flugplatz Großer Sand be' Mainz, am 15. November 1913 Anerkannte Rekords. Der Dauerrekord mit 2 Passagieren über 6 Stunden 16 Min. 30 Sek., ausgeführt von Sch ir rm e is t er am 12. November, wurde von der Fäderation Aeronautique Internationale als Weltrekord anerkannt. Ferner wurde der Weltrekord von Gsell mit 3 Passagieren über 3 Stunden 11 Min. 14 Sek. bestätigt. Seite_975_„FLUGSP ORT."_____No._25 Von den Flugplätzen. Vom Flugplatz llebxtoek Frankfurt a. M. Auf dem hiesigen Flugplatz sind dieser Tage beachtenswerte Leistungen vollführt worden. Der Flieger Schroeter flog am 3. Dezember unter Sportzeugen auf einem Anderthalbdecker der Deutschen Sommer-Flugzeug-Werke, G. m. b. H. Darmstadt mit Betriebsstoff für 4 Stunden ohne Fluggast in 7'/2 Min. auf 800 m Höhe. Bei einem zweiten Fluge erreichte er mit einem Fluggast auf 200 kg Belastung ergänzt und Betriebsstoff für 4 Stunden, in 15 Min eine Höhe von 800 m. Zum Betriebe dient ein 80 PS Gnom. Ferner flog Schäfer am 6 Dezember auf einem Eindecker eigener Konstruktion 4 Stunden mit Fluggast um die Nationalflugspende. Durch diesen Flug hat er 6000 M. an sich gebracht. Von den Leipziger Flugplätzen. Auf dem Flugplatz Mockau hat sich die Flugschule von Frl. Beerbohm niedergelassen. Die Schule steht unter der Leitung von Georgi. Zurzeit werden 5 Schüler auf Tauben und Gradeapparalen ausgebildet. Auf dem Flugplatz der Deutschen Flugzeug-Werke in Lindenthal bei Leipzig flogen am 26. November Sievert 2 Stunden und Höf ig 5 Stunden um die Nationalflugspende. Von der Wasserflugstation in Warnemünde. Der bekannte Bootskonstrukteur Oertz hat ein neues Wasserflugzeug herausgebracht, das vor kurzem in Warnemünde versucht wurde Dieses Flugzeug ist ein Doppeldecker und besitzt ein seetüchtiges Boot von ca. S m Länge> welches nur 120 kg wiegen soll Zum Betriebe dient ein 120 PS 6 Zylinder Argus-Motor, der mittels einer Gelenkkette die Kraft auf die Schraube überträgt. Der erste Probeflug mit einem Fluggast gelang vorzüglich. Das Flugzeug kam bereits nach 80 m vom Wasser ab. Militärische Flüge. Sergeant Grübbel flog am 27. Nov. mit Ltn. von der Elz als Beobachter auf einem'Aviatik-Doppeldecker mit 100 PS Argus-Motor um 8:44 vom Flugplatz Habsheim ab über Mainz nach Frankfurt. Nachdem er längere Zeit über Frankfurt gekreuzt hatte, flog er nach Darmstadt wo er 12:47 landete. Sergeant Grübbel erhält somit einen entsprechenden Anteil an die National-Flugspende Am 29. Nov. erfolgte der Rückflug. Von Döberitz nach Neustrelitz flogen am 26. Nov. Ltn. v. Blaue mit Ltn. Kempe als Beobachter auf einem Albatros-Doppeldecker. Lt. Geyer mit Major Siegert als Beobachter flogen am 4 Nov. auf einem Aviatik-Doppeldecker von Döberitz nach Gotha. Für Major Siegert schein! die Eisenbahn überhaupt nicht mehr zu existieren Schüler erreicht mit einem Fluggast 3400 m Höhe. Am 26. November startete Schüler auf einem Ago-Doppeldecker 6 Zylinder Argus-Moto: mit Kapitän-leutiiant Libman n als Beobachter 11 : 19 zu einem Höhenflug. In den unleren Luftschichten bis zu 1500 m hatten die Flieger mit einem heftigen Wind von 10 m zu kämpfen. Je höher die Flieger kamen umso ruhiger wurden die Luftschichten Die Höhe von 3400 m wurde in 1 Std. 49 Min. erreicht. Von Johannisthal nach Dresden—Leipzig—Johannisthal in 8 Stunden ohne Zwischenlandung flog am 27. November der Flieger Georg Hans auf L. V. G. Doppeldecker. Der Start in Johannisthal erfolgte 7: 50 vormittags und die Landung in Johannisthal 4 Uhr nachmittags. No. 25 „FLU G S P 0RT. 6 Stunden um die National Flugspende flog am 26. November Häusler auf Union-Pfeildoppeldecker 100 PS Mercedes 6 Zylinder Motor. Der Start erfolgte 10 Uhr vormittags in Teltow mit 1 Fluggast. Der Flieger umkreiste in 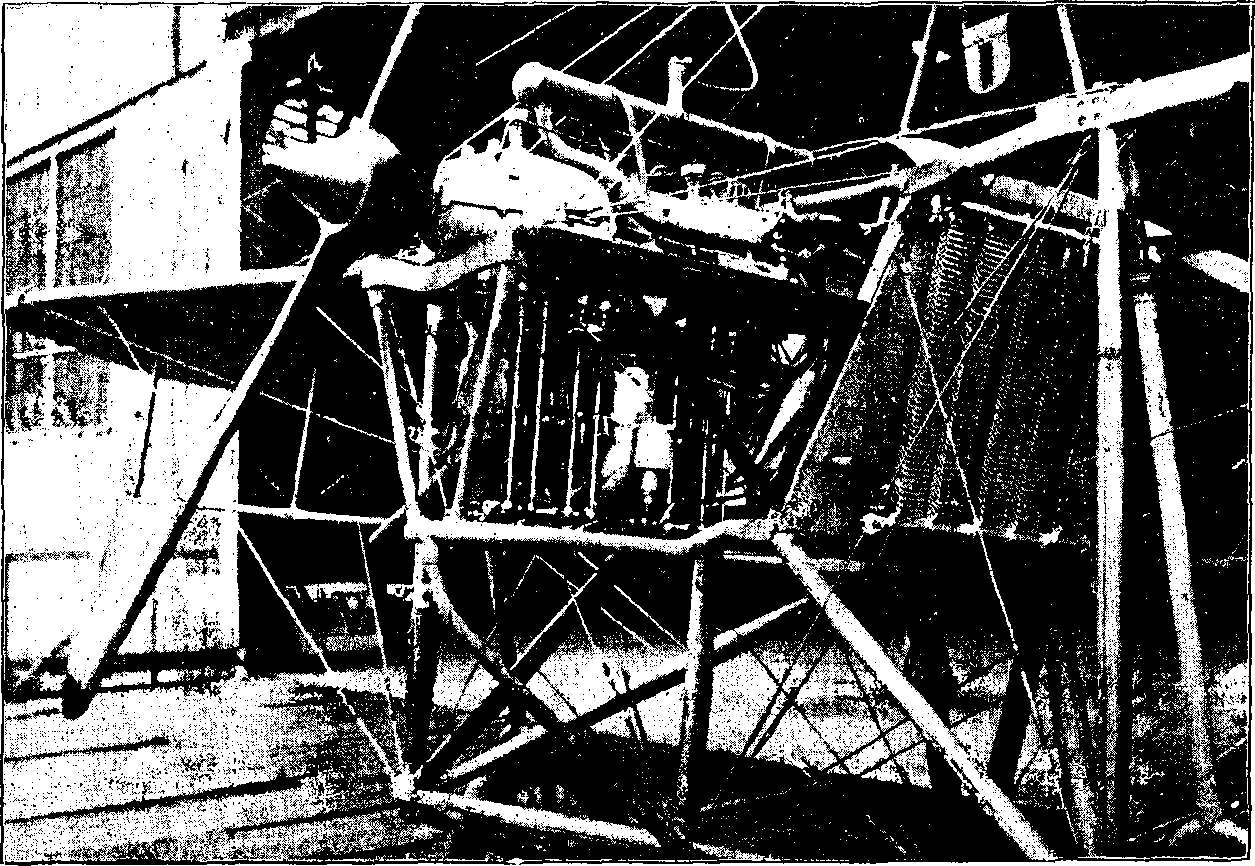 Motor mit hängenden Zylindern im Rumpler-Eindecker. (S. 973.) 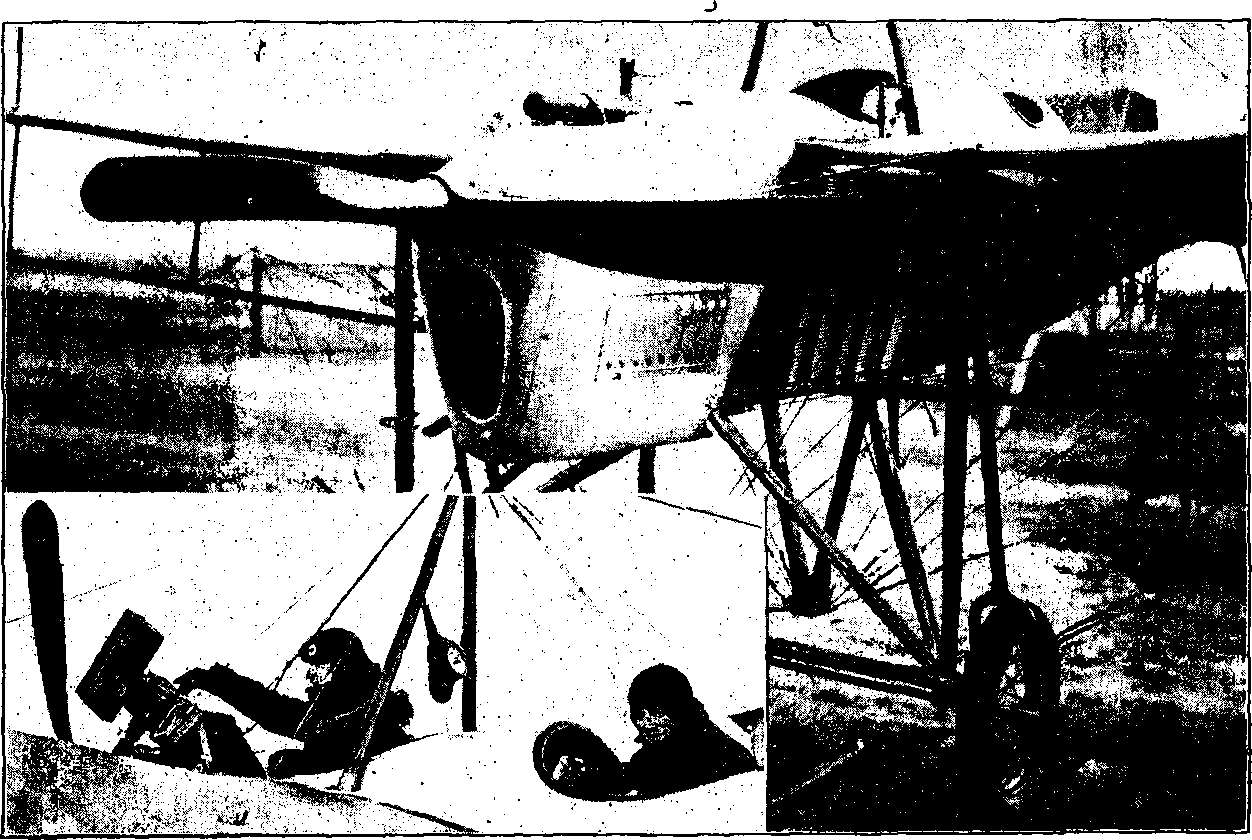 Neuer Rumpler-Eindecker. (S. 973) Unten links Einbau eines kinematogr. Apparates. großer Höhe den Flugplatz in weiter Umgebung, flog nach Johannisthal und von da Uber Berlin nach dem Teltower Flugfeld wieder zurück. Trotz des heftigen Windes flog Häusler bis zu Einbruch der Dunkelheit und landete 4 : 30 auf dem Flugfeld Teltow. _ Ausland. Neues von Orville Wright. Aus den Werkstätten von Wright ist in letzter Zeit verhältnismäßig wenig an die Oeffentlichkeit gedrungen. Neuerdings hat O. Wright eine Wasserflugmaschine herausgebracht. Die Maschine besitzt ein großes Boot aus Metall, welches 4 Personen faßt. Der Motor befindet sich unter den Sitzen. Zum Betriebe dient ein nur 60 PS.-Motor. Der Wasser-Doppeldecker konnte sich mit 3 und 4 Personen schon nach 50 m Anlauf erheben. Weiter wird berichtet, daß O. Wright einen neuen Apparat, der eine völlige Stabilität der Flugmaschine gewährleistet, erfunden hat. Den Lesern des „Flugsport" ist aus früheren Veröffentlichungen eine ähnliche patentierte Einrichtung von Wright bekannt. Curtiss will den Atlandlschen Ozean überfliegen. Anläßlich des Pariser Salon wurde erzählt, daß Curtiß große Anstrengungen macht seine Flugboote seetüchtig zu machen und sogar beabsichtigt, um die Seetüchtigkeit zu beweisen, den Ozean zu überfliegen. Das Flugzeug besteht aus 2 Gleitbooten und ist mit mehreren Motoren ausgerüstet. Curtiss beabsichtigt die Strecke Neufundland-Irland ohne Zwischenlandung zu durchfliegen. Voraussichtlich soll der Fing im August nächsten Jahres stattfinden Für die russische Marine sollen 400 Militärflugzeuge beschafft werden und zwar beabsichtigt man merkwürdiger Weise nur Deperdussin-Eindecker einzustellen. 360 Flugzeuge werden an russische Firmen vergeben, während der Rest an ausländische Firmen, die in Petersburg Filialen haben, in Auftrag gegeben werden soll. In Prankreich sucht man Militärpiloten. An die Regimenter ist ein Rundschreiben ergangen, durch welches junge Soldaten zum Uebertritt ins Militärflugwesen aufgefordert werden. Dieses Zirkular hat in Fachkreisen nicht gerade ermutigt. Man wirft die Frage auf warum die Flieger, die das Patent haben und eine größere Anzahl Mechaniker mit Motorenkenntnis, die in Corps zerstreut seien, nicht zur Betätigung im Flugwesen herangezogen werden. Verschiedenes. Ueber die Veredlung der 300000 Markpreise der National-Flugspende In der am 29. Nov stattgefundenen Sitzung des Kuratoriums der National-Flug-spende wurde über die Verteilung der 300000 Markpreise entschieden Hierüber teilt das Kuratorium folgendes mit: „In der vierten Verwaltungsausschußsitzung des Kuratoriums der National-Flugspende wurde beschlossen, in Anerkennung der unerwartet großen Leistungen der Zivil- und Militärflieger in dem Wettkampf um die von der National-Flug-spende ausgesetzten Preise für die Fernflüge sämtliche Preise zur Verteilung zu bringen. Nach dem bisher festgestellten Ergebnis kommen die Flüge in folgender Reihenfolge in Frage: 2078 Kilometer V. Stoeffler, Aviatik-Doppeldecker, 100 PS Mercedes, Mühl-hausen, 100000 Mark; 1506 Kilometer E. Schlegel, Gotha-Taube, 100 PS Mercedes, 60 000 Mark; 1371 Kilometer Dipl.-Ing. R. Thelen, Albatros-Doppeldecker, 100 PS Mercedes, Johannisthal, 50 000 Mark; 1228 Kilometer Oberleutnant Kastner, Albatros-Taube, 100 PS Mercedes, 40000 Mark; 1175 Kilometer Stiefvater, Jeannin-Stahltaube, 100 PS Argus, Johannisthal, 25 000 Mark; 1157 Kilometer Leutnant Geyer, Aviatik-Doppeldecker, 100 PS Mercedes; 15000 Mark; 1115 Kilometer W. Caspar, Gotha-Hansa-Taube, 100 PS Mercedes, 10000 Mk. Die Preisverteilung wird nach endgültiger Feststellung der genauen Entfernungen in feierlicher Sitzung des Kuratoriums der National-Flugspende am 18. Dezember 1913, zu der auch Prinz Heinrich von Preußen sein Erscheinen zugesagt hat, erfolgen. Rückgang des Cölner-Flugwesens. Dr. Hoos hat seine Werkstatt von Cöln-Merheim nach Hangelar b. Bonn verlegt. Die Ursache für diese Maßnahme sind die Verbotsschwierigkeiten der Militärverwaltung in Cöln. Den in Cöln ansässigen Flugunternehmen ist verboten, Flugschüler gewerbsmäßig auszubilden. Der noch in Cöln ansässige Flieger Falderbaum wird auch demnächst sich ein anderes Flugfeld suchen. Ein Schelde-Rhein-Wasserflugwettbewerb soll im nächsten Jahre stattfinden. Die Anregung hierfür geht von dem belgischen Aero-Club aus. Die deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, E. V., Adlershof, hat eine sehr wertvolle Schenkung von den Siemens Schuckert-Werken erhalten. Es handelt sich um eine elektrische Umformerzentrale, die den von den B.E.W, bezogenen Drehstrom in Gleichstrorn für die Versuchszwecke umwandelt. Die soeben in Betrieb genommene Anlage vermag über 200 KW abzugeben Man mag sich wundern, wozu in einer Versuchsanstalt für Luftfahrt sovfel elektrischer Strom gebraucht wird; denn die Propeller der Flugmaschinen werden bekanntlich von Benzinmotoren getrieben. Aber gerade zur Untersuchung dieser Motoren und der Luftschrauben braucht man die Elektrizität. Man muß nämlich imstande sein, die dem Fluge entsprechende Luftströmung an den Motoren auf dem Prüfstand künstlich herzustellen, ferner auch die Luftschrauben, besonders bei den Rotationsmotoren, unabhängig von diesen anzutreiben, um die Arbeitsverluste richtig zu bestimmen, die der Luftwiderstand des kreisenden Zylindersternes bedingt. Auch für vielerlei sonstige Untersuchungen braucht man einen gleichmäßigen Luftstrom von regelbarer Stärke, z. B. für die Prüfung von Wind-geschwindigke tsmessern, fürModellversuche verschiedenster Art im Windkanal u.s.f. Dazu ist der elektrische Gleichstromantrieb mit seiner zuverlässigen Gleichförmigkeit unentbehrlich. Um eine möglichst weitgehende Regelbarkeit zu erreichen, ist die Anlage so ausgeführt, daß die erzeugte Spannung zwischen 50 und 500 Volt verändert werden kann, und zwar vermittels einer Fernsteuerung direkt von der Verwendungsstelle aus, sodaß die Bedienung sehr einfach ist." Die Schenkung der Siemens Schuckert-Werke ist für die Versuchsans'alt und somit für die Ent-wickelung der Luitfahrt von außerordentlichem Werte. Ein Flugapparat beim Eisenbahntransport verbrannt! Ein Flug-apparatist nur als leicht brennbarer, nicht als leicht feuerfangender Gegenstand anzusehen. (Urteil des Reichsgerichts vom 5. Dezember 1913.) Eine für unsere moderne Zeit mit ihren bedeutenden Fortschritten auf dem Gebiete der Flugtechnik interessanten Frage beschäftigte am 5. Dezember das Reichsgericht. In einer Schadenersatzklage machte ein Flieger gegen den Preußischen Eisenbahnfiskus einen Anspruch auf Ersatz des bei dem Transport verbrannten Flugzeuges geltend. Die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung bestimmt nun im §56 Wagen mit leicht feuerfangenden Gegenständen dürfen nicht in unmittelbarer Nähe der Lokomotive befördert werden. Offene Wagen müssen mit einer Decke versehen werden. Ah solche leicht feuerfangende Gegenstände werden von der Rechtsprechung z. B. Benzin, Aether, Celluloid usw. angesehen. Die Frage, ob in einem Flugapparat als solchen ein leicht feuerfangender Gegenstand zu erblicken sei, wurde von dem Reichsgericht verneint. Im Jahre 1911 wollte sich der Flieger Witterstätter mit einer Ritmpler Taube an einer Flugkonkurrenz in Kiel beteiligen. Hierzu sollte der Apparat von der Speditionsfirma Br. in R. nach Kiel befördert werden, geriet aber unterwegs in Brand und verbrannte vollständig. Im Frachtbrief war der Apparat als „Flugzeug" bezeichnet. Er war auf einem offenen Wagen unmittelbar hinter der Lokomotive befördert und hier jedenfalls durch Funkenflug entzündet worden. Der Flieger sah in dieser Beförderungsweise einen Verstoß gegen § 56 der Betriebsordnung, da ein Flugzeug ein leicht feuerfangender Gegenstand sei, und erhob gegen den Preuß. Eisenbahnfiskus beim Landgericht Berlin eine Schadenersatzklage in Höhe von über 22000 Mark. Landgericht und auf seine Berufung das Kammergericht Berlin wiesen jedoch den Anspruch des Fliegers ab. Der Entscheidung des Berufungsrichters lagen folgende Erwägungen zu Grunde: Bei Gütern, die im offenen Wagen befördert werden, haftet die Eisenbahn nach § 86 Ziffer 1 der Eisenbahn-Verkehrsordnung nicht für den Schaden, der aus dieser Beförderungsart verbundenen Gefahr entstehe. Der Kläger habe also ein grobes Verschulden der Eisenbahn nachzuweisen Der § 56 der Eisenbahn- und Betriebsordnung verbiete nun, Wagen mit leicht feueifangenden Gegenständen in unmittelbarer Nähe der Lokomotive zu befördern. Unter leicht feuerfangend sei aber eine Sache zu verstehen, die bei jeder flüchtigen Berührung mit dem Feuer, sei es als Funken oder in offener Flamme, sich sofort entzünde, also die Fähigkeit habe, das Feuer zu fangen. Davon müßten aber leicht brennbare Sachen unterschieden werden. Hierunter seien Gegenstände zu verstehen, die bei flüchtiger Berührung mit der Flamme nicht entzündet würden, bei denen es vielmehr einer gewissen Mühe bedürfe, sie in Brand zu setzen. Wenn man von diesem Unterschiede ausgehe, so könne ein Flugapparat, der in der Hauptsache aus Leinwand und Holz bestehe, wohl als leicht brennbar, nicht aber als leicht feuerfangend betrachtet werden. § 56 finde also keine Anwendung. Auch wenn man die weitere Behauptung des Klägers, es handle sich in diesem Falle um einen besonderen feuergefährlichen Apparat, da die Leinewand mit Gummi imprägniert sei, unterstelle, könne doch ein Verschulden der Eisenbahn nicht angenommen werden. Zwar sei der Inhalt der Ladung für alle beteiligten Beamten durch, den Frachtbrief bekannt worden. Sie könnten aber nicht damit rechnen, daß im Inneren des Apparates sich leicht feuerfangende Sachen, Benzin usw. befanden. Die Eisenbahn habe aber auch nicht gegen die Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers nach § 429 HGB. verstoßen, da es Sache des Versenders gewesen wäre, auf die Feuergefahr au merksam zu machen. Die von dem Flieger W. beim Reichsgericht eingelegte Revision war erfolglos. Der 2. Zivilsenat wies das Rechtsmittel zurück. Patentwesen. Selbsttätige Querstabilisierungsvorrichtung für Flugzeuge mittels verschiebbarer Gewichte.*) Die Erfindung bezieht sich auf eine selbsttätige Querstabilisierung für Flugzeuge, bei welcher das Gleichgewicht durch verschiebbare Gewichte gewahrt wird. Von den bekannten Vorrichtungen dieser Art unterscheidet sich der Erfindungsgegenstand dadurch, daß die Verschiebung der Gewichte durch den Wind unter Vermittlung von Klappen geschieht, die gegen die Längsachse des Fahrzeuges hin umlegbar sind. Nach außen hin dagegen dem Winde Widerstand bieten, und von ihm verschoben werden. Bei dieser Verschiebung wird durch einen Seilzug das Gegengewicht nach der anderen Seite verschoben, so daß ein daselbst seitlich nach oben wirkender Winddruck durch das Gegengewicht ausgeglichen wird. In der Zeichnung ist die Erfindung in ihren wesentlichen Teilen in einer Ausführungsform dargestellt. Die beiden Rollen a, über welche das Seil b läuft, sind an dem Gestell des Flugzeuges unterhalb der Tragflächen befestigt. Der obere Teil dieses Seiles trägt die beiden Gewichte p, p1, die für gewöhnlich symmetrisch zur Mittelachse des Flugzeuges liegen. Der untere Teil des Seiles b läuft durch zwei gelochte Platten c, c', die ebenfalls symmetrisch zur Mittelachse liegen und mit dem Maschinengestell verbunden sind. Außen legen sich gegen diese Platten c, cl die Platten d, d1, an denen unten die Winddruckflächen e, e1, gelenkig befestigt sind. Die beiden Enden des Seiles b sind auf Rollen gewickelt und deren Achsen mit Spiralfedern i, i1 versehen, welche das Bestreben haben, die Seilenden gegen die Mittelachse hin zu ziehen und welche das Seil straff halten. Die Winddruckflächen e, e1 sind mit den nach außen gerichteten Ansätzen e2 D R. P. Nr. 267 373. Hans Franck in Charlottenburg. versehen, die bei senkrechter Lage der Platten e, e1 den Schnurlauf b berühren ; dieser hat unmittelbar vor den Ansätzen e2 je einen Anschläger oder Mitnehmer s, s1. Es sei nun angenommen, daß der Wind rechts von unten kommt, also die rechte Tragfläche zu heben bestrebt ist. Der Wind wirkt dann gegen die Fläche e1, bringt dieselbe in die punktiert angegebene Lage und trifft nun gegen die Fläche e, die bei dem Bestreben, sich zu drehen, mit ihrem Ansatz e2 gegen das Seil b, bezw. den Mitnehmer s wirkt, mithin in ihrer senkrechten Lage verbleibt und durch den Winddruck nach links verschoben wird, wobei der gegen den Mitnehmer s wirkende Anschlag e2 die Bewegung des Seillaufes b im Sinne der angegebenen Pfeile veranlaßt. Bei dieser Verschiebung wird die Feder i noch stärker gespannt. Wenn e in die links punktiert angegebene Stellung gekommen ist, nehmen auch die Gewichte p, p1, die punktiert angegebenen Lagen ein, werden 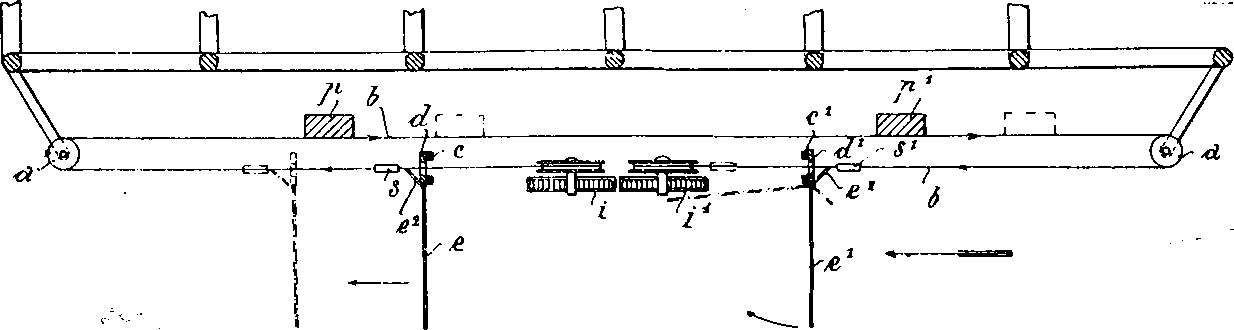 a'so derartig nach rechts verschoben, daß sie dem gegen die Unterseite des rechten Flügels wirkenden Winddruck entgegenwirken, Da der Wind sich ferner in dem Winkel fängt, welcher von der linken Flügelfläche und der Winddruckfläche e gebildet wird, so sucht der Wind auch den linken Flügel anzuheben, wodurch der nachteiligen Wirkung des Windes gegen den rechten Flügel noch weiter entgegengewirkt wird. Läßt der Wind nach, so zieht die Feder i das mit ihr verbundene Seilenende zurück, wobei der Mitnehmer s gegen den Ansatz e2 der Druckfläche e wirkt und diese sowie die Platte d nach c zurückführt, während die Druckfläche e in die senkrechte Lage zurückfällt. Der Ueberschuß der Spannung der Feder i, wie er sich durch den Winddruck ergab, läßt dabei eine Abwicklung der anderen Feder i1 um soviel zu, daß das mit ihr verbundene Seilende wieder in die gewöhnliche Lage zurückkehrt. P at e n t-An sp ru ch. Selbsttätige Querstabilisierungsvorrichtung für Flugzeuge mittels verschiebbarer Gewichte, dadurch gekennzeichnet, daß die Verschiebung dieser Gewichte durch den Wind unter Vermittlung nach der Mitte zu umlegbarer aber nach außen zu verschiebbarer Klappen erfolgt, die bei ihrer Verschiebung Federn spannen, bei ihrer Umlegung aber von dem die Gewichte führenden Seilzuge entkuppelt werden. Modelle. Das Eindecker-Entenmodell Klein ist nach dem Prinzip der Neigungswinkeldifferenz gebaut und in allen Teilen mit Ausnahme des verspannten Motorstabes aus Bambusrohr hergestellt. Die Ver-spannung besteht aus 0,25 mm Klaviersaitendraht. Mit Rücksicht auf die bei Modellen häufig vorkommenden Fahrgestellbrüche ist in der Nähe der Kopffläche ein besonders verstrebtes Stoßrad angebracht. Dasselbe wird von der Gabel R festgehalten. Infolge ihrer Elastizität werden die Landungsstöße sanft aufgenommen. Unter der V förmig nach oben gerichteten Haupttragfläche von 1250 mm Spannweite und 156 mm Flächentiefe befindet sich ein abgefedertes Radgestell, das zum Schutze der 40 cm großen Druckschraube mit zwei elastischen Schleifkufen versehen ist. Einfach und zweckmäßig ist die Schraubenlagerung durchgeführt. Die Welle a geht durch den Bügel b und die Diagonalversteifung c Dieses Lagergestell wird mittels zweier Holzschrauben an den Motorstab A festgeschraubt. An der Vorderseite des Bügels b ist eine Hülse d eingelassen, die mit einem Bordrand versehen ist. Ueber diesen Bordrand greift der Kugelkäfig e, der nach dem Einlegen der Kugeln um den Flansch der Hülse d gebördelt wird. Hierdurch ist erreicht, daß die Kugeln niemals herausfallen können. Die Welle a geht durch die Schraube f und ist an ihrem Ende mit einem Splintloch versehen. Der Splint g sichert den Propeller f gegen Abfliegen und überträgt das 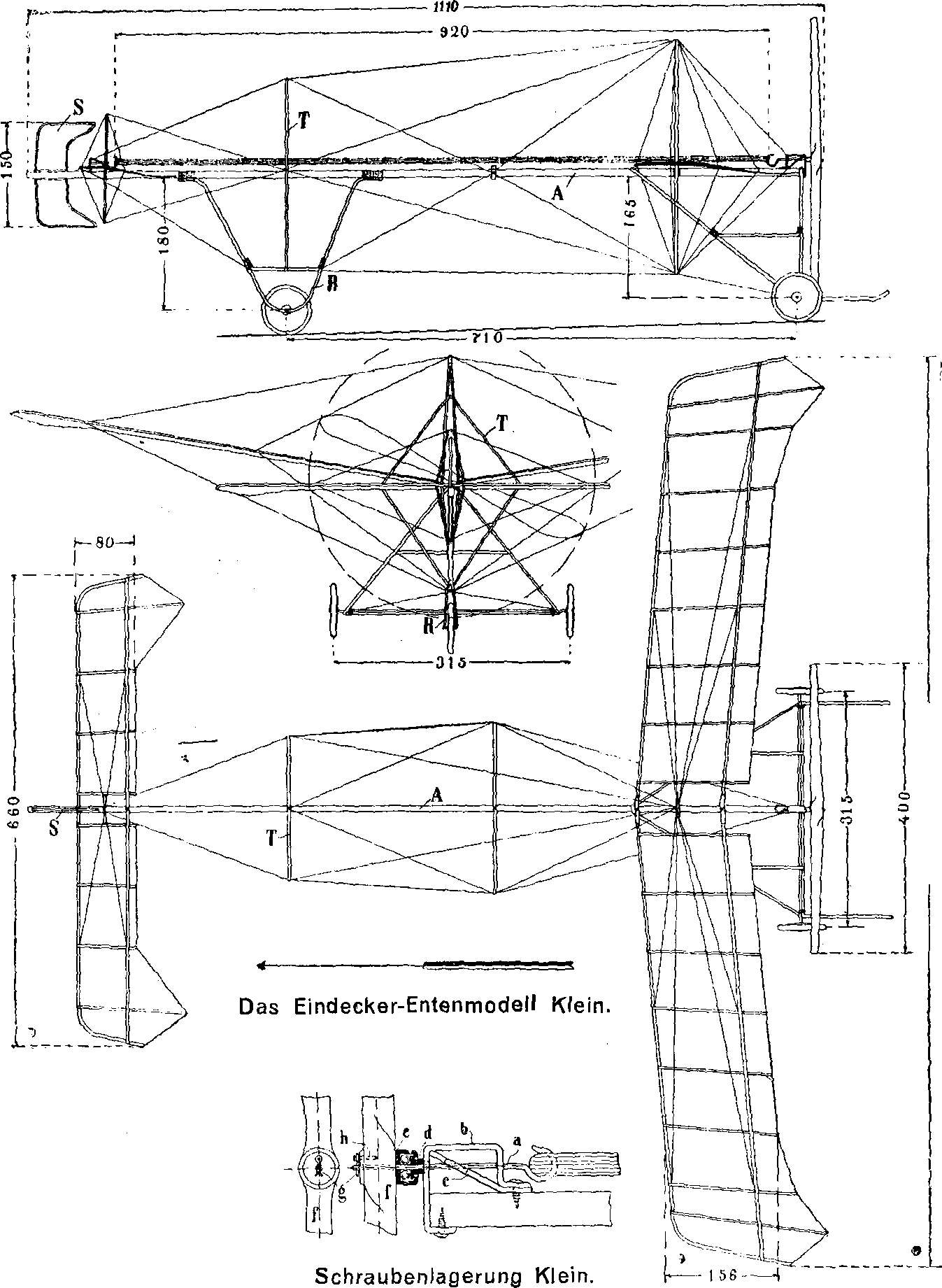 Drehmoment des Gummimotors unter Vermittlung des Stiftes h als Mitnehmet auf die Schraube f. Diese einfache Verbindung gestattet ein leichtes und schnelles Auswechseln der Luftschraube Die Bespannung der Tragdecken und des Seiten-Steuers S besteht aus Continental-Aeroplansfoff. Der Gummimotor wird von 10 3 mm starken Gummisträngen gebildet. Das Modell ist nur 380 g schwer und besitzt eine ausgezeichnete Stabilität. Frankfurter Flugmodell-Verein. (Geschäftsstelle: Frankfurt a. M, Eppsteinerstr. 26.) Bei der letzten Mitgliederversammlung fand die Preisverteilung des Prämien-fliegens vom 9. November statt. Hierbei erhielt den Preis für den längsten Flug Kopietz (Eindecker), sowie den Höhenpreis und den Preis für den stabilsten Flug. Im Zielflug erhielt den ersten Preis Zilch (Rumpf-Pfeil-Zweidecker) und den zweiten Preis Paul David (Pfeil-Zweidecker). Für Mai 1914, in der Zeit des Prinz Heinrich-Fluges soll ein großer Wettbewerb und Ausstellung in Frankfurt stattfinden. Es ist empfehlenswert schon jetzt sich dafür vorzubereiten. Anläßlich unseres einjährigen Bestehens findet Samstag, den 13. Dezember, abends 8 Uhr im Restaurant „Kaiserkeller" eine kleine Feier statt. Modell-Flugsport-Club Herne (Geschäftsstelle Goethestraße No. 17) In letzter Zeit fanden wieder einige Uebungsflüge statt und zwar auf dem vom Magistrat der Stadt Herne für diesen Zweck gütigst zur Verfügung gestellten Städtischen Sportplatz am Stadtgarten. Das neue Flugfeld wurde am 26. Okt. durch ein Prämienfliegen in Benutzung genommen. Des weiteren fanden Uebungsflüge am 9. und 23. November statt, jedoch hatten dieselben unter der Ungunst der Witterung zu leiden, weshalb sich auch die Leistungen in bescheidenen Grenzen bewegten. Am besten schnitten die Gebr. Kamien (Eindeckermodell) ab, mit 46, 48 und 60 m Fluglängen. Ein anderes Modell von Gebr. Kamien vollführte mehrere gelungene „Pegoud"-Flüge, die ebenso wie die von W. Back mit einem schwanzlosen Eindecker angestellten Versuche hochinteressant verliefen. Weitere Uebungsflüge finden jeden Sonntag zwischen 2-5 Uhr nachmittags statt. Der „Cölner Club für Modellflugsport", der bereits 29 Mitglieder zählt, beschloß in der Versammlung vom 6. er. den Anschluß an den Verband für Modellflugsport. Den Tagesrekord des am 7. er. stattgehabten Wettfliegens hält der „Kastner-Enten-Eindecker" mit 92 m; er wiegt 300 g, hat eine Spannweite und Länge von je 1 m, wird von einem 65 g schweren Gummi-Motor und einer 30 cm Luftschraube angetrieben. Die Tragflächentiefe beträgt 18 cm. Der Eindecker ist ein Präzisionsmodell. Im nächsten Jahre wird eine internationale Flugmodellausstellung mit anschließendem Wettfliegen stattfinden. Zuschriften sind zu senden an den 1. Vorsitzenden Civil-lng. Bigenwald in Cöln-E., Gutenbergstr. 26. Die Auskunftsstelle leitet Herr Staubesand in Cöln, Schildergasse 110. Jeden Sonntag Vormittag 10 Uhr wird im Stadtwald vor der Waldschenke (Linie 8) geflogen. Die Neujahrsfeierlichkeit ist auf Samstag, den 3. Januar verlegt worden. Näheres wird noch berichtet. Ausstellungswesen. Schweizerische Landesausstellung Bern 1914. (Gruppe Luftschiffahrt.) Bei der vom 15 Mai—15. Oktober 1914 in Bern stattfindenden „Schweizerischen Landesausstellung" wird, wie die „Ständige Ausstellungskommission für die Deutsche Industrie" bereits früher mitgeteilt hat, u. a. die Gruppe „Luftschiffahrt" internationalen Charakter erhalten. Nach einer der Kommission von Seite 983 „r'LU GSP0ET." No. 25 dem Präsidenten dieser Gruppe gewordenen Mitteilung legt man besonderen Wert darauf, daß gerade auch die einschlägige deutsche Industrie sich beteiligt. Aus dem übrigen Auslande seien bereits einige Anmeldungen eingegangen. Die Gruppe ist in folgende Untergruppen gegliedert: I. Frei- und Fesselballon, II. Lenkbare Luftschiffe, III. Drachen und Flugzeuge aller Art, IV. Motoren für Flugzeuge und Lenkballon, V. Materialien zum Bau von Flugzeugen, Ballon und lenkbaren Luftschiffen, VI Apparate zur Erzeugung und Kompression von Gas, VII Instrumente und Apparate für die Luftschiffahrt und zum Studium der Atmosphäre, VIII. Wissenschaftliche Luftschiffahrt, Aerologie und Meteorologie, IX. Militär-Luftschiffahrt, X. Sportliche Luftschiffahrt XI. Geschichte der Luftschiffahrt- XII. Literatur, Luftschifferkarten, Ballon-Photographien u. dgl. Um speziell deutschen Ausstellern von Flugzeugen entgegenzukommen, soll für diese kein Platzgeld erhoben werden. Der Rücktransport der Flugzeuge erfolgt gleichfalls nach Mitteilung der Ausstellungsleitung ko st en 1 os, die Zollerledigung mittels Freipass. Der Spezial-Prospekt der Gruppe „Luftschiffahrt" sowie die allgemeinen Ausstellungs-Drucksachen können an der Geschäftsstelle der Ständigen Ausstellungskommission (Berlin NW. 40, Roonstraße 0 eingesehen werden. Literatur.*) Flitgerkurs. Leitfaden für Militär- und Zivilflieger von Josef Flassij, k. k. Leutnant und Feldpilot. Verlag R. v. Waldheim Wien 1913. 164 Text- und Tafelabbildungen, 390 Seiten, Preis Kr. 6.50 geb. Der Verfasser h-t in eingehendster Weise die wichtigsten Wissenschaften und neuesten Erfahrungen im Bau von Flugzeugen auf das sorgfältigste behandelt und an Hand von zahlreichen Illustrationen umfassend erläutert, sodaß das vorliegende Werk jedem Flugsportinteressenten als Nachschlagewerk empfohlen werden kann. Die Stabilität der Flügzeuge. Einführung in ihre dynamische Stabilität von G. H. Bryan, Prof. für reine und angewandte Mathematik. Uebertragen aus dem Engl, von Dipl.-Ing H. G Bader. Verlag Julius Springer, Berlin 1914, 40 Text-Abbildungen, 139 Seiten. Preis brosch. Mk. 6— geb. Mk. 7.-Im vorliegenden Werk ist der Versuch gemacht worden, die dynamischen Verhältnisse bei Flugzeugen auf rein mathematischem Wege im bezug auf Stabilität zu klären. An Hand von Abbildungen und Skizzen werden die einzelnen Flugzeugtypen rechnerisch, mit Hilfe der Theorie der kleinen Schwingungen auf ihre Stabilität eingehend geprüft. Dadurch sind wertvolle Resultate für den Bau von Flugzeugen gewonnen worden, die bei entsprechender Würdigung nicht ohne Einfluß auf die Fortentwicklung des Flugzeugbaues bleiben werden. Die Fliegerschule, Jahrbuch für Flugschüler von Albert Rupp, und Willy Rosenstein, Fluglehrer. Verlag C. J. E. Volckmann Nachf. Berlin-Charlottenburg 1913 Preis Mk. 2 80 In leicht verständlicher Weise wird der Flugschüler in die Grundbegriffe der Flugkunst eingeführt. Die technischen Abhandlungen sind sehr pupulär gehalten und werden an Hand von Abbildungen eingehend erläutert. *) Sämtliche besprochenen Bücher können durch die Expedition des „Flugsport" bezogen werden.  Kreuzband M. 14 Postbezug M. 14 pro Jahr. Jllustrirte No. 26 technische Zeitschrift und Anzeiger Abonnement 22. Dezember für das gesamte mmJ- „Flugwesen" unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Telef.4557 Amt I. Oskar UrsinUS, Civilingenieur. Tel.-Adr.: Ursinus. Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8. Erscheint regelmäßig 14 tägig. = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. r Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 7. Januar. Ende 1913. Mit der heutigen Nummer beschließen wir den Jahrgang 191.r>. 5 stattliche Bände liegen vor uns. Wir dürfen wohl behaupten, daß die Entwicklung des Fingwesens an keiner anderen Stelle so lückenlos und ohne unnützes Beiwerk übersichtlich dargestellt ist, wie in den 5 Bänden vorliegender Zeitschrift. Wir haben fortgesetzt versucht in inniger Beziehung zur Praxis, indem wir die Vorgänge auf dem Gebiete des Flugwesens in der ganzen Welt unausgesetzt beobachteten, unsere deutschen Flugzeug-Konstrukteure, die Industrie und die Interessenten auf die richtigen Bahnen zu lenken. Die uns bezeugten Sympathien veranlassen uns auch hier annehmen zu dürfen, daß wir das richtige getroffen haben. Einer der hervorragendsten Flugzeug-Industriellen schreibt uns: „Zu meiner großen Freude habe ich beobachtet, daß sie rein aviatische Interessen mit großem Sachverständnis verfolgen, und auch flugsportlich fand ich in Ihrer Zeitung immer nützliche Winke und richtige Anschauungen. Ihre Veröffentlichungen über den Stand der ausländischen Flugtechnik und des Flugsports, beweisen gute eingehende Informationen aus dem Auslande. Die gesammelten Bände Ihrer Zeitschrift führen den internationalen konstruktiven Entwicklungsgang der Flugmaschine in Wort, und Bild wie keine Zeitschrift dem Leser vor Augen und es worden wohl in J späterer Zeit alle Journalisten aus Ihrer Zeitschrift Nützliches und Authentisches schöpfen können. Auch in vaterländischer Beziehung habe ich von Ihrer Zeitung immer den Eindruck gewonnen, daß sie von rein patriotischem Geiste geleitet, zum Zwecke hatte, unserem nationalen Flugwesen und den Landesverteidigungs-Interessen dienlich zu sein. Sie haben immer mit klarem Blick erkannt, daß die Basis der Leistungen unseres deutschen Flugsports nur die deutsche Industrie sein kann und diese gesund und leistungsfähig auszugestalten, das erste Bestreben sein müsse. Ihre Arbeiten und Bestrebungen werden sicher die ihnen gebührende allgemeine Anerkennung finden." Vorliegendes Anerkennungsschreiben haben wir aus den vielen Hunderten uns zugegangenen Sympathiebezeugungen herausgegriffen, um endlich einmal den von gewissen Seiten (hauptsächlich Berlin) betriebenen Agitationsversuchen gegen unsere Zeitschrift, die vor einigen Tagen wieder an verschiedenen Stellen zum Ausdruck kamen, jedwede Bedeutung zu nehmen. Erledigt! Im März v. Jahres haben wir durch einen Aufruf in unserer Zeitschrift „Flugsport" die erste Anregung zu einer großzügigen Sammlung für die National-Flugspende gegeben. Heute ist das Werk beendet. Das Kuratorium der National-Flugspende, hat in gemeinschaftlicher Arbeit mit den maßgebenden Faktoren Vorzügliches geleistet. Die Erfolge sprechen für sich selbst. Mit der Entwicklung des Flugwesens und dem Entstehen vollständig neuer Dinge, die wir fortgesetzt zu beschreiben gezwungen waren, ergab sich die Schaffung von Fachausdrücken von selbst. Wir waren genötigt, noch nie genannte Gegenstände mit Fachausdrücken zu belegen, für welche noch keine Ausdrücke vorhanden waren. Der verantwortungsvollen Aufgabe waren wir uns sehr wohl bewußt. Zuerst versuchten wir derartige Ausdrücke und beobachteten, wie sie von den Lesern aufgenommen wurden, und erst hiernach verwendeten wir sie dauernd. Wohl der größte Teil der jetzt gebräuchlichen Fachausdrücke sind auf diese Weise zuerst von uns geprägt und eingeführt worden. Am Schluß des vorliegenden Jahrgangs nehmen wir Veranlassung allen denjenigen, die an der Ausgestaltung des „Flugsport" mitgewirkt haben, recht herzlich zu danken. In der Entwicklung der Flugmaschine ist bis jetzt noch immer nur der erste Schritt getan. Es muß noch viel gearbeitet werden. Ein großer Teil der im Eeiche schlummernden Kräfte ist noch unbenutzt. Vor allen Dingen geben wir dem Wunsche Ausdruck, die heranwachsende Generation, die Jugend, möge sich auch fernerhin eifrig fördernd für das Flugwesen verwenden. Gerade der Jugend ist es vorbehalten noch fernstehende Kreise für das Flugwesen zu interessieren. Wohl mancher Vater, der von der halsbrecherischen Fliegerei nichts wissen wollte, ist durch den unermüdlich für das Flugwesen begeisterten Sohn für die gute Sache gewonnen worden. Gerade jetzt, wo vielleicht die Entwicklung des Flugwesens in langsamerem Tempo vorwärts schreiten wird, bedarf es der Zusammenfassung aller verfügbaren Kräfte. Ehrfurchtsvoll gedenken wir aller derjenigen Pioniere, die ihr Leben für die Entwicklung der Flugmaschine einsetzen. Die Geschichte wird sie nie vergessen. Es ist Großes geleistet worden, noch viel Größeres ist zu vollbringen! — — Die Redaktion des Flugsport wird sich nicht mit dem bisher geleisteten zufrieden geben, sondern angespornt durch die Erfolge der letzten Jahre mit verdoppeltem Eifer die bisherigen Arbeiten zu tibertreffen suchen, um die verehrten Leser auch fernerhin zu befriedigen. Möge das Jahr 1914 im Zeichen der Entwicklung der Flugmaschine stehen. Pariser Salon. Civ.-Ing. Oskar Ursinus. (Fortsetzung aus No. 25.) Motoren. Nebst Gnome hat in Frankreich in letzter Zeit der Motor Le Rhone in der Praxis viel Verwendung gefunden. Die Gesellschaft Le Rhone, mit einem Kapital von 2100 000 Eres, arbeitend, zeigt auf einem Stand sämtliche von ihr in den Handel gebrachte Typen. Alle Motoren haben 105 mm Bohrung und 140 mm Hub.' Der 7 Zyl. leistet bei 1200 Touren 50 PS und wiegt 80 kg „ 9 „ „ „ 1200 „ 80 „ „ „ 110 „ „ 14 „ „ „ 1150 , 100 , , „ 140 „ „ 18 „ „ „ H50 „ 160 „ „ „ 170 „ Bei dem vorliegenden Rotationsmotor wird bekanntlich das Gasgemisch durch ein besonderes Gaszuführungsrohr am Zylinderkopf eingeführt. Ein- uud Auslassventil werden durch einen in einem Kugellager gelagerten zweiarmigen Hebel gesteuert. In der umstehenden Abbildung ist der 160 PS 18 Zylinder dargestellt. Auf dem Stand von Clerget sehen wir außer einem stationären wassergekühlten 200 PS 8 Zylinder in V-Form, Rotationsmotore von 60 bis 80 PS. Dieser Rotationsmotor besitzt von einander unabhängig gesteuerte Ein- und Auslaß-Ventile. Das Gasgemisch wird durch ein besonderes Zuführungsrohr nach dem Zylinderkopf geleitet. Mit dem Olerget-Motor wurde bekanntlich der Flug Biarritz-Kolum um den Pommery-Pokal ausgeführt. Von neueren Rotationsmotoren ist zu erwähnen der Motor S. H. K. konstruiert von Secqueville et Hoyau. Dieser Motor ist ein Einventil-Motor mit 7 Zylindern. Die Gaszuführung erfolgt am Zylinderkopf. Die Gesamtleistung beträgt 70 PS. Das Gewicht 70 kg. Auch ein Motor mit gegenläufigen Schrauben, ähnlich der bekannten Escherkonstruktion, ist vertreten. Diese Konstruktion, der E. J. C.-Motor leistet 60 PS. Das Zylindervolumen beträgt 4,7 1; das Gewicht 84 kg. Die relativ Tourenzahl zwischen Welle und Gehäuse beträgt 2000. Dem Verlangen einen möglichst billigen Motor zu schaffen versuchte der Konstrukteur des Rotationsmotors Dhenain nachzukommen. Das Gehäuse und die Zylinder sind aus einem Stück in Stahlguß gegossen. Die Zylinderköpfe sind durch 4 Schrauben aufgeschraubt. Das Gasgemisch wird durch einen im Zylinder mit angegossenen Kanal nach dem Zylinderkopf geleitet. (In der Abbildung nicht ersichtlich). In dem Zylinderkopf befinden sich zwangläufige mittels Steuerstange betätigte Ein- und Auslaßventile. Ebenso einfach durchgebildet sind die Kurbel-und Pleuelstangen. Letztere greifen gemeinschaftlieh am Kurbelzapfen an. DerMoter besitzt 150Hub und 90 Bohrung. Die Betätigung der Ventilstöße erfolgt durch 2 Ex-centerkränze, die auch noch eine Veränderung während des Betriebes gestatten sollen. Die Zuleitung des Benzins bezw. Gasgemisches erfolgt nicht nur durch das Kurbelgehäuse, vielmehr durch besondere Kanäle, welche sich an die im Zylinderboden eingegossenen Kanäle anschließen. Dadurch soll vermieden Werden, daß das im Kurbelgehäuse befindliche Oel durch die Ben-aingase ausgewaschen wird. Dieser Motor leistet bei 850 Touren 50-60 PS und wiegt HO kg. Der Benzinverbrauch soll hierbei 16 1 pro Stunde betragen. 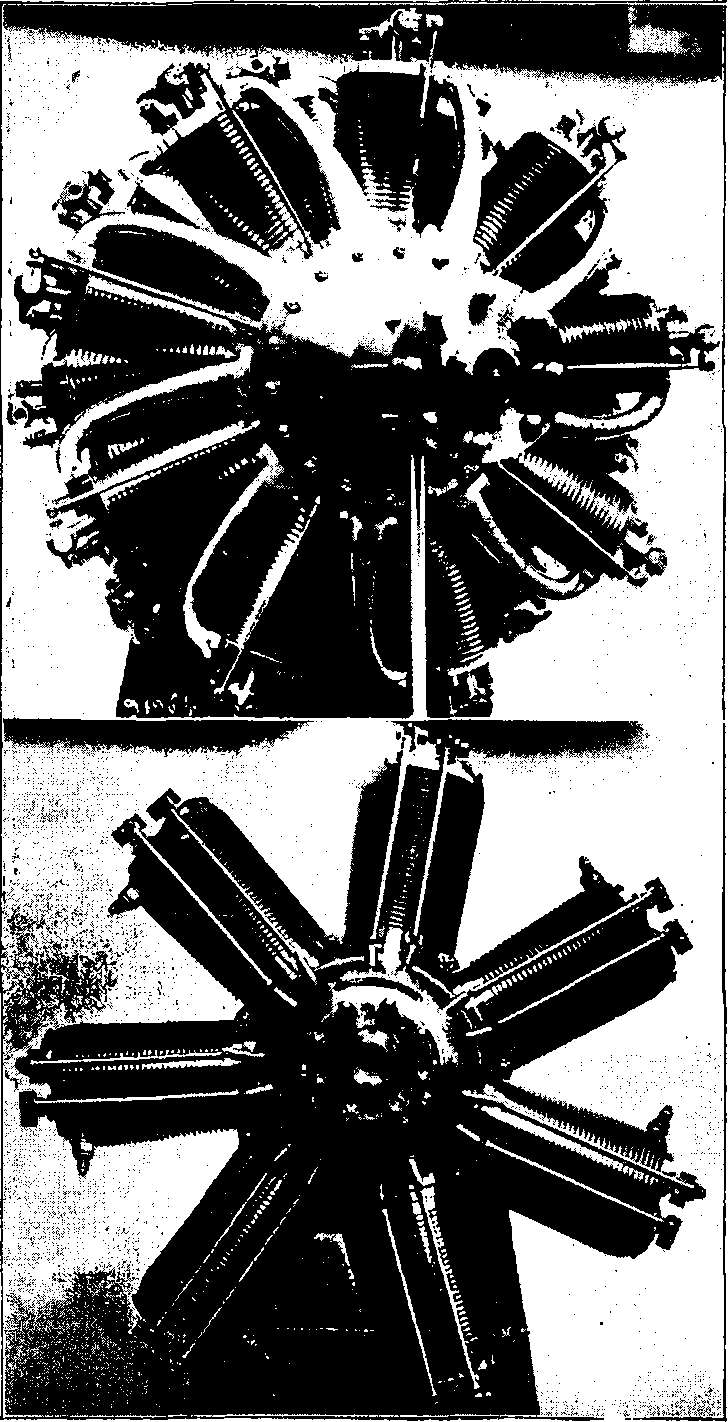 Pariser Salon. Oben: Unten: Motor Le Rhone WO PS. Motor Clerget 80 PS. Einen ventillosen Umlaufmotor zeigt dieses Jahr Esselbe. Dieser im Viertakt arbeitende 7 Zylinder leistet 70 PS. Die Zu- führung des Gasgemisches erfolgt durch Kanäle in der Nähe des Zylindergehäuses.^j-Der diesjährige Pariser Salon gibt ein sehr gutes Bild über die Weitläufigkeit in welcher sich die Fantasie der Motoren-kpnstrukteure bewegt. 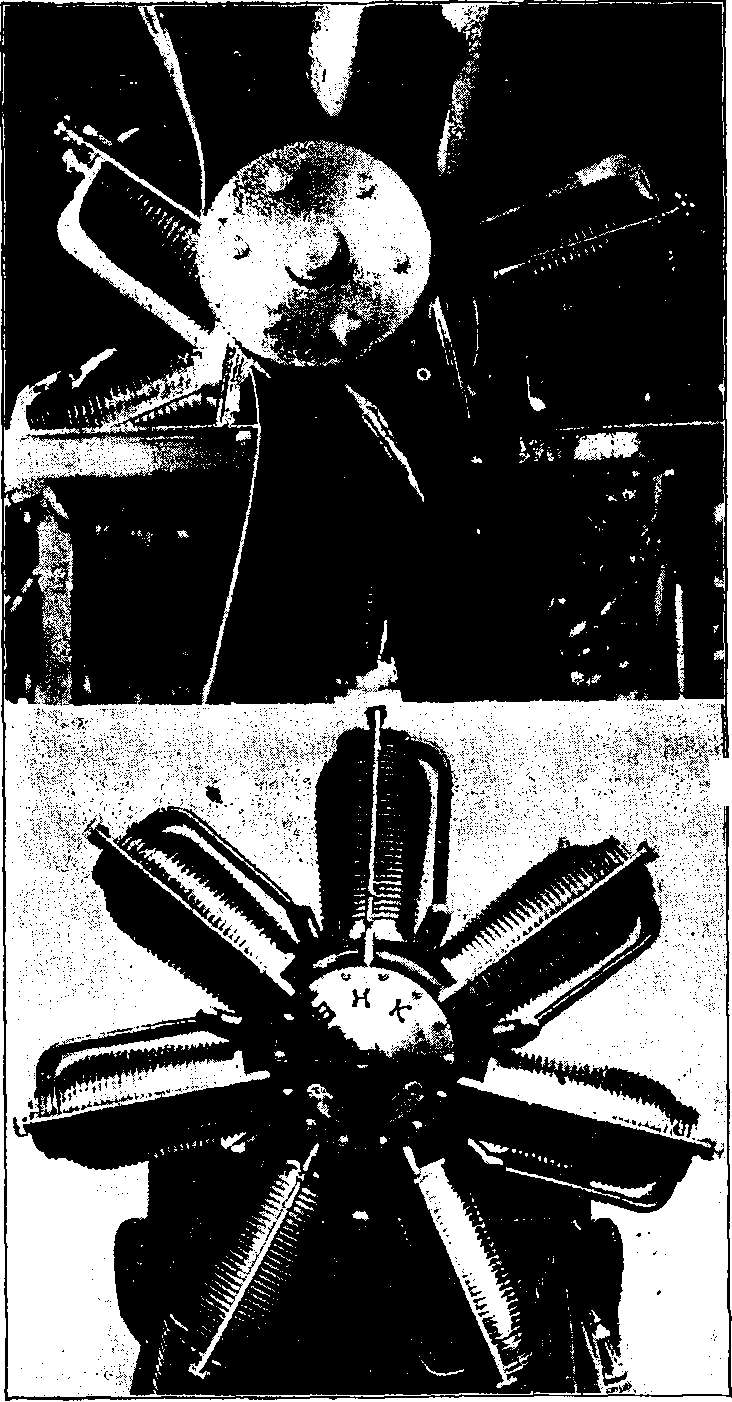 Pariser Salon. Oben: Motor E. J. C. 60 PS. Unten: MotorS.ti.K-Von Secqueville u. tioyaa 70 PS. welcher wassergekühlte Sternmotoren bis Austro Daimler zeigt den normalen in der Praxis bewährten tj Zylinder Motor. Hier sehen wir einen Sternmotor Edelweiß bei dem das Prinzip vollständig umgekehrt worden ist. Bei diesem Motor sind die 6 Kolben an einem runden Gehäuse befestigt. An den Kolben sitzen die Ein- und Auslaßventile, sowie dieZünd-kerzen. Auf den nach innen stehenden Kolben bewegen sich die mit Kühlrippen versehenen Zylinder, an welche die Schubstangen angreifen. Die Anordnung geht aus der umstehenden Abbil-!J dung hervor. Von den luftgekühlten Sternmotoren sehen wir noch die bekannten bewährten Anzani-Typen und die Renault-Motore, mit V-förmig angeordneten Zylindern. Die verhältnismäßig wenig vertretenen wassergekühlten Motoren werden in der Hauptsache präsentiert von zu Salmson 200 PS ausstellt. 90 PS wassergekühlten Ein Motor auffallend durch seine Größe ist der 8 Zylinder Lawrance Moulton. Dieser Motor, der für große Wassermaschinen bestimmt ist, leistet 240 PS. Von weiteren interessanten Konstruktiven JSinselheiten ist noch folgendes zu erwähnen. Der Selbsstarter von Bleriot. Das Halteseil a (Abb. 1) ist mit einem Pfahl oder Baum verbunden und wird von der Hakenklinke b festgehalten. Zieht man die Hülse c vermittels des Zugseiles d vom Führersitz aus zurück, so schnappt die Klinke b aus ihrer Rast heraus und gibt das Halteseil a frei. Der ganze Mechanismus wird von dem Seil e, das am Apparat befestigt ist, stets mitgenommen. Das Fahrgestell des Bleriot - Doppeldeckers. 50 PS Abb. 2 wird von zwei 70 PS Radgabeln a gebildet, die am Punkt b gelenkig gelagert und an ihren oberen Enden elastisch festgehalten sind. Die Abfederung liegt in den teleskopartig ineinandergeschobenen Metall- 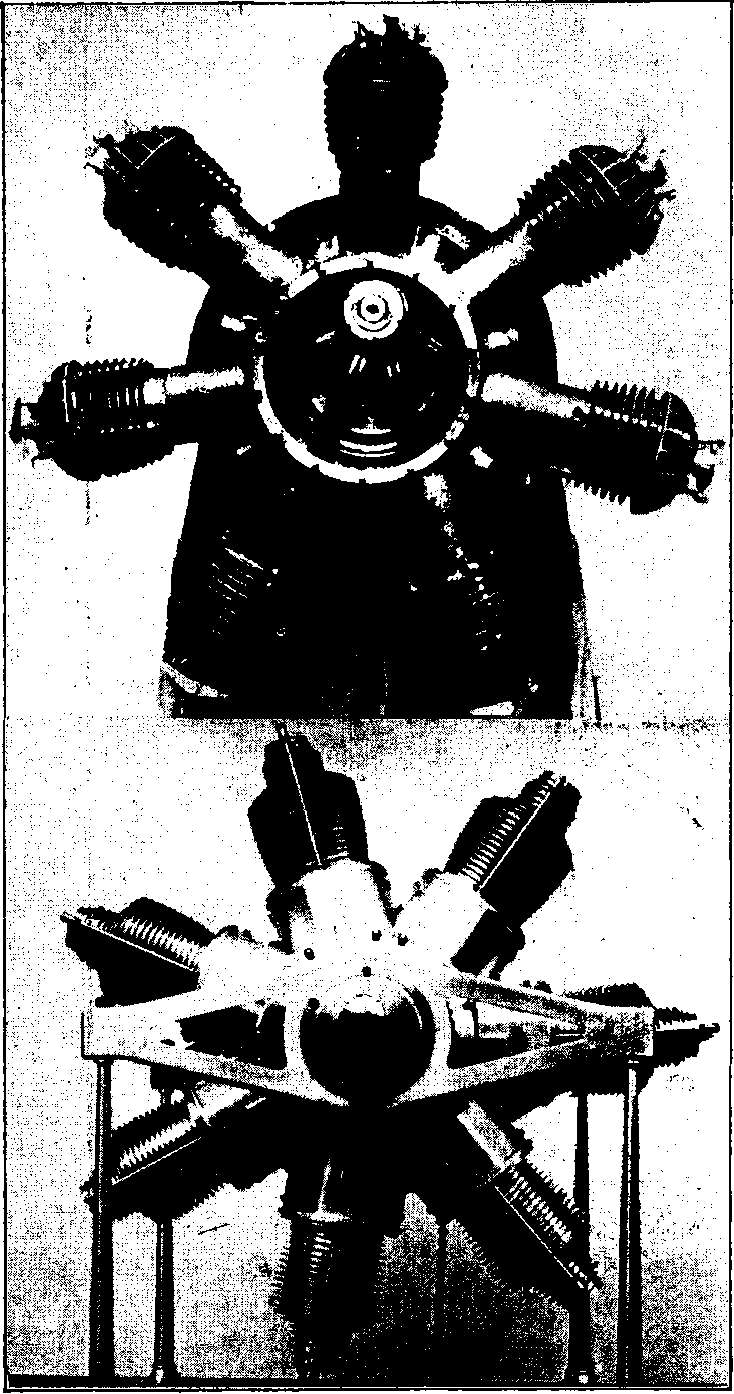 Pomer Salon. Oben: Motor Dhe'nain. Unten: Motor Esselbe' 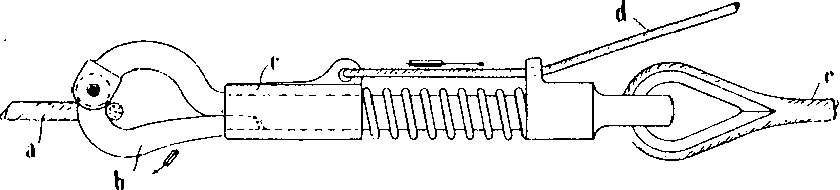 Abb. 1 hüken c und d, die jede Durchfederungsbewegung kardanisch gelagerten Punkt d mitmachen können. Die um den Hülsen c werden nach rechts und links von einer Vorspannung festgehalten, in welche zum Ausgleich der seitlichen Stöße der Gummizug f eingeschaltet ist. Das Anfahrgestell Sanchez-Besa. An der Hauptkufe b (Abb. 3) ist vorn ein Stoßräderpaar angebracht. Hinten befinden sich auf der geteilten Radachse a die Haupt- 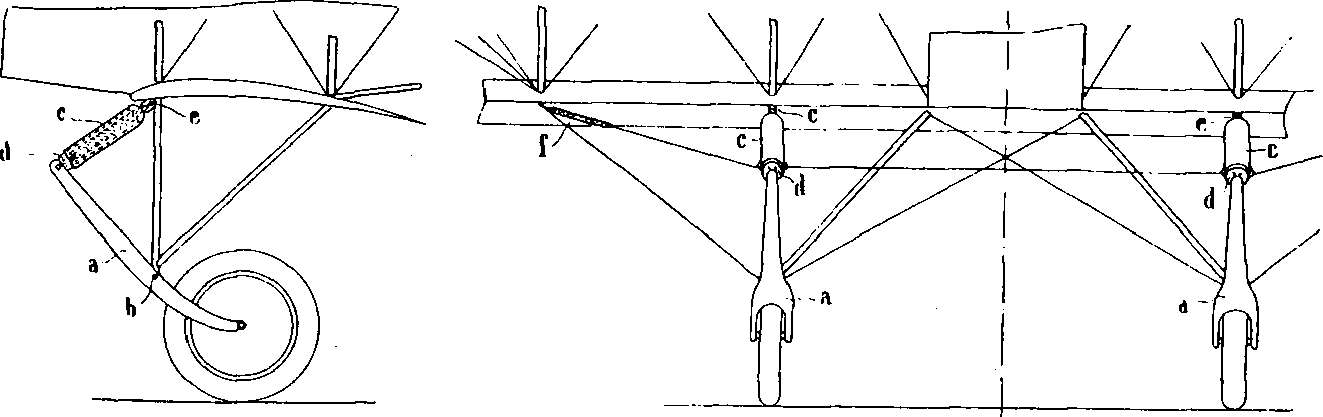 Abb. 2 tragräder. Auf ihren Naben sind Bremsen d montiert, die mittels des Seiles e vom Führersitz aus betätigt werden. Die geteilte Radachse a wird von dem teleskopartig ineinandergeschobenen Stoßstangen c abgestützt, die beim Ineinanderschieben die Gummizüge f auseinanderziehen. Der obere Befestigungspunkt der Gummischnüre steht fest, während der untere in einem Längsschlitz geführt wird. 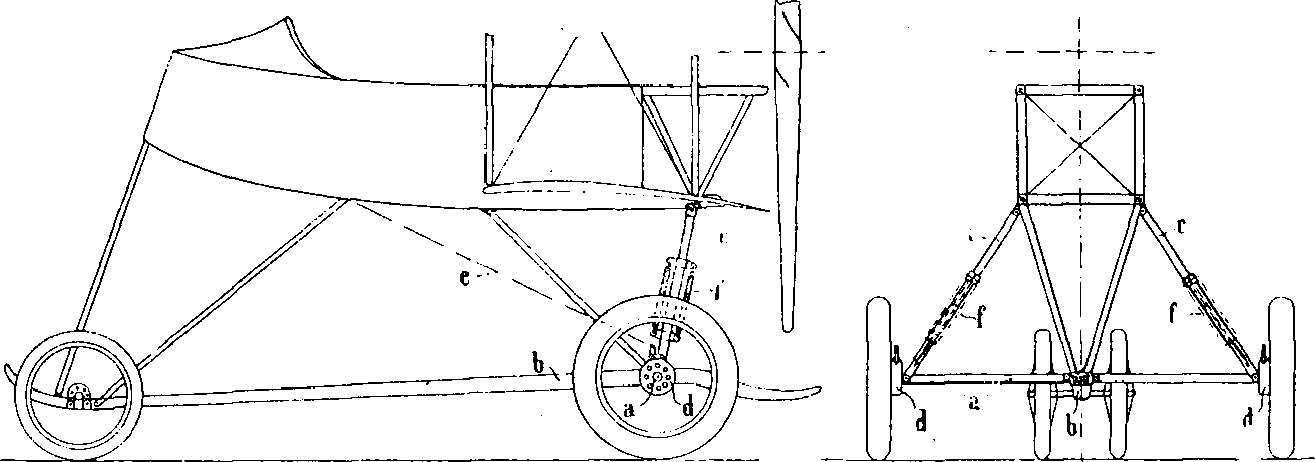 Abb 3 Die Schraubensteigung ist je nach der Bestimmung der Flugmaschine verschieden. Sogar bei ein und derselben Flugmaschine wird man je nach der Aufgabe, die dieselbe zu erfüllen hat, verschiedene Schraubensteigung verwenden. Soll die Maschine möglichst schnell vom Boden wegkommen, kürzester Anlauf, so wird man eine Schraube nehmen, die im Stande die größte Zugkraft entwickelt. Bei Schnelligkeitsprüfung wird man eine solche verwenden, welche bei der kritischen Geschwindigkeit die größte Zugkraft hervorruft. Um ökonomisch zu arbeiten ist es schon längst als ein Bedürfnis empfunden worden, Schrauben mit während des Fluges verstellbarem Steigungswinkel zu besitzen. Es existieren nach dieser Richtung hin bereits viele Erfindungen, aber noch keine hat sich in der Praxis bewährt. um an seinen Ausgangspunkt zurückzukehren. Um Mittag passierte Letort über Angouleme und zwanzig Minuten später langte er in der Nähe von Barbezieux an, wo er, 2 km von der Stadt entfernt, auf einem am Rande eines Gehölzes, auf einer kleinen Anhöhe gelegenen Felde landen wollte Der Apparat näherte sich dem Boden, ging aber zweimal wieder in die Höhe. Beim dritten Landungsversuche stellte der Flieger die Zündung ab und gelangte endlich in Kontakt mit der Erde. Zum Unglück vermochte Letoit nicht einem breiten Graben auszuweichen, welcher sich quer durch das bezeichnete Terrain zieht, nnd in den er hineinrollte. Letort, der im letzten Momente die Pariser Salon. Molor Edeiweiss. Gefahr erkannte, bog sich völlig zusammen, um so den Stoß besser aushalten zu können, und als man ihn aus den Trümmern des Flugzeuges befreite, hatte er den Kopf buchstäblich zwischen den Beinen. Unter dem Gewichte der Reservoire, die auf ihn gefallen waren, war der Unglückliche nahezu erstickt und er atmete kaum noch. Man brachte ihn in das Hospital, wo er schon nach wenigen Minuten den Geist aufgab. Am letzten Sonnabend ist wieder eine Ueberquening des Kanals zu Zweien ausgeführt worden, und zwar seitens des Fliegers Sahnet, welcher die bekannte Luftschifferin Miß Asheton-Harbord, an Bord seines Bleriot-Tandemsitzers genommen hatte. Die beiden flogen gegen Mittag von Hendon ab, als sie aber in Folkestone anlangten, sahen sie sich einem dichten Nebel gegenüber, welcher im Kanal herrschte und sie an der englischen Küste festhielt. Am Sonntag entschlossen sie sich zur Fortsetzung des Fluges, obgleich noch immer nebliges Wetter herrschte. Sie flogen mit einem Südost - Gegenwind ab, der sie bald aus ihrer Flugrichtung abdrängte, sodaß sie ein und eine halbe Stunde brauchten, um die Meerenge zu übersetzen, und anstatt in Boulogne, wie beab- sichtigt, zu landen, langten sie in Dieppe an. Da sie des Sonntags wegen kein Benzin fanden, mußten sie den Weiterflug nach Paris bis zum folgenden Tage verschieben und am Montag früh gegen 10 Uhr kamen sie auf dem Blöriot - Flugfelde zu Buc an. Von den Weitflügen nach anderen Weltteilen von denen anfangs soviel Aufhebens gemacht worden ist, spricht man jetzt nur noch recht wenig; der Verlauf jener „grandiosen" Projekte hat eben stark enttäuscht. Von Daucourt und Roux ist überhaupt nicht mehr die Rede; bisher hat sich noch keine Stelle gefunden, die den beiden einen Ersatzapparat nachschicken will. Vedrines feiert augenblicklich in Konstantinopel „Triumphe", wo er neulich bei einem-Fluge über die Stadt eine türkische Fahne auf das Sultanspalais herabfallen ließ. Er will von der türkischen Hauptstadt seinen Flug nach Asien fortsetzen, und auch Bonnier, der täglich sein Projekt ändert, scheint nun wieder entschlossen zu sein, Vedrines zu folgen. Einen unglimpflichen Anfang nahm der oftbesprochene Flug von Kairo nach Chartum den bekanntlich Marc Pourpre vorhatte und zu dessen Start er sich vor kurzem nach Kairo begeben hat. Schon beim Abflug stürzte er dicht bei Heliopolis ab, wobei der Apparat schwer beschädigt wurde; der Flieger selbt blieb zum Glück unverletzt. Inzwischen nehmen allenthalben die Sturzflug-Vorführungen '"ϖ* ihren weiteren Verlauf. Chevillard produziert sich jetz in der,^fthweiz, Chanteloup in Belgien, Hannouilie in Marseille und der „Meister" Pegoud gibt, bevor er seine neue europäische Tournee- antritt, in Juvisy Schauflüge der gedachten Art zum besten, für die unter Hinweis auf den in Deutschland erzielten Erfolg große Reklame gemacht wird. Am letzten Sonntag sollen denn auch an die hunderttausend Menschen in Juvisy gewesen sein, um sich die Sturzflüge anzusehen. Dabei weis Pegoud seinen Vorführungen jetzt eine neue Nuance zu geben, indem er Passagier-Sturzflüge in der Nacht unternimmt, zu denen sich Zeitungsberichterstatter als Passagiere melden. Natürlich geben diese in spaltenlangen Artikeln ihre „Eindrücke" bei jenen Sturzflügen zum besten. Es ist aber wohl anzunehmen, daß sie diese Eindrücke erst später aus ihrem Gedächtnis oder aus ihrer Fantasie schöpfen, denn die immerhin etwas ungewöhnliche Stellung mit dem Kopf nach unten wird zu besonders scharfsinnigen Beobachtungen wohl kaum die rechte Gelegenheit bieten. Hierbei sei erwähnt, daß im Augenblick hier die Frage der Zweckmäßigkeit der Nachtflüge im Mittelpunkt allen Interesses steht und allseitig ventiliert wird, umsomehr als diese Frage demnächst seitens der Sport-Kommission des Aero-Clubs bei Feststellung des Reglements für die nächstjährigen Michelin- und Pommery-Pokale zur Entscheidung gelangen wird. Eine hiesige Fachzeitschrift hat sogar eine Rundfrage bei namhaften Fliegern veranstaltet und das Ergebnis dieses Referendums soll auf die Entschließungen der Kommision bestimmend wirken. Brindejonc des Moulinais und Prövost erklären das Fliegen bei Nacht für außerordentlich gefährlich und letzterer meint, für einen Preis von 100 oder 200000 Francs könne man allenfalls schon die Sache wagen, aber für irgend einen Pokal die Nacht zum Fliegen bestimmen, bedeute einen sicheren Mißerfolg, den kein, französischer Flieger werde sich zu diesem Experiment hergeben. Maurice Farman sagt, man solle sich allmählich im Nachtfliegen üben, und Leutnant Gaubert beantwortet die Frage vom militärischen Standpunkt mit Entschiedenheit dahin, daß für das militärische Flugwesen die Nachtflüge unerläßlich seien. Deutschland habe das vor allen anderen Nationen erkannt und besondere Bewerbe dafür eingerichtet und g«t dotiert. Frankreich müsse diesem Beispiel folgen. Man solle mit ganz kurzen Flügen beginnen und nach und nach die Forderungen erhöhen und auf diese Weise eine Sicherheit und Gewandtheit im Nachtfliegen herbeiführen. Andererseits ist die Frage der verbotenen Zonen denen sich eine Sitzung des Vorstandes der Internationalen Aeronautischen Vereinigung vom letzten Dienstag beschäftigte, dadurch wieder akut geworden. Diese Sitzung fand in den Räumen des Aero-Clubs zu Paris unter Vorsitz des Prinzen Roland Bonaparte statt, und es waren erschienen für Deutschland: Professor Hergesell und Rasch; für Oesterreich: Baron Economico; für Italien: Montu und Hauptmann Mina; für Belgien: Fernand Jacobs; für Frankreich : Graf de la Vaulx; für England: Roger W. Wal-lace; für Dänemark: Marineleutnant von Ullidtz; für Ungarn : von Hevesey; für die Niederlande: Jonkheer van den ßerch van Heem-stedei für die Schweiz: Oberst Audeoud; f ür Schweden: Amundsen; für die Vereinigten Staaten: Champbell Wood; für Argentinien : Oberstleutnant Nach langer Diskussion einigte sich die Versamm-dahin, an den von der Internationalen Rechtskommission ausgearbeiteten und von der Versammlung im Haag aeeeptierten Beschluß zu erinnern, und zu betonen, daß der heutige Zustand des Luftverkehrs, trotz einiger in einzelnen Ländern vorgenommenen Verbesserungen, noch immer ein ernster sei. Es gelangte 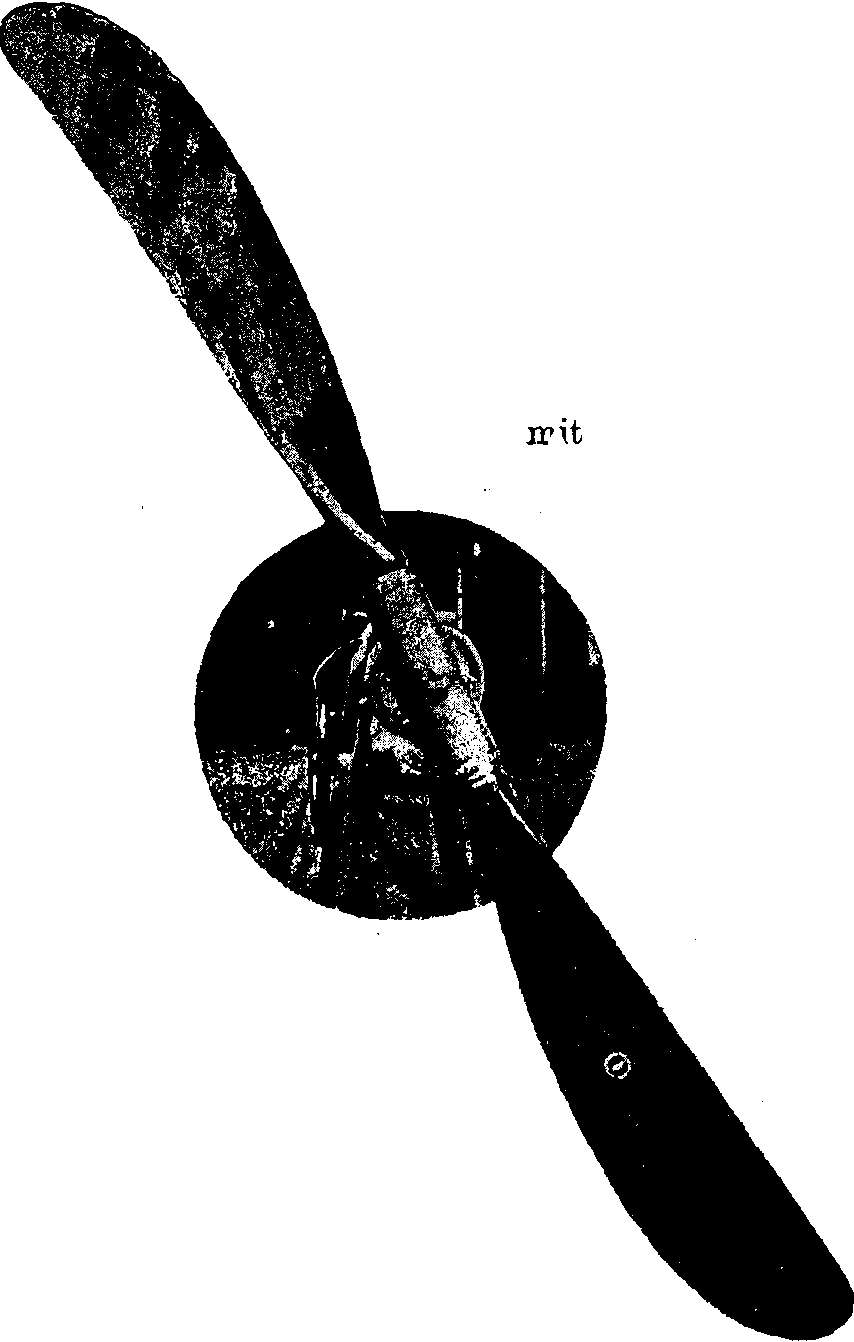 Schraube von Chauviere mit wahrend des Betriebes veränderbarer Steigung. Enrique Mosconi. lung einstimmig folgender Beschluß zur Annahme : 1. daß jede nationale Vereinigung bei ihrer Regierung vorstellig werden möge, damit die Maßregeln betreffend das Verbot gewisser Zonen für Luftfahrer in liberalem Sinne gemildert werden, wie es die vitalsten Interessen der Luftfahrt notwendig machen, ohne daß die Sicherheit des Landes dadurch angetastet werde; 2. daß jede nationale Voreinigung ihre Regierung ersucht, den von der Haagcr Versammlung gefaßten Beschluß bei der französischen Regierung zu unterstützen, du mit diese die Initiative zur Einberufung einer neuen internationalen Konferenz ergreife, die im Laufe ihrer Verhandlungen die internationale Regelung des Luftverkehrs, soweit er die verbotenen Zonen betrifft zu prüfen haben soll. Es wurde ferner beschlossen, eine ausserordentliche Sitzung der Int. Aeronautischen Vereinigung einzuberufen, in der jede zugehörige Vereinigung durch drei Delegierte vertreten sein soll. Der österreichische Delegierte gab alsdann folgende Entschließung der Österreich-ungarischen Regierung bekannt: „Die Hälfte der verbotenen Zonen in Oesterreich-Ungarn wird wieder frei gegeben. Ferner ist formeller Befehl ergangen, daß in Zukunft Luftfahrzeuge nicht mehr, wie das vorgekommen ist, beschossen werden." Es sei auch des Gerüchts Erwähnung getan, wonach ein Postbeamter in Grasse einen neuen praktischen Fallschirm erfunden haben soll, der zwar erst in verkleinertem Modell erprobt worden ist, bei dem man aber auf außergewöhnliche Resultate rechne. Man will wissen, daß der deutsche Flieger Paul Stöffler den Apparat bei einem demnächstigen öchaufluge in Nizza von seinem Flugzeug aus demonstrieren werde. Das französische Militärflugwesen bereitet sich unter seinem neuen, anscheinend sehr rührigen Chef, dem General Bernard, zu intensiver Tätigkeit vor. Zunächst folgen sich fast täglich Verordnungen auf Verordnungen, welche offenbar eine gründliche Reorganisation des ganzen militärischen Flugwesens bezwecken. Namentlich ist eine allgemeine Personalveränderung in in den leitenden Stellen vorgenommen worden, welche in mancher Hinsicht interessant ist. So ist der Oberst ßouttieaux vom Geuiekorps mit der Leitung der 1. Fliegergruppo in Lyon, der Oberstleutnant Canter vom 7-1. Infanterie-Regiment mit der Leitung der 2. Fliegergruppe in Reims beauftragt worden. Major Richard vom Geniekorps wird der Station Versailles-Saint Cyr vorstehen, während deren bisheriger Leiter, der Geniehauptmann Steve dem Zentraletablissement für militärisches Flugzeug- IJ^terial. zugeteilt ist. Der Hauptmann Lucas von der Kolonial-Infanterie wird das Flugzentrum von Saint Cyi und der Hauptmann Neant die Station Epinal befehligen Hauptmann Renaux ist zum Leiter der Station ßelfort, Hauptmann Schneegans zum Chef des Flugzentrums Toul berufen. Hauptmann Roisin, der von der 2. Gruppe in Reims, ist zum Chef des Lagers von Chälons, Geniehauptmann Delassus zum Chef der Station Verdun ausersehen, während das Zentrum Maubeuge in Zukunft dem Artilleriehauptmann Yen ce unterstellt sein wird. Infanteriehauptmann Guillabert von der 1. Fliegergruppe zu Villacoublay wird dem Zentrum Reims vorstehen und Hauptmann Legardeur dem Zentrum Lyon. Die zahl- reichen Personalveränderungen, von denen hier nur die wichtigsten angeführt sind, werden in hiesigen, auch nicht militärischen Kreisen sehr lebhaft besprochen, weil sie ersichtlich die Tendenz der Verjüng ung in den leitenden Stellen zeigen. Besonderes Interesse wendet sich neuerdings hier auch dem Plugwesen in den Kolonien zu für dessen Entwicklung mehrere Vereinigungen im Mutterlande in außerordentlich rühriger und geschickter Weise tätig sind. So hat die Ligue Nationale Aerienne für die Ueber-querung der Sahara die von ihr organisiert und mit allen Mitteln gefördert wird, nun-„ . , , mehr endgültig die Pariser Salon. Strecke fest e Station für drahtlose Telegrafie im Breguet-Zweideäer. Welcher fag Links: Die Trommel mit aufgewickelter Antenne. ., ' *«■ϖϖ■ J& mit dieser Mission betraute Luftgeschwader zu folgen haben wird. Die Strecke ist folgende: 1. Oran-Figuig, die Eisenbahnlinie entlang; 2. Figuig, das Tal von Zusfana, Igli, Adghar, Aoulef, die Linie der Oasen entlang. Dieser Teil der Strecke bedarf keiner besonderen Markierung; 3. Aoulef, In Zize, Timissao, In Uzel, Timiaouoin, zum Generalgouvernement von Algerien ressortierend; 4. Timi'aöuin, das Tal von Irar In Enzel Agarek, Tabancort, Gao, und Timbuktu. Von Aoulef nach Timbuktu muß ein sehr sorgfältiges Strecken-Markieren vorgenommen werden. Es wird das durch eine Reihe von Steinpyramiden geschehen, wie es seitens des Generals Bailloud gelegentlich seiner kürzlichen Durchquerung der Säharl'sf" bereits versucht worden ist. Der bekannte Flieger Frank Barra hat "den Auftrag erhalten, seinen Rekognozierangsfliig zu unternehmen um' die Markierung der Flugstrecke zu bewirken. Schließlich sei noch erwähnt, daß auf dringenden Wunsch des die tunesische Okkupationsarmee befehligenden Generals der französische Kriegsminister dem Flugzentrum von Kassar-Said zwei neue Militärzweidecker zugeteilt hat, die in einer demontablen Fliegerhalle untergebracht werden sollen. Außerdem ist beschlossen worden, das Luftgeschwader von Biskra, das sich gegenwärtig in Tunis befindet, dort bis auf weiteres zurückzubehalten. 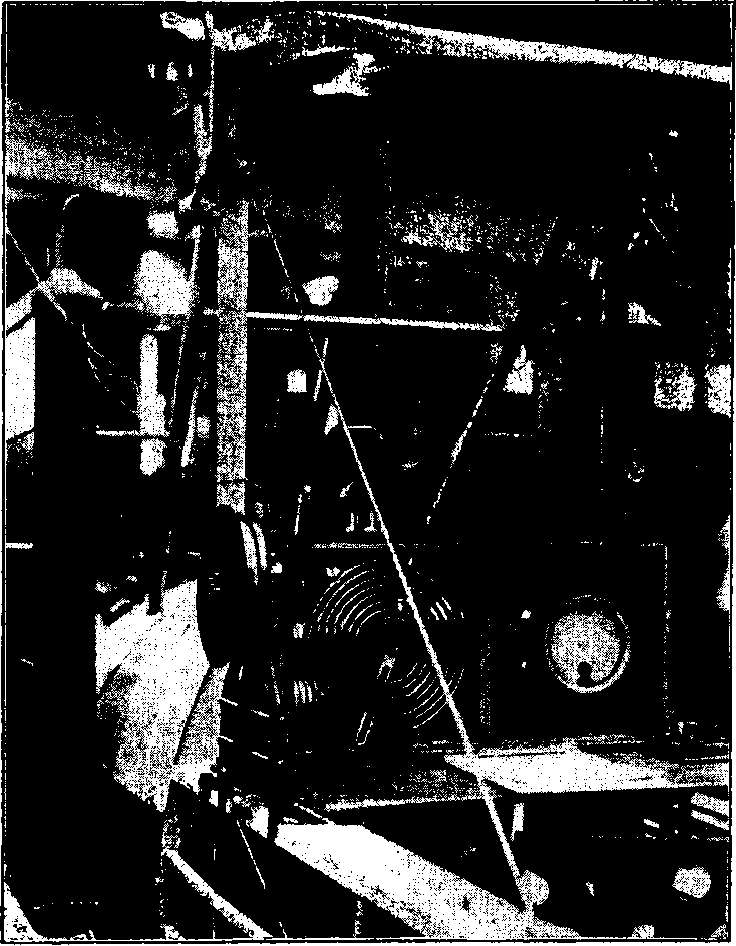 Es wird von Interesse sein, zu erfahren, daß der bekannte rumänische Prinz Bibesco, welcher sich schon häufig durch seine übereifrige Tätigkeit zugunsten der französischen Flugzeugkonstrukteure von sich reden machte, soeben dem Aero-Club von Rumänien einen Pokal ausgehändigt hat, welcher dazu bestimmt sein soll, als Siegestrophäe für ein Flugzeug-Rennen Paris-Bukarest zu dienen. Dieser Pokal soll, nach dem Wunsche seines Stifters alljährlich bestritten werden und es wird angenommen, daß die Strecke zwischen der französischen und der rumänischen Hauptstadt ungefähr in 25 Stunden von den Flugzeugen zurückgelegt werden kann. Rl. Johannisthaler Brief. (Von unserem Johannisthaler Korrespondenten.) Weihnachten steht vor der Türe. Doch von tüchtigem Frost und weißem Winter, der den Fliegern schön recht wäre, ist in Johannisthal noch immer nichts zu merken. Statt dessen nur wieder Sturm, ein unsolides Wintergewitter und Regen. Wenn es nur ein klein wenig aufhellt, ist auch ein flinker Ein- oder Doppeldecker aus dem Schuppen heraus und flitzt zwischen Himmel und Erde dahin. Der 17. Dezember 1913! Heute sind es 10 Jahre her, daß einem menschlischen Wesen mit Maschinenkraft der erste freie Flug gelang. Es war am 17. Dezember 1903, als die Gebrüder Wright in Kitty Hawk einen Flug von 12 Sekunden fertig brachten. Und ein sonderbares Spiel des Zufalls fügt es, daß am 18. Dezember 1913, fast auf den Tag zehn Jahre nach der Geburt der Fliegerei im  Ago-Pfeil-Doppeldecker. Reichstagsgebäude den Siegern der Großen Preise der Nationalflugspende die verdienten Preise überreicht werden. Darunter der erste Preis dem 1. Sieger Victor Stoeffler, dem Chef-Piloten der Automobil-& Aviatik A.-G. für einen Flug von 24 Std. 45 Min. Dort in Kitty Hawk ein Flug von 12 Sekunden, hier nach einem Jahrzehnt ein solcher von 24 Std 45 Min. Was liegt alles zwischen diesen beiden Etappen, auf denen die Flugtechnik noch nicht stehen bleiben wird! Wieviel Erwartungen wurden gebrochen, wieviel Hoffnungen wurden trotzdem erfüllt. Flug-Enthusiasten, Flug-Pioniere wurden zu Flug. Märtyrern. Und doch, wo immer in die Reihen eine Lücke gerissen ■wurde, neue Männer sprangen dafür in die Bresche: in den vernichtenden Flug-Apparat, an den vereinsamten Zeichentisch. Vorwärts, nur vorwärts heißt es bei uns in Deutschland. Die Leistung Victor Stoeffltr's darf nicht der Höhepunkt sein, nein sie muß die erste Stufe iür weit größere Taten der Deutsehen Flugzeug- und Moloren-Industrie, der deutschen Fileger werden. Deutsche Flieger die an Stoeffler, Schlegel, Caspar, Thelen, Oberleutn. Kastner, Leutnant Geyer, Stiefvater, sich ein Vorbild nehmen, brauchen wir. — Zum 5. Aerqsalon in Paris sind auch von Berlin und Johannisthal eine ganze Anzahl Herrn abgereist, um mit eigenen Augen die Fortschritte der Franzosen im Flugzeug- und Motorenbau zu schauen. Es hat hier allgemeine Anerkennung gefunden, daß der „Flugsport" schon in seiner letzten Nummer so schnell und ausführlich über die mannigfaltigen neuen konstruktiven Verbesserungen des französischen Flugzeuges und Motors berichtet hat. Von absolut zuverlässiger Seite erhält Ihr Korrespondent die Mitteilung, daß die Kaiserl. Marine ein Curtiß-Flugboot neuesten Typs erworben hat. Das Boot trifft Ende ds. Mts. bereits in Putzig ein und wird von der Marineflieger-Abteilung dort eingehend erprobt werden. In einem viel gelesenen Berliner Blatte war dieser Tage eine Meldung; aus der Provinz zu lesen, wonach die Alhatros-We ke Ges. m. b. H. ihren gesamten Betrieb nach Schneidemühl verlegen sollten. In Wirklichkeit verhält sich die Sache folgendermaßen: Die Albatros-Werke verlegen lediglich ihre Offiziersschule nach Schneidemühl. Mit der Offiziersfliegerschule, deren Zöglingszahl das Kriegsministerium jeweils bestimmt, siedelt das erforderliche Lehrer- und Montagepersoual und die nötige Anzahl Schulmaschinen nach Schneidemühl über. Das dort zur Verfügung stehende Gelände ist lund 260 Morgen groß und liegt am alten Exerzierplatz in der Berliner Vorstadt. Eine Verlegung der gesamten Fabriken und des vorbildlich organisierten kaufmännischen Bureaus ist, wie ich aus bester Quelle erfahre, zurzeit nicht geplant. Der Versand neuer Apparate geschieht ebenfalls weiter von Johannisthal aus. Die Albatros-Werke sind noch beschäftigt und haben augenblicklich ungefähr 400 Arbeiter. Es stehen aus oben angeführten Gründen auch nicht Entlassungen von Arbeitern bevor, wie sie die Gesamtiibersiedlung der Fabrik ja notwendig maohen .Jiönntp. Im Höchstfalle gehen 60—100 esprobjte Arbeiter vom Werk nach Schneidemühl, die für Instandhaltung und Reparatur der Apparate der Offiziersflieger bestimmt sind. Ueber den Bau eines Flugplatzkasinos in Schneidemühl für 20—25 Offiziere schweben bei der Fabrikleitung noch Erwägungen Eine Reparaturwerkstatt wird sofort eingerichtet. Alle anderen in der Tagespresse noch verbreiteten Mitteilungen über diese Angelegenheit werden mir ausdrücklich als falsch bezeichnet. Gleich der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt in Adlershof hat auch die Techn. Hochschule Charlottenburg in Staken (Geh. Reg.-Rat, Prof. A. Riedler) und die Mechanisch Techn. Versuchsanstalt der Techn. Hochschule Dresden (Herr Geheimrat Scheit) einen Prüfstand für Flugmotoren. — Bei den neuen nach Geh. 'Reg.-Rat Riedler geschaffenen Prüfständen, ist für Flugmotoren dasrjGestell des Prüfstands aus nahtlosen Röhren als geschweißter Rahmen hergestellt, in Länge, Form, Massen und Verteilung dem Flugzeug entsprechend.  Ago-Kßvallerie-Eindedier, Dieses Gestell wurde in der Mitte und hinten auf Luft gelagert, genau wf& das Flugzeug durch die mittleren Tragflächen und durch die hinteren Schwanzflächen auf Luft gestützt ist. Die hintere Lagerung ist znr Schrägstellung veiänderlich. Das Kopfende nimmt 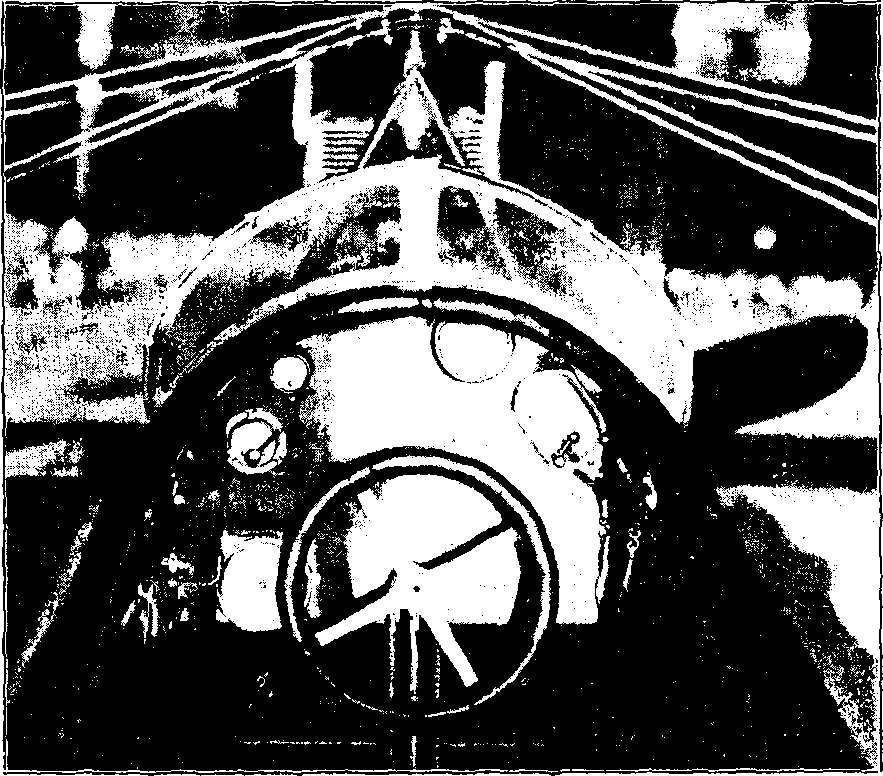 Führersitz des Ago-Kavallerie-Eindeckers. den Flugmotor auf und wird so eingerichtet, daß schon während der Versuche ein anderer Motor außerhalb des Flugzeuges in den Kopf eingebaut wird und dann rasch auf dem Prüfgestell gegen das vorhandene Kopfstück mit Motor ausgewechselt werden kann. Die elastische Stützung auf Luft erfolgt in Lnftgummireifen. Die Spannnng in diesem kann nach Bedarf so reguliert werden, daß die Schwingungen des Motors während seines Laufs auf dem Prüfstand genau mit denen auf dem Flugzeug übereinstimmen. In gleicher Weise wie diese zwei Hauptstellungen des Prüfstandes sind auch alle weiteren Lagerungen für die Durchführung der Messungen luftelastisch ausgeführt. Mit den neuen Prüfständen und den von ihm verbesserten Massenvorrichtungen können trotz des äußerst complizierten Zusammenwirkens vieler Kräfte z. B., die Drehmomente bis '/*> mkg oder Leistungen bei 50 —100 PS Motoren bis Vio PS genau ermittelt werden Der zweite Kaiserpreiswettbewerb für Flugmotoren wird die gesamte Deutsche Flugmotoren-Industrie an die Front bringen. Der Kaiserpreis im Gesamtbetrage von 140 000 Mark wird zu gleichen Teilen dem besten luft- und dem besten wassergekühlten Motor zuerkannt. Als bester Motor gilt derjenige, welcher die niedrigste Wertungszahl erhält. Bis zu zehn folgende Bewerbern erhalten ev. für jeden Motor einen Preis von 4000 Mark. Die zuzulassenden Motoren müssen von deutschen Bewerbern angemeldet und in Deutschland nach der Konstruktion der Bewerber oder in deren Fabrik ohne Verwendung aus dem Ausland bezogene Teile hergestellt sein.*) Der Bund der Industriellen stellte in einer Umfrage bei 300 meistens sehr großen Industriebetrieben fest, daß sie durchschnittlich 85 v. H. ihrer Patente vorzeitig und unfreiwillig fallen lassen mußten, blos durch den Druck der jährlichen Gebühren dazu veranlaßt. Wie soll da der meist wenig oder gar nicht bemittelte Einzelerfinder in der Lage sein, nachdem er, wie gewöhnlich für ein Patent und die Versuche schon seinen letzten Heller geopfert hatte, noch weiter alljährlich steigende Gebühren zu zahlen! Mit Jürgensohn rufe ich: „Darum fort mit dem Jahresgebührensystem dieser Zerstörungsmaschine auf dem Gebiete werteschaffender erfinderischer Geistesarbeit !" Von Herrn Hauptmann a. D. Hildebrandt, wird mir bestätigt, daß ein neuer deutscher Brennstoff für Explosionsmotoren im Anmarsch ist. Just, wie wir ihn wünschen: 30°/o billiger als Benzin, in den Explosionen kräftiger als Benzin, im Verbrauch wesentlich sparsamer als dieses. Der neue Brennstoff hat sich in Fahrt&n von ca. 45C0 km im Wagen gut bewährt. — Oesterreich hat im Anschluß an die Tagung der Föderation Aeronautique Internationale, deutsche Vertreter: Geh. Rat Hergesell und Oberlt. Rasch und die von dieser angenommenen Resolution gegen die Verbotszonen für Luftfahrer die Hälfte der Verbotszonen aufgehoben. Die Wünsche der Deutschen Hochburg der Fliegerei gehen dahin, daß die Deutsche Regierung dem guten Beispiel der Bundesgenossen recht bald folgen möge: Zum Wohle des Lufverkehrs, den jede Fessel hindert. — Für heute will ich mit dem Wunsche: „Fröhliche Weihnachten, lieber Leser", schließen. *) An anderer Stelle geben wir die Ausschreibung wieder. Aus den englischen Flugcentren. Lond on. In den hiesigen Flugzeugfabriken wird fieberhaft gearbeitet. Ueber die neuen Konstruktionen dringt wenig an die Oeffentliohkeit. Viokers Ltd. hat einen neuen Doppeldecker fertiggestellt, der ausschließlich aus Stahl erbaut worden ist. Der Bau erinnert an die bekannte Henry Farman-Type, indessen zeigt das Anfahrgestell vollständig neue Formen. Der zwischen den Tragflächen angeordnete Rumpf ist mit zwei Cellonfenstern zu beiden Seiten versehen. Der Beobachtersitz befindet sich vor dem des Führers. In dem vollständig gepanzerten Rumpf befindet sich vor dem Beobachtersitz ein Maschinengewehr. Diese Maschine ist von Vickers für die Militärverwaltung konstruiert worden. Der Motor ist ein 100 PS Gnom und hat der Apparat bei seinen Probeflügen eine Geschwindigkeit von 69 Meilen in der Stunde erreicht. Nicht geringes Aufsehen erregte der neue Doppeldecker der Deutschen Flugzeugwerke, der bereits mehrere ausgezeichnete Flüge unter der Führung des bekannten Fliegers Roempler "ausgeführt hat. Diese Maschine repräsentiert hier eine vollständig neue Type. Bemerkt sei noch, daß der Apparat direkt aus den Werken nach hier verschickt wurde ohne vorher geflogen zu werden. Der Apparat wurde hier von den meisten Militär Sachverständigen, unter anderen auch von Colonel Henderson, dem Direktor für das englische Flugwesen, sowie vieler Attachöes anderer Staaten besichtigt, die sich sämtlich hervorragend über dieses neueste Produkt deutscher Flugzeug-Industrie äußerten. Deutscher Fleiß und deutsche Arbeit haben diese neue Technik bereits auf eine Stufe gehoben, die sie in den Vordergrund der gesamten Flugwelt stellt. „Eine für Kriegszwecke sich hervorragende eignende Maschine, die nicht nur dem Flieger, sondern auch dem Beobachter ein äußerst großes Gesichtsfeld bietet", bemerkten die Vertreter der englischen Regierung und diese Ansicht teilt mit ihnen die gesamte englische Presse, die sich nicht nur auf kurze Miteilangen beschränkt, sondern sich auf Seiten und Seiten erstreckt. Soweit bekannt gegeben werden darf, haben sich die Deutschen Flugzeugwerke mit einer großen englischen Schiffsbauwerft zusammengetan, die in aller kürzester Zeit diese deutsche Maschine und ebenfalls einen deutschen Motor hier fabrikmäßig herstellen wird. Eine Schule mit sechs Apparaten wird vorläufig auf dem Flugplatze in Brooklands eingerichtet werden. Man darf deshalb mit Bestimmtheit annehmen, daß in Zukunft deutsche Maschinen nicht nur in England gebaut werden, sondern auch von hieraus an den Weltmarkt gelangen werden. Ein interessanter Prozeß beschäftigte dieser Tage die hiesigen Gerichte. Die Gebr. Pashley, Aeroplane Besitzer auf dem Flugplatze zu Shoreham, verklagten die British and Colonial Aeroplane Co., besser bekannt als die Bristol-Werke für Schadenersatz in Höhe von Lstr. 123, Eric Pashley, der an Kruken erschien, sagte in Gegenwart vieler Zeugen aus. daß er bei einem Landungsversuche mit dem Bristol-Doppeldecker Leutnants Crowford-Kehrmann, einen Schüler der Bristol Co., zusammenstieß. Der Grund war, daß der Bristol-Schüler entgegen den Bestimmungen des Flugplatz-Vorstandes auf dem Platze hin und her flog und damit den Zusammenstoß verursachte. Das Gericht erkannte die British und Colonial Co. als den schuldigen Teil und verurteilte dieselbe zur Zahlung der erwähnten Summe von Lstr 123. Claude Grahame White, der bekannte englische Pionier auf dem Gebiete des Flugwesens, hatte die Absicht dem Pariser Salon einen fliegenden Besuch abzustatten. Bei diesem Fluge begleitete ihn der bekannte Sportsmann Lord Drogheda, sowie zwei weitere Fluggäste Bis zur Küste ging alles sehr gut. In der Nähe von Folkestone, in Sandgate, wurde eine Landung vorgenommen um die Benzinbehälter für den Kanal zu füllen. Beim Weiterung wollte der große Apparat, der sonst mit 8 und 9 Fluggästen mit Leichtigkeit vom Boden abkam, denselben nicht verlassen und rannte mit einer Geschwindigkeit von If> Meilen in der Stunde gegen eine Pallisade, um zur Unerkennt-lichkeit zertrümmert zu werden. Verletzt wurde jedoch niemand.  Doppeldecker D. German Aireraft Works Ltd. (Deutsche Flugz.-Werke Leipzig) auf der Brodiland Rennbahn Flieger Rocmpler mit E. C. Kjiy. Ein anderes Abenteuer, das unter Umständen ein recht schlechtes Ende hätte nehmen können, durchlebte der Flieger Sahnet auf seiner Bleriot-Maschine, als er mit seinem Fluggast. Mrs. Assheston Harbord von Folkestone aus, den englischen Kanal überflog. Gleich nachdem die Flieger die Küste vcrlasson hatten, gerieten dieselben in einen dichten Nebel, und nach kurzer Seit landeten die Flieger in Nieuvillc an der französischen Küste. Der Fing über den Kanal nimmt bekanntlich nicht mehr als 20 Minuten in Anspruch. Der Englische Flugzeiig-Motoreii-Wettbewerb, der seinerzeit vom englischen Kriegsininistorium organisiert wurde und der auf den 1. Februar festgesetzt war, is( wegen Konstruktions- Schwierigkeiten seitens der Motorenfabriken bis auf den 30. April verschoben worden. Der Hauptpreis beträgt bekanntlich 100 00Ö Mark. Ils haben sich bis jatzt über 25 englische Fabriken zur Teilnahme angemeldet, unter denen sich auch die große Finna Armstrong und Whitworth befindet, die den Bau von Daimler Motoren in England aufgenommen hat, und in nächster Zeit auch eine deutsche Flugmaschine konstruieren wird. Lord Die National-Flugspende. Am 18. Dezember fand im Reichstagsgebäude eine Sitzung des Kuratoriums der National-Flugspende statt. Prinz Heinrich von Preußen als Protektor übernahm den Vorsitz mit einer Ansprache, in der er zunächst darauf hinwies, daß der vor 1'/, Jahren an das deutsche Volk ergangene Appell, das deutsche Flugwesen mit geldlichen Mitteln zu unterstützen, Ergebnisse gehabt habe, auf die wir stolz sein dürften. Er erinnerte dann an die Fortschritte im Flugwesen seit dem 29 Sekunden - Flug der Gebrüder Wright in Amerika im Jahre 1903 bis zu dem 21 Stunden-Flug Victor Stöfflcrs in diesem .Jahre. Wenn Deutschland die Periode des Tastens im Flugwesen überwunden und nunmehr dieses nationale Gut selbständig entwickeln könne, so habe zu diesem Gelingen die Nationalflugspende in hervorragender Weise beigetragen. Nach Eintritt in die Tagesordnung erfolgte zunächst nun die Rechnungslegung. Aus dieser ergibt sich: Nach dem unter dem 15. Dezember 1912 veröffentlichten AbschlulJ betrug das Sammelergebnis der Nationalflugspende 7 234 506 Mark. Hiervon standen zur freien Verfügung des Kuratorium-, der Nat:onalflugspcndc zuzüglich der bis 15. Dezember 1913 hinzugetretenen weiteren Spenden und Zinsen insgesamt 5 601 135 Mark. Hiervon sind in der Zeit vom 16. Dezember 1912 bis 15. Dezember 1913 verausgabt worden : für Fliegerausbildutig (erste Ausbildungsperiode) 586272 Mk , für Fliegerprämien (Renten) 479513 Mk , für Fliegerversicherung 80429 Mk., für Ehrengaben für Hinterbliebene abgestürzte Flieger 24504 Mk., für Wettbewerb 213000 Mk., für Flugstützpunkte 125 013 Mk., für die wissenschaftliche Gesellschaft für Flugtechnik zur Prüfung von Erfindergesuchen 0(1000 Mk., für verschiedene Verwendungszwecke 132 036 Mk., für allgemeine Unkosten und dergleichen 14 574 Mk., zusammen 1715 314 Mark. Mithin verbleiben 3S85 791 Mark. Die Uebersicht über die Verwendung der noch zur Verfügung stehenden Gelder ergibt: Auf Grund des Beschlusses des Verwaltungsrates sind bereits in rechtlich verbindlicher Form zugesagt: 2846 170 Mk. und zwar n. a. für die großen Fernflüge 300000 Mk., Reichskolonialamt: Förderung des Flugwesens in den Kolonien 100000 Mk.. für Unter-lialtungszwecko des Daimlermotors löOOOiMk. Ehrenpreise für Militärflieger 55 000 Mk.. Förderung nach geprüfter Neukonstruktion 4OO00 Mark, Flugzeugmotorenwcttbew'orb 225000 Mk., Wasserflugzeug-Stützpunkte 100000 Mk., Wasscrflugzeugwettbewcrb 1914 der Reichs- marine 125000 Mk., Wasserflugzeugplätze an der Ostsee 250000 Mk , Fliegerkurse in München 25 000 Mk., Fliegerschule Johannisthal 60 000 Mk., Prämienkosten für die Fliegera sbildung (zweite Aus-bilduns;speriode) 776000 Mk., Kosten der Versicherung der Flieger 669 570 Mk., für die Durchführung des Programms auf Grund des Beschlusses des Vorwaltungsaussehusses sind grundsätzlich festgelegt: 1 170000 Mk und zwar u. a. Prämionkosten für Fliegerausbildung (dritte Ausbildungsperiode) 380000 Mk., Stunden- und Rentenflüge (städtische Flüge 1914) 435000 Mk., Schnelligkeitswettbewerb 1914 300000 Mk., Flüge mit Weit-Höhenleistungen 5000Mk. Von dieser Summe von 4016170 Mk. stehen 3 885 791 Mk. zur Verfügung, der verbleibende Rest von 130379 Mk. wird durch Spenden ziemlich gedeckt werden. Hiernach folgte die Beratung des nächstjährigen Programms, Zu dem Punkte Stundenflüge und Ehrenpreise wurde beschlossen, die bisherigen Bestimmungen auch für 1914 grundsätzlich beizubehalten, aber die nachstehende Aenderungen eintreten zu lassen : Um einen stärkeren Anreiz zu wirklich großen Leistungen zu geben, soll eine Staffelung der Preise dahin eintreten, daß große Leistungen nicht mehr wie bisher im gleichen Verhältnis, sondern in einer Höhenprogression bewertet werden. Ferner kann die Zahlung einer Prämie für einen StundenElug nach dem heutigen Stande der Flugtechnik überhaupt nicht mehr in Frage kommen Infolgedessen ist für das kommende Jahr in Aussicht genommen, die Bewertung erst von einem Zweistundenfluge beginnen zu lassen. Preise der Nationalflugspende. Bei der Verteilung der Preise der Nationalflugspende hat sich infolge nachträglicher Nachweise nachstehende Reihenfolge ergeben: 1. Aviatik-Mühlhausen (Stoeffler); 2079 km, 100000 Mk. 2. Waggonfabrik Gotha (Schlegel), 1497 km, 60000 Mk. 3. Waggonfabrik Gotha (Caspar), 1381 km, 50000 Mk. 4. Albatros-Johannisthal (Thelen), 1373 km, 40000 Mk. 5 Militärverwaltung (Oberleutn. Kastner), 1228 km, 25000 Mk. 6. Militärverwaltung (Leutnant Geyer), 1173 km, 15000 Mk. 7. Jeannin-Johannisthal, (Stiefvater) 1170 km, 10000 Mk. Bestimmungen für den zweiten deutschen Kaiserpreis-Wettbewerb für Flugmotoren. 1) Wettbewerbsausschuss. Der Ausschuß besteht aus folgenden Herren : vom Reichsamt des Innern: Dr. Lewald, Ministerialdirektor, Vorsitzender, Dam marin, Geheimer Oberregierunosrat, vortragender Rat. Albert, Geheimer Oberregierungsrat, vortragender Rat; vom Reichsmarineamt: Laudahn, Marinebaumeister, Bröking, Marinebaumeister als Vertreter; von der Heeresverwaltung: Oschmann, Oberstleutnant, Abteilungschef im Kriegsministerium, Bartsch, Hauptmann, kommandiert zum Kriegsministerium; vom Ministerium der geistlichen etc. Angelegenheiten: Dr. Dr-Ing. Naumann, Wirklicher Geh. Rat, MinisterialJirektor, von Achenbach. Geheimer Regierungsrat, vortragender Rat; von der Technischen Hochschule Berlin: Dr. Dr.-Ing Riedl er, Geheimer Regierungsrat, Professor; vom Kaiserlichen Automobilklub: Ad Graf von Sierstorpff, Vizepräsident, Paul Daimler, Direktor, Stutgart-Untertürkheim, Wolff, Direktor der Neuen Automobil-Ges, Berlin-Oberschöneweide, vom Kaiserlichen Aeroklub: von Nieber, Generalleutnant z. D. vom Verein Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller: Dr. Heinrich Kley er, Kommerzienrat Frankfurt a M August E u l e r, Fabrikbesitzer, Frankfurt a. M. E Rumpier, Fabrikbesitzer, Berlin-Johannisthal, Willy Tischbein, Direktor der Continental Caoutchouc- und Gutta-Percha-Compagnie in Hannover; von der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt: Rieß von S cheu r ns ch 1 oß, Generalleutnant z. D. Präsident des Vereins, Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt. Dr-Ing Bendemann, Professor, Direktor der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, und die Mitglieder des Preisgerichtes (s. Ziff. 3) Der Ausschuss hat den Wettbewerb einzuleiten und Seiner Majestät dem Kaiser über das Ergebnis zu berichten. ' 2) Prüfstelle. Die Prüfung der Motoren findet in der Motorenabteilung der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt zu Adlershof bei Berlin statt Die Verantwortung für die Prüfstandseinrichtungen und ihre richtige Handhabung sowie für die sachgemäße Durchführung der Versuche und die Richtigkeit der dem Preisgericht als Grundlage für die Beurteilung übergebenen Versuchswerte trägt der D rektor der Versuchsanstalt, unbeschadet seines Rechts, sich in der Ausübung seiner Funktion vertreten zu lassen. Die Prüfstelle hat die Motoren nach Maßgabe der folgend.n Bestimmungen zu untersuchen und die Ergebnisse in übersichtlicher Form bis zum 1. Jan 1915 dem Preisgericht vorzulegen. 3) Preisgericht. Das Preisgericht besteht aus folgenden Herren: Dr.-Ing. Veith, Wirklicher Geheimer Oberbaurat, Abteilungschef im Reichsmarineamt, Präsident, G u n d e 1, Major, Kommandeur des Fliegerbataillons Nr. 1, I. Vizepräsident Richard Müller, Marineoberbaurat, kommandiert zum Reichsmarineamt, II Vizepräsident, Laud ahn, Marinebaumeister, kommandiert zum Reichsmarineamt, Schriftführer, Baumann, Professor an der Technischen Hochschule in Stuttgart. Josse, Geheimer Regierungsrat, Professor an der Technischen Hochschule in Berlin, Kutzbach, Professor an der Technischen Hochschule in Dresden, Lynen, Professor an der Technischen Hochschule in München, Dr Prandtl, Professor an der Universität in Göttingen, Dr. Riedler, Geheimer Regierungsrat, Professor an der Technischen Hochschule in Berlin, Grade, Hauptmann im Fliegerbataillon Nr. 1, von Buttlar, Leutnant, kommandiert zum Fliegerbataillon Nr. 1. Die Entscheidungen des Preisgerichts erfolgen nach Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten oder seines Vertreters. Erforderlichen Falles kann der Wettbewerbsausschuß zur Ergänzung des Preisgerichts weitere Herren berufen. Der Vorsitzende des Wettbewe bsausschusses kann zu den Sitzungen des Preisgerichts einen Vertreter des Ausschusses entsenden, der jederzeit gehört werden muß. Der Direktor der Versuchsanstalt und nach seinem Ermessen auch der Leiter der Prüfstelle sowie ein Vertreter des Arbeitsausschusses, sofern nicht mindestens ein Mitglied desselben zugleich Preisrichter ist, nehmen an den Sitzungen des Preisgerichts mit beratender Stimme teil Das Preisgericht hat auf Grund der Prüfungsergebnisse endgültig über die Reihenfolge zu entscheiden, /ach welcher die /v.otoren Seiner Majestät dem Kaiser zur Preisverteilung vorzuschlagen sind Es ist für Zweiteis- und Streitfälle die entscheidende Stelle. Es hat einen Arbeitsausschuß zu bilden, zu dem neben den Mitgliedern des Preisger chts auch anderweit geeignete Sachverständige herangezogen werden können Von diesem Arbeitsausschuß oder vom Preisgericht soll ständig wenigstens ein Mitglied als Zeuge bei den Versuchen zugegen sein, ohne jedoch selbst in diese einzugreifen. Die Versuche dürfen nicht durch Fehlen eines Zeugen vom Arbeitsausschuß aufgehalten werden. Im Notfälle hat der Leiter der Prüfstelle einen Ersatzzeugen zu bestimmen, der aber nicht zugleich die Versuche leiten darf. 4) Delinitionen. In diesen Bestimmungen und in allen auf den Wettbewerb bezüglichen sonstigen Fes'setzungen soll das Wort „Bewerber" alle Beauftragten und Vertreter der sich btwerbenden Person oder Firma umfassen. Desgleichen soll das Wort „Motor" die sämtlichen Zubehörteile des Motors mitumfassen 5) Zulassungsbedingungen Die Motoren müssen: a. von deutschen Bewerbern angemeldet und in Deutschland nach der Konstruktion der Bewerber oder in deren Fabrik ohne Verwendung aus dem Ausland bezogener Teile hergestellt sein, b. eine Leistung von wenigstens 80, höchstens 200 PS haben (Bremsleistung) c. ihr Eigengewicht mit Zubehör (vergl. Ziffer 28 a) da f nicht mehr als 4 kg für 1 PS betragen. Von jedem Bewerber können mehrere Motoren verschiedener Bauart zugelassen werden, deren jeder für sich um den Preis wirbt. Ein Unterschied von weniger als 15 v. H. im Hubraum aller Zylinder, gilt nicht als Merkmal verschiedener Bauart. Von gleicher Bauart kann, jedoch nur bei rechtzeitiget Anmeldung, noch ein zweiter Motor desselben Bewerbers zugelassen werden, der gegebenen Falles (Ziffer 25) als „Ersatzmotor" für den ersten eintritt. Der Bewerber hat den Ersatzmotor als solchen zu kennzeichnen. 6) Anmeldung. Die Anmeldung ist bis zum 1. Mai 1914 an den Vorsitzenden des Preisgerichts zu richten. Sie hat unter Benutzung des in Anlage beigefügten Vordruckes (wovon weitere Exemplare von der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, Adlershof, zu beziehen sind) für jeden Mo:or (bezw. jede Bauart) getrennt zu erfolgen und muß alle darin vorgesehenen Erklärungen und Angaben enthalten, insbesondere: a die eidesstattliche Versicherung des Bewerbers, daß der Motor in einer von ihm anzugebenden Fabrik in Deutschland ohne Verwendung aus dem Ausland bezogener Teile hergestellt ist; b die Erklärung des Bewerbers, daß er sich diesen Bestimmungen und dem Spruche des Preisgerichts endgültig unterwirft: c. die Erklärung des Bewerbers, daß er auf Entschädigungsansprüche aus dem Wettbewerb, auch im Falle von Beschädigungen des Motors oder dergl., verzichtet; d. die folgenden „allgemeinen Konstruldionsangaben": Art des Motors (Viertakt oder Zweitakt, feste oder umlaufende Zylinder, Luft- oder Wasserkühlung), Anordnung der Zylinder (in einer Reihe stehend, hängend oder liegend; fächer- oder sternförmig, V-förmig in Doppelreihe usw.), Zylinderanzatil, Bohrung und Hub, voraussichtliches Eigengewicht mit allem Zubehör (vergl. Ziff. 28a), Nutzleistung in PS 1 k ϖ k„„k„;„i,(,„(=„ Motordrehzahl bel dfsℜ,Ä.,-ltlßten Drehzahl der Schraubenwelle J uauerbetneD Durchmesser der Schraube. Stündlicher Verbrauch an Brennstoff und Schmieröl und stündlicher Kühlwasserumlnuf in kg, Durchmesser der Anschlußleitungen für Kühlwasser, Brennstoff und Schmieröl, Druckhöhe des Brennstoffs u Schmieröls, bezogen auf die Motorwelle; e. eine Zeichnung („Einbauzeichnung") welche die Anordnung des Motors und alle für den Einbau und die Leitungsanschlüsse erforderlichen Maße angibt. No. 20 „Flugsport." Seite 1003 Aenderung der Angaben, die ohne wesentlichen Einfluß auf die Ausgestaltung der Versuchsstände bleiben, sind noch bis zum 1. Juli 1914 zulässig. f. Falls sich der Motor in Wirkungsweise, Aufbau oder Bedienung wesentlich von den gebräuchlichen Arten unterscheidet: eine Erläuterung der Wirkungsweise und eine Bedienungsvorschrift, aus der zu ersehen sein muß, Ob und welche besonderen Vorbereitungen für seine Prüfung nötig sind 7) Prüfungsgebühr. Für jeden Motor und für jeden Ersatzmotor ist als Beitrag zu den Prüfungsunkosten und für die Lieferung der Betriebsstoffe (Ziff. 17) je eine Prüfungsgebühr von 800 Mark zu erlegen. Erst nach Eingang dieser Gebühr ist die Anmeldung gültig. Wird die Anmeldung zurückgezogen oder der Motor nicht rechtzeitig eingeliefert, so ist die Prüfungsgebühr verfallen. Für den Ersatzmoior wird die Hälfte der Gebühr zurückgezahlt, falls er nicht zur Prüfung kommt. 8) Nachanmeldung. Nachträgliche Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. 9) Zulassung. Das Preisgericht hat die Anmeldung zu prüfen und die erfolgte Zulassung dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Die Prüfstelle hat ihm die zur Anpassung der Motoren an die Prüf einrichtung nötigen Angaben zu machen. Wird die Zulassung versagt, so erhält der Bewerber de Prüfungsgebühr zurück. 10) Zulassung außer Wettbewerb. Zulassung von Motoren außer Wettbewerb findet nicht statt 11) Abnahme und Einlieferung der Motoren. Die Motoren Sindbis zum 1. Septemher 1914 frachtfrei an die Prüfstelle einzuliefern. Später und zwar spätestens bis zum 15. September 1914 eingelieferte Motoren werden nur auf Grund einstimmigen Beschlusses des Preisgerichts zugelassen, falls höhere Gewalt als Hinderungsgrund dem Preisgericht einwandfrei nachgewiesen wird. Die Motoren müssen vollständig ausgerüstet, mit den zum Anpassen an den Prüfstand erforderlichen Teilen und mit einem Satz Werkzeuge versehen sein, wie er zur Instandhaltung des Motors erforderlich ist unl dem Käufer mitgeliefert wird. Sie sind mit ihrem Kühler und den sonstigen Hilfsapparaten betriebsfertig ausgerüstet auf einem gemeinsamen, zum Prüfstand passenden Gestell, ähnlich wie im Kopf eines Flugzeugrumpfes, zu befestigen, wobei auf geringen Luftwiderstand der ganzen Motoranlage Bedacht zu nehmen ist. (vergl. Ziff. 20). Umkleidungen (Kappen, Hauben) sind zulässig. Nicht mitzuliefern sind die Behälter für Benzin und Oel. Zum Anschluß der Benzinzuleitung und stets auch einer äuOeren Oelzuleitung müssen die Verbindungsteile an passender Stelle vorhanden sein. Zum Antrieb eines Umlaufzählers muß ein von der Motorwelle zwangläufig angetriebener Anschlußzapfen an passender Stelle vorgesehen sein, der gleiche Drehrichtung und Drehzahl mit der Schraubenwelle hat. Mitzuliefern ist ferner eine für den Motor bei der Prüfung auf dem Versuchsstande passende Luftschraube gewöhnlicher Art, welche beim Betrieb auf festem Stand die volle Leistung des Motors aufnimmt und einen Luftstrahl von wenigstens 20 ni/sk gegen das den Motor tragende Gestell (in der Regel also auch gegen den Motor) bläst und sich von dieser Seite (hinten) gesehen im Sinne des Uhrzeigers dreht (rechtsgängige Zugschraube). Sollte die Motorkonstrüktion eine andere Schraube erfordern, so ist dies bei der Anmeldung besonders anzugeben. 12) Besondere Angaben. Mit den Motoren sind bis zum 1. Sept. 1914 an das Preisgericht einzuliefern: a. eine Schnittzeichnung des Motors (Längs- und Querschnitt), aus welcher Bauart und Anordnung aller wesentlichen Teile ersichtlich sind und zwar in je einer Ausfertigung für die Prüfstelle und für jedes Mitglied des Preisgerichts: b. die Angabe des Preises für die Bestellung eines Motors der gleichen Art; c. Angaben darüber zu machen, ob und welche Materialien des Motors vom Ausland bezogen sind. Diese Zeichnungen und Angaben zu a und b haben das Preisgericht und Prüfstelle streng geheim zu halten. Außerdem ist an die Prüfstelle eine Probe von mindestens je 2 kg der verlangten Betriebsstoffe einzureichen, falls andere als die von der Prüfstelle vorgesehenen Betriebsstoffe gewünscht werden (vergl. Ziff. 17). 13) Zelt und Reihenfojge der Prüfungen. Die Motoren werden vom 1. September 1914 ab in firmenweise auszulosender Reihenfolge geprüft. Die Prüfstelle darf von dieser Reihenfolge abweichen, w^nn dadurch Zeit gespart wird. 14) Art der PrQfung. Zuerst werden in Vorversuchen die allgemeinen Eigenschaften des Motors, Betriebsfähigkeit, Regelbarkeit und Bereitschaft nachgeprüft unter Erschwerungen, wie sie im Fluge vorkommen. Dann werden in Leistungsversuchen die Leistungs- und Verbrauchszahlen ermittelt. Schließlich wird in Dauerversuchen bei gewöhnlicher Belastung die überlegene Zuverlässigkeit geprüft. Zu den Dauerversuchen wird nur eine beschränkte Zahl von Motoren nach Entscheidung des Preisgerichts zugelassen (vergl. Ziff. 29). Inwieweit außer der durch die eigene Schraube gegebenen noch eine besondere Belüftung der Motoren erfolgen wird, bleibt der Entscheidung des Preisgerichts vorbehalten. Die Entscheidung wird den Bewerbern mitgeteilt werden. 15) Aufstellung und Vorbereitung der Motoren auf den Prüf ständen. Die Motoren werden nach Anweisung der Prüfstelle durch den Bewerber aufgestellt und vorbereitet. Dafür wird ein Zeitraum von je zwei Tagen gewährt, die dem Bewerber von der Prüfstelle rechtzeitig benannt werden, nämlich: durch eingeschriebenen Brief, der spätestens am 4. Tage vorher, oder durch Telegramm, das spätestens am 2. Werktage vorher, Vormittags zur Post gegeben sein muß. Die Motoren werden durch den Bewerber selbst aus der Verpackung entnommen. Beim Transport eingetretene Beschädigungen zählen als eine Betriebsstörung im Sinne der Ziff. 23, wenn sie nach dem Urteil des Preisgerichts durch unsachgemäße Verpackung oder sonstige vom Bewerber zu vertretende Umstände verui sacht sind. Die Motoren werden in Gegenwart je eines Mitgliedes des Arbeitsausschusses und der Prüfstelle ausgepackt und sofort auf äußere Anzeichen von Beschädigungen untersucht. Die als Betriebsstörungen anzusehenden Transportbeschädigungen werden auf die zulässigen Störungen bei den Dauerversuchen angerechnet. (Ziff. 24) Das gleiche gilt für Beschädigungen, die während der Vorbereitungen und bei den Probeläufen eintreten, auch dann, wenn sie durch falsche, eigenmächtige Handhabung der Prüfstandseinrichtungen verursacht sind. Die Prüfstelle kann die Vorbereitungsfrist ausnahmsweise verlängern. Während der Vorbereitung kann der Motor versuchsweise in Betrieb gesetzt werden. (..Probeläufe'') Dabei dürfen aber außer den vorgeschriebenen Anpas-sungsarbeiteh keinerlei bauliche Aenderungen am Motor und seinen Zubehörteilen vorgenommen werden. Alle Arbeiten werden von der Prüfstelle überwacht, alle Vorgänge werden zu Bericht genommen, auch etwaige Verzögerungsursachen, die dem Bewerber nicht zur Last fallen. Lange Dauer der Vorbereitungen ist ein Zeichen mangelnder Bereitschaft. Etwaige besondere Unkosten bei der Aufstellung hat der Bewerber zu i ragen. Die Aufstellung des Motors mit allen Hilfsapparaten geschieht ähnlich wie im Flugzeug. Alle zur Bedienung im Gange nötigen Handgriffe, auch ein Kurzschluß für die Zündung, sind an einem wenigstens 1,5 m von der Motormitte entfernten Stand anzubringen. Eine Hilfsölzuleitung ist stets vorzusehen. 16) Bedienung des Motors während der Prüfungen. Die Bedienung erfolgt nur von dem genannten Stand aus und durch eine von dem Bewerber beauttragte Person, deren Abwechslung statthaft ist. Andere Eingriffe und Nachhilfen am Motor selbst sind unzulässig. Auch der etwa nötige schmieröl-oder Kühlwassersatz darf nur vom Bedienungsstand aus erfolgen. Die Bewerber können der Prüfung der eigenen Motoren beiwohnen. Sie dürfen jedoch das innerhalb des Versuchsraumes abgesperrte Prüffeld während der Versuche nicht betreten. 17) Betriebsstoffe. Den Brennstoff zur Vorbereitung und Prüfung liefert die Prüfstelle, und zwar nach Wahl Benzin vom Litergewicht 0,72 kg oder 0,75 kg oder Benzol, auf besonderen Antrag auch andere Betriebsstoffe, sofern sie Handelsware sind und in der verfügbaren Zeit beschafft werden können. Falls der verlangte Brennstoff mehr als 0,50 Mk. pro 1' kg kostet, ist der überschießende Betrag für den gesamten Bedarf vom Bewerber zu tragen Auch das Schmieröl wird von der Prüfstelle geliefert, und zwar nach Wahl der Bewerber, ein leicht-, mittel- oder strengflüssiges Mineralöl oder Ricinusöl. Verwendung eines besonderen, vom Bewerber gelieferten Schmieröles ist statthaft; das Preisgericht entscheidet darüber, inwieweit dies in die Beurteilung einzubeziehen ist. Besondere, sauerstuff- oder stickstoffhaltige Beimengungen im Schmieröl und im Verbrennungsgemisch sinJ unzulässig. 18) Vorversuche. Es sind festzustellen: die Betriebsfähigkeit und die Regelbarkeit bis zur niedrigsten Drehzahl, mit welcher der Motor noch sicher laufen kann, auch bei Schräglagen der Motorachse bis zu + 10" bei voller und bis zu + 15° bei verminderter Drehzahl. 19) Leistungsversuche. a. Im „L e is t u ng sv e r su c h" sind bei voller Belastung durch die mitgelieferte Schraube und bei der vom Bewerber hergestellten Drehzahl zu messen: Die Bremsleistung an der Schraubenwelle (Drehmoment u. Drehzahl). Betriebsstoff verbrauch. Der Leistungsversuch muß drei Stunden ohne Unterbrechung durchgeführt werden. b. In kürzeren Neben versuchen werden dieselben Messungen bei veränderten Drehzahlen ausgeführt. Dazu hat der Bewerber an Stelle der Schraube eine von der Piüfstelle gelieferte Bremsvorrichtung anzusetzen. Die Nebenversuche können nach Befinden der Prüfstelle unterbleiben wenn die Zeit dazu nicht ausreicht. 20) Luftwiderstandsversuche. Das Preisgericht kann besondere Luftwiderstandsversuche anordnen, wenn das durch eine für den Einbau ins Flugzeug ungünstige Gestalt eines Motors geboten erscheint. 21) Dauerversuche. Die vom Preisgericht für die Dauerversuche zugelassenen Motoren (vergl. Ziff. 14) haben mit möglichst gleicher Belastung wie beim Leistungsversuch in rascher Folge bis zu 10 Stunden abschnittweise zu Uufen. Dabei wird Drehzahl, Betriebsstoff- und Wasserverbrauch stand g gemessen. Die Motoren werden tunlichst mit Auspuflschalldämpfern versehen. Zuerst sind 2 Abschnitte von je 10 Stunden zurückzulegen. Die zwischen beiden Abschnitten einzuschaltende Pause muß mindestens 2 Stunden betragen und darf 5 Stunden nicht überschreiten. In dieser Pause dürfen nach Benachrichtigung der Prüfstelle kleine Ueberholungsarbeiten vorgenommen werden, wie sie der Flieger mit einem zweiten Mann mit dem im Flugzeuge als Reserveteile gewöhnlich mitgenommenen Maschinenteilen uud Werkzeugen auszuführen vermag, ohne eine Reparaturwerkstätte zu Hilfe zu nehmen. Nach diesen beiden 10stündigen Dauerversuchen sind die weiteren Erprobungen in 5 stündigen Abschnitten auszuführen, zwischen denen Betriebspausen von wenigstens 2, höchstens 5 Stunden einzuschalten sind Wegen der in diesen Pausen gestatteten kleinen Ueberholungsarbeiten gilt das oben Gesagte. Falls im Verlauf der Dauerversuche eine Leistungsverminderung eintritt, kann die Schraube auf Antrag des Bewerbers derart verkleinert oder durch eine schwächere ersetzt werden, daß die noch erreichbare Leistung des Motors richtig zutage tritt. 22) Betriebsstörungen. Fällt bei den Leistungs- und bei den Dauerversuchen die Drehzahl des Motors auf länger als I Minute unter 85 v. H. der beabsichtigten, so ist der Versuch wegen Betriebsstörung abzubrechen. Nach jeder Unterbrechung ist seitens der Prüfstelle sofort die Ursache der Störung aufzusuchen. Dabei ist das anwesende Mitglied des Arbeitsausschusses heranzuziehen. Der Befund wird sogleich schriftlich festgestellt. Vor Beendigung der Untersuchung darf der Bewerber den Prüfstand nicht betreten. Ist festges eilt, daß die Ursache einer Störung nicht dem Motor oder dem Bewerber zur Last fällt, so darf der Motor ausgebessert oder durch einen anderen Motor gleicher Bauart ersetzt werden. Wenn dazu der mit eingelieferte Ersatzmotor benutzt wird, so gilt dieser von nun an als Hauptmotor und es kann ein neuer Ersatzmotor geliefert werden. Jeder Motor hat die Prüfungen vollständig von neuem zu beginnen. 23) Ausbesserungsarbeiten. Werden nach einer Betriebsstörung, die dem Motor oder dem Bewerber zur Last fällt, größere Ausbesserungsarbeiten nötig so sind solche Arbeiten jeder Art, auch Auswechslung einzelner Teile des Motors, zulässig, wenn sie binnen 12 Stunden erledigt werden. Andernfalls scheidet der Motor aus. Das Gewicht der ausgewechselten Teile darf bei einem Motor im ganzen nicht mehr als Vi seines Eigengewicht betragen. Die ursprüngliche Konstruktion darf durch die Instandsetzung in keiner Weise verändert werden. Die Prüfstelle hat über die Arbeiten genauen Bericht zu führen. Alle ersetzten Teile sind der Prüfstelle zur Vorlage an das Preisgericht zu überlassen. In allen Betriebspausen wird das Prüffeld für den Bewerber gesperrt, sofern er keine Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen hat. 24) Wiederholung der Versuche. Während der Vorversuche und des Hauptversuchs dürfen bei demselben Motor im ganzen höchstens dreimal, während der Dauerversuche wiederum im ganzen dreimal Betriebsstörungen vorkommen. Bei der jeweils 4. Unterbrechung scheidet der Motor aus, auch wenn sich die Störung in kurzer Zeit beheben läßt. Störungen, welche zweifellos nicht dem Motor oder dem Bewerber zur Last fallen, zählen dabei nicht mit. Beschädigungen, welche beim Transport oder bei den Vorbereitungen vorkommen, werden, falls sie auf Verschulden des Bewerbers zurückzuführen sind, auf die Dauerversuche angerechnet (vergl. Ziffer 15). 25) Eintritt des Ersatzmotors. Für einen ausgeschiedenen Motor kann während der Vörversuche und der Leistungsversuche der angemeldete Ersatzmotor eintreten. Während der Dauerversuche darf er nur noch eintreten, wenn der Hauptmotor durch eine zweifellos nicht in ihm liegende oder dem Bewerber zur Last fallende Ursache ausgeschieden ist. Der Ersatzmotor hat in jedem Falle die Prüfungen vollständig von neuem zu beginnen. 26) Einwände gegen die Versuchsleitung. Beschwerden sind schriftlich an den Präsidenten des Preisgerichts zu richten. Das Preisgericht hat darüber nach Anhörung der Prüfstelle alsbald endgültig zu entscheiden. 27) Entscheidung des Preisgerichts. Es sind sämtliche technische Gesichtspunkte zu berücksichtigen, welche praktisch wichtig erscheinen. Insbesondere sind bei der Bewertung neben den Leistiingsmessungen alle Betriebsverhältnisse zu berücksichtigen. Für jeden (Votor ist zunächst eine be-werlungsgrundzahl (vergl Ziff. 28) festzustellen. Aus der Grundzahl ergibt sich die maßgebende Wertungszahl durch Zu- oder Abschläge, die vom Preisgericht in Anbetracht aller Betriebseigenschaften des Motors beschlossen werden. Die Seiner Majestät dem Kaiser vorzuschlagende Reihenfolge entscheidet sich nach zunehmender Höhe dieser Zahlen. 28) Berechnung der Bewertungsgrundzahl. a Das Eigengewicht ist das Gewicht der betriebsfertigen Motoranlage mit allem beim Leistungsversuch auf dem Prüfstand benutzten Zubehör, mit vollständiger Kühlwasserfüllung und mit der zum Betriebe nötigen Oelmenge im Motorgehäuse Als solche wird die am Schlüsse des Leistungsversuches aus dem Motor abgezapfte Menge angesehen. Nicht eingerechnet werden die Luftschraube und die zu ihrer Befestigung auf der Welle dienenden Teile. b. Der stündliche Betriebsstoffverbrauch ist das mittlere Gewicht der im Leistungsversuch stündlich zugeführten und der von der Motoranlage selbst verzehrten Betriebstoffe- u. Wassermengen. c. Das T-s t ii n dige Betriebsgewicht ist die Summe des Eigengewichtes und des Gewichtes der in T-stündigem Betrieb unter den Verhältnissen des Leistungsversuches verbrauchten Betriebsstoffe. d. Die Nutzleistung des Motors ergibt sich aus der beim Leistungsversuch gemessenen Bremsleistung durch Abzug der anzurechnenden Leistungsverluste für Luftwiderstand u. dergl. Uebersteigt sie zeitweilig oder dauernd die zugelassene Grenze (200 PS), so wird der Ueberschuß nicht angerechnet. e. Bewertungsgrundzahl. Das T-stündige Betriebsgewicht geteilt durch die Nutzleistung ergibt die Grundzahl. Ueber die zu Grunde zu legenden Betriebsstundenzahlen (T) und Uber die Bestimmung der anzurechnenden Leistungsverluste hat das Preisgericht vor Beginn der Prüfungsversuche zu beschließen. Die Stundenzahl T kann für Umlaufmotoren und für Standmotoren verschieden festgesetzt werden. 29) Zulassung zu den Dauerversuchen. Das Preisgericht hat bereits nach Beendigung der Leistungsversuche eine vorläulige Bewertungsreihenfolge festzustellen und danach zu entscheiden, welche Motoren zu den Dauerversuchen zugelassen sind, (vergl. Ziff. 14) 30) Veröffentlichung der Ergebnisse. Für die preisgekrönten Motoren werden die (berichtigten) Angaben der Anmeldung, die Ergebnisse der Leistungsversuche und der Wägungen durch die Prüfstelle veröffentlicht; ebenso auch für die übrigen Motoren, insoweit der Bewerber nicht Einspruch erhebt. Vor Veröffentlichung der Ergebnisse hat die Prüfstelle die Zustimmung des Vorsitzenden des Wettbewerbsausschusses und des Präsidenten des Preisgerichts einzuholen. 31) Preisverteilung. Der Kaiserpreis im Gesamtbetrage von 140000 Mk. wird zu gleichen Teilen dem besten luft- und dem besten wassergekühlten Motor zuerkannt. Als bester Motor gilt jeweils derjenige, der die niedrigste Wertungszahl erhalten hat, der also nach Ansicht des Preisgerichts den größten Fortschritt für das Flugwesen darstellt. Liegen für mehrere Motoren die Wertungszahlen so nahe beieinander, daß sie fast gleichwertig erscheinen, so kann das Preisgericht eine weitere Teilung beantragen. Bis zu zehn weitere Bewerber erhalten für jeden Motor einen Preis von 4000 Mk.. wenn das Preisgericht den Motor für prak'isch wertvoll erklärt. B e r 1 i n, den 12. Dezember 1913. Der Vorsitzende des Ausschusses. L e w a 1 d, Direktor im Reichsamt des Innern. Neues vom Schwingenfluge. Naturstudien und Modellversuche. Q. Vorndran, Stuttgart. Bereits in früheren Nr. des „Flugsport", (vergl. Nr. 12 u 13, Jahrg. 1913) habe ich meine Ansichten zu diesem Problem geäußert und versucht, eine neue Theorie aufzustellen und zu begründen. Inzwischen habe ich weitere Naturstudien betrieben und die gewonnenen Ergebnisse durch vielseitige Modellversuche nachgeprüft und bin damit zu den merkwürdigsten und interessantesten Resultaten gekommen. Jedenfalls hat sich meine Theorie in allen wesentlichen Teilen als zutreffend erwiesen, wenn auch in einzelnen Punkten eine Richtigstellung nötig ist. Wie seinerzeit bereits beschrieben, ist diese Theorie in ihren wesentlichen Teilen folgendermaßen zu fassen: „Irgendwelche, mit der Flügelfläche verbundene Arme oderRippen werden auf und ab geschwungen. Die Filigelfläche selbst kann um diese Arme oder Rippen schwingen. Während der 1. Hälfte des Ab war t sga n ge s der betreff. Arme schwingt die Flügelfläche um diese Arme nach aufwärts, während der 2. Hälfte des Abwärtsganges der Arme schwingt die Flügelfläche um diese Arme nach abwärts. Während der ersten Hälfte des Abwärtsgangs der Arme hebt sich also Abwärtsgang der Arme und Aufwärtsgang der Flügelfläche gewissermaßen geeenseilig auf, die Flügeliläche bewegt sich also relativ zur Luft fast gar nicht. Während der 2. Hälfte des Abwärtsganges der AVfife, summiert sich Abwärtsgang der Arme und Abwärtsgang der Flügelfläche, die Flügelfläche bewegt sich also relativ zur Luft sehr schnell, schneller als die bewegten Arm?. Die Geschwindigkeit der Luft verdrängu ng, die ja nur von der Geschwindigkeit der Flügelfläche, nicht der Leitarme abhängt, muß hierbei in sehr kurzer Zeit von 0 bis Maximum steigen, was einen sehr großen Luftwiderstand erzeugt" Die hierbei eintretende sehr günstige Hebewirkung ist in den früheren Abhandlungen bereits ausführlich beschrieben, ich kann also auf diese Ausführungen verweisen. In diesen Ausführungen ist nun der Aufwärtsgang als in ähnlicher Weise erfolgend beschrieben: „Während der 1. Hälfte des Aufwärtsganges schwingt die Flügelfläche um die Arme nach aufwärts, während der 2. Hälfte des Aufwärtsganges nach abwärts." Dies hat sich durch die weiteren Studien und die Modellversuche als unrichtig erwiesen. Es ist ja auch seinerzeit bei der Bildung des betreffenden Diagramms festgestellt worden daß auf diese Weise beim Aufwärtsgang ein kleiner Verlust entsteht. Die Natur führt aber auch den Aufwärtsgang des Flügels ohne Verlust aus. „Während des Aufwärtsgangs schwingt nämlich die Flügelfläche kaum um die bewegten Arme oder Rippen, Flügelfläche und Arme machen vielmehr den Aufwärtsgang mit annä' ernd gleichgroßer Geschwindigkeit." Als Studienobjekte dienten Vertreter aus a'len fliegenden Gruppen des Tierreichs, Insekten aller Art, Vögel und Fledermäuse. Es hat sich gezeigt, daß der Flug bei allen Gruppen auf denselben Bedingungen beruht, trotz der großen äußerlichen Unterschiede. Aber, obgleich man meinen sollte, daß die Vögel infolge ihrer Größe ein besonders geeignetes Studienmaterial darbieten, haben doch gerade sie den Untersuchungen die größten Schwierigkeiten gemacht, ja es ist überhaupt erst auf dem Umweg Uber die Insekten gelungen, das Geheimnis ihres Flugs zu ergründen. Die dankbarsten Objekte waren ohne Zweifel die Schmetterlinge. An ihnen ist es gelungen, alle Einzelheiten der Flugbewegung festzustellen, und ein nach ihnen gebautes Modell hat auch die ersten Erfolge gebracht. Als eifriger Schmetterlingssammler seit meiner Jugend her waren diese hübschen Tiere überhaupt immer meine besonderen Lieblinge, meine ziemlich umfangreiche Sammlung bot mir ein geeignetes Studienmaterial aus allen Gruppen und ich war zudem gewöhnt, die Tiere lebend in der Freiheit zu beobachten, kannte ihre Lebensgewohnheiten und konnte daher manchen verbindenden Schluß zwischen Flügelbau und Flugvermögen und Art ziehen. Eifrige und gründliche Beobachtungen der lebenden und toten Tiere unter Zu-grundelegen der oben festgestellten Theorie haben schließlich folgendes ergeben : „Jede Flügelseite eines Schmetterlings besteht bekanntlich aus 2 etwa dreieckigen Teilen, Vorder- und Hinterflügel. Die beiden Teile stoßen an einer Seite so zusammen, daß sie zusammen die ebenfalls meist dreieckige ganze Flügelfläche bilden. In der oberen Endlage des Flügelschlags bildet diese ganze Flügelfläche eine Ebene. (Abb. 1) Nun wird die Vorderrippe des Vorderflügels abwärts und zugleich etwas zurückgeschlagen bis zur Mittellage, (diese Vorder-rippe beschreibt also einen Teil einer Kegelfläche, siehe den Schnitt Abb. 4), während gleich eitig der Hinlerflügel noch ein wenig gehoben wird. Die Flügelfläche hat nun eine dachförmige Form (Abb 2) und bildet damit die unten offene Rinne, in der die Luft fast ruht Die Vorderrippe des Vorderfliigels wird weiter abwärts, zugleich auch wieder vorwärts bewegt und der Hinterflügel wird nun ebenfalls abwiins geschlagen, die ganze in der Rinne befindliche Luft wird plötzlich verdrängt. In der unteren Endlage ist die Flügelfläche wieder eine Ebene. (Abb. 3) Der Aufwärtsgang erfolgt mit ganz gestreckter ebener Flügelfläche." Wenn man schräg durch die Flügelfläche einen Schnitt A B legt, so wird die Bewegung deutlich ersichtlich. (Abb. 4) 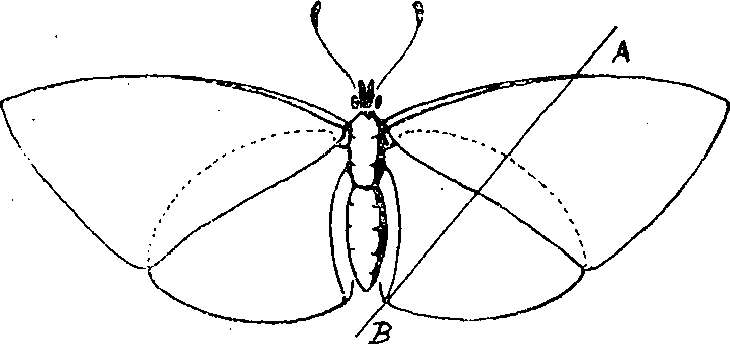 Die Vorderrippe des VorderflUgels beschreibt eine Kegelfläche, deren ab-wärisgehender Teil stark und deren aufwärtsgehender Teil flach gewölbt ist. Der Hinterflügel schwingt einfach auf und ab, beginnt jedoch die Abwärtsschwingung etwas später als die Vorderrippe. Da die Flügel und Rippen elastisch sind, so werden sie sich bei der Bewegung etwas durchbiegen u. andpn Außenrändern stets im Schwingungsstadium gegenüber der Wurzel etwas zurück sein. Die verdrängteLuftwellewird also stets von der Wurzel nach außen abfließen. Durch die Reaktion entsteht dann die Vorwärtsbewegung. Diese Vorwärtsbewegung wird durch die besondere Form der Flügelrippen noch verstärkt. Alle diese Flügel rippen sind nämlich nach rückwärts gekrümmt, so daß die Luft dadurch in hohem Maße nach rückwärts abgeleitet wird. (Abb. 5) Durch die während des Abwärtsgangs erzeugte Vorwärtsbewegung und den dadurch entstehenden Luftdruck von vorn wird die Flügelfläche wieder gehoben, sie wirkt dabei also als Drachenfläche, nur mit dem Unterschied gegen die Drachenflieger, daß sie nicht das Gewicht des Fahrzeugs selbst, sondern nur, ihr eigenes geringes Gewicht heben muß, also sehr wenig Auftriebskraft verbraucht. Nach dieser vorstehend beschriebenen Art der Flügelbewegung der Schmetterlinge erfolgt auch die Fliigelbewegung der übrigen 4 flügeligen Insekten, der Bienen, Hummeln usw. (Abb. 6.) Die beiden Flügel einer Seite bilden während des Abwärtsgangs eine ähnliche dachförmige Rinne wie bei den Schmetterlingen. Bei sehr vielen Insekten, insbesondere denen mit verhält- \ nismäßig kleinen HinterFlügeln und sehr schnellem Flügelschlag, bei denen also die ganze Kraftübertragung in der Hauptsache durch die starken Vorderrippen der Vorderflügel erfolgt, sind Vorder- und Hinterflügel durch eine besondere Vorrichtung, die sogenannte Haftborste, zu einer einzigen Fläche verbunden, um zu verhindern, daß der Luftdruck während des Abwärtsganges die beiden Flügel trennt, da sonst natürlich die beabsichtigte Wir- 3 Ulms niclit eintreten könnte. ,,, , Abb. 4 F.s gibt nun aber eine Gn ppe der Insekten, die sogenannten Zweiflügler, Dipteren, die gar keine .^"VSHinterflügel haben, bei Vdenen also das oben be-\s schriebene Zusammen-* wirken von Vorder- und Hinterf liigel auch nicht stattfinden kann. Wie die Natur bei dieser Gruppe das schwierige At)r)_ 5 Problem gelöst hat, das 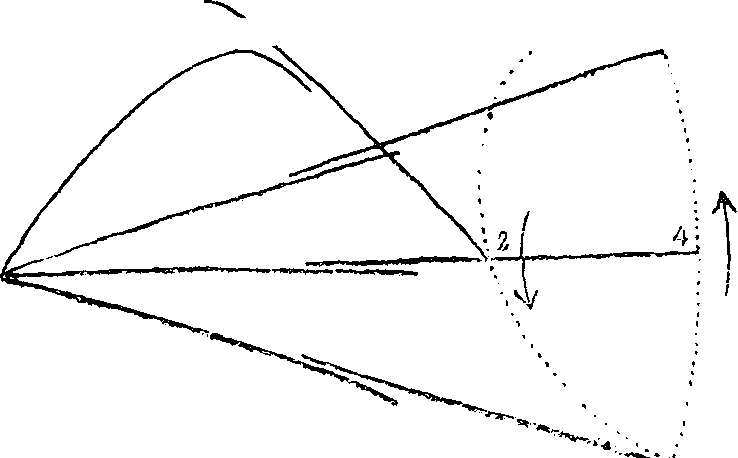 ist geradezu wunderbar und zeigt aufs deutlichste, daß die Natur stets den'besten und vorteilhaftesten Weg findet, und daß es uns niemals gelingen wird, dieselbe auch nur zu erreichen, geschweige zu übertreffen. Wie den Naturforschern längst bekannt ist, besitzen diese Zweiflügler an Stelle der Hinterflügel ein eigentümliches Organ, die sogenannten Schwing- Soviel war bis jetzt nur sicher, daß es auf irgend eine Weise mit dem Flug zusammenhängen müßte, denn wenn man den Tieren die Organe entfernte, so konnten sie nicht mehr fliegen, auch wenn sie die Flügel weiter bewegten, entfernte man nur eins und warf das Tier dann in die Luft, so kam es in Spiralen zur Erde. Man nahm daher an, daß die Organe zur Orientierung dienten und als Sinnesorgane aufzufassen seien. Eine andere Erklärung wollte sie als Mittel zur Gleichgewichtserhaltung angesehen wissen. Sie sollten dazu dienen, das während des Flügelschlags eintretende Verschieben des Schwerpunkts von vorn nach hinten und umgekehrt auszugleichen. Eingehende Studien und Versuche unter Zugrundelegen meiner Theorie haben mich aber zu dem zwingenden Schluß geführt, daß ihre Funktion eine ganz andere ist. „Sie haben nichts anderes als die Aufgabe der Hinterflügel der übrigen Insekten zu erfüllen. Obgleich sie die F I äc h e des Hinterflügels nicht haben, so haben sie doch die Aufgabe, wenigstens die richtige Bewegung des Vorder-flligels zu vermitteln, daß also während des 1. Teils des Abwärtsgangs der Vorderrippe die Flügelfläche oben bleibt und während des 2. Teils des Abwärtsgangs der Vorderrippe die Flügelfläche ebenfalls und zwar noch schneller als die Vorderrippe selbst abwärts geht, so daß die Bedingungen der Theorie erfüllt werden." 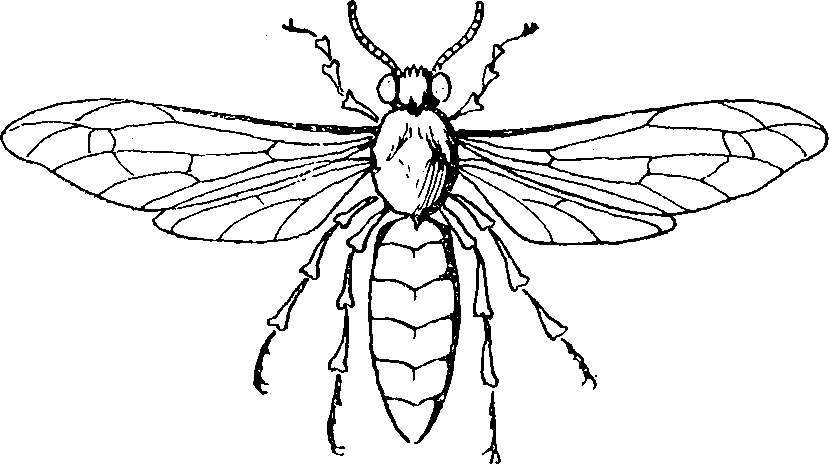 kölbchen oder Halteren, ein am Ende einer Art Borste angebrachtes Kügelchen, das bei den Flügelbewegungen sehr rasch rotiert, ähnlich etwa wie ein Kugelregulator an einer Dampfmaschine. (Abb. 7.) Abb. 6 Ueber den Zweck dieses Organs wurden schon viele Untersuchungen angestellt und Vermutungen ausgesprochen, ohne daß es bis jetzt gelungen wäre, eine annehmbare Erklärung zu finden. 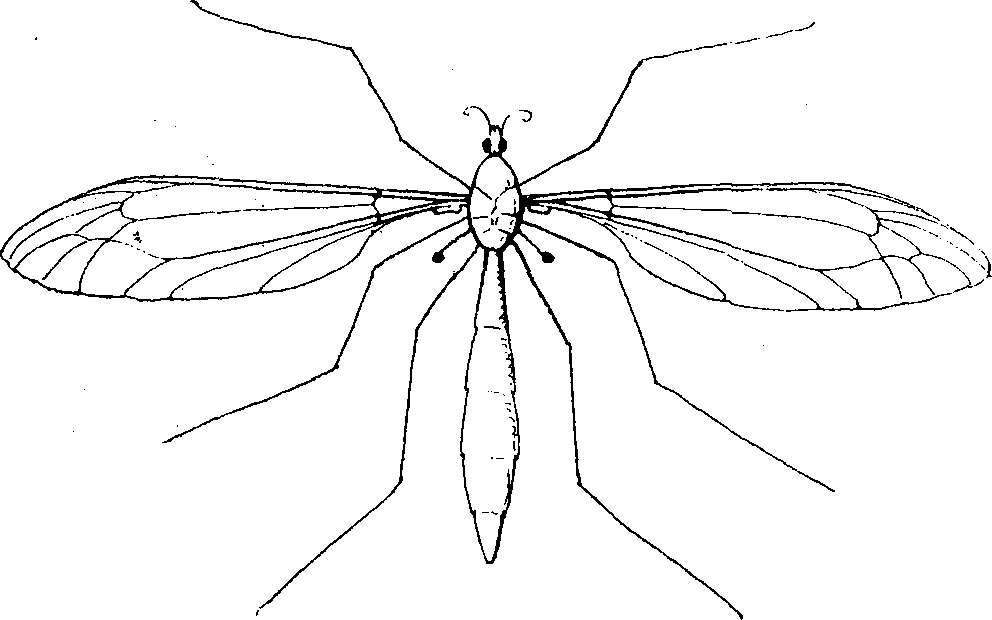 Abb 7 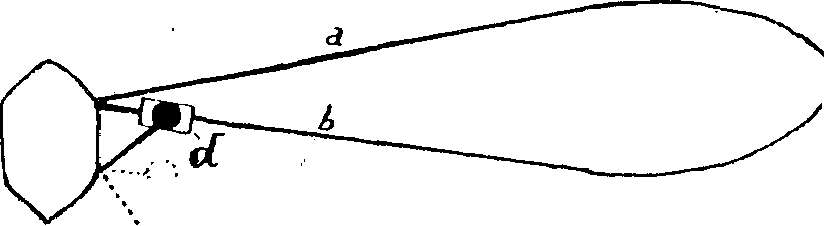 In den folgenden Ausführungen möchte ich nun zeigen, wie diese Bewegungen bei diesen Zweiflüglern im einzelnen erfolgen. Vergl. hierzu Abb. 8 u. 0. Der Flügel wird durch die 2 einen spitzen Winkel mit einander bildenden Rippen a und b begrenzt. Die Vorderrippe a wird ähnlich wie bei den vier-flügeligen Insekten in einer Kegelfläche bewegt (vergl. den Schnitt Abb. 9). Der Schwingkolben c rotiert um seinen Ansatzpunkt und zwar in entgegengesetzter Richtung wie die Rippe a. An der Hinterrippe b ist eine eigentümliche Fangvorrichtung d angebracht. Wenn nun der Flügel die obere Endlage überschritten hat, und bereits im Abwärtsgehen, und ..zwar infolge des Luft-) drucks in schräger Stellungbegriffen ist, so fängt sich der rotierende Schwingkolben in der Fangvorrichtung d der : :C Hinterrippe b. Während des "weiteren Abwärts-Abb. 8 ganges ist also jetzt der Flügel mit dem Schwing-kolben verbunden. Ein Vergleich mit dem Schnitt Abb. 4 zeigt die hierbei entstehende Gleichartigkeit der Bewegung des Flügels mit dem Vorderflügel bei den Vierflüglem. Hat der Flügel die untere Endlage erreicht, so löst sich die Fangvorrichtung aus,! der ISchwingkolben gleitet einfach ab und setzt seinen Weg fort, während der Flügel den Aufwärtsgang auf die ganz gleiche Weise wie bei den Vierflüglem macht. Bis der Flügel die obere Endlage erreicht hat, ist auch der Schwingkolben wieder da ■'" und das Spiel kann von neuem beginnen. Also ein / höchst wunderbarer und raffinierter Mechanismus. Die meisten Zweiflügler, die mit diesem merkwürdigen Flugapparat aus-gerüstet sind, haben die Ge-wohnheit, lange, oft stundenlang, am einem Platz in der \ Luft stehen zu bleiben, „zu schweben" ohne wesentlicke Vorwärtsbewegung. Es scheint also, daß diese Bauart dieser Art des Fliegens besonders günstig ist. Entsprechende Ueberlegungen machen dies auch erklärlich. Da der Flügel mit der den Hinterflügel vertretenden Haltere während des Aufwärtsgangs nicht verbunden ist, so kann der Flügel während des Aufwärtsgangs viel weiter nach vorn schwingen, die Vorderrippe kann einen Kegel von kreisförmigem oder sogar in der Wagrechten langgezogen elliptischen Querschnitt beschreiben. Dadurch ist es möglich, während des FlUgelhubs den während des Abwärtsgangs erzielten Vortrieb aufzuheben, bezw. durch die Drachenwirkung des vorwärts bewegten Flügels in Auftrieb umzuwandeln. Bei den Vierflüglem ist diese schwebende Flugart im allgemeinen nicht möglich, und kommt daher auch nicht vor, mit Ausnahme einer Gruppe mit sehr schmalen Hinterflügeln, z. B. den Bienen, Hummeln, den Schwärmern unter den Schmetterlingen. Bei dieser Gruppe sind die Hinterflügel nicht blos auf und ab, sondern auch etwas nach vorn beweglich, so daß die Vorderflügel ebenfalls weiter nach vorn schwingen können, ohne die Verbindung mit den Hinterflügeln zu verlieren; es entsteht dann ungefähr die gleiche Wirkung wie bei den Zweiflüglern. (Vergl. hierzu auch Abb. 6) Zweifellos ist aber das „Schweben" mit der Bauart der Zweiflügler günstiger zu erzielen, Es stellt sich also dieser Bau als eine spezielle Anpassung an die Flugart des „Schwebens" dar. Die Bienen, Schwärmer usw. führen das 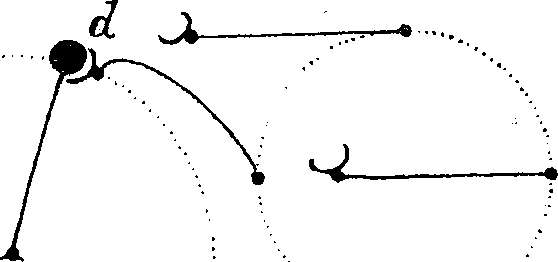 Abb. 9 Seite 1017 „ FLUGS VOR T." No. 26 „Schweben" doch nur gelegentlich aus, in der Hauptsache bewegen sie sich vorwärts. Ihr Flügelbau ist deshalb auch mehr für die Fortbewegung eingerichtet. Die daraus für den Bau menschlicher Flugzeuge zu ziehenden Schlüsse ergeben sich von selbst. Die richtige Anwendung der Theorie auf den Flügelbau und Flug der Vögel und Handflügler wollte lange nicht gelingen. Aus der unmittelbaren Betrachtung der Flügel und dem Studium ihres Baus waren ebenso wenig Aufschlüsse zu bekommen, wie aus der fortgesetzten Beobachtung des Flugs. 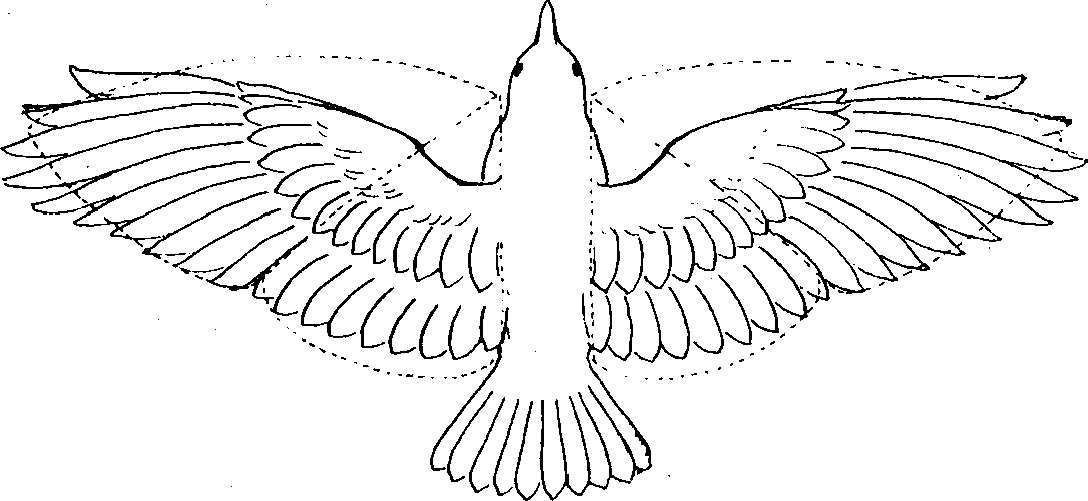 Abb. 10 Es ließen sich einfach keine Bewegungen erkennen, die mit der Theorie in Einklang zu bringen waren. Vergleiche mit den Insekten waren zunächst auch nicht erfolgreich, denn die Vögel haben ja nur zwei Flügel, und der Flügel wird nur durch einen einzigen Arm bewegt, ein Organ, das die Funktion des Hinterflügels der Insekten übernehmen könnte, ist nicht vorhanden. 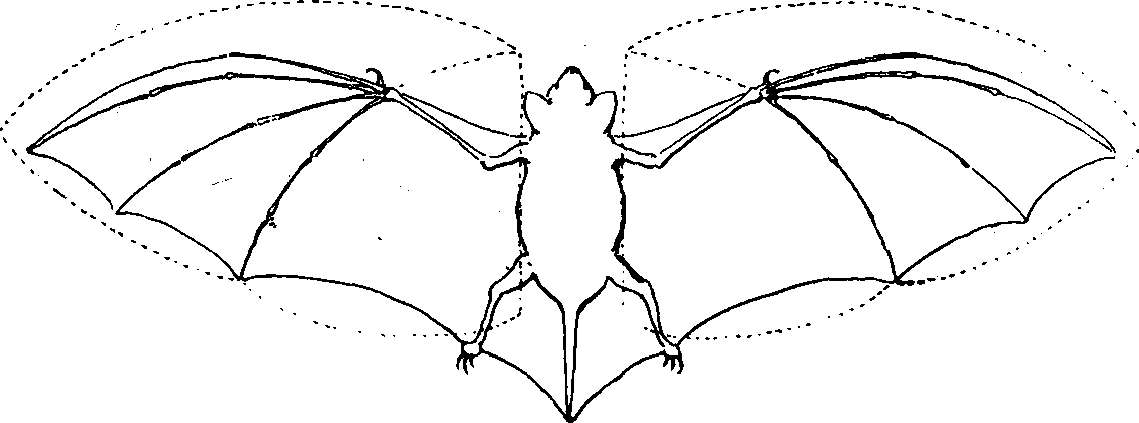 Abb. 11 Aber ich sagte mir, es muß gelingen, die Theorie muß richtig sein, und auch der Vögelflug muß sich damit erklären lassen, nur nicht nachgeben I Und es gelang endlich doch. Ich sagte mir schließlich, es ist ja garnicht nötig, daß die Organe, die bei den Insekten die Bewegung leiten, in ähnlicher Form tatsächlich vorhanden sind, es genügt, v enn der Flügel eine Bewegung macht, als ob diese Organe vorhanden wären; Wenn also diese Bewegung innerlich durch Sehnen u. dergl. so geleitet wird, als ob die betreffenden Leitrippen wie bei den Insekten vorhanden wären. Nun war die Frage gelöst. Ich zeichnete mir in ein Schmetterlingsflügelpaar einen Vogelflügel ein und das Ergebnis war ganz überraschend. Die beiden Flügeüormen deckten sich sowohl in der Form als auch in der Bewegung fast genau. (Abb. 10) Der Vogelflügel entsprach, soweit der Ober-und Unterarm reichte, genau dem Hinterflügel des Schmetterlings, die Hand m;t den Handschwingen dagegen entsprach genau dem Vorderflügel. Der Aim wird genau dem Hinterflügel des Schmetterlings gleich auf und ab geschwungen, die Hand wird durch Sehnen derart bewegt, daß die Vorderkante eine ähnliche Kegelfläche beschreibt, wie die Vi rderrippe des Schmetterlingsflügels. Gegenüber dem Schmetterlingsfliigel fehlt also der Fläche des Vogelflfigels nur ein geringer Teil an der Wurzel, der für die Wirkung wohl nicht sehr in Betracht kommen dürfte. Bei den Handf lüglern entspricht natürlich der Flug durchaus dem der Vögel, da ja der Flügel ganz ähnlich gebaut ist. (Abb II.) Je nach dem gewollten Zweck, der verschiedenen Flugarten, ist der Bau der Flügel sowohl bei den Vögeln als auch den Insekleii von einer unendlichen Mannigfaltigkeit im einzelnen, und es gibt da noch ungeheuer viel zu studieren und zu versuchen, aber die Grundlagen und die allgemeinen Richtlinien sind doch bei allen dieselben. Mit diesen Grundlagen muß es durch unausgesetzte und zielbewußte Arbeit auch möglich sein, in absehbarer Zeit brauchbare menschliche Flugzeuge zu bauen, und ich fordere alle ernsthaften Flugtechniker, denen es wirklich um den Fortschritt des Flugwesens zu tun ist, auf, dieser wichtigen Sache ihre Aufmerksamkeit zu schenken und durch Bau von Modellen und Anstellung von weiteren Versuchen an der Klarstellung dieses Problems zu arbeiten. Nur durch eifrige auf e i n Ziel gerichtete Arbeit vieler Köpfe wird es möglich sein, bald alle die vielen noch festzustellenden Einzelheiten so aufzuklären, daß etwas damit angefangen werden kann. Der Erfolg wird sicher nicht ausbleiben, und das Ziel ist der Anstrengung wohl wert, denn wohl alle ernsten Flugtechniker denen nicht nur an einem Augenblickserfolg gelegen ist, werden mit mir darin einig sein, daß erst der Schwingenflug die Eroberung der Luft bringen wird. Um einen Anhaltspunkt zu geben, wie diese Studien erfolgreich betrieben werden können, will ich in einem weiteren Artikel, besonders auch den jüngeren angehenden Flugtechnikern die Beschreibung eines nach dem Vorbild der Schmetterlinge gebauten Modells geben, mit dem ich meine ersten Erfolge erzielt habe. Daran zu verbessern, bis zur höchst erreichbaren Vollkommenheit, sollten sie sich zur Aufgabe machen. Es wird viel Mühe kosten und viel schwieriger sein, als z. B. der Bau eines Drachenfliegers, aber wenn es gelingt, wird es auch viel Freude und ernste Befriedigung gewähren.  Flugtechnische ZJP^ Rundschau. Inland. Mug/ührer-Zeiignisse Jtabeii. erhalten : Nr. 598 lsobe, Onokichi, Marineingenieur, geb. am 14. August 1877 zu Tokio; für Eindecker (Rutnpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 21. Nov. 191.5. Nr. 599. Gliier, Friedrich, Wilhelm, Osnabrück, geb. am 27 Juni 1882 zu Sagan i. Schles.; für Zweidecker (LVG.1 Flugplatz Johannisthal, am 21. Nov. 1913. Nr. 600. Manger, Kuno, Wilmersdorf, geb. am 29. Septemb. 1879 zu Grabow b. Brandenburg; für Zweidecker (LVG , System Schneider) Flugplatz Johannisthal am 21. Nov. 1913. Nr 601. Michailoff, Wilhelm, Ingenieur, Riasan (Rußland), geb. am 1. Januar 1886 zu Riasan; für Zweidecker (LVG.), Flugplatz Johannisthal, am 24 November 1913. Nr. 6J2. Reuber, Ernst, Merseburg, geb. am 14. Nov. 1894 zu Merseburg; für Eindecker (Grade), Flugfeld Bork, am 24. Nov 1913. Nr. 603. Puschmann, Albert, Mechaniker, Johannisthal, geb. am 2 April 1888 zu Neustädtel (Erzgeb.); für Zweidecker (Ago), Flugplatz Johannisthal, am 25. November 1913. Nr. 604. Weiß, Josef, Edling b. Wasserburg a. Inn, geb. am 5. Juli 1891 zu Hohenzell; für Eind (Schulze), Flugfeld Madel b. Burg, am 26. Nov. 1913. Nr. 605. Schweizer, Franz, Mechaniker, Johannisthal geb. am 14 Dezemb. 1890 zu München; für Zweideck. (Ago) Flugplatz Johannisthal, am 26. Nov. 1913. Nr. 606. Schröder, Willy, Dipl.-Ing., Königsberg i. Pr, geb. am 16. April 1882 zu Berlin; für Zweidecker (Wright), Flugplatz Johannisthal, am 27. Nov. 1913. Nr. 607. Reinert, Kurt, Ltn. z. S., Berlin, geb. am 29. März 1889 zu Posen ; für Zweidecker, (LVG.-Farman), Flugplatz Johannisthal, am 27. Nov. 1913. Nr. 608 v. Prodzynski, Stephan, Ltn. z. S., Johannisthal, geb. am 28. März 1889 zu Straßburg i. Eis.; für Eindecker (Albatros), Flugplatz Johannisthal, am 27. Nov. 1913. Nr. 609. Rosenfeld, Franz, Berlin W., geb. am 20. Sept. 1888 zu Berlin; für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 1. Dez. 1913. Nr. 610. Lange, August, Marineingenieur, Putzig, geb, am 13 März 1879 zu Hameln a. W.; für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 1. Dezember 1913. Nr. 611. Zentzytzki, Stanislaus, stud. mach., Charlottenburg, geb. am 9. August 1887 zu Münster i. W ; für Eindecker (Rumpier), Flugplatz Johannisthal, am 1. Dezember 1913. Nr. 612. Hinsen, Hans, stud. ing. Adlershof, geb. am 23. Dezember 1891 zu Linnich; für Zweidecker, (Wright), Flugplatz Johannisthal, am 2. Dez. 1913. Nr. 613. Heyer, Ewald, Ingenieur, Cöln, geb. am 28. Dezember 1886 zu Herten; für Eindecker, (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 3. Dez. 1913. Nr. 614. Garber, Hugo, Hamburg 39, geb. am 8. Nov. 1893 zu Hamburg ; für Eindecker (Gotha-Taube), Flugplatz der Gothaer Waggonfabrik, am 3. L'ez. 1913. Nr. 615. Huth, Fritz, Dr., Oberlehrer, Ingenieur, Tempelhof, geb. am 23. Februar 1872 zu Schöneberg; für Eindecker (Rumpler-Taube), Flugplatz Johannisthal, am 3. Dezember 1913. Nr. 616. Schuster, Hermann, Reinickendorf, geb. am 25. März 1879 zu Friedeburga. Saale;"für Zweidecker (LVG.), Flugplatz Johannisthal am 3. Dez. 1913 No. 617. Steyer, Herrn , Schöneberg, geb. am 5. April 1893 zu Berlin; für Zweidecker (LVG), Flugplatz Johannisthal am 3. Dezember 1913. Nr. 618. Wieland, Lothar, Charlottenburg, geb am 3. Februar 1888 zu Berlin; für Eindecker fAlbatros), Flugplatz Johannisthal, am 4. Dezember 1913. Von den Plugplätzen. Vom, Flugplatz Leipzig-Mockau. Seit der Eröffnung starteten im ganzen HOFlugzeuge, es ist hierbei jedoch zu berücksichtigen, daß die Flugzeughallen erst seit kurzer Zeit ihrer Bestimmung übergeben worden sind. Von auswärts kommende Flugzeuge landeten 21 mal, hierin sind 11 Heeres-flugzeuge inbegriffen, für die auch die Schuppen in Anspruch genommen wurden. Die Heeresflugzeuge kamen von Döberitz, Berlin, Johannisthal, Gotha, Weimar, Posen und Wien und setzten nach kurzem Aufenthalt ihre Reise fort. Als besondere Leistung ist zu erwähnen ein Dreistundenflug um die National-Flugspende, außer diesen hat eine Flugfiihrerpriifung auf dem Platz stattgefunden. Ililye um die JS atimmt,-21,»iy.spende. 7 Stunden flog Krumsieck am 15. Dezember auf einer Gotha-Hansa-Taube. Krumsieck startete 9 Uhr morgensauf dem Fuhlsbüttler Flugplatz bei sehr starkem Wind und landete gegen 4 Uhr bei Oldesloe. Während der Flugzeit herrschte fortgesetzt ein undurchdringlicher Nebel, der die Orientierung fast unmöglich machte. 5 Stunden um die National-FIugspende flog am 8. Dezember Willi Eckard t mit Ltn. Riedel als Beobachter auf einer Gotha-Taube. Der Flug führte von Gotha über Eisenach nach Meiningen und zurück dann von Gotha über Erfurt nach Meiningen und zurück, von Gotha nach Mülhausen i. Th. und zurück. 3 Stunden um die National-FIugspende flog am 8. Dezember Hugo Garber gleichfalls auf einer Gotha-Taube. Der Flieger Schüler hat in letzter Zeit mehrfach durch seine Leistungen überrascht. Am 12. Dezember führte Schüler auf eirem Ago-Doppeldecker einen beachtenswerten Flug von Johannisthal nach Döberitz aus. Die hierbei  Ing. Max Schüler stellte mit Fluggast K.ptlt.~" Liebmann au/ Ago Höhen-Rpkord 3400 m auf nach der Landung. An der Seite des Rumpfes sieht man den Sauerstoffapparat. gemessenen Windgeschwindigkeiten betrugen 18 bis 21 m. Infolge des starken Windes benötigte er für die Strecke Johannisthal -Döberitz 25 Minuten. Für den Rückflug nur 107» Minuten, entsprechend einer Stundengeschwindigkeit von ca. 230 km. Seile 1021 „FL JG SPORT." No. 26 Ausland. Ein Riesenflugzeug: wird zurzeit in der Russiscli-Ballischeu Waggonfabrik in Riga von Sikorsky gebaut. Dieses Ungetüm ist ein Doppeldecker der bei 30 m Spannweite, I50 qm Tragfläche besitzt. Zum Betriebe dienen 6 Motore von je 100 PS Der Doppeldecker wiegt mit Betriebsstoff 4500 kg und ist zum Transport von 15 Fluggästen bestimmt Ein Riesen-Wasserflugzeug wird zurzeit in Amerika von Hauptmann Batson zu Dutsch-Jslnnd bei Savannah gebaut. Das Wasserflugzeug besitzt (i Tragdecken von 10—12 m Spannweite. Der seetüchtige Bootskörper mißt 24 m Länge. Zum Betriebe dienen 3 Motoren, welche 2 Schrauben eine vor und eine hinter den Tragdecken in Bewegung setzen. Das Gesamtgewicht mit 3000 kg Nutzlast soll 5000 kg betragen. Als Besatzung sind incl. dem Führer 6 Mann vorgesehen. Der Konstrukteur beabsichtigt mit dieser Maschine den Ozean zu überfliegen. Wettbewerbe. Der II. Süddeutsche Rundflug wird vorraussichtlich vom 10.—15. Oktober 1914 stattfinden. Veranstalter ist die neugegründete Bayerische Luftfahrtzentrale, der folgende Städte angehören: Nürnberg, München, Augsburg. Würzburg, Regensburg, Ulm Die Flugstrecke ist vorläufig wie folgt festgelegt: Nürnberg—Regensburg—München-Stuttgart Gotha-Koburg—Bamberg—Nürnberg. Ein Scheide—Rhein Maass Wasserflugzeug-Wettbewerb. Vor einigen Tagen fanden in Paris zwischen dem belgischen Aero-Club und dem D.L.V. Besprechungen über den deutsch-belgischen Wasserflug-Wettbewerb statt. Als Strecke ist in Aussicht genommen: Brüssel-Düsseldorf— Lütt ch—Rotterdam-Brüssel. Als Zeitpunkt ist der Monat Juni 1914 festgelegt. Ferner soll auf der Strecke Brüssel—Düsseldorf—Frankfurt a. M. ein Wettbewerb für Gleitboote mit Luftschraubenantrieb stattfinden. Der König der Belgier hat für Belgien das Protektorat übernommen. Verschiedenes. Beleuchtung des Geländes durch Feuerwerkskörper. Auf die Bedeutung und Möglichkeit dieser Sache haben wir bereits mehrfach hingewiesen. Neuerdings sind Tn Oesterreich in Fischamend Versuche mit solchen Beleuchtungseinrichtungen gemaefit worden. Die Vorrichtung ist eine Erfindung, von Ingenieur Ludwig Klinkosch und Pyrotechniker E. Hyra. Im Beisein des Kommandanten der Versuchsabteilung für Luftschiffahrt Hauptmann Ey b und zahlreicher Fliegeroffiziere, stieg bei Einbruch der Finsternis Feldpilot Oberleutnant Flatz auf einem Lohner-Doppeldecker mit einigen Leachtminen und einem Beobachter auf. Nachdem der Flieger sich in eine Höhe von etwa 500 Meter emporge-schraubt hatte, sah man plötzlich vom Flugapparat sich eine helleuchtende Feuerkugel loslösen, die anfangs in der Luft stillzustehen schien, dann langsam zur Erde niederschwebte. Es war ein herrlicher Anblick, wie das Terrain wie von einem weißen Lichtschimmer Übergossen dalag, der in einem Umkreise von zwei Kilometer alle Gegenstände erkennen ließ wie bei Tageslicht. Der grandiuse Beleuchtungseffekt währte 3'/a bis 4 Minuten, während welcher Zeit die Leuchtkugel sich langsam der Erde näherte, um schließlich in einer Höhe von zirka 100 Meter zu erlöschen. Der Flugapparat selbst war während dieser Zeit unsichtbar für das Auge geblieben, was in militärischer Hinsicht von großer Bedeutung ist und nur aus dem hörbaren Kr.attern des Motors konnte man den Standort des Doppeldeckers annähernd beurteilen. Der Flieger und sein Beobachter erklärten nach der Landung, daß das Terrain so grell beleuchtet unter ihnen lag, daß ihnen jede Einze'heit erkennbar war und daher die Rekognoszierung e schöpfend durchgeführt werden konnte. Es folgte nun ein zweiter Versuch, der den Zweck hatte, die Leuchtmine als Hifsmittel bei der Landung zu erproben. Wieder wurde die Vorrichtung in zirka 500 Meter Höhe lanziert, und wahrend sie ihren Lichtschimmer über das Feld ergoß, vollzog der Flieger eine glatte Landung Feldpilot Oberleutnant F 1 a t z berichtete, daß das Licht der Leuchtmine ihm das Terrain nicht hur so klar wie bei Tageslicht vorgezeichnet habe, sondern daß noch die Unebenheiten des Bodens durch tiefe Schatten besonders markiert hervortraten. An der Luftfahrschule Berlin-Adlershof wird von Januar bis März der erste 3-Monatskurs für Fliegerund Flugschüler abgehalten Es handelt sich um den Kurs, den die National-Flugspende zunächst obligatorisch für die National-Flugschüler vorgesehen hatte. Wenn auch der Besuch für die Nationalflugschüler nicht mehr obligatorisch ist, so wünscht doch die National-Flugspende und wirkt darauf hin, daß diese Kurse freiwillig besucht werden. Der Lehrplan umfaßt: Motorenbau und -betrieb, Flugzeuglehre. Fluglehre, Montage- und Herstellungsarbeiten an Flugzeugen, Wetterkunde, Kartenlcsen, Kompaßlehre u. astronomische Hilfsmittel zu Orientierung, Instrumentenkunde, Aerztliche Unterweisung, Gesetz-und Polizeivorschriften. Als Lehrer sind sehr gute Kräfte gewonnen. Das Unterrichtshonorar beträgt 150 Mark. Anmeldungen sind zu richten an die Direktion Adlershof bei Berlin, Radickestraße 10. 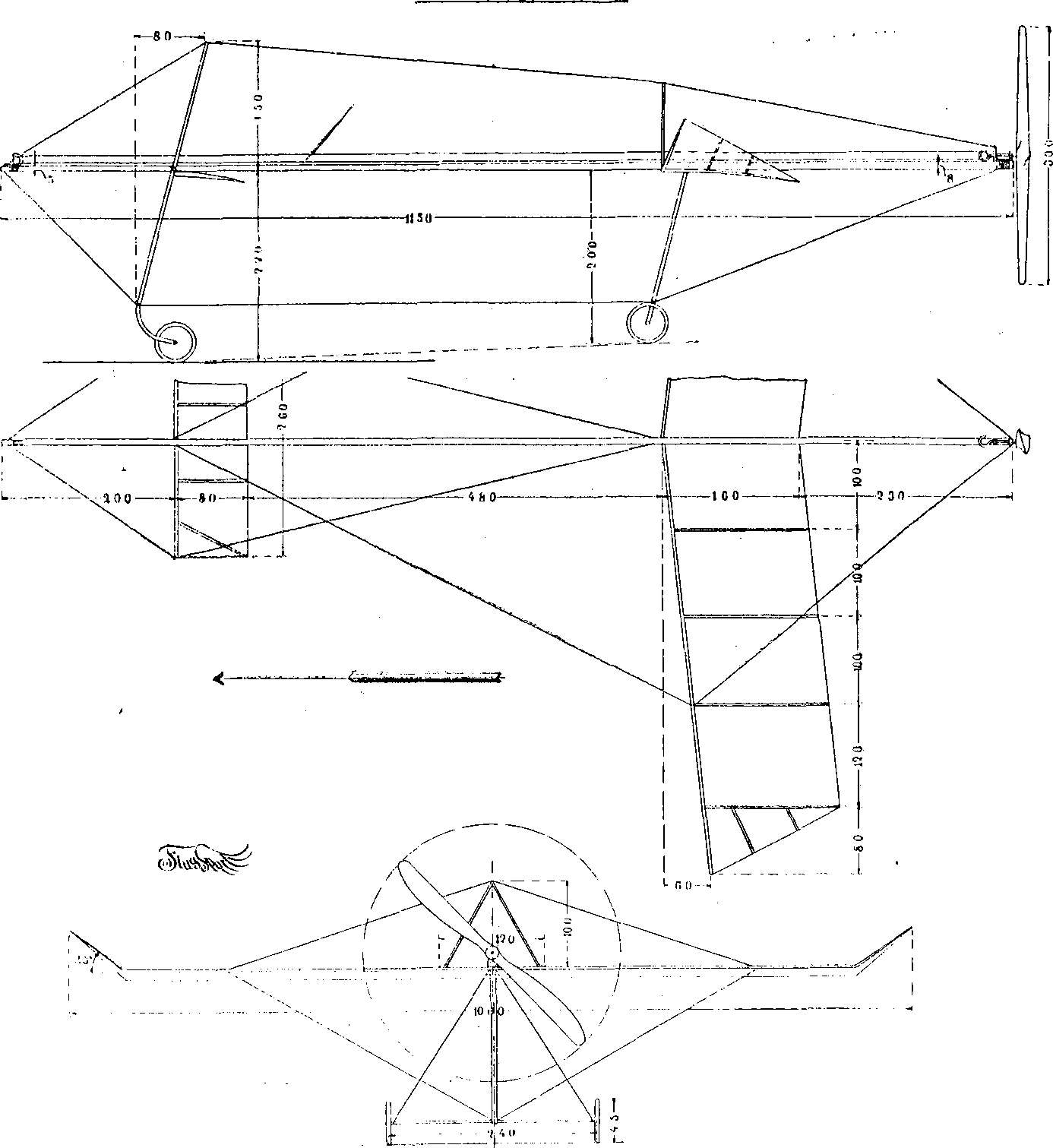 Das Eindecker Entenmodell Reimer. Modelle. Ein Benzin - Motor für Modelle hat W. J. Zenker, Dresden, Wintergartenstr. 78 gebaut. Der Motor leistet bei 1600 bis 1900 Touren mit einer Schraube von 50 cm Durchmesser ca. '/s PS und wiegt 800 g. Der dem Motor beigegebene Benzinbehälter reicht für 15 Minuten Betriebsdauer. DerPreis des kompletten Motors (also mit Vergaser, Zündung. Benzinbehälter, Propeller etc.) beträgt Mk. 150. (Siehe nebenstehende Abbildung) Das Eindecker Entenmodell Reimer besitzt einen Motorstab aus Bambus von 1,15 m Länge, auf welchem die Schraubenlagerung und der Gegenhaken für die Gummischnurbefestigung angebracht ist. Die Verspannung des Modells verleiht sowohl den Tragflächen, als auch dem Fahrgestell die erforderliche Festigkeit. Unter der 26 cm großen Kopffläche befindet sich ein Stoßrad von 45 mm Durchmesser, während unter den Haupttragflächen das eigentliche Fahrgestell angeordnet ist. Die Haupttragfläche besitzt eine Spannweite von 1 m und eine Flächenriefe von 16 cm. Dieselbe ist etwas V-förmig nach hinten gerichtet und wird durch 2 dreieckige Dämpfungsflächen an den Flügelenden stabilisiert. Der Antrieb erfolgt durch eine Luftschraube von 30 cm Durchmesser und 35 cm Steigung. Der Gummimotor besteht aus 12 Gummisträngen von 1,5 mm Stärke; nach 550 Umdrehungen wird eine Lanfdauer von 20 bis 25 Sekunden erreicht. Das Modell wiegt nur 100 g, die größte Fluglänge beträgt bei Handstart 235 m, bei Bodenstart 158 m, wobei eine Flughöhe von 40 m erreicht wird. Das Reimermodell gewann 2mal, für obige Höchstleistungen, beim Johannisthaler Modellwettfliegen den 1. Preis. 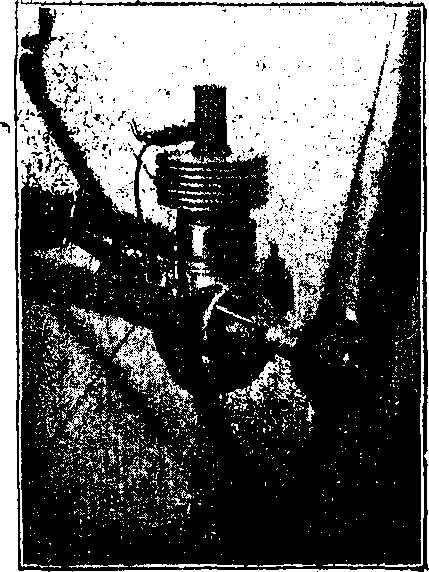 Men unferen ße/em und Sönnern wünftyen wir ein frohes und erfolgreiches fleueö f&ahrf (Redaktion und Verlag „Wugfport"
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Markus Lenz - Frankfurt am Main | www.Pennula.de | Zuletzt aktualisiert am 9. Dezember 2020 | E-Mail | Impressum |