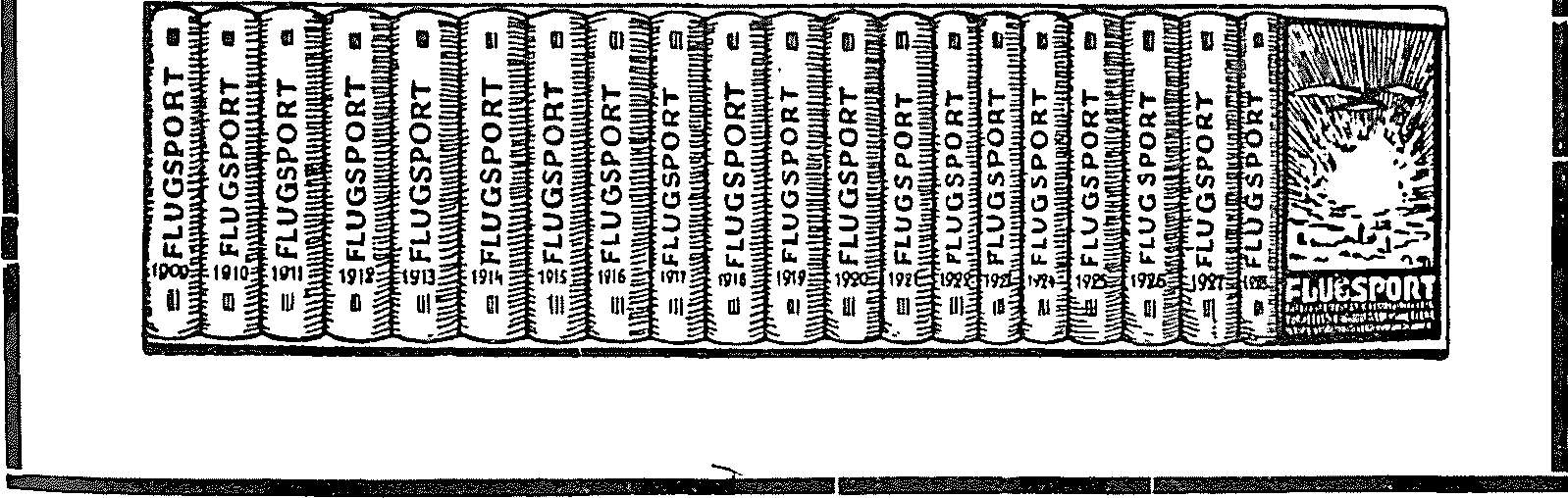Jahresausgabe 1939
Zeitschrift Flugsport: Jahrgang 1939 als digitaler Volltext
Luftfahrt und Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg 1939
Auf dieser Seite werden alle Hefte aus dem Jahrgang 1939 der Zeitschrift Flugsport in Textform mit Tabellen, Abbildungen und Graphiken dargestellt. Die Heftinhalte wurden neu retrodigitalisiert und gewährleisten einen kostenlosen und barrierefreien Zugang zur Geschichte der Luftfahrt für das Jahr 1939.
Heft 1/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburg-Platz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro H Jahr bei Htäglichem Erscheinen RM 4.50
Tele!.: 34384 — Teleer.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalten und Verlan Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet.
Nr. 1 4. Januar 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 18. Januar 1939
Anfang 1939.
Die Vorbedingungen für Weiterentwicklung sind im vergangenen Jahre 1938 geschaffen worden. Die vollbrachten Leistungen scheinen, wenn man den Maßstab von vor 6 Jahren anlegt, phantastisch. Und doch wird jeder zugeben, daß die Leistungen noch bedeutend gesteigert werden müssen. Man hat hierbei auch gelernt, wie man mit günstigstem Ansatz von Kräften Arbeitskräfte einsparen und unnütze Arbeit vermeiden kann.
Hand in Hand mit der größeren Erzeugungsfähigkeit geht die Verbilligung. Man braucht nur einen Seitenblick zu machen auf die Preise der Kraftwagen. Hier war natürlich Vorbedingung: Erweiterung des Absatzgebietes, welcher für das Flugzeug, abgesehen von Militärlieferung, noch geschaffen werden muß. Im Verkehrsflugzeugabsatz nach dem Ausland sind beachtenswerte Ansätze vorhanden. Die deutsche Werkarbeit genießt im Ausland großes Ansehen. Man kauft die Flugzeuge nicht wegen unserer schönen Augen, sondern wegen der Güte der Arbeit. Und so muß es auch mit den anderen Flugzeugarten werden, bis zu dem kleinsten Sportflugzeug. Motoren, die RM 1000.— kosten, sind auf dem Markt. Was dann ein Kleinflugzeug kosten darf, kann sich jeder selbst ausrechnen.
Vielleicht bringt uns das Jahr 1939 in dieser Hinsicht einen neuen Fortschritt.
Heizluftstrahltriebwerke.
Jeder in Luft oder Wasser mit eigener Kraft sich fortbewegende Körper bedient sich des Reaktions- oder Rückstoßprinzips, d. h. er entnimmt entweder Teile in sich aufgespeicherter Massen oder er erfaßt mit geeigneten Organen Teile des ihn umgebenden Strömmittels und beschleunigt diese Massen mit einer Geschwindigkeit, die größer ist als seine eigene Bewegungsgeschwindigkeit, und zwar im allgemeinen entgegengesetzt der Richtung, in der er sich fortbewegen will, wobei in gewissen Fällen zu der durch den Rückstoß erzeugten Kraft eine durch das vordere Ansaugen des Strömmittels auftretende Kraft hinzukommt. Einrichtungen, die nur den durch Ansaugen entstehenden
Diese Nummer enthält Patent-Sammlung Nr. 32 und DIN-Sammlung Nr. 3.
Unterdruck zum „Hineinsaugen" benutzen wollen, etwa durch seitliches Abschleudern mittels radialer Flächenstücke bei sehr hohen (fünfstelligen) minutlichen Drehzahlen, haben sich trotz wiederholter Versuche nicht bewährt.
Das Kennzeichen jedes sich des Rückstoßes bedienenden Triebwerks ist der Strahl. Man spricht daher auch bei der Luft- oder Wasserschraube wie bei anderen, Strömungskräfte erzeugenden Einrichtungen, von einem Strahlantrieb ; der gegenwärtige Sprachgebrauch behält sich im allgemeinen jedoch diesen Ausdruck für eine bestimmte Gattung vor, nämlich für diejenigen Rückstoßer, die zur Erzeugung des Strahles der Wärmeentwicklung oder -Zuführung (Heizung) bedürfen. Man hat also, korrekt ausgedrückt, neben den „Kaltstrahl-antrieben"*) die „Heizstrahlantriebe"; diese umfassen wieder zwei Hauptgruppen, nämlich die z. Zt. noch als „Raketenantriebe" — besser vielleicht als „A bb r an dant r i e b e" — bezeichneten Rückstoßer, die sämtliche zur Strahlerzeugung notwendigen Massen (z. B. Explosivstoffe oder Brennstoff + Sauerstoff in flüssiger oder Gasform) gespeichert haben, und die als „Heizluft-Strahlantriebe" zu bezeichnenden Rückstoßer, die den Sauerstoff der umgebenden Luft entnehmen, also nur den Brennstoff speichern.
Während die Abbrandtriebwerke ihrer UnWirtschaftlichkeit und sehr eingeschränkten Brenndauer wegen nur für den Film („Raumschiffe") und den Krieg (Geschoßraketen) — in welchen beiden Fällen Geld bekanntlich keine Rolle spielt —, allenfalls auch als Leucht- und Rettungsraketen eine gewisse praktische Bedeutung erlangten, sind die Heizluftstrahltriebwerke, an denen seit Jahren gearbeitet wird, noch im keimhaften Zustande, nähern sich aber bereits klar erkennbar der Wirtschaftlichkeitsschwelle und erscheinen als Mittel geeignet, die Aufgabe der Flugzeug-Geschwindigkeitssteigerung über 700 km hinaus zu lösen.
Ueber sie sei an Hand des vorhandenen, bisher u. W. noch nicht zusammengefaßten Patentschriftenmaterials berichtet.
Allen Heizluftstrahltriebwerken ist der Aufbau aus drei Elementen gemeinsam: dem Luftverdichter, der Brennkammer und dem Entspannungstrichter (Diffusor). Unterscheidbar sind sie im wesentlichen durch die Art der Verdichtung.
*) Zu diesen gehören — auf die Luftfahrttechnik beschränkt — außer den Luftschrauben (auch solche, deren Strahl in einem Rohr geführt wird) weiterhin
die bisher noch nicht zur Flugfähigkeit gelangten, mehr oder weniger sinnvoll erdachten .Schwingen (z. B. mit gesteuerter Einstellungsänderung), Schlagflügel (z. B. mit Klappen) und Walzflügel (z. B. Rohrbach, Strandgren).
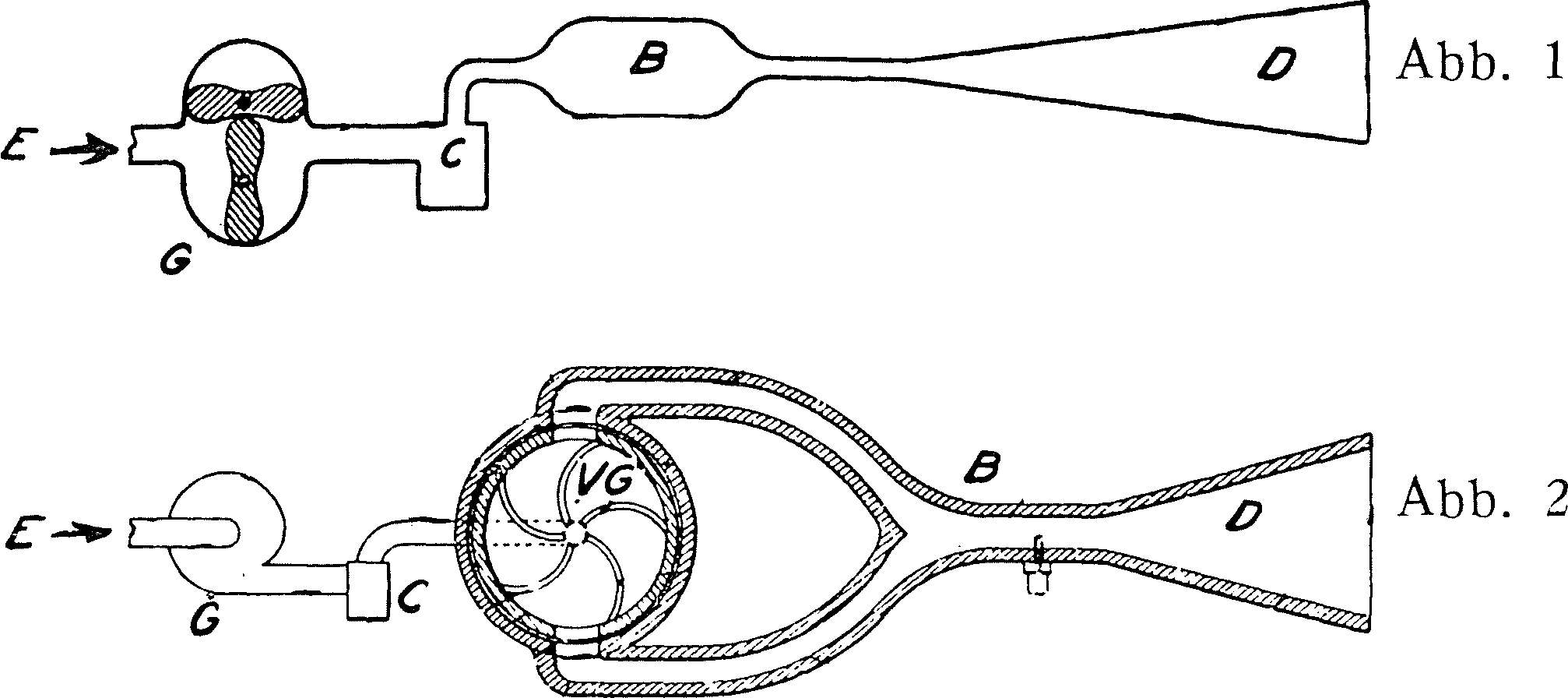
Abb. 3
Abb. 4
Abb: 1—4: Heizluftstrahltriebwerke Marconnet (1909). B Brennkammer, C Vergaser, D Diffusor, E Lufteintritt, G Gebläse, K Brennstoffbehälter, VG Verteiler, zugleich Gebläse, V Klappenventil, Z Zündvorrichtung.
1909 hat M a r c o n n e t in der französischen Patentschrift 412 478 Beispiele derjenigen Art angegeben, bei der die Verdichtung durch Kompressoren oder Gebläse erfolgt; er unterscheidet bereits Triebwerke mit konstantem Druck (Abb. 1. u. 4) und solche mit konstantem Volumen (Abb. 2 u. 3). Bei den ersteren wird ein ununterbrochener Strahl vom (Kapsel-) Gebläse (Abb. 1) erzeugt und über den Vergaser durch die Brennkammer in den Diffusor geleitet, der, um Schubkraft und Strahlgeschwindigkeit gemäß den beim Start und im Fluge unterschiedlichen Verhältnissen regeln zu können, längenänderbar (bei gleichem Kegelwinkel) sein soll. Nach Abb. 4 wird die ebenfalls von einem Gebläse (nicht gezeichnet) gelieferte Druckluft mit Brennstoff versorgt und gelangt mit hoher Geschwindigkeit in eine sich hohlkegelförmig erweiternde Brennkammer, in deren Verlauf sie sich entspannt, um am Ende gezündet werden zu können. Da eine Flamme sich nur ausbreiten kann, wenn ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit größer als die Abzugsgeschwindigkeit der brennbaren Umgebung ist, hört die Verbrennung des Gemischs in dem spitzeren Teile der Kegelkammer dort auf, wo die Geschwindigkeit des Durchtritts größer als die der entgegenlaufenden Flamme ist.
Bei dem diskontinuierlichen Betriebe nach Abb. 2 liefert ein Gebläse über den Vergaser Gemisch in ein zugleich als Verteiler ausgebildetes zweites ebenfalls angetriebenes Gebläse, das als ein mit Durchtrittsöffnungen versehener Schaufelzylinder von einem ebenso mit Oeffnungen versehenen Gehäuse umgeben ist. Von jeder Oeffnung führt ein Kanal zur Brennkammer mit Kerze. Jedesmal beim Gegenübertreten der Oeffnungen entweicht eine Gemischmenge, die sofort die Brennkammer füllt, bei inzwischen gesperrten Oeffnungen gezündet wird und sich im Diffusor entspannt. Macht der Verteiler beispielsweise 1200 Umdr./min, so bewirkt er bei zwei Durchtritten 20 Doppelzündungen in der Sekunde und 40, wenn statt zweier Oeffnungen vier vorhanden sind.
Bei dem ebenfalls diskontinuierlichen Triebwerk nach Abb. 3 ist an Stelle des Verteiler-Gebläses ein Klappenventil eingebaut. Nach Brennstoffanreicherung im Vergaser tritt das Gemisch durch das Ventil hindurch in die Brennkammer. Hier wird es gezündet, wobei es die Klappe schließt; die Gase treten mit großer Geschwindigkeit durch ein langes Rohr in den Entspannungstrichter. Infolge der Bewegungsgröße der auspuffenden Gassäule und ihrer Trägheit bildet sich in der Kammer ein Unterdruck; dieser genügt, um eine neue Gemischladung durch das Klappenventil und den Vergaser hindurch anzusaugen und in die Kammer zu holen. Auch auf diese Weise erhält man motorische Impulse in schneller Aufeinanderfolge; auch hier läßt sich wieder durch Längenänderung des Diffusors Schub- und Strahlgeschwindigkeit regeln. Weitere Vorschläge Marconnets über die Ausbildung derartiger Geräte als Gas- oder Luftkompressoren für beliebige Zwecke übergehen wir.
Marconnet hat somit 1909 das Wesentliche der Heizluftstrahltrieb-< werke offenbart, übrigens zu einer Zeit, als eine Stundengeschwindigkeit
Abb. 5 u. 6. Heizluftstrahltriebwerk Lorin (1908). Ansaugen, Verdichten und Zünden findet in einem motorähnlichen Kurbel-Zylinder-System statt.
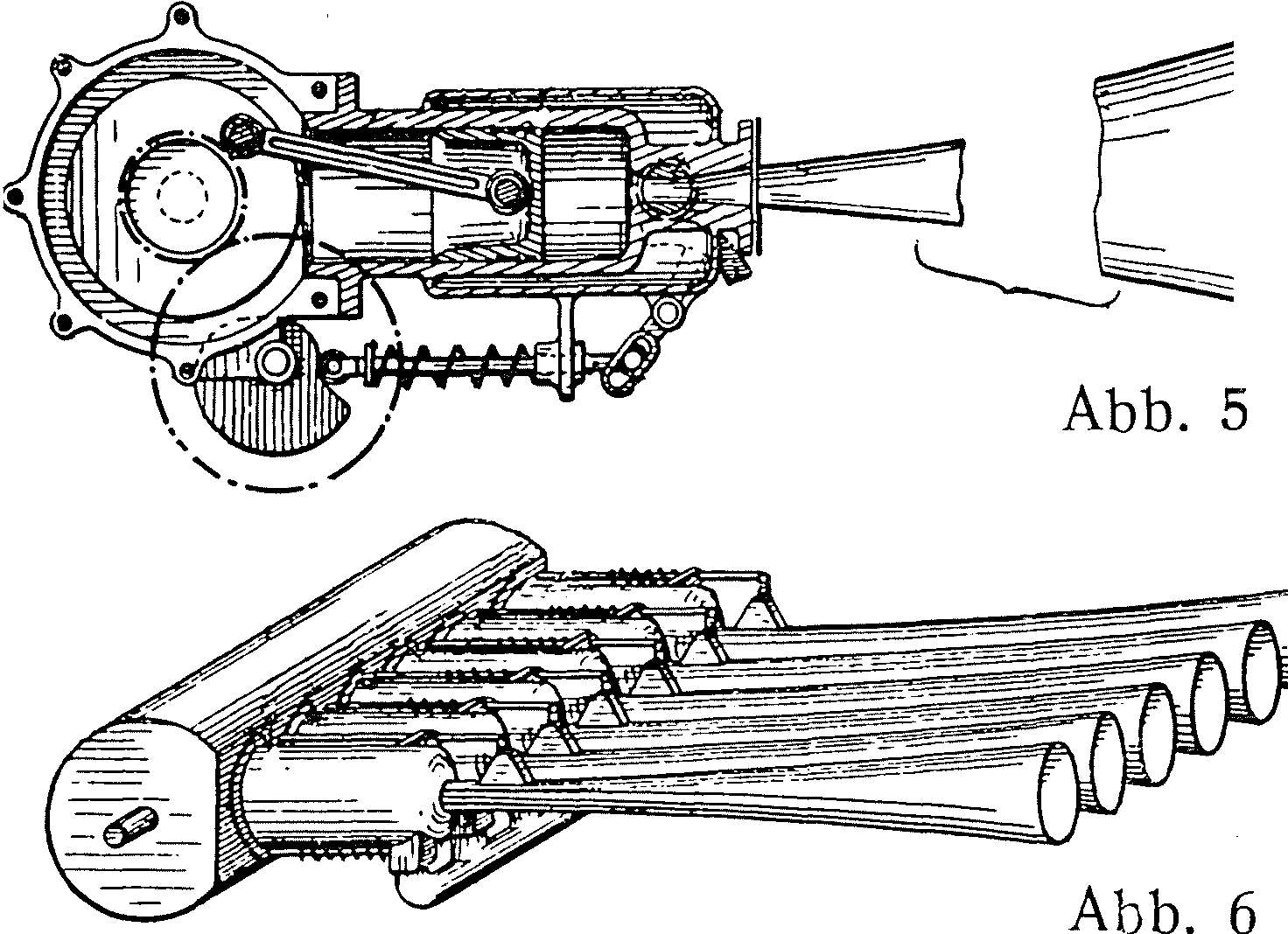
des Flugzeugs von 200 km als ein fernes, schwer zu erreichendes Ziel galt. Der französische Ingenieur Lorin, der in der Literatur öfter sich als Erfinder dieses Systems angesehen findet, hat erst 1913 im „Aerophile" diese Art Rückstoßer beschrieben; allerdings hat er seit 1908 in einer Reihe von Aufsätzen den Gedanken des „Vortriebes durch direkte Reaktion" im Gegensatz zu der durch Motor und Luftschraube bewirkten indirekten zu fördern gesucht und 1908 eine Art Zwischenlösung veröffentlicht und zum Patent angemeldet. Letzteres (Frankreich 390 256) enthält neben anderen Vorschlägen den Gedanken, ein Zylinder-Kurbel-System nach Art von Verbrennungsmotoren zum Ansaugen, Verdichten und Zünden zugleich zu benutzen und mit den (z. B. über ein Ueberdruck- oder gesteuertes Ventil) einen Auslaßtrichter verlässenden Gasen Rückstoß zu erzeugen (Abb. 5 u. 6). Es tritt hier zuerst der Gedanke auf, Brenngas-Energie des Rückstoßers für Verdichtungszwecke abzuspalten. Bei der in Abb. 5 u. 6 dargestellten Ausführungsform, die in sich verständlich ist und keiner Erläuterung bedarf, dient der motorähnliche Aufbau lediglich der Rückstoßerzeugung; es wird also der Kurbelwelle keine Leistung entnommen. Natürlich ist eine derartige Ausnutzung von Auspuffgasen1 auch bei Motoren sonst üblicher Ausbildung durchführbar, und zwar erfolgreich, was in jüngster Zeit vorgenommene Versuche erwiesen haben. Die batterieweise Anordnung der Zylinder gestattet, derartige Triebwerke leicht in Flugzeugtragflügel einzubauen.
In zwei Aufsätzen der genannten Zeitschrift hat Lorin im Jahre 1913 Geräte beschrieben, die sich zum Teil mit Vorschlägen seines Vorgängers Marconnet decken, so in den Abb. 7 u. 9, die Heizluftstrahltriebwerke mit konstantem Druck bzw. konstantem Volumen nach Art der Abb. 1 u. 3 darstellen. Abb. 8 zeigt, wie die Luft grundsätzlich ohne eine mechanische Einrichtung (Kompressor, Gebläse) vorzuverdichten ist, nämlich durch entsprechende Ausgestaltung der Lufteintrittsöffnung. Hier soll anscheinend die Luft auch aus der Grenzschichtzone eines windschnittigen Körpers entnommen, jedenfalls durch Erweiterung der Eintrittsöffnung ihre kinetische in potentielle Energie umgesetzt werden, um dann aus Diffusoren auszutreten und Rückstoß zu liefern. Mit der aus Abb. 8 erkennbaren Divergenz der Gasstrahlen wird bezweckt sie auf immer neue Schichten der außen vorbeistreichenden Luft treffen zu lassen. Triebwerke dieser Art be-
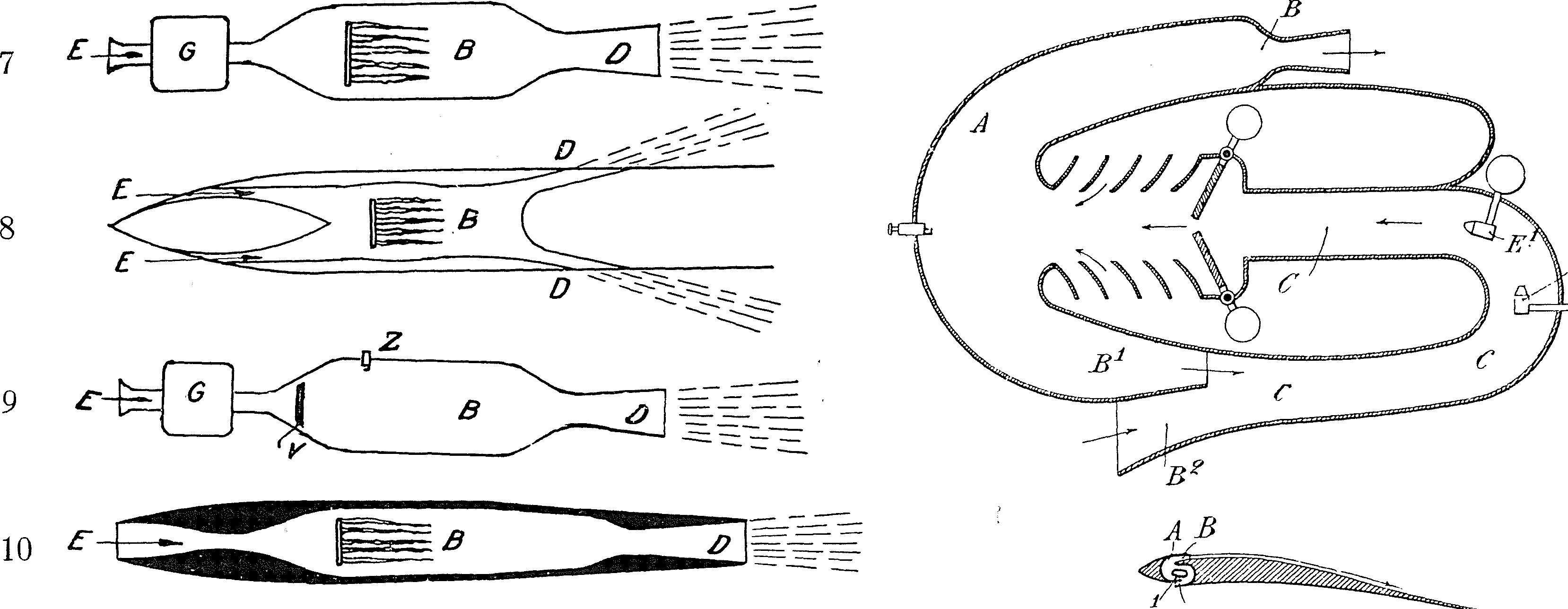
Abb. 7—10. Heizluftstrahltriebwerk Lorin (1913): B' Be
Buchstabenbedeutung dieselbe wie zu Abb. 1—4. Abb. 11 und 12. Heizluftstrahltriebv
Hayot (1913): Ein Teil der Brenn,
wird abgespalten und mittels des Injektors B1 zum Ansaugen der Luft verwc Gemäß Abb. 12 dient der austretende Gasstrahl auch zur Erhöhung der Strömu geschwindigkeit auf der Tragflügel-Oberseite.
dürfen beim Start einer anfänglichen Beschleunigung durch zusätzliche Mittel (Katapult, Startrakete oder Luftschraube). Versuche sind mit ihnen bereits 1886 von einem Rumänen Ciurcu in Paris auf der Seine und um 1908 herum von den bekannten Flugpionier Chanute in Amerika gemacht worden, ohne jedoch Ergebnisse hinterlassen zu haben. In Abb. 10 aus dem Jahre 1913 hat Lorin diesem mit stetigem Strahl, also konstantem Druck arbeitenden Rückstoßgerät seine gewissermaßen klassische windschnittige Form gegeben, ohne sonst über die in Abb. 4 dargestellte Ausführungsform Marconnets wesentlich hinausgelangt zu sein.
Eine weitere Entwicklung des Heizluftstrahl-Triebwerks zeigt sich ebenfalls in der aus Frankreich stammenden Erfindung Hayots, die 1913 angemeldet, zu dem deutschen Patent 330 014 geführt hat; vgl. die hier wiedergegebenen Abb. 11 u. 12. Nach dem Hauptmerkmal wird ein Teil der in dem Krümmer C entstehenden Verbrennungsgase durch eine Injektordüse B 1 in den Lufteintrittskanal B 2 geführt, um die Luft mitzureißen, die dann bei E mit Brennstoff und bei E 1 mit Wasser versorgt wird, bevor das Gemisch in der Kammer A verbrennt. Der übrige Teil der Gase tritt aus dem Diffusor B aus und ergibt Rückdruck. Bei der Anordnung an einem Tragflügel nach Abb. 11 wird außer dem waagerecht gerichteten Rückdruck in bereits früher bekannter Weise auch der Tragflügelauftrieb gesteigert, indem die über die Spannweite verteilten Gasstrahlen die auf der Flügeloberseite vorhandene Zirkulationsgeschwindigkeit noch steigern. (Fortsetzung folgt) Gohlke.
Avion Thermopropulseur.
Nebenstehende Abb. zeigt das Modell eines im Auftrag der französischen Regierung entwickelten Schnellflugzeuges, wie es auf dem
Pariser Salon gezeigt wurde („Flugsport" 1938, Nr. 25, Seite 679). Der Antrieb erfolgt nicht durch einen Benzinmotor mit Luftschraube, sondern durch irgendeinen Heizstrahlantrieb, wie im vorstehenden Artikel angedeutet. Das Flugzeug soll bei 2000 kg Fluggewicht, 16 m2 Fläche und 14000 PS Antriebsleistung 1000 km/h Geschwindigkeit erreichen.
Franz. Avion Thermopropulseur.
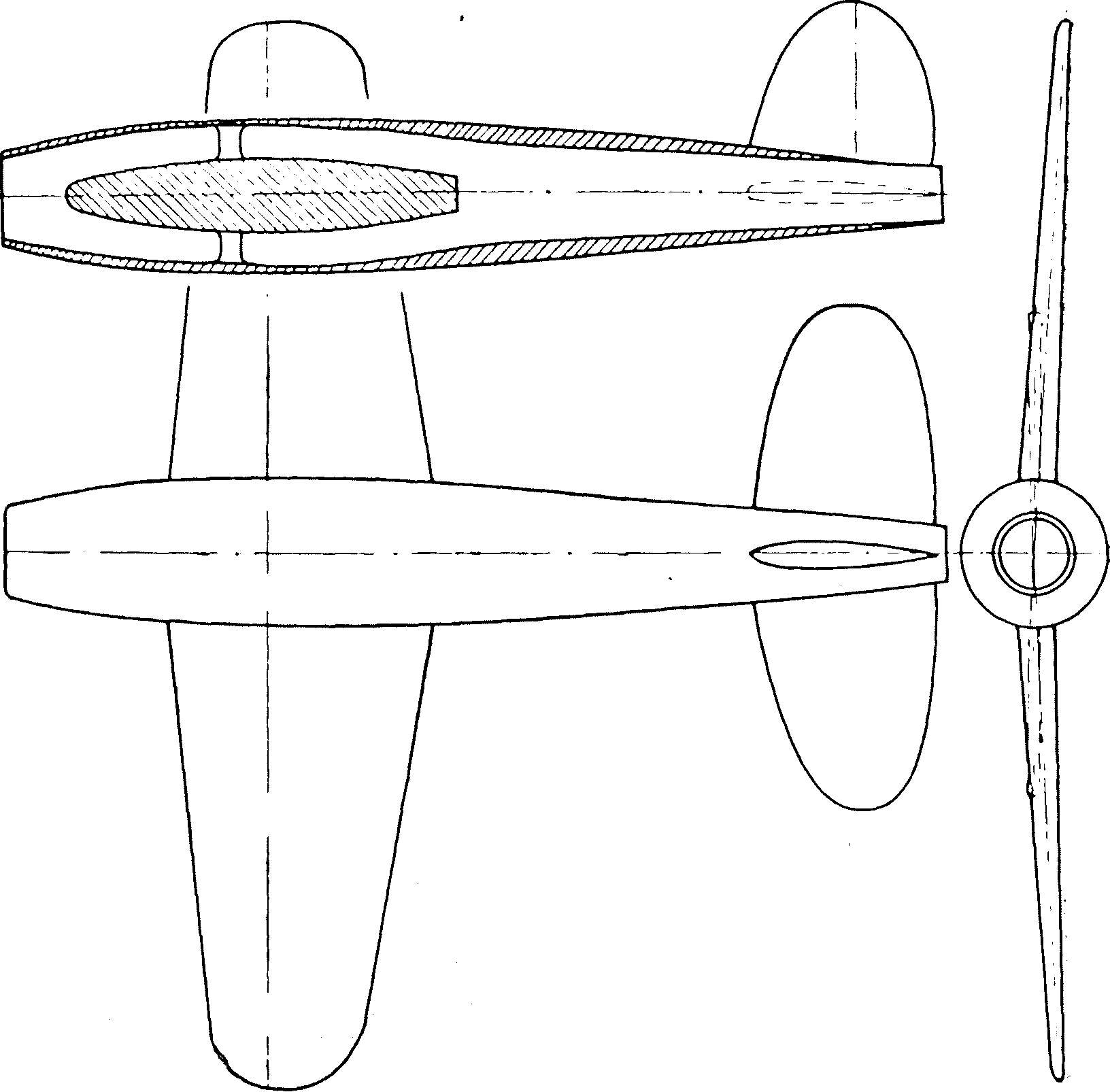
Onigkeit Muskelflugzeug.
Onigkeit, Leipzig, ein alter Vorkriegsflieger, hat in aller Stille, ganz auf sich selbst angewiesen, eine neue Flugzeugart gebaut. Der Vortrieb wird durch 4 am hinteren Ende der Tragflächen angelenkte Teilflächen bewirkt, die durch eine Nockenwelle mit um 180° versetzten Nocken angetrieben werden. Die Nockenwelle wird durch Fußantrieb betätigt.
Spannweite 15,5 m, Länge 9 m, Tragfläche 20 nr, bewegte Fläche 10 m2.
Auf diesem Gebiet sind eine Menge Vorschläge auf dem Papier
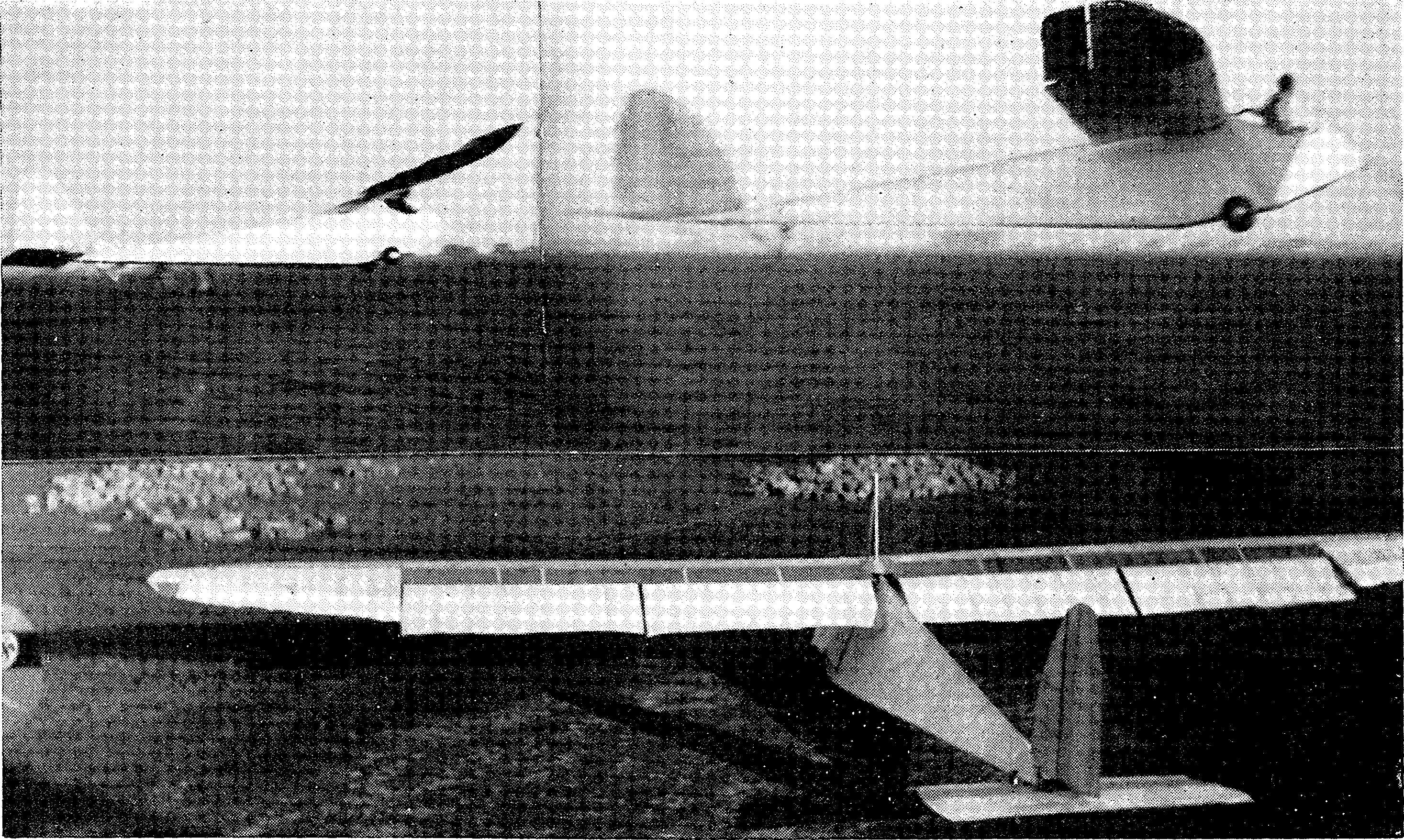
Onigkeit Muskelflugzeug. Oben links: Erster Start mit 600-fädigem Seil ohne Querruder in der Ebene von Leipzig am 15. 8. 32. Rechts: Start mit 600-fädigem Seil am 5. 5. 38 in 300 m Höhe mit Querruder. Nockenwellen durch Fußantrieb bewegt. Unten: Ansicht von hinten.
gemacht worden. Aber zum Bauen und zum Fliegen haben sich nur einzelne durchgerungen. Wenn auch die Erfolge dieser Versuche bescheiden sind, so sind sie doch weit mehr, als die vielen theoretischen Erörterungen, die auf dem Papier stehen geblieben sind. Aber bei all diesen Sachen ist es immer so: Der Prophet gilt nichts in seinem eigenen Vaterland und seiner eigenen Vaterstadt und findet dort immer am allerletzten eine Unterstützung. So scheint es auch bei dem alten Onigkeit gegangen zu sein. Aber Schwierigkeiten sind dazu da, daß sie überwunden werden. Hoffentlich setzt Onigkeit seine Versuche in dieser Richtung fort.
Japan. Segelflugzeug Mayeda-Rokko 1.
Mayeda - Rokko Type 1 Einsitzer, Konstrukteur Kenichi, wurde gebaut von der Flugzeugfirma Fukuda Mayeda Manufacturing Co.
Rumpf Sperrholz, feste Höhenflosse mit angelenktem Höhenruder. Seitenruder ausgeglichen.
Freitragender Knickflügel, Profil am Rumpf NACA 4418 und an den Enden 4312.
Spannweite 18,18 m, Länge 6,44 m, Höhe 1,03 m, Flügeltiefe 1,4 m, Fläche 16,50 m2. Leergewicht 155 kg, Fluggewicht 230 kg.
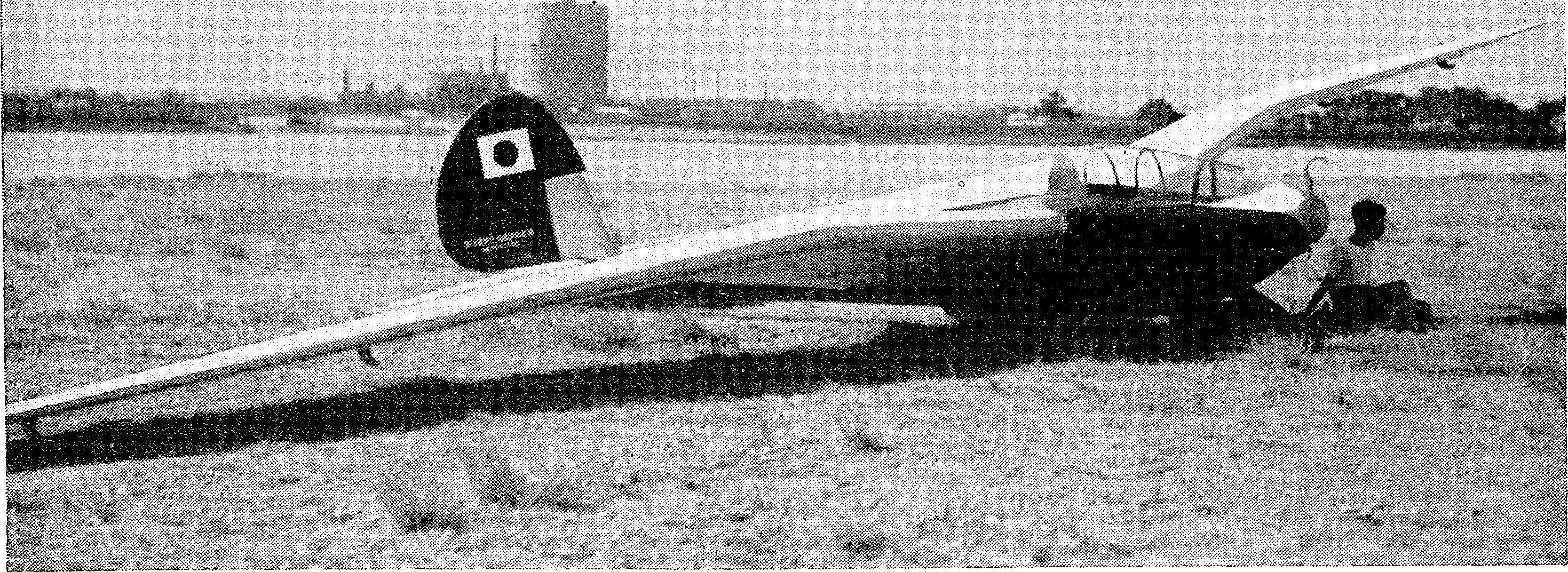
Japan. Segelflugzeug Mayeda-Rokko 1. Archiv Flugsport
Gleitwinkel 1 : 26, Gleitgeschwindigkeit 60,1 km/h, Landegeschwindigkeit 43,8 km/h. Seitenverhältnis 1 : 20.
Henschel-Mehrzwecke-Flugzeug „Hs 126".
Den abgestrebten Hochdecker haben wir auf S. 32 u. 574, 1938 ausführlich besprochen, und bringen nun noch das Typenblatt der Maschine: 1 starres MG., la Patronenkasten,
2 bewegliches MG., 2a Munitionstrommeln,
3 Lichtbildgerät,
4 FT. - Geräte, 4a Schleppantenne, 4b Festantenne, 4c Generator für FT.,
5 Kraftstoff-
Schmierstoff-Behälter, 6 Magazin für 10 10-kg-Bomben.
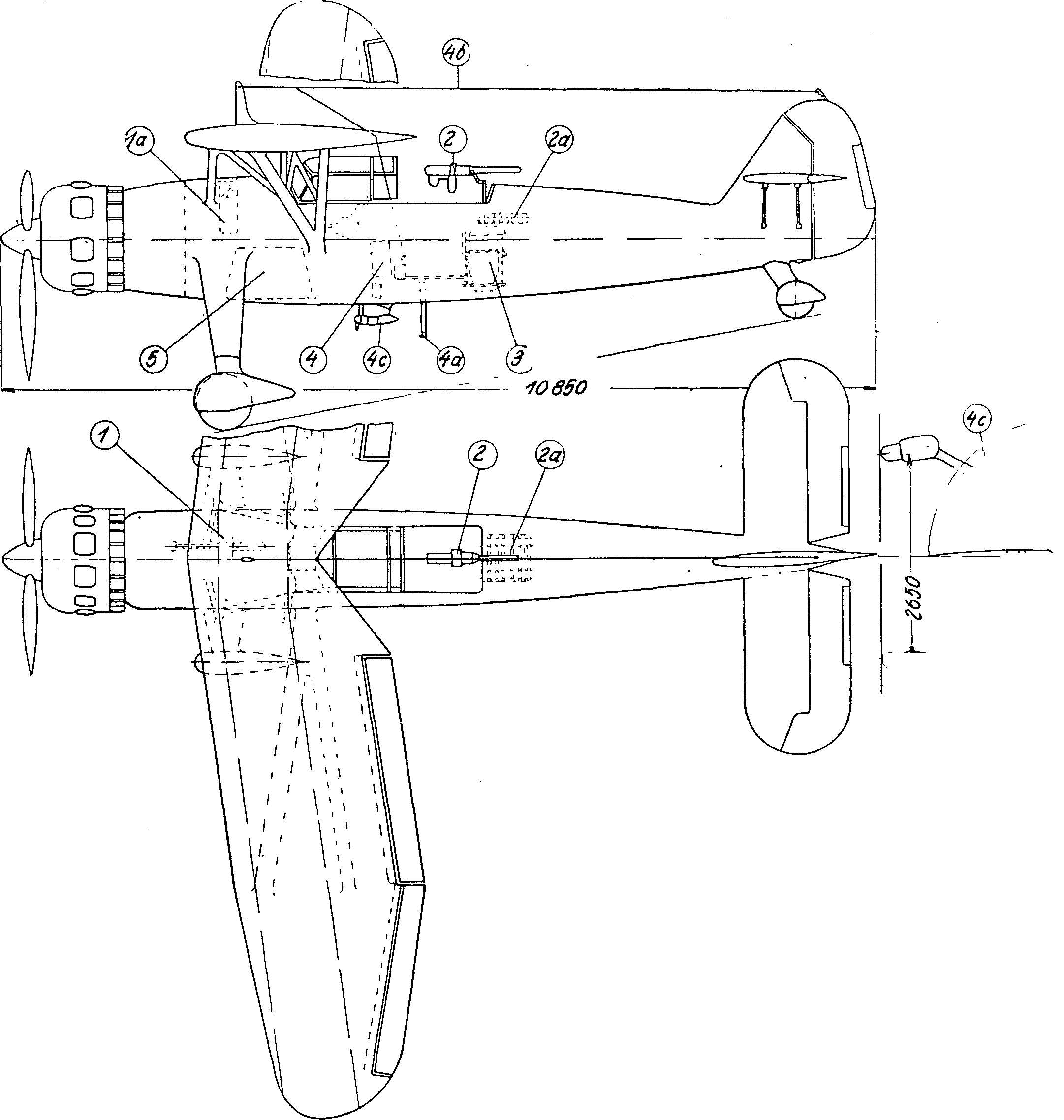
Henschel Hs 126
Zeichnung: Flugsport
Airspeed Oxford leichter Bomber.
Der zweimotorige freitragende Tiefdecker wurde von „Airspeed" für das englische Luftfahrtministerium als Mehrzwecke-Uebungs-bomber entwickelt.
Flügel dreiteilig, sperrholzbeplankt. Zwei Holzholme. Landeklappen unter dem Rumpf von Querruder zu Querruder, hydraulische Betätigung.
Rumpf zweiteilig, Halbschale sperrholzbeplankt. Rumpfvorderteil Aluminium mit Bombenabwurffenster.
Leitwerk freitragend; Höhenleitwerk Aufbau wie Flügel; Seitenleitwerk ebenfalls Holzbau, aber blechbeplankt. Seitenruder statisch und aerodynamisch ausgeglichen.
Fahrwerk hydraulisch nach hinten einziehbar.
Triebwerk 2 Armstrong Sidde-ley Cheetah X, 7-Zyl.-Stern-motoren von je 375 PS bei 2300 U/min; De Havilland „constant speed" Luftschrauben.
Zeichnung: Flugsport Airspeed Oxford
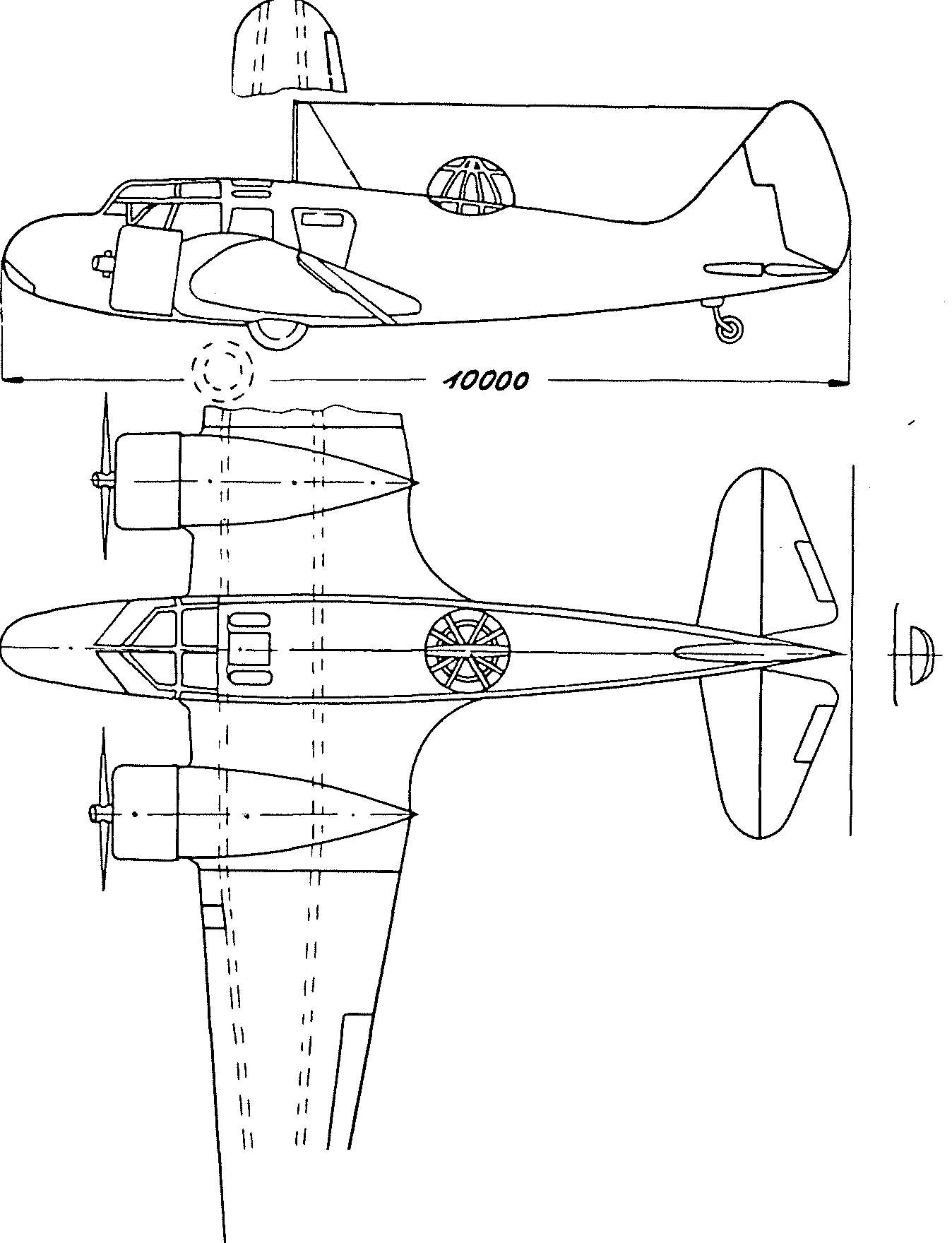
Airspeed Oxford, 2-motoriges Kampfflugzeug; 1 Oelkühlluftführung, 2 Oelbehälter, 3 Fallschirm, 4 FT-Geräte, 5 Gerätebrett beim Beobachter, 6 Fallschirm, 7 Sauerstoff, 8 Träger des Oelbehälters, 9 Austritt der Oelkühlluft, 10 Hilfsflügel, 11 Brennstoffbehälter, 12 Kontrollklappe, 13 Landelicht, 14 Brennstoffbehälter, 15 Schleppantenne, 16 Bomben im Flügelkasten, 17 Führersitz, 18 Navigationstisch, 19 Kontrollampen, 20 Seitensteuerfußhebel, 21 Beobachtungsfenster für den Bombenabwurf, 22 Sitz des 2. Flugzeugführers, 23 Oelkühllufteinlaß, 24 elektr. Anlasser.
Spannw. 16 m, Länge 10 m; Leergew. 2417 kg, Nutzlast 988 kg, Fluggew. 3405 kg. Höchtsgeschw. in Bodennähe 272 km/h, in 1520 m Höhe 295 km/h, Reisegeschw. in 1520 m Höhe 267 km/h. Steigzeit auf 1828 m 5 Min. Dienstgipfelhöhe 7150 m, absolute Höhe 7550 m.
„Norge" Hochdecker Modell A.
Birger Hönningstad hat ein Hochdecker-Zweischwimmer-Kabinenflugzeug konstruiert, welches in der Werkstatt der Wideröe's Flyve-selskap A/S, Oslo, im Auftrag von Aksel Kristiansen und Arne R. Bjercke gebaut wurde.
„Norge" ist ein zweisitziger Hochdecker, Schul- und Sportflugzeug, mit geschlossener Kabine. Sitze nebeneinanderliegend, doppelte Knüppelsteuerung.
Flügel von gleichbleibender Tiefe mit ellipitschen Flügelenden, zweiholmig (Spruce), Fachwerkrippen (Spruce), Clark-Y-Profil. Flügel stoffbespannt, Vorderkante Sperrholz.
Rumpf Stahlrohr, geschweißt. Großer Gepäckraum (für Sanitätsdienst eingerichtet). Leitwerk Stahlrohrkonstruktion. Rumpf zum Teil mit Dural beplankt und stoffbespannt, Leitwerk stoffbespannt.
Fahrwerk: Oelstoßdämpfung, amerik. Warner-Räder und -Bremsen. Fahrwerk nicht einziehbar. Als Wasserflugzeug auf Edo-Schwim-mern montiert.
Alle Stahlrohrkonstruktionsteile sind gegen Seewasser besonders gestrichen.
Triebwerk: Warner-Scarab-Motor 125 PS, Hamilton-Standard-
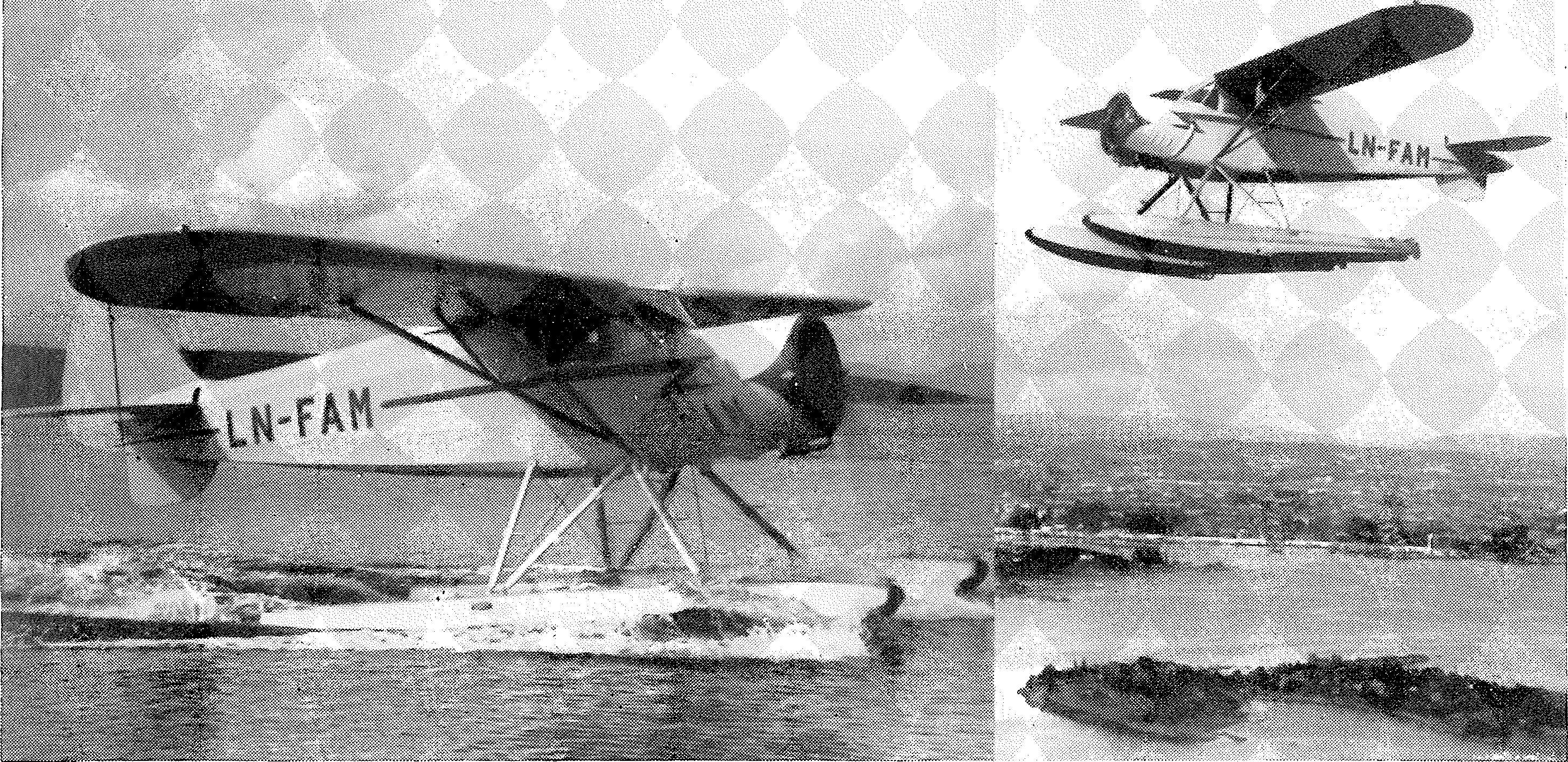
„Norge" Hochdecker Modell A. Werkbild
Propeller. Spannweite 11,45 m, Länge 7,75 m, Höhe 3,54 m, Fläche 16 m2, Leergewicht 700 kg, Zuladung 234 kg, Fluggewicht 934 kg. Max. Geschw. 200 km/h, Landegeschw. 80 km/h.
Cant Z 509, Atlantikflugboot.
Anläßlich des Mailänder Salons 1937 (s. „Flugsport" 1937, S. 574) haben wir die bis dahin bekannt gewordenen Konstruktionen der Cantieri Riuniti delFAdriatico, Triest, besprochen. Das jetzt veröffentlichte 3motorige Flugboot ähnelt der Torpedomaschine „Cant Z 506 B" (s. „Flugsport" 1937, S. 575); von der Großflugbootbauweise, wie sie bei dem „Cant Z 508" ausgeführt worden ist, scheint man abgekommen zu sein.
Flügel freitragend in Mitteldeckeranordnung, trapezförmig mit elliptischen Enden. Dickes Profil, 3holmig. Sperrholzbeplankt bzw. stoffbespannt. Querruder zweiteilig, ausgeglichen.
Rumpf elliptischer Querschnitt, Holz; Beplankung vollständig mit Tulpenbaumholz. Doppelführersitz vor dem ersten Spant, dann Funkraum mit Sende- und Empfangsanlage. Hinter dem dritten Spant Fluggastraum für 6 Fluggäste; je 2 Sitze nebeneinander, Einstieg im hinteren Teil der Kabine. Im Rumpfhinterteil Toilette, Vorratskammer und Gepäckraum.
Leitwerk Holz, stoffbespannt. Höhenleitwerk durch je 2 Streben nach dem Rumpf abgefangen. Höhen- und Seitenruder ausgeglichen.
Schwimmer Metall, in wasserdichte Kammern unterteilt; beide Schwimmer mit Anker- und Einholring.
Länge 19,14 m, Spannweite 28,35 m, Höhe 7,52 m, Fläche 100 m2. Normales Fluggew. 16 500 kg, max. Fluggew. 17 500 kg, Leergew.
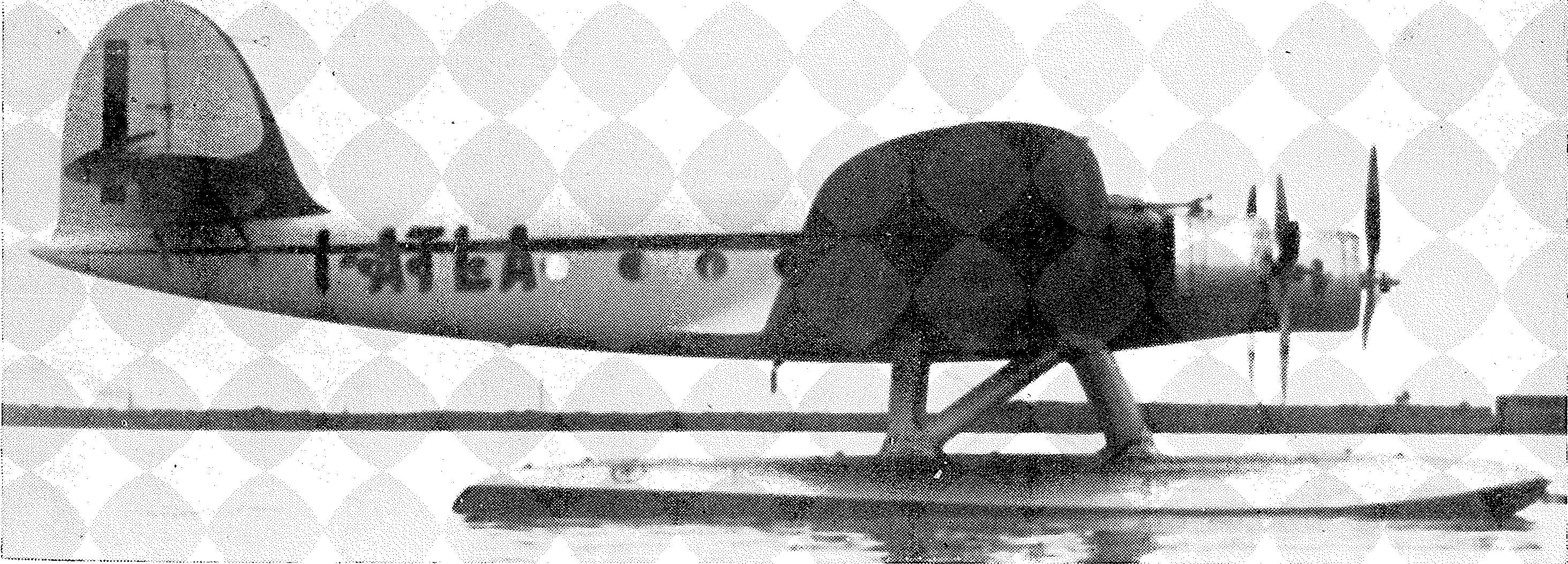
Cant Z 509 Atlantikflugboot.
Werkbild
10 000 kg, Post u. Pass. 1000 kg, Brennstoff 4700 kg, Nutzl. 6500 kg.
Max. Geschw. in 4500 m 420 km/h, max. Geschw. in Bodennähe 330 km/h, Landegeschw. 130 km/h, Steigzeit auf 4000 m 13 Min., Gipfelhöhe 7500 m.
Curtiss-Wright CW 20 Zweimotor.
Die Curtiss-Wright Corporation hat in den letzten Jahren nur Kriegsmaschinen herausgebracht. Die einzige Luftverkehrsmaschine war die alte Curtiss Condor, gebaut in dem Werk St. Louis, wo auch jetzt der Curtiss Wright CW 20 seit vorigem Jahr im Bau ist. Typenbeschreibung haben wir bereits 1938 Seite 502 mit Uebersichtszeich-nungen und Bildern Seite 621 veröffentlicht.
Der in vier Stücken gebaute Rumpf, 22,8 m lang, in der Mitte 3 m breit, faßt in der Hauptsache eine große Flugkabine von 10,5 m Länge mit 30 Sitzplätzen oder 20 Schlafstellen. Kabinenüberdruck 0,35 kg/cm2.
In der Abb. auf Seite 11 sieht man rechts oben die Ueberdruck-kabine mit den luftdichten Schotten und Schottentür. Man beachte die vielen Versteifungsringe und Längsprofile. Darunter sieht man den Rumpf auf der Helling. In das freigelassene Rumpfstück wird später das in einem anderen Teil der Fabrik hergestellte Flügelmittelstück eingefügt.
Flügelmittelstück 9,65 m, Flügeltiefe 4,8 m, Profilhöhe 0,9 m. Die vier Betriebsstoffbehälter, 5000 1 fassend, sind in den Außenstücken untergebracht.
Die 1500-PS-Cyclone-Motoren sind mit dreiflügeligen Curtiss-Electric-Propellern von 4,5 m Durchmesser ausgerüstet.
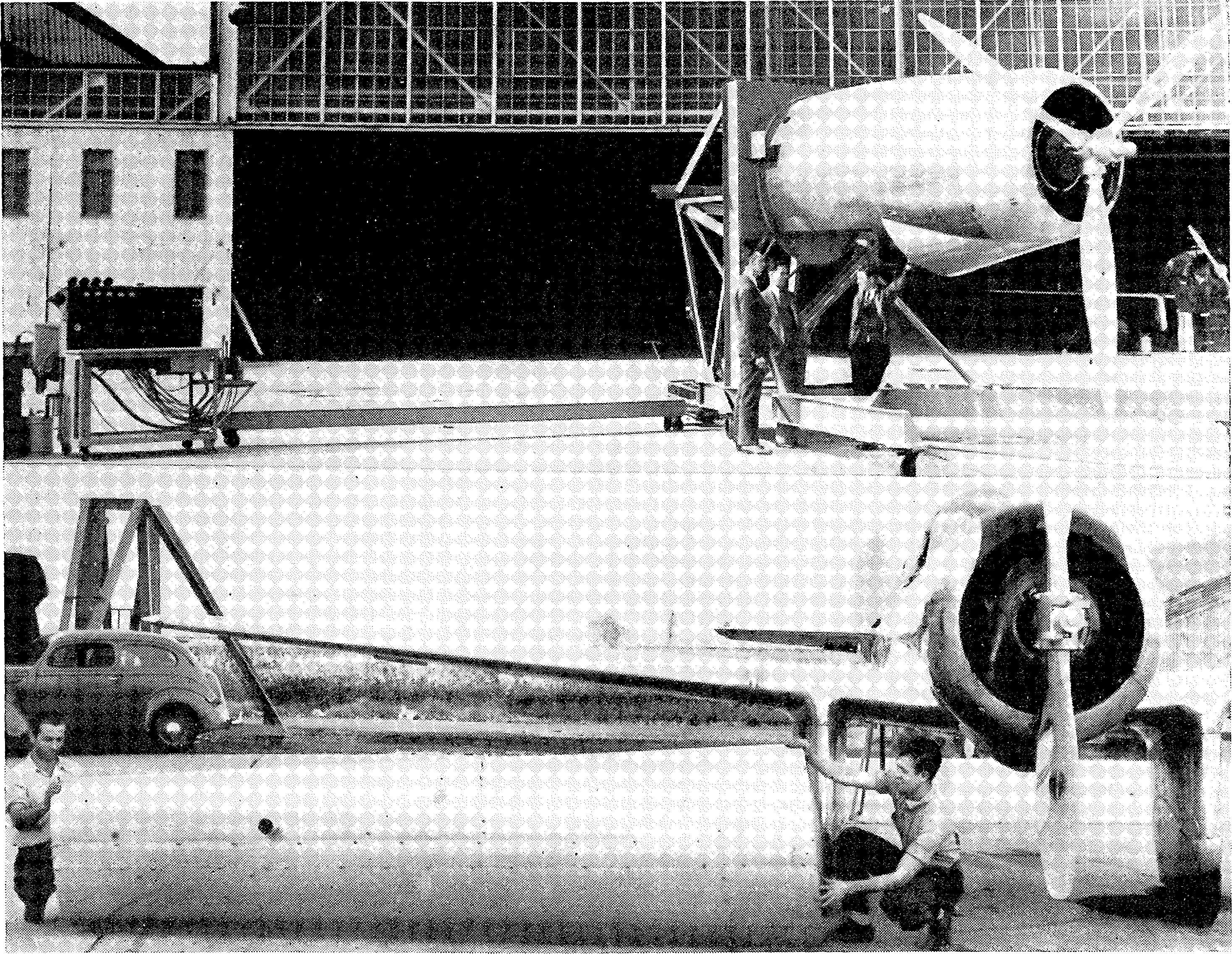
Wright Doppelstern Cyclone 1500 PS für Curtiss-Wright CW 20 Zweimotor als einbaufertiges Aggregat auf einem Sonder-Versuchsstand, bevor es in die fertige Zelle eingebaut wird. Betriebsstoffbehälter des Curtiss-Wright 20, 1300 1, im Vergleich mit einem Curtiss 19 R Jagdflugzeug. (Diese Tanks sind in den äußeren Flügelstücken untergebracht.) Archiv Flugsport
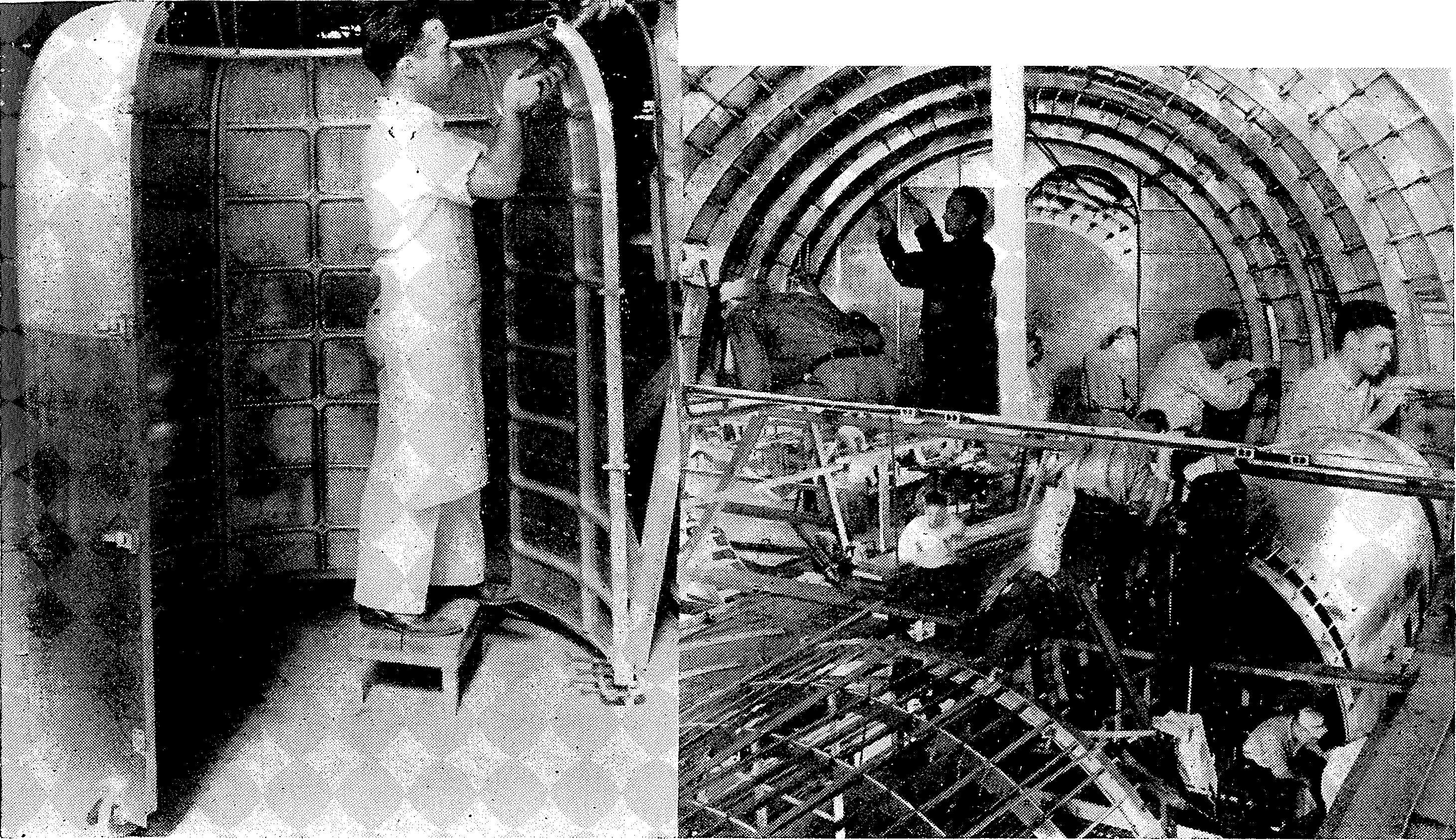
Links: Motorverkleidung für den doppelreihigen Wright Cyclone 1500 PS.
Reichweite mehrmotoriger Verkehrsflugzeuge.
In der Zeitschrift „Aviation" bringt Schairer eine in mehrfacher Hinsicht interessante Reichweitenberechnung, bei der auf die Charakteristik moderner Triebwerke (Ladermotoren und Versteilschraube) näher eingegangen wird. Als Beispiel wurde ein Flugzeug angeführt, das ziemlich genau der Douglas DC4 entspricht.
Der Schubleistungsbedarf eines Flugzeuges ist bestimmt durch S = cw * q ϖ F. Den Propellerschub kann man aus dem Propellerbelastungsgrad Cs = S/qFs *) ermitteln. Hiermit wird cs =cw F/Fs.
Da das Verhältnis der Flügelfläche zur gesamten Schraubenkreisfläche F/Fs für jedes Flugzeug eine Konstante ist, kann man der Schraube für jeden Flugzustand einen bestimmten cs-Wert zuordnen. Trägt man, wie in Abb. 1 gezeigt, den Belastungsgrad als Parameter über dem Fortschrittsgrad und Wirkungsgrad auf, so erhält man Kurven, die mit ihrem Optimum für jeden (aus obiger Beziehung durch cw festgelegten) cs-Wert einen ganz bestimmten Fortschrittsgrad, d.h. Drehzahl vorschreiben. Man erkennt also, daß man beim Ausfliegen eines modernen Flugzeuges auf Reichweite mit der Verstellschraube die günstigste Drehzahl möglichst exakt einhalten muß.
Die Daten des Flugzeuges sind folgende: Vier Motoren zu je 1000 PS bei 2500 U/min in 2,4 km Höhe, Spannweite 42,5 m, Flächeninhalt 186 m2, Fluggew. 27,2 t, Zuladung 11 t. Sämtliche Reichweiten
gelten für Volldruckhöhe, ohne Wind und ohne Start und Landung, Steig-und Gleitflug.
Abb. 1. Belastungsgrad als Parameter über dem Fortschritts- und Wirkungsgrad.
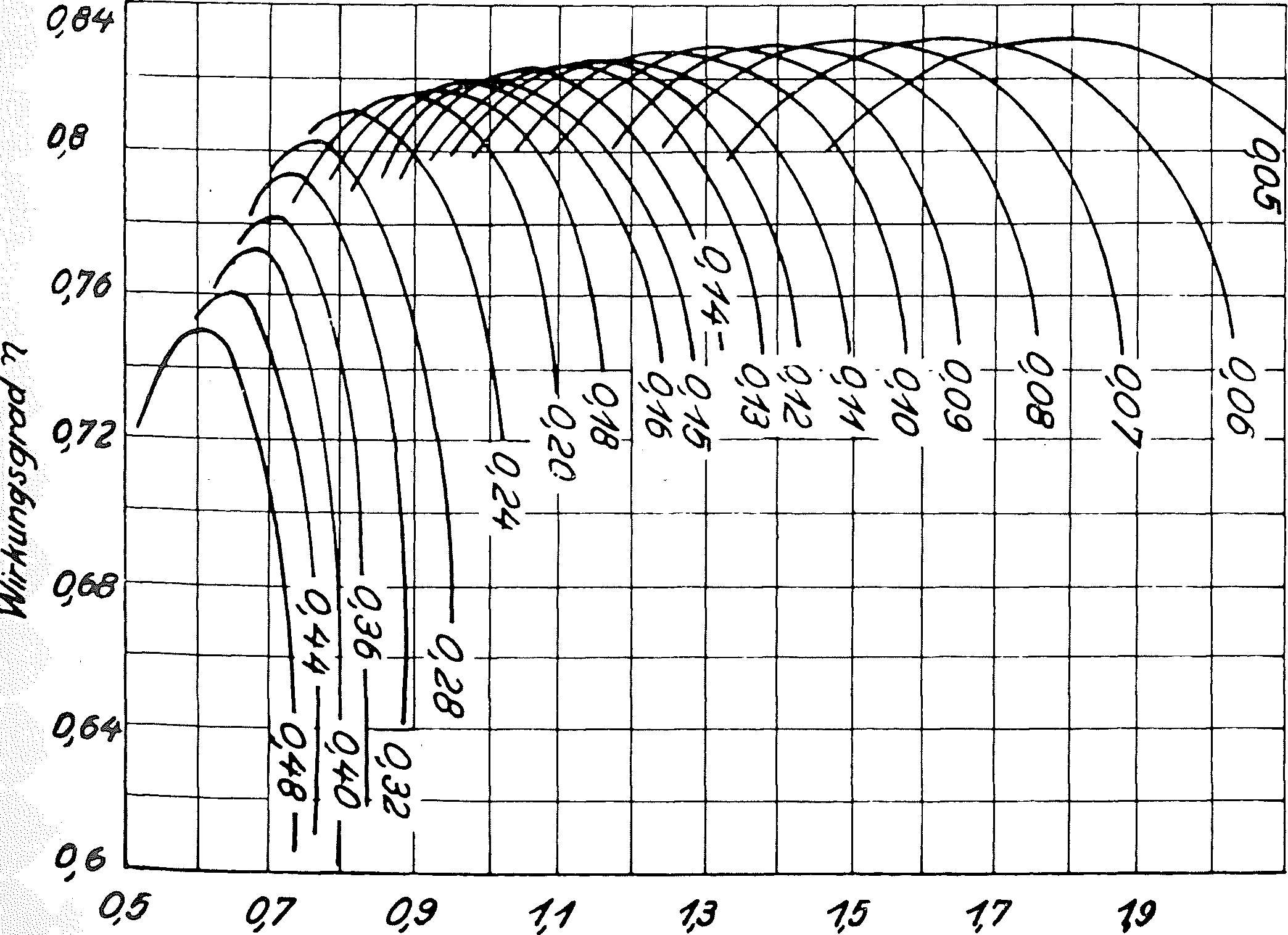
*) Ueber die Bedeutung des Belastungsgrades von Luftschrauben siehe auch „Flugsport" 1935, Nr. 23, Seite 532.
Abb. 2. Spez. Reichweiten bei drei verschiedenen Fluggewichten. Man beachte, daß bei hohen Fluggewichten das Geschwindigkeitsoptimum sehr flach verläuft, d. h. Reisegeschwindigkeit von 280—300 km/h zulässig sind ohne wesentlich an Reichweite zu verschenken. Bei leergeflogener Maschine gilt das Gegenteil; Stillsetzen von zwei der 4 Motoren lohnt sich.
400 200 $00 <VOO
In Abb. 2 sind die spezifischen Reichweiten bei drei verschiedenen Gewichten angegeben. Da mit zunehmendem Belastungsgrad der Schraube der Propellerwirkungsgrad abnimmt und bei starker Drosselung des Motors der Brennstoffverbrauch wieder ansteigt, liegen die günstigsten Geschwindigkeiten v0Pt durchweg um 20—25 km/h höher als der Geschwindigkeit der besten Gleitzahl entspricht. Bei Fluggewichten unter 20 t wird die Drosselung der Motoren so stark, daß es sich lohnt, zwei Motoren stillzusetzen. Für den Fall des Zwei-motorenfluges wurde der Widerstand der beiden in Segelstellung befindlichen Schrauben berücksichtigt. Abb. 3 zeigt, daß man beim Drosseln während des Fluges eher mit der Propellerverstellung die Drehzahl begrenzen soll, als mit dem Gashebel den Ladedruck zu stark zu drosseln. Schließlich laufen die Motoren beim Zweimotorenflug (unter 22 t) mit höheren Drehzahlen und annähernd Reiseleistung.
Obwohl der Gewinn an Reichweite beim Zweimotorenflug naturgemäß klein ist, können durch geringe Laufzeiten des Triebwerks die Flugstunden zwischen den Triebwerksüberholungszeiten erhöht werden. Abb. 4 und 5 zeigen die Reichweiten für fünf verschiedene Flugzustände. Man erkennt, daß bei einem ausgesprochenen Fernflug ohne Nutzlast (Abb. 4) durch exaktes Fliegen, am Schluß mit zwei Motoren, die Reichweite gegenüber einem Flug mit Reiseleistung (75%) um fast 50% verbessert werden kann. Bei 8 t Zuladung dagegen beträgt dieser Gewinn nur noch knapp 25%.
Abb. 3. Drehzahlen und Motorleistungen für das Ausfliegen der größten Reichweite. Man muß beim Fliegen mit 4 Motoren die Drehzahl durch Propellerverstellung stark herabregulieren; d. h. der Ladedruck fällt wesentlich langsamer ab als bei fester Schraube. Beim Flug mit riur 2 Motoren (gestrichelte Kurven) laufen diese zu Beginn mit Reiseleistung und zum Schluß immer noch mit etwa der gleichen Drehzahl wie beim 4-Mo-torenflug mit vollem Fluggewicht.
O 40 20 30
|
-f 4 |
1 1 1 1 |
|||||||||||||
|
13,6 |
||||||||||||||
|
2Q< |
||||||||||||||
|
< |
||||||||||||||
|
I 2%2 |
||||||||||||||
|
7 Lt |
||||||||||||||
|
40C |
||||||||||||||
|
-— |
eseti |
|||||||||||||
|
V h |
||||||||||||||
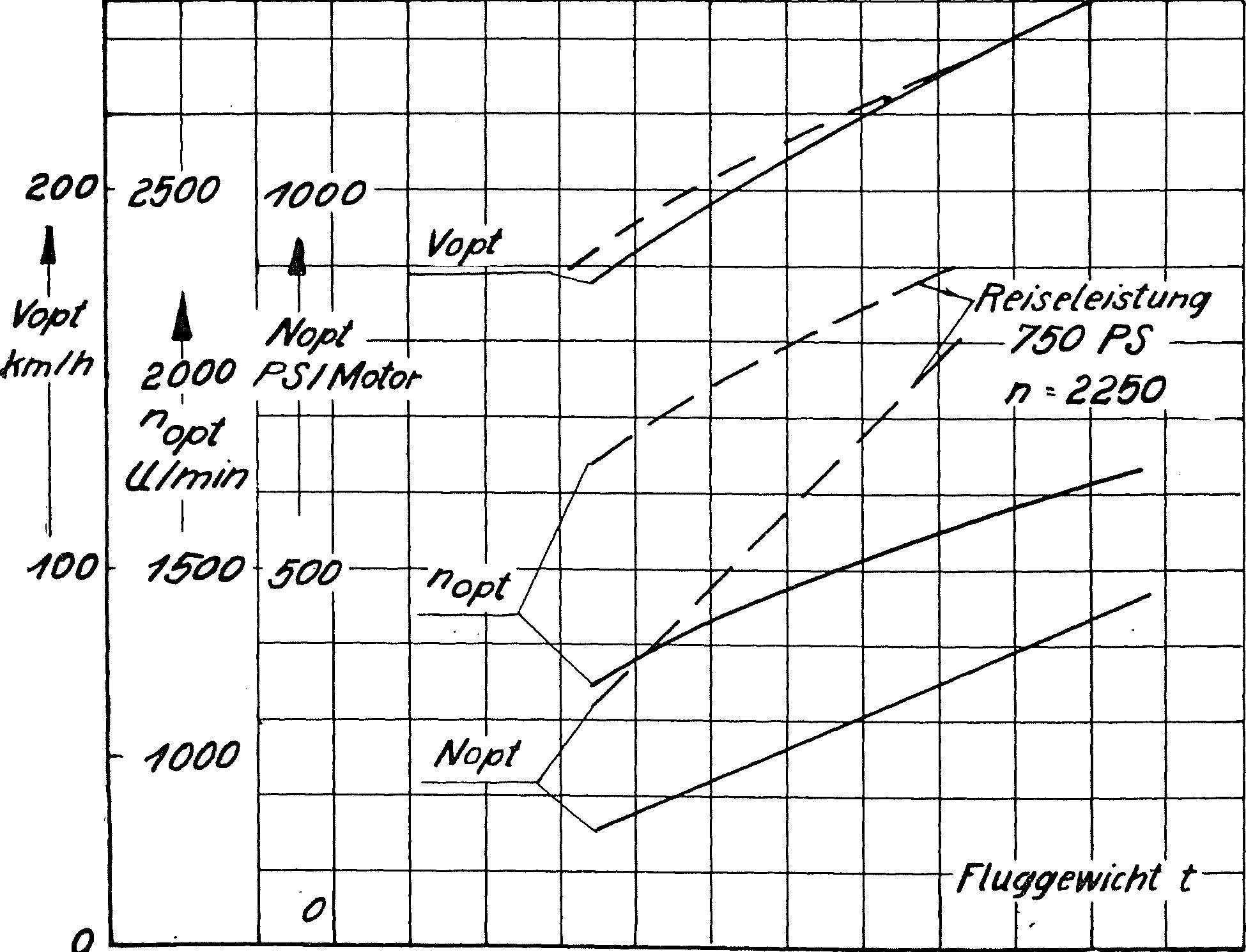
10OOO
8000
Abb. 4. Reichweiten des Flugzeuges für verschiedene Brennstoffmengen, äooo Startgewicht jeweils 27,2 t. Wie schon Abb. 2 zeigte, lohnt sich ein Ausfliegen mit vopt erst ab etwa 4000 4000 km Reichweite. Gestrichelt der geringe Gewinn durch 2-Motorenflug.
ZOOO
|
1 1 2 fl/fntnr/>n |
/ J |
||||||||||
|
1 |
gfes |
etzt |
V |
||||||||
|
1 |
|||||||||||
|
1 |
(gm |
Oy |
|||||||||
|
i |
Stet |
||||||||||
|
Vorrat t 1,. 1 |
|||||||||||
Mit Hilfe einer Drehmomenten-meßnabe und einer
Versteilschraube kann bei bekannten
c -Werten der Zelle der Verlauf des Belastungsgrades, wie er in Abb. 1 aus Windkanalmessungen aufgetragen wurde, durch Flugmessungen für jede interessierende Schraube bestimmt werden.
40000
8000 -
6000
4000
2000
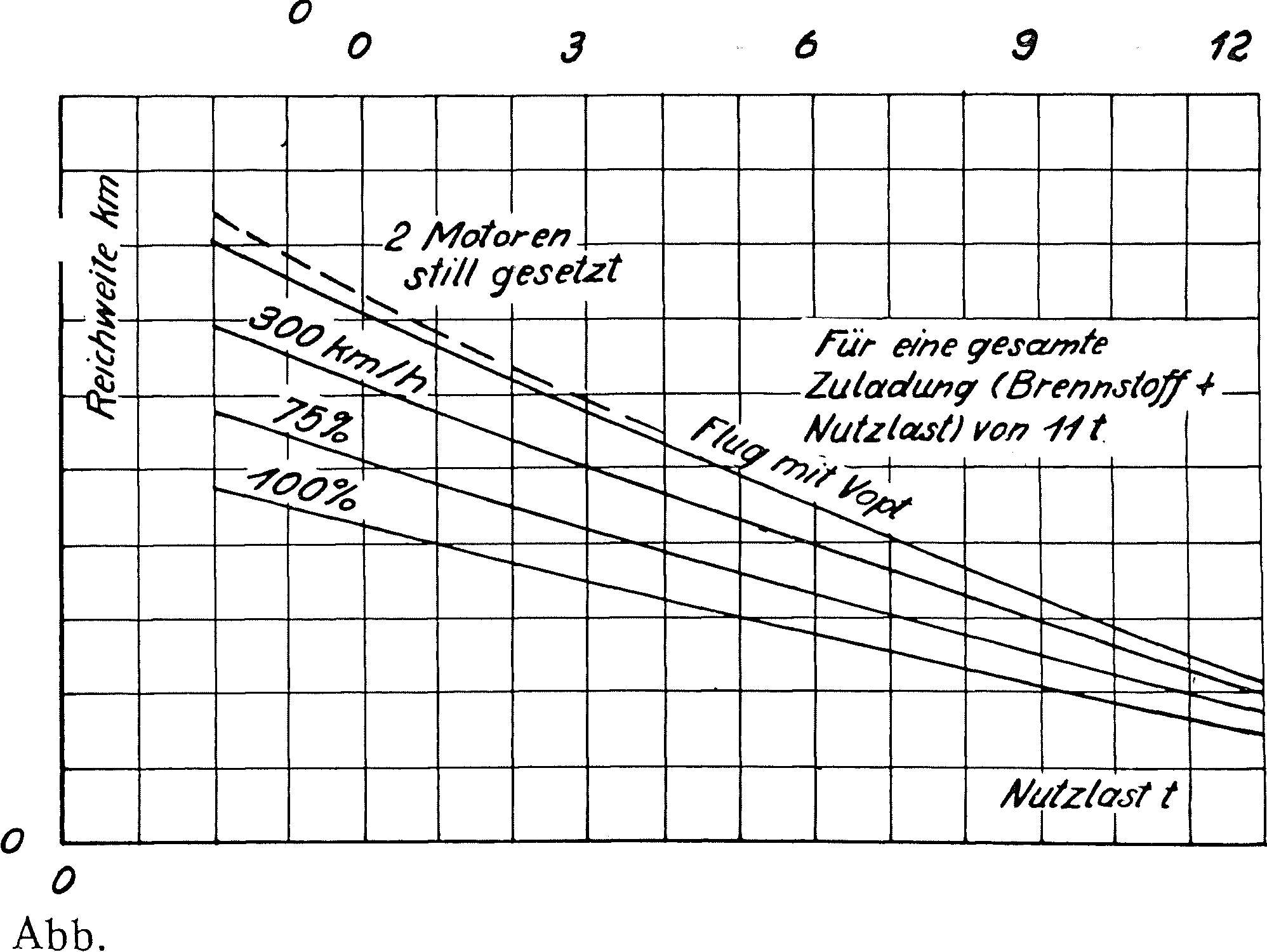
4 2340678
5. Reichweiten für 5 verschiedene Flugzustände über der Nutzlast.
Messung der Fluggeschwindigkeit
Dr.-Ing. Walter Haag.
Die Messung der Fluggeschwindigkeit durch Abstoppen einer Meßstrecke wird namentlich bei der Erprobung von Muster-Flugzeugen durchgeführt, zur genauen Ermittlung von Höchst- und Reisegeschwindigkeit, zur Kontrolle der Anzeige des Fahrtmessers, zum Vergleich verschiedener Luftschrauben, sowie zur Ermittlung des Einflusses verschiedener Ausführungsformen auf die Geschwindigkeit, z. B. Windschutzscheiben, Fahrwerksverkleidungen, Abdeckung des Beobachtersitzes u. dgl.
Für die Auswertung der Messungen ist es nun erforderlich zu wissen, mit welcher Meßgenauigkeit im allgemeinen gerechnet werden kann. Um sich hierüber ein Urteil bilden zu können, sollen die üblichen Methoden der Geschwindigkeitsmessung einer Betrachtung unterzogen und die verschiedenen Faktoren untersucht werden, die die Horizontalgeschwindigkeit eines Flugzeuges beeinflussen und deshalb bei Nichtbeachtung zu fehlerhaften Meßergebnissen führen können.
Wahl der Meßstrecke.
1. Anordnung der Meßstrecke,
Je nach Anordnung unterscheidet man die einfache Meßstrecke, bei der eine (gerade) Strecke hin und zurück überflogen wird, die Dreieckmeßstrecke, bei der die einzelnen Strecken jeweils nur in einer Richtung beflogen werden und die Doppel-
Abb. 1
v vQ* + w2
Die Verhältnisse bei beliebiger Windrichtung sind in Abb. 2 dargestellt. Die Windgeschwindigkeit W ist in zwei Komponenten parallel und senkrecht zur Meßstrecke zerlegt. Die parallele Komponente (Wp) fällt bei der Auswertung heraus, während der Einfluß der Seitenkom-ponente (WSJ durch die Beziehung
v =]/vm' + w/1
gegeben ist, wobei Vm = Vq — WP.
In Abb. 3 ist nun aus dieser Beziehung ein Diagramm gezeichnet, aus dem für jede Windgeschwindigkeit der Zuschlag A v zu entnehmen ist, um den die aus der Messung erhaltene Fluggeschwindigkeit Vm zu vergrößern ist. Vm sowie AVm sind in % von V angegeben. Aus diesem Diagramm läßt sich so für beliebige Verhältnisse die erforderliche Korrektur für die Seitenkomponente des Windes ablesen.
Den während der Flugmessung herrschenden Wind erhält man übrigens außer der dritten Messung aus der Geschwindigkeitsmessung selbst, denn die in Richtung der Meßstrecke fallende Komponente WP ist gleich der halben Differenz zwischen der Geschwindigkeit im Hin-und Rückflug.
Aus Wp und der Windrichtung läßt sich dann zeichnerisch leicht der Seitenwind bestimmen. Weitere Anhaltspunkte für den Seitenwind erhält man aus dem Vorhaltewinkel (f. Wie aus Abb. 1 und 2 ersicht-
Ws
lieh, ergibt sich dieser aus tg<p=~rr~. Die Messung des Vorhalte-
v in
Winkels reicht also aus, um den Einfluß des Seitenwindes bei der einfachen Meßstrecke zu eliminieren. In Abb. 4 ist der Vorhaltewinkel abhängig vom Seitenwind und der bei Seitenwind erforderliche Zuschlag als Funktion des Vorhaltewinkels aufgetragen. Der Zuschlag
A V = V — Vm läßt sich entweder aus Abb. 3 oder aus der Beziehung
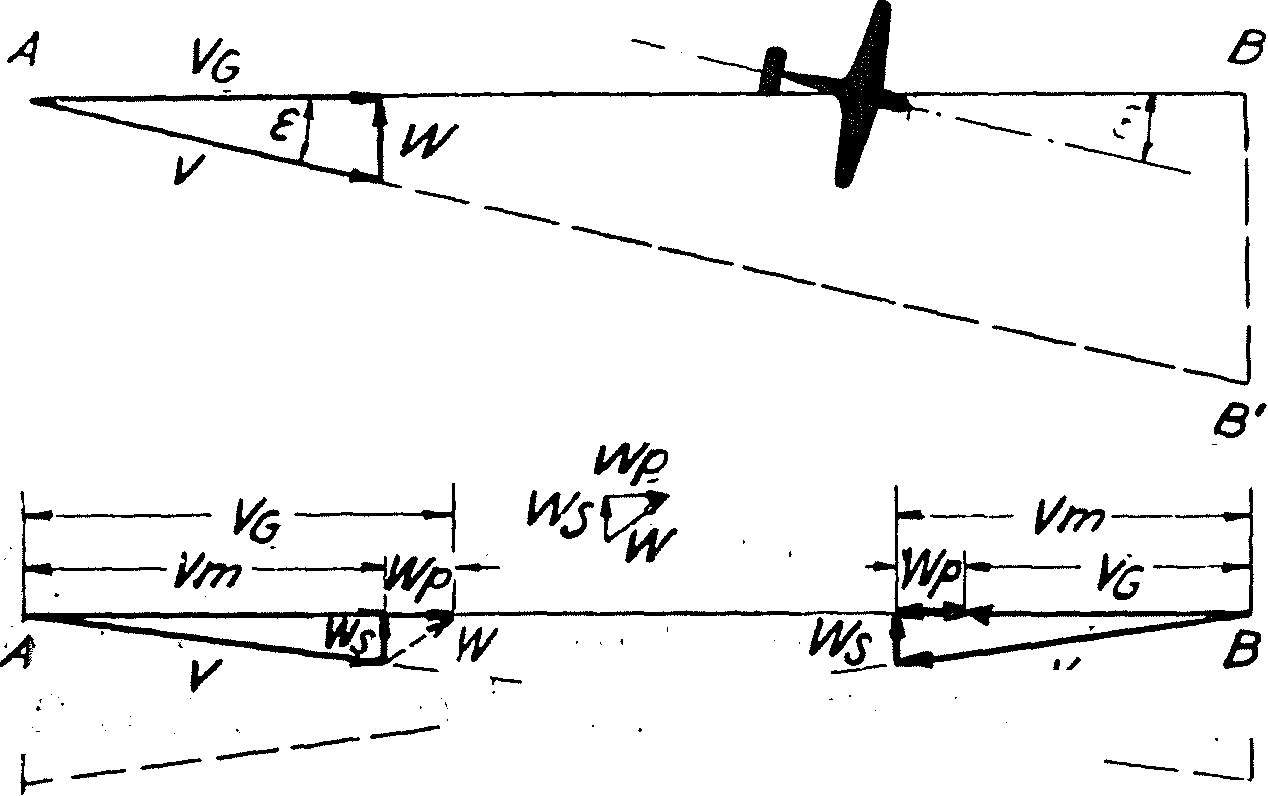
cos <p
Abb. 2 I X-^^"^^^^ J bestimmen.
ni eßst recke (auch Vierecksmeßstrecke genannt), die aus zwei ungefähr senkrecht zueinander stehenden einfachen Meßstrecken besteht, die beide hin und zurück überflogen werden. Wohl die erste Forderung, die man bei einer Geschwindigkeitsmessung an Flugzeugen stellt, ist die Eliminierung der Windgeschwindigkeit. Die drei genannten Meßstrecken sollen nun zunächst hinsichtlich der Erfüllung dieser Forderung untersucht werden.
a) Einfache Meßstrecke.
Bei dieser wird nur die in die Flugrichtung fallende Wind-Komponente herauskorrigiert, jedoch nicht die Seitenwind-Komponente.
Betrachten wir den Einfluß dieser Seitenkomponente zunächst für reinen Seitenwind. In Abb. 1 sind Wind- und Fluggeschwindigkeit ihrer Größe und Richtung nach als Vektoren aufgetragen. Die Fluggeschwindigkeit über Grund (Vq) ist die Resultierende aus wahrer Fluggeschwindigkeit (V) + Windgeschwindigkeit (W). Aus Abb. 1 ergibt sich für die Fluggeschwindigkeit V
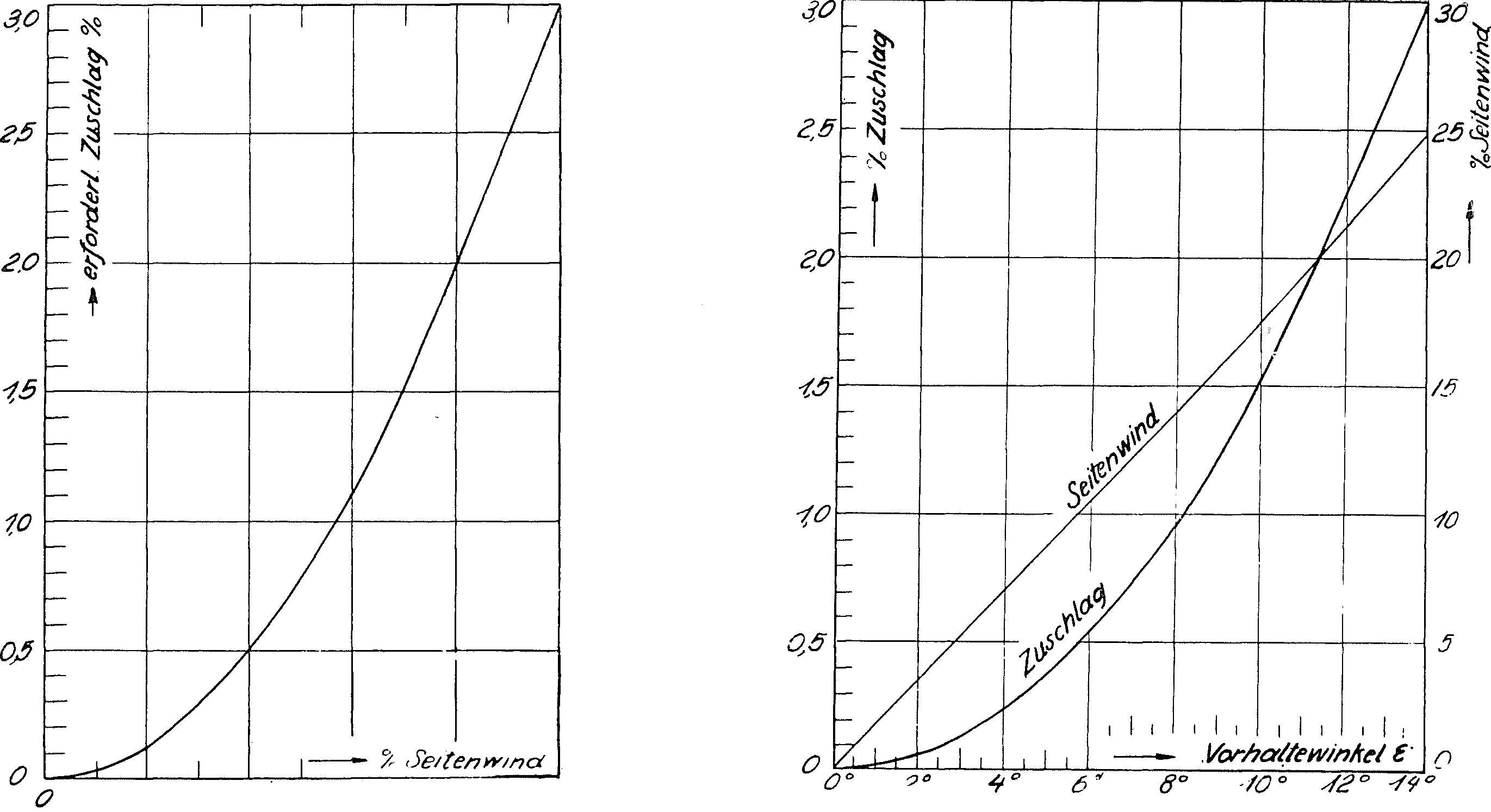
ff 10 15 20 2S "
Abb. 3 Abb. 4
Zur vollständigen Eliminierung des Windeinflusses muß also bei der einfachen Meßstrecke entweder der Vorhaltewinkel oder der Wind nach Stärke und Richtung gemessen werden.
b) Dreiecksmeßstrecke.
Die Auswertung der Messung geschieht hier auf folgende Weise: Zunächst werden aus den gestoppten Zeiten die Geschwindigkeiten über Grund für die drei Teilstrecken bestimmt. Diese werden dann von einem Punkte aus in Richtung der drei Strecken als Vektoren aufgetragen (Abb. 5). Durch die Endpunkte der Vektoren wird ein Kreis gezogen, dessen Radius die windkorrigierte Fluggeschwindigkeit angibt, der Vektor von 0 bis zum Kreismittelpunkt M gibt den während des Meßfluges herrschenden mittleren Wind nach Größe und Richtung an.
c) Doppelmeßstrecke.
Bei der Doppelmeßstrecke, die aus zwei aufeinander senkrecht stehenden Einzelmeßstrecken besteht, werden die Teilgeschwindigkeiten, wie bei der Dreiecksmessung von einem Punkt aus als Vektoren aufgetragen (Abb. 6). Durch die Endpunkte der vier Vektoren ist wieder ein Kreis zu ziehen, dessen Radius die windkorrigierte Fluggeschwindigkeit V angibt.
Da der Kreis nur dann durch die vier Endpunkte der Vektoren geht, wenn genau gestoppt wurde, und der Wind sowie die Flug-
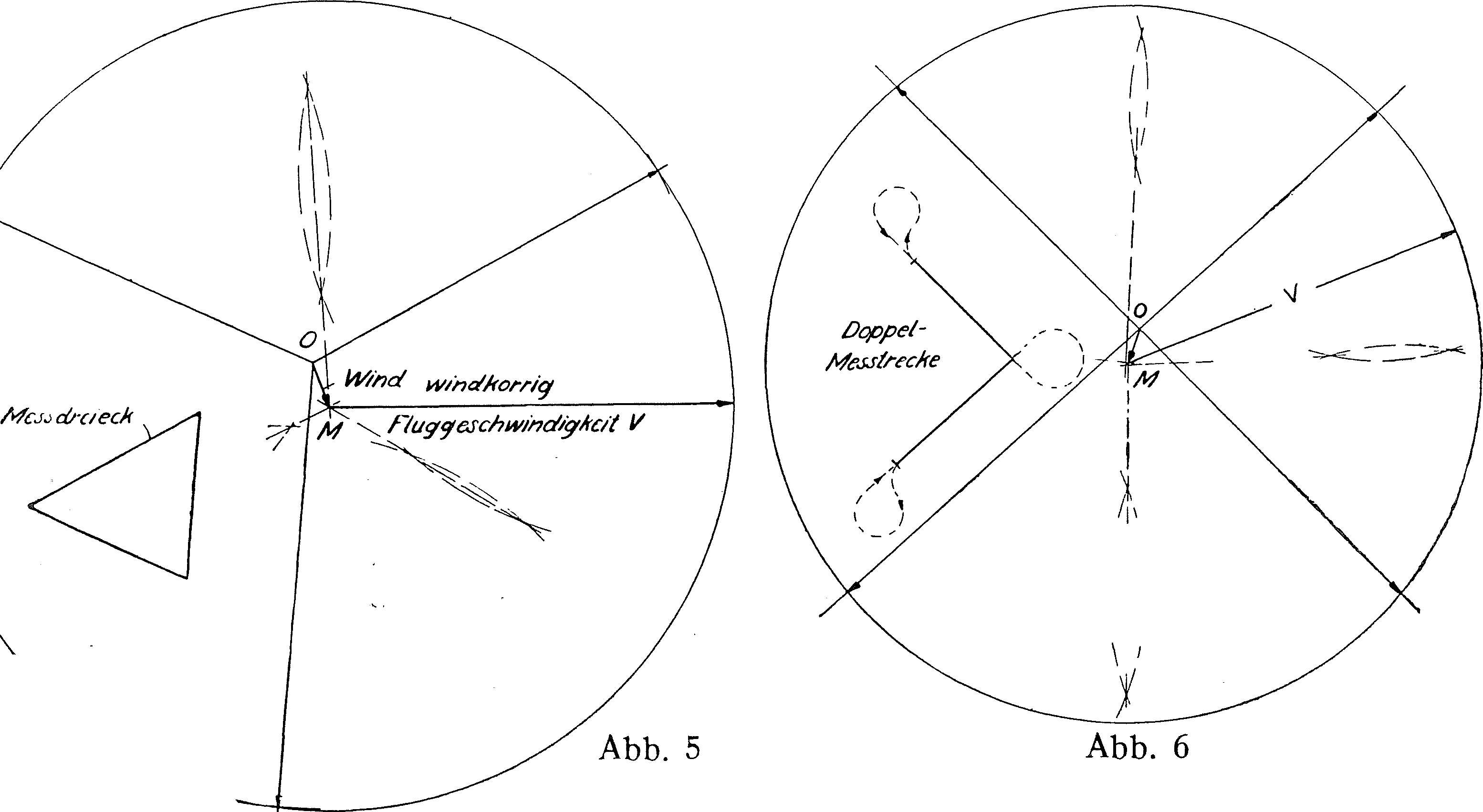
geschwindigkeit V während der Messung unverändert blieb, erhält man bei der Doppelmeßstrecke eine wertvolle Kontrolle der Messung. Das „Fehlerviereck", das entsteht, wenn die vier Lote nicht durch einen Punkt gehen, gibt ein Maß für die Genauigkeit der Messung. Bei der Dreiecksmessung fehlt diese Kontrolle, da durch drei Punkte stets ein Kreis zu ziehen ist.
Noch ein Gesichtspunkt spricht für die Doppelmeßstrecke. Es kommt gelegentlich vor, daß das Stoppen an einem der Meßpunkte mißlingt, z. B. wenn der Pilot zu dicht über dem Meßpunkt fliegt. Bei der Dreiecksmessung ist dann die ganze Messung wertlos, während man bei der Doppelmeßstrecke aus der einen hin- und zurückgestoppten Strecke, die dann als einfache Meßstrecke ausgewertet werden kann, noch meist ein brauchbares Resultat erhält.
Wie oben bereits erwähnt, erhält man bei jeder in beiden Richtungen gestoppten Strecke aus der Flugmessung die in Flugrichtung fallende Komponente des Windes. Da die beiden Strecken der Doppelmeßstrecke etwa senkrecht aufeinanderstellen, stellt die in Flugrichtung fallende Windkomponente der einen Strecke gleichzeitig den Seitenwind für die andere Strecke dar.
Die in Flugrichtung fallende Windkomponente kann deshalb bei der Doppelmeßstrecke viel einfacher und genauer rechnerisch eliminiert werden. Die graphische Auswertung wird nämlich nur zur Eliminierung des Seitenwindes vorgenommen. Bei Kenntnis des Seitenwindes kann die erforderliche Korrektur auch aus Abb. 3 entnommen werden. Da die windkorrigierten Geschwindigkeiten auf beiden Teilmeßstrecken dieselben sein müssen, erhält man auch bei der rechnerischen Auswertung eine Kontrolle und damit einen Anhaltspunkt für die Genauigkeit der Messung.
Die angestellten Betrachtungen zeigen, daß die Doppelmeßstrecke den Vorzug verdient gegenüber der in der Literatur viel häufiger genannten Dreiecksmeßstrecke. Eine 100%ige Ausschaltung des Windeinflusses wird jedoch bei sämtlichen Meßstrecken-Anordnungen nur dann erreicht, wenn keine vertikalen Windströmungen auftreten, und wenn der Wind während des Meßfluges gleichbleibt.
2. Länge der Meßstrecke.
Diese muß der Geschwindigkeit des zu prüfenden Flugzeuges angepaßt sein.
Die wesentlichen Gesichtspunkte für die Bemessung der Meßstrecke sollen kurz erläutert werden. Vorteile einer langen Meßstrecke:
1. Es ist leicht, genau zu stoppen;
2. Einfluß der Visierfehler wird kleiner;
3. Einfluß von Höhenunterschieden beim Ueberfliegen der Zielpunkte wird kleiner.
Vorteile einer kürzeren Meßstrecke:
1. Schonung der Motoren bei Flügen mit Vollgas;
2. Kraftstoff- und Zeitersparnis.
3. Wahl der Meßpunkte,
Man wählt von oben leicht zu erkennende Zielpunkte, wie Türme, Giebel einzeln stehender Häuser u. dgl, die in beiden Flugrichtungen gut zu erkennen sind.
Wie weiter unten näher erläutert, ist es bei manchen Flugzeugtypen vorteilhafter, an Stelle von Zielpunkten Zielebenen senkrecht zur Meßstrecke zu wählen, z. B. eine Hauswand oder eine durch zwei Masten gebildete Ebene. Nach Möglichkeit wird man die Meßstrecken entlang von Straßen oder Eisenbahnlinien führen, um das Kurshalten zu erleichtern.
4. Einfluß vertikaler Windströmungen.
Bei Geschwindigkeitsmessungen muß sorgfältig auf Einhaltung gleicher Flughöhe geachtet werden. Herrscht nun während der Messung beispielsweise Aufwind, so wird aus dem Horizontalflug gewissermaßen ein gedrückter Flug mit entsprechend höherer Geschwindigkeit. Umgekehrt gleicht der Horizontalflug im Abwind einem Steigflug mit verringerter Geschwindigkeit.
Beispiel: Es betrage: Fluggewicht G = 650 kg, Fluggeschwindigkeit V = 200 km/h bei einer Motorenleistung von N = 82 PS und einem Wirkungsgrad der Luftschraube von ^ = 0,73, Aufwind im Mittel w = 0,5 m/s.
Würde man trotz des Aufwindes mit demselben Anstellwinkel weiterfliegen, so würde das Flugzeug 0,5 m/s gehoben werden. Bei einem Flugggewicht von 650 kg entspricht dies einer Leistung von 0,5 X 650 mkg = °^^50 = ^ pg
Bei Horizontalflug kommt dann diese Leistung des Aufwindes zur Motorleistung hinzu. Da die Geschwindigkeit mit der dritten Wurzel der in Schraubenschub umgesetzten Motorleistung zunimmt (soweit CWges unverändert bleibt), erhält man im vorliegenden Fall
■ V, = V, 1/N ' + Alf V N -V
mit Vi = 200 km/h und N ϖ i? = 82 X 0,73 = 60 PS; AN = 4,35 PS wird
3 _
V2 = 200 ϖ \/ 5q = 200 X 1,023 = 204,6 km/h.
Ein Aufwind von 0,5 m/s ergab also im vorliegenden Fall eine Geschwindigkeitssteigerung von 4,6 km/h = 2,3 %. Das Beispiel zeigt, daß Auf- oder Abwinde das Meßergebnis unter Umständen erheblich beeinflussen können.
Ein Aufwind bestimmter Größe wirkt sich nun bei den einzelnen Flugzeugen verschieden aus. Wie obige einfache Berechnung zeigte, wird die Beeinflussung der Geschwindigkeit durch Aufwind bestimmt durch die Leistungsbelastung. Je größer bei der Messung die Motorleistung (genauer gesagt N * rj) im Vergleich zum Fluggewicht ist, desto kleiner wird der Einfluß von vertikalen Windströmungen. Um Meßfehler durch vertikale Windströmungen auszuschalten, wird man das für die Messungen vorgesehene Gelände daraufhin zu prüfen haben, ob nach den Erfahrungen des Segelflugs Thermik oder Hangwind zu erwarten ist.
5. Böigkeit.
Der Einfluß von Vertikalböen auf die Geschwindigkeit läßt sich schwer abschätzen. Soviel steht jedoch fest, daß durch die Aenderun-gen der Anströmrichtung bei böigem Wetter der mittlere Luftwiderstand größer, und damit die Maschine etwas langsamer wird.
Das Visieren.
Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Erde, z. B. beim Stoppen in einem Kraftwagen, braucht man kein Visier, weil man dicht an den Zielpunkten (Kilometersteinen) vorbeikommt, und deshalb auch genügend genau erkennen kann, in welchem Augenblick ein Zielpunkt passiert wurde. Im Flugzeug dagegen befindet man sich im Augenblick des Stoppens in wesentlich größerer Entfernung vom Zielpunkt, so daß ein genaues Anvisieren des Zielpunktes erforderlich wird. Da man ferner meist keine Sicht senkrecht nach unten, sondern nur schräg
nach unten hat, wird jeweils eine bestimmte Strecke vor dem Ueber-fliqgen des Zielpunktes gestoppt. Außerdem fliegt man je nach den Sichtverhältnissen mehr oder weniger seitlich an den Zielpunkten vorbei.
Bei Tiefdeckern wird häufig die Vorderkante der Fläche als Visier verwendet. Der (seitlich zu überfliegende) Zielpunkt rückt immer näher heran, bis er schließlich unter der Fläche verschwindet. In diesem Augenblick wird dann gestoppt.
Um Fehler durch ungleiches Anvisieren zu vermeiden, muß der Beobachter beim Stoppen jeweils genau dieselbe Lage einnehmen.
Wie aus Abb. 7 ersichtlich ist, werden solche Visierfehler um so kleiner, je geringer die Flughöhe gewählt werden kann. Der Vollständigkeit halber sei auch bemerkt, daß die Maschine beim Stoppen keine Querneigung besitzen darf, weil hierdurch ähnliche Visierfehler entstehen. Zu beachten ist ferner, daß auch der seitliche Abstand des Flugzeuges von den Zielpunkten an beiden Zielpunkten etwa gleich groß ist.
Wo keine Flugzeugteile als Visier verwendet werden können, muß eine besondere Visiervorrichtung angebracht werden. Mit der Visiervorrichtung legt man am besten eine Ebene fest, deren Schnitt mit der Horizontalebene senkrecht zur Flugrichtung verläuft.
Diese Visiervorrichtung wird man zweckmäßig so bauen, daß die Zielpunkte vor und möglichst auch noch eine kurze Zeit nach dem Passieren der Visierebene beobachtet werden können.
Außer der geschilderten Methode des Anvisierens von Zielpunkten kann bei einigen Flugzeugtypen, z. B. beim Hochdecker, mit Vorteil ein anderes Verfahren angewendet werden.
Während bei der ersten Methode die Visierebene durch Teile des Flugzeugs gebildet, also vom Flugzeug mitgeführt wird und die Bewegungen des Flugzeugs mitmacht, werden bei der zweiten Methode an Stelle der Zielpunkte ortsfeste Zielebenen verwendet, die senkrecht zur Meßstrecke verlaufen. Gestoppt wird hier beim Durchgang des Flugzeugs durch die Zielebenen. Visierfehler durch Bewegungen des Beobachters oder durch Neigungen des Flugzeugs können bei dieser Methode nicht entstehen.
Zusammenfassung.
Die Untersuchung zeigte, daß die Doppelmeßstrecke für genaue Messungen den Vorzug verdient. Erstens wegen der sich ergebenden Kontrolle, dann, weil man aus der Flugmessung für jede Teilstrecke sowohl die in Flugrichtung fallende als auch die Seitenkomponente des Windes erhält und damit in der Lage ist, die Auswertung des
Meßfluges rein rechnerisch vorzunehmen.
Weiter ergab sich, daß nur ein gleichbleibender und horizontal verlaufender Wind bei der Messung eliminiert wird.
Um etwaige Meßfehler durch Aufoder Abwind zu vermeiden, wählt man für die Meßstrecke ein Gebiet ohne Hangwind und mit geringen Thermikeinflüssen. Auch wird man die Messungen möglichst bei ruhigem Wetter und bei Sonnenschein nicht gerade in den Mittagsstunden, der Zeit großer Thermik und Böigkeit ausführen.
■Abb. 7
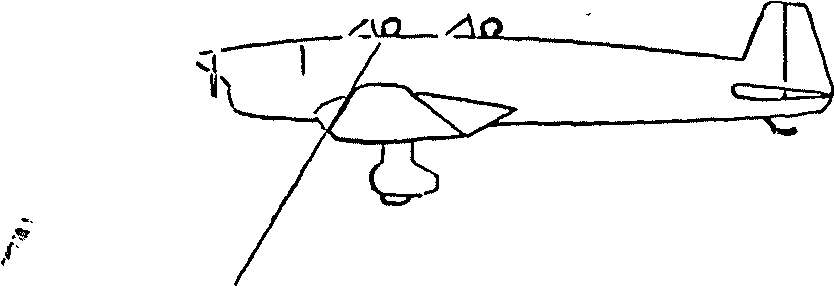
Wright-Cyclone-Motoren-Versuchsfeld.
Die Curtiss Wright Corporation hat ein umfangreiches Motorenprüffeld gebaut, in dem Motoren bis zu 3000 PS, deren Bau in Aussicht genommen ist, geprüft werden können. Zur Zeit laufen 1100-PS-Mo-toren, die vor ihrer Ablieferung alle einen lOstündigen Lauf gemacht haben müssen.
Das ganze Prüffeld umfaßt 14 Stände, wovon vier in Betrieb sind. Zur Zeit ist der 1500-PS-Cyclone im Bau, welcher für die großen Boeing-Flugzeuge, den Curtiss-Wright CW 20 und das neue Martin-Patrouillenboot verwendet werden soll.
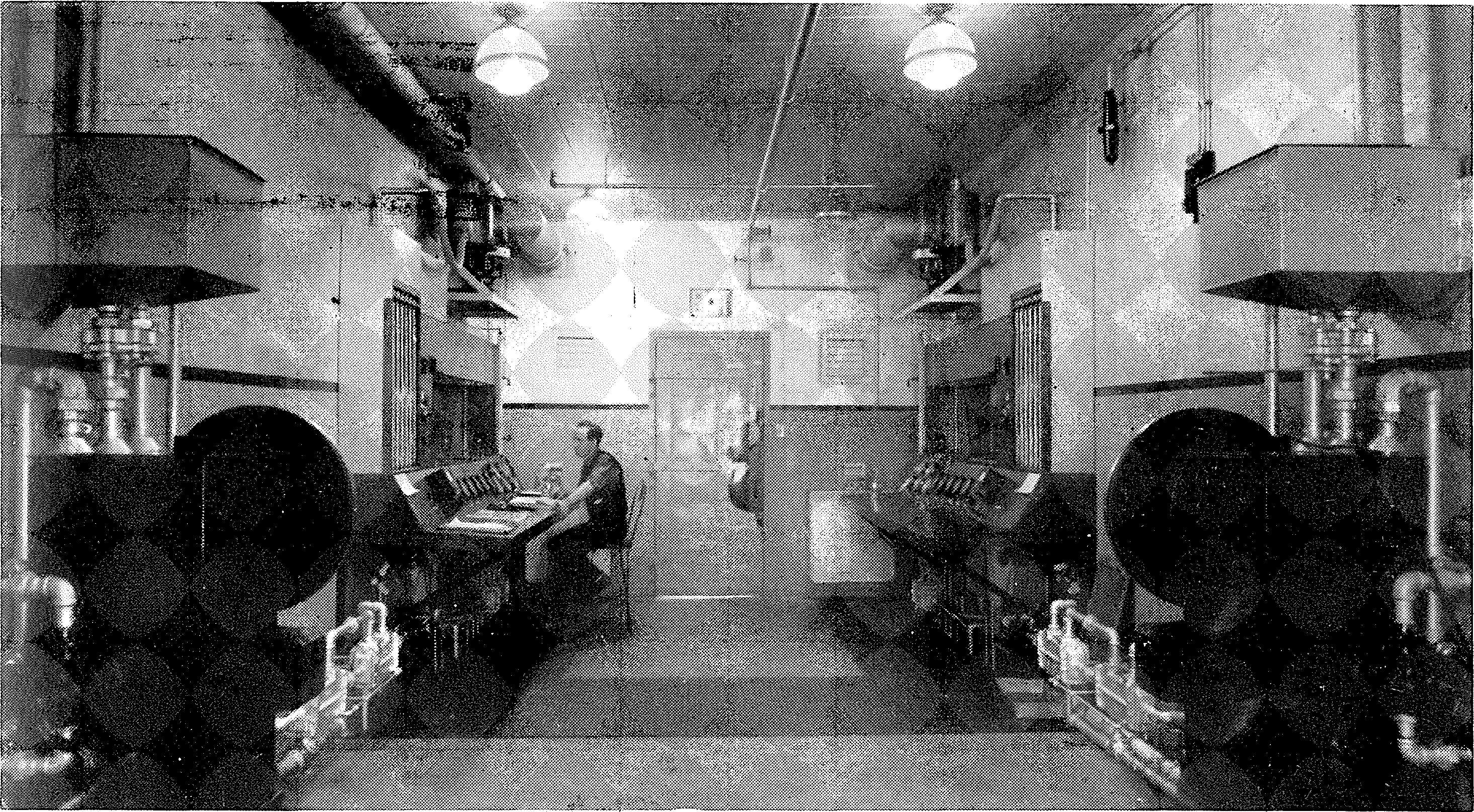
Beobachtungsrauin der Curtiss-Wright Moto renprüf stände.
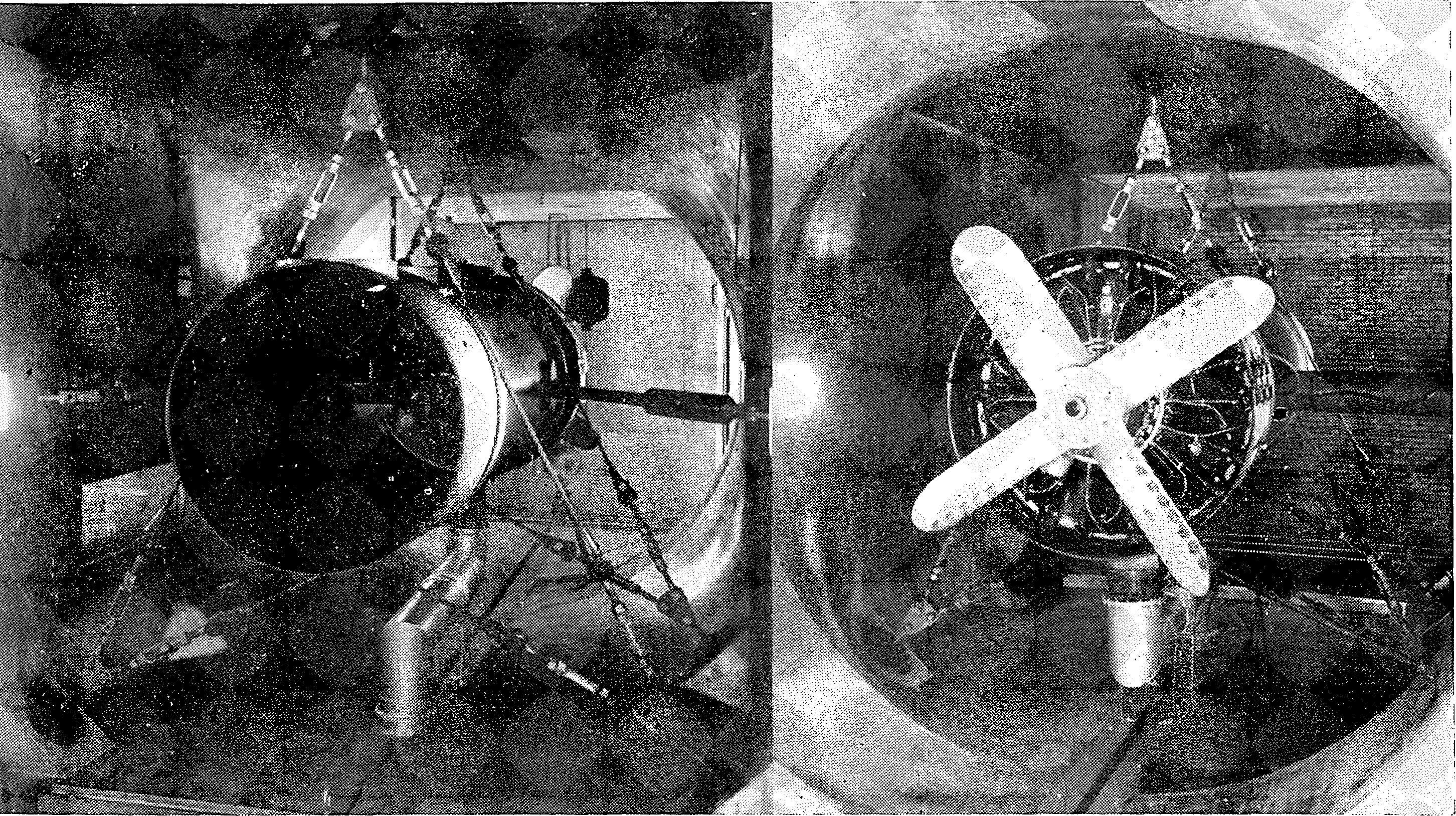
Curtiss-Wright Motorenprüfstände. Ansicht von vorn und von hinten.
Für ein besonderes Laboratorium zur Entwicklung der 3000-PS-Motoren sind im vergangenen Jahr 250 000 Dollar ausgegeben worden. Die Prüfstände besitzen eine besondere Einrichtung, damit die Vergaser der Motoren unter den gleichen Bedingungen laufen wie ein Flugzeug mit 320 km/h Geschwindigkeit. Im umgekehrten Sinn kann auch die Luft verdünnt werden, um die gleichen Verhältnisse zu schaffen, wie sie in größeren Höhen auftreten. Ebenso kann der Luftstrom geheizt werden, um den Motor bei allen Temperaturen laufen zu lassen. Der Beobachtungsraum befindet sich seitlich vom Versuchsstand. Vergleiche die Abbildung. Ueber dem Instrumentenbrett befindet sich das Beobachtungsfenster für den Motorenraum.
Bremsstand, sowie Beobachtungsraum sind gut abgedämpft, so daß die Motoren 24 Stunden, ohne das Bedienungspersonal zur belästigen, laufen können.
Die Motoren sind in dem runden Prüfstandtunnel mittels Stahlkabel im Dreiecksverband aufgehängt. Vergleiche die Abbildung.
Vor und hinter den Prüfständen befinden sich senkrechte, 9 m hohe, Luftschächte und über dem Motor eine Laufkatzenschiene, um die Motoren bequem an- und abtransportieren zu können.
PLUG UflDSCHÄl
Inland.
Generalfeldmarschall Göring an die Luftwaffe.
Kameraden der Luftwaffe! Die Wiedervereinigung Oesterreichs mit dem Reich und die Befreiung unserer sudetendeutschen Brüder sind geschichtliche Ereignisse, die das Jahr 1938 zu einem entscheidenden Jahr der deutschen Geschichte gemacht haben. Durch

Blindflugschule Brandes bei Machern. Links: Uebung am „Linkstrainer". Der Flugschüler sitzt hier in einem Flugzeugmodell, dessen Führersitz vollkommen verschlossen werden kann und der alle Apparate eines richtigen Flugzeuges enthält. Die Befehle werden dem Piloten, wie in der Wirklichkeit, auf drahtlosem Wege übermittelt, während der Ausbildungsoffizier an den Bewegungen des Modells genau feststellen kann, ob der Flugschüler den richtigen Kurs steuert.
Rechts: Uebung am Peilgerät. Weltbild
die geniale Lenkung und die einmalige Tatkraft unseres Führers ist der Traum der Deutschen Tat geworden: Großdeutschland!
Auch die Luftwaffe hat ihr gerüttelt Maß an den Erfolgen dieses Jahres. Voll ruhiger Entschlossenheit und unerschütterlicher Siegesgewißheit stand die Luftwaffe bereit, für Führer und Reich den höchsten Einsatz zu wagen. Ich weiß, daß jeder einzelne von euch, Offizier wie Mann, Flieger, Fallschirmjäger, Kanonier und Funker, seine äußerste Pflicht getan hat. Euch allen hierfür zu danken, ist mir ein stolzes Bedürfnis. Die Leistungen des vergangenen Jahres sollen uns Ansporn sein für das kommende. Wir werden alle Anforderungen mit letzter Mingabe erfüllen in treuer Gefolgschaft unseres Führers und Obersten Befehlshabers und im Glauben an die Größe unseres ewigen Deutschland.
Her mann Göring, Generalfeldmarschall Veranstaltungen 1939. 8.—10. 4. Reichswettschießen des NS.-Fliegerkorps, Bad Kissingen. 18.—21. 5. Rundflug des NS.-Fliegerkorps durch den Sudetengau. Durchführung:
NSFK.-Gruppe 6 (Schlesien). 26.—29. 5. Reichswettbewerb für Segelflugmodelle auf der Wasserkuppe. IL—18. 6. Deutschlandflug 1939.
18. 6.—2. 7. 3. Zielflug-Wettbewerb des Korpsführers des NS.-Fliegerkorps.
25. 6.—9. 7. Nation. Segelflug - Wettbewerb für doppelsitzige Segelflugzeuge, Hannover. Durchführung: NSFK.-Gruppe 9 (Weser-Elbe).
30. 6.—2. 7. Reichswettkämpfe des NS.-Fliegerkorps, Kassel.
14.—16. 7. Zuverlässigkeitsflug. Durchf.: NSFK.-Gr. 1, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15. (Startber. nur Flugzeugbes., die bis zum 14. 7. 39 an keinem flieg. Wettbewerb teilgenommen haben.)
23. 7.-6. 8. Rhön-Segelflug-Wettbewerb 1939 (20. Rhön). Veranstalter: Korpsführer d. NSFK.
27.—30. 7. Deutsche Meisterschaft im Geschicklichkeitsflug 1939, Frankfurt a. M. Veranstalter: Korpsführer d. NSFK.
29. —30. 7. 2. Intern. Luftrennen d. NS.-Fliegerkorps, Frankfurt a. M. Veranstalter: Korpsführer d. NSFK.
12.—14. 8. 3. Deutscher Küstenflug 1939, Borkum. Durchführung: Küstenflug-leitung.
25.—28. 8. Reichswettbewerb für Motorflugmodelle, Borkenberge.
16.—17. 9. Alpen-Querflug, Graz. Durchführung: NSFK.-Gr. 14 (Bayern-Süd).
28.—29. 10. Reichswettbewerb für Saalflugmodelle.
Verwaltung des NSFK. Zum Amtschef hat der Korpsführer Generalleutnant Christiansen ab 1. 1. 39 Verwaltungs-Oberführer Wilhelm Schröder ernannt.
Fürst Ulrich Ferdinand Kinsky f ist während einer rennsportlichen Sitzung in Wien plötzlich an einem Schlaganfall gestorben. Fürst Kinsky, 45 Jahre alt, war früher im österr. Sportflugwesen tätig.

Generaloberst Milch weiht Gedenkstein für die alten Flugpioniere v. Schröder und Albrecht, Wustrau bei Neuruppin. v. Schröder war der Organisator der ersten Ueberseeflüge der Lufthansa und stürzte mit seinem Begleiter Albrecht auf seinem ersten Teneriffaflug 19. 12. 1929 ab. Wettbild
Deutsche Luithansa übernahm am 1. Jan. in vollem Umfange die Durchführung des bisherigen Flugdienstes der Oesterreichischen Luftverkehrs-Aktiengesellschaft, die am 31. Dez. ihren Betrieb einstellte. Damit ist die Deutsche Lufthansa, deren innerdeutsche Aufgaben durch die Eingliederung der Ostmark und des Sudetengaues stark gewachsen sind, die alleinige Trägerin des Luftverkehrs in Großdeutschland.
Im Hinblick auf die wirtschaftliche und verkehrsmäßige Bedeutung der Hauptstadt der deutschen Ostmark richtet die Lufthansa eine Bezirksleitung Südost mit dem Sitz in Wien ein, die neben der Leitung des Flugdienstes der bisherigen Oesterr. Luftverkehrs-Aktienges., deren gesamte Gefolgschaft in den Dienst der Deutschen Lufthansa übertritt, auch die Aufgaben der früheren Streckenleitung Südost übernimmt.
Nordafrika—Britisch-Indren, Ohnehaltflug, 6400 km, auf Arado Ar 79 vollbrachten Oüerltn. Pulkowsky und Ltn. Jenett von der Luftwaffe am 29. 12. 38. Mit diesem Flug der Arado über 6000 km wurde der im Ausland befindliche Leichtflugzeugrekord, Stand zur Zeit 41^5 km, um die Hälfte überboten. Obltn. Horst Pulkowsky und Ltn. Rudolf Jenett sind mit einem zweisitzigen Kabinen-Reiseflugzeug „Arado 79**, das mit einem 105-PS-Hirth-Motor ausgerüstet ist, unterwegs auf einem Langstreckenflug nach Australien. Sie starteten auf dem Werftflughafen der Arado-Werke in Brandenburg, überflogen nach kurzer Zwischenlandung in München die Alpen und machten Halt im Flughafen Bozen. Der zweite Tag führte sie von Bozen nach Brindisi an der Südküste Italiens, am dritten bewältigten sie bei schlechtem Wetter die 1100 km von Brindisi nach Bengasi in Nordafrika. Dabei mußte in einem Seeflug über 1000 km das Mittelmeer an seiner breitesten Stelle überflogen werden, und das nur in fünf m Höhe über der Wasseroberfläche, da Nebel und Wolken jede Sicht nahmen. Ohne Funkgerät fand das deutsche Reiseflugzeug seinen Weg, während ein viermotoriges Verkehrsflugzeug der Afrika-Linie auf dem gleichen Flugweg seinen Flug unterbrechen mußte. — Nach einigen Ruhetagen in Bengasi starteten Pulkowsky und Jenett am 29. 12. 38 nachm. zu ihrer nächsten Etappe. Ohne jeden Zwischenfall kam die schwerbeladene Maschine hoch, und nun ging es im Ohnehaltflug bis Gaja in Britisch-Indien, wo die beiden Flieger nach Zurücklegung einer Strecke von 6400 km — die der Flugstrecke Berlin—New York entspricht! — am 31. 12. morg. landeten. Gegenwinde und Sandstürme erschwerten den Flug über zum Teil unbewohnten Gegenden, zwei Nächte hindurch ging es ohne Orientierungsmöglichkeit weiter, und dabei mußten noch die 4000 m hohen Ausläufer des Himalaia-Gebirges übercuert werden! Dabei verbrauchte die „Arado" je 100 km

Eisnotdienst der Lufthansa. Die Nord- und Ostfriesischen durch Eis blockierten ii-? -Inseln.*.sawie^izayr.eich.e;ci|n ϖ iEi§;^ei|i§f4r©rene-und...:festgehaltene Schiffe wurden durch besonders eingesetzte Flugzeuge der Lüfthansa mit den notwendigsten Lebensmitteln versorgt. Die Abb. zeigt den Start der Flugzeuge nach den in
Eisnot befindlichen Schiffen. Weitbild
nur 9 1 Brennstoff, also nicht mehr als ein kleiner Kraftwagen, eine Tatsache, die die Leistungsfähigkeit des deutschen Leichtflugzeugbaues ins Licht stellt.
Was gibt es sonst Neues?
Fliegerhandwerker-Wettbewerb des NSFK. 1939 findet 4.—12. Nov. auf dem Festhallengelände Frankfurt a. M. statt.
ISTUS-Tagung 1939, 14. 5.—20. 5. Warschau und Kattowitz. Croydon Lufthaien soll vergrößert werden.
Dr. Heinrich Hertel, Direktor der Ernst Heinkel-Flugzeugwerke, Rostock, welcher zur Zeit an der Universität Rostock über Flugtechnik liest, wurde der Titel Honorarprofessor verliehen.
Maj. Gotthardt Handrick, deutscher Olympiasieger im Modernen Fünfkampf 1936, hat sich in Berlin-Dahlem mit der Gräfin Karin Fischler von Treuberg, einer Nichte des Generalfeldmarschalls Göring, vermählt.
Ausland.
Imperial Airways hat 400 t Weihnachtspost befördert.
Imperial Airways stellt ein zweites schwimmendes Hotel in Dienst in Mo-zambique auf der Afrika-Linie. Zu diesem Zweck wird der ,,Richard King" umgebaut. Das andere dieser schwimmenden Hotels ist der ,,Mayflower" am Nil in der Nähe von Kairo.
Engl. Luftverkehr Südafrika—Australien soll unter Benutzung des Südpolarkreises verkürzt werden. Der bisherige Luftumweg über Südafrika—Kairo und dann durch Indien über Singapur wird vermieden. Die Linienlänge beträgt demnach nur noch 10 000 km gegenüber früher 25 000 km.
250 £ Sicherheitspreis (trophy of safety in the air), gestiftet von den Bürgern von Auckland in Neuseeland, für die beste Arbeit auf diesem Gebiet. Diese Trophäe wird jährlich im Januar zuerkannt an Einzelpersonen, Gruppen oder Körperschaften von dem Institut der aeronautischen Wissenschaften in USA. und der Royal Aeronautical Society of England. Er ist gestiftet zur Erinnerung an die bei den Auckland-Inseln umgekommene amerikanische Besatzung unter Capt. Edwin Musick. bei dem ersten Flug von USA. nach Neuseeland.
Franz. Luftfahrtministerium hat in USA. hundert „Curtiss P-36" Jagdeinsitzer mit Pratt & Whitney „Twin Wasp" Motoren bestellt. Laut Vertrag muß die Lieferung bis zum April dieses Jahres erfolgt sein, der erste Teil soll bereits am 15. Januar geliefert werden. Die für Frankreich bestimmte Serie des P-36 wird mit 75-Al bezeichnet; bei den Flugversuchen, die Capitaine Viguier vom C E. M. A. in Buffalo durchgeführt hat, erreichte die Maschine 475 km/h Dauerleistung und maximal 491 km/h.
Franz. Flugzeugkonstrukteure, Rene Caudron und Robert Moräne, wurden zu Kommandeuren der Legion d'Honneur ernannt.

Savoia Marchetti Geschwindigkeitsrekord über 2000 km mit 2000 kg Bombenlast. Die Mannschaft mit der mitgeführten Bombenlast nach dem Fluge. In der Mitte Flugzeugführer Colonnelle Angelo Tondi. Archiv fiuksdoh
Ala Littoria, italienische Luftfahrtgeseilschaft, hat auf der Linie Triest— Haifa ein „Macchi Castoldi 94"-Flugboot in Dienst gestellt.
Rom—Rio de Janeiro—Buenos Aires soll in Kürze von der Ala Littoria eröffnet werden. Gesamtreisedauer 2 Tage mit ,,Savoia Marchetti" für 24 Fluggäste und „Macci" für 18 Fluggäste. Die argentinische Luftfahrgesellschaft „Cor-poraciön Argentina" stellt die Verbindung mit Rosario und Montevideo her.
Poln. Luftverkehrsgesellschaft hat bei der Lockheed Aircraft Corporation, Kalifornien 4 Lockheed 14 Verkehrsmaschinen im Werte von 32 000 $ in Auftrag gegeben.
Koscharsch f, Einflieger bei einer tschechischen Flugzeugfabrik, ist bei einem Vorführungsflug abgestürzt.
Schweizer Flugzeugwerke sollen in der Mähe von Stans neben dem großen Militärflugplatz im Halbkanton Nidwaiden errichtet werden. Die Flugzeughallen sollen auf Geleisen gebaut und in das Innere des Bürgenberges, welcher ausgesprengt werden soll, geschoben werden. Hoffentlich friert die Sache im Winter nicht ein.
Tschkalow t, Sowjetflieger, bekannter Fluglehrer, ist beim Einfliegen eines neuen Typs verunglückt. Tschkalow war Inhaber des Lenin-Ordens und erhielt für seinen Langstreckenflug Moskau—Kamtschatka-Tschita den Ehrentitel „Held der Sowjet-Union". Eine weitere Leistung war der Ohnehaltflug Moskau—Nordpol—Amerika 1937.
Curtiss P-36 mit Pratt & Whitney „Twin Wasp" flog am 27. Okt. von Dayton nach Buffalo in 61 min; Entfernung 579 km. Der Pilot Ltn. Kelsey gibt an, daß er 96 km/h Rückenwind hatte.
Lockheed Aircraft Corporation, gibt bekannt, daß sie noch unerledigte Aufträge im Werte von 29 900 000 $ besitzt.
Japan. Luftverkehrsges. Dai Nippon Aviation Co. ist in Tokio am 28. 11. 38 gegründet worden. Der Betrieb wurde am 1. 12. 38 eröffnet.
Mandschurische Flugzeugfirma Manchuria Aeroplane Mfg. Co. hat Vice-Pres. Maehara nach Deutschland entsandt, um gemäß des deutsch-italienischjapanischen Abkommens Finanzierungsverträge für Serienflugzeugbau abzuschließen.
Japan. Luftstreitkräfte werden z. Zt. zur Abwehr von Sowjetflugangrifferi an den mandschukisch-sowjet. Grenzen verstärkt.
Japan. Luftverkehrslinien in Mandschukuo seit sieben Jahren auf 13 Strecken (8470 km) ausgebaut. Diese sind:
1. Dairen—Siuyen—Antung—Kuangtien—Tsian—Tuneua—Huanjin — Mukden, 825 km. 2. Mukden—Chinchow—Chengte—Chihfeng—Linsi—Linhtang—Kailu— Tungliao—Hsinking, 1445 km. 3. Hsinking—Yenchi—Hunchun—Seishin, 600 km. 4. Dairea—Mukden—Hsinking—Harbin, 865 km. 5. Hsinking—Mutankiang—Harbin, 630 km. 6. Harbin—Tsitsihar—Hairaerh—Manchuri, 850 km. 7. Harbin—Peian— Sunwu—Heiho—Nonni—Tsitsihar, 1110 km. 8. Harbin—Tungho—Ilan—Chiamussu, 315 km. 9. Chiamussu—Pactsing—Fuchin—Chiamussu, 400 km. 10. Fuchin— Luopei—Holichen—Chiamussu—Tangtuan, 270 km. 11. Mutangkiang—Muling—
Flughafen Karachi (Indien) eingeweiht. Abb. zeigt das Verwaltungsgebäude.
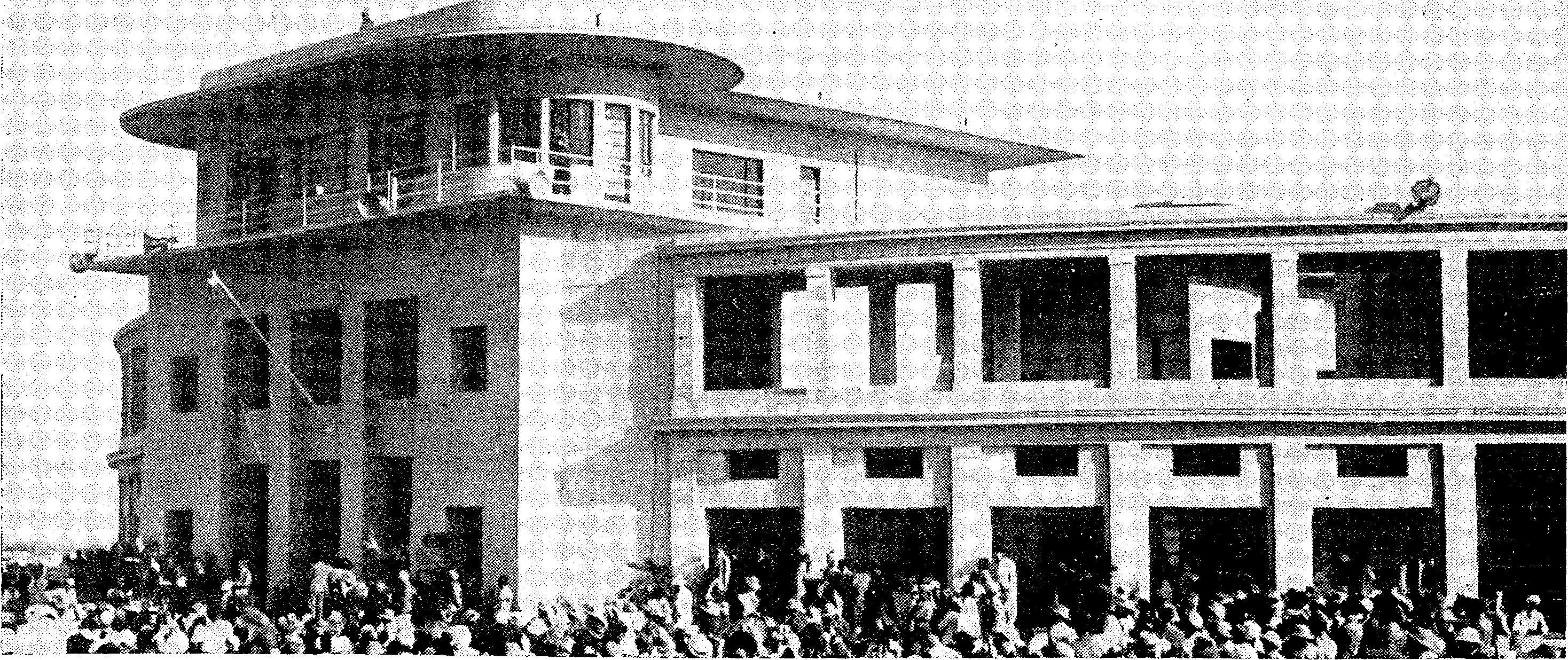
Weltbild

Die .,Condor"-Besatzung besuchte nach ihrem Flug nach Tokio das japanische Nationalheiligtum, den Meiji-Schrein. Weltbild
Suifenho—Tungning, 175 km. 12. Mutankiang—Pamientung—Pantsaiho—Mishan— Hulin—Jacho— Tungchiang, 675 km. 13. Harbin—Chiamussu, 310 km.
Das ausgedehnte Eisenbahnnetz wird von den Bahngesellschaften, besonders im Süden Mandschukuos, mit hierfür beschafften Flugzeugen überwacht. Man-dschukuo besitzt zwei Flugzeugfabriken, die Manchuria Aviation Co. und die Manchuria Aeroplane Manufacturing Co. Ltd., beide in Mukden. Die erste Firma baut den „Hayabusa"-Typ, Verkehrstiefdecker für 6 Fluggäste, mit Makajima-
Kotobuki-Motoren von 460 PS.
Motor- und
Segelflugschulen befinden sich in den Städten Dai-ren, Mukden, Hsin-king, Harbin, Fu-shun, Kirin, Tsit-sihar. Als Schul-
und Schleppmaschinen werden von Deutschland
eingeführte Bücker - Flugzeuge verwendet.
Luftverkehr in Mandschukuo.
Japan. „Hayabusa"-Verkehrsflugzeug. Unten: Flughafen
von Mukden. Man beachte den Motorandrehwagen
Archiv FluRSüort

Segelflug
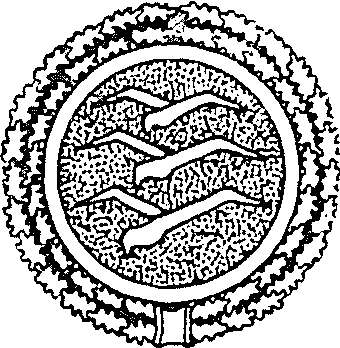
Drechsel hat bei seinem Flug am 5. 8. 38 in der Rhön, wobei er 6687 m ü. M. erreichte, kein Sauerstoffgerät mitgehabt.
Segelflugzeugvorführungen Ruc bei Versailles, dem alten Flugplatz von Bleilot, anläßlich des Pariser Salons, wurden von ausländischen Segelflugkameraden stark beachtet. Die französischen Kameraden, darunter auch Madame Jarlaud, machten viele Flüge, allein 20 auf der „Minimoa". Auch Abrial, einer der ältesten Rhönbesucher aus Frankreich, von der Groupe-L'Air flog sämtliche Maschinen. Außer der „Minimoa" waren noch ein „Kranich", eine „Weihe", ein „Grunau-Baby" und ein „Habicht" da. Geschleppt wurde von Barabas mit Heinkel „Kadett", von Abrial mit 130 PS Morane-Eindecker und von Wolf Hirth mit KL 25.
Segelflug in Mandchukuo hat sich im letzten Jahre beachtenswert entwickelt. Im November waren 55 Segelflugzeuge im Betrieb. 1939 werden wieder zwei Segelflug-Wettbewerbe stattfinden.
Brünner Segelflug-Verband hat unter schwierigsten Verhältnissen auch im Jahre 1938 versucht, seinen Segelschulbetrieb aufrecht zu erhalten. Mit 1321 Starts wurden im ganzen 5 Std. 55 min geflogen. Diese Flüge wurden durchweg auf Gleiter „Zögling" auf dem Schulungsgelände Tschebin durchgeführt (wo Hoff mann gelandet ist — Flug von Trebbin). Der längste Flug war 15 min 30 sec und dieser auf „Zögling". Prüfungen wurden 13 „A", 12 „B", keine „C" abgelegt, da leider kein Leistungsgelände in der Nähe ist. Nur die letztgenannte Prüfung wird in Rannei in Böhmen oder in Sillein in der Slowakei gemacht. Flugzeuge sind: 3 „Zöglinge", 1 „Skaut" 37 mit Gondel, 1 „Grünau Baby" II, 1 „Grauer Wolf", Zweisitzer. Im Frühahr 1938 mußte der Flugzeugschlepp wegen Nichtzulassung der Schleppmaschine eingestellt werden.
Die Segelflugkameraden in Brünn haben es wirklich nicht leicht gehabt. Bisher hatte man in den offizellen Stellen in Prag nichts für den Segelflug übrig. Die Mittel mußten sie sich selbst Krone um Krone zusammenschnorren. Auch das Verhältnis zwischen Motor- und Segelflieger ist nicht das, wie wir es in Deutschland gewöhnt sind. Dort wird der Segelflieger vom Motorflieger über die Achsel angesehen. Aber jetzt nach der Umstellung wird wohl hoffentlich bald vieles anders werden, so daß die Segelflugschulung großen Auftrieb erhält.
Scheurers segelflugbegeisterte Frau, Irvington (USA), ist mit einem Gleiter am 13. Dezember tödlich abgestürzt. Was die beiden lieben Kameraden für das
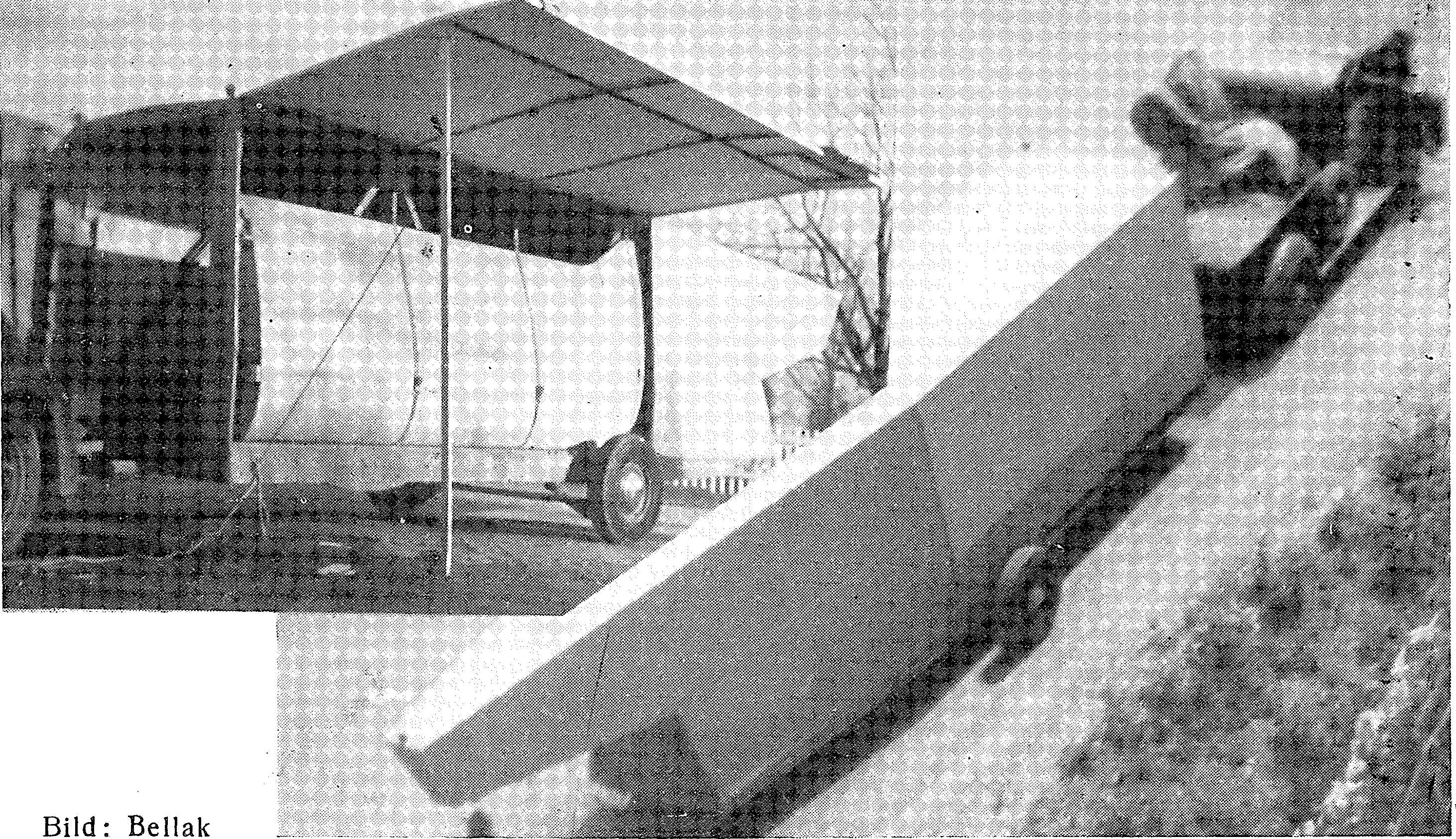
Bellak Minimoa-Transportwagen.
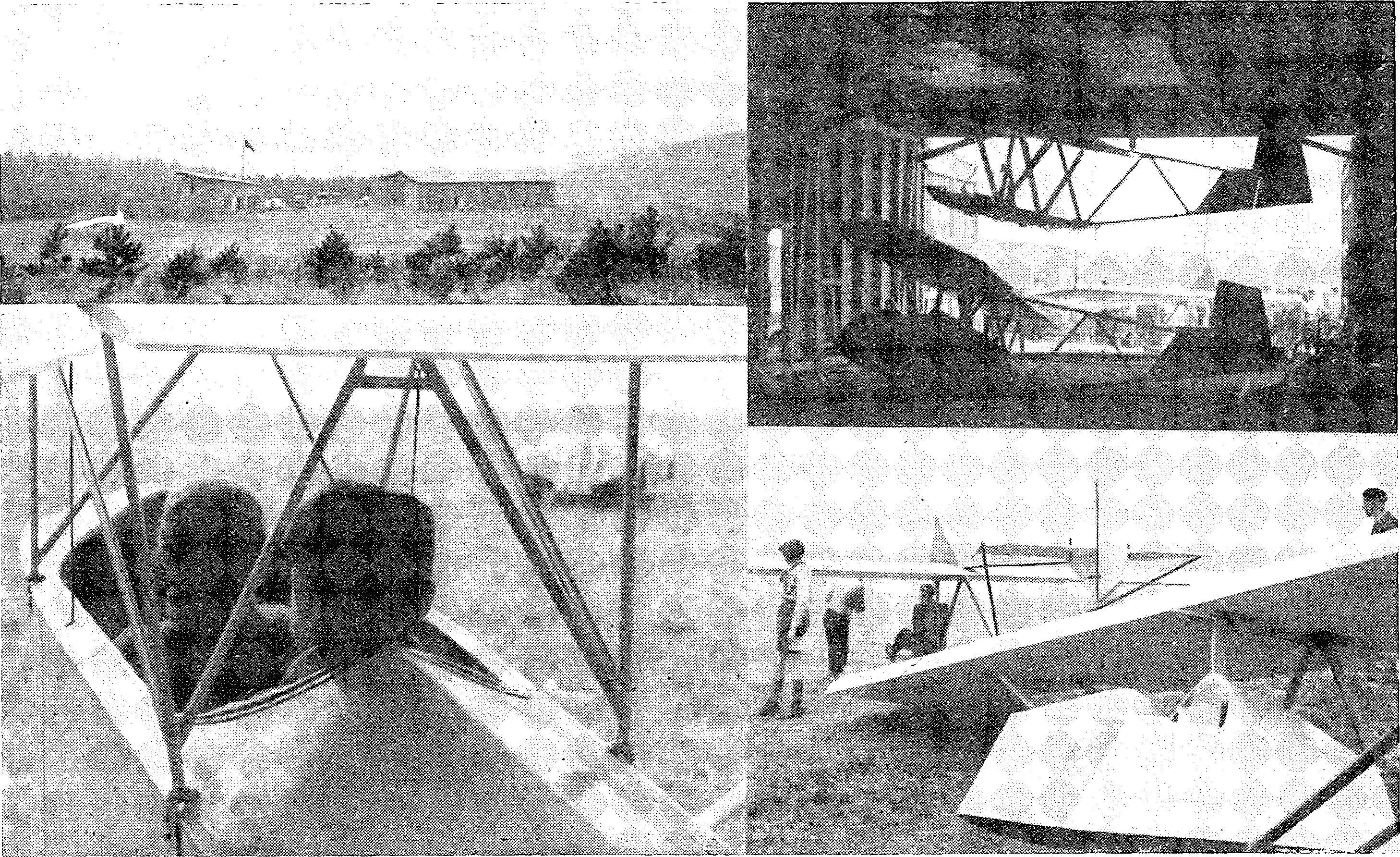
Vom Brünner Segelflug-Verband. Oben links Segelfluggelände Tschebin, rechts Blick aus der Halle. Unten links „Grauer Wolf", rechts „Zögling" u. „Skaut" 37.
Bilder: Raschovsky
Deutschtum im Ausland und die Segelfliegerei geleistet haben, können wir nicht hoch genug schätzen. Es wird weiter geflogen!
Minimoa-Startwagen hat Bellak, Newark, USA. gebaut. 10,5 m lang, 2,1 m breit und 2,7 m hoch. Leergewicht 540 kg, belastet 800 kg. Bei der Konstruktion wurde Wert gelegt auf schnelle Unterbindung, Fahrtsicherheit bei größeren Geschwindigkeiten, kurzer Bremsweg.
Bauweise Holz, Dach und Fußboden Sperrholz. Die vorderen Seitenwände in Stahlrohrrahmen, Leinwand bedeckt, nach oben hochklappbar. Flügel am Hauptrahmenwerk aufgehängt. Dazwischen der Rumpf. Bremsen elektrisch vom Führersitz aus zu betätigen, Batterie im Schleppwagen. Fahrgeschwindigkeit max. SO km, Bremsweg 30 m. Türen vorn und hinten.
Bei einer Ueberlandfahrt nach den Wichita-Fällen in Texas, 5600 km, wurde stellenweise sogar mit 120 km Geschwindigkeit gefahren. Bei eingearbeiteter Besatzung, vier Mann, wurde in 8 Minuten verladen.
Segelflugbetrieb i. d. Schweiz, 32 Segelfluggruppen mit 474 Flugzeugführern, 2645 Starts, Gesamtflugdauer 104 h 28 min 20 sec.

Deutsche Flugmodell-Höchstleistungen. Stand vom 1. Januar 1939. Klasse: Rumpfsegelflugmodelle:
Handstart-Strecke: W. Saerbeck, Borghorst, 43 000 m. — Handstart-Dauer: E. Bellaire, Mannheim, 20 min 13 sec. — Hochstart-Strecke: W. Bretfeld, Hamburg, 91 200 m. — Hochstart-Dauer: H. Kummer, Düben, 55 min.
Klasse: Nurflügel-Segelflugmodelle:
Handstart-Strecke: A. Herrmann, Nordhausen, 2375 m. — Handstart-Dauer: K. Schmidtberg, Frankfurt a. M., 37 min 41 sec. — Hochstart-Strecke: H. Kolenda, Essen, 10 400 m. — Hochstart-Dauer: H. Kolenda, Essen, 11 min.
Klasse: Rumpfflugmodelle mit Gummimotor:
Bodenstart:Strecke: W. Bauer, Köln, 1030 m. — Bodenstart-Dauer: Neel-meyer, Dresden, 13 min 7 sec. — Handstart-Strecke: O. Michalicka, Dresden, 24 000 m. — Handstart-Dauer: A. Lippmann, Dresden, 1 h 8 min.
Klasse: Rumpfflugmodelle mit Verbrennungsmotor:
Bodenstart-Strecke: J. Schmidt, Allenstein, 25 250 m. — Bodenstart-Dauer: J. Schmidt, Allenstein, 1 h 15 min 33 sec. — Handstart-Strecke: Th. Roleff, Essen, 42 800 m. — Handstart-Dauer: J. Schmidt, Allenstein, 1 h 19 min.
Klasse: Rumpfwasserflugmodelle mit Gummimotor:
Wasserstart-Dauer: A. Menzel, Dresden, 64 sec. Klasse: Rumpfwasserflugmodelle mit Verbrennungsmotor:
Wasserstart-Dauer: NSFK.-Sturm 7/27, Berlin - Friedrichshagen, 5 min 26 sec.
Klasse: Schlagflügel-Flugmodelle mit Gummimotor:
Bodenstart-Dauer: liegen z. Zt. keine Ergebnisse vor. — Handstart-Dauer: liegen z. Zt. keine Ergebnisse vor. Klasse: Schlagflügel-Flugmodelle mit Verbrennungsmotor:
Bodenstart-Dauer: A. Lippisch, Griesheim, 4 min 15 sec. — Handstart-Dauer: A. Lippisch, Griesheim, 16 min 8 sec. Klasse: Saalflugmodelle mit Gummimotor:
Handstart-Dauer: HJ. Mischke, Königsberg, 9 min 9 sec.
F. Alexander, Beauftragt mit der Führung der vorstehenden Liste.

Luftschrauben-Kopier-Fräsmaschinen für Holzschrauben s. „Flugsport" 1916 S. 567.
Raketenmodelle waren 1909 auf der IIa für den Wettbewerb nicht zugelassen. Syndicato Condor, Ltda., Rio de Janeiro (Brasilien).
DIN-Normen über Hobelwerkzeuge finden Sie unter Normblatt DIN 7310, DIN 7311, DIN 7312, DIN 7218, DIN 7219 und DIN 7220. Erläuterungen würden hier zu weit führen. Die Normblätter sind zu beziehen vom Beuth-Vertrieb GmbH.. Berlin SW 68, Dresdener Straße 97.
Aus Neujahrsbriefen.
Ein Ostmärke r schreibt: Lieber Rhönvater!
Das vergangene Jahr war ein Jahr zäher, stiller Arbeit. Die großen Spannungen und die namenlose Freude vor allem über die Heimkehr Oesterreichs in das große gemeinsame Reich aber gaben diesem Jahr eine Bedeutung, die wir wohl im ersten Jubel gefühlt haben, aber doch wohl erst dann ganz ermessen werden, wenn die genügende Distanz zu diesen Ereignissen hergestellt ist.
Ein alter Fl i e g e r k am e rad aus Nordengland schreibt:
Mein lieber Old Pop!
Es ist schade, daß wir die Fliegerkameradschaft nicht auf die Politik über-
^_____ . ..... - tragen kön-
nen. Ich hoffe, Dich bald wieder einmal zu
-~ i - . sehen.
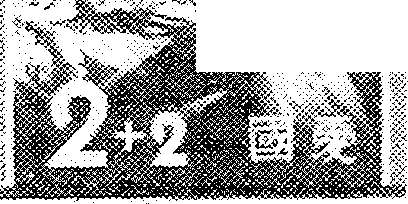
Erinnerungspostkarte mit Japan. Sonderstempel Postamt Tokio Condor in Tokio.
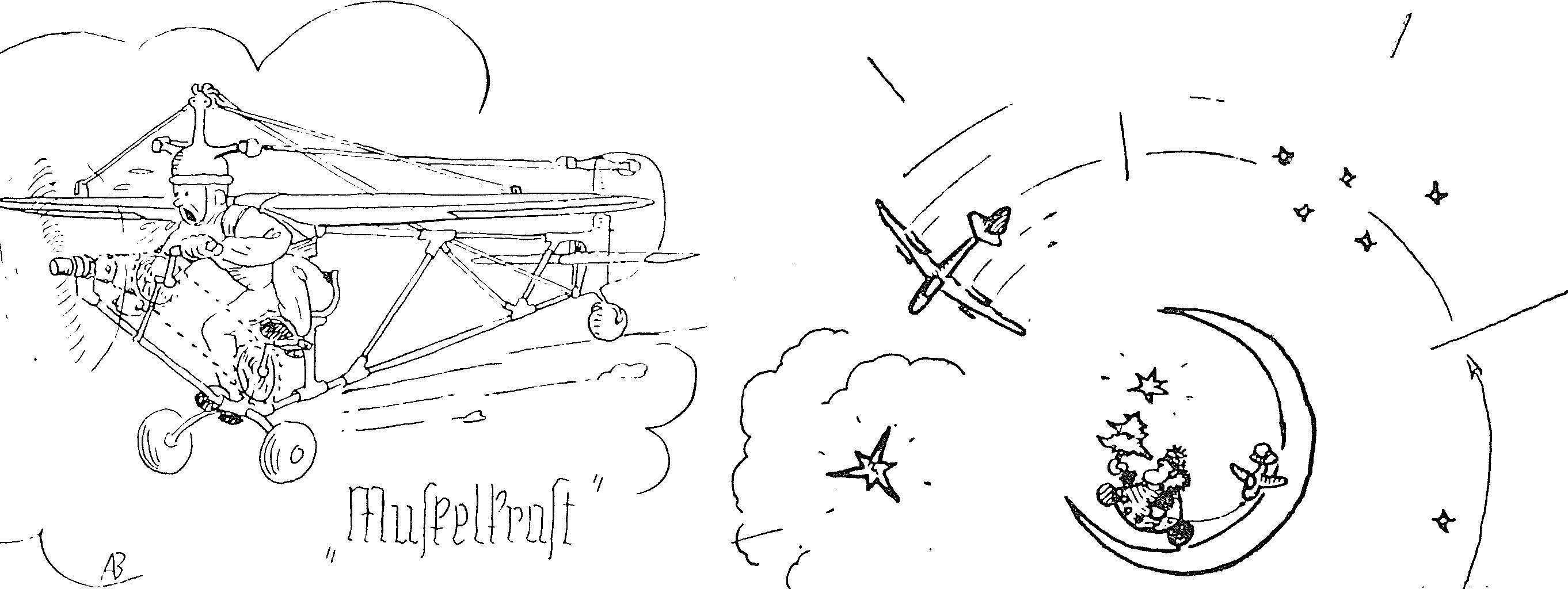
Liebe Fliegerkameraden! ( ^=^^\ + + *,
In diesem Jahre ist mir eine so große Zahl von Neujahrswünschen und aufmunternden Briefen zugegangen, daß
es mir unmöglich ist, jedem einzelnen i \
recht herzlich zu danken, wie ich es gerne getan hätte. Mögen alle die guten Gedanken und Wünsche zum Wohle der Entwicklung unserer Fliegerei in Erfüllung gehen, und möge vor allen Dingen der alte Kameradschaftsgeist, frei von Eigennutz, das schönste, was wir neben der Ausübung der Fliegerei besitzen, zum Wohle der weiteren Entwicklung unserer Fliegerei erhalten bleiben.
Und allen Fliegerkameraden im In- und Ausland für das Jahr 1939 schönsten Erfolg mit Hals und Bein! Oskar Ursinus.

Literatur,
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Weit im Rücken des Feindes. Kriegserlebnisse eines Fernaufklärers v. Fr. W. Radenbach. 208 S., 39 Abb., 1 Flugkarte. Traditions-Verlag Kolk & Co., Berlin SW 68. Preis RM 3.50.
Verfasser gibt in diesem lesenswerten Buch packende Schilderungen unserer deutschen Kriegsflieger auf weniger bekanntgewordenen Gebieten. Hier handelt es sich weniger um den Luftkampf, im Gegenteil, man mußte diesen meiden, um unbehindert ins Hinterland zu gelangen, um sehen zu können, was hinter der Front geschah. Brückensprengungen, hinter den feindlichen Linien, Agentenabsetzen hinter der französischen Front, Aufklärungsflüge bei Gewitter und Sturm, und dann das Ende. Unsere Kameraden im Kriege haben nicht umsonst gekämpft. Die Wehrmacht steht wieder.
Volkskalender für den Deutschen Luftschutz 1939. Jahrbuch, 144 S., mit Bildern. Wilhelm Limpert-Verlag, Berlin SW 68. Preis RM —.50.
Der Luftschutz ist durch sachgemäße Belehrung eine Volksbewegung geworden. Trotzdem möchten viele noch mehr wissen und vor allen Dingen noch Fernstehende heranholen. Der vorliegende Volkskalender für den deutschen Luftschutz ist hierfür ein gutes Werbemittel.
Auto-Atlas von Deutschland, Schweiz und Italien mit Reiseführer, herausg. v. Dr. Peter Oestergaard. Deutscher Autokarten-Verlag Dr. Peter Oestergaard, Berlin-Lichterfelde. Peis RM 5.80.
Das Kartenwerk umfaßt das gesamte deutsche Reichsgebiet, fast ganz Sudetendeutschländ und die deutschsprachige Schweiz im Maßstabe 1 : 500 000, im Anschluß daran Kartenbilder bis an die Südspitze Italiens. Praktisch ist der ABC-Reiseführer. Man findet 500 Orte in alphabetischer Reihenfolge mit allem Wissenswerten.
Luftbild und Vorgeschichte, Nr. 16, Luftbild und Luftbildmessung, herausgeg. v. d. Hansa Luftbild G. m. b. H., Berlin SW 29, mit ausgezeichneten Abbildungen. Besonders interessant sind die Farbdrucke (Rot-blau-Raumbilder) mit einer dazugehörigen Brille. Enthält: Englische Aufnahmen (Befestigungen, Grabanlagen, Kultstätten, Siedlungen, Bodendenkmäler alten Ackerbaues, Straßen, Sonstiges) und deutsche Aufnahmen.
Heft 2/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburg-Platz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro % Jahr bei Htäglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet.
Nr. 2 18, Januar 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 1. Februar 1939
Entgleisungen.
Wir in Deutschland sind stolz, den Segelflug geschaffen und der Welt geschenkt zu haben. Und da kommt plötzlich ein unerfahrener Mensch und sucht, in einer sogenannten Fachzeitschrift für die deutsche Sportfliegerei Stimmung gegen das Segelflugwesen zu machen. Hierbei behauptet er mit ungetrübter Sachunkenntnis, daß die .Segelflugbewegung nur der im früheren Deutschland herrschenden katastrophalen Arbeitslosigkeit zu verdanken sei. Dann werden die Mitglieder der Fluggruppen aufgehetzt, man könne nicht mehr von ihnen verlangen, daß sie die Nächte noch mit Spierenklopfen sich um die Ohren schlagen, und so weiter. Eine Brunnenvergiftung schlimmster Sorte!
Es ist unerhört, wie die deutsche Pressefreiheit von hemmungslosen Menschen dazu benutzt wird, um die Leistungen unserer deutschen Segelflugpioniere, von denen viele ihr Leben opferten, in den Schmutz zu ziehen. Ich habe absichtlich an dieser Stelle mit einer Stellungnahme zurückgehalten und geglaubt, daß die vielen im Segelflugwesen tätig gewesenen Schriftsteller energisch zu dieser Entgleisung Stellung nehmen würden. Nichts ist geschehen! Oder fürchtete vielleicht der eine oder andere — —?
Im vorliegenden Fall gibt es nur eins: Derartige Entgleisungen dürfen nicht mehr vorkommen, und es muß mit allen Mitteln vermieden werden, daß solche Schriften in die Hände unserer Jugend kommen. Daneben muß solchen unverantwortlichen Schriftleitern das Handwerk gelegt werden. 0. U.
Heizluftstrahltriebwerke.
(Fortsetzung v. S. 5 Nr. 1, 1939.)
Bei Lorin fanden wir bereits den Gedanken — vgl. Abb. 5 im vorigen Heft Seite 3 —, aus der Wärmemenge der Brennkammer einen Teil abzuspalten und mechanische (Kurbel-) Arbeit zur Vorverdichtung der Verbrennungsluft verrichten zu lassen. In der französischen Patentschrift 534 801 von M. Quillaume aus dem Jahre 1921 sehen wir dieses Prinzip zum erstenmal für einen Turbinen-Kompressor angewandt, eine Ausführungsform, die in neuerer Zeit mehrfach
weiterausgebildet worden ist. Auf einer die Brennkammer g durchdringenden Welle — Abb. 13 — sitzt in einem an beiden Enden offenen rohrförmigen Gehäuse vorn ein Kompressor (Rateau-Typ) A und hinten eine Gasturbine B, beide mehrstufig und mit Leitschaufeln durchsetzt. Von dem Brennstoffbehälter p führt ein mit Reglern versehenes Rohr r in die Brennkammer; ein Ventil q in einem zweiten gleichartigen Rohr läßt sich als Accelerator und zum Zwecke des schwierigen Anlassens benutzen, dem auch die mit den Zündmagneten n verbundene Anlaßkurbel 1 dient.
Eine ähnliche Einrichtung wurde im Jahre 1930 von F. Wh i 111 e in England angemeldet und unter Nr. 347 206 patentiert. Auch hier sitzt — Abb. 14 — auf derselben Welle vorn ein Gebläsekompressor 3 und hinten eine Gasturbine (1), die von einem Teil der Brennkammer (10) — Energie — gespeist wird. Zwischen den ringförmigen Gehäusen der umlaufenden Bauteile liegen, in der Flucht mehrerer am Umfange verteilter Brennkammern die den Rest der Entspannung besorgenden Düsen (7), die für Steuerzwecke gegebenenfalls schwenkbar sein können. Whittle hat das Heizluftstrahltriebwerk in neuerer Zeit weiter ausgebaut, worüber noch zu berichten sein wird.
Aus der Zeit Marconnets stammen auch die Vorschläge des Amerikaners Lake. Er meldete 1909 in V. St. A. Patente an, in denen u. W. zum erstenmal der Gedanke der Luftzumischung in den Brenngasstrahl auftritt, vgl. Abb. 15 und 16, die wir seiner österreichischen Patentschrift 63 081 entnommen haben; seine Strahltriebwerke sind also Vorläufer des etwa 10 Jahre später auftauchenden, sehr viel bekannter gewordenen Melotschen „propulseur ä trompe". Die hitzebeständige Brennkammer, vorn offen für Luftzutritt, läuft in einem Diffusor aus, der durch schräge seitliche Schlitze Luft zutreten läßt und in ein weiteres, ebenfalls mit Luftschrägschlitzen versehenes, im Durchmesser zunehmendes Rohr mündet. Beide Diffusoren sind von einem dritten, weiter werdenden Rohr, das der Luftführung sowie der Wärmehaltung dient, umschlossen. Abb. 16 zeigt einen Längsschnitt durch die rechtwinklige Hauptbrennkammer; aus dem Querschnitt in Abb. 15 ist eine zweite gleichartige Brennkammer im unteren Teil des Flugzeugs zu erkennen. Auch die Flügel sind mit solchen versehen; sie sollen mit jalousieartigen, von einem Pendel gesteuerten Klappen mit puerruderwirkung ausgestattet sein. Mit der Luftzumischung wird bezweckt, die Ausströmmasse zu vergrößern; da-
,10
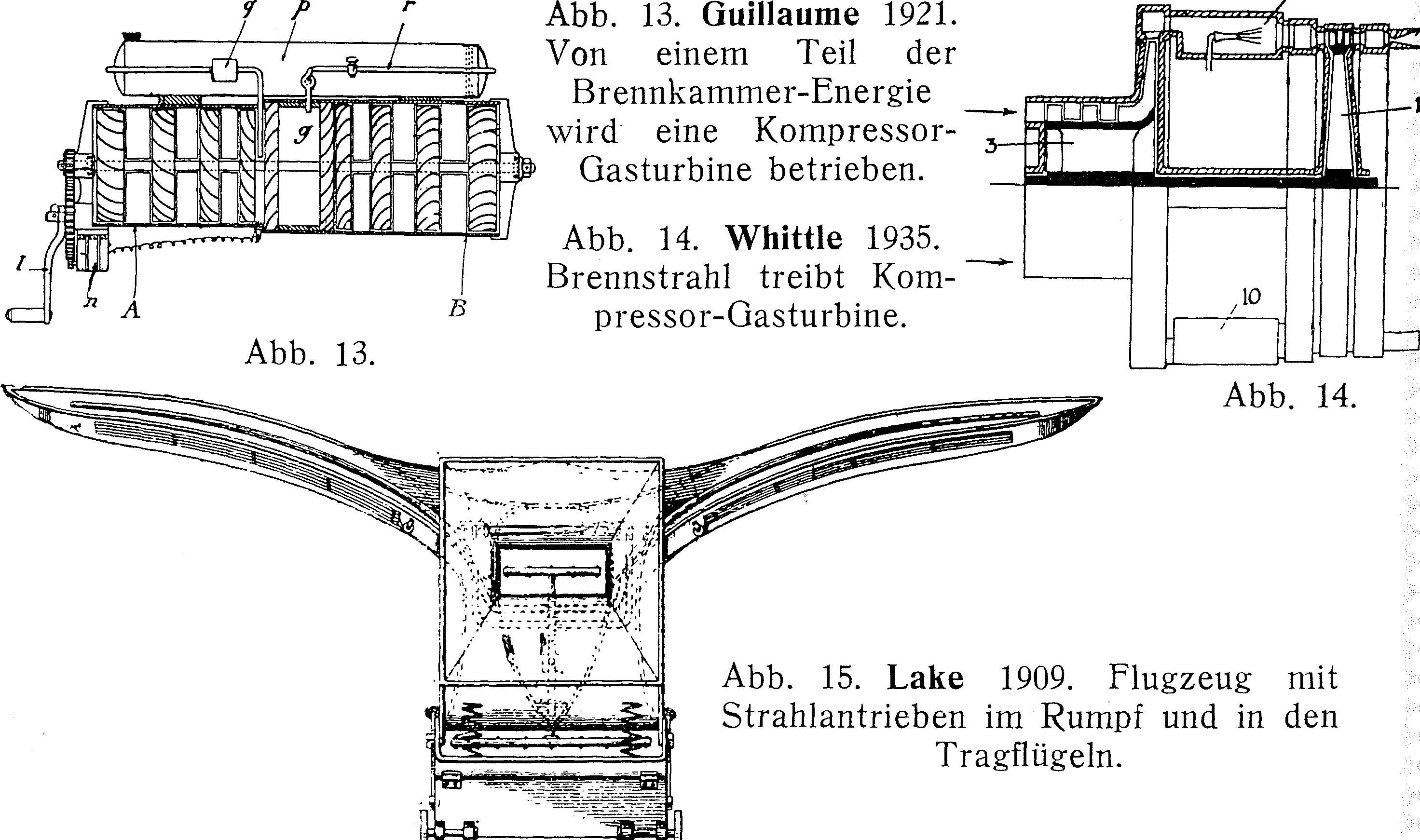
durch wird natürlich die Strahlgeschwindigkeit im Düsenaustrittsquerschnitt herabgesetzt. Nicht erkannt ist der mit der Verringerung der Austrittsgeschwindigkeit verbundene Vorteil, letztere mit der Eigengeschwindigkeit des Flugzeugs in Einklang*) bringen, und dadurch den Wirkungsgrad des Triebwerks erheblich erhöhen zu können.
Als ein Vorläufer Melots ist auch der Engländer H. St. Harris anzusehen, der in der britischen Patentschrift 118 123 vom Jahre 1917 die in Abb. 17 gezeigte Einrichtung beschreibt. An ein Niederdruck-Gebläse mit in Flugrichtung offener Saugmündung schließen sich Brennkammern an, die in weitere, nach hinten enger werdende Rohre von bedeutender Länge münden. Diese Rohre, die wie bei Lake mit (nicht gezeichneten) besonderen Luftzutrittsschlitzen über ihre Länge versehen sein können, dienen ebenfalls der Vergrößerung der Strahl-masse. Die infolge Kühlung der Brenngase in den Rohren eintretende Einschnürung des Strahles soll saugend wirken; die zeichnerisch angedeutete Erweiterung der Brennkammer soll die Volumenvergrößerung aufnehmen, derart, daß die Gase aus ihr ohne Druckerhöhung austreten.
Melot hat sein Düsen- („trompe"-) System, siehe Abb. 18, am 19. 1. 1920 in Frankreich angemeldet (Nr. 523427), nachdem die französische Heeresverwaltung bereits im Kriege Untersuchungen mit seinem Gerät vorgenommen hatte, die anscheinend jedoch nicht befriedigend waren. Hinter einer Brennkammer b, in die vorn Fahrtwind mit abnehmender Geschwindigkeit eintritt, liegt eine Reihe immer größer werdender Düsen, die seitlich Luft ansaugen. Außerdem ist die Brennkammer von einem System mehrerer konzentrischer Düsen umgeben, das als „multiplicateur de depression" gedacht war, aber später offenbar wieder fallen gelassen worden ist. Abb. 19 (aus „La
*) Vgl. Everling-Lademann in „Verkehrstechnische Woche", 1929, S. 604-607.
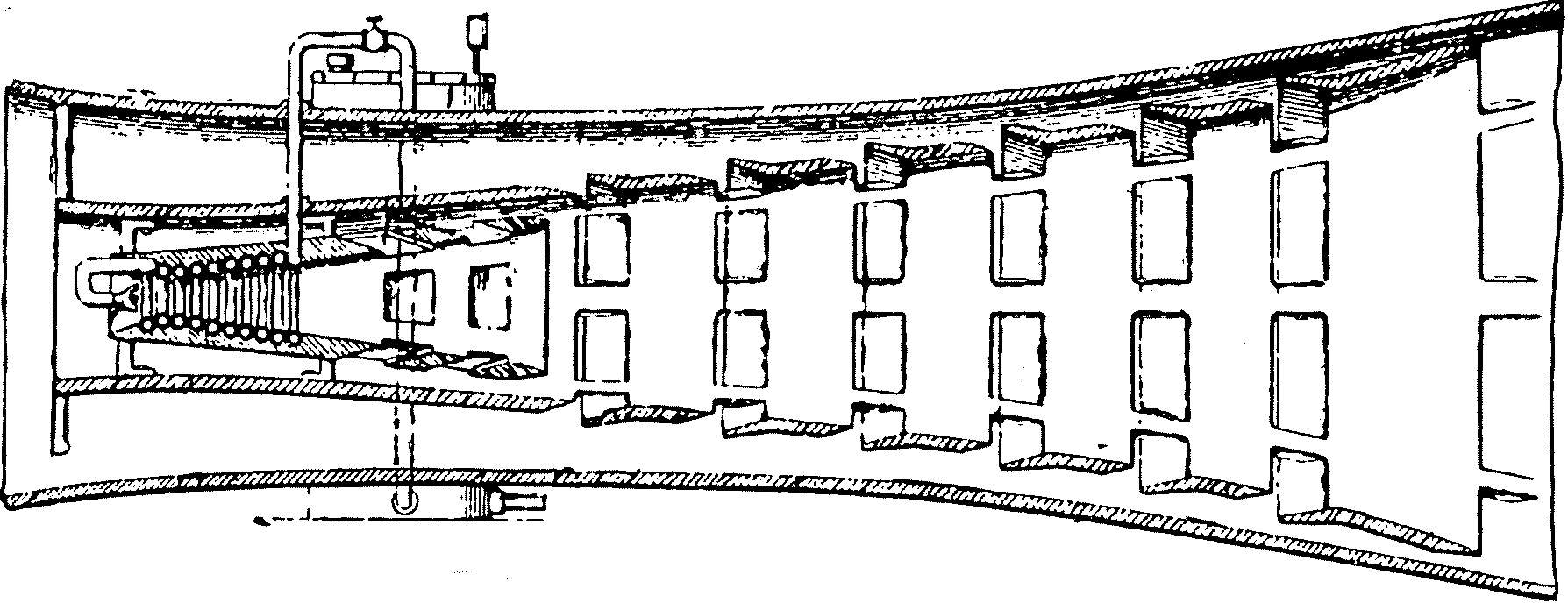
Abb. 16. Lake 1909. Heizluftstrahltriebwerk mit Luftzutritt im Diffusor.
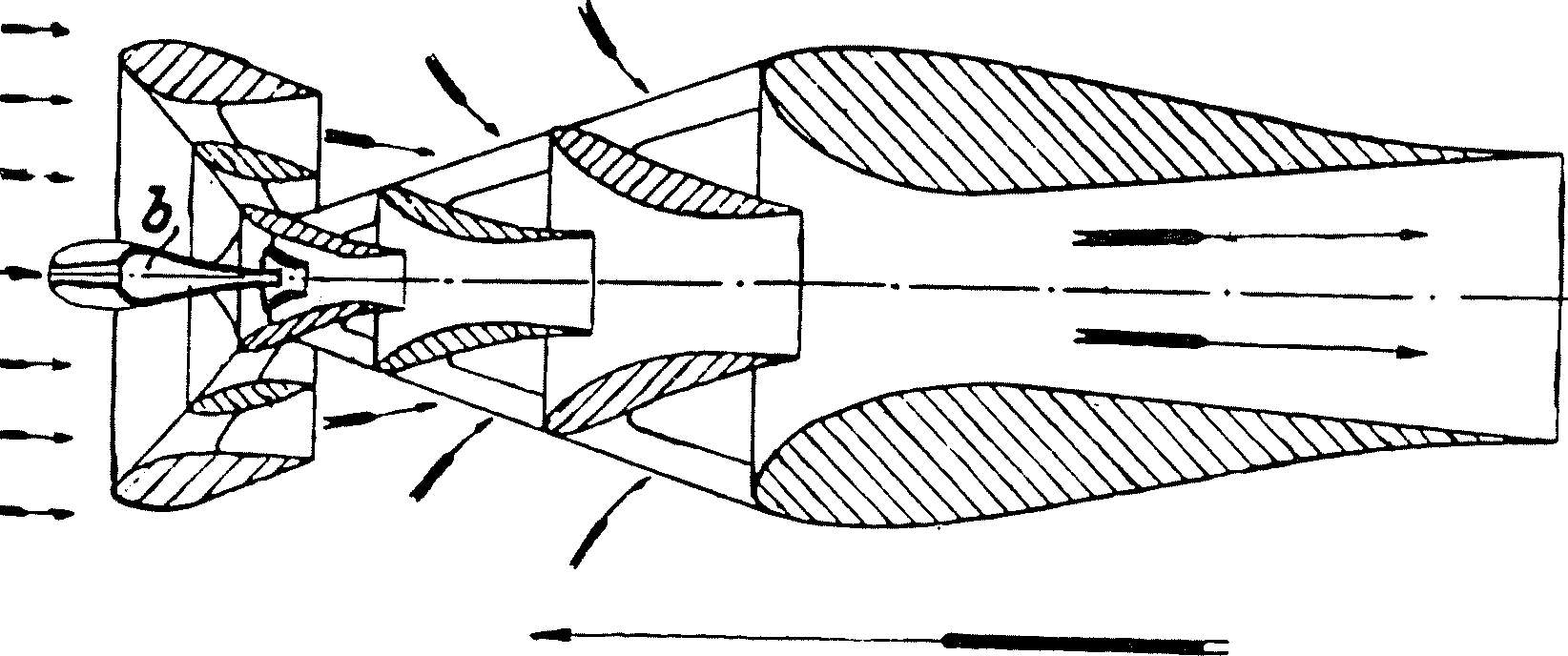
Abb. 18. Melot 1920. Strahldüsen mit seitlicher Luftansaugung.
Abb. 19. Melot-Düsen-
trieb in Versuchsanordnung: A Verbrennungsluftzutritt, B Zündkerze ßr fürs Anlassen, Br Brenner, C Brennstoffzutritt, D Düsen, G Gasstrahl, L Mischluft, T Brennkammer-Mündung.
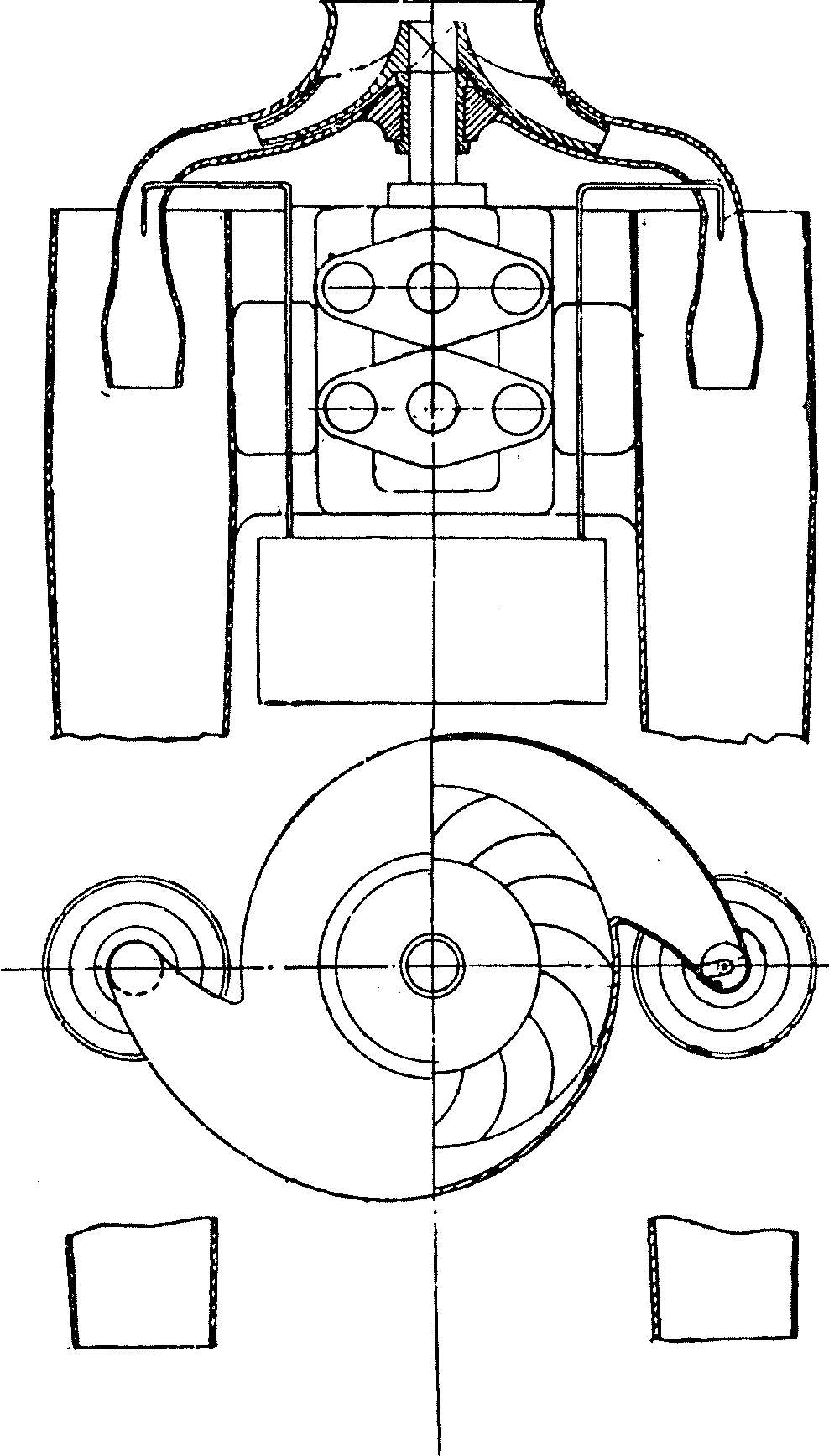
Abb. 17. Harris 1917. Lange Luftmischrohre abnehmenden Querschnitts.
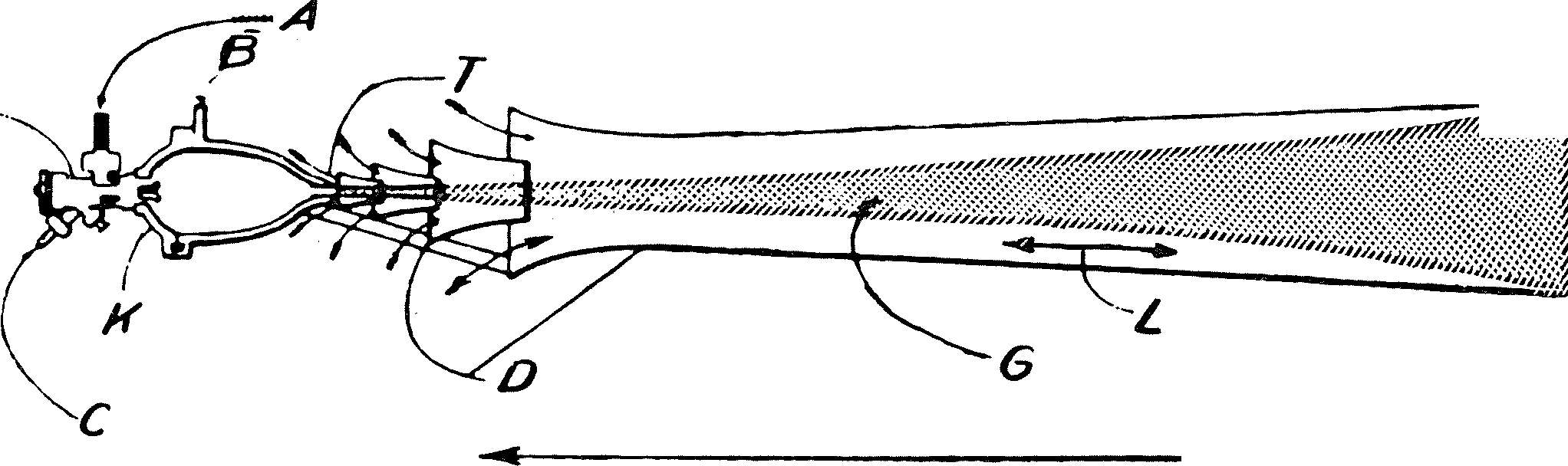
Nature", 1920, Seite 368) gibt eine Stand versuchs-Anordnung wieder, die den Düsenkranz um die Kammer nicht zeigt. Durch die Ansaugung der zusätzlichen Luft wird der Wirkungsgrad gegenüber dem des freien Strahles nachgewiesenermaßen verbessert*), jedoch hat er anscheinend noch nicht die Höhe erreicht, um mit dem Schraubentriebwerk ernstlich in Wettbewerb treten zu können.
Da der Wirkungsgrad mit zunehmender Vorverdichtung des Zündgemischs besser wird, schuf Melot später eine verbrennungsmotorische Einrichtung, die in gewisser Weise der in Abb. 5 (auf Seite 3 des vorigen Heftes) gezeigten von Lorin entspricht; jedoch ist — Abb. 20 — statt eines Kurbelgetriebes ein freiliegender Kolben mit zwei konkaven Böden vorgesehen, der im Betriebe, nachdem er das in der Mitte eintretende Gemisch in dem einen Zylinderraum komprimiert hat und dieses gezündet worden ist, das Gemisch durch seine Schleuderwucht in dem gegenüberliegenden Räume komprimiert und so fort. Die Brenngase, deren wechselseitiger Austritt durch den Kolben gesteuert wird, treten in das Melotsche Düsensystem ein, um Rückdruck zu erzeugen. Das Anlassen erfolgt mit Hilfe von Preßluft und Zündkerze; letztere kann im Dauerbetriebe abgeschaltet werden, weil Selbstzündung eintritt.
Etwa zu gleicher Zeit mit dem Melot-Strahlantrieb entstand der Düsen-Propeller von M o r i z e, in Frankreich am 26. 7.17 angemeldet, nachstehend auf Grund der britischen Patentschrift 124 736 zitiert, vgl. die Abb. 21—24, die nur noch geringer Erläuterung bedürfen. Der Motor (Abb. 21) betreibt eine Brennstoffpumpe d und einen Kompressor g, der über eine Ausgleichskammer h Preßluft in die Brennkammer b liefert. Durch das Düsenrohr a wird vorn Luft angesaugt und das Brenngas-Luftgemisch bis zum hinteren Ende verlangsamt. In Abb. 22 sind zusätzliche Luftdüsen zwischengeschaltet, in Abb. 23 ist die Anzahl der Brenndüsen m vermehrfacht, in Abb. 24 eine Ringdüse i gezeigt. Während die bisher besprochenen Geräte für Fluggeschwindigkeiten unterhalb der kritischen, d. h. unterhalb der Schallgeschwindigkeit (330 m/sek) gedacht waren, tritt nunmehr das zuerst von den Ballistikern (Mach, Cranz u. a.) behandelte, auch in der aerodynamischen Versuchsanstalt Göttingen (Prandtl) untersuchte; schwierige Problem*) der überkritischen Geschwindigkeiten in die Entwicklung des Heizluftstrahltriebwerks ein. War bisher die Eigenverdichtung der Luft dem Bernouillischen Gesetz zufolge durch Erweiterung des Eintrittstrichters nach hinten zu erreichen, so erfordern nunmehr die bei kritischen Geschwindigkeiten anders gearteten Zustandsänderungen des Strömmittels andere Einrichtungen.
Di\-Ing. A. Fono, Budapest, ließ sich 1928 mit dem Patent 554 906 der Kl. 46 — Abb. 25 bis 27 — einen Luftstrahlmotor für Hochflug für Luftfahrzeuge mit überkritischen, großen Geschwindigkeiten schützen, der bekanntermaßen aus einem in der Bewegungsrichtung liegenden Körper besteht, der vorn eine Lufteintrittsöffnung, dahinter eine Verdichtungsdüse mit Brennstoffzufuhr B und Zündung C nahe der Stelle des höchsten Druckes und anschließend eine Ausdehnungsdüse besitzt, und dessen Kennzeichen darin besteht, daß „der Querschnitt der Verdichtungsdüse sich in der Strömungsrichtung anfangs verjüngt". Wie sich aus einem Vergleich der auf S. 4 im vorigen Heft gebrachten Abbildung 10 mit der der vorgenannten, nicht gerade klaren Patentschrift entnommenen Abb. 25 ergibt, waren alle Merk-male des Fonoschen Hauptanspruchs bereits bei dem 1913 veröffent-
*) s. NACA-Report 431 (Versuche mit Preßluft ohne Wärmezufuhr). *) Scherschevsky „Die Rakete für Fahrt und Flug", Charlottenburg 1929. Vgl. auch Scherschevsky „Das Raumschiff" Flugsport 1927, Heft 20 u. 21.
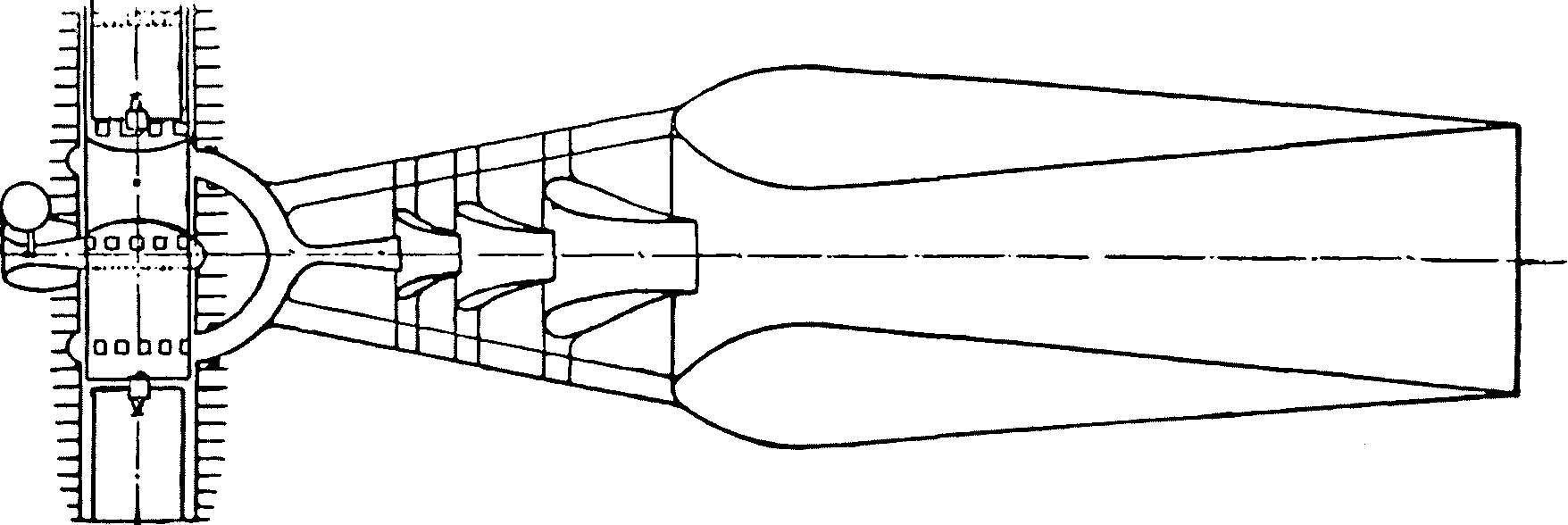
Abb. 20. Melot-Verdichter mit freifliegenden Kolben.
lichten Lorinschen Vorschlage vorhanden; doch ist das Fono-Patent erloschen. Im übrigen beschränken wir uns auf die mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegebenen Abbildungen der Patentschrift.
Die Zusatzpatentschrift 560 075/46 von Fono bildet den Unteranspruch des Hauptpatents insofern weiter aus, als an Strahltriebwerken der genannten Art „in dem engsten Querschnitt" (soll wohl heißen zwischen den engsten Querschnitten der Ein- und Auslaß-trichter) „ein Verdichter eingeschaltet ist". Sollte nach dem Hauptpatent (Abb. 27) der Verdichter b durch Fahrtwindflügel a angetrieben werden, so wird hier — Abb. 28 bis 30 —, um auch bei stillstehendem Flugzeug verdichten zu können, der außer dem Eigenverdich-tungstrichter a vorhandene Verdichter d von einer besonderen Kraftquelle angetrieben. Die bei a — Abb. 28 — zuströmende Luft gelangt vorverdichtet mit geringerer Geschwindigkeit in die Kammer b und nach Oeffnen des Saugventils c in den Zylinderraum d und füllt diesen beim
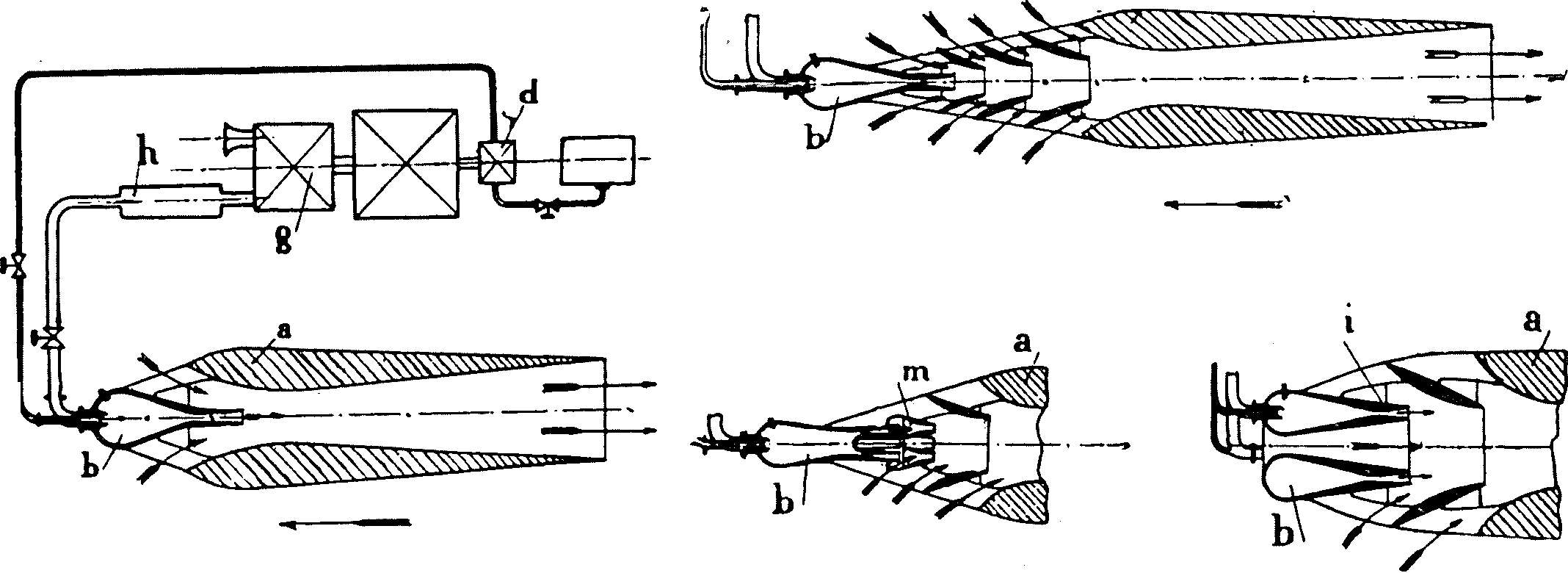
Abb. 21—24. Morize 1917. Düsen-Strahltrieb.
Abb. 25—27. Fono 1928.
Heizluftstrahltriebwerk für überkritische Fluggeschwindigkeiten.
Abb. 28—30. Fono 1928. Verdichter-Anordnungen.
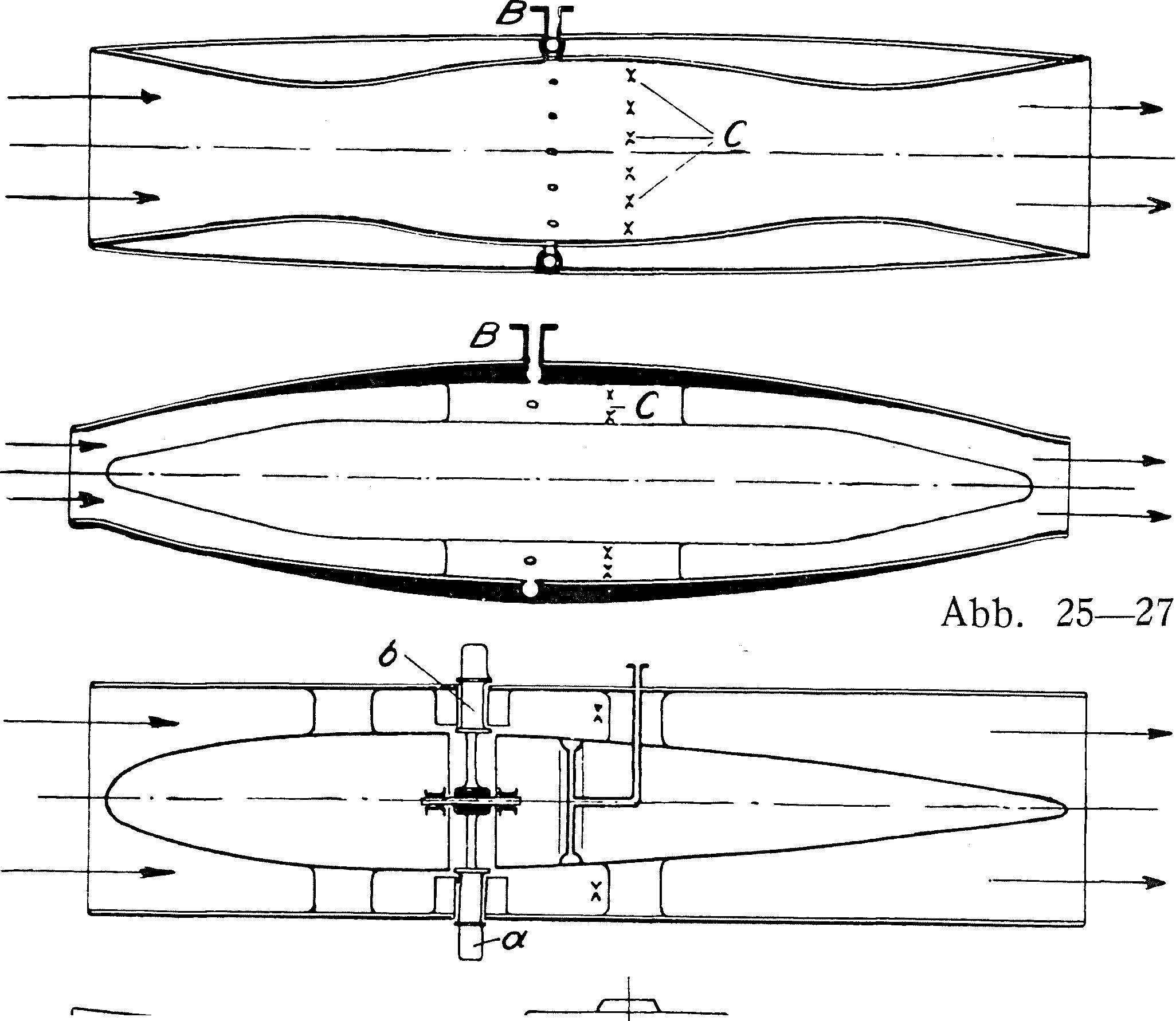
Niedergang des Kolbens. Beim Rückgang wird die Luft verdichtet, Brennstoff zugeführt und gezündet, wonach der Kolben zurückgeworfen und der Kurbelwelle Arbeit übertragen wird. Nachdem die Entspannung bei niedergehendem Kolben soweit erfolgt ist, daß die geleistete Arbeit unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades der Verdichtungsarbeit entspricht, öffnen sich die Auspuffventile e, und die Verbrennungsgase gelangen noch unter hohem Druck und mit hoher Temperatur in die Sammelkammer f und in die Entspannungsdüse g, von wo sie nach vollständiger Entspannung ins Freie gelangen. In den Abb. 29 und 30 ist der vom Motor j angetriebene Verdichter di von der Brennkammer fx getrennt.
Dem gleichen Problem der Anpassung an überkritische Fluggeschwindigkeiten hat sich auch der Italiener S. C a m p i n i zugewandt. Wir legen seine im Jahre 1932 angemeldete französische Patentschrift 741 858 — Abb. 31 bis 33 — zu Grunde, soweit sie sich auf Flugzeuge bezieht Seine umfangreiche Schrift betrifft z. T. auch Strahlantriebe für Wasserflugzeuge und enthält viele konstruktive Einzelheiten, auf die im Rahmen dieses Aufsatzes jedoch nicht näher eingegangen werden kann.
Die Hauptaufgabe, die Campini zu lösen sucht, ist: Verwendbarkeit des Strahlantriebs sowohl für Unter- wie für Überschallgeschwindigkeiten.
Wir wissen aus dem Vorhergesagten, daß der Lufttrichter von der Einlaßmündung ab im ersteren Falle divergieren, im zweiten Falle konvergieren muß. Campini will mit demselben Gerät wahlweise beides machen. Der Fahrtwind wird im allgemeinen am Umfange eines Körpers 8 von etwa eiförmiger Gestalt, der zugleich eine Höhenkabine bildet, eintreten lassen, an einer Stelle, wo er infolge Reibung (Staudruck, Grenzschicht) eine verhältnismäßig kleine Relativgeschwindigkeit hat. Bei unterkritischer Geschwindigkeit hat der von dem Körper 8 und einem Fangzylinder 2 gebildete Eintritts-Kreisschlitz den kleinsten Querschnitt; er erweitert sich in bekannter Weise nach hinten, um die Bewegungsenergie der Luft in Druckenergie umzuwandeln. Wird die Fluggeschwindigkeit auf eine überkritische gesteigert, so wird der Ring 3 über die bisherige Mündung hinaus nach vorn geschoben (gestrichelt angedeutet), so daß der Fahrtwind nun in einen nach hinten zunächst enger werdenden und dann erst sich erweiternden Trichter eintritt, womit den eigenartigen Strömungsverhältnissen
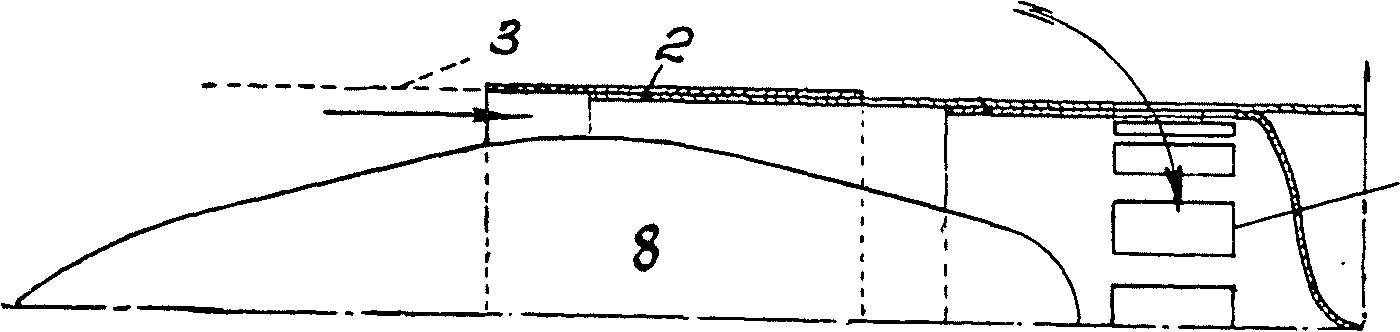
Abb. 31. Campine 1932. Eigenverdich-zb tungsraum, für unter- und überkritische Geschwindigkeiten einstellbar.
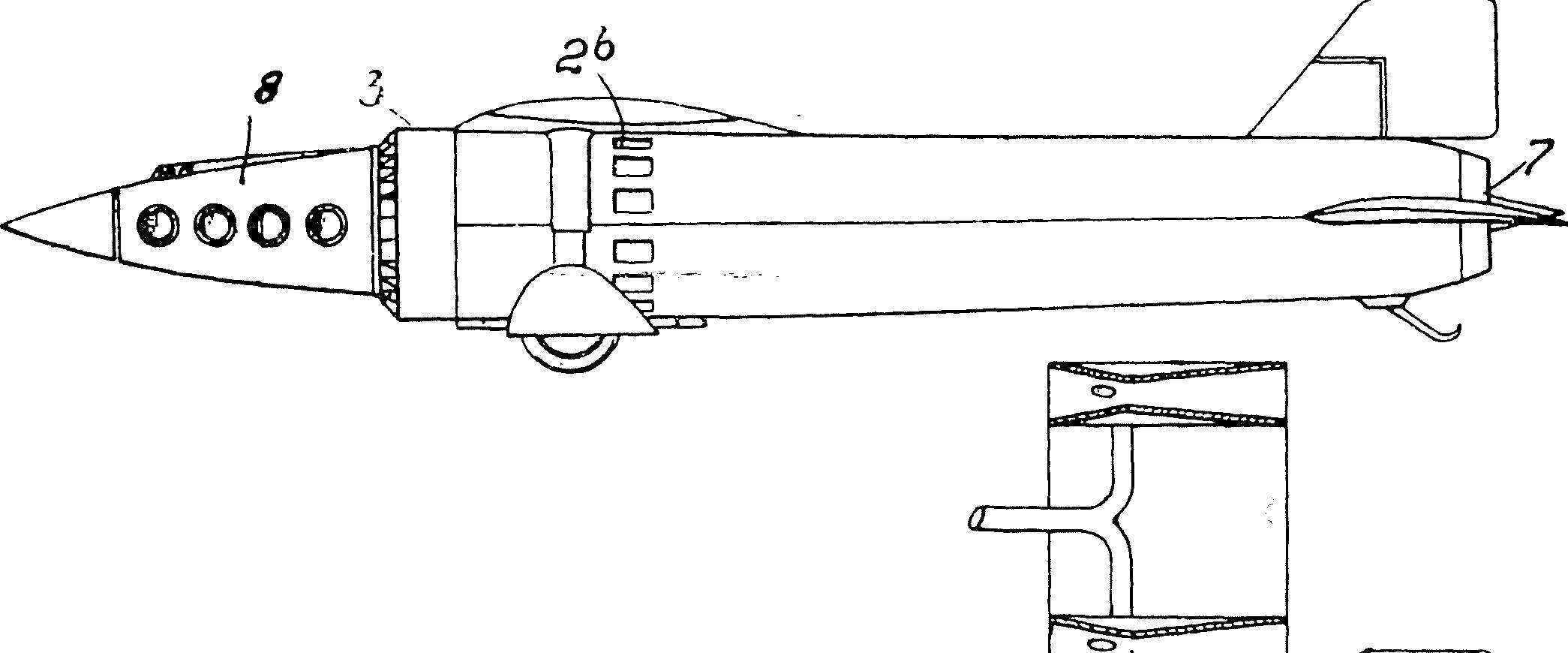
Abb. 32 u. 33. Flugzeug mit Heiz-
werk; die Höhenkabine 8 ist mit Fallschirm lösbar.
luftstrahltrieb-
bei Ueberschallgeschwindigkeiten Rechnung getragen ist. Durch Verschiebung steuerbare seitliche Oeffnungen 2b sollen Luft einlassen, wenn im Einlaßraum — von Campini Rückgewinner genannt — Unterdruck entsteht (z. B. beim Anlassen). Die im Rückgewinner verdichtete Luft gelangt durch, von einem Motor 10 oder einer Brenngasturbine angetriebene, Schleuderverdichter 4 und einen auch als Gleichrichter dienenden Motorkühler hindurch in den weiten Brennkammerraum 5; dort wird sie in einem ringförmigen Kanal 0 venturiartigen Querschnitts mit Brennstoff versorgt; schließlich strömt sie in bekannter Weise durch einen im Querschnitt regelbaren, verschwenkbaren Diffusor 7 ins Freie. Der größte Durchmesser, der schwach kegel-stumpfförmigen Umhüllung des Triebwerkes, befindet sich an der Stelle des Fahrtwindeintritts. (Fortsetzung folgt.)
Gohlke.
Aeronca „Chief".
Zur Ergänzung unserer Typenbeschreibung des Aeronca „Chief" der Aeronautical Corporation of America, Cincinnati, Ohio, S. 690 des „Flugsport" 1938, geben wir nebenstehend eine perspektivische Darstellung des Führersitzes, aus welcher verschiedene interessante Einzelheiten hervorgehen. Man erkennt oben die Querruderseilführung, die Anordnung des Gerätebrettes mit den in der Richtung des Flugzeuges verschiebbaren Handradwellen sowie Seitenruder und Bremspedale. Die Einzelheiten sind durch Beschriftung in der Abbildung näher bezeichnet.
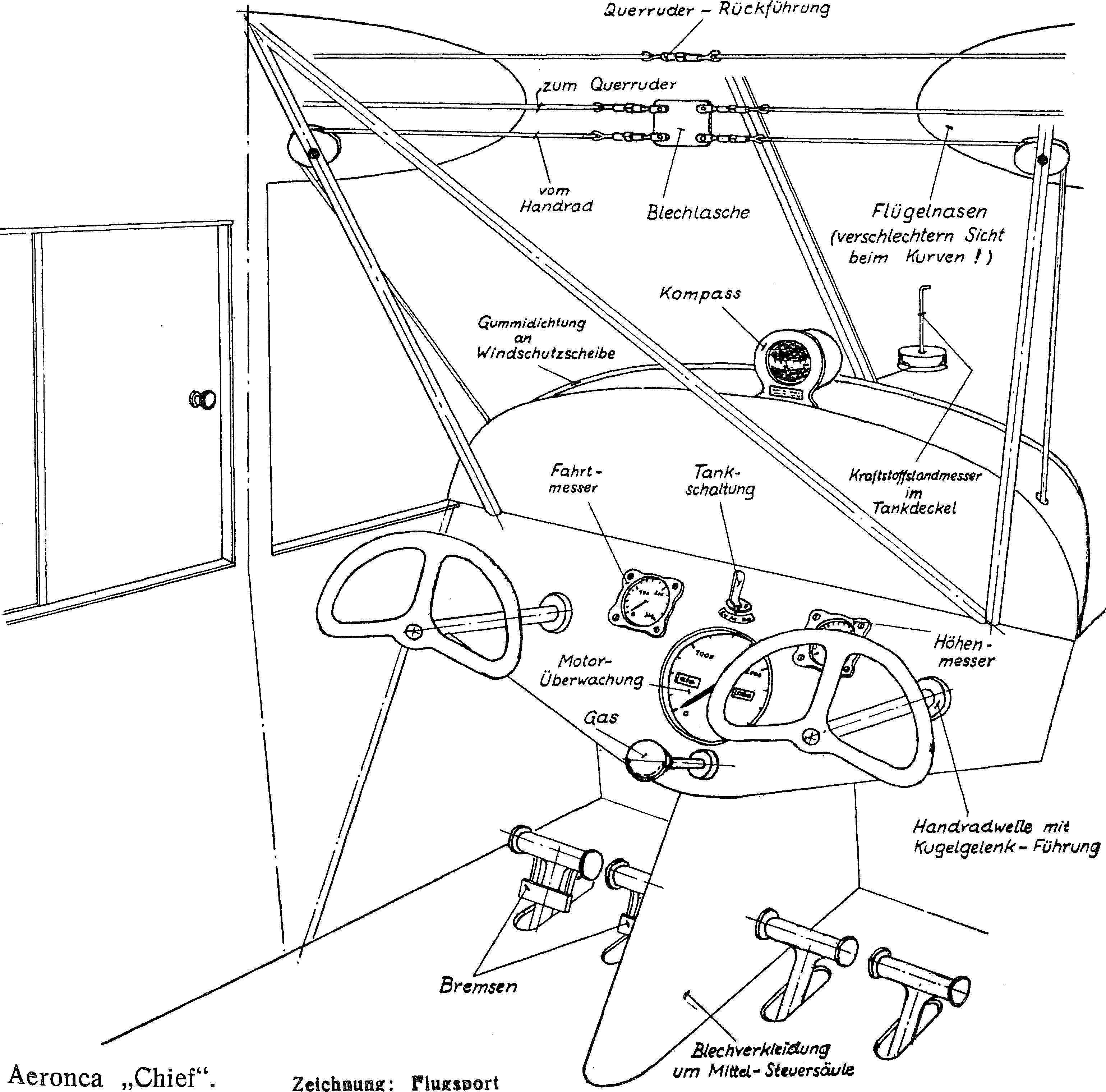
Chrislea „Airguard", Leichtflugzeug.
Der zweisitzige freitragende Tiefdecker wurde von der Chrislea Aircraft Company, Ltd., Heston Airport, Hounslow für das C. A. Q. gebaut. Entwurf stammt von B. V. Leak, A. F. R. Ae. S.
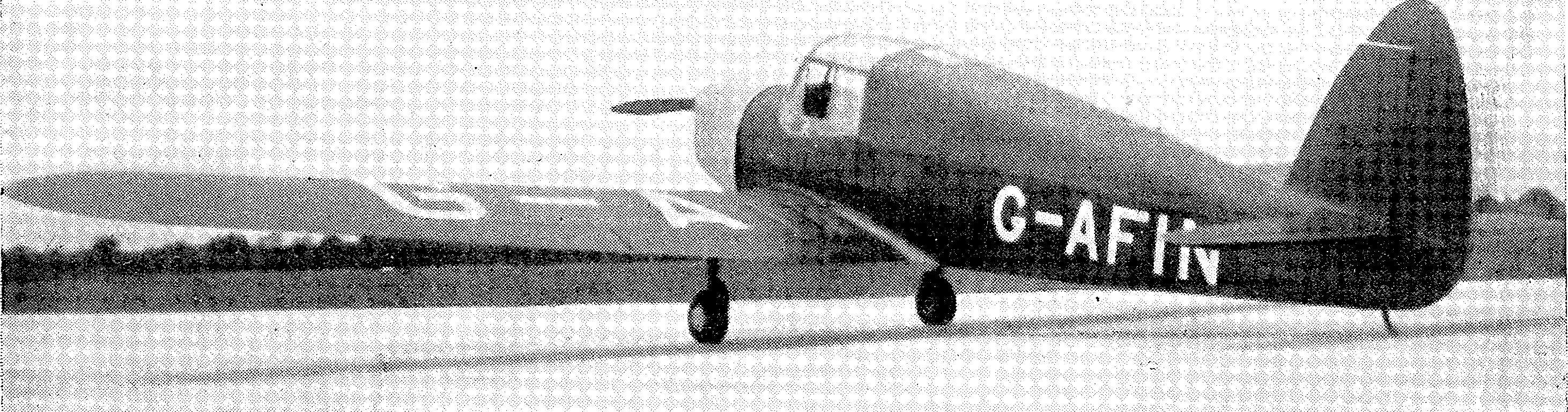
Chrislea „Airguard", Leichtflugzeug. Bild: Shell Aviation News
Flügel dreiteilig, 2holmig, sperrholzbeplankt; Clark y-Profil, einfache 3-Positions-Landeklappen vom Rumpf bis zu den Querrudern. Flügelspitzen leicht abnehmbar; Mittelstück 2 parallele Kastenholme. Beim Serientyp beide Außenflügel hochklappbar.
Rumpf Spruce, sperrholzbeplankt; 2 nebeneinanderliegende Sitze, dahinter Qepäckraum für 20 kg.
Leitwerk freitragend, Aufbau wie Flügel, sperrholzbeplankt. Fahrwerk Halbgabeltyp, druckgummigedämpft. Triebwerk Walter Mikron II, 62 PS; wird von der Firma in Lizenz gebaut; Zweiblattholzluftschraube. Brennstoff- (57 1) und Oel-
behälter (5,2 1) vor dem Brandschott.
Spannweite 10,9 m, Länge 6,54 m, Höhe 1,9 m, Fläche 14,4 m2.
Leergewicht 370 kg, Zuladung 220 kg, Fluggew. 590 kg; Flächenbelastung 41 kg/m2, Leistungsbelastung 9,55 kg/ PS.
Höchstgeschw. 190 km/h, Reisegeschw. 177 km/h, Landegeschw. normal 64 km/h, mit Vollast 69 km/h. Steig-geschw. in Bodennähe 183 m/min.
Dienstgipfelhöhe 4580 m, absolute Höhe 5200 m; Aktionsradius 595 km.
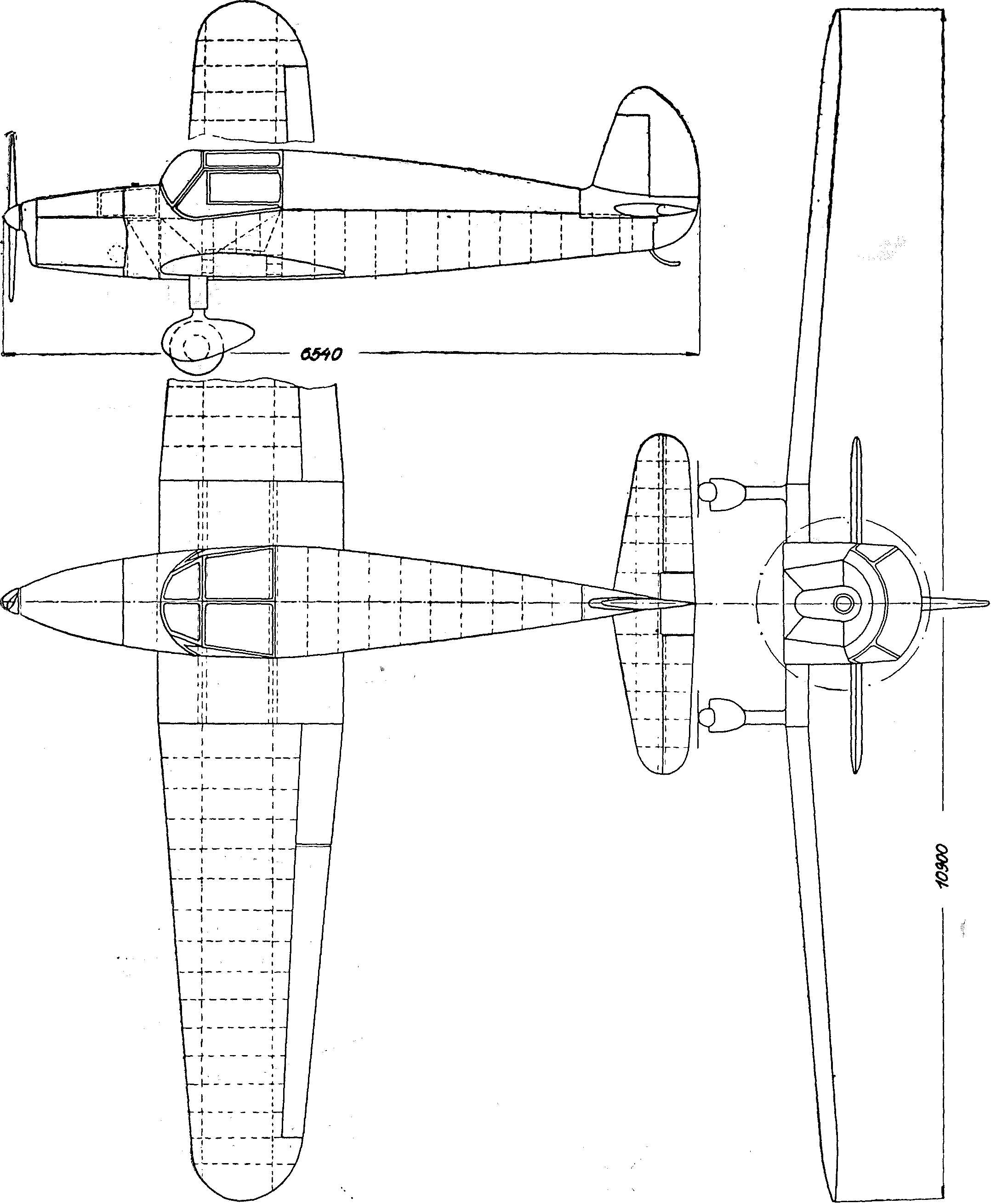
Chrislea „Airguard" Leichtflugzeug.
De Havilland Moth Minor.
De Havilland hat seit mehreren Jahren einen Tiefdecker, hauptsächlich für privaten Gebrauch, für Reise und Sport entwickelt. Bei der Konstruktion war maßgebend nicht nur eine hochwertige Maschine, sondern ein in allen Teilen einfaches, leicht zu überwachendes und reparierendes Flugmittel zu schaffen. Serienmäßig wird der Minor gebaut als zweisitzige offene und Kabinenmaschine mit Gipsy-Minor-Motor 2600 U/min 90 PS, 2250 U/min 80 PS Startleistung, im normalen Reiseflug 60 PS (66,6%) 2250 U/min. Zylinderinhalt 3,759 1. (Gewicht 97,6 kg.)
Flugeigenschaften stabil um alle Achsen. Ist nicht zum trudeln zu bringen. Einsitzig kann die Maschine von jedem Führersitz aus, ohne daß die Flugeigenschaften sich ändern, geflogen werden. Hierbei ist der vordere
De Havilland Moth Minor.
Zeichnunz: Flusrsoort
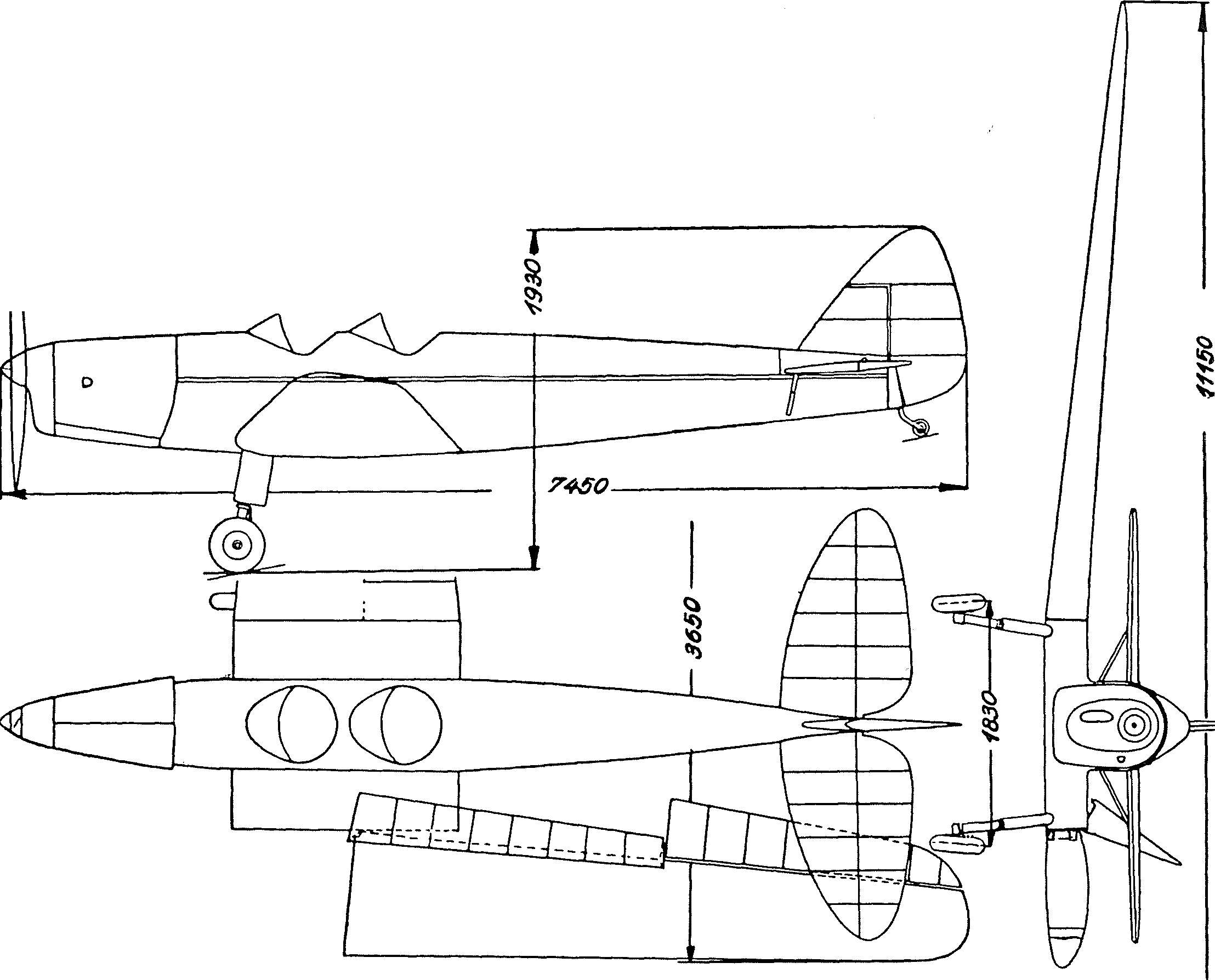
liül iplilpilii
.....................,..............Hnni^^ni
llliliBH^
fei
De Havilland Moth Minor. Oben mit Kabine. Unten mit offenen Sitzen.
Archiv Flugsport
Sitz günstiger mit Rücksicht auf das Gesichtsfeld. Kurzer Start. Steigen bei 104 km/h. Steuerfähigkeit auch bei abnehmender Geschwindigkeit. Landeklappen wirken nur als Luftbremse nicht für Auftrieb. Falsche Betätigung daher ausgeschlossen. Flughandhabung leichter wie bei der alten Original-Moth. Kunstflugtauglich, auch für Fortgeschrittenen-Schulung geeignet.
Hörrohre eingebaut. Flügel mit schmalem Mittelstück nach hinten zurückklappbar, auf 3,65 m Breite. Gesamtaufbau Holzkonstruktion.
Flügelholme mit Sprucegurten, Sperrholz bedeckt. Querruder sowie die beim Zurückklappen der Ansatzflügel nach oben wegklappbaren Flügelhinterenden, Holzgerippe mit Leinwand bedeckt. Querruder gewichtlich und aerodynamisch ausgeglichen.
Sitze hintereinanderliegend, große Rumpfbreite. Vorderer Sitz unter dem fast leeren Instrumentenbrett, großer Ablegeraum, sogar für kleines Handgepäck. Hinter dem Hintersitz Gepäckraum. Gleichzeitig in den beiden Sitzen Raum für Fallschirme.
Im linken Flügelstummel Betriebsstoffbehälter 59 1 enthaltend, ausreichend für 486 km. Im rechten Flügelstummel Gepäck oder Zusatztank für längere Flüge.
Führerraum vollständig gasfrei. Im vorderen Sitz außer Steuerknüppel und Fußhebel links Gasdrossel, Trimmrad für Höhenleitwerk, Radbremse, Luftbremse. Instrumente: Höhenmesser, Luftgeschwindigkeitsanzeiger, Drehzähler, Oeldruckmanometer.
Luftbremse unter dem Mittelstück. Höhenleitwerk, Holzbauweise, nach unten verstrebt mit großen Löchern, Antrieb durch Handhebel vermittels Kabel.
Fahrwerk, freitragende Federbeine, nur Gummiabfederung. Bremsen differentialgesteuert.
Sehr einfach ist die Befestigung der freitragenden, leicht nach vorn gestellten, Federbeinen an dem Vorderholm des Mittelstücks.
Hauptaugenmerk hat De Havilland auf einen ausgedehnten Kundendienst und Ersatzteillager in allen Ländern gelegt.
Spannweite 11,15 m, Länge 7,45 m, Höhe 1,93 m, Spurweite 1,83 m,
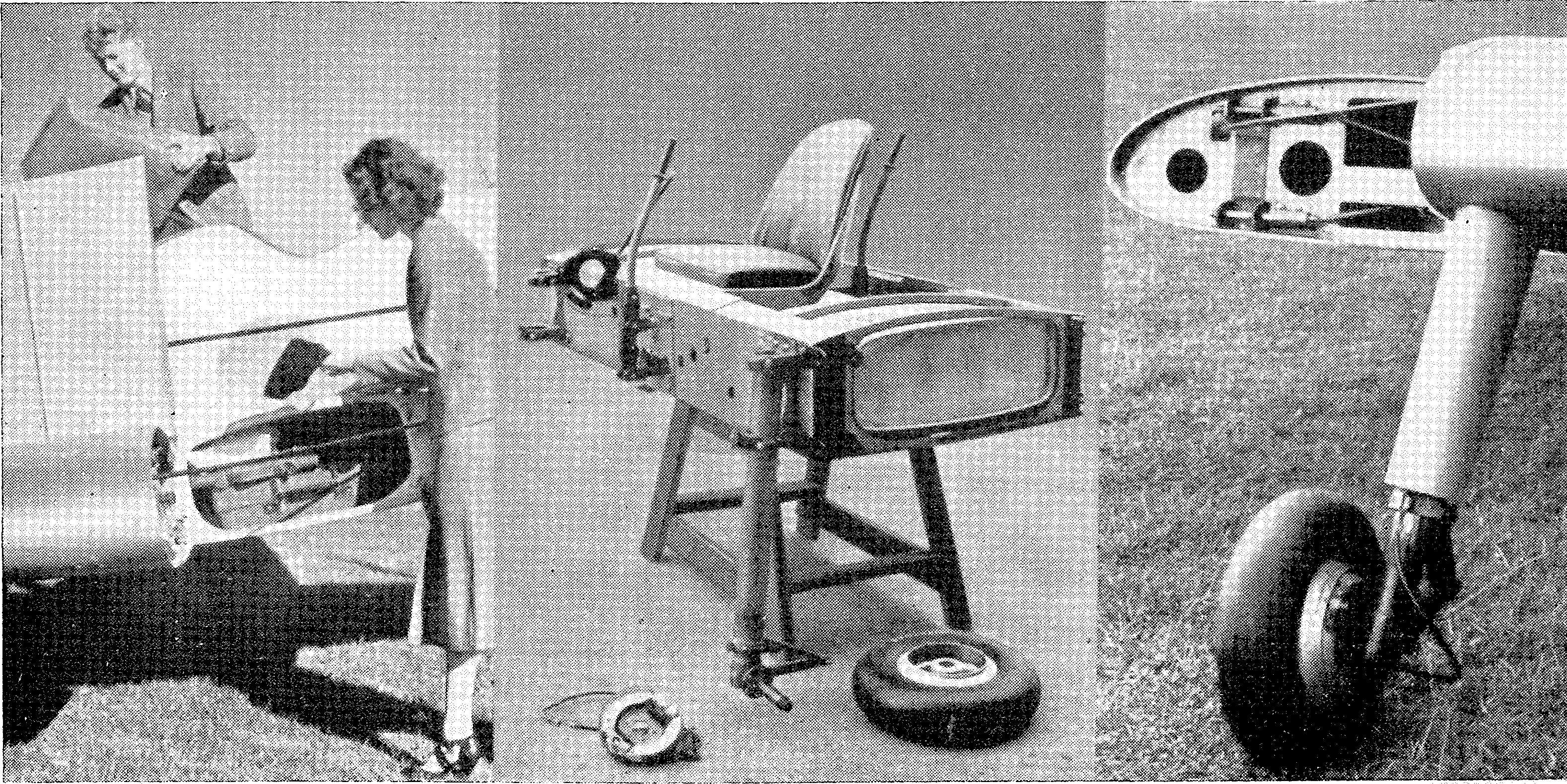
De Havilland Moth Minor. Links: Rechter Flügel zurückgeklappt, Kofferraum geöffnet. Mitte: Flügelmittelstück. Man beachte die einfache Bauweise, Montage der Steuerknüppel an den Holmen, ferner freitragende Federbeine, wenig nach vorn gentigt, sowie Einbau des Betriebsstoffbehälters. Rechts: Rechter Flügel zurückgeklappt. Man beachte die Verriegelungsvorrichtung.
Archiv Flugsport
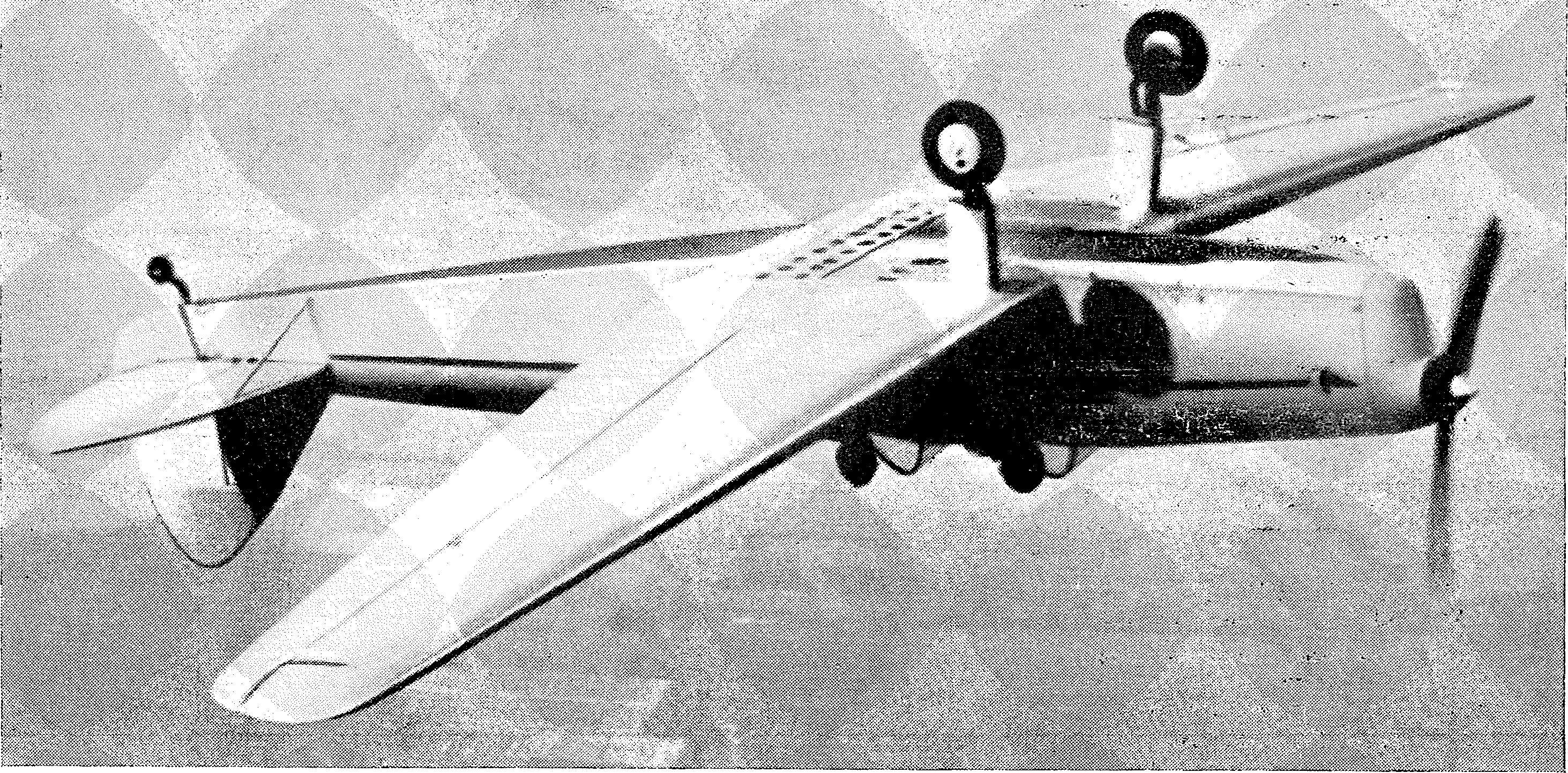
De Havilland Moth Minor mit offenen Sitzen im Rückenflug.
Archiv Flugsport
Leergewicht 430 kg, Fluggewicht 679 kg (für Schulbetrieb Leergewicht 441,6 kg, Fluggewicht 659,9 kg, für Kunstflug Fluggewicht 656,8 kg). Höchstgeschwindigkeit 193 km/h, Reisegeschwindigkeit 161—169 km/h, Landegeschwindigkeit 75,5 km/h, Start 170 m ± 14 m. Auslauf 96 m ± 14 m, Steigfähigkeit 3,15 m/sec, auf 1524 m in 9,5 Min. Gipfelhöhe 4900 m.
Preis der Moth Minor £ 575.
Saiman 202.
Der zweisitzige freitragende Tiefdecker wurde von der Societa Anonima Industrie Meccaniche Aeronautiche Navali gebaut; der Entwurf stammt von Ing. Sacerdote.
Flügel 2 Holme trapezförmig mit abgerundeten Enden. Holzbau. Landeklappen mit 60° Ausschlag.
Rumpf rechteckiger Querschnitt; nebeneinanderliegende Sitze, Doppelsteuerung. Seitenfenster und durchsichtige Abdeckung. Hinter der Kabine Gepäckraum.
Leitwerk in der Form wie Flügel; Höhenleitwerk nach dem Rumpf zu abgefangen.
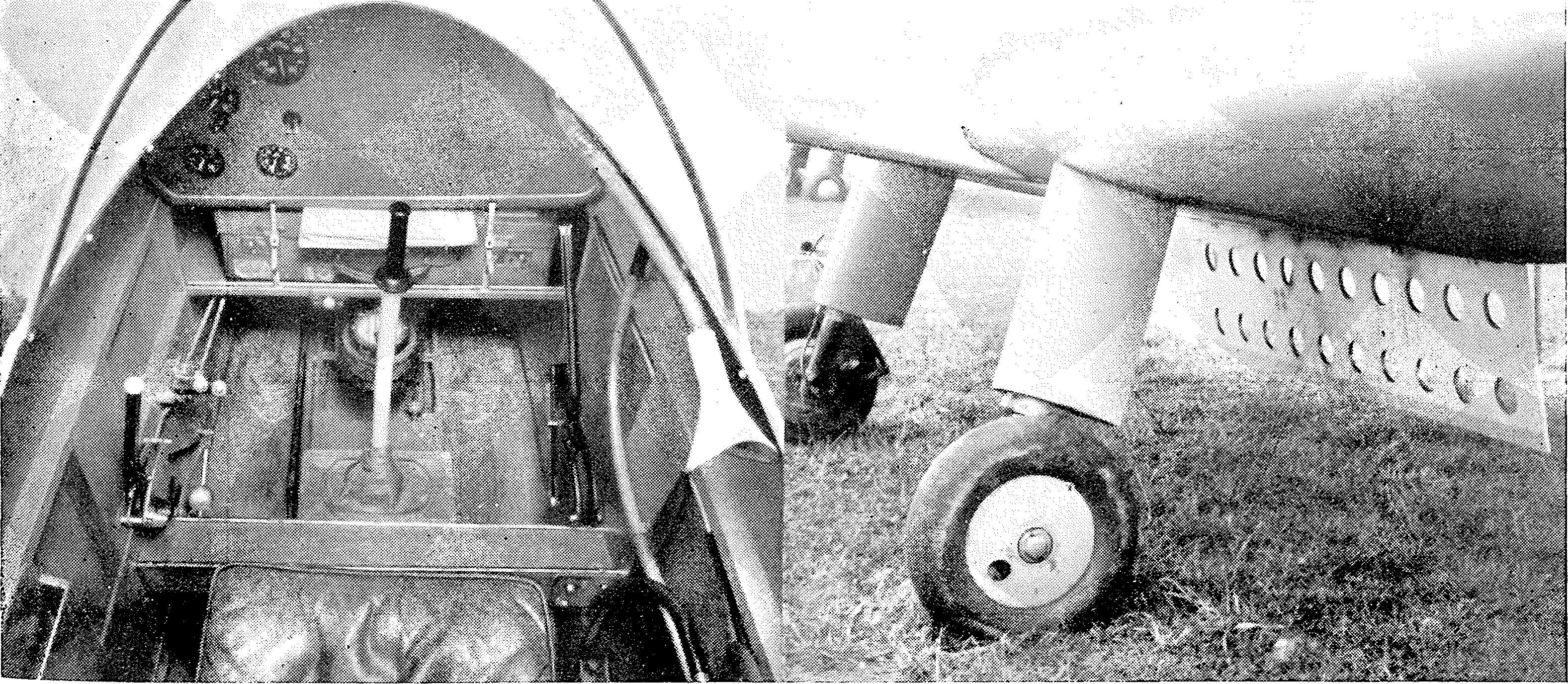
De Havilland Moth Minor. Links: Blick in den vorderen Sitz. Man beachte den Kofferraum unter dem Instrumentenbrett. Rechts: Landeklappe.
Archiv Flugsport
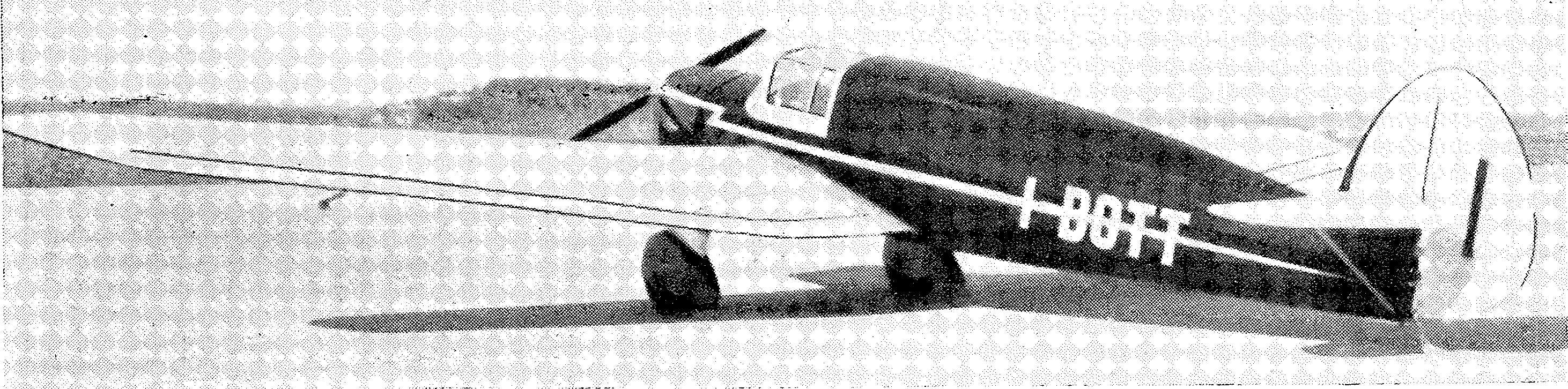
„Saimatl" 202, mit Alfa 110 Motor. ßild: Shell Aviation News
Fahrwerk in 2 Hälften am Vorderholm montiert.
Triebwerk Alfa 110 120 PS. 4 Zylinder luftgek. i. Reihen. Gesamtvolumen 6,124 1, Gewicht 136 kg.
Spannw. 11,2 m, Länge 7,7 m, Höhe 2,1 m, Fläche 18 m2
Leergew. 635 kg, Zuladung 300 kg, Fluggew. 935 kg. Flächenbelastung 52 kg/m2.
Höchstgew. 230 km/h, Reisegeschw. 200 km/h, Landegeschw. 70 km/h. Dienstgipfelhöhe 5000 m, Aktionsradius 1000 km; Startweg 130 m.
De Havilland „Flamingo", D. H. 95.
Bei dem Verkehrsflugzeug De Havilland D. H. 95 wurde nach vorausgegangenen Vorversuchen im Januar 38 mit dem Bau begonnen. Am 28. Dezember wurden die ersten Flugversuche, darunter auch 5-Std.-Flüge, ausgeführt.
Dieser Verkehrstyp wurde den Erfordernissen des engl. Luftverkehrs entsprechend auch mit Rücksicht auf die Dominions entwickelt. Das Gewicht beträgt ungefähr die Hälfte des Albatross, der 14 t wiegt. Die Reisegeschwindigkeit ist die gleiche. Die vorliegende Ausführung als Hochdecker ist auch als See-Flugzeug, ferner in der Ausrüstung mit Skiern in Aussicht genommen.
Zwei Schiebermotoren Bristol Perseus XIIc 850 PS mit De Havilland Verstellschrauben in der Flügelnase. Reisegeschwindigkeit 320 km/h.
Kabine für Langstreckenflüge 12 bis 17 Fluggäste. Bei Zubringerdienst für kürzere Strecken 20 Fluggäste. Kabine größte Breite 2,24 m, hinten 2,18 m. Länge 4,9 m.
Gepäckräume hinter der Fluggastkabine und unter dem Führerraum.
Die Hochdeckerform wurde gewählt mit Rücksicht auf eine bessere Sicht aller Insassen, ferner um die Flügel weiter vom Boden
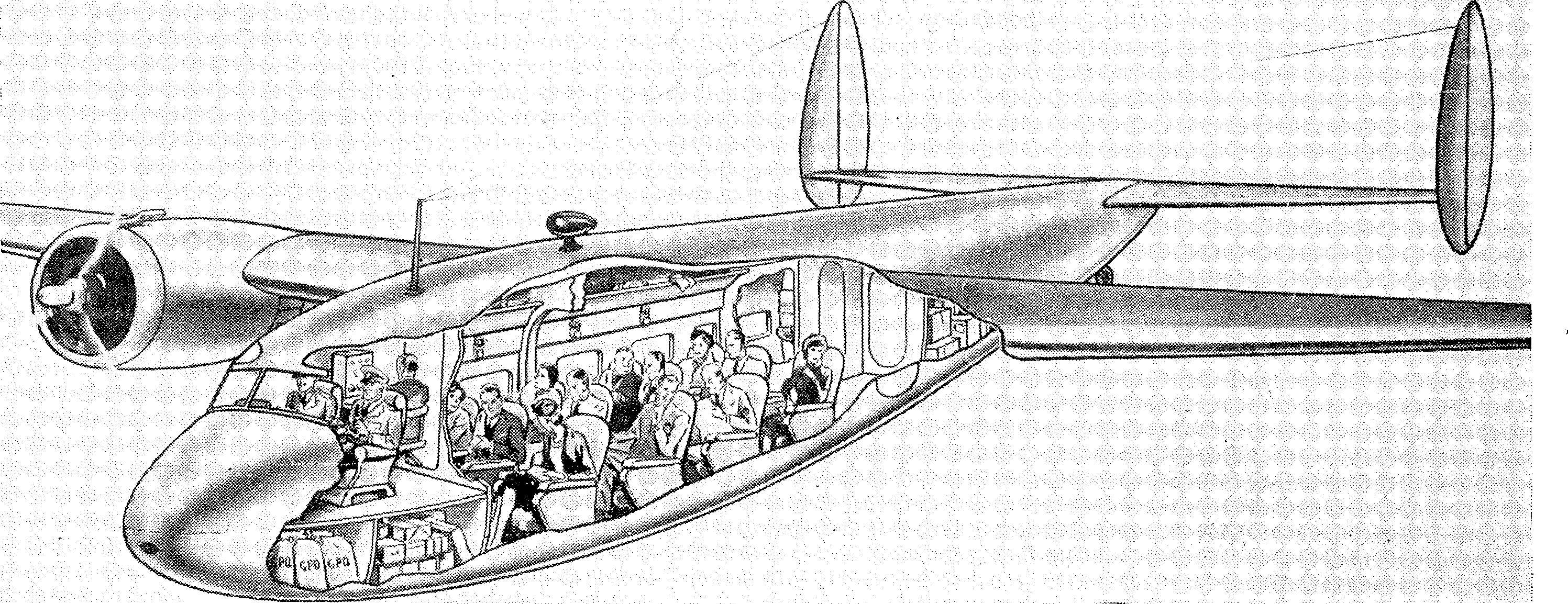
De Havilland „Flamingo" D. H. 95.
Werkbild
De Havilland „Flamingo" D. H. 95. Werkbüd
wegzubekommen, um bei Außenlandungen Hindernissen, wie Zäunen, auszuweichen.
Fahrwerk nach hinten hochziehbar in die Motorenverkleidung. Leitwerk auf der Rumpfoberseite mit Endscheiben und Seitenruder.
Flügel dreiteilig, Mittelstück und Endflügel. Landeklappen, die andere Hälfte Querruder.
Spannweite 20,10 m, Länge 15,25 m, Höhe 4,65 m. Nutzlast ungefähr 2250 kg. Steiggeschwindigkeit mehr als 7,6 m/sec.
Dewoitine „D-342".
Diese neue zweimotorige Verkehrsmaschine der SNCA du Midi ist aus dem Typ D 338 entwickelt worden, den wir im „Flugsport" 1936, S. 614, beschrieben haben. Flügel freitragend, Mitteldeckeranordnung; trapezförmig mit elliptischer Abrundung. Doppel-T-förmiger Holm. Tragende Außenhaut ; nur Querruderklappen blechbeplankt. Starke V-Form.
Rumpf elliptischer Querschnitt, aus einem Stück, blechbeplankt. Fluggastraum für 24 Fluggäste, dahinter Kombüse und im Rumpfhinterteil Frachtraum.
Leitwerk freitragend, Höhenflosse liegt oberhalb der Mittellinie des mittleren Motors. Flossen Qanzmetall, Ruder blechbeplankt mit Flettnerrudern; statisch und aerodynamisch ausgeglichen.
Dewoitine „D-342", 950 PS Gnöme-Rhone 14-N, 17.
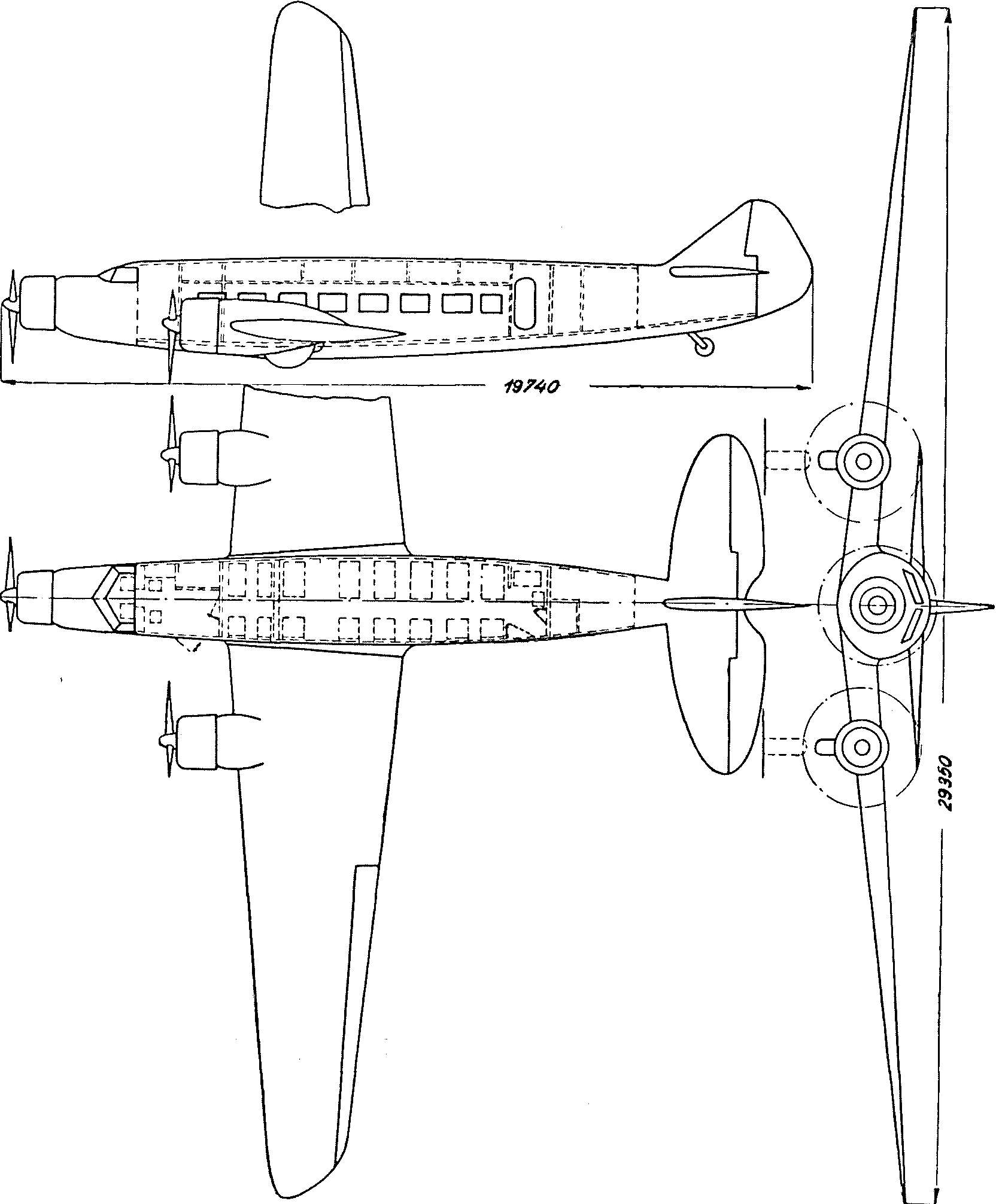
Fahrwerk nach hinten halb in die Motorgondel einziehbar.
Triebwerk 3 Gnome-Rhone 14-N 17 mit je 950 PS in 1750 m Höhe; Brennstoffbehälter im Flügel.
Spannw. 29,35 m, Länge 19,74 m, Höhe 4,77 m; Fläche 98,2 m2.
Leergew. 8340 kg, Mannschaft 360 kg, Betriebsstoff 1600 kg, Fluggäste 2160 kg, Fracht 600 kg, Fluggew. 13 060 kg.
Flächenbelastung 133 kg/m2, Leistungsbelastung 4,6 kg/PS; Höchstgeschw. am Boden 340 km/h, in 1750 m Höhe 370 km/h, in 1750 m Höhe mit 2 Motoren 312 km/h; Reisegeschw. (65%) in 2000 m Höhe 320 km/h. Theoretische Gipfelhöhe 8400, mit 2 Motoren 5700 m.
Cunliffe-Owen „Flying Wing".
Die von der Cunliffe-Owen Aircraft. Ltd. Southampton, entwickelte Verkehrsmaschine zeigt den neuesten Stand der Burnelli-Bauweise (s. „Flugsport" 1929, S. 110—121; 1930, S. 43 und 1936, S. 95). Wenn man den Burnelli-Verkehrsschulterdecker U. B.-14, den wir 1935, S. 585, beschrieben haben, mit dem „Flying Wing" vergleicht, vermutet man zunächst eine direkte Weiterenwicklung derselben Firma. Konstruktiv ist die Maschine aber auf den neuesten Entwicklungsstand gebracht worden.
Hauptmerkmal der Burnelli-Konstruktion war bisher: vollständig zusammengerückte Motoren, anstelle eines Rumpfes ein breites Mittelstück, zwei Leitwerksträger. Bei den neueren Konstruktionen ist das Mittelstück breiter geworden und das Höhen- und Seitenleitwerk unter Wegfall von irgendwelchen Verspannungen näher an das Mittelstück herangerückt und insbesondere wesentlich höher verlagert. Vermutlich haben sich bei Betätigung der Landeklappen unangenehme Beeinflussungen auf das Höhenleitwerk bemerkbar gemacht. Eigenartig ist noch die stark nach vorn geneigte Achse des Seitenleitwerks.
Im Flügelmittelstück Fluggastraum für 15 bis 20 Fluggäste; liefert normal 20% des Gesamtauftriebes. Bei großen Anstellwinkeln ist der Anteil der Außenflügel größer, im Schnellflug soll nach Kanalmessungen das Flügelmittelstück 90% des Gesamtauftriebes liefern. Vier Hauptquerschotten, Duralumin-Profile.
Auß e nf lügel z weihol-mig, dünne Duraluminbeplankung ; Trägerrippen zur Aufnahme der Brennstoffbehälter, deren zusätzliche Beanspruchungen von einem Hilfsholm aufgenommen werden. Flügelspitzen leicht abnehmbar. Querruder ausgeglichen, hohes Seitenverhältnis. ( Hydraulisch betätigte Spaltklappen auf beiden Seiten zwischen Rumpf und Querruder.
Cunliffe-Owen „Flying Wing".
Zeichnuns:: Flugsport
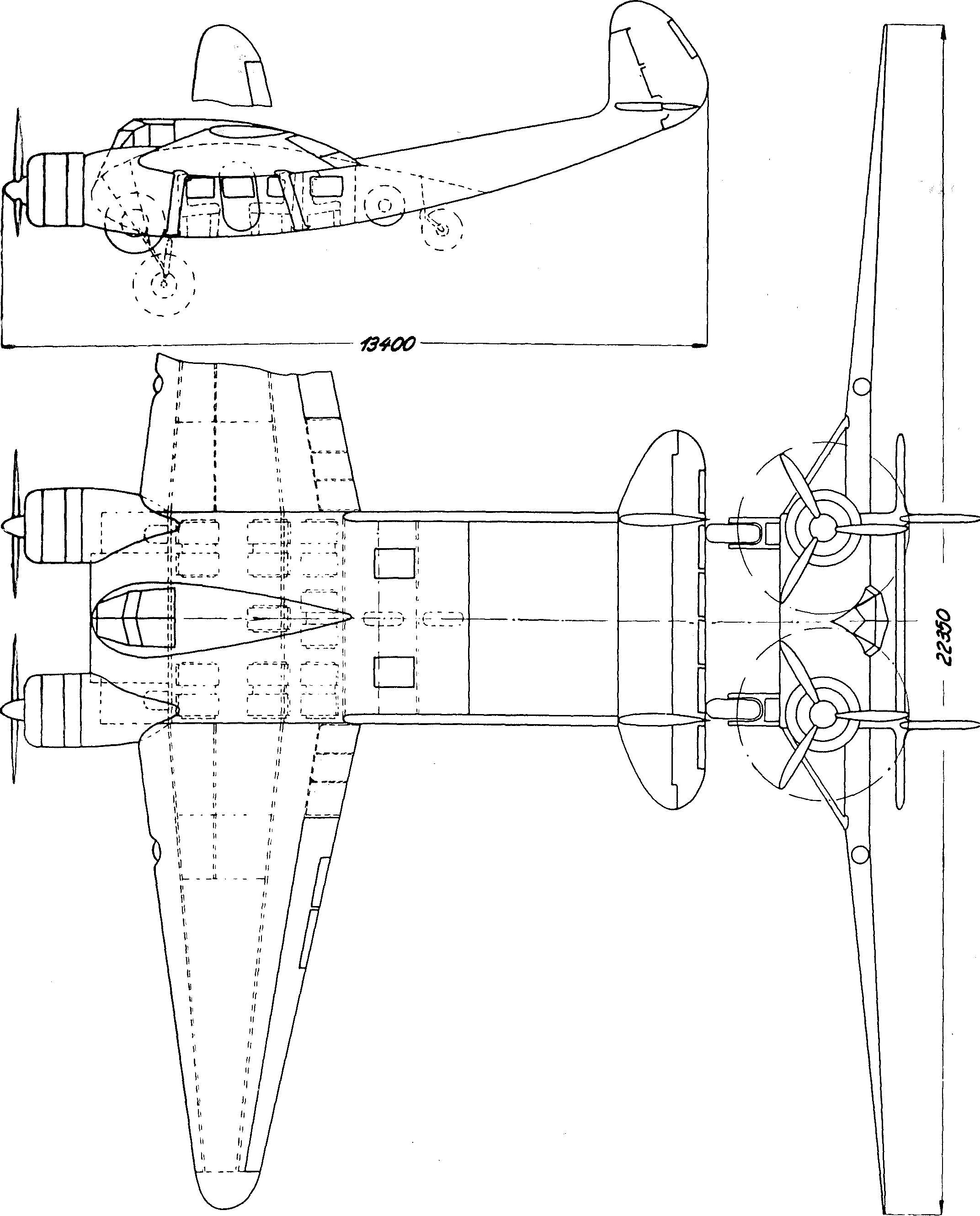
Cunliffe-Owen „Flying Wing". Man beachte die nahe zusammengerückten
Motoren. Archiv Flugsport
Beim U. B.-14 hat sich eine Klappe unter dem Rumpf gut bewährt, und ist auch hier vorgesehen. Die äußeren Spaltklappen können unabhängig von der hydraulischen Rumpfklappe betätigt werden.
Die beiden Leitwerksträger aus Duralumin D-Profilen, versteift; Kontrollklappen für die Steuerzüge.
Fahrwerk hydraulisch nach vorne in die Motorgondeln einziehbar; Spornrad ebenfalls nach vorne einziehbar.
Triebwerk 2 Bristol Perseus XIVC, neunzyl. Schiebermotor von je 900 PS Startleistung; Bristol Kühlerhaubenverstellung. VDM-Ver-stelluftschrauben von je 3,2 m Durchmesser.
Acht Brennstoffbehälter im Flügel, 2 von 243 1, 2 von 300 1, 2 von 450 1 und 2 von 470 1. Robertson Oel-Kühler.
Spannw. 22,35 m, Länge 13,4 m, Fläche 7,7 m2.
Fluggew. 4300 kg. Höchstgeschw. in Bodennähe 360 km/h, in 2800 m Höhe 376 km/h; Landegeschw. 107 km/h. Dienstgipfelhöhe 6090 m; größte Reichweite 3100 km.
Ital. Fiat CR 42 Jagd-Doppeldecker.
Auch bei der italienischen Luftwaffe ist man bei Jagdflugzeugen unter Berücksichtigung aller luftkampftechnischen Voraussetzungen noch nicht klar über die Frage Doppeldecker oder Eindecker. Geklärt indessen scheint die Frage, unbedingt luftgekühlter Motor, da der wassergekühlte Motor trotz seiner spezifischen Leistungsfähigkeit im Luftkampf zuviel Einwirkungen ausgesetzt ist, von seinem höheren Gewicht gar nicht zu sprechen. —
Man hat daher in Italien unter Mitwirkung der Militär-Sachverständigen einen Doppeldecker, den Fiat CR. 42, und einen Eindecker, den Aer. Macchi C. 200, gebaut. Beide sind mit dem gleichen luftgekühlten doppelreihigen Sternmotor Typ Fiat A. 74 ausgerüstet.
Dieser neue Typ Fiat CR. 42 ist eine Weiterentwicklung des in
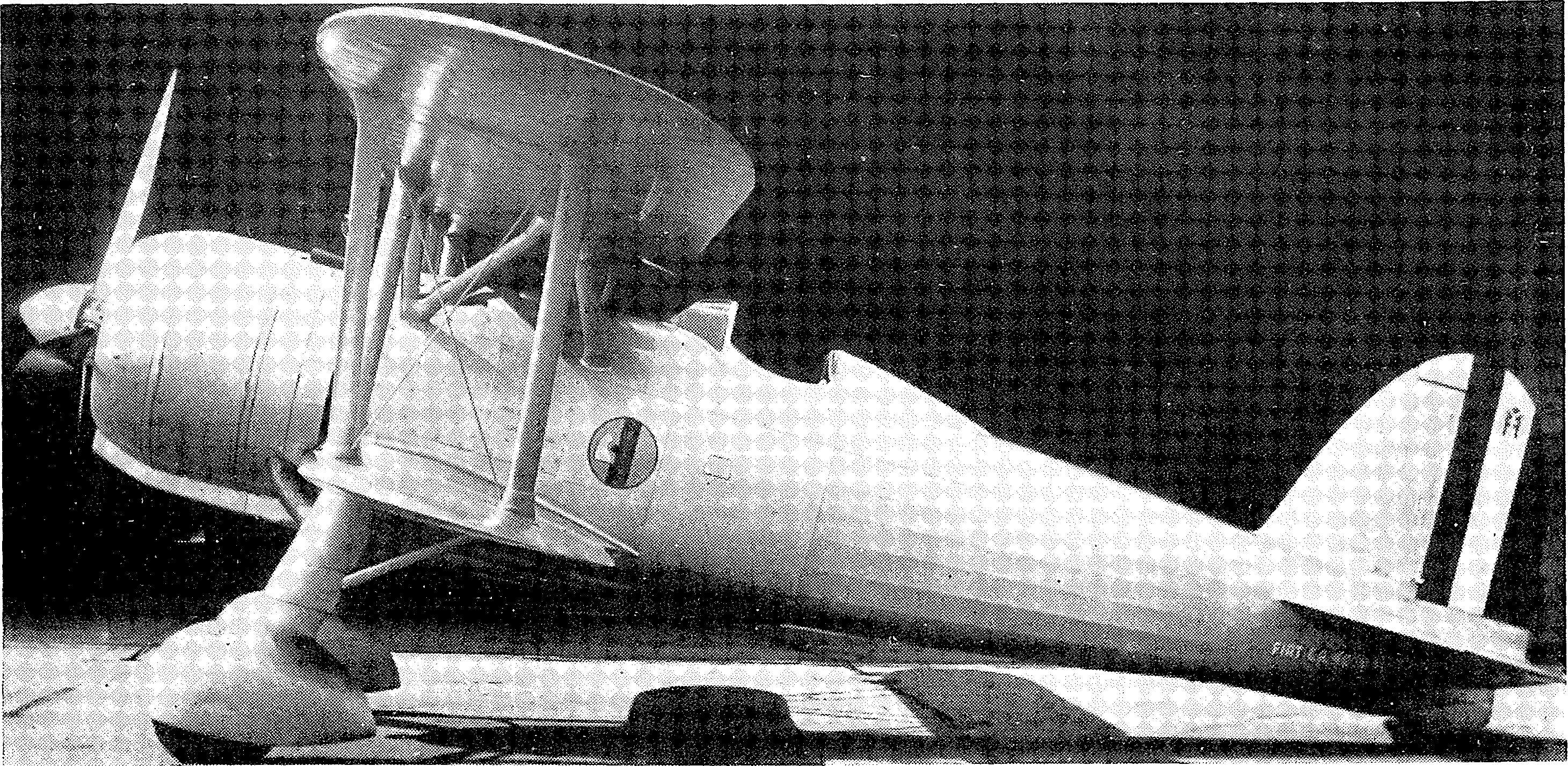
Fiat CR. 42. Werkbild
Spanien bewährten Fiat CR. 32. (Soll 500 Abschüsse zu verzeichnen haben.) Die neue Maschine wird besonders beeinflußt durch den neuen luftgekühlten Motor, den Fiat A 74 RC 38 14-Zylinder 840 PS in 3800 Meter Höhe mit dreiflügeliger Luftschraube mit während des Fluges veränderlicher Steigung (Hamilton). Gipfelhöhe, Flug- und Steiggeschwindigkeit wurden erhöht.
Tragwerk großer Oberflügel, kleiner Unterflügel, im Dreiecksverband versteift und beide Stielreihen gegeneinander verspannt. Profil mit nach außen gewölbter Unterseite. Holme viereckige Duraluminrohre, zur Erleichterung dreieckig ausgepart. Querruder aerodynamisch und statisch ausgeglichen.
Rumpf Stahlrohrrahmenwerk, viereckiger Querschnitt mit aufgelegten Formspanten und Rippen. Vorn mit Duralumin, hinten mit Leinwand bedeckt. Führersitz nahe unter der Oberflügelhinterkante, gute Sicht nach oben, nach vorn und auch nach unten infolge des schmalen Unterflügels. Sitz in der Höhenlage während des Fluges bequem verstellbar.
Fahrwerk zwei Oeldruckfederbeine ohne Achse, nach dem Rumpf verstrebt.
Doppelte Radbremsen. Schwanzrad mit Oleostoßaufnehmern lenkbar. Hochziehbares Schwanzrad vorgesehen.
Höhen- und Seitenleitwerk freitragend. Ganz in Duralumin. Höhenruder im Fluge trimmbar.
Spannweite 9,7 m, Länge 8,26 m, Höhe 3,35 m, Leergewicht 1650 kg. Höchstgeschwindigkeit in 4000 m 450 km/h. Landegeschwindigkeit 122 km/h. Steigfähigkeit auf 4000 m in 4,50 Min., auf 6000 m in 8,20 Min., Gipfelhöhe 9700 m.
Ital. Jagdflugzeug Aer. Macchi C. 200.
Der Aer. Macchi C. 200, Konstrukteur Mario Castoldi, wurde zum erstenmal auf der Belgrader Ausstellung gezeigt. Ueber Einzelheiten war damals nichts zu erfahren. Die später stattgefundenen eingehenden Flugeigenschaftsprüfungen ergaben überraschenderweise eine gleiche Wendigkeit wie bei Doppeldeckern. Es ist das erste Mal, daß in dieser Hinsicht ein einwandfreies Prüfurteil gegeben worden ist.
Flügel Ganzmetall, freitragend mit großen Auswölbungen am Flügelanschluß nach dem Rumpf. Verstellbare Querruder für Start und Landung.
Schalenrumpf mit nach hinten verschiebbarer Führerraumüber-
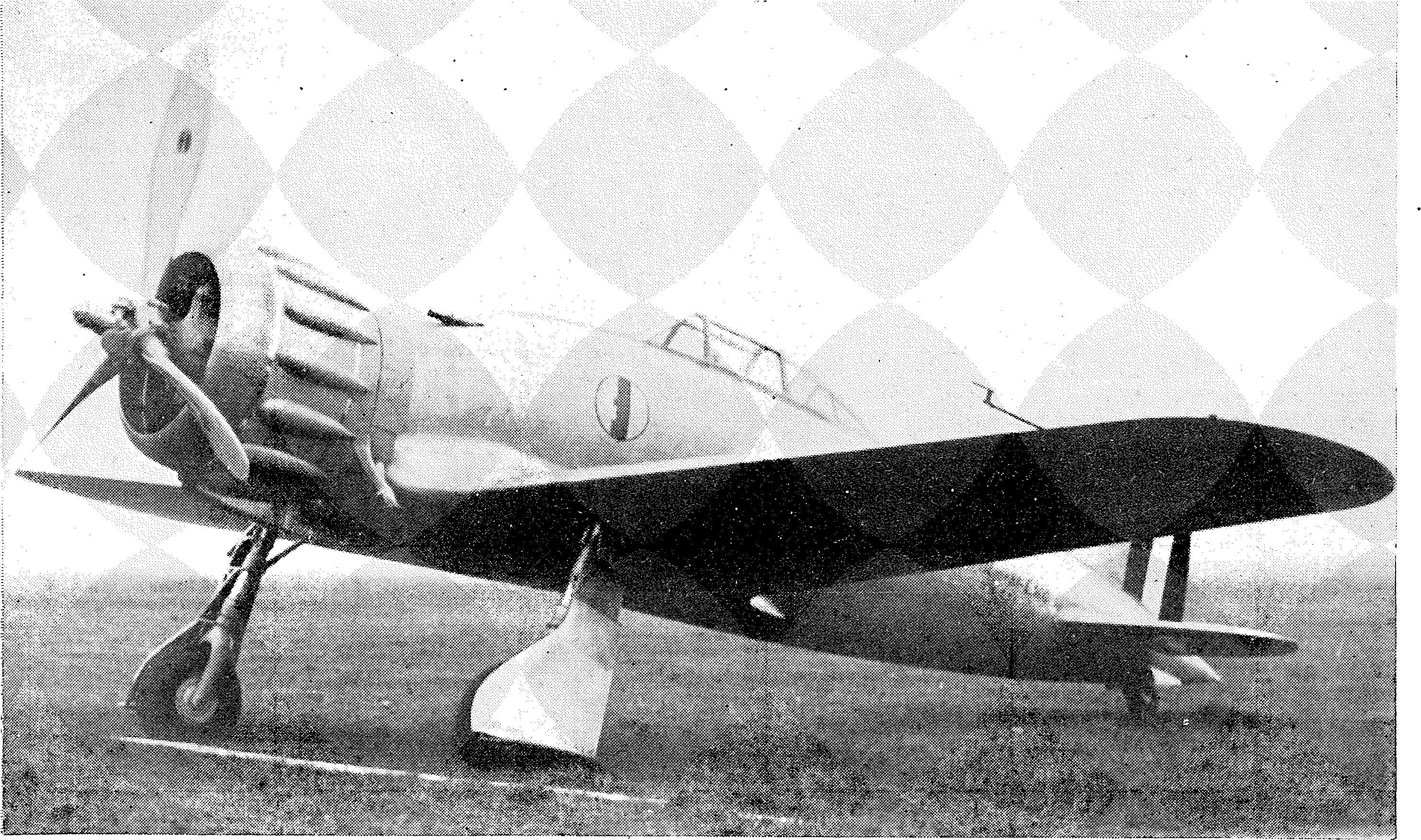
Aer. Macchi C. 200. Werkbild
dachung. Motor der gleiche wie beim Fiat CR. 42, ein Fiat A. 74 RC. 38 Doppelstern luftgekühlt 850 PS in 3800 m Höhe mit Kompressor. Dreiblatt-Verstellschraube.
Fahrwerk nach dem Rumpf zu hochziehbar. Schwanzrad nach der Rumpfspitze nach hinten verschwindbar.
Spannweite 10,6 m, Länge 8 m, Höhe 3,4 m, Leergewicht 1770 kg. Höchstgeschwindigkeit in 4800 m 505 km/h, Steigfähigkeit auf 6000 m mit 340 kg Last in 6,30 min. Gipfelhöhe 10 400 m.
Festigkeitsprüfung löfache Belastung ohne Deformation.
Vultee-Bomber Typ V-12.
Der schnelle Tagbomber, der sich besonders für Tiefangriffe eignet, wurde von der Airplane Developement Corp., Glendale, Kalifornien, aus dem Typ V—11 (s. „Flugsport" 1936, S. 12) entwickelt. Der V—11 soll sich strategisch in Ethiopia, Spanien und im Orient gut bewährt haben. Konstruktiv stellt der neue Typ die auf den neuesten Entwicklungsstand gebrachte, hinreichend bekannte Vultee-Glattblech-bauweise dar. Triebwerk Wright GR—1820 G—105 A 900 PS in 2000 Meter Höhe ausgerüstet mit Zweiganggebläse. Die Reisegeschwindigkeit konnte bei der Ausführung für Angriffs- und Kampf zwecke von 340 auf 351 km/h erhöht werden.
In der Zeichnung erkennt man unter dem Rumpf die Aufhängung für große Bomben, in der Mitte des Rumpfes unten ein Bombenmagazin für kleinere Bomben. Neben dem in der Flügelnase eingebauten MG. oder MK. ist für die Abwehr oberhalb des Rumpfes ein MG., ferner unterhalb des Rumpfes ein MG. nach hinten unten
Vultee-V-12, Bomber.
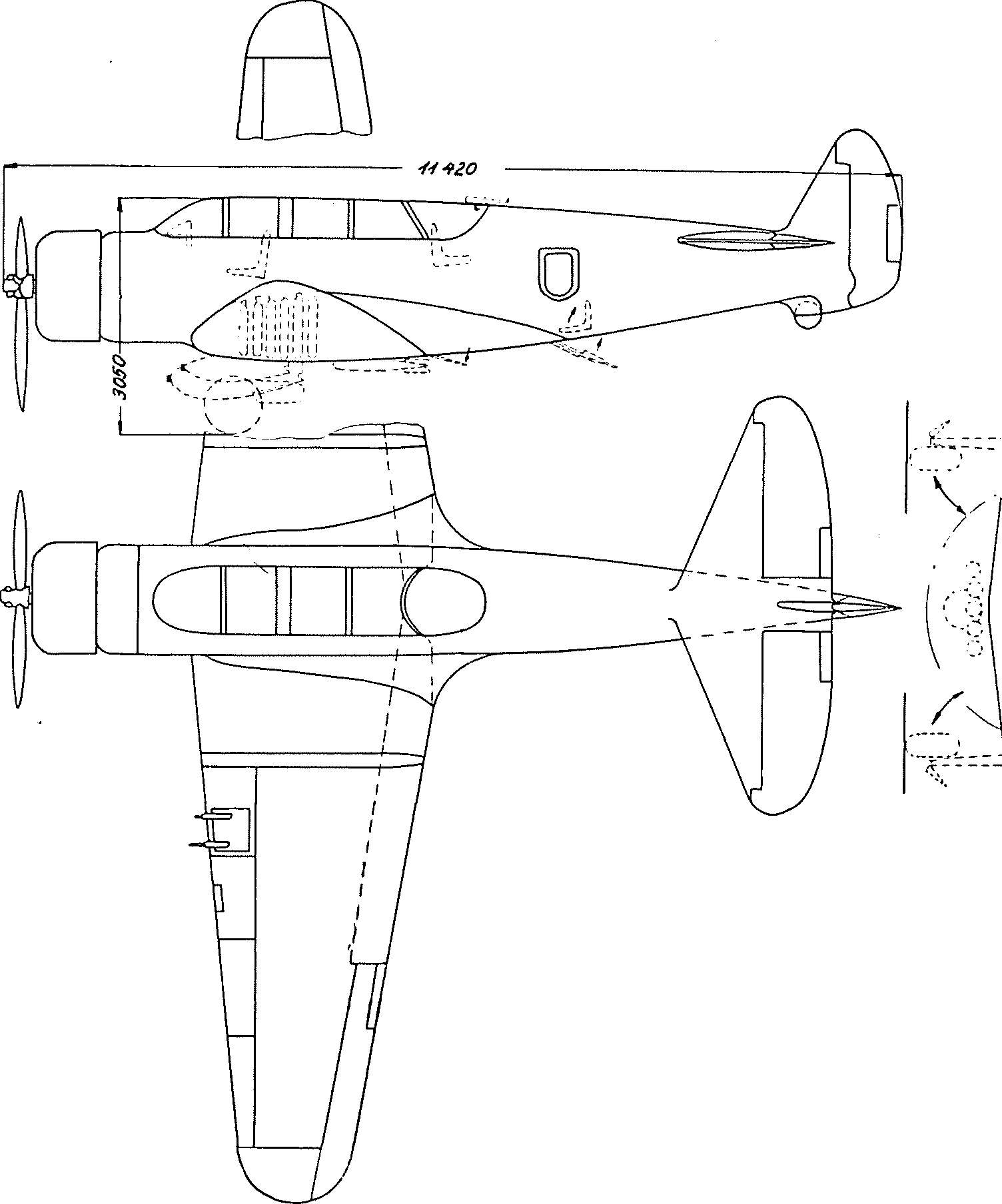
herausklappbar angeordnet. Der darüber befindliche Führersitz kann weggeklappt werden. Etwas weiter nach vorn in Höhe der hinteren Flügelkante ein Beobachtungsfenster, aufklappbar, für die Bombenzielvorrichtung oder auch Lichtbildgerät.
Spannw. 15,25 m, Länge 11,42 m, Höhe 3,05 m, Flügelfläche 35,67 m2.
Für Angriffs- u. Kampfzwecke: Höchstgeschw. am Boden 349 km/h, in 2280 m Höhe 378 km/h, in 5780 m 392 km/h; Reisegeschw. in 3400 m 340 km/h, in 4565 m 351 km/h; Landegeschw. (ohne Bomben) 111 km/h. Steigzeit auf 2000 m 5,1 min, auf 3000 m 8,0 min, auf 4000 m 11,3 min, auf 5000 m 15,2 min, auf 6000 m 19,3 min. Dienstgipfelhöhe 7760 m; größte Reichweite 1930 km. Leergew. 2991 kg, Zuladung 1514 kg, Fluggew. 4505 kg.
Als Langstreckenbomber: Höchstgeschw. am Boden 328 km/h, in 2280 m 351 km/h, in 5780 m 358 km/h; Reisegeschw. in 3400 m 306 km/h, in 4565 m 306 km/h; Landegeschw. (ohne Bomben) 116 km/h. Steigzeit auf 2000 m 7,6 Min., auf 3000 m 12,1 Min., auf 4000 m 18,0 Min., auf 5000 m 25,5 Min., auf 6000 m 33,5 Min. Dienstgipfelhöhe 6690 m; größte Reichweite 3330 km (errechnet unter der Annahme, daß die Bomben abgeworfen sind, wenn der halbe Brennstoff verbraucht ist). Leergew. 2963 kg, Zuladung 2511 kg, Fluggew. 5474 kg.
Für Angriffs- und Kampfzwecke 2 Besatzungsmitglieder, 680 kg Brennstoff, 78 kg Oel und 273 kg Bomben; als Langstreckenbomber 3 Besatzungsmitglieder, 1347 kg Brennstoff, 102 kg Oel und 511 kg Bomben.
Lockheed Schnellbomber.
Der viel genannte Lockheed Schnellbomber, von dem in letzter Zeit England 200 Stück bestellt hat, ist hervorgegangen aus der Lockheed Super-Electra Typ 14, nur mit dem Unterschied, daß kurz vor dem Höhenleitwerk hinten ein MG-Drehturm und statt der Passagiereinrichtung Bombenmagazine eingebaut sind. Fahrwerk, Motoren und Flügel mit Fowlerflügeln an der Hinterkante sind die gleichen geblieben.
Abmessungen: Spannweite des Super-Electra 20 m, Länge 13,5 m„ Höhe 3,5 m, Fläche 51,2 m2, Leergewicht 440 kg, Fluggewicht max.. 7700 kg, Flächenbelastung 150 kg/m2, Höchstgeschw. m. zweimal 760 PS in 2000 m Höhe 400 km/h, Reisegeschw. m zweimal 450 PS in 4300 m Höhe 333 km/h, am Boden 300 km/h. (Vgl. auch die Typenbeschreibung „Flugsport" 1937, S. 513.)
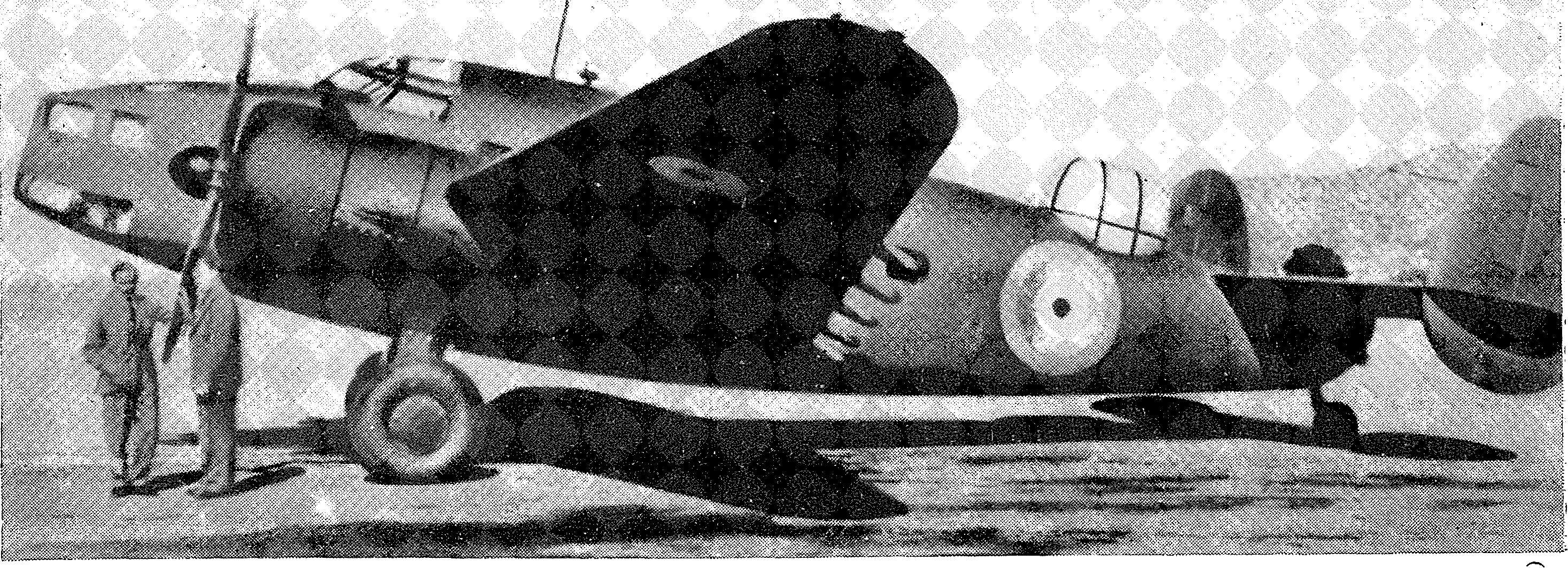
Lockheed Schnellbomber. Archiv Flugsport
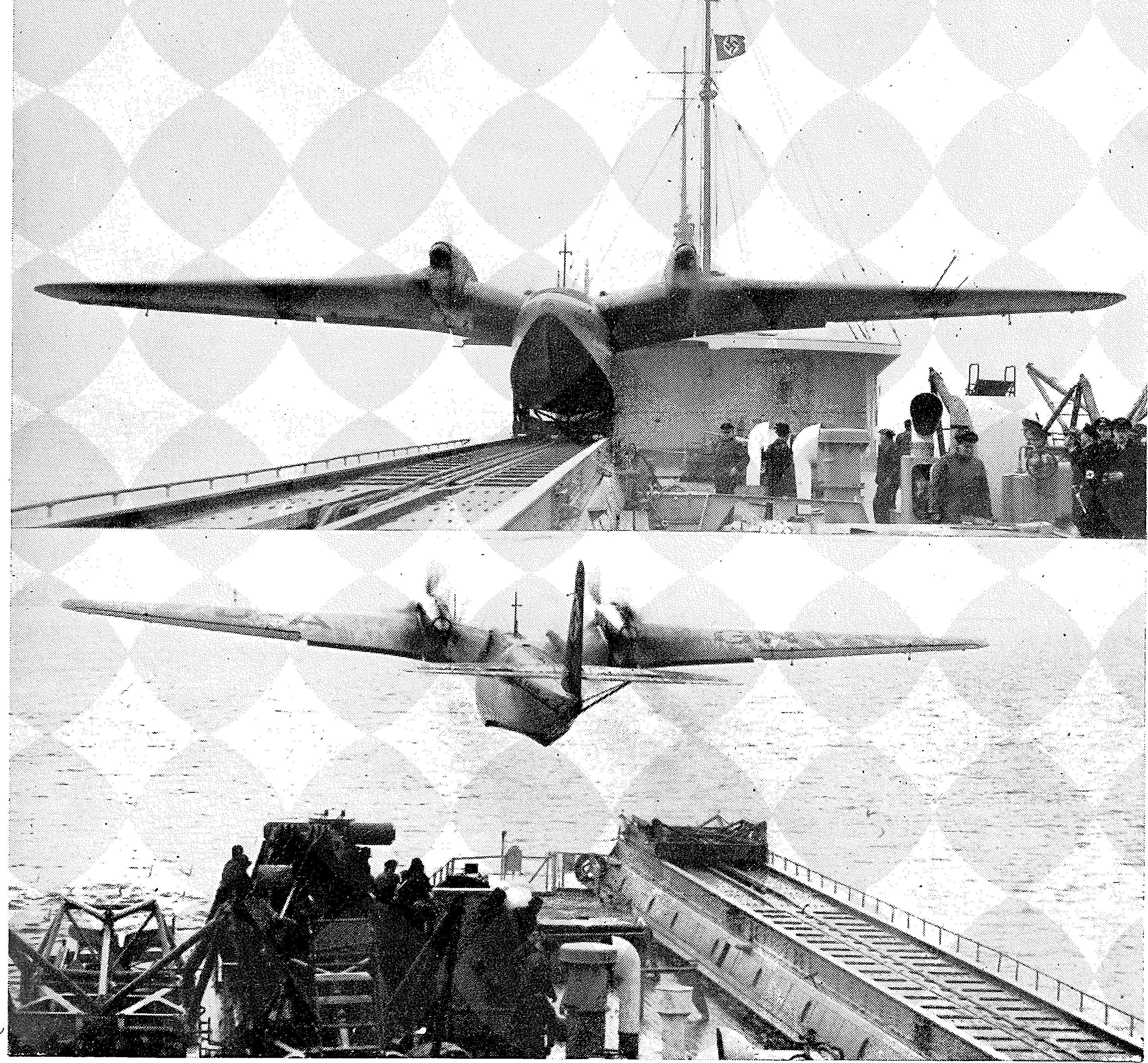
Flugboot Dornier Do 26. Oben: Auf der Katapultbahn des Flugzeugschleuderschiffs „Friesenland" kurz vor dem Abflug. Unten: Schleuderstart mit 19 000 kg Fluggewicht. Das Baumuster Do 26 besitzt 4 Junkers Rohölmotoren und kann 80 000 Luftpostbriefe oder entsprechende Fracht über eine Strecke von 9000 km befördern. Bei dem im Bild sichtbaren Abflug betrug das Fluggewicht des Bootes 19 000 kg. Am Ende der Schleuderbahn erkennt man den Schlitten, auf dem das
Flugboot ruhte. Bilder: A. Stöcker
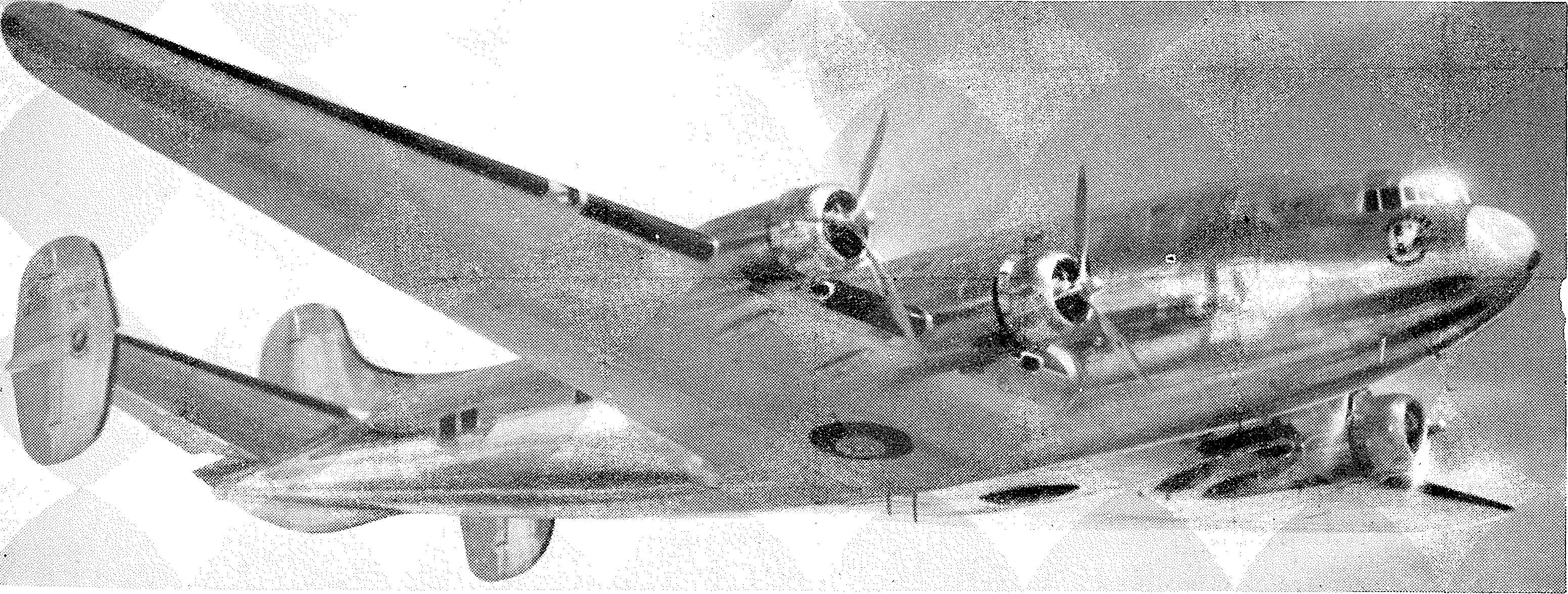
Douglas DC 4 mit zwei stillstehenden Motoren steuerbord. Man beachte die zwei dreiflügeligen Schrauben in Segelstellung, ferner das stark gezogene Höhenruder und Enteiserflügelnase sowie Nasen von Höhen- und Seitenleitwerk. Vergleiche die Typenbeschreibung Flugsport 1938, S. 364. Werkbild

Das neue Ozeanflugboot Dornier Do 26 wird nach dem Niedergehen auf das Wasser am Kran des Flugzeugschleuderschiffs „Friesenland", der es wieder an Deck hebt, festgemacht. Man beachte die seitlichen Stützschwimmer, die im Fluge zur Vermeidung unnötigen Luftwiderstandes in die Tragfläche hineingezogen
werden können. Bilder: a. Stöcker
Ultrakurzwellee-Höhenmeßgerät
ist in USA von der Western Electrical Co. und den Bell Telephone Laboratories für die United Air Lines entwickelt worden. Das Gerat besteht aus einem Geber im einen Flügelende, der Kurzwellen von 60 cm Länge in Richtung des Bodens aussendet, und einem Empfänger, der gleichzeitig die gesendeten Wellen sowohl vom Sender direkt als auch vom Boden reflektiert empfängt. Der Zeitunterschied zwischen den empfangenen Signalen ergibt die Flughöhe über Grund.
Dieser Zeitunterschied würde z. B. bei 1000 m über Grund nur
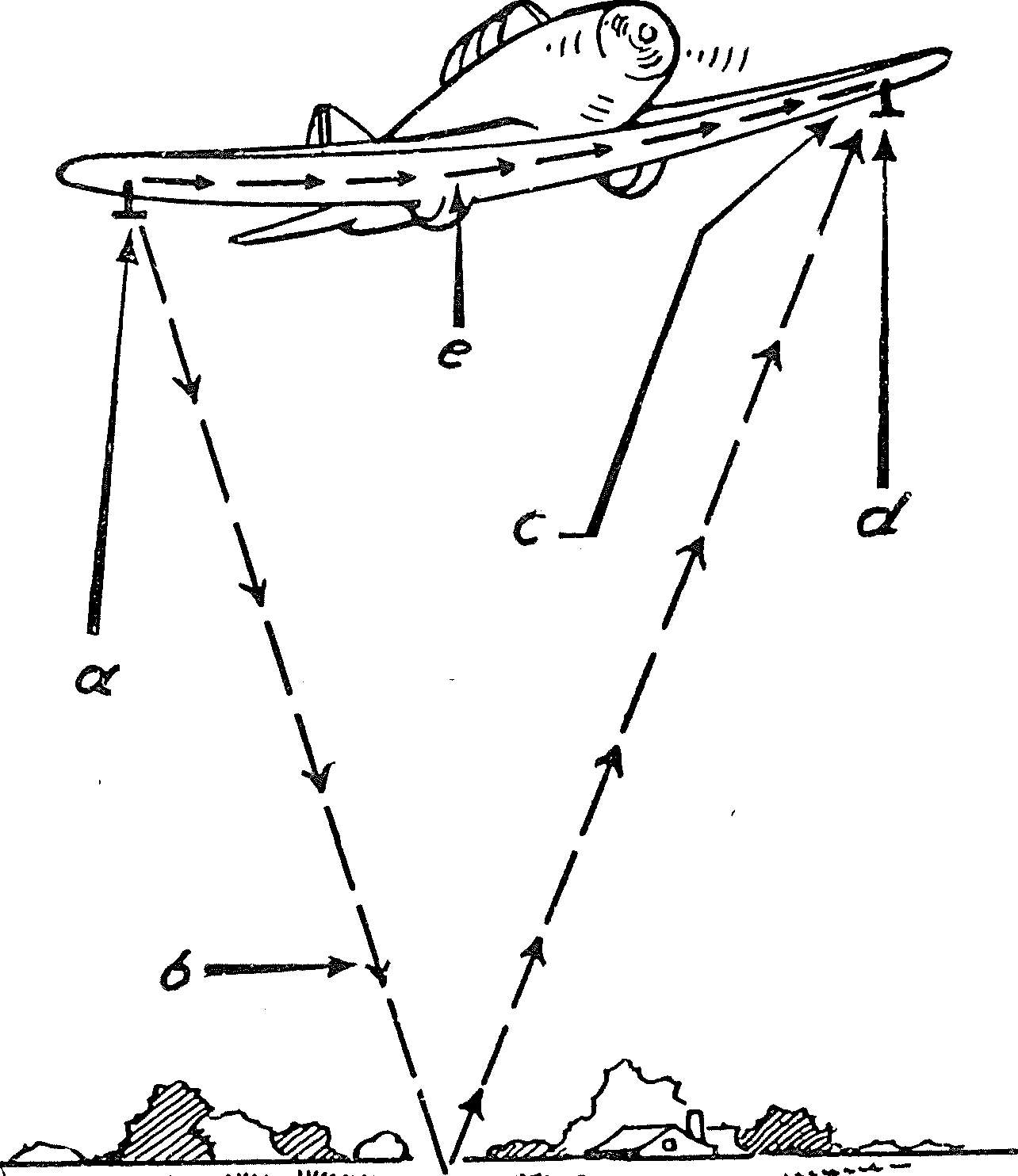
Ultrakurzwellen-Höhenmeßgerät, a Geber, b 490-Hz-Welle, c Empfänger, d 490- u. 495-Hz-Wellen, e 495 Hz-Welle.
Vsooooo sec betragen; derartig kleine Zeitintervalle können nicht mehr direkt gemessen werden. Da aber Frequenzunterschiede in dieser Größenordnung noch meßbar sind, wird die Frequenz des Gebers von 400 bis 510 Hz kontinuierlich variiert, d. h. die Schwingungszahl der Ultrakurzwellen wird proportional der Zeit verändert.
Die Wirkungsweise geht aus nebenstehender Abbildung hervor; "r^7^
die Welle wird mit 490 Hz gegeben, trifft auf dem Boden mit 490 Hz auf und erreicht auch den Empfänger mit 490 Hz; in der Zeit, in der die Welle den Weg vom Sender zum Boden und zurück zum Empfänger zurücklegt, hat aber der Sender seine Frequenz entsprechend geändert, in unserem Beispiel (s. nebenstehende Abb.) um 5 Hz. Die Welle mit 495 Hz erreicht den Empfänger auf dem direkten Weg unter dem Flügel gleichzeitig mit der reflektierten Welle von 490 Hz. Der Frequenzunterschied ist direkt proportional der Höhe vom Boden, die somit auf einem Frequenzmesser, der auf m Höhe geeicht ist, abgelesen werden kann.
Der Meßbereich des Gerätes beträgt 1500 m und sein Gewicht 20 kg. Für Flüge in unsichtigem Wetter kann die Richtung der gesendeten Strahlen in Flugrichtung verdreht werden, um z. B. den Anflug von Bergen oder sonstigen Hindernissen rechtzeitig erkennen zu können.
Ueberziehwarngerät.
Bekanntlich liegt die Durchsackgeschwindigkeit in der Kurve höher als im Normalflug, da Zentrifugalkräfte ausgeglichen werden müssen, und der Auftrieb größer wird, als das Fluggewicht. Der Fahrtmesser der im Normalflug als Kontrolle genügt, ist daher beim Kurvenflug kein hinreichend sicheres Anzeigegerät für die kritische Geschwindigkeit. Hierfür wurde vom NACA eine akustische Warnanlage entwickelt.
Das Gerät besteht aus einem PrandtFschen Staurohr, das unmittelbar über der Vorderkante in der Nähe der Flügelspitze eingebaut ist (s. a. nebenstehende Abb.). Vor dem Staurohr ist ein Stück Blech aufgebracht, das eine scharfe Kante bildet, damit örtlich der Druckverlust bzw. das Ueberziehen früher eintritt als für den gesamten Flügel. (Bei Versuchen an einer Fairchild-Uebungsmaschine, die eine kritische Geschwindigkeit von 68 km/h hat, sprach das Instrument bereits bei 95 km/h an, so daß sich genügend Sicherheit ergab.) Der kurz vor dem Ueberziehen auftretende lokale Druckverlust an dem PrandtFschen Stau-
Durchsackwarngerät, a Prandtlsches Staurohr, b scharfe Kante, c Schaltkasten, d Warnhorn.
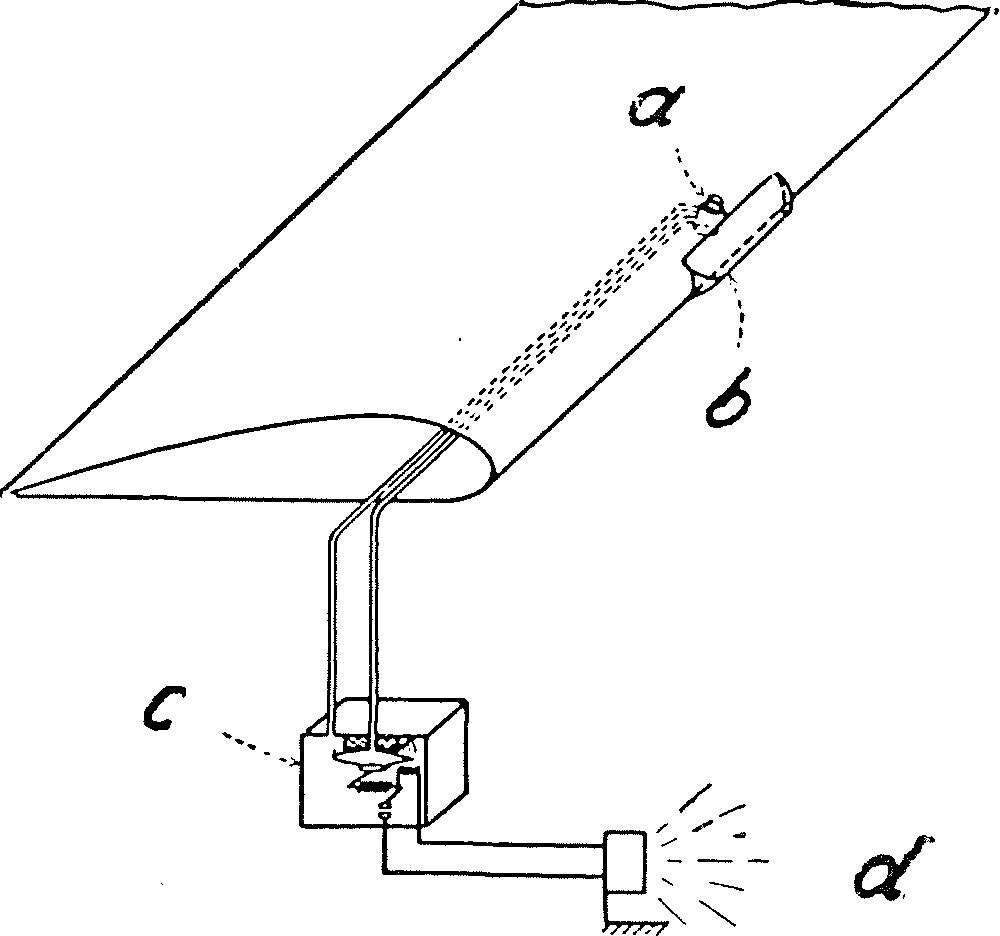
röhr schließt automatisch den Stromkreis eines im Führerraum angebrachten akustischen Warnsignals.
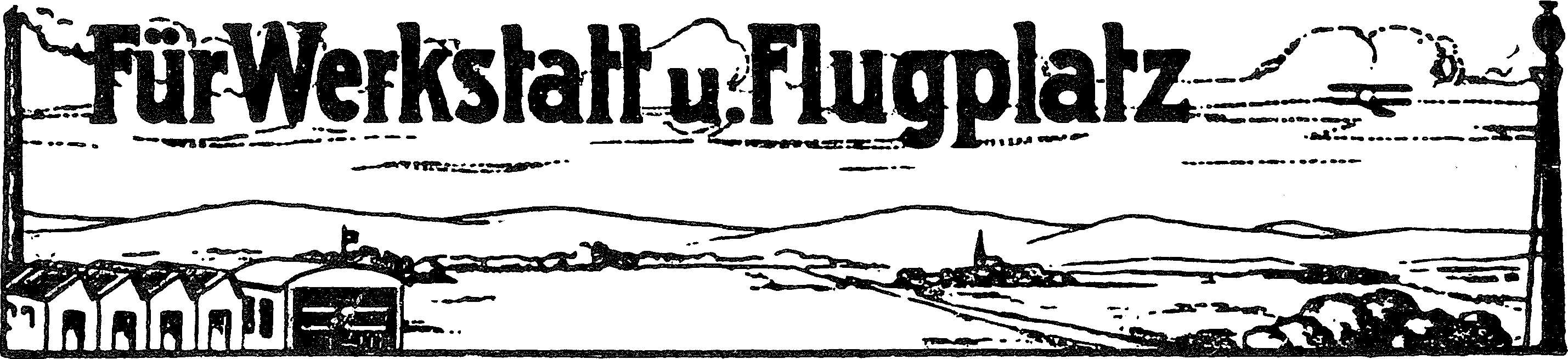
Elektron-Gesenke für Preßarbeit.
Bei der zunehmenden Preß- und Stanzarbeit im Leichtmetallbau ist man im Bau der dazu nötigen Gesenke, wie die Bilder 1—4 aus dem Betrieb der Henschel A.-G. zeigen, sehr weit vorgeschritten. Als Gesenkwerkstoff wird in zunehmendem Maße Elektron verwendet. Die Herstellung von Elektrongesenken erfordert jedoch umfassende Betriebserfahrung, insbesondere Kenntnisse über Modellherstellung und Bearbeitungszugaben. Da Holzmodelle, insbesondere verwickelte Formen, für einen einmaligen Abguß meist zu kostspielig sind, werden die Modelle aus Gips hergestellt. Am einfachsten und schnellsten erhält man einen Gipsabdruck, wenn man ein Blechmusterteil einformt. Voraussetzung sind allerdings erstklassige Treibklempner, denn die einmal durch das Blechmuster festgelegte Form ist für die ganze Serie bestimmend. Nach dem Einformen sind sodann die Schwindmaße nachzuarbeiten.
Bei der Herstellung eines Gipsabdruckes geht man von der Bauvorrichtung, auch Bauschablone oder Gerüst genannt, aus. Z. B. bei der Motorverkleidung für einen Sternmotor wird die runde Bauvorrichtung mit Gips gefüllt und man erhält dann die runde Form, wie Abb. 1 zeigt. Durch das Ausstraken der Form kann man gleichzeitig die einzelnen Vorrichtungsschnitte überprüfen. Damit ist die Grundlage zum Abnehmen der Gegenform („Negativ") geschaffen. Das „Negativ" wird dem Schwindmaß entsprechend nach den Erfahrungswerten nachgearbeitet. Desgleichen können alle Teilgesenke für Aussteifungen und Profile von dem „Positiv" abgenommen werden. Die Bauvorrichtung wird sodann wieder vom Gips befreit und dient dem ursprünglichen Zweck. Das in Abb. 1 abgenommene „Negativ" kann unmittelbar, d. h. ohne Anfertigung eines „Positivs" eingeformt werden, sofern die Möglichkeit gegeben ist, mit Gummikissen zu pressen. In allen Fällen ist es wichtig, das fertige Preßteil mit der Zusammenbauvorrichtung in Uebereinstimmung zu bringen.
Abb. 2 zeigt den Aufbau eines Gipsmodells für eine Führerraumüberdachung, die für das gesamte Gerippe gepreßt wird (Abb. 3). Das „Positiv" dient auch hier der Festlegung der Gesamtform und der Schnitte. Die „Negative" werden in Form von 2 Hälften abgenommen, da eine derartige Pressung in einem Stück Schwierigkeiten hinsichtlich der Stabprofilierung mit sich bringt. Abb. 4 zeigt eine im Gesenk gepreßte Rumpfschale, und zwar die Seitenwand der Hs 126. Man sieht hieraus, wenn Gesenke und Schablonen vorhanden sind, welch saubere und vor allen Dingen gleichmäßige Arbeit erzielt wird.
Zum Abguß der Gesenke wählt man am zweckmäßigsten die Legierung AZG. Zum Schmelzen dienen Stahltiegel, die elektrisch, gas-, öl- oder koksbeheizt sein können. Die Gießtemperatur liegt für Gesenke zwischen 650 bis 680° je nach Art und Größe der Werkstücke. Trotz der höheren Zähflüssigkeit gegenüber Aluminiumlegierungen genügt diese Temperatur für Gesenkguß. Dadurch, ebenso wie durch Vermeidung von Werkstoffanhäufungen, werden Brandstellen verhütet.
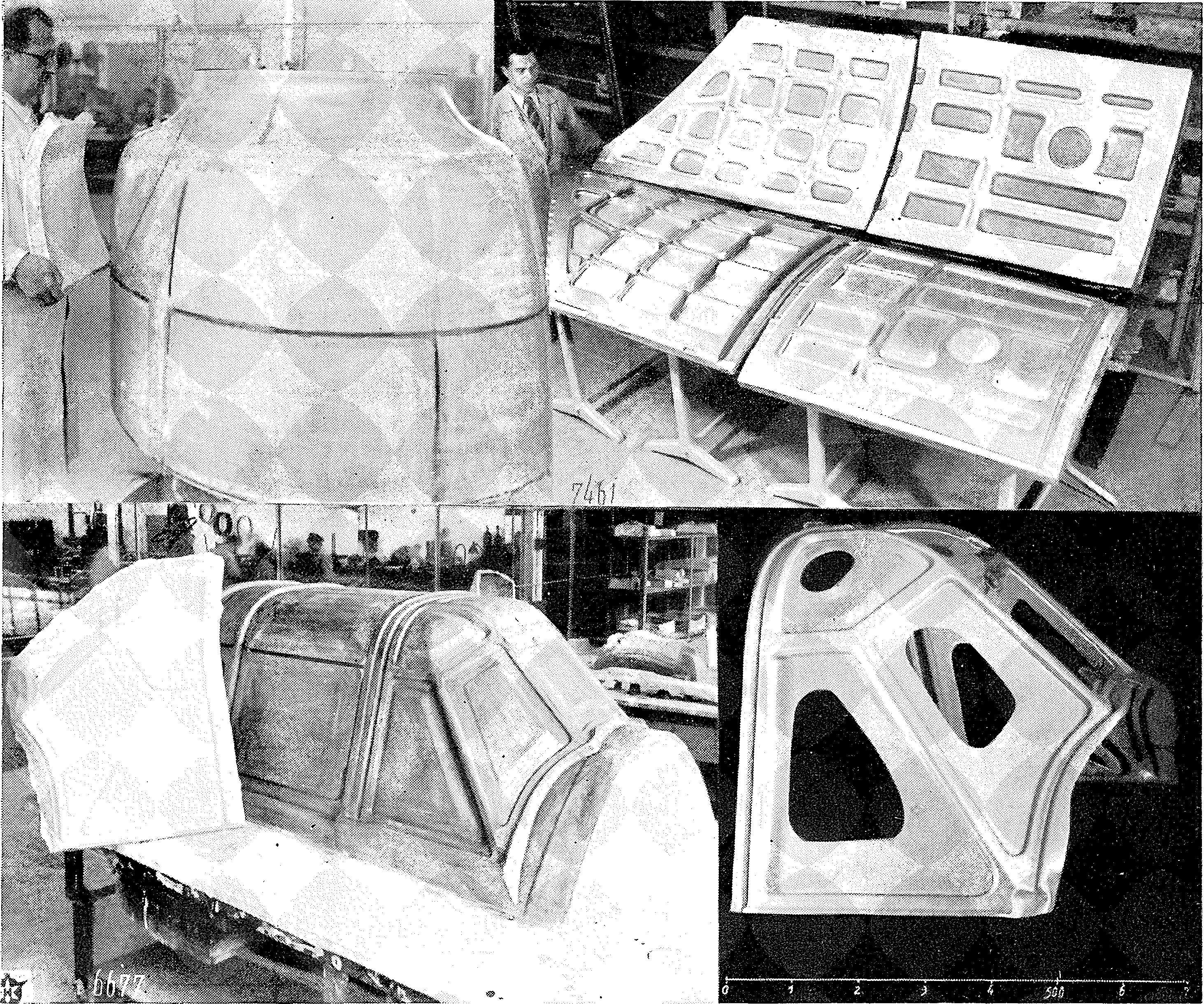
Elektron-Gesenke für Preßarbeit. Abb. 1 (oben links): Bauvorrichtung für Triebwerksinnenverkleidung zur Abnahme der „Negative" mit Gips aufgefüllt. Abb. 2 (unten links): Gipsmodell der Führerabdeckimg wird ein „Negativ" abgenommen, das in Sand eingeformt, in Magnesium abgegossen und bearbeitet wird. Abb. 3 (rechts unten) zeigt das abgegossene in Elektron gepreßte Flügelteil. Abb. 4 (oben rechts): Im Gesenk gepreßte Rumpf-Seitenwand der Hs 126. Werkbilder
Langstreckenflug Europa—Australien—Europa der Ar 79.
Die Arado 79 hat nach ihrem Langstreckenrekordflug (s. „Flugsport" 1939, S. 22) eine neue schwere Etappe hinter sich gebracht. Pulkowski und Jennett starteten am Neujahrstage zu der 2000 km entfernten Hauptstadt Siams in Hinterindien, Bangkok, wo sie nach 11-stündigem Nachtflug eintrafen. Bemerkenswert ist die navigatorische Arbeit der Besatzung, die ohne Funkgerät auf dem kürzesten Weg ihr Ziel erreichte.
Am 7. Jan. Start in Bangkok zur nächsten Etappe nach Medan an
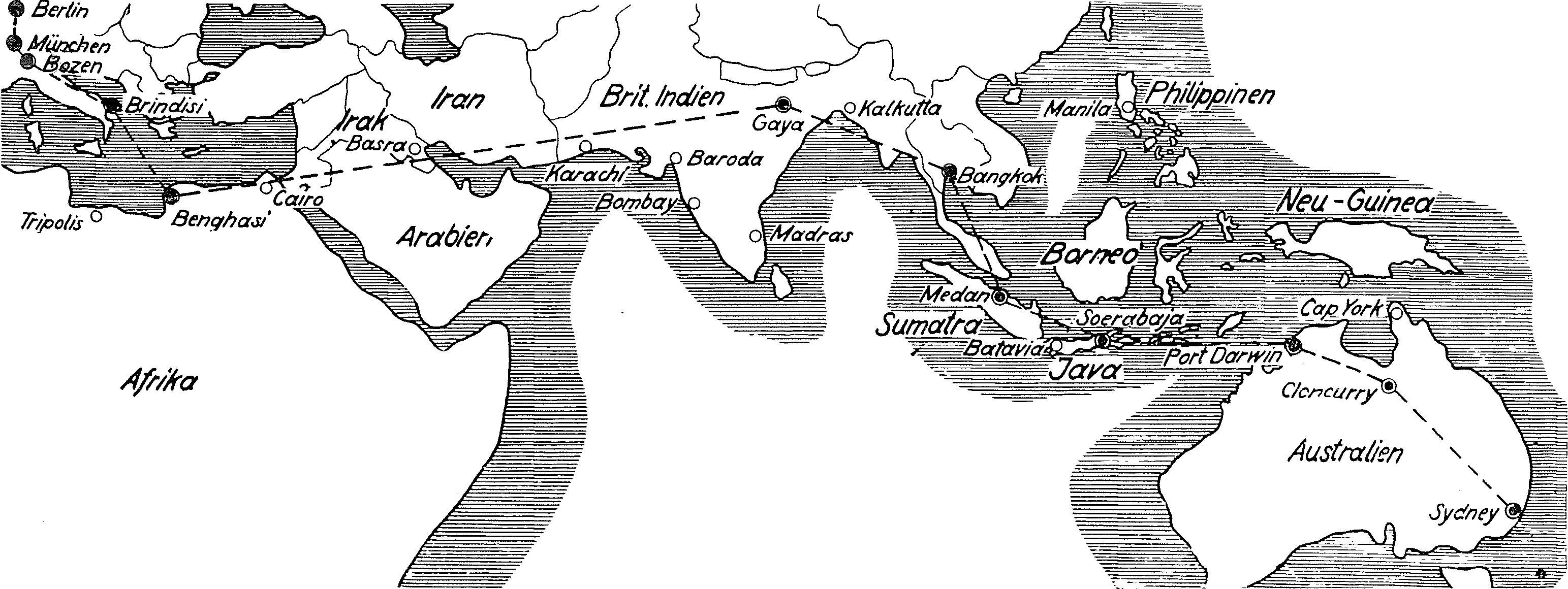
Berlin—Sydney, 20 000 km, flogen Pulkowski und Jenett auf Arado Ar 79 mit
105-PS-Hirth-Motor HM 504 A2. Zeichnurls: Flugsport
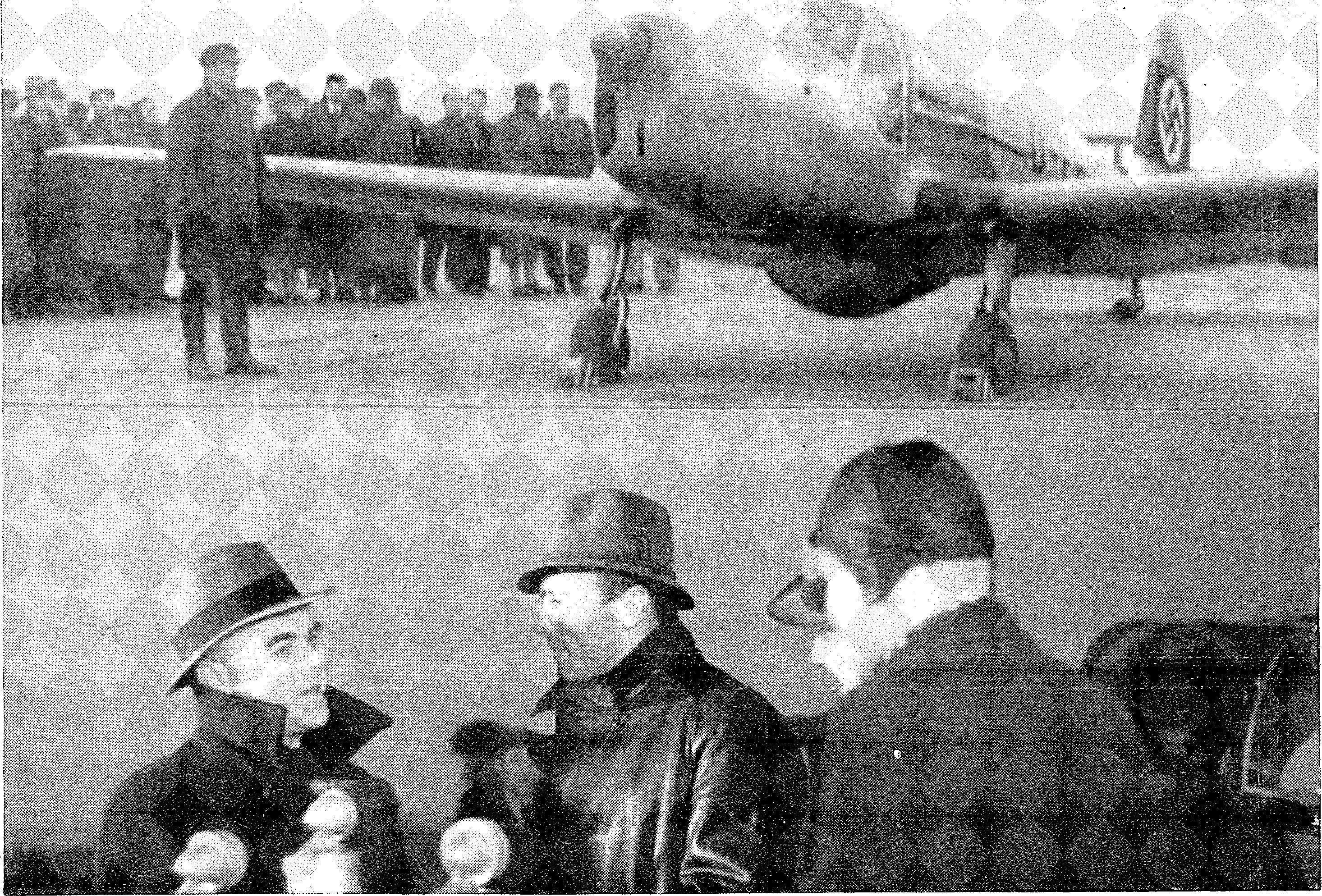
Arado Ar 79 Landstreckenflug Europa—Australien. Oben: Kurz vor dem Start. Man erkennt unter dem Rumpf den abwerfbaren Zusatztank. Unten von links: Direktor Blume, Oblt. Horst Pulkowski, Ltn. Rudolf Jenett. Werkbild
der Nordküste Sumatras. Der zur Zwischenlandung: vorgesehene Flugplatz Penang wurde nicht angeflogen. Während diese Zeilen in Druck gehen, trifft soeben die Nachricht ein, daß die Arado 79 auf dem Flugplatz Mascot bei Sydney gelandet ist.
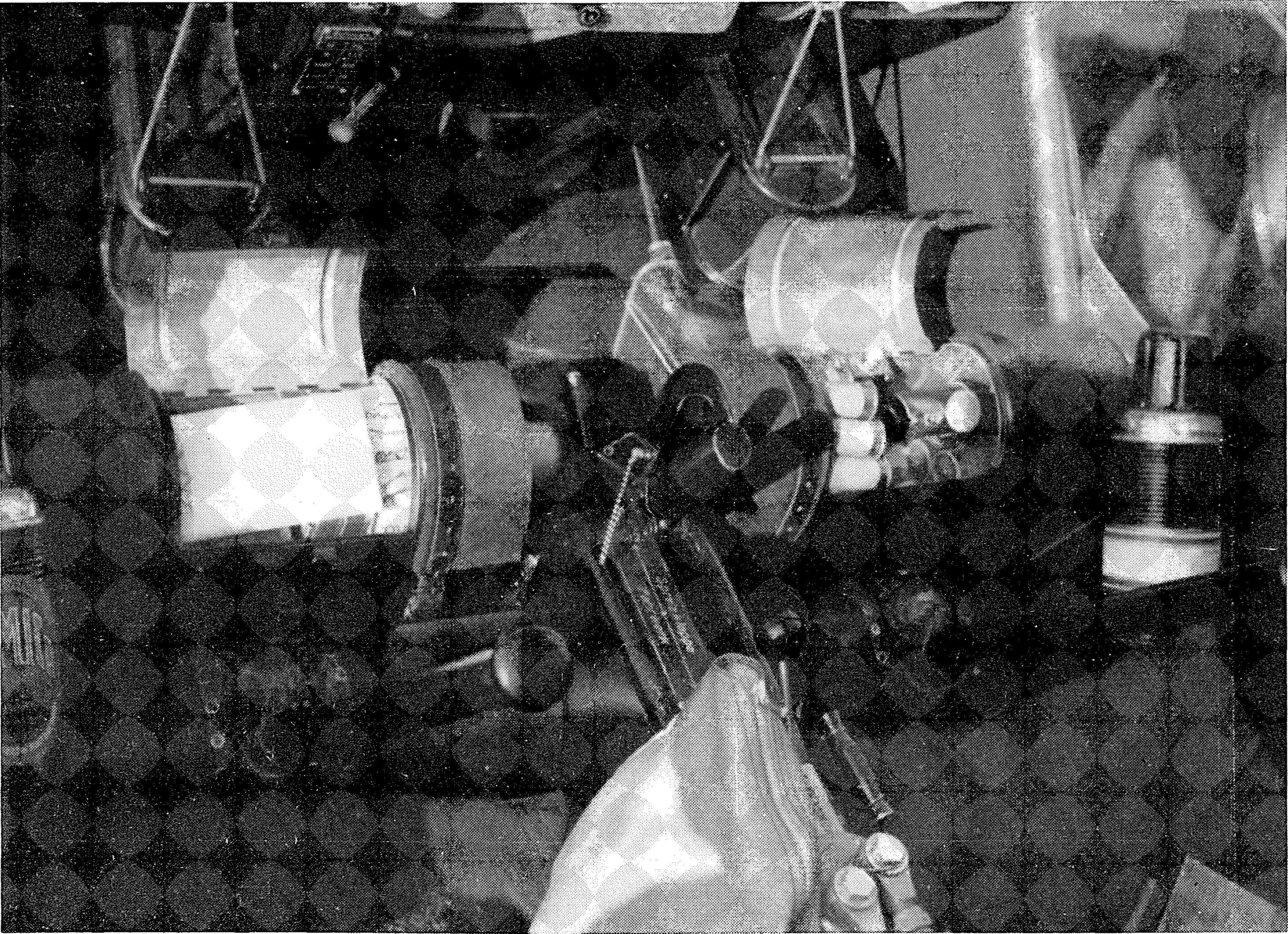
Arado Ar 79 Langstreckenflug Europa—Australien. Blick in die Kabine vor dem Start von oben, vorn hängend die Barographen, vor den Knüppeln die Kniebüchsen mit den Nahrungsmitteln, Eiserner Ration und Leuchtmunition. werkbüd

Inland.
Einstellung von Offizieranwärtern der Luftwaffe.
Am 1. Januar hat die Meldefrist für die Einstellung als Offizieranwärter der Luftwaffe begonnen (d. h. für die Fliegertruppe, Flakartillerie und Luftnachrichtentruppe), und zwar für die Einstellung im Herbst 1940. Die Meldefrist läuft bis zum 30. April 1939.
Als Offizieranwärter kommen nur ehemalige Abiturienten höherer Lehranstalten in Frage, sowie solche Schüler höherer Lehranstalten, welche im Frühjahr 1940 ihre Reifeprüfung ablegen. Den höheren Schulen im Altreich entsprechen die Mittelschulen im früheren Oesterreich und im Sudetenland.
Die Bewerbung ist zu richten:
a) Von Anwärtern für die Fliegertruppe und die Luftnachrichtentruppe an die Annahmestelle für Offizieranwärter der Luftwaffe, Berlin NW 40, Kronprinzenufer 12, soweit sie nördlich der Linie Touskow—Eger—Hof—Frankfurt a. M.— Wiesbaden—Trier wohnen, und an die Annahmestelle München, Luftgaukommando VII, Prinzregentenstr. 28, soweit sie südlich o. a. Linie wohnen (Orte der Trennungslinie zum südlichen Bezirk).
b) Von Anwärtern für die Flakartillerie an den Kommandeur derjenigen Flakabteilung, bei welcher der Bewerber eingestellt zu werden wünscht. Die Standorte der Flakabteilungen können bei dem zuständigen Wehrbezirkskommando erfragt werden.
Auf Grund des Einsteilungsgesuches erhalten die Bewerber von den Annahmestellen nähere Anweisungen, welche Unterlagen sie noch einzureichen haben.
Ueber den Gang des Einstellungsverfahrens und den Werdegang der Offizieranwärter ist näheres aus den Merkblättern zu ersehen, die bei den Annahmestellen und Truppenteilen der Luftwaffe, bei den Wehrbezirkskommandos und Wehrmeldeämtern sowie bei den Direktoren aller höheren Schulen zu erhalten sind.
Beisetzung der Besatzung des Großflugzeuges D-AIVA, welches bei Bathurst an der westafrikanischen Küste am 26. Nov. 38 verunglückte, erfolgte am 5. Jan. 1939 auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Als Vertreter des Reichsluftfahrtministers und Oberbefehlshabers der Luftwaffe, Generalfeldmarschall Göring, rief Generalleutnant Udet den 12 toten Kameraden von Bathurst, im Beisein von zahlreichen führenden Männern der Wehrmacht, der Partei und des Staates, den letzten Abschiedsgruß zu.
Deutsch-Amerik. Petrol.-Ges. übernahm mit Genehmigung der Reichsregierung im Sudetenland die Lager und Organisationen der Vacuum Oil Company, Prag, und der Naftaspol AG.
Prof. Dr. lieinkel machte der Universität Rostock eine Stiftung zur Schaffung eines Instituts für angewendete Mathematik und Mechanik auf dem Gebiete der Weiterentwicklung der Luftfahrt. Institutsleitung Dozent Dr. Lösch, bisher bei der DVL.
Gothaer Waggonfabrik Vorsitz ab 1. 8. 38 Dr.-Ing. K. P. Berthold. Dir. Paul Herrmann 1. 9. 38 auf eigenen Wunsch ausgeschieden.
Mahle Komm.-Ges., Stuttgart-Bad Cannstatt, hat für ihre Erzeugnisse (Kolben, Filter, Spritzguß) neue Fabrikschutzmarke „MAHLE" (große Buchstaben in ovalem Feld) gewählt. Die seitherige ,,Ec" wird nur noch von der Schwesterfirma Elektron-Co. m. b. H. für Flugzeug-Räder, -Beine und Flugmotorenkolben weitergeführt.
Faudi Feinbau-Ges. m. b. IL, Oberursel L Ts., Stammkapital 400 000 RM, ins
Handelsregister eingetragen. Gesellschaftsvertrag 18. November 38 festgestellt.. Herstellung: Flüssigkeitsfilter, Segelflugzeugstoßdämpfer, Flugzeug- und Motorenbauteile. Gesellschafter Ing. Fritz Faudi, Falkenstein i. Ts., und Emil Brauer,, Kronberg i. Ts.
Dr. Waldemar Braun 25 Jahre 16. 6. in Hartmann & Braun AG.
Was gibt es sonst Neues?
Berlin—Rom in 5 Std. flog vorige Woche Köster auf Messerschmitt „Taifun" mit Siemens-Kurssteuergerät.
Ital. aeronautisch medizinische Forschungsanstalt in Mailand an der Universität eingerichtet.
Brüssel, 2. internationale Luftfahrtausstellung vom 8. bis 23. Juli 1939.
Flughafen-Einrichtungsausstellung London findet vom 1. bis 3. Februar in der Central Hall, Westminster, statt.
Imperial Airways Flugstrecke Sydney—Auckland Neuseeland in Flugnetz einbezogen.
Ausland.
British Airways führte Versuchsflüge auf der Strecke London—Lissabon durch. Diese Teilstrecke soll die erste Etappe bei dem in Aussicht gestellten regelmäßigen Atlantikflugdienst nach Bathurst bilden.
Imperial Airways kündigt für das Frühjahr einen regelmäßigen Nordatlantikdienst mit vier neuen Flugbooten „Cabot", „Caribou", „Connemara" und „Clyde" an. Diese Atlantikflugboote entsprechen grundsätzlich den von den Versuchsflügen 1937 bekannten Booten „Caledonia" und „Cambria". Tragfähigkeit vergrößert und eingerichtet zum Tanken im Fluge.
„Ark Royal", 22 OOO-t-Flugzeugträger, soll im Laufe dieses Monats für die Royal Navy in der Werft in Portsmouth fertiggestellt werden. Länge des Flugdecks 245 m; Höchstgeschw. 31 Knoten (57 km/h), Besatzung 1400 Mann und 140 Offiziere. Flugzeughallen unter Deck für 60—70 Maschinen.
Der erste englische Flugzeugträger, der nicht als Kreuzer oder Schlachtschiff entworfen wurde und dann für diese Sonderauf gäbe umgebaut wurde.
Fünf weitere Flugzeugträger derselben Wasserverdrängung sind von der Royal Navy bestellt.
Handley-Page-Flügel hat bei Versuchen mit einer Messerschmidt Me-108 B „Taifun" eine l,25fache Vergrößerung der Tragfähigkeit ergeben.
Ueber lebende Stromlinien-Wandtafel, den ausgezeichneten Rauchkanal der D. F. S. zum Sichtbarmachen des Strömungsverlaufs (s. „Flugsport" 1938, S. 539 bis 542), hielt der Konstrukteur des Geräts, Alexander Lippisch, in London vor Fachkreisen anhand eines Films einen Vortrag in englischer Sprache, der, wie unser Freund C. Q. Grey in seinem „Aeroplane" in einiger Aufmachung berichtet, zu einem ganz großen Erfolge Meister Lippischs wurde.
Heston Hochgeschwindigkeitsflugzeug wird, wie „Aeroplane" berichtet, z. Z. von der Heston Aircraft Ltd. im Auftrag von Lord Nuffield gebaut. Konstrukteur Mr. A. E. Hagg, von dem der De Havilland Comet stammt und der jetzt für Napier arbeitet. Ein fliegender Motor mit Höhenleit-, Seitenleit- und Fahrwerk. 500 Meilen.
Nuffield, Lord, der englische Automobilfabrikant, baut zur Zeit ein großes Flugzeugwerk in Birmingham. Er hat bereits einen Auftrag für 1000 „Supermarine Spitfire".
„Mercury" beförderte eine Tonne Post auf einem Ohnehaltflug von Southampton nach Alexandria, 3700 km, in 15 h 40 min. Die 4 Napier-Rapier-Motoren der Maschine leisten max. nicht ganz 1600 PS.
Frankreichs Flugzeugbau ist nach einem Bericht des Luftfahrtausschusses, Senator de la Grange, mit allen Mitteln gefördert worden. Im vergangenen Jahr wurde allein 1 Milliarde Franken zur Erneuerung der Werkzeugmaschinen für die Luftfahrtindustrie aufgewendet, um die Serienfabrikation zu fördern. Herstellungskosten eines Flugzeuges im Durchschnitt 3 Millionen Franken. Bei der Herstellungszahl von 500 Maschinen pro Monat wären also 1,5 Milliarden Franken aufzuwenden.
Frachet, Korrespondent von Les Ailes, ist vom franz. Luftfahrtministerium zum Chevalier de la Legion d'Honneur ernannt worden.
Franz. Marineminister M. Campinchi gibt bekannt, daß von den Krediten für 1939 für Schiffe 8 Milliarden Fr. und 381 Millionen für Flugzeuge verwendet werden.
Franz. Luftwaffe soll nach Art. 80 des Finanzgesetzes für das Rechnungsjahr 1939 eine Effektivstärke von 4432 Offizieren und 77 200 Mann haben.
Air France will den Dienst auf der Strecke Marseille—Saigon—Hanoi nicht mehr mit Flugbooten, sondern mit Smotorigen Landmaschinen versehen; die Strecke soll dann über Korsika, Tunis, Benghazi, Kairo, Lyada geführt werden.
35 Curtiss P 36 mit 1100 PS Pratt & Whitney, Sowjet-Fabrikat, sind über Frankreich nach Rotspanien geliefert worden. Die Maschinen sollen wegen ihrer hohen Geschwindigkeit schwer zu fliegen sein.
Dewoitine D. 520 Jagdflugzeug erreichte bei Versuchen in Villacoublay mit einem Hispano-Suiza-910-PS-Motor 530 km/h. Mit einem 1000-PS-Motor will man 550 km/h erreichen.
Seversky P. 36 ist in Villacoublay am 5. 1. eingetroffen.-.um vor dein Service Technique zu beweisen, daß er eben so schnell ist wie-der Curtiss P. 36.
Franz. Forschungsinstitut für Rüstungen ist für die franz. Wehrmacht gegründet worden. Vorsitz: Generalstabschef d. franz. Wehrmacht, General Gäme-lin, Beis.: General Colson, Chef des Stabes der Armee,Vizeadmiral Darlan, Generalstabschef der Kriegsmarine, General Vuillemin, Generalstabschef der Luft» waffe, Generalsekr. des Kriegsministeriums Jacomet, Generalsekr.. des Obersten Nationalverteidigungsrates General Jamet, fünf Wissenschaftler, sieben Beamten des Unterrichtsministeriums, je fünf Vertreter der drei Wehrmimsterien und vier auf Grund ihrer besonderen Kenntnisse und Funktionen bestimmte Persönlichkeiten.
Ital. Flieger in Spanien nach amtlichem Bericht aus Saramtmca 674 Abschüsse mit Sicherheit, wahrscheinlich noch 163 weitere Flugzeugabschüsse. Verlust der Italiener 85 Maschinen.
„Ala Littoria" hat ihr Streckennetz um 6990 km vergrößert. Im Vorjahre 20 120 km, jetzt 27 110 km.
Nachstehende neue Fluglinien wurden eingerichtet: Rom—Alghero—Cagliari, Rom—Bukarest, Rom—Rhodes, Genua—(Tunis, Valona—Argirocastro, Rom— Venedig, Rom—Bologna. In Spanien: Tetuan—Melilla, Tetuan—Malaga—Sevilla (später bis Lissabon). In Ethiopia: Addis Abeba—Gimma, Asmara—Gondar, As-mara—Dessie—Addis Abeba. Geplant ist außerdem eine direkte Verbindung zwischen Addis Abeba und Khartum.
Im Juli vorigen Jahres verfügte die Gesellschaft über 40 Wasser- und 59 Landflugzeuge mit einer Gesamtträgfähigkeit von 885 330 kg. In Auftrag gegeben sind 12 Savoia Marchetti S. M. 75 mit Alfa Romeo R. C. 34, 7 Cant Z. 506 mit Alfa Romeo 126 R. C. 10 und 3 Aer. Macchi ebenfalls mit Alfa Romeo R. C. 10.
Ital. Luftfahrtministerium hat für das kommende Rechnungsjahr (1. Juli 1939 bis 30. Juni 1940) Kredite in Höhe von 2 165 060 000 Lire bewilligt bekommen, das sind 900 060 000 Lire mehr als für das laufende Rechnungsjahr.
„Piaggio Pegna", Bomber mit 3 Piaggio-Motoren flog am 30. Dez. vorigen Jahres mit 5000 kg Nutzlast über 2000 km mit 403,908 km/h Durchschnitt und über 1000 km mit 5000 kg Nutzlast mit 405,350 km/h. Der Rekord über 2000 km wurde bisher von Frankreich mit 307,455 km gehalten, der über 1000 km von Italien mit 401,965 km/h. Der Flug wurde auf der Strecke Santa Marinella—Neapel—Monte Corvo—Santa Marinella durchgeführt (500 km geschlossene Bahn).
Flugzeugführer Ltn. Colone! Angelo Tondi und N. C. Off. Giovanni Pontonutti.
Amelia Earhart, die bekannte amerik. Fliegerin, ist jetzt, IV2 Jahre nach ihrer Ueberfälligkeit im Pazifischen Ozean, für tot erklärt worden. 1928 flog sie mit 2 Begleitern als erste Frau über den Atlantischen Ozean und landete in Wales, 1932 unternahm sie einen Alleinflug über den Atlantischen Ozean von Neufundland nach Irland, 1934 flog sie im Alleinflug in 18 Std. von Hawai nach Kalifornien. Bei dem 27 000-Meilen-Flug um die Erde ist sie verschollen.
Tragschrauber im Luftverkehr wird Amerika als erstes Land besitzen, nämlich zwischen dem Lufthafen und der Stadt Philadelphia; dort ist das neuerrichtete Postgebäude bereits mit einem zum Landen geeigneten Dach versehen worden. Der Zubringerdienst durch überall landefähige Luftfahrzeuge kürzt die sonst zum Hinausfahren erforderliche Zeit und damit die „Flugzeit". Auch aus New York, dessen Flughafen Newark 18 km durch den Hudson-Tunnel hindurch von der Post entfernt ist, werden gleiche Absichten bekannt.
Steilschrauber-Interesse in Amerika. Kongreß in Washington hat 2 Millionen Dollar für Drehflügel-Entwicklung bewilligt, und im Franklin-Institut in Philadelphia hat man im Oktober über die beste Verwendung dieses Geldes 2 Tage lang verhandelt. So sprachen außer bekannten amerik. Aerodynamikern R. Hafner und Vertreter des Kellett-Autogiro und des Wilford-Gyroplane; Vorträge von Prof. Dr. Focke und L. Breguet wurden verlesen. Auch Wälzflügel-Triebwerke wurden behandelt.
Curtiss Wright „CW-20" Stratosphärenflugzeug macht Anfang Februar die ersten Flugversuche.
D. D. L. (Det Danske Luftfartselskab) hat weiteren Focke-Wulf 200 Condor bestellt.
Aero A/Y, finnische Luftfahrtgesellschaft, hat 2 Focke-Wulf 200 „Condor" mit Pratt & Whitney Hörnet S. 1 E-G Motoren bestellt.
Austral. Flugzeugindustrie, die ihren eigenen Heeresflugzeugbedarf selbst herausbringt, soll mit Hilfe einer Kommission und der australischen Commonwealth ins Leben gerufen werden. Der Kommission gehören an als Leiter Sir Hardam Lever, der bekanntlich der Kommission nach Kanada angehörte, ferner der Staatssekretär des Luftfahrtministeriums Oberst Sir Donald Banks und der Luftmarschall Sir Arthur Longmore.
Argentin. nation. Flugzeugwerke, die 1928 gegründet wurden, haben bereits 208 Maschinen fertiggestellt; es handelt sich in der Hauptsache um Lizenzen von Focke-Wulf, Dewoitine und Avro. Als Eigenkonstruktion haben sie jetzt einen leichten Bomber mit Wright 650-PS-Sternmotor herausgebracht.
K. L. M. Batavia-Linie soll 1939 geändert werden. Flugzeuge fliegen nicht mehr über Indien und Burma und Siam, sondern direkt nach Colombo, und von dort über die See nach Medan auf Sumatra, von wo die Linie wieder der alten Strecke über Singapore nach Batavia folgt. Voraussetzung ist, daß der Flughafen auf Colombo mehr ausgebaut wird.
Segelflug
Entwicklung des Fliegernachwuchses in der HJ. Nach dem Kampfblatt „Die HJ." betrug die Durchschnittsstärke 90 000. Jungen. Die von den Modellflug-Arbeitsgemeinschaften erfaßte Anzahl der Pimpfe stieg in den letzten 12 Monaten von 20 000 auf 80 000. 9000 Jungen hatten die „A"-Gleitfliegerprüfung bestanden, 5000 die „B", 1000 Jungen die „C" oder den Luftfahrerschein für Segelflugzeug-führer. 32 Hitler-Jungen erhielten das silberne Segelfliegerleistungsabzeichen, 2 das goldene.
Segelfluggruppe Gymnasium Bern vom Berner Aero-Club gegründet. Alter ab 17 Jahre. Ausbildung bis zur B.
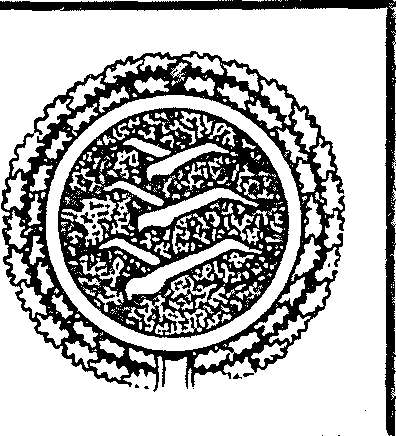
Hütter H 28 II startet am Braunwald (Schweiz). Archiv Flugsport
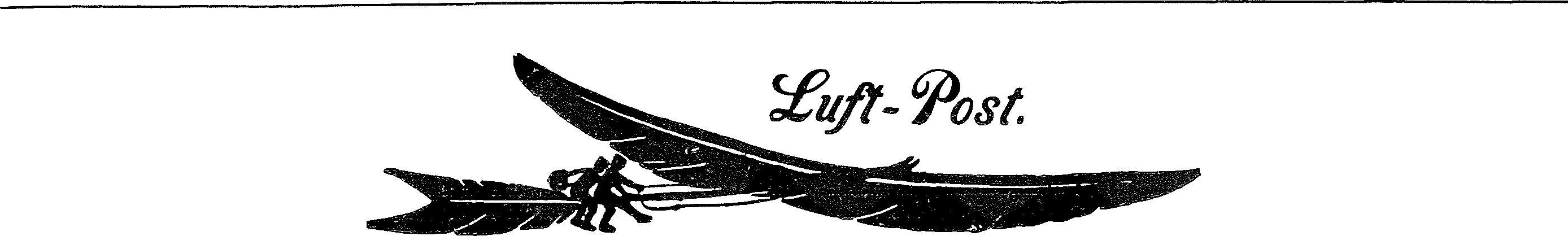
Profildicke an der Flügelwurzel soll bei Schnellflugzeugen nicht mehr als 17% größer sein als die mittlere Flügeltiefe.
Geodetic-Bauweise ist Netzbauweise; „all-geodetic" wurde im Flugzeugbau erstmalig angewandt beim Vickers „Wellesley", s. „Flugsport" 1938, S. 647.
Startraketen sind lange bekannt. Sie stellen eine noch am leichtesten zu verwirklichende Form des Abbrand-Triebwerkes dar, wie es z. B. von Stamer und Lippisch im und am fliegenden Flugzeug auf der Wasserkuppe untersucht worden ist; vgl. „Flugsport" 1928, S. 232—235. Nachdem die Startrakete dem Flugzeug zum Abheben ver-holfen hat, kann was von ihr übrig bleibt abgeworfen werden und beeinträchtigt so den Flug nicht. Wie aus der rechten der nebenstehenden Abbildungen, die einem französischen Vorschlag von 1924 entstammen, ersichtlich ist, hat man Raketen auch als Bremsmittel gegen zu groß werdende Sturzgeschwindigkeiten anwenden wollen. Das hat jedoch kaum eine praktische Bedeutung, denn Strahl und Fahrtwind sind entgegengesetzt gerichtet und ergeben daher einen sehr geringen, von Null nicht sehr verschiedenen Wirkungsgrad, was eine ungeheure Raketenmasse erfordern würde, ganz abgesehen davon, daß Führer und Maschine für diesen Fall einigermaßen feuerfest gebaut sein müßten. Kofferklebezettel der mandschurischen
Luftverkehrsges. Manchuria Aviation Co. Ein Sprung ins neue Jahr.
Archiv Flussport Bild : Autoflug
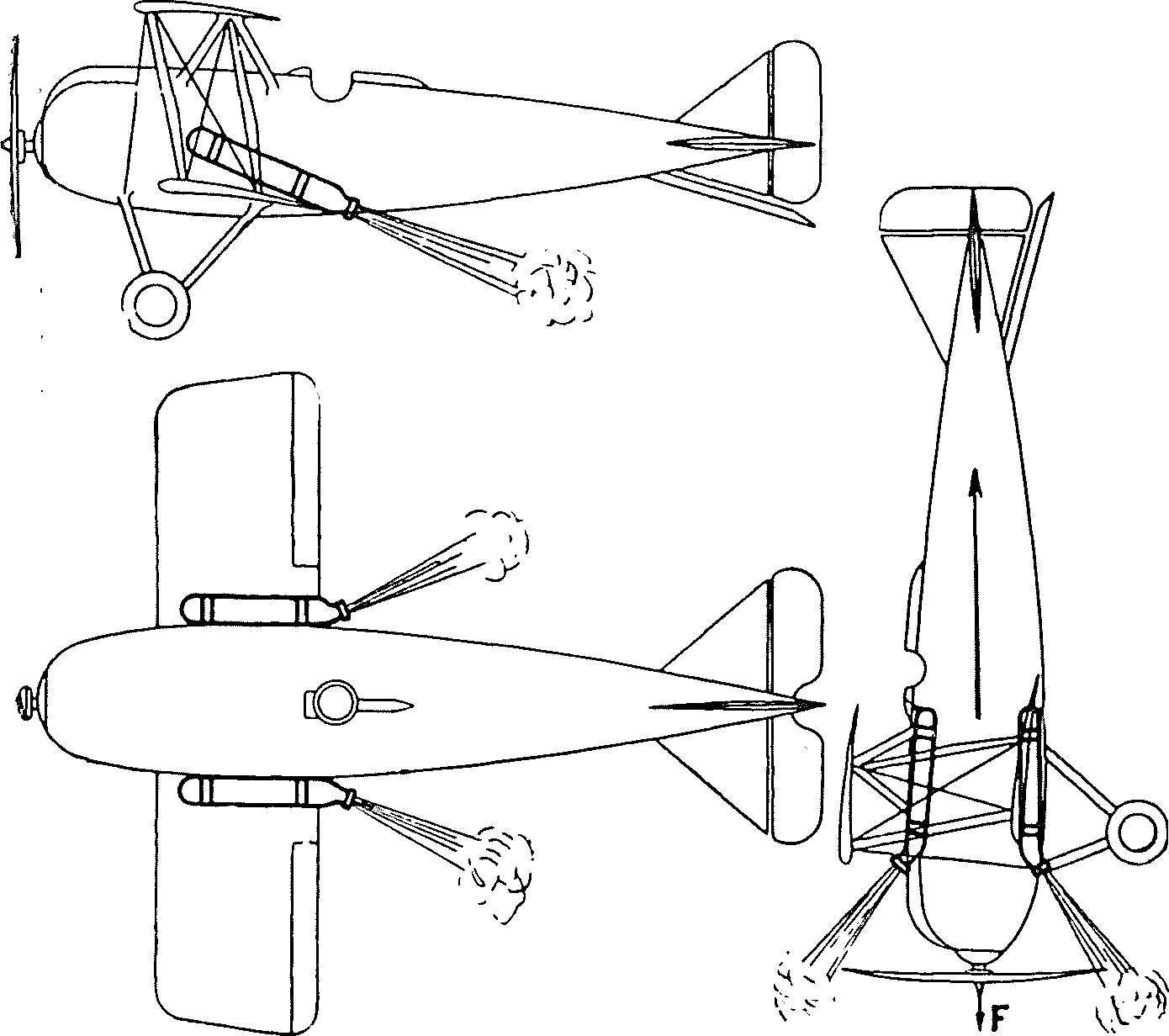
Berichtigung. In der Bildunterschrift zu Onigkeit Mus'<elflugzeug, „Flugsport" 1939, S. 6, muß es richtig heißen: „in der Ebene von Leipzig am 5. 2. 38. Rechts: Start mit 600fädigem Seil am 5. 3. 38, in 3 m Höhe", statt „in der Ebene von Leipzig am 15. 8. 32. Rechts: Start mit 600fädigem Seil am 5. 5. 38 in 300 m Höhe".
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Deutsche Flugzeugkonstrukteure. Werdegang und Erfolge unserer Flugzeug-und Flugmotorenbauer. Von Walter Zuerl. Curt Pechstein Verlag, München 22. Preis RM 5.80.
Enthält den Werdegang 17 deutscher Flugzeug- und Motorkonstrukteure, mit Lilienthal beginnend. Wenn man schon Segelflugzeugkonstrukteure nennt, so hätte man Lippisch nicht vergessen dürfen. Ebenso vermißt man mehrere hervorragende Konstrukteure, deren Arbeiten im Flugzeugbau richtunggebend waren und denen es nicht vergönnt war, ein eigenes Werk zu besitzen.
Funker
z. Zt. Zivil-Bordfunker (Milit.-Bordfunkerprüfung), langjähr. Erfahrung in Erledigung von kaufmännischen und Behörden-Schriftwechsel, sucht nichtflieg. Arbeitsgebiet i. Flugbetrieb od. ähnl. Angeb. unter 4011 an den Verlag des „Flugsport"
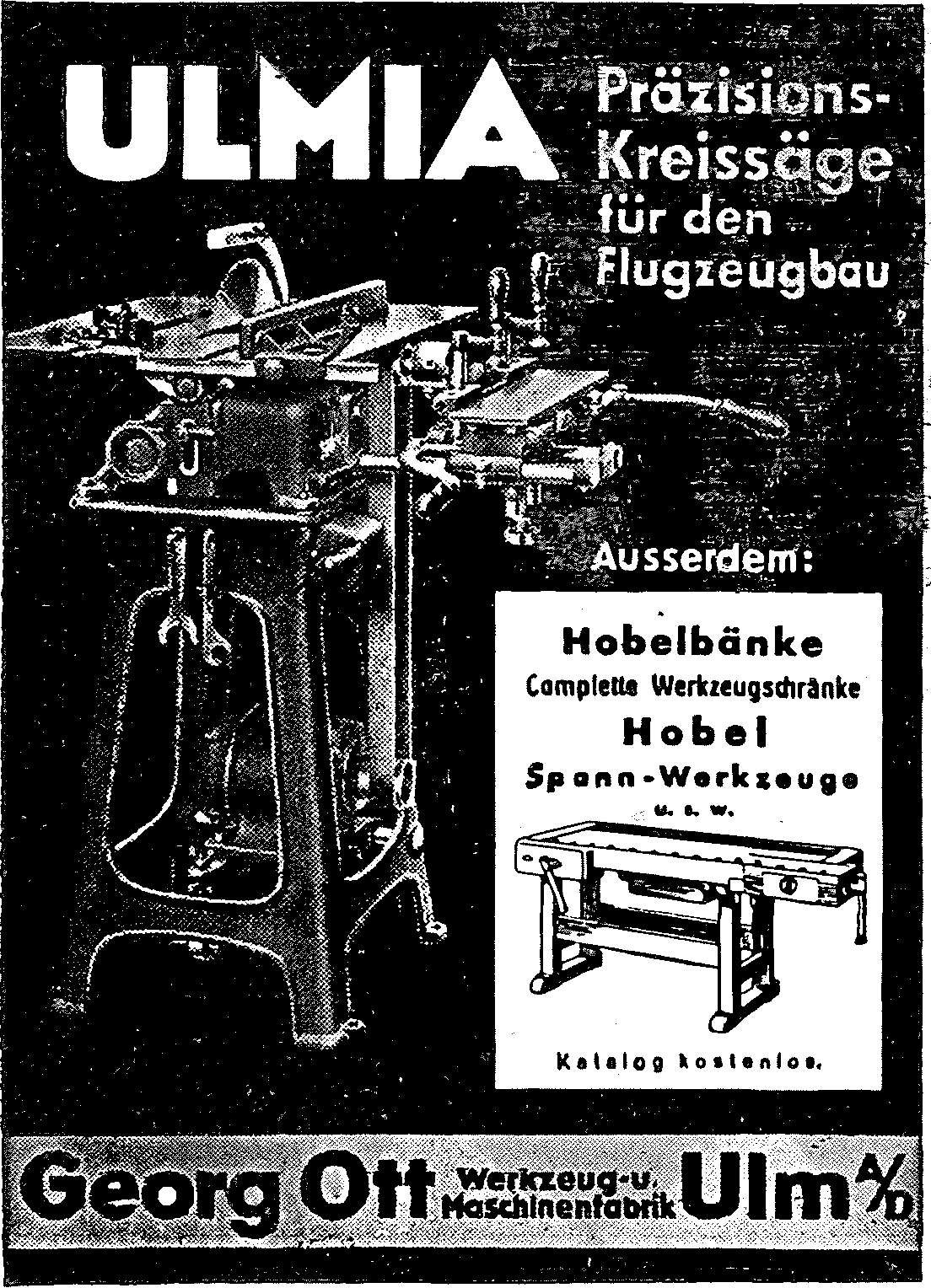
Flugzeugführer
Land und See
CII, Blindflug, KU sucht Stellung in der Industrie. Ängeb. u. 4010 a d. Exped. d. „Flugsports
NS^-Mittweida
| Maschinenbau / Automobil- u. Flugtechnik I i Elektrotechnik. Programm kostenlos I
ernschule für
F
lugzeugbau
Theoret, Vorbereitung für Bauprüfer, Flugzeugführer, Ingenieure sowie für den gesamten Flugdienst. Sonderlebr-gängefür Jungflieger. AbjchlußPrüfungen - Abschlußzeugnisse. Studienpro gr. Nr. 145 durch das Sekretariat.
Fernschule G.m.b.H. BerlinWl5
Kurfürstendamm 66 p.
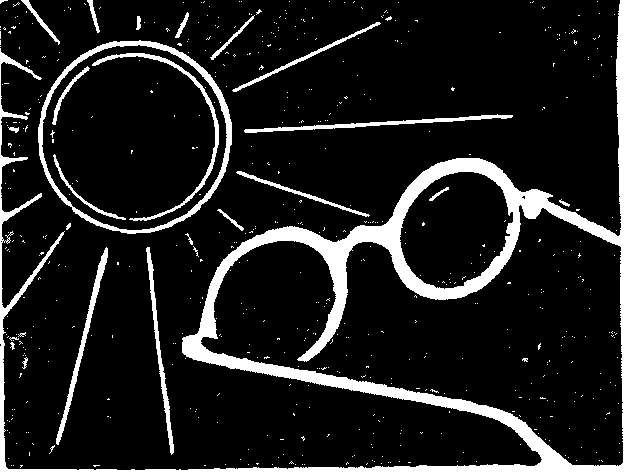
Flieger sagen: Neophan!
Weil kontrastreiche, plastische Boden- und Wolkensicht. Schutz gegen Sonnen-, Schnee- und Wasserstrahlung,
natürliche Farbeindrücke, denn: Blau bleibt Blau, Grün bleibt Grün, Rot bleibt Rot!
Auergesellschaft - Aktiengesellschaft,
■ BERLIN N 65
Verschlüsse u. Beschlagteile
für den Flugzeughau fabrizieren Preß- und Stanzwerk Büscher & Claussen
Inh.s Heinrich Büscher & Hans Wessel
Iserlohn in Westfalen
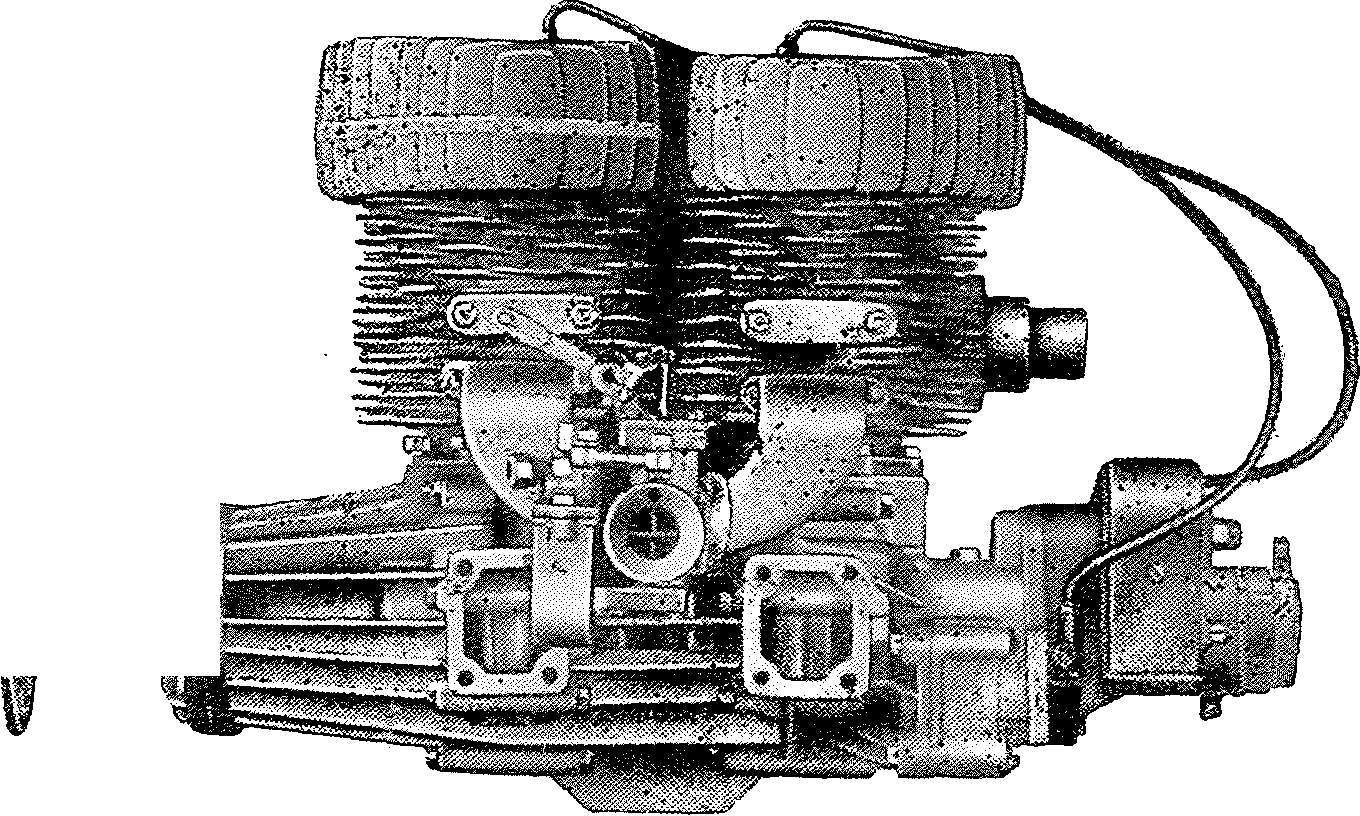
Kieinllugmoloren Tür Einsitzer u. motorgleiter 1000 cm3
Dauerleistung 20 PS bei 2400 n Start- und Steigleistung 28 PS
Seld^Kompressorenbau^H Heidelberg
Rohrbacherstrafye 36 Telefon 6323
„FLUGSPORT*
plugzeug =Spann lacke
Ivlarke „Cellemit", liefert seit 1911
Dr. Quiffner & Co.
Berlin * Lichtenberg Rittergutstraße 152, Fernr. 612562
BirkeniFlugzeug
Sperrholzplatten
deutsches Fabrikat
bei Rekordflügen erprobt, in den Qualitäten: AVIATIC, SPEZIAL, OLEITFLUQ in allen Stärken von 0,4-8 mm liefert prompt ab Lager
Georg Berte BerlinsCharloftenburg
Kaiser Friedrich-Straße 24 Ftrnspr.-Sammelnummer: 34 5841 T@lgr.-Adr.: FHegerhölzer Berlin
r
Falls diirme
aller Art
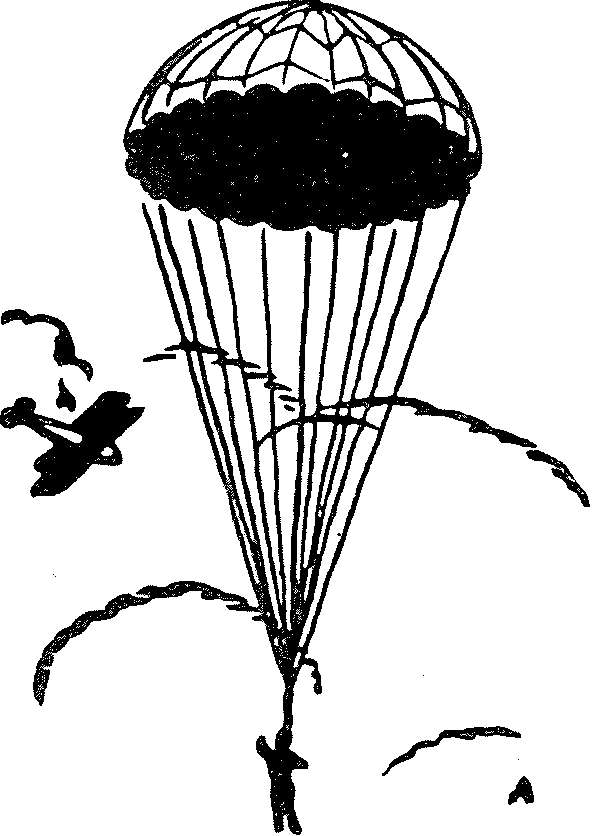
SCHROEDER & CO.
Berlin-Neukölln
Bergstraße 93-95
Älteste Flugzeug* Fallschirm*Fabrik der Welt
Für unsere Entwicklungsabteilung suchen wir für sofort oder spätestens 1. April 1939
Entwurfs-Ingenieur
der bereits als Eniwurfs-Konstrukteur tätig war und über gute statische und aerodynamische Kenntnisse verfügt.
Nur von Herren, die beste Erfolge nachweisen können und an selbständiges Arbeiten gewöhnt sind, erbitten wir unter Kennwort EE ausfuhr! iche Bewerbungen mit handschriftlichem Lebenslauf, Bild, Zeugnisabschrift, sowie Angabe der Gehaltsansprüche und des früh. Eintrittstermins.
SIEBEL FLUGZEUGWERKE HALLE K.G. ■ HALLE/S.2
BORDGERÄTE
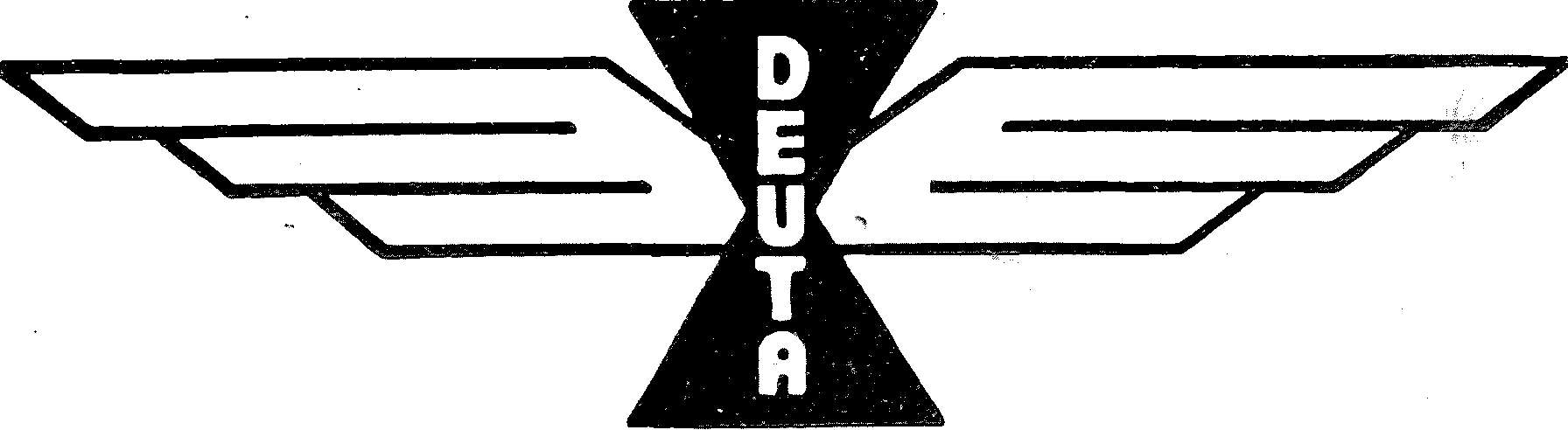
Morell Handwindmesser Jl
» A n e m o «
DEUTA-WERKE
BERLIN 5036 ORANIENSTR 25
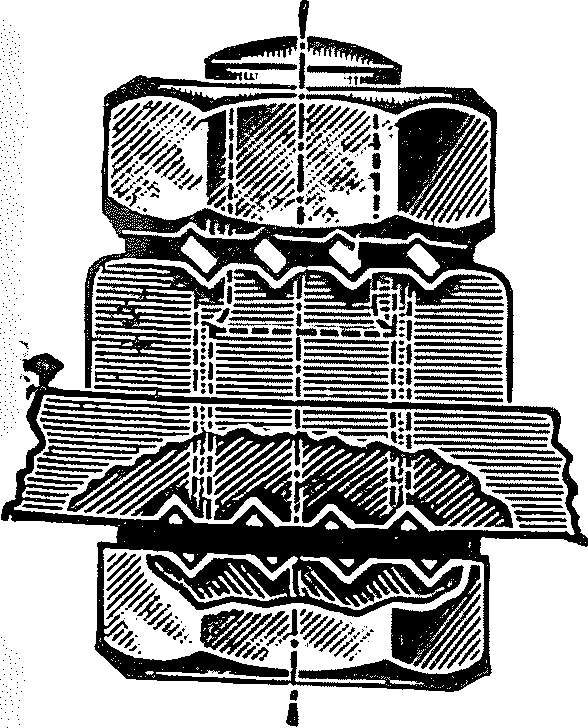
Original Federnde Zahnscheiben
Deutsche und Auslandspatente für Sechskant-, Vierkant- u. Flügelmuttern, sowie für Zylinder-, Halbrund-, Linsen-, Sechskant-u. Vierkantschrauben für Rechts- U. Linksgewinde / Alle Gröben nach DIN von M 1,4 bis M 32 mm und Whitw. von bis Zoll
Die Schrauben- und Muttersieherijng
aus Spezial-Federstahl _ federharter Phosphor-Bronze — Leichtmetall Hohe Rüttelsicherheit / Gleichmäßiger Prefjdruck / Keine Biegungsmomente / Kürzere Bolzenlänge / Kein Strecken u. Verheddern / Schneller Ein- u. Ausbau / Zeit- u. Materialersparnisse
So wirken u. sperren diegeschränkt.Zähne
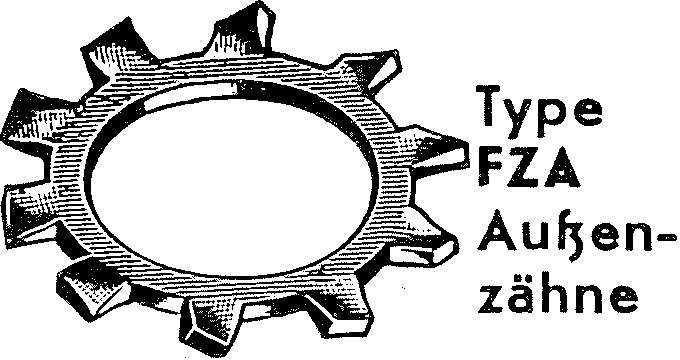
Zahnscheibenfabrikation J. M e y e & Co., Stuttgart - West
Heft 3/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hiiidenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro Vi Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 343S4 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Ouellenangabe gestattet.
Nr. 3 1. Februar 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 15. Februar 1939
Frischer Auftrieb.
Die Einheits-Olympia-Segelflugzeuge sind fertig. Zur Zeit finden irgendwo Vorvergleichsflüge statt. Die Entscheidung über den endgültigen Typ erfolgt dann in Rom. Dieser Segelflugeinsitzer mit geradem Flügel von 15 m Spannweite wird sicher einen Normaltyp abgeben, der auch auf anderen Gebieten mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Bei den flugtechnischen Fachgruppen scheint es durch die neue Verfügung starken Auftrieb gegeben zu haben, so daß auch in diesem Jahre mit Fortschritten und Neuerungen zu rechnen ist. Das Programm der Veranstaltungen des Korpsführers des NSFK. haben wir bereits an dieser Stelle bekanntgegeben. In den NSFK.-Horsten herrscht überall rege Tätigkeit.
In der Entwicklung neuer Sportflugzeuge ist die Flugzeugindustrie nicht untätig gewesen. Die Sport-Typen werden starken Zerreißproben unterworfen. Die deutschen Flieger mit ihrer Ar 79 haben in Australien überrascht. Die Fh 104 trainiert über den weiten Strecken Afrikas, die Bus in allerhand Ländern Südamerikas. Weitere Versuchsflüge sind in Vorbereitung.
Die deutschen Flugzeuge und Motoren haben ihre Leistungsfähigkeit bewiesen.
Uebungssegelflugzeug Musger „Mg 12a".
Dieses Segelflugzeug wurde geschaffen, um die große Lücke, die zwischen einem Schulgleiter und z. B. einem Grünau Baby II bestand, auszufüllen. Der Entwurf wurde dahin eingehend durchgearbeitet, um die Type auch für den Gruppennachbau geeignet zu machen. Es standen daher folgende Forderungen fest: Leichte, billige und übersichtliche Bauweise. Verwendung von leicht zu beschaffendem und billigem Material. Größter Schutz des Führers bei Bruchlandungen. Angenehme Flugeigenschaften. Gute Flugleistungen. Schnelle Montage.
Wie aus der Uebersichtsskizze zu ersehen ist, entstand ein kleiner abgestrebter Hochdecker mit leichter Pfeil- und V-Form. Die Pfeilform wurde darum gewählt, um den Führer so weit als möglich unter der Fläche unterbringen zu können, und um die Eigenstabilität zu erhöhen. Diese Forderung wurde jedoch nicht soweit getrieben, um
Diese Nummer enthält Patentsamrnlung Nr. I. Fand VITI.

den Blickwinkel nach oben zu beeinträchtigen. Die Sicht ist daher nach allen Seiten vollkommen ausreichend und entspricht ungefähr der des „Bussard".
Trotz der Pfeilform stehen die Rippen senkrecht zum Holm, die Flugeigenschaften und Leistungen wurden dadurch, was auch die Flugversuche zeigten, in keiner Weise beeinträchtigt.
Der Flügel ist zweiholmig. Vorder- und Hinterholm sind als C-Holme ausgebildet, diese haben die gleiche Bauhöhe, gleiche Breite und auch die gleichen Gurtabmessungen. Die Drehmomente werden durch die dazwischenliegenden Diagonalen auf die Holme bzw. die V-Strebe tibertragen.
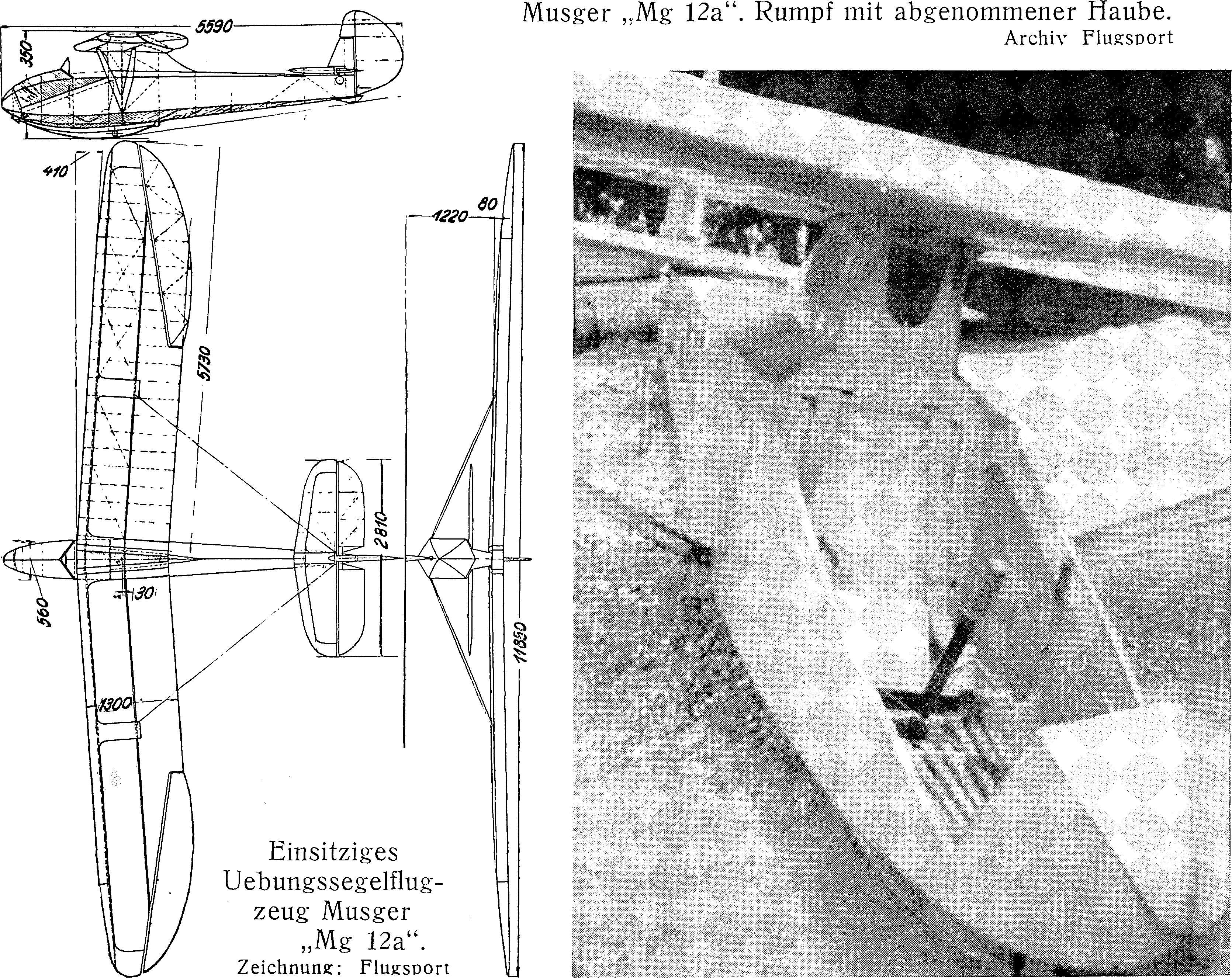
Der Rumpf hat einen kräftigen Kiel, auf welchem die Knüppelsteuerung, Starthaken mit Ausklinkvorrichtung und die Bauchgurte befestigt sind. Die Maschine besitzt einen abnehmbaren großen, bis nahezu zur Rumpfspitze reichenden Einsteigdeckel. Der aus dem Rumpf herausragende Hals, der gleichzeitig als Kopfabfluß dient, trägt die Baldachinrippen mit den Beschlägen für den Flügelanschluß. Der Rumpf ist konstruktiv so durchgebildet, daß er vollständig mit billigem Gleitersperrholz beplankt werden kann. Da Anfänger mit Vorliebe Drehlandungen hinlegen, wurde das Rumpfende mittels eines Spannseiles zum hinteren Strebenanschlußbeschlag am Flügel abgefangen.
Die erste Versuchsmaschine erhielt Profilrohrstreben, diese wurden jedoch bei der Neuausführung durch volle Holzstreben ersetzt, was sich im normalen Flugbetrieb als billiger erwiesen hat. Geknickte Profilrohrstreben müssen ganz entfernt, während Holzstreben geschäf-tet werden können.
Die ganze Maschine wurde bewußt robust gebaut, um dem rauhen Betrieb besser widerstehen zu können. Die Festigkeit geht daher über die verlangten Werte der BVS. hinaus.
Das Höhenleitwerk ist gedämpft und mit Seilen angetrieben, ebenfalls auch das Seitenruder. Das Querruder hat Differentialantrieb durch Stoßstangen im Rumpf und Seile im Flügel.
Der Entwurf der Versuchsmaschine ist beinahe 2 Jahre alt und wurde weitgehend den damals herrschenden Verhältnissen in Oesterreich angepaßt. Der Erstbau entstand im Segelflugzeugbau des ehemaligen Oesterr. Aero-Clubs (Oe. L. V.) in Wien. Nach Abschluß einer langen und harten Flugerprobung durch alle bekannten österreichischen Segelflieger wie Qumpert, v. Lerch, Kahlbacher usw., welche sich in erster Linie auf die Trudeleigenschaften richtete, wurde dann von der gleichen Werkstätte eine Serie von 10 Stück aufgelegt.
Die „Mg 12a" läßt sich mit losgelassenem Knüppel fliegen; durch volles Durchziehen und Kreuzen aller Ruder beginnt sie zu trudeln und kommt nach % Umdrehungen, ohne nachzudrücken, wieder heraus. Ein weiteres Trudeln ist nur möglich, wenn mit dem Querruder durch grobe Knüppelausschläge die Strömung am Flügel zum Abreißen gebracht wird. Durch langsames Durchziehen des Höhenruders und ohne größere Bewegungen der übrigen Ruder bringt man die Maschine in den Sackflug und kann ohne Gefahr auch so gelandet Werden. Musger „Mg 12a" Segelflugzeug. Archiv FluffSPOrt
Die Flugleistungen sind etwas, was an der Type besonders überraschte: Am Hundsheimer Kogel, wo das Muster mit allen anderen Flugzeugen gleichzeitig am Hang segelte, zeigte sich, daß auch unerfahrene Flieger damit wiederholt höher waren, als so manche Hochleistungsmaschine. Man kann tatsächlich wenig Maschinen so „hinhängen" wie die „Mg 12a", die dann noch mit wenig Fahrt ruhig weitersteigt und nicht abschmiert.
Spannweite 11,85 m, Länge 5,59 m, Rüstgewicht 134,0 kg, höchstzulässiges Fluggewicht 225 kg, Flügelstreckung 62/F = 10. Normale Fluggeschwindigkeit 40 bis 60 km/h. Die beste Sinkgeschwindigkeit liegt unter einem Meter. Gleitzahl 1 : 15.
Franz. Rayen N. R. Pa-112-C 1. „Flechair."
Der einsitzige Anderthalbdecker in Tandemanordnung soll als leichtes Jagdflugzeug Verwendung finden.
Vorderflügel 2teilig, 2 Holzholme, sperrholzbeplankt; Kastenholm aus Spruce und Esche. Hinterer Flügel mehrholmige Kastenbauweise, Kastenrippen, Sperrholz- und blechbeplankt.
Rumpf ovaler Querschnitt, Spruceholmen, sperrholzbeplankt. 23 mm Madson-Kanone im Rumpfvorderteil schießt durch die Propellermitte, 2 MG von 7,9 mm mit je 200 Schuß im Flügel.
Leitwerk halbstarr, gedämpft. Querruder Holz. Bremsklappen. Freitragendes Einbeinfahrwerk, nach hinten oben einziehbar. Abstützstreben unter dem hinteren Flügel und Spornrad einziehbar.
Triebwerk 2 luftgekühlte Salmson von 100 PS, Spannweite 4,16 m, Länge 6,74 m, Höhe 2,04 m, Leergewicht 430 kg, Fluggew. ohne Bewaffnung 610 kg.
Max. Geschw. am Boden 460 km/h, Startgeschw. \ 140 km, Landegeschw. ü °0 km/h, Startlänge 80 m, Auslauf 150 m, Reichweite 800 bis 850 km.
Franz. „Flechair" Payen N. R. Pa-112-CL
Zeichnune: FluKSDort
Ital. Katapult-Jagdflugzeug „Ro 44"*).
Bei der Konstruktion von Seekampf-Einsitzern sind dem Konstrukteur mit Rücksicht auf die Größenverhältnisse enge Grenzen gezogen. Die Maschine, äußerst leicht, muß wenig Raum beanspruchen, schnell in der Luft sein, und muß sich bei einer Notwasserung bei starker See noch halten können. Diese Erfordernisse hat der Konstrukteur der Ro 44 (gebaut von der Industrie Meccaniche e Aeronau-tiche Meridionali, Neapel) berücksichtigt und hat mit seinem Doppeldecker-Typ mit zwei seitlichen Stützschwimmern das Richtige getroffen; vgl. die nebenstehende Abbildung.
Aufbau-Doppeldecker, Oberflügel an den. Anschlüssen auf den Rumpf heruntergezogen, somit ausgezeichnetes Gesichtsfeld. Querruder am Oberflügel, Landeklappen an den Flügelwurzeln am Ober-und Unterflügel.
*) Vgl. Romeo „Ro. 43" Einschwimmer, Doppelsitzer, Aufklärungsflugzeug, „Flugsport" 1937, S. 180; Romeo „Ro. 41" Jagdeinsitzer, Doppeldecker, Land, „Flugsport" 1937, S. 181, sowie Romeo „Ro. 51" Jagdeinsitzer, Tiefdecker, „Flugsport" 1937, S. 580.
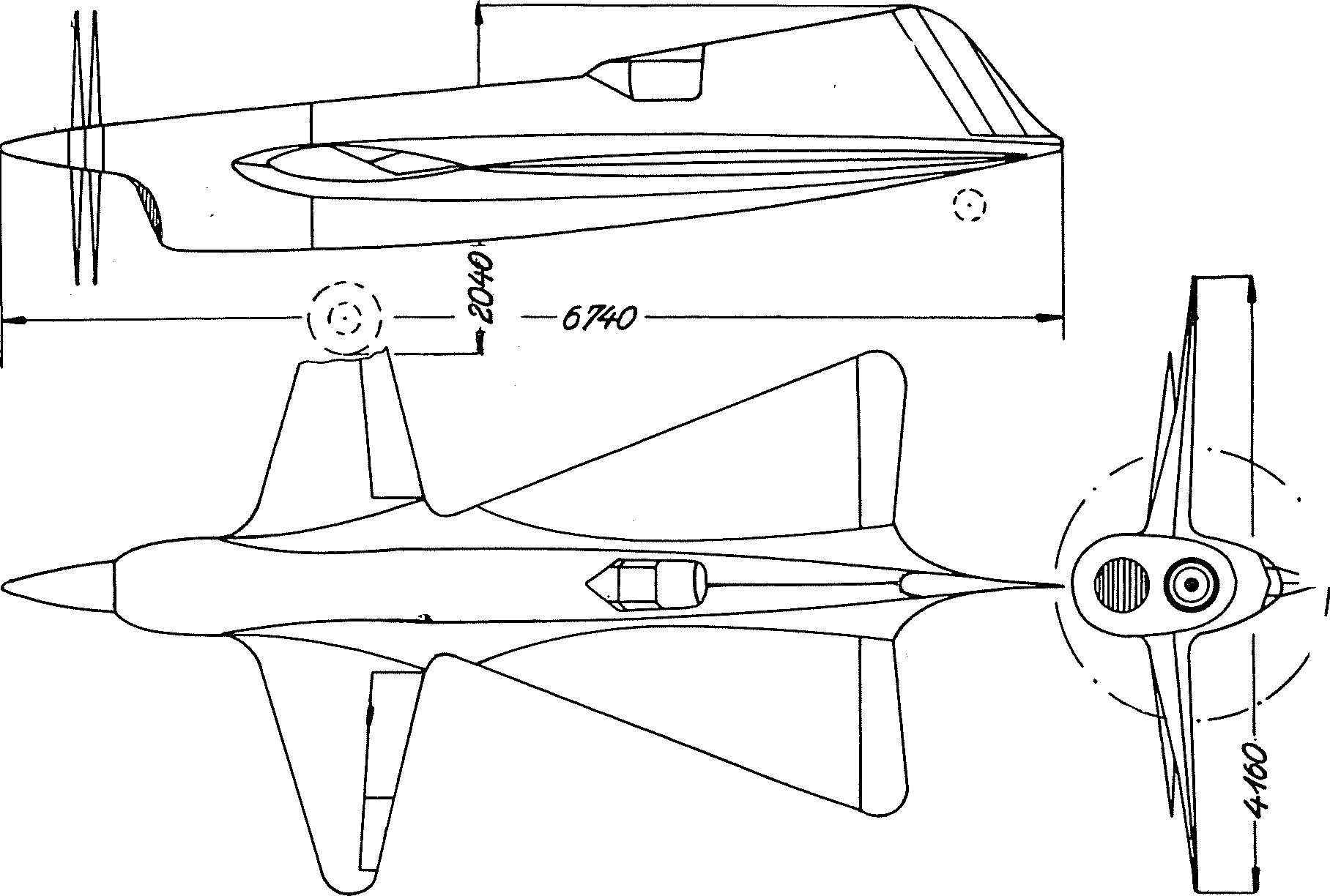
Ital. Ro 44-700-PS-Jagd-Einsitzer. Werkbild
Flügel gegeneinander stark gestaffelt.
Rumpf mit dünnem Profil. Stahlrohr mit Aluminiumbedeckung auf der Unterseite und hinter dem Motor. Unter dem Rumpf mit Stahlrohren versteift ein Zentralstützschwimmer mit Wasserruder, steuerbar vom Führersitz. Unter den Flügelenden zwei seitliche Stützschwimmer.
Höhenleitwerk gegen die Unterseite des Rumpfes verstrebt, im Fluge verstellbar. Ruderenden mit Trimmklappen.
Unterflügel von der Unterseite des Rumpfes nach unten geknickt und gegen diesen durch zwei kurze Streben, an deren Knotenpunkten gleichzeitig die Verspannung angreift, verstrebt.
Bewaffnung: zwei fest eingebaute „Breda Safat" 12,7 mm-MG.s, gesteuert, durch Propeller schießend.
Empfänger und Sendestation mit Langwellen.
Spannweite 11557 m, mit zurückgeklappten Flügeln 4,08 m, Länge 9,71 m, Höhe 3,51 m, Fläche 33,36 m2. Leergewicht 1770 kg, Nutzlast 450 kg, Fluggewicht 2220 kg. Wider Standskoeffizient 11. Höchstgeschwindigkeit am Boden 285 km/h, in 2500 m 305 km/h, Landegeschwindigkeit 98 km/h. Steigfähigkeit auf 1000 m in 1 min 35 sec, auf 2000 m in 3 min 30 sec, auf 4000 m in 8 min 40 sec, auf 5000 m
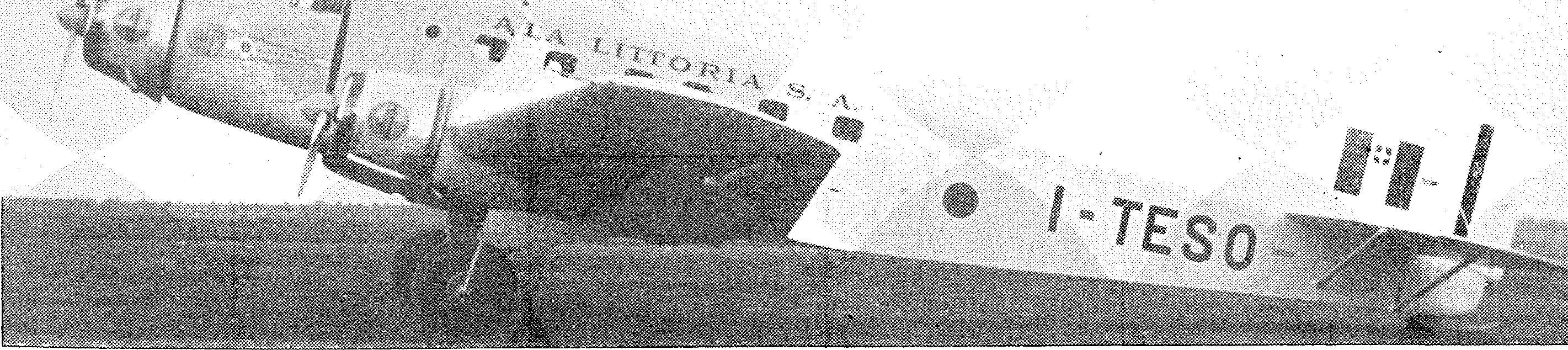
„Savoia Marchetti S. M. 75"-Verkehrsflugzeug mit 3 luftgekühlten Alfa Romeo 126 R. C. 34 von je 750 PS hat über 2000 km mit 10 000 kg Ladung einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt (vergleiche auch Kurznotiz). Werkbüd
in 12 min 30 sec. Gipfelhöhe 7000 m. Reichweite mit vollen Tanks in 4000 m Höhe mit 240 km/h Geschwindigkeit 5 Std. oder 1200 km; mit normaler Belastung in 4000 m Höhe mit 240 km/h Geschwindigkeit 2 Std. oder 480 km.
Motor 700 PS Piaggio P. X. R. mit Verstellschraube.
Poln. P. Z. L. „Sum" (Wels).
Das vorliegende Baumuster der polnischen Firma P. Z. L. (Panstwowe Zaklady Lotnicze, Warschau) ist als freitragender Mitteldecker in Ganzmetallbauweise ausgeführt und wird als leichter Bomber und Fernaufklärer eingesetzt; drei Mann Besatzung.
Flügel 3-teilig, trapezförmig; Vorderkante gerade. Außenflügel glattblechbeplankt als Kastenträger ausgeführt, wellblechversteift. Nasen- und Endrippenkästen angesetzt. Flügelmittel aus einem Stück mit dem Rumpf, 3-holmig, glattblechbeplankt; Verkleidung Unterseite abnehmbar. Klappen zwischen Querruder und Mittelstück hydraulisch betätigt. Mittelstück Spreizklappen.
Rumpf rund, Schalenbauweise Dural; Z-Längsprofile, glattblechbeplankt; Versenknietung. Einziehbare Rumpfwanne mit MG. für Bodenangriffe. In der Rumpfoberseite weiteres bewegliches MG.
Leitwerk freitragend, Ganzmetallbauweise, glattblechbeplankt. Trimmklappen an Höhen- und Seitenrudern. Seitenleitwerk Endscheiben.
Fahrwerk halbfreitragend 2-teilig; schwenkbares Gabelspornrad mit Hilfsspornfläche.
Triebwerk: Bristol „Pegasus XX", 925 PS, 9-zyL Sternmotor oder Gnöme-Rhöne 14 N 21, 1030 PS in 4000 m. Bei ersterem Bristol-Klappenkühler. Dreiflügelige Metallverstelluftschraube.
Spannweite 14,6 m,
Länge 10,5 m. Leergew. 1995 kg, Zul. 1555 kg, Fluggewicht 3550 kg. Leistungsbelastung mit Bristol 3,84 kg/PS.
Mit Bristol: ^ Höchstgeschw. in 3600 m 425 km/h, \ in Bodennähe 350 \km/h: Dienstgipfel-1 ϖ höhe 7700 m, Reich-/ weite bei 80% Mo-7 torleistung 1300km. Mit Gnöme-Rhöne: Höchstgeschw. in 4700 m 470 km/h, in Bodennähe 370 km/h;
Dienstgipfelhöhe 8600 m, Reichweite bei 80% Motorleistung 1100 km.
Douglas Verkehrsflugzeug DC-5.
Bei dem DC-5 hat man mit den bisherigen Konstruktionsgepflogenheiten gebrochen, um etwas Besseres zu schaffen. Charakteristisch für diesen Typ sind Hochdeckerbauart, Dreiradfahrwerk und starke V-
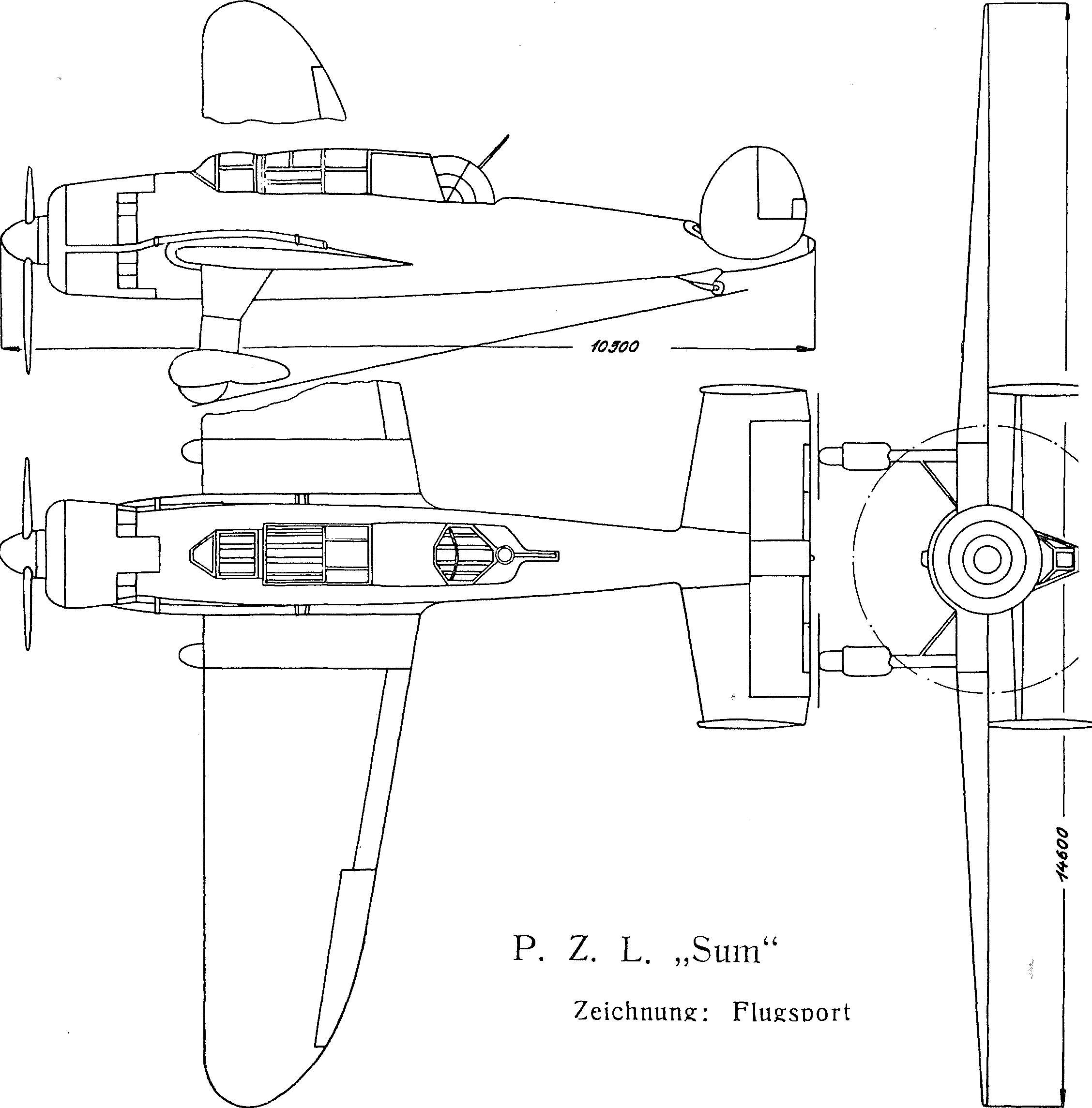
Stellung der Flügel. Durch die V-Stellung soll wohl die Stabilität, durch das Dreiradfahrwerk bessere Start- und Landemöglichkeit auf kleinen Plätzen und Hochdeckerbauart bequemere Verlegung und Kontrolle von Steuerzügen, Rohrleitungen und womöglich Zugänglichkeit des Flügelinneren während des Fluges erreicht werden. Durch Verwendung des Dreiradfahrwerkes steht die Maschine am Boden fast waagrecht, so daß der Einstieg der Fluggäste und Besatzung und vor allen Dingen das Tanken erleichtert wird.
Haupteinzelteile wie Motoreinbauten, Motorverkleidung, Steuerungseinrichtungen, Führersitz u. a. m. sind die gleichen geblieben und können mit dem DC-3 und DC-2 ausgewechselt werden.
Flügel Ganzmetall, Torsionskastenholm. Mittelstück mit dem Rumpf verbunden, Ansatzflügel außerhalb der Motoren.
Rumpf Schalenbauweise mit Längs- und Ringversteifung. Unterhalb des Rumpf-Fußbodens von der Nase bis hinter die Kabine als Kufe wirkender und zur Verstärkung des Rumpfes dienender Träger. Rumpf von kreisrundem Querschnitt, Fluggastkabine ein Gang in der Mitte, zu beiden Seiten je 8 Sitze. Die Größe und Ausstattung des Führerraums ähnelt dem des DC-3. Nur sind die Motorbedienungseinrichtungen und die Instrumente etwas höher, teilweise fast in Augenhöhe, untergebracht. Führersitz verstellbar, ebenso Fußhebel. Klappenbetätigung rechts vom Führersitz, Fahrwerk links.
Leitwerk freitragend, metallbedeckt. Ruder leinwandbedeckt.
Für den Einbau sind vorgesehen der Wright Cyclone G-2 mit 850-PS-Leistung in 1750 m, Startleistung 1000 PS und der Pratt & Whitney Hörnet SIE-2G mit 750 PS in 2100 m, Startleistung 875 PS. Betriebsstoffbehälter in den Flügeln 2500 1.
Spannweite 23,4 m, Länge 18 m, Höhe an der Nase 3,2 m, am Schwanz 6,07 m, Fläche 76 nr, Fahrwerk Spurweite 6,6 m.
Mit Cyclone-Motor: Flächenbelastung 108 kg/m2, Leistungsbelastung 4,85 kg/PS; Leergew. 5330 kg, Nutzlast 2950 kg, Fluggew. 8270 kg. Höchstgeschw. 360 km/h, Reisegeschw. 270—310 km/h, Lande-geschw. 103 km/h. Dienstgipfelhöhe 7150 m, absolute Höhe mit 1 Motor 3350 m; Steig-geschw. 374 m/min.
Mit Hornet-Motor: Flächenbelastung 108 kg/m2, Leistungsbelastung 5,51 kg/PS; Leergewicht 5210 kg, Nutzlast 3060 kg, Fluggew. 8270 kg, Höchstgeschw. 350 km/h, Reisegeschw. 250 bis 293 km/h, Landegeschw. 103 km/h. Dienstgipfelhöhe 6900 m, absolute Höhe mit 1 Motor 3240 m; Steig-geschw. 305 m/min.
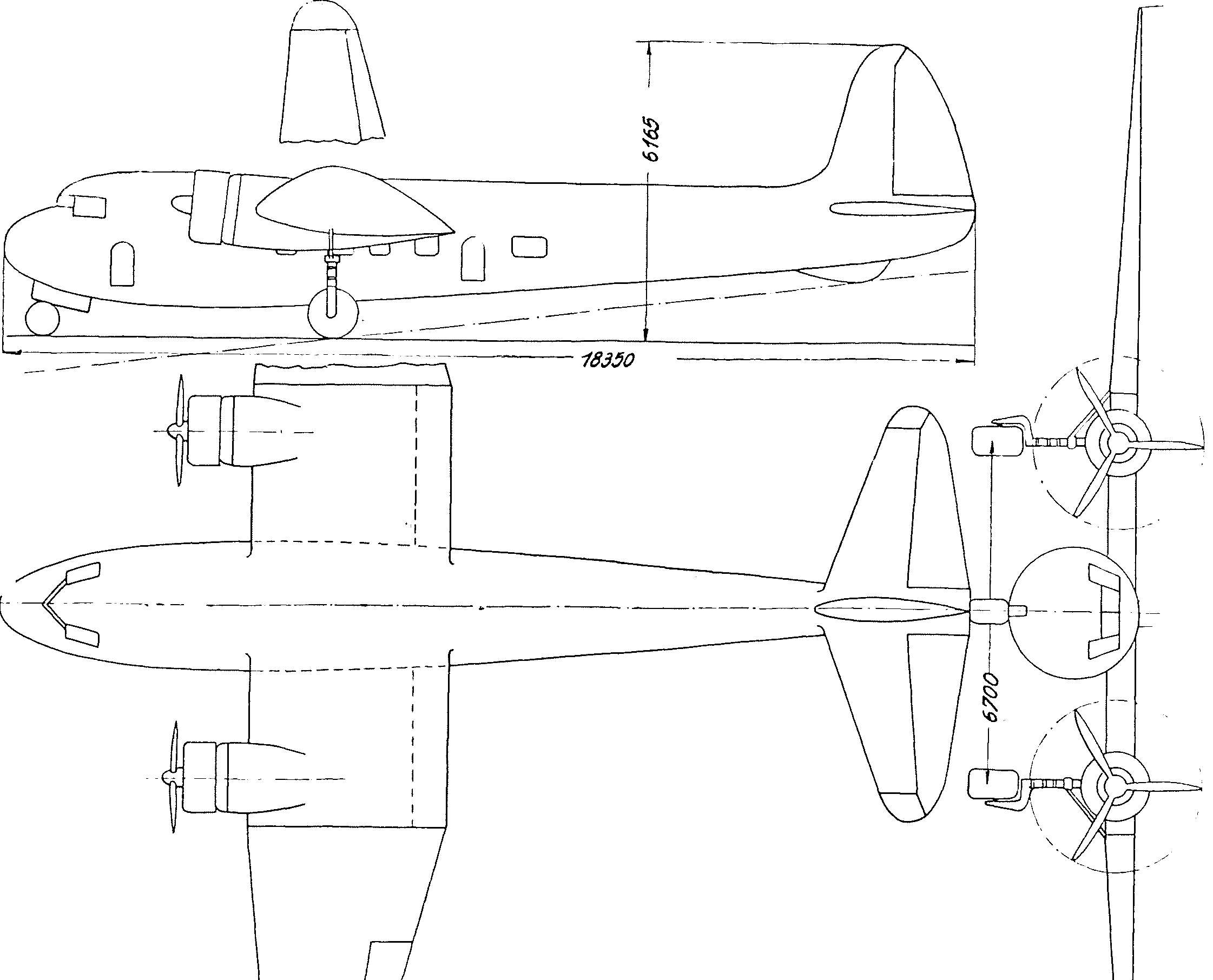
Douglas DC-5.
Zeichnung: FlussDort
Napier Haiford „Dagger" VIII.
Diesen wassergekühlten 24-Zyl.-H-Motor haben wir bereits anläßlich des Pariser Salons (s. „Flugsport" 1938, S. 658, u. 724) beschrieben. Nun ist der „Dagger" VIII. für den Serienbau des schnellen „Herford"-Bombers (die von Short and Harland gebaute Version
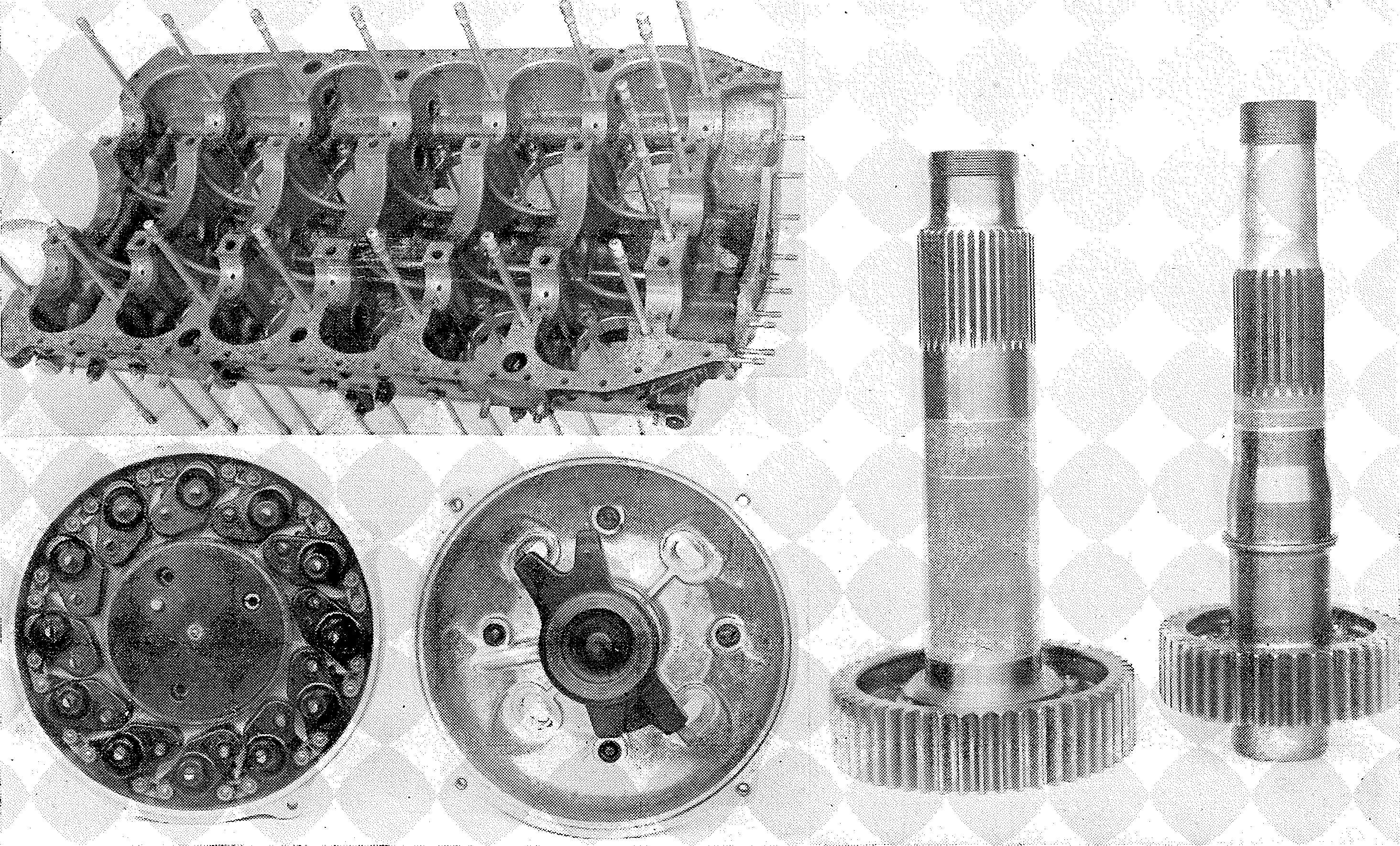
Abb. 1. Napier Haiford „Dagger" VIII, 1000 PS. Oben links: Kurbelgehäuse mit Queraussteifungen. Unten: Verteiler, der von der British-Thomson Co. Ltd. für dieses Motormuster entwickelt wurde. Rechts: Ritzel mit Luftschraubenwelle des „Dagger" VIII (links) vergleiche mit dem des „Dagger" III (rechts).
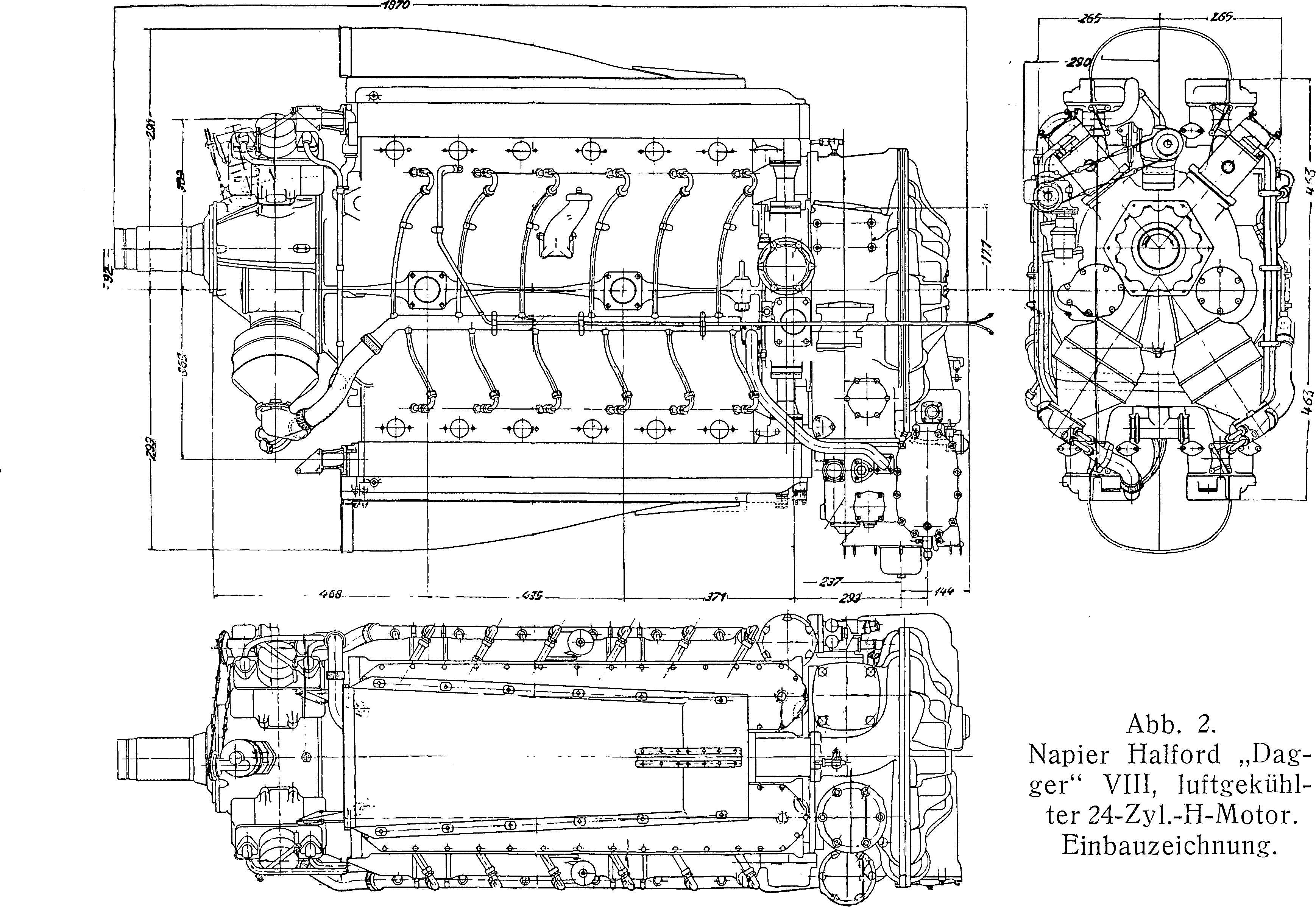
Nr. 3/1939. Bd. 3J „ F L U Q S P 0 R T " Seite 69
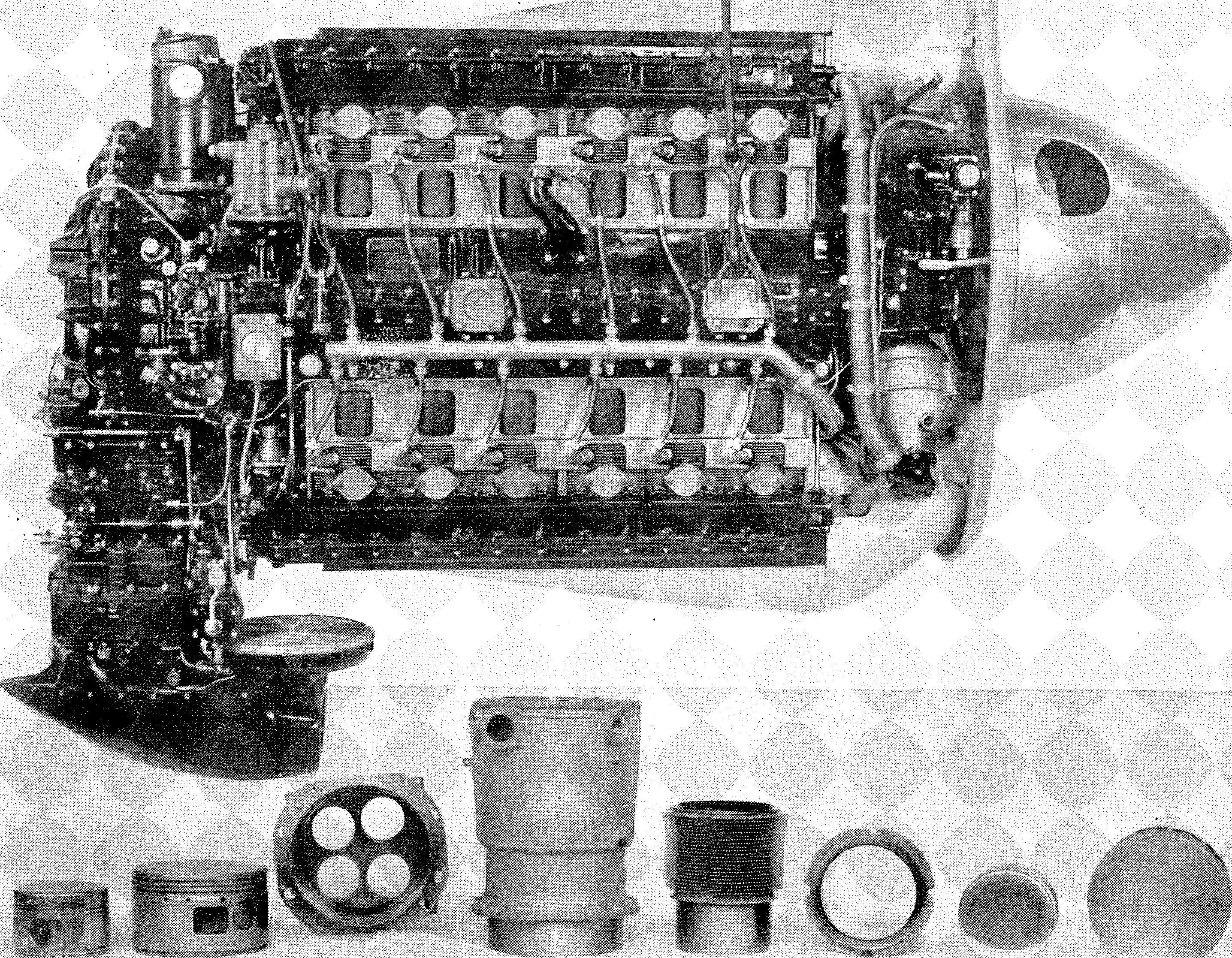
Abb. 3. Napier Haiford „Dagger" VIII. Man beachte oben rechts die Form der Kühlluftführung und der Propellerhaube. Gegenüberstellung von einigen Teilen des 1000 PS und des alten wassergekühlten 450 PS, Napier Lion.
des Handley Page „Hampden") vorgesehen worden und findet daher starke Beachtung.
Magnete und Verteiler sind wieder an der Nase in Kreuzform angeordnet, um die Ausbildung der Kühlluftführung zu gewährleisten (s. Abb. 2).
Die 24 Zylinder und die hohe Drehzahl des „Dagger" erforderten einen besonderen Verteiler (s. Abb. 1); Isolationsplatten mit je zwei Kontakten aus einem Stück.
Durchmesser und Hauptabmessungen der Luftschraubenwelle mußten mit Rücksicht auf die vorgesehene Verstelluftschraube stark vergrößert werden (s. Abb. 1). Man beachte die Größenverhältnisse.
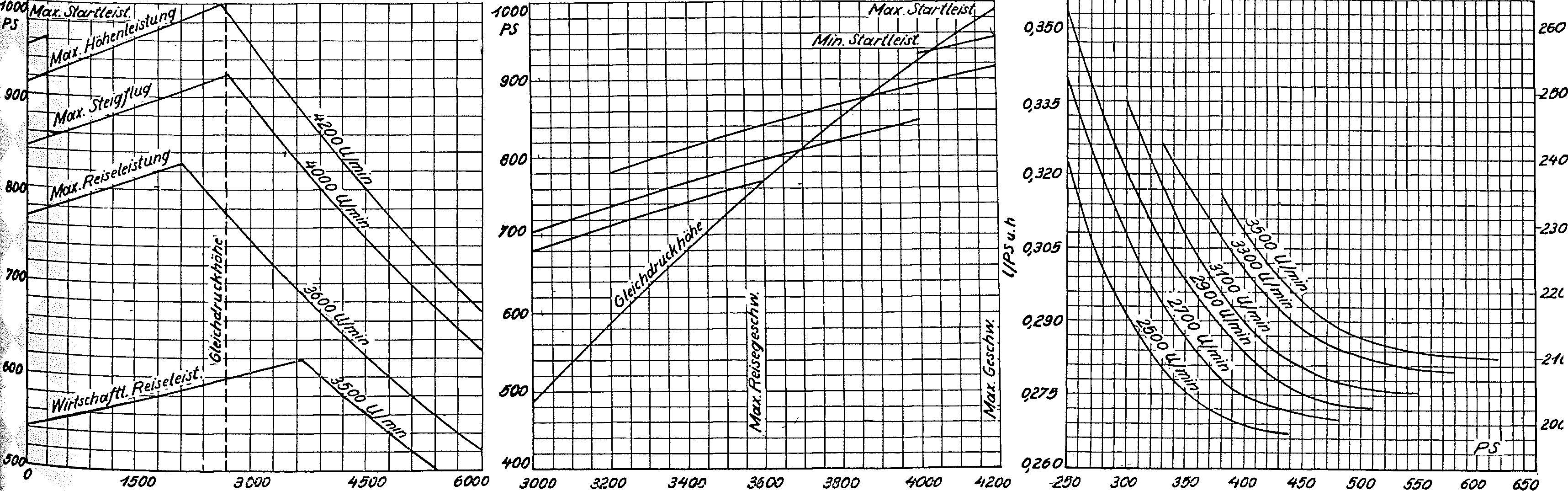
Höhe ittm U/wh
Abb. 4. Napier Haiford „Dagger" VIII, luftgekühlter 24-Zyl.-H-Motor. Links: Höhenleistungskurven; Mitte Leistungsschaulinien über der Drehzahl; rechts: Brennstoffverbrauch bei verschiedenen Drehzahlen.
Der Motor ist trotz der längeren Luftschraubenwelle um insgesamt 18 cm kürzer als das letzte Baumuster.
Abb. 3 zeigt einen Vergleich zwischen Zylindern und Kolben des 450 PS 12 Zyl. Napier „Lion" und des „Dagger".
Konstruktiv interessant ist das Aluminiumkurbelgehäuse mit Längs- und Querversteifungen (s. Abb. 1).
Frontfläche 0,49 m2, Gesamthubraum 16,84 1, Literleistung 59 PS/1, Leistungsgewicht 0,63 kg/PS.
Nennleistung 890/925 PS bei 4000 U/min in 2750 m Höhe. Höchstleistung 1000 PS bei 4200 U/min in 2660 m Höhe. Startleistung 955 PS bei 4200 U/min. Wirtschaftlichste Dauerleistung bei 3500 U/min und 0,017 kg/cm2 Ueberdruck.
Heizluftstrahltriebwerke.
(Fortsetzung von S. 37, Nr. 2, 1939.)
Die der Vergrößerung der Masse des Strahles und — damit verbunden — die Verringerung seiner Geschwindigkeit (Anpassung an die Fluggeschwindigkeit) dienende Luftbeimischung hat sich in der Weise, wie sie von Melot (s. Heft 2, S. 33) und andern vorgenommen wurde, nämlich durch Benutzung der Förderwirkung der strömenden, bereits expandierten Brenngase, nicht als sehr wirksam erwiesen.
Dipl.-Ing. Paul Schmidt, München, begründet die dabei auftretenden Energieverluste in seiner deutschen Patentschrift 523 655/62b (angemeldet am 23. April 30) mit folgenden Worten;
„Bei einem Ejektor (Strahlapparat) erfolgt die Beschleunigung der zugemischten Massen nach den Gesetzen des plastischen Stoßes; es ist also die Bewegungsgröße (Masse mal Geschwindigkeit) der gesamten den Ejektor verlassenden Masse stets gleich der Bewegungsgröße des Energiestrahles, durch welchen der Ejektor betrieben wird. Da die Bewegungsgröße aber auch gleich der Reaktionskraft ist, die durch die Strömung einer Masse erzeugt werden kann, ändert sich die Reaktionskraft durch Einschalten eines Strahlapparates nicht. Es tritt infolge des Mischvorganges vielmehr ein derart hoher Verlust an Energie ein, daß die Vermehrung der Masse durch die Verminderung der Geschwindigkeit aufgehoben wird."
Nutzt man dagegen die Druckwirkung der Brenngase zur Beschleunigung einer verhältnismäßig sehr großen Zusatzluftmasse aus, so ergibt sich, wie Schmidt ausführt, eine sehr wesentliche und wirtschaftliche Erhöhung der Reaktionskraft, deren Größe proportional der ausgestoßenen Masse und deren Geschwindigkeit ist. Die Energie, die zur Beschleunigung der Masse aufgewendet werden muß, ist in gleicher Weise von der Masse, aber von dem Quadrat der Geschwindigkeit abhängig, so daß die größte Wirtschaftlichkeit der Erzeugung von Reaktionskräften bei relativ kleinen Geschwindigkeiten und relativ großen Massen, die diesen Geschwindigkeiten unterworfen werden, erreicht wird.
Der Hauptanspruch des Schmidt7sehen Patents 523 655 lautet demgemäß: „Verfahren zum Erzeugen von Antriebskräften (Reaktionskräften) an Luftfahrzeugen durch Verpuffen von entzündlichen Stoffgemischen, dadurch gekennzeichnet, daß eine Luftmenge, deren Gewicht das des entzündlichen Gemisches um ein Vielfaches übertrifft, durch die Kraft des Ueberdruckes des zum Verpuffen gebrachten Gemisches unmittelbar beschleunigt wird." Der Ausdruck „Vielfaches" wird in einem Unteranspruch insofern bestimmt, als die der Beschleunigung unterworfene Luftmasse um etwa das 10- bis 50fache größer sein soll, als die des entzündlichen Stoffgemisches. Weitere Unteransprüche beziehen sich auf die Füllung des rohrförmigen Reaktionsraumes mit neuen Luftmassen.
Auch ein Zusatzpatent 567 586/62b (angemeldet 20. Februar 31) nimmt hierauf Bezug: der Lufteinlaß des rohrförmigen Reaktionsraumes a ist mit Klappen, Ventilen o. dgl. b ausgerüstet, die bei der Einwirkung der Druckkraft auf die Luftmassen die Oeffnung abschließen. Der Vorgang der Luftmassenbeschleunigung ist in den Abb. 34—37 dargestellt, und zwar in 4 Phasen:
1. Das durch die geöffneten Klappen eingeführte brennbare Gemisch nimmt nur einen sehr geringen Bruchteil des Gesamtraumes ein (Abb. 34).
2. Nach dem Schließen der Klappen erfolgt Verpuffung und Expansion, wobei das expandierte Gemisch immer noch einen verhältnismäßig geringen Bruchteil des Rohrinhaltes ausmacht. Infolge der Druckwirkung der entzündeten Gase setzt eine Strömung der Luftsäule in Richtung des Pfeiles d ein (Abb. 35).
3. Die Klappen sind wieder geöffnet, die Luft und die expandierten Verbrennungsgase schreiten in Richtung des Pfeiles d fort und erzeugen eine Saugspannung, die in Richtung des Pfeiles e eine Einströmung neuer Luftmassen in das Rohr a hinein bewirkt (Abb. 36).
4. Das expandierte Gemisch ist im Begriff, das mit einer neuen Luftsäule vollgesaugte Rohr zu verlassen; brennbares Gemisch ist hinter der Luftsäule nachgesaugt (Abb. 37). Hierauf beginnt der Kreislauf von neuem.
Ein anderes (am 9. Nov. 31 angemeldetes) Zusatzpatent 558 113/62b hat eine Ausbildung der Haupterfindung für die Zwecke des Höhenflugs zum Gegenstände. Die Entzündung erfolgt in einer verbrennungsmotorischen Einrichtung; in ihr geht zunächst unter Leistung mechanischer Arbeit eine Teilentspannung auf einen mittleren Druck vor sich, und erst die restliche Entspannung dient der unmittelbaren Beschleunigung einer Luftsäule. Diese Art der Anwendung des Haupterfindungsgedankens ist nach Schmidt deswegen für Höhenflugzeuge vorteilhaft, weil bei verbrennungsmotorischen Einrichtungen dieser Luftfahrzeuge der in höheren Luftschichten herrschende geringe Luftdruck nicht ohne weiteres zur Leistung mechanischer Arbeit nutzbar gemacht werden kann. Die P <*
Druckenergie, die denVer- ^/v-,; ■-^-
puffungsgasen nach Entspannung auf einen mittleren Druck von z. B. 3-4 at in

Abb. 34—37: P. Schmidt 1931:____________
Reaktionsrohr nach (PiZ TL WW^L^iyW^f
DRP. 567 586. Abb. 38 u. 39: P. Schmidt 1931: Reaktionsrohr nach DRP. 558 113.
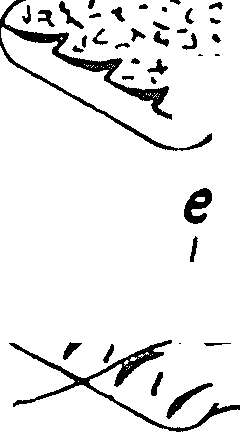
Abb. 38 u. 39. Abb. 34—37.
z. B. 15 km Höhe noch innewohnt, ist ungefähr von der gleichen Größe, wie die von der verbrennungsmotorischen Einrichtung aus den Ver-puffungsgasen aufgenommene Energie. Jedoch treten auch in geringeren Höhen die grundsätzlichen Vorteile des Verfahrens in die Erscheinung. Die Abb. 38 u. 39 zeigen den Reaktionsteil einer Einrichtung nach DRP. 558 113. Durch das Ventil 1 — Abb. 38 — werden die erfindungsgemäß auf einen mittleren Druck entspannten Ver-puffungsgase dem Reaktionsraum 2 zugeführt und beschleunigen in der durch die Pfeile 3 und 4 angedeuteten Weise die in ihm lagernde Luftsäule. In der Abb. 39 ist das Ventil 1 geschlossen und die in dem Rohr 2 befindliche Luftmasse infolge der durch die Kraft des Ueber-drucks der Verpuffungsgase erteilten kinetischen Energie entsprechend dem Pfeil 5 in Strömung begriffen. Diese (mit abnehmender Geschwindigkeit verlaufende) Strömung bewirkt nach Oeffnung der Klappen 6 das Hineinsaugen einer neuen Luftmasse, und zwar solange, bis das Rohr 2 mit ihr angefüllt ist, worauf durch einen neuen Druckimpuls von Verpuffungsgasen nach Schließung der Klappe 6 eine erneute Beschleunigung herbeigeführt wird und so fort. Man kann natürlich Strahlmasse nebenher zum Antrieb einer Turbine für den Luftvorverdichter der verbrennungsmotorischen Einrichtung und die letztere zum Antriebe einer Vortriebsluftschraube verwenden. Das Zusammenwirken der verbrennungsmotorischen mit der Reakions-Einrichtung ergibt eine gute Brennstoffausnutzung bei geringem technischen Aufwände und geringem Baugewicht.
Das deutsche Holzwarth -Patent 644633/46g (Erf.: Dipl.-Ing. Dr. U. Meininghaus), angem. am 30. März 32 (vgl. auch die umfassendere französische Patentschrift 751 949) stellt ein Betriebsverfahren für Rückstoßantriebe unter Schutz, bei dem die Brennstoffausnutzung aufs Aeußerste getrieben werden soll: dem Treibstrahl wird der Wärmeinhalt völlig entzogen, so daß er vor seinem Austritt
3fy Abb. 40. Meininghaus-Holzwarth 1932: Die dem Treib-
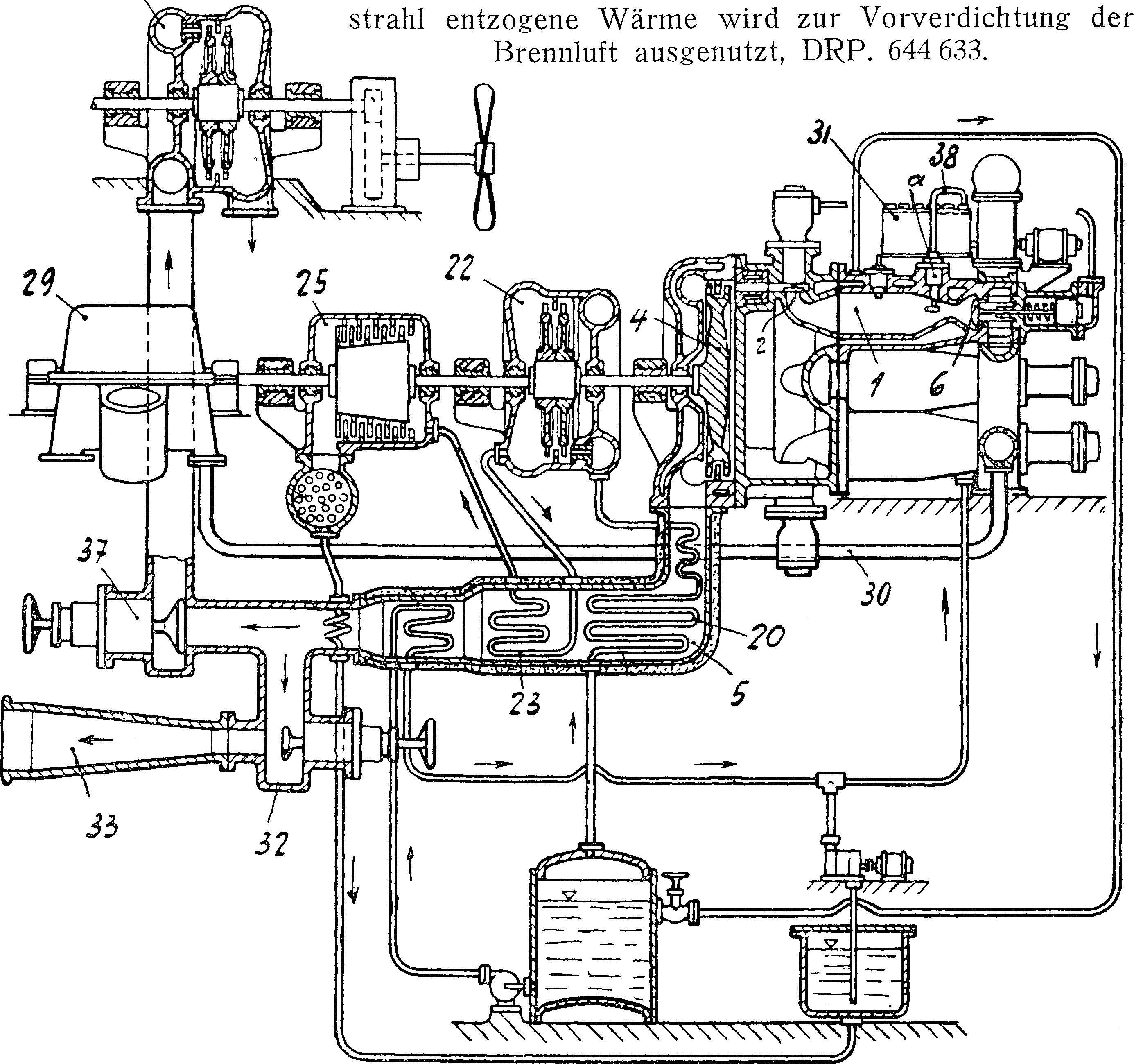
bereits die Temperatur der Außenluft besitzt; die entzogene Wärme wird in Energie, die zur Vorverdichtung der Brennluft dient, umgesetzt. Der Hauptanspruch kennzeichnet das Neue des Verfahrens mit dem Merkmal, daß diese Energie nach Verlassen der Verpuffungs-kammer, aber vor der Ausstoßbeschleunigung dem gesamten Treibmittel entzogen wird.
In dem Ausführungsbeispiel Abb. 40 wird den Verpuffungs-kammern 1 über das Ventil 6 und die Leitung 30 aus dem Verdichter 29 Verbrennungsluft und aus der Brennstoffpumpe 31 über Leitung 38 und Ventil a flüssiger Brennstoff zugeführt. Nach Zündung bei Kammerabschluß öffnet sich das Düsenventil 2 und läßt die hochgespannten, hocherhitzten Feuergase der Beschaufelung eines Turbinenlaufrades 4 zuströmen. Haben sich die Kammergase genügend weit entspannt, so öffnet sich das Luftventil 6 und die eingelassene Luft schiebt den Feuergasrest aus. Die Turbine 4 ist mit dem Ladeluft-Verdichter 29 unmittelbar gekuppelt, deckt aber nur einen Teil der zu dessen Antrieb erforderlichen Energie. Die Deckung des Restes erfolgt durch zwei Dampfturbinen 22, 25, die ihren Dampf durch Ueberhitzerschlangen 20 und 23 erhalten, die in dem von den Feuergasen der Turbine 4 durchstrichenen Wärmeaustauscher 5 angeordnet sind.
Dem Wärmeaustauscher 5 entströmende Gase haben einen verhältnismäßig hohen Druck, aber eine sehr niedrige Temperatur. In diesem Zustand werden sie, solange Rückstoßantrieb bestehen soll, über das geöffnete Ventil 32 der Rückstoßdüse 33 zugeleitet. Die Gase verlassen das Ausströmende 33 unter Umständen sogar unterkühlt; der Treibstrahl führt also keine Wärme nutzlos ab.
Sinkt die Fahrzeuggeschwindigkeit unter ein bestimmtes Maß, wie beispielsweise bei Luftfahrzeugen, wenn sie sich in dichteren Luftschichten bewegen, so wird der Rückstoßantrieb unwirtschaftlich und besser durch Luftschraubenantrieb ersetzt. Im vorliegenden Falle ist eine Dauerstromturbine 34 vorgesehen, die über eine Untersetzung eine Vortriebsschraube antreibt, nachdem das Ventil 32 geschlossen und das Ventil 37 geöffnet worden ist.
Der durch seine ergebnisreichen Versuche mit Abbrandtrieb-werken und sein hierüber aussagendes Werk*) bekannt gewordene amerikanische Physiker R. H. Goddard hat in der amerikanischen Patentschrift 1 980 266 (angem. 7. Febr. 31) ein Heizluftstrahltriebwerk (Brennkammer mit konstantem Volumen) dargestellt, vgl. Abb. 41 bis 46. Luftein- und Gasaustritt werden durch die auftretenden Drücke selbsttätig gesteuert, und zwar mit Hilfe einer Feder 36 (Abb. 45) und in folgender Weise: Hat soeben in der Kammer 2\ (Abb. 41) bei offenem Schließkegel 26 und geschlossenen Klappen 31 (Abb. 42) eine Zündung
*) „A method of reaching extreme altitudes", Washington 1919, ein Buch, das Anlaß zu der Raumschiff-Epidemie vor 10 Jahren gab.
Abb. 41—44. Goddard 1931: Ein- und Austrittsverschlüsse regeln sich selbsttätig gemäß dem im Brennkammer-Innern vorhandenen Druck.
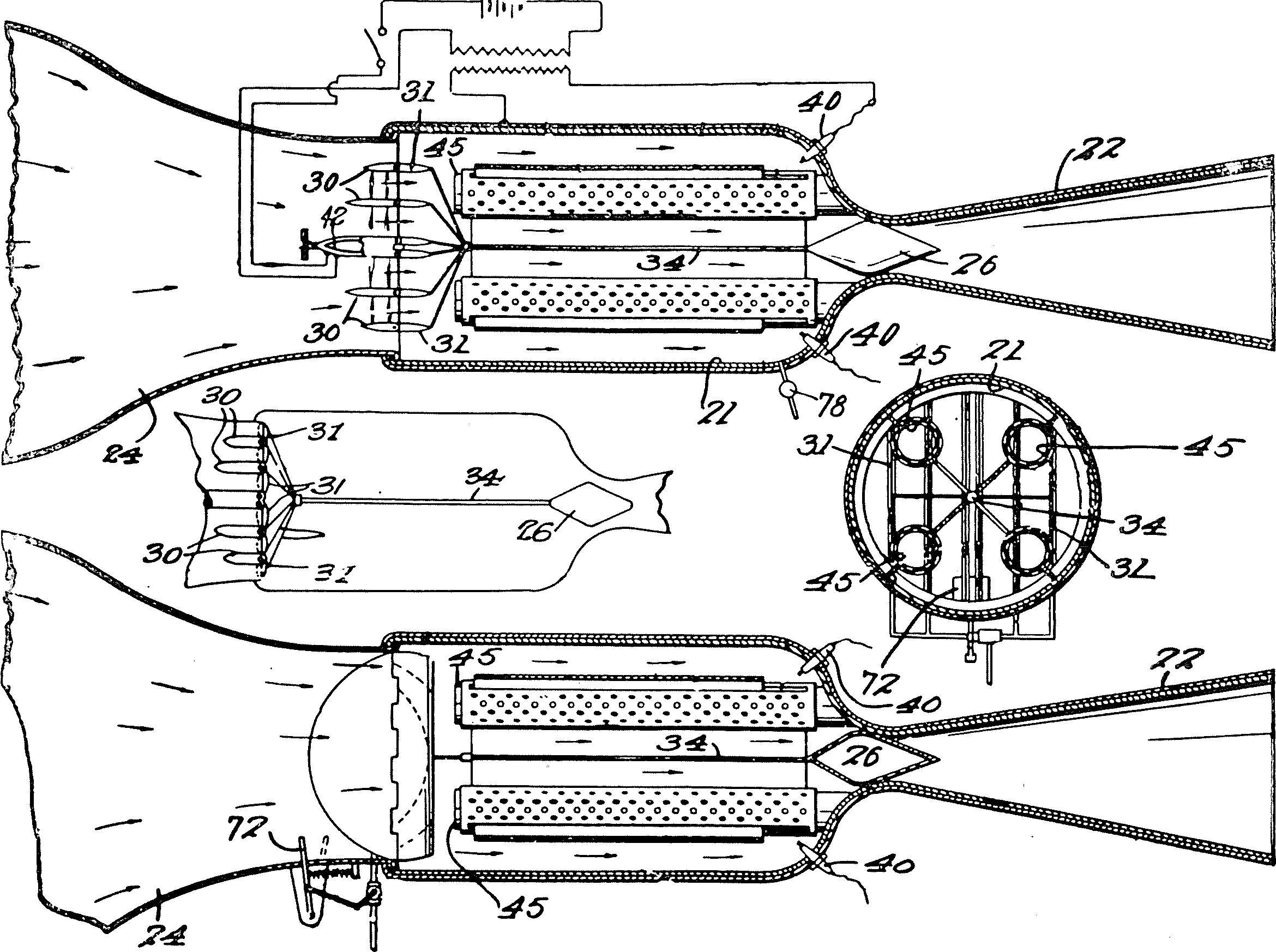
stattgefunden und das durch den Diffusor 22 entweichende Gas infolge seiner Trägheit einen Unterdruck in der Kammer erzeugt, so wird dieser und die vom Trichter 24 aufgefangene Luft (Fahrtwind) die Klappen 31 öffnen — zugleich den Kegel in Schließlage bringen — und die von den Brennstoffstrahlen bei 30 (Abb. 45 u. 46) angereicherte Luft wird in das hintere Kammerende vordringen, In dem Maße, wie die Klappen sich mit zunehmendem Druckausgleich schließen, nimmt die Brennstoffzufuhr ab, so daß in der Nähe des Kegels 26 und der Kerzen 40 ein reicheres, zündfähigeres Gemisch als in der Nähe der Klappen 31 vorhanden ist. Ein solches wird auch noch in sogenannten Hilfsbehältern 45 (durchlöcherte Zylinder, die von einem axial verschiebbaren durchlöcherten Zylinder umgeben sind) erzeugt, indem an denjenigen Stellen der brennstofführenden Wände 30, die in der Flucht der Behälter 45 liegen (Abb. 46) die Spritzdüsen in größerer Zahl angeordnet sind; von der Stange 34 gesteuert, gewähren die Zylinder-Löcher vollen Durchtritt dem brennstoffreichen Inhalt der Behälter 45, wenn die Klappen geschlossen sind; dann entsteht durch Berührung von 38 und 42 (Abb. 45) Zündkontakt, der Kammerinhalt entflammt und das Brenngas entströmt in den Diffusor. Das geschilderte Spiel wiederholt sich. Die bei einem Spiel anfallende Brennstoffmenge regelt sich selbsttätig durch die Beaufschlagung einer Fühlfläche 72 (Abb. 44) im Trichter 24 nach Geschwindigkeit und Dichte der eintretenden Luft; ein Hilfsvergaser für den Start ist bei 78 (Abb. 41) angedeutet. Dem Einwände, daß der Wirkungsgrad dieses Triebwerks nur gering sei, weil die Verdichtung in der Kammer bei geöffnetem Kegel 26 nicht hoch sein könne, begegnet Goddard mit der Feststellung, daß der Druckabfall im Kammerinnern im Verhältnis zum Staudruck wegen des kleinen Diffusor-wurzelquerschnitts bei 26 und der raschen Aufeinanderfolge der
Vorgänge nicht beträchtlich sei.
Die am 7. Juni 33 und am 2. Jan. 34 von R. L e d u c angemeldeten französischen Patentschriften 770 326 bzw. 779 655 befassen sich mit den uns schon aus älteren Veröffentlichungen bekannten Verfahren der Umwandlung von Wärme- in Bewegungs-Energie ohne Zuhilfenahme mechanischer Verdichter. Der Flugzeugaufbau, vgl. die Abb. 47 und 48, ähnelt der Campinischen Ausführungsform (s.ÄAbb. 31 auf S. 36), abgesehen von den dort vorhandenen Schleuderverdichtern. Mit 9 sind Leitflächen bezeichnet, die die Strömung an die Rohrinnenwand leiten sollen; 3 sind Brenner, 4 Brennstoffvorwärmer. Da das s& Strömmittel in sich erweiternden (Verdichtungs)-Trichtern schwe-
Abb. 45 und 46. Goddard 1931: Lufteintrittsklappen mit Brennstoffeinspritzung.
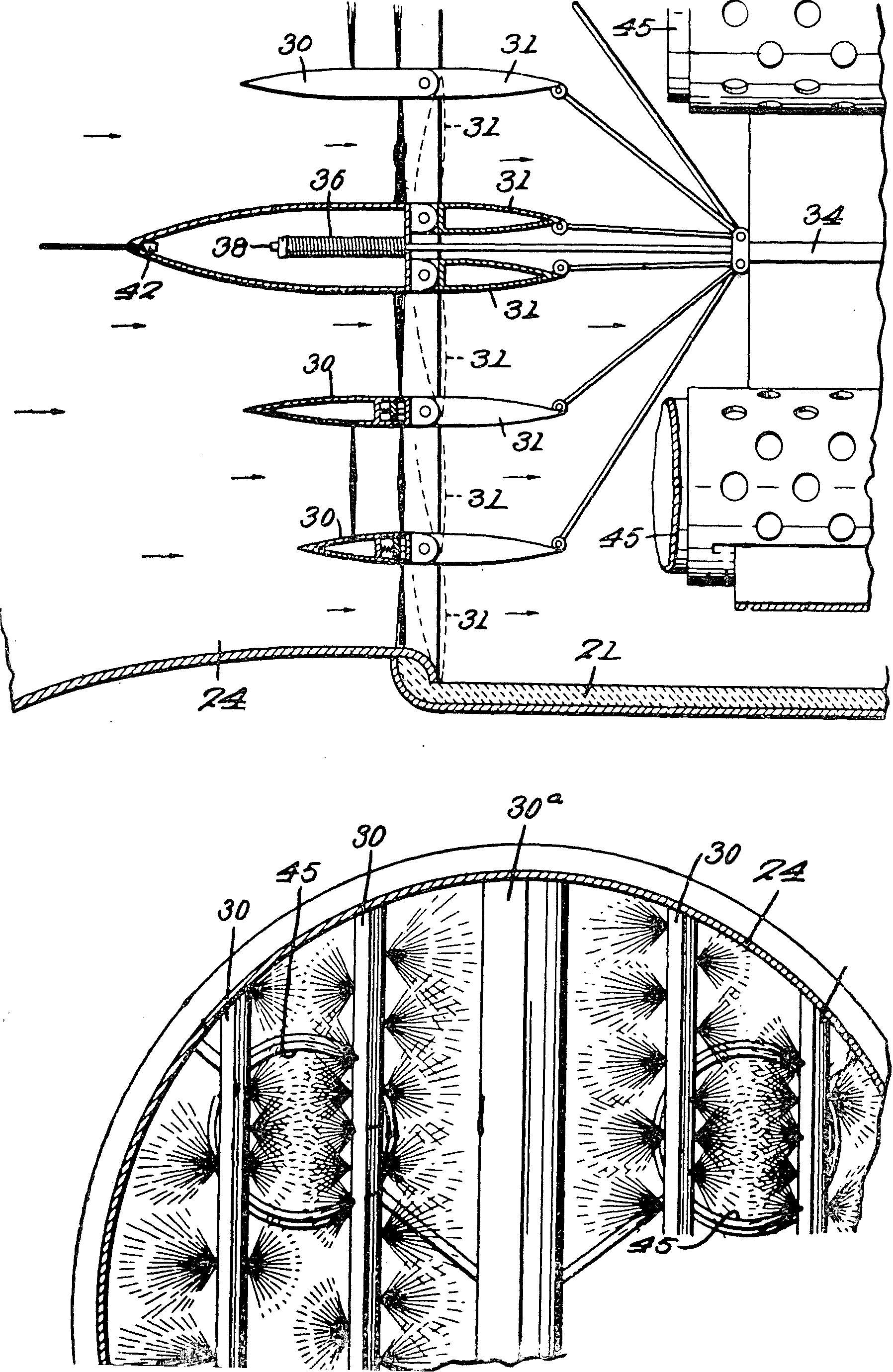
Abb. 51. Leduc 1933: Geschoß mit Abb. 52. Leduc 1933: Turbinenartige
Strahlrohr. Vortriebseinrichtung für Flugzeuge.
Abb. 53.
Durand-Fontugne 1933: Startrakete schafft Unterdruck hinter Motorkolben.
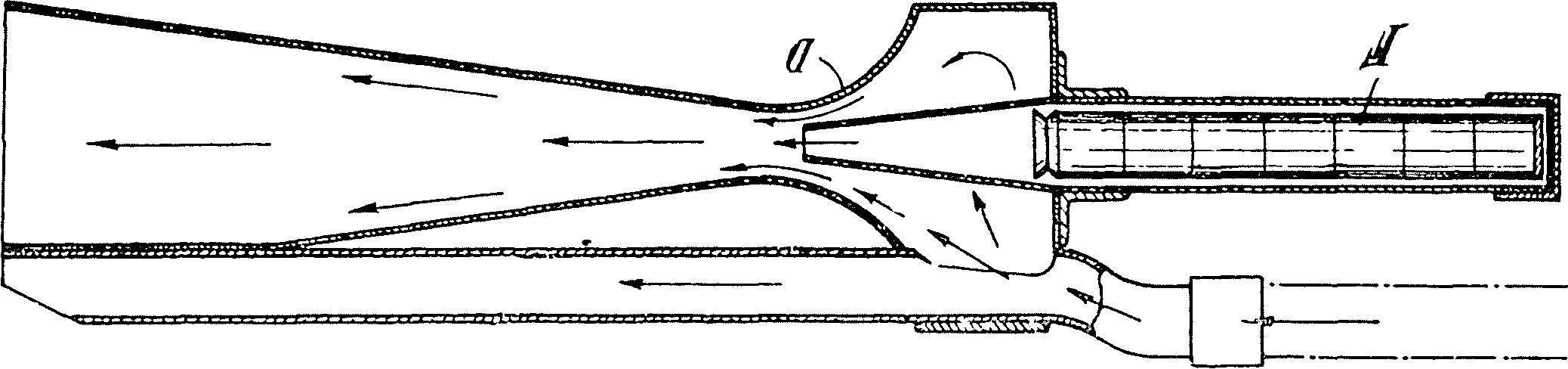
rer vor der Ablösung von der Wand zu bewahren ist als in sich verengernden (Expansions)-Trichtern will Leduc, vgl. Abb. 49, längs der Wand der ersteren eine dünne Schicht des Strömmittels entlangblasen, das von Stellen höheren Drucks (8) nach ringförmigen Rillen (10) geleitet ist. In ähnlicher Weise sucht er auf der Außenseite die Grenzschichtbildung durch Fortblasen zu verhindern (Abb. 50). Auf Geschosse beziehen sich weitere Vorschläge Leducs, vgl. z. B. Abb. 51, wonach der eigentliche Geschoßkörper von einem „die Stoßwellen bei Ueberschallgeschwindigkeit unterdrückenden" Rohrkörper ohne oder mit Heizquelle (2) umgeben ist. Abb. 52 zeigt einen turbinenartigen Strahlerzeuger, bei dem die winklig angeordneten Brennkammern 31 das Laufrad 32 in Umdrehung versetzen, wodurch die eintretende Luft im Gebläse 33 vorverdichtet wird.
Die Verbindung von Strahlantrieb mit Grenzschichtabsaugung findet sich in neuerer Zeit häufiger, z. B. in der deutschen Patentschrift 607 894/62b (Mainguet) und in der brit. Patentschrift 484 405 (Bristol).
Eine eigenartige Anwendung einer Startrakete (s. hierzu auch Heft 2, S. 59) findet sich in der französischen Patentschrift 770 689 von Durand-Fontugne vorgeschlagen, vgl. Abb. 53. Die in einen mit dem Motorauspuff in Verbindung stehenden Ejektor D ausblasende Rakete F soll beim Start durch Schaffung eines brüsken Unterdrucks hinter den Motorkolben die Motorleistung steigern. Gohlke.
(Schluß folgt.)
Technische Hochschule Braunschweig.
"""7 Bekanntlich ist Braunschweig
neben den Hochschulen Berlin und Stuttgart zum Luftfahrtzentrum erhoben worden. Die neueingerichtete Abteilung für Luftfahrt, der die Aufgabe obliegt, neuen technischen Nachwuchs für die Luftfahrt heranzubilden, wurde im November vorigen Jahres eingeweiht. Die vier Hauptlehrstühle sind in vier Instituten — Institut für Flugzeugbau, Institut für Triebwerkslehre, Aerodynamisches Institut, Institut für Luftfahrtmeßtechnik und Flugmeteorologie —, jedes in einem eigenen Gebäude, untergebracht. Zu den Baulichkeiten gehören noch eine große Flugzeughalle sowie ein modernes Hörsaalgebäude.
Institut für Flugzeugbau — Leiter Prof. Dr.-Ing. Winter, bekannt als Konstrukteur des „Fieseler-Storch" — enthält Werkstätten und Arbeitsräume, die sich um eine große Versuchshalle gruppieren, in der die erforderlichen Maschinen und Einrichtungen für die statischen und dynamischen Festigkeitsversuche untergebracht sind.
Institut für Triebwerkslehre — Leiter Prof. Dr.-Ing. Schmidt — verfügt gleichfalls über eine große Prüfhalle, die aber den kleineren „Prüflingen" entsprechend mehr unterteilt ist. Hier stehen Prüfstände zur Prüfung verschiedenartiger Flugmotoren. Grundsätzliche Untersuchungen werden an „Einzylinder"-Motoren angestellt. In Nebenräumen sind elektrische Maschinen und Sammler für die Gleichstrom-Versorgung aller Institute untergebracht; weiter befinden sich dort Werkstätten und Arbeitsräume für Dozenten und Studenten.
Aerodynamisches Institut — Leiter Prof. Dr. Schlichting — enthält als wichtigste Anlage einen großen Windkanal, in dem an Modellen die Flugleistungen und Eigenschaften von ganzen Flugzeugen oder einzelnen Tragflügeln mit Hilfe feiner Waagen gemessen und untersucht werden. Ein kleiner Wasserkanal gestattet die Veranschaulichung von Strömungsvorgängen. Auch eine kleine Versuchsanlage zur Erzeugung von Ueber-Schall-Luftgeschwindigkeiten ist vorgesehen.
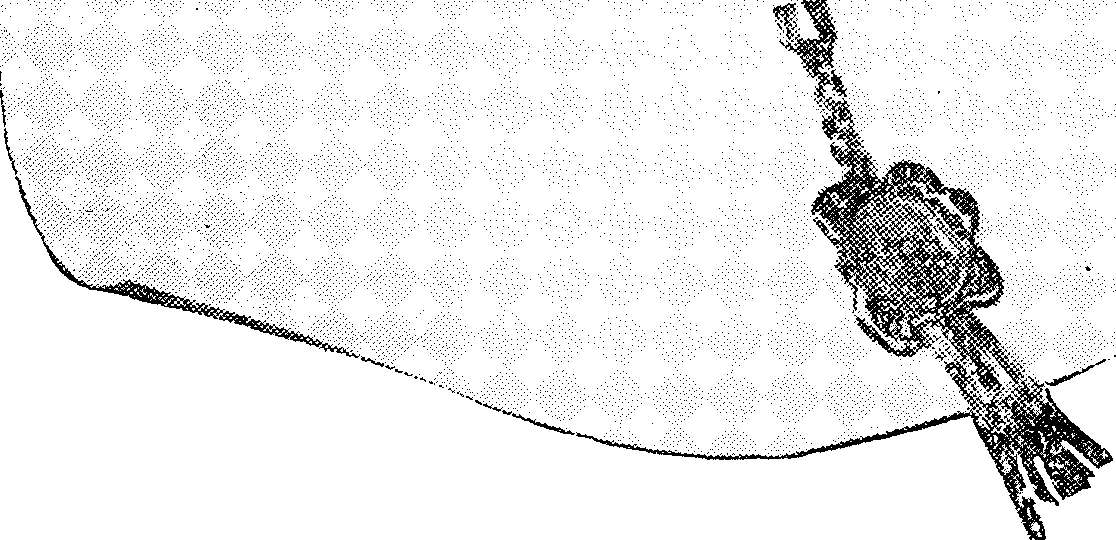
Von der Technischen Hochschule Braunschweig. Blick auf die Institute für Trieb-wrerkslehre, für Flugzeugbau und auf das Hörsaalgebäude.
Bilder Archiv N. S. D. Doz.-Bd. (4)
Institut für Luftfahrtmeßtechnik u. Flugmeteorologie — Leiter Prof. Dr. Koppe — besitzt nebst Beobachtungsfeld insbesondere alle Einrichtungen für die Prüfung von Meßgeräten zur Ueberwachung des Triebwerks, des Flugzustandes, der Navigation und endlich des Luftmeeres im Laboratorium und im Luftfahrzeug.
Zu diesen vier ordentlichen Lehrstühlen kommen noch eine außerordentliche Professur und elf Lehraufträge, die die verschiedensten Sondergebiete der Luftfahrt berücksichtigen:
Lehrauftrag für Gasdynamik — Leiter Prof. Dr.-Ing. Busemann. — „Gasdynamik" bezeichnet Aerodynamik der hohen Geschwindigkeiten. — Sobald sich Körper durch die Luft mit Geschwindigkeiten bewegen, die mit der Schallgeschwindigkeit vergleichbar sind, macht sich die Eigenschaft der Gase bemerkbar, daß sie bei den mit dieser Strömungsgeschwindigkeit verbundenen Druckunterschieden ihre Volumen wesentlich ändern. Der Charakter der Strömung wird ein anderer und damit ändern sich die günstigen Formen für tragende Teile und für durch die Luft geschleppte Teile, die Profileigenschaften bei Aenderung des Anstellwinkels werden anders; kurz, es muß die ganze Aerodynamik, wie sie für die geringen Geschwindigkeiten entwickelt ist, für jeden Geschwindigkeitsbereich der hohen Geschwindigkeit neu aufgebaut werden. Zwar liegen die in unteren Luftschichten bisher erreichten Fluggeschwindigkeiten noch unterhalb der Schallgeschwindigkeit, die bekanntlich 333 m/sec oder rund 1200 km in der Stunde beträgt. Ueberschreitungen der Schallgeschwindigkeit kommen aber schon heute bei Luftschrauben im und am Triebwerk und in der Meßtechnik vor. Die unstetigen weitgehenden Veränderungen der Gesetze der Aerodynamik bei Lieberschreiten der Schallgeschwindigkeit erfordern noch umfassende theoretische und experimentelle Forschungsarbeiten.
Lehrauftrag für Meteorologische Meßtechnik — Leiter Dr. phil. habil. Grundmann. — Die Notwendigkeit, unsere Kenntnisse von den physikalischen Vorgängen im Luftmeer noch mehr auszudehnen und zu vertiefen, fordert immer feinere Meßgeräte und Verfahren. Das Flugzeug hat sich als aerologisches Forschungsmittel ausgezeichnet bewährt. Für die Ueberwachung und Feinmessung aller, das Wetter und den Zustand des Luftmeeres gestaltenden, physikalischen Vorgänge im freien Luftmeer wie auch am Boden geeignete Meßgeräte und Verfahren zu entwickeln, ist Aufgabe der meteorologischen Meßtechnik.
Lehrauftrag für Segelflugzeugbau — Leiter Dr.-Ing. Wienecke. — Es ist kein Geheimnis mehr, daß der Motorflugzeugbau durch den Segelflugzeugbau weitgehend befruchtet worden ist. Einmal in bezug auf aerodynamische Formen und dann in bezug auf den Leichtbau der Flugzeugzelle. Erfolgreiche Motorilug-zeugbauer wie Messerschmitt, Klemm und andere sind aus dem Segelflugzeugbau hervorgegangen. Großversuche mit neuartigen Flugzeugformen im Anschluß an Modellversuche werden billiger zunächst mit Segelflugzeugen durchgeführt. Hierbei kann an die erfolgreichen Versuche bei der Entwicklung mit schwanzlosen Flugzeugen erinnert werden. Der Segelflug hat seine Kraftquellen im Luftmeer. Die Schulung des fliegerischen Nachwuchses auf Segelflugzeugen hat daher die gleiche Bedeutung wie die Ausbildung des Seemannes auf Segelschiffen.
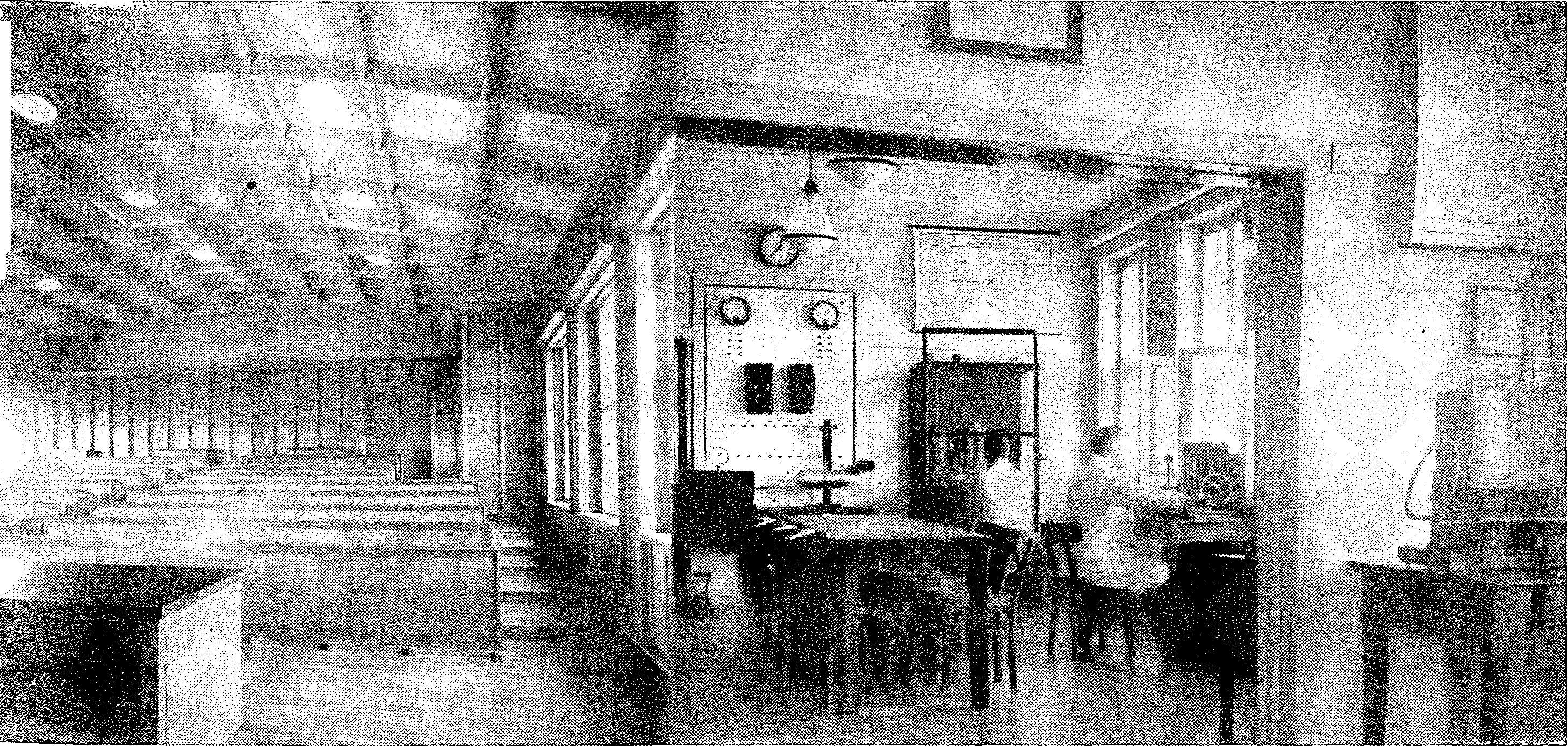
Von der Technischen Hochschule Braunschweig. Linkt: Großer Hörsaal der Abteilung für Luftfahrt. Rechts: Blick in das Druck-Prüflaboratorium des Instituts
für Luftfahrtmeßtechnik.
Lehrauftrag für Fertigungswesen — Leiter Fliegeroberstabsingenieur DipL-Ing. Haarmann. — Aufgabe des Fertigungswesens des Luftfahrzeugbaues ist, den Entwurf des Flugmechanikers sowie die vom Flugzeugbauer berechnete Gestaltung des Luftfahrzeuges so in die Wirklichkeit umzusetzen, daß die geforderte Flugleistung und Festigkeit durch die handwerkliche Bearbeitung keine Einbuße erleidet. Nur durch neue Fertigungsverfahren, z. B. Versenknietung glatter Bleche, ist die Erzielung der heute erreichten hohen Flugleistung möglich. Der Metallflugzeugbau ist ebenso wie die Schweißtechnik ein besonderer Lehrberuf im handwerklichen Sinne. Die Verbesserung der Entwicklungs- und Fertigungsverfahren hat überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen, Flugzeuge in Reihenfertigung zu bauen, die den hochgespannten Anforderungen der Aerodynamik entsprechen. Der Reihenbau verlangt weiterhin hoch entwickelte Vorrichtungen und Prüfverfahren um Austauschbarkeit einzelner Bauteile zu gewähren.
Lehrauftrag für Flugfunkwesen. — Leiter Prof. Dr.-Ing. Pungs. — Die besonderen Betriebsbedingungen des Luftfahrzeugs stellen auch besonders hohe Anforderungen an die Nachrichtenübermittlung von und mit Flugzeugen. Als Nachrichtenmittel in der Luftfahrt kommt fast ausschließlich das Funkgerät in Frage, das sowohl der Uebermittlung von Nachrichten wie auch ganz besonders der technischen Navigation dient. Es muß auch heute noch gesagt werden, daß ohne Bodenorganisation, also vor allem funktechnische Hilfen, kein Luftfahrzeug in der Lage ist, ohne Sicht irdischer oder astronomischer Anhaltspunkte ein vorbezeichnetes Ziel zu erreichen. Die Funkpeilung, die als Eigen- oder Fremdpei-lung ausgeführt werden kann, unterliegt aber vor allem zu Zeiten der Dämmerung sehr erheblichen Störungen infolge der Reflexion der elektromagnetischen Wellen, an den elektrisch leitenden Hüllen, die unsere Erde in großen Höhen umgeben. Diese Peilfehler zu beseitigen und die Nachrichtenübermittlung auf große Entfernung sicher zu stellen ist ein wichtiges Aufgabengebiet des Flugfunkwesens, das sich auf die Anwendung aller Wellenbereiche, vor allem aber auch der kurzen und ultrakurzen bezieht.
Lehrauftrag für Luftwaffenwesen — seit dem Ableben von Fliegeroberstabsingenieur Dr.-Ing. Thome verwaist. — Nachdem Deutschland seine Wehrhoheit wieder erreicht hat, spielt der Kriegsflugzeugbau wie in allen anderen Ländern eine hervorrragende wichtige Rolle. Ein besonders wichtiges Gebiet des Kriegsflugzeugbaues ist die Bewaffnungsfrage, da die zur Verwendung kommenden fest oder beweglich eingebauten Luftwaffen, Maschinengewehre, Geschütze, Bomben usw. bei den besonderen Betriebsbedingungen der Luftfahrzeuge vor allem den hohen Geschwindigkeiten ganz andere Eigentümlichkeiten und Leistungen aufweisen, die eine eingehende Bearbeitung aller dieser Einzelfragen erfordern. Die Rückwirkung der Luftwaffen auf Flugleistungen, Flugeigenschaften und auch die Festigkeit eines Flugzeuges müssen gesondert behandelt werden.
Lehrauftrag für Luftbildwesen — Leiter Fliegeroberstabsingenieur Dr.-Ing.
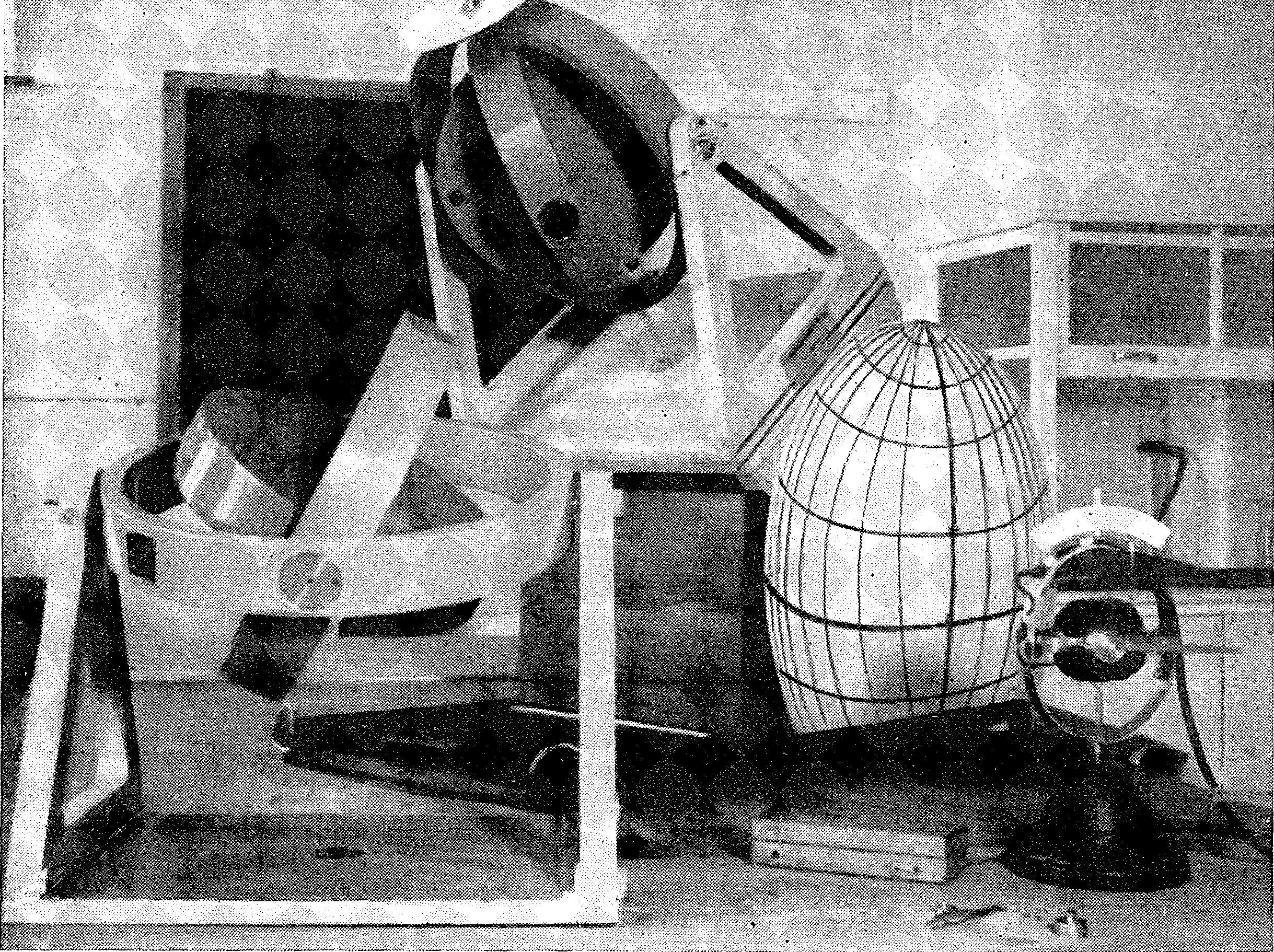
Aschenbrenner. —■ Die Möglichkeit, vom Luftfahrzeug aus mit geringstem Zeitaufwand genau vermeßbare Abbildungen des überflogenen Geländes zu erhalten,
Von der Technischen Hochschule
Braunschweig:
Flugzeug-Lehrkreisel, entwickelt im Institut für Luftfahrtmeßtechnik der T. H. Braun-
schweig.
hat die Erdvermessung vielfach verdrängt. Die Ausbildung des Aufnahmegeräts (fest eingebaute oder von Hand zu bedienende Aufnahmekammern), die in Abhängigkeit von der Uebergrundgeschwindigkeit selbsttätig schaltenden Reihenbildner, welche die Aufnahme kilometerlanger zusammenhängender Geländestreifen gestatten, ist dabei von ebenso großer Bedeutung wie die Entwicklung von Auswerte-Geräten, mit denen in einfacher, oft rein mechanischer Weise, z. B. aus einem stereoskopischen Aufnahmepaar unmittelbar eine genaue Landkarte mit Höhenschichtlinien gezeichnet werden kann. Es versteht sich von selbst, daß das Luftbildwesen für militärische Zwecke besondere Bedeutung besitzt.
Lehrauftrag für Luftschiffwesen — (noch nicht erteilt). — Neben dem Flugzeug wird das gasgetragene Luftschiff für bestimmte Aufgaben immer noch Verwendung finden, deswegen muß der Luftfahrtingenieur sich neben dem Luftschiffbau, dessen Grundlagen im wesentlichen die gleichen wie die des Flugzeugbaues sind, auch mit der Führung und dem Betrieb des Luftschiffes vertraut machen.
Lehrauftrag für Flugmedizin — Leiter Prof. Dr. Rautmann. — Da es der Mensch ist, der das Flugzeug führt und von ihm getragen wird, so unterliegt auch sein Orgnismus allen Einflüssen und Beanspruchungen, die das Luftmeer und der jeweilige Flugzustand mit sich bringen. Flugzeug und Flieger bilden also gewissermaßen einen Organismus, und die Leistungsfähigkeit eines Flugzeuges ist letzten Endes nicht nur ein physikalisch-technisches, sondern auch ein biologisches Problem. Der Luftfahrt-Ingenieur muß sich also auch mit diesen Dingen beschäftigen. Die Luftfahrtmedizin hat gerade in der letzten Zeit sehr wichtige Hinweise zur technischen Weiterentwicklung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Luftfahrt gegeben.
Lehrauftrag für Luftverkehr — Leiter Prof. Dr.-Ing. Gerstenberg. — Wie Eisenbahn- und Schiffsverkehr, so hat auch der Flugverkehr seine besonderen Eigenarten. Diese kommen nicht nur in der Aufstellung von Flugplänen und Luftlinien unter besonderer Berücksichtigung der geographischen, meteorologischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten zum Ausdruck; Ausgestaltung der Flughäfen, zweckmäßige Einrichtungen zur Beschleunigung der Wartung der Luftfahrzeuge wie auch der Abfertigung von Personen und Gütern spielen dabei ebenfalls eine wichtige Rolle zur allgemeinen Beschleunigung des Luftverkehrs.
Lehrauftrag für Luftrecht — Leiter Luftwaffengruppenintendant Ministerialrat Dr. Plagemann. — Der Luftverkehr hat infolge seiner großen Reichweite und seiner Freizügigkeit sehr schnell die eng gezogenen Ländergrenzen gesprengt. Das Ueberfliegen fremder Hoheitsgebiete setzt rechtsverbindliche Abmachungen voraus, die unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsbedingungen der Luftfahrzeuge (Begrenzung der Freizügigkeit durch Festlegung bestimmter Fluglinien und Anflughäfen auf der einen Seite, die Möglichkeit von unvorhergesehenen Fehlortungen und Notlandungen auf der anderen Seite, Versicherungsschutz usw.) von besonderen sachverständigen Juristen ausgearbeitet und in weitgehende zwischenstaatliche Vereinbarungen gebracht worden sind.
Durch dieses umfassende Arbeitsprogramm wird in Braunschweig zum ersten Male wie an keiner anderen Technischen Hochschule die Möglichkeit geboten, auf allen Gebieten der Flugtechnik die grundlegenden Kenntnisse zu erwerben und die praktischen Fertigkeiten zu üben.
Beförderungen in der Luftwaffe zu Generalen der Flieger: die Generalleutnante Volkmann, Klepke, Christiansen;
zu Generalmajoren: die charakteris. Generalmajore Schwub, v. Stubenrauch, v. Kotze; und die Obersten Schubert, Carlsen, Dipl.-Volksw. Weigand, Cranz, Ritter, Siburg, Mußhoff, Mahncke, Ritter v. Mann, Edler v. Tiechler, Lech, Bruch, Brocker, Kolb, Vierling, Schulz, Doerstling, Coeler, Flugbeil, Süßmann,

UMDSCHAI
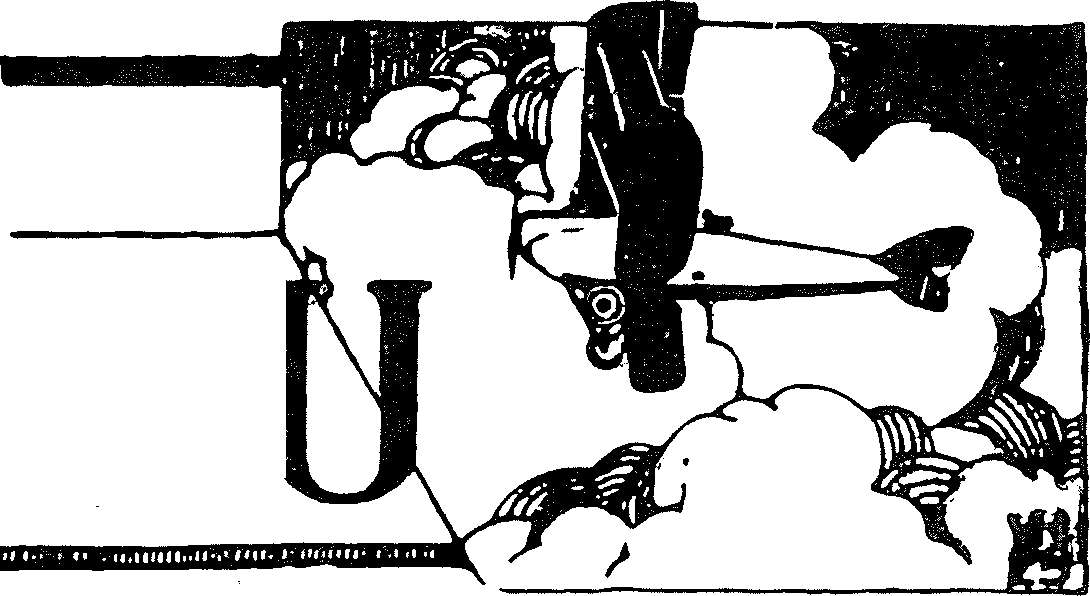
Inland.
Koch, Somme, Ritter v. Pohl, Deßloch, Fischer, Haehnelt, Dr. Weißmann, Witting;
zu Obersten: die Oberstleutnante Schulze, Franz, Behrendt, Boettge, Krah-mer, Frhr. v. Boenick, v. Stutterheim, Fischer, Funcke, Dipl.-Ing. Mälzer, Dr. Fisser, Müller-Kahle, Dipl.-Ing. Riesch, Tschoeltsch, Seywald, Müller (Gottlob), Bülowius, Kammhuber, Köchy, Czeck, v. Chamier-Qliszinski, Fütterer, v. Heyking, Pfeiffer, Abernetty, Sattler, Stapelberg, Buchholz, Pistorius, v. Gerlach, Dauber, Deunert, Wolff, Roesch, Christenn, Weyert, Carganico, Bernardt, Nowak, Müller (Fritz), Frhr. v. Wangenheim;
zu Oberstärzten: die Oberfeldärzte Dr. Knörr, Dr. Gebler, Dr. Sabersky-Müssigbrodt.
Fieseier „Storch", als Geschenk des Generalfeldmarschalls Göring an Balbo,
ist durch Major v. Cramon, dem Leiter der Attachegruppe Luft, überbracht worden. Der Fieseier „Storch" wurde auf dem schwierigen Ueberführungswinterflug über Alpen und Appenin nach Rom geflogen. Landungen bei über 70 cm Neuschnee bereiteten keine Schwierigkeiten. Gleichzeitig mit dem Flugzeug wurde ein Handschreiben des Generalfeldmarschalls Göring an Marschall Balbo im Beisein des Luftattaches bei der deutschen Botschaft in Rom, Generalmajor Freiherr v. Bülow, übergeben. Besonders herzliche Aufnahme fand der deutsche Flieger bei den italienischen Kameraden in Bozen, Trient, Verona, Bologna und Jesi.
Flugtechn. Fachgruppen an den Hochschulen werden in Zukunft besonders gefördert. Der Reichsstudentenführer und in seiner Begleitung der Beauftragte für Fachschulen und der Reichsgruppenfachleiter für Technik waren zu einer gemeinsamen Aussprache beim Chef des Technischen Amtes des Reichsluftfahrtsministeriums, Generalleutnant Udet, zu Gast. Es wurden Fragen des Ingenieurnachwuchses, der Nachwuchslenkung und Ingenieurerziehung erörtert. Weiter wurde ein Abkommen über flugtechnische Fachgruppen von Generalleutnant Udet und dem Reichsstudentenführer Dr. Scheel unterzeichnet.
AradoAr79ist auf ihrem Langstreckenflug Europa—Australien—Europa am 21. 1. in Sydney gestartet und am gleichen Tag in dem 2000 km entfernten Clon-curry über die Randgebirge der Ostküste Australiens hinweg glatt gelandet. Die nächste Etappe führte über die 1500 km entfernte Hafenstadt Port Darwin, 2000 km über verschiedene Inseln Niederländisch-Indiens und große Meeresstrecken nach Balik Papan an der Ostküste Borneos. Von hier aus Start am
26. 1. über die Südsee, 1500 km, nach Cebu auf den Philippinen. Vgl. „Flugsport" 1939, S. 22 u. 53.
Brasil. Luftwaffenkommission ist auf Einladung des Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe, Generalfeldmarschall Göring, am
27. 1. von Hamburg kommend in Berlin eingetroffen, um die deutsche Luftwaffe und die deutsche Luftfahrtindustrie zu studieren.
„Entwicklungsrichtungen im Flugzeugbau". Ueber dieses Thema sprach vor der Lilienthal-Gesellschaft in Berlin der Direktor bei der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, Adlershof, Prof. Dipl.-Ing. Günther Bock. Er legte seinem Vortrag die Frage zugrunde: Welche Möglichkeiten bestehen, um die in den letzten Jahren außerordentlich gesteigerten Flugleistungen weiterhin zu verbessern?
Der einfachste Körper, den wir uns als Tragfläche vorstellen können, so führte er aus, ist die ebene unprofilierte Platte unendlich geringer Dicke. Ihr Luftwiderstand besteht ausschließlich aus Reibungswiderstand; dessen Abhängigkeit von der Fluggeschwindigkeit, den Abmessungen der Platte und den Eigenschaften der Luft ist seit langem bekannt. Tragflächen p r o f i 1 e ergeben für das Gebiet, das für heutige Flugzeuge in Betracht kommt, bei grundsätzlich gleichem Verlauf etwas größere Widerstände. Der induzierte Widerstand des Flügels, der von dem Umriß der Tragfläche abhängt, spielt bei den heutigen hohen Geschwindigkeiten nur eine untergeordnete Rolle. Verringert man den Luftwiderstand des Flugzeuges durch Verkleinerung der Tragfläche, so ist, um die Landegeschwindigkeit nicht unzulässig wachsen zu lassen, die Benutzung von Profilen mit gro-ßenAuftriebshöchstwerten notwendig. Hierzu wird z. B. vor der Landung die Profilwölbung durch Ausschlag von Klappen an den Flügelhinterkanten verändert oder ein Spalt an geeigneter Stelle des Profils geöffnet, durch den Luft von der Unterseite nach der Oberseite der Tragflächen hindurchtritt und so das Abreißen der Strömung verhindert. Auch bei den übrigen Bauteilen des Flugzeuges, wie Rumpf, Motoreinbau, Kühler usw. lassen sich durch zweckmäßige Gestaltung Luftwiderstandsverringerungen erzielen.
Die Erhöhung der Fluggeschwindigkeit hat auch an die Luftschraube erhöhte Anforderungen gestellt: so hat die Entwicklung in den letzten Jahren von der starren Holzluftschraube zur verstellbaren Luftschraube mit Holzoder Metallblättern geführt. Diese ändert die Steigerung ihrer Blätter selbsttätig so, daß sie unabhängig von der Drosselstellung des Motors eine bestimmte vom Flugzeugführer wählbare Drehzahl stets einhalten.
Im Qrenzfall kann man sich ein Flugzeug vorstellen, dessen Luftwiderstand nur noch aus Reibungswiderstand besteht. Ein solches „Ideal-Flugzeug" würde je nach Wahl seiner Flächenbelastung eine Geschwindigkeitserhöhung von 20—30% gegenüber modernen Schnellflugzeugen aufweisen, falls seine Trieb Werksanlage ungeändert bleibt; falls man die Leistung des Triebwerks bis in große Höhen konstant erb alten könnte und man zum Höhenflug überginge, wäre ein weiterer Fortschritt erzielbar. Der Höhenflug erfordert aber für Zelle und Triebwerk besondere Maßnahmen. Zum Schutze der Besatzung sind entweder druckfeste x4nzüge, wie bei den englischen und italienischen Höhenrekorden oder druckfeste Kabinen mit größerer Bewegungsfreiheit, vorzusehen. Die Triebwerke werden für den Höhenflug mit einem Lader versehen, der die Ansaugluft vor Eintritt in den Motor verdichtet. Während für geringe Höhen der heute übliche mechanische Antrieb des Laders sich als brauchbar erwiesen hat, ist für die Erreichung großer Höhen die Ausnutzung des Druckgefälles der Abgase durch eine Abgasturbine notwendig, die ihrerseits den Lader antreibt.
Das Flugzeug, das seit 1934 den Weltrekord von 700 km/std hält, das italienische Seeflugzeug Macchi C 72, nutzt bereits die meisten der hier für eine Geschwindigkeitssteigerung erwähnten Möglichkeiten aus, und verwendet ferner Oberflächenkühler und gleichachsig gegenläufige Luftschrauben. Bei weiterer Annäherung an die Schallgeschwindigkeit ändern sich jedoch infolge des Einflusses der Kompressibilität die Strömungsverhältnisse grundsätzlich. Diese Erscheinungen sind aus der Ballistik bei der Feststellung des Luftwiderstandes von Geschossen bekannt. Für die Gestaltung des Flugzeuges und seiner Teile ergeben sich daher für die Steigerung der Geschwindigkeiten etwa bis zu 1000 km/std neue Gesichtspunkte, die noch der Erforschung harren.
Was gibt es sonst Neues?
F. A. I.-Sitzung Sept. 1939 in Athen.
Empire Air Day findet in England am 20. Mai statt.
3. Mailänder Salon wird vom 2. bis 17. Oktober stattfinden.
Erster Weltkongreß der Luftfahrtpresse soll im Juni in Rom abgehalten werden aus Anlaß des 20jährigen Bestehens der ältesten italienischen Luftfahrtzeitschrift „Ala d'Italia".
Polnische Flugplätze Krosno, Bydgoszcz, Mielce und Molodeczno sind geschlossen worden.
Ausland.
Engl. Passagierflugzeug „Cavalier" der Imperial Airways mußte am 21. 1., 13.20 Uhr amerik. Zeit (19.20 MEZ) 320 km von Kap May (New Jersey) entfernt auf dem Ozean niedergehen. Durch Funkspruch gab der Tankdampfer ,,Esso Baytown" bekannt, daß es ihm gelungen ist, an das Wrack heranzukommen und 6 Passagiere und 4 Mann Besatzung aus den Fluten zu bergen. Zwei weitere Passagiere und ein Mann Besatzung waren verschwunden. Wie die Geretteten aussagten, war das Flugzeug bereits 10 Min. nach der Notwasserung untergegangen. Nur durch die angelegten Rettungsgürtel gelang es ihnen, sich noch über 10 Std. in den eisigen Fluten zu halten.
Phillips and Powis neue Fabrik in Reading, am 27. 1. eröffnet, baut Miles Master, Schulflugzeug mit Rolls-Royce Kestrel mit 430 km Höchstgeschwindigkeit, im Serienbau.
British Airways bestellten bei Lockheed zwei weitere Lockheed 14 die bis März geliefert werden.
Engl. Schweröl-Diesel, Entwurf von Major Haiford und seinem Stab fertiggestellt. Mittel für die Durchführung konnten noch nicht bereitgestellt werden.
„Ensign" und „Frobisher", viermotorige engl. Langstreckenflugboote sind infolge dringender flugtechnischer Abänderungen aus dem Luftverkehr zurückgezogen. Bei dem „Ensign" muß neben der Notwendigkeit des Einbaus von stär-
keren Motoren auch die Zelle geändert werden. Bei dem „Frobisher" soll das Fahrgestell verstärkt werden. „Frobisher" machte bei ihrem Aegyptenflug in der Weihnachtswoche 352 km/h-Reise.
Schottische Flugzeug-Ausstellungen in Glasgow und Edinburgh vom 11. bis 25. Februar von modernen Bombern, verschiedenen neuen Motortypen, Zubehörteile, Einzelteile und R. A. F. Werkstatt-Unterricht für Fabrikanten und Interessenten, welche die Anfertigung von Flugzeugteilen, Motoren oder Einzelteile für Regierungslieferungen aufnehmen wollen.
Franz.-amerikan. Vorvertrag zwischen Pan American Airways und der Air-France Atiantique für /^jährige Zusammenarbeit im Nordatlantik-Flugverkehr wurde abgeschlossen. Pan American Airways darf die franz. Einrichtungen in Biscarosse und Bordeaux benutzen und umgekehrt die Air France die amerikanischen. Nach ömonatigen Erfahrungen hofft man, einen Definitivvertrag für längere Zeit abschließen zu können.
Dewoitine D. 520 Jagdflugzeug mit 910 PS Hispano Suiza, welches als schnellstes franz. Jagdflugzeug gilt, erreichte mit Doret am Steuer am 18. Januar auf einer Meßstrecke 525 km/h. Nach Dorets Angaben soll dieser Dewoitine-Typ 50 km schneller sein als die bisherigen Jagdflugzeuge. Die Angaben von Doret sind etwas sehr bescheiden. Oder sollten damit die Leistungen des Dewoitine damit geringer angegeben sein?
Geringe Unterstützung der franz. Flugzeugindustrie kennzeichnet ein Vorgang der letzten Wochen. Nach einer Mitteilung der „Vie Aerienne" vom 25. 1. wurde in Fachkreisen bekannt, daß aus den Krediten für die franz. Luftwaffe ein Betrag von 32 Millionen Franken abgespaltet werden sollte zum Ankauf eines Boeing 401 Clipper für den Atlantik-Flugverkehr in Gemeinschaft mit der Pan American Airways. Hierzu erklärt „La Vie Aerienne" wörtlich: „Sollen wir den Amerikanern ihre alten Schinken abkaufen, die nur 240 km/h erreichen und 40 Millionen Franken kosten (1 Million pro t).
„Savoia Marchetti S. 79 B" 4motoriger Bomber mit „Fiat A. 80 R. C. 41", 1000 PS, soll in 4600 m Höhe mit Vollast eine Geschwindigkeit von 410 km/h entwickeln; absolute Höhe 7100 m.
Dr.-Ing. Giuseppe Valle hat für militärische Verdienste die Medaille de l'Ordre de St. Maurice erhalten.
„Savoia Marchetti S. M. 75" (Typenbeschreibung s. „Fugsport" 1938, S. 201) flog am 9. Januar 1939 über 2000 km mit 10 000 kg Ladung einen Durchschnitt von 330,972 km/h. Der Flug stellt eine weitere Weltbestleistung der Italiener dar, und wurde der F. A. I. zur Homologation angemeldet.

Von Francos Luftwaffe. Zweimotor-Schnellbomber, letzte Vorbereitungen zu einem Vorstoß auf sowjetspanisches Gebiet. Weitbild
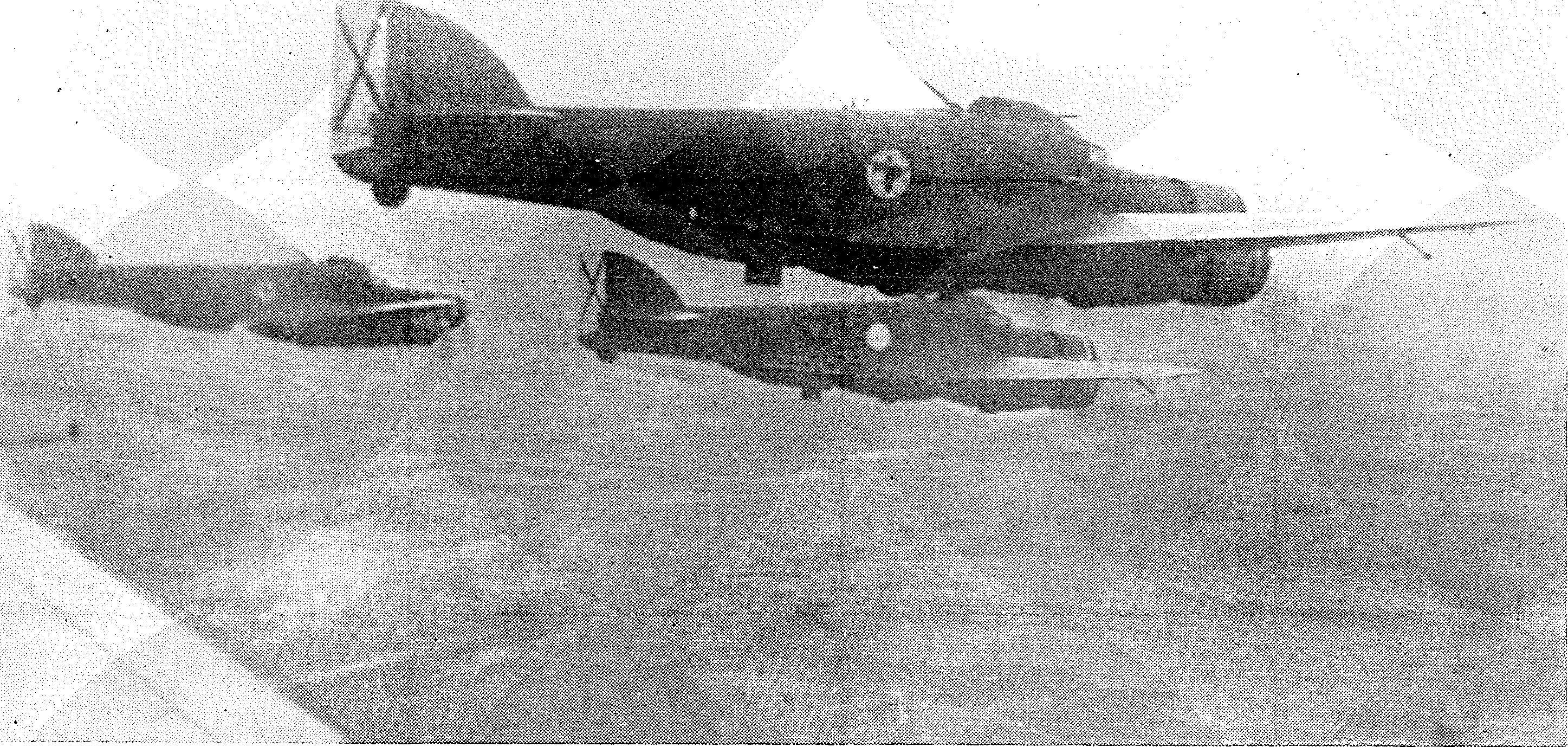
Von Francos Luftwaffe. Nationalspanische Staffel.
Weltbild
Strecke wie beim Flug des JPiaggio Pegna" (s. „Flugsport" 1939, S. 57): Santa Marinella—Neapel—Monte Corvo—Santa Marinella (500 km). Schnellste Runde 338,294 km/h; die letzten 1000 km 33,209 km/h, d.h. 11,120 km/h schneller als die ebenfalls von den Italienern gehaltene Weltbestleistung von 322,089 km/h.
Flugzeugführer Capt. Nunziante Prota und Capt. Giuseppe Bertocco; Mechaniker Maffezzoni und ein Passagier.
RWD-16, poln. Volksflugzeug, kostet 9200 Zloty (RM 4350.—), Motor 6000 Zloty extra, wird jedoch vom polnischen Luftschutzbund LOPP leihweise zur Verfügung gestellt. Flugunterricht ohne Kosten, ebenso Unterstellung der Maschine in Flugzeughallen, Betriebsstoff für 50 Flugstunden kostenlos. Den RWD-16, eine sehr schöne Kabinenmaschine, haben wir im „Flugsport" 1938, S. 500, ausführlich beschrieben.
Ungarische Luftfahrtgesellschaft Malert hat von den 5 bestellten Savoia S. 83 bereits 3 in Dienst gestellt. Die Gesellschaft verfügt außerdem über 3 Junkers Ju 52.
Sikorsky Amphibian „Baby Clipper", ein neuer Zweimotor, konstruiert von Pan American Airways für Flüge in großen Höhen auf den Amerika-Flugstrecken zwischen Seattle, Washington und Juneau, Alaska. Der neue Sikorsky unterscheidet sich von dem bekannten S 43 durch ein doppeltes Seitenleitwerk an Stelle eines einfachen. Fluggewicht 9000 kg (bei dem S 43 8850 kg). Zwei 750 PS Pratt & Whitney Wasp, Startleistung 875 PS, Hamilton-,,Hydromatic"-Verstellpropeller. Kabine und Führerraum geheizt.
USA-Gleitbombe wurde unter Patent Nr. 494 399 Mr. E. Conolly, Toronto, patentiert. Nach der bekannten Mayo Composite Konstruktion trägt, wie Aero-plane berichtet, ein Motorflugzeug ein Gleitflugzeug. In der Nähe des Zieles wird die Verbindung mit dem Gleitflugzeug gelöst. Der Segelflieger steuert das Gleitflugzeug auf das Ziel, worauf er kurz vor Erreichung des Ziels im Fallschirm abspringt.
Ital. nationaler Segelflugwettbewerb in Sezze di Littoria vom 13. bis 19. Februar 1939.
Geographische Lage der Schule: Geograph. Breite 61° 47' N., geograph. Länge 2° 13' O.
Verkehrsverbindung: Helsinki—Tampere 3 ßtd. Bahnfahrt, anschließend 89 km Autobus. Nächste Bahnstation Jämijärvi von der Schule 12,5 km entfernt. Von Tampere 67 km Luftlinie, von Helsinki 225 km Luftlinie.
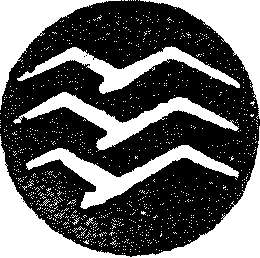
Segclflug
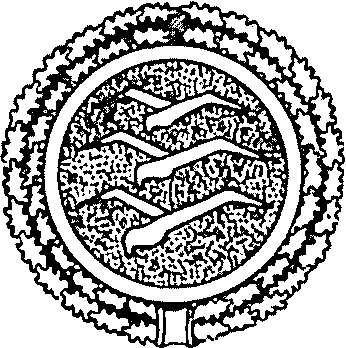
Finnische Segelfliegerschule in Jämijärvi.
A/arwegre/7
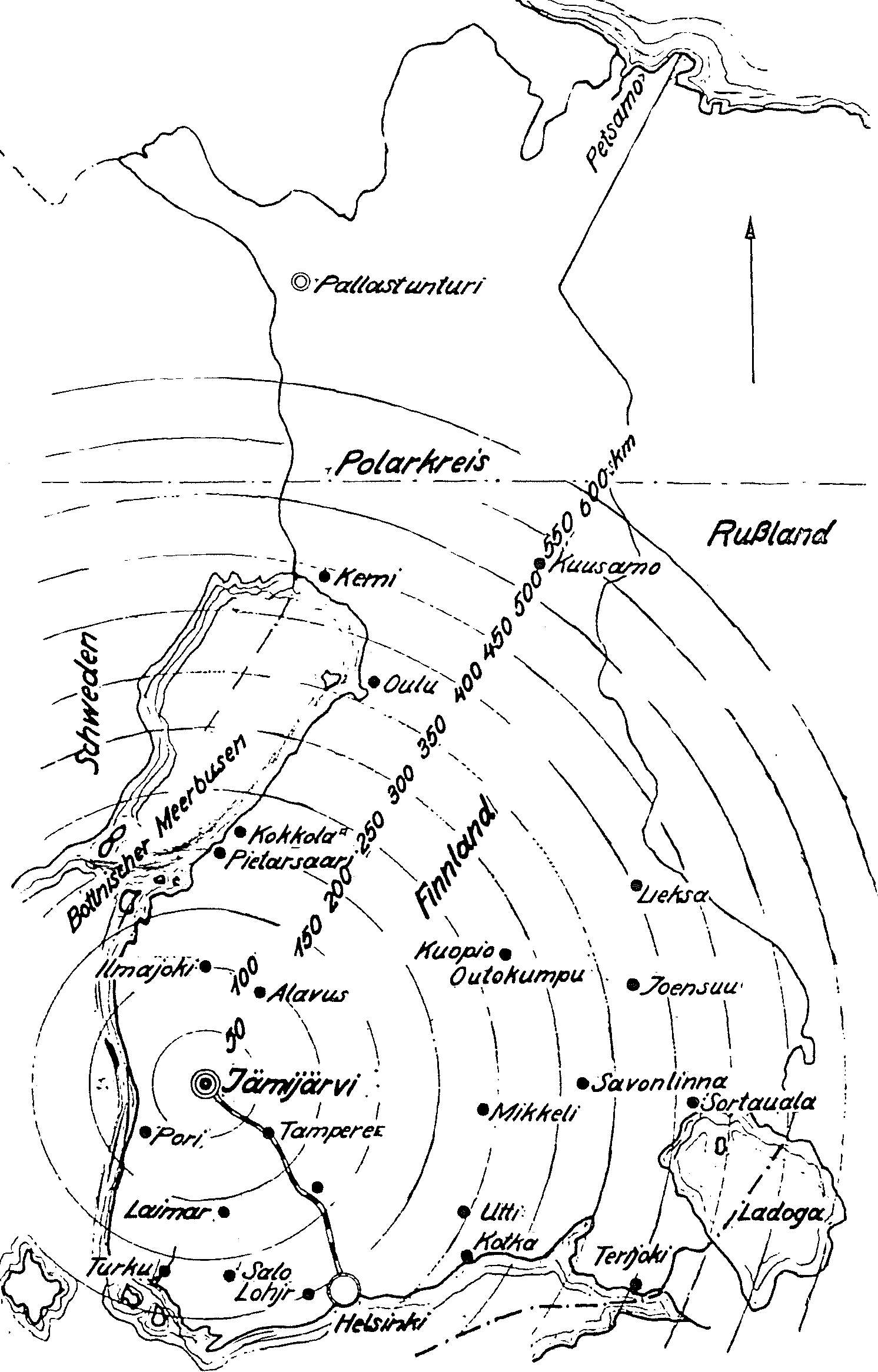
Finnisches Segelfluggelände Jämijärvi.
GSi?7Cei _Zeichnung- Flugsport
Flächeninhalt des Flugplatzes 147 ha. Von Nordost nach Südwest 219 m hohe Erhebung. Im Osten ist der Flugplatz in einer Entfernung von 2—3 km von einem Seengürtel begrenzt, im Westen von sumpfigem Waldgebiet. Bodenthermik max. 12 m/sec, an sonnigen Tagen 3—6 m/sec.
Bisher ausgeführte Flüge: 1937 31 Flüge über 1000 m Höhe, 1936 16 Flüge, größte erreichte Höhe 2800 m. Wolkenflüge bisher noch verboten.
Quartier: 150 Betten in den Schulgebäuden, Möglichkeit von Masseneinquartierung in den umliegenden Gebäuden.
Zwei Hallen für 30—35 Segelflugzeuge mit Werkstatt, 1 Halle für 3 Motorflugzeuge. Kantine mit Eiskeller. Raum für 100 Gäste. Unterbringung der Schüler (100) Wohnhaus mit großem Schlafsaal, 3 Einzelzimmer, Dampfbad usw.
Flugbenzin und gewöhnliches Benzin unterirdisch untergebracht.
In dem Zentralwerkstattgebäude befinden sich Vorratszimmer für Holz-

JNPttN
Fluggelände der Segelflugschule Jämijärvi. Unten: Modellfliegen ist auch in
Finnland sehr beliebt. Archiv Flugsport

Fluggelände der Segelflugschule Jämijärvi. Rechts unten: Toivo Nissinen, Leiter
der Schule. Archiv Flugsport
material, Metalle und Reserveteile, ein Turm zum Trocknen und Lüften der Fallschirme, meteorologisches Büro und Wohnung des Wachtmeisters.
Wasservorrat innerhalb des Schulgebietes durch Quellwasser gesichert.
Auf dem Kamm des Höhenzuges das Wohnhaus des Direktors.
Ambulanz: 3 Betten, Ambulanzauto immer bereit.
Garage für 5 Autos und Reparaturwerkstatt.
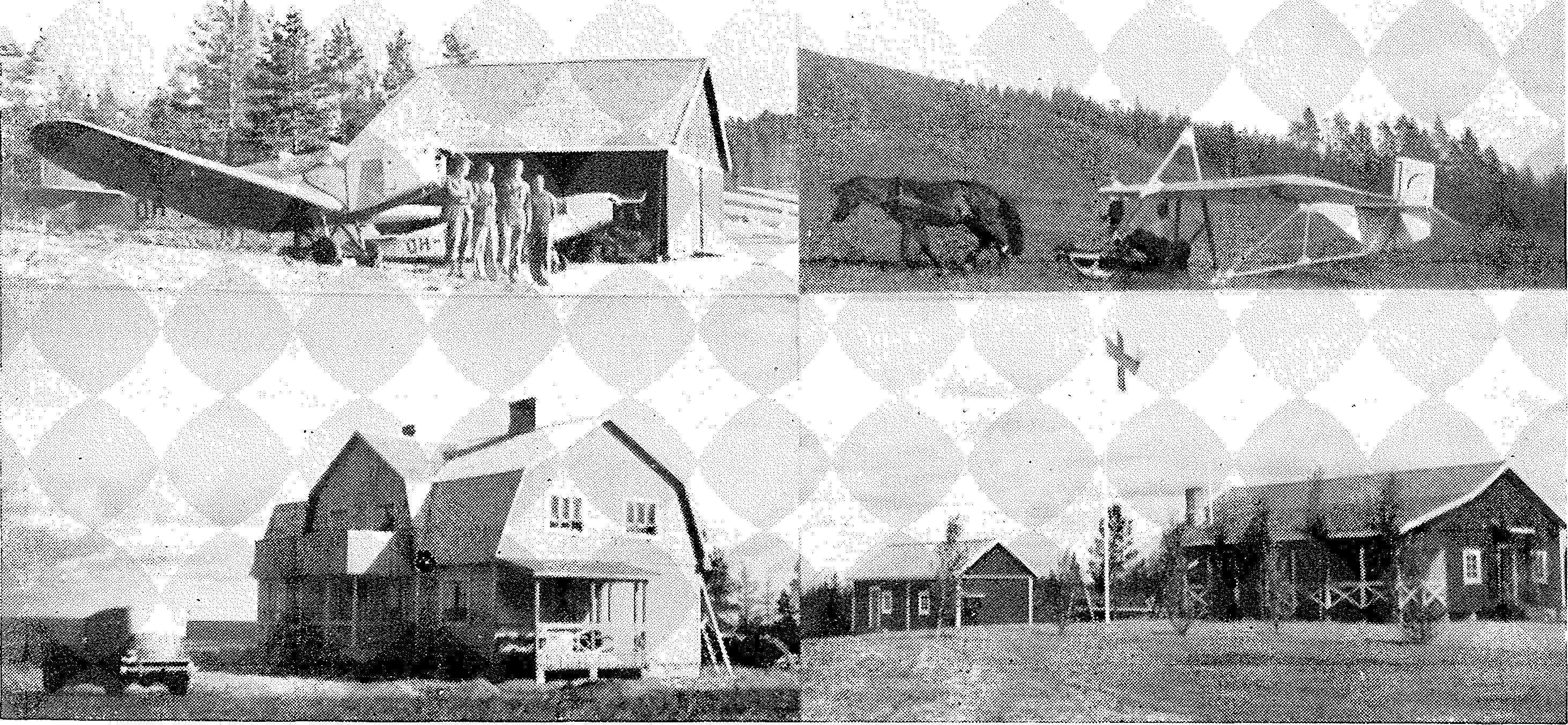
Segelflugschule Jämijärvi. Links oben: Halle für Motorflugzeuge, rechts: Hochschleppen einer Schulmaschine. Links unten: Wohnhaus der Lehrer, rechts: die „Sauma" und das Restaurant. Archiv Flugsport
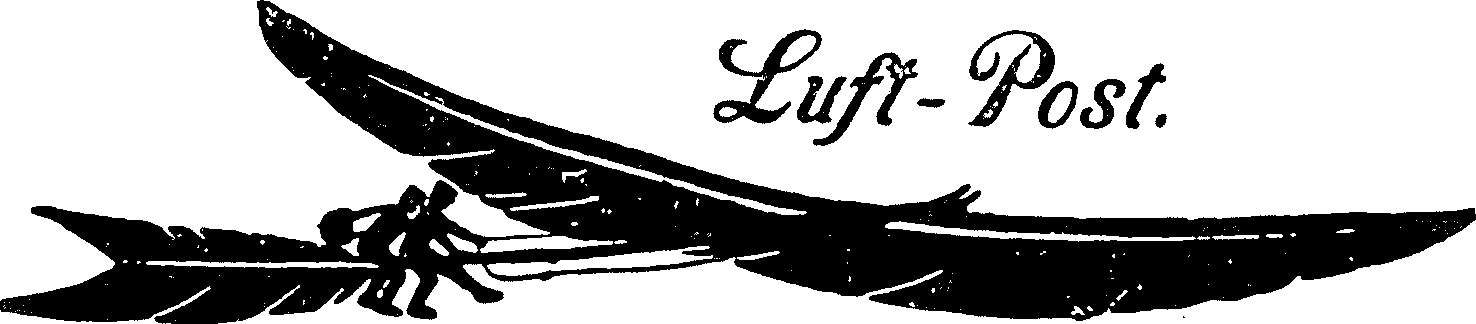
Hochschulen für Luftfahrt sind die Technischen Hochschulen in Aachen, Berlin, Braunschweig, Darmstadt, Hannover, Karlsruhe, München und Stuttgart, ferner die Universität in Göttingen.
Ingenieurschulen für Luftfahrt sind folgende: Stadt. Höhere Techn. Lehranstalt Augsburg, Ingenieurschule Bad Frankenhausen, Beuth-Schule Höh. Techn.
Lehranstalt der Reichshauptstadt Berlin, Staatl. Akademie für Technik Chemnitz, Ingenieurschule für Luftfahrt b. d. DFS. Darmstadt, Höh. Techn. Staatslehranstalten Essen, Höh. Maschinenbauschule Eßlingen, Adolf-Hitler-Polytechnikum Friedberg, Techn. Staatslehranstalten Hamburg, Höh. Techn. Lehranstalt Kiel, Staatl. Hochschule f. angewandte Technik Kothen, Technikum Konstanz, Vereinigte Techn. Staatslehranstalten Magdeburg, Ingenieurschule Mittweida, Höh. Techn. Staatslehranstalt Stettin, Ingenieurschule Weimar, Ingenieur-Akademie d. Seestadt Wismar.
Flugzeuge mit kreisrunder Fläche, amerik. Parasol, „Flugsport" 1934, S. 203. Siehe auch Farman Versuchsflugzeug mit tiefem Flügel, 1934, S. 115.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Jahrbuch 1938 der Deutschen Luitfahrtforschung. Herausgeg. unter Mitwirkung des Reichsluftfahrtministeriums und der Luftfahrtforschungsanstalten. 1252 S. mit 2204 Abb. Verlag R. Oldenbourg, München. Preis RM 50.—.
Das Werk beginnt mit der Ansprache des Präsidenten der Deutschen Akademie der Luftfahrtforschung Generalfeldmarschall Göring in der Festsitzung der Deutschen Akademie der Luftfahrtforschung am Dienstag, dem 1. März 1938, im Haus der Flieger zu Berlin und enthält die Tätigkeitsberichte der Deutschen Akademie und der Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung sowie der Ausschüsse und Fachgruppen Versuchs- und Forschungsanstalten und -Instituten, ferner Abhandlungen über I. Flugwerk (Hydrodynamik; Luftschrauben; Festigkeit und Konstruktion; Werkstoffe des Flugwerks; Meßtechnik); II. Triebwerk (Motorische Arbeitsverfahren, Höhenverhalten; Physikalische Grundlagen der motorischen Arbeitsverfahren; Bauteile; Aufladung; Kühlung; Werkstoffe; Kraft-und Schmierstoffe; Meßtechnik; Allgemeine Fragen); III. Ausrüstung (Navigation; Elektrotechnik, Funkgeräte; Luftbildwesen; Medizin; Allgemeine Fragen).
Jahrbuch 1938 der Deutschen Luftfahrtforschung, Ergänzungsband. Herausgegeben unter Mitwirkung des Reichsluftfahrtministeriums und der Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung* 414 S. mit 492 Abb. Verlag R. Oldenbourg, München. Preis RM 24.—.
Enthält die gesammelten Vorträge von der Hauptversammlung der Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung vom 12. bis 15. Oktober 1938 in Berlin: Bollenrath, Zeit- u. Dauerfestigkeit d. Werkst.; Christian, Luftgek.Reihenflugmot.; Cremona, Ber. ü. Untersuch, u. Vers. i. Schleppkanal z. Guidonia; Ellor, Aufgab, b. d. Auflad. v. Flugmot.; Esau, Physik u. Technik d. Zementierwellen; Fedden, Entw. d. Ein-Schieber-Steuerung b. Flugmot.; Ferri, Untersuch, u. Vers. i. Ueber-schallwindkanal z. Guidonia; Findeisen, Meteorol.-physik. Vorbeding, d. Vereis, i. d. Atmosph.; Fischel, Verfahr, u. Baugl. automat. Flugzeugsteuerungen; Frhr. v. Gablenz, Betriebserf. i. Luftverk. u. i. Folgerungen f. Entw. u. Forsch.; Garner, Neuere Untersuch, a. Seeflugz. i. natürl. Größe u. a. Mod.; Hahnemann, Grund-sätzl. Betracht, d. elektr. u. akust. Uebertragungsmittel f. Navig. i. d. Luftf. b. unsicht Wetter; Haus, Aerodyn. Gründl, d. selbsttät. Stabilisierungseinricht.; Heinkel, Erhöh, d. Geschw. d. Flugz. i. d. letzt. Jahren; Kaul, Statist. Erheb, ü. Betriebsbeanspruch, v. Flugzeugflüg.; Klein, Bedeut. automat. Flugzeugsteuergn, f. d. Flugzeugbau; Klumb, Ueber Entsteh, u. Abführ, elektrostat. Auf lad. a. Luft-fahrz.; Kotowski, Dimensionierung v. Empfänger-Eingangsschaltungen i. Hinbl. a. d. äuß. Störspiegel; Minelli, D. energet. Verfahr, i. d. Flugzeugstatik; Nissen, Festigkeitsfrag. b. d. Gestalt, neuzeitl. Flugz.; Perring, Neue Luftschraubenforsch, i. Großbrit. u. bes. Berücksicht. d. Startprobl.; Poincare, Mess. d. Motorleist, i. Fluge; Ragazzi, Beitr. z. Fr. d. Höhenverhalt, v. Flugmot.; Ritz, Vereisung; Sachse, Selbsttät. Regel, v. Flugmot.; Schmidt, E., D. graph. Berechn. d. Vergleichsproz. v. Verbrennungsmot. u. Berücks. d. Temperaturabh. d. spez. Wärmen; Schmidt, F. A. F., Thermodyn. u. motor. Untersuch, ü. Leistungsteig, d. Flugmotors u. ü. Verbrauchsverb. i. Fernflug; Sikorsky, Großflugboot; Sottorf, Start u. Land. i. Modellvers.; Tomlinson, Erfahr, b. Höhenfl. u. wirtsch. Betracht, hierzu; Truscott, D. vergröß. NACA-Schleppkanal u. einig, ü. s. Arbeitsweise; Wilde, Ueber neuere Arb. a. d. Geb. d. automat. Steuerung.
Vorträge über motorlosen Flug (Mitteilungsblatt Nr. 6, Juni 1938, herausgeg. vom Präs. d. Intern. Studienkomm. f. d. motorl. Flug [ISTUS], Darmstadt). 79 S. mit 135 Abb. Verlag R. Oldenbourg, München. Preis RM 6.—.
Enthält die Vorträge über den motorlosen Flug von der Istus-Tagung im Mai 1937 in Wien und Salzburg.
Untersuchungen über Grenzschichtabsaugung. Von Dr. Alfred Gerber (Mitteilungen a. d. Instit. f. Aerodynamik d. Eidg. Techn. Hochsch. Zürich, herausgeg. v. Prof. Dr. Ackeret). Verlag AG. Gebr. Leemann & Co., Zürich. Preis RM 3.50.
Verfasser hat in vorliegender Arbeit versucht, Meß- und Auswertungsmethoden anzugeben, die gestatten, zunächst Fragen der Grenzschichtabsaugung möglichst erschöpfend zu beantworten und dann verschiedene Absaugschlitze miteinander zu vergleichen. Er gibt dem Konstrukteur wertvolle Unterlagen, die als Berechnungen bei neuen Entwürfen zugrunde gelegt werden können. Die Möglichkeit, mit Hilfe der Grenzschichtabsaugung den Widerstand von Tragflügeln zu verringern, wird an Hand einer Strömungsanalogie eingehend untersucht. Es zeigt sich, daß hier eine Möglichkeit besteht, den größten Nachteil des dicken Profiles, den großen Widerstand, erheblich zu verkleinern, indem durch Versuche bewiesen wird, daß die starke Widerstandzunahme mit der Profildicke tatsächlich zum großen Teil eine Folge der gegen die Hinterkante zu stark anwachsenden Grenzschicht ist, die durch Absaugen verringert und damit der Widerstand verkleinert werden kann. Interessant sind weiter die Untersuchungen an dicken Tragflügeln mit ihren Hilfsflügeln und Klappen.
Benzinmotoren für Flugmodelle und ihr Selbstbau. Von A. Feigiebel. 143 S. mit 179 Abb. u. 7 Tafeln. Verlag C. J. E. Volckmann Nachf. E.Wette, Berlin. Preis RM 3.60.
Mit Bienenfleiß hat der Verfasser die wichtigsten Konstruktionen der Benzinmotoren für Flugmodelle zusammengetragen, in ihren Einzelheiten studiert und beschrieben. Hervorzuheben sind die sauberen Skizzen, gleichmäßige Beschriftung und übersichtliche Anordnung des Stoffes.
joly Technisches Auskunftsbuch 1939 (44. Auflage). Herausgeg. von August Joly. Joly Auskunftsbuch-Verlag, Kleinwittenberg (Elbe). Preis RM 6.50.
Mit Beginn des Januar erschien die neue Ausgabe für das Jahr 1939, die 44. Auflage, welche sonst immer Anfang Dezember erscheint. August Joly, welcher als Erbe seines Vaters die Herausgabe dieses Werkes übernommen hat und welcher das spätere Erscheinen damit entschuldigt, daß er 3 Monate zur Dienstleistung bei der Fliegertruppe einberufen war, können wir nur dazu beglückwünschen mit dem Wunsche, daß in zukünftigen Jahrgängen die Flugzeug- und -Zubehörindustrie sowie vor allen Dingen die Leichtmetalle (Elektronmetall u. a.) mit ihren verschiedenen Nebenindustrien noch eingehender berücksichtigt werden.
Die deutsche Luftgeltung von Oberreg.-Rat Dr. Heinz Orlovius. (Schriften der Hochschule für Politik, herausgeg. von Paul Meier-Benneckenstein. II. Der organisatorische Aufbau des Dritten Reiches, Heft 26.) Junker & Dünnhaupt Verlag Berlin. Preis RM —.80.
Auf 35 Seiten ist hier alles Wissenswerte von der Jahreswende 1932/33 an zusammengefaßt: Gliederung des Reichsluftfahrtministeriums und der Luftwaffe, Aufbau und Aufgaben der Luftwaffe, Höchstleistungen der Luftfahrtindustrie, der deutsche Flugsport und Luftverkehr.
Funker
z. Zt. Zivil-Bordfunker (Milit.-Bordfunkerprüfung), langjähr. Erfahrung in Erledigung von kaufmännischen und Behörden-Schriftwechsel, sucht nichtflieg. Arbeitsgebiet!. Flugbetrieb od. ähnl. Angeb. unter 4011 an den Verlag des „Flugsport"
Flugzeugführer
Land und See
CII, Blindflug, KU sucht Stellung in der Industrie. Ängeb. u. 4010 a. d. Exped. d. „Flugsport".
Wir suchen zu baldigem Eintritt einen
PATENT-INGENIEUR
(möglichst Dipl.-Ingenieur)
zur Bearbeitung von Patentanmeldungen, Ausführung von Nachforschungen und anderen Arbeiten auf dem Gebiet des Patentwesens, möglichst mit engl. u. franz. Sprachkenntniss. Kennwort „Patent11.
Ausführliche Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnisabschriften, Angabe der Gehaltsansprüche und des frühesten Eintrittstermins erbitten wir an die Personal-Abteilung der
DORNIER-WERKE G.M.B.H.
Friedrichshafen a. B.
Heft 4/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag- „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro Vi Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: J43S4 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit ,,Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet.
Nr. 4 15. Februar XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 1. März 1939
Atlantik-Plugverkehr.
Die Verhandlungen zwischen Imperial Airways und Pan American Airways haben noch immer nicht zu einer Inbetriebnahme des Ozeanluftverkehrs geführt. Bekanntlich beabsichtigen die Amerikaner, dieses Jahr die Neufundland-Irland-Route zu benutzen. Der Imperial Airways wurde nur die Erlaubnis bis Montreal zu fliegen erteilt mit der ausdrücklichen Einschränkung, daß New York nicht angeflogen werden dürfe.
Die Azoren-Linie kann erst von der Pan American Airways beflogen werden, wenn die Boeing 314 eingesetzt wird, welche im Ohne-Haltflug die Strecke bewältigen kann. Es bleibt für die Imperial Airways nur die Neufundland-Route übrig, dies aber auch erst Ende Mai, wenn Neufundlands Häfen eisfrei sind. Für die Route England— Montreal werden die Short-Flugboote „Cabot, Connemara, Caribou und Clyde" eingesetzt. Die Post muß dann von Montreal auf anderem Weg nach New York gebracht werden.
Zur Zeit bemüht man sich in England, aus dem vorhandenen Langstrecken-Personal geeignete Besatzungen für den Atlantikflugverkehr herauszuziehen. Bei den Flügen nach Indien mit den großen Flugbooten, wie „Canopus", sind verschiedene Besatzungen recht gut geschult worden, so daß für die kommenden Atlantikflüge keine Schwierigkeiten hinsichtlich der Besatzung zu überwinden sind. Die Hauptaufgabe ist jetzt Bereitstellung des allen Anforderungen gewachsenen Flugmaterials.
Internationale Veranstaltungen 1939.
5. 3. —12. 3. Raduno Sahariano, Tripolis.
14. 5. — 20. 5. I S T U S - Sitzung und Segelflugwettbewerb Warschau und Kattowitz (Polen).
20. 5. Empire Air Day, England.
Mai Weltkongreß der Luftfahrtpresse, Rom.
8. 7. — 23. 7. Internat. Aero-Salon, Brüssel.
16. 7. — 23. 7. Raduno del Littorio, Rimini.
29. 7. — 30. 7. Internat. Luftrennen NS.-Fliegerkorps, Frankfurt a. M.
September F.A.I.-Sitzung, Athen.
1.10. Coupe Deutsch de la Meurthe, Etampes.
2. 10. — 17.10. 3. Mailänder Salon.
Diese Nummer enthält Patent-Sammlung Nr. 2, Band VIII, Din-Samtnlung Nr. 4.
Engl* Segelflugzeug „Gull II".
Slingsby Sailplanes, Kirby-moorside, Yorks,hat ein zweisitziges Segelflugzeug, Sitze nebeneinander, im Bau, welches bis April fertig werden soll. Flügel dreiteilig, Teilstelle an der Querruderwurzel im Knick des Flügels. Flügelprofil NACA 4418 im Flügelmittelstück einschließlich Ansatzstück, geht dann nach außen in das Profil R. A. F. 34 über.
Querruder sehr lang vom Flügelknick bis zu den Flügelspitzen.
Die folgenden Typen im Serienbau sollen mit Sturzflugbremsklappen ausgerüstet werden.
Rumpf Verkleidung, von der Rumpfnase bis zum Flügelholm reichend, ergibt bequemen Ausstieg. Höhenleitwerk ziemlich hochgelegt.
Hinter der Kufe ein Laufrad mit Bremsen.
Spannweite 18,3 in, Länge 7,7m, Leergewicht errechnet240kg, Fluggewicht 415 kg.
Flächenbelastung 18 kg/m2.
Franz. Elytroplane Rouge.
Im letzten Pariser Salon zeigte Rouge auf einem Stand unter der Qalerie Ausführungsformen seiner zuletzt entwickelten Typen mit vorn über der Haupttragfläche liegendem Höhen-Franz. Elytroplane Rouge. Links Typ Decroix, rechts Typ Boufort.
Zeichn. Flugsport
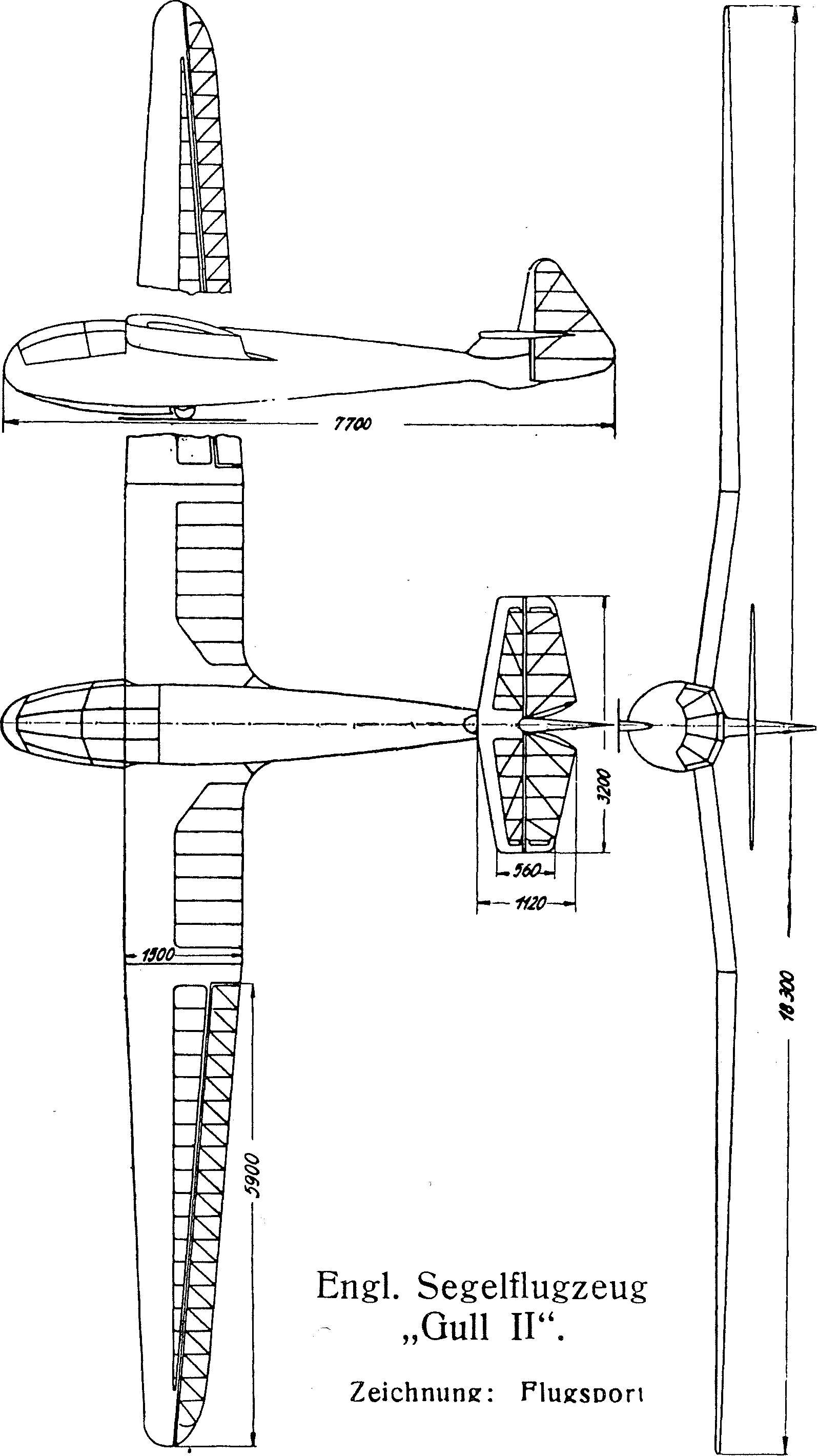
leitwerk. Durch Vorführung von Modellen im Fluge auf seinem Stand suchte er die Aufmerksamkeit der Besucher auf seine Sache zu lenken. Der größte Teil der Interessenten waren Laien, die sich über die außerordentlich stabile Flugart freuten. Die meisten Besucher gingen jedoch lächelnd vorüber.
M. de Rouge hat zwei Elytroplane von 9 m2 Tragfläche gebaut. Ein Typ „Decroix" mit 35-PS-Mengin-Motor und einen Typ „Boufort" mit 38-PS-Polymecanique-Motor.
Während Rouge bei den früheren Versuchstypen im Jahr 1936 Höhen- und Seitenleitwerksflosse hochgelegt hatte, ist bei den neuen, oben angeführten Typen nur das Höhenleitwerk ca. 2 m über dem Flügel angeordnet.
Beide Maschinen besitzen druckpunktfeste Profile. Gute Sicht finden Führer.
Typ „Decroix" Schulterdecker-Bauart. Flügel abgestrebt. Höhenleitwerk weit nach vorn gestaffelt. Propellerachse weit unter dem Flügel. Fahrgestell große Spurweite. Spannweite 7 m. Leergewicht 270 kg.
Typ „Boufort" Schulterdecker, Flügel freitragend mit Endscheiben. Höhenleitwerk vor der Vorderkante des Flügels. Schraubenachse durch den Flügel gehend. Fahrwerk schmale Spurweite. Spannweite 6,60 m. Leergewicht 250 kg.
Si 202 „Hummel".
Noch in letzter Zeit während des Pariser Salons wurde von Fachleuten in Zeitschriften die Ueberlegenheit der sogenannten ausländischen Volksflugzeuge in allen Tonarten gerühmt. Die deutschen Ingenieure haben es nicht nötig, sich an ausländische Vorbilder zu halten, um so mehr, da der Leichtflugzeugbau gerade durch die Segelflugentwicklung in Deutschland seinen Anfang genommen hat. Es sei nur an den viel verschrieenen Leichtflugzeugwettbewerb 1924 in der Rhön erinnert.
Unsere Flugzeugindustrie, welche zur Zeit nicht über Beschäf-tigunglosigkeit klagen kann, hat trotzdem nebenbei noch Zeit gefunden, sich mit dieser Frage zu beschäftigen.
Am 31. 1. 1939 erreichte Flugkapitän Ziese auf Flugzeug Si 202 „Hummel", Konstrukteur Fecher der Siebel-Flugzeugwerke, Halle, mit 2-l-Zündapp-Motor-50-PS mit Fluggast 5982 m Höhe, womit der von der Tschechoslowakei gehaltene Rekord von 4872 m überboten wurde. Am 3.2.1939 erreichte Ziese 7043 m einsitzig und überbot den tschechoslowakischen Rekord von 5851 m.
Das Baumuster Si 202 ,JHummel" haben wir bereits im „Flugsport" 1938, S. 272 beschrieben. Durch den Einbau des 50-PS-2-l-Zündapp-Rei-henmotors an Stelle eines Sternmotors hat die Rumpfnase eine gefällige schlanke Form erhalten. Dieses einfache Maschinchen erfüllt alle Ansprüche, die man an ein Flugzeug dieser Größenordnungen für
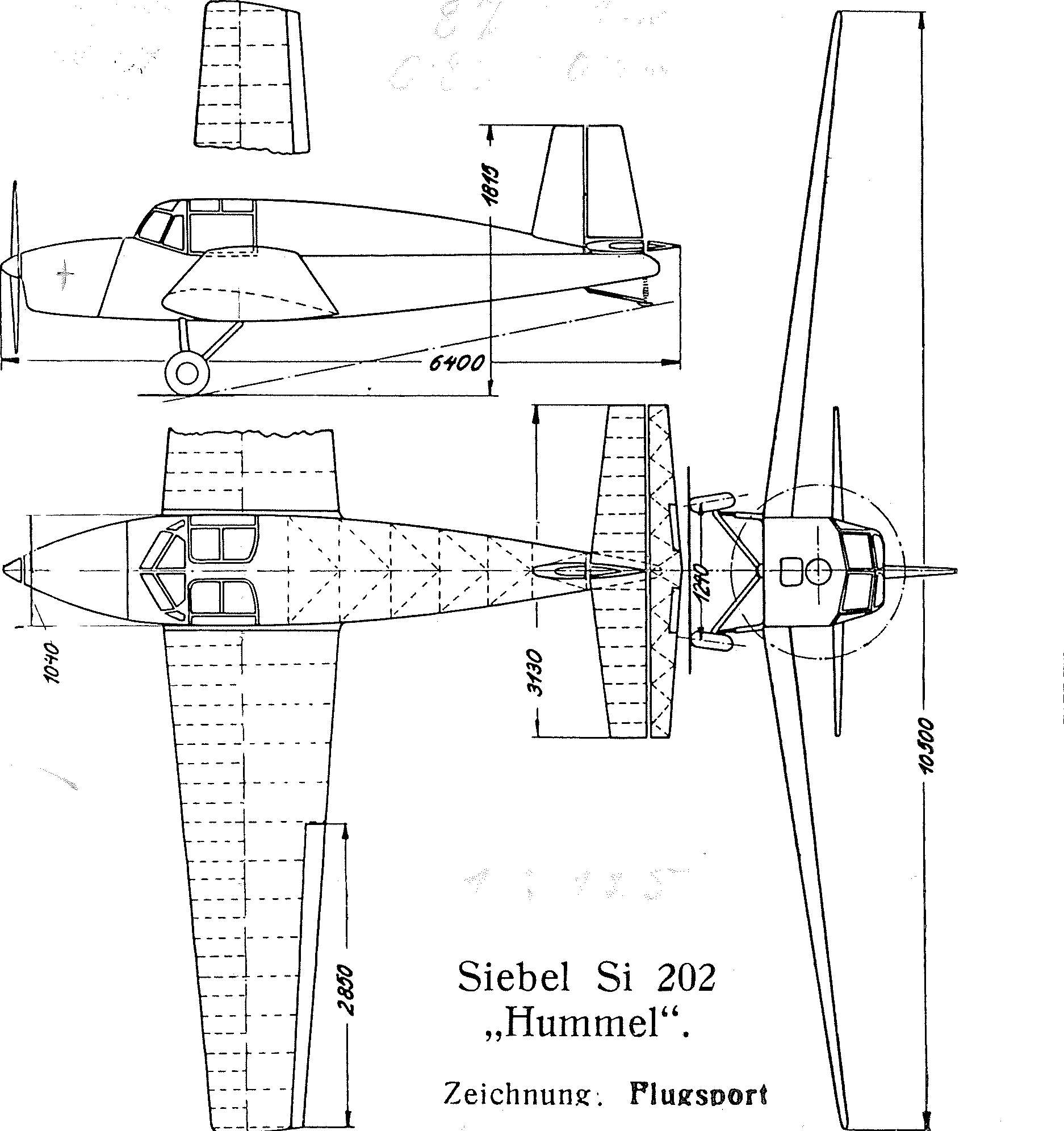
Si 202 „Hummer', Längsschnitt, a) Betriebsstoffbehälter, b) Schmierstoffbehälter, c) Qepräckraum, d) Seile zum Höhenruder, e) Seile zum Seitenruder. Zeichnung: Flugsport
Anfangsschulung auf Motorflugzeugen sowie für den Uebungs-, Reise-und Sportflug stellen darf.
Der einholmige Flügel in Holzbauweise besitzt eine größte Flügeltiefe von 1700 mm.
Doppelsteuerung (vgl. den nebenstehenden Längsschnitt). Einfache und robuste Ausführung. Zweite Steuerung leicht ein- und ausbaubar. Seitensteuer mit parallel geführten Pedalen. Bremstätigkeit für linkes und rechtes Rad. Ein zentraler Knüppel mit zwei Handgriffen ermöglicht einfaches Ein- und Aussteigen und bequemes Sitzen. Trimmung durch Handhebel an Kabinendecke.
Kraftstoffbehälter hinter dem brandsicheren Rumpfspant aufgehängt. Oelb ehält er mit Rücksicht auf einfache Pflege der Maschine im Motorraum untergebracht.
Ausrüstung: Höhenmesser, Fahrtmesser, Kompaß, Uhr, Drehzähler, Brennstoffuhr, Oeldruckmesser, Zündschalter in leicht zugänglicher Weise im Gerätebrett angeordnet. Ablegetaschen für Karten,
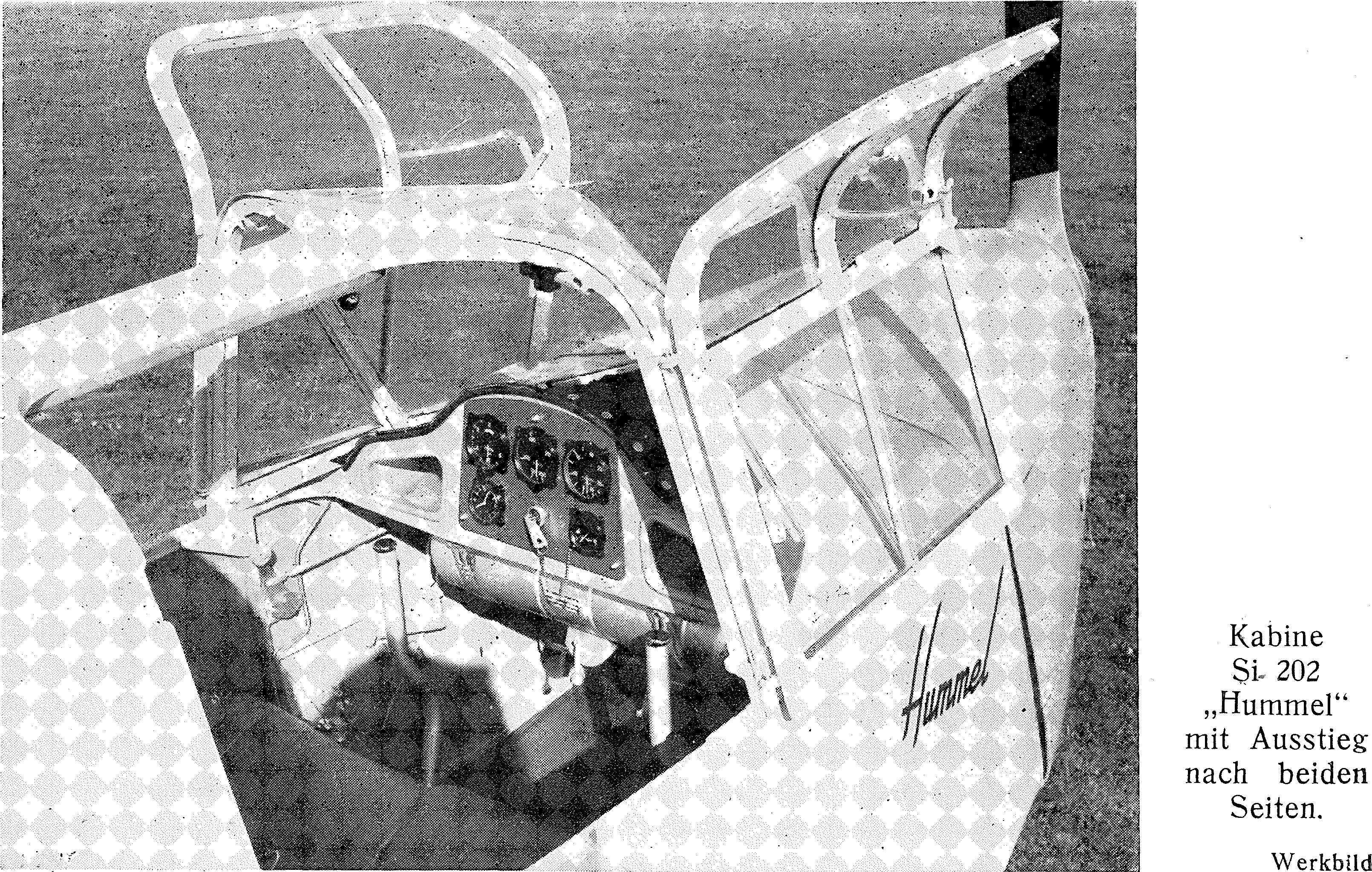
Kabinen-Doppelsitzer Si 202 „Hummel". Werkbild
Handschuhe u. dgl. im Gerätebreit, Feuerlöscher, Sanitätspack, Sitzkissen, Werkzeug usw.
Spannweite 10,5 m, Länge 6,4 m, Höhe 1,85 m, mittlere Flügeltiefe 1,4 m, Tragflächeninhalt 14 m2, Flächeninhalt Höhenleitwerk 2,25 m2, Seitenleitwerk 0,9 m2, Querruder 2X0,48 m2, Tragflächenbelastung 38,6 kg/m2, Leistungsbelastung 10,8 kg/PS.
Rüstgewicht 310 kg, Zuladung 230 kg, Fluggewicht 540 kg.
Höchstgeschw. 160 km/h, Reise 140 km/h, Lande 70 km/h, Kraftstoffverbrauch 9,5 1/100 km, Flugweite (45 1 Vorrat) 470 km, Steigzeit auf 1000 m 8,5 Min., Dienstgipfelhöhe 3300 m, absolute Gipfelhöhe 4300 m.
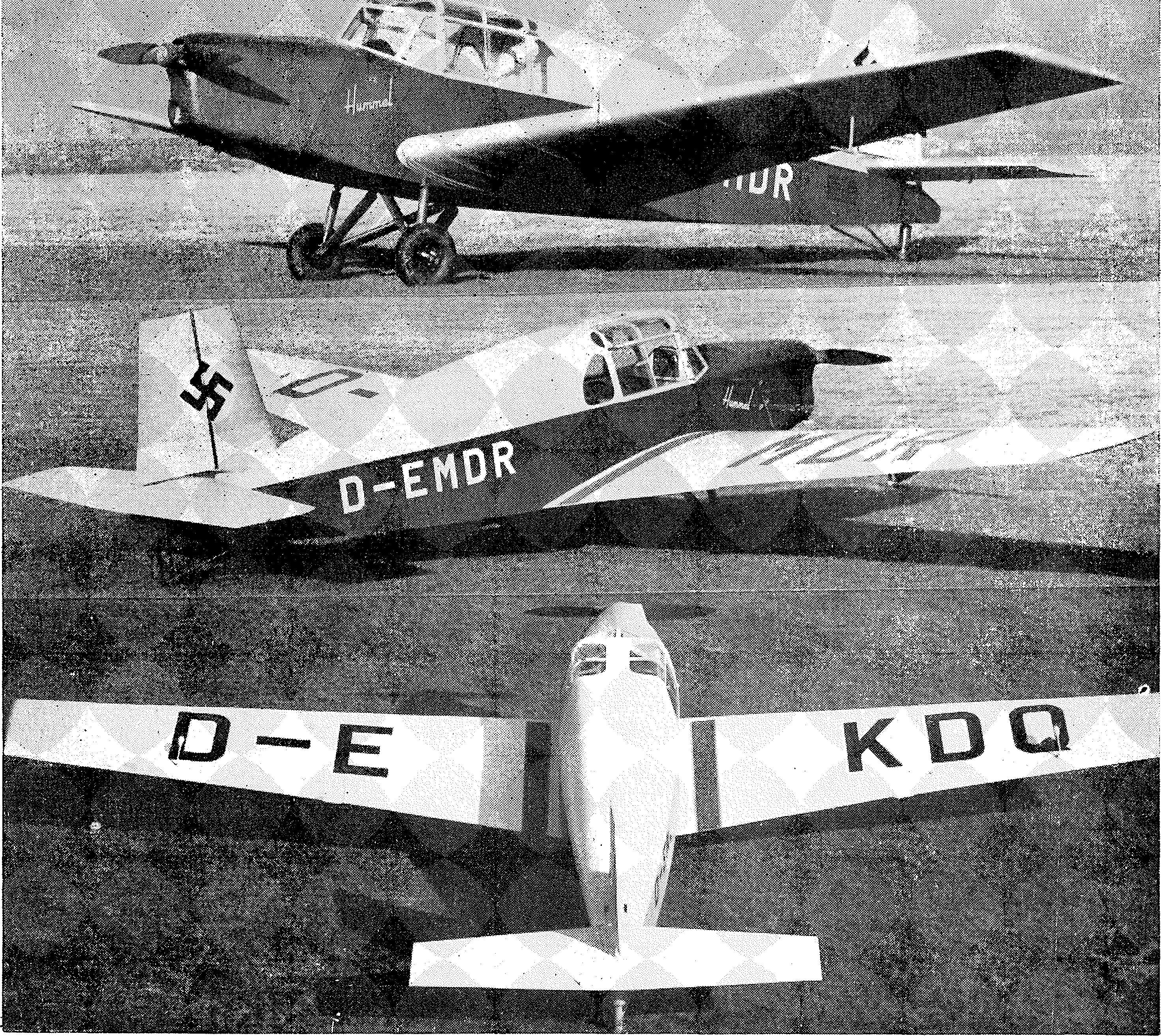
Siebel Si 202 „Hummel". Werkbilder
Reiseflugzeug „S.A.I.2S".
Den freitragenden Tiefdecker haben wir anläßlich des Mailänder Salons 1937 auf S. 586 bereits beschrieben. Inzwischen sind weitere Daten veröffentlicht worden. Interessant ist der Ueb ergang vom
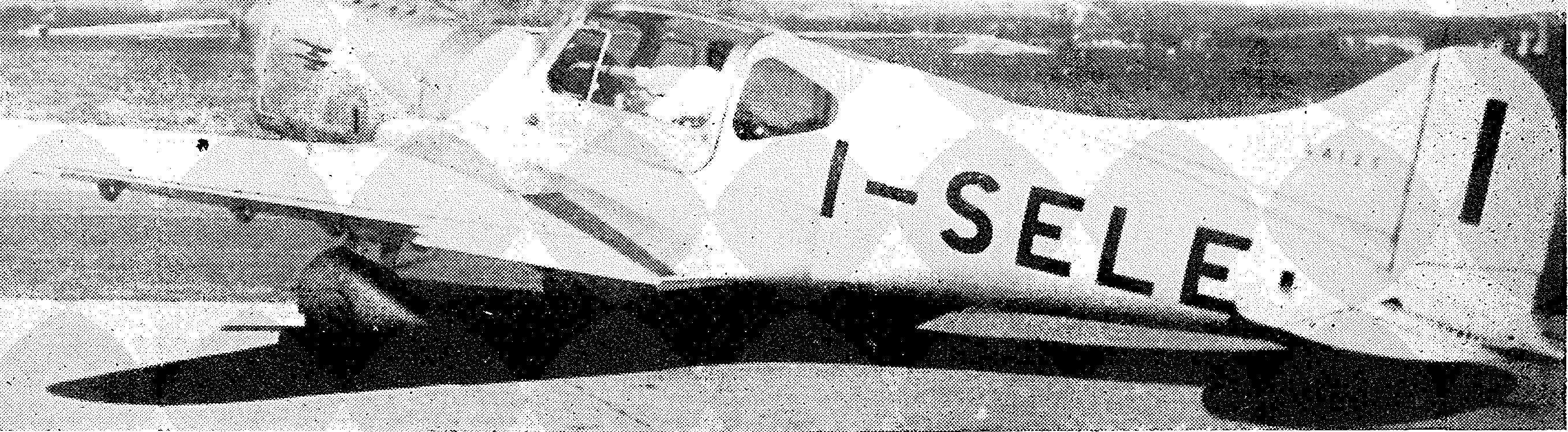
Ital. Reiseflugzeug S. A. I. 2 S. Werkbild
Rumpf zum Höhenleitwerk. Höhenflosse im Fluge verstellbar. Als Uebertragungsorgane nur Stoßstangen.
Spannweite 10,64 m, Länge 7,5 m, Höhe 2,8 m, Flügelfläche 18 m2; Leergew. 890 kg, Nutzlast 530 kg, Fluggew. 1420 kg.
Höchstgeschw. am Boden 250 km/h, Landegeschw. 85 km/h, Reise-geschw. (70%-Leistung) 215 km/h. Gipfelhöhe 6000 m. Starten 150 m, Landen 200 m; Steigzeit auf 1000 m mit 300 kg Nutzlast 3 min 22 sec, auf 3000 m mit 300 kg Nutzlast 13 min 48 sec, auf 5000 m mit 300 kg Nutzlast 36 min 21 sec.
Clark F-46 Reiseflugzeug.
Es ist bekannt, daß das Verhalten eines Flugzeuges im Langsamflug durch Schlitzflügel an den Flügelenden wesentlich verbessert werden kann. Durch die „Slots" wird der Anstellwinkel des Maximalauftriebs am Außenflügel um 10—15° erhöht und hiermit die Rolldämpfung und Querruderwirkung im Langsamflug verbessert. Um ein Abkippen zu verhindern, sind im allgemeinen Slots von 40% Halb-spannweitenlänge erforderlich. Würde man diese starr am Flügel anbringen, so wird der Schnellflugwiderstand des Flugzeuges stark heraufgesetzt. Andererseits hängen die Abkippeigenschaften eines Flugzeuges stark von Querruderwirkung und Flügelform ab. Bei Trapezflügeln verhalten sich Ausführungen mit gerader Vorderkante harmloser als solche mit gerader Hinterkante. Schließlich haben zum Beispiel Schlitzquerruder mit Differential im Sackflug bessere Wirkung als solche ohne Schlitz mit linearem Antrieb. Man kann also annehmen, daß ein Flugzeug mit an und für sich harmlosen Abkippeigenschaften schon mit Hilfe eines relativ kleinen Slots narrensicher wird.
Oben: Clark Spaltklappe. Mitte und unten: Bekannte Verbesserung der Strömung bei ausgeschlagenem Querruder und hohem Anstellwinkel durch den Slot.
Zeichnung: Flugsport
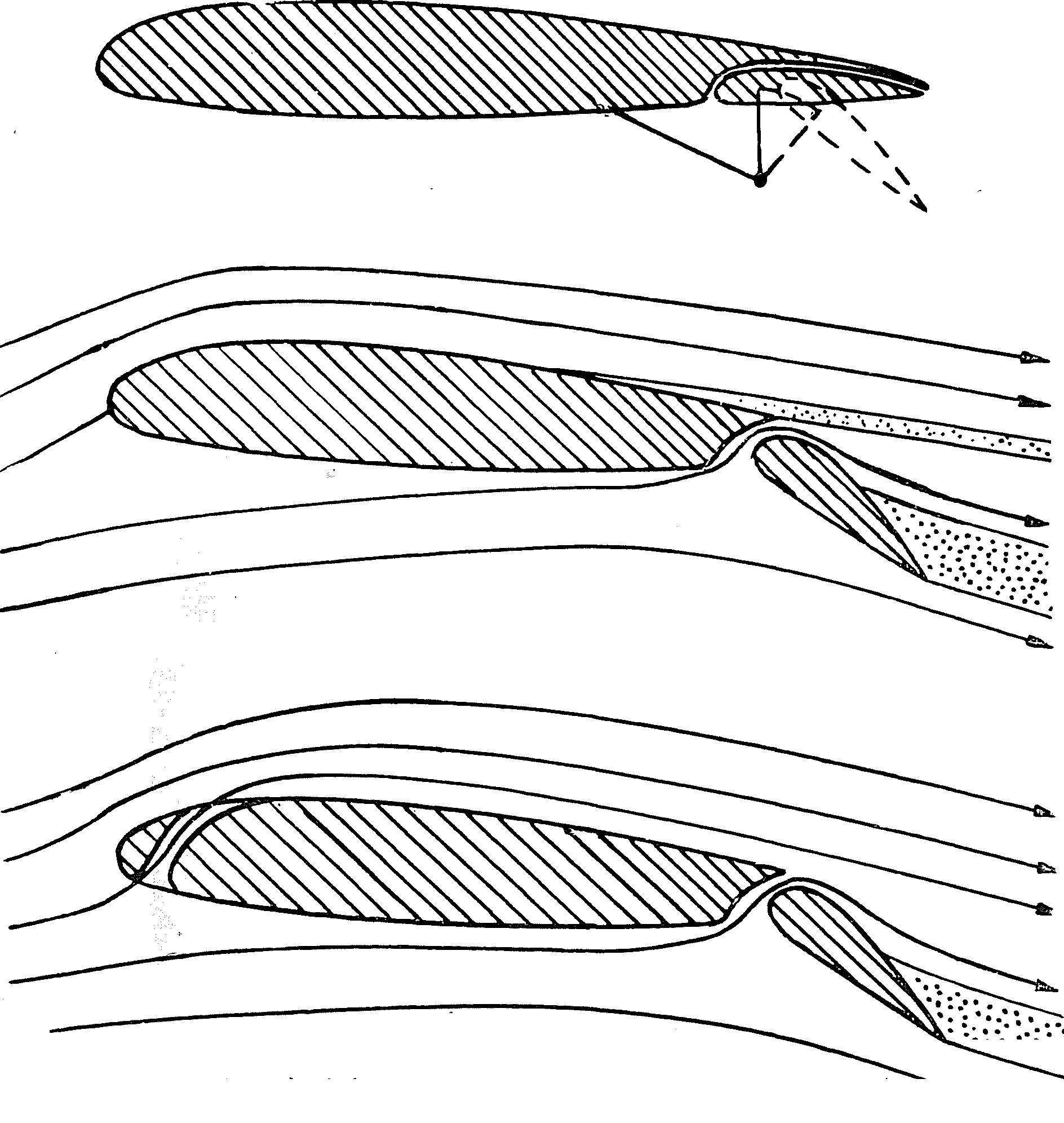
USA Clark F - 46 Reiseflugzeug.
Ein modernes Beispiel hierfür ist das fünfsitzige Reiseflugzeug Clark F-46. Tragwerk: Tiefdecker, Unterelliptischer Trapezflügel (Zuspitzung 1 : 3), Profile NACA 23-Serie, Schlitzquerruder mit Differentialantrieb (Anschläge 32° nach oben, 14° nach unten), Schlitz-Spreizklappe von 22%-Tiefe. An den Flügelenden ein fest eingebauter Slot von nur 22% der Halbspannweitenlänge. Triebwerk: 400 PS Ranger 12 Zylinder-V-Reihenmotor. luftgekühlt mit Versteilschraube. Rumpf: Aus Kunststoff gepreßte Schale mit schmalen Versteifungsschotten. Leitwerk: Seitenleitwerk vor dem Höhenruder, beide Ruder aerodynamisch ausgeglichen.
Die wie ein Fowlerflügel nach unten herausklappbare Spreizklappe ist ebenfalls aerodynamisch ausgeglichen, so daß sie ohne hydraulischen Antrieb von Hand ausgefahren werden kann. Zusammen mit den kleinen eingebauten Slots soll diese Landeklappe im Fluge ein Camax von über 2 ergeben haben. Die Rolldämpfung dieses Schlitzflügels soll trotz der Zuspitzung auch im Sackflug sehr gut sein und die gute Wirkung der Differentialquerruder bleibt auch noch bei Anstellwinkeln erhalten, die bis zu 10° über dem Camax des Innenflügels liegen. Der Widerstandszuwachs durch die eingebauten Slots beträgt nur 2%; d. h. die Maximalgeschwindigkeit sinkt um etwa 1%. Ein geringes Opfer im Verhältnis zu dem Gewinn an Flugsicherheit.
Interessant ist, daß der Konstrukteur zugunsten einer ; guten Zusammenfügung von j Rumpf und Flügel und be- l" quemer Einstiegverhältnisse p den Flügel zu relativ „hoch" angesetzt hat, obwohl hier- . durch ein wesentlich höheres j Fahrwerk in Kauf genommen p -werden muß.
USA Clark F-46 Reiseflugzeug.
Werkbild
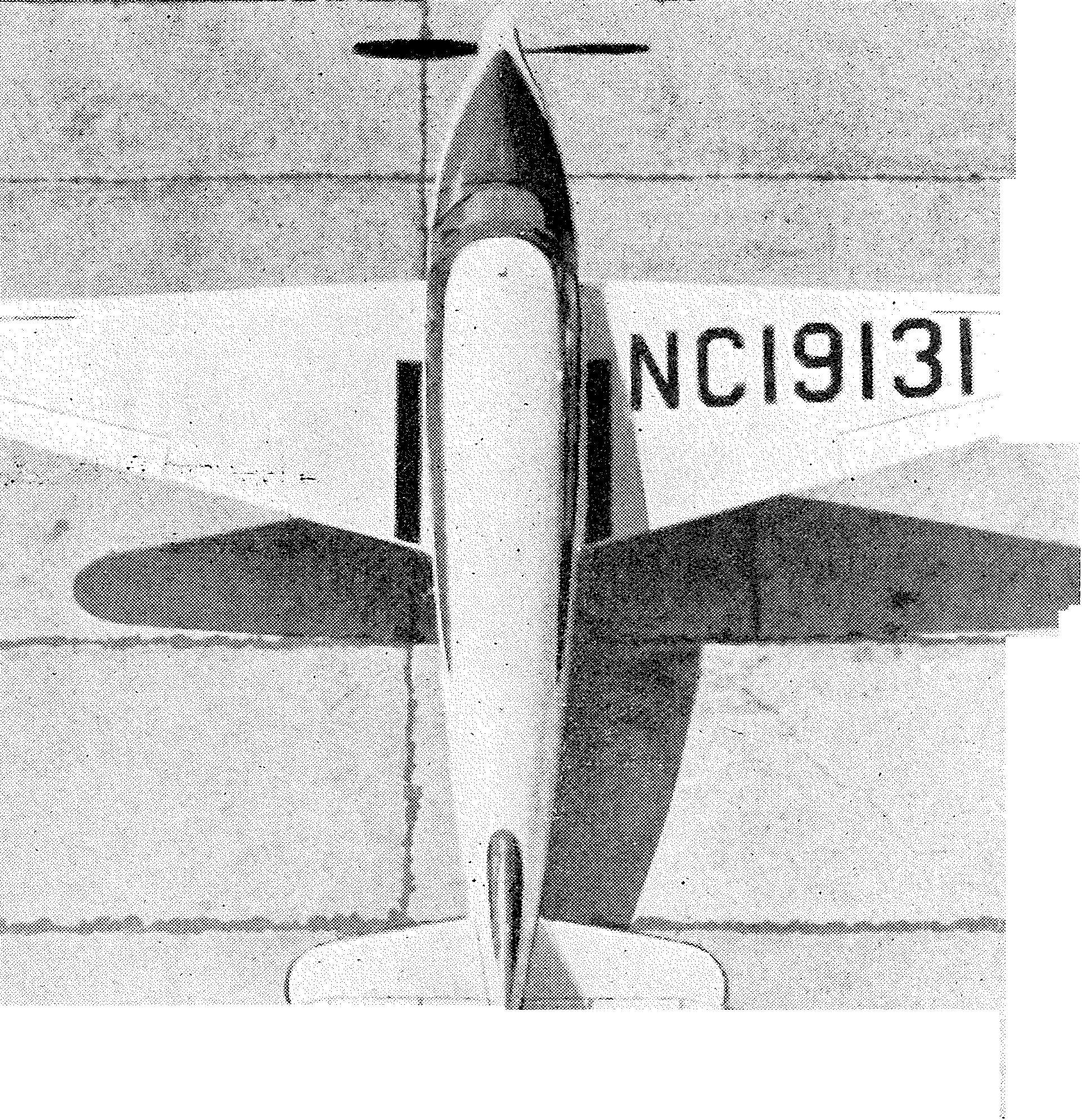
USA.-Spartan 7 W Executive.
Der fünfsitzige, freitragende Kabinentiefdecker in Ganzmetallbauweise der Spartan Aircraft Co. Tulsa, Oklahama USA, ist in den letzten Jahren ohne Veränderung weitergebaut worden. 1936 veröffentlichten wir die Beschreibung, Ausführung mit Jacobs- und mit Wasp-Junior-Motor. Heute scheint die Maschine nur noch mit Wasp Junior geliefert zu werden.
Der Flügel besteht, wie nebenstehende Abb. erkennen läßt, aus zwei oberen und einem unteren Stahlrohrholm, die im Dreiecksverband durch Stahlrohre versteift sind. In dem mit dem Rumpf fest verbundenen Mittelstück ist die Blechbeplankung aufgeschraubt und in den Ansatzstücken aufgenietet. Die Flügelhaut wird durch I- und U-Profile verstärkt. Drei Landeklappen, eine unter der Mitte des Rumpfes, und daran anschließend zu beiden Seiten Landeklappen bis zu den Querrudern reichend, welche einzeln oder zusammen durch Vakuum betätigt werden können.
Querruder Duralumin, Betätigung durch Stoß- und Zugstangen. Leitwerksflächen und Ruder aus Duralumin, vergleiche die nebenstehenden Abbildungen.
Rumpf kräfteübertragende Teile Stahlrohrgerüst. Aeußere Form-
USA Spartan 7 W Executive. Flügelbauweise.
Werkbild
Unten: Rumpf-Längsschnitt
Spartan 7W Executive, a Hamilton - Propeller, gleichbleibender Drehzahl; b Pratt & Whitney Motor, Wsp JR. SB.; c Oelkühler; d Oeltank; e Reservekraftstoffbehälter; f Höhenflosse-Kontrolle; g Drossel; h Klappen-Einstellung; i Kraft-stoffhahn; j Handfeuerlöscher; k Hebel zur Sitzverstellung; 1 Handpumpenhebel; m Kabinenentlüftung; n Radio, Kompaß; o Gepäckraum; p Unterdruckkessel - Klappen - Betätigung; q Druckfeuerlöscher; r Steuerungsschieber für die Bremse; s Belüftungsregulierung; t Kraftstoffpumpe (Hand); u Hauptkraftstofftank; v Zusatzkraftstofftank; w Sender und Empfänger; x Rumpf-Landekl.-Va-X kuum-Zyl.; y Flügel-Landekl.-Vakuum-Zji.; z Batterie.
Zeichnung;: Flugsport
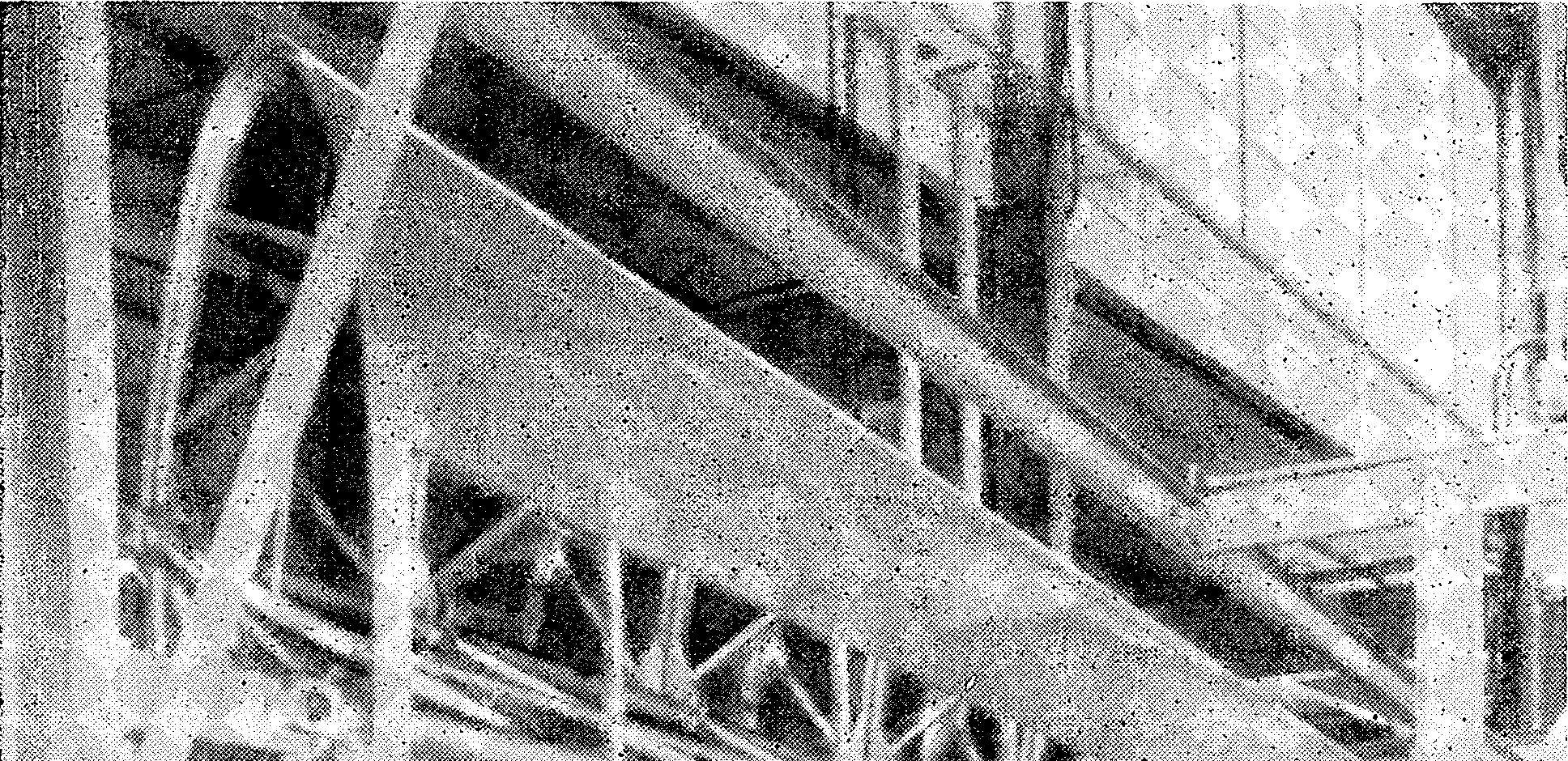
11
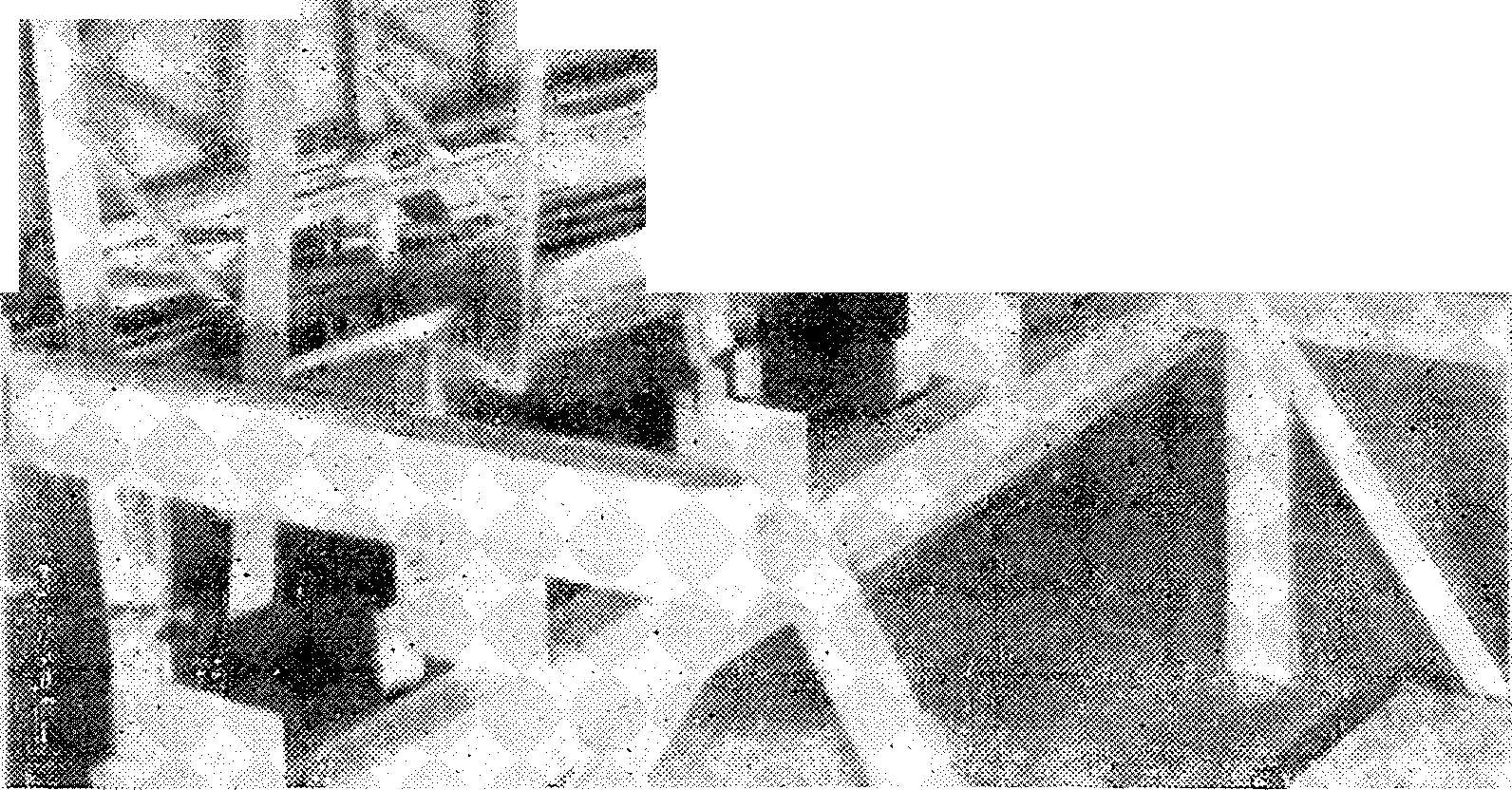
USA Spartan 7 W Executive.
Werkbild
gebung durch Profilringe und Profillängsversteifungen. Haut aufgenietet. Fahrwerkräder verschwinden beim Hochziehen im Flügelstummel in der Nase vor dem Holm. Betätigung durch Eclipse Elektromotor, gespeist durch 12-Volt-Batterie. Fahrwerkskontrolle auf dem Schaltbrett: bei roten Lampen Fahrwerk oben, bei grünen Lampen Fahrwerk ausgefahren.
Spannweite 11,89 m, Länge 8,18 m, Höhe 2,44 m, Fläche 23,23 m2. Flügelschnitt an der Wurzel NACA. 2418, an der Flügelspitze NACA. 2406, Fahrwerk-Spurweite 3,14 m. Flächenbelastung 85,93 kg/m2. Leistungsbelastung 4,91 kg/PS. Motor Pratt & Whitney Wasp Junior 400 PS. Leergewicht 1355 kg, Fluggewicht 1996 kg Max. Betriebsstoff
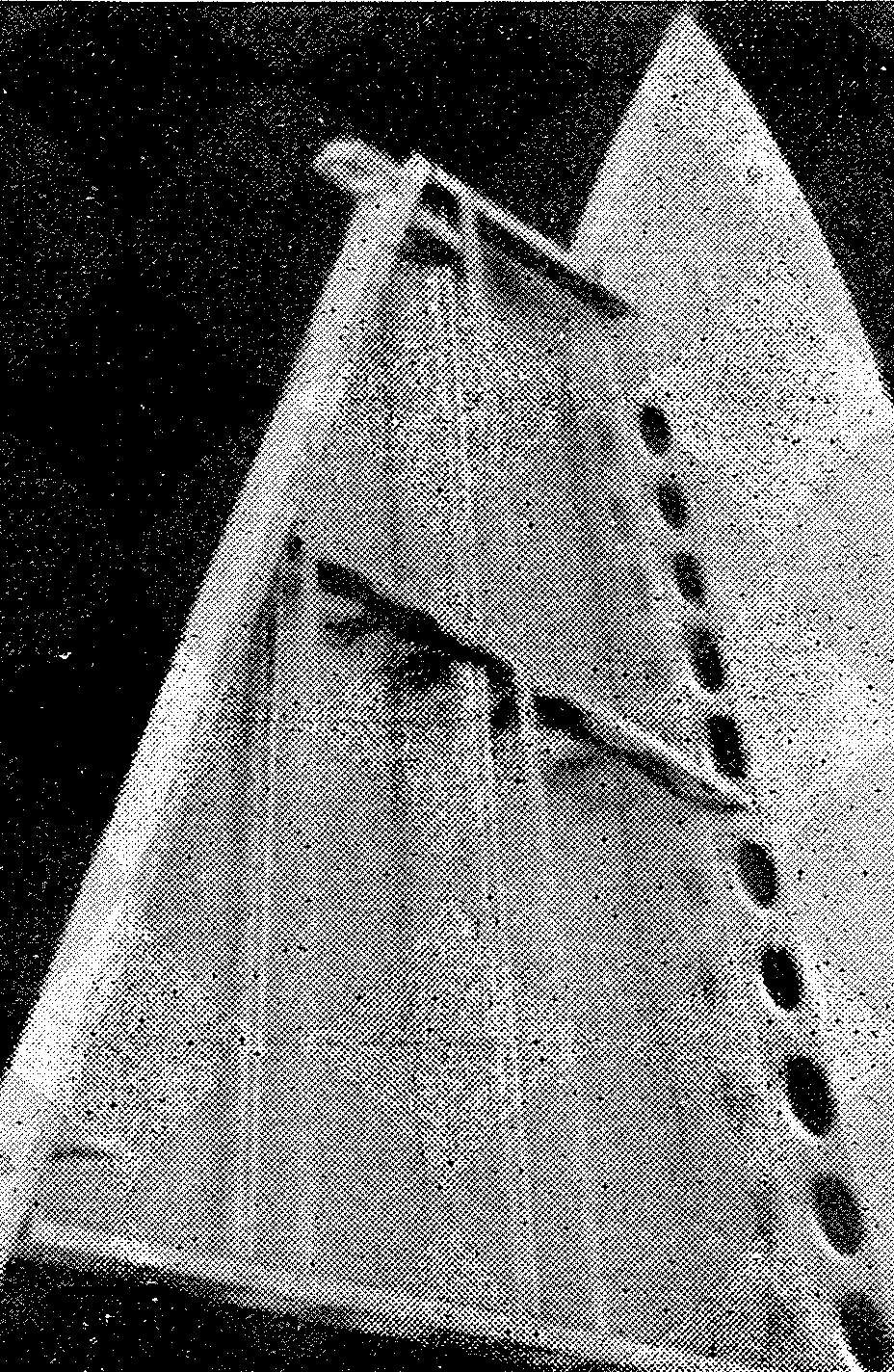
USA Spartan 7W Executive. Oben links: Seitenleitwerk; rechts: Seitenruder;
unten: Höhenleitwerk. Werkbild
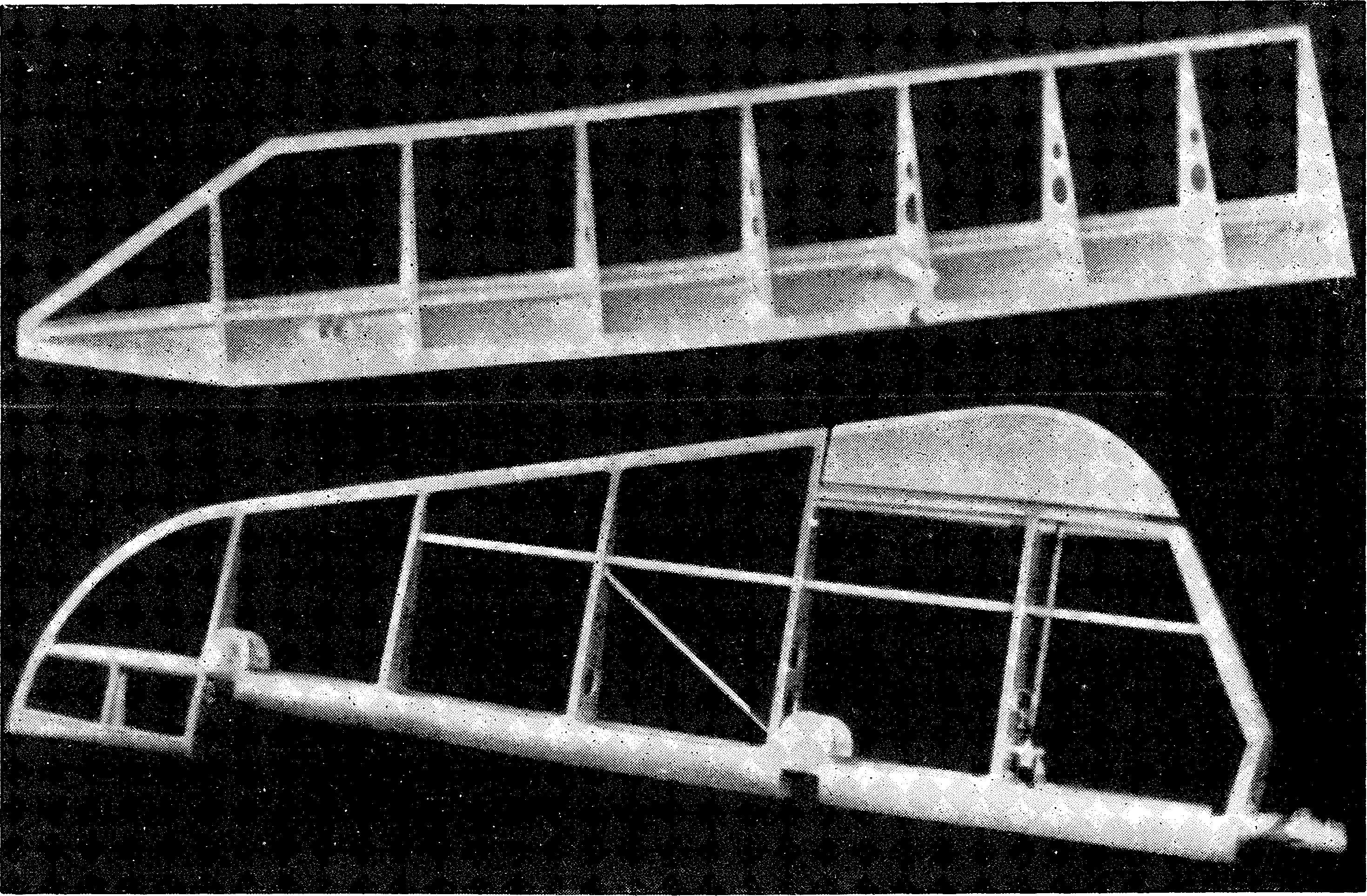
USA Spartan 7 W Executive. Oben: Querruder; unten: Höhenruder. Werkbild
432,9 1. Höchstgeschwindigkeit 341 km/h, Landegeschwindigkeit 104,6 km/h. Reisegeschwindigkeit mit 75% Motorleistung 321,8 km/h, mit 65% Motorleistung 305,7 km/h. Reichweite mit 75% Motorleistung 1448 km, Gipfelhöhe 7315 m.
Fairey-Verkehrsflugzeug F. C-1.
Die Fairey Company, welche sich bisher nur mit der Konstruktion und dem Bau von Maschinen für die englische Luftwaffe beschäftigte, hat seit 3 Jahren im Stillen Versuche für die Konstruktion von Verkehrsflugzeugen mit verringerten Start- und Landegeschwindigkeiten durchgeführt. Während man, sich bisher mit Lande- und Spreizklappen begnügte, geht die Entwicklungsrichtung von Fairey dahin, durch Vergrößerung der Tragfläche, Ausklappen von Flächen, das Ziel zu erreichen. Die Mittel für die Versuche sind vom Air Ministry bereitgestellt. Die British Airways hat bereits eine Serie der Maschinen bestellt.
Die erste Versuchsmaschine unter der Bezeichnung F. C.-l ist im Bau. Die Hilfsflügel, welche an der Hinterseite der Haupttragfläche liegen, werden während des Reisefluges eingezogen.
Im ausgefahrenen Zustand der Zusatzflügel, beim Langsamflug, bildet das Tragwerk einen Doppeldecker, einen großen Oberflügel und einen kleineren Unterflügel in Tandemform gestaffelt. Durch Entfaltung der Zusatzflügel verringert sich die Flügelbelastung von 156 kg/m2 auf 122 kg/m2. Bei der Landung werden dann die Zusatzflächen noch weiter herausgezogen, so daß sie als Landeklappe wirken. Durch diese Anordnung ist es möglich, die Landegeschwindigkeit noch um weitere 16 km herunterzudrücken, als wie mit gewöhnlichen Landeklappen.
Durch diese Anordnung ist es möglich, das erforderliche Tragflächenareal 30% geringer zu gestalten, als bei Verwendung von normalen Landeklappen.
Für den Betrieb sind vorgesehen vier Taurus 1050 PS luftgekühlte Schiebermotoren mit Konstant-Speed-Verstellschrauben. Bei 50% Motorleistung beträgt die Reichweite des F. C.-l 2700 km bis 2800 km bei 2050 kg Nutzlast bzw. 4250 kg Nutzlast. Reise-
Geschwindigkeit 350 km/h. Bei 80% Motorleistung Reise-Geschwindigkeit 400 km/h und bei max. Motorleistung 430 km/h. Fluggewicht 18 700 kg.
Der Kabinenraum ist als Ueberdruckkabine ausgebildet, in der der Druck in allen Höhen konstant gehalten wird.
Besatzung: zwei Flugzeugführer, ein Funker, Motorenwart, Koch und Stewards.
Dreirad-Fahrwerk hochziehbar, auch das Bugrad.
Boulton Paul-Defiant-Zweisitzer-Jagdflugzeug.
Der von Boulton Paul in dem Werk Wolverhampton in Serien gebaute Jagdzweisitzer besitzt als Neuerung einen durch Motorkraft angetriebenen Drehturm für schwere Bewaffnung.
Aufgabe bei der Konstruktion war, ein Flugzeug für die Abwehr von Angriffsgeschwadern zu schaffen.
Bauweise: Ganzmetall. Flügel und Rumpfbedeckung Duralumin mit Kräfte übertragend. Guter Formgebung. Drehturm hinter dem Führeraufbau gestattet Feuerwirkung schräg nach vorn.
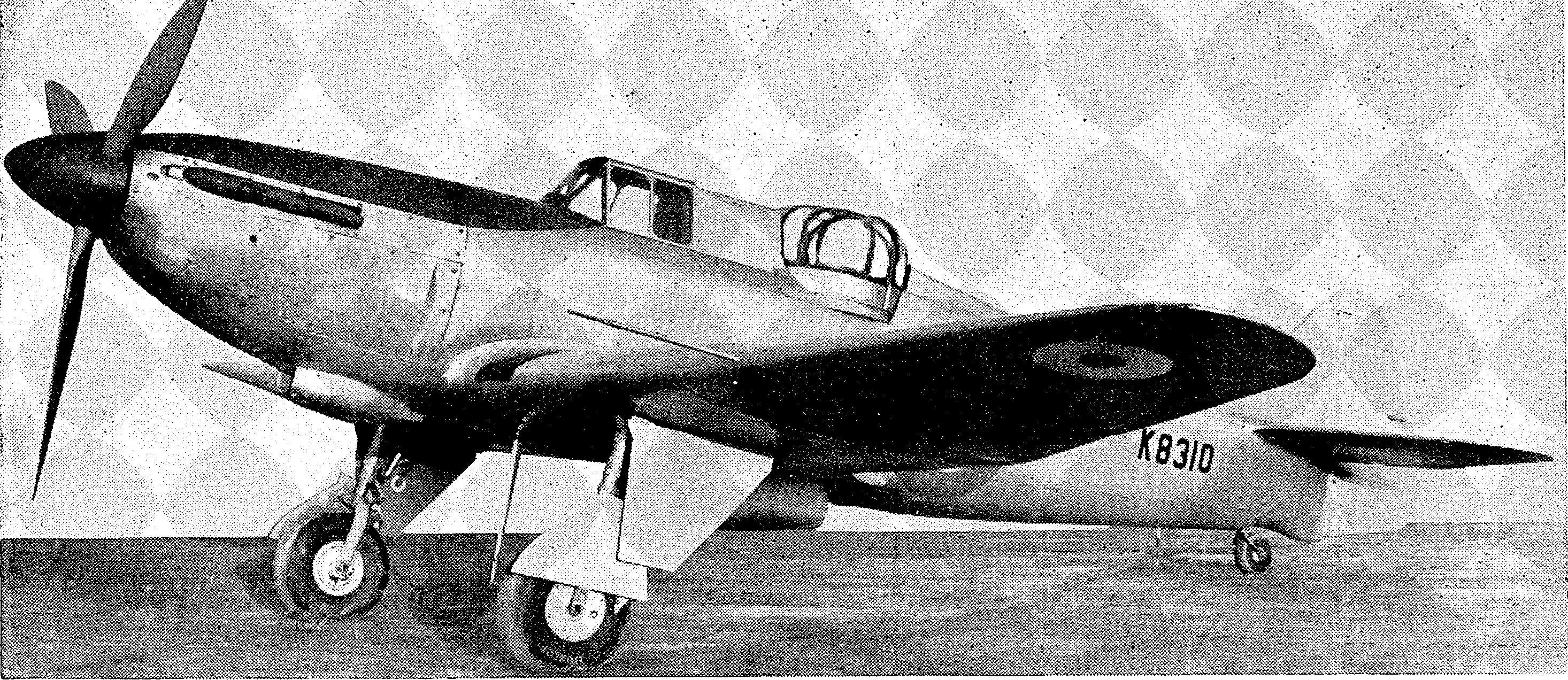
Boulton Paul „Defiant" Zweisitzer-Jagdflugzeug. Werkbild
Motor Rolls-Royce Merlin flüssig gekühlter 12-Zylinder-Motor mit Dreiblatt-De-Havilland-Verstellschraube. Spreizlandeklappen.
Fahrwerk hochziehbar nach der Innenseite des Mittelstücks. Dieser Typ ist' der schnellste, der in dieser Klasse entwickelt wurde. Leistungen sind noch nicht bekanntgegeben.

Bloch 151 Jagdeinsitzer.
Werkbild
Heizluftstrahltriebwerke,
(Fortsetzung und Schluß von S. 75, Nr. 3, 1939.)
Den am Schlüsse des vorigen Aufsatzes (S. 75, vorletzter Abs.) angedeuteten Strahltriebwerken, die zugleich mit der heute im Vordergrunde des Interesses stehenden Grenzschichtabsaugung verbunden sind, schließt sich die in Deutschland unter Nr. 626 326 (angem. 4.6. 34) patentierte Erfindung von N. W. Akimoff an. Sie stellt zugleich eine weitere Entwicklung der von Melot, Kort u. a. gebrachten Strahlantrieben dar; in den aus der Brennkammer tretenden Strahl wird zusätzliche Luft über ringförmige Tragflügelprofile mit außenliegender Sehne angesaugt (vgl. z. B. die Abb. 18—24 auf S. 33—35 in Heft 2). Auch Akimoff verringert den Luftwiderstand der Strahltriebkörper dadurch (vgl. Abb. 54), daß er der Brennkammer 3 und der Kanalwandung eine einheitliche Stromlinienform gibt; außerdem aber verlegt er die ringförmige, annähernd rechtwinklig zur Körperachse beginnende Eintrittsöffnung 4 des Saugkanals an eine Stelle nächst und hinter dem Hauptspant, nämlich dorthin, wo sonst die Ablösung der vorbeistreichenden Luft erfolgen würde, was bei Ueberschall-Fluggeschwindigkeiten besondere Vorteile gegenüber spitzwinkligem Lufteintritt hat. Wie aus Abb, 54 erkennbar ist, wird durch den bei 4 beginnenden Kanal ein Tragprofilring 5 gebildet, dessen konvexe Innenseite über die Ventilöffnungen 1 und 2 von Brennkammer strahlen beaufschlagt wird, die hier trotz der angesaugten Luft eine schnellere Strömung erzeugen, als sie die Außenluft an der ebenen oder konkaven Profilwand hat. Infolge der Zirkulationsströmimg um den Profilring treten Querkräfte 6 auf, deren radiale Komponenten 9 sich gegenseitig aufheben, während die axialen (8) sich zu einer Vortriebskraft summieren, die zu der an der Mündung entstehenden Rückstoßkraft hinzutritt. Werden die Ventile 1, 2 usw. teilweise geschlossen, so entstehen Steuerwirkungen. Die Patentschrift enthält mehrere Ausführungsbeispiele, siehe Patentsammlung VI des „Flugsport", S. 79/80.
Ein ähnliches, jedoch weniger überzeugendes Heizluftstrahltriebwerk hatte zuvor H. Coanda am 23. 11. 32 in Frankreich angemeldet und unter Nr. 762 688 patentiert erhalten; vgl. auch Oesterreich 150 009 und England 431646. Auch hier wird — wie aus Abb. 55 ersichtlich — ein mit Luft untermischter Brenngasstrahl — c sind die Brenner und e Luftzulässe — über Tragflügel oder tragflügelprofilierte Ringe g geleitet, um die hier entstehenden Querkräfte („Auftriebe") sich mit ihren axialen Komponenten summieren und zusätzlich Rückstoß leisten zu lassen. Der Körper o kann ein Rumpf oder ein'Tragflügel sein.
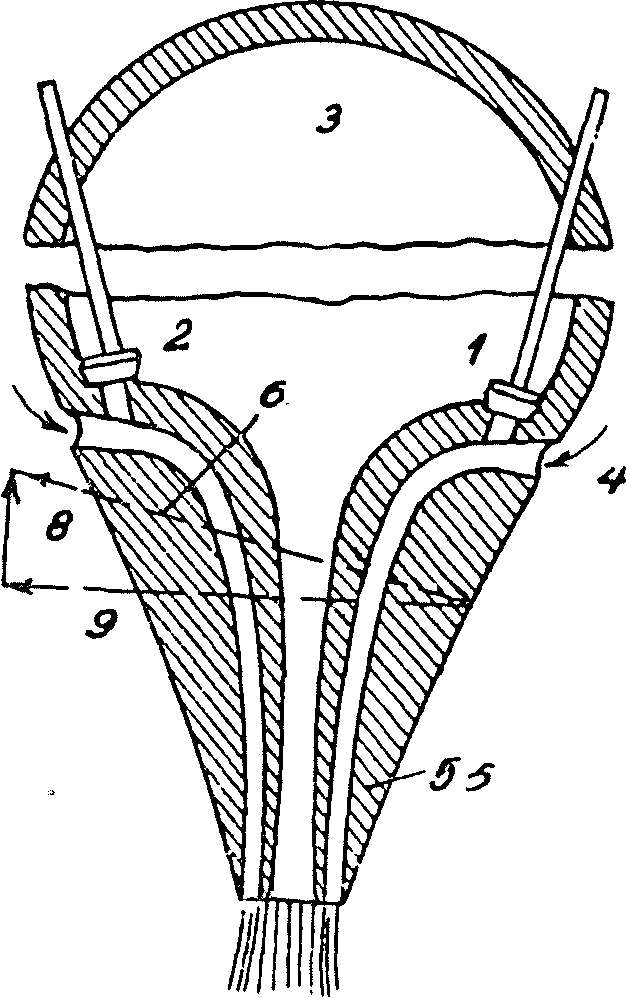
Abb. 54. N. W. Akimoff 1934: Zusätzliche Luft über Tragflügelprofile; Grenzschichtabsaugung.
Abb. 55 (rechts). H. Coanda 1922: Rückstoß und Flügelvortrieb.
6
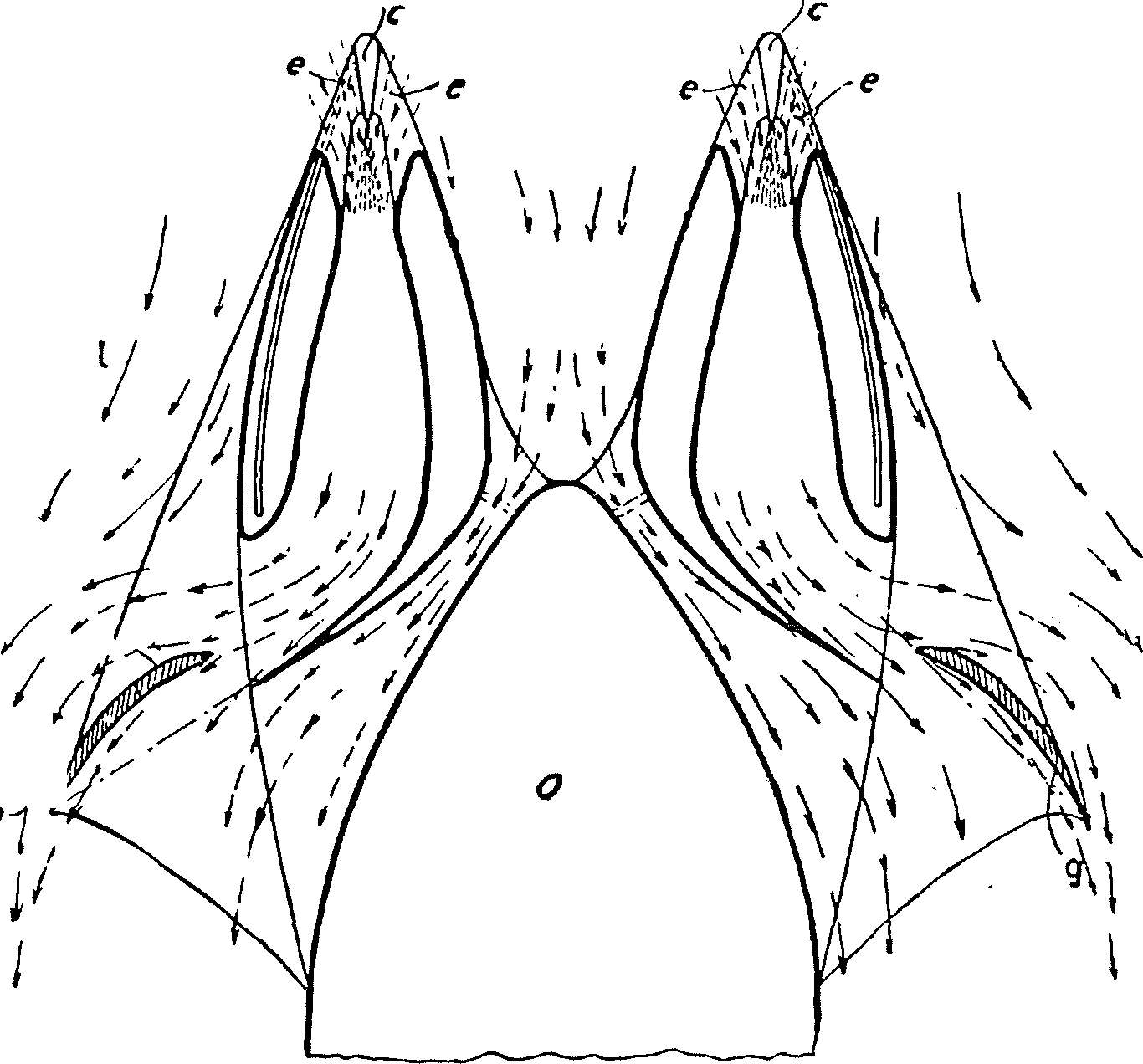
Das Strahltriebwerk, das sich G. Caproni in Frankreich mit dem am 30. 1. 34 angemeldeten Patent 767 816 schützen ließ, läßt die Auspuffgase des Luftschraubentriebwerks (Motor oder Gasturbine) zum Vortriebe beitragen. Die Motorgase treten bei der einen Ausführungsform (Abb. 56) am Punkte 8 in ein Venturirohr 5 kurz vor dessen engster Stelle ein, wo auch ein ringförmiger, Schraubenluft führender Kanal 4 mündet. Längs dieses Kanals sind die Kühler 7 der Verbrennungskraftmaschine 6 angeordnet. Bei der zweiten Ausführungsform (Abb. 57) erstreckt sich das Venturirohr 5 nicht wie zuvor axial durch den ganzen Rumpf, sondern ist kürzer und endet, kegelringförmig ausgebildet, am Rumpfumfang. In beiden Fällen können im Punkte 1 zusätzlich Brenner vorgesehen sein, um die Wärmeenergie des Treibstrahles zu erhöhen.
In die Reihe der von uns bereits erwähnten Heizluftstrahltriebwerke mit konstantem Volumen, die aus Verdichter -j- Brennkammer + Brenngasturbine + Diffusor mit oder ohne vorgesetzter Luftschraube bestehen, gliedern sich die mannigfachen, konstruktiv bemerkenswerten Bauformen der Aktiebolaget M i 1 o, Stockholm, ein, die wir zunächst aus der am 15. 2. 33 angemeldeten, zusammenfassenden, amerikanischen Patentschrift 2 085 761 (Erf.: A. Lysholm), Abb. 58 bis 61, zitieren. Abb. 58 zeigt, daß die Strahltriebwerke, auf den Flugzeugflügeln angeordnet, bei 4 abgezapfte verdichtete Luft und zugleich Wärme regelbar an die Höhenkabine 20 abgeben können. Abb. 59 zeigt den Aufbau der Triebwerkseinheit deutlicher. Der vorn bei 2 eintretende Fahrtwind wird in einem mehrstufigen System A verdichtet, in einem Ringkanal 8 längs der Wandung zu Brenndüsen 14 geführt und tritt als Brenngas hinter der sich erweiternden Brenn-
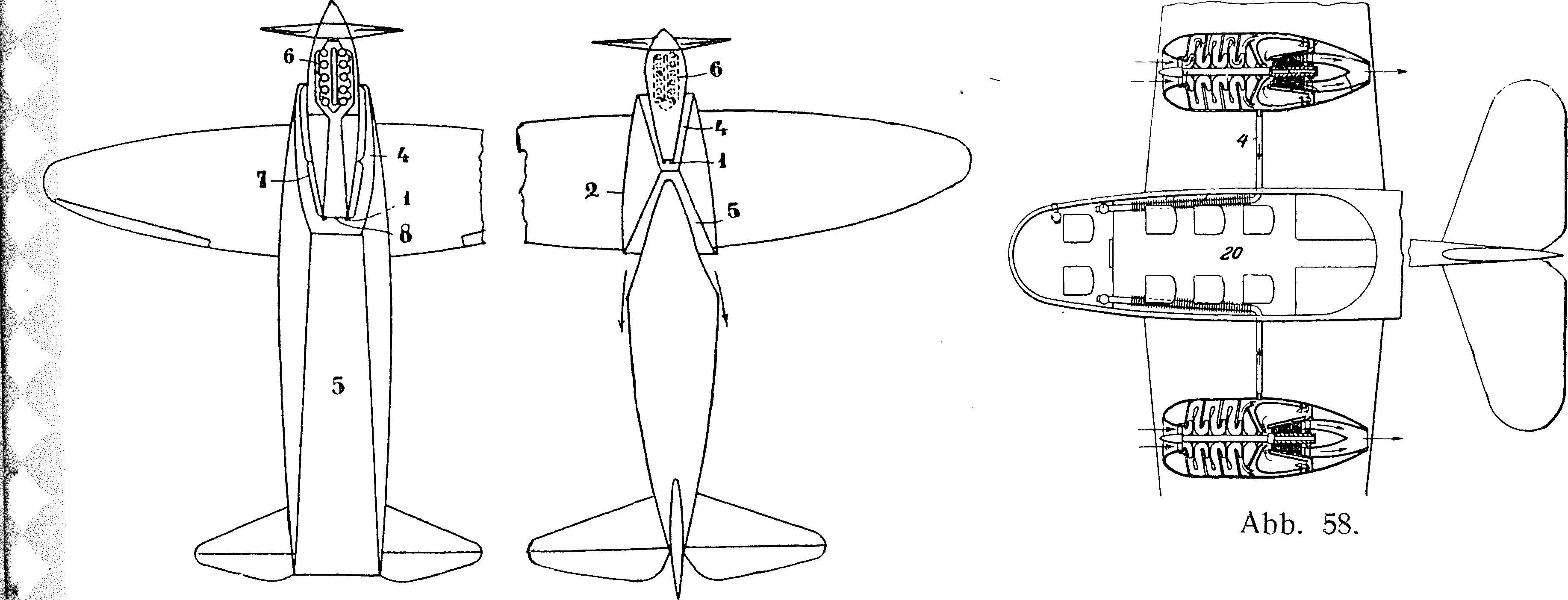
Abb. 56, 57. G. Caproni 1934: Ausnutzung der Motorabgase für zusätzlichen Vortrieb.
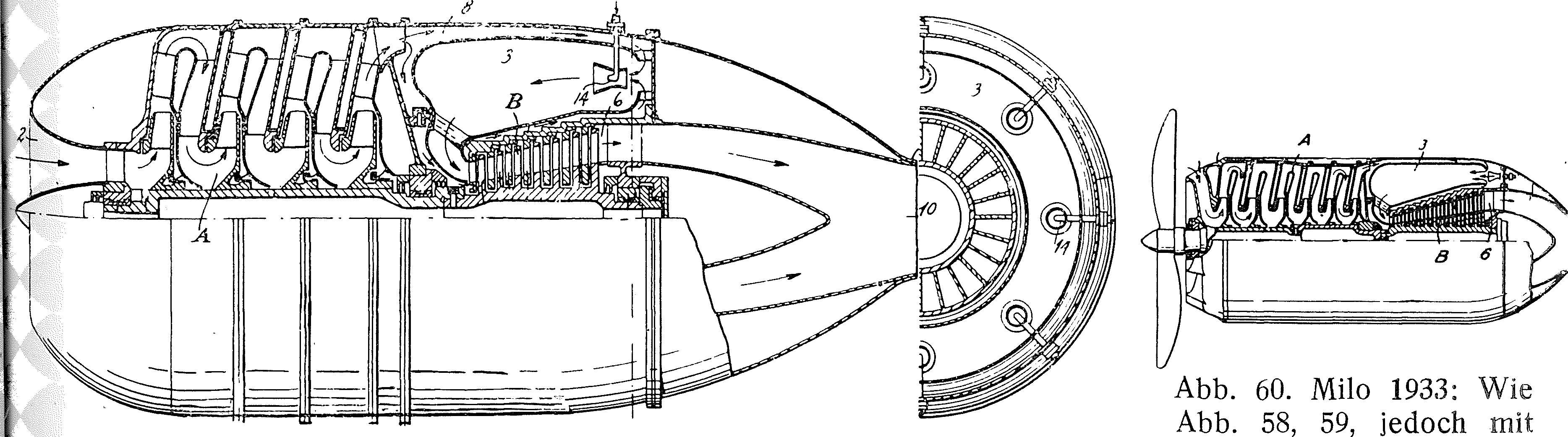
Abb. 58, 59. Milo 1933: Heizluftstrahltriebwerk mit Axialturbine. Luftschraubenantrieb.
kammer 3 in eine Axialturbine B ein, wo ein Teil der Energie für den Antrieb des Verdichters und gegebenenfalls auch einer Luftschraube, vgl. Abb. 60, aufgebraucht wird. Mit noch immer hoher Spannung und Geschwindigkeit strömt das aus einem großen Turbinen-Querschnitt 6 austretende Treibmittel in einen Austrittskanal, dessen Durchflußquerschnitt nach dem Ende 10 hin, wo der Rückstoß erzeugt wird, abnimmt.
Bei der Ausführungsform nach Abb. 61 findet eine Radialbrenngasturbine 14 Anwendung, die zwischen zwei gegenläufigen Verdichterstufen 15, 16 eingebaut ist. Nachdem die Luft die Niederdruckstufe 15 durchlaufen hat, umspült sie das Turbinenaggregat, bevor sie in die Hochdruckstufe 16 eintritt, und strömt dann wieder — wärmehaltend — an der Wand entlang und umkehrend durch die Brenndüse 14 fast arn Ende des windschnittigen Gehäuses in die Brennkammer 3. Durch Kanäle 17 hindurch wird das Brenngas in die Radialturbine 14 mit gegenläufiger Verschaufelung und von dort radial an den Körperumfang geführt. Hinter dem Größtdurchrnesser tritt der Strahl Rückstoß erzeugend aus Stutzen 7 am Umfang aus.
Verwiesen sei noch auf die deutsch gefaßten schweizerischen Patentschriften 174 257 und 170 667, deren erstere den Abb. 58 und 59, deren zweite, die mehr über Luftschraubentriebwerke sich ausläßt, den Abb. 60 und 61 entspricht, und ferner auf die brit. Patentschrift 472 850 (angem. 21. 4. 36) der Aktiebolaget Ljungströms Angtur-bin, Stockholm, in der ähnliche Bauarten beschrieben werden.
F. W h i 111 e , Cambridge, der mit seinem Prinzip-Patent eines Heizstrahlers bereits erwähnt worden ist (Heft 2, S. 32, Abb. 14), hat am 16. 5. 35 und 4. 3. 36 Bauformen angemeldet, über die nachstehend an der Hand der schweizerischen Patentschriften 188 758 und 195 823 berichtet wird. In der erstgenannten, Abb. 62—65, handelt es sich hauptsächlich um die Ausbildung des Schleuderverdichters, der in
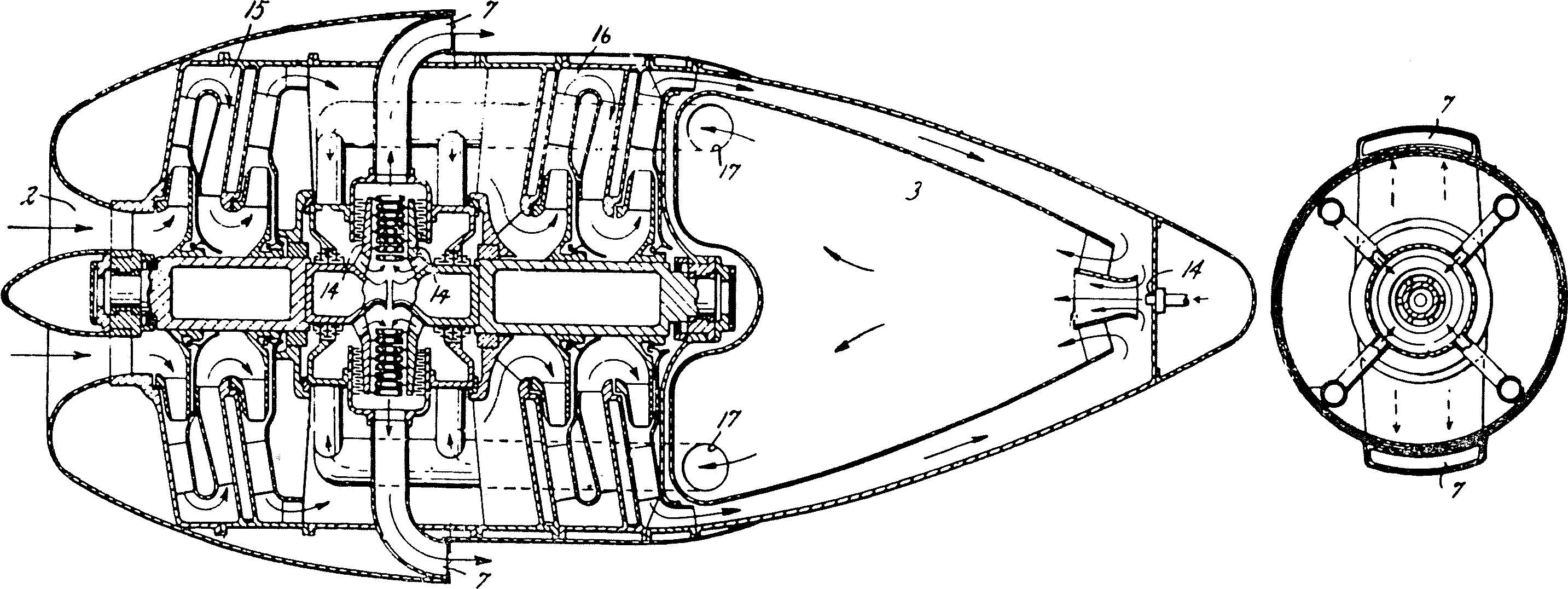
Abb. 61. Milo 1933: Heizluftstrahltriebwerk mit Radialturbine.
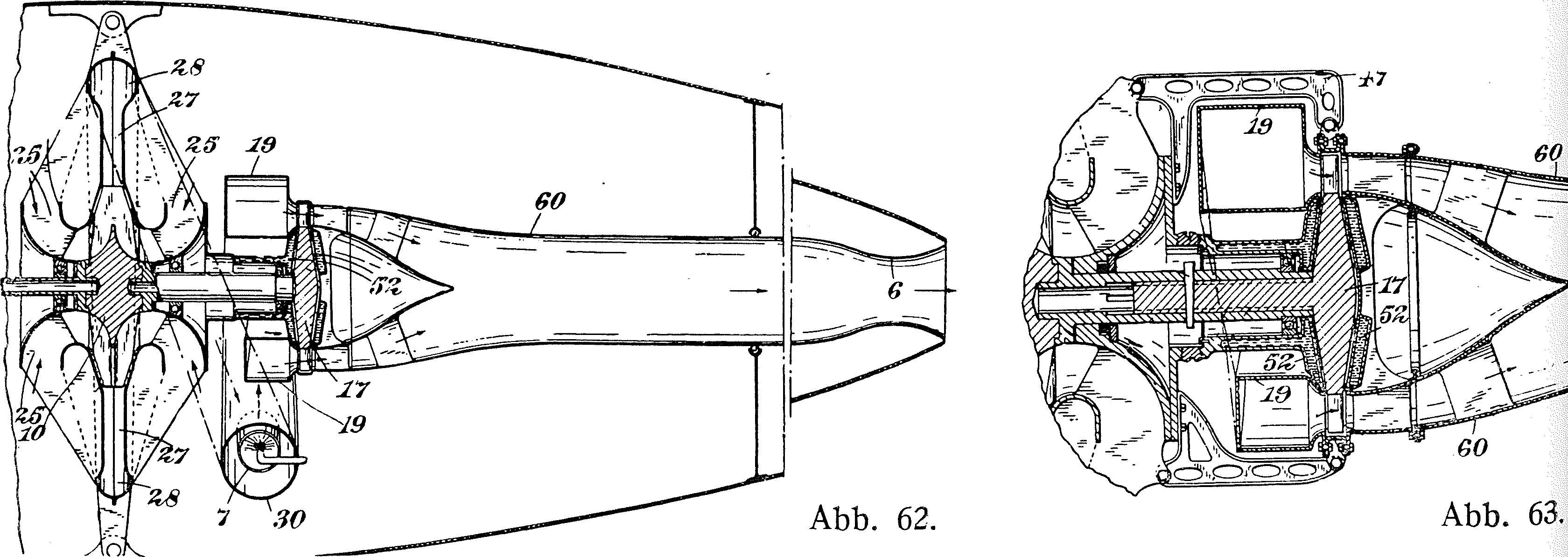
Abb. 62—65. Whittle 1935: Heizluftstrahltriebwerk mit Axialturbine.
einem vorn offenen Gehäuse von einem Turborotor 17 angetrieben wird. Das Schaufelrad 10 des Verdichters läßt die Luft bei 25 zu beiden Seiten seiner Symmetrieachse eintreten, beschleunigt sie an seinem Umfang auf Ueberschallgeschwindigkeit und schickt sie über einen Diffusor 27 in die Leitschnecke 28, aus der sie in eine gewundene Verbrennungskammer 30 mit sich erweiterndem Querschnitt und über eine Düse in die ringförmige Beaufschlagungskammer 19 der teilweise von einem Kühlmantel 52 umgebenen Turbine 17 gelangt, nachdem sie in einem in Abb. 64 dargestellten Zündrohr 7 mit Brennstoff angereichert ist und ein zündfähiges Gemisch gebildet hat. Die Innenwand des Zündrohres 7 ist mit einem Drahtnetz belegt, um eine Grenzschicht geringerer Geschwindigkeit zu erzeugen. Ein Teil der verdichteten Luft, die in 3^fächern Ueberschuß gefördert wird, umströmt das Zündrohr 7. Nachdem das Brenngas einen Teil seiner Energie an den Turborotor 17 abgegeben hat, tritt es über den Kanal 60 aus der Düse 6 rückstoßerzeugend aus. Aus Abb. 63 ist u. a. die konstruktive Verbindung von Verdichter und Turbine in Form bügelartiger Ausleger 47 erkennbar, aus Abb. 65 die Ausbildung eines zweistufigen Verdichters, bei dem die beiden äußeren Schaufelräder 77, 79 über gewundene Leitkanäle 85, 86 die Doppeleinlässe 84 des mittleren Hochdruck-Schaufelrades 78 beliefern.
Einen Zwillingsantrieb stellt die zweiterwähnte Patentschrift Whittles dar, Abb. 66. Der in jedem der beiden Düsenkörper bei E eintretende Fahrtwind wird von einem Axialverdichter 50 erfaßt, der von einer verbrennungsmotorischen Einrichtung — einem Kolbenmotor oder wie dargestellt einer Gasturbine 55 — über eine Ueber-setzung 54 angetrieben wird. Die verdichtete Luft wandert z. T. durch die Rückdruckdüsen D ab, z. T. in einen die beiden Düsenkörper verbindenden Mittelraum 56 hinein, wo sie von einem zweistufigen Verdichter 57, 58, bereits beschriebener Art noch weiter verdichtet und durch Kanäle 59 übergeleitet in Einlaßkammern 60 von Gleichdruckturbinen 62 brennfähig gemacht wird, die mit gemeinsamer Welle 61 das Verdichteraggregat betreiben. Die Abgase dieser Turbinen werden über Kanäle 63, 64 zu den bereits erwähnten Verbrennungskraftmaschinen 55 geleitet, um sich nach Austritt aus diesen mit der
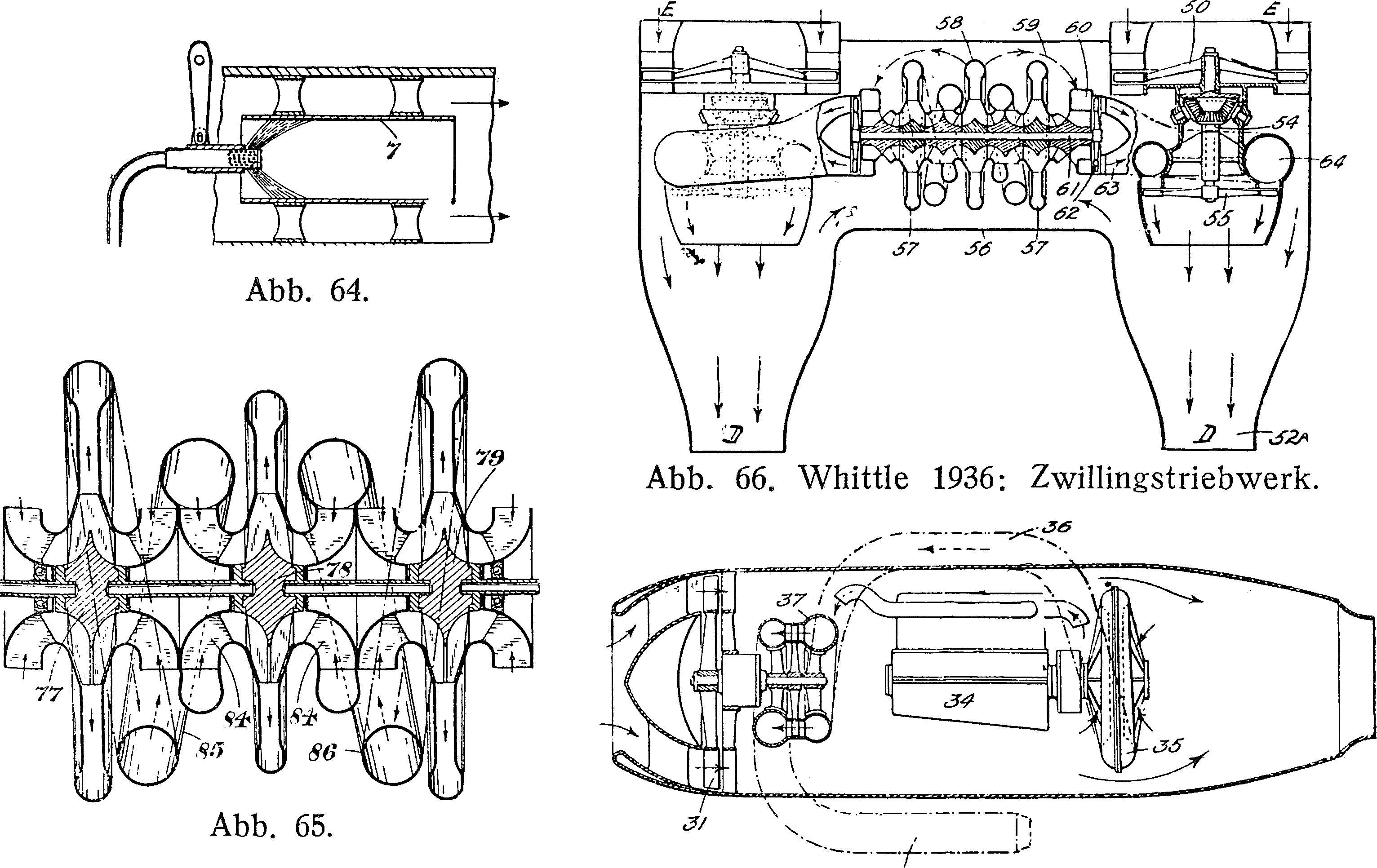
Abb. 67. Whittle 1936: Heizluftstrahltriebwerk mit Kolbenmotor und Turbine.
unmittelbar den Hohlkörper durchströmenden Luftmasse zum Treibstrahl zu vereinen.
Bei einer weiteren, in derselben schweizerischen Patentschrift 195 823 dargestellten Bauform, Abb. 67, erhält die, den Vorverdichter 31 treibende Gasturbine 37 ihr Treibmittel teils aus einem Schleuderverdichter 35 über Rohr 36, teils aus dem den Verdichter treibenden, von ihm aufgeladenen Motor 34, indem auch dessen Abgase dem Rohr 36 zugeleitet werden. Die Turbinenabgase geben ihren Energierest im Rückdruckrohr 38 ab.
Die Erfindung des vor wenigen Wochen ausgegebenen am 14. 5. 37 angemeldeten deutschen Patents 669 687/46b der E r 1 a -Maschinenwerk G. m. b. HL, Leipzig (Erf.: Dr. E. Münder), sucht die Nachteile der wärmeverzehrenden Dissoziation, die Gase bei den hohen Temperaturen in der Brennkammer erfahren, und die ihnen
Abb. 68. Erla 1937: Dissoziations-Einrichtung.
chemisch-technische Energie nimmt, dadurch zu beseitigen, daß das Gasgemisch bereits beim Eintritt in den Ofen d, Abb. 68, im Vorraum a durch eine besondere Wärmequelle zur Dissoziation gebracht wird, so daß „infolge der im Austrittsteil des Ofens stattfindenden Assoziation der Atome zu Molekülen neben der Wärme des erothermen öxyda-tionsvorganges der Moleküle auch die wieder frei werdende Dissoziationswärme zur Erzeugung des Gasdruckes ausgenützt wird". Als Wärmequelle wird ein elektrischer Lichtbogen benutzt, der zwischen schräg gestellten Wolframelektroden c gebildet wird, unter Heranführung von Wasserstoff und Sauerstoff an den Lichtbogen durch die Rohre e u. f.
Bereits in frühesten Zeiten hat man dem Strahltriebwerk als künftigem Luftfahrzeugantrieb Beachtung geschenkt. Wie lange wird es noch dauern, bis dieses Ideal-Vortriebsmittel zur praktischen Bedeutung gelangt? Gohlke.
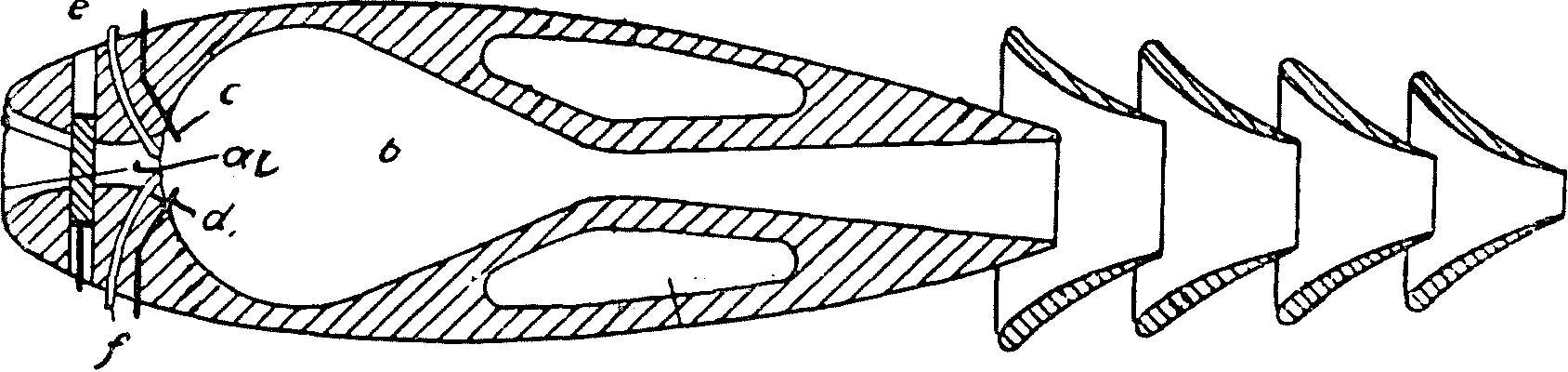
KQWRUKTIO/NS INZELHEITEM
Querruder-Antrieb Hanriot 232
bei dem abgestrebten Anderthalbdecker (vgl. d. Abb.) verläuft wie folgt:
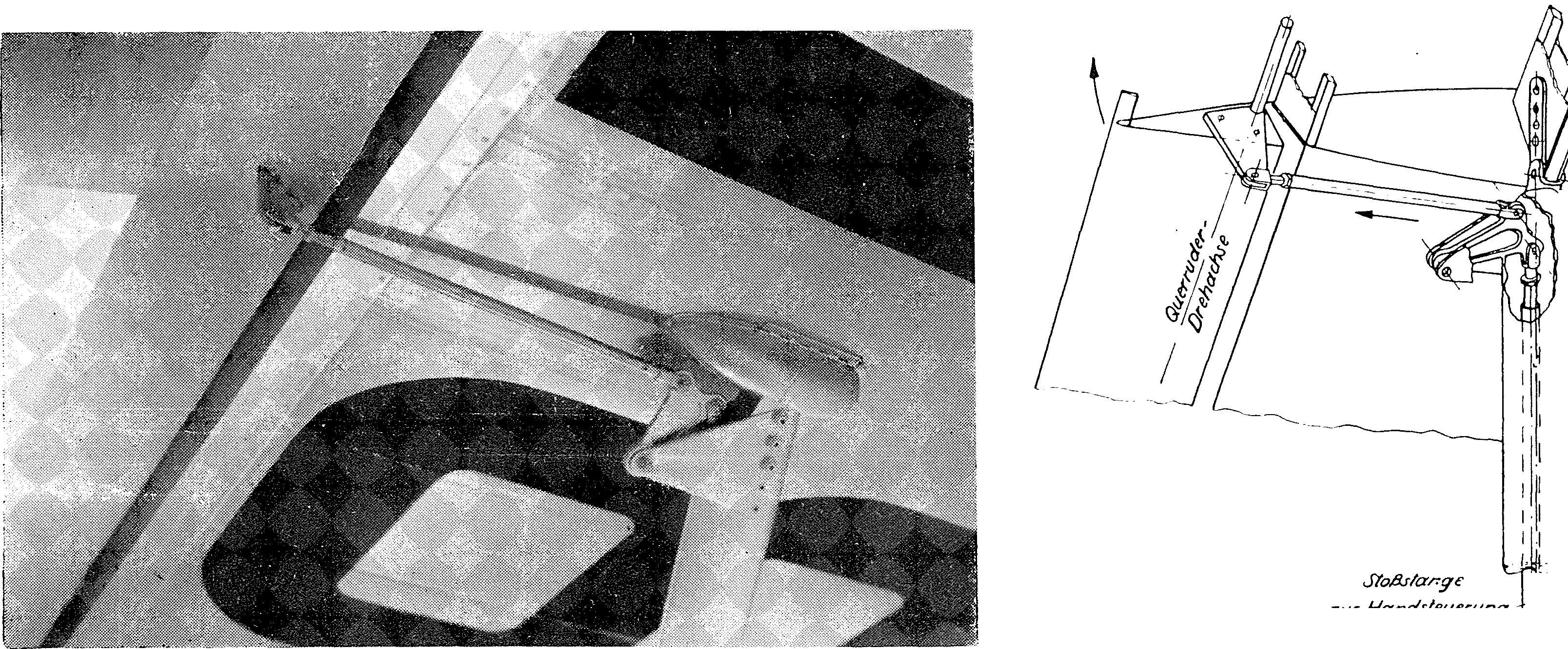
Bild Quitter.
Zeichnung: Flugsport
Stoßstange vom Knüppelfuß unter Fußboden weg in den Unterflügel-Stummel hinein. Am Stummelende Ablenkung der Stoßstange mittels Hebel, Weiterführung durch das hintere Profilrohr des V-förmigen Flügelstiels. Am oberen Stielanschluß Betätigung eines zweiten Zwischenhebels, dessen Lagerbock am Flügelstiel selbst angeschraubt ist. Diesen Zwischenhebel, der gleichzeitig Differential-Antrieb bewirkt verbindet eine kurze, im freien Luftstrom in Flugrichtung verlaufende Stoßstange mit dem auf Flügel Unterseite hervorstehenden Querruder-Hebel. Querruder-Drehachse an Profil-Oberseite.

Inland.
Neuorganisation der Luftwaffe.
Der Führer hat auf Vorschlag des Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe mit Wirkung vom 1. Februar 1939 organisatorische Veränderungen innerhalb der Luftwaffe genehmigt, die durch schärfste Konzentration aller Kräfte einen weiteren entscheidenden Fortschritt für den Aufbau der Luftwaffe bedeuten.
Im Zuge dieser Veränderungen werden die Luftflottenkommandos 1, 2 und 3 neu gebildet. Ihre Befehlshaber führen die Dienstbezeichnung: Chef der Luftflotte 1 und Befehlshaber Ost, Chef der Luftflotte 2 und Befehlshaber Nord, Chef der Luftflotte 3 und Befehlshaber West. Die bisherigen Luftwaffengruppenkommandos entfallen.
Im Reichsluftfahrtministerium sind als die wesentlichsten Veränderungen die Ernennung des Staatssekretärs der Luftfahrt zum Generalinspekteur der Luftwaffe, eine wesentliche Erweiterung der Befugnisse der Dienststelle des Chefs der Luftwehr, die Schaffung der Dienststelle des A u s b i 1 -dungswesens, des Generalluftzeug meisters und einer Luft-w a f f e n k o m m i s s i o n hervorzuheben.
Ferner erfolgte die Ernennung von Generalen der Luftwaffe bei den Oberkommandos des Heeres und der Kriegsmarine.
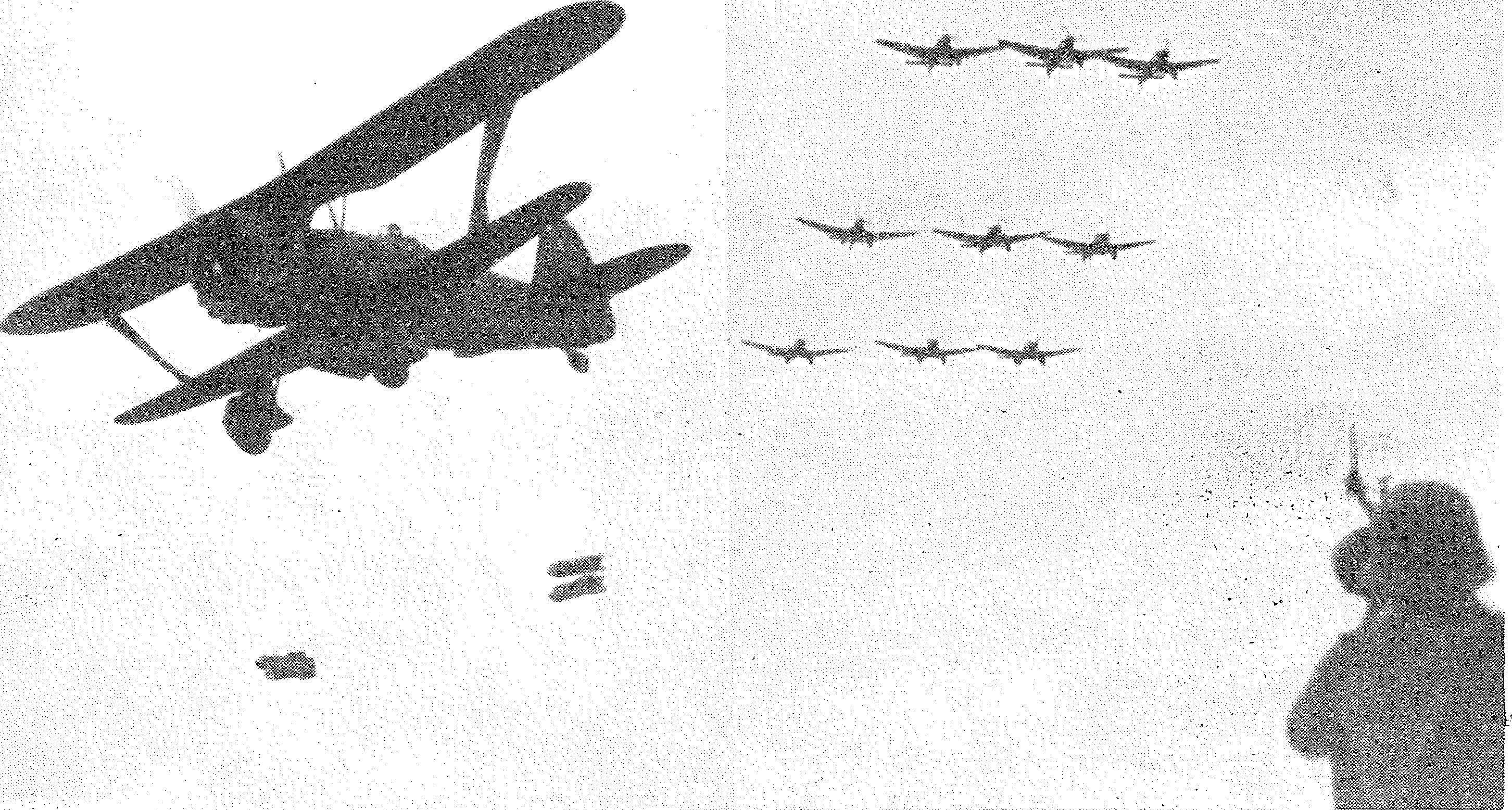
Sturzkainpfflieger. Links: Stuka-Angriff. Die Bomben sind gerade abgeworfen. Rechts: Ab wehr Übung gegen eine Stuka-Staffel beim Luftexerzieren.
Weltbild (2)
Alle diese Maßnahmen dienen zur Verstärkung der Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der deutschen Luftwaffe und insbesondere ihrer weiteren personellen und materiellen Vermehrung.
Es werden ernannt:
Generaloberst Milch, Staatssekretär der Luftfahrt, unter Beibehaltung dieser
Stellung zum Qeneralinspekteur der Luftwaffe; General der Flieger Stumpff zum Chef der Luftwehr;
General der Flieger Kesselring zum Chef der Luftflotte 1 und Befehlshaber Ost;
General der Flieger Felmy zum Chef der Luftflotte 2 und Befehshaber Nord; General der Flieger S p e r r 1 e zum Chef der Luftflotte 3 und Befehlshaber West; General der Flakartillerie Rudel zum Präsidenten der Luftwaffenkommission;

Neugliederung der Luftwaffe. Weitbild (2)
Der Führer hat auf Vorschlag des Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe mit Wirkung vom 1. Februar 1939 organisatorische Veränderungen innerhalb der Luftwaffe genehmigt, die durch schärfste Konzentration aller Kräfte einen weiteren entscheidenden Fortschritt für den Aufbau der Luftwaffe bedeuten. Im Zuge dieser Veränderungen wurden ernannt (v. 1. n. r.): Generaloberst Milch, Staatssekretär der Luftfahrt, unter Beibehaltung dieser Stellung zum Generalinspekteur der Luftwaffe; Generalleutnant Udet zum Generalluftzeugmeister; General der Flieger Stumpff zum Chef der Luftwehr; General der Flieger Felmy zum Chef der Luftflotte 2 und Befehlshaber Nord; General der Flieger Sperrle zum Chef der Luftflotte 3 und Befehlshaber West; General der Flakartillerie Rudel zum Präsidenten der Luftwaffenkommission.
Generalleutnant Kühl zum Chef des Ausbildungswesens;
Generalleutnant Udet zum Generalluftzeugmeister;
Generalmajor Loeb zum Amtschef im Reichsluffahrtministerium;
Generalmajor K a s t n e r wird mit der Wahrnehmung der Geschäfte eines Amtschefs im Reichsluftfahrtministerium beauftragt;
Generalmajor Bogatsch zum General der Luftwaffe beim Oberkommando des Heeres;
General Ritter zum General der Luftwaffe beim Oberkommando der Kriegsmarine;
Oberst Jeschonnek zum Chef des Generalstabes der Luftwaffe; Generalleutnant W i m m e r zum Kommandierenden General der Luftwaffe in Ostpreußen;
Generalleutnant Keller unter Beibehalt des Ranges eines Kommandierenden Generals zum Kommandeur der Fliegerdivision 4; General Ritter von G r e i m zum Kommandeur der Fliegerdivision 5; Generalmajor L o e r z e r zum Kommandeur der Fliegerdivision 2; Generalmajor Deszloch zum Kommandeur der Fliegerdivision 6; Oberst Put zier zum Kommandeur der Fliegerdivision 3.
Beförderungen in der Luftwaffe hat der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht mit Wirkung vom 1. Februar 1939 befohlen: Zum General der Flieger den charakterisierten General der Flieger von Witzendorff; zu Generalmajoren die Obersten Steudemann, Heilingbrunner, von Arnould de la Perriere, Putzier; mit Wirkung vom 1. Februar erhält den Charakter als Generalmajor der Oberst Triendl, mit Wirkung vom 1. Februar werden befördert zu Obersten die Oberstleutnants von Chaulin-Egersberg, Dipl.-Ing. Burchard, Dr. Dr. Dipl.-Ing. Seidel, Eibenstein, von Axthelm, Hempel, Heydenreich, Dietrich,
Negenborn, Kern, Dr. Roos. -
Naehmilitfrische Schulung.
Nach Ableistung ihrer Wehrpflicht kehren die Soldaten der Fliegertruppe als Reservisten in das NS.-Fliegerkorps zurück, um sich hier — dem Willen des Führers gemäß — ihre geistigen und körperlichen Kräfte sowie ihr fliegerisches Können zu erhalten. Diese Schulung erstreckt sich:
1. im Motorflug auf die Erhaltung der Flugfrische utid damit der fliegerischen Einsatzbereitschaft. Sie wird bei den Flugbereitschaften der NSFK.-Grup-pen und -Standarten durchgeführt. Allen Nichtflugzeugführern ist im Rahmen des Segelfluges weiteste fliegerische Betätigung gegeben;
2. bezüglich der Erhaltung der geistigen Kräfte auf die weltanschauliche Schulung, die von den Schulungsreferenten der Standarten und Stürme durchgeführt wird:
3. die körperlichen Kräfte werden in sportlicher und wehrsportlicher Betätigung erhalten. In Zusammenfassung in Wehrschaften derjenigen Reservisten, die das NS.-Wehrabzeichen noch nicht besitzen, kann dieses bei den Einheiten des Fliegerkorps erworben werden. Hierzu steht ein ausreichendes Netz von geschulten Lehr- und Prüfscheininhabern seit Jahren bereit.
Durch diese nachmilitärische Schulung soll den Reservisten im NS.-Fliegerkorps die Möglichkeit gegeben werden, in Kürze als Führer, Unterführer und Ausbilder sowohl im Fliegerkorps als auch in der Flieger-HJ. Verwendung zu finden, um nun ihrerseits wieder den kommenden Nachwuchs auf den Dienst bei der Waffe vorzubereiten.
Tagesbefehl des Korpsführers des NSFK., General der Flieger Christiansen, vom 30. Januar 1939:
„Am 6. Jahrestag der nationalsozialistischen Revolution blickt das NS.-Fliegerkorps auf zwei Jahre kraftvoller Aufbauarbeit zurück. Organisatorisch war eine in dieser Art völlig neue Gliederung aufzustellen, die inzwischen auch bei höchster Beanspruchung feste und dauerhafte Formen fand.
Das NS.-Fliegerkorps hat sich im deutschen Volk als eine für unsere Jugend, ja für die gesamte fliegerische Zukunft des Reiches, ebenso notwendige wie unentbehrliche Einrichtung durchgesetzt. Die Angehörigen des Korps können auf diese in hartem Kampf, in ehrlicher Kameradschaft und in sauberer Disziplin geschaffene Leistung stolz sein.
Ich erwarte, daß die Führer und Männer des NS.-Fliegerkorps auch weiterhin durch einen gesteigerten und unermüdlichen Einsatz zeigen, daß sie fest durchdrungen sind vom Geist einer wahrhaften nationalsozialistischen Kampf- und
Opfergemeinschaft und unserem Führer Adolf Hitler durch die dienende Tat ihre unerschütterliche Treue beweisen. Heil unserem Führer!"
Kennzeichnung der Flugzeuge der Luftwaffe wird gemäß einer Anordnung des Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe wie folgt geändert: An Stelle der Reichs- und Nationalflagge führen nunmehr sämtliche Flugzeuge der Luftwaffe am Seitenruder das Hakenkreuz als Hoheitszeichen. Das Hakenkreuz bleibt in den bisherigen Maßen bestehen. Es erhält eine weiße Umrandung die von einer schwarzen Linie nach außen begrenzt wird. Alle übrigen Teile des bisherigen Hoheitsabzeichens auf rotem Grunde werden mit ßlickschutzfarbe überstrichen. An den zur Zeit gültigen Bestimmungen über die Bezeichnung mit militärischen Kennzeichen (Balkenkreuz und Numerierung) ändert sich nichts.
Heranbildung des Luftwaffennachwuchses im NSFK.
Gegen Ende des Jahres 1938 erhielt das NS.-Fliegerkorps vom Reichsminister der Luftwaffe und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Generalfeldmarschall Göring, den Befehl, für den Nachwuchs an Flugzeugführern der Luftwaffe nun auch die Schulung im Motorflug in die vormilitärische Ausbildung hineinzunehmen. Mit stolzer Freude nahmen Führer und Männer des Korps diesen Befehl entgegen, der ein Beweis des uneingeschränkten Vertrauens darstellt, das der Generalfeldmarschall dem Korpsführer und der Leistungsfähigkeit des von ihm geführten Korps entgegenbringt. Die Vorbereitungen wurden sofort in Angriff genommen, so daß bereits am 3. Januar 1939 die ersten vier Lehrgänge an den NSFK.-Motorflugschulen Königsberg, Hamburg, Bielefeld und Karlsruhe anlaufen konnten, denen im Laufe des Jahres noch weitere Schulen folgen werden. Damit erweitern sich die Aufgaben des NS.-Fliegerkorps gewaltig und bilden nun erst ein in sich geschlossenes Aufgabengebiet.
Vormilitärische Ausbildung.
Schon im Früjahr 1937 erhielt das NS.-Fliegerkorps durch Erlaß des Führers als seine Hauptaufgabe die vormilitärische Ausbildung des Luftwaffen-Nachwuchses zugewiesen. Diese erstreckt sich nunmehr auf folgende Gebiete:
1. Modellbau und Modellflug in den Modellflugarbeitsgemeinschaften des Deutschen Jungvolks und in den Modellbauschulen des NS.-Fliegerkorps.
2. Gleit- und Segelflugzeugbau sowie Gleit- und Segelflug für die Angehörigen der Flieger-HJ. und des NS.-Fliegerkorps bei den Stürmen, in den Segelfluglagern und Segelflugschulen des NS.-Fliegerkorps und
3. Motorflug: a) im Kleinflugzeug als Krönung der abgeschlossenen Segelflugausbildung für Angehörige der Flieger-HJ. und des NS.-Fliegerkorps, b) in A2- und B 1-Maschinen für die Angehörigen des NS.-Fliegerkorps, die als Flugzeugführer für die Fliegertruppe in Aussicht genommen sind. Diese Ausbildung erfolgt nach abgeleisteter Dienstpflicht in sechsmonatigen Lehrgängen in den Motorflugschulen des NS.-Fliegerkorps.
Sturzkampfflieger. Mit dem Bornbenbeladewagen bereiten die Bombenwarte die Einhängung der Bomben vor. Alle Aufnahmen von Sturzkampf-Fliegern sind vorn RLM. am 30. 1. 1939 freigegeben.

Weltbild
Luitaufsichtsgesetz, das die Befugnisse der Luftfahrtbehörden bei Ausübung der Luftfahrt regelt, hat die Reichsregierung erlassen. Die Luftfahrtbehörden können zur Ausübung Aler Luftaufsicht Verordnungen und Verfügungen erlassen und sonstige Anordnungen treffen. Sie können die Befolgung einer Verfügung, wenn die Verfügung unanfechtbar geworden ist oder sofort ausgeführt werden muß, durchsetzen, und zwar durch Ausführung der zu erzwingenden Handlung auf Kosten des Verpflichteten oder durch Festsetzung von Zwangsgeld, an dessen Stelle im Nichtbeitreibungsfall Zwangshaft treten kann, oder durch unmittelbaren Zwang. Gegen die Verfügung einer Luftfahrtbehörde und gegen die Festsetzung und Ausführung eines Zwangsmittels durch eine Luftfahrtbehörde steht dem Betroffenen die Beschwerde zu.
Gleichzeitig hat der Reichsminister der Luftfahrt eine Durchführungsverordnung zu dem neuen Luftaufsichtsgesetz erlassen. Luftfahrtbehörden im Rahmen des Gesetzes sind danach der Reichsminister der Luftfahrt und die Luftämter. Die letzteren unterhalten nach Bedarf Außenstellen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Reichsminister der Luftfahrt die Befugnisse der Luftämter ausdehnen. Der Vollzug der Luftaufsicht ist Aufgabe des Reichsluftauf Sichtsdienstes. Die Angehörigen des Reichsluftaufsichtsdienstes bekommen, unbeschadet des Rechts der Notwehr, Möglichkeiten unmittelbaren Zwanges in die Hand, wenn die Erreichung des verfolgten Zweckes es erfordert. Das neue Gesetz und die Durchführungsverordnung treten am 15. Februar 1939 in Kraft.
Höhenflugleistung mit Si 202 „Hummel'* mit 50-PS-Zündapp-Motor vollbrachte Flugkpt. Ziese. Am 31. 1. erreichte er auf dem Werksflugplatz der Siebel-Flug-zeugwerke Halle mit Fluggast 5982 m. Bisheriger Rekord, Kategorie 4, Tschechoslowakei 4872 m. Am 3. 2. erreichte er einsitzig mit dem gleichen Flugzeug 7043 m und überbot den tschechoslowakischen Rekord von 5851 m. Beide Höchstleistungen wurden bei der F. A. I. zur Anerkennung als internationale Rekorde angemeldet.
Berlin-Addis Abeba auf Siebel Fh 104 mit zwei 240-PS-Hirth-Motoren, reine Flugzeit 33 Std. Die Besatzung des Flugzeuges, Obltn. Kaldrack, Obltn. Balthasar und Feldw. Anhäuser wurden am 1. 2. in Addis Abeba vom Vizekönig von Aethiopien, Herzog von Aosta, empfangen. Inzwischen sind die Flieger am 10. ?., 15 h, in Kapstadt eingetroffen.
NSFK-Hauptreferat 5 (Wehrsport, Sport, weltanschauliche Schulung) zur Abteilung 5 umgewandelt. Abteilungschef 5 SA.-Oberführer Arthur Ledy.
Brasil. Luftwaffenkommission besuchte auf Einladung des Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe, Generalfeldmarschall Göring, mehrere Werke der deutschen Luftfahrtindustrie und Einrichtungen der Luftwaffe. In Berlin fanden weiter noch verschiedene Empfänge statt. Führung der Kommission Fregattenkpt. Fernando Victor de Amaral Savaget. Unter dem Gefolge befand sich auch der bekannte brasilianische Flieger Mello.
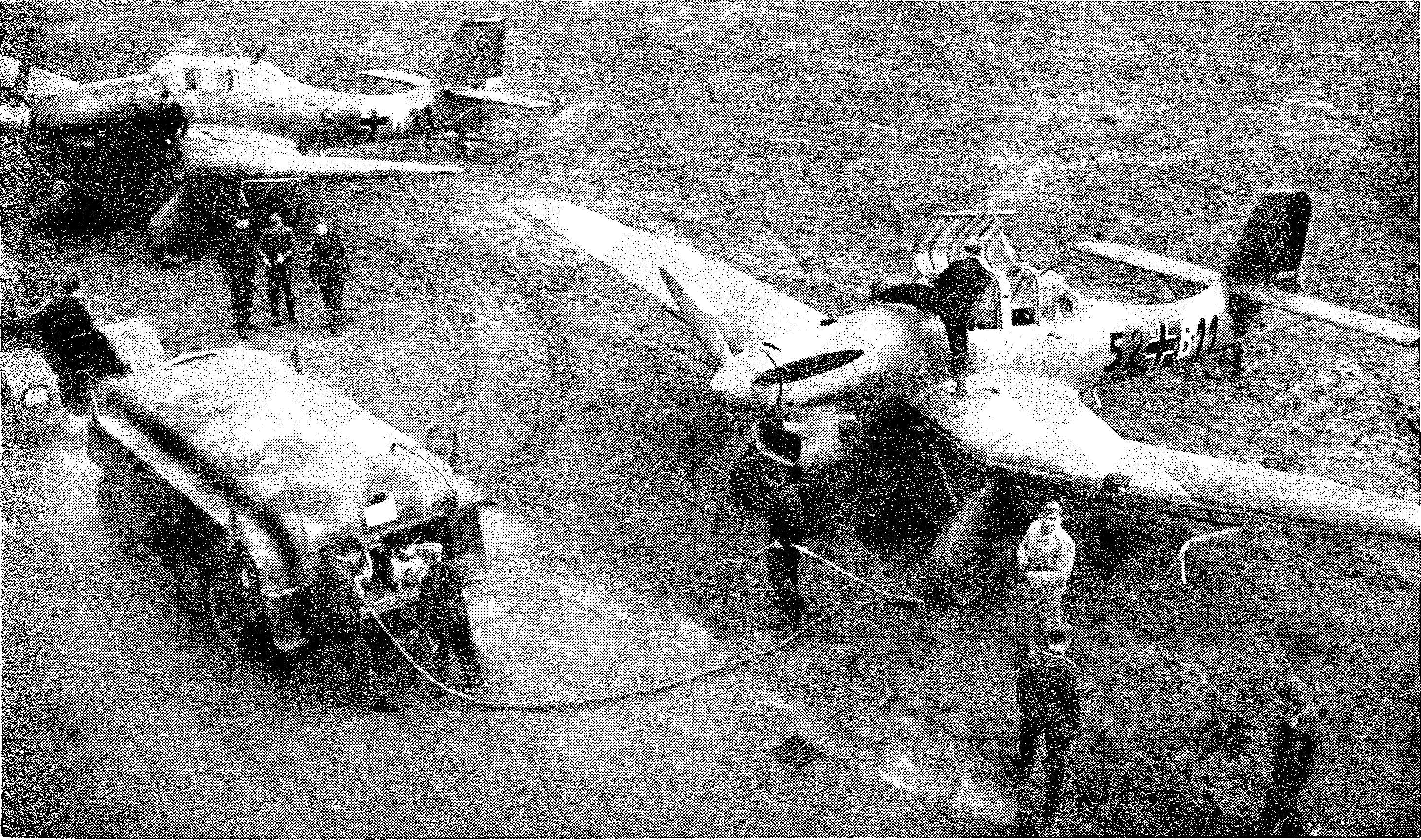
Sturzkampfflieger. Schnelltankwarte bei der Arbeit.
Weltbild
Franz Reinhard f> Gründer und verdienstvoller Leiter von Nobel & Co., im Alter von 56 Jahren, Schlaganfall, 30. Januar gestorben.
Oberltn. ^ulkowsky t am 9. 2. in Madras (Vorderindien) bei einem Vorführungsflug mit einem indischen Fluggast durch Berührung eines Hindernisses tödlich verunglückt. Wie wir im „Flugsport" berichteten, hatte Oberltn. Pulkowsky mit Ltn. Jenett mit dem Reiseflugzeug Ar 79 einen Fernflug nach Australien unternommen und hierbei hervorragende Flugleistungen, so durch die Ueberwindung der Strecke Bengasi (Nordafrika)—Qaja (Hinterindien), 6400 km, im Ohnehaltflug, vollbracht, lieber den Flug vgl. „Flugsport" 1939, S. 53 u. 80.
Focke-Wulf F 61 verbesserte ihren Höhrenrekord von 2439 m auf 3570 m, Flugzeugführer Bode. Bisher im Ausland erzielte größte Höhe mit Hubschrauber 158 m.
Was gibt es sonst Neues?
Olympiade 1940 Finnland sollen kleinere Landeplätze für Privatflieger vorbereitet werden. " . ,
Aero-Club von Deutschland Organ nicht mehr „Luftreise", jetzt „Luftwelt". Engl. Militärflugplatz nördlich von Gibraltar im Bau.
Stabsgebäude des NS.-Fliegerkorps jetzt Berlin-Wilmersdorf, Meierottostr. 8-9.
Ausland.
London—Kapstadt—London flog Alex Henshaw, ein in deutschen Fliegerkreisen bekannter englischer Flieger, in einer Zeit, womit alle bisherigen Leistungen überboten wurden. Für den Hinflug nach Kapstadt benötigte er 1 Tag 15 Std. 25 Min., für den Rückflug nach London 1 Tag 15 Std. 33 Min. reine Flugzeit. Für den Flug hin und zurück hat er insgesamt 4 Tage 10 Std. ,16 Min. benötigt. Henshaw traf am 9. 2. um 13.51 Uhr aus Afrika kommend in England auf dem Flugplatz Gravesend ein. Er war bei seiner Ankunft so erschöpft, daß er aus dem Flugzeug herausgetragen werden mußte. — Eine fabelhafte Leistung, zu der wir Henshaw bestens gratulieren. Bekanntlich brauchten Clouston und Kirby Green im Jahre 1937 für den Hinflug 1 Tag 21 Std. 6 Min., für den Rückflug 2 Tage 9 Std. 23 Min. und im ganzen 5 Tage 17 Std.
Paul Johnston, der Schriftleiter von „Aviation", welcher voriges Jahr Europa bereiste und Flugzentren in den verschiedensten Ländern studierte, bringt in seiner Januarnummer Angaben über mutmaßliche Produktionsziffern. Danach sollen in Deutschland 1938 6000 Flugzeuge produziert worden sein. 1939 wird die Produktion auf 8000 geschätzt. Während in England die Produktion 1938 ca. 3000 bis 3500 Flugzeuge betragen habe, solle sich dies 1939 auf 5000 steigern.
Fairey P. 4/34 Zweisitzer-Jagdflugzeug wird für die dänische Marine in Dänemark in Lizenz gebaut. Als Sturzbomber ist die Maschine mit Spezialklappen ausgerüstet, um die Geschwindigkeit beim Sturzflug bremsen zu können.
Wadi neuer Flugplatz Haifa, 1. 1. 39 in Betrieb genommen, der alte aufgegeben. Lage: 21° 50' nördl. Breite, 31° 20' östl. Länge, 122 m hoch, 1 km westl der Haupteisenbahnlinie nach Atbara, 10 km südl. von Wadi Haifa, einige 8 km stidl. des ehem. Platzes. Fläche: 1,097 X 1,097 km, Oberfläche fester glatter Sand, gekennzeichnet durch Kreise, Ecken und Grenzmarken.
Nuffield Hochgeschwindigkeitsflugzeug, welches zur Zeit bei der Heston Aircraft Co. in Konstruktion ist, soll einen neuen Napier-Motor von 2000 PS erhalten und soll über 640 km/h Geschwindigkeit erreichen.
Engl. Luftmarschall für den Mittleren Osten, Sir William Mitchell, mit dem Sitz in Kairo ernannt. Der englische Luftbezirk des Mittleren Ostens umfaßt Aegypten, den Sudan, Kenya, Palästina und Transjordanien. Die Luftmacht des Mittleren Ostens besteht aus 4 Bombenstaffeln, 2 Jagdstaffeln, 1 Staffel für Bombentransport und 1 Heeresstaffel. Außerdem befinden sich noch 3 Staffeln in Palästina. Dieser Bezirk ist der einzige, welcher mit Jagdstaffeln ausgestattet ist, während alle anderen Jagdstaffeln sich in Großbritannien zur Verteidigung des Heimatbodens befinden.
Flughäfen um London werden ausgebaut. Lufthafen von Heston soll bis 1942 fertig werden, der neue Flughafen von Fairlop in den nächsten 3 Jahren. Erst dann wird es möglich sein, den Flughafen Croydon den neuzeitlichen Erfordernissen entsprechend auszubauen. In Zukunft soll der Luftverkehr auf mehrere Häfen dezentralisiert werden.
Verkehrsflugzeug Potez 62 der Air France am 27.1. 8 km westlich von Köln gegen Schornstein gestoßen, verunglückt, vier Mann Besatzung und zwei Fluggäste tot.
Coupe Deutsch de la Meurthe bei Nennungsschluß 6 Meldungen. Drei Lignels, eine Max Holst, eine Regnier und eine Payen. Nachnennungsschluß 12. 7. 39.
Ital. General Bernosconi, Befehlshaber der italienischen freiwilligen Flieger in Spanien, wurde vom Duce zum Geschwadergeneral der italienischen Luftwaffe befördert.
USA.-Luftwaffe wurden für neue Personalerweiterungen 300 Millionen Dollar beantragt. Es handelt sich um die Einstellung von weiteren 1656 Offizieren, 603 Reserveoffizieren und 25 143 Mannschaften.
200 Curtiss P - 36 sind bekanntlich von Frankreich bestellt. In Fachkreisen ist man, wie Les Ailes berichtet, hierüber geteilter Meinung. Ohne von dem Preis, der pro Stück ungefähr IV2 Millionen Francs betragen wird, zu reden, kann das Material mit dem französischen nicht Schritt halten. Die Höchstgeschwindigkeit des P - 36 beträgt nur 475 km/h. Wenn man ausländisches Material beschafft, so hätte man unter allen Umständen dieses denselben Prüfungen unterziehen sollen, welche von französ. Flugzeugen gefordert werden.
Rom—Südamerika ist am 4. 2. der italienische Transozeanflieger Oberst Bisceo gestartet.
Brasilien bestellte 14 Bücker „Jungmann", 12 für den Aero-Clu]b do Brasil und 2 für Private.
Duala-Flugplatz, neue Startbahn, größere Halle im Bau.
Lome-Flugplatz, Startbahn soll im Februar fertig werden.
Belgisch Kongo, Flugplätze Costermansville, Görna und Rutshuru sind für den Zivilverkehr freigegeben; die von Tshikapa und Kikwit noch im Bau.
Ausschreibung 1938/39 Nehring-Gedächtnispreis des Herrn Reichsstatthalters in Hessen. Der Korpsführer des NSFK. schreibt den Wanderpreis aus. Der Preis läuft vom 1. 4. 38 bis 31. 3. 39 und wird am 16. 4. 39 zugesprochen. Bewerber muß NSFK.-Mann sein (Segelflugzeugführer). Bedingung: 38.'39: Höhenflug, mindestens 5000 m über Start mit einem motorlosen Flugzeug. Die Anerkennung einer Flugleistung erfolgt auf Grund eingereichter Unterlagen durch den Korpsführer des NSFK. Die Flugleistung kann im In- oder Ausland aufgestellt werden. Außer Gummiseilstart ist auch Schleppstart zulässig (Ausklinkpunkt = Startpunkt, in Sicht des Sportzeugen). Bewerbungen sind mit Unterlagen, auf dem Dienstweg, durch Einschreibebrief an den Korpsführer des NSFK. Berlin zu richten. Jede Leistung durch anerkannte Sportzeugen beurkunden lassen, die beim Start persönlich anwesend sein müssen. Zu den Flugbeurkundungen gehören: ein ausgewertetes und beglaubigtes Barogramm des Segelflugzeuges, Start- und Landebescheinigung, Bescheinigung über das Ausklinken, sowie bei Schleppflug Barogramm des Schleppflugzeuges. Kosten der Beurkundung trägt der Bewerber. Eine Berufung gegen die Preiszuteilung ist ausgeschlossen. Der Korpsführer übernimmt keinerlei Verpflichtungen zum Tragen von Kosten irgendwelcher Art. Er behält sich das Recht vor, die Ausschreibung zu ergänzen und etwa notwendig werdende Ausführungsbestimmungen zu erlassen.
Nehring - Gedechtnispreis - Preisträger 37/38 NSFK.-Truppführer Steinig, NSFK.-Gruppe 6 (Schlesien). Er hat am 21. 5. 37 vom Flugplatz Hirschberg/Hartau aus eine Höhe von 7500 m über NN und 4680 m über Start erreicht.
Segelflug-Olympiade Helsingfors 1939 werden gemäß Beschluß der FAI 4 Segelflüge zur Ausführung zugelassen, wobei bei 2 Flügen die größte erreichte Höhe und bei 2 Flügen die kürzeste Flugzeit gewertet wird. Für die Durchführung des einen oder anderen Zielsegelfluges wird jeweils ein Tag bestimmt. Zu den olympischen Wettkämpfen sind keine Berufssportler, sondern nur Amateursportler zugelassen.

Segelflug
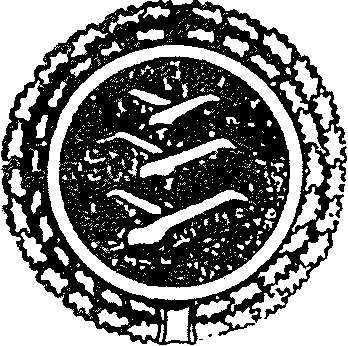
Autogiro-Saalflugmodell des Amerikaners Huguelet, bestehend aus zwei rast gleichen Tragflächen in Tandemanordnung, vordere Fläche starke V-Form (vgl. Abb.), Seitenruder unter dem hinteren Flügel. Im ersten Drittel der Entfernung zwischen beiden Flächen ist auf dem Stab ein vierflügeliger freilaufender Rotor unangetrieben aufgesetzt. Flügel und Rotor mikrofilmbespannt, übliche amerikanische Saalflugmodell-Bauweise. Dem Modell, obschon es kein reiner Hubschrauber ist, wurde der amerikanische Dauerflugrekord mit 4 min 29 sec für das Jahr 1938 zuerkannt.
-336
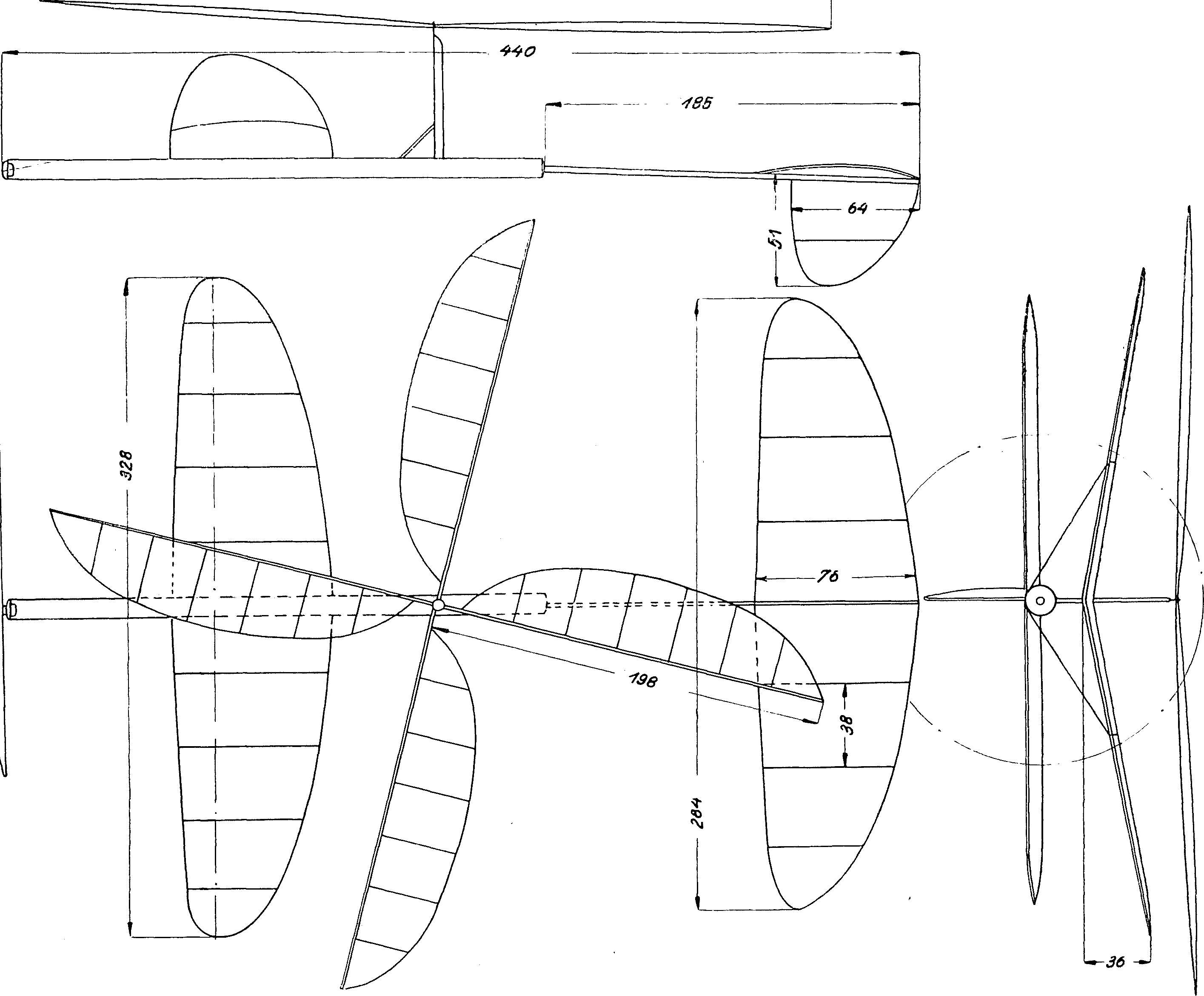
Zeichnung: Flugsport
Amerik. Autogiro-Saalflugmodell Huguelet. Berichtigung. Der zweimotorige Schnellbomber in Nr. 3/1939 des „Flugsport" S. 82 gehört nicht zu Francos Luftwaffe, sondern ist der russische Bomber SB-2 (Vmax 420 km/h) in rotspanischen Diensten.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.) Fliegen, v. F. L. Neher. Verlag F. Bruckmann, München. Preis RM 9.50 Im Plauderton behandelt Verfasser in diesem Buch, unterstützt von ausgezeichneten Zeichnungen von E. v. Saalfeld, 2300 Jahre Fluggeschichte, der Mensch lernt fliegen, der vollendete Flug, Sicherheit, Fliegen und Bestehen, Flug von morgen.
Lehrblätter für die technische Ausbildung in der Luftwaffe. Bd. 1, 3, 4, 5, 6
u. 7. Verlag Bernard & Graefe, Berlin SW 68.
Jeder Band besteht aus losen Blättern, die in einer gediegen ausgeführten Sammelmappe in Taschenformat mit praktischem Schukir-Hefter zusammengehalten werden. Jeder einzelne Band läßt sich beliebig mit der fortschreitenden Entwicklung, indem die einzelnen Blätter nachgeliefert werden, ergänzen. Auch kann man einzelne Blätter, die man vielleicht gerade für eine Bearbeitung braucht, bequem herausnehmen.
Band 1, Abriß der mathematischen und mechanischen Grundbegriffe. Von DipL-Ing. Dr. Adolf E r 1 e n b a c h , RLM. Preis RM 3.85.
Enthält Formel- u. Einheitszeichen, Rechnen mit natürlichen und unbekannten Zahlen, Berechnung und zeichnerische Bestimmung von Flächen, Körperberechnung, Mechanik der festen, flüssigen und luftförmigen Körper, im Anhang-Tabellen und Formeln.
Band 3, Flugzeugkunde. Von Dipl.-Ing. Alb recht Priester Jahn. Preis RM 3.85. Enthält das Wissenswerteste über die Einteilung der Luftfahrzeuge, ferner Einteilung der Motorflugzeuge, Bauweise und Baugruppen der Flugzeuge und eine kurze Beschreibung der bei der Luftwaffe eingeführten Flugzeuge und deren Leistungsangaben.
Band 4, Gerätekunde. Von Dipl.-Ing. Herbert Zacharias, RLM, u. Ing. Erich Otto, Erprobungsst. d. Luftw. Preis RM 4.85.
In kurzer, verständlicher Form sind die heute gebräuchlichsten Geräte beschrieben. Inhalt: Triebwerküberwachungsgeräte, Flugwerküberwachungsgeräte, Flugüberwachungsgeräte, Luftversorgung, Navigationsgeräte, selbsttätige Steuerung, Gerätebrett, Gerätenormen.
Band 5, Triebwerkkunde. Von Dipl.-Ing. Martin Münch. Preis RM 4.85.
Inhalt: Geschichtliche Entwicklung, Aufbau eines Flugmotors, Wirkungsweise, Arbeitsgrundlagen, Hauptteile und Nebenapparate eines Flugmotors, Einteilung der Flugmotoren und die gebräuchlichsten deutschen Flugmotoren.
Band 6, Physik des Fliegens. Von Ing. Artur Z i e g 1 e r. Preis RM 3.85.
Inhalt: Luft in Ruhe, in Bewegung, der Widerstand, Kräfte am Flügel, das ganze Flugzeug — die Flugzeugpolare, Flugleistungen, Flugeigenschaften.
Band 7, Rettungs- und Sicherheitsgerät. Von Flieger-Haupting. Fritz H. Eitz u. Ing. H. L ü t g e n. Preis RM 4.85.
Inhalt: Fallschirm, Fallschirmbegurtung, Sanitätspack, Schlauchboot, Schwimmweste, Anschnallgurt, Stehgurt, Höhenatemgerät, Bordlöscher, Ankergerät, Trinkwasserbehälter.
Gebrauchte
II Maschine
sof. geg. bar gesucht. Ausführl. Angebote mit Angabe d. Preises, der Betriebsstund. der Zelle und d. Motors, Zulassung usw. erbet, unt. 4018 a. d. Exp. d. „Flugsport"
Fl ugzeug*Spann lacke
Marke „Cellemit", liefert seit 1911
Dr. Quittner & Co.
Berlin «Lichtenberg Rittergutstraße 152, Fernr. 612562
INGENIEURSCHULE
III MASCHINENBAU . ELEKTRO 111 TECHNIK : AUTOMOBIL- UND 4 1 I FLUGZEUGBAU.. . * III * *"* PROSPEKT ANFORDERN
WEIMAR;
> E M E STE R B E N N fÄPÄÄ. UNÖ- OKTOBER EIGENE WERKSTTTTEtf '
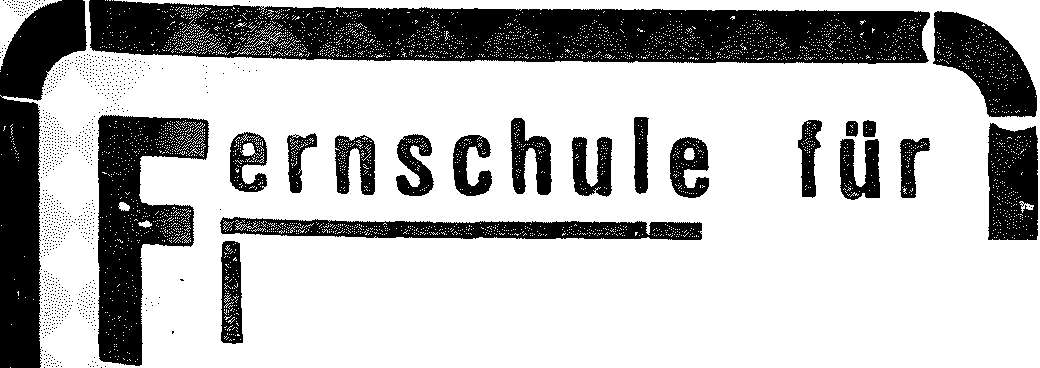
ugzeugbau
Tbeoret. Vorbereitung für Bauprüfer, Flugzeugführer, Ingenieure so^ie für den gesamten Flugdienst. Sonderlehrgängefür Jungflieger. Abschlußprüfungen - Abschlußzeugnisse. Studien-progr. Nr. 14$ durch das Sekretariat.
Fernschule G.m.b.H. BerlinW15
KyrfUrstendamm 66 p.
Zu sofort oder später
Werkstatt-Ingenieur
von R.-Betrieb gesucht. Derselbe muß in der Herstellung von Armaturen u. sonstigen Dreh- etc. Teilen erfahren sein u. Refa-System, Terminplanung, Zeitvorgabe, betriebswirtschaftl. Rechnen, Passungssysteme, Abnahmekontrolle usw. beherrschen, um eine selbständige Abteilung von etwa 50 Köpfen mit Sicherheit führen zu können. Leichtmetall- und Stahlbearbeitung. Nur Bewerber, die eine gleiche oder ähnliche erfolgreiche Tätigkeit einwandfrei nachweisen können, wollen Lebenslauf, Foto u. Zeugnisabschriften senden an
AUrOFLUG, Berlin-Tempelhof, Berliner Str. 167/168
Welches
Lizenz- oder Flugzeugreparaturwerk
interessiert sich für den Bau und spätere Serienfabrikation eines billigen und leistungsfähigen zweisitzigen Kleinflugzeugs?
Gtfi. Anfragen unier Ziffer Nr. 4013 an die Expedition des „Flugsport".
Flugzeugstatiker
mit Erfahrung in der Durchführung von statischen und Festig* keitsrechnungen sowie von Festigkeitsversuchen wird für viel* seitige Tätigkeit im Sonderflugzeugbau gesucht. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften, Angabe des frühesten Eintrittstermines und Gehaltsansprüchen sind zu richten an
Anfon Fiettner G. m. b. H., Flugzeugbau,
Berlin-Johannisthal, Segelfliegerdamm 27
Heft 5/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro X Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Ouellenangabe gestattet.
Nr. 5 1. März 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 15. März 1939
Drei Jahrzehnte Leichtmetall.
Der heutige Stand der Entwicklung des Flugwesens in der ganzen Welt wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht unsere deutschen Chemiker das dazu nötige Leichtmetall geschaffen hätten. Jetzt nach 30 Jahren ist es an der Zeit, dieser Männer, genannt und ungenannt, zu gedenken.
Wie fing es an? 1827 fand Friedrich Wöhler, geboren 31. 7. 1800 zu Frankfurt a. M.-Eschersheim, nach wochenlangem Experimentieren in einem kleinen Laboratorium der städtischen Gewerbeschule in Berlin, auf der Oberfläche seines kleinen Platintiegels ein mattglänzendes graues Pulver. Er hatte zum erstenmal der Tonerde durch chemische Zerlegung ihr Metall entrissen und reines Aluminium hergestellt.
1852 stellte Robert Wilhelm Bunsen in Breslau durch Elektrolyse von geschmolzenem, wasserfreiem MgCL zwei Gramm Magnesiummetall her und legte den Grundstein zum heutigen Erzeugungsverfahren.
Die Einführung der Elektrolyse in die deutsche chemische Großindustrie brachte 1893, unter Ausnützung der Braunkohlenvorkommen, die Errichtung von Anlagen zur elektrolytischen Zersetzung von Kochsalz und Chlorkalium. In Bitterfeld wurde unter dem Namen „Chemische Fabrik Elektron A.-G." eine elektrolytische Anlage errichtet. Bereits 1896 nahm Bitterfeld durch Schmelzflußelektrolyse die Gewinnung von Magnesium als Reduktionsmittel in der Metallurgie der Schwermetalle und als Pulver für pyrotechnische Zwecke auf. 1904 wurde Direktor Pistor in die „Chemische Fabrik Griesheim-Elektron" berufen. 1909 konnte man auf der „IIa" (Internationale Luftschiffahrtausstellung), Frankfurt a. M„ zum erstenmal die neue Magnesiumlegierung ..Elektron" sehen, die im „Preisausschreiben für feste Leichtmetalle" den 1. Preis errang.
1906 machte Alfred Wilm, als Assistent an der Universität Göttingen, wo der große Friedrich Wöhler ein halbes Jahrhundert gewirkt hatte, bei der Kugeldruckprobe die Feststellung, daß ein Versuchsstück aus einer Legierung von Aluminium mit Kupfer und Mangan, dem er winzige Mengen Magnesium zugesetzt hat, über Nacht eine
Diese Nummer enthält Patentsammlung Nr. 3, Band VIII, und Stand der Welt-Rekorde Januar 1939.
ungewöhnlich hohe Festigkeit erreicht hat. Systematisch spürt der Forscher dem Geheimnis nach. Das Metall, das er auf etwa 500 Grad erhitzt und dann in kaltem Wasser abgeschreckt hatte, machte durch einfaches Lagern bei Zimmertemperatur einen Ausreifeprozeß durch, der eine Steigerung der Festigkeitseigenschaften um etwa 50 v. H. bewirkte. Zwei Jahre noch vergehen, bis I)y. Wilm mit aller Sorgfalt -eines deutschen Gelehrten die Vorgänge erforscht hat, unter denen der zauberhafte Prozeß der Veredelung des Aluminiums sich mit mathematischer Genauigkeit vollzieht. Endlich, im Herbst 1908, ist es so weit: Die neue Leichtmetall-Legierung ist patentreif. Die Patentschrift Nr. 244 554 von Alfred Wilm betrifft ein Verfahren zum Veredeln von magnesiumhaltigen Aluminiumlegierungen, patentiert im Deutschen Reiche vom 20. März 1909 ab, ausgegeben am 9. März 1912. Patentanspruch lautet: „Verfahren zum Veredeln von magnesiumhaltigen Aluminiumlegierungen, dadurch gekennzeichnet, daß die Legierungen nach der letzten im Laufe der Verarbeitung vorgenommenen Erhitzung Temperaturen von über 420° ausgesetzt und nach etwaigen leichteren Formgebungen einige Zeit lang selbsttätiger Veredlung überlassen werden."
Wilm, Vater von 6 Kindern, stellte seine bahnbrechende Erfindung dem Vaterland zur Verfügung. Die staatlichen Stellen zeigten jedoch kein Verständnis. Das Metall erhielt den Namen „Duralumin", welcher den Dürener Metallwerken als Warenzeichen geschützt ist. Von da ab begann der Siegeszug. Die Produktion der Leichtmetalle ist seit 1933 ganz bedeutend gesteigert worden. Während 1870 noch 1 kg Magnesium etwa RM 500.— kostete, beträgt heute der Kilopreis für Elektron-Masseln RM 1.50. '■
Die Entwicklung steht nicht still. Wir werden hier noch manche Ueberraschungen erleben. Heute gedenken wir mit Ehrfurcht der deutschen Pioniere, die deutschem Erfindergeist Weltgeltung verschafft haben.
Englisches Hoehleistungssejrel-flugzeug „Petrel".
Eine weitere Neukonstruktion von Slingsby ist ein ein-sitziges Hochleistungssegelflugzeug von geringer Sinkgeschwindigkeit, von dem die erste Ma-* schine an Frank Charles vom ^ Furness Gliding Club, geliefert wurde.
Flügel zweiteilig, Hochdeckerbauweise, leichter Knick. Differentialruder. Leitwerksform nach deutschem Muster.
Spannweite 17,345 m, Länge 7,235 m.
Englisches Hochleistungssegelflugzeug „Petrel".
Zeichnung: Fluesoort
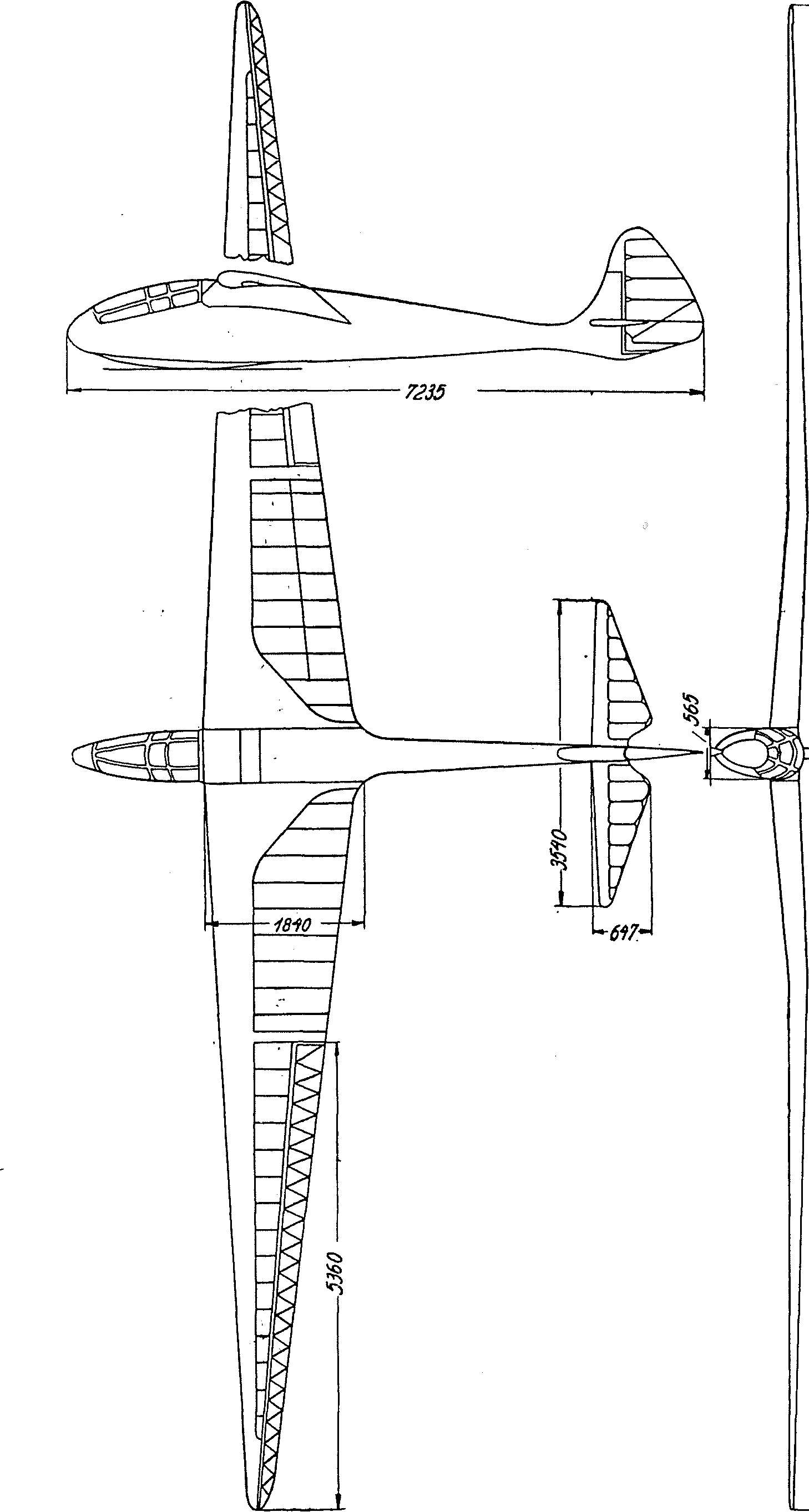
Knight Einblatt-Rotor,
Einblattrotor ohne mechanische Kraftübertragung schlägt der amerik. Prof. Montgomery Knight vor.
Der in der Nähe des Flugzeugschwerpunktes liegende Motor (s. nebenstehende Abb.) treibt einen Kompressor, von dem aus die komprimierte Luft entlang dem Rotor zu einer Strahldüse geführt wird. Die Düse befindet sich am äußersten Ende des Rotors, um ein möglichst großes Rückstoßmoment zu erhalten. Der Rotor ist durch ein Gegengewicht ausgeglichen; kein Drehmomentenausgleich.
Einblattrotor nach Knight. 1 Rückstoßdüse, 2 Drehrichtung, 3 Motor, 4 Kompressor, 5 Gegengewicht, 6 Leitung der komprimierten Luft.
Jugoslaw. Schul-Jagdflugzeug R-IOO.
Die von der Rogojarski AG. Beograd gebaute Jagdschulmaschine ist eine Weiterentwicklung des P. V. T. Abgestrebter Hochdecker, Flügel, Pfeilform, an einem Stahlrohrbaldachin über dem Rumpf angelenkt. Holzbauweise, Querruder Stahlrohr, Höhen- und Seitenleitwerk Holzkonstruktion.
Fahrwerk zwei unter dem Rumpf angelenkte V-Streben. Stoßaufnehmerstreben am Oberteil des Rumpfes abgefangen. Spurweite 2,6 m. Motor Gnome Rhone K-7 von 420/430 PS.
Spannweite 10,20 m, Länge 7,35 m, Fläche 20,56 m2. Leergewicht 1024 kg, Fluggewicht 1326 kg. Max. Geschwindigkeit am Boden 252 km/h, in 700 m 260 km/h, Landegeschwindigkeit 101 km/h. Steigfähigkeit auf 5000 m in 15 min 39 sec, Flugdauer 2V4 Std.
Bestückung ein MG. und,ein Photo-MG.
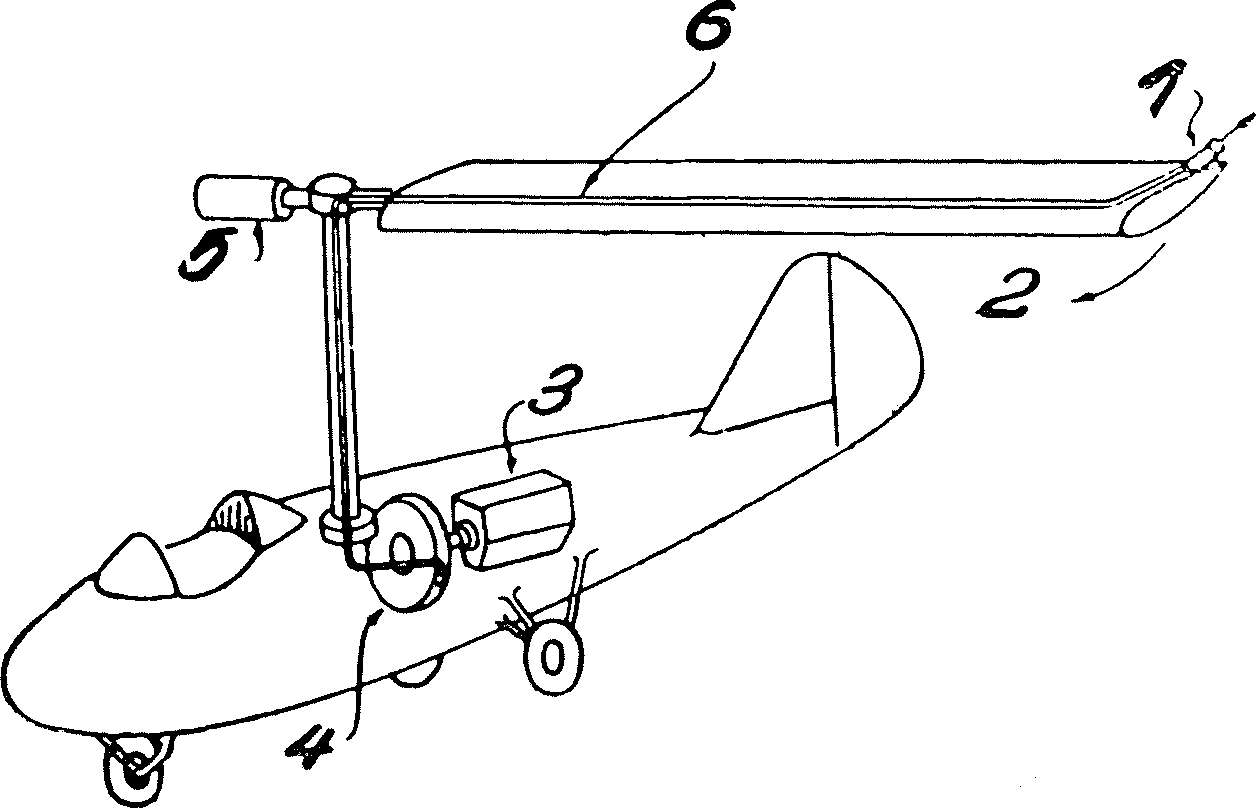
Jugoslaw. Schuljagdflugzeug R-100.
Werkbild
Jugoslaw. Jagdflugzeug Rogojarski I. K.-3.
Der I. K.-3 ist ein Tiefdecker, freitragend, in Gemischtbauweise. Flügel mit fast gerader Vorderkante, zweiholmig, sperrholzbedeckt. Rumpf Stahlrohr. Charakteristisch der Kopfabfluß bis zum Leitwerk. Fahrwerk große Spurweite, Messier Federbeine zurückklappbar. Bestückung ein MK. Hispano-Suiza, Type 404, zwei MG., gesteuert, durch den Propeller feuernd, zwei MG. im Flügel.
Motor Hispano-Suiza 12 Y-29 Kanonenmotor von 910 PS. Luftschraube Hispano-Hamilton Constant Speed.
Spannweite 10.30 m, Fluggewicht 2400 kg. Max. Geschwindigkeit irl 5450 m 527 km/h, am Boden 421 km/h. Steigfähigkeit auf 5000 m in 7 min.
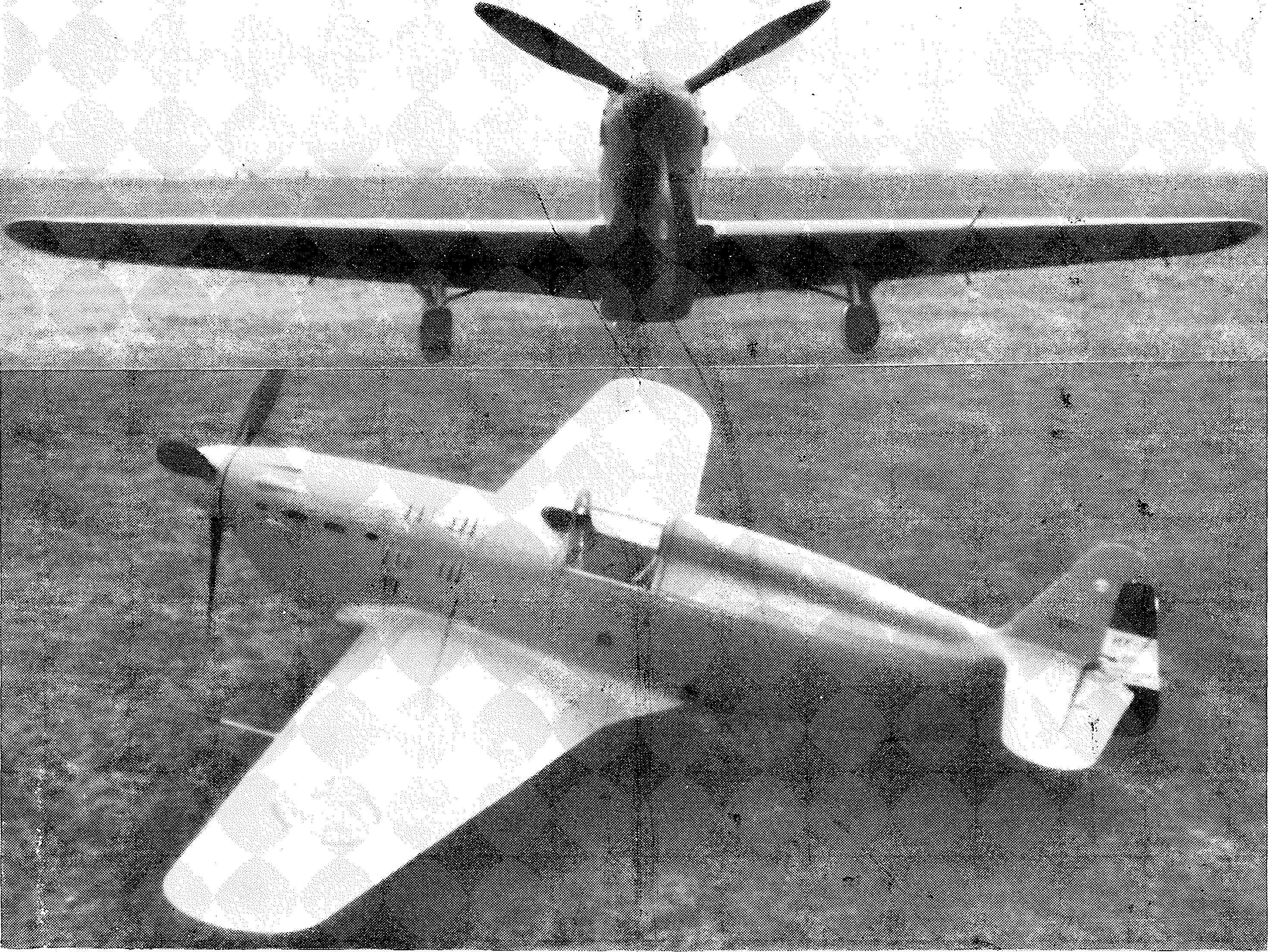
Jugoslaw. Jagdflugzeug Rogojarski I. K.-3. Werkbilder
Curtiss-Wright Jagdflugzeug FW-21 Interceptor.
In der St. Louis Airplane Div: der Curtiss Wright Corp. ist ein neues Jagdflugzeug CW-21 fertig geworden und in den Serienbau gegangen. Dieser Ganzmetall-Tiefdecker ist erkenntlich an der unter dem Flügel befindlichen Fahrwerksverkleidung und den nach dem Höhen-und Seitenleitwerk sich stark verjüngenden Rumpf.
Flügel Dural-Konstruktion dreiteilig. Flügelspitzen sind abnehmbar und können leicht ausgewechselt werden. In der Mitte geteilte Spreizklappen, die vom Führersitz mittels Kettenübertragung betätigt werden. Querruder aerodynamisch und statisch ausgeglichen.
Rumpf Schalenbauweise, mit, Ringspanten und Längsprofilen innenversteift. Hinter dem Führersitz ein verstärkter Spant zum Schutz bei Ueberschlag. Der obere Teil dieses Ueberschlagspantes ist mit Panzerblech 7 mm bewrehrt, bei einzelnen Maschinen der ganze Schott, ebenso die Unterseite des Sitzes.
Fahrwerk hydraulisch hochziehbar, wobei sich die beiden Verkleidungsschalen automatisch schließen. Hydraulische Räder, Typ Goodyear 7,50X10.
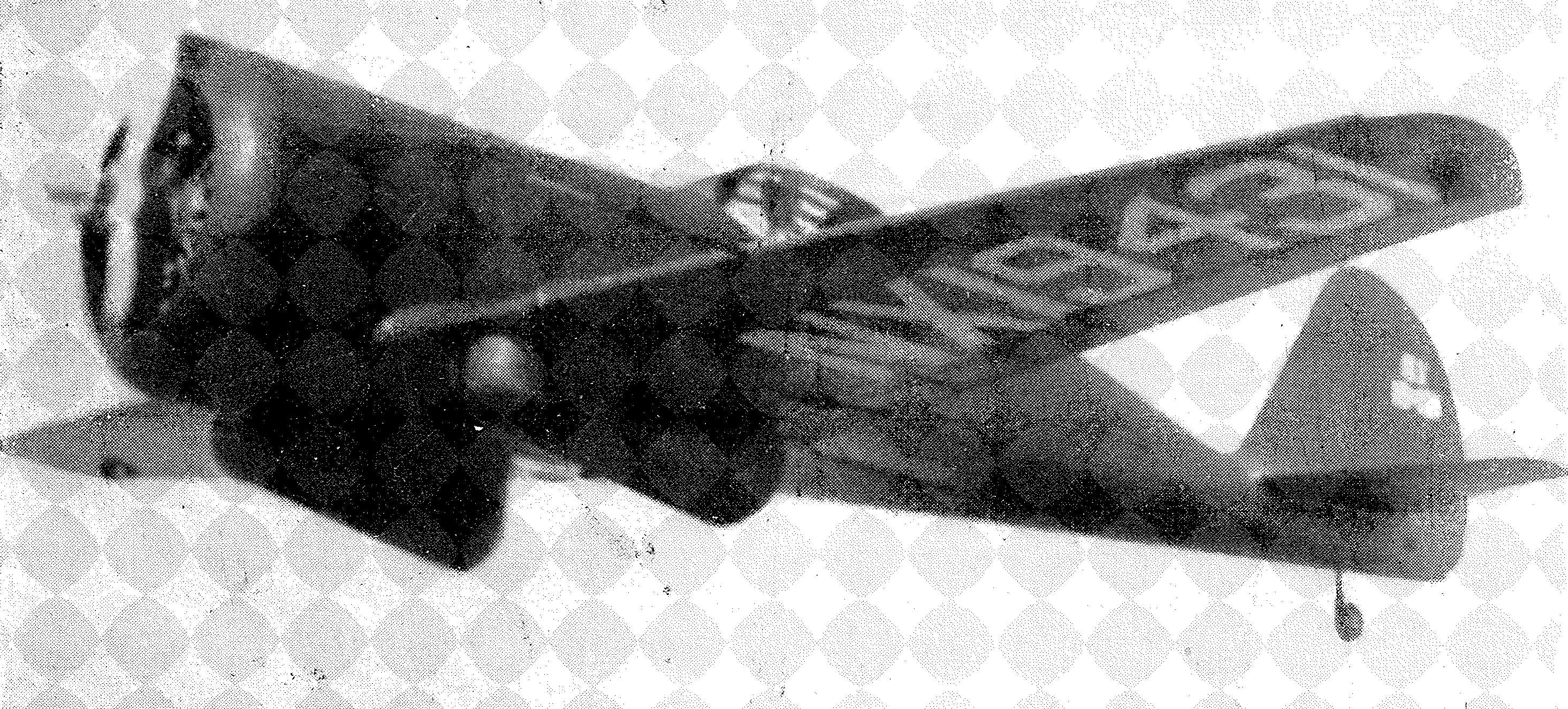
USA-Curtiss-Jagdflugzeug, wie es für Frankreich geliefert wurde. Geschwindigkeit 500 km/h, steigt auf 1500 m in 64 Sekunden. Größte Sturzgeschwindigkeit 925 km/h. Das hochziehbare Fahrwerk verschwindet in den unter dem Flügel
erkennbaren Verkleidungen. Archiv Flugsport
Schwanzrad 8 Zoll in einer steuerbaren Qabel gelagert. Höhenleitwerksflossen fest. Höhenruder dynamisch ausgeglichen mit vom Führersitz zu betätigenden steuerbaren Trimmklappen.
Motor Wright Cyclone R 1820-G5 mit zweistufigem Kompressor, Vergaser Chandler Qroves. 760 PS in 4600 m, 860 PS in 1800 m Höhe. Startleistung 1000 PS. Schraube Dreiblatt Hamilton-Standard mit konstanter Steigung und 2,7 m Durchmesser. Die Motorverkleidung ist nach beiden Seiten nach oben aufklappbar. Kraftstoffbehälter 2mal 154 1 im Flügelmittelteil, Zusatzbehälter je 60 1 in den Flügelwurzeln.
Zwei MG., gesteuert, durch den Propeller schießend. Ein Colt-Browning-MG. 30 Cal. (7,6 mm) 500 Schuß und ein Colt-Browning 50 Cal. (12,7 mm) mit 200 Schuß.
Spannweite 10,6 m, Länge 8,1 m, Höhe 2,93 m. Leergewicht 1360 kg, Fluggewicht 1830 kg, Lastvielfaches 10. Höchstgeschwindigkeit in 5100 m 480 km/h, in 2300 m 462 km/h, in Meereshöhe 430 km/h. Landegeschwindigkeit
110 km/h. Steiggeschwindigkeit mit Startleistung löSOm/min, Steigzeit auf 6000 m in 6 min. Dienstgipfelhöhe 10 760 m. Reichweite bei
Reisegeschwindigkeit (600 PS) 950 km. Startlänge 175 m.
USA-Curtiss-Wright-Jagdflugzeug CW-21.
Zeichnunjr: Flugsport
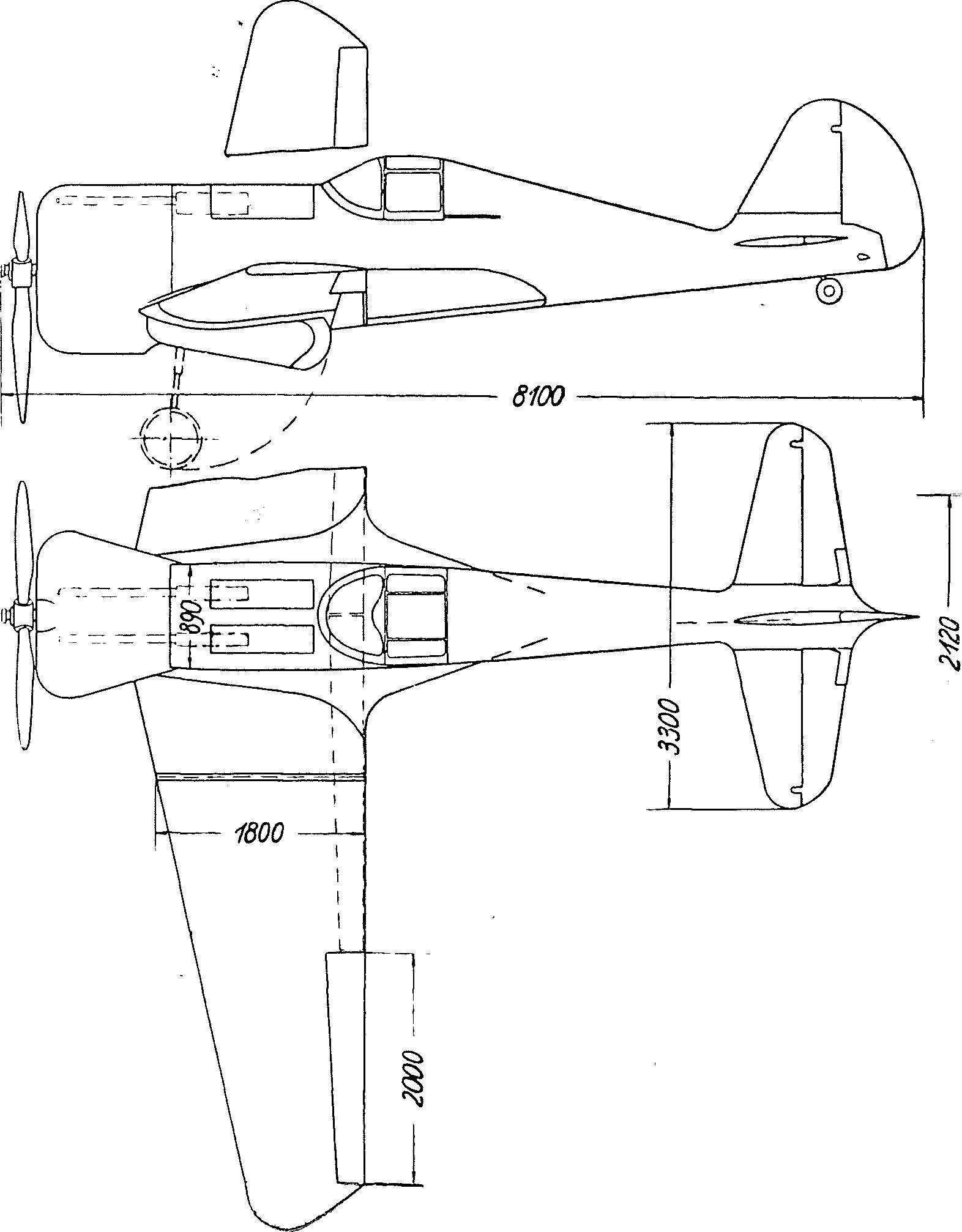
Curtiss P 36, wie sie nach Frankreich aus der USA-Bestellung geliefert wurden.
Belg. S. A. B. C. A.-S. 47, Mehrzweckeflugzeug.
Dieses von der belgischen Firma S. A. Beige de Constructions Aeronautiques, Brüssel, hergestellte Muster haben wir bereits anläßlich des Pariser Salons (s. „Flugsport" 1938, S. 678) kurz angeführt. Der freitragende Tiefdecker kann als Jagdflugzeug, Tiefaufklärer, leichter Bomber und als Fernaufklärer eingesetzt werden; 2 Mann Besatzung.
Flügel 2teilig, trapezförmig, Holzbauweise, Hauptholm und Sperrholznase, Endrippen sperrholzbeplankt. Spreizklappen zwischen Querruder und Rumpf. 2 starre MG. am Schraubenkreis vorbeifeuernd; 10 Bomben zu je 10 kg.
Rumpf geschweißte Stahlrohre, glattblechverkleidet. Verkleidete Besatzungsräume, Führerraumüberdachung nach vorn verschiebbar. Hinter dem Führer 2 Betriebsstoffbehälter, Bombengehänge (2 Bomben zu je 50 kg), FT-Gerät, Sauerstoffgerät, Bildkammer. (Beachte auch nebenstehenden Armierungsplan.) Außerdem bewegliches einfahrbares MG. in Rumpfober- und -Unterseite hinter Flügelhinterkante.
Leitwerk freitragend, sperrholzbeplankt mit Stoffüberzug. Trimmklappen an Seiten- und Höhenruder.
Fahrwerk freitragend, 2-teilig; hydraulisch oder mechanisch nach hinten in den Flügel einziehbar; Schwenkung der einziehbaren Federbeine um 90° (s. a. nebenstehende Schemaskizze). Gabelspornrad schwenkbar, einziehbar.
Triebwerk: Hispano Suiza flüssigkeitsgekühlter 12-Zyl.-V-Motor 12 Ycrs, 835 PS in 4200 m; dreiflügelige Hispano-Suiza-Hamilton-Me-tallverstelluftschraube gleichbleibender Drehzahl; 500 kg Kraftstoff.
stoffbehälter, FT-Gerät. Hinterer Gefechtsstand mit Sichtausschnitten.
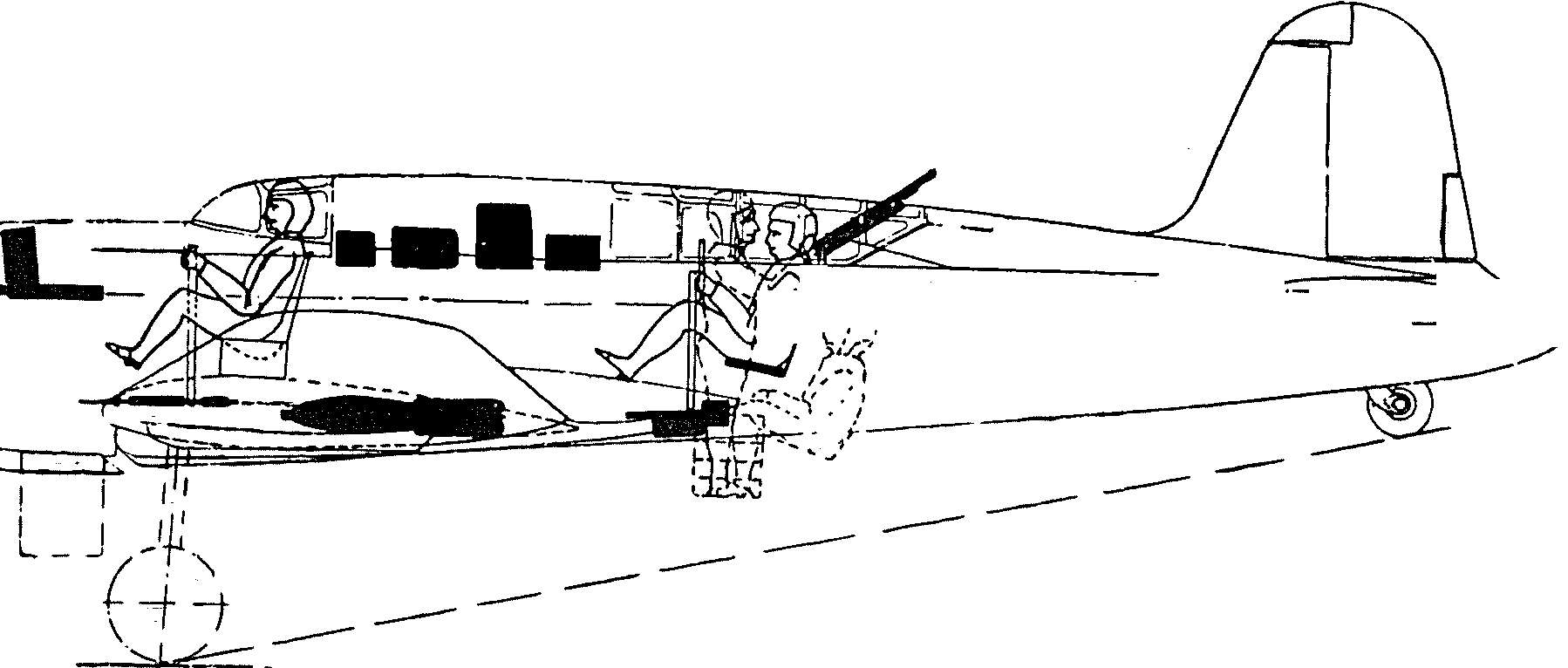
Armierungsschema der S. A. B. C. A.-S. 47 mit Hispano - Suiza Kanonenmotor 12 Ycrs. Vorne Flug-
ytt::-,--—---f=EEE=^Er} zeugkanone durch die hohle
Luftschraubenwelle feuernd, je ein starres MG. rechts und links vom Rumpf im Flügel, dahinter Rumpfbombengehänge, dann 2 Kraft-
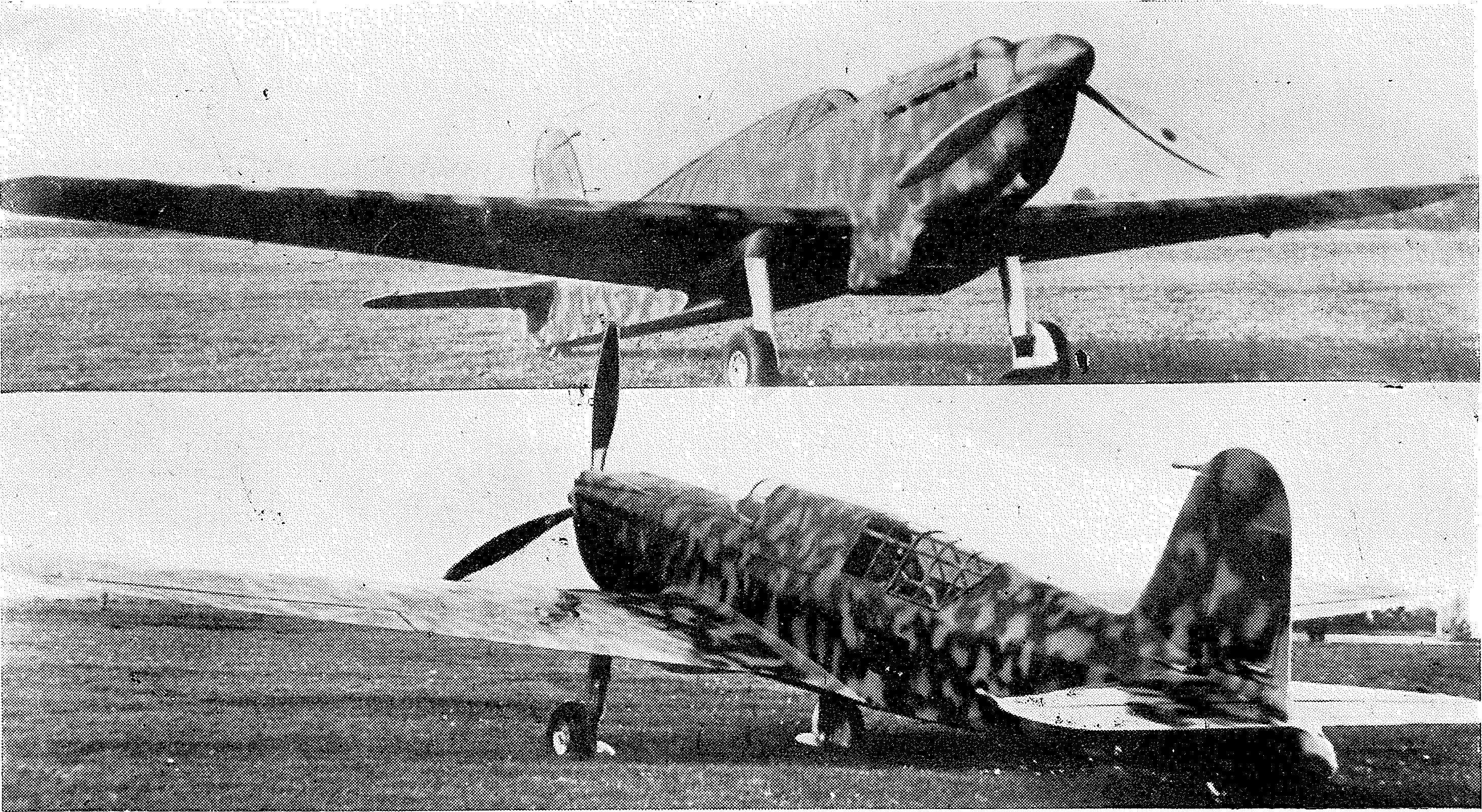
S. A. B. C. A.-S. 47. Mehrzweckeflugzeug. Werkbilder
Flugzeugkanone (20 mm) zwischen den Zylindern durch die hohle Luftschraubennabe feuernd.
Spannweite 13,2 m, Länge 10,61 m, Höhe 3,2 m; Spurweite 2,61 m. Fläche 23,8 m2, mittlere Flügeltiefe 1,8 m, Flügelstreckung 7,3. Höhenleitwerksfläche 3,49 m2, Seitenleitwerksfläche 1,66 m2. V-Form-Winkel 5°, Flügelansteliwinkel + 0°30', Pfeilformwinkel 11°40\
Höchstgeschw. am Boden 390 km/h, in 4000 m 480 km/h, Lande-geschw. 115 km/h. Startstrecke 300 m, Auslauf 300 m.
Jagdflugzeug: Leergew. 2100 kg, Zuladung 725 kg, Fluggew. 2825 kg; Flächenbelastung 119 kg/m2, Leistungsbelastung 3,28- kg/PS, Flächenleistung 36,2 PS/m2. Steigzeit auf 2000 m 3 min 20 sec, auf 4000 m 6 min 40 sec, auf 6000 m 11 min 40 sec. Dienstgipfelhöhe 10 500 m. Flugdauer 2 Std.
Leichter Bomber: Leergew. 2100 kg, Last 1100 kg, Flqggew.
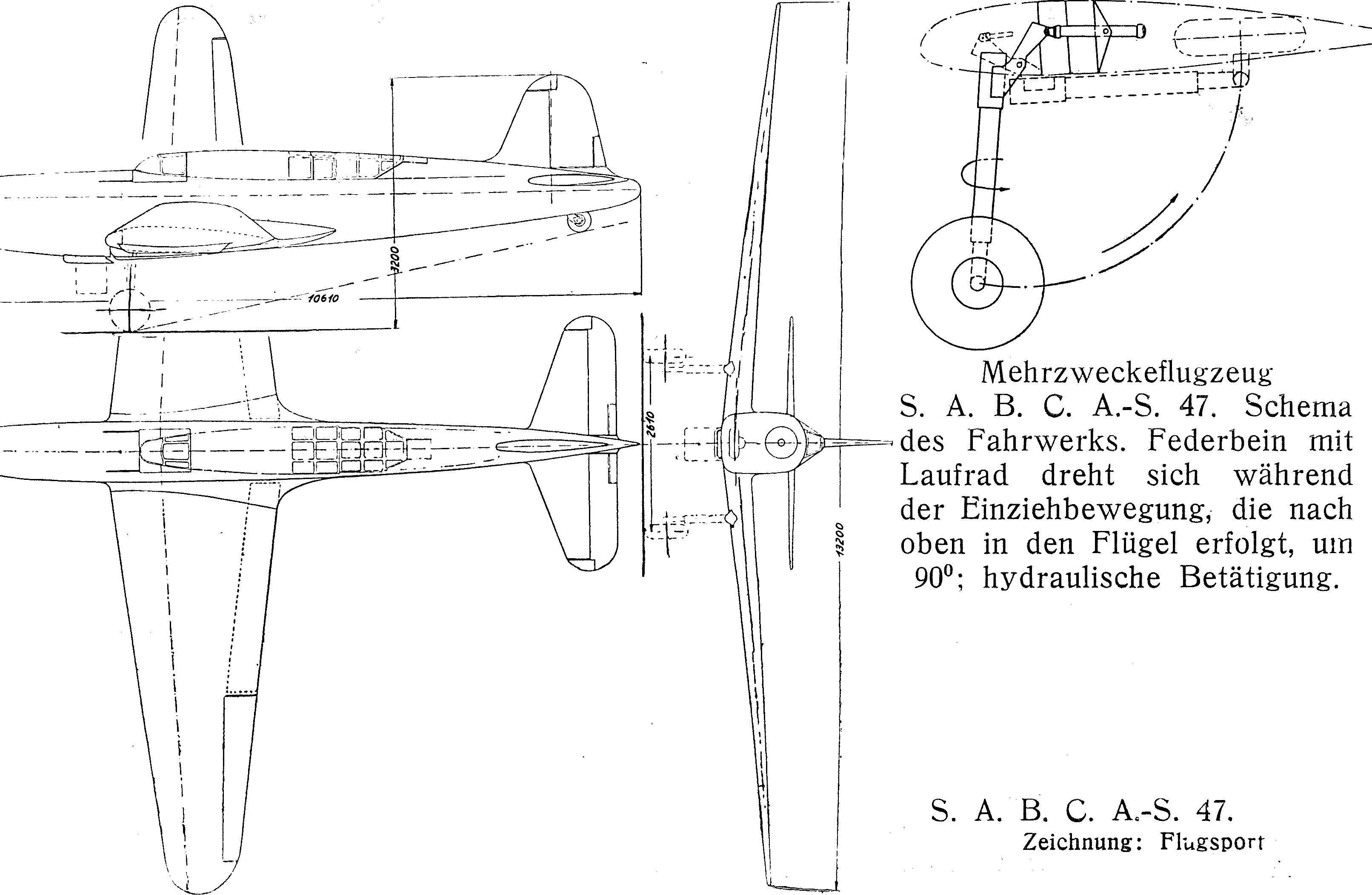
3200 kg, Flächenleistung 36,2 PS/m2, Leistungsbelastung 3,72 kg/PS, Flächenbelastung 134,5 kg/m2. Steigzeit auf 2000 m 4 min, auf 4000 m 8 min, auf 6000 m 14 min. Dienstgipfelhöhe 9500 m.
USA Boeing YB-17 A Höhenflugzeug.
Der Boeing YB-17 A gleicht in seiner äußeren Form dem Boeing YB-17, hat besondere Ausrüstung für Höhenflüge erhalten. Die Motoren besitzen einen besonderen Vorverdichter, der die Ansaugluft auf konstantem Druck, Seehöhe, hält. Vor Eintritt in den Vergaser wird die Luft auf Normaltemperatur gekühlt. Die Maximal-Motorleistung bleibt daher in allen Höhenlagen konstant.
Vier Motoren Wright G Cyclone. Spannweite 31,2 m, Länge 21 m, Höhe 4,5 m. Gewicht 22 t.
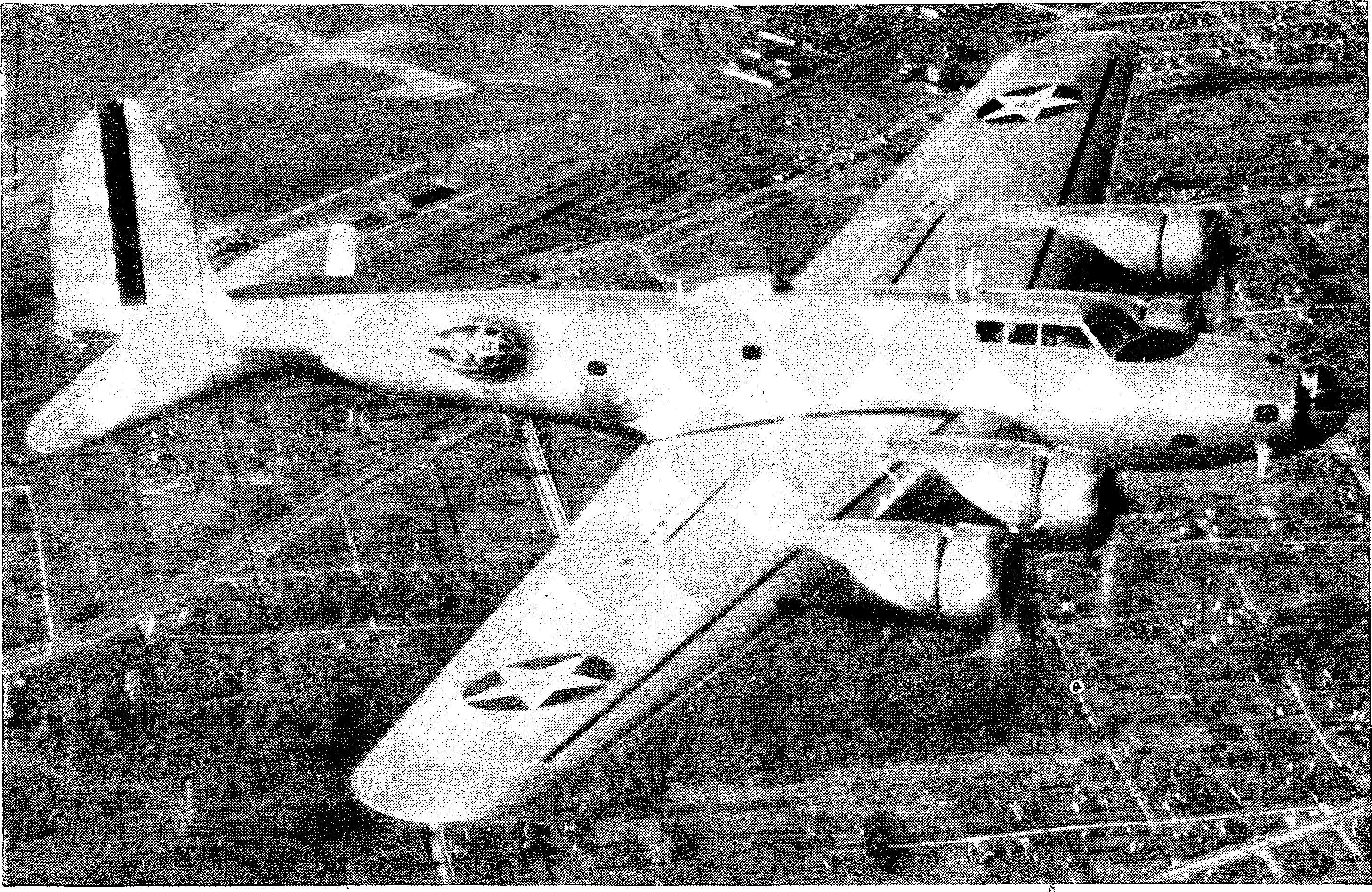
Boeing Höhenflugzeug YB-17 A. Werkbild
7 bis 9 Mann Besatzung. Kommandant, zwei Flugzeugführer. Beobachter, Motorenwart, Bombenwerfer, Funker und MG.-Schützen. Bewaffnung fünf MG.
Flugfähigkeit ohne Höhenverlust noch mit zwei Motoren.
Höhen-Atlantikflugzeug „Centre" 2234 mit luftdichter Kabine.
Auf dem letzten Pariser Salon war auf dem Stand des Luft-Ministeriums ein viermotoriges Landflugzeug „Centre" 2234 für den Nordatlantik-Flugverkehr, für Flüge in 8000 m Höhe, ausgestellt. Dieses Flugzeug ist aus dem älteren Farmantyp 223 über den ,,Centre" 223 entwickelt worden.
Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem „Centre" 2234 und dem Centre 223 sind folgende: Entfernung^der Betriebsstoffbehälter aus den Flügeln.
V-Form-Stellung der Flügel. Schlankere Rumpfnase, da der Raum für die Bomben-Zieleinrichtungen weggefallen ist.
Unterbringung der acht Betriebsstoffbehälter in dem unteren Rumpfteil an einem besonderen Träger. Vier Zusatzbetriebsstoffbehälter sind im Innern des Rumpfes untergebracht.
Die Wand der luftdichten Kabine besteht aus einer äußeren Metallbedeckung und einer inneren Gummistoffauflage zum Ablauf des Kondenswassers.
Es ist vorgesehen, die Kabine in großen Höhen bis auf 15° zu beheizen und ganz mit Sauerstoff zu beschicken, so daß die Besatzung ohne weiteres 5 Std. in 8000 m Höhe bei —50° arbeiten kann. Zu den wichtigsten Geräten gehört ein Luftanalysen-Anzeiger, der jederzeit angibt, ob das Verhältnis Sauerstoff und Stickstoff die Grenzwerte noch nicht überschritten hat; ferner ein besonderer Sauerstoffanzeiger. Zu starke Kohlenstoffanreicherung und Kondenswasser wird auf chemischem Wege gebunden.
Die Sauerstofflieferung aus einer Batterie von Sauerstoffflaschen, welche für eine Ueberquerung ausreicht. Sauerstoffabgabe wird proportional der Höhe geändert. Sauerstoffanreicherung 50%, Gemischluftzufuhr pro Mann Besatzung 80 1/h. Für die Vornahme astronomischer Messungen und zur Ueberwachung der hinten liegenden Be-triebsstoffbehälter ist es notwendig, die luftdichte Kabine verlassen zu können. Hierfür ist am hinteren Teil eine besondere Schleusenkammer vorgesehen. Die Mannschaft muß hierbei vorher eine vorgewärmte Kombination und ebenso die nötigen Sauerstoffatmungsgeräte sowie Höhenatemmaske anlegen. Während des Aufenthalts außerhalb der Kabine muß diese in telefonischer Verbindung mit der Zentrale bleiben.
Vier Motoren Hispano-Suiza 12 Ydrs, 860 PS in 3400 m Höhe, je zwei hintereinander, mit Zug- und Druckschraube.
Fahrwerk hochziehbar in die Motorengondeln.
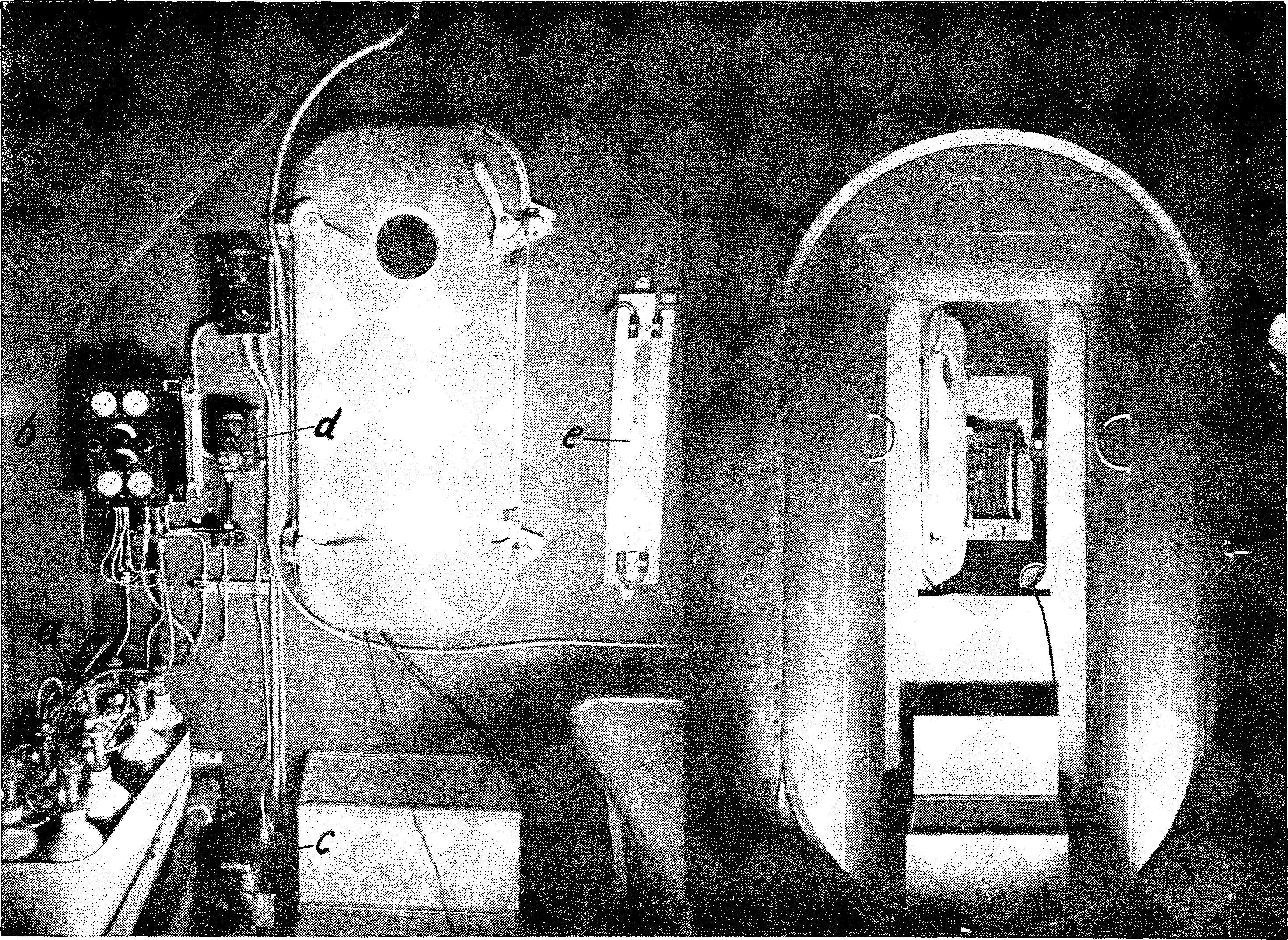
Links: Hinterer Teil der luftdichten Kabine des Centre 2234. Links unten: Preß-Sauerstoffflaschen a. Oben links: b Sauerstoffverteiler, c Bronslavia-Mischer, d Telefon zur Verständigung mit der Besatzung außerhalb der Kabine, e Wassermanometer zeigt die Differenz von Innen- und Außendruck. Man beachte den inneren Qummistoffbelag der Kabine, welcher auch mit einem gewissen Abstand von seiner Unterlage abgelegt sein muß, um die Kondensation zu verringern. Fenster und Schotten müssen möglichst mit Rücksicht auf die Verdichtung klein gehalten sein. Rechts: Blick durch die Schotten nach hinten. Werkbild
Betriebsstoffbehälter mit Schnellentleerungsvorrichtung. Vordere linke Behälter speisen den vorderen linken Motor, hintere linke Behälter den hinteren linken Motor. Entsprechend auch auf der anderen Seite. Umschaltungsventile für anders geartete Speisung vorgesehen. Luftkompressor zur Speisung der luftdichten Kabine. Zwei Zylinder gegenüberliegend in den Achsen seitlich gegeneinander versetzt. 75 mm Bohrung und 70 mm Hub. 800 U/min. Einlaßventil gesteuert, Druckventile automatisch. Kompressorantrieb auf die Kurbelwelle zwischengelagerte Kupplung. Kurbelwelle 180 gekröpft, zweimal gelagert in Elektrongehäuse. Zylinderbefestigung durch vier Stehbolzen. Elektronkolben mit 3 Ringen.
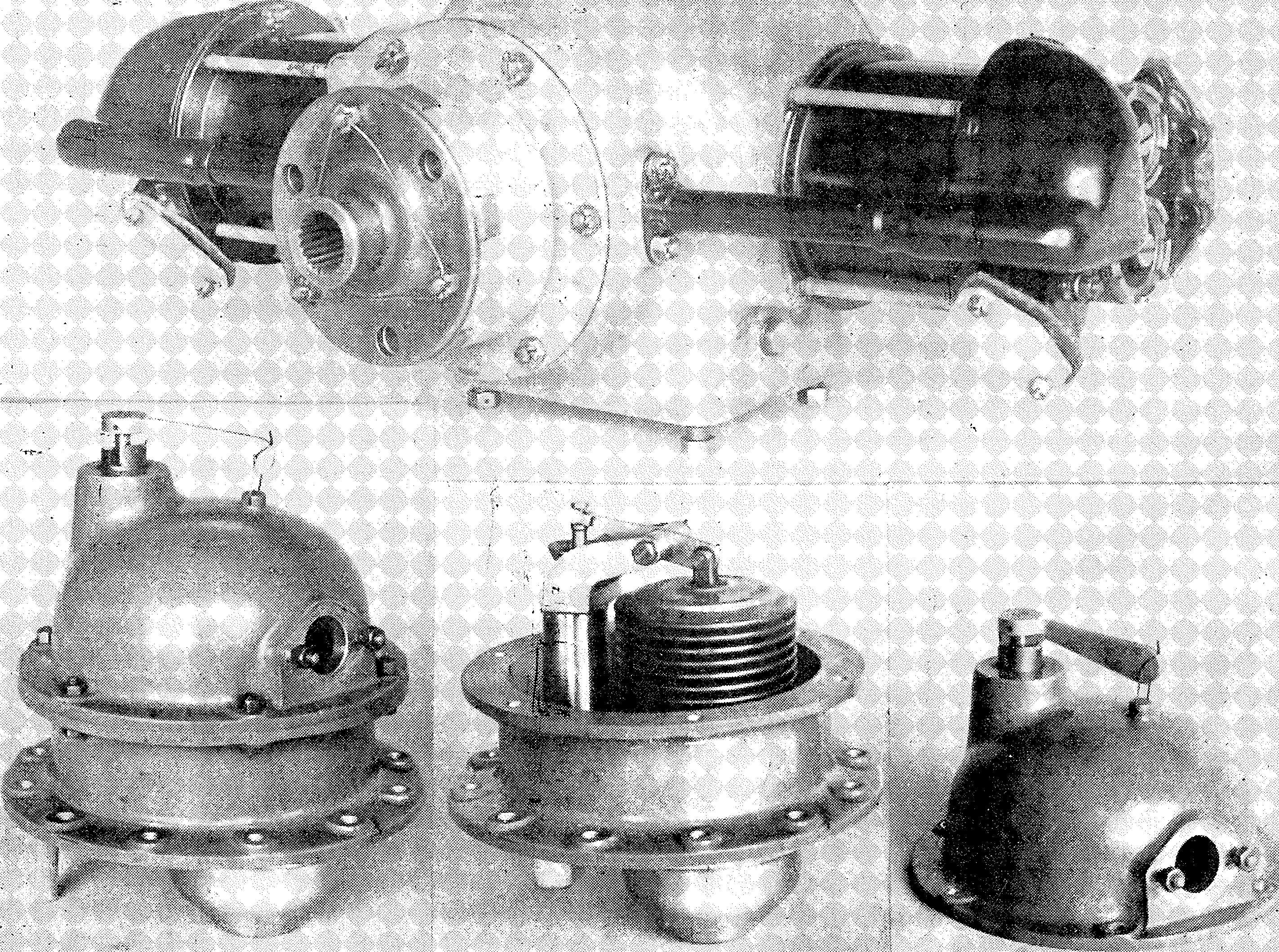
Oben: Luftkompressor des Centre 2234.
Werkbilder
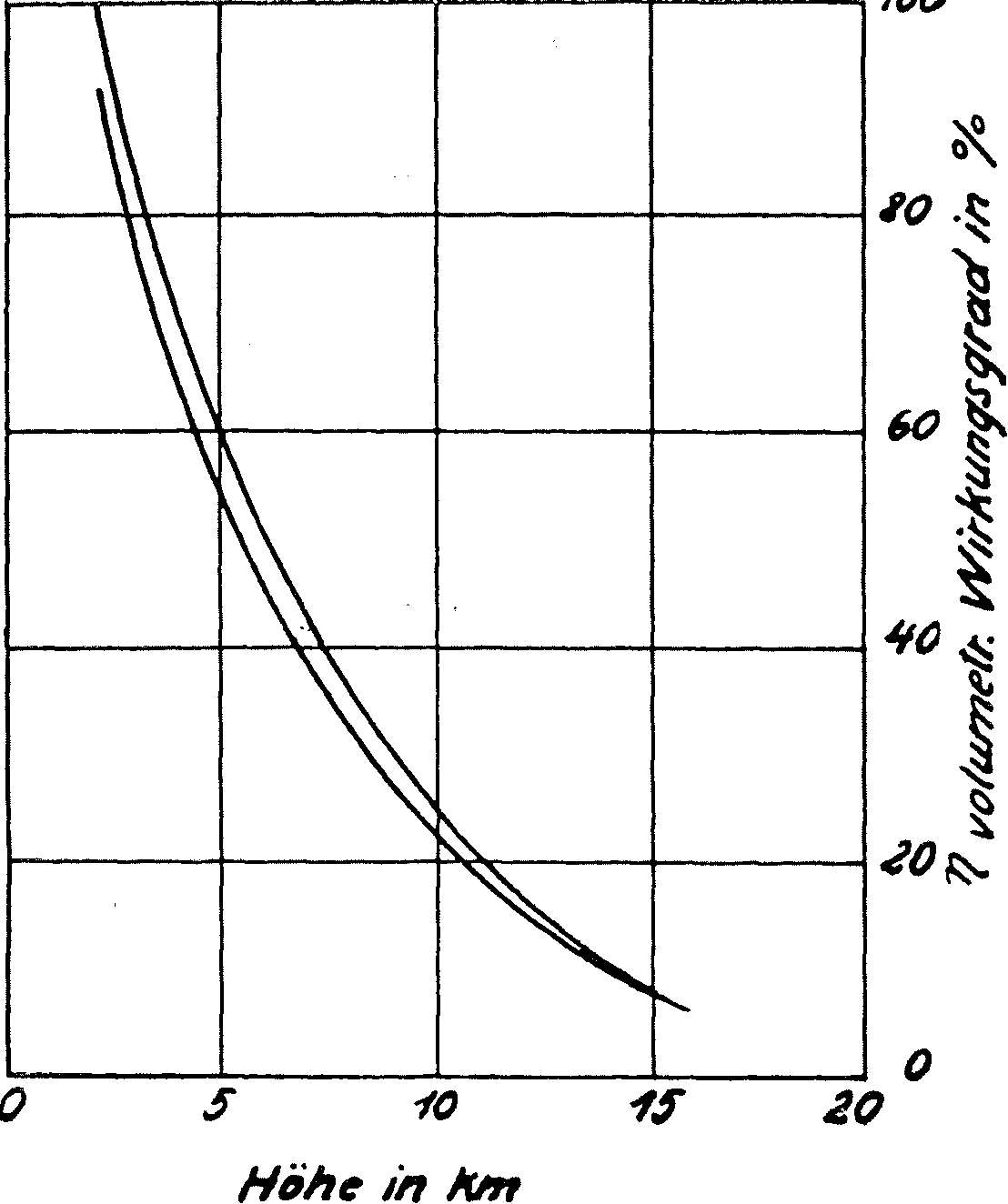
Unten: Automatisches Luftregulierventil für die luftdichte Kammer des Centre 2234. Links geschlossen* in der Mitte abgenommener Deckel. Man erkennt die manometrische Kapsel, welche sich ausdehnt, wenn der Luftdruck sinkt. Wenn der Druck steigt, zieht sich die Kapsel zusammen und stellt eine Verbindung der inneren Kabine mit der Außenlufi her. Das Ventil kann bei Unfällen auf seinem Sitz blockiert werden.
Links: Kompressorleistungskurven der Luftdruckanlage des Centre 2234.
Zeichnung: Flugsport
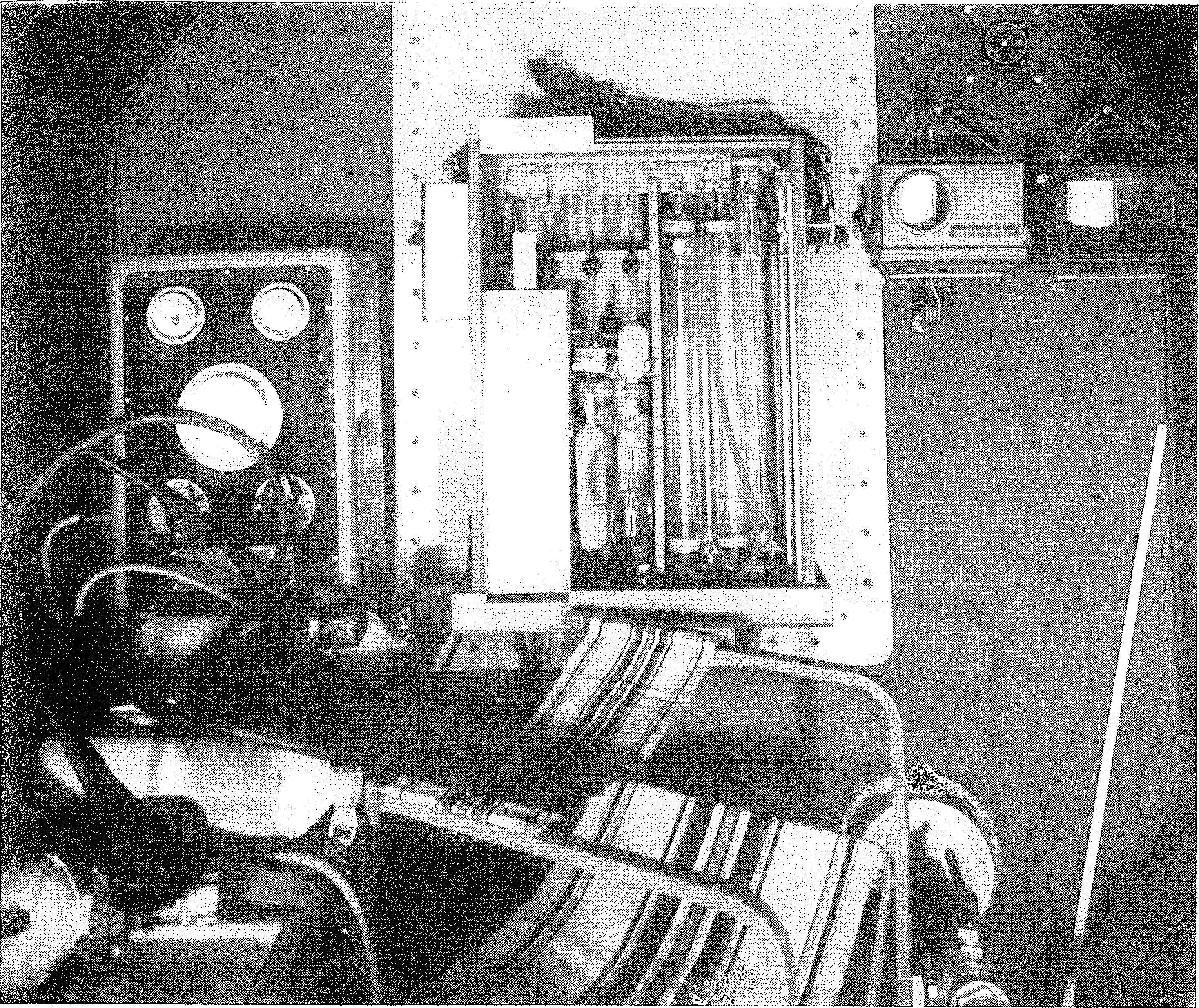
Oben: Kabinenteil des Centre 2234 mit Luftprüf gerät. Werkbild
Unten: Uebersicht d. Kabine des Centre 2234.1. schwenkbarer Scheinwerfer, 2. Abtriftanzeiger, 3. Sauerstoffanzeiger, 4. Luftanalysator zur Bestimmung des Luftzustandes in der Kabine, 5. Zentralstelle zur Ueberwachung der Sauerstoffzufuhr, 6. Kohlenstoffabsorber, 7. Sauerstoffluft-Misch- und -Vorwärmung, 8. Kabinenheizung, 9. tragbarer Höhenatmer zur Reserve, falls die Kabinenanlage versagt, und für Mannschaften, die außerhalb der Druckkabine gehen, 10. Sauerstoffflaschen, 11. Luftschleuse für den Verkehr mit der Außenluft, 12. Steckanschlüsse für Sauerstoff, Warmluft und Telefon, 13. Verschwind-Beobachtungslaterne für astronomische Messungen. Im Grundriß sieht man bei i die Hilfsspeisung für
Betriebsstoff, Wasser und Oel. Zeichnung: L'Aeronautique
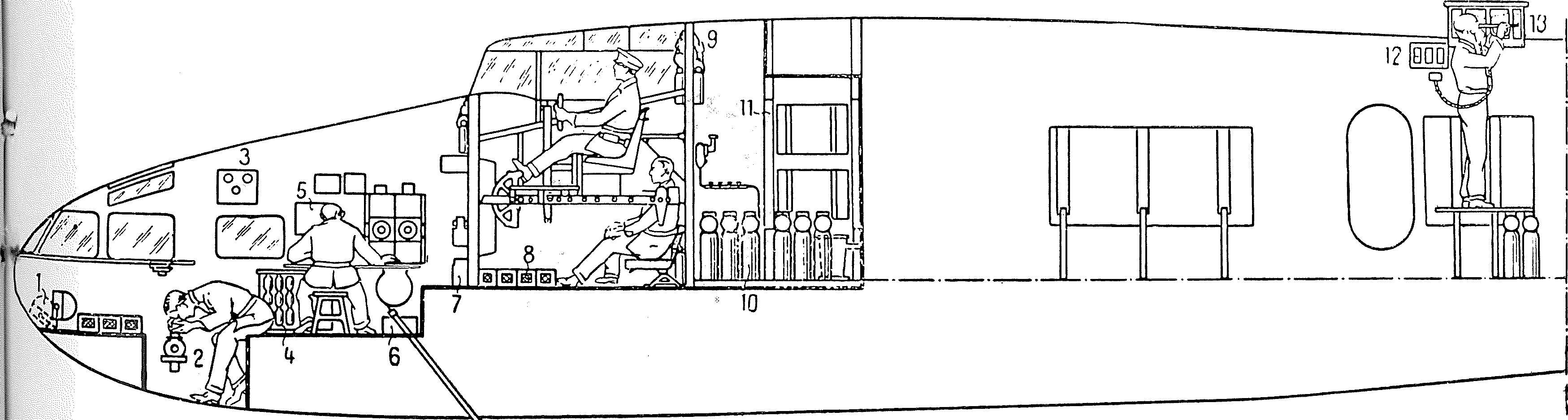
Kühlwasserwechsel während des Fluges aus besonderen Vorratsbehältern, unter dem Rumpf liegend. 0elnachf üllmöglichkeit sämtlicher Oelkühler, auch einzeln während des Fluges, wenn irgendein Motor zu viel Oel braucht.
Zur Sonderausrüstung gehören alle Geräte für Tag- und Nachtflug, Funkanlage für mittlere und lange Wellen, Feuerlöschgeräte, je ein Fallschirm, Schwimmgürtel, zwei Schlauchboote L. M. T., aufblasbar mit im Boot befindlicher Druckluftflasche.
Heizung und Beleuchtung durch zwei Stromerzeuger, angetrieben von den beiden vorderen Motoren.
Automatische Steuerung Jaeger-Smith.
Enteiser an der Vorderkante von Flügeln und Leitwerksteilen und an den Schrauben.
Bei Versuchen mit der luftdichten Kammer konnte sich das Flugzeug 4 Std. in 8000 m Höhe halten.
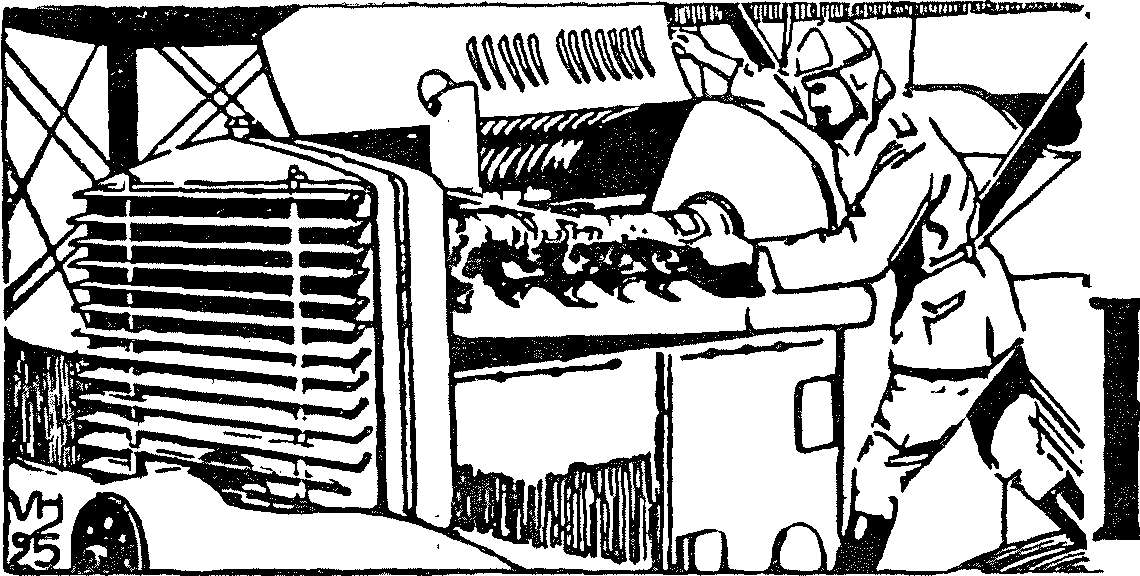
KONSTRUKTION INZELHEITEH
Forderimg im Flugzeugfahrwerksbau
an Federbeine und Räder: Sicherheit, einfache Austauschbarkeit und hormgerechte Ausführung, billige Herstellungspreise, geringes Gewicht, lange Lebensdauer, bei Flugzeugrädern und Bremsen speziell Dauerfestigkeit, hohe Bremsleistung und Wärmekapazität, beim-Feder-
ll
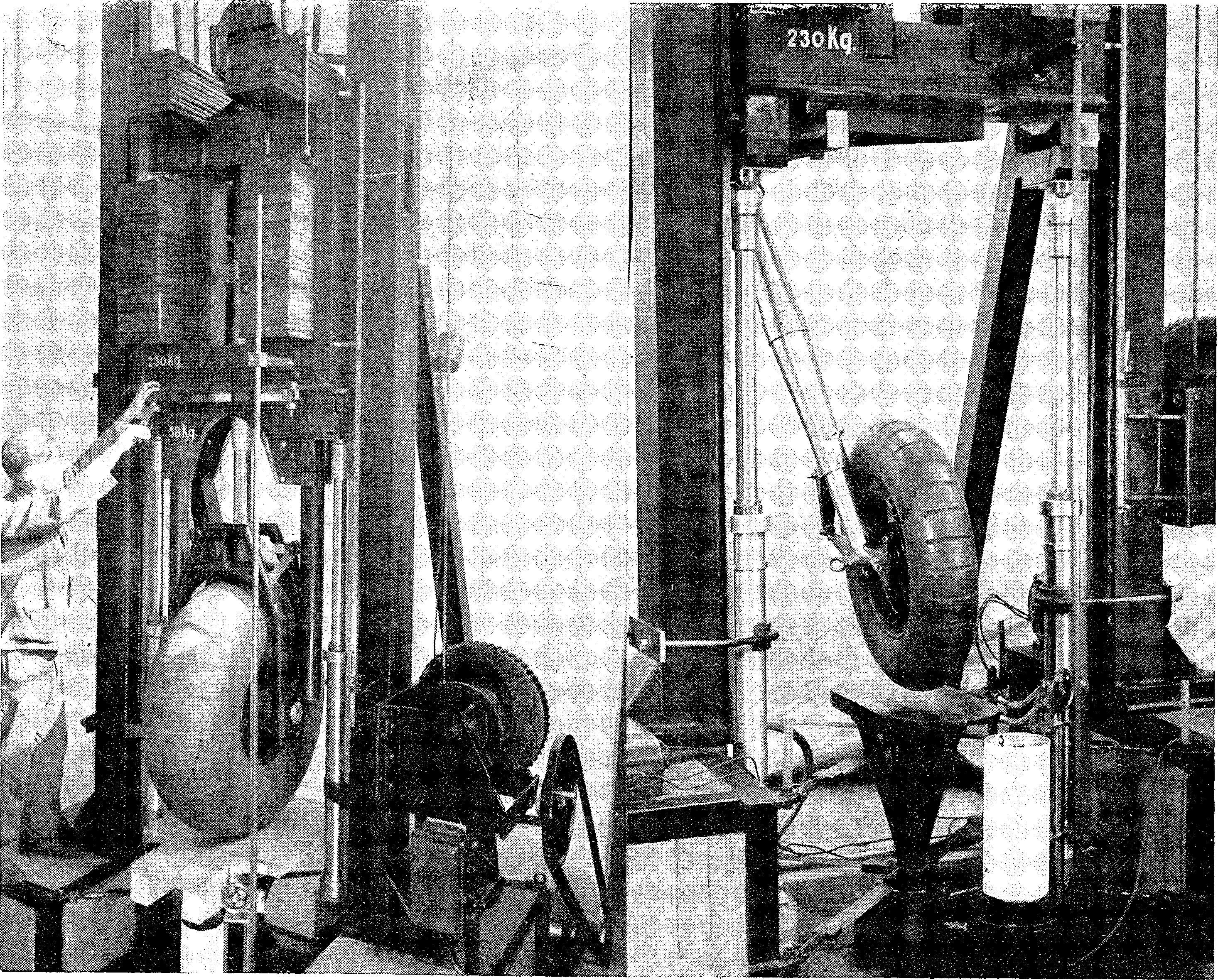
Abb. 2 u. 3 EC-Prüf stände.
Werkbild
bein hoher Völligkeitsgrad und gute Dämpfung. Haupterfordernis ist hierbei noch weiter, die Wartung der Geräte auf ein Minimum zu beschränken.
Daher hat das Schraubenfederbein mit Oeldämpfung, welches nur geringe Wartung bei höchster Arbeitsaufnahme verlangt, zunehmende Verwendung gefunden. Abb. 1 zeigt ein solchesEC-Schraubenfeder-Ein-beinfahrwerk. Der Landestoß des Flugzeuges wird durch die Schraubenfeder 2 aufgenommen. Um das Gewicht der Feder möglichst gering zu halten, tritt gleichzeitig eine neuartige Oelringraum - Dämpfung in Tätigkeit. Der Dämpfungskolben erzeugt je nach der auftretenden Sinkgeschwindigkeit in dem ölge-füllten Ringraum entsprechende Drosselkräfte. Dadurch erhält man eine wesentlich höhere Arbeitsaufnahme als bei einer einfachen Schrauben- oder Ringfeder. Die Rückgangsdämpfung wird durch den gleichen Kolben in umgekehrter Richtung erzeugt.
Die Abb. 2 und 3 zeigen solche Federbeine in e'nem Fallhammer auf dem EC-Prüffeld, auf dem sämtliche Prototypen erprobt werden. Abb. 4 zeigt ein aufgenommenes Federungsdiagramm eines EC-Schraubenfederbeines mit Oeldämpfung. Die hohe Völligkeit dieser Konstruktion (Verhältnis der gestrichelten Fläche zur Gesamt-Rechteck-Fläche), Abb, 5, ist ohne weiteres zu ersehen, auf Wunsch bis zu 85%, Besonders günstig liegen auch die Dämpfungsverhält-
1 Zylinder .
2 Schraubenfeder
3 obere Packung
4 Öleiniüllöffnimg
5 Distanzhülse
6 Kolbenstange
7 u. 7a Brcnzering
8 Drosselring
9 untere Packung
10 Stopf buchsmuftex
11 oberer Lenker
12 unterer Lenker
13 Ledermanscheita
14 Achsschenkel
15 Anlaufring,
16 Verschraubung
17 Laufrad
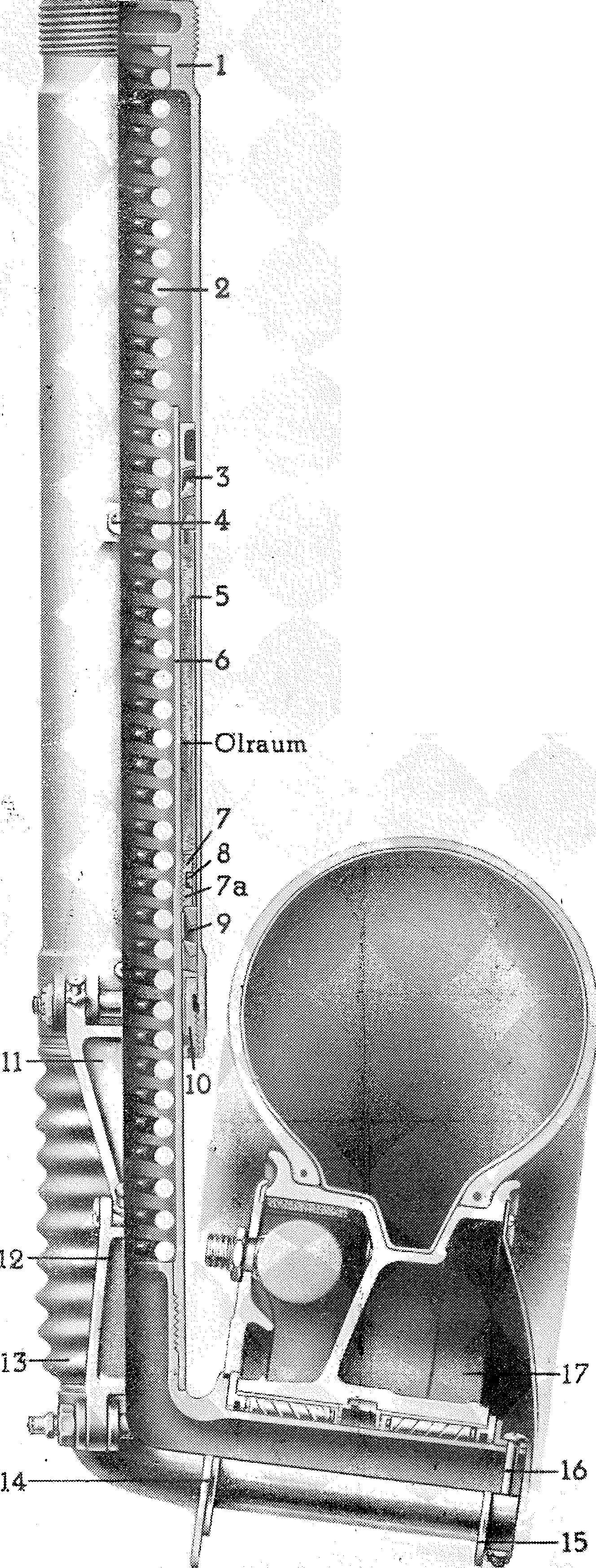
Abb. 1.
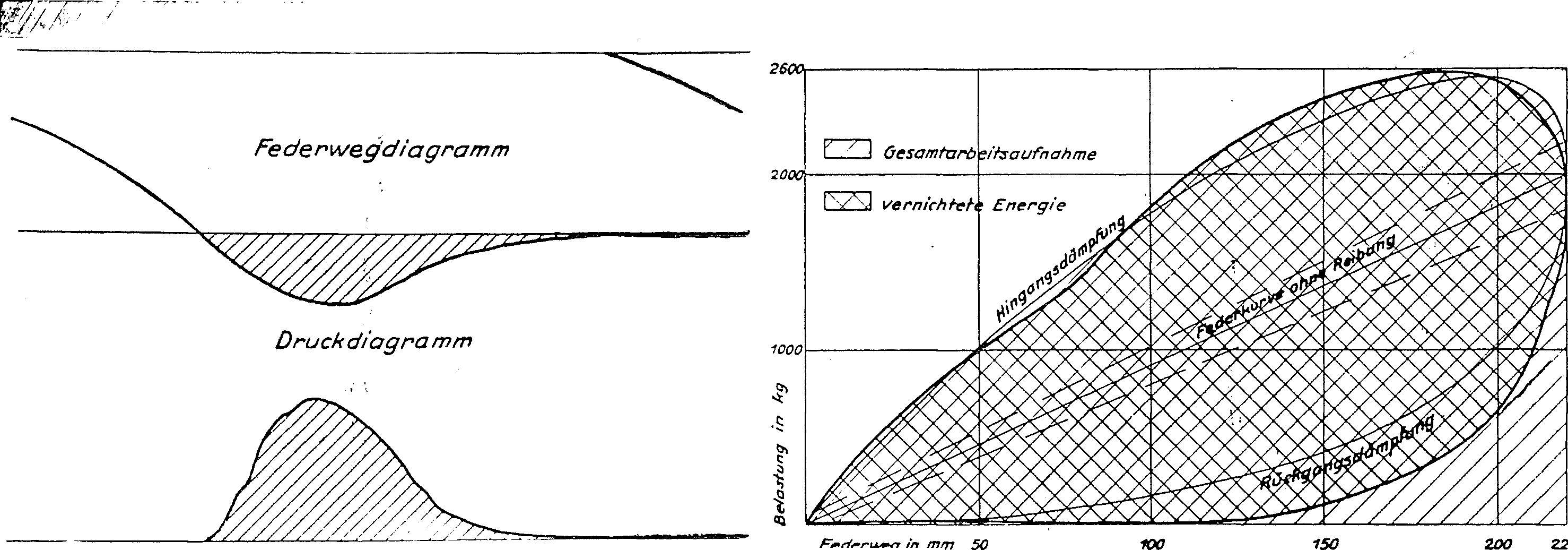
Abb. 4. Fallhammerdiagramm eines Z°:
Schraubenfederbeins mit Oeldämpfung.
Werkzeichnuns en
Fallhamwerdiagramm ; Errechnetes Diagramm
Abb. 5.
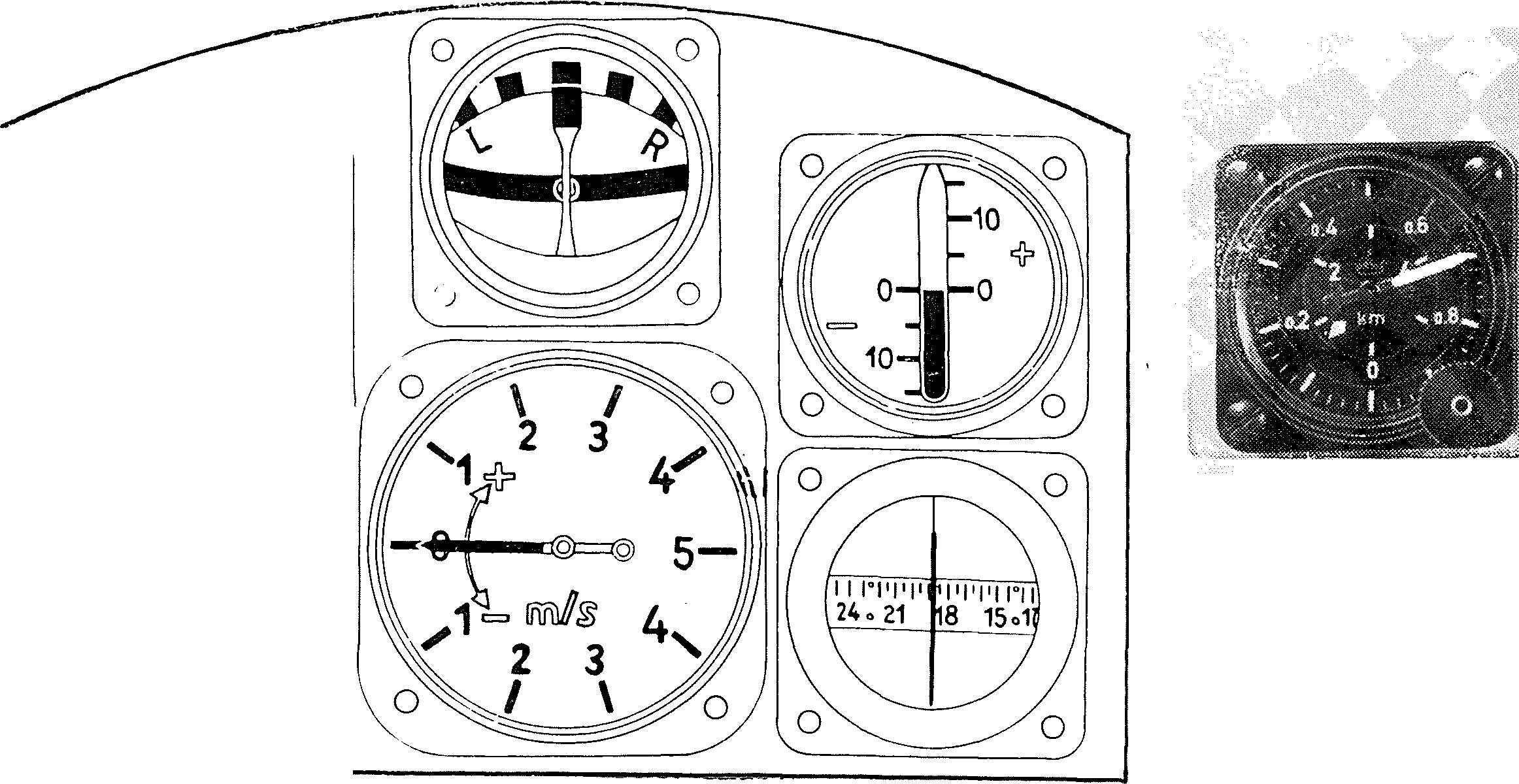
nisse, beträgt doch der Prozentsatz der vernichteten Energie (gekreuzte Fläche) zur aufgenommenen etwa 60—70% (ohne Reifen). Die Dämpfung kann man selbstverständlich durch Aenderung der Drosselquerschnitte weitgehend verändern, Eine Wartung des Federbeins, wie sie noch bei ölgedämpften Luft-Federbeinen notwendig ist, erübrigt sich. Lediglich bei den normalen Grundüberholungen der Maschine wird durch die einfache Oelfüllschraube 4 gelegentlich der Oel-spiegel überprüft. Gegen irgendwelche Schußverletzungen ist diese Konstruktion besonders widerstandsfähig, da auch bei Verlust des Oeles noch eine einwandfreie Landung auf der Schraubenfederung gewährleistet ist.
Die Konstruktion der EC-Fahrwerke richtet sich selbstverständlich nach der erforderlichen Federungsart, wie sie der Konstrukteur braucht. Für Spezialmaschinen besonders leichter Bauart wird man ölgedämpfte Luftfederbeine bevorzugen, für Schulmaschinen dagegen das einfache reibungsgedämpfte Schraubenfederbein oder, falls der Preis keine Rolle spielt, das EC-Ringfederbein. Für Sport- und Reisemaschinen, wobei auf geringste Wartung Wert gelegt wird, wird man das ölgedämpfte Schraubenfederbein bevorzugen.
Die Baumuster Go 145, Go 149, Bf 108, FW 56, Ju 87 Sporn, Bf 109 Sporn und viele andere mehr, sind bereits nach diesen Konstruktionsrichtlinien gebaut worden.
Askania-Kleingeräte.
Noch immer sieht man unsachgemäß und falsch eingebaute Bordinstrumente, deren Art der Aufhängung Fehlerquellen mit sich bringt.
Wir haben im „Flugsport" schon mehrfach auf das von der Askania-AG., Berlin-Friedenau, entwickelte Gerätebrett für Bordgeräte in kleiner Norm hingewiesen (s. „Flugsport" 1938, S. 236, S. 314, S. 644). (S. auch Bordgeräte-Behandlung, 10 Gebote „Flugsport" 1938, S. 456.)
Zusammenfassend bringen wir in Abb. 2 bis 12 die Abmessungen der neuesten Askania-Kleingeräte: Variometer, elektr. Wendezeiger, Fahrtmesser, Meßdüse für Fahrtmesser, Staurohr für Fahrtmesser, Halter für Düsen und Düsenrohre, Höhenmesser, Längsneigungs-messer, Kompaß, Borduhr, Zwischenplatte (muß dann eingebaut werden, wenn in dem Brett eines Flugzeuges Ausbrüche für Geräte riiit einem Nenndurchmesser von 80 mm bereits vorhanden sind).
Bei neuzeitlichen Flugzeugen, im besonderen für den Segelflug, wird die Einbaufrage immer schwieriger, weil nicht nur die Anzahl der Geräte wächst, sondern auch für andere wichtige Einrichtungen, wie z. B. Funkgerät, künstlicher Horizont usw. Platz geschaffen werden muß. Bei Flügen in größerer Höhe und bei fast allen Segelflügen in der Wolke machte sich immer sehr unangenehm die Vereisung der Wende-
Kleinste Askania-Qerätetafel. [
Abb. la u. b. Großes Gerätebrett. Links oben:: Fahrtmesser, daneben elektr. Wendezeiger, da- [ neben Längsneigungsmesser. Rechts unten: Kompaß, links daneben Variometer und Fahrtmesser. |
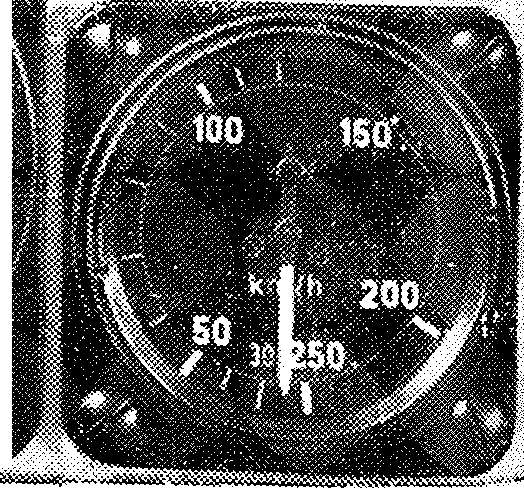
Abb. 2. Variometer einschließlich Ausgleichsgefäß; Gew. 0,25 kg.
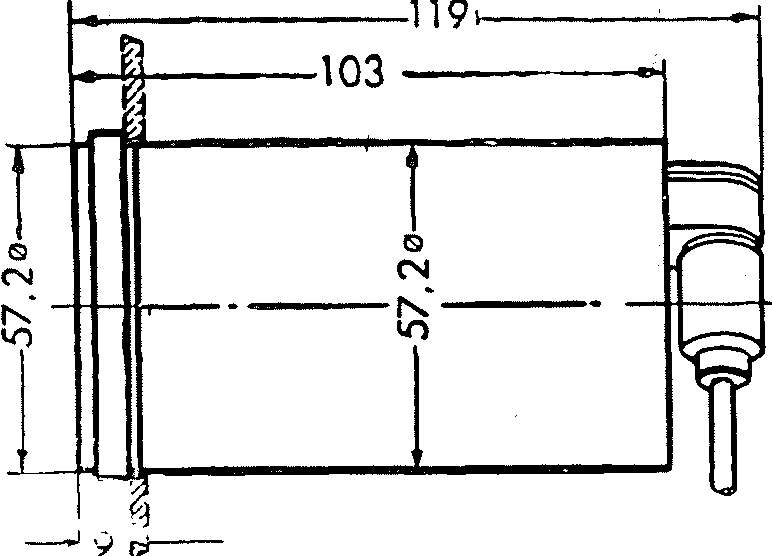
Abb. 3. Elektr. Wendeanzeiger einschließlich Batteriegehäuse; Gewicht 0,40 kg.
r
U...
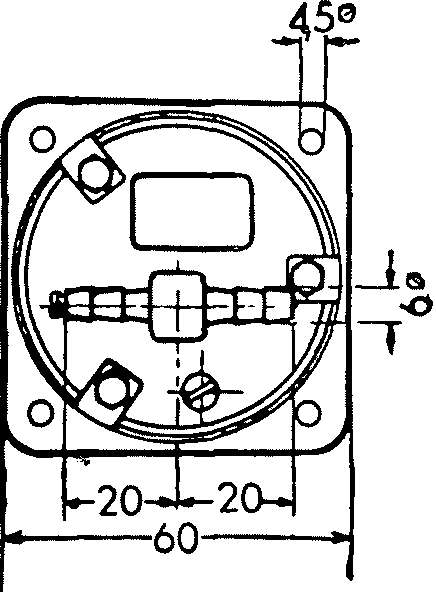
Abb. 4. Fahrtmesser für Meßdüsen oder Staurohre; Gew. 0,16 kg.
Abb. 5. Meßdüse für Fahrtmesser; Gew. 0,07 kg.
f
Vi
Abb. 6. Staurohr für Fahrtmesser; Gew. 0,07 kg.
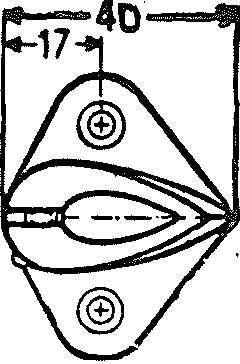
Abb. 7. Halter für Düsen und Staurohre; Gew. 0,04 kg.
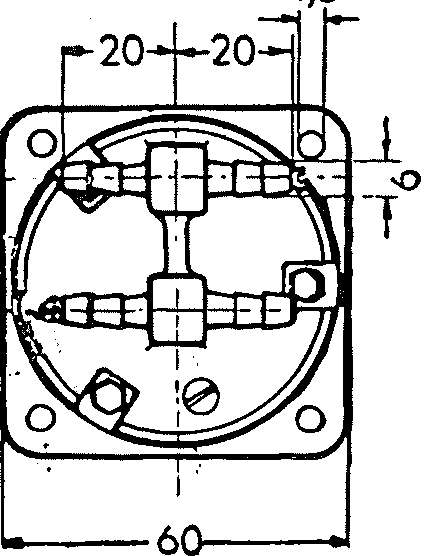
Abb. 8. Höhenmesser; Gew. 0,15 kg.
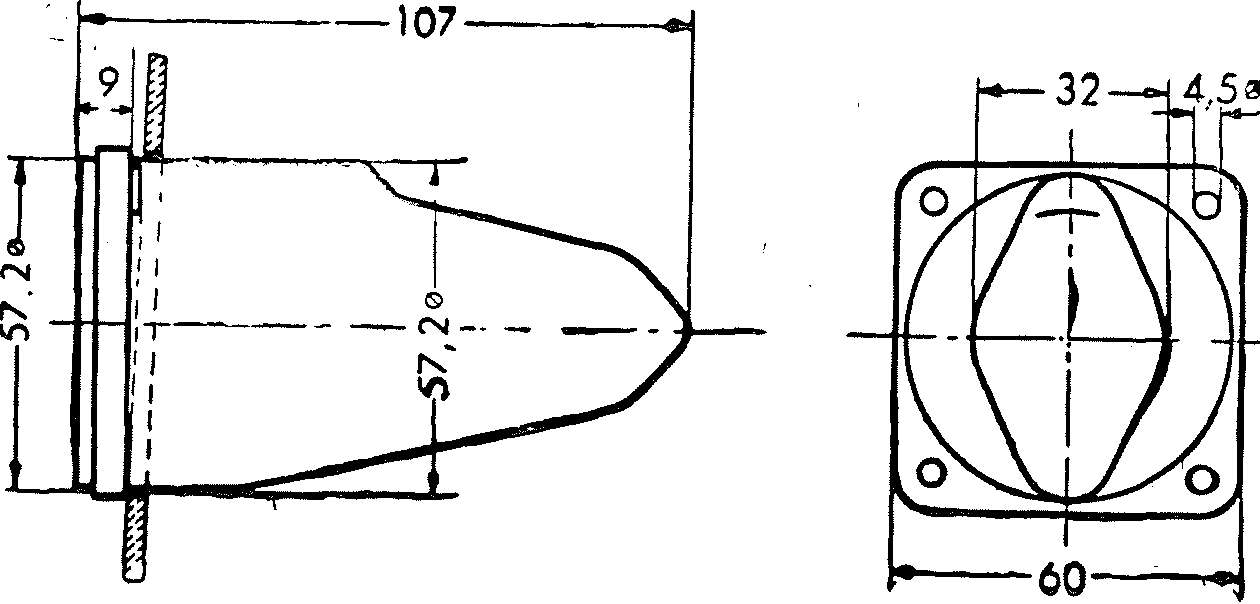
Abb. 9. Längsneigungsmesser; Gew. 0,12 kg.
|
— 68- |
52-* |
|
j |
r i |
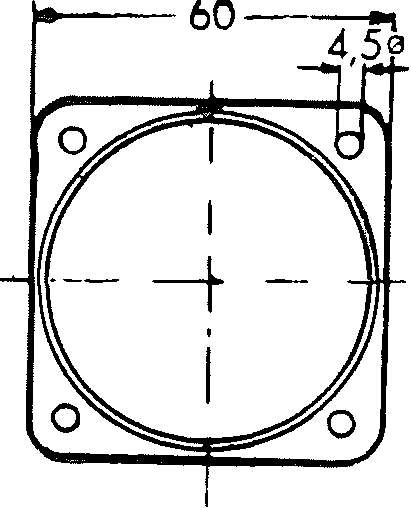
Abb. 10. Kompaß; Gew. 0,02 kg.
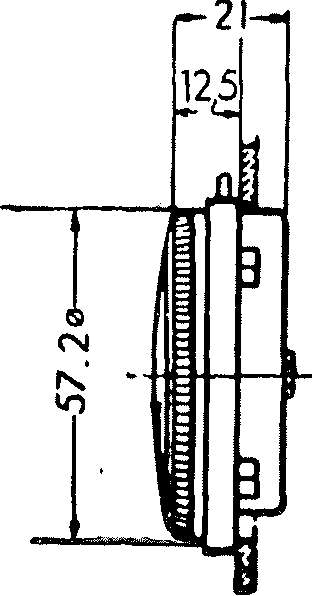
Abb. 11. Borduhr; Gew. 0,10 kg.
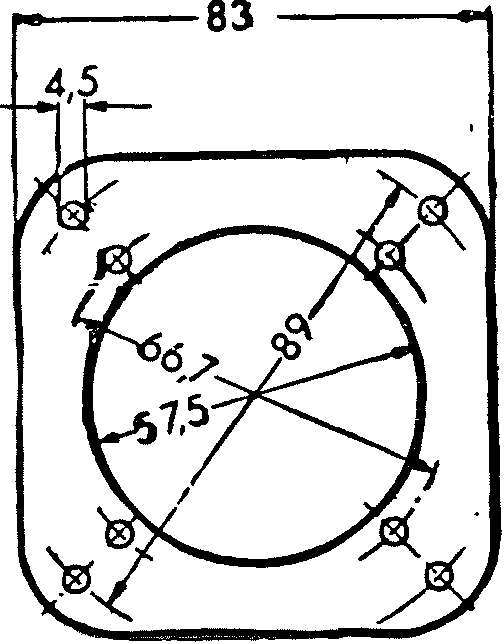
Abb. 12. Zwischenplatte; Gewicht 0,01 kg. ϖ
zeigerdüse bemerkbar, und daher ist die Entwicklung eines elektrischen Wendezeigers als besonderer Fortschritt in der Instrumententechnik anzusehen.
Auf Grund ihrer langjährigen Erfahrungen in der Ausrüstung von Segel- und Motorflugzeugen mit Geräten gibt die Firma anschlußfertige Gerätebretter heraus, die am Umfang mit mehreren Bohrungen versehen sind, durch die in beliebiger Anordnung Gummischnüre zur federnden Aufhängung des Brettes gezogen werden können. Durch die vorgesehene Halterung können die Bretter schnell in das Flugzeug eingesetzt werden und vor allem auch mit einem Handgriff wieder herausgenommen werden, was bei Außenlandungen und Segelflugzeugbeförderungen mittels Transportwagen besonders angenehm empfunden wird.
Diese Tafeln sind zur Aufnahme von 3 bzw. 6 (s. Abb. la u. b) der Askania-Kleingeräte mit einem Nenndurchmesser von 57 mm eingerichtet. Nur das zugehörige Variometer, als wichtigstes Segelflugbordgerät, ist in großer Rundnorm ausgeführt, um den hohen Ansprüchen des Segelfluges an Genauigkeit und Empfindlichkeit Rechnung zu tragen.

PLUG
umso«
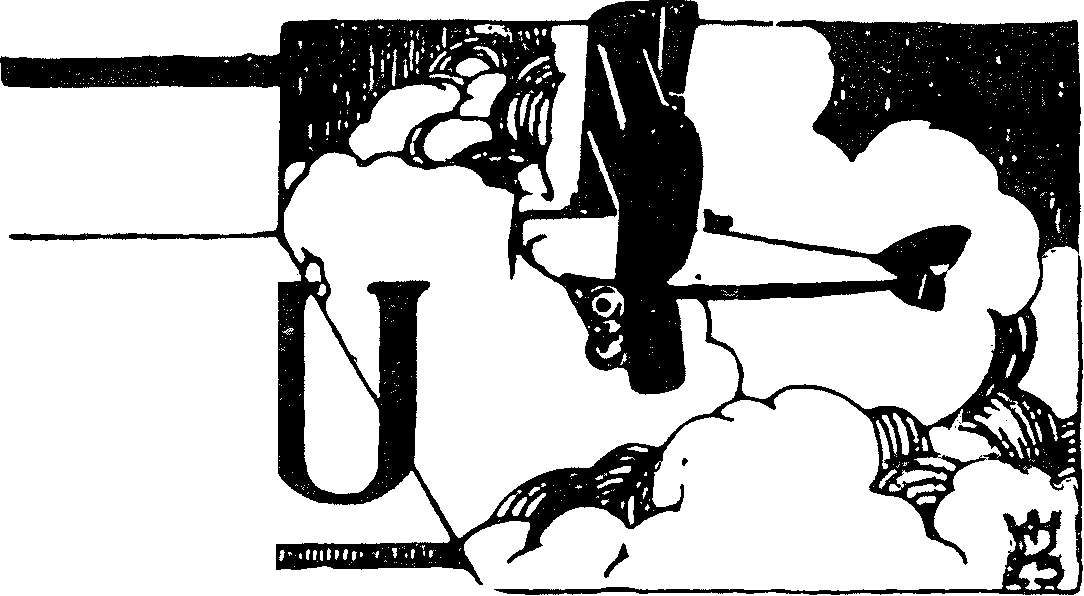
Inland.
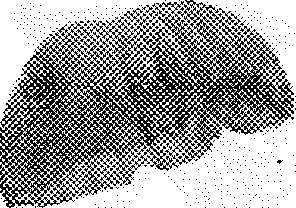
Von einem Besuch der Fallschirmschule Stendal. Ein Fallschirmjägerregiment beim reihenweisen Absprung aus einem Flugzeug. Der Absprung erfolgt waagerecht und öffnet mechanisch den Fallschirm. Weitbild
Tag der Luftwaffe.
Der Reichsluftfahrtminister und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Generalfeldmarschall Göring, hat für den 1. März für die Luftwaffen-
WM
Besuch beim Fallschirm-Regiment in Stendal. Links: Zunächst wird im Offiziershaus der Absprung aus mehreren Meter Höhe geübt, und zwar in der Haltung, wie sie beim Absprung aus dem Flugzeug er forderlich ist. Rechts oben: Absprung aus dem am Boden stehenden Flugzeug. In der gleichen Weise wird später aus der Maschine in der Luft abgesprungen. Unten: Das Landen erfordert höchste Geschicklichkeit, denn der Fallschirmschütze muß nach der Landung sofort voll verwendungsfähig sein. Das Ueben der Landung kann daher nicht hart genug sein.
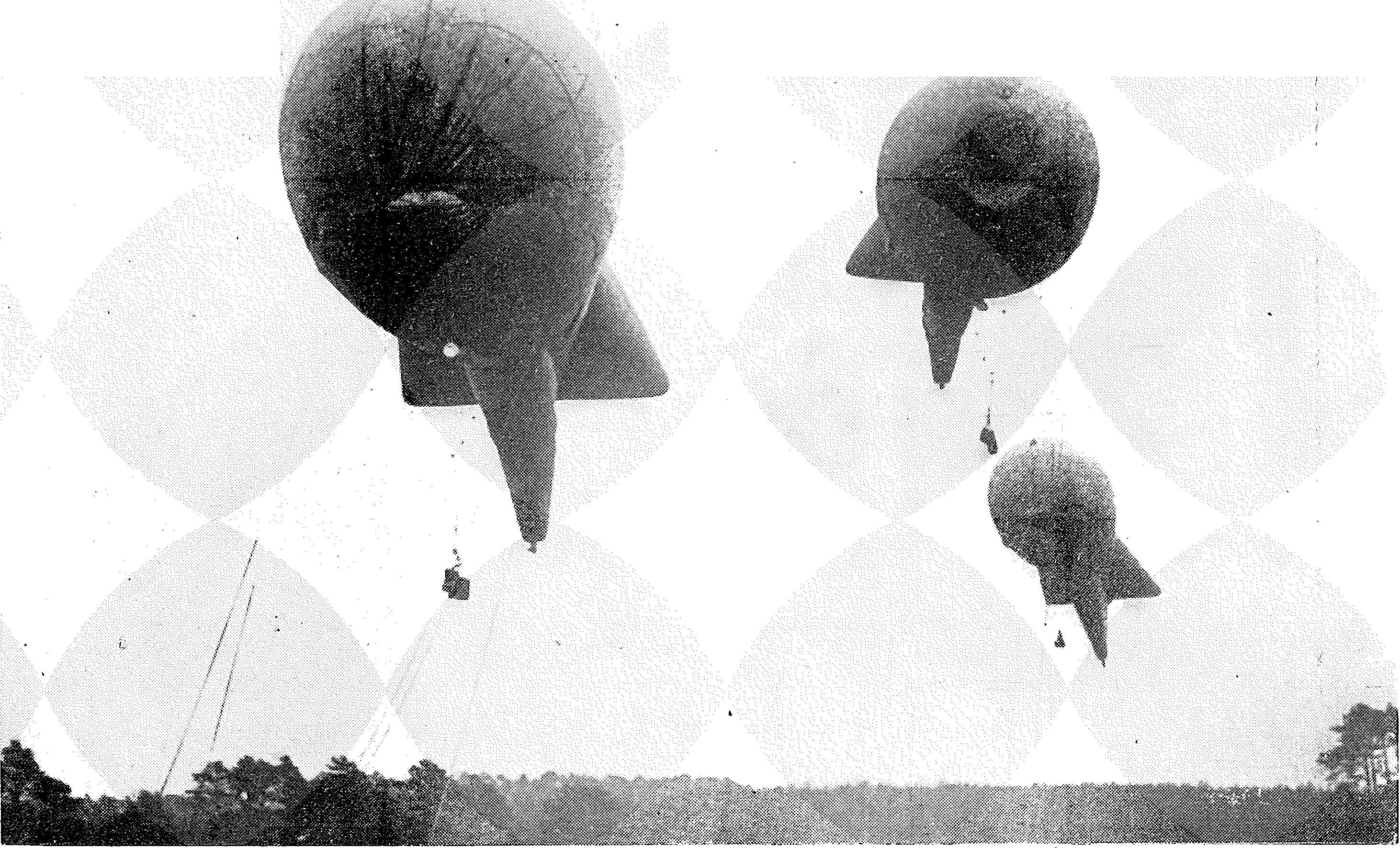
Besuch bei der Luftsperrbatterie in Bad Sarow. Eine Gruppe von Ballons wird als Ballonsperre zum Schutze gegen feindliche Fliegerangriffe hochgelassen,
ϖ ϖ■ ■ϖ Weltbild
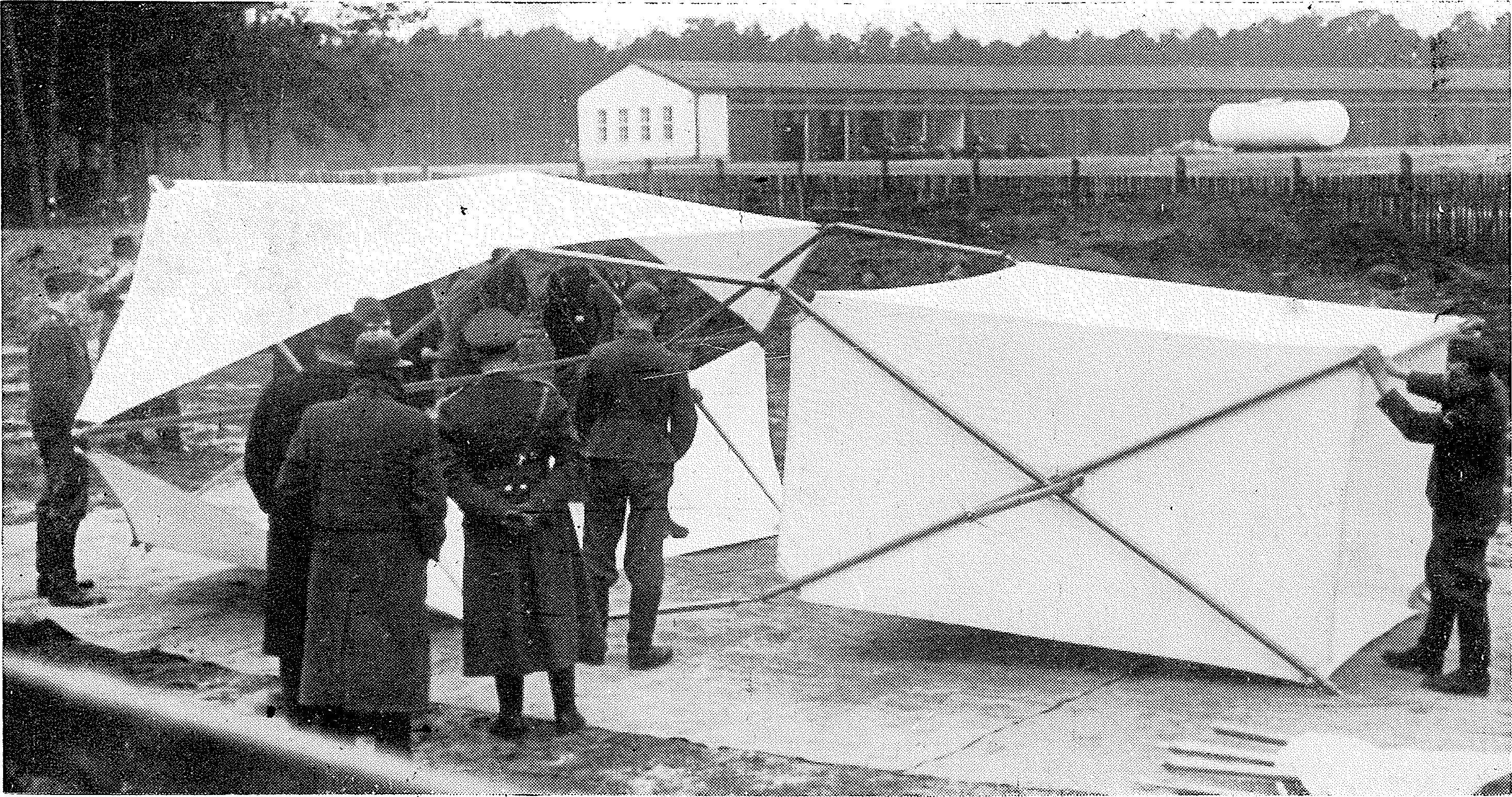
Besuch bei der Luftsperrbatterie in Bad Sarow. Bei stürmischem Wetter werden statt der Ballons Drachen verwendet. Das Bild zeigt die Drachen fertig zum
Aufgehen. Weitbild
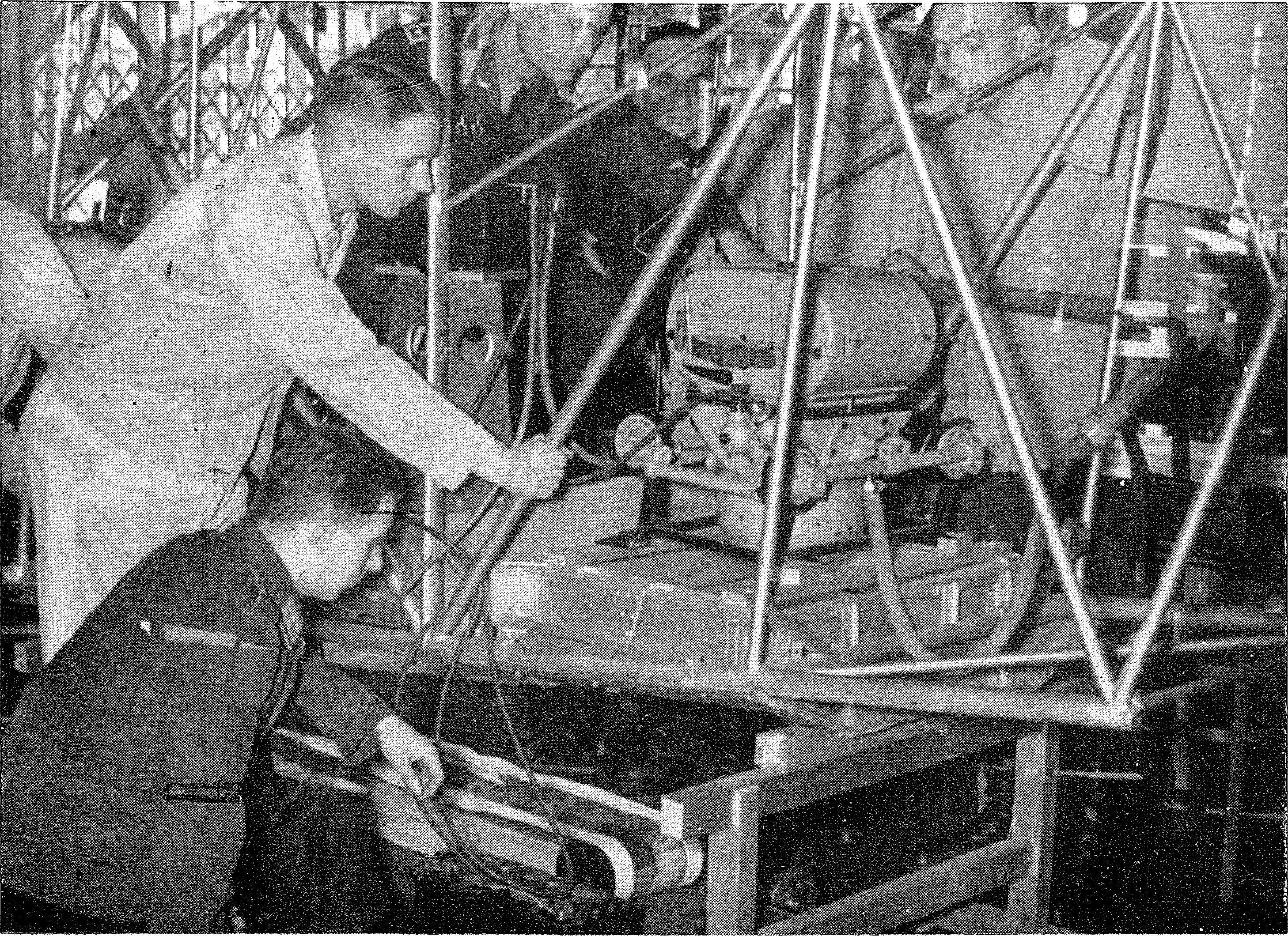
Aus der Aufklärungsfliegerschule Braunschweig-Broitzen. Aufklärungsflieger haben an der Durchführung der militärischen Operationen wesentlichen Anteil. Sie haben die Aufgabe, die höhere Truppenführung in den Stand zu setzen, vorbereitende operative Maßnahmen oder sofort Entschlüsse von wichtigster strategischer Bedeutung zu treffen. Obige Abb. zeigt ein Lehrgerät, eine Kamera, welche in den Boden eines Flugzeugrumpfes für Geländeaufnahmen eingebaut ist.
Weltbild
teile in allen Standorten gemeinsame Veranstaltungen angeordnet. — Vor vier Jahren wurde die Wiederaufrichtung einer deutschen Luftwaffe proklamiert. Appelle, Vorbeimarsch der Truppen vor dem Kommandeur, Kameradschaftsfeiern fanden an allen Standorten statt.
Deutsches Flugboot Do 26 „Seefalke" brachte Medikamente für Chile über den Ozean nach Natal. Das Flugboot flog am 14. 2. von Travemünde über Lissabon nach Bathurst in Westafrika und startete am 16. 2. 10 h MEZ über den Südatlantik. Außer der Besatzung war noch ein Angestellter der Lufthansa sowie 775 kg Fracht für das Erdbebengebiet an Bord. Diese bestand aus Medikamenten, Verbandszeug, chirurgischen Instrumenten, welche von der Reichsregierung der chilenischen Regierung als Geschenk übermittelt wurden und vom deutschen Roten Kreuz zusammengestellt worden waren. Wasserung in Natal in Brasilien 19.59 h MEZ. Der Do 26 „Seefalke" mit Jumo 205 Schwerölmotoren, Besatzung Flugkpt. Graf Schack, Flugkpt. Blum, Flugmasch. Dielewicz und Oberfl.-Funker Wittrock, hat hiermit seinen ersten Ozeanflug ausgeführt. Die Fracht wurde dann auf dem Luftwege nach Chile weiterbefördert. Rückflug von Rio de Janeiro am 20. 2. 8.57 h (Ortszeit).
Werkstoffaustausch patentfähig? Die in neuerer Zeit, besonders auch vom Vierjahresplan angeregt, geschaffenen Kunststoffe (Kunstharze) hatten eine gewisse Patentrechtsunsicherheit zur Folge, weil die Prüfungsstellen des Patentamts nicht einheitlich verfuhren. Teils haben sie Konstrukteuren auf die Anwendung der von Chemikern erfundenen und ihnen patentierten Stoffe für bestimmte Gebiete der Technik Patente erteilt, teils die Patentierung abgelehnt. Hier hat das Reichsgericht in Bestätigung einer patentamtlichen Nichtigerklärung eines solchen Patents Klarheit geschaffen, indem es einfachem Werkstoffaustausch eine die Patentierung rechtfertigende Erfindungshöhe abgesprochen hat. Damit hat es seine in der Kinderzeit des rostfreien Stahls ergangene sog. Klaviersaitendraht-Entscheidung aufrecht erhalten, wonach die neue Verwendung bekannter Werkstoffe mit bekannten Eigenschaften an einem an sich bekannten oder unbekannten Gerät nicht als eine Erfindung angesehen ist.
PIN Fachnormenausschuß für Luftfahrt FALU
Bezugsfertige Normblätter. Erschienen sind folgende, vom Beuth-Vertrieb, Berlin SW 68, Dresdener Straße 97, erhältliche Normblätter:
1. Luftfahrtnormen: DIN L 163 (vereinigt m. DIN L 581) Profile a. Blech, Formen und Grundmaße (Jan. 39, 2. Ausg.); DIN L 174 Pilzniete (Jan. 39), (nicht für neue Baumuster); DIN L 175 Flachsenkniete (Jan. 39); DIN L 351 Gelenklager (Einstellager) (Jan. 39, 2. Ausg.); DIN L 401 Bördellöcher f. Bleche (Jan. 39); DIN L 552 (Ersatz für DIN Vornorm L 552) Webstoffe, Schrägstreifen (Jan. 39); DIN L 553 (Ersatz für DIN Vornorm L 553) Webstoffe, Zackenstreifen (Jan. 39): DIN L 554 (Ersatz für DIN Vornorm L 554) Webstoffe, Wickelbänder (Jan. 39); DIN L 591 Flansche a. Blech, leicht (Jan. 39); DIN L 592 Flansche a. Blech, schwer (Jan. 39); LgN 12090 Vorblatt Werkstoffe zu Normen, Einführung (Jan. 39), Blatt 1 Werkstoffe zu Normen, Dinormen (Jan. 39), Blatt 2 Werkstoffe zu Normen, DIN L-Normen (Jan. 39), Blatt 3 Werkstoffe zu Normen, DIN Kr-Normen (Jan. 39), Blatt 4 Werkstoffe zu Normen, Hg-Normen (Jan. 39), Blatt 5 Werkstoffe zu Normen, Lg-Normen (Jan. 39), Blatt 11 Werkstoffe zu Normen, Stähle i. Flugwerksbau (Jan. 39).
2. Allgemeine Normen: DIN 75 Senkungen 90° für Beschlagteile (Dez. 38, 2. Ausg.); DIN 83 (Ersatz für DIN 83 Blatt 1 u. 2) Zylinderschrauben (Nov. 38, 2. Ausg.); DIN 617 Lagernadeln, Nadellager (Nov. 38); DIN 668 Rundstahl blank, gezogen oder gedreht, ISA-Lehre h 11 (Okt. 38, 4. Ausg.): DIN 1345 Formelgrößen und Einheiten der Wärmelehre und Wärmetechnik (Okt. 38); DIN 1755 Messingrohr, nahtlos gezogen (Jan. 39, 4. Ausg.); DIN 4070 Holzabmessungen, Kantholz, Balken, Dachlatten, Nadelholz (Nov. 38, 2. Aug.); DIN 4071 Holzabmessungen, Bretter, Bohlen, Nadelholz, Laubholz (Nov. 38, 2. Ausg.); DIN 4078 Sperrholzplatten, Fournierplatten, Tischlerplatten, Abmessungen (Dez. 38); DIN 7701 Kunstharz-Preßstoffe, warmgepreßt (Jan. 39, 2. Ausg.); DIN 7702 Ueber-wachungsgeräte für typisierte Preßmassen und -Stoffe (Dez. 38); DIN DVM 3504 Prüfung von Gummi, Bestimmung der Zugfestigkeit und Dehnung (Nov. 38); DIN Vornorm DVM A 131 Prüfverfahren, Schwindmaßbestimmung (Okt. 38).
Eingezogen und ersetzt wurden gemäß Blatt LgN 12090 folgende Luftfahrtnormen: DIN Vornorm L 11 Nahtlose Präzisionsstahlrohre (kaltgezogen); DIN L 24 Rohre aus Aluminium- und Magnesium-Legierung; DIN Vornorm L 41 Rundstangen aus Aluminium-Legierung, gezogen; DIN L 48 Sechskantmuttern; DIN L 49 Flache Sechskantmuttern: DIN L 50 Kronenmuttern' DIN L 51 Flache Kronenmuttern; DIN Vornorm L 54 Sechskantbolzen (Konstruktionsblatt); DIN Vornorm L 62 Bolzen (Splintbolzen); DIN Vornorm L 581 Profile aus Blech, Formen.
Was gibt es sonst Neues?
ItaL Luftlinie Rom—Barcelona seit 27. 1. wieder im Betrieb.
Flugzeug-Konstrukteure u. -Betriebsführer sollten alle einige Tage die Leipziger technische Messe, 5.—13. 3., studieren. Anregungen für neue Wege zur Leistungssteigerung, neue konstruktive Gedanken finden sich auf allen Gebieten: Werkzeugmaschinen, Fertigungsverfahren, Holz und Metall, ganz neuartige Einrichtungen, Maschinenelemente. Jede Flugzeugfirma sollte einen ihrer besten Männer mit Weitblick nach Leipzig entsenden.
Schweizer Aeroclub Präsident jetzt Oberstltn. Walo Gerber, früher Oberst Mesner.
Ausland.
Engl. Luftfahrtminist, hat am 22. 2. für den Nachtragshaushalt 8 Millionen Pfund (100 Millionen Reichsmark) gefordert. Zweck: Beschaffung 3V2 Millionen für Flugzeuge und Sperrballons, 2V2 Millionen neue Flugzeugfabriken, V2 Million Sonderballonsperre für größere Städte, Zuschüsse für zu erweiternde Fabriken 1 Million.
Flugzeugfallschirme (Anti-Spin-Parachute) wurden bei Versuchsflügen von amerikanischen Schulmaschinen in England verwendet. Geschwaderführer Robert Cazalet hatte versuchsweise eine solche Maschine, die auch mit einem Flugzeugfallschirm ausgerüstet war, absichtlich stark hinterlastig gemacht. In großer Höhe kam die Maschine ins Trudeln. Er betätigte den Fallschirm und kam aus dem Trudeln heraus, hängte den Fallschirm ab, die Maschine flog wieder normal, geriet wieder ins Trudeln und da kein weiterer Fallschirm mehr vorhanden war," zerschellte die Maschine am Boden. Die Angelegenheit wird in England stark kritisiert.
Imperial Airways bestellt für europäische Luftlinien 2 Maschinen der „F"-Klasse, Bezeichnung „Fingal" und „Fiona", vom gleichen Typ wie die „Frobisher" und „Falcon".
Bristol Perseus X, Schieber-Motor, seit voriges Jahr in Serie. In der Konstruktion ähnlich dem Perseus XII (siehe „Flugsport" 1938, S. 323), erhöhte Verdichtung wurde erreicht durch Vergrößerung des Laderdurchmessers und Erhöhung der Drehzahl.
Neun Zylinder, luftgekühlt 145 mm Bohrung, 165 mm Hub, max. Leistung 880 PS in 4650 m Höhe. Der Bristol Merckry der gleichen Größe leistet nur 840 PS in 4200 m Höhe. Ein Drosselungslauf von 50 h, Leistung 520 PS, ergab Betriebsstoffverbrauch von 203 g/PS/h.
De Havilland Aircraft Co. Nach Mitteilungen des Vorsitzenden Butler betrug 1938 der Gewinn fast 24 000 £ mehr als im Vorjahr. Die Zunahme ist zurückzuführen auf die größeren Militärlieferungen und auf Vergrößerung des Exports. Angegliedert ist die Scottish Aviation Co., die in der Nähe von Edinburg und Glasgow einen Schulplatz einrichten wird, der später auch als Verkehrsflugplatz benutzt werden soll.
Franz. Flugzeugbestellungen in Amerika: Außer den bereits früher genannten 200 Curtiss P-36 Jagdflugzeugen, von denen jetzt 24 in Frankreich angekommen sind, 20 Sturzflugbomber Chance Vought V-156, die besonders zur Ausrüstung des franz. Flugzeugträgers „Bearn" bestimmt sind, 115 Bomber Glenn Martin-167 Zweimotor von 2100 PS, 100 Douglas B-19 Zweimotor-Bomber von 2100 PS (ein neuer Typ, der noch absolut geheim ist), 200 Schulflugzeuge North-America BT-9, Einmotor von 550 PS. Kosten dieser Bestellung 60 Millionen
Englischer Luftschutz für Luftschutzkeller. In Birmingham bei der Luftschutzausstellung wurde ein Luftschutzkeller gezeigt, der mit dicken Zementkugeln abgedeckt ist. Die Kugeln sollen verhindern, daß der Keller von einem Volltreffer getroffen wird, da die Kugeln, die zudem kegelförmig aufgeschichtet sind, die Bombe ablenken.
Weltbild
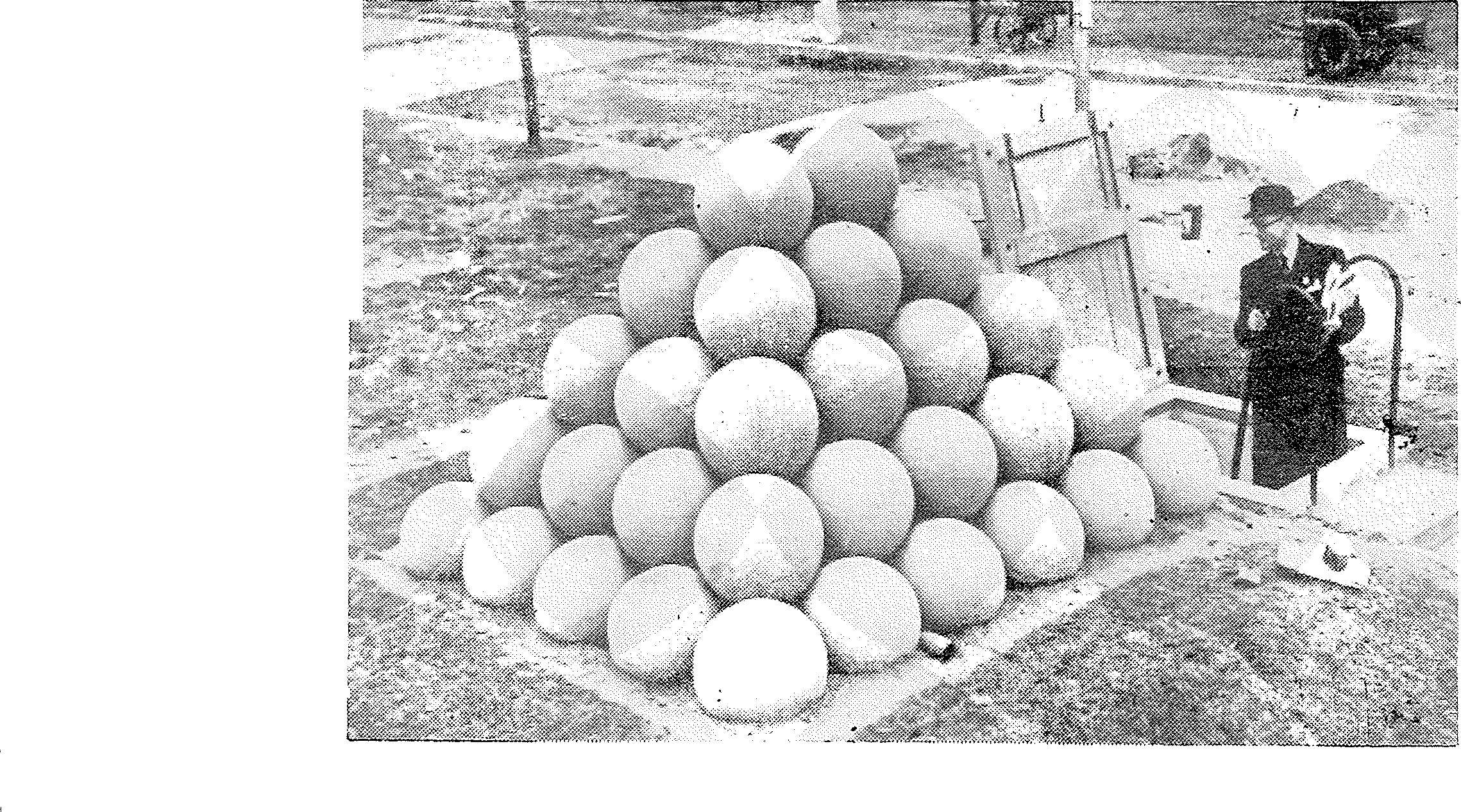
Dollar. Dabei sind die mehrere Hundert Pratt & Whitney Ersatzmotoren noch nicht inbegriffen.
4. Sahara-Meeting vom 5.—15. März 39, offen für mittlere und große Sportflugzeuge einschließlich Amphibienflugzeuge. Motorleistung von 130 bis 950 PS. Veranstalter R. U. N. A. (Reale Unione Nazionale Aeronautica), 6, Via Lepanto, Rom. Nennungsschluß 1. 3. Erster Preis 15 000 Lire und Ehrenpreis, zweiter 8000 Lire und Ehrenpreis, dritter 4000 Lire und Ehrenpreis. Eintrefftag 4. März Flugplatz Mellaha (Tripolis). Nach einem Wüstengeschicklichkeitsflug von 400 km, Rundflug vom 8. —10. 3. Tripolis — Sinauen —-Derg—Gadames—Gadames—Derg— Esagciuref — Hun Hun—Tagrifet—Ära dei Fileni—El Agheila —Agedabia—Bengasi, Gesamtstrecke 1823 km. Danach Geschwindigkeitsflug Bengasi — Agedabia — Agheila—Sirte—Buerat—Taourga, Gesamtstrecke 711 km. Weiterhin Geschwindigkeitsrennen auf dem Taourga-Tripolis-Abschnitt über 194 km.
Franz. Luftfahrtminist, bestellte 500 Rolls-Royce-Motoren.
Douglas-Kampfflugzeuge kosten für Frankreich 100 000 Golddollar, in Amerika kosten sie nur 70 000 Dollar.
Fokker D 23 soll an Stelle der Walter-,,Sagitta"-Motoren Daimler-Benz-600 von 1000 PS oder Rolls-Royce-Merlin-Motoren erhalten.
Sir Henry Deterding t> jahrzehntelanger Leiter der Shell-Organisation, Gegenspieler der amerikanischen Petroleummächte, geborener Holländer, englisch geadelt, 4. 2. 1939, St. Moritz, 72 Jahre alt, gestorben.
USA-Militärausschuß des Senats bewilligte für die Aufrüstung der Luftstreitkräfte (von 5500 auf 6000 Flugzeuge) 358 Millionen Dollar.
Lockheed Aircraft Corp. hat, wie Dir. Gross bekannt gibt, im Jahr 1938 rund für 10 Millionen $ Flugzeuge geliefert. Die unerledigten Aufträge betrugen am Jahresende 33,3 Millionen $, Reingewinn 1938 betrug 442 000 $ gegenüber 138 000 $ im Jahr 1937. Im Jahr 1939 soll die Fabrikation so gesteigert werden, daß je Tag ein Flugzeug die Werkstatt verläßt.
Northrop Zweimotor, Schnellbomber (Abb. unten), Municipal Airport, Los Angeles, am 23. 1. abgestürzt. Es handelt sich um einen zweimotorigen, noch nicht an der Oeffentlichkeit bekannten Schnellbomber. Mitteldecker, Dreiradfahrwerk, flache MG.-Kuppel auf der hinteren Rumpfoberseite. Einfaches Höhen-und Seitenleitwerk. Das Flugzeug, geführt von dem Werkpiloten John Cable und einem unbekannten Fluggast an Bord, befand sich bereits V2 Std. in der Luft in 15 m Höhe. Die Motoren liefen mit Vollgas. Plötzlich fiel ein Motor aus, die Maschine machte eine Steilkurve, stieg auf 150 m und ging über den Flügel. Wie es scheint, gelang es noch, die Maschine etwas abzufangen, sie geriet jedoch in eine Gruppe parkender Automobile, die mit den Flugzeugtrümmern in Brand gerieten.
USA-Flugzeugverkauf gab Senator Nye Veranlassung, beim Kongreß in Washington eine Vorlage einzubringen, nach der die Regierung der Vereinigten Staaten nicht mehr ermächtigt sein soll, amerikanische Militärflugzeuge auf eigene Initiative an fremde Mächte zu verkaufen. Den Chefs der Land-, See- und Luftstreitkräfte soll Einspruchsmöglichkeit vorbehalten bleiben, wenn nach ihrer Ansicht dadurch eine Schwächung der Landesverteidigung eintreten könnte. Senator
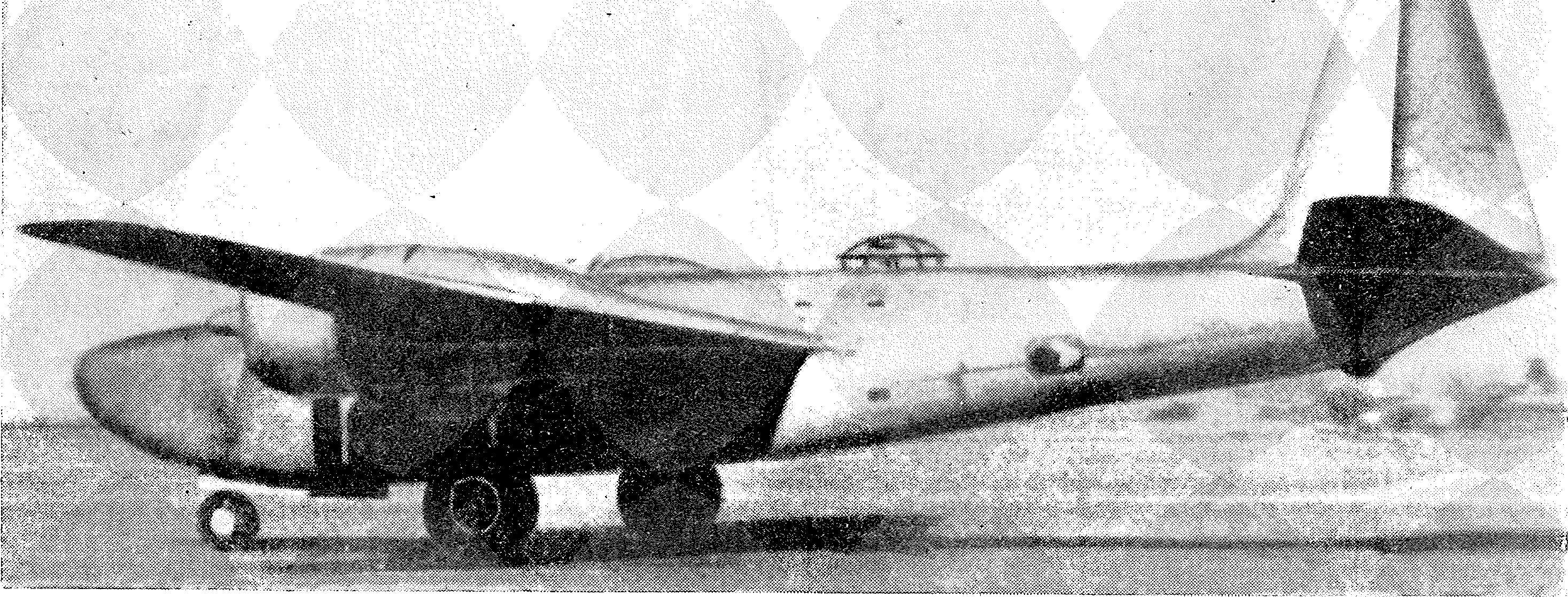
USA Northrop Zweimotor-Versuchsschnellbomber. Archiv Flugsport
Nye teilte mit, daß die Verkäufe nach Frankreich nicht rückgängig gemacht werden könnten, da die Verträge bereits unterzeichnet sind. Die französische Lieferung umfaßt 615 Flugzeuge für 60 Millionen Dollar. An der Lieferung sind 4 Flugzeugfabriken beteiligt: 100 Curtiss-Jagdflugzeuge, 200 Bomber von der North American Aviation Corp., 115 leichte Glenn L. Martin-Bomber und 100 Douglas-Bomber. Verkauf an Niederlande und Sowjetrußland nur gegen Barzahlung unter der Bedingung, daß militärische Geheimnisse nicht preisgegeben und die Verhandlungen nicht öffentlich geführt werden.
USA-Uebungsflugzeuggeschwader, 12 Maschinen, wurden vom Nebel überrascht und stießen mehrfach zusammen. 4 Maschinen konnten mit geringen Beschädigungen landen. 7 Maschinen gingen zu Bruch, 6 Führer konnten noch rechtzeitig mit Fallschirmen aussteigen. Ueber den Verbleib der letzten Maschine liegen noch keine Meldungen vor.
World Automotive Engineering Congress in New York, Indianapolis, Detroit und San Francisco vom 22. 5.—8. 6. 39 ladet die Society of Automotive Engi-neers, Inc., New York, ein. 60 Vortragssitzungen und Besuch von Fabriken. Henry Ford Ehrenvorsitzender. Die Vorträge, die in New York beginnen, umfassen neben Kraftwagen, Ackerbau-Traktoren, Flugzeuge und Flugmotoren. 2 Besichtigungstage: Wichtige Verkehrsadern, Motortunnel unter dem Hudson River, George-Washington-Brücke, Hochfahrbahnen in New Jersey und New York, einschließlich der Weltausstellung New York und mehrerer Automobilfabriken. Fortsetzung des Kongresses in Detroit vom 31. 5.—2. 6. Von Detroit Weiterfahrt nach Chicago und über Los Angeles nach San Francisco. Ankunft 6. 7. 8. Juni Schluß des Kongresses mit Bankett in San Francisco. Auskünfte durch die Society of Automotive Engineers, Inc., 29 West 39th Street, New York City (USA).
Schweizer. Volksbegehren, das eine Vermögensabgabe zur Finanzierung eines großen schweizerischen Luftaufrüstungsprogramms fördert, wird von Nationalrat Duttweiler betrieben. Dem Bundesrat erscheint die Aktion infolge der eigenen Rüstungspläne überflüssig. Eine Zusage der Militärverwaltung wegen Schaffung einer schweizerischen Flugzeugindustrie scheint noch nicht vorzuliegen. Man spricht davon, daß das Gründerkonsortium im Ausland bereits eine Jagdflugzeuglizenz erworben hat.
Von der engl. USA-Bomber-Bestellung werden die ersten von den 250 Lockheed 14 nach England verladen. Der Lockheed 14 Bomber ist aus dem Schnellverkehrsflugzeug Lockheed 14 hervorgegangen. (Vgl. die Typenbeschr. „Flugsport" 1937, S. 513.) Höchstgeschwindigkeit mit 2X760 PS 400 km/h. Durch die große MG.-Laterne auf der Hinterseite des Rumpfes dürfte die Höchstgeschwindigkeit
Aenderung der Rekorde am 1. April 1939,
Gemäß Beschluß der F. A. I.-Sitzung Berlin vom 23.—28. 6. und der Sitzung der F. A. I. in Paris vom 7.-1. 39 werden nachstehende Rekorde in der offiziellen Liste ab 1. 4. 39 nicht mehr geführt. 1. Rekorde mit 500 kg Nutzlast in den verschiedenen Klassen,
(Fortsetzung Seite 141)
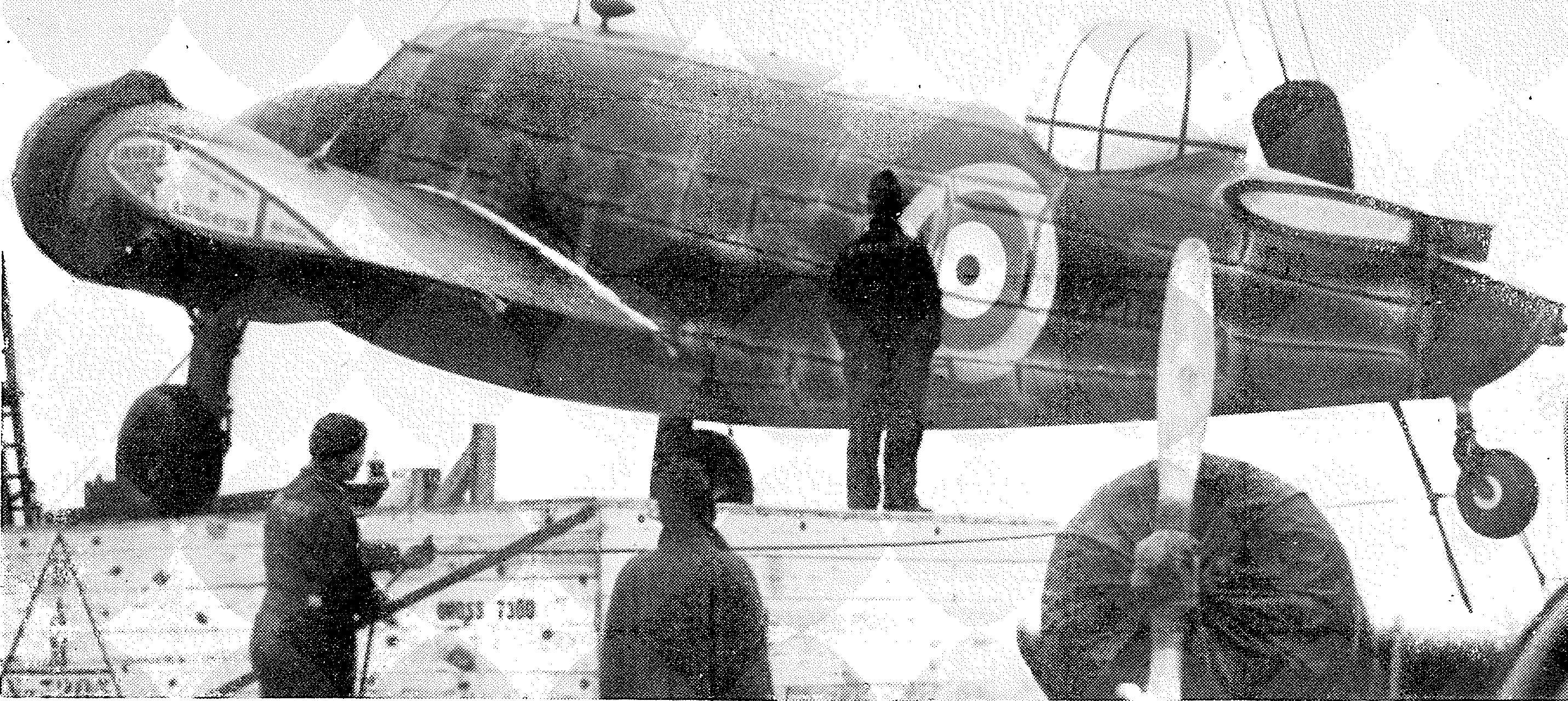
geringer sein.
Weltbild
Liste der Welt-*) und internationalen Rekorde, Stand Januar 1939.
Klasse Ci Landflugzeuge
|
Ohne Nutzlast |
Mit 500 kg Nutzlast |
Mit 1000 kg Nutzlast |
Mit 200-0 kg Nutzlast |
Mit 5000 kg Nutzlast |
Mit 10 C'0'01 kg Nutzlast |
||||
|
Höhe: |
*) 17 083 m Italien Lt.-Col. Mario Pezzi, Caproni 161, Piaggio XI-RC, Montecelio 22. 10. 38 |
12 816 m U. R. S. S. Vladimir Kokkinaki, C. K. B. 26, 2X800 PS M-85, Tchelcovo-Moskau 3. 8. 36 |
12 246 m U. R. S. S. Michel Alekseev, ANT-40, 2X 860 PS M-103 12 Zvl., Moskau-Podlipki 2. 9. 37 |
11 005 m U. R. S. S. Vladimir Kokkinaki, C. K. B. 26, 2X800 PS M-85, Tchelcovo 7. 9. 36 |
9312 m Deutschland K. Kindermann, R. Wendel u. Ing. Hotopf, Ju-90, 4 Motoren DB 600, Dessau 4. 6. 38 |
7242 m Deutschland A. Kindermann u. Ing. Hotopf, Junkers Ju-90, 4 Motoren DB 600 8. 6. 38 |
|||
|
Höchstgeschwindigkeit über 3 km |
*)610,950 km/h Dtschld. Ing. H. Wurster, BF-113 R, DB 600-950 PS, Augsburg 11. 11. 37 |
||||||||
|
über 100 km |
634,320 km/h Dtschld. Generalmaj. Udet, fiein-kel He 112 U, DB 601, Wustrow-Müritz 5. 6. 38 |
||||||||
|
über 1CO0 km |
524,185 km/h Italien Ing. Furio Niclot, Breda 88, 2X1000 PS, Piaggio 11 RC-40 9. 12. 37 |
524,185 km/h Italien Ing. Furio Niclot Breda 88, 2X1000 PS, Piaggio 11 RC-40 9. 12. 37 |
524,185 km/h Italien Ing. Furio Niclot Breda 88, 2X1000 PS, Piaggio 11 RC-40 9. 12. 37 |
472,825 km/h Italien A. Tondi u. G. Pon-tonutti, 2 Mechaniker, Savoia S-79, 3X1000 PS, Piaggio P-XI RC-40 4. 12. 38 |
401,965 km/h Italien G. Lucchini u. A. Ti-vegna, S-79, 3X750 PS, Alfa Romeo 126-RC, Osservatorio del Vesuvio-Monte Cavo 30. 11. 37 |
322,089 km/h Italien Giuseppe Tese u. Tino Rosci, S-74 I-ROMA, 4X750 PS, Alfa-Romeo, 126 RC-34 22. 12. 37 |
|||
|
über 20»» km |
468,811 km/h Italien A. Tondi u. G. Pon-tonutti, 2 Mechaniker, Savoia S-79, 3X1000 PS, Piaggio P-XI RC-40 4. 12. 38 |
468,811 km/h Italien A. Tondi u. G. Pon-tonutti, 2 Mechaniker, Savoia S-79, 3X1000 PS, Piaggio P-XI RC-40 4. 12. 38 |
468,811 km/h Italien A. Tondi u. G. Pon-tonutti, 2 Mechaniker, Savoia S-79, 3X1000 PS, Piaggio P-XI RC-40 4. 12. 38 |
468,811 km/h Italien A. Tondi u. G. Pon-tonutti, 2 Mechaniker, Savoia S-79, 3X1000 PS, Piaggio P-XI RC-40 4. 12. 38 |
307,455 km/h Frankreich A. Curvale u. G. Perot, Bloch 160, 4X680 PS Hispano-Suiza, Istres-Grenav 17. 10. 37 |
||||
|
über 5000 km |
400,810 km/h Frankreich M. Rossi u. 1 Mech., Amiot 370, 2X860 PS Hispano-Suiza Istres-Cazaux-Istres 8. 6. 38 |
400,810 km/h Frankreich M. Rossi u. Vigroux, Amiot 370, 2X860 PS Hispano-Suiza Istres-Cazaux-Istres 8. 6. 38 |
400,810 km/h Frankreich M. Rossi u. 1 Mech., Amiot 370, 2X860 PS Hispano-Suiza Istres-Cazaux-Istres 8. 6. 38 |
||||||
|
über 10 000 km |
186,197 km/h Japan Cdt. Yüzö Fujita, Sgt.- Maj. Takahashi, 1 Mech., Koken Long Range, Motor:. Kawa-saki Special 700 PS. Kisarazu 13.—15. 5. 38 |
||||||||
|
Größte Entfernung in gebrochener Linie ohne Zwischenlandung- |
10 148 km U: R. S. S. Col. M. Gromov, Col. A. Youmacher, Ing. S. Daniline, Moskau— San-Jacinto, 12. 13. 14. 7. 37. |
Größte Strecke in gerader Linie ohne Zwischenlandung. |
*)10 148 km U.R.S.S. Col. M. Gromov, Comrn. A. Youmachev, Ing. S. Daniline, ANT-25-1, AM-34, 860 PS. Von Moskau-Tchelcovo—San Jacinto (U. S. A.) 12.-13.-14. 7. 37. |
||||||
|
Größte Entfernung im ununterbrochenen Rundflug, jedoch mit Betriebsstoffaufnahme. |
*) 11 651,011 km Japan. Cdt. Yüzö Fujita, Sgt.-Maj. Takahashi, 1 Median. Koken Long Range, Kawasaki Spezial 700 PS, 13.-14.-15. 5. 38. |
Größte Nutzlast in 2000 m Höhe. |
13 000 kg U. R. S. S. Michel Nioukhtikov u. Michel Lipkine, Transportflugzeug Bolkhovi-tinov, 4 Motoren AM-34 ä 860 PS. Tchelcovo, 20. 11. 36. |
||||||
Klasse C bis: Wasserflugzeuge
|
Ohne Nutzlast | Mit 500 kg Nutzlast j Mit 1000 kg Nutzlast |
Mit 2000- kg Nutzlast | Mi* 5#0# kg Nutzlast | Mit 1« €00 kg Nutzlast |
Mit 15 000 kg Nutzlast |
|||||
|
Höhe: |
11 753 m V. St. A., Lt. A. Soucek, Wright Apache, Pratt & Whitney 425 PS, Washington, 4. 6. 29 |
10 389 m Italien, N. di Mauro u. Stoppani, Cant Z-506 B, 3X700 PS, Alfa-Romeo RC-55. Monfalc. 12. 11. 37 |
10 389 m Italien, Nicola di Mauro u. M. Stoppani, Cant Z-506B 3X700 PS Alfa-Romeo RC-55. Monf. 12.11.37 |
8951 m Italien, Mario I 7410 m_ Italien M. Stoppani u. N.di Mau- Stoppani, N. di Mauro ro, Cant Z-506 B, 3X u Forlivesi Cant Z-700 PS Alfa RC, Mon- 50°-B> 3 X 70?J^V falcone 3. 11. 37 fa-Romeo 127 RC, |
4863 m Italien., Mario Stoppani u. 2 Passag. Cant Z-508, 3X836PS, Isotta-Fraschini-Asso 11 RC-40, Monfalcone 13. 4. 37 |
3508 m Frankr. „Lieu-tenant-de-Vaisseau-Paris", Biscarosse 30. 12. 37 |
|
|
Höchstgeschwindigkeit über 3 km |
709,209 km/h Italien, F. Agello, M. C. 72. Fiat A. S. 6, Desenzano 23. 10. 34 |
||||||
|
über 100 km |
629,370 km/h Italien. Guglielmo Cassinelli, Macchi C-72, Fiat A. S. 6, 2400 PS, Falco-nara-Pesaro 8. 10. 33 |
||||||
|
über 1000 km |
403,424 km/h Italien, M. Stoppani u. G. Gorini u. 2 Passag., Cant Z-509, 3X1000PS, Fiat A-80 RC-41, 30. 3. 38 |
403,424 km/h Italien, M. Stoppani, G. Gorini, 2 Passag., Cant Z-509, 3X1000 PS, Fiat A-80 RC-41, 30. 3. 38 |
403,424 km/h Italien, M. Stoppani, G. Gorini, 2 Passag., Cant Z-509, 3X1000 PS, Fiat A-80 RC-41. 30. 3. 38 |
403,424 km/h Italien, M. Stoppani, G. Gorini, 2 Passag., Cant Z-509, 3X1000 PS, Fiat A-80 RC-41, 30. 3. 38 |
251,889 km/h Italien, M. Stoppani, Ing. A. Maiorana, 3 Passag., Cant Z-508,3X846 PS, Isotta-Fraschini ,,As-so" 11 RC. 1. 5. 37 |
211,002 km/h Frankr., E. Guillaumet, Leclai-re Com et, Le Duff, Le Morvan, Chapaton. Latecoere 521 „Lieu-tenant-de-Vaisseau-Paris", 6X650 PS, Hispano-Suiza, Aureii-han-Lngon, 27. 12. 37 |
189, 741 km/h Frankr., „,Lieutenant-de-Vais-seau-Paris" 29 12. 37 |
|
über 2000 km |
396,464 km/h Italien, M. Stoppani, G. Gorini u. 2 Passagiere, Cant Z-509,3X1000 PS, Fiat A-80 RC-41, 30. 3. 38 |
396,464 km/h Italien, M. Stoppani, G. Gorini u. 2 Passagiere, Cant Z-509,3X1000 PS, Fiat A-80 RC-41, 30. 3. 38 |
396,464 km/h Italien, M. Stoppani, G. Gorini u. 2 Passagiere, Cant Z-509,3X1000 PS, Fiat A-80 RC-41, 30. 3. 38 |
396,464 km/h Italien, M. Stoppani, G. Gorini u. 2 Passagiere, Cant Z-509,3X1000PS, Fiat A-80 RC-41, 30. 3. 38 |
248, 412 km/h Italien, M. Stoppani, Ing. A. Maiorana, 3 Passag., Cant Z-508, 3X846 PS Isotta-Fraschini ,,As-so" 11 RC, 1. 5. 37 |
||
|
über 5000 km |
308,424 km/h Italien, M. Stoppani u. C. Tonini, Cant Z-506 I-LERO, 3X750 PS, Alfa-Romeo 126 RC-34 Monfalc. 27.-28. 5. 37 |
308,244 km/h Italien, M. Stoppani, C. Tonini, Cant Z-506 I-LERO 3X750 PS, Alfa-Romeo 126 RC-34, Monfal-cone 27.-28. 5. 37 |
308,244 km/h Italien, M. Stoppani, C. Tonini, Cant Z-506 I-LERO 3X750 PS, Alfa-Romeo 126 RC-34, Monfal-cone 27.-28. 5. 37 |
||||
|
über 10 000 km |
|||||||
|
Größte Entfernung in gebrochener Linie ohne Zwischenlandung |
8435 km Dtschld. Kpt. H. V. von Engel u. E. Gundermann, Dornier Do 18, 2 Diesel ,,Jumo 205", Start Bay - Caracella - Bahia 27.-29. 3. 38. |
Größte Strecke in gerader Linie ohne Zwischenlandung: |
9 652,001 km Groß-Britannien, Capt. D.C.T. Bennet u. 1. Offz. I. Harvy, Short-Mayo „Mercury", 4X370 PS, Napier „Rapier" J-l 6.-8. 10. 38 |
||||
|
Größte Entfernung im ununterbrochenen Rundflug: |
5200 km Italien, M. Stoppani, C. Tonini, Cant Z-506, 3 X 750 PS, Alfa-Romeo 126 RC—34, 27.-28. 5. 37 |
Größte Nutzlast in 2000 m Höhe: |
18 040 kg Frankreich, Equigape Guillaumet, Leclaire, Comet, Le Duff, Le Morvan, Chapaton, Latecoere 521 ,,Lieutenant-de-Vaisseau-Paris", 6X650 PS Hispano-Suiza Biscarosse 30. 12. 37 |
||||
r
Klasse C: Lelchtla^df lugzeuge (mit 1 Passagier)
|
1. Kategorie 6,5—9 Liter |
, 2. Kategorie 4—6,5 Liter |
3. Kategorie 2—4 Liter |
4. Kategorie bis 2 Liter |
|
|
Höhe: |
5118 m Frankreich A. Japy, 1 Passag. Caudron „Simoun" Renault 7,983 1 Orly 31. 12. 37 |
6827 m Frankreich M. Arnoux u. M. Lallus Farman 357, Renault „Bengali", 140 PS, 6,34, 1, Orly 18. 12. 37 |
7113 m Tschech. Maj. K. Bräzda u. J. Valda, Tatra T 101 Tatra HM 504, 3,98 1 Brünn 16. 3. 38 |
4872 m Tschech. J. Anderle u. E. Franek Praga E 115-1 Praga B., 1,904 1 Letnany 21. 3. 38 |
|
Entfernung in gerader Linie |
3318,198 km U. R. S. S. A. Qoussarov u. K. Qlebov, v. Ing. Moska-lev, M-ll, 8,577 1 Moskau-K rasnoyarsk 23. 9. 37 |
3415,9 km Frankreich A. Japy u. Q. Morizot Caudron C-600 „Aiglon" Renault „Bengali Junior", 6,33 1 Istres-Wadi-Alfa ' 2Q.-21. 12. 37 |
909,1 km Frankreich J. Chas u. Salmson Leopoldoff „Colibri" L-3, Salmson 2,97 1 Saint-Inglevert-Perpignan 21. 12. 38 |
309,8 km Frankreich M. Blazy u. M. Varon, S. F. A. N. 4, Train 1,995 1 30. 12. 37 |
|
Geschwindigkeit über 100 km |
343,839 km/h Frankreich M. Arnoux u. M. Lallus, Caudron 686, Renault 7,950 1, Villesauvage-La Marmogne 30. 12. 37 |
231,035 km/h Tschech. Cpt. J. Cervenka u. Lt. M. Srepänek, Tatra T-001-1, Tatra HM-504, 3,98 1 30. 4. 38 |
174,064 km/h Tschech. Cdt. J. Polma u. Cpt. Fr. Zeleny, Benes-Mräz „Bibi Be 550", Walter „Mikron", 1,978 1 12. 5. 38 |
|
|
Geschwindigkeit über 1000 km |
318,431 km/ Frankreich Ii. Bori§ u. A. Qarnier, Caudron „Rafale", Renault „Bengali" 6,33 {,» Bernay-Thiber-ville-'Bernay 27. 12. 37 |
228,241 km/h Tschech. Cpt. J. Cervenka u. Lt. M. Srepänek, Tatra T-001-1, Tatra HM-504, 3,89 1 30. 4. 38 |
144,148 km/h Tschech. Com. V. Fuksa u. E. Franck, Praga „Air-Baby", Praga B, 1,900 1, Prag 20. 7. 37 |
|
|
Geschwindigkeit über 2000 km |
249,930 km/h Frankreich R. Bejlon u. M. Chan-dron, Caudron „Rafale" C-53Q^ Renault „Bengali'*, 6,33 1, Istres 24. 1.2. 37 |
|||
|
Klasse C: Leichtlandflugzeuge (ohne Passagier) |
||||
|
1. Kategorie 6,5—9 Liter |
2. Kategorie 4—6,5 Liter |
3. Kategorie 2—4 Liter |
4. Kategorie bis 2 Liter |
|
|
Höhe: |
7985 m U. R. S. S. N.-D. Fedoseev, Q-23 M-ll E 150 PS, 8,6 1 Moskau-Touchino 2.8.38 |
8303 m Deutschland fl. Kalkstein, Kl-35 B Hirth HM-506, 5,96 1 Böblingen 18. 10. 38 |
7470 m Tschech. Maj. K. Bräzda, Tatra T 101 Tatra HM-504, 3,98 1 Brünn 16. 3. 38 |
5851 m Tschech. Jan Anderle, Praga E-115-1 Praga B. 11, 1,904 1 Letnany 22. 3. 38 |
|
Entfernung in gerader Linie |
3318,198 km U. R. S. S. A. Gous-Sarov, K. Qlebov v. Ing. Moskalev M-ll, 8,577 1, Moskau-Krasnoyärsk 23. 9. 37 |
5099,3 km Frankreich Andre Japy Caudron 600 „Aiglon" Renault „Bengali Junior", 6,33 1, Istres-Djibouti 30. 11. 37 |
4175,431 km Tschech. Maj. Jan Ambrus, V. Matena, Tatra T-101-1 Tatra HM-504, 98 PS 3,98 1, Prag-Khartoum 17.-18. 5. 38 |
1631,878 km V. St. A. Rob. E. Bryant, Aeron-ca C-3, Aeronca E-113-B 36 PS, 1,86 1, Miami-Camdem 31. 7. 38 |
|
Geschwindigkeit über 100 km |
372,979 km/h Frankreich M. Arnoux, Caudron 685 Renault 7,85 1, Villesauvage-La Marmogne 1. 10. 38 |
383,386 km/h V. St. A. S.-J. Wittman Wittman „Special" Menasco C. 4 S, 150 PS, 5,95 1, Detroit 19. 9. 37 |
231,243 km/h Tschech. Cpt. Jan Cervenka Tatra T-001-1 Tatra HM-504. 3,98 1 6. 5. 38 |
179,229 km/h Tschech. Jan Stepan, Bibi Be-501 Walter-Mikron, 1,98 1 6. 5. 37 |
|
Geschwindigkeit über 1000 km |
319,534 km/h Frankreich M. Arnoux, Caudron 660 -ϖRenault 6,33 1 Etämpes-'Chartes-Bonce 23. 10. 38 |
229,040 km/h Dtschld. H. A. Lueber, Arado Ar-79 HM-504 A-2, 3,98 1 Schönhausen-Qroß-Behnitz 15. 7. 38 |
170,809 km/h Tschech. Lt. Jan Cervenka „Bibi" Be-105 Walter-Mikron, 1,98 1 6. 5. 37 |
|
|
Geschwindigkeit über 2000' km |
317,779 km/h Frankreich M. Arnoux, Caudron 660 Renault 6,33 1, Etampes-Chartres-Bonce 23.10.38 |
227,029 km/h Dtschld. Fr. Seelbach Ar-79 D-EHCR HM-504 A-2, 3,984 1 29. 7. 38 |
||
|
Klasse G: Hubschrauber |
||||
|
Dauer m. Rückkehr zur Startstelle |
Entfernung in gerader Linie |
Geschwindigkeit über 20 km |
Höhe über Startplatz |
Entfernung in geschl. Flugbahn |
|
1 h 20 min Deutschland bw. Rohlfs FW-61-VI von Prof. H. Focke, Siemens 14a 160 PS, Bremen 25. 6. 37 |
230,248 km Deutschland Karl Bode, Dipl.-Ing. Focke-Wulf FW-61-V1, Sh 14a 160 PS, Faßberg-Rangsdorf 20. 6. 38 |
122,533 km/h Dtschld. E. Rohlfs FW-61-VI (H. Focke), Sh 14a, 160 PS, Bremen 26. 6. 37 |
2439 m Deutschland E. Rohlfs, FW-61-VI (H. Focke), Sh 14a, 160 PS, Bremen 25. 6. 37 |
80,604 km Deutschland E. Rohlfs FW-61-IV (H. Focke) Sh 14a, 160 PS, Bremen 26. 6. 37 |
Klasse C bis: Leichtwasserflugzeuge
|
1. Kategorie 6,5—9 Liter |
2. Kategorie 4—6,5 Liter |
3. Kategorie bis 2 Liter |
4. Kategorie 2—4 Liter |
|
|
Höhe |
4086 m U. R. S. S., Cath. Mednikova, Yakovlev UT-1, M-ll Q, 8,600 1, Moskau 27. 9. 38 |
6649 m Deutschland H. Kalkstein, Klemm WKL-35 B, HM-506, 5,96 1, Lindau 11. 9. 38 |
||
|
Entfernung in gerader Linie |
||||
|
Geschwindigkeit über 100 km |
197,271 km/h U.R. S.S. Cath. Mednikova, Yakovlev UT-1, M-ll G, 8,600 1, Moskau 23. 9. 38 |
228,717 km/h Dtschld. H. Kalkstein, Klemm WKL-35 B, HM-S06V 5,96 1, Lindau IL; 9. 3S |
||
|
Geschwindigkeit über 1000 km |
228,01-7 km/h Dtschld. Ii. Kalkstein, Klemm WKL-35 B, HM-506, 5,96 1, Lindau 11. 9. 38 |
|||
|
Geschwindigkeit über 2000 km |
Klasse € ter: Amphibien
|
Leer |
500 kg |
100O kg |
2000 kg |
|
|
Höhe |
7605 m V. St. A. Cap. B. Sergievsky, Sikorsky S-43, 2X750 PS, Pratt & Whitney „hörnet", Stratford 14. 4. 36 |
7605 m V. St. A. Cap. B. Sergievsky, Sikorsky S-43, 2X750 PS, Pratt & Whitney „Hörnet", Stratford 14. 4. 36 |
6432 m Italien, G. Burei, E. Rossaldi, Macchi C-94, I-NEPI, 2X750 PS Wright „Cyclone", Varese 15. 4. 37 |
5982 m V. St. A„ Cap. Boris Sergievsky, Sikorsky S-43,2X750 PS Pratt & Whitney „Hörnet", Stratford 24. 4. 36 |
|
Größte Geschwindigkeit über Boden |
370,814 km/h V. St. A. Maj. A. P. de Seversky, Seversky, Wright „Cyclone", 700 PS 15. 9. 35 |
|||
|
1<M) km |
337,079 km/h V. St. A. Mai. A. P. de Seversky, Seversky, Wright „Cyclone" 1000 PS, Miami 19. 12. 36 |
|||
|
IOiOO km |
257,138 km/h Italien G. Burei, E. Rossaldi; G. Velati. Macchi C-94, I-NEPI, 2X750 PS Wright ,,Cyclone" 9. 5. 37 |
257,138 km/h Italien G. Burei, E. Rossaldi; G. Velati. Macchi C-94, I-NEPI. 2X750 PS Wright „Cyclone" 9. 5. 37 |
257,138 km/h Italien G. Burei, E. Rossaldi; G. Velati. Macchi C-94, I-NEPI, 2X750 PS Wright „Cyclone" 9. 5. 37 |
Größte Entfernung in gerader Linie, ohne Zwischenlandung |
|
2000 km |
248,967 km/h Italien G. Burei, E. Rossaldi; G. Velati. Macchi C-94, I-NEPI, 2X750 PS Wright „Cyclone" 6. 5. 37 |
248,967 km/h Italien G. Burei, Enrico Rossaldi, Macchi C-94 Wright „Cyclone", 2X750 PS 9. 5. 37 |
2300,860 km V. St. A. F. M. Andrews, Douglas Y, O. A. 5, 2X800 PS Wright „Cyclone", San Juan-Langley Field 29. 6. 36 |
|
|
Klasse D: Segelflugzeuge |
||||
|
Höhe über Starte teile |
Dia/uieir mit Rückkehr . zuir Startsitelilie |
Entfernung mit Rückkehr zur Startstelle |
Entfernung in gerader Linie |
|
|
Einsitzer |
6687 m Deutschland Flg.-Kpt. W. Drechsel auf Göppingen 3 ,,Minimoa", Wasserkuppe 5. 8. 38 |
36 h 35 min Deutschland Kurt Schmidt auf „D-Loerzer", Type Grünau Baby, Korschenruh (Ostpr.) 3.-4. 8. 33 |
305,624 km Deutschland B. Flinsch auf D-ll-180, Type D-30, Bremen-Lübeck u. zurück 7. 7. 38 |
652,256 km U. R. S. S. V. Rastorgoueff auf „GN-7", Moskau-Ton- chino-Iarygenakaya 27. 5. 37 |
|
Mehrsitzer |
3304 m Deutschland E. Ziller, Ouadfasel auf D-6405 „Kranich", Hartau 18. 9. 37 |
40 h 38 min Deutschland Toni Kahlbacher; J. Fuehringer auf Mg-9a, Spitzerberg 8.—10. 9. 38 |
258,830 km Deutschland Heinr. Huth; Heinr. Brandt auf „Kranich", Hamburg-Altona— Hannover-Vahrenwald u. zurück 10. 8. 38 |
619,748 km U. R. S. S. I. Kartachev; P. Savtzov auf Staklia-novetz, Moskau-Isniai-lovo—Ouchnia 17. 7. 33 |
Klasse D: Motorgleiter i. Kategorie (Einsitzer)
Höhe über Startstelle
4595 m Polen M. Offierski auf „Bäk" SP-1102, Kroeber-Köller 16 PS, Warschau-Moko-töw 23. 2. 38
Dauer mit Rückkehr zur Startstelle
5 h 24 min 19 s Polen, M. Offierski auf „Bäk" SP-1102, Kroeber-Köller 16 PS, Warschau-Mokotöw, 23. 2. 38
2. Rekorde über Entfernung in gebrochener Linie in den verschiedenen Klassen,
3. Rekorde der Kategorie Mehrsitzer für Leichtflugzeuge, klassifiziert nach ihrem Zylinderinhalt,
4. weibliche Rekorde, klassifiziert nach der Nutzlast,
5. weibliche Rekorde, klassifiziert nach dem Zylinderinhalt.
Olympia-Segelflugzeug-Ausscheidungswettbewerb Rom
hat sich der für die Auswahl eines Einheitstyps für ein solches Flugzeug eingesetzte technische Ausschuß nach einwöchiger Prüfung vom 19. bis 25. 2. 39 auf dem italienischen Flugplatz Sece-Rom für den von der DFS gebauten Typ „Meise", Konstrukteur Hans Jacobs, als dem geeignetsten Typ, entschieden. An dem Ausscheidungswettbewerb nahmen noch teil außer der DFS die Flugtechnische Fachgruppe München mit einem Segelflugbaumuster „Mü 17", Italien mit 2 Mitteldeckern und einem Hochdecker, Polen mit einem Orlik-Mitteldecker, Bremsklappen nur auf der Unterseite. Die Normal-Spannweite für das Olympia-Flugzeug beträgt 15 m. Die „Meise" ist, wie untenstehende Abbildung zeigt, ein Hochdecker in Holzbauweise. Die „Mü 17" hat einen Stahlrohrrumpf.
Lilienthal-Medaille für Segelflug 1938 wurde, laut Beschluß der F. A. I. dem Polen Tadeusz Gora für größte Entfernung im Segelflug in gerader Linie, 577 km, zuerkannt.
Segelflugschulung als vormilitärische Ausbildung für die Ausbildung von Militärpiloten wird von der amerik. Zeitschrift „Soaring" als dringlich vorgeschlagen. In der Februar-Nummer 2/1939 wird darauf hingewiesen, daß es schon aus finanziellen Gründen unmöglich ist, 20 000 Militärpiloten pro Jahr auszubilden. Die einzige, sicherste und zuverlässigste Möglichkeit wäre, die Beschaffung von möglichst vielen Segelflugzeugen und Schulen.
Steptoe Butte, amerikan. Segelfluggelände Nr. 2, im Nordwesten in der Nähe der Stadt Rosalia gelegen, erhielt seinen Namen zu Ehren des Colonel Steptoe, der in früheren Tagen die Palouse-Indianer in einer Schlacht an dieser Stelle zurückschlug. Das Gelände, 330 m hoch, ist für Starts in jeder Richtung günstig und ist umgeben ringsum von Weizenfeldern, die ausgezeichnete Landemöglichkeiten bieten. Vorherrschende Windrichtung Südwest.
Engl, nationaler Segelflug-Wettbewerb 1939, Zeit und Ort steht noch nicht fest. Club-Veranstaltungen: 7.—10. 4. Ratcliffe-Aerodrome, nördlich von Leicester
Meise DFS wurde im Ausscheidungs-Wettbewerb Rom Olympia-Segelflugzeug.

Segelflug
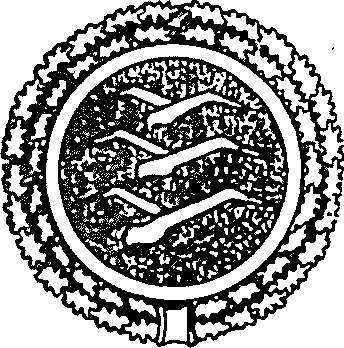
r
vom London, Derbyshire, Lancashire und Midland Gliding Club. Ende April Wilt-shire Camp des Cambridge Gliding Club. Schulungs-Kurse der verschiedenen Clubs: 7.—15. 4. Midland Club, 7.—16. 4. London Club, 5.—14. 5. London-Club,
27. 5.-4. 6. Midland Club, 28. 5.-3. 6. Yorkshire Club, 2.—11. 6. London Club, 7.—16. 7. London Club, 15.—30. 7. Surrey Club, 30. 7.-6. 8. Yorkshire Club (nur Fortgeschrittenen-Schulung), 4.—18. 8. London Club, 5.—13. 8. Midland Club, 13.—26. 8. Yorkshire Club, 19.—27. 8. Midland Club, 2.—16. 9. Derbyshire und Lancashire Club, 3.—16. 9. Yorkshire Club, 8.—17. 9. London Club. Aufenthalt und Schulung 14 Tage 12 Guineas.
Francis Allen f, engl. Segelflieger, verheiratet mit Miss Naomi Maxwell,
28. 1. 39 an einer Operation in Oesterreich gestorben.
<£uß-%st.

Amerik. Riesenflugzeug der General Development Co. of Connecticut, 8800 PS, Konstrukteur Ing. Dr. Whitney Christmas, Beschreibung „Flugsport" 1929 S. 499, ist nie zur Durchführung gelangt.
Literatur.
(Die hier besprochenen Bücher können von uns bezogen werden.)
Jane's All The World's Aircralt 1938, zusammengestellt und herausgegeben von C. G. Grey und Leonard Bridgman. Preis 2 Guineas. Verlag Sampson Low, Southwark Street, London.
Pünktlich mit Beginn des Jahres ist Jane's Jahrbuch, ein zur Gewohnheit gewordenes Standardwerk, mit seiner ausgezeichneten Zusammenstellung über den Stand des Weltluftverkehrs und der Entwicklung des Flugzeugbaues erschienen. Mr. C. G. Grey gibt in der ihm eigenen Art einen unparteiischen Ueberblick über die Situation der Fliegerei. Er verweist auf die politische Krise im vergangenen Jahr, während welcher Zeit bereits Messerschmitts und Spitfires vorhanden waren. Was hiernach an Kriegsflugzeugen folgt, ist in der Entwicklung noch nicht so weit, daß darüber gesprochen werden kann. Die Seitenzahl über die Flugzeugtypen ist von 344 auf 316 und die Zahl der Abbildungen von 603 auf 557 zurückgegangen. Mr. Grey hebt dann hervor, daß allein durch den Rückgang der französischen Flugzeugindustrie der für die Beschreibung der franz. Typen um 15 Seiten und die Abbildungen um 34 zurückgegangen sind. Die deutsche Flugentwicklung, welche im vergangenen Jahr 30 Seiten beanspruchte, ist auf 34 Seiten gestiegen und die Abbildungen von 62 auf 71.
Die russische Abteilung über neue Flugzeugtypen ist sehr zurückgegangen. Neue Typen sind seit 1937 nicht mehr erschienen.
An dem Jahrbuch, welches zum 22. mal erscheint, haben Mrs. McAlery, Mr. Leonard Bridgman und Mr. Ihursten James mitgearbeitet. Auch das neue Jahrbuch wird in keiner Bibliothek fehlen.
K JL E AI M
Kl 32
dreisitzige Kabine in fast neuwertiger Verfassun g,Spezial-ausführung, sehr bequeme Reisemaschine,nur gegen bar zu verkaufen. Anfragen an
S. Zell, Emmerieh-Rh.
Postfach 115
In den nächsten Tagen erscheint
Pafenfsammlung Band VII
enthaltend die Flugpatente der Jahre 1937 und 1938. Preis RM 6.30 portofrei. Redaktion u. Verlag Flugsport Frankfurt/M., Hindenburgplat;
Hochschulinstitut für Leibesübungen in Königsberg
sucht sofort einen
Leiter für die Abteilung Luftfahrt
Berücksichtigung finden nur solche Bewerber, die die hierfür erforderliche wissenschaftliche und technische Ausbildung nachweisen können und auf Grund ihrer fliegerischen Ausbildung in der Lage sind, einen großen Flugbetrieb zu leiten. Bewerber muß anerkannter Segelflughauptlehrer des NSFK. sein. Alter nicht unter 25 Jahren.
Besoldung je nach Vorbildung, entweder als Angestellter im öffentlichen Dienst (TOA) oder bei Beamten unter Weiterzahlung des Gehalts. Daneben wird eine Fliegerzulage in Höhe von RM 60.— monatlich gezahlt. Reise- und Umzugskosten, sowie gegebenenfalls Trennungsentschädigung für Verheiratete werden nach den gesetzlichen Bestimmungen gewährt. Parteimitglieder erhalten bei gleichen Voraussetzungen den Vorzug. Bewerbungen sind, umgehend an das Institut einzureichen.
Maschinenbau / Automobil- w. Flugtechnik 1 Elektrotechnik.__Programm kostenlos I
■ cawit. Birken<Flugzeugi Sperrholzplatten
deutsches Fabrikat bei Rekordüflgen erprobt, in den Qualitäten: AVIATIC, SPEZIAL, GLEITFLUG in allen Stärken von M-8 mm liefert prompt ab Lager
Georg Herte
B@rlin*Charlottenburg
Kaiser Friedrich-Straße 24 Fernspr.-Sammelnummer: 34 5841 Telgr.-Adr.: PlieKerhölzer Berlin
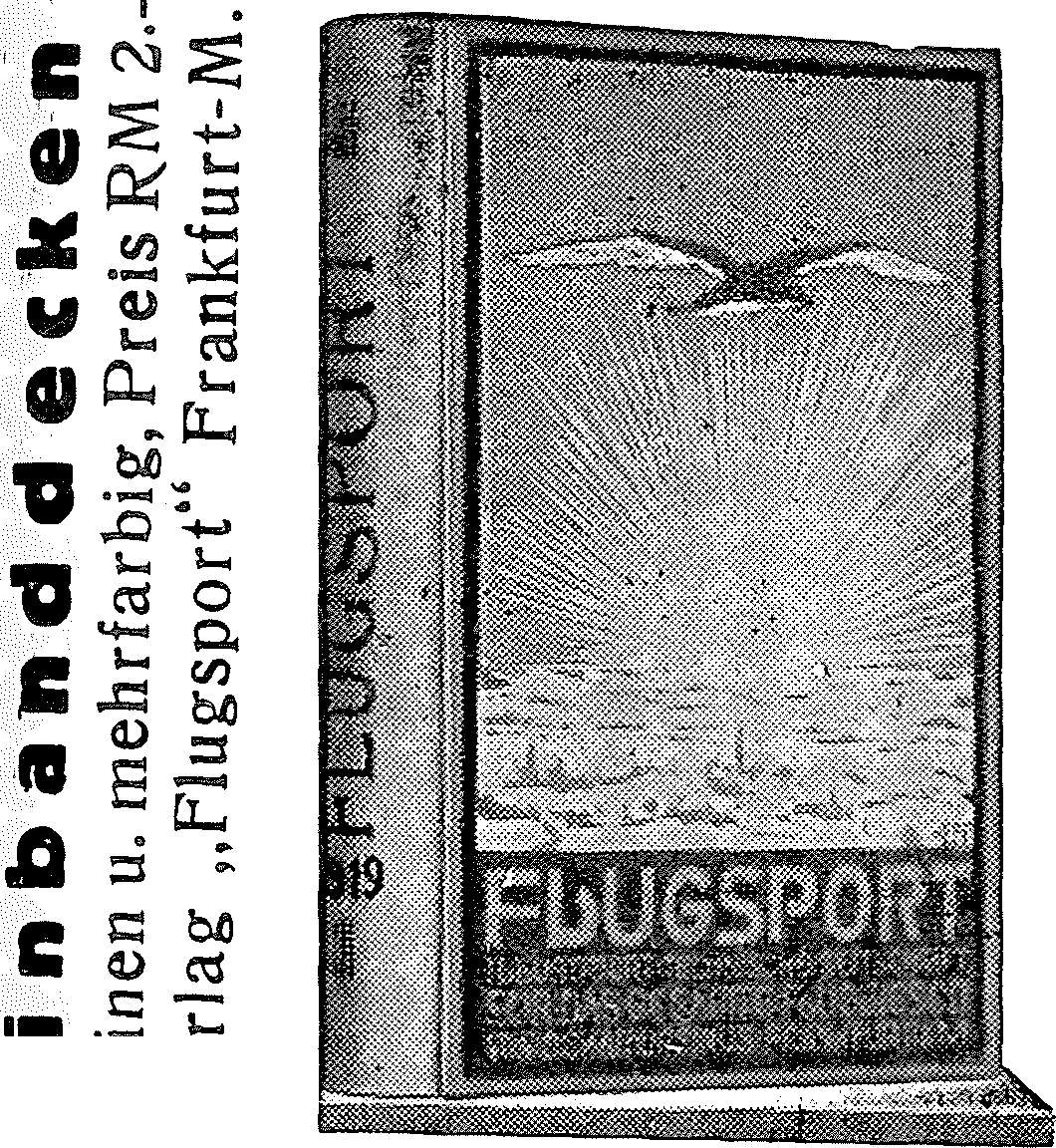
Jetzt
noch preisgünstiger!
Die Freuden, die das Selbstfilmen Ihrer eigenen Erlebnisse bietet, sind noch leichter erreichbar durch Nizo 8 E-S, die neue, preis-gün tige 8-mm-Kinokamera mit Auswechseloptik 1:2,5 auch für Zeitdehneraufnahmen und dem neuen lichtstarken, überaus kleinen und leichten Nizo-Projektor 8 NL. - Druckschrift Nr. M 33 kostenlos von Herstellerfirma
.5 -.. * ■ ■ 6. m. b. H.
MÜNCHEN 23'
.FLUGSPORT"
üiillllllMHi
Mause
HlllMllllliii
S^temCo^
multipliziert subtrahiert dividiert addiert
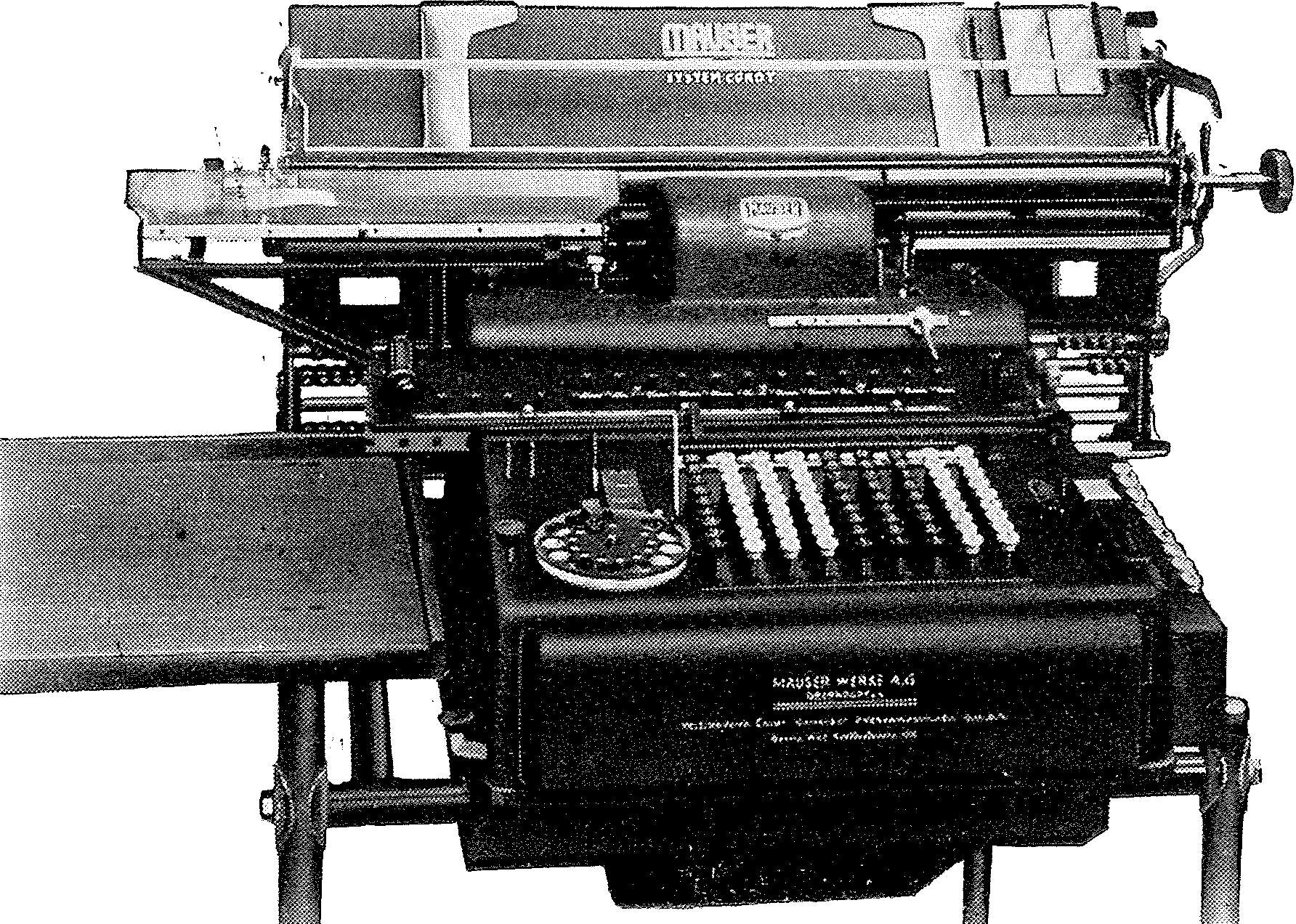
^ . Li
schreibt Aufgabe und Resultat nieder und speichert in 19 Zählwerken. Fordern Sie bitte Prospektmaterial und Muster-Arbeiten an.
Weltvertrieb durch:
CORD-UNIVERSAL-RECHENMASCHINEN-GESELLSCHAFT
M. B. H.
Berlin W 62 - Kurfürstenstr. 105 - Tel. 24 2406
Zur Leipziger Frühjahrsmesse
a. d. Stand d. Mauserwerke A.-G., Halle 6, Block III
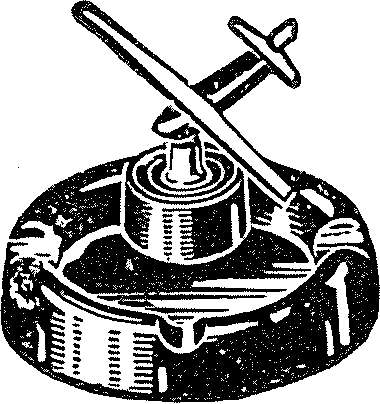
fltto-JMditr
mit betDeglidiem flugjeug, öet paffenbe Sefdienhattihel „ . . . . ... , t
ftftG.m.M.[nulila6ll
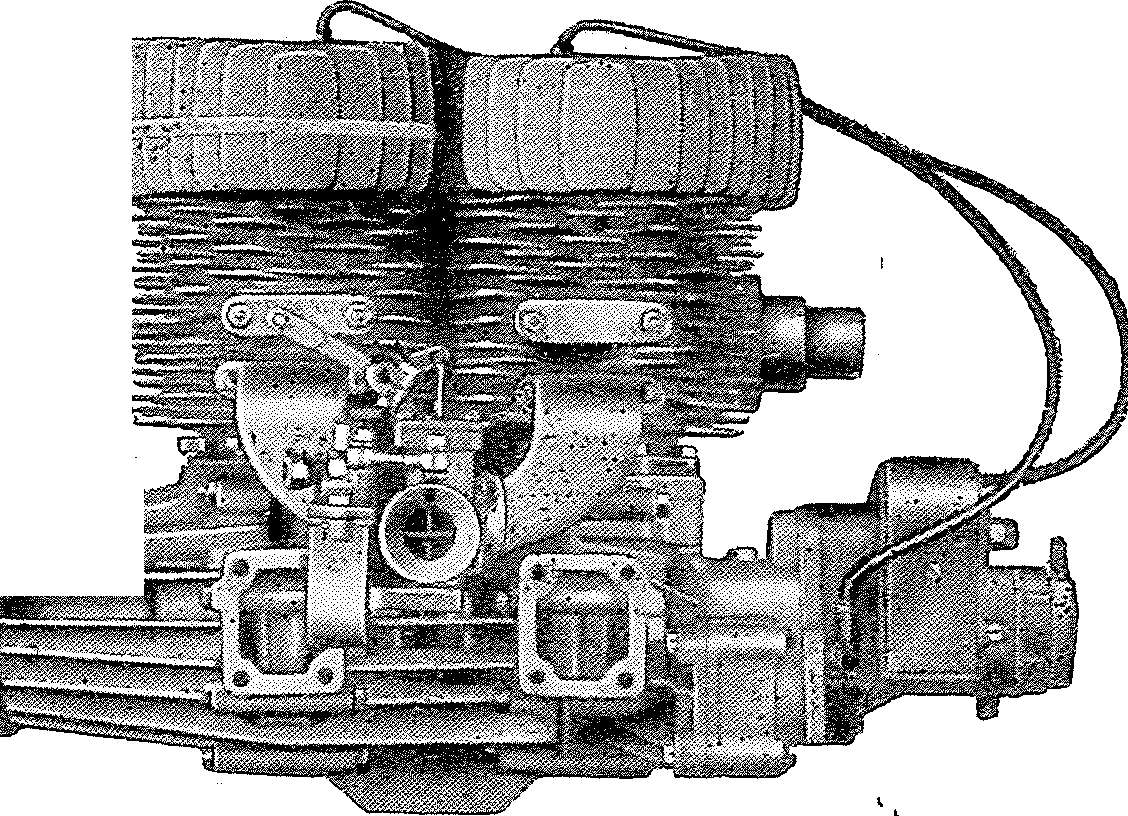
Kleinllugmoioren iflr Einsitzer u. motorgleiter 1000 cm3
Dauerleistung 24 PS bei 2400 n / Start- u. Steigleistung 28 PS stehend oder hängend einzubauen.
SelcUKompressorenbau 2;"B; Heidelberg
Rohrbaeheri!raf|e 36 Telefon 6323
Heft 6/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro K Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalten und Verlag; Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ..Nachdruck verboten" versehen, nur mit E e n a u e r Quellenangabe gestattet.
Nr. 6 15. März 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 29. März 1939
Deutsches Olympiaflugzeug.
Deutschland hat der Welt nicht nur den Segelflug gegeben, sondern ist auch in den Jahren der Entwicklung seit 1920 in der Welt führend geblieben. Die Föderation Aeronautique Internationale hatte beschlossen, ein einheitliches Flugzeug für den Olympia-Segelflug zu schaffen. Gefordert wurde beste Einsatzmöglichkeit des Flugzeuges auch bei schlechten Wetterlagen im olympischen Wettbewerb, einfacher Aufbau des Flugzeugs, um einen leichten Nachbau in allen Ländern zu ermöglichen.
In der Zeit vom 19. bis 25. 2. fand in Rom ein Vergleichsfliegen statt, bei welchem, wie wir bereits berichteten, alle im Segelflug führenden Nationen vertreten waren. Nach einer eingehenden Prüfung der erschienenen 5 Baumuster aus Deutschland, Italien und Polen auf dem Segelfluggelände von Sezze bei Rom entschied sich die technische Kommission der FAI für das Baumuster „DFS — Meise". Hiermit ist zum erstenmal ein Segelflugzeug überhaupt zur Benutzung in der Welt genormt worden, wieder einmal ein Beweis, daß deutsche Ingenieur-arbeit aus dem Gebiet des Segelfluges an der Spitze marschiert.
Auf dem Olympia-Segelflugwettbewerb Helsinki 1940 wird demnach als Einheitsflugzeug eine deutsche Konstruktion von allen Teilnehmern der Welt benutzt werden.
Olympia-Leistungs-Segelflugzeug „DFS-Meise".
Nach dem Vergleichsfliegen für das Olympia-Normalflugzeug hat man sich in Rom für das von der DFS., Konstrukteur Jacobs, gebaute Segelflugzeugbaumuster „Meise" entschieden. Spannweite, Rumpfbreite, Rüstgewicht, Festigkeitsvorschriften waren von der FAI. genau vorgeschrieben. Dem Konstrukteur blieb trotzdem weitgehender Spielraum in den Ausführungsmöglichkeiten, aerodynamische Formgebung wie überhaupt konstruktiver Aufbau, vorbehalten.
Für die Herstellung sämtlicher Einzelteile in Holz wie auch in Stahl wurde immer die einfachste Ausführungsform gewählt, um einerseits mit wenig geschulten Kräften für den Nachbau und andererseits mit
Diese Nummer enthält Patent-Sammlung Nr. 4.
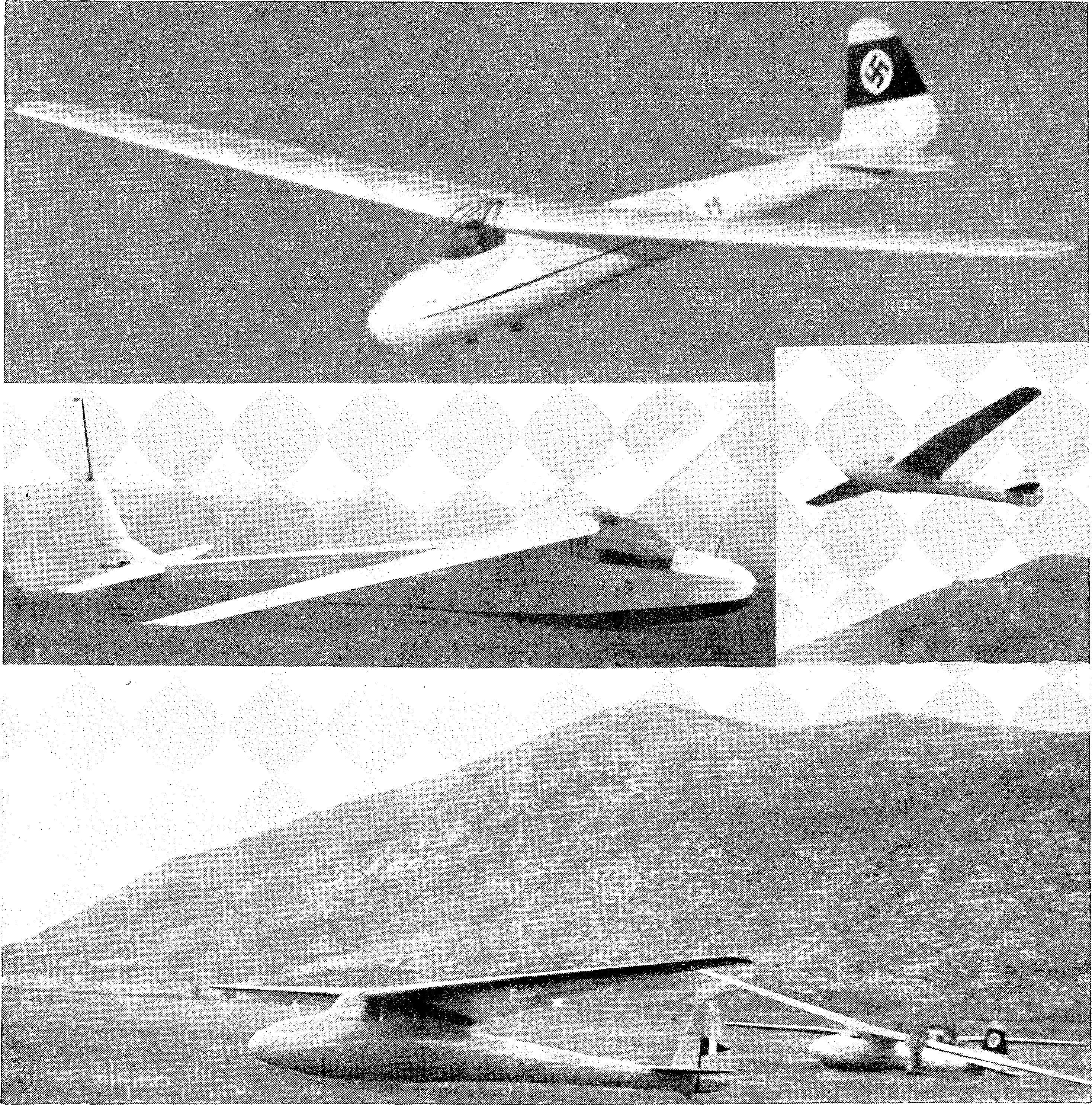
Vom Olympischen Segelflugzeug-Vergleichsfliegen in Rom. Oben: „DFS-Meise". Darunter links: „Mü 17 Merle" d. Flugtechn. Fachgruppe München, Konstrukteur Dipl.-Ing. Karch-München, Rumpf Stahlrohrkonstruktion. Rechts: Polen Typ „Or-lik", Knickflügel, dünner Flügel. Unten: Italien „AI 3", schmaler Rumpf, lange spitze Flügel. (Den zweiten italienischen Flugzeugtyp „Pelicano" werden wir in ^ einer der nächsten Nummern besprechen.) Archiv Flugsport
einem Minimum an Spezialwerkzeugen auszukommen. Schwierige Schweißstellen wurden vollkommen ausgeschaltet.
,JPtei der Konstruktion „DFS.-Meise" wurden die Flugleistungen und -erfahrungen beim Flügelentwurf der Segelflugzeugmuster „DFS.-Reiher" und „DFS.-Weihe" zugrunde gelegt, für den Innenflügel Prof. Gö 549 auf 16% verdickt, im Außenflügel Prof. Qö 676.
Die Abb. 1 zeigt, daß nach den vorliegenden Messungen dieses Profil für die hier zugrunde liegende Aufgabe des günstigsten Kompromiß-Flugzeugs als besonders geeignetes Profil bezeichnet werden mag. Der für diese Aufgabe maßgebende Ca-Bereich liegt zwischen 0,6 und 1,4. Profil 549 ist in den Göttinger Versuchsreihen zweimal enthalten. Da die Werte wesentlich voneinander abweichen, wurde eine dritte Nachmessung von der DFS. im neuen großen Göttinger Kanal durchgeführt (in der Abb. 1 mit III bezeichnet). Als vierte Vergleichsmessung können noch die Werte des Profils Gö 426 gelten,
welches mit geringer Aenderung der Profildicke mit 549 identisch ist. Zum Vergleich sind in der Abbildung die im Segelflugzeugbau bekannten Profile Gö 532 und Gö 535 sowie noch NACA 23012 eingetragen, wobei die Profilwiderstände aller dieser Profile auf die Dicke des Vergleichprofils 549 umgerechnet wurden. Die Darstellung zeigt, daß selbst unter Annahme der ungünstigsten Meßwerte oberhalb Ca = 0,6 Göttingen 549 überlegen ist. Ob für den Schnellflug NACA 23012 besser ist, kann wegen der starken Abweichung der Messung seitens der DVL. mit den übrigen Messungen sowohl im 7X10 ft-Kanal wie auch im Ueberdruckkanal der Amerikaner noch nicht eindeutig entschieden werden. Hier sind noch wTeitere Messungen, evtl. Flugmessungen, abzuwarten. Daß andererseits für den Langsamflug Gö 535 aus der Darstellung als das günstigste herausfällt, ist ja ein bekanntes Ergebnis.
Im Außenbereich des Flügels ab 0,6 der Halbspannweite wurde statt 549 das Profil Gö 676 verwandt, welches sich durch einen sehr breiten c -Bereich auszeichnet.
Abb. l. Proiiimessungen. Die aerodynamische und geo-
metrische Schränkung des Flügels wurde mit 7° reichlich bemessen, um im überzogenen Flug seitliches
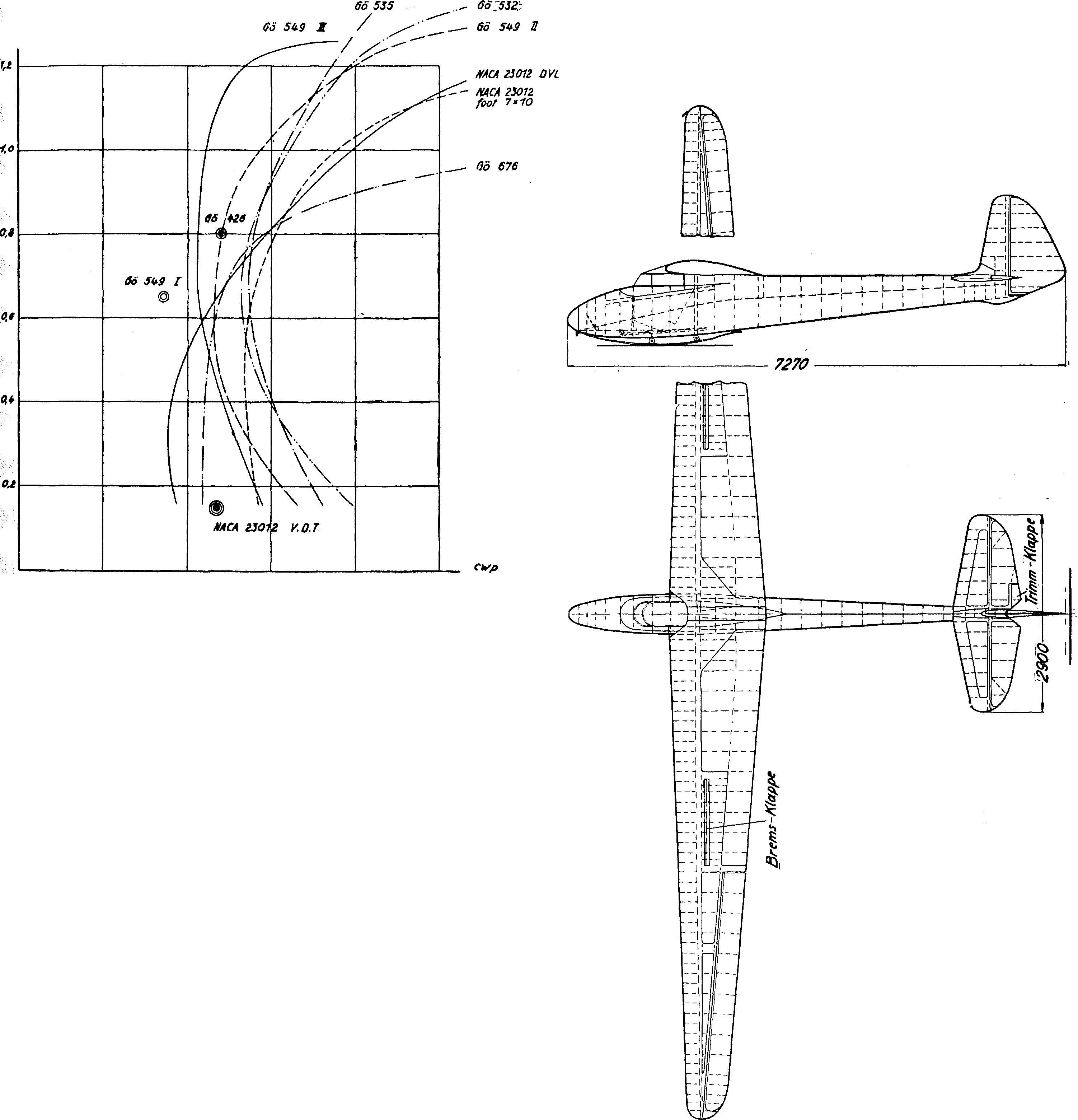
O.OO* 0,008 0,01t 0,016 0,0»
® Oö 5<*31.Mtsung--- M5W E.Messung
® Oä f26 - Oö 5H-9 M. Messung.
------- Oö 532.
--- Oö 535
------ Oö 676
- fi/ACA 23012 DVL Messung zwS'Nr-762^
----- NACA 23012 7>10 fror wind tunnel NACA Report'Nr'573
% NACA 23012 V, O. Tunnel NACA Report 530
9°
ISO (60 170 ISO
|
—* Vh* Km/h Horizontalgafchwinatgk. |
||||||||||||||
|
S? |
||||||||||||||
|
DFS - Meife QafchwiüctigkBltsdiagramm |
||||||||||||||
|
L |
\ |
|||||||||||||
|
^Inkge/thwindlgkett |
—V |
|||||||||||||
Abb. 3. Uebersichtszeichnung.
Zeichnung Flugsport
Abb. 2. Leistungskurve, gerechnet und gemessen.
Zeichnung DFS
Abkippen zu vermeiden. Der Flügel hat eine V-Stellung von 2,5° (bezogen auf Holm-Mitte), die sich nach einer Reihe von Versuchen als die günstigste für den Kurvenflug bei dem vorliegenden Flugzeug ergeben hat. Zur Erzielung guter Flugeigenschaften und Ruderwirksamkeiten wurde der Leitwerksabstand von Flügel-Vorderkante bis zum Leitwerks-Druckmittel mit 4,5 m sehr groß gewählt und auch die Leitwerksflächen ausreichend bemessen.
Von der Verwendung eines Knickflügels wurde aus baulichen Gründen abgesehen. Außerdem hat sich bei einer Reihe von Segelflugzeugen herausgestellt, daß bei ausreichender V-Stellung der Flügel und bei genügender Wirksamkeit der Seitenleitwerksfläche eine feste Kurvenlage für Blindflug und gute Richtungsstabilität vorhanden ist.
Abb. 2 zeigt die Leistungskurve des Flugzeugs. Nach der Entwurfsrechnung ergaben sich die Werte, die in der ausgezogenen Kurve dargestellt sind. Die eingetragenen Kreise sind die sich aus Leistungsmessungen ergebenden Werte. Die Messungen wurden durchgeführt ohne Kufenverkleidung, so daß die wirklichen Werte noch einige Prozent günstiger liegen dürften.
Gemessene Werte: Gleitwinkel 1 : 25, Sinkgeschwindigkeit 0,67 m/Sek., geringste Geschwindigkeit 50 km/h.
Tragwerksaufbau normal. Die Biegekräfte werden durch einen geraden Doppel-T-Holm aufgenommen und die Drehkräfte über die drehsteife Nase und das Flügelschulterstück in den Rumpf eingeleitet (Abb. 4).
Die Abb. 5 u. 6 zeigen einige Rippenbeispiele. Der Zusammenbau der Rippen mit dem Holm erfolgt auf die übliche Weise durch Ueberschieben der Rippen über den Holm. Ober- und Unterseite des Holmdurchlasses werden vorher durch aufgeleimte Leisten überbrückt.
Sämtliche Beschläge möglichst einfach ausgebildet. Die Hauptholmbeschläge (Abb. 7) sind glatte Bleche mit aufgeschweißten Verstärkungen an den Augen und einem eingeschweißen Quersteg. Die vier Beschläge für Ober- und Unterseite der Holme sind vollkommen gleich ausgeführt, so daß sämtliche acht Laschen und Verstärkungen gemeinsam gebohrt werden können. Um die Beschläge in die An-
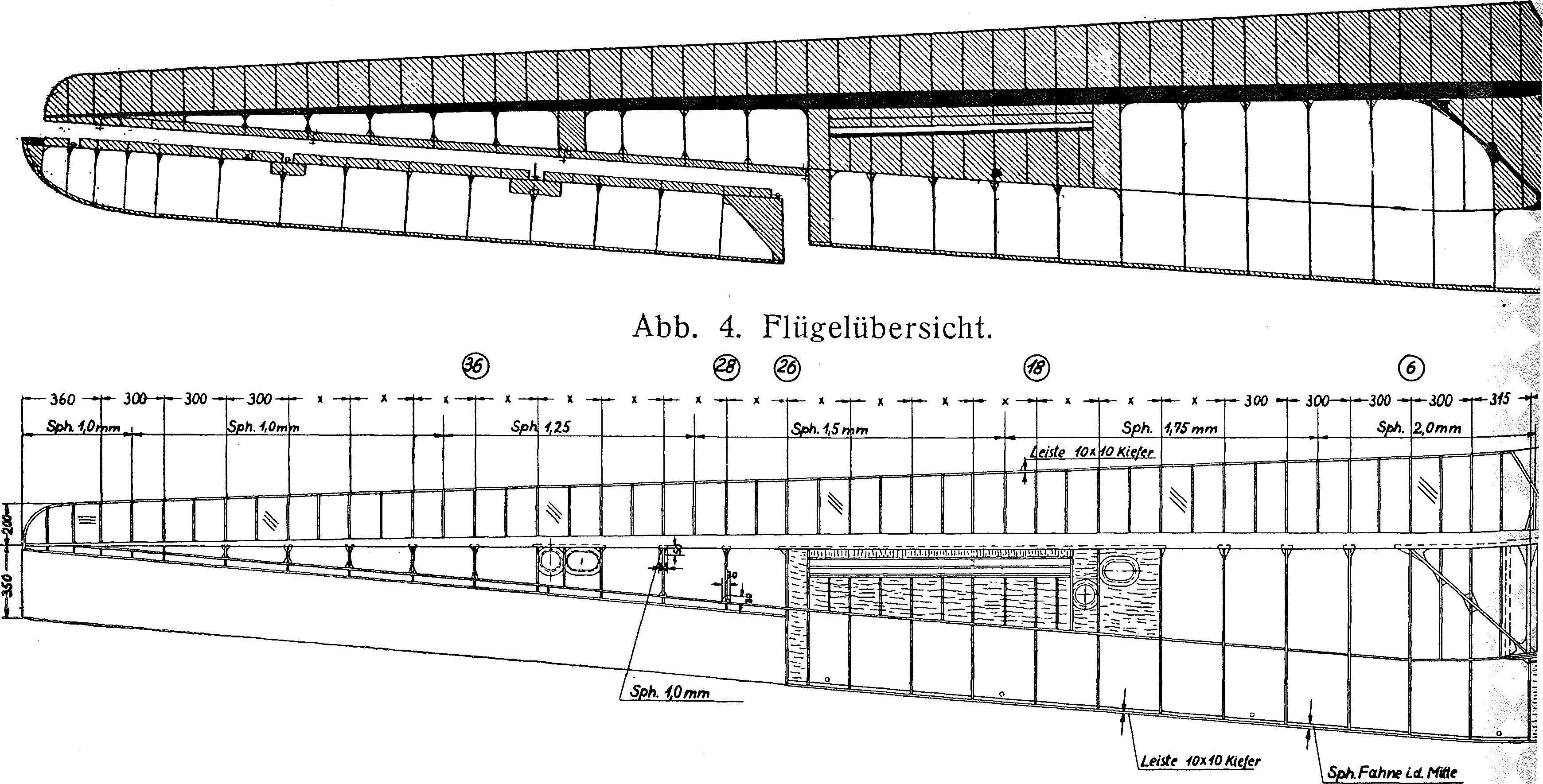
Abb. 5. Flügel der Olympia-Meise. Die Profilrippen Nr. 6, 18, 26, 28, 36 sind
in Abb. 6 wiedergegeben. Zeichnungen dfs
schlußebene zu bringen, werden die erforderlichen Abschrägungen am Holm vorgenommen.
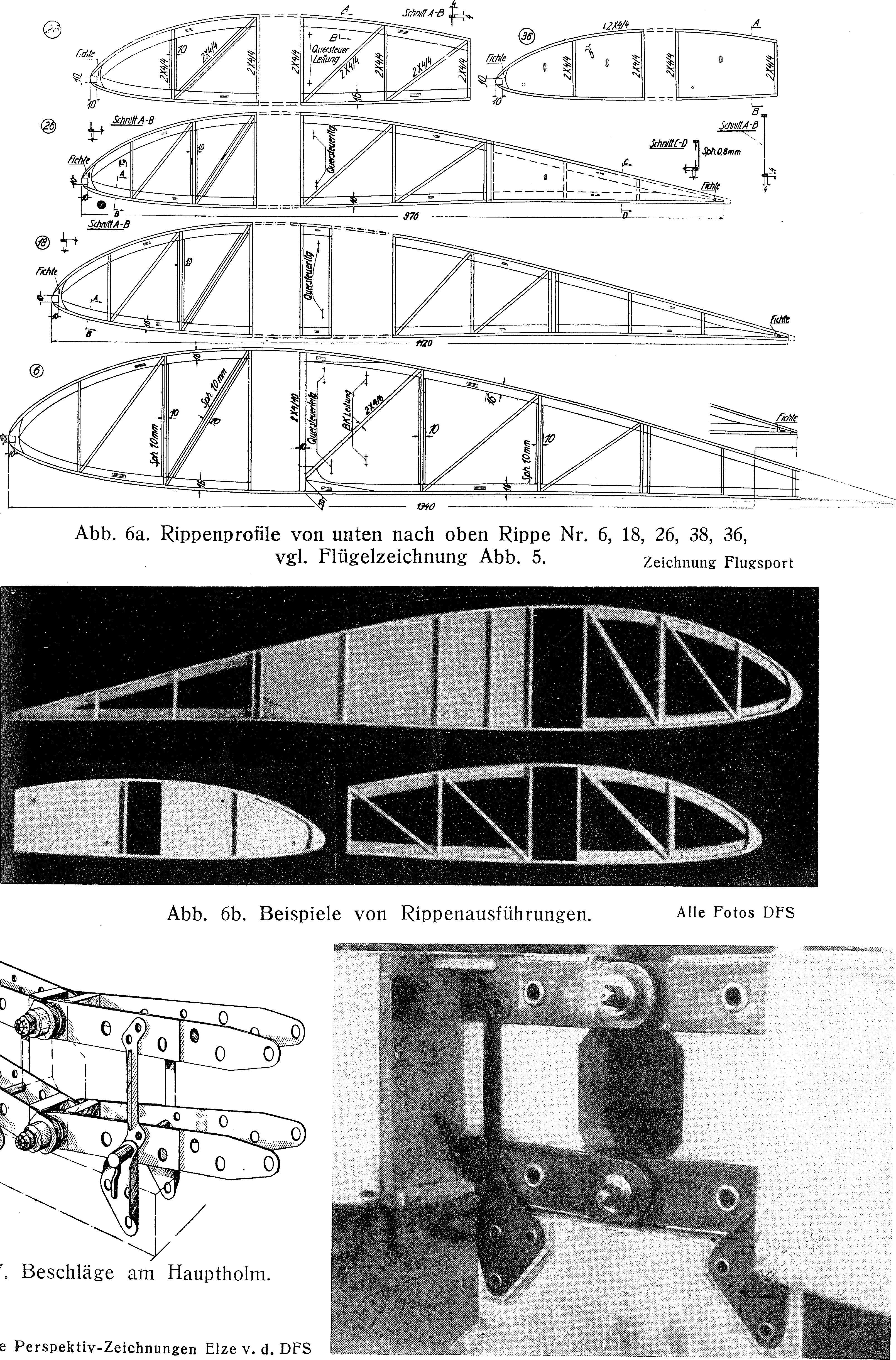
Anschlußbohrung im unteren Hauptbeschlag für die Rumpf-Flügel-Verbindung kann für den Einzelbau bei der Rohbaumontage durchgeführt werden. Der Hauptholmbeschlag dient also gleichzeitig als Rumpf-Flügel-Verbindungsbeschlag, so daß die Herstellung eines besonderen Beschlages gespart wird. Auch die Rumpfbeschläge, die außen über die Hauptflügelbeschläge greifen, sind glatte Bleche mit Börtelkante und Steg.
Hinterholmanschluß am Rumpf Abb. 8. Die beiden Rumpf-Flügel-Anschlußbolzen sitzen in einer Achse, so daß nach Lösen der beiden konischen Hauptbolzen die Flügel dachförmig abgelassen werden können. Die Montage läßt sich ohne Schwierigkeiten durch drei Männer in kurzer Zeit ausführen. (Montage flugfertig 8 Min. und Demontage 4 Min.)
Der Anschluß der Querruder-Stoßstangen an die Umlenkhebel im Flügel erfolgt durch zylindrische Bolzen. Desgleichen der Anschluß des Bremsklappenantriebes. Automatische Anschlüsse für Ruder und Klappen sind nicht vorgesehen, da sie sehr genaue Werkstattarbeit voraussetzen würden.
Die Sturzflugbremsen-Ausführung und Einbau der Bremsklappen zeigen Abb. 9 u. 10. Antrieb erfolgt im Rumpf durch Stoßstangen und im Flügel durch Hebel und Seile. Im Bereich der Bremsklappen ist ein Kniehebel eingeschaltet, der ein sicheres Schließen der Klappen ohne Festhaltevorrichtung oder Gegenfedern auch bei höchsten Geschwindigkeiten gewährleistet. Die Klappen nach dem System Göppingen schieben sich parallel zum Hauptholm in einem schmalen Sehacht heraus. Diese Anordnung hat folgende Vorteile:
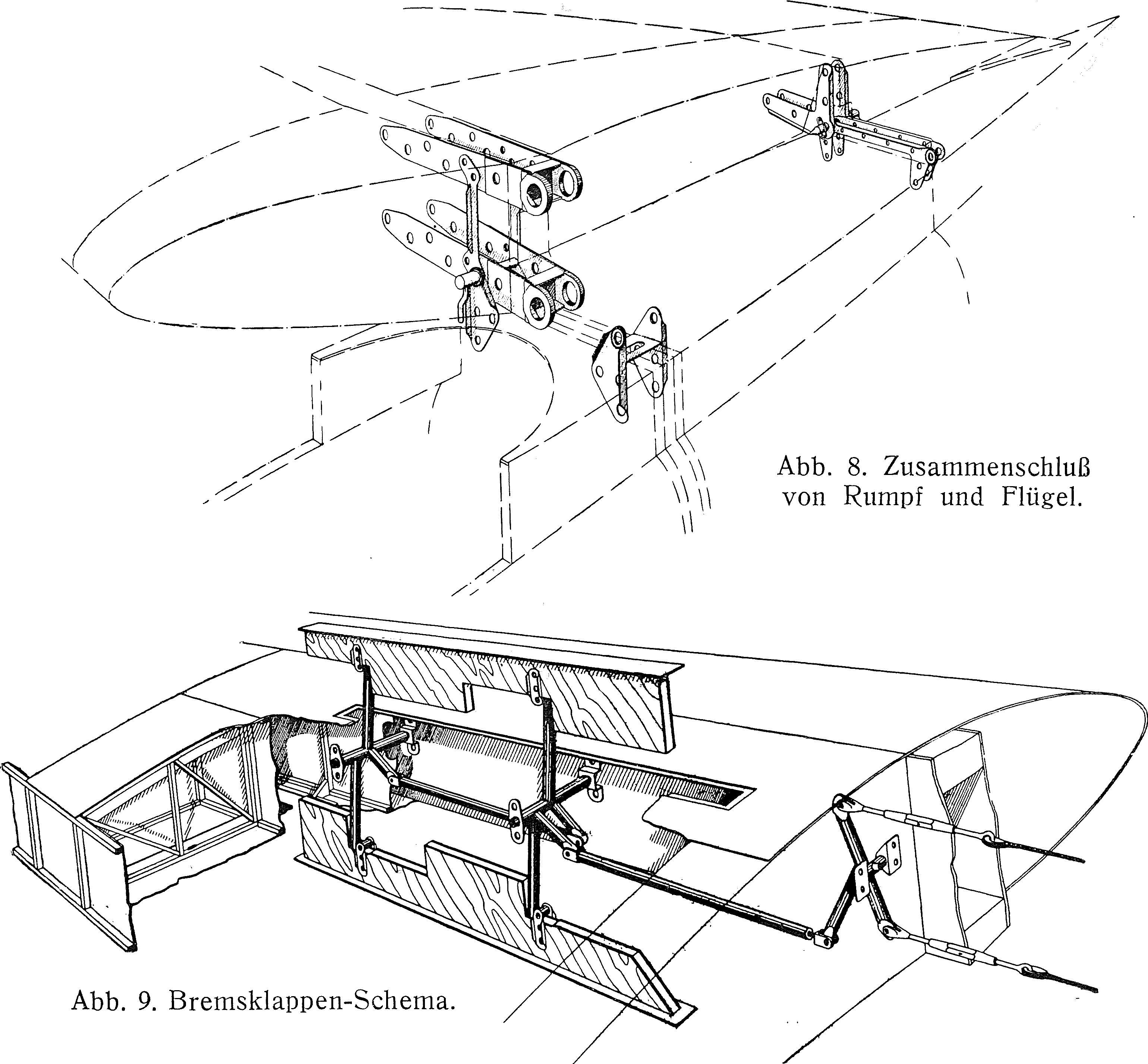
Abb. 10. Bremsklappen-Ausführung.
Die Bremsflächen können aus Holz hergestellt werden, da sich ein Verziehen der Klappen nicht ungünstig auf die Flügelglätte auswirkt.
Holzklappen sind billiger als Metallklappen mit den dazugehörigen Versteifungen.
Die gesamte Anpaßarbeit der Klappen wird wesentlich erleichtert, da nur ein schmaler Schlitz durch ein aufschraubbares Blech abgedeckt werden muß. Bei fertig eingebauten Klappen wird von der Oberseite entweder solange abgehobelt oder beigelegt, bis der schmale Deckel sauber paßt.
Die Rippenbauweise ist gegenüber der früheren Ausführung vereinfacht.
Der Schacht, in dem die Bremsklappen untergebracht sind, ist ein abgeschlossener Raum. Feuchtigkeit, die immer durch die Brems-
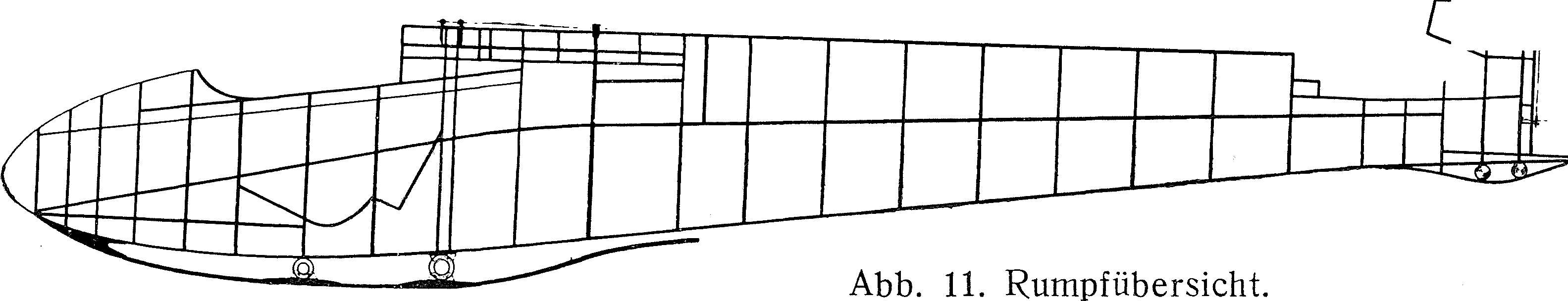
klappenschlitze eindringen wird, kann bei dieser Anordnung nicht ins Flügelinnere.
Rumpfbau zeigt, wie Abb. 11—13 erkennen lassen, die im Segelflugzeugbau übliche Ausführung. Die Gurte der Spante sind 2—3fach lamelliert und mit Sperrholzfahnen als Versteifung hergestellt. Die Doppel-T-Bauweise ist für sämtliche Spante einheitlich. Im hinteren Teil des Rumpfes haben die Spante auf der Ober- und Unterseite eine spitze Form. Die Zuspitzung der Rumpfoberseite ergab sich aus Flugeigenschaftsgründen. Diese Form bietet aber gleichzeitig den Vorteil einer vereinfachten Bauweise und ermöglicht ein müheloseres Aufbringen der Sperrholzbeplankung.
Die Fußsteuerung ist in zwei Ausführungen vorgesehen, und zwar eine billigere Konstruktion ohne Versteilvorrichtung, und eine elegantere Durchbildung, die eine Verstellung der Pedalen durch Kurbel im Flug ermöglicht (Abb. 14). Diese einfache und für den Führer bequeme Verstellmöglichkeit ist mit geringen Mehrkosten einzubauen. Beide Fußsteuerungen sind als Stahlrohrgerüste mit einem Fußbrett aus Holz ausgeführt. Die Pedale sind an der Unterkante gelenkig an einem Spant angeschlossen. Bei der verstellbaren Fußsteuerung ist dieses Gelenk auf zwei Rohren und einem Querrohr durch eine Spindel verschiebbar angeordnet. Durch die aus der Abb. 14 zu ersehende Seilführung ist es möglich, die Verstellung ohne Lösen von irgendwelchen Teilen durchzuführen.
Rollenböcke werden an den verschiedensten Stellen, die entweder schief verschweißt oder unterlegt, benötigt. Für die „DFS.-Meise" ist
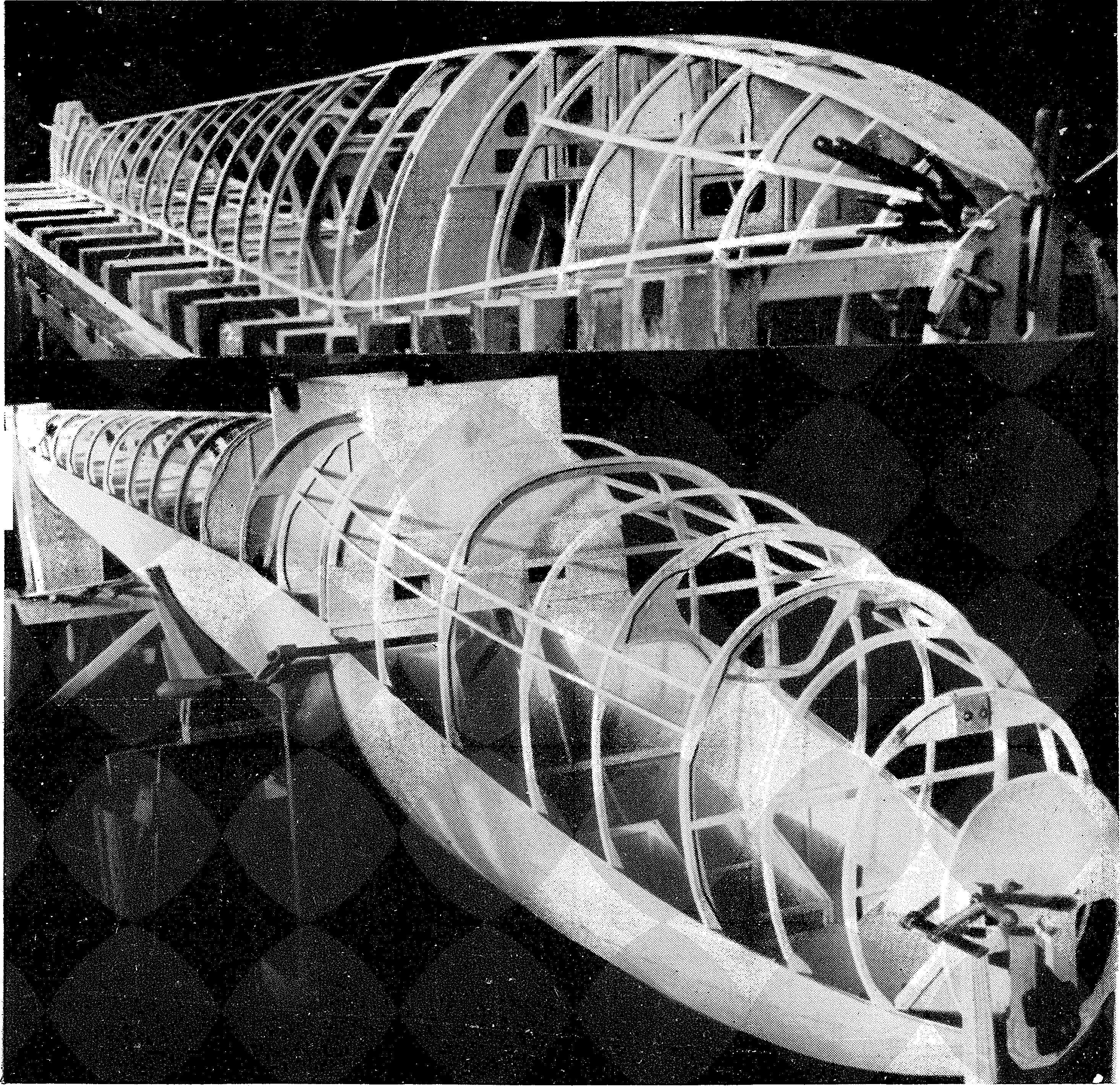
Abb. 12. Rumpf im Rohbau.
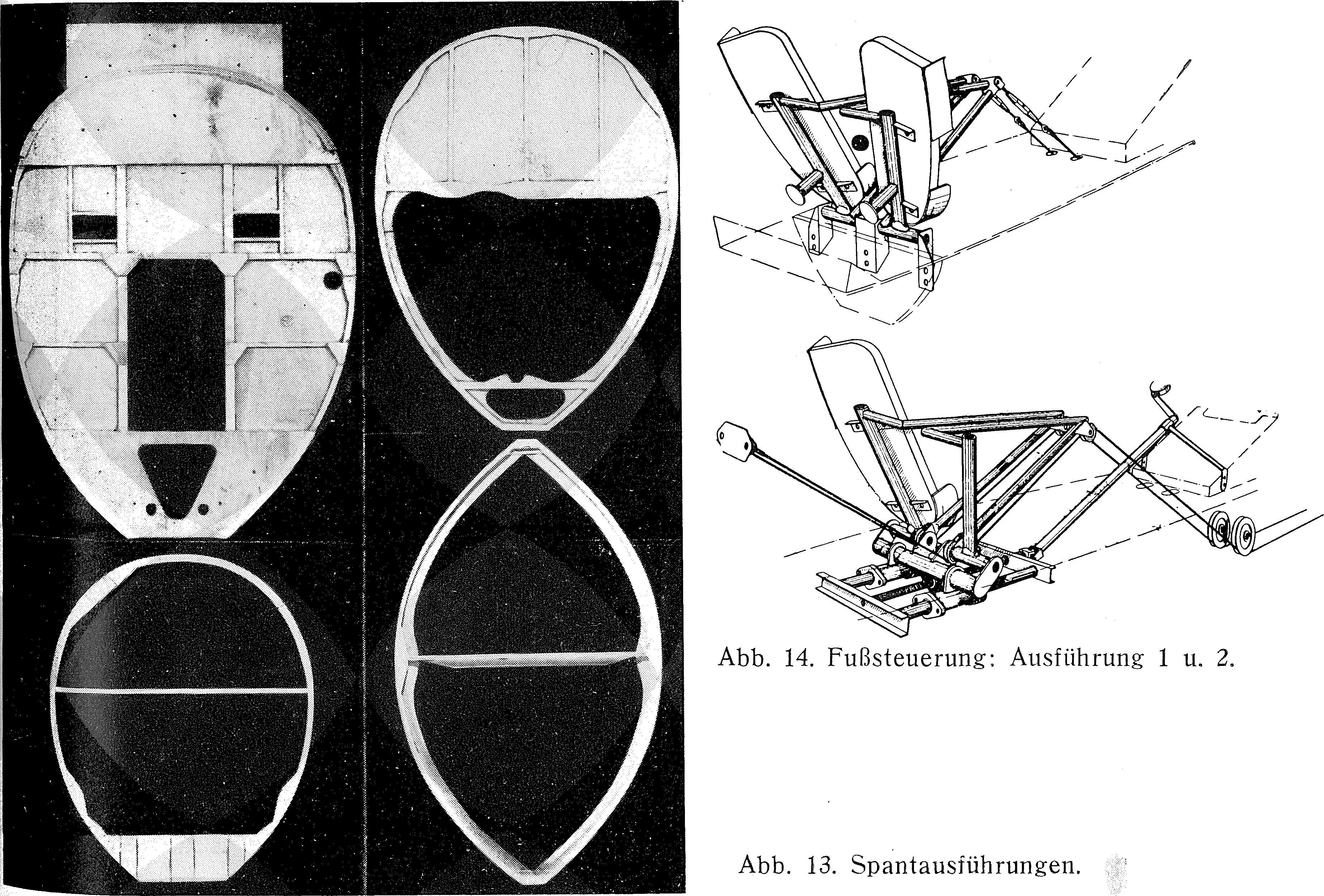
ein Einheitsbeschlag: vorgesehen, der je nach Verwendungszweck angebracht werden kann (Abb. 16). Das Loch für den Hauptbolzen wird gebohrt und der Bock kann jetzt um den Bolzen gedreht oder auch geschwenkt werden. Hat der Rollenbock die richtige Stellung, wird die Schraube angezogen und die Drehsicherung angebracht. Auf diese Weise wird immer ein einwandfreier Seilauflauf erzielt.
Bei der Handsteuerung ist auf den leichten Ein- und Ausbau derselben Rücksicht genommen. Die Hauptwelle ist zweiteilig, um sie auch nach dem Zusammenbau des Rumpfes montieren oder bei Bruch leicht demontieren zu können. Die Hauptwelle ist zweimal gelagert, und zwar am Vorderteil kardanisch an einem Qtierrohr, welches durch zwei Bolzen gegen die Sitzträger verschraubt wird. Dieses La<?er nimmt die Druckkräfte auf. Das hintere Lager hat nur vertikale oder seitliche Kräfte aufzunehmen und ist als Lasche ausgebildet. Durch diese Art der Lagerung kann die Steuerung nicht verkantet eingebaut werden und wird trotz Gleitlager immer leichtgängig sein.
In dem gesamten Flugzeug sind insgesamt nur vier Kugellager vorgesehen. Die Lagerungen der wichtigsten Steuerteile sind als Bronze-Gleitlager mit Fettschmiernippel ausgebildet. Der Aufbau dieser Gleitlager wurde vereinfacht. Es sind keine eingepreßten Bronzebuchsen vorgesehen, sondern Distanzrohre aus Bronze, auf denen die Beschlagslager gleiten. Hiermit wird die für die Gruppen schwierige Arbeit des Einpressens der Bronzebuchse vermieden und außerdem das sonst übliche Distanzrohr aus Stahl gespart. Alle verwendeten Bronze-Distanzrohre haben gleichen Querschnitt, so daß für diese Lager nur eine Reibahle (10 mm) erforderlich ist.
Die Kufe wird durch Ring-Gummiklötze und der Sporn durch zwei Tennisbälle abgefedert. Baustoff für Kufe und Sporn Esche, beide können bei Bruch schnell ausgewechselt werden (Abb. 11).
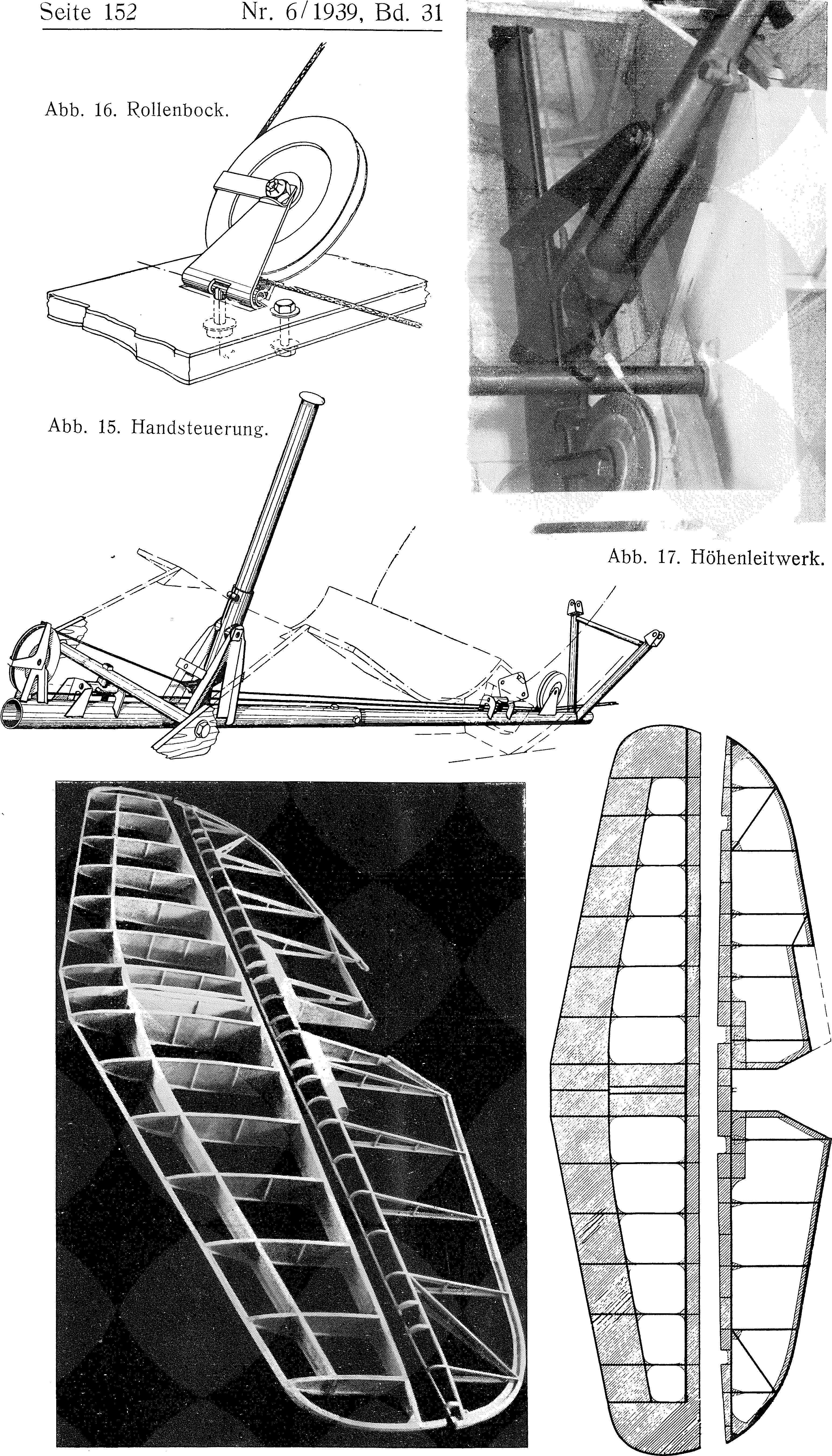
Abb. 18. Höhenleitwerk im Rohbau.
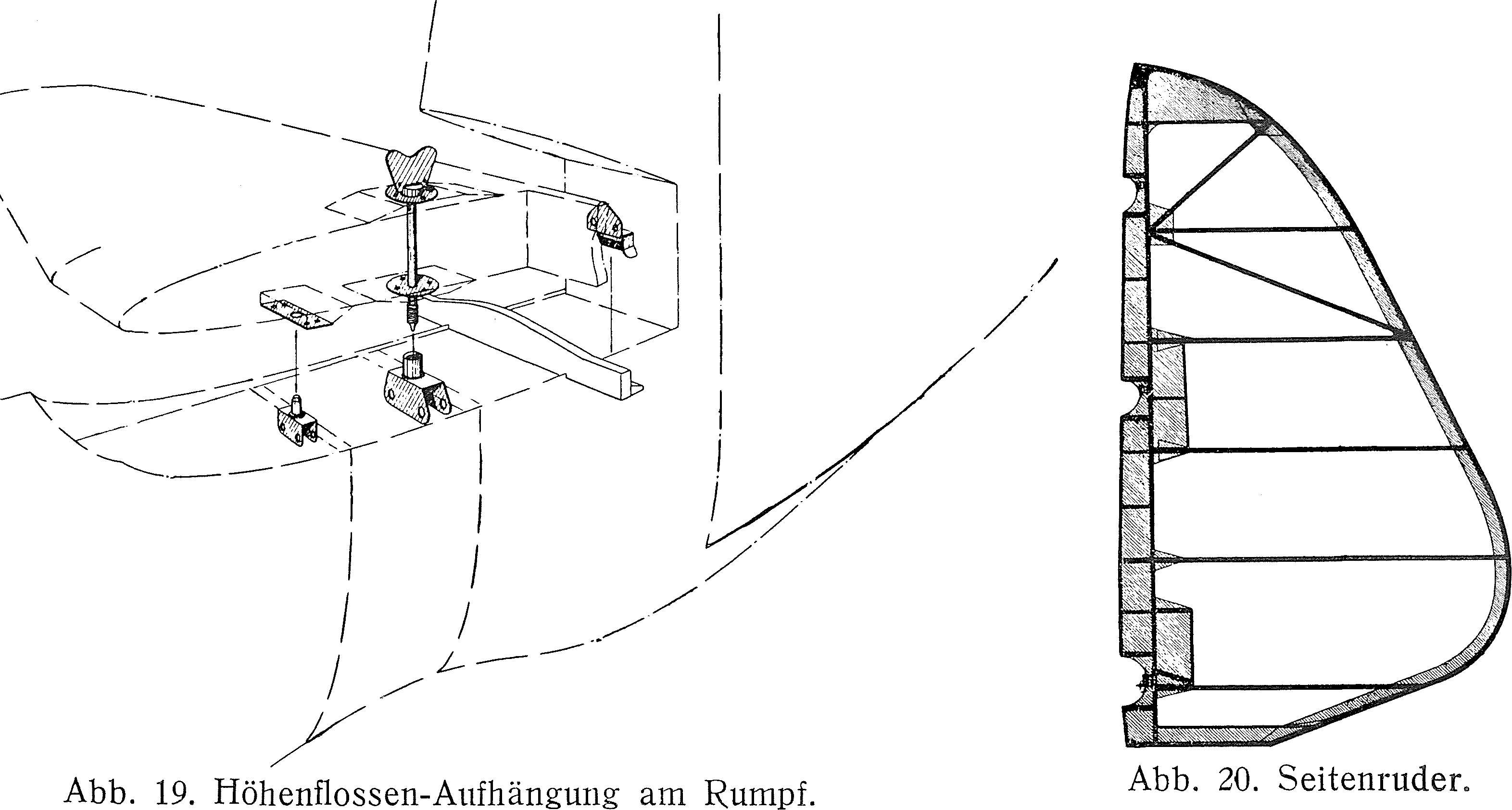
Gepäckraum mit Unterbringmöglichkeit für Barographen ist hinter dem vorderen Hauptspant, bequem nach außen zugänglich, vorgesehen.
Höhenleitwerk. Aufbau der Höhenflosse mit Ruder zeigen Abb. 17 u. 18. Aus Gewichts- und baulichen Gründen wurde für die Höhenflosse die zweiholmige Bauweise beibehalten. Sämtliche Rippen in U-Bauweise sind einseitig durchgehend mit Sperrholz beplankt. Die Holme sind in der gleichen Bauweise ausgeführt. Das Höhenruder ist gewichtlich ausgeglichen und mit einem vom Führersitz verstellbaren Trimmruder versehen. Die Verstellung erfolgt durch einen Bowden-zug, der nur auf Zug beansprucht und durch eine Gegenfeder im Höhenruder strammgehalten wird.
Die Verbindung der Höhenflosse mit dem Rumpf erfolgt durch eine Schraube mit Flügelmutter, Beim Aufsetzen der Höhenflosse setzt sich diese mit zwei am Hinterholm befestigten Beschlägen auf den Querarm, der aus dem Rumpf herausragt. Am Vorderholm setzt sich der in Abb. 19 dargestellte Stift in einen Beschlag und sichert so die Höhenflosse gegen horizontales Drehen. Diese einfache Montage wird durch die Abb. 19 veranschaulicht.
Der Aufbau des Seitenruders entspricht dem des Höhenruders. Die Drehkräfte werden von der Sperrholznase aufgenommen. Für sämtliche Ruder hat es sich aus Steifigkeits- und baulichen Gründen als günstig erwiesen, die Drehkräfte nicht durch die Diagonalen, sondern durch die Sperrholznasen der Ruder aufzunehmen (Abb. 20).
Spannweite 15 m, Flügelfläche 15 m2, mittlere Tiefe 1 m, Seitenverhältnis 15, Zuspitzung 1: 2,6, mittlere Flügeldicke 14,5%, Höhenleitwerksfläche 2,13 m2, Höhenleitwerksdicke 9%, Seitenleitwerksfläche 1,37 m2, Seitenleitwerksdicke 9%, größter Rumpfquerschnitt 0,55 m2, Flügelschränkung 7°.
Rüstgewicht 160 kg, Zuladung 95 kg, Fluggewicht 255 kg, Flügel (1 Stck.) 44,5 kg, Rumpf mit Seitenflosse 60,8 kg, Seitenruder 2 kg, Höhenleitwerk 7 kg.
B.-Nepomuk Sport-Zweisitzer.
Dieser Tiefdecker, Konstruktion Ing. Blumrich, Ausführung Josef Fritsche-Schönlinde, Sudetendeutscher, ist in der sudetendeutschen Kampfzeit als Privatflugzeug für Reise und Sport entstanden.
Rumpf Gemischtbauweise, zwei Sitze hintereinander, der vordere, als Gastsitz, kann bei Nichtbenutzung durch leichten Holzdeckel verschlossen werden. Steuereinrichtung nur im Hintersitz.
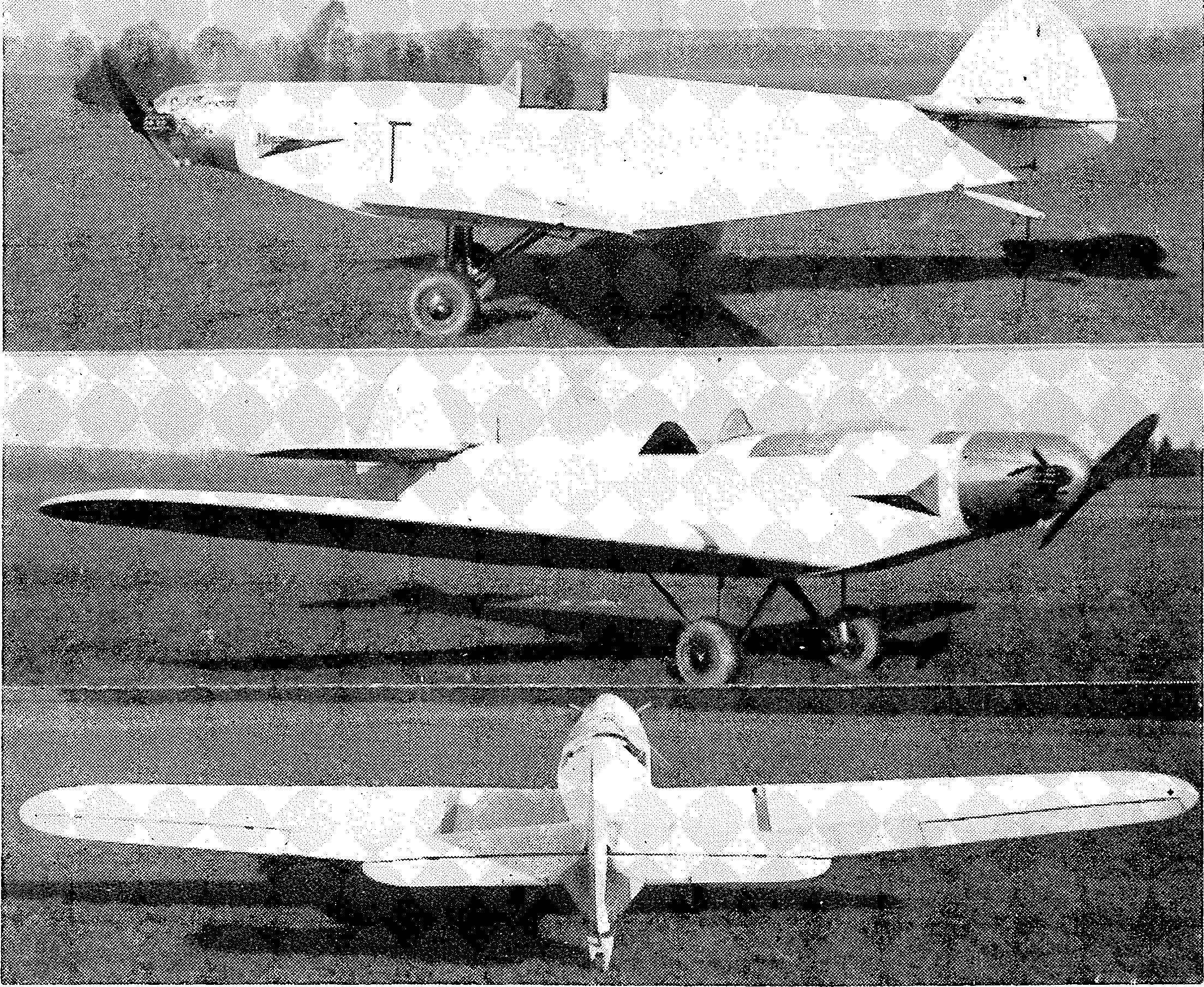
B.-Nepomuk-Sport-zweisitzer.
Bilder: Archiv Flugsport
Flügel und Leitwerk zweiholmig, bis Hinterholm mit Sperrholz beplankt. Flügel dreiteilig, Mittelstück mit Rumpf verbunden, um leichte Beschläge zu erzielen.
Fahrwerk normal, Dreistrebenausführung. Arbeitsaufnahme im Rad. Motor 23 PS Vaselin, Schwarz-Schraube.
Bei der Entwicklung war besonders darauf Rücksicht zu nehmen, daß die werkstattmäßige Ausführung mit einem Mindestaufwand an Arbeit und Geld durchzuführen war, denn als Fritsche im Winter 1934/35 mit der Arbeit begann, war er arbeitslos. Es ist bezeichnend für seine Zähigkeit, daß er in der Lage war, die Maschine unter den bedeutenden Schwierigkeiten tatsächlich fertigzustellen und mit Ausnahme einiger größerer Schweißarbeiten alles selbst zu machen. Im Mai 1937 kam der Nepomuk zum ersten Start. Die Flugeigenschaften waren sehr gut: Stabile Lage im Flug, gute Steuerempfindlichkeit, kurze Start- und Landestrecken.
Es mag mit die Folge dieser guten Ergebnisse gewesen sein, daß im Herbst 1937 die tschechischen Behörden ohne vorhergehende Verwarnung die Maschine beschlagnahmten. Nach längeren Verhandlungen erhielt sie Fritsche zurück. Die an die Rückgabe geknüpfte Bedingung ist bezeichnend für das unerhörte Vorgehen der tschechischen Behörden gegen Sudetendeutsche. Es heißt in dem Schreiben wörtlich: „---daß die Maschine so zu zerlegen ist, daß die einzelnen Teile nicht mehr als Teile eines Flugzeuges anzusprechen sind." Und es wurde auch für die Ausführung dieser Forderung gesorgt!
Zur Freude über die Befreiung des Sudetenlandes kommt nun auch die frohe Zuversicht, ohne Belästigungen weiterbauen zu können.
USA Timm T-840 Zubringerflugzeug.
Die vorliegende amerikan. Konstruktion der Timm Aircraft Corp. ist entstanden aus einer Umfrage in Kreisen, welche das Flugzeug als Verkehrsmittel benutzen. Es ist klar, daß die Anforderungen an ein Luftverkehrs-Flugzeug nur von den technischen Leitern einer Luftverkehrsgesellschaft beurteilt werden können, und nicht von dem Laien, welcher letzten Endes wünschen würde, daß das Flugzeug ohne
Flügel bis vor sein Hotel rollt. Wir haben dies Flugzeug bereits im „Flugsport" 1938, S. 333, beschrieben.
Die Abmessungen werden in letzter Zeit etwas abweichend wie folgt angegeben. Spannweite 15,2 m, Länge 11,5 m, Höhe 3,8 m, Fläche 35,7 m2. Leergewicht 2395 kg, Fluggewicht 3538 kg,
Flächenbelastung 99 kg/m2, Leistungsbelastung 4,2 kg/PS. Motoren zwei Wright „Whirlwind" R-975-E 3 von 420 PS.
U. S. A. Timm T-840.
Zeichnung Flugsport
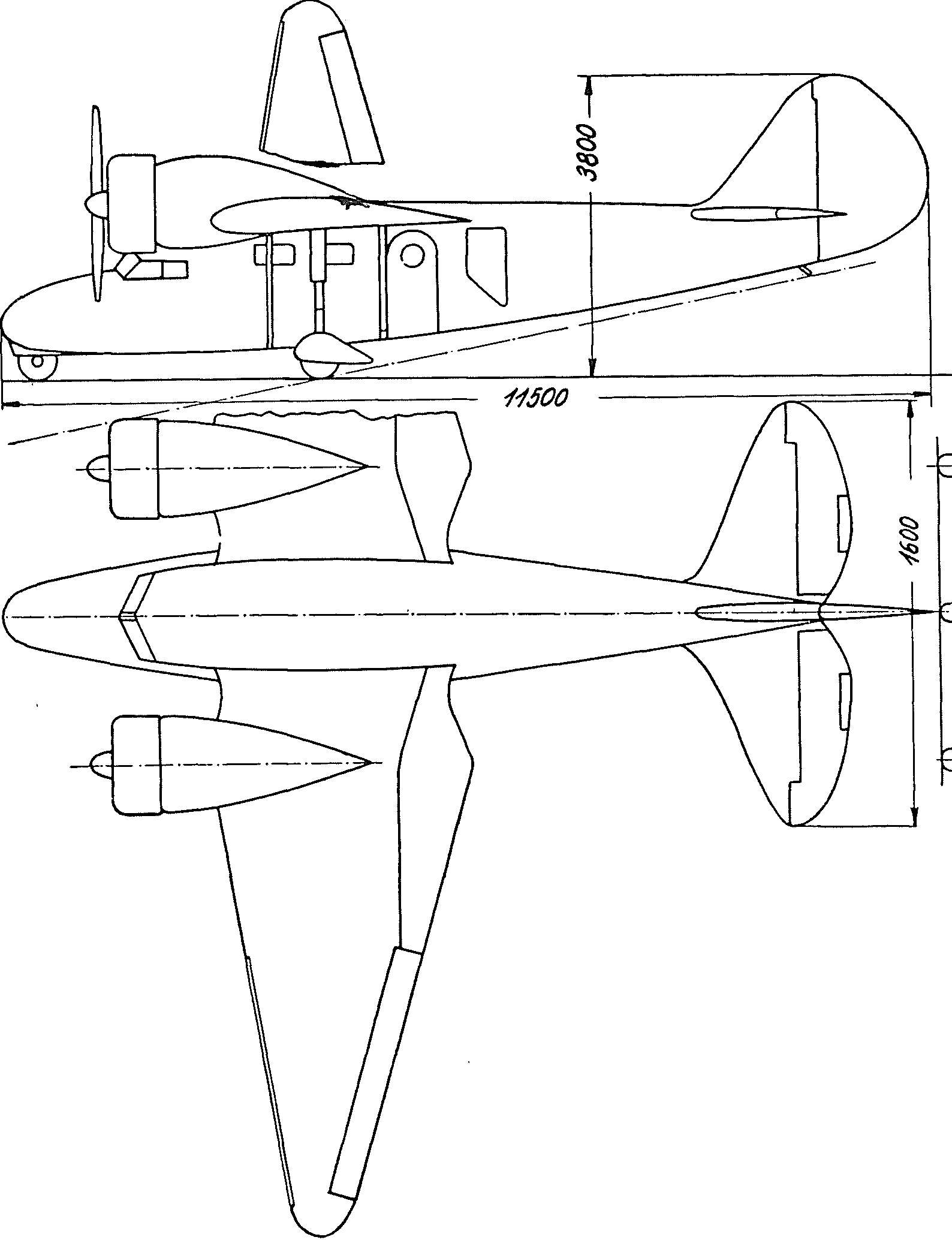
De Havilland „Flamingo" DH. 95.
Zu der Typenbeschreibung des „Flamingo" D. H. 95 („Flugsport" 1939, S. 42) ist noch folgendes nachzutragen. Landeklappen ermöglichen eine Auftriebserhöhung von 25% bei 25° Ausschlag.
Motoren sind mehr nach der Flügelunterseite1 gerückt, damit die Oberseite des Flügels so wenig wie möglich gestört wird. Dadurch verringert sich auch die Höhe der Fahrwerkskonstruktion.
Auspuffrohr auf der Oberseite des Flügels. Motorkühlluftabfluß mit Regulierkragen auf der Unterseite.
Spannweite 20,70 m, Länge 15,45 m, Höhe 4,65 m, Fläche 59,3 ml
Leistungsbelastung 4,27 kg/PS, Flügelbelastung 13 kg/m2, Kabinenabmessungen für 12 Passagiere Breite 2,29 m, Höhe 2 m, Länge 4,85 m, für 17 Passagiere Länge 5,82 m. Für 20 Passagiere Länge 6,64 m.
Handley Page-Schlitzklappen 20°/o der Flügeltiefe 6,60 m2, max. Anstellwinkel 53°. Fahrwerk Spurweite 6,30 m, Zeit des Hochziehens 11 Sek., Herunterlassen 7 Sek.
Zwei Bristol Perseus XII 9 - Zyl. luftgekühlte Schiebermotoren mit Untersetzung und Kompressor. Bohrung 146, Hub 165 mm, 24,8 1. Untersetzung 0,5:1. Kompressionsverh. 6,75 :1. Betriebstoffminimum 87 Oktan. Startleistung bei 2700 U. 865/890 PS, Steigleistung 680/710 PS, Reiseleistung 655/685 PS.
De Havilland „Flamingo"
D. ff. 95. Zeichnung Flugsport
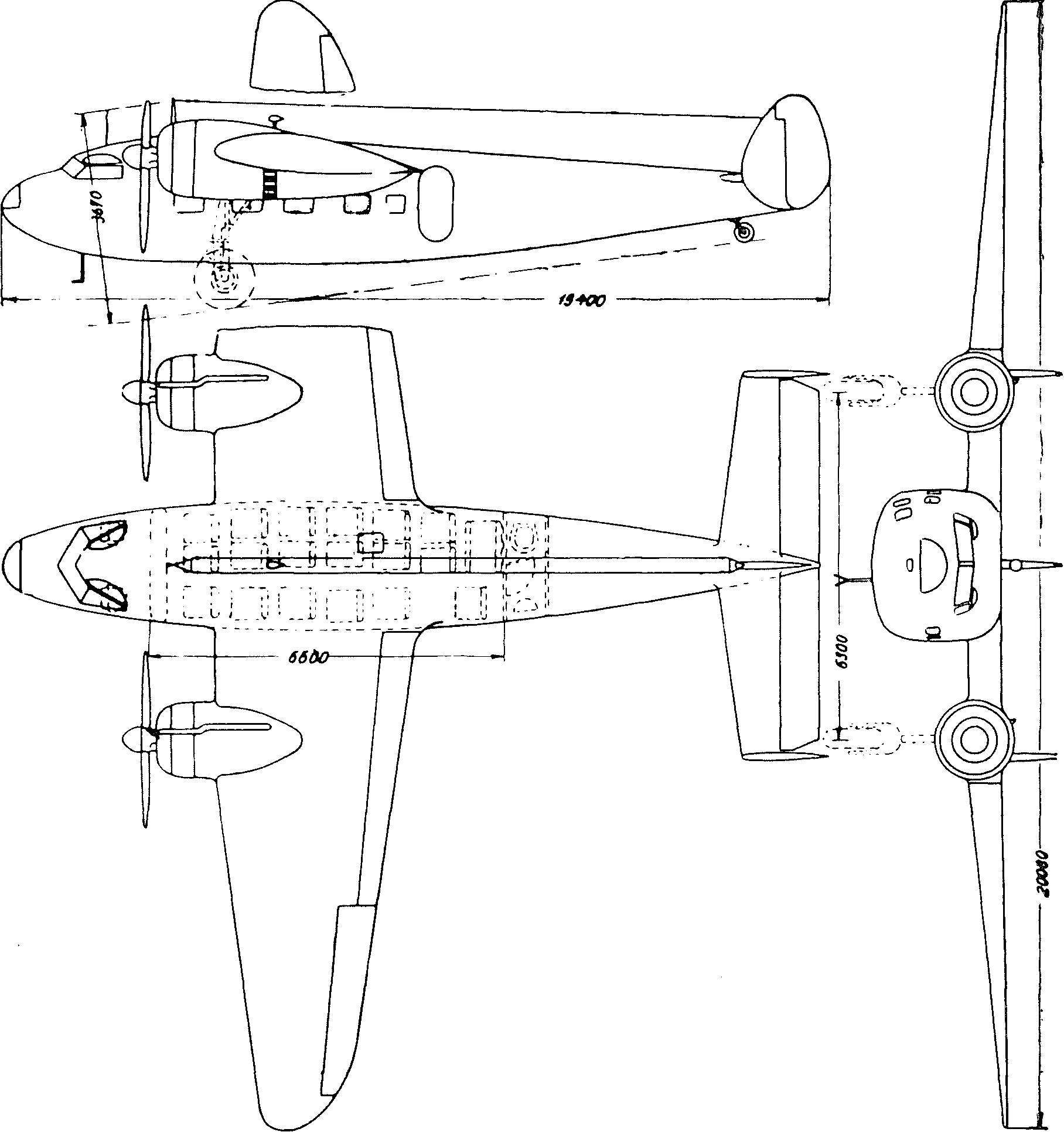
De Havilland „Flamingo" D. IL 95 Verkehrsflugzeug. Werkbild
Dreiflügelige De Havilland Versteilschraube 3,89 m Durchmesser, Steigung 20°.
Leergewicht 5142 kg, Besatzung (3 Mann) 230 kg, bei Windstille Aktionsradius 1610 km, Betriebstoff 1066 kg, Oel 90 kg, 12 Passagiere, Gepäck und Fracht 1182 kg. Bei 64,5 km/h Gegenwind Aktionsradius 805 km, Betriebsstoff 663 kg, Oel 90 kg, 12 Passagiere, Gepäck und Fracht 1585 kg, Fluggewicht 7710 kg.
Bei 7710 kg Fluggewicht max. Geschwindigkeit in 2290 m Höhe 391 km/h, Reisegeschwindigkeit in 1525 m Höhe 365 km/h, in 3050 m Höhe mit gedrosseltem Motor 328 km/h, Start 228,5 m, Auslauf 251,5 m.
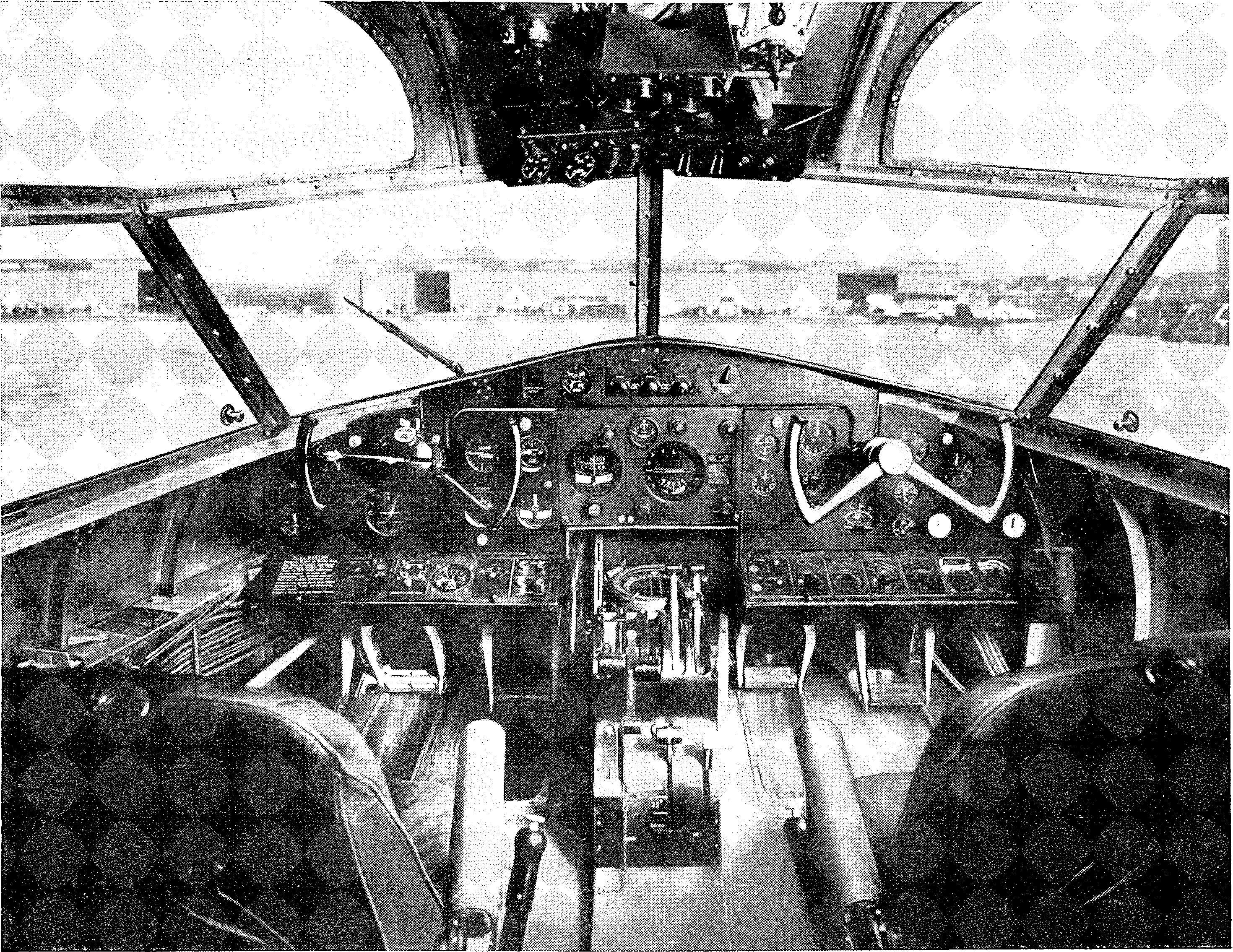
Führerraum des De Havilland „Flamingo". Werkbild
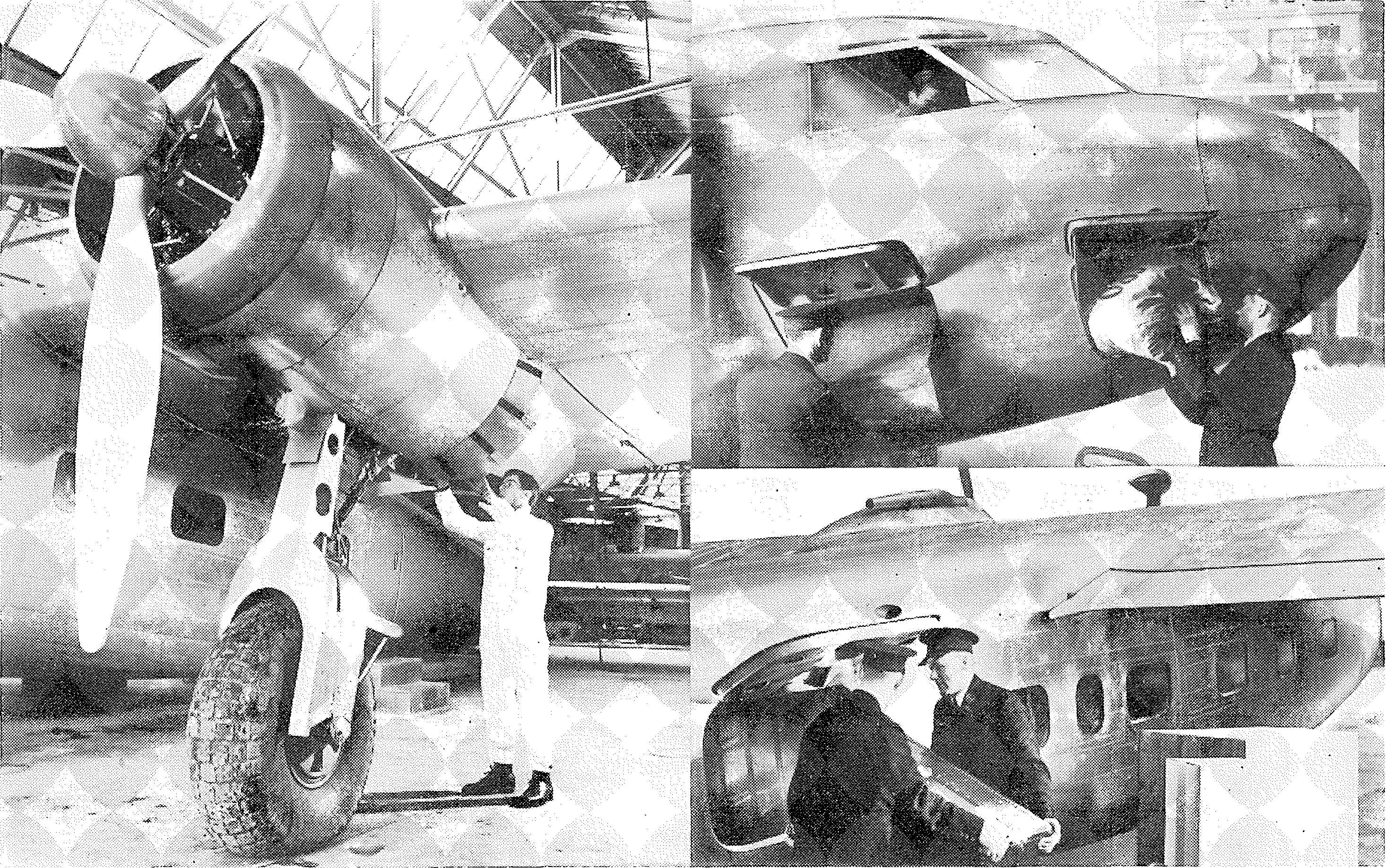
De Havilland „Flamingo". Links: Verschwindfahrwerk. Man beachte unter dein Flügel die Kragenklappen für die Kühlluftregulierung. Rechts oben: Gepäckraum unter dem Führerraum. Unten: Hinterer Gepäckraum. Werkbilder Flügelaufbau Ganzmetall, vierteilig, zwei Flügelstummel enthaltend die Betriebsstoffbehälter und Ansatzaußenflügel. Flügelprofil ist aus dem R. A. F. 34 hervorgegangen. Flügelholme Flanschen T-Profil. Im Mittelstück Gitterträgerform mit U-Profilstreben. Am Außenflügel wird der Steg durch Glattblech gebildet. Flügelnasen abnehmbar.
Steigfähigkeit vom Boden mit Startleistung 457,5 m/Min., Steigleistung 320,5 m/Min., Steigfähigkeit auf 1525 m in 4,7 Min., auf 3050 m in 10,6 Min., auf 4575 m in 21 Min. Absolute Gipfelhöhe 6150 m, Dienstgipfelhöhe 5650 m. Betriebstoffverbrauch bei gedrosseltem Flug 2911/h. Absolute Gipfelhöhe mit nur einem Motor laufend 2440 m, Steigfähigkeit mit nur einem Motor 45,7 m/Min.
Tschech. Aero A-300.
Aero A-300 ist ein Großbomber und für Erkundung, Bristol Mercury 830 PS. Konstrukteur Husnik.
Die vorderen Gefechtsstände der Besatzung sind, um eine gute Verständigung zu ermöglichen, sehr nahe aneinander gerückt. Beobachter im vorderen Rumpfteil mit guter Sicht nach allen Seiten, vgl. die Abbildung. Ein MG. in der Rumpfspitze. Dahinter Visier- und sonstige Einrichtung für Bombenwerfen. Fundamentrahmen für die Bombenwerf einrichtung, passend für Auswechslung gegen Lichtbildgerät. Im Fußboden
zwei Motoren
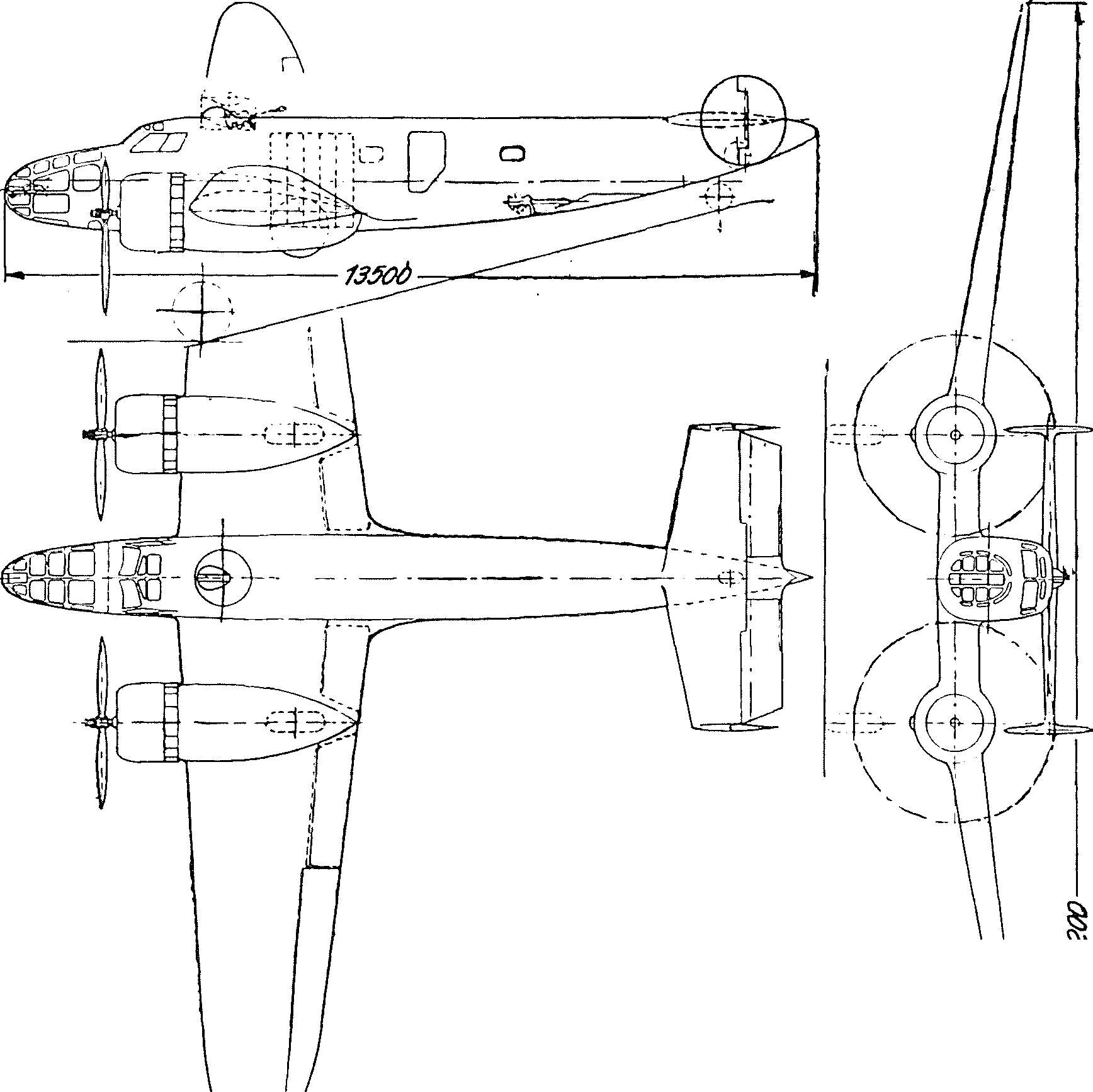
Tschech. Aero A-300 Zweimotor.
FZeichnung Flugsport
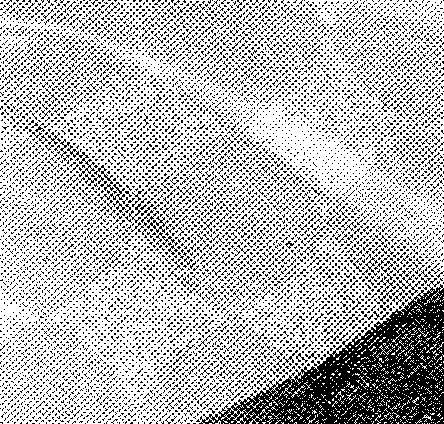
■
Tschech. Aero A-300 Zweimotor. Man beachte in der unteren Abb. den oberen
eingefahrenen MG.-Stand. Werkbilder
lw— Falltür für die vorderen | ^2 drei Mann Besatzung. Fall-*—TB tür auch zum Aussteigen in der Luft.
Führersitz mit Fallschirmeinbau verstellbar. Dahinter ein Sitz für den j'sH Beobachter für die Landung, wegklappbar. Gerätebrett, elastisch aufgehängt, enthält alle Einrichtungen für Nacht- und Blindflug.
Sitz für den oberen MG.-Schützen in der Nähe des Führers. MG.-Turm vollständig durchsichtig nach oben ausfahrbar. Bei eingefahrenem Turm ermöglicht eine kleine gewölbte Ausbuchtung dem Schützen noch gutes Gesichtsfeld nach oben.
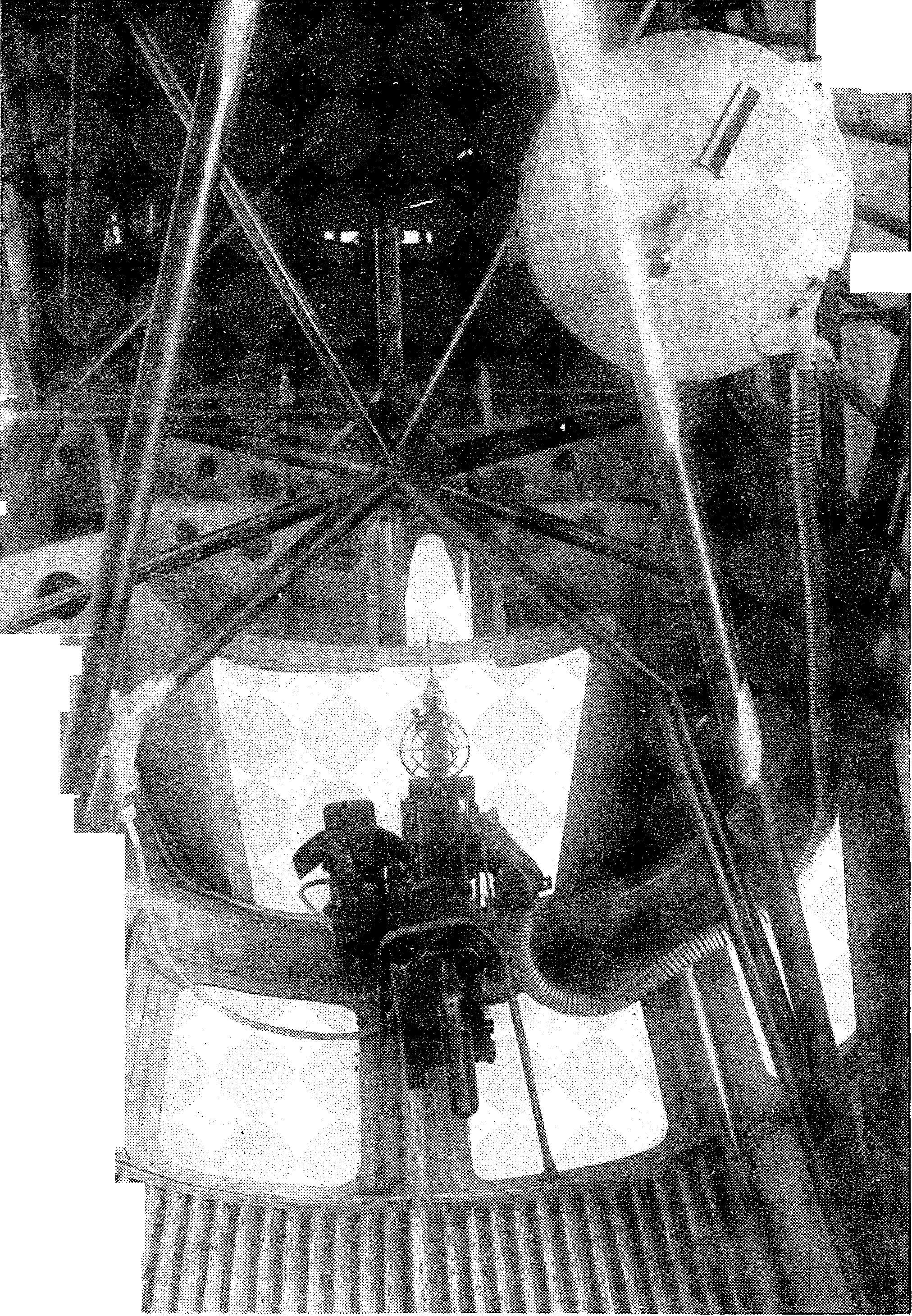
Tschech. Aero A-300 Zweimotor. Hinterer MG. - Stand, davor Sichtfenster nach unten. Rechts oben: Patronengurttrommel mit Gurtführungsschlauch zum MG.
Werkbild
Hinterer MG.-Stand, vgl. die Abbildung, MG. auf einem Schottenrand montiert. Gutes Gesichtsfeld nach hinten und unten, ohne daß die äußere Form des Rumpfes geändert worden ist. MG.-Fenster nach innen zu öffnen. Schußfeld 30° nach beiden Seiten, 90° von der Waagerechten zur Senkrechten. Hinterer Schütze bedient auch die Funkstation. Verständigung mit den vorderen Besatzungsgliedern durch Sprachrohr.
Hinter dem oberen MG.-Stand liegt das Bombenmagazin für eine Last von 1000 kg Bomben. Bombenauslösevorrichtung pneumatisch mit Notauslösung von Hand.
Komplette Beleuchtungsanlagen für Nachtflüge, Stromerzeuger vom Motor angetrieben.
Kleinere Funkstation im oberen MG.-Stand, größere Funkstation im hinteren MG.-Stand.
Flügel Holzkonstruktion mit Sperrholz. Querruder leinwandbedeckt. Landeklappen Duralumin.
Rumpf Stahlrohrgerüst. Vorderer Teil Duralumin-Konstruktion, abnehmbar.
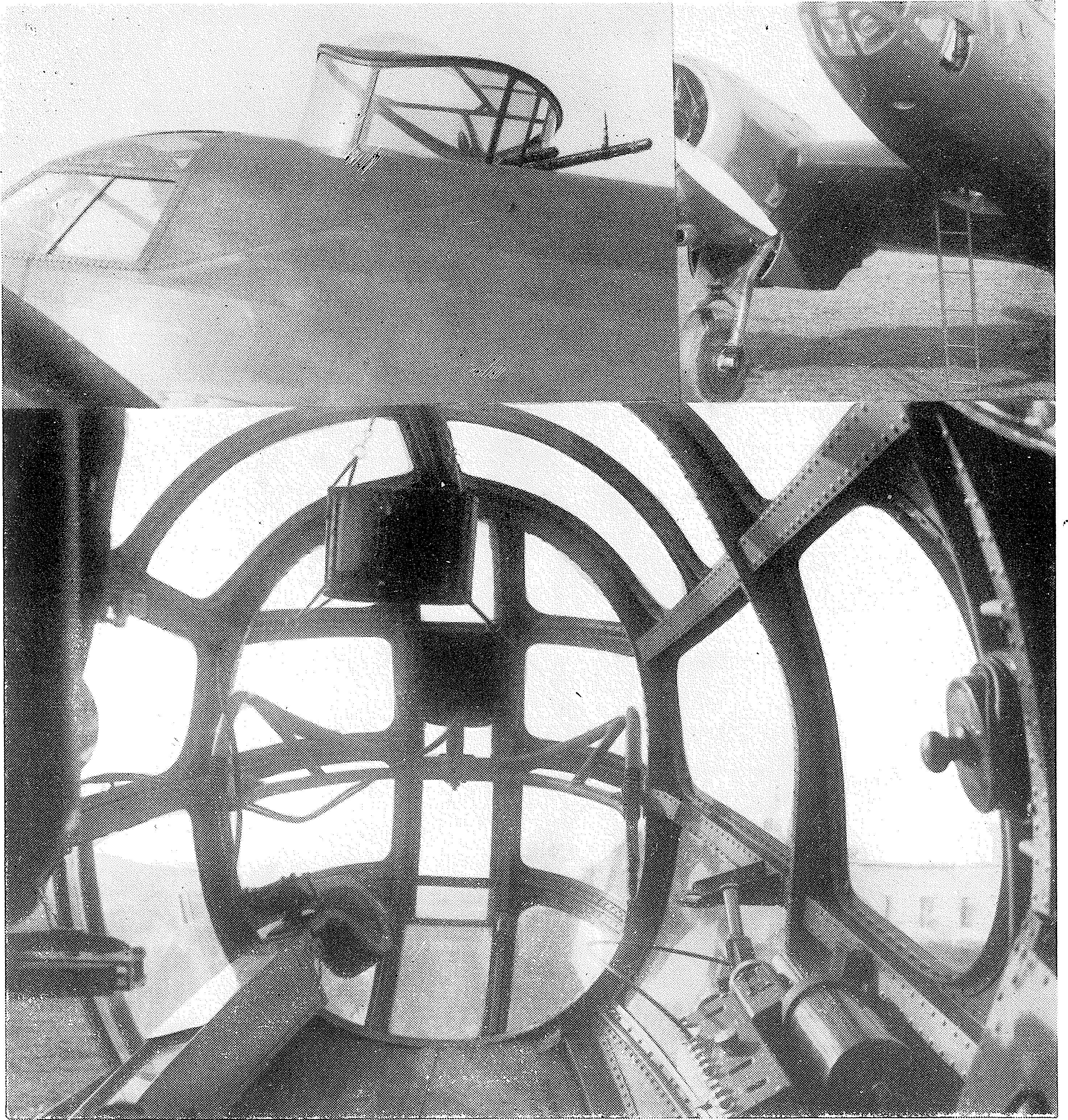
Tschech. Aero A-300 Zweimotor. Oben links: .Oberer MG.-Stand ausgefahren. Rechts: Fahrwerk und vorderer Einstieg im Rumpf. Unten: Rumpfnase.
VVerkbilder
Tschech. Aero A-3UÜ Zweimotor. Oben: Anordnung der Landeklappen, sowie hinterer Einstieg. Unten: Leitwerk. Man erkennt links die kleine Blickkuppel des eingefahrenen oberen MG.-Standes. Werkbilder
Für die Formgebung des Rumpfes Qerippeauflage in Gemischtbauweise aus Duralumin und Holz. Mit Rücksicht auf das große Leitwerk mit den Endscheiben ist das Stahlrohr^erüst des Rumpfes besonders torsionssteif ausgeführt.
Höhen- und doppeltes Seitenleitwerk Duralumingerippe mit Dural-blech bedeckt. Höhen- und Seitenruder Stahlrohr, leinwandbedeckt mit steuerbaren Flettnerrudern.
Fahr werk hochziehbar, hydraulisch betätigt, mit Notbetätigung von Hand. Räder Niederdruckreifen, Differentialbremsen. Abdeckung des Verschwindfahrwerkes durch zwei gewölbte, in der Längsrichtung des Flugzeuges anscharnierte Klappen.
Zwei Motoren Bristol Mercury IX, Leistung in 4400 m Höhe 830 PS.
Betriebsstoffbehälter Duralumin im Flügel. Zusatzbehälter können im Rumpf untergebracht werden. Gesamt max. Betriebsstoffinhalt 2250 1.
Spannweite 19,20 m, Länge 13,50 m, Höhe 3,80 m, Fläche 45,50 m2. Leergewicht 3955 kg, Fluggew. 6040 kg, Flächenbelastung 133 kg/m2. Leistungsbelastung 3,6 kg/PS. Geschwindigkeit am Boden 365 km/h, in 1000 m 385 km/h, in 2000 m 410 km/h, in 3000 m 432 km/h, in 4000 m 462 km/h, in 5000 m 462 km/h, in 5500 m 470 km/h, in 6000 m 455 km/h. Steigfähigkeit auf 1000 m in 1 min 58 sec, auf 2000 m in 3 min 40 sec, auf 3000 m in 5 min 31 sec, auf 4000 m in 7 min 3 sec, auf 5000 m in 9 min 4 sec, auf 6000 m in 11 min 35 sec. Absolute Gipfelhöhe 8300 m, praktische Gipfelhöhe 8000,m, mit einem Motor 4000 m. Reichweite mit Reisegeschwindigkeit 900 km.

Reparatur-Werkstattwagen
hat „Couse Laboratories, Inc., East Orange, N. J." (s. Abb.) für zivile wie militärische Erfordernisse gebaut. Man will in Amerika festgestellt haben, daß es sich sogar bei kleinen Flugzeugtypen lohnt, die Reparaturwerkstatt an die Unfallstelle zu fahren, anstatt die ungünstigen Verladebedingungen eines Flugzeuges in Kauf zu nehmen. Bei der Militärluftfahrt, bei schlechten Landebedingungen, ungünstigen Witterungsverhältnissen und Kampfbeschädigungen kann man sich sowieso nur durch Reparatur an Ort und Stelle helfen. Mit einer Ausrüstung, auf irgendeinen schweren Lastwagen verladen, hat man schon im Weltkrieg keine allzu guten Erfahrungen gemacht. Für den vorliegenden Werkstattwagen wurde ein besonders langes Fahrgestell mit hinterem zweiachsigem Federungsgestell verwendet. Vorn großer Führerraum, über dem Motor liegend. Seitenteile und hintere Giebelwand des Wagens nach oben aufklappbar. Als Regen- und Sonnenschutz können zu beiden Seiten und nach hinten große Zeltbahnen herausgerollt und unter Zuhilfenahme von Stangen verspannt werden.
Die Ladung ist um die Längsachse gut ausgeglichen und der Schwerpunkt liegt in halber Bauhöhe, so daß sich eine gute Straßenlage und Geländegängigkeit ergibt. Im Vergleich mit einem gewöhnlichen Lastwagen sind die Dimensionen bei derselben Tragfähigkeit
Reparaturwerkstattwagen. Links oben erkennt man elektrische Anlage, darunter verschiedene Ansichten der Werkstattausrüstung. Rechts: Funkgeräte, kleine Büroeinrichtung mit Schreibmaschine, unten der Werkstattwagen mit aufgeklappten Seitenteilen und Zeltverlängerung.
Archiv Flugsport
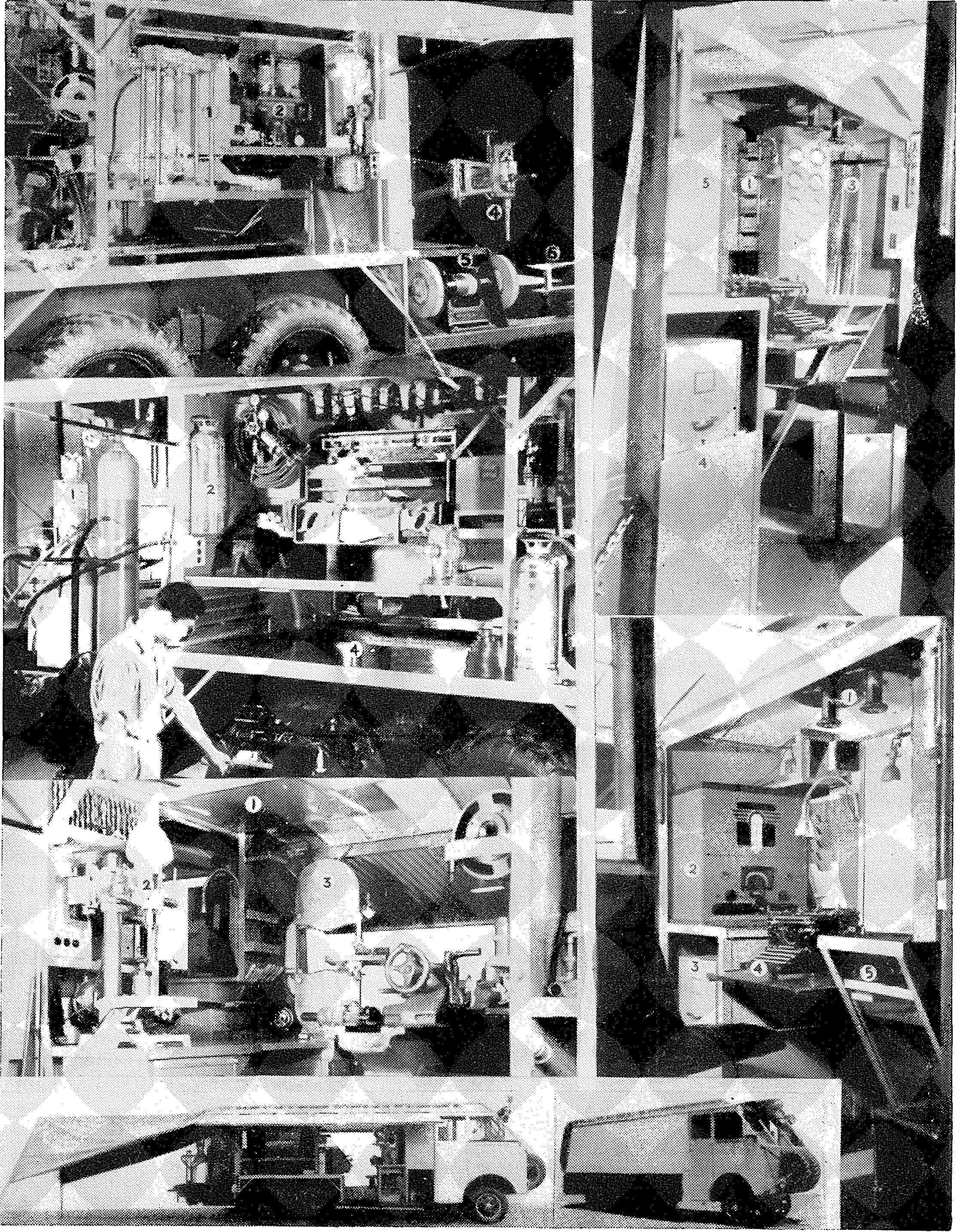
wesentlich kleiner gehalten. Bei 9 t zulässiger Tragfähigkeit 2,75 m hoch, 2,44 m breit, Abstand Vorderrad bis Mitte der beiden Hinterräder 4,45 m, Gesamtlänge 8,3 m; Gesamtgewicht bei voller Ausrüstung zwischen 11 und 12 t.
Die Kabine ist mit drei Sitzen und 2 Schlafstellen ausgerüstet.
Als Antrieb dient ein 85-PS-Ford-Lastwagenmotor. Durchschnittsgeschwindigkeit in ebenem Gelände 70 km/h und in unwegsamem Gelände 40 km/h; nimmt Steigungen bis zu 35° und gestattet eine seitliche Neigung bis zu 35°, was auch bei schlechtem Gelände gute Manövrierfähigkeit ermöglicht.
Neuerungen für Werkbetrieb auf der Leipziger Messe waren recht vielseitig. Elektrische Fühlersteuerung für Fräsmaschinen, zum erstenmal auf der technischen Messe in Leipzig gezeigt, arbeitet nach dem sogenannten verbesserten Kellerverfahren, wobei die Schablone durch Fühlhebel abgetastet und unter Zuhilfenahme von 3 Kontakten auf ein Relais übertragen werden.
Waagerecht-Feinstbohrmaschine, Bauweise Fomag, für flache Bohrungen mit hydraulisch gesteuerter Kopiereinrichtung, Nockenwellenschleifmaschinen für Flugmotoren, Bauart F. Werner, Tieflochbohrmaschinen zur Herstellung der langen Oelkanäle in Kurbelwellen und Pleuelstangen waren in den mannigfachsten Formen auf der technischen Messe vertreten.
Kunstharze, wie Lignuvol, ein Kunstharzhartholz, werden jetzt dadurch billiger hergestellt, daß von Schälmaschinen die Rotbuche in genauen Fournierungen geschnitten und mit einem Spezialkunstharz verleimt und unter besonderen Fournierpressen verdichtet wird. Verwendungszweck: Geräuschlos arbeitende Zahnräder u. a. m. Neuartig sind die aus Azetylen entwickelten Kunstharze wie Guttalyn, Verwendungszweck: Dichtungsmaterial, Maschinenschläuche, Schutzschürzen. Material ist alterungsbeständig sowie öl- und benzinfest. Kunstharzpreßschrauben verwendet man, um nicht leitende Teile miteinander zu verbinden. Kunstharzspritzmaschinen, Spritzmenge genau regulierbar, sind verhältnismäßig leicht zu handhaben.
Werkzeugmaschinen, spanabhebend, für Leichtmetallbearbeitung, sind eine kleine Wissenschaft für sich geworden, arbeiten alle mit hohen Drehzahlen. Dabei ist der Drehzahlbereich so gehalten, daß man Hartmetalle, Weichmetalle sowie Stahl und Guß bearbeiten kann. In der Schmelz- und Vergütungstechnik für Leichtmetalle, ebenso für die Warmbehandlung von Leichtmetallen gab es allerhand Apparate zu sehen, die in keinem Betrieb fehlen sollten. Wir hatten bereits vor der Leipziger Messe auf das Studium derselben durch Betriebsleiter und Ingenieure hingewiesen.
Kerbnagel dient zur Verbindung von Metallteilen, ähnlich wie der Nagel im Holz. Der Kerbnagel ist, ähnlich dem bekannten konischen Stift, längs gekerbt und wird in das passende Loch getrieben, wobei sich die Kerbwulste elastisch in den inneren Teil der Lochwandung einpressen.
Gleit- und Segelflug in der Luftwaffe. Der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe hat Richtlinien für den Gleit- und Segelflugbetrieb in der Luftwaffe erlassen. Die Aufnahme des Segelflugsports bei der Luftwaffe soll in erster Linie als Ausgleich für den ausschließlichen Bodendienst des nicht fliegenden Personals dienen. Der Segelflugsport soll im dienstlichen Interesse nach Kräften gefördert werden. Die beteiligten Angehörigen innerhalb einer Dienststelle sollen in einer Segelfluggruppe zusammengefaßt werden. Für die geeigneten Angehörigen des Reichsluftaufsichtsdienstes ist die Ausübung des Gleit-und Segelfluges Pflicht. Hier dient er besonders der Ausbildung von amtlichen

Inland.
Luftfahrtsachverständigen für die Abnahme von Segelflugzeug-Führerprüfungen und zur Ausbildung von Sachverständigen für Ueberwachung des Segelfluges. Nach den Richtlinien soll im übrigen Soldaten, Beamten, Angestellten und Arbeitern, die sich durch besonderen Diensteifer auszeichnen und das notwendige Interesse aufbringen, in erster Linie Gelegenheit zur Ausübung des Segelflugsportes gegeben werden. Bereits im Motorflug fliegerisch tätiges Personal soll hauptsächlich als Segelfluglehrer oder Schleppflugzeugführer verwendet werden. Gegen eine eigene segelfliegerische Betätigung bestehen keine Bedenken. Die zivilen Angehörigen der Segelfluggruppen der Luftwaffe müssen dem NS.-Fliegerkorps angehören. Der Eintritt in die Segelfluggruppen ist freiwillig. Gleit- und Segelflugzeuge sind grundsätzlich selbst zu bauen.
Deutsche Akademie der Luftfahrtforschung hielt am 3. 3. im Haus der Flieger eine Festsitzung ab. Der Chef der Luft wehr, General der Flieger Stumpff, betonte in seinem Vortrag, daß einzelne Wissenschaftstagungen sich besonders der Pflege der Randgebiete zwischen der Luftfahrttechnik und den allgemeinen Wissenschaftszweigen widmen sollen. Dabei können auch ausländische Wissenschaftler herangezogen werden. Ferner soll das Berichtswesen der Akademie ausgebaut und verstärkt werden. Auf den einzelnen Gebieten der Luftfahrttechnik sollen sofort größere Gemeinschaftsarbeiten aufgenommen werden, die sich auf längere Zeiträume erstrecken und wichtige Beiträge für den Fortschritt der Gesamttechnik und Wissenschaft zu ergeben geeignet sind. Hierzu folgende Beispiele:
Die Flugmotorenforschung wird die physikalisch-chemischen Vorgänge der Verbrennung im Flugmotor und das Problem der Kühlung aufzuklären haben.
Der Erforschung der Stratosphäre und der fernabliegenden Ionosphäre sollen weitere Gemeinschaftsarbeiten gewidmet sein. Gerade hier wird auf de Basis internationaler Zusammenarbeit manch bedeutender Fortschritt erwartet. Die deutsche Luftfahrtforschung ist zu solcher Zusammenarbeit bereit.
Die flugmedizinische Forschung muß unsere Kenntnisse über die Wirkungen der mit der Höhe abnehmenden Luftdichte und Luftzusammensetzung ergänzen. Auch den Arbeiten über die Einwirkungen von Beschleunigungen beim Start, Kurven- und Sturzflug auf den menschlichen Körper kommt Bedeutung zu.
Die Strömungsforschung muß sich mit der Luftwaffenforschung verbinden, um die physikalischen Grundgesetze für die Anwendung der Luftwaffe aufzuhellen und der Entwicklung grundsätzlich neue Wege zu weisen.
Die Wetterkunde hat gemeinsam mit der Strömungsforschung Arbeiten in Angriff zu nehmen, deren Ziel die Weiterentwicklung der meteorologischen Strömungslehre bildet.
General Stumpff teilte weiter mit, daß erstmals die bei der Gründung der Akademie als höchste Auszeichnung der deutschen Luftfahrtwissenschaft gestiftete Hermann-Göring-Denkmünze verliehen wird, und zwar erhält diese Denkmünze der ordentliche Professor der Universität Göttingen, Ludwig Prandtl, im Hinblick auf seine außerordentlichen Verdienste um die Wissenschaftsgrundlage der Strömungsforschung. Prandtls wissenschaftliche Arbeit, die auch über die Grenzen des Reiches hinaus anerkannt wird, hat die Grundlage für den Bau des modernen Luftfahrzeuges schwerer als die Luft, auf einigen entscheidenden wichtigen Gebieten geschaffen. Stumpff beschloß seine Rede mit einem Hinweis auf die vom Führer der deutschen Wissenschaft gewiesenen neuen Regeln der Arbeitsweise und Arbeitsrichtung.
Hiernach sprach Luftzeugmeister Generalleutnant Udet über die Bedeutung einer engen und umfassenden Zusammenarbeit der wissenschaftlichen Forschung mit der Luftwaffe. Alle technisch neuen Erkenntnisse auf die Serienerzeugnisse neuer Luftfahrzeuge anzuwenden, sei nicht immer möglich. Man müsse sich vielmehr im Hinblick auf die Bedürfnisse der Front zu einer starken Konzentrierung auf die vordringlich wichtigen Aufgaben entschließen. Den Werken der Flugzeugindustrie ist mit Rücksicht auf ihre individuelle Leistungsfähigkeit ein weiter Spielraum für schöpferische Eigenbetätigung gelassen worden, soweit diese Werke praktischen Bedürfnissen besonders gerecht geworden sind. Die übrigen Firmen mußten stärker auf die reine Fabrikation bewährter Muster angesetzt werden. Die Zahlen grundlegender Veränderungen durch neue Erkenntnisse sind übrigens, wie die Erfahrung gezeigt hat, überraschend gering, verglichen mit den Fortschritten, die durch planmäßige Fortentwicklung bewährter Erstkonstruktionen erzielt werden. Udet hob aber hervor, daß sich keine all-
gemeinen Formeln für die zweckmäßigste Nutzbarmachung des technischen Fortschrittes festlegen lassen, sondern daß das individuelle Können des Führertums ausschlaggebend bleibt. Den Unternehmungen der Luftfahrtindustrie wurden Möglichkeiten zur eigenen Initiative auf wirtschaftlichem Gebiet eingeräumt. Staatskapitalistische Gedankengänge wurden abgelehnt. Udet gab dann eine Uebersicht über die einzelnen Maßnahmen, durch die die Leistungsfähigkeit der Luftfahrttechnik und der Luftfahrtindustrie gewährleistet und gesteigert worden ist. Hierzu gehörten die Heranführung erstklassiger Facharbeiter an die im Aufbau begriffenen Werke, die Heranbildung des Nachwuchses in mustergültigen Lehrlingswerkstätten, Maßnahmen auf dem Gebiete des Hochschulwesens zur Beseitigung des Mangels an gut durchgebildetem Ingenieurpersonal für die Konstruktionsbüros, die Begründung eines Ingenieurkorps für die Luftwaffe u. s. f. Udet führte dabei aus, daß die Maßnahmen an den Hochschulen und Lehranstalten für die Ingenieurausbildung noch nicht ausreichend seien. Es fehle der notwendige Nachwuchs an den technischen Hochschulen. Deshalb werde jetzt in Darmstadt besonders bewährten Arbeitern der Luftfahrtindustrie eine Ingenieurausbildung erteilt, die ihnen die Möglichkeit zum Hochschulbesuch eröffne. Udet erläuterte dann die Bedeutung der ihm übertragenen Dienststelle des Generalluftzeugmeisters und erklärte, daß seine Dienststelle auch in Zukunft für den Ausgleich aller einzelnen Interessen sorgen werde. Generalleutnant Udets Rede klang in der Hoffnung aus, daß Deutschland auch in Zukunft zur friedlichen Gemeinschaftsarbeit mit allen Völkern der Erde berufen sein möchte.
DIH Fachnormenausschuß für Luftfahrt FALU
Bezugsfertige Normblätter.
Folgende Normblätter sind beim Beuth-Vertrieb G. m. b. H., Berlin SW 68, Dresdener Straße 97 (Fernruf 676666) bezugsfertig:
1. Luftfahrt-Normen: LgN 13282 Riffelblech (Jan. 39)
LgN 13460 Preßprofile aus Leichtmetall, Grundmaße (Jan. 39) LgN 13511.1 Nahtlose Präzisionsstahlrohre, kaltgezogen, aus 1111.2 und 1452.9 (Jan. 39)
LgN 13511.2 Nahtlose Präzisionsstahlrohre, kaltgezogen, aus 1030.2 (Jan. 39) LgN 13511.3 bis 5 Nahtlose Präzisionsstahlrohre, kaltgezogen, aus 1452.5, 1452.6 und 1460.6 (Jan. 39)
LgN 13533.1 bis 5 Rohre aus Aluminium-Legierungen, nahtlos gezogen (Jan. 39)
LgN 13535.1 und 2 Rohre aus Magnesium-Legierungen, nahtlos (Jan. 39)
LgN 13811.1 und 2 Profile aus Blech, L-Profile (Jan. 39)
LgN 13812.1 und 2 Profile aus Blech, L-Profile m. Bördel (Jan. 39)
LgN 13813.1 und 2 Profile aus Blech, U-Profile (Jan. 39)
LgN 13814.1 und 2 Profile aus Blech, U-Profile m. Bördel (Jan. 39)
LgN 13815.1 und 2 Profile aus Blech, Z-Profile m. einem Bördel (Jan. 39)
LoN 13816.1 und 2 Profile aus Blech, Z-Profile m. zwei Bördeln (Jan. 39)
LgN 13817.1 und 2 Profile aus Blech, A-Profile (Jan. 39)
LgN 13818.1 und 2 Profile aus Blech, A-Profile m. Bördel (Jan. 39)
LgN 13819.1 und 2 Profile aus Blech, A-Profile, halbrund (Jan. 39)
LgN 14144.1 und 2 Sechskantbolzen (Jan. 39)
LgN 14146 Sechskantbolzen, abgesetzt (Jan. 39)
LgN 14155.1 und 2 Stiftschrauben m. Bund, Einschraubende ~ 1,6 di (Jan. 39)
LgN 14156.1 und 2 Stiftschrauben m. Bund, Einschraubende ~ 2 di (Jan. 39)
LgN 14180 Sechskantschrauben (Jan. 39)
LgN 14181 Sechskantschrauben mit dünnem Schaft (Jan. 39)
LgN 14439 Flügelmuttern mit Sicherungslöchern (Jan. 39)
LgN 14483.1 und 2 Sechskantmuttern (Jan. 39)
LgN 14484.1 und 2 Sechskantmuttern, flach (Jan. 39)
LgN 14488 Kronenmuttern (Jan. 39)
LgN 14532 Scheiben mit Fase (Jan. 39)
LgN 14533.1 und 2 Scheiben (Jan. 39)
LgN 15229 Bolzen (Splintbolzen) (Jan. 39)
LgN 15236 Sg-Ringe für Wellen (Jan. 39)
LgN 15237 Sg-Ringe für Bohrungen (Jan. 39)
LgN 16614.1 Schilder, Geräteschilder (Jan. 39, 2. Ausg.)
LgN 16614.2 Schilder, Geräteschilder für Geräte mit Anforderzeichen (Jan. 39)
LgN 16615.1 Schilder, Wortschilder, Format 9X26 (Jan. 39) LgN 16615.2 Schilder, Wortschilder, Format 9X37 (Jan. 39) LgN 16615.3 Schilder, Wortschilder, Format 9X52 (Jan. 39) LgN 16615.4 Schilder, Wortschilder, Format 13X52 (Jan. 39) 2. Allgemeine Normen:
DIN 5461 Keilwellen- und Keilnaben-Profile, Uebersicht (Febr. 39, 2. Ausg.) DIN 5462 Keilwellen- und Keilnaben-Profile, leichte Reihe (Febr. 39, 2. Ausg.) DIN 5453 Keilwellen- und Keilnaben-Profile, mittlere Reihe (Febr. 39, 2. Ausg.) DIN 5464 Keilwellen- und Keilnaben-Profile, schwere Reihe (Febr. 39, 2. Ausg.)
Do 26 „Seefalke" von Chile zurück am 28. 2., 19.42 h, von Lissabon kommend, in Travemünde gewassert, wo die aus Flugkpt. Graf Schack, Flugkpt. Blume, Funkermasch. Dielewicz und Obflgz.-Funker Wittrock bestehende Besatzung von Vertretern der Lufthansa und der Dornier-Werke empfangen wurde. Mit diesem Flug hat das viermotorige Atlantikflugboot Do 26 „Seefalke" seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.
Siebel Fh 104, 240 PS-Hirth-Motoren, vom Afrikaflug am 7. 3. Tempelhof zurückgelandet. Die Besatzung, welche 40 000 km in 7 Wochen zurückgelegt hat, wurde vom stellvertretenden Präsidenten des Aero-Clubs von Deutschland, Krog-mann, empfangen. Ueber den Flug haben wir bereits im „Flugsport" 1939 S. 109 berichtet. Längste Ohnehaltstrecke (16 000 km) war der Flug von Addis Abeba nach Kenya. Der Rückflug von Kapstadt erfolgte über Südwest-Afrika, Angola, Kongo-Staat, Französisch-Aequatorialafrika, Kamerun, über den Tschad-See, am Südrand der Sahara entlang, über Französisch-Marokko, Spanien, Frankreich nach Berlin.
Was gibt es sonst Neues?
Korpsführer Christiansen 25 Jahre Flugzeugführer, fliegt noch heute. Pilotenzeugnis Nr. 707, Prüfung am 27. 3. 1914 auf Taube, Hamburg-Fuhlsbüttel.
Dr. Ley zum Gruppenführer des NS.-Fliegerkorps von Reichsminister der Luftfahrt, Generalfeldmarschall Göring ernannt.
General der Luftwaffe (See) Zander infolge Altersgrenze ausgeschieden, Befehlshaber Marineluftwaffe: General Ritter.
Wolfgang von Gronau zum Luftattache an der Deutschen Botschaft in Tokio ernannt.
Verlag E. S. Mittler & Sohn 3. März 150]ähriges Jubiläum.
Ausland.
Spitfire macht jetzt offiziell 582,6 km/h in 5640 m Höhe, steigt auf 3609 m Höhe mit voller Belastung in 4,8 min. Bei Verwendung von Verstellpropellern verkürzt sich die Startlänge und erhöht sich die Steigfähigkeit, auf die Geschwindigkeit ohne Einfluß.
London—Frankfurt—Budapest-Luftlinie der Imperial Airways für die nächste Zeit in Aussicht genommen.
Baron Foucaucourt und Frau f bei einem Ausflug nach den Nilquellen auf einem Percival Vega - Gull bei Ounianga in der Nähe der franz. Sudangrenze verunglückt.
Engl. Leichtflugzeug-Rennen für Nachwuchsschulung wird voraussichtlich anschließend an das „King's Cup" veranstaltet.
Prof. Ludwig Prandtl,
Göttingen, wurde die höchste Auszeichnung der deutschen
Luftfahrtwissenschaft, die Hermann-Göring-Denkmünze (in den Abb. rechts wiedergegeben), verliehen.
Weltbild
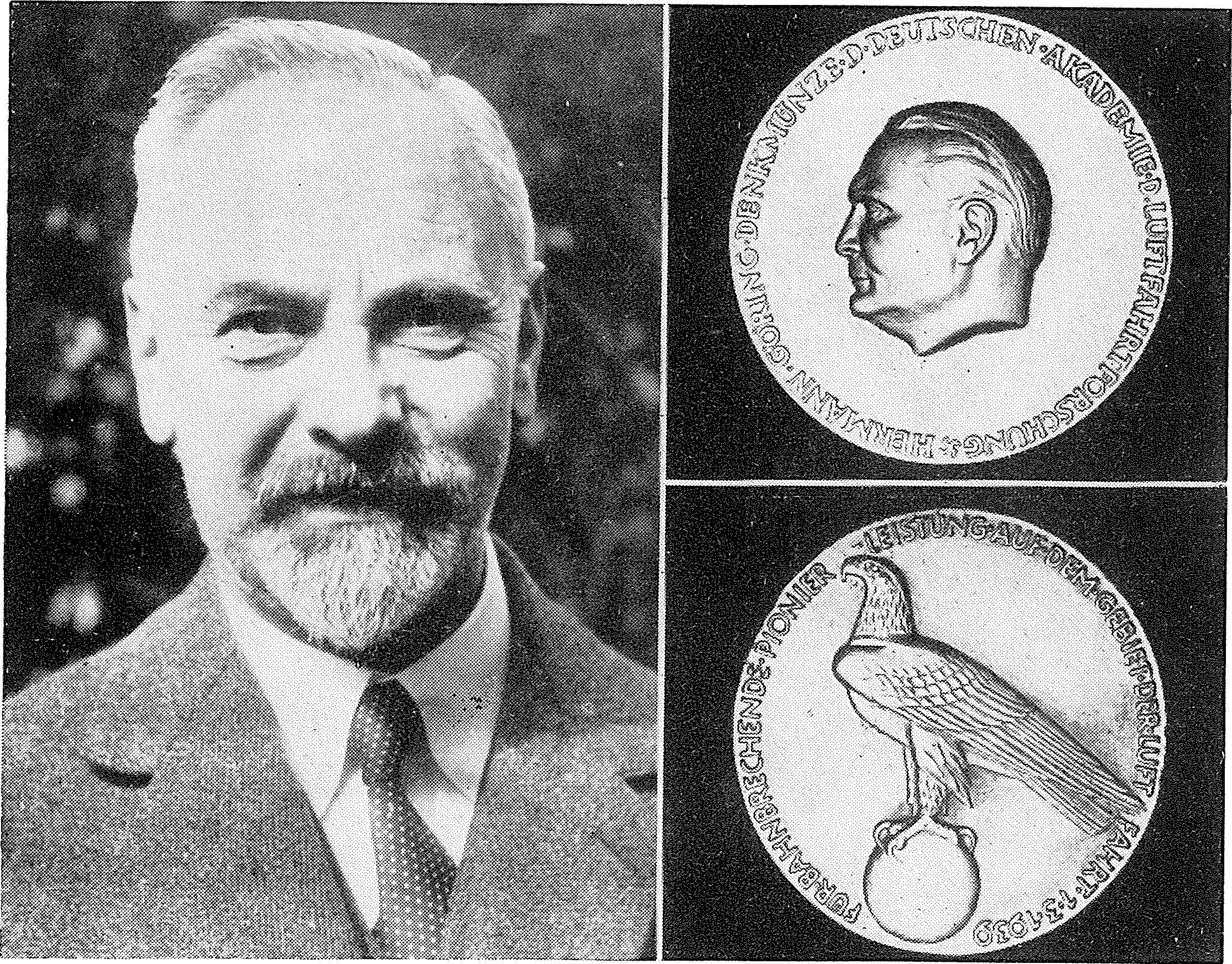
Mayo-Composite-Flugboot, ausführliche Typenbeschreibung siehe Flugsport 1938, Seite 104 und ff. Obige Abbildung zeigt, wie das Mercury-Flugzeug, am Kran hängend, auf das Mayo-Flugboot in dem Wasserflughafen Southampton Water aufgesetzt wird. Gegen Ende des Jahres flog der Mercury mit 1 t Nutzlast von Southampton nach Alexandria in 12 Std. Bild: Sheü
Engl. Flughafen Pagham Harbour in der Nähe von Bognor an der Küste von Sussex, östlich von Portsmouth, ca. 100 km von London entfernt, wohin eine Eisenbahnverbindung von Victoria Station aus vorgesehen ist, soll unter Aufwendung von 800 000 Pfund errichtet werden.
Kurzwellen-Sender und -Empfänger, tragbar, Typ Hermes, Gewicht 20 kg, Reichweite 5000 km, bei engl. Verkehrsflugzeugen eingeführt. Abmessungen 56 cm hoch, 31 cm breit. Wellenlänge zwischen 5 und 1000 m. Einrichtung für Kopfhörer und Lautsprecher.
Chines. Luftverkehrsges. Tchoung-Koua, selbständige Gesellsch. der 3 von Tchang-Kai-Chek unabhängigen chinesischen Regierungen, gegründet. Die früheren beiden Luftverkehrsges. Dai Nippon Aviation Co. und Huitoung Aviation Co. sind darin aufgegangen. Betrieben werden folgende Fluglinien: Shanghai—Hankau, Shanghai—Kanton, Peking—Dairen und Peking—Tatung.
Links: Luftschutzkellerbau in England. Das Stahlwellblech wird fertig zugeschnitten geliefert, und die Empfänger brauchen nur eine Grube auszuheben und die Stahlblechteile zusammenzuschrauben. Das ganze wird mit Erde abgedeckt und im Ernstfall noch mit Sandsäcken, von welchen bereits 127 Mill. Stück ausgegeben sind, bedeckt. Rechts: Der König von England besichtigt auf der Industrieausstellung
----; Birmingham einen
Weitbild Luftschutzkeller.
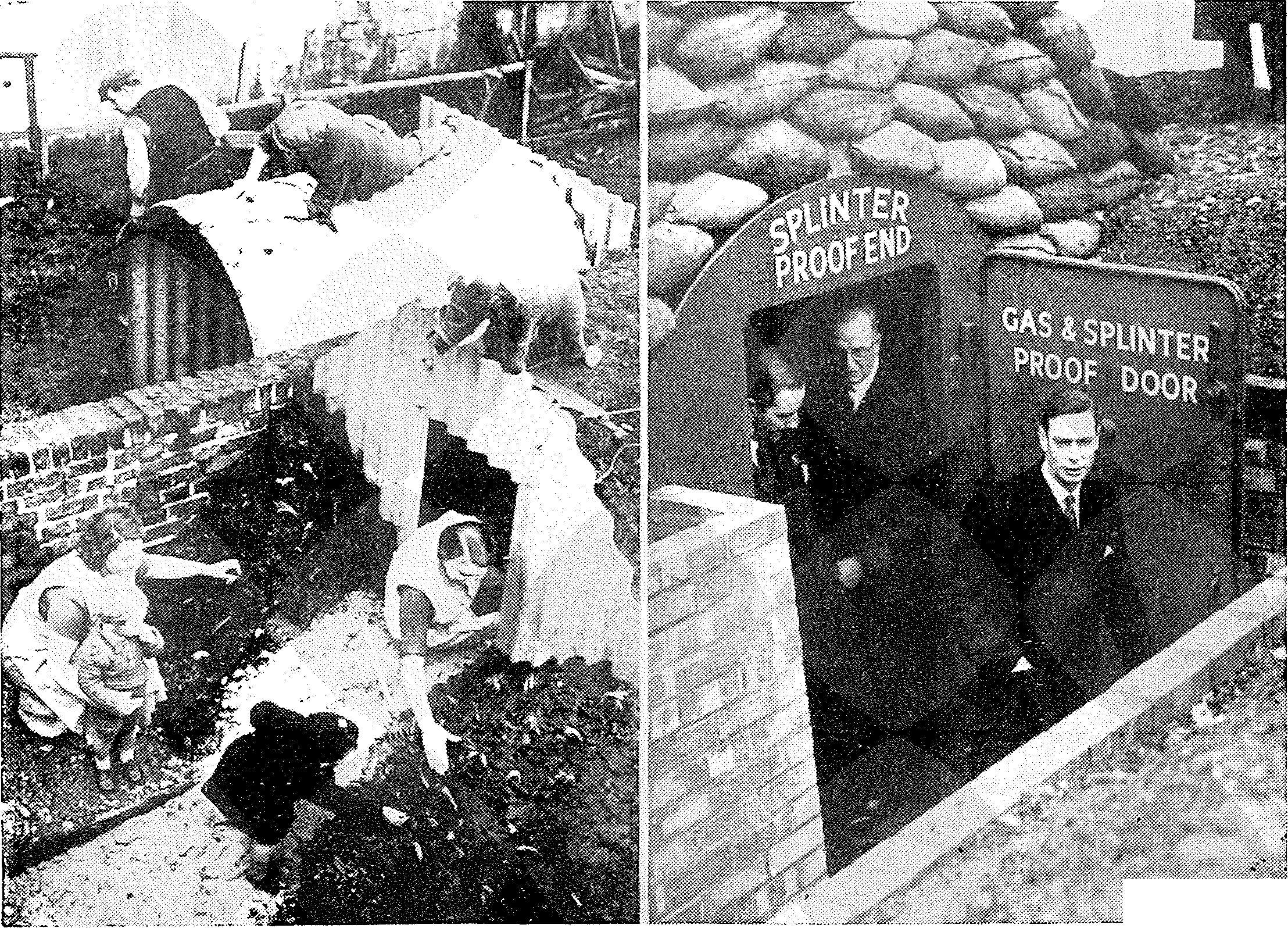
Franz. Flugzeugkonstrukteure besuchen engl. Flugzeugfirmen. Führung Sir Charles Bruce-Qardner. Franz. Teilnehmer: Gourdou (Vertreter der franz. Flugzeugindustrie), Arene, Managing Direktor der S. N. C. A. Sud-Est; Louis Breguet, M. Dewoitine von der S. N. C. A. Sud; Maurice Quilbot von der Union der Flugzeugindustrien; Outhenin-Chalandre von S. N. C. A. Centre; Henri Potez von S. N. C, A. Nord; Demenais von der franz. Thomson-Houston Co. und Lucien Chauviere vom Chauviere-Propellerwerk.
Breguet und Latecoere, Interessengemeinschaft, Kapital 41 Millionen Frs. Leitung: Direktor Breguet.
Ital. Flugzeugfabrik Neapel mit Forschungsinstitut für Land- und Wasserflugzeuge 30 km nordwestlich von Neapel auf Veranlassung des Duce in Bau genommen.
Runa, Reale Unione Nazionale Aeronautica, betreut in Italien das Sportflug-wesen, gleichzeitig Verbindungsstelle mit der ital. Luftwaffe. Nach einem dem Duce erstatteten Bericht sind in 39 Zivil-Schulen 2762 Flugzeugschüler mit 45300 Flugstunden ausgebildet. In den Segelflugschulen von Asiago und Sezze Littoria sind 254 Schüler und in 55 Modellflugschulen 4135 Schüler.
„Atti di Guidonia", neue ital. wissenschaftliche Zeitschrift, 14täglich erscheinend, bringt die Forschungs- und Versuchsergebnisse von Guidonia, dem führenden ital. Experimentier-Zentrum für Flugwesen.
Fokker-Atlantikflugzeug, Typ F. 56, mit 4 Schwerölmotoren, 56 Fluggäste, 5 Mann Besatzung, Geschwindigkeit 320 km/h, seit längerer Zeit in der Konstruktion.
Schweizer. Luftwaffenkommission ist nach einer Besichtigung der amerikanischen Flugzeuge aus USA zurückgekehrt. Ein sozialdemokratischer Abgeordneter verlangte Auskunft, warum die Schweiz von den amerikanischen Flugzeugkonstruktionen keinen Gebrauch gemacht habe, nachdem doch Frankreich und England Hunderte von Militärflugzeugen gekauft hätten. In der Antwort hierauf wurde hervorgehoben, daß die amerikanischen und englischen Flugzeuge wohl für die Schweiz brauchbar seien, jedoch die von der Schweiz angekauften deutschen Maschinen nicht überträfen.
USA-Luftwaffe sieht Verstärkung auf 6000 Flugzeuge vor. Kosten 300 Millionen Dollar.
Kongreß des Institute of the Aeronautical Sciences findet in der Woche vom 11. 9. 39 in der Columbia Universität in New York statt, wozu Delegierte aller europäischer Länder, die am Flugwesen interessiert sind, eingeladen werden. Gleichzeitig ist eine USA.-Flugpionier-Gedächtnisfeier, um der Verdienste der amerik. Flugpioniere (Montgomery, Prof. Langley, Manley, Prof. Octave Chaunte [der Lehrer der Wrights] und Glenn Curtiss) zu gedenken.
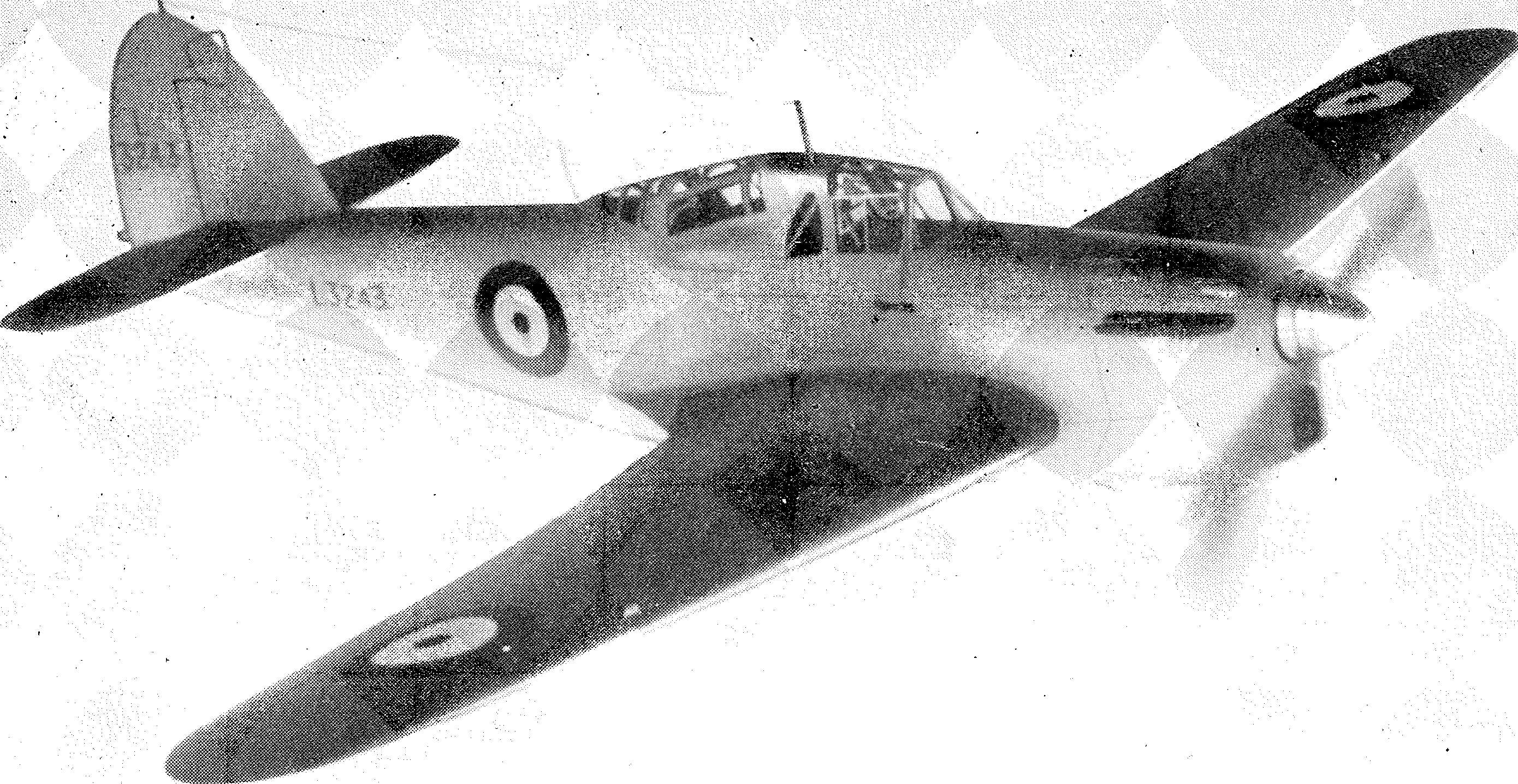
Hawker „Henley", ausgerüstet mit 1065 PS Rolls Royce „Merlin", Höchstgeschw. 480 km/h, Spannweite 14,65 m, Länge 11,1 ra, gebaut von der Gloster Aircraft Co.
Kennzeichen der Flugzeuge.
Nachstehende Buchstaben bezeichnen die Nationalität (Hoh.-Zch.), dann folgt Bindestrich. Die Buchstaben nach dem Bindestrich sind das Eintragungszeichen des betr. Landes.
In Deutschland kommt dem 1. Buchstaben nach dem Bindestrich die Klassifizierung der Maschine zu. Es bedeutet:
|
Staat |
Hoh.-Zch. |
Staat |
Hoh.-Zch. |
|
|
Deutschland |
D |
4 Buchst. |
Island |
TF 3 Buchst. |
|
Aegypten |
SU |
3 „ |
Ital. u. Kolonien |
I 4 „ |
|
Afghanistan |
YA |
3 „ |
Japan |
J 4 „ |
|
Albanien |
ZA |
3 „ |
Jugoslawien |
YU 3 „ |
|
Argentinien |
LV |
3 „ |
Kolumbien |
HK 3 „ |
|
Australien |
VH |
3 „ |
Kuba |
CL (od. M) 2 B. |
|
Belgien |
00 |
3 „ |
Lettland |
YL 3 Buchst. |
|
Bolivien |
Name |
Litauen |
LY 3 „ |
|
|
Brasilien |
PP-C 2 „ |
Malayenstaaten |
VR3B.(R \A-RZZ) |
|
|
P |
2 „ |
Luxemburg |
LX 3 Buchst. |
|
|
V |
2 „ |
Marokko |
CN 3 „ X\ (od. XB) 3 B. |
|
|
I |
2 „ |
Mexiko |
||
|
T |
2 „ |
Niederlande |
PH 3 Buchst. |
|
|
Bulgarien |
LZ |
3 „ |
Niederl.-Curacao |
PJ 3 „ |
|
Chile |
CC |
3 „ |
-Indien |
PK 3 „ |
|
China |
XT |
3 „ |
„ -Surinam |
PZ 3 „ |
|
Costarica |
TI |
3 „ |
Nikaragua |
YN 3 „ |
|
Dänemark |
OY |
2 „ |
Norwegen |
LN 3 „ |
|
Danzig |
YM |
3 „ |
Panama |
RX 3 „ |
|
Domin. Rep. |
HI |
3 „ |
Paraguay |
nicht vorhanden |
|
Ekuador |
HC |
3 „ |
Peru |
OB 3 Buchst. |
|
Estland |
ES |
3 „ |
Polen |
SP 3 „ |
|
Finnland |
OH |
3 „ |
Portugal CS,CT,CU 3 „ |
|
|
Frankr. m. Kolon. |
Portug. Kolon. |
CR 3 „ |
||
|
u. Schutzgebieten F |
4 „ |
Rumänien |
YR 3 „ |
|
|
Griechenland |
sx |
3 „ |
Rußland |
URS^.-Nummer |
|
Großbritan. |
G |
4 „ |
innerruß. Verk. |
CCCP.-Nummer |
|
Brit. Kol. u. |
VP |
(0 oder R) |
Salvador |
YS 3 Buchst. |
|
Schutzgeb. |
3 Buchst. |
Schweden |
SE 3 „ ' |
|
|
Indien |
VT |
3 „ |
Schweiz |
HB 3 „ |
|
Kanada |
CF |
3 „ |
Siam |
HS 3 „ |
|
Neue Hebrid. |
YJ |
3 „ |
Nationalspan. |
M-C 3 „ |
|
Neufundland |
VO |
3 „ |
Südafr. Union |
ZS 3 „ |
|
Neuseeland |
ZK |
3 „ |
Tschechoslowakei |
OK 3 „ |
|
Guatemala |
LG |
3 „ |
Türkei |
TC 3 „ |
|
Haiti |
HH |
3 „ |
Ungarn |
H\ 3 „ |
|
Honduras |
XH |
3 „ |
Uruguay |
CK 3 „ |
|
Irak |
YI |
3 „ |
Venezuela |
YV 3 „ |
|
Iran |
EP |
3 „ |
V. St. A. |
N 4 „ |
|
Irland |
EI |
3 „ |
||
|
Klasse |
Fluggewicht in kg |
|||||
|
Landflugz. |
Wasserflugz. |
|||||
|
Y |
AI |
bis 500 |
bis 600 |
1 Pers. |
Sportflugzeug |
(bis 50 PS) |
|
E |
A2 |
bis 1000 |
bis 2200 |
1—3 „ |
(bis 200 PS) |
|
|
I |
Bl |
bis 2500 |
bis 5500 |
1-4 „ |
Reiseflugzeug |
|
|
0 |
B2 |
bis 5000 |
1—8 „ |
Verkehrsflugzeug |
||
|
U A |
Cl C2 |
über 5000 |
einmotorig mehrmotorig |
5J |
||
Bei Frachtbeförderung können die Fluggewichte überschritten werden. Eine Maschine kann unter Berücksichtigung der Flugeigenschaften und des Verwendungszweckes in eine andere Klasse eingereiht werden (z. B. B2-Masch. „Ju 160" in Klasse C).
Außerdem tragen die Maschinen der Lufthansa (ähnl. dem Schiffsverkehr), typenweise eingeteilt, einen Namen, z. B.:
Junkers Ju 52 Pour-le-merite-Flieger und im Luftverkehr Verunglückte, Ju 160 Raubtiernamen (Leopard), Ju 90 Ländernamen (Württemberg), Ju 86 Bergnamen (wie Schneekoppe);
Heinkel He III Deutsche Städte (wie Dresden), He 70 Vogelnamen (wie Schwalbe), Die deutschen Typenabkürzungen: Ao = Ago Qo
Ar = Arado Fh
Bf = Bayr. Flugzeugwerke1) He
Bü = Bücker Hs
Do — Dornier Ju
Fieseier Kl
Fi
Fw = Focke-Wulf
Gothaer Waggonfabrik
Flugzeugwerk Halle2)
Heinkel
Henschel
Junkers
Klemm
*) od. Me = Messerschmitt. — 2) jetzt: Si — Siebel-Flugzeugwerke.

Segelflug Jugoslawien.
Zu den bereits bestehenden Segelfliegerschulen in Jugoslawien gesellte sich als neueste eine Hochleistungsschule in Vrsac, die unter der Leitung der bekannten Segelfliegergruppe „Deveti" steht.
Die Schule befindet sich auf den südlichen Ausläufern des Karpatengebirges. 80 km von Beograd entfernt und durch gute Landstraßen wie auch Eisenbahnlinien verbunden, entspricht sie jedweden Ansprüchen. Der Flugplatz selbst befindet sich am Fuße eines 400—800 m hohen und ca. 5 km langen Hügels, „Vrsacka Kula" benannt. Derselbe erstreckt sich von Süd-West gegen Nord-Osten und ist für die meist herrschenden Westwinde besonders gut geeignet. Es kann auch bei allen anderen Windrichtungen geflogen werden. Auch wurden sehr gute Ergebnisse bei reiner Thermik erzielt.
Da sich anschließend fast ausnahmslos Ebene befindet, ist das Gelände natürlich auch sehr für Landungen außerhalb des Flugplatzes geeignet, was für Anfängerschulung, wie besonders für Ueberlandflüge von Anfängern, sehr von Vorteil ist.
Nach den bisherigen Erfahrungen dürfte man wohl ruhig behaupten, es wäre das beste Gelände in Jugoslawien, was durch fabelhafte Resultate bewiesen wurde, obwohl die Schule erst ca. 2 Monate dauerte, und zwar:
Segelflugschule Vrsac. Jugoslaw. Segelflug-Gelände. Lageplan.
Zeichnung Flugsport
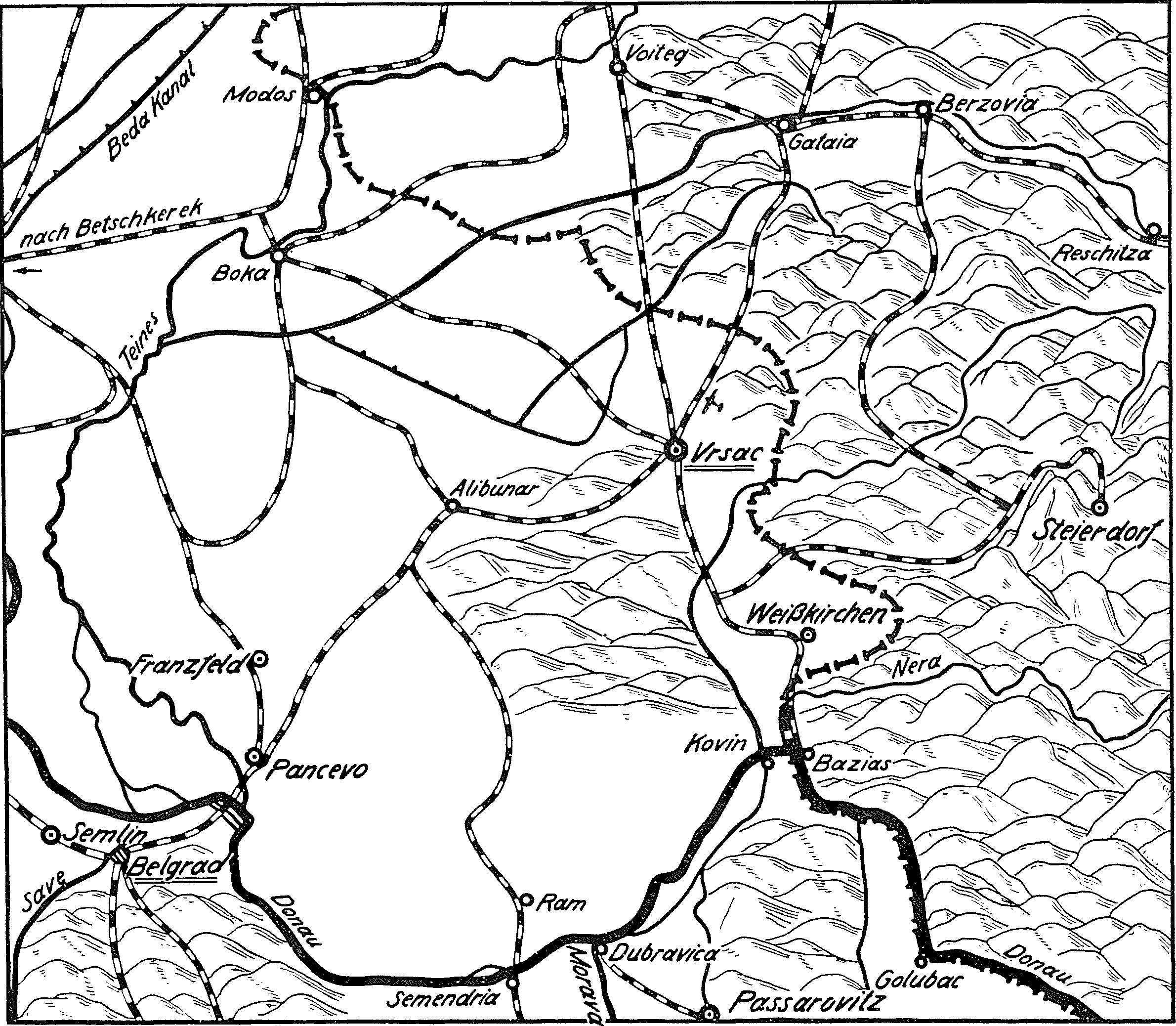
Jugoslaw. Segelfluggelände Vrsac. Archiv Flugsport
30 C-Prüfungen, 16 amtliche C-Prüfungen, 2 silberne C-Prüfungen, 7 Dauerbedingungen, 6 Höhenbedingungen, 2 Entfernungsbedingungen. Weiter wurde der neue jugoslawische Höhen- (1555 m) und Dauerrekord (11h 5') aufgestellt. Insgesamt wurden 481 Flugzeugschleppstarts mit 255 Flugstunden erzielt. Gestartet wurde mittels Flugzeug und Autowinde.
Für dieses Jahr ist die Erbauung eines Gebäudes geplant, welches allen Anforderungen einer solchen Schule entsprechen wird. Damit würde Jugoslawien auch eine eigene Rhön bekommen. Wir wünschen eine baldige Verwirklichung.
7000 m Höhe segelte Erich Kjöckner, Segelflugforschungsgruppe Prien am Chiemsee. Er hatte sich zur Föhnforschung mit einem Motorflugzeug bei stürmischem Wind bei Oberbinzau hochschleppen lassen, klinkte über Mitterfill aus und wurde in 7000 m Höhe durch Einfrieren des Sauerstoffgerätes bewußtlos, fiel auf 4500 m und landete dann bei Seefelde.
Engl. Flieger-Kadetten sollen von Mai bis Oktober in engl. Segelfluglagern im Segelflug ausgebildet werden.
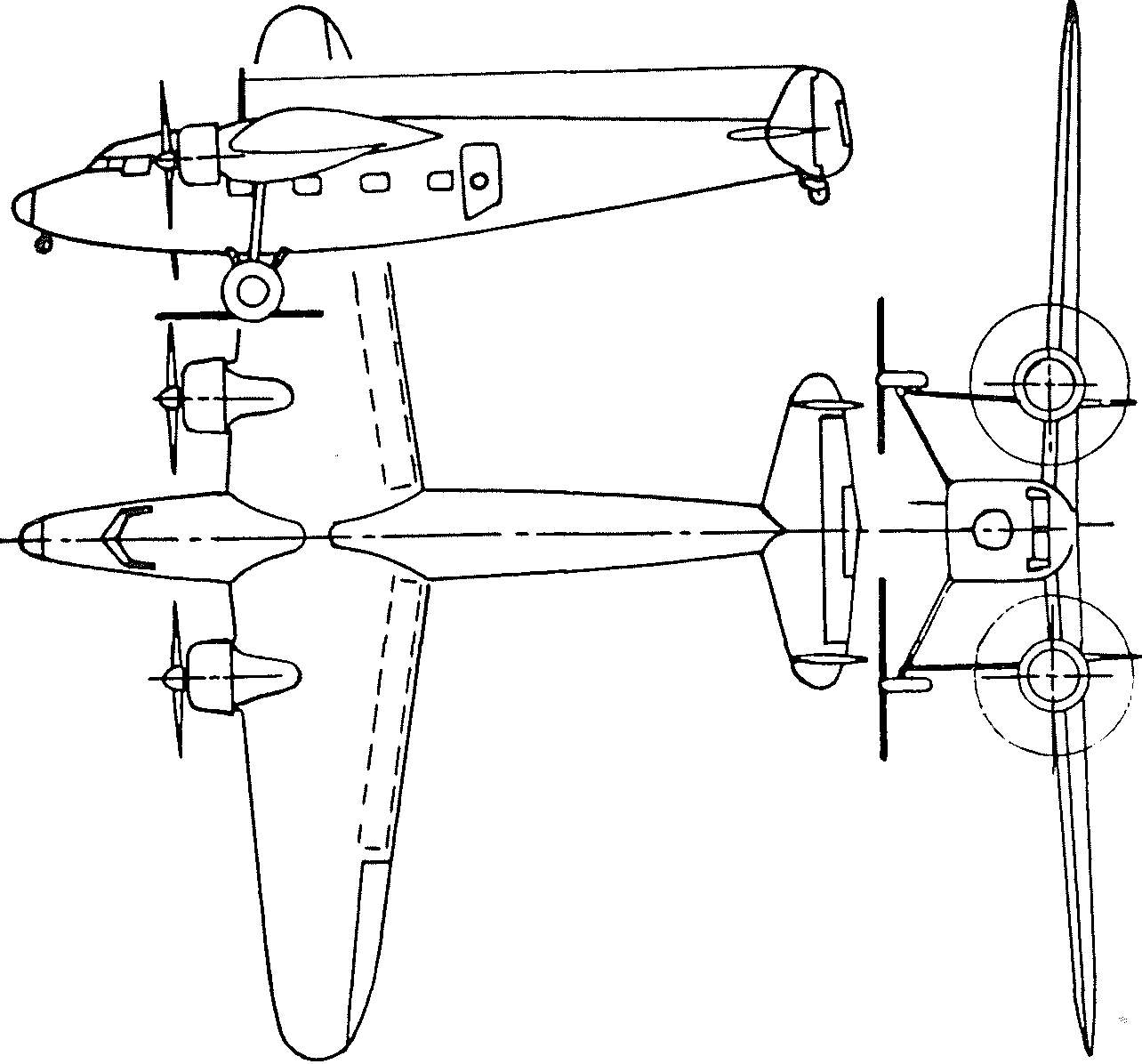
Koolhoven F. K. 50
*£uß-%st.

230-PS-Benz-Flugmotor finden Sie sehr ausführlich im „Flugsport" 1918, S. 585, beschrieben.
Reiseflugzeug Koolhoven F. K. 50
war ein freitragender Hochdecker. Eine Uebersichtsskizze finden Sie nebenstehend.
Luftdruckabnahme beträgt bei 0 km Höhe 760 mm, 1 km 674 mm, 2 km 596 mm, 3 km 525 mm, 4 km 461 mm, 5 km 403 mm, 6 km 352 mm, 8 km 266 mm, 10 km 198 mm.
Literatur,
(Die hier besprochenen Bücher können von uns bezogen werden.) Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst v. Otto Lilienthal. 3. Auflage m. 80 Abb. u. 8 Tafeln. Verlag R. Oldenbourg, München. Preis RM 9.—.
In letzter Zeit war ein Buch von Lilienthal kaum noch aufzutreiben Endlich
kommt eine Neuauflage, es ist dies die dritte. Die neueste Ausgabe ist ein fotomechanischer Nachdruck der 1. Auflage, und zwar hergestellt nach dem Handexemplar von Otto Lilienthal, das er inzwischen, offenbar zur Vorbereitung einer 2. Auflage, mit handschriftlichen Bemerkungen versehen hatte. Diese Bemerkungen geben dein Buche einen besonderen Reiz. Hinzugefügt ist ein Verzeichnis der Veröffentlichungen von Otto Lilienthal und des Schrifttums über ihn selbst. Das Geleitwort schrieb Prof. L. Prandtl.
Medizinischer Leitfaden für fliegende Besatzungen, mit Anhang Erste Hilfe bei Flugunfällen, v. Heinz v. Diringshofen, Oberstabsarzt der Luftwaffe. Mit 75 Abb. u. 2 Ausschlagtafeln. Verlag Theodor Steinkopff, Dresden. Preis RM 3.—-.
Im vorliegenden Leitfaden ist zum erstenmal in klarer und allgemein verständlicher Sprache alles das behandelt, was der Flieger und Arzt von der Luftfahrtmedizin wissen muß. Wichtig für alle am Flugwesen Interessierten sind die Kapitel Höhenflug, Wirkung von Beschleunigungen und Fliehkräften auf den Menschen, Bedeutung der Sinnesorgane für den Flieger, Sinnestäuschungen beim Blindflug, Schall- und Erschütterungswirkungen und die Ursache der Luftkrankheit.
Der regelmäßige deutsche Luftverkehr nach Südamerika in seiner wirt-schafts- und politisch-geographischen Bedeutung, v. F. K. Frhr. v. Koenig-Wart-hausen. (Heft 3 d. Tübinger geogr. u. geol. Abhandig., Reihe II). Verlag Hohen-lohesche Buchhandlung Ferdinand Rau, Oeh ringen. Preis RM 2.20.
Verfasser behandelt hauptsächlich bis zum Jahre 1934 die auf der Strecke Deutschland—Südamerika auftretenden meteorologischen Schwierigkeiten und Hindernisse, Verkehrsgeographien und wirtschaftlichen Zustände.
Segelflugmodell „Sperber-We 371", v. Helmut Wechler. (Schäfers Bauplanreihe freifliegender Flugmodelle Nr. 11.) Verlag Moritz Schäfer, Leipzig C 1. Preis RM 1.—.
Betrifft ein Wettbewerbsmodell mit geradem abwerfbarem Tragflügel und ovalem Rumpf, Spannweite 1950 mm, nur für deutsche Baustoffe und fortgeschrittene Modellbauer.
Segelflugmodell „Greif", v. Rudolf Elger. (Schäfers Bauplanreihe freifliegender Flugmodelle Nr. 12.) Verlag Moritz Schäfer, Leipzig C 1. Preis RM 1.—.
Ein Wettbewerbsmodell mit nach oben geschwungenem abwerfbarem Flügel, Spannweite 1800 mm, nur für deutsche Baustoffe und fortgeschrittene Modellbauer.
Reichsluftkursbuch unter Mitarbeit d. Deutschen Lufthansa AG. herausg. v. Reichsluftfahrtministerium. 1. Februar—15. April 1939. Preis RM 1.—.
Der 1. Teil enthält in den wichtigsten Weltsprachen Vergleiche der Uhrzeiten, Höchstmaße zur Beförderung von Gepäck und Fracht, Endbuchungsstellen und Zubringerdienst, der 2. Teil die Flugpläne von Europa und Außereuropa, der 3. Teil allgemeine Bestimmungen für die Fluggast- und Gepäckbeförderung im Luftverkehr, Luftpost, ferner sämtliche Anschriften der Luftverkehrsgesellschaften mit Telefon und Telegrammadresse.
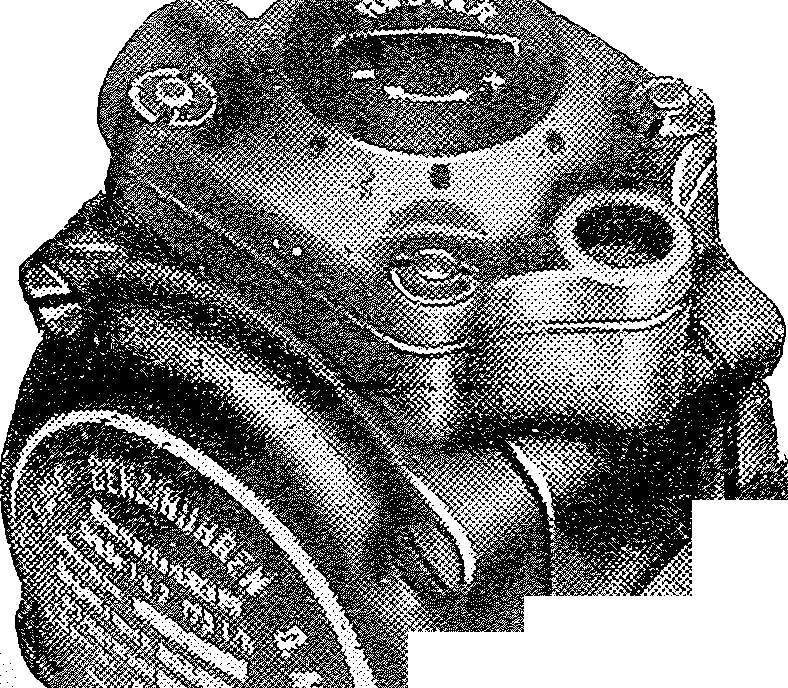
oßu
Gewichtsersparnis
Erhöhung der Sicherheit Erleichterung für Konstrukteur und Pilot
.■■ # i sind die Vorzüge unserer
wfy-^ij dmmMÜJcm f&c dm f^f^mf^m.
Heft 7/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro Vi Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ,,Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Ouellenangabe gestattet.
Nr. 7 29. März 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 12. April 1939
Höchstleistungen,
517 km/h über 1000 km mit 2000 kg Nutzlast auf Junkers Ganzmetalltiefdecker zwei Motoren Jumo 211 am 19. 3. 39.
171,9 km/h mit 50 PS über 1000 km auf Bücker „Student" Motor Zündapp mit Fluggast am 24. 3. 39.
Segelflugraum Südosten.
Zu den günstigsten Segelflugstrecken von der Wasserkuppe gehörte der Sektor zwischen Süd und Ost. Bereits vor mehreren Jahren wurden viele Fernflüge ausgeführt, die aber vielfach an der tschechischen Grenze abgebrochen werden mußten. Selbst die Tschechen, welche an dem Wettbewerb seinerzeit auf der Wasserkuppe teilnahmen, bedauerten die Schwierigkeit. Heute ist der Weg frei. Der Raum von Böhmen und Mähren in diesem Sektor mit der Fortsetzung nach der Slowakei und Ungarn gestattet Entfernungen von über
Unten: Lageplan Wasserkuppe Südosten.
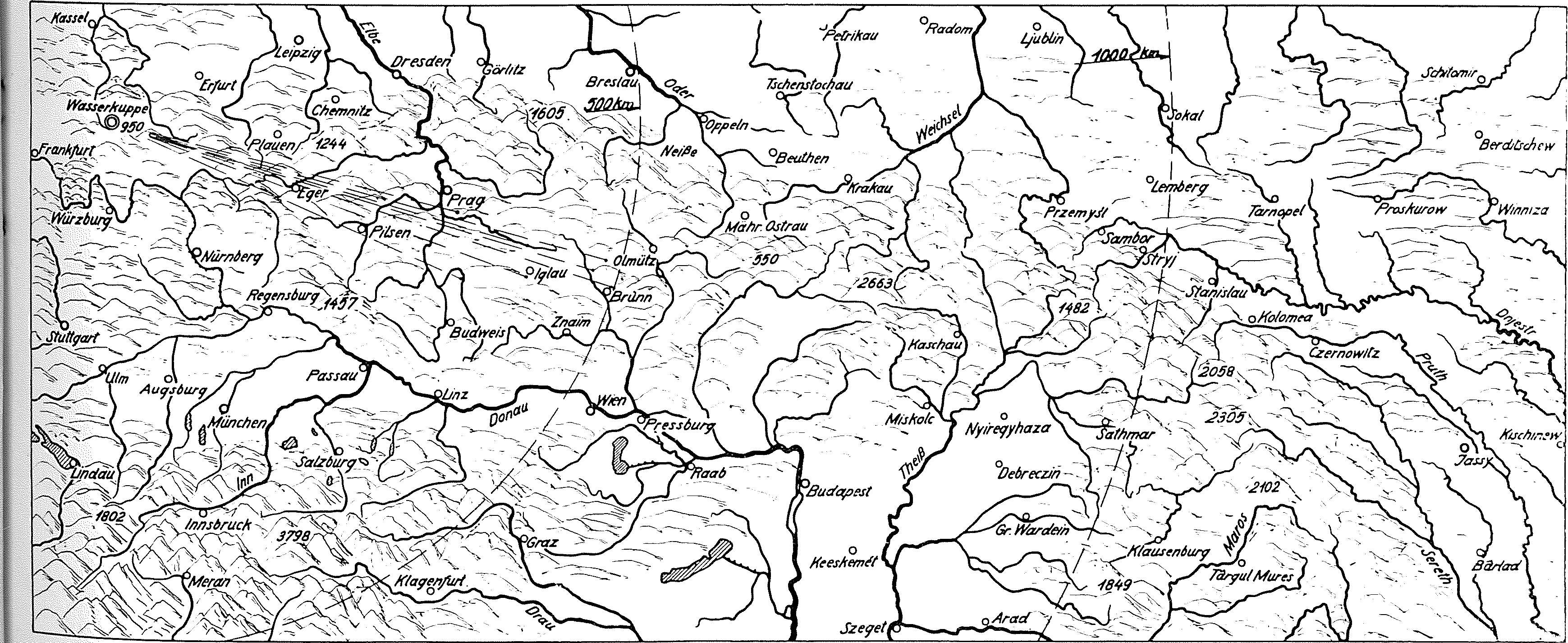
Verehrte Leser des Flugsport! Bitte sparen Sie unnütze Nachnahmespesen und senden Sie uns die fällige Bezugsgebühr für das 1. Vierteljahr 1939: RM 4.50, möglichst auf unser Postscheckkonto 7701 Frankfurt a. M. Nach dem 7. April werden wir diese zuzüglich 30 Pf. Spesen durch Nachnahme einziehen.
Diese Nummer enthält Patentsammlung Nr. 5, Band VIII.
2000 km. Dabei ist dieser Sektor ausgestattet mit wunderbaren Gebirgszügen, im Norden die Tatra mit der Fortsetzung der Ostbeskiden, Karpaten und allerhand Querverbindungen, den böhmischen Höhen, dem weißen Gebirge, dem ungarischen Erzgebirge nach Süden.
Der Segelflugraum — und freie Bahn dem Tüchtigen — ist vorhanden.
Daneben steht immer noch der Bibesco-Preis offen. Bisher wurde er noch nicht ausgetragen. Jetzt ist das Gelände frei. Vielleicht gelingt es in diesem Jahre.
Der bisher in diesen Ländern zurückgebliebene Segelflugsport wird nunmehr starken Auftrieb erhalten.
Luscombe ,.Fifty".
Der abgestrebte Hochdecker der amerikanischen Firma „Luscombe Aircraft Corporation" ähnelt dem Baumuster „Phantom" (s. „Flugsport" 1937, S. 222); eine Bauweise, die den heutigen Anforderungen in Europa nicht mehr entsprechen.
Flügel abgestrebt, zweiteilig, an der Oberkante des Rumpfes über der Kabine angelenkt. Abgefangen mit V-Stiel.
Rumpf Leichtmetallschalenbau, geschlossene Kabine mit 2 nebeneinanderliegenden Sitzen, 2 gut zugängliche Türen.
Leitwerk freitragend. Stahlrohrgerippe, Flossen mit Duralumin beplankt. Höhenruder 0,82 m2, Seitenruder 0,52 m2, beide nicht ausgeglichen.
Fahrwerk halbfreitragend, Oelfeder-beine. Frei drehbarer Schwanzsporn mit 76 mm Spornrad.
Triebwerk: „Continental A — 50", luftgekühlt mit 4 gegenüberliegenden Zyl., bei 1900 U/min 50 PS, 50-1-Brenn-stoffbehälter im Rumpf.
Spannweite 10,65 m, Länge 6,34 m, Höhe 1,65 m, Leergew. 280 kg, Fluggew. 500 kg, Flächenbelastung 40 kg/cm2.
Höchstgeschw. 166 km/h, Reise-geschw. 150 km/h, Landegeschwindigkeit 50 km/h. Steigzeit 1 min auf 229 m. Steiggeschw. 198 m/min. Dienstgipfelhöhe 4100 m, Reichweite 640 km.
Skandina. Zweisitzer KZ 11 Sport und Kupe.
KZ II wurde von der Skandinavisk Aero Industri A/S., Kopenhagen, nach den englischen Bauvorschriften gebaut.
Flügel freitragend, zweiholmig. Mittelstück mit dem Rumpf fest verbunden. Ansatzflügel zweiholmig, Holzkonstruktion.
Rumpf Stahlrohrkonstruktion, leinwandbekleidet. Sitze bei KZ II Sport hintereinander, offen, mit Windschirm. Bei KZ II Kupe geschlossene Kabine, Sitze nebeneinander, Kabinenbreite 1,44 m, Einstieg durch das Kabinendach. Hinter den Sitzen Gepäckraum 1,1X0,7X0,5 m, der nach vorn offen ist. Die Steuerung ist in der Mitte zwischen beiden Sitzen mit je einem Griff angebracht.
Höhen- und Seitensteuerflächen mit Rudern in Holzkonstruktion, letztere aerodynamisch ausgeglichen. Höhenruder Trimmklappe, am Führersitz durch Bowdenzug zu betätigen.
Fahrwerk fest, mit Spiralfedern abgefedert (für Fallgeschwindigkeit von 3 m/sec), Räder Friktionsbremsen, Ballonreifen 465X165 mm
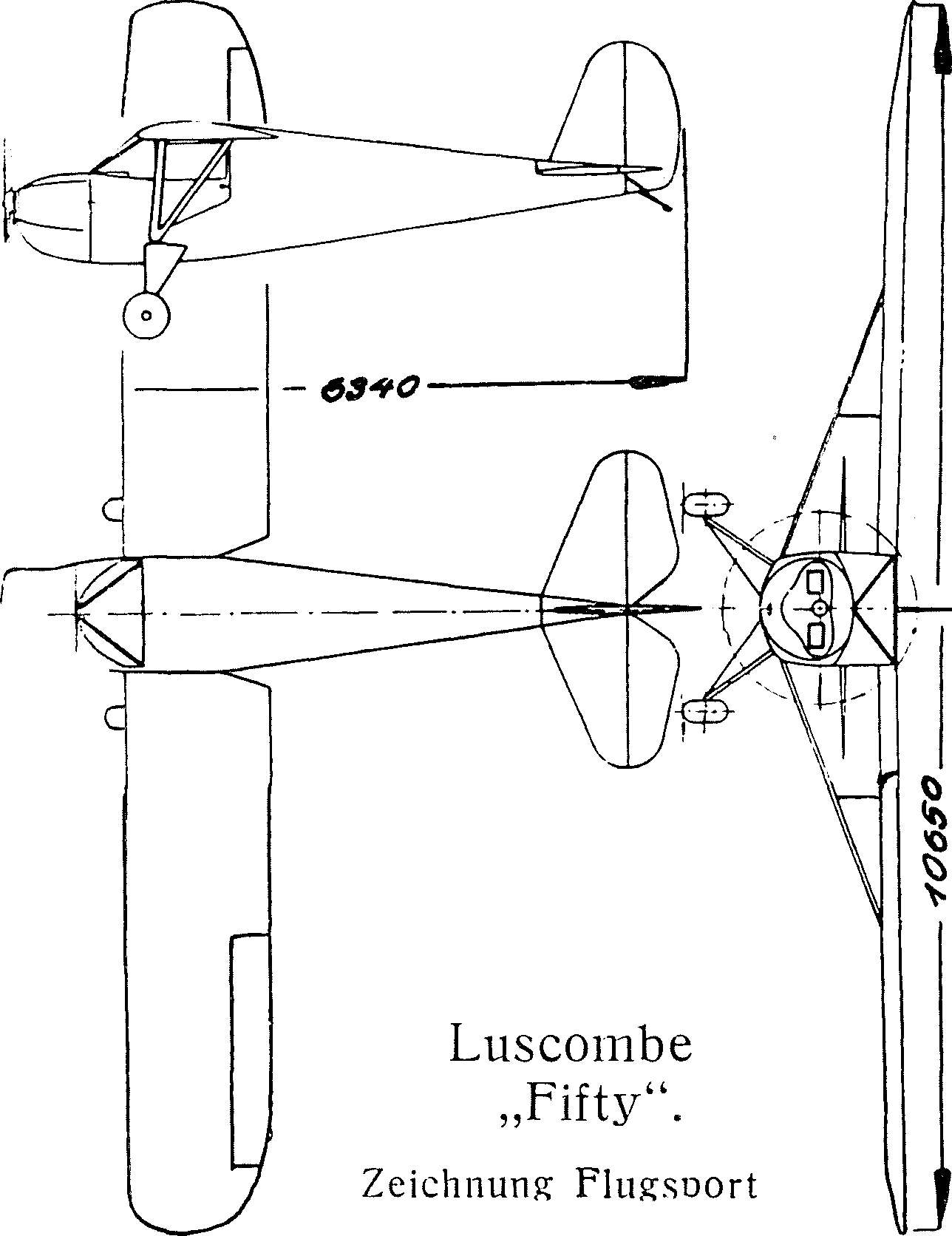
KZ II Sport Motor Hirth 504 A II 105 PS. Je 1 Betriebsstoffbehälter von 55 und 60 1 in den Flügelstümpfen. Spannweite 10,2 m, Länge 7,6 m, Höhe 2,1 m, Tragfläche 15 m2. Leergewicht 475 kg, Nutzlast 325 kg, Fluggewicht 800 kg.
Höchstgeschwindigkeit 220 km/h, Reisegeschwindigkeit 200 km/h, Landegeschw. 72 km/h, Auslauf, voll belastet mit Bremsen und Landeklappen, 85 m, Startstrecke, voll belastet, 95 m, Gipfelhöhe 5000 m, Aktionsradius 1100 km. Oelverbrauch 0,15 1/h, Betriebsstoffverbrauch 25 1/h.
KZ II Kupe Motor 80/90 PS „Citrus Minor". Dahinter vor dem Brandspant Oelbehälter 11,5 1. Zwei Betriebsstoffbehälter je 72 1 in den Flügelstümpfen.
Bei der Ausführung als Kabinenflugzeug befinden sich die Sitze nebeneinander. Steuerknüppel Y-förmig, an den oberen Enden zwei Handgriffe, so daß beide Insassen den Knüppel bedienen. Fußpedale vor beiden Sitzen,
Flügel bei der Kabinenmaschine nach hinten zurückklappbar, so daß das Flugzeug in einem Raum von 4,5 m Breite untergebracht werden kann.
Spannweite 10,5 m, Länge 7,3 m, Höhe 2 m, Tragfläche 15 m2. Leergewicht 450 kg, Nutzlast 300 kg, Fluggewicht 750 kg. Höchstgeschwindigkeit 210 km/h, Reisegeschwindigkeit 175 km/h,
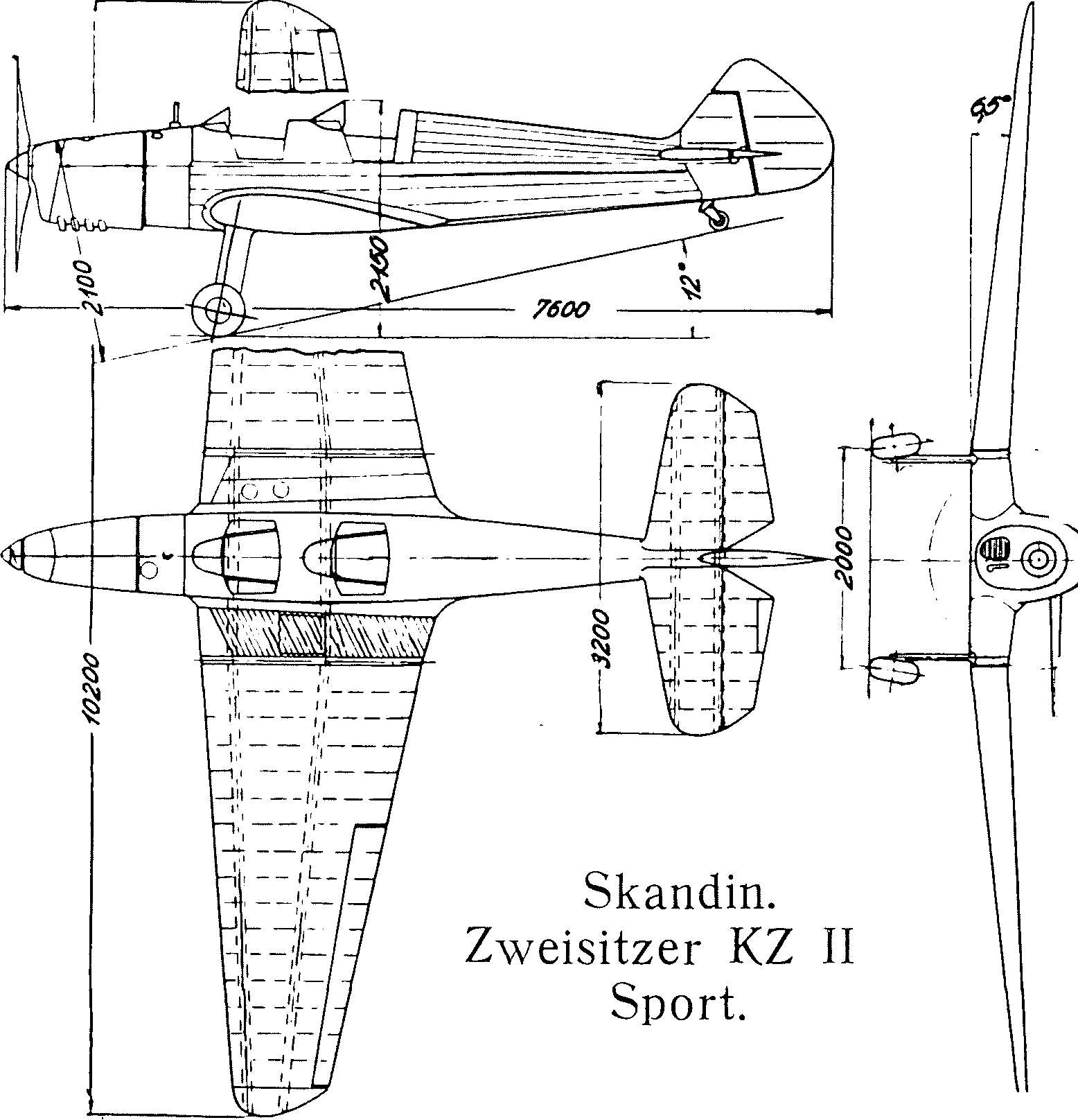
Zeichnung Flugsport
"";-Ä2*>
■ü

Skandinav. Zweisitzer KZ II. Oben Typ Sport, unten Typ Kupe.
Werkbilder
Landegeschwindigkeit 72 km/h, Auslauf, voll belastet, mit Bremsen, 105 m, mit Bremsen und Landeklappen 85 m, Startstrecke, voll belastet, 95 m, Gipfelhöhe 5000 m, Aktionsradius 1100 km. Oelverbrauch 0,25 1/h, Betriebsstoffverbrauch 21 1/h.
Dart-G. Sportflugzeug.
Der doppelsitzige Tiefdecker wird von der Dart Manufacturing Corporation, Port Columbus, Ohio, hergestellt.
Flügel freitragend, halbelliptisch mit Profil NACA 2315; 51/2°, V-Form. Holzbauweise, 2holmig, stoffbespannt. Querruder Holz, stoffbespannt, Ausschlag 30° nach oben und 25° nach unten. Brennstofftanks im Flügel.
Rumpf rechteckiger Querschnitt, verschweißte Stahlrohrkonstruktion; stoffbespannt und metallbeplankt, nebeneinanderliegende Sitze, geschlossene Kabine.
Leitwerk sehr groß, freitragend, Stahlrohre geschweißt, stoffbespannt. Höhenruder ± 30°, Seitenruder 30° nach rechts und links.
Dreibeinfahrwerk, Stahlrohre. Senkrechte Strebe, Oelfederbein.
Triebwerk Lambert R-266, 90 PS bei 2375 U/min.
Spannweite 9,12 m, Länge 5,68 m, Höhe 1,83 m, Fläche 13,58 m2; sL Leergew. 412 kg, Flug-"7 gew. 704 kg, zahlende Last 136 kg. Max. Geschwindigkeit 211 km/h, Reisegeschw. 180 km/h, Landegeschw 65 km/h, Steiggeschw. 4,3 m/Sek., Dienstgipfelhöhe 4540 m, absolute Höhe 5560 m.
Brennstoff 95 1, Oel 9,1 1. Reichweite 890 km.
Dart-G.
Zeichnung Flugsport
Fiat „0 50".
Den Jagdeinsitzer, einen freitragenden Tiefdecker in Ganzmetall-schalenbauweise, haben wir im „Flugsport" 1937, S. 320 und S. 583 anläßlich des Mailänder Salons besprochen. Nebenstehend bringen wir eine Uebersichtszeichnung, aus welcher man sich eine Vorstellung von dem guten Gesichtsfeld über dem Doppelsternmotor und den sonstigen Größenverhältnissen der Maschine machen kann. Charakteristisch ist die Flügelvorderkante und die Verbreiterung im Mittelstück nach dem Rumpf zu, wodurch gerade noch Raum, für das hochgezogene Fahrwerk geschaffen wird (vgl. den Grundriß: Fahrwerksanlenkung im Mittelstück).
Spannweite 10,90 m, Länge 7,8 m, Höhe 2,96 m, Flächeninhalt 18,25 m2.
Motor Fiat A 74 RC 38, 840 PS in 3800 m Höhe, mit dreiflügeliger Fiat-Verstell-Luftschraube. Leergewicht 1900 kg, Fluggewicht 2330 kg.
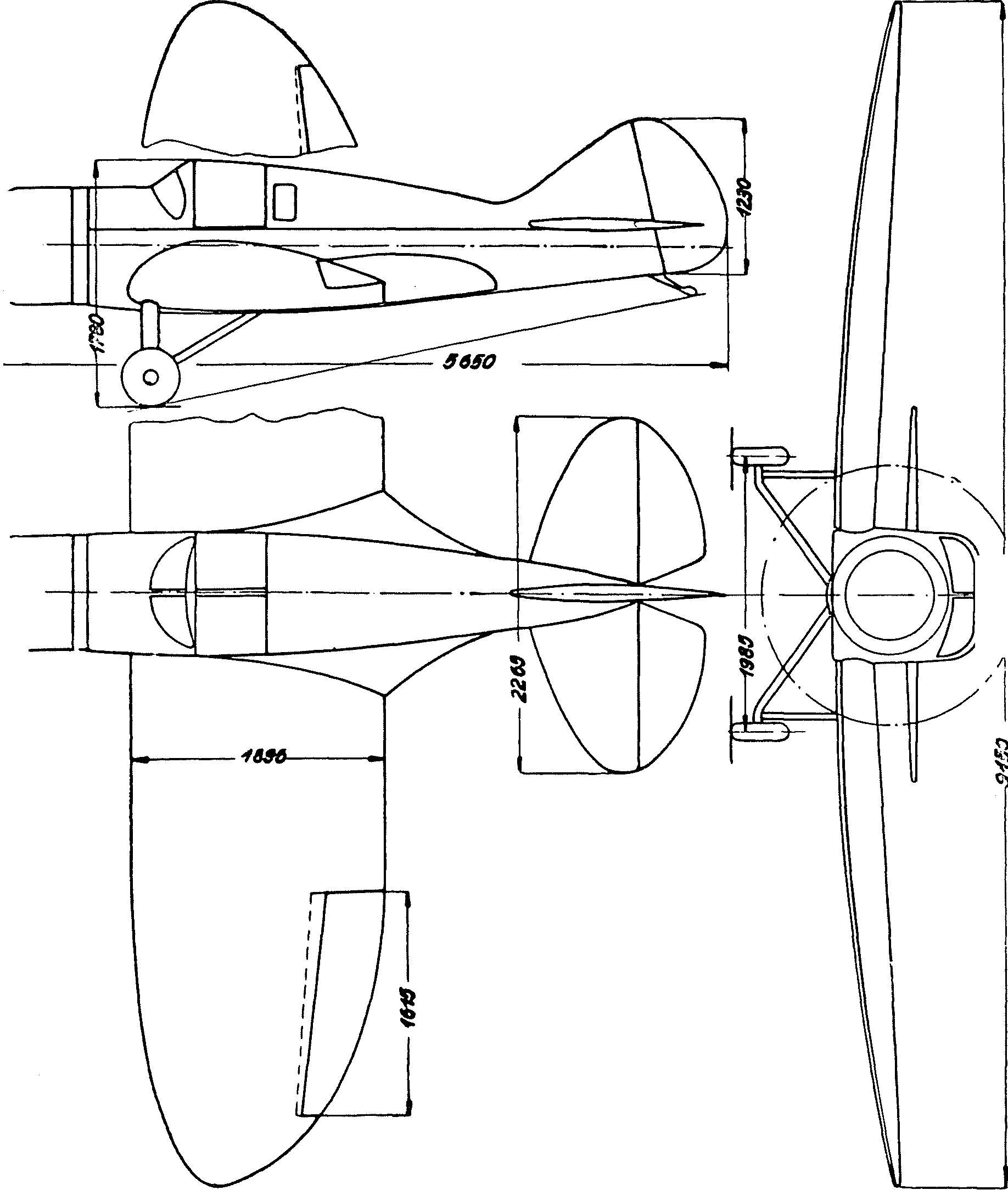
Fiat Q 50,
Archiv Flugsport
Nutzlast 430 kg, normale Flughöhe 4500 m, Höchstgeschwindigkeit 490 km/h, Reisegeschwindigkeit mit 70% Volleistung 420 km/h, Landegeschwindigkeit mit Klappen 115 km/h, Steigzeit auf 5000 m 5 min 2 sec, Gipfelhöhe theoretisch 9500 m, Lastvielfaches 14.
Tschech. Aero A-304.
Dieser Tiefdecker Aero A-304 mit 2 Walter-Motoren 430 PS. konstruiert von Ing. A. Husnik, gebaut von der Aero, Tovarna Letadel Dr. Kabes, Prag, ist bestimmt für Erkundung, Schulung, Bombenwerfen und Photographie. Besatzung: Führer, Beobachter und Schütze.
Bewaffnung ein fest eingebautes MG. nach vorn, je ein bewegliches MG. nach hinten und unten. Bombenaufhängungen entweder 6 Bomben von 10—20 kg oder 2 Bomben von 50 kg unter dem Flügel und eine Bombe von 100—200 kg unter dem Rumpf.
Für Nachtflugbetrieb zwei Leuchtbomben unter dem Flügel. Bombenauslösebetätigung pneumatisch.
Ausrüstung Funk-Anlage für Gebe und Empfang. Ein Hand- und automatisches Lichtbildgerät. Telefonverbindung nach allen Arbeitsstellen. Elektrische Zentrale für Beleuchtung, Heizung, Lichtbildgerät. Stromlieferung Generator und Batterie.
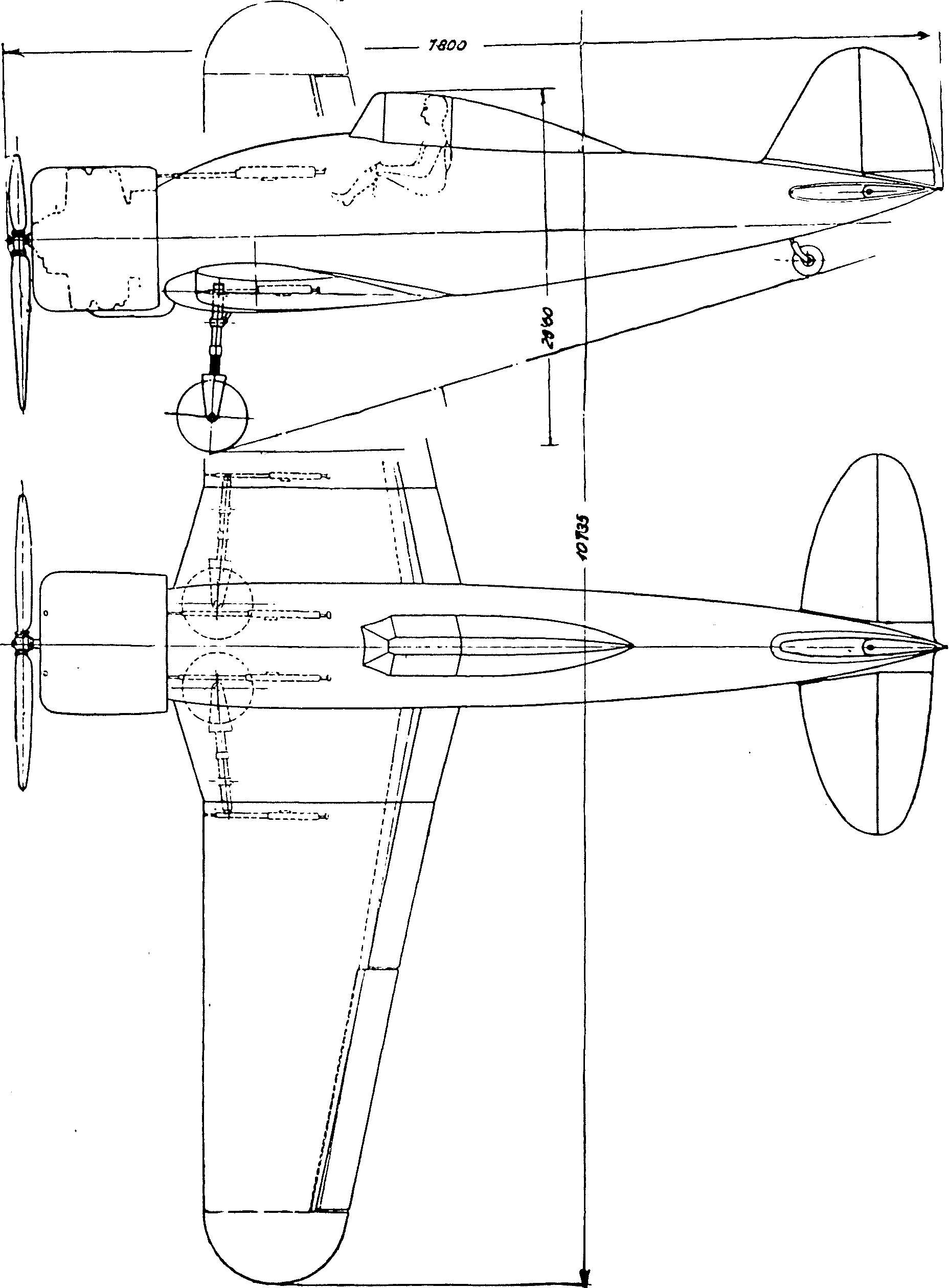
Fiat G 50. Jagdeinsitzer Zeichnung Flugsport
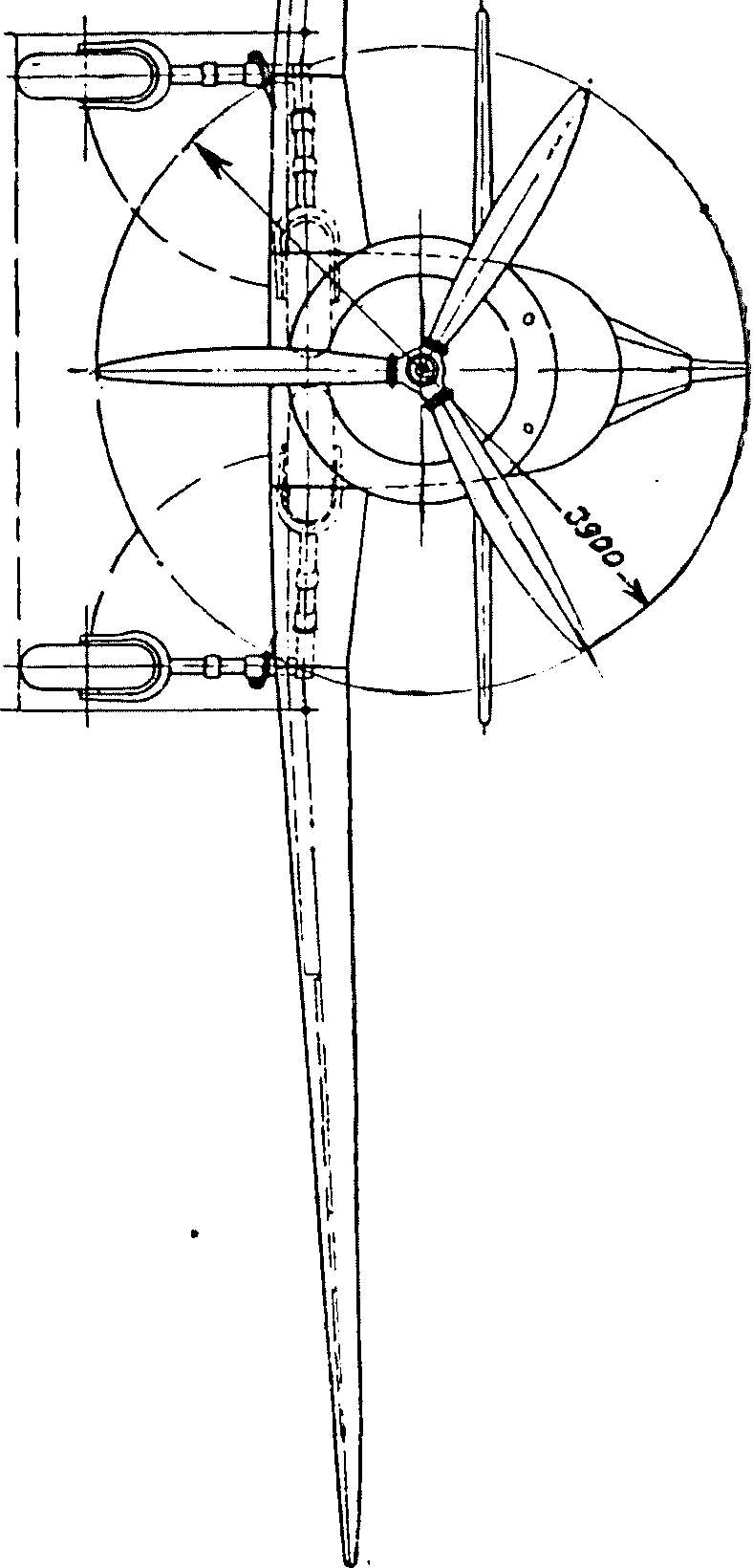
Tschech. Aero A-304 Zweimotor.
Werkbilder
Flügel V-Form, Holzbauweise, Bedeckung Sperrholz. Querruder Holzkonstruktion, mit Leinwand bedeckt. Landeklappen Duralumin, hydraulisch betätigt.
Rumpf Stahlrohrgerüst, geschweißt. Formgebung durch Holzgerippeauflage, Rahmenwerk für Fenster Duralumin.
Feste Leitwerksflächen, Holzkonstruktion, Sperrholzbedeckung. Ruder Stahlrohr, Leinwandbedeckung. Am Ende Flettnerruder.
Fahr werk große Spurweite, hydraulisch hochziehbar. Drucklieferung durch Motorpumpe, zur Reserve durch Handpumpe. Radreifen Niederdruck, Differentialbremsen.
Zwei Motoren Walter-Super Ca-stor I-MR 430 PS in 1750 m Höhe.
Spannweite 19,20 m, Länge 13,20 m, Höhe 3,40 m, Fläche 45,50 m2. Leergewicht 3000 kg, Nutzlast 1355 kg, Fluggew. 4355 kg. Leistuhgsbelastung 5,1 kg/PS, Flächenbelastung 95,8 kg/m2, Höchstgeschwindigkeit am Boden 300 km/h, in 1000 m 318 km/h, in 1750 m 323 km/h, in 2000 m 322 km/h, in 3000 m 318 km/h, in 5000 m 315 km/h.
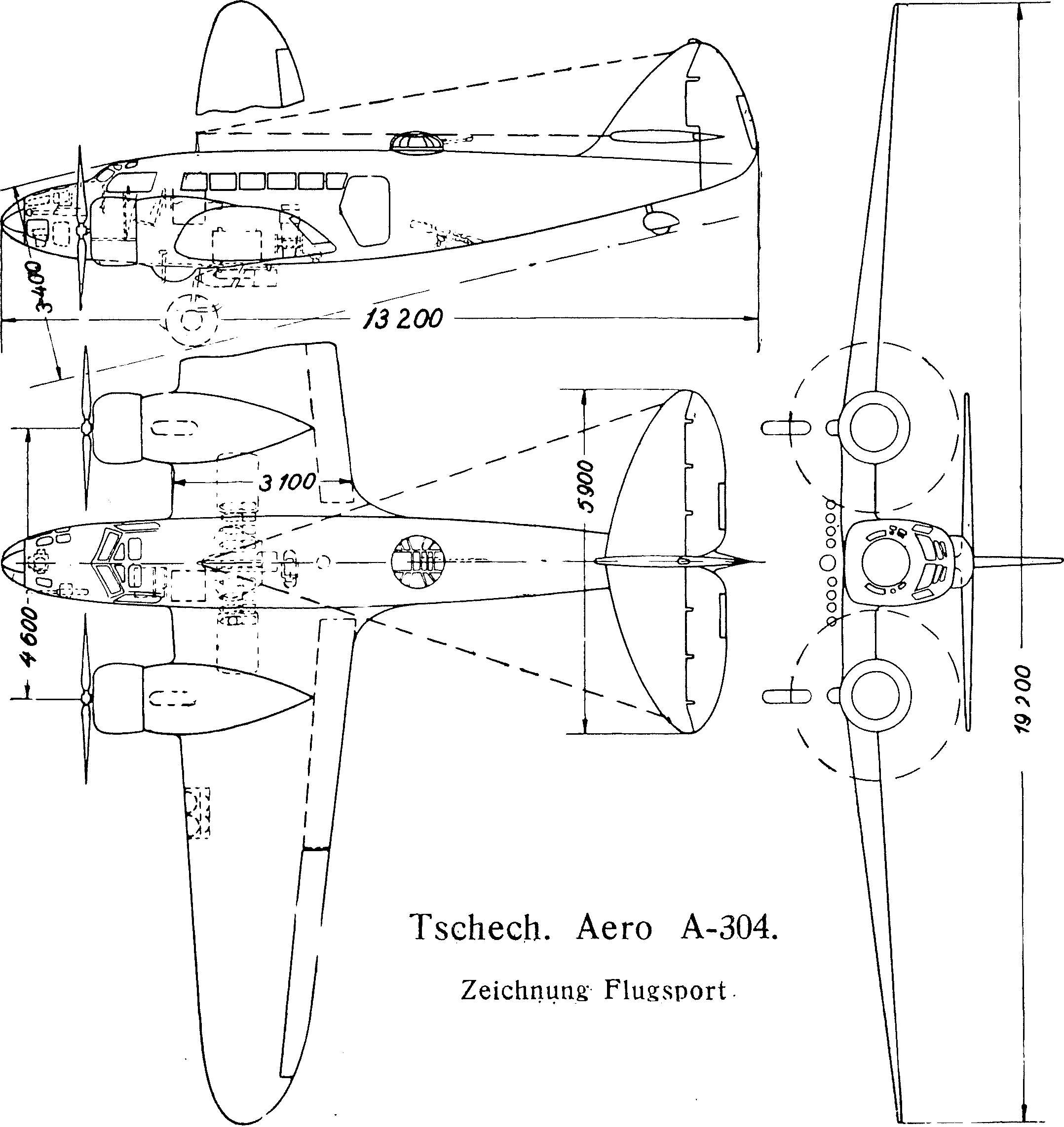
Steigfähigkeit auf 1000 m in 4 min, auf 2000 m in 7,30 min, auf 3000 m in 12,20 min, auf 4000 m in 19 min. Absolute Gipfelhöhe 6300 m, praktische Gipfelhöhe 5800 m, mit einem Motor 2000 m. Start 230 m, Auslauf 200 m. Reichweite mit 70% Motorleistung 1200 km.
Schwanzlose Handley Page.
Handley Page hat nach den Entwürfen von Lachmann ein schwanzloses Zweimotorenflugzeug mit Druckschrauben im Bau. Freitragender Flügel mit Endscheiben und Endrudern. Für die Längsstabilität und Trimmung sind vor dem Mittelstück, etwas über der Flügelnase liegend, zwei Hilfsflügel angeordnet. Auf diese Anordnung wurde Lachmann — Handley Page am 2. 1. 39 ein Patent Nr. 497 969 erteilt. Ob jedoch das Flugzeug in der skizzierten Form (Abb. 1) bei Ausfall eines Motors noch geradeaus fliegen kann, muß stark bezweifelt werden.
Bekanntlich macht bei Schwanzlosen die Ueberwindung der stark kopflastigen Momente der Landeklappen insofern Schwierigkeiten, als ja beim „Ziehen" des normalen Höhenruders (meistens übernehmen die Querruder durch gleichsinniges Ausschlagen diese Funktion) der Gesamtauftrieb stark verringert wird. Eine normale Schwanzlose wird also bei gleicher Flächenbelastung und Landeklappengröße immer eine größere Landegeschwindigkeit besitzen als ein Normalflugzeug.
Da zur Erzielung von Längsstabilität der gesamte Sclrwerpunkts-bereich knapp vor dem Neutralpunkt des Flügels liegen wird, lag es nahe, alle kopflastigen Momente nicht durch das auftriebvermindernde Höhenruder, sondern (genau wie bei der „Ente") durch eine auftriebserhöhende Stabilisierungsfläche vor dem Schwerpunkt zu kompensieren. Hierbei sind die zwei kleinen Hilfsflügel derartig mit der Landeklappe gekuppelt, daß beim Ausfahren der Landeklappe keine Lastig-keitsänderung um die Querachse eintreten kann.
Geflogen und gelandet wird die Handley Page wie üblich mit als Höhenruder ausgebildetem Querruder.
Zusätzlich können die Hilfsflügel zum Austrimmen des Flugzeuges bei verschiedenen Schwerpunktlagen verwendet werden.
Abb. 2 (unten links). Auf der Steuerbordseite „normales" Austrimmen der kopflastigen Landeklappenmomente durch Abtrieb erzeugende Höhenruder hinter dem Schwerpunkt. Auf der Backbordseite Austrimmen der kopflastigen Momente nach Lachmann durch vor dem Schwerpunkt liegende, Auftrieb erzeugende Trimmflächen. Das Höhenruder kann unter Umständen zur Auftrieberzeugung nach unten ausgeschlagen werden. MHö = schwanzlastiges Moment des Höhenruders, MTri = schwanzlastiges Moment der Trimmfläche und MLa = kopflastiges
Moment der Landeklappe.
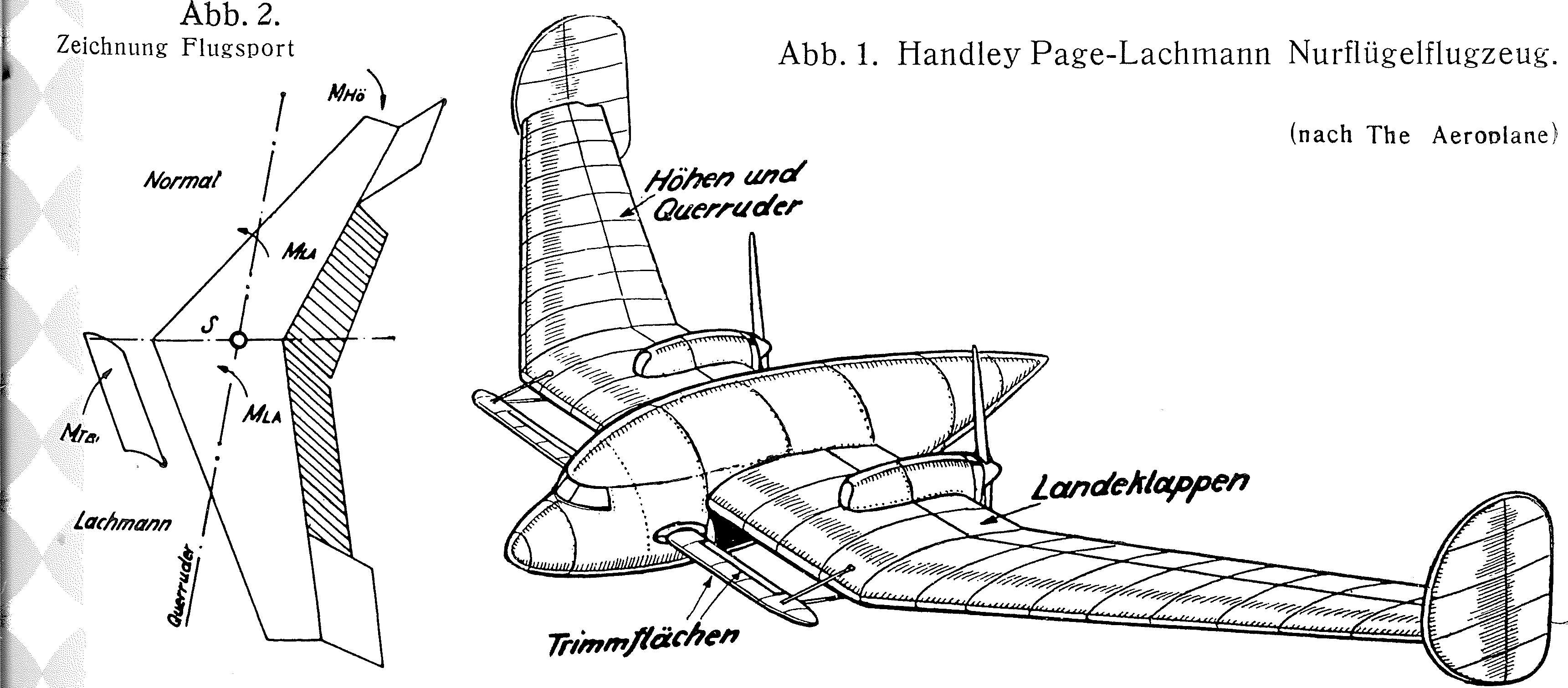
f
1
Streckziehen im Flugzeugbau.
Beim Streckziehen wird das Blech hauptsächlich durch Strecken verformt, im Gegensatz zum Tiefziehen, wo das Blech mit Niederhalter und Ziehring gezogen wird. Zum Streckziehen bedient man sich einer Streckpresse, die in einem modernen Betrieb hydraulisch betätigt wird. Bei. den im Junkers-Flugzeugbau verwendeten Pressen ruht der Tisch auf ein oder zwei Kolben, die in entsprechenden Zylindern unter Druckwirkung von Oel und Wasser den Tisch nach oben bewegen. Durch sein Eigengewicht bewegt sich der Tisch, unter gleichzeitiger Verdrängung der nicht mehr unter Druck stehenden Flüssigkeit, wieder nach unten. Der Tisch kann auch in geneigter Stellung betrieben werden, und zwar durch verschiedenen Druck, den man den einzelnen Kolben gibt.
An der Längs- und Querseite des Tisches sind auf T-Trägern, die im Boden eingelassen sind, unter Zwischenfügung von beweglichen Spannbalken verstellbare Spannzangen angebracht, welche beim Arbeiten das Blech festhalten (Abb. 1). Durch diese beweglichen Spannbalken mit ihren verstellbaren Spannzangen kann man sich den verschiedenen Grundformen der Formhölzer anpassen und dadurch schon eine wesentliche Unterstützung der Verformung erreichen. Die Spannbalken werden durch motorisch angetriebene Spindeln verstellt und bewegt. Die Spannzangen selbst werden von Hand durch Lockern der Stellmutter zur Grundform passend eingestellt.
Die Steuerung der Streckpresse erfolgt von einem pultförmigen Bedienungsstand aus, auf dem die Druckknöpfe für die einzelnen Motoren, die Steuerhebel für die Kolbenbewegung, die Druckeinstellventile und die Druckanzeiger übersichtlich aufgebaut sind (Abb. 3).
Die Hersteller der Streckpressen haben in den letzten Jahren für die verschiedenen Bauelemente des Metallflugzeugbaues neben der oben geschilderten Streckpresse, die einen Preßdruck von 150 t aufweist, verschiedene Größen und Ausführungen auf den Markt gebracht. Neben dem unterschiedlichen Preßdruck von 15—150 t sind Pressen gebaut worden, welche feststehende Spannbalken, nur horizontal zu hebende und drehbare Tische sowie entsprechend der Tischgröße mehr oder weniger Spannzangen aufweisen.
Der Streckziehvorgang ist einfacher wie beim Tiefziehen. Das Aufbringen des Formholzes, die Spannzangeneinstellung ist in wenigen Minuten durchgeführt. Der Zuschnitt wird aus der Abwicklung des Formholzes in Länge und Breite direkt herausgemessen. Für die Ein-spannung werden je nach Form und Aufbau des Formholzes und Lage der Streckebene 100—150 mm je Einspannende zugegeben. Der Zu-
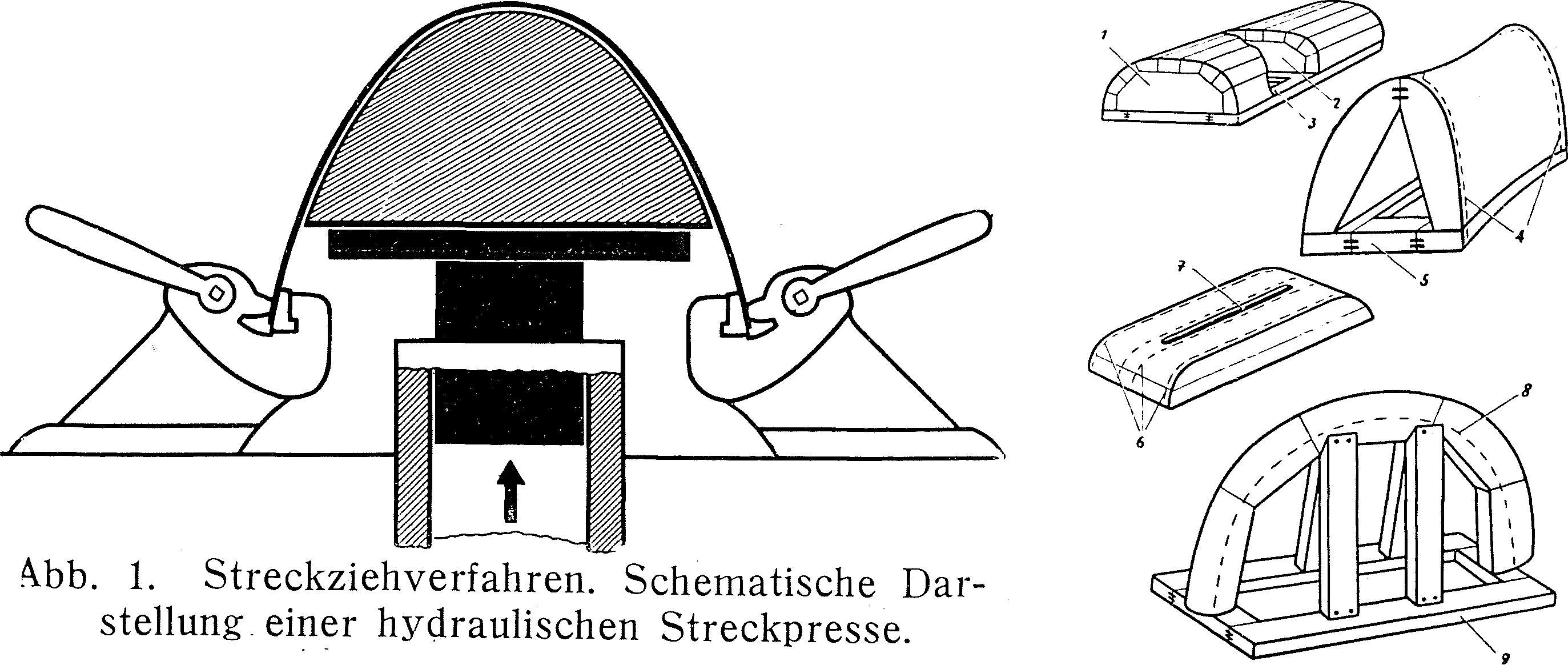
Rechts: Abb. 2. Streckziehverfahren. Formhölzer für die Blechverformung. 1, 2 Stützwand; 3, 6, 9 Formrahmen; 4, 5, 8 Markierungslinien zum Beschneiden; 7 Sicke.
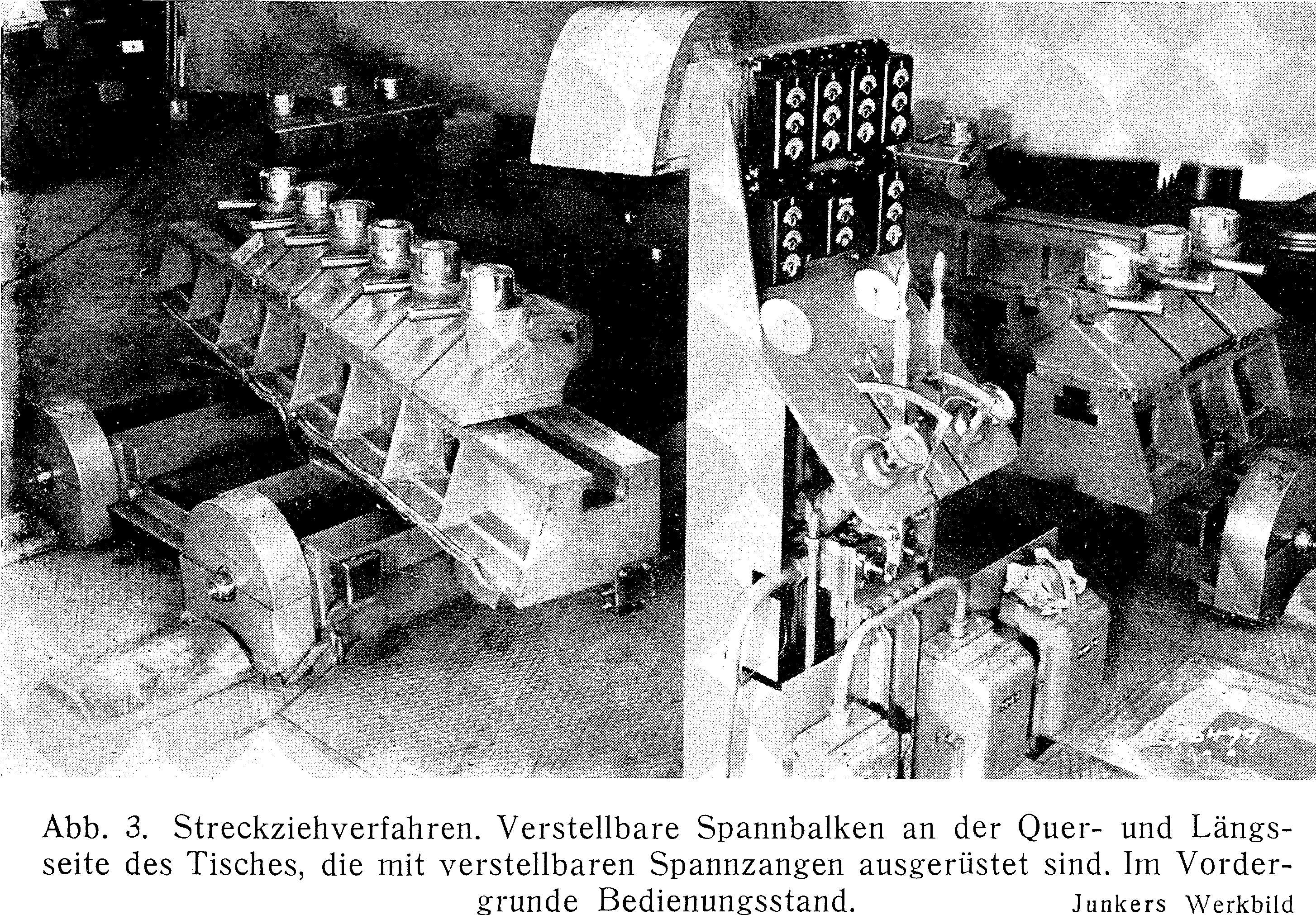
schnitt kann in den meisten Fällen gradlinig gewählt werden. Wird ein Formzuschnitt notwendig, so achte man auf einen sauberen Schnitt, da jede Einkerbung ein Reißen des Teiles schon bei der geringsten Beanspruchung herbeiführt. Ein Entgraten, möglichst Abrunden der Schnittkante ist zu empfehlen.
Ist nun das Formholz (Abb. 2) auf den Maschinentisch aufgebracht, wird das Blech fest in die Spannzangen eingespannt. Der Maschinentisch wird nun gehoben, bis sich das Formholz gegen das Blech legt. Durch entsprechende Drucksteigerung und langsames Heben des Tisches legt sich das Blech um das Formholz (Abb. 4).
Zur Unterstützung der Verformung kann man die Spannbalken mit den Spannzangen vom Tisch wegbewegen oder an den Tisch
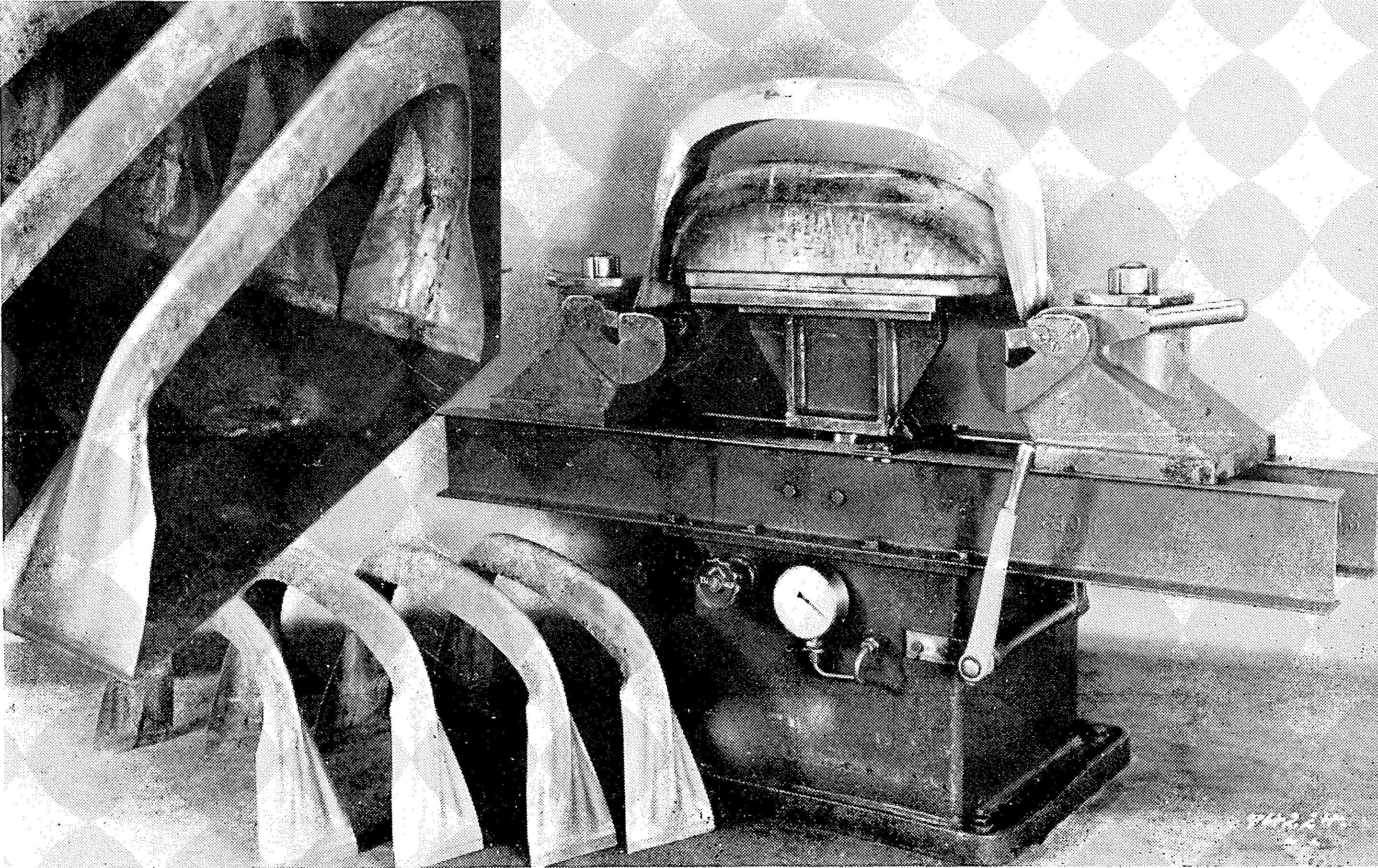
Abb. 4. Streckziehverfahren. Herstellung von Flügelendkappen. Junkers Werkbild
heranfahren. Dadurch tritt eine zusätzliche Streckung in der Tischebene oder senkrecht dazu ein.
Es empfiehlt sich in jedem Falle, also nicht nur bei größeren Verformungsarbeiten, den zur Verfügung stehenden Betrag der Blechdehnung nicht vollständig aufzubrauchen und eine oder mehrere Zwischenglühungen einzuschalten.
Bilden sich Falten, so können diese bequem und sauber mit Hilfe von Holz- und Gummihämmern entfernt werden. Sollen flache, nur wenig bombierte oder parallel zur Tischebene liegende Teile gestreckt werden, so können die auftretenden Falten durch Hereinschlagen des Bleches in Sicken entfernt werden, welche den Ueber-schuß an Werkstoff aufnehmen.
Auch ein rechtzeitiges Beschneiden des Bleches zwischen den einzelnen Streckgängen am äußeren Rand des Einspannendes begünstigt den Vorgang insofern, als man die Streckrichtung von einer weniger verformten Fläche auf die mehr verformten Flächen ablenken kann.
Das Gelingen eines Streckziehvorganges hängt in hohem Maße von der richtigen Anlage des Formholzes ab. Der Konstrukteur der Streckwerkzeuge hat immer darauf zu achten, daß die Streckebene parallel zum Tische liegt, um ein Abrutschen des Bleches zu verhindern. Ein Schrägstellen des Formholzes oder des Maschinentisches kommt dieser Forderung entgegen. Auch ein Zusammenlegen von gleichen oder verschiedenen Teilen auf ein Formholz ermöglicht oft ein gut angelegtes Streckwerkzeug und damit neben leichterer Verformbarkeit auch eine wesentliche Ersparnis an Werkstoff, da Einspannenden in Fortfall kommen.
Das Beobachten des Werkstoffes beim Strecken und das Erkennen der größten zu erreichenden Verformung, rechtzeitiges Zurückschlagen sich bildender Falten und Beschneiden der Teile setzt eine längere Schulung der nur aus angelernten Arbeitern bestehenden Belegschaft voraus.
Selbstverständlich muß die Oberfläche der Hölzer sauber und glatt gearbeitet sein, damit der Gleitwiderstand des Bleches verringert wird. Hochbeanspruchte Kanten an den Formhölzern kann man mit Harthölzern bewehren, um eine zu große Abnutzung zu vermeiden.
Vorteilhaft ist, um den Arbeiter an der Presse die notwendig werdende Beschneidarbeit und die Form des Teiles erkennen zu
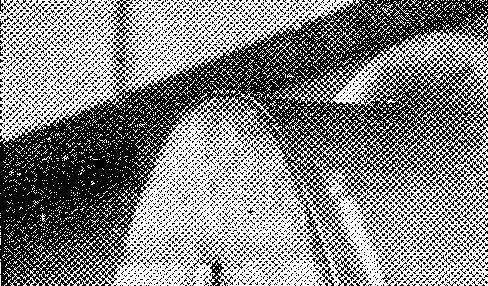
Abb. 5 u. 6. Arbeitsbeispiele für das Junkers-Streckziehverfahren. Rechts: Streckpresse, Druck 150 t, beim Streckziehen von NACA-Ringen. Werkbilder
lassen, die benötigte Fläche mit einem kleinen Zuschlag auf das Formholz aufzuzeichnen.
Für die Schmierung des Bleches oder Formholzes verwendet man am besten konsistente Fette oder pulverförmige Präparate.
Auf der Streckpresse werden nicht nur Rumpfhäute verformt, sondern auch ganze Triebwerksverkleidungen, Randbögen und Endkappen der Tragflächen und Leitwerke, NACA-Ringe (Abb. 5 u. 6), Spaltverkleidungen, Kehlen zwischen Rumpf und Tragfläche, Abgas-leitungen, Profile für Rumpf, Fläche, Trieb- und Fahrwerk.
Der einfache Aufbau der Streckpresse, die einfache billige Gestaltung der Werkzeuge hat das Verfahren zu einem beachtlichen Faktor der spanlosen Formgebung innerhalb des Metallflugzeugbaues gemacht. Fast überall, wo die Handverformung den ersten Platz einnahm, kann heute auch bei kleinsten Stückzahlen das Streckziehen angewendet werden.
Messung der Fluggeschwindigkeit,
Zu dem im Januar-Heft 1939 des „Flugsport" enthaltenen Aufsatz von Dr.-Ing. Walter Haag über „Messung der Fluggeschwindigkeit" möchte ich folgendes ergänzend mitteilen:
Die Geschwindigkeitsmessung durch Abstoppen der Flugzeit auf bestimmten, gegebenen Flugstrecken ist mit folgenden Nachteilen verbunden:
1. ist es nicht immer möglich, in der Nähe des Flugplatzes günstig gelegene, geradlinige Strecken von genügender Länge zu finden;
2. muß während des Meßfluges der Flugzeugführer dauernd zur Kontrolle des Flugweges aus dem Flugzeug zum Erdboden sehen. Er kann seine Aufmerksamkeit also nicht voll den Instrumenten widmen, was aber zur Innehaltung von Geschwindigkeit bzw. Höhe dringend notwendig ist.
Diese Nachteile vermeidet folgende Methode der Geschwindigkeitsmessung, die ich häufig mit befriedigendem Erfolg angewendet habe: Das Flugzeug fliegt keine vorgegebene Meßstrecke ab, sondern von einem markanten Punkt (A) eine gewisse Zeit lang (z. B. 5 Min.) einen bestimmten Kompaßkurs. Der nach dieser Zeit erreichte Standort (B) wird genau festgestellt (z. B. durch mehrmaliges Umkreisen und Vergleichen mit der Karte) und auf der Karte angezeichnet. Anschließend wird mit genau entgegengesetztem, also um 180° geänderten Kompaßkurs (verschiedene Kompaß-Deviationswerte sind zu berücksichtigen) nochmals der Punkt A überflogen. Wiederum nach der gleichen Zeit (5 Min.) wird der genaue Standort C festgestellt und in die Karte eingetragen. Die Entfernung B—C wird mit Zirkel und Lineal gemessen. Sie entspricht genau dem 2-fachen der Eigengeschwindigkeit, bezogen auf die vorher benutzte Zeiteinheit (im Beispiel 5 Min.). Folgende Skizze veranschaulicht die geometrischen Beziehungen:
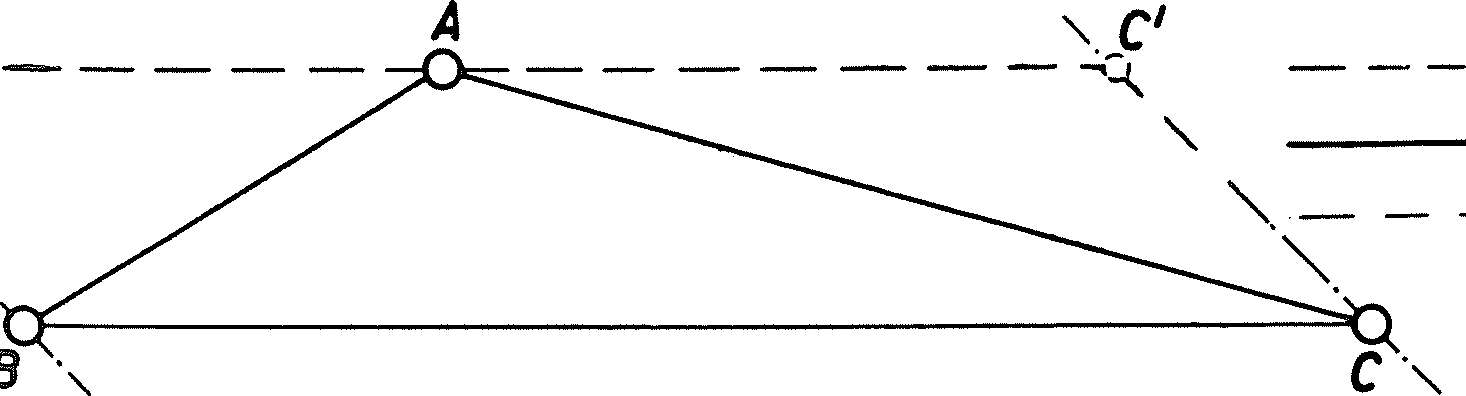
Flugweg über Grund (Grundkurs, Grundgeschw.) Windversetzung (Windrichtung, Windgeschw.) Flugweg durch die Luft (Kompaßkurs, Eigengeschw.)
Die Strecke B — C entspricht der Strecke B' — C\ also der Eigengeschwindigkeit.
Zweckmäßigerweise überfliegt man den Punkt A zunächst mit einem Kurs annähernd entgegen der Windrichtung. Die gesamte Flugzeit wird dann im allgemeinen wesentlich unterhalb der Zeit liegen, die man z. B. für einen Meßflug auf der „Doppelmeßstrecke" benötigt.
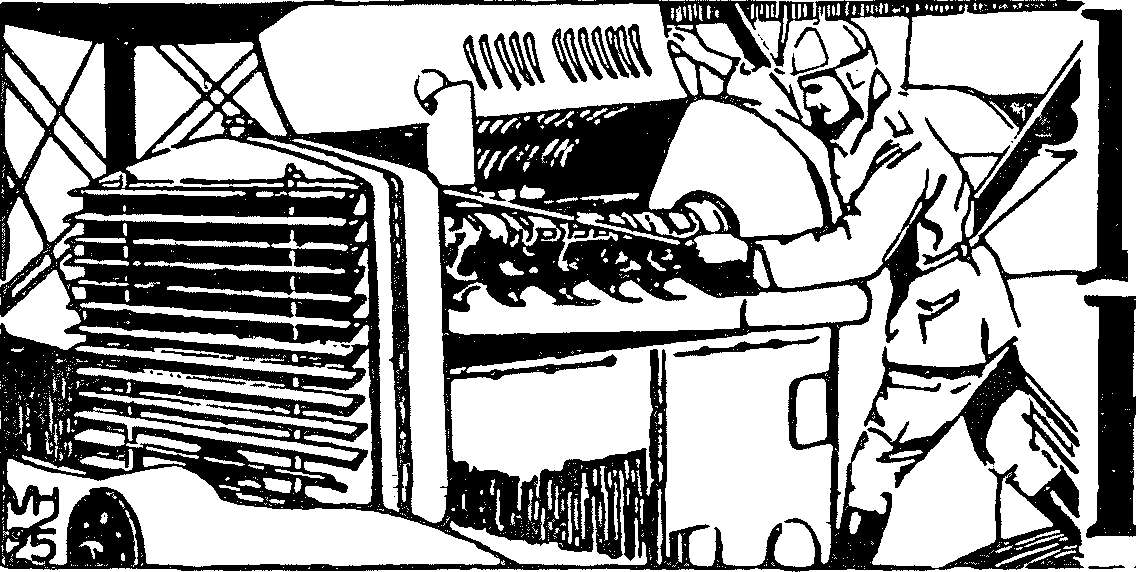
Bei dem genannten Verfahren kann der Flugzeugführer während des eigentlichen Meßfluges seinen Blick dauernd auf das Gerätebrett richten, kann also z. B. genau eine bestimmte Fahrtmesseranzeige innehalten und dabei Höhenmesser und Variometer beobachten bzw. umgekehrt. Eine selbsttätige Steuerung läßt sich hierbei zweckmäßig zur Erhöhung der Genauigkeit des Meßfluges verwenden.
«WbTRUKTIO/NS 1NZELHHTBH
Selbstsichernde „Oddie"-Schrauben für Blechverkleidungen werden im engl. Flugzeugbau, wie untenstehende Abbildung n. Flight zeigt, verwendet. Hersteller: Oddie, Bradbury and Cull, Southampton Airport.
Die Verbindung besteht aus einer Schraube mit Schlitzkopf und einer U-förmig gebogenen Feder, die in Aussparungen des runden Mutterteils einschnappt und die Mutter am Drehen verhindert. Zwischen diesen Sicherungsteilen und den zu verbindenden Flächen ist eine Halbhartgumml-scheibe unterlegt, damit die Verbindung gleichzeitig wasserdicht wird. In der Praxis wird man vorteilhaft Schraubenschlitze in eine Richtung stellen, senkrecht oder waagrecht, so daß man durch einen Ueberblick von außen erkennt, ob sich eine Schraube gelöst hat.
Gelenkflügel für Vortriebsschrauben sind zwar schon vor Jahren vorgeschlagen, aber — abgesehen von der einflügeligen Everelschraube — noch nicht ausgeführt worden. Neuerdings tritt der bekannte Steilschrauber-Konstrukteur Hafner für sie ein. Es ist in der Tat nicht ersichtlich, warum man, besonders bei großen Propellerabmessungen, sich der der Gelenklagerung innewohnenden Vorteile begibt, zumal sie der Trag- und Hubschraube erst zur praktischen
Verwirklichung verholfen | | l— ϖ " . haben. Durch die starke
Verringerung der Biegemomente in gelenkgelagerten Flügeln werden diese gewichtsärmer ausführbar bei gleichzeitiger Abnahme der Schleuderkräfte; außerdem werden die von der Kreiselwirkung herrührenden Präzisionskräfte nicht auf das Flugzeug übertragen.
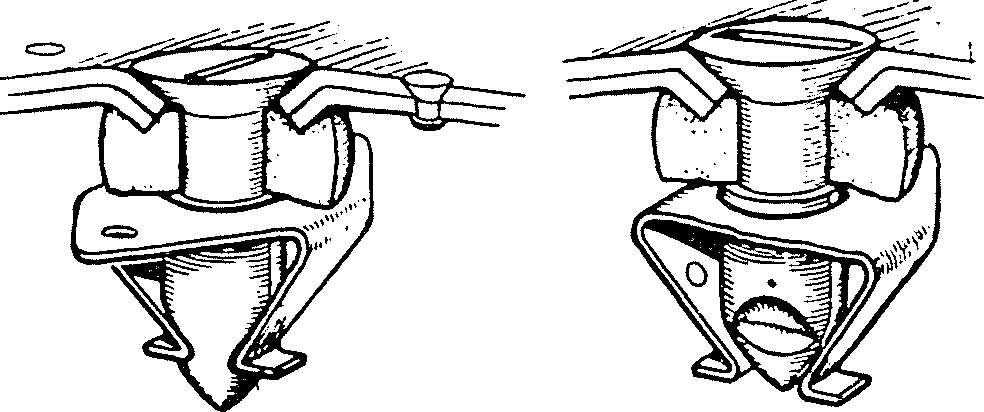
Fiat „G. 18 V" Viermotor-Verkehrsflugzeug.
Unten: Leitwerk, Ruder
mit Trimmklappen. Oben rechts: Landeklappen.
(Vgl. „Flugsport" 1937, S. 637.)
Werkbild
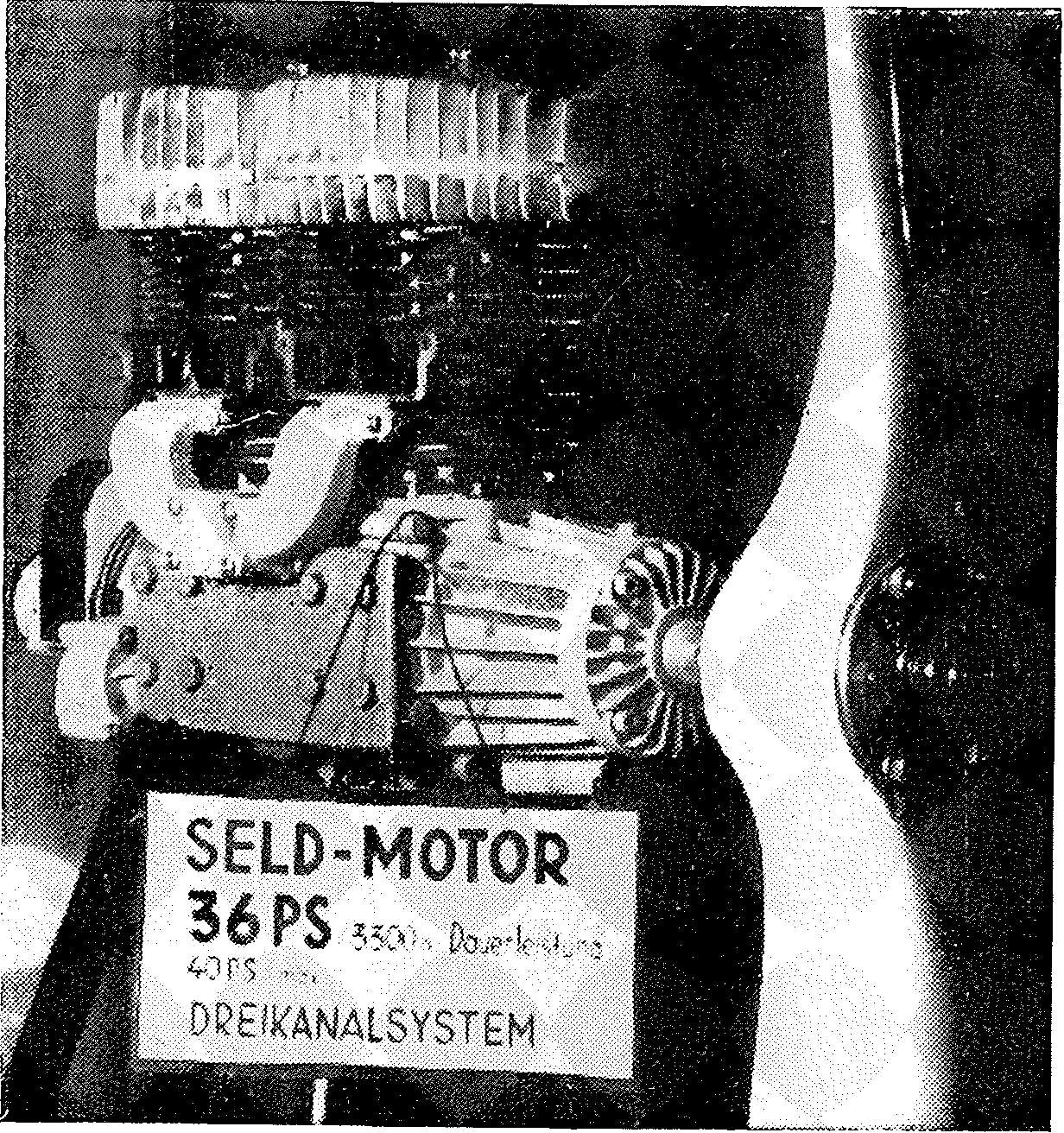
Vielseitige Kühlrippen-Anordnung beim Kleinflugmotor Seid, Zweitakt, Zweizylinder, Höchstleistung ~ 0 , , , « , . . . 36 PS, Dauerleistung 30 PS bei n .„ ?owty Schwenkfederbe.n im oberen 2750 Umdrehungen, Steigleistung gnttel fest gelagert das Hochziehaggregat.
33 pg Preßzylinder und -kolben machen die Schwen-
Werkbiid kung mit, wie in nebenstehender Abbildung dargestellt.
Einflügelrotor für Hubschrauber von Professor M. K n i g h t brachten wir auf S. 117. Der Antrieb des durch ein Gegengewicht ausbalanzierten Flügels soll durch den Rückdruck von Preßluft erfolgen, die, von einem Gebläse erzeugt, durch die Rotorwelle und den Flügel hindurchgeleitet wird und am Flügelende entgegen der Umlaufrichtung aus einer Düse austritt. Diese Antriebsart, die den Vorzug der Rückdrehmomentenfreiheit hat, ist seit langem bekannt: Isacco, Pescara, Dornier, Sikorsky u. a. haben sich mit ihr befaßt, anscheinend ohne zu brauchbaren Wirkungsgraden gelangt zu sein. Ob das Einflügelsystem gegenüber der üblichen zwei- oder dreiflügeligen Anordnung im Gesamteffekt besser ist, kann wohl nur durch Versuche am fliegenden Gerät geklärt werden.
Schwingenflugzeug Karl Brunner, Wien, im vorigen Jahre gebaut, nachdem er mit einem gleichartigen Gummiflugmodell Erfolg, und Strecken bis zu 60 m bei Bodenstart erzielt hatte. Die Großausführung dieses manntragenden Schwingenflugzeugs, in der nebenstehenden Abb. unbespannt, ist bei Versuchen zu Bruch gegangen. Die Brun-nersche Bauart fällt durch die
eigentümliche Lage des — übrigens nur vier-
pferdigen — Motors auf, der über den die Schwingen in kreisend kegelförmige Bewegung setzenden Kurbelgetrieben und hoch über
dem Rumpf
Schwingenflugzeug Brunner, Typ 1938, unbespannt.
Archiv Flugsport
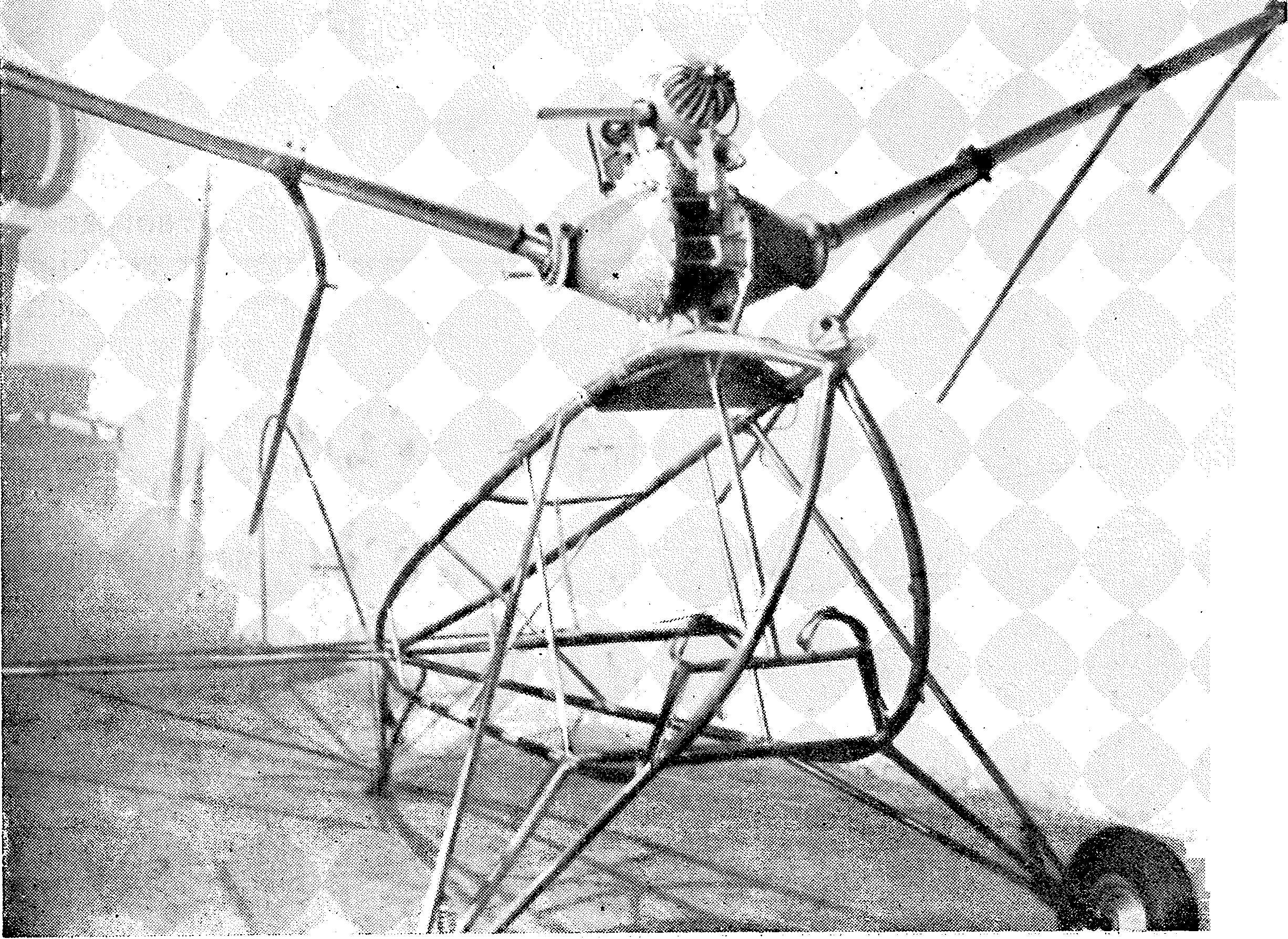
angeordnet ist. Die Schwingenkegelbewegung wird in eigenartiger Weise durch Reaktionswirkung in eine auf- und abwärtsschlagende umgesetzt. Infolge ihrer großen Schwingweite (450) sollen die sehr elastischen Schwingen bei hochgestellter Rumpfachse das Aufsteigen vom Fleck weg ermöglichen; man hat sich in diesem Falle ihr Wirken ähnlich wie das der Kolibriflügel vorzustellen.
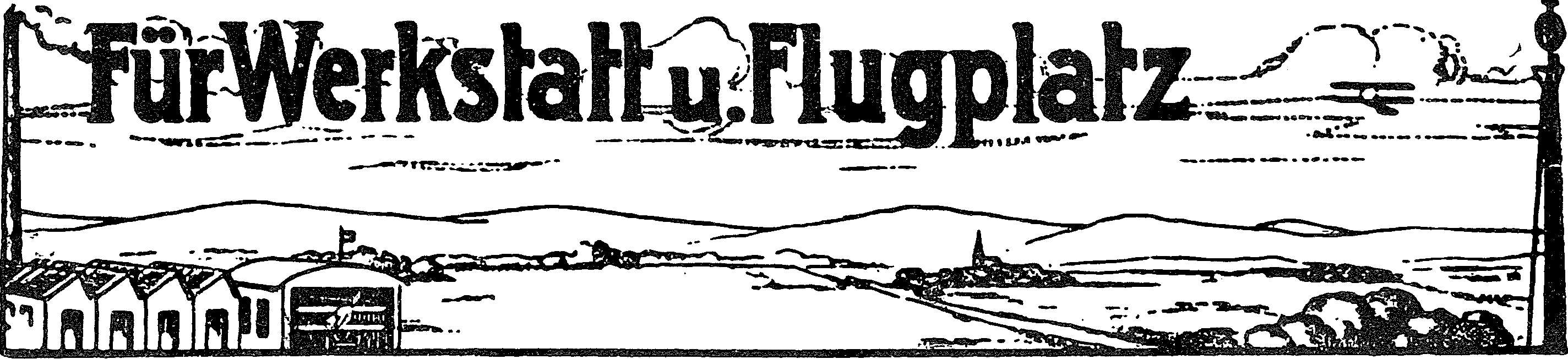
Anhänger statt Kraftwagen. Im Flugwesen ist es besonders wichtig, Geräte aller Art, wie sie zum Flugbetrieb auf Traktoreinrichtungen gehören, fahrbar zu machen. In neuerer Zeit ist man in Italien gerade durch die Praxis des Abes-sinienfeldzeuges immer mehr dazu übergegangen, das zu transportierende Gerät statt auf einem Kraftwagen auf einem Anhänger unterzubringen. Ein Kraftwagen kann durch Motorstörung jederzeit lahmgelegt werden. Ein Anhänger hingegen läßt sich an jeden im Betrieb befindlichen Kraftwagen, der heutzutage immer eine normalisierte Anhängevorrichtung besitzt, anhängen. In Italien werden die Anhänger so gebaut, daß sie vorn und hinten Anhängevorrichtung und steuerbare Vorder- und Hinterräder besitzen, wie sie für die jeweiligen Kurven notwendig sind. Sämtliche Räder sind bremsbar. Starke Reifendimensionen, Stahlstoßaufnehmer, Konstruktionsteile wetterunempfindlich. Ferner Einrichtung für Hintereinanderanhängen von zwei bis drei. Normalmaße: Länge 5.50, Breite 2.50 m, Höhe 2.94 m.
Verwendungszweck für bewegliche photographische Laboratorien, Ersatz-teilwerkstätten für Revision und Ausbesserung von Flugzeugen, Motoren usw., drahtlose Gebe- und Empfängerstationen, Installationen für Nachtflugverkehr, für Betriebsstoffmisch- und -Verteilungsapparate u. a. m.
Blitzgefahr soll nach italienischen Erfahrungen bei Holz- oder gemischter Bauart größer als bei Ganzmetallflugzeugen sein.

FLUG UND5CHAI
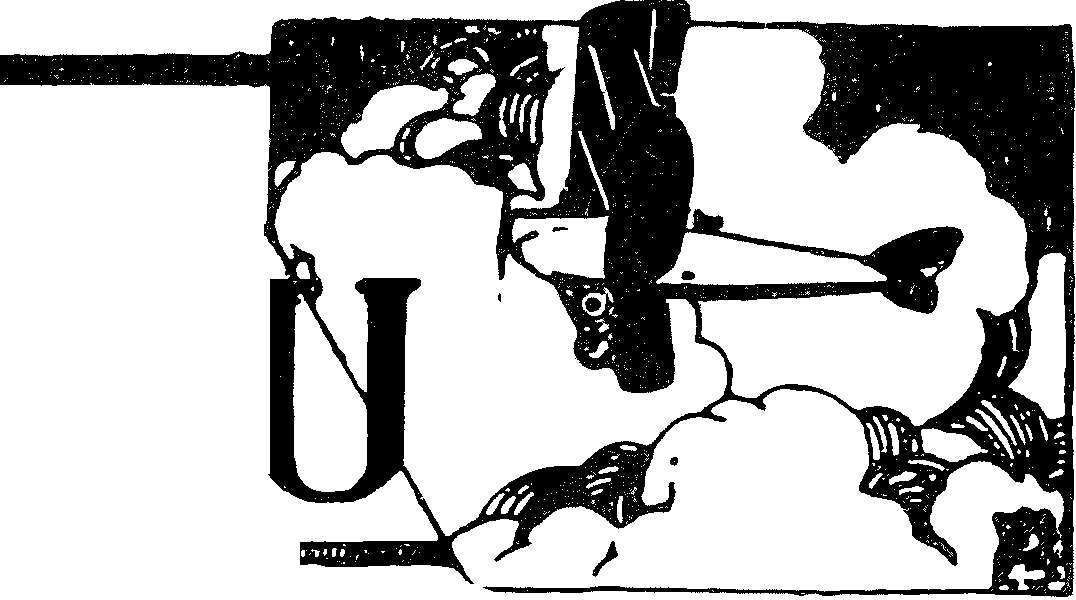
Inhalt.
Neugliederung der deutschen Luftwaffe.
Zur Ergänzung unseres Berichtes über die Neuorganisation der Luftwaffe
im „Flugsport" Nr. 4, S. 105, entnehmen wir der neu erschienenen, unter Mitwirkung des Reichsluftfahrtministeriums herausgegebenen Zeitschrift „Der Adler""
über die Neugliederung der Luftwaffe noch folgendes: Die Fliegerdivisionen der Luftwaffe sind:
Luftwaffen-Lehrdivision in Greifswald, Kommandeur: Generalmajor Förster;
Fliegerdivision 1 in Berlin, Kommandeur: Generalmajor Grauert;
Fliegerdivision 2 in Dresden, Kommandeur: Generalmajor Loerzer;
Fliegerdivision 3 in Münster, Kommandeur: Generalmajor Putzler;
Fliegerdivision 4 in Braunschweig, Kommandeur: Generalleutnant Keller;
Fliegerdivision 5 in München, Kommandeur: Generalmajor Ritter von Greim;
Fliegerdivision 6 in Frankfurt a. M., Kommandeur: Generalmajor Deßloch;
Fliegerdivision 7 in Berlin, Kommandeur: Generalmajor Student;
Führer der Seeluftstreitkräfte in Kiel ist Generalmajor Geisler.
Befehlshaber und Kommandeur der Luftverteidigungszone West ist Generalleutnant Kitzinger.
Luftverteidigungskommandos befinden sich in Berlin, Stettin, Hamburg, Düsseldorf und Leipzig.
Aehnlich den Wehrkreisen ist das Reichsgebiet in Luftgaue eingeteilt, deren Spitze bilden:
Das Luitgaukommando I in Königsberg, Kommandeur: Generalmajor Mohr; Luftgaukommando III in Berlin, Generalleutnant Weise; Luftgaukommando IV in Dresden, Generalmajor Mayer; Luftgaukommando VI in Münster, Generalmajor Schmidt; Luftgaukommando VII in München, Generalmajor Zenetti; Luftgaukommando VIII in Breslau, Generalmajor Danckelmann; Luftgaukommando XI in Hannover, Generalmajor Wolff; Luftgaukommando XII in Wiesbaden, Generalmajor Heilingbrunner; Luftgaukommando XIII in Nürnberg, Generalmajor Mußhoff; Luftgaukommando XVII in Wien, Generalleutnant Hirschauer.
Beförderungen in der Luftwaffe. Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat ab 1. 3. 39 zu Obersten ernannt die Oberstleutnante Kreßmann, Luczny, Haenschke, Hantelmann.
Flugpark der tschechischen Luftwaffe wurde am 15. 3., nachdem die Spitzengruppe des Heeres eingetroffen war, vom Kommandeur im Luftgau XVIII in Brünn übernommen. Der General besichtigte die Flugzeuge der ehemaligen tschechischen Luftwaffe, die Ausrüstung der Flakformationen, die Fliegerkasernen und den Militärflugplatz.
517 km/h über 1000 km mit 2000 kg Nutzlast. Mit dieser überragenden Flugleistung hat die deutsche Luftfahrt einen neuen stolzen Erfolg zu verzeichnen. Am 19. 3. 39 mittags gelang es einem zweimotorigen Junkers-Flugzeug, den internationalen Geschwindigkeitsrekord für Landflugzeuge über 1000 km mit 2000 kg Nutzlast für Deutschland zu erobern. Besatzung, Flugzeugf. Ing. Ernst Seibert und Dipl.-Ing. Kurt Heintz, erreichte auf der Meßstrecke Dessau—Zugspitze und zurück eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 517 km pro Stunde und überbot damit den bisher vom Ausland mit 474 km gehaltenen Rekord um 43 km pro Stunde. Das Rekordflugzeug ist ein bei der deutschen Luftwaffe neu eingeführter Bomber der Junkers-Flugzeugwerke, ein Ganzmetalltiefdecker, ausgerüstet mit zwei Motoren JUMO 211. Bei diesem Rekordflug wurden vollautomatische Luftschrauben verwendet, die ebenfalls ein Spitzenerzeugnis der Junkers-Werke darstellen. Die neue Weltbestleistung wurde durch den Aero-Club von Deutschland der FAI. zur Anerkennung als internationaler Rekord angemeldet.
Die Vorbereitungen für den Angriff auf den Rekord wurden unter Aufsicht von Sportzeugen der FAI. in aller Stille getroffen. Nach den einzuhaltenden Rekordbestimmungen war es am zweckmäßigsten, als Flugweg eine 500 km lange Meßstrecke zu wählen, die zweimal durchflogen werden mußte. Die um die Zeit
des Rekordversuchs herrschenden Wetterverhältnisse ließen es ratsam erscheinen, hierfür die Strecke Dessau—Zugspitze festzulegen. Das Rekordflugzeug überflog die Meßlinie auf dem Werkflughafen der Junkers-Werke in Dessau um 9.47 h vormittags. Bereits nach 56 Minuten umrundete die Maschine um 10.43 h die Wende-
Junkers Bomberbesatzung: Rechts Flugzeugführer Seibert, links: Flugzeugführer Heintz.
Werkbild Junkers

marke auf der Zugspitze und überflog um 11.45 h wohlbehalten wieder die Meßlinie bei Dessau, wo der erfolgreichen Besatzung durch die Gefolgschaft des Werkes ein begeisterter Empfang bereitet wurde. Das Flugzeug hat somit mit einer Nutzlast von 2 Tonnen für die 1000 km lange Strecke Dessau—Zugspitze—Dessau eine Flugzeit von 116 Minuten benötigt.
Der Motor JUMO 211 stellt eine Weiterentwicklung des bekannten JUMO 210 dar, der auf manchem internationalen Wettbewerb deutschen Flugzeugen gegen schärfste Konkurrenz zum Siege verhalf.
Im Juli 1937 verbesserten Bisco und Bruno Mussolini den bisher auf 390 km/h stehenden 2000-kg-Nutzlast-Rekord auf 423 km/h, im November des gleichen Jahres überbot die gleiche Besatzung ihren Rekord auf 430 km/h, der ihnen dann 8 Tage später von einer anderen italienischen Besatzung mit einer Leistung von 444 km/h abgenommen wurde, im Februar vorigen Jahres gelang den Italienern eine weitere Steigerung auf 448 kin/h und im Dezember wurde dieser Rekord abermals von einem dreimotorigen italienischen Savoia-Flugzeug schließlich auf 474 km/h erhöht.
Igo Etrich, dem sudetendeutschen Flugpionier, galt eine im NSBDT vom VDI und der ATG unter Teilnahme der Lilienthal-Gesellschaft veranstaltete Sitzung, die am 23. März im großen Saale des VDI in Berlin stattfand. Es war mühevollste Pionierleistung, die Etrich Vater und Sohn lange vor dem Kriege, durch Otto Lilienthals Vorbild begeistert, zu Wege brachten. Was die Schaffung des ersten eigenstabilen, beispiellos volkstümlichen Flugzeugs, der „Taube" — nach Ahlborns Vorschlag der Zanoniasamenform nachgebaut — für das Ansehen unserer Flugtechnik auch außerhalb der deutschen und österreichischen Grenzen bedeutet hat, wie z. der erste Flug 1913 nach Paris mit Alfred Friedrich am Steuer und Dr. Elias als Orter und die Rekordleistungen des einzig flugbegabten Hellmuth Hirth, wird heute nicht immer genügend gewürdigt. Das gilt auch von den weiteren Arbeiten Igo Etrichs in Liebau (Schlesien), die zur „Schwalbe" und dem weltersten Kabinen-Eindecker führten, an deren Konstruktion ein damals noch unbekannter junger Ingenieur, „ein gewisser Herr Heinkel", mitwirkte. Die Schilderung der nicht sehr sauberen Praktiken Rumpiers, der den in jahrelanger Versuchsarbeit in Ober-Altstadt bei Trautenau ohne Windkanal und bar aller wissenschaftlichen Unterlagen entwickelten Typ auch noch nach seiner
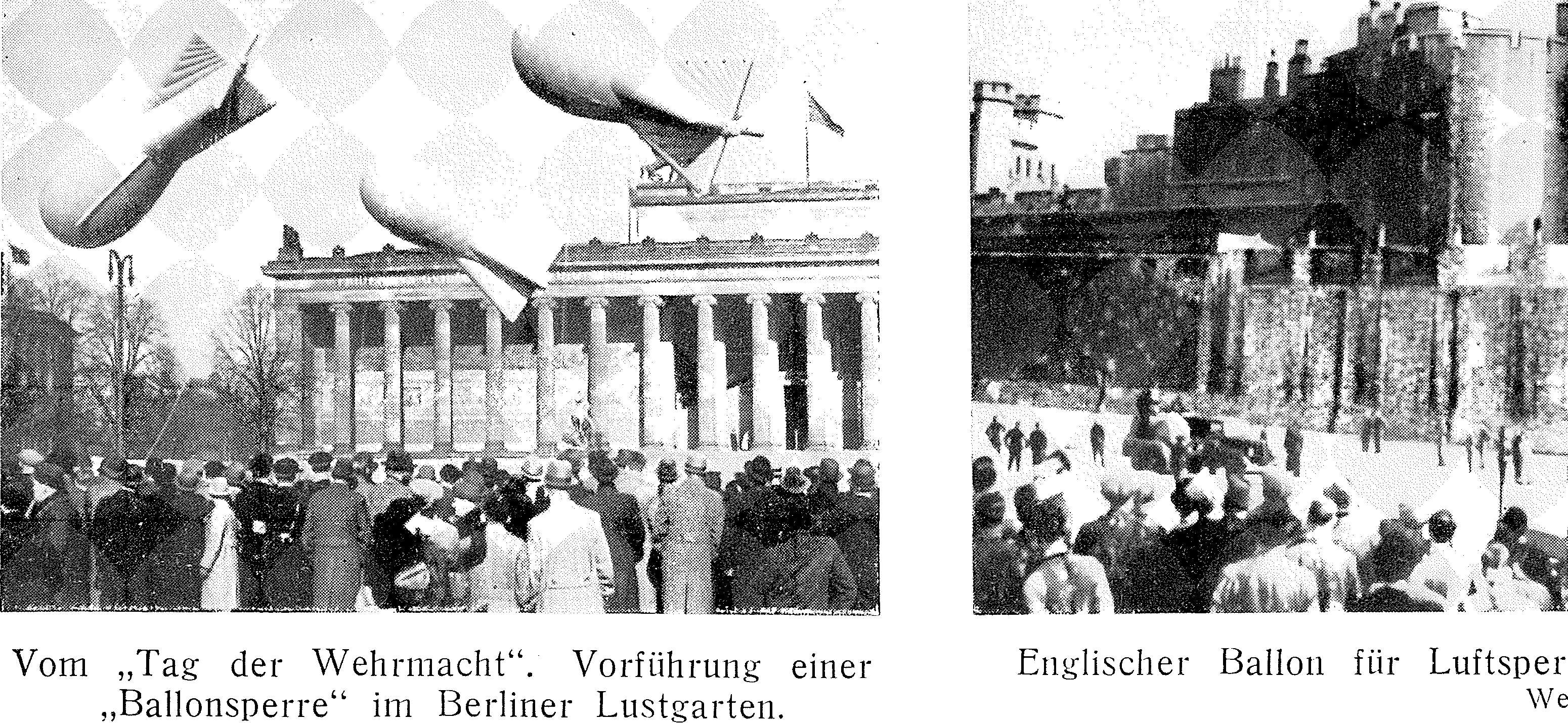
Weltbild

„christlichen Taufe" der Mitwelt als sein Produkt — „Rumpier" (!) - Taube — aufzureden verstand, gab ein eindringliches Bild von den Schicksalsmöglichkeiten eines Erfinders. Etrichs Darlegungen sowie seine Anerkennung der ebenso uneigennützigen wie unerschrockenen Hilfe, die John Rozendaal ihm im Kampfe um seine berechtigten Erfinder-Ansprüche leistete, führten zu starken Beifallskundgebungen der zahlreichen Zuhörerschaft aus ältesten und jüngsten Fliegerkreisen. Qo.
„Bodenseeflieger'* Willi Truckenbrodt feiert am 4. 4. 25jähr. Fliegerjubiläum. 1913 Flugzeugführer beim Flugzeugbau Friedrichshafen, im Krieg Marineflieger. 1922 Bodensee-Rundflugverkehr eingerichtet und bis Oktober 1936 18 354 Flüge mit 55 904 Menschen ohne einen Unfall ausgeführt.
171,9 km/h mit 50 PS über 1000 km erreichte am 24. 3. 1939 auf Bücker „Student", Motor Zündapp, Flugzeugführer Werner Ahlfeld mit Fluggast, Strecke Bremen-Schwessin (Pommern)—Bremen, 1000 km insgesamt 5 Std. 48 Min.
Was gibt es sonst Neues?
Island-Flugverkehrverträge durch Lufthansa in Reykjawik abgeschlossen, von Bülow, Gruppenführer, jetzt Inspekteur des Korpsführers des NSFK. Prof. Dr. Hertel jetzt bei Junkers.
Ausland.
King's Cup Rennen, neuartige Ausschreibung. Berücksichtigt sind die Geschicklichkeit des Flugzeugführers, Hochgeschwindigkeit, unbegrenzte Motorleistung, Schnelligkeit in der Berechnung des Handicaps. Mindestgeschwindigkeit 231,5 km/h. Das Rennen wird eingeteilt in 4 Abschnitte, bestehend aus 5 Teilstrecken von je 320 km; die Gesamtstrecke des Rennens beträgt daher 6400 km. Zwischen den Flugabschnitten neues Handicap, wobei die vorangegangene Leistung zugrunde gelegt wird.
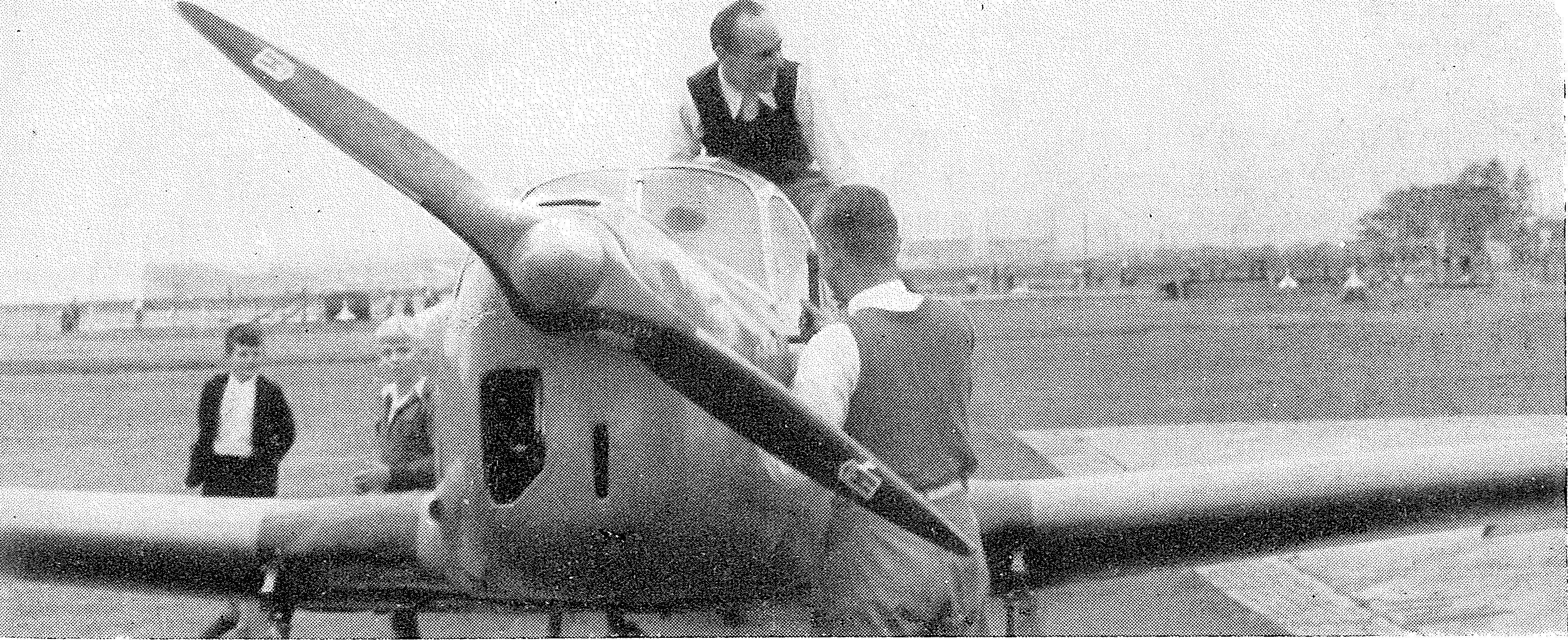
Vom Kingsford-Smith-Flugplatz Sydney (Australien). Landung der Aradoflieger Pulkowsky und Jenett auf Ar. 79.
Archiv Flugsport
In den einzelnen Flugabschnitten werden gleichzeitig die Rennen für das Wakefield Challenge Trophy Rennen für Leichtflugzeuge ausgetragen.
Royal Aeronautical Society umgezogen nach 4, Hamilton Place, London W. L
Bristol Hercules IV, Schieber-Motor, ergab bei seinen Versuchen: Startleistung .1380 PS bei 2800 U., max. Leistung in 1600 m 1220 PS bei 2800 U., in 1350 m 1010/1050 PS bei 2400 U. Konstruiert für die neuen Groß-Flugboote der Imperial Airways, ist dieser neue Motor aus den Militär-Hercules-Typen entwickelt. 14 Zylinder in zwei Reihen, Inhalt 38,6 1.
Südafrikan. Luftverkehrsges., „South African Airways", wird mit den im Juni zur Ablieferung gelangenden zwei Junkers Ju. 90 folgenden Maschinenpark besitzen: 30 Junkers-Maschinen, und zwar 17 Ju. 86, 11 Ju. 52 und 2 Ju. 90.
Henshaw Kapstadt-Flug, London—Kapstadt 39 h 25 Min. 244, 876 km/h und Kapstadt—London 39 h 36 Min. 243, 745 km/h, von der FAI. bestätigt.
Batavia Aero-Club, Niederländ. Indien, bestellte 6 Bücker-Jungmann.
11. 4. Cannes, Internat. Flugmeeting. Veranstalter Aero Club de France.
Louis Breguet f. Der bekannteste französische Flugzeugkonstrukteur ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Breguet baute 1906 den ersten Hubschrauber, welcher sich zum erstenmal vom Boden erhob. Dann 1908 seinen zweiten Schrauber und einen Tandem-Eindecker. Breguet war der erste, der ingenieurmäßig den Flugzeugbau betrieb.
Franz. Flugzeugproduktion vom 1. 1. bis 1. 9. 1938 monatlich im Durchschnitt 41 Kriegsflugzeuge (verglichen mit 38 Durchschnitt im selben Zeitraum 1937). Vom 1. 9. bis 1. 12. 38 stieg der Durchschnitt auf 73 Flugzeuge pro Monat gegenüber 33 im Jahr 1937. Im Dezember 38 wurden 70 Flugzeuge gegenüber 40 im Dez. 37 herausgebracht. Im Januar sollen 80, verglichen mit 45 im Vorjahr, herauskommen. Das Programm für die nächsten zwei Jahre sieht den Bau von 4800 Flugzeugen und 1200 Motoren vor.
Talbot-Werke, Frankreich, bauen Pratt & Whitney Twin-Wasp in Lizenz und die Alsthom-Qruppe den engl. Bristol-Hercules-Schieber-Motor.
Ital. Luftverkehrslinienerweiterung: „Ala Littoria": Rom—Brindisi—Athen— Rhodos—Haifa ausgedehnt bis Bagdad und Barsorah, Rom—Belgrad—Bukarest bis Constanza. Neue Linien: Mailand—Venedig—Wien—Budapest und Brindisi-Bari; ebenso Rom—Rimini—Venedig—Triest—Bratislava—Prag. „Avia Linee Italiane": Neue Linien: Turin—Cannes—Marseilles; Mailand—Brüssel; Rom— Venedig^Budapest—Warschau—Gdynia.
Vierter Sahara-Rundflug, 1. Teilwettbewerb Geschwindigkeitsrennen über 400 km, Start und Ziel Mellaha—Flugplatz Tripolis, beteiligten sich von 24 gemeldeten Maschinen 21. Die vier deutschen Teilnehmer erledigten ihre Flüge zur Bestimmung des Stundenmittels in vorgeschriebener Form.
Am 2. Tage begannen die Geschicklichkeitsprüfungen in Zielabwürfen, Auffindung von Scheiben, versteckten Zielen usw. Bewertung nach Punkten. Die ersten beiden Plätze belegten die Italiener Crocco und Regoli mit je 140 Punkten, hiernach folgte der Franzose de la Cheneliere mit 125 Punkten, dann als bester Deutscher Bader mit 105 Punkten vor Obltn. Götze mit 101,5 Punkten, Dietrich mit 95 Punkten Zwölfter und Flugkpt. Ziese mit 65 Punkten Achtzehnter.
Hiernach begann das eigentliche, in 3 Etappen stattfindende Rennen von Tripolis nach den 1823 km entfernten Bengasi über Sinauen, Gadames und Oase Hun. Hieran schloß sich ein Verfolgungsrennen auf der 711 km langen Strecke Bengasi—Tauorga, und den Abschluß bildete die Geschwindigkeitsprüfung auf der 194 km langen Strecke Tauorga—Tripolis.
Endergebnis: 1. Ital. Crocco auf Zweimotor Ghibli, 2. Ital. Marino auf Libecco, 3. Franz. de la Cheneliere auf Caudron-Goeland, 4. Ital. Regoli auf Ghibli. Von den Deutschen wurde Bester an 5. Stelle Dipl.-Ing. Bader auf Messerschmitt-Taifun, 6. Dipl.-Ing. Dietrich auf Siebel Fh 104, 8. Obltn. Goetze auf Messerschmitt-Taifun (Vertreter der Luftwaffe) und 15. Flugkpt. Ziese vom NSFK. auf Siebel Fh 104.
I. Weltkongreß der Luftfahrt-Presse Rom, 5.—13. 6. 1939, anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung der „L'Ala d'Italia". Veranstalter Editoriale Aero-nautica, Direktion Dr. Federigo Valli.
Die stattfindenden Besprechungen und Vorträge gliedern sich in 8 Gruppen: 1. Luftfahrtjournalismus und Tagespresse im Dienst der Friedens- und Kriegsberichterstattung. 2. Wissenschaft und Technik der Luftfahrtpresse. 3. Luftfahrtpresse und die Jugend. 4. Luftfahrtphotographie und die Luftfahrtpresse. 5. Luftfahrt und Rundfunkpresse. 6. Einfluß der Luftfahrt auf Kunst und Schrifttum. 7. Kino und Luftfahrt. 8. Auswahl und Ausbildung der Luftfahrt.
Bis jetzt sind gemeldet acht Vorträge für die 1. Gruppe, fünf für die 2., drei für die 3., drei für die 6., zwei für die 8. und verschiedene für die restlichen Gruppen.
Während der Tagungen finden Veranstaltungen der verschiedensten Art auf künsterischem, technischem und anderen Gebieten statt. Ebenso sind Besichtigungen von militärischen und zivilen Luftfahrtzentren in anderen Städten Italiens vorgesehen.
Anlässig der Tagung organisiert die R. U. N. A. am 4. 6. einen Fliegerpresse-Wettflug. An dem Flugwettbewerb, welcher nach Bestimmungen der F. A. I. stattfindet, können Flugzeuge aller Art teilnehmen, welche von Schriftleitern, Verlegern und sonstigen Pressevertretern eingeschrieben worden sind. Nennungsschluß 31. 5., Einschreibungsstelle Unione Nazionale Aeronautica-Via Lepanto 6, Rom. Einschreibegebühr 25 Lire je Flugzeug und 10 Lire je Fluggast. Für die Einschreibegebühr wird das Flugzeug auf dem Flugplatz Littorio kostenlos untergestellt. Gewertet wird beim Wettbewerb nach einer Formel, nach Punkten, zurückgelegter Entfernung in km, Flugmotorenzylinderinhalt, Personenzahl mit einem Koeffizienten, entsprechend der Fluggastzahl. Der vom Teilnehmer zurückgelegte Weg muß einer tatsächlichen Annäherung dem Endziel seiner Reise entsprechen. Näheres vergleiche Ausschreibung. Landung der Teilnehmer muß auf dem Littorio-Flugplatz zwischen 16 und 18 h am 4. 6. stattfinden. Landung vor 16 h, 10 Strafpunkte, nach 18 h bis 20 h, 3 Strafpunkte für je 10 Min.
Während der Kongreßzeit kostenlose Beförderung auf den italienischen Flugverkehrslinien nach Rom und zurück von Deutschland, England, Frankreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Ungarn, Rumänien, Albanien, Griechenland, Aegypten nach vorheriger Anfrage wegen Bewilligung solcher Vergünstigungen bei der Editoriale Aeronautica bis zum 5. 5., soweit Plätze vorhanden.
D-ALUS, deutsches Flugzeug, 23 km südöstlich Ferrara in Italien zu Bruch gegangen. Von den 7 Insassen blieben 2 unverletzt.
D-AEHF, deutsches zweimotoriges Wasserflugzeug, auf einem Langstreckenversuchsflug nach Südamerika, nachdem bereits 7000 km im Ohnehaltflug zurückgelegt waren, wurde Motorstörung im linken Motor festgestellt, nahm Funkverbindung mit dem „Monte Pascoal" der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffahrtsgesellschaft auf und wasserte nach etwa einstündigem Weiterflug verabredungsgemäß neben dem deutschen Dampfer. Flugzeug und Besatzung wurden an Bord geheißt.
Boeing Stratosphärenflugzeug der Boeing Aircraft Co., Seattle, ist bei einem Probeflug über dem Staat Washington abgestürzt. Sämtliche 10 Insassen kamen ums Leben. 8 waren Angestellte der Boeing-Werke und 2 Beamte der Royal Dutch Air Lines, die an dem Probeflug als Beobachter teilnahmen. Augenzeugen berichten, daß das Flugzeug aus großer Höhe in eine Bergschlucht stürzte. Es habe den Anschein gehabt, daß während des Absturzes sich einzelne Teile von dem Flugzeug ablösten, welche dann später weit auseinanderliegend gefunden wurden. Es handelt sich hierbei um den im „Flugsport" 1939 auf Seite 122 beschriebenen Typ Boeing YB-17 A, Gewicht 22 t, von welchem 6 Maschinen aufgelegt und unter anderm für militärische Zwecke sowie als Großflugzeug für 33 Fluggäste bestimmt waren.
Lockheed „212", Militärschulmaschine, bestimmt für niederländ. Ost-Indien. Fluggewicht 4100 kg, Steigfähigkeit auf 3000 m in 11 min. Aktionsradius 5 Std. Zwei Pratt & Whitney-Motore. Bewaffnung: ein festes MG. in der Rumpfnase, ein bewegliches MG. über der Kabine. Bombeneinrichtung an der Flügelunterseite zwischen dem hochziehbaren Fahrwerk.
Boeing-314-Flugboot (4Xl500-PS-Doppelstern-Cyclone-Motoren) erster Versuchsflug über den Pazifik am 4. März beendet. Fluglinie San Franzisko—Hongkong soll im Mai eröffnet werden.
Austral. Flugplatz Essendon brach Brand aus, wodurch 7 moderne Flugzeuge vernichtet wurden. Man spricht von Sabotage.
Australien Flugzeug-Absatzmöglichkeiten, wie Mr. Cotton, der Verkaufs manager von Lockheed, berichtet, besonders günstig. Große Entfernungen, günstige meteorologische Bedingungen, Luftverkehr mit Neu-Seeland notwendig.
Austral. Kriegsflugzeugbau soll, wie Sir Kingsley Wood, engl. Luftfahrtminister, im Unterhaus mitteilte, mit einem Typ der „Bristol Beaufort"-Klasse begonnen werden. Für den Anfang sollen fertige Teile dieser Maschinen nach Australien wie auch nach Neuseeland geliefert werden, mit welchem ähnliche Bedingungen vereinbart worden waren.

Segelflug
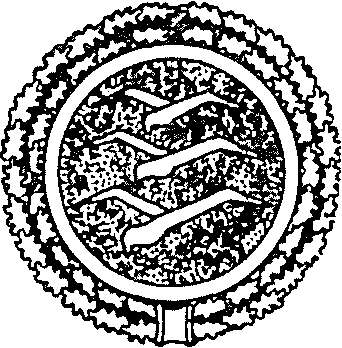
Zielstrecken - Segelf lug - Wettbewerb 1939 des NS.-Fliegerkorps.
Veranstalter und Zeit des Wettbewerbes. . .
1. Der Korpsführer des NS.-Fliegerkorps veranstaltet in der Zeit vom 18. Juni bis 2. Juli 1939 den Zielstrecken-Segelflug-Wettbewerb 1939 des Nationalsozialistischen Fliegerkorps.
Schriftverkehr.
2. Der Schriftverkehr des Zielstrecken-Segelflug-Wettbewerbes 1939 ist mit dem Korpsführer des NS.-Fliegerkorps, Berlin W 15, Meierottostraße 8/9, zu führen. Ab 15. Juni 1939 ist er zu richten an die Wettbewerbsleitung Zielstrecken-Segelflug-Wettbewerb, Reichsschule für Motorflugsport in Rangsdorf, Kr. Teltow, Flughafen.
Zweck des Wettbewerbes.
3. Der Wettbewerb verfolgt den Zweck, eine vorgeschriebene Flugstrecke ungeachtet der in den Wettbewerbstagen vorhandenen Wetterlage durchfliegen zu lassen, um dadurch dem Segelflug neue Wege zu eröffnen. Er soll außerdem den Leistungsstand des Deutschen Segelfluges auf diesem Gebiete zeigen und den fliegerischen Geist und die Kameradschaft unter den Segelfliegern fördern.
4. Als Bewerber sind zum Wettbewerb zugelassen:
a) NSFK.-Gruppen und nachgeordnete Einheiten des NS.-Fliegerkorps sowie NSFK.-Segelflugschulen,
b) Luftwaffe, DVL. und DFS.
Meldungen.
5. Die Meldung hat für jedes Segelflugzeug gesondert auf dem vorgeschriebenen Meldevordruck zu erfolgen.
Die Meldung der Bewerber zu 4 a) muß bis zum 20. Mai 1939, 12 Uhr, als Einschreiben bei der für die Bewerber zuständigen NSFK.-Gruppe eingegangen sein. Die NSFK.,Gruppen reichen die Meldungen als Einschreiben bis zum 22. Mai 1939 dem Korpsführer des NS.-Fliegerkorps ein.
Die Meldungen der Bewerber zu 4 b) sind als Einschreiben an den Korpsführer des NS.-Fliegerkorps zu richten und müssen bis zum 22. Mai 1939, 12 Uhr, beim Korpsführer des NS.-Fliegerkorps vorliegen.
Die Teilnahme der Segelfluggruppen der Luftwaffe wird vom Korpsführer NS.-Fliegerkorps mit dem Reichsminister der Luftfahrt geregelt. Entsprechend dieser Regelung werden die in Frage kommenden Bewerber von dem Reichsminister der Luftfahrt zur Meldung aufgefordert.
Ueber sämtliche Meldungen entscheidet der Korpsführer des NS.-Fliegerkorps. Die endgültige Annahme der Meldung wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt.
Es können nur solche Meldungen angenommen werden, die vollständig und mit allen angeforderten Angaben eingereicht werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Meldungen als endgültig zu gelten haben. Der Veranstalter behält sich vor, unvollständige oder verspätete Meldungen zurückzuweisen und dafür andere Bewerber, die allen Vorbedingungen genügen, zuzulassen. Beschränkung der Teilnehmerzahl.
6. Zu dem Wettbewerb wrerden 20 Segelflugzeuge zugelassen. Die Auswahl durch den Veranstalter erfolgt unter Berücksichtigung der Wettbewerbseignung der gemeldeten Flugzeuge und Flugzeugführer.
Zurückgewiesene Meldungen können bis zum Beginn des Wettbewerbes wieder angenommen werden, wenn andere Meldungen zurückgezogen oder ungültig werden.
Teilnahme von Doppelsitzern.
7. Am Zielstrecken-Segelflug-Wettbewerb 1939 können auch doppelsitzige Segelflugzeuge einsitzig oder doppelsitzig besetzt teilnehmen. Eine Punktaufwertung für doppelsitzige Segelflugzeuge wird nicht erteilt.
Ausschreibung.
Bewerber.
Art des Wettbewerbes.
8. Der Wettbewerb wird durchgeführt als Zielstrecken-Segelflug-Wettbewerb. Die Qesamtflugstrecke wird unterteilt in einzelne Zielflugstrecken mit Zielflugplätzen. Die einzelnen Zielflugstrecken müssen nacheinander in ihrer Reihenfolge erflogen werden.
9. Der Zielstrecken-Segelflug-Wettbewerb führt quer durch Deutschland, von Freiburg i. Br. über Karlsruhe—Würzburg—Erfurt—Magdeburg nach Berlin. Sofern die Wetterlage es gestattet, ist eine Weiterführung bis Stettin vorgesehen.
10. Die genaue Flugstrecke, die vorgesehenen Flugplätze und die Unterteilung mit den Zielflugeinzelstrecken wird den Bewerbern durch den Veranstalter
14 Tage vor Beginn des Wettbewerbes bekanntgegeben. Durchführung des Wettbewerbes. Wertung.
11. Die Bewertung der Flüge erfolgt nach Punkten nach den jeweilig erflo-genen Wertungsstrecken. Als Wertungsstrecke gilt die Entfernung auf der vorgeschriebenen Kurslinie vom Startort bis zu d e m Punkt der Kurslinie, der dem Landeort am nächsten liegt.
12. Bei Flügen, die im Zielflugplatz enden bzw. bei denen der Zielflugplatz überflogen wird, und solche, bei denen die Landung innerhalb des vorgeschriebenen Umkreises um den Zielflugort erfolgt, werden je Wertungskilometer 3 Punkte berechnet. Als vorgeschriebener Umkreis gilt ein Kreis von 10 km Radius um den Mittelpunkt des Zielflughafens. Bei Flügen, deren Landung außerhalb des vorgeschriebenen Umkreises erfolgt, wird je Wertungskilometer 1 Punkt zugeteilt, sofern die Wertungsstrecke mindestens 20 km beträgt.
13. Für das Erreichen jedes Zielflugplatzes wird ein Punktzuschlag von
15 Punkten zugeteilt.
14. Flüge, die über den Zielflugplatz hinausgehen, ohne daß dieser erreicht wurde oder als erreicht gilt, werden nur bis zum Zielflugplatz (ohne Punktzuschlag) gewertet.
15. Die Gesamt- Punktzahl zur Ermittlung des Wettbewerbssiegers bzw. zur Festlegung der Reihenfolge in der Endbewertung wird wie folgt festgelegt:
Die erflogene Punktzahl wird durch die Anzahl der Tage dividiert, die für das Erreichen des Endzieles benötigt wurden. Wird der Endzielflugplatz vor 13 Uhr erreicht, so wird hierfür ein halber Tag in Anrechnung gebracht. Wird der letzte Zielflugort nicht erreicht, so werden die gesamten Wettbewerbstage angerechnet.
16. Schlechtwettertage, an denen von sämtlichen Teilnehmern keine Wertungsflüge ausgeführt werden, gelten als neutralisiert und werden den unter Punkt 15 genannten Tagen nicht zugerechnet. Es können auch einzelne Zielflugplätze neutralisiert werden. Für einen Zielflugplatz tritt dann eine Neutralisation ein, wenn keinem Teilnehmer auf der nächsten und der zurückliegenden Zielflugstrecke ein Wertungsflug gelingt.
17. Der Zielflugplatz gilt als erreicht, wenn das Segelflugzeug innerhalb der Flugplatzgrenze landet oder sich über dem Flugplatz in einer Höhe aufhält, daß es vom Boden „gesichtet und erkannt" werden kann. Das Flugzeug darf dabei nicht höher als 800 m über dem Flugplatz sein.
18. Als Ausgangs- und Startstelle zu den einzelnen Zielstreckenflügen sind nur die Zielflugplätze zugelassen.
19. Bei allen Landungen außerhalb der 10-km-Qrenze um den angeflogenen Zielflugplatz ist das Segelflugzeug auf dem Wege des Landtransportes zu dem Startort bzw. zuletzt erreichten Zielflugplatz zurückzubringen.
20. Das auf der Zielflugstrecke zuletzt liegende Flugzeug darf — gemessen auf der vorgeschriebenen Flugstrecke — nicht mehr als 200 km hinter dem vordersten Flugzeug liegen. Vom vierten Wettbewerbstage an müssen die Flugzeuge, die weiter als 200 km hinter dem vordersten Flugzeug zurückliegen, zu dem nächsten Zielflugplatz transportiert werden, der in die 200-km-Grenze fällt.
Dies gilt jedoch nur dann, wenn nicht mehr als acht Flugzeuge gleichzeitig unter diese Bestimmung fallen.
Die durch den Nachschub ausfallenden Zielflugstrecken werden nicht gewertet.
Der Nachschubtransport der Flugzeuge kann als Landtransport oder mittels Flugzeugschlepp erfolgen.
21. Zur Anwendung des Punktes 20 wird jeweils Anordnung durch den Wettbewerbsleiter erteilt. Der Wettbewerbsleiter ist berechtigt, bei besonders gearteten Fällen von den Bestimmungen des Punktes 20 Abstand zu nehmen.
22. Der Start erfolgt durch Flugzeugschlepp mit einer Schlepphöhe bis zu 500 m über Flugplatzhöhe. Größere Schlepphöhen sind, mit Ausnahme auf den beiden letzten Zielflugplätzen, zulässig. Bei Schlepphöhen von mehr als 500 in über Flugplatzhöhe werden jedoch für jede weiteren begonnenen 100 m Schlepphöhe 5 km der Wertungsstrecke abgezogen.
Das Auslösen des Schleppseiles muß in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes geschehen, so daß dieser Vorgang durch den der Sportleitung angehörigen Beurkunder von dem Zielflugplatz aus einwandfrei beobachtet werden kann.
23. Hat ein Flugzeugführer nach einem Start keinen Anschluß erhalten, so ist er zu weiteren Starts berechtigt.
Preise.
24. Die Sieger des Wettbewerbes erhalten als Ehrenpreis die Plakette des Korpsführers des NS.-Fliegerkorps.
1. Sieger: Goldene Plakette.
2. und 3. Sieger: Silberne Plakette. 4. bis 6. Sieger: Bronzene Plakette.
Die übrigen Flugzeugführer und Mannschaften erhalten eine Erinnerungsplakette. Einzelbestimmungen.
25. Das Transportgerät ist von den Bewerbern zu stellen.
26. Sämtliche Motorschleppflugzeuge werden vom Veranstalter gestellt.
27. Pro Wertungskilometer wird dem Bewerber ein Kilometergeld von RM 0.50 erstattet.
28. Jedes Wettbewerbsflugzeug erhält ein Flugbuch, in dem Start und Landung der Wettbewerbsflüge amtlich beglaubigt werden müssen.
Diese Flugbücher müssen am 2. Juli 1939 bis spätestens 12 Uhr bei der Sportleitung auf dem letzten Zielflugplatz abgegeben werden.
29. Für den Zielstrecken-Segelflug-Wettbewerb 1939 gelten außerdem folgende Punkte der Ausschreibung des Rhön-Segelflug-Wettbewerbes 1939:
Wettbewerbsleitung (4), Preisgericht (5), Verlängerung bzw. Ausfall des Wettbewerbes (7), Ergänzungen der Ausschreibung (8), Haftung und Versicherung (9—11), Bekanntmachungen (12), Anerkennung der Ausschreibung (15), Erklärungen Minderjähriger (16), Segelflugzeugführer (19, 20, 21), Segelflugzeuge und Zulassung (siehe Punkt 22—24 mit der Aenderung, daß die Segelflugzeuge für den Zielstrecken-Segelflug-Wettbewerb bis zum 20. Mai 1939 prüffertig sein müssen), Registriergerät (26, 27).
Berlin W 15, den 17. März 1939 General der Flieger:
Wettbewerbsausschreibung
Rhön-Segelflug-Wettbewerb 1939 des NS.-Fliegerkorps
(20, Rhön).
Veranstalter, Zeit und Ort des Wettbewerbes.
1. Der Korpsführer des NS.-Fliegerkorps veranstaltet in der Zeit vom 23. Juli bis 6. August 1939 auf der Wasserkuppe den Rhön-Segelflug-Wettbewerb 1939 des NS.-Fliegerkorps (20. Rhön).
Schriftverkehr.
2. Der Schriftverkehr des Rhön-Segelflug-Wettbewerbes 1939 ist mit dem Korpsführer des NS.-Fliegerkorps, Berlin W 15, Meierottostraße 8/9, zu führen. Ab 20. Juli 1939 ist er zu richten an die Wettbewerbsleitung des Rhön-Segelflug-Wettbewerbes bei der Reichs-Segelflugschule Wasserkuppe, Post Gersfeld/Rhön. Zweck des Wettbewerbes.
3. Der Wettbewerb soll den Leistungsstand des Deutschen Segelfluges zeigen, soll die Kameradschaft unter den Segelfliegern fördern und soll Anregung für die fliegerische und technische Weiterentwicklung des Deutschen Segelfluges geben.
Wettbewerbsleitung.
4. Der Wettbewerbsleiter ist NSFK.-Standartenführer Kunz. Der Wettbewerbsleiter ist zuständig und verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung des Rhön-Segelflug-Wettbewerbes 1939.
Preisgericht.
5. Der Korpsführer des NS.-Fliegerkorps ist Vorsitzender des Preisgerichts. Er beruft die Preisrichter.
Das Preisgericht entscheidet auf Grund der von der Wettbewerbsleitung festgestellten Flug- und Prüfergebnisse. Das Preisgericht entscheidet endgültig.
Die Bekanntgabe der Preisgerichtsentscheidung erfolgt bei der Preisverteilung mit nachfolgender schriftlicher Bestätigung.
Beurkundungen,
6. Die Flugergebnisse werden täglich durch Anschlag von der Sportleitung bekanntgegeben. Jeder Wettbewerber hat sich von der Richtigkeit der angeschlagenen Beurkundungen selbst zu überzeugen.
Bei irrtümlichen Beurkundungen durch die Sportleitung ist spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntgabe der Flugergebnisse mündliche und schriftliche Meldung an den Wettbewerbsleiter zu erstatten. Verlängerung bzw. Ausfall des Wettbewerbes.
7. Der Veranstalter kann den Wettbewerb verlängern oder bei Vorliegen besonderer Gründe ausfallen lassen.
Ergänzung der Ausschreibung.
8. Der Veranstalter behält sich vor, Ergänzungen der Ausschreibung vorzunehmen sowie den Bestimmungen der Ausschreibung Auslegung zu geben. Haftung und Versicherung.
9. Durch Abgabe der Meldung erkennen die Bewerber und Wettbewerbsteilnehmer an, daß sie gegenüber dem Veranstalter und seinen Beauftragten auf sämtliche Ansprüche für Sach- und Personenschäden irgendwelcher Art verzichten, die den Bewerbern und Wettbewerbsteilnehmern oder den von ihnen beauftragten Personen im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen. Dies gilt, gleichviel aus welchem Rechtsgrunde Ansprüche hergeleitet werden können. Der Verzicht erstreckt sich gleichzeitig auf solche Personen und Stellen, die aus einem Schaden oder Unfall eines Bewerbers oder Wettbewerbsteilnehmers oder der von ihnen beauftragten Personen selbständig sonst Ansprüche erheben könnten.
Eine gegenüber außenstehenden (dritten) Personen wirksame Haftpflichtversicherung zugunsten des Veranstalters ist vom Korpsführer veranlaßt.
10. Für die von den Dienststellen und Einheiten des NS.-Fliegerkorps zur Verfügung gestellten Flugzeuge laufen auch für die Teilnahme an dieser Veranstaltung die gesetzlich vorgeschriebene Flugzeughalter-Haftpflichtversicherung sowie eine Sitzplatz-Unfallversicherung mit den vom Korpsführer des NS.-Fliegerkorps vorgeschriebenen Versicherungssummen:
RM 12 000.— für den Todesfall bei Verheirateten. Außerdem gelten bei Versicherten, die verheiratet sind oder gewesen sind, im Todesfall weitere RM 1 000.— je Kind bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, aber höchstens RM 3 000.— als versichert. Die Versicherungssumme für Kinder gilt auch für solche Kinder, die dem tödlich Verunglückten nach seinem Tode innerhalb von 9 Monaten nachweisbar geboren werden. RM 5 000.— für den Todesfall bei Unverheirateten über 18 Jahre, RM 3 000.— für den Todesfall bei Unverheirateten bis zu 18 Jahren, bis zu
RM 1 000.— Heilkosten, RM 20 000.— für den Invaliditätsfall, RM 3.— Tagegeld für Verheiratete, RM 1.50 Tagegeld für Unverheiratete.
11. Soweit Flugzeuge benutzt werden, die nicht zu den von den Dienststellen und Einheiten des NS.-Fliegerkorps betriebenen Flugzeugen gehören, oder die nicht als reichseigene Segelflugzeuge gelten, haben die Bewerber vor der Veranstaltung die vorgeschriebene Flugzeughalter-Haftpflichtversicherung nachzuweisen.
Der Bewerber ist verpflichtet, für sämtliche Teilnehmer, die nicht unter die Unfallversicherung des NS.-Fliegerkorps fallen, eine Unfallversicherung mindestens mit den unter Punkt 10 genannten Versicherungssummen abzuschließen. Bekanntmachung.
12. Sämtliche den Rhön-Segelflug-Wettbewerb betreffenden, vor dem Wettbewerb erscheinenden Bekanntmachungen werden in der amtlichen Zeitschrift des NS.-Fliegerkorps (Luftwelt) veröffentlicht oder den Bewerbern vom Veranstalter als Sonderanweisung für den Wettbewerb zugestellt.
Bewerber.
13. Als Bewerber sind zum Wettbewerb zugelassen:
a) NSFK.-Qruppen und nachgeordnete Einheiten des NS.-Fliegerkorps sowie NSFK.-Segelflugschulen,
b) Luftwaffe, DFS und DVL. Meldungen.
14. Die Meldung hat für jedes Segelflugzeug gesondert auf vorgeschriebenen
Meldevordrucken zu erfolgen.
(Fortsetzung folgt.)
Engl. Hochleistungsflugzeug „Petre!1'. In Ergänzung unserer Typenbeschreibung im Flugsport 1939, Seite 116, geben wir untenstehend einige Abbildungen. Segelfähigkeit 47 km/h, Höchstgeschwindigkeit mit noch brauchbarer Sinkgeschwindigkeit 96 km/h. Beste Sinkgeschwindigkeit 0,6 m/sec. Gleitwinkel 1 : 25. Leergewicht 190 kg. Flächenbelastung 14,4 kg/m2. Führerverkleidung in der obigen Abbildung wurde auf Sonderbestellung ausgeführt. Bei Normalmaschinen Ausführung wie auf Zeichnung S. 116.
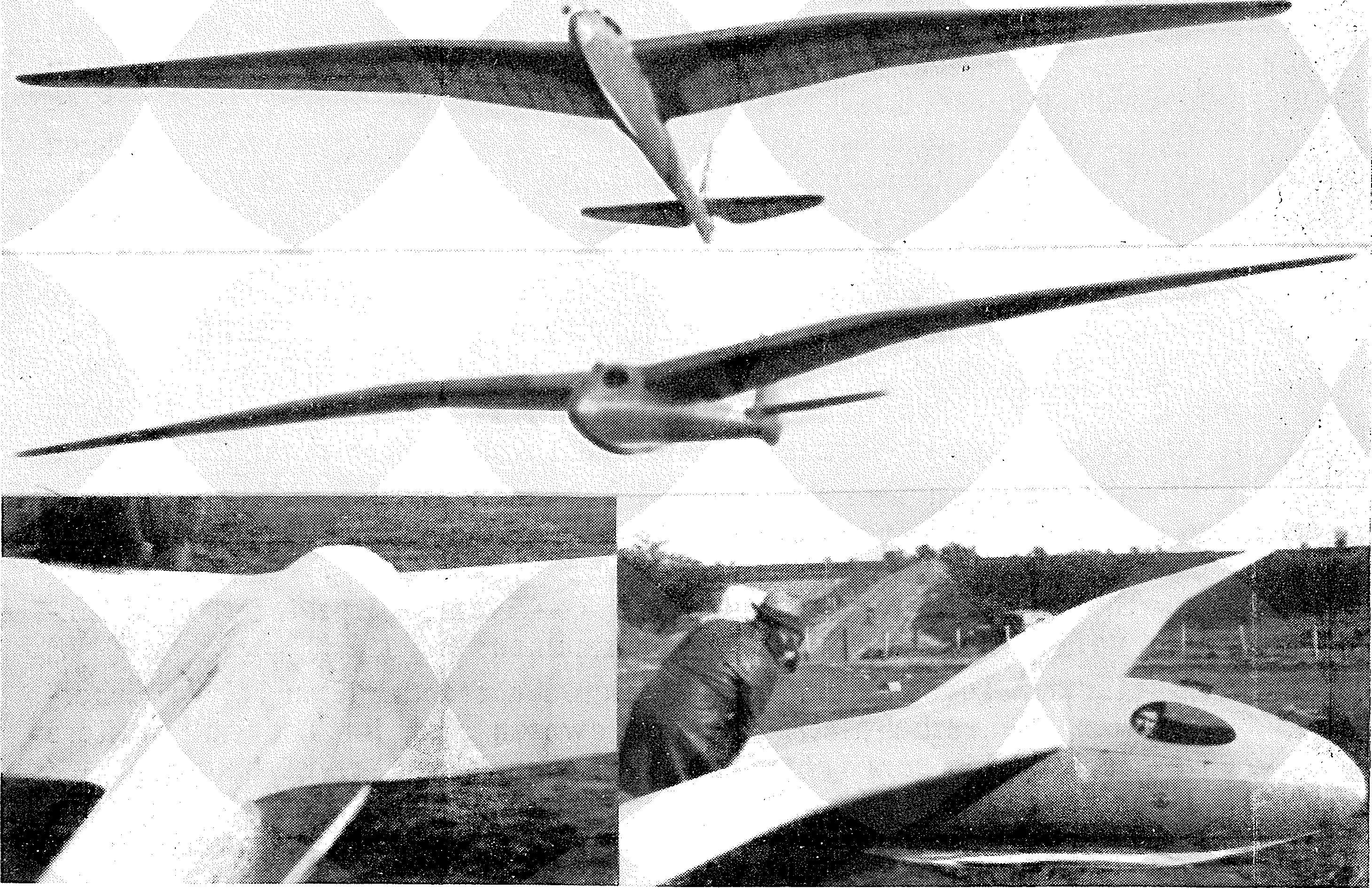
Engl. Hochleistungssegelflugzeug Petrel. Archiv Flugsport
Internat, poln. Segelflugveranstaltung vom 14.—20.5. findet anläßlich der Tagung in Warschau der Commission für motorlosen Flug FAI. in Kattowitz statt. Während der Veranstaltung sollen vor allen Dingen die Segelflugmannschaften mit der Art und Weise der Leistungsflüge während der Olympischen Spiele bekanntgemacht werden. Zugelassen sind je Land 3 Flugzeuge mit ihrer Mannschaft und einem Führer; Schleppmaschine und Transportmaschinen hat jedes Land selbst mitzubringen. Zweisitzige Segelflugzeuge sind zugelassen. Anmeldungen an Aeroklub Rzeczypospolitej, Polskiej, Warschau, Krolewska Str. 2.
British Gliding Association. Generalversammlung 14. 4. 39 Piccadilly, London W 1.
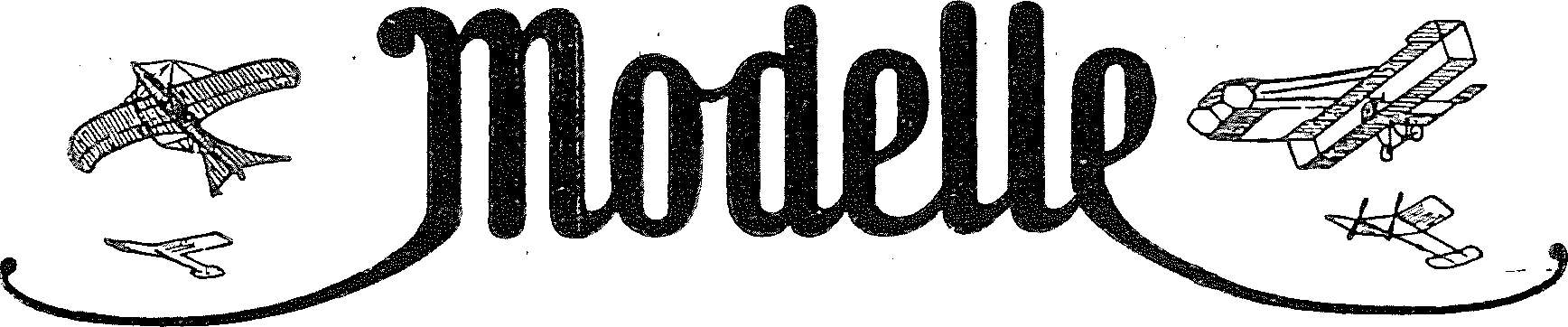
Köllig Peter II Cup, ein Ehrenpreis für Modell-Wettbewerb zwischen nationalen Gruppen, ist von dem jungen König Peter von Jugoslawien gestiftet worden.
Deutsche Flugmodell-Höchstleistungen. Bei dem Stand vom 1. April 1939 hat sich gegenüber dem Stand vom 1. Januar 1939 (vgl. „Flugsport" 1939, S. 27) folgendes geändert:
Klasse Rumpiflugmodelle mit Verbrennungsmotor: Bodenstart-Strecke: H. G. Holl, Essen, 112 400 m.
Ausschreibung Reichswettbewerb für Segelflugmodelle auf der Wasserkuppe, Rhön.
Pfingsten 1939.
Geschäftsstelle: Berlin W 15, Meiero.ttostr. 8/9. Ab 25. Mai: Reichssegel-flugschule Wasserkuppe, Post Gersfeld (Rhön).
Veranstalter: Der Korpsführer des NS.-Fliegerkorps., Maßgebend sind die „Allgemeinen Wettbewerbsbestimmungen für Flugmodellwettbewerbe des NS.-Fliegerkorps". Spätester Eintrefftermin für Wettbewerbsteilnehmer: Freitag, den 26. Mai 1939, 16 Uhr.
27. Mai, 9—22 Uhr: Bauprüfung und Zulassung der Flugmodelle. 28., 9 Uhr: Eröffnung des Wettbewerbs; 9.30—18 Uhr sowie 29., 9—16 Uhr: Handstart- und Hochstartwettbewerb. 29., 17.30 Uhr: Preisverteilung und Wettbewerbsschluß. Unterbrechung während der Mittagspause findet nicht statt.
Meldungen auf Meldevordrucken, NSFK.-Formblatt Nr. 561, über die zuständige NSFK.-Gruppe auf dem Dienstweg einreichen. Schlußtermin 10. Mai, 24 Uhr.
Jede NSFK.-Gruppe ist berechtigt, bis zu 30 Flugmodelle zu melden, Danzig bis 12. Für die Gruppenwertung wird folgende Sollbeteiligung verlangt: Flugmodelle je Klasse: A : 6, AI : 1; B : 10; Bl : 1; C : 2; Cl : 2; D : 3; zus. 25 Modelle. Standarte 4 Danzig: A : 1; AI : 1; B : 2; Bl : 1; C : 2; Cl : 1; D : 2; NSFK.-Gruppen unter Sollbeteiligung scheiden bei der Gruppenwertung aus. Für nicht erreichte Sollbeteiligung in einer Klasse dürfen in einer anderen Klasse keine Mehrmeldungen abgegeben werden.
Außerhalb der Gruppenwertung kann jede Gruppe 5 (Danzig 2) den FAL-ßauvorschriften entsprechende Flugmodelle melden. Die Flugmodelle der FAL-Klasse werden nach ihrer Bauart nicht weiter voneinander unterschieden. Berufsmodellbauer dürfen nur außerhalb der Gruppenbewertung für die Klassen B—D und FAI. melden.
Durchführung: Jeder Bewerber erhält für jedes Modell je 3 Karten für Handstart und 3 für Hochstart, nicht übertragbar, Verlust zieht Ausschluß nach sich. Fehlstart = vollzogener Flug. Vorschriftsmäßige Hochstartschnur, sonst Ausschluß der gesamten Mannschaft.
Flugmodelle der Klassen A—D unterliegen den „Allgemeinen Bestimmungen des NSFK. über Flugmodellbau und Modellflug". Bestimmungen der FAI.-Klasse: Erlaubt Tonkin, Bambus, Balsaholz, Japanseide und -papier. Mindestspannweite 0,70 m, Höchstspannweite 3,50 m, Flächenbelastung mindestens 15 gl'dm2. Höhenleitwerksfläche nicht über 33% der Tragflügelfläche, sonst als Tragfläche gerech-
L2
net. Rumpfquerschnitt S = (L = Gesamtlänge), bei mehreren Rümpfen gilt die Summe der einzelnen als S. Nurflügel-Modelle: Rumpf, hochstehende Ellipse, große Achse = a, kleine = ^-S = ~~p". Platz für den Höhenschreiber (frei)
12X8X6 cm, 175—190 g.
Sieger ist die NSFK.-Gruppe mit der höchsten Punktzahl, sie erhält die goldene Plakette des Korpsführers des NSFK. Beste Gesamtleistung eines Teilnehmers: Wanderpreis des Korpsführers. Bewertet wird nur eine Höchstleistung eines Modells in einer Klasse.
Klasse A: Jungen mit Bauplan-Normalflugmodellen und Nachbau-Normalflugmodellen. Klasse AI: Jungen mit Bauplan-Flugzeugmodellen und Nachbau-Flugzeugmodellen. Klasse B: Jungen und Männer mit selbstentworfenen Normalflugmodellen. Klasse Bl Jungen und Männer mit selbstentwörfenen Flugzeug-
modellen. Klasse C: Jungen und Männer mit neuartigen Flugmodellen. In den einzelnen Klassen wird unterschieden zwischen Handstart-Dauer und Hochstart-Dauer.
Für Bestleistungen mit Selbststeuergeräten der Klasse D Sonderpreise in Höhe von 750.— RM. Klasse FAL:Jungen und Männer mit selbstentworfenen Flugmodellen aller Art, die den Bauvorschriften der FAI. entsprechen. Die Sieger dieser Klassen erhalten außer den Plaketten keinerlei Sonderpreise. Als besondere Auszeichnung werden sie mit ihren Sieger-Flugmodellen je nach Einsatzmöglichkeit das NSFK. auf den internationalen Flugmodellwettbewerben vertreten.
Das Preisgericht setzt sich zusammen aus: 1. dem Korpsführer des NSFK., General der Flieger Christiansen, 2. NSFK.-Gruppenführer von Eschwege, 3. NSFK.-Sturmbannführer Bengsch (Wettbewerbsleiter), 4. Oberbannführer Voigtländer (Vertreter des RJF.), 5. NSFK.-Sturmbannführer Heibig (Vertreter des REM.), 6. Pg. Lippisch (Leiter der techn. Prüf stellen), 7. NSFK.-Sturmführer Alexander (techn. Leiter), 8. Pg. Baumann (Leiter der Auswertungsstelle), 9. NSFK.-Ober-truppführer Winkler (Hauptschriftleiter der Zeitschrift „Modellflug").
Ueber die Abfindung der Wettbewerbsleitung, der Teilnehmer am Wettbewerb und über die Abrechnung ergeht Sonderbefehl.
Literatur.
(Die hier besprochenen Bücher können von uns bezogen werden.)
Britische Gedanken über den Einsatz des Luftheeres. Von Dr. Otto-Ernst Schüddekopf. Verlag E. S. Mittler <k Sohn, Berlin. Preis RM 3.80.
Wie Oberst Haehnelt, Chef der 6. (kriegswissenschaftl.) Abt. des Generalstabs der Luftwaffe, sagt, ist es notwendig, sich nicht nur mit den Kampfmitteln, sondern auch mit der Kriegführung anderer Länder vertraut zu machen. Die Kapitel über Einsatzmittel wie das Erringen der Luftüberlegenheit, Bombenziele und Art des Einsatzes im Raum, Durchführung der Angriffe usw., sind außerordentlich lesenswert.
Reglement sur FUsage International des Symboles et Termes Employes en Technique Aeronautique. Herausgegeben von der Commission Internationale de Navigation Aerienne, 60 bis, avenue d'Jena, Paris. Preis Fr. 20.—.
Enthält Formeln, Formelzeichen, Fachausdrücke aus den wichtigsten Gebieten der Aerodynamik, Flugtechnik, Navigation, wie sie von der C.I.N.A. und den ihr angeschlossenen Ländern zur Verwendung empfohlen werden. Ferner ein Verzeichnis von Fachausdrücken in französisch, englisch und italienisch.
Reglement sur TEmploi des Appareils de Radiocommunications ä Bord des Aeronefs. Herausgegeben von der Commission Internationale de Navigation Aeronautique, 60 bis, avenue d'Jena, Paris. Preis Fr. 10.—.
Dieses Reglement wurde von der C.I.N.A. am 1. 6. 1935 in Brüssel angenommen. In Kraft seit 1. 1. 1936. Regelt den Funkverkehr, Kontrolle des Funkdienstes, Wellen, Frequenzen, Notnachrichten, Uebermittlung von Telephon, Wellenände--rungen, Handelsabkürzungen u. a. m.
DIN - Normblatt-Verzeichnis 1939, herausg. vom Deutschen Normenausschuß, Berlin NW 7. Verlag Beuth-Vertrieb G.m.b.H., Berlin SW 68. Preis RM 4.—.
Bei den Maßnahmen zur Leistungssteigerung spielt die Anwendung der Deutschen Normen eine große Rolle. Die Bedeutung der deutschen Normung ist jetzt restlos anerkannt. Das vorliegende Verzeichnis gibt einen Begriff von der Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit der Normblätter nach dem neuesten Stand und verzeichnet etwa 6500 Normblätter und ferner 600 Entwürfe. Wertvoll ist die Aufführung der Hausnormen der Wehrmacht. Es sind dies 220 Heergerät-Normen (HgN) und 110 Technische Lieferbedingungen für Heergerät (T. L. und V. t. L.), 30 Marine-Waffen-Normen (MWaN) sowie 170 Kriegsmarine-Normen (KM) für Maschinenbau, Schiffbau und Elektrotechnik. Die 474 österr. Normen (ÖNORM) des 1938 im Deutschen Normenausschuß aufgegangenen Österr. Normenausschusses sind in Kursivschrift aufgeführt. Etwa 20 ÖNORM-Blätter sind inzwischen durch DIN-Blätter endgültig ersetzt worden.
DerTnhaberdes 631325
Deutschen Reichspatentes i^^^^h^^h betreffend: „Verfahren und Einrichtung zum Verhindern des Ablagern« von Eis und Schnee auf Luftfahr-zeugteilen" wünscht dieses Patent zu verkaufen oder Lizenzen darauf zu erteilen. — Anfragen erbeten unter F. Z. 960 an die WEFBA
Frankfurt/M., Kalserstr. 5.
Für Gleit- und Segelflugzeugbau suchen wir einen
SEGELFLUGLEHRER
mit Windenschlepp-Berechtigung und Werkstattleiter-Prüfunf. Angebote mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild unter Angabe der Gehaltsansprüche u. des frühesten Antrittstermins an
ARADO
FLUGZEUGWERKE G. M. B. H., WERK WARNEMÜNDE
„FLUGSPORT
Salmson-Klemm-|j 25 ^Flugzeug
Tausch oder Verkauf, la Zustand, ab» nahmefertig, nur 180 Flugstunden. Auto in Zahlung. ß. Ahlswede,
Hamburg 23, Wielands tr. 5
57^habcrinDRp# £2325?
des Patentes
Gefl.
„Stoßdämpfer für Land* und Wasserflugzeuge" wünscht zwecks gewerblicher Verwertung ihrer Erfindung in Deutschland mit Interessenten in Verbindung zu treten.
Anfragen unter Fr. 30 770 an Ala, Berlin W 35.
Birken>Flugzeug>
Sperrholzplatten
deutsche* Fabrikat
bei Rekordfingen erprobt. In den
Qualitäten: AVIATIC, SPEZIAL, QLEITFLUQ in allen Stärken von 0,4=8 mm liefert prompt ab Lager
Georg Herte Beriln»Charloftenburg
Kaiser Friedrich-Straße 24 Fernspr.-Sammelnummer: 34 5841 TalßJ'.-Adr.: rileierholxer Berlin
Argus- modellmotor
neuwertig, zu kaufen gesucht. Angebote unter 4023 an die Expedition des „Flugsport", Frankfurt a. Main, Hinden-burgp'atz 8, erbeten.
-eo- und £
Falls diirme
aller Art

SCHROEDER & CO.
Berliii-\cuktilln
Bergstraße 93-95
Älteste Flugzeug FalIsdiirm~Fabrik der Welt
ngenieur-schule
Maschinenbau / Automobil- u. Flugtechnik I Elektrotechnik. Programm kostenlos I
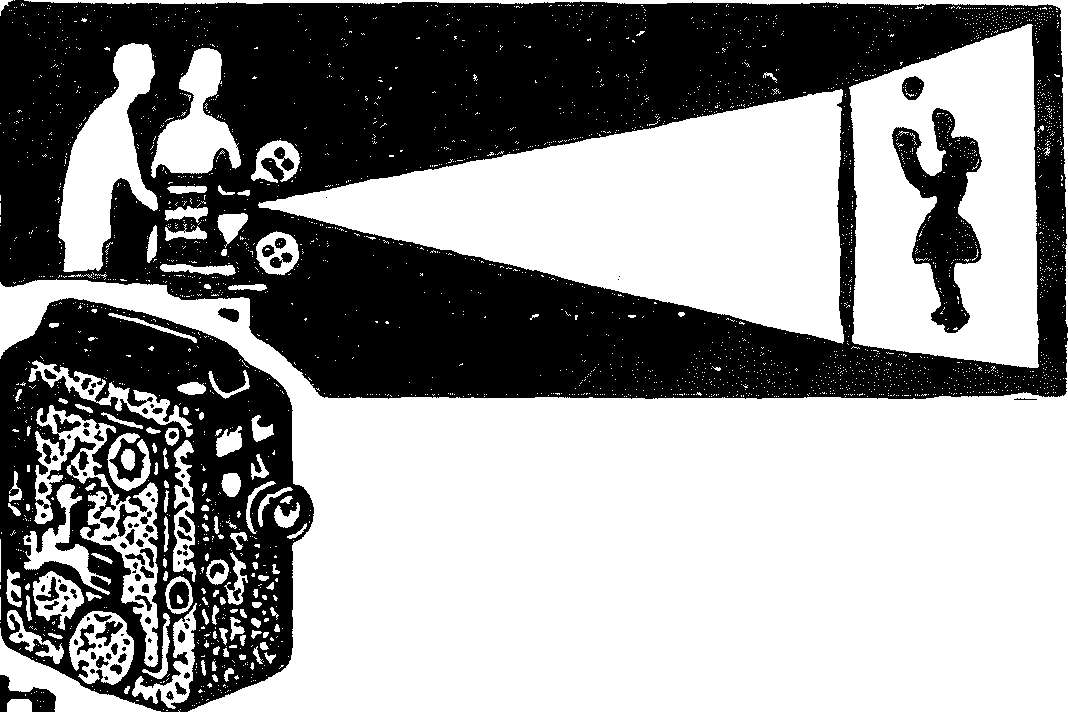
Jetzt
noch preisgünstiger!
Di« Freuden, die das Selbstfilmen Ihrer eigenen Erlebnisse bietet, sind noch leichter erreichbar durch Nizo 8 E-S, die neue, preis» gün tige 8-mm-Kinokamera mit Auswechseloptik 1:2,5 auch für Zeitdehneraufnahmen und dem neuen lichtstarken, überaus kleinen und leichten Nizo-Projektor 8 NL - Druckschrift Nr. M 33 kostenlos von Herstellerfirma
6. m. b. H. MÜNCHEN 23
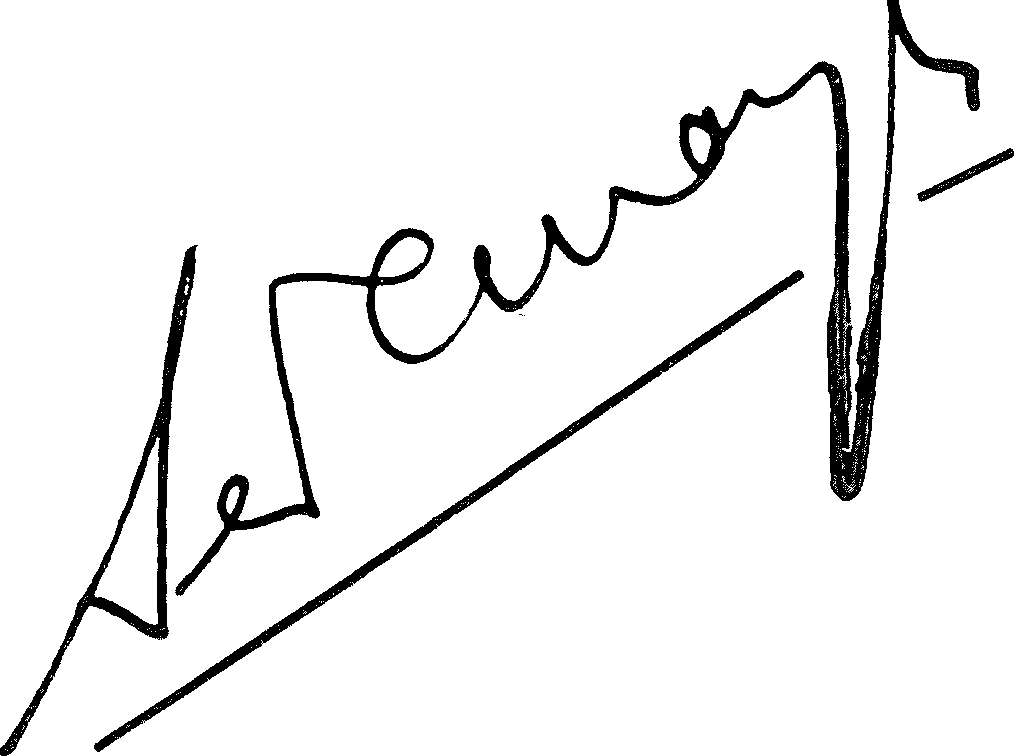
Der Namenszug, der
28-Jährige Erfahrung im
Flugwesen bedeutet
Diese Erfahrung steht auch Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich bei Bedarf an
Flugzeugmaterial aller Art
an uns wenden.
AUTOFLUG
Inhaber Gerhard Sedlmayr
Berlin -Tempelhof
Berliner Straße 167/168
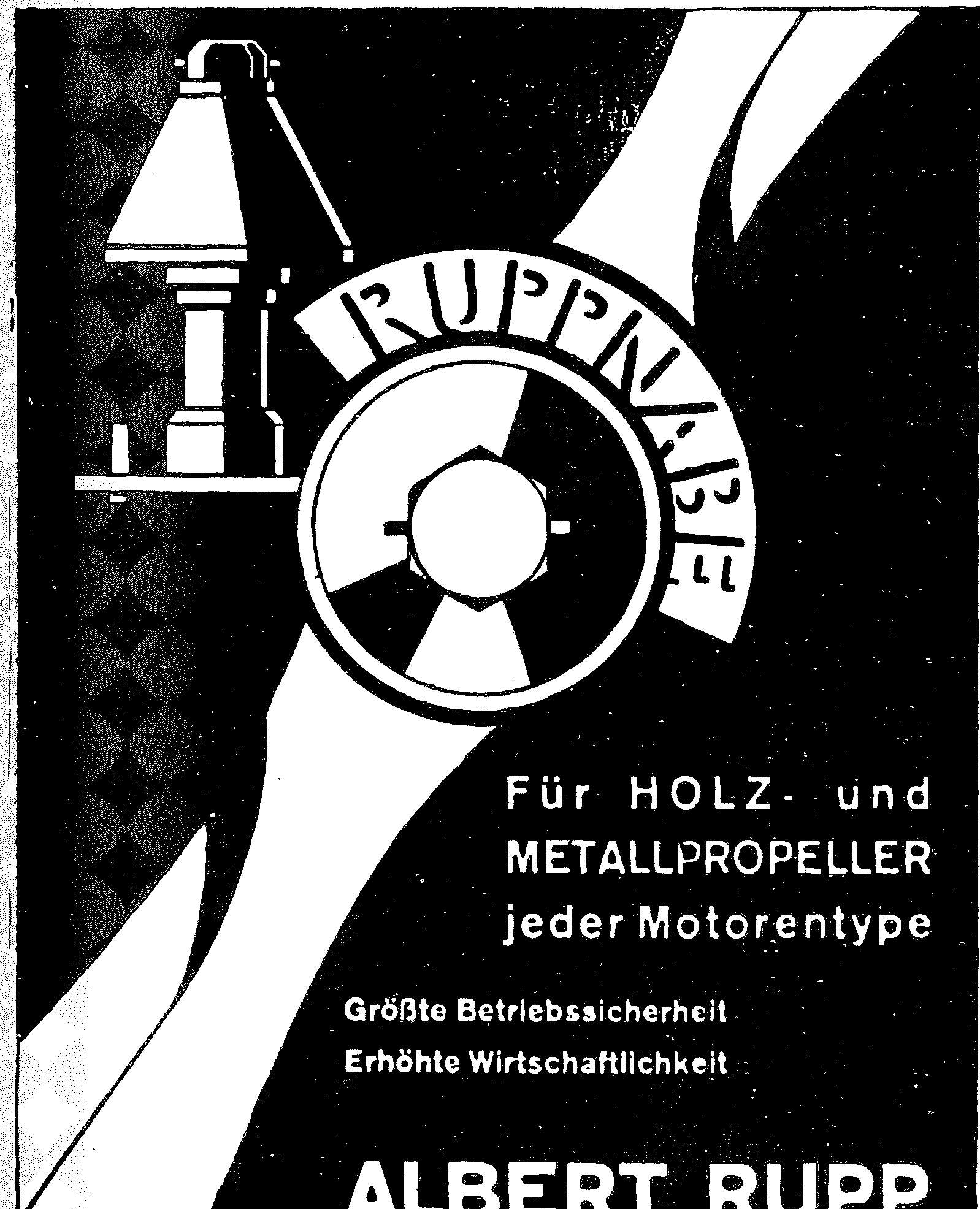
Heft 8/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro % Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit ..Nachdruck verboten" versehen. __nur mit genauer Quellenangabe gestattet.
Nr. 8_12. April 1939_XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 26. April 1939
Weitere deutsche Höchstleistung.
Zu den an dieser Stelle in der letzten Nummer gemeldeten Höchstleistungen ist eine weitere^die Welt überraschende Leistung in der deutschen Geschichte zu verbuchen. Am 30. März erreichte Flugzeugführer Hans Dieterle auf einem einsitzigen, mit Daimler-Benz-Flugmotor „DB 601", VDM-Prop., ausgerüsteten Jagdfingzeug der Heinkel-Flugzeugwerke eine Fluggeschwindigkeit von 746,66 km/h. Der Flug wurde auf der 3 km langen Meßstrecke in der Nähe des Werksflugplatzes Oranienburg ausgeführt. Damit wurde die am 23. 10. 1934 von dem Italiener Francesco Agello mit einem Wasserflugzeug auf dem Qardasee aufgestellte Leistung von 709,209 km/h überboten.
Das verwendete Flugzeug ist eine Weiterentwicklung der He 112 U, mit der General Udet Pfingsten 1938 einen Geschwindigkeitsrekord über 100 km aufstellte.
Der Führer hat zu der großartigen Leistung des Heinkel-Jagdflug-zeugs Prof. Heinkel, Flugkapitän Dieterle und Generaldirektor Kissel der Daimler - Benz - Werke telegraphisch seine Glückwünsche übermittelt. Auch Generalfeldmarschall Göring hat den an der überragenden fliegerischen Leistung Beteiligten, Prof. Heinkel, Flugkapitän Dieterle und Generaldirektor Kissel, telegraphisch seine Glückwünsche und seine besondere Anerkennung ausgesprochen.
Generalfeldmarschall Göring hat Flugzeugführer Dieterle unmittelbar im Anschluß an seinen Rekordflug zum Flugkapitän ernannt.
Staatssekretär Generaloberst Milch wies in einer Pressebesprechung darauf hin, daß zum erstenmal der Rekord von einem Landflugzeug auf einem Flugplatz von ganz normalen Ausmaßen aufgestellt worden ist. Der internationale Rekord für Landflugzeuge wurde von Dr. Wurster auf einer Messerschmitt-Maschine Bf 109 mit 610 km/h gehalten. Der absolute Rekord des Italieners Agello ist nunmehr um rund 37 km/h auf 746,66 km/h verbessert worden, wobei zu berücksichtigen ist, daß das Wasserflugzeug Agellos hinsichtlich der Start- und Landestrecken keinen Beschränkungen unterworfen war. Trotzdem bleibt der Rekord des Italieners Agello eine ganz außerordentliche Leistung.
Diese Nummer enthält Patentsammlung Nr. 6, Band VIII.
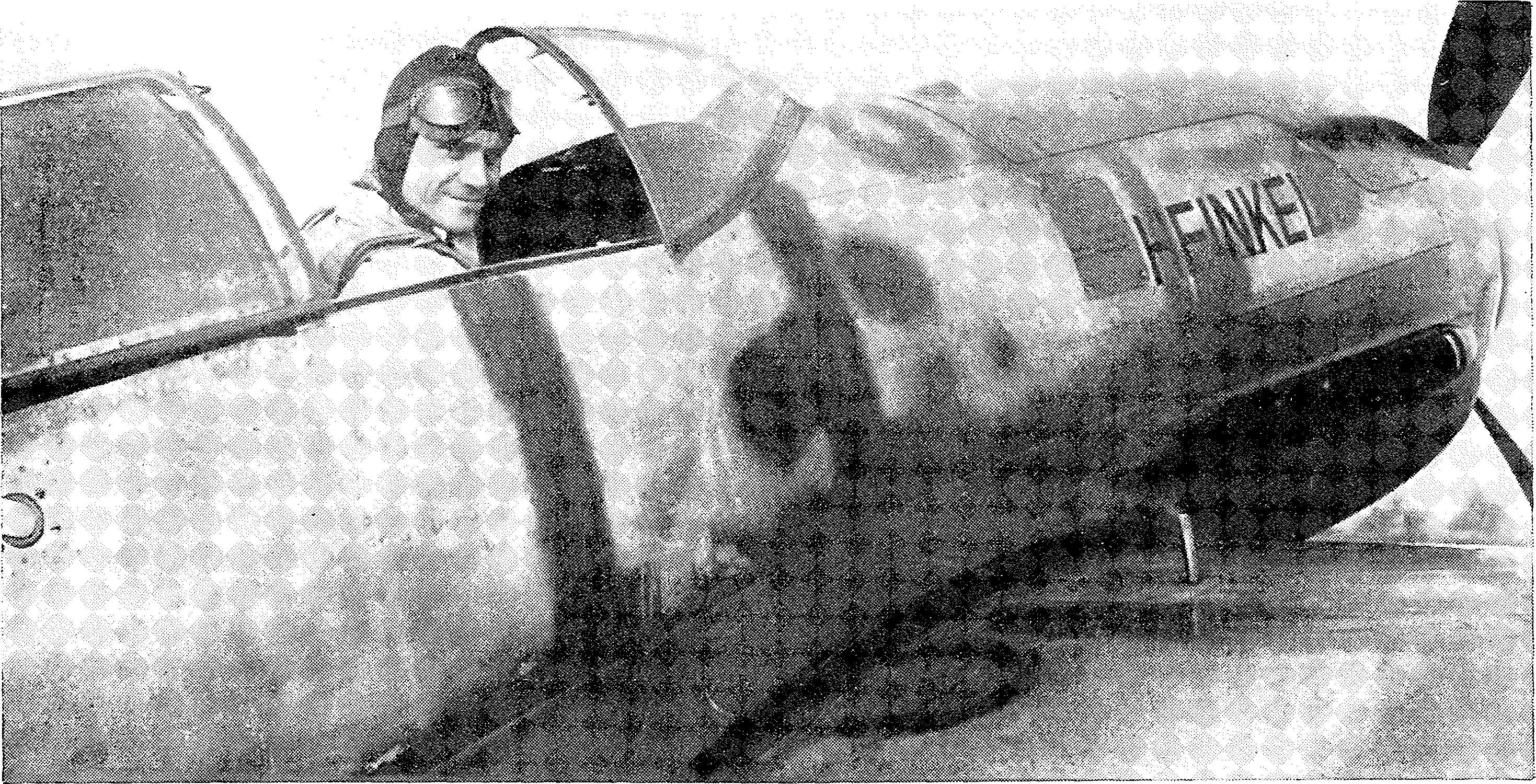
Hans Dieterle auf Heinkel-Jagdflugzeug stellte Weltgeschwindigkeitsrekord
mit 746,66 km/h am 30. 3. 39 auf. Weltbild
Der hervorragende Italienische Flieger hat es fertiggebracht, den Rekord vier Jahre lang zu behaupten. Seine Leistung wird in der Geschichte der Luftfahrt unvergessen bleiben. Zu der in einem Landflugzeug vollbrachten Leistung des Flugkapitäns Dieterle betonte Staatssekretär Milch noch besonders, daß der Rekord über die Meßstrecke in Höhen unter 75 m geflogen werden muß, und daß auch beim Wenden nicht über 400 m Höhe gegangen werden darf.
Deutschland muß natürlich gewappnet sein, den soeben errungenen Rekord zu verteidigen. Die deutsche Luftfahrt hat den festen und ernsten Willen, ihre führende Position auch in Zukunft beizubehalten. Dafür bürgen das hohe Können und die vorbildliche Einsatzbereitschaft der deutschen Konstrukteure und Piloten.
Dieterle schilderte seinen Flug in sehr bescheidener Weise: „Die Maschine wurde aus der Halle genommen. Sie w^ar vorher noch einmal poliert worden, denn bei einem Flug mit derartigen Geschwindigkeiten kommt es sehr auf die Oberflächenbeschaffenheit an. Sie wurde getankt und der Motor warmgefahren. Alles war gut durchprobiert, so daß keine Spur von Nervosität vorhanden war. Um 17.15 h starteten die beiden Kontrollflugzeuge. Der späte Nachmittag wurde gewählt, weil es abends ruhiger wird. Große Böigkeit kann man nämlich bei diesen Geschwindigkeiten in niedrigen Höhen nicht brauchen. Wenn des Abends die Sonne sinkt, verschwinden die Wärmeausstrahlungen, und es wird regelmäßig ruhiger. Ich selbst startete 17.23 h, prüfte, ob alles in Ordnung war, und flog dann die Strecke an. An den Wendepunkten überwachten die beiden mit Flugzeugführern und Sportzeugen besetzten und mit Barographen versehenen Kontrollmaschinen die Ausführung des Fluges, vor allem daraufhin, daß die Höhe von 400 m nicht überschritten wurde." Die Zeitmessungen wurden mit Askania-Renn-Meßkamera, die eine Meßgeschwindigkeit von ein tausendstel Sekunde ermöglicht, durchgeführt.
Ital. Hochleistungssegelflugzeug Aliante „A. L. 3".
Die Aliante A. L. 3 wurde von der Aeronautica Lombarda, zur Teilnahme an dem Olympia-Segelflugzeug-Vergleichssegelfliegen in Rom, gebaut. Vgl. auch die Abbildung auf Seite 144 im „Flugsport" 1939.
Bei der Konstruktion war maßgebend: größte Einfachheit in der Bauweise, leichte Reparaturmöglichkeit, geringes Gewicht, billige und
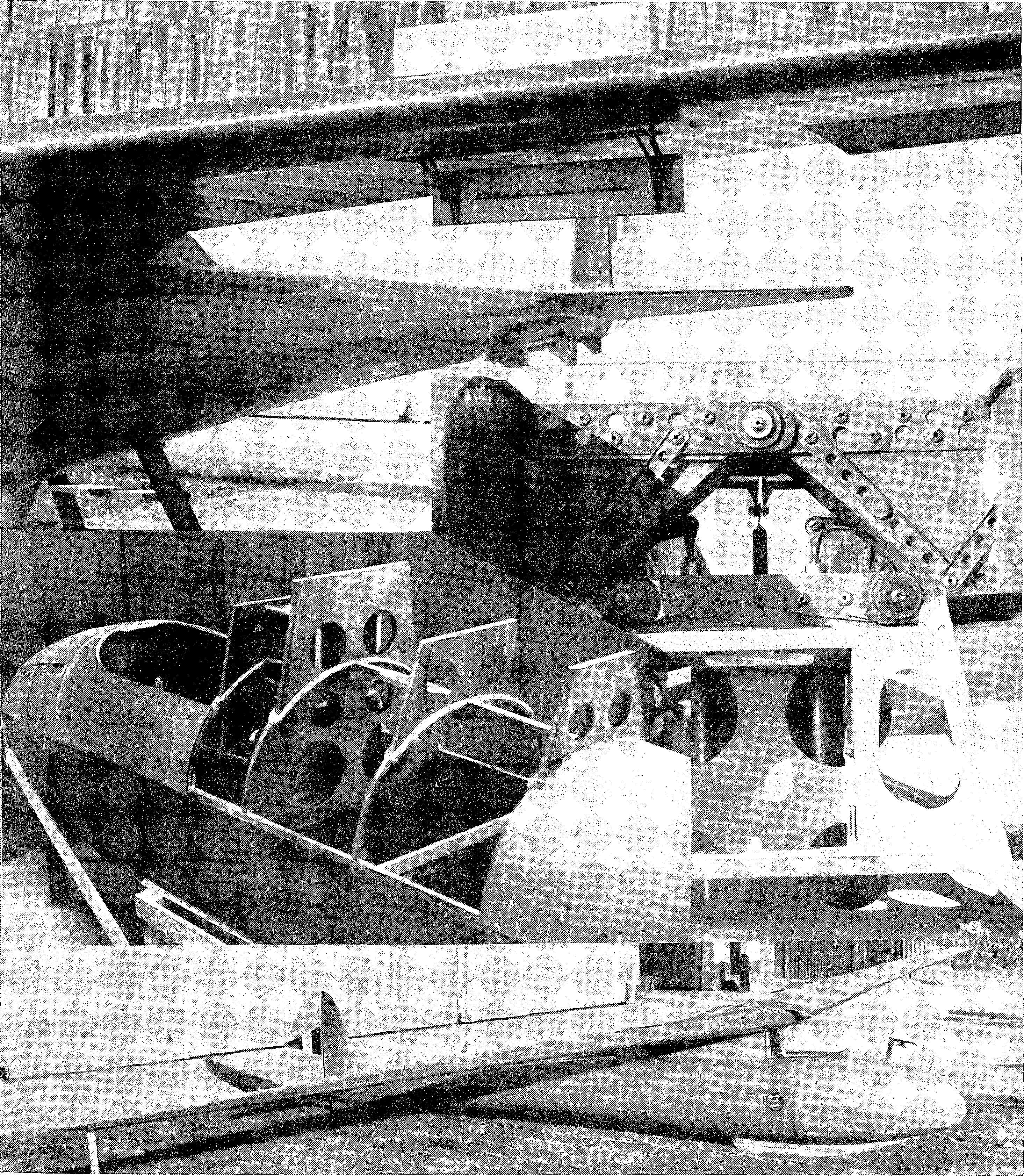
Ital. Hochleistungssegelflugzeug Aliante A. L. 3. Oben: Bremsklappen ausgefahren.
Darunter: Rumpf im Rohbau, rechts Holmbeschläge. Werkbiider
leicht beschaffbare Baumaterialien. Nur die Bremsklappe ist aus Duralumin.
Flügelprofil NA CA 4514, übergehend nach den Flügelenden in Profil 0012 V-Form 5°.
Versuche ergaben Gleitwinkel 1 : 25, Sinkgeschwindigkeit 78 cm/ sec, Qleitgeschwindigkeit 60 km/h. Größte Geschwindigkeit mit geöffneten Bremsklappen 198 km/h. Minimal-Geschwindigkeit 50 km/h. Flügel Kastenholme mit mehrfach verleimten Tannenflanschen und Sperrholzstegen. Rippen, unterbrochen an den Längsholmen, aus Ulme und Sperrholz. Flügelanschlußbeschläge einfach in der Herstellung, Blechstreifen übereinander gelegt, einfach verschweißt. Vgl. die Abbildung. Flügelnase Diagonalsperrholz. Querruder differential gesteuert, und zwar so, daß die äußeren Querruder einen größeren Ausschlag haben als die inneren, wodurch die Wendigkeit erhöht wird.
Rumpf runder Querschnitt, zwei Seitenholme und ein Kielholm.
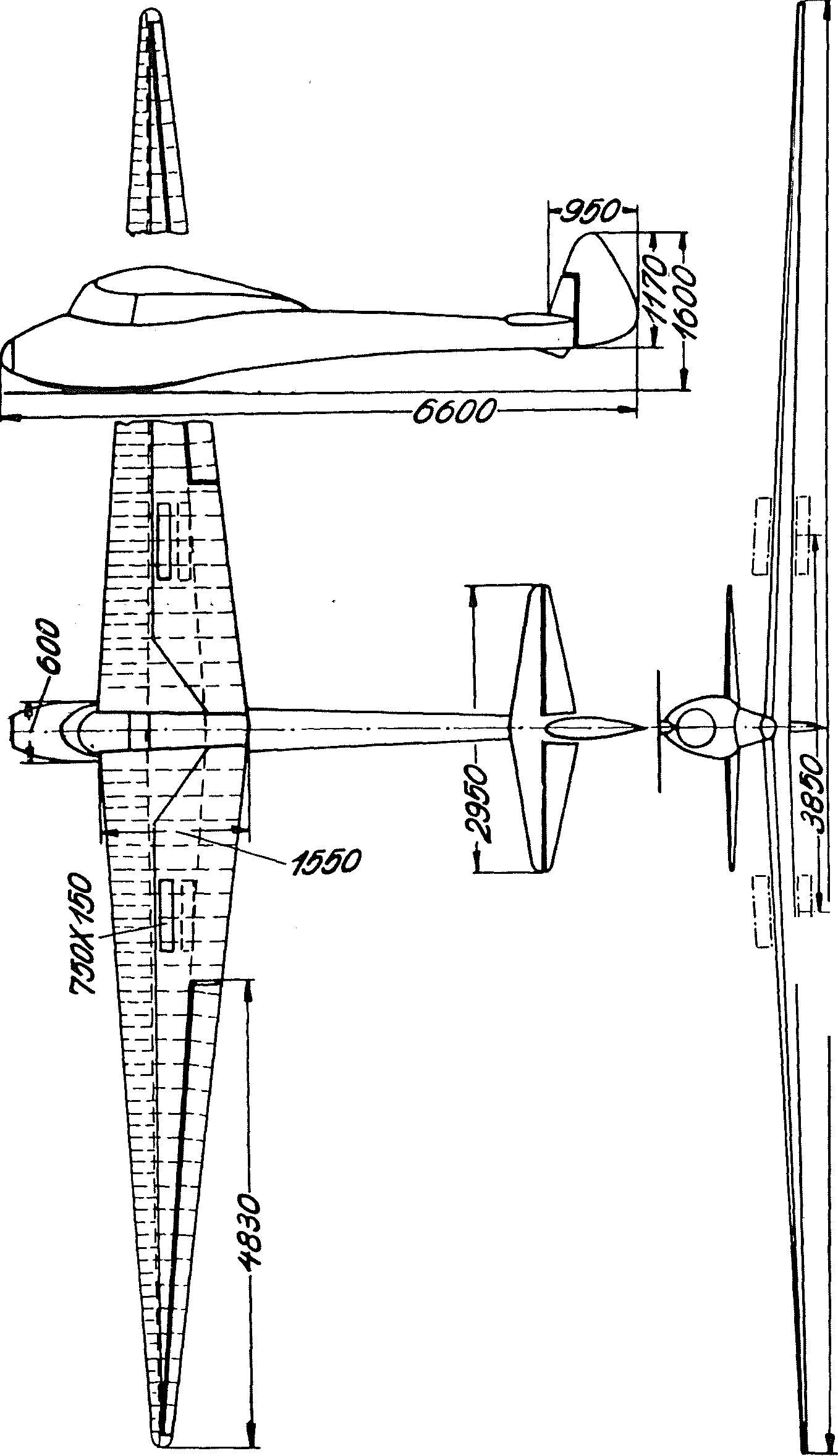
Einfache Bauweise der Schotten. Erster Schott hinter dem Kopf des Führers ausgespart für Barographen. (Vgl. Abb.)
Für das Auswiegen Bleigewichte. Bei leichten Führern unter dem Sitz, bei schweren in einem kastenförmigen Raum in der Kielflosse.
Kufe einfache Ausführung, Abfederung mit Gummiblocks. Schwanzkufe Tennisball mit Blechlöffel in einer Ledertasche.
Leitwerk übliche Ausführung, Kiel und Höhenflosse in Sperrholz, Ruder leinwandbedeckt.
Spannweite 15 m, Fläche 14 m2, J| mittlere Flügeltiefe 0,94 m, mittlere Flügeldicke 13%, Länge6,85 m, Leergewicht 160 kg, Fluggewicht 255 kg.
Ital. Hochleistungssegelflugzeug Aliante „A. L. 3".
Zeichnung Flugsport
Bäcker „Student".
Der zweisitzige Tiefdecker Bücker „Student" mit 50-PS-Zündapp-Motor ist durch seinen Rekord von 171,95 km/h über 1000 km Strecke, über den wir bereits in der letzten Nummer des „Flugsport" berichteten, in der Welt bekannt geworden. Mit diesem Rekord hat Deutschland bewiesen, daß es nicht nur in der Lage ist, große Verkehrs- und Kampfflugzeuge zu bauen, sondern daß es auch auf dem Gebiete des Kleinflugzeugbaues große Fortschritte zu verzeichnen hat. Der frühere Vorsprung des Auslandes ist hier nicht nur vollkommen wettgemacht, sondern, wie diese neue hervorragende Leistung zeigt, sogar überboten. Der Bücker „Student" (vgl. Typenbeschr. „Flugsport" 1938, S. 78—80) kann offen oder mit Kabine geflogen werden und stellt eine verhältnismäßig billige, besonders auf die Privatfliegerei abgestellte Maschine dar. Das Rekordflugzeug wurde der Serie entnommen und erhielt, abgesehen von einem Zusatztank und Radverkleidungen, keine besonderen Einrichtungen.
Spannweite 11,5 m, Länge 7,25 m, Höhe 1,9 m.
Inhalt des Kraftstoffbehälters 50 1.
Rüstgewicht, Beanspruchungsgruppe S4*), 360 kg (Zahlen für Beanspruchungsgruppe P3 in Klammern), (310 kg), Zuladung 210 kg (230 kg), Fluggewicht 520 kg (540 kg).
Leistungen bei C = 540 kg: Flugdauer 4 h, Flugweite 650 km, Kraftstoffverbrauch 7,5 1/100 km.
Höchstgeschw. 170 km/h, Reisegeschw. 155 km/h, Landegeschw.
* S4: Unterscheidung der Flugzeuge bei der Festigkeitsrechnung. S Flugzeuge, die der Ausbildung von Flugzeugführern der Klasse A dienen (Schulflugzeuge). P Flugzeuge, die der gewerblichen Beförderung von Personen dienen (Personenflugzeuge). Beanspruchungsgruppe 3 bedeutet normal, Beanspruchungsgruppe 4 hoch.
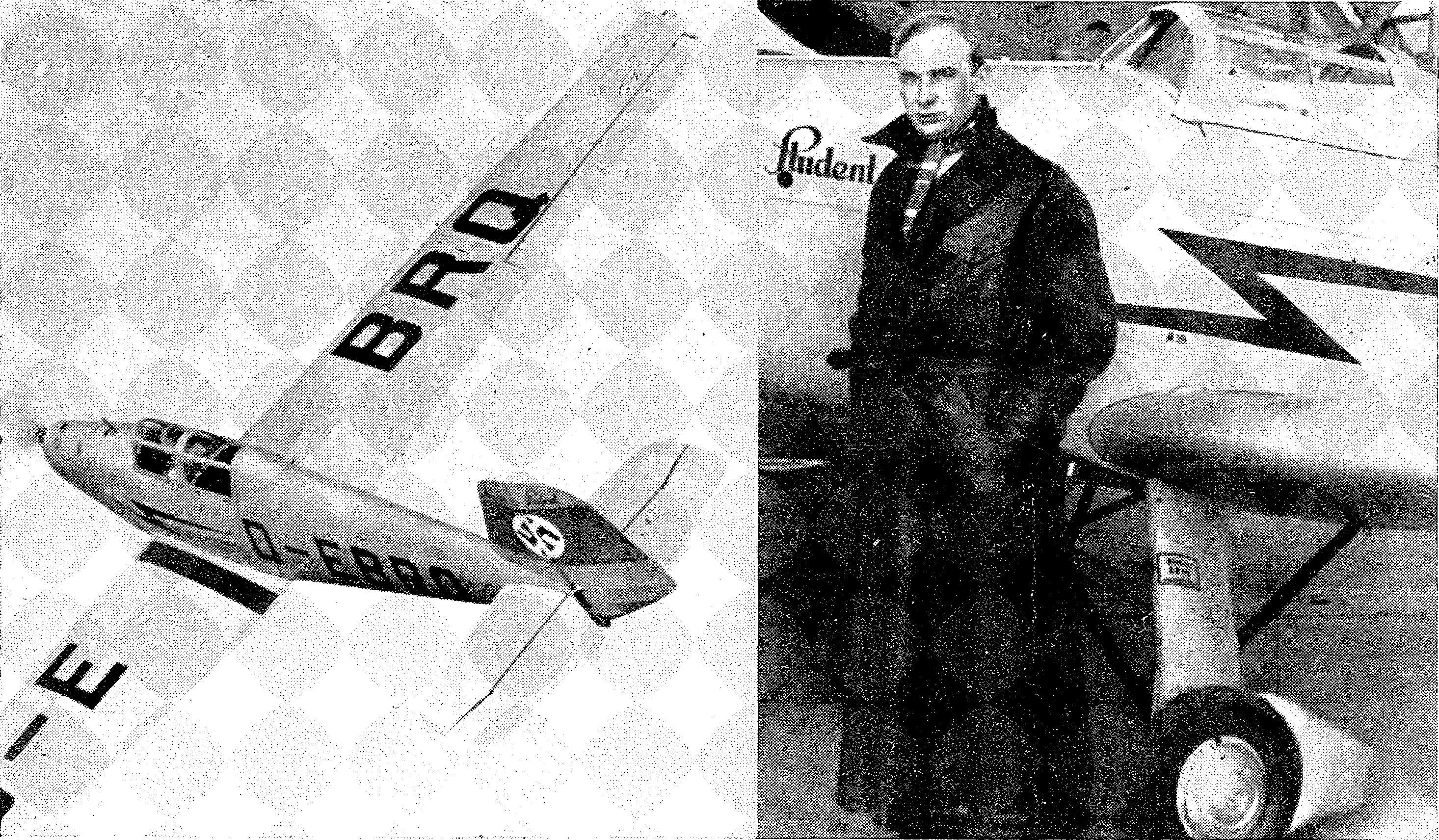
Bücker „Student" erreichte am 24. 3., gesteuert von Flugzeugführer Ahlfeld, mit Fluggast über 1000 km Strecke 171,95 km/h.
Links Werkbild, freigeg. d. RLM. Nr. 8925/39, rechts Weltbild, freigeg. d. RLM. Nr. 47 698.
65 km/h. Startstrecke 115 m, Landestrecke 110 m, Dienstgipfelhöhe 4000 m, Steigzeit auf 1000 m 7,7 min, 2000 m 18 min, 3000 m 32,6 min, Steiggeschw. in Bodennähe 2,4 m/s.
Flächenbelastung 36 kg/m2, Leistungsbelastung 10,8 kg/PS, Flächenleistung 3,34 PS/m2, Schraubenflächenleistung 19,7 PS/m2.
Franz. Jagdflugzeug Dewoitine D. 520.
Der Dewoitine-Jagdeinsitzer wurde am Anfang dieses Jahres von Marcel Doret eingeflogen und erreichte hierbei 560 km/h. Das ist immerhin 50 km mehr als bei bisherigen franz. Jagdflugzeugen. Die Geschwindigkeiten der deutschen und ital. Flugzeuge wurde damit bei weitem noch nicht erreicht.
Baufirma S. N. C. A. du Midi, Bauweise Dewoitine. Flügel V-Form, einholmig. Flanschen aus zwei Winkelprofilen, Steg Glattblech, beide sich nach den Enden verjüngend. Mit aufgenieteten Verstärkungsprofilen an den Stegen. Vgl. Abbildung. Flügelnase dient gleichzeitig als Torsionsträger. Flügelbedeckung hinter dem Holm nimmt Stirnkräfte auf. Zwischen Querruder und Rumpf Landeklappe als Schlitzflügel ausgeführt.
Rumpf eiförmiger Querschnitt. Profilringe und Profillängsversteifungenmit tragender Außenhaut. Führersitz verhältnismäßig weit hinten.
Franz. Jagdflugzeug Dewoitine D. 520.
Zeichnung Flugsport
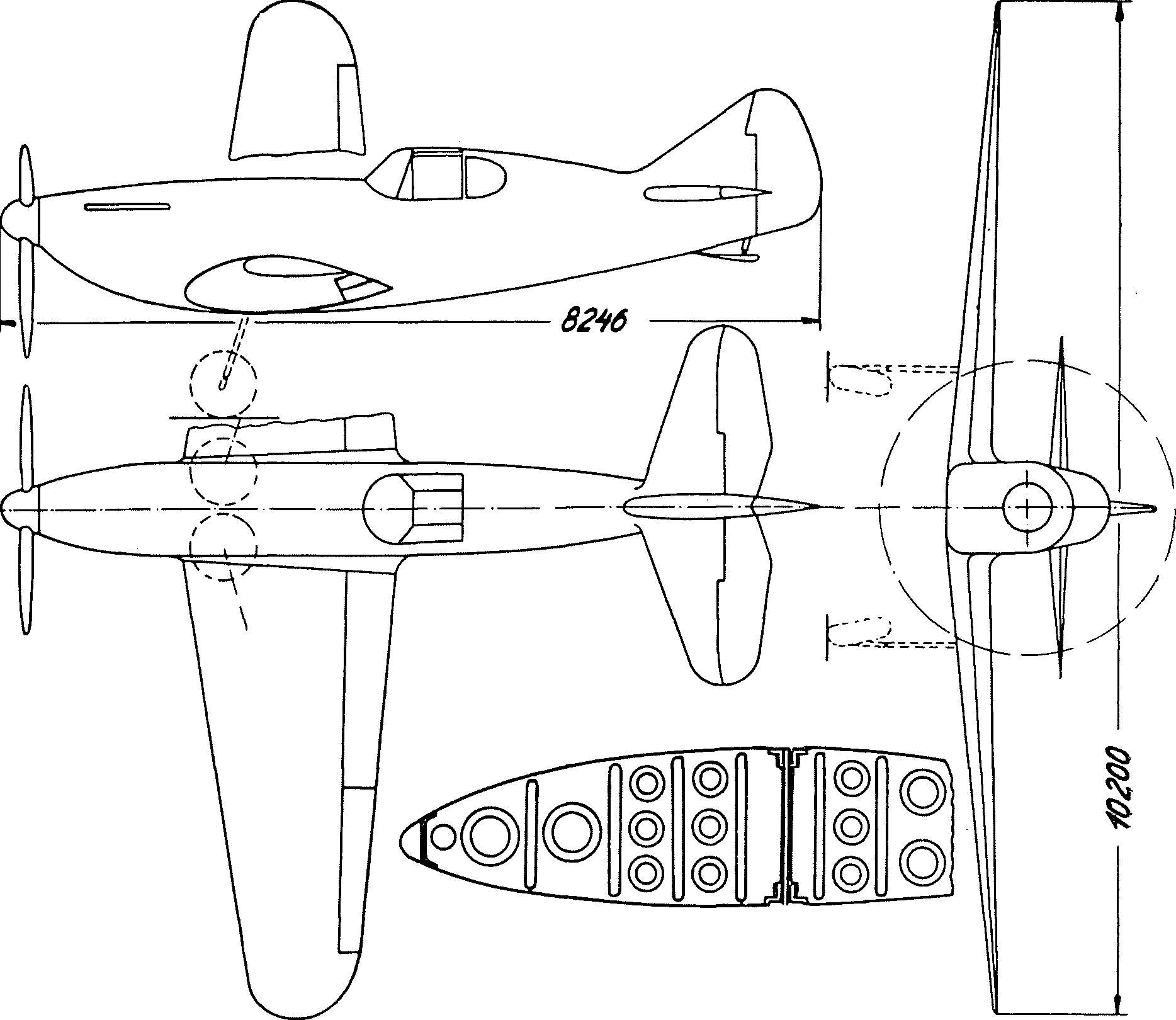
Franz. Jagdflugzeug Dewoitine D. 520. Weltbild
Motor Hispano Suiza 12 Ycrs 860 PS. Ratier Metallverstell-Drei-blattschraube. Fahrwerk nach innen hochziehbar. Bewaffnung: Eine M.-K. und vier MQ.'s.
Bei der Konstruktion wurde von vornherein Wert auf Serienfabrikation gelegt. Durch Vereinfachung der Bauweise ist die Herstellung auf 7000 Arbeitsstunden herabgedrückt worden. Für den D 510 betrug die Arbeitszeit 14 000 Stunden.
Spannweite 10,20 m, Länge 8,246 m, Höhe 2,60 m, Fläche 14 m2. Fluggewicht 2200 kg, Höchstgeschw. in 4000 m Höhe 560 km/h, Lande-geschw. 113 km/h. Steigfähigkeit auf 4000 m in 3 min 50 sec. Gipfelhöhe 10 500 m.
Tschech. Jagdflugzeug Avia 35.
Hochleistungs - Jagdflugzeug, Typ 35, gebaut von der Avia-Aktienges. für Flugzeugindustrie, Prag, ist ein Tiefdecker in Gemischtbauweise.
Flügel zwei Längsholme, Holzbau, Bedeckung Sperrholz mit Duraluminblechauflage. Landeklappen Duralumin.
Rumpf Stahlrohr, Knotenpunkte vernietet, aus mehreren Teilen, durch Schrauben verbunden. Kabine mit Schiebedach.
Leitwerk, Seitenflosse und Ruder Holzkonstruktion, sperrholzbedeckt. Höhenflosse und Ruder Stahlrohr, leinwandbedeckt.
Betriebsstoffbehälter im Flügel unter dem Rumpf. Oelbehälter und Oelkühler in der Flügelnase. Wasserkühler unter dem Motor.
Fahrwerk fest oder hochziehbar.
Motor bei der Versuchsmaschine Avia HS 12 YCrs, im Serienbau Avia HS Y 29 oder Avia HS Y 1000—1200 PS.
Bewaffnung: Kanone durch hohle Welle schie-\ Bend. Zwei fest einge-\ baute gesteuerte MQ.'s, J \ Bombengewicht 60 bis / 220 kg. / Leistungen: Ausführung A mit Motor YCrs, Holzschraube, Wasser-| kühlung, festem Fahr-* werk. Max. Geschwindigkeit am Boden
Tschech. Jagdflugzeug
Avia 35. Zeichnung- Flugsport
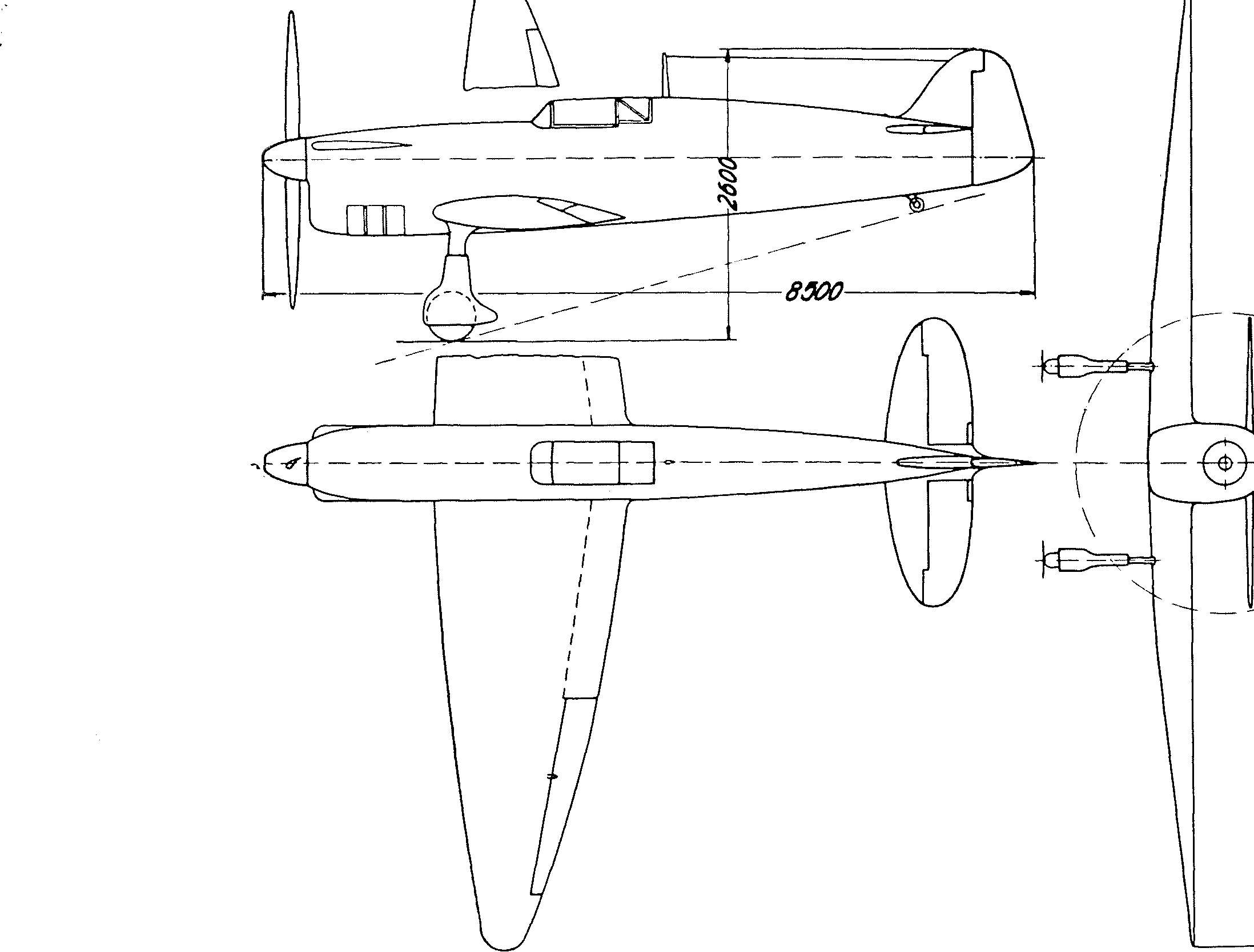
Avia 35 Jagdflugzeug. Motor Hispano-Suiza 12 Ycrs 860 PS.
Werkbild
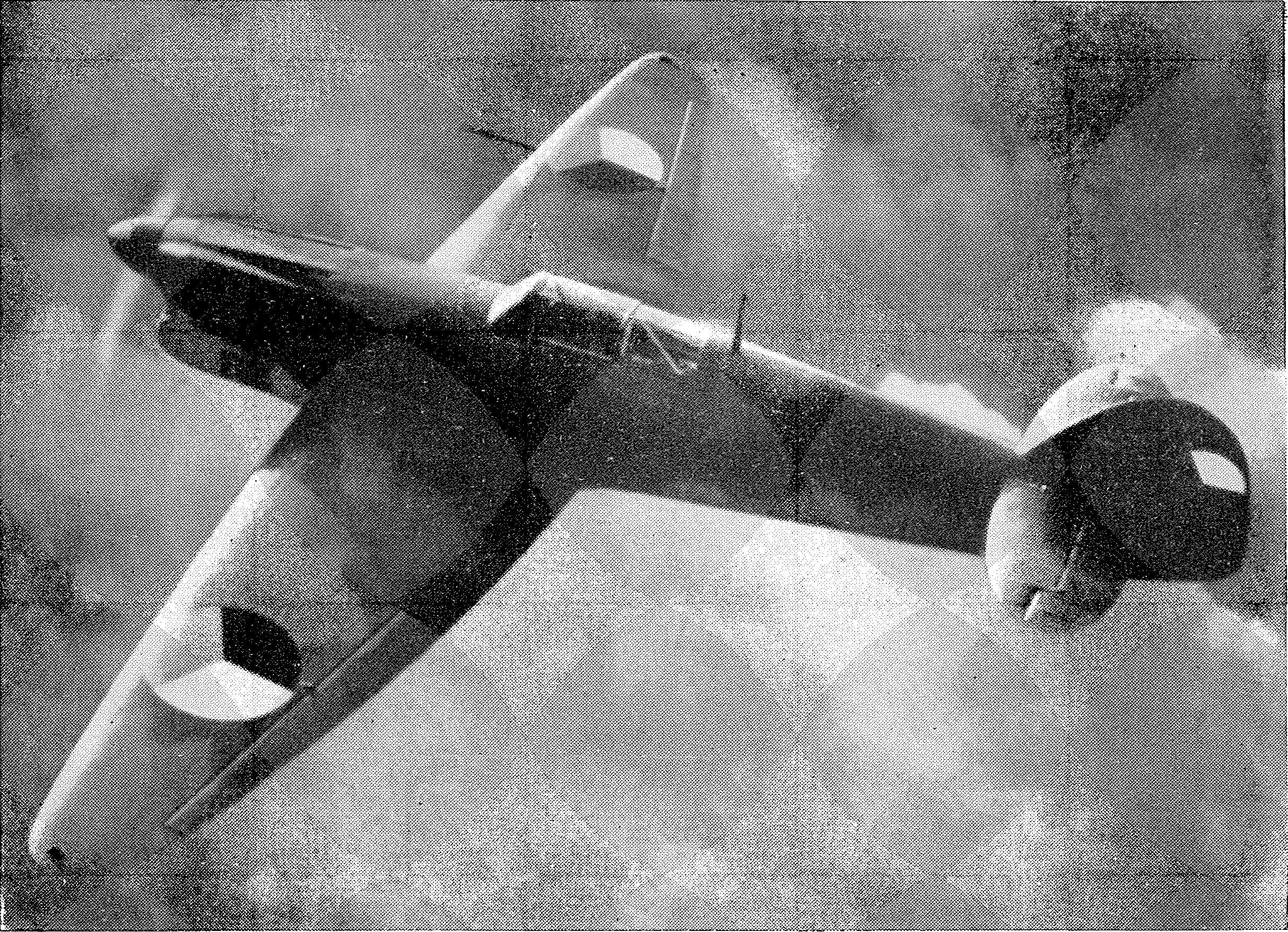
435 km/h, in 4500 m Höhe 495 km/h. Steigzeit auf 4000 m in 4 min 40 sec.
Ausführung B mit Motor YCrs, Metallschraube, Qlycolkühlung, hochziehbarem Fahrwerk. Max. Geschwindigkeit 535 km/h. Ausführung C mit Motor Avia HS 1200 PS, max. Geschwindigkeit 560 km/h.
Spannweite 10,85 m, Länge 8,50 m, Höhe 2,60 m, Fläche 17 m2. Leergewicht 1690kg Nutzlast, Flugzeugführer und Betriebsstoff 510kg, Fluggewicht 2200 kg, mit Ueberbelastung 2490 kg. Sicherheitskoeffizient 14.
Engl. Hawker Henley.
Hawker Henley haben wir bereits im Flugsport 1937, Seite 202, unter der Bezeichnung P/4, und 376 und ein neueres Bild Flugsport 1939, S. 167, gebracht.
Dieser Typ, 4fTT\ —r—
früher als Leichtbomber bezeichnet, wurde längere Zeit geheim
gehalten und jetzt, nachdem er nur noch als
Zielscheiben-Schlepper verwendet wird, ist er zur Veröffentlichung freigegeben.
Flügelprofil I Clark YH, 20% V Dicke an der
Wurzel und 12,2% an den Enden. Anstellwinkel 1,5°. Flügel dreiteilig. Holme Stahlträ-
Engl. Hawker Henley Leichtbomber.
Zeichnung Flugsport
ger aus DTD 138 Stahl. Rippen Duralumin. Metallbedeckung nichttragend. Spreizklappen zwischen Rumpf und Querruder.
Rumpf Kräfte aufnehmender Teil Stahlrohr- und Alumin-Gemischt-konstruktion. Formgebung aufgelegtes Holzgerippe mit Leinwand bedeckt, vorn Leichtmetallbedeckung.
Höhen- und Seitenleitwerksflossen und Ruder Leichtmetall, leinwandbedeckt, Trimmklappen. Am Boden verstellbar.
Fahrwerk nach innen hochziehbar. Ebenso Schwanzrad.
Rolls-Royce Merlin II Zwölfzylinder flüssig gekühlter V-Motor. Startleistung 880 PS, max. Flugleistung 1030 PS in 4960 m. Normale Geschwindigkeit (67%) 690 PS in 4750 m. Dreiblatt De Havilland-Hamilton-VerStellschraube. Vier Betriebsstofftanks, zusammen 930 1 Betriebsstoff fassend, zwei an jeder Rumpfseite im Mittelstück. Oel-tank im Rumpf.
Spannweite 14,6 m, Länge 10,81 m, Höhe 3,58 m, Fläche 31,75 m2. Leergewicht 2620 kg, Ausrüstung 109 kg, Besatzung 182 kg, Betriebsstoff 680 kg, Höchstgeschwindigkeit in 5000 m Höhe 438 km/h, Reisegeschwindigkeit mit 67% Motorleistung in 4570 m Höhe 380 km/h, Landegeschwindigkeit 105 km/h. Steigfähigkeit auf 6100 m in 19,4 min. Gipfelhöhe 8250 m, Aktionsradius mit 67% Leistung 1530 km.
Franz, Jagdeinsitzer Loire-Nieuport 210.
Der Loire-Nieuport 210, gebaut von der S. N. C. A. Ouest, hat Anfang dieses Jahres seine Katapult-Typenprüfung gemacht. Die Prüfungen zeigten gutes Verhalten beim Ab- und Anwässern, auch bei stärkerem Seegang.
Ganzmetallbauweise.
Ein großer Zentralschwimmer mit zwei seitlichen Stützschwimmern. Am hinteren Ende des Zentralschwimmers Wasserruder, ermöglicht gute Manövrierfähigkeit. Halbkreisförmiger Querschnitt Sechs wasserdichte Schotten. Unterseite stark gekielt. Eine Stufe, Schwimmerheck stark hochgezogen. An der Hinterseite vier Befestigungsösen für den Katapultstart.
Seitliche Stützschwimmer formähnlich wie der Zentralschwimmer. Eine Stufe, drei wasserdichte Schotten. Die Stützschwimmer bilden ein Stück mit den Ansatzflügeln und werden auch mit diesen abmontiert.
Tiefliegender Flügel, Rechtecksform, dreiteilig, die Ansatzflügel leicht V-förmig gestellt. Flügel zwei Kastenholme, das Mittelstück ab-
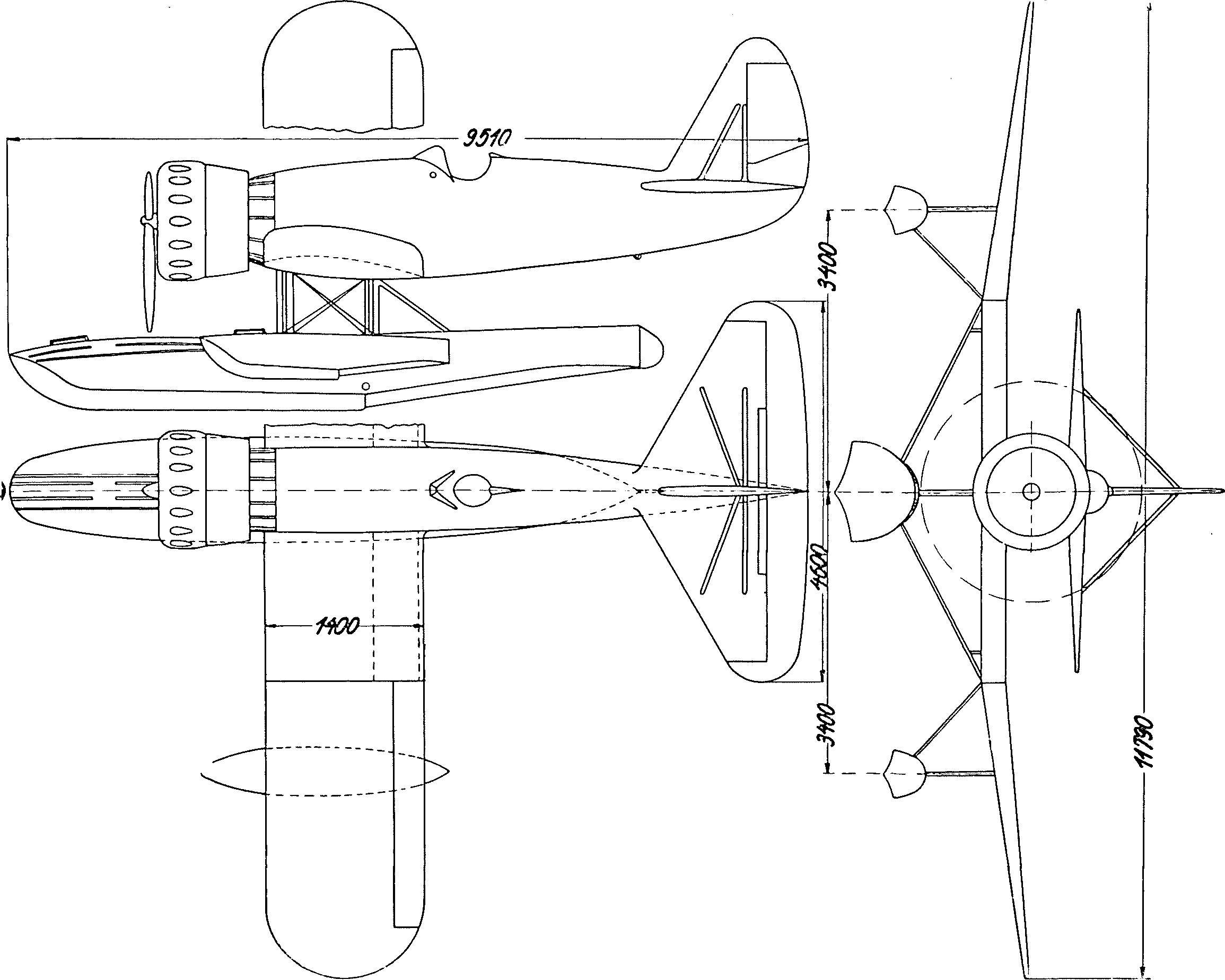
gestrebt, daher
torsionssteif. Landeklappen
über das ganze
Mittelstück. Querruder an den Ansatz-
flügeln.
Rumpf Metall-
bauweise, vier Längskasten-
holme mit Zwischenverstei-
fungsgliedern.
Franz. Katapult-Jagdeinsitzer Loire-Nieuport 210..
Zeichnung Flugsport
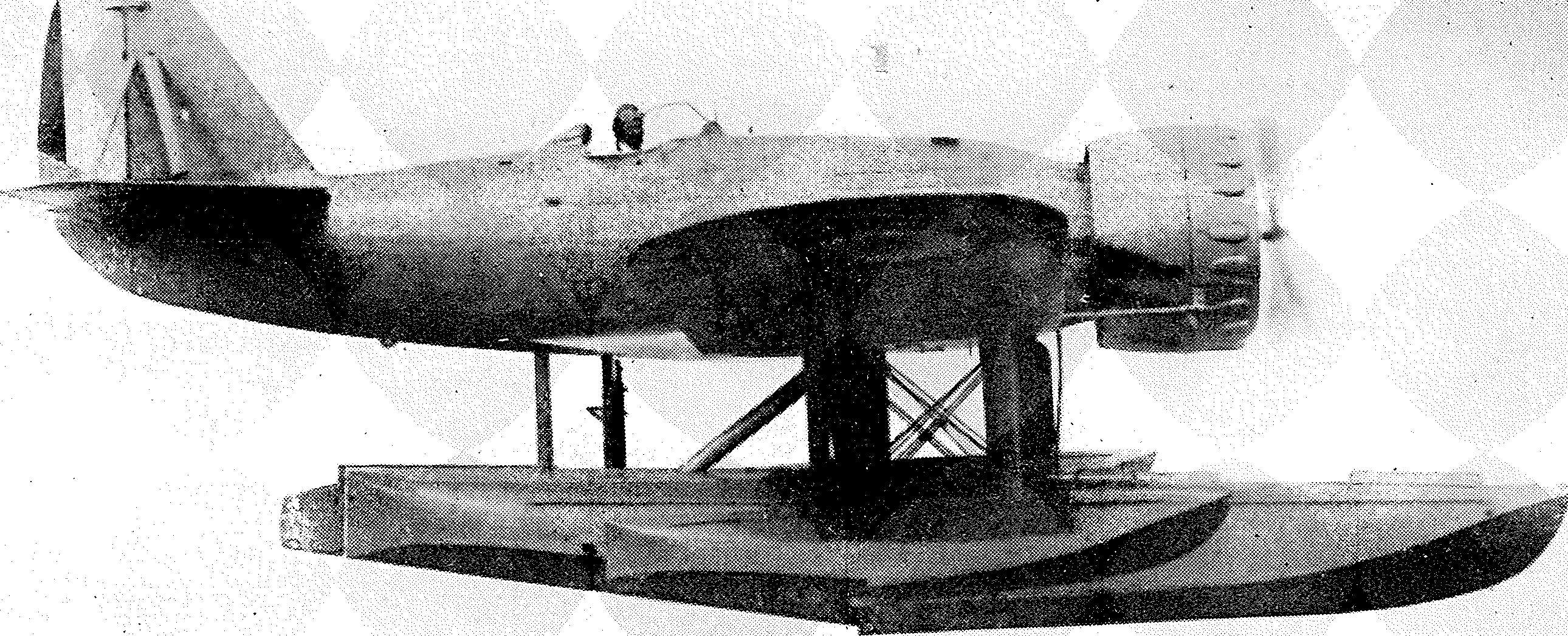
Franz. Jagdeinsitzer Loire-Nieuport 210. Werkbild
Motor Hispano Suiza 9 Vsb von 720 PS. Dreiblatt Verstellschraub e.
Ausrüstung außer den wichtigsten Bordinstrumenten solche für den Katapultstart und Gebe-Empfangsstation. Vier MG.'s.
Spannweite 11,79 m, Länge 9,51 m, Fläche 20,26 m2, Höhe 3,73 m. Leergewicht 1638 kg, normales Fluggewicht 2100 kg, höchstzulässiges Gewicht 2150 kg, Flügelbelastung 104 kg/m2, Leistungsbelastung 2,95 kg/PS. Geschwindigkeit in 3000 m Höhe 310 km/h, Landegeschwindigkeit 105 km/h. Steigfähigkeit auf 3000 m in 5 min 19 sec. Aktionsradius bei Windstille 750 km, Startzeit 9 sec.
Avia 158, Zweimotor.
Avia 158 ist ein zweimotoriges Bomben- und Fernaufklärungsflugzeug, konstruiert von Ing. Dr. Nebesar, Bau Avia A. G. für Flugzeugindustrie, Prag.
Flügel Dural-Schalenbauweise. Landeklappen, hydraulischer Antrieb. Querruder System „Friese", statisch ausgeglichen, mit Stoffbespannung.
Rumpf Dural-Halbschalenbauweise. Anordnung der Bombenkästen und Ausrüstung im Rumpf gewährt bequemen Verkehr der Besatzung miteinander.
Leitwerk mit zwei Kielflossen in Dural-Schalenbauweise. Höhen-und zwei Seitenflossen aus Dural-Gerippe, mit Stoff bespannt.
Fahrwerk und Spornrad einziehbar, hydraulische Betätigung. Ausfahren automatisch durch Preßluft. Einziehen sowie auch Ausfahren - im Notfall durch Handölpumpe.
Als Bomber 4 Betriebsstoffbehälter je 205 1 im Mittelteil des Flügels, als Fernaufklärer noch 2 Zusatzbehälter je 320 1 im Rumpf an Stelle der Bombenkästen. Außerdem können in den Außenflügeln noch 2 Behälter untergebracht werden. 2 Oelbehälter je 45 1 hinter den Motoren.
Besatzung als Bomber: Flugzeugführer, Beobachter, Schütze; als Fernaufklärer noch ein Schütze rückwärts nach unten.
Bomber-Bewaffnung: 1 bewegliches MG. nach vorn sowie nach hinten, 6 Bombenkästen im Rumpf, insgesamt 500 kg Bombenlast. 700 Geschosse, 6 Lichtbomben, Raketenpistole mit 20 Raketen. Als Ueberlast eine weitere 500 kg-Bombe oder zwei Bomben zu je 200 kg unterhalb des Rumpfes.
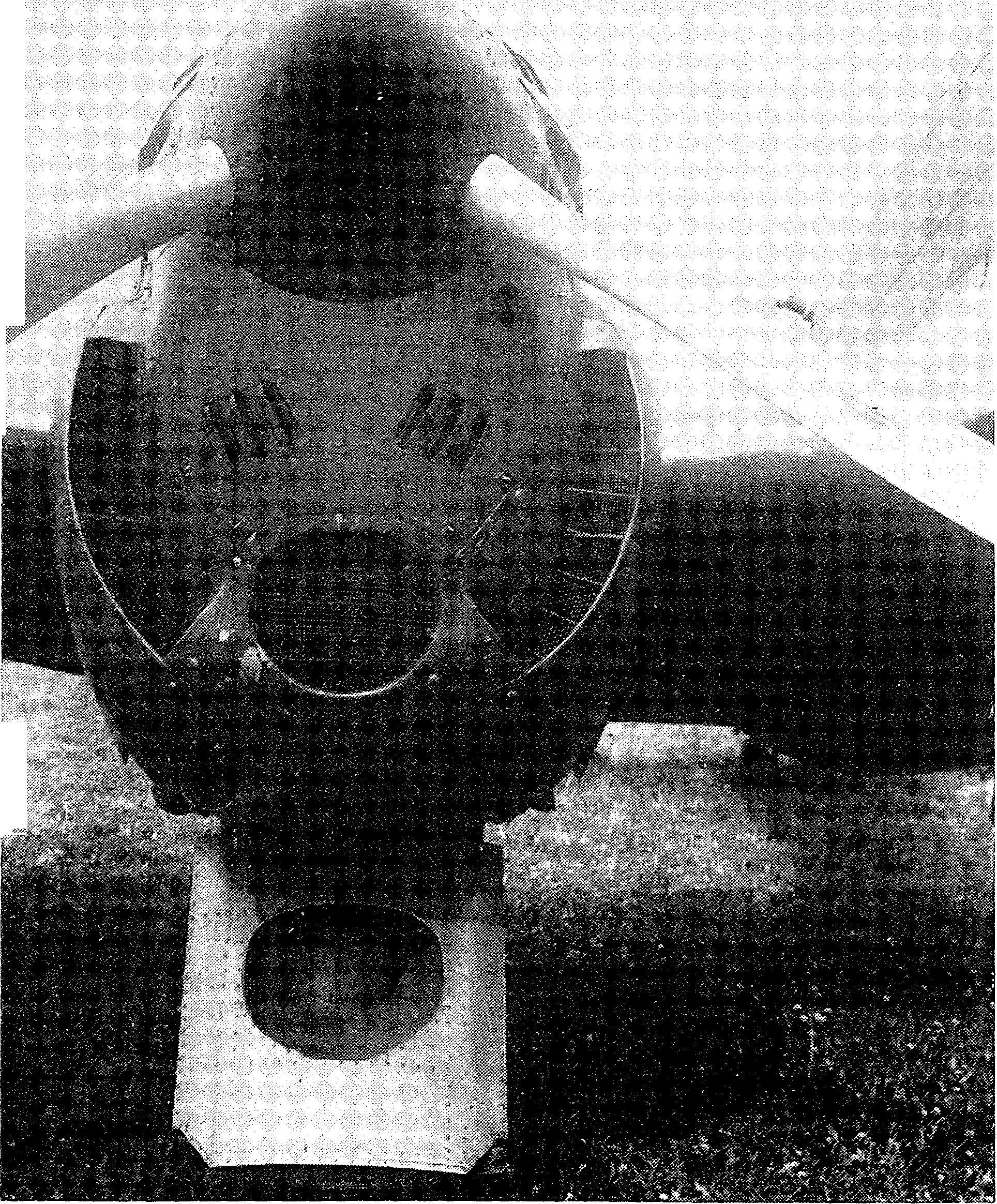
Avia 158. Anordnung der Kühler. Hochziehbares Fahrwerk mit Deckblech.
Werkbild
Fernaufklärer: Außer den zwei MG.'s des Bombers noch ein weiteres MG. für den Schützen rückwärts nach unten, zusammen 1000 Geschosse, 10 Lichtbomben. Abwerfen der Bomben pneumatisch.
Zwei Motoren Avia HS 12 YCrs, Leistung je 860 PS in 3600 m Höhe.
Dreiflügelige Luftschraube Hispano-Suiza-Hamilton mit im Fluge einstellbaren Schraubenblättern und automatischer Regulierung der konstanten Drehzahl.
Unten: Avia 158.
Werkbilder
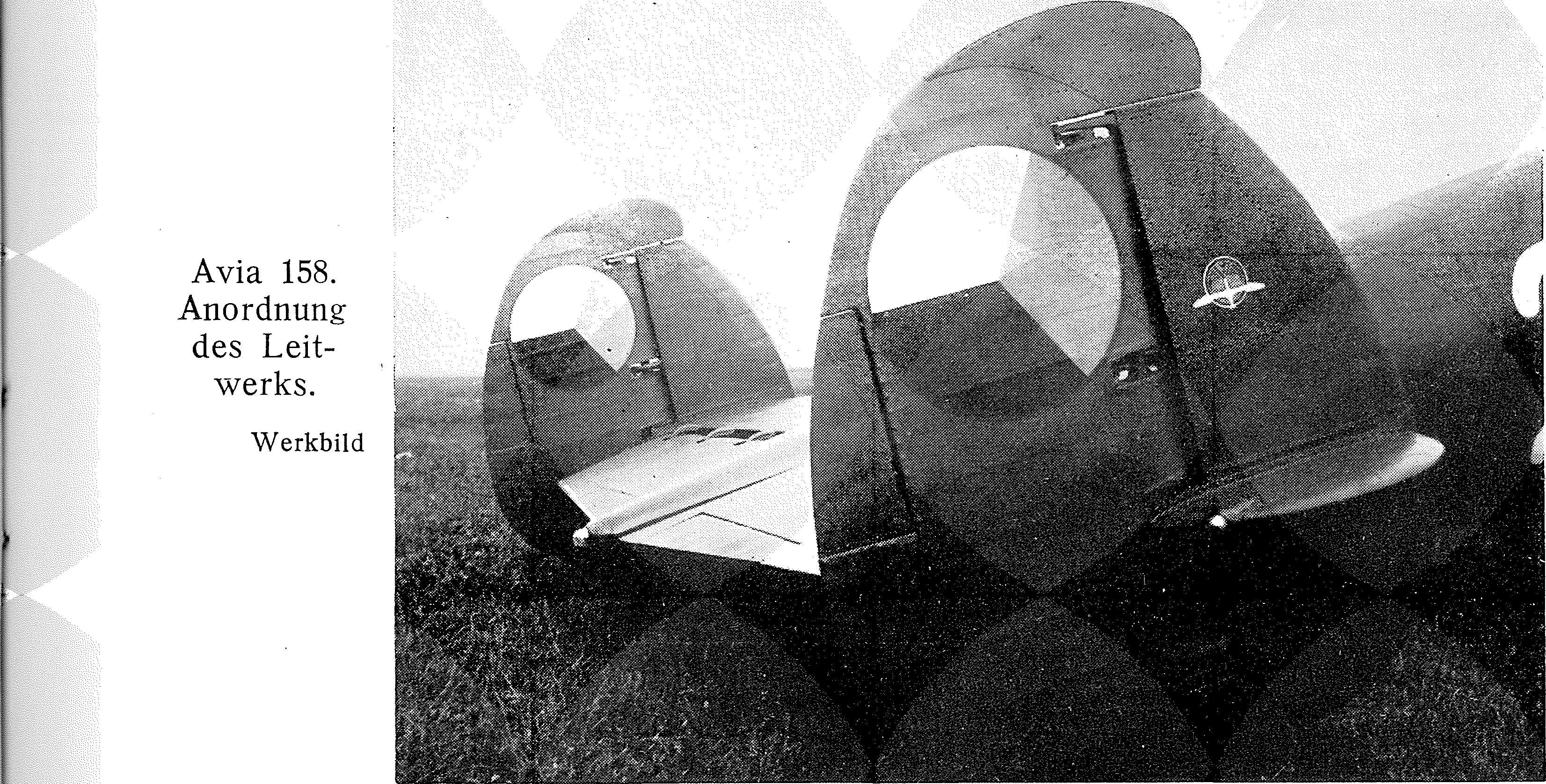
Spannweite 16 m, Länge 12 m, Flügelinhalt 42,7 m2. Fluggewicht (Bomber) 6600 kg, Höchstfluggewicht (Bomber mit Ueberlast) 7260 kg (Fernaufklärer 7000 kg).
Höchstgeschw. am Boden (Bomber b. Fluggewicht) 365 km/h, in 4500 m Höhe 435 km/h, Startlänge 210 m, Auslauf 300 m, Steigzeit auf 5000 m 11 min, praktische Gipfelhöhe 8500 m, Reichweite bei Vollgas 600 km (als Fernaufklärer 1100 km), Reichweite bei Reise-geschw. 1000 km (als Fernaufklärer 1850 km).
Die angeführten Leistungen gelten für die Werkstattausführung
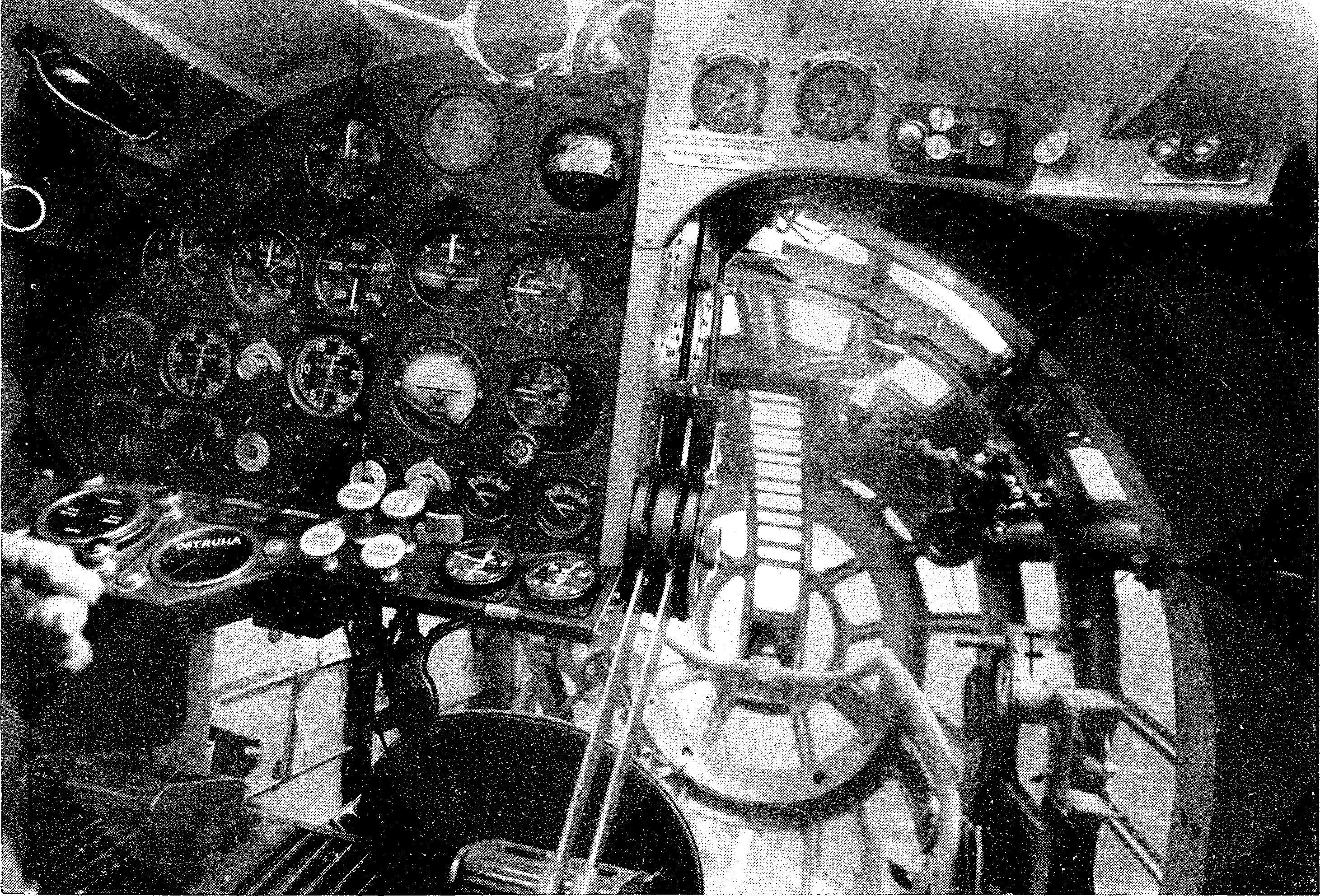
Avia 158. Reclits Blick in die Rumpfuase mit MG-Stand, links Instrumentenbrett.
Werkbild
i j
des Typenmusters mit gewöhnlicher Bekleidungsnietung und Blechüberlappung. Bei der Ausführung mit versenkter Nietung und glatter Oberfläche sinken die Reibungswiderstände erheblich. In diesem Falle ist es möglich, Geschwindigkeiten über 460 km/ h zu erzielen.
Das erzielte Lastvielfache im I. Flugfalle beträgt 8,75, die errechnete Geschw. im III. Flugfalle 609 km/h, die kritische Geschw. des Flügels und des Schwanzleitwerks ist höher als 700 km/h.
Boeing 307, Höhenverkehrsflugzeu?.
Durch den Unfall des Boeing 307-Höhenverkehrsflügzeugs über dem Staat von Washington, vgl. Flugsport 1939, S. 191, ist die Aufmerksamkeit der Fachkreise erneut auf diesen Typ gelenkt worden. Ueber die Ursachen des Unfalles sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.
Von diesem Typ sind noch mehrere im Bau. Der Unterdruckraum des Flugzeugrumpfes ist in Vorversuchen studiert worden. So wurden diese Räume am Boden 60mal wechselnd unter Druck gesetzt, welcher der Druckdifferenz im Höhenfluge entspricht. Hierbei zeigten sich keine Ermüdungen der Dichtstellen. Allerdings sind die Beanspruchungen im Höhenflug infolge der Temperaturdifferenzen und anderen nicht genau die gleichen. Bei diesen Druckversuchen wurde die Kabine mit der vorgeschriebenen Fluggast-Besatzungszahl und der Fracht belastet und gleichzeitig die Ventilationseinrichtungen, die Drucklufterzeugeranlagen und anderes mehr geprüft, wobei auch Vergleichsmessungen an Instrumenten innerhalb und außerhalb der Kabine durchgeführt wurden.
Nebenstehende Abbildungen geben einen Einblick in die Montagewerkstätten und über die Art und Weise der Dichtigkeitsprüfungen der Kabine.
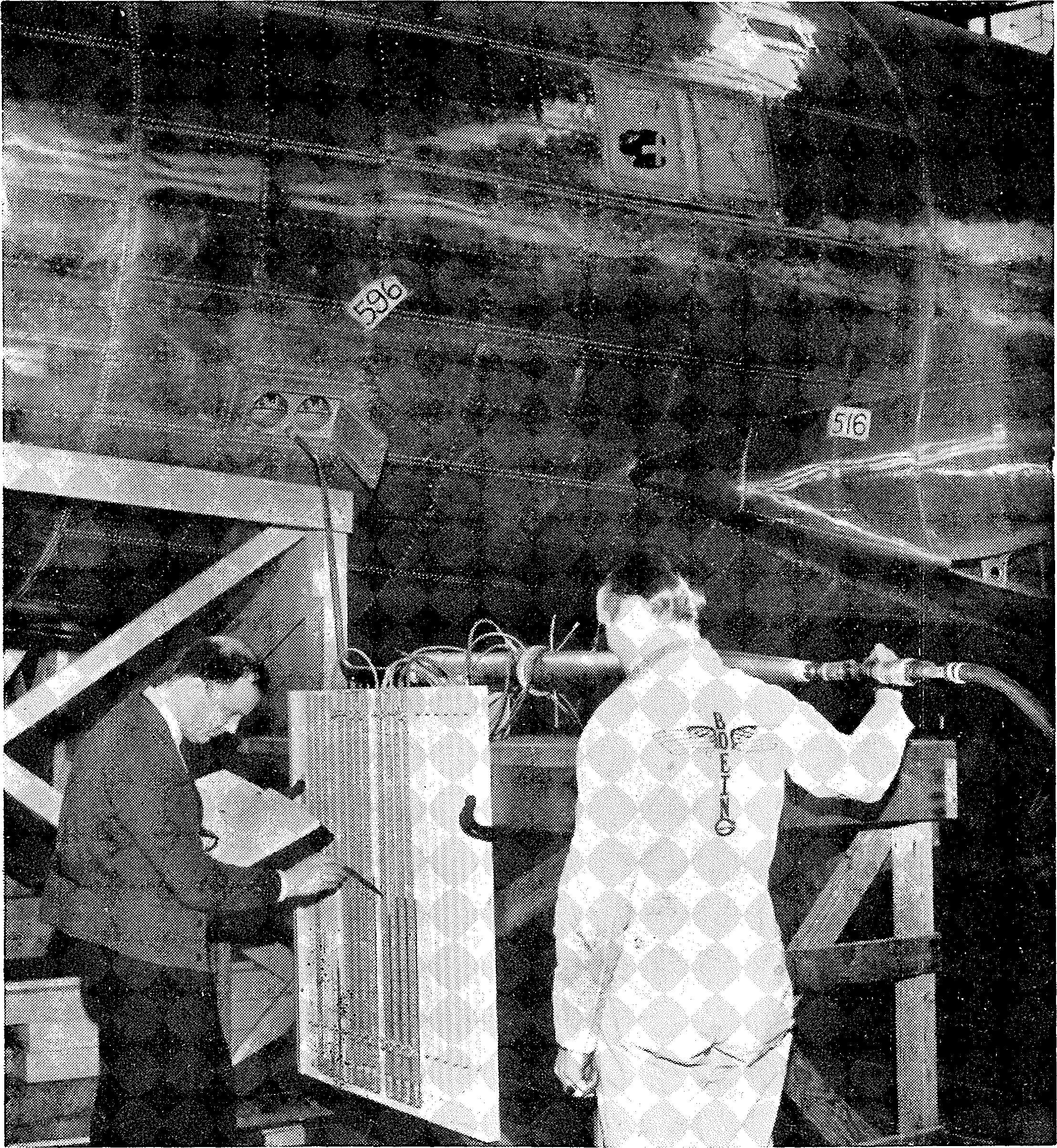
Boeing 307 Höhenverkehrsflugzeug. Prüfung der einzelnen Abteile auf ihre Luftdichte. Auf einer Tafel sind die Standrohrmanometer nebeneinan-
der befestigt.
Werkbild!
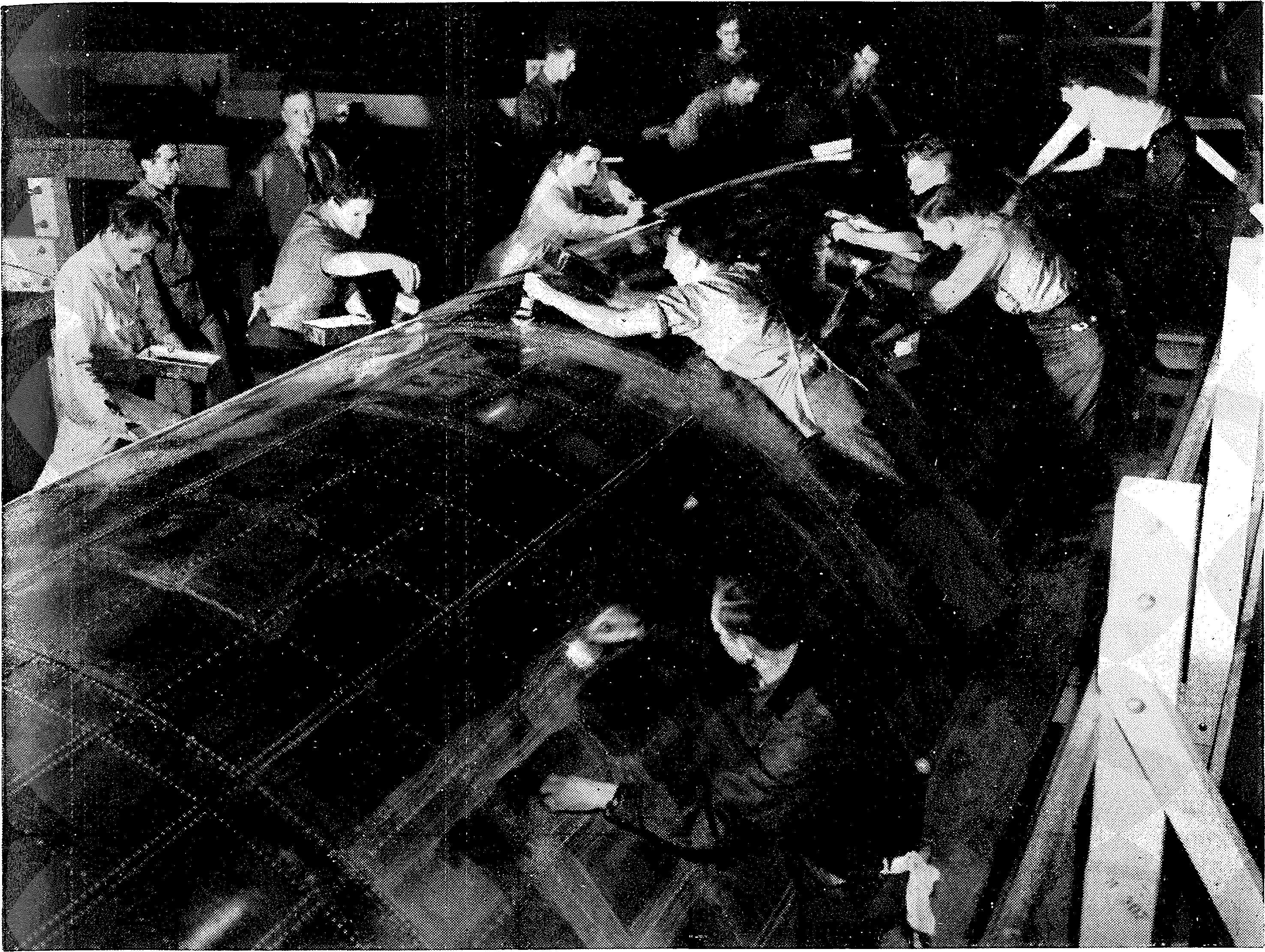
Boeing- 307 Höhenverkehrsflugzeug. Um die Kabine auf Luftdichte zu prüfen, wird die Außenhaut mit Schmierseife bestrichen und das Innere unter Druck gesetzt.
An den undichten Stellen bilden sich dann Seifenblasen. Werkbild

Boeing 307 Höhenverkehrsflugzeug für 33 Fluggäste, Besatzung 4 oder 5, Gleichdruckhöhe 6000 m, von welchem 3 Stück fertiggestellt werden, werkbiid

FLUG
UMBCHÄ
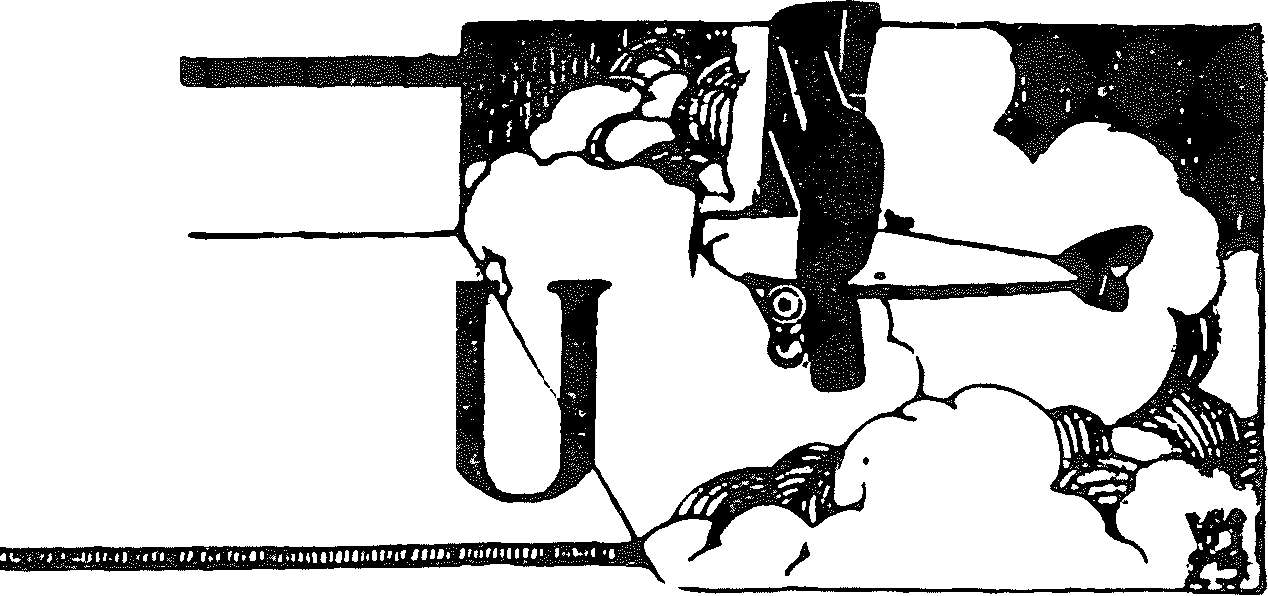
Inland.
Deutschlandflug 1939 findet, wie General der Flieger, Christiansen, mitteilt, nicht statt. Hierfür sind vier größere regionale Flugwettbewerbe geplant. Zu diesen gehören der Küstenflug an der Nordsee und in der Ostsee mit Start in Rangsdorf. 1940 wird der Deutschlandflug dann in vergrößertem Umfang durchgeführt werden.
Luftwaffe-Beförderungen mit Wirkung vom 1.4.39 zum Kommandeur der Luftkriegsakademie General der Flieger Volkmann, zum Kommandeur der Höheren Luftwaffenschule Generalmajor Bieneck. Mit dem 31. März sind General der Flieger von Stülpnagel, Kommandeur der Luftkriegsschule, unter Verleihung des Rechtes zum Tragen der Liniform der Luftkriegsakademie, und Generalleutnant Quade, Kommandeur der Höheren Luftwaffenschule, mit dem Charakter als General der Flieger und unter Verleihung des Rechtes zum Tragen der bisherigen Uniform, aus dem aktiven Wehrdienst ausgeschieden.
Hauptm, v. Moreau f ist am 31. 3. während eines Probefluges tödlich verunglückt. Frhr. v. Moreau, 1910 in München geboren, widmete sich nach Besuch der Technischen Hochschule ganz der Fliegerei. Man erinnert sich noch seiner Flüge mit der Ju 52 nach Afrika, wo er zum erstenmal Zentralafrika überquerte. Später gehörte er der Besatzung des „Condor"-Flugzeuges an, welches den ersten Flug Berlin—New York und zurück ausführte. Auch an dem Flug Berlin—Tokio, mit welchem 4 internationale Rekorde für Deutschland verbucht wurden, hat er teilgenommen. Der Führer hat den Eltern des Fliegerhauptmanns von Moreau telegraphisch sein Beileid ausgesprochen.
Luftschutz, DIN 4063. Hinweisschilder, Luftschutz (Träger: Ausschuß zur Normung der Hinweisschilder. Anerkannt vom Reichsluftfahrtministerium) vom Deutschen Normenausschuß herausgegeben (Beuth-Vertrieb, Berlin SW 68).
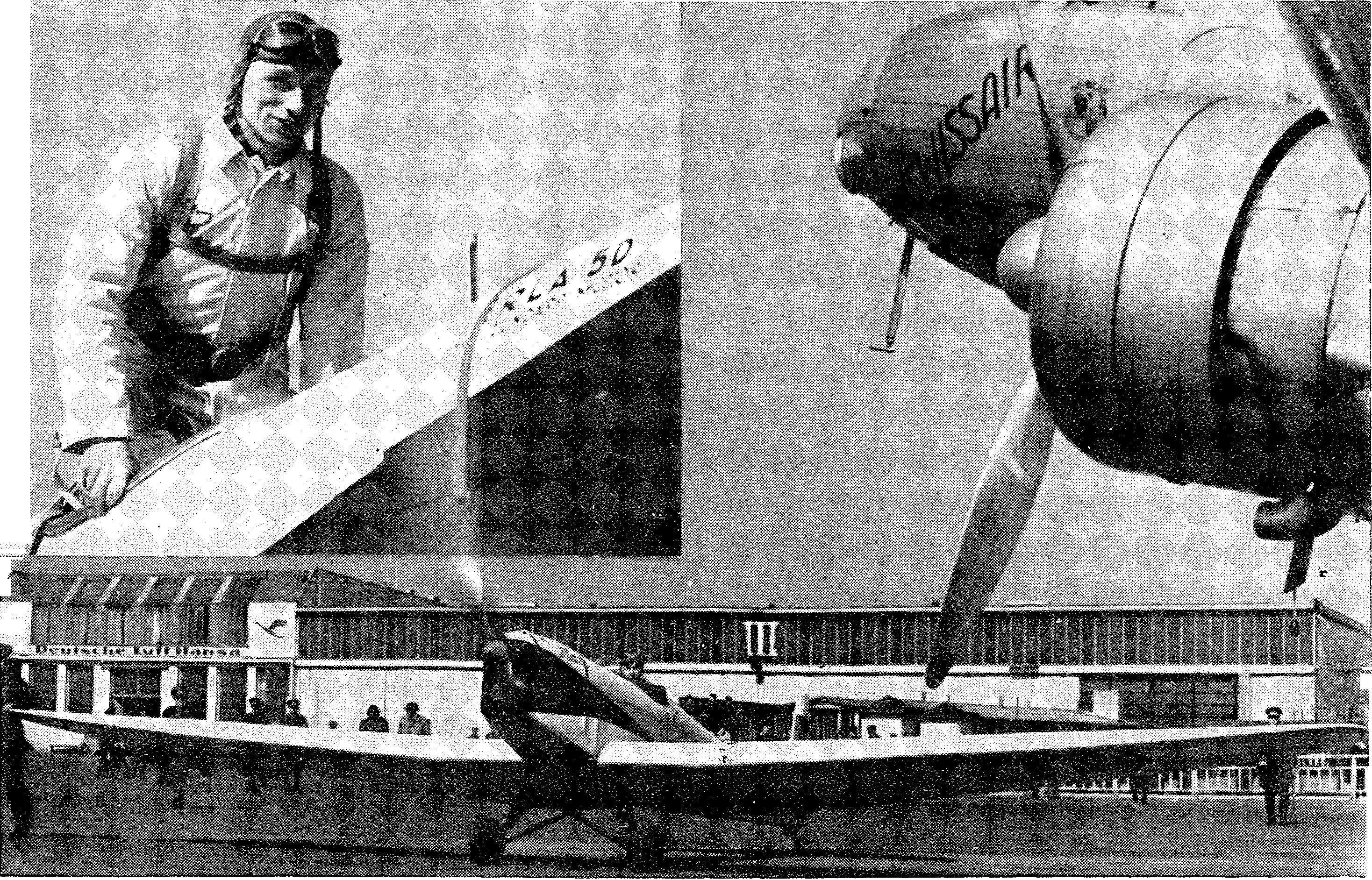
„Erla 5 D" deutsches Kleinflugzeug, Führer Auffermann, startete am 1. 4. von dem Flughafen Tempelhof zu einem Fluge nach Kairo. (Betriebsstoffverbrauch 7 1 auf 100 km, Höchstgeschwindigkeit 160 km, Reise 140 km.)'5 Weltbild
Was gibt es sonst Neues?
Zahn, Gruppenführer Gruppe 3 (Nordwest) des NS-Fliegerkorps, Hamburg. Soaring, die USA-Segelflugzeitschrift, Herausgeber jetzt Henry N. Wightman. Royal Air Force, am 1. 4. 1918 gegründet, besteht 21 Jahre, demnach jetzt majorenn.
Ausland.
Engl. Flugzeugträger „Ark Royal", 22 000 t, für 60 Flugzeuge, wurde kürzlich in Dienst gestellt. Mit diesem besitzt England jetzt 11 Flugzeugträger. Vier von 23 000 t: „Illustrious", „Victorious", „Formidable" und „Indomitable". Die bereits länger bestehenden sind: „Glorious", „Furious", „Courageous", „Hermes" und „Eagle". Dazu kommt noch der Seeflugzeugträger „Albatross". Fassungsvermögen sämtlicher Flugzeugträger mehr als 500 Flugzeuge.
King's Cup Rennen = Headache Race (Kopfweh-Rennen) in engl. Fliegersprache getauft (entstanden durch die vielen Berechnungen zwischen den einzelnen Rennen). Vorversuche zum King's Cup voraussichtlich am 2. oder 9. 9. Birmingham Flughafen Elmdon wird am 8. 7. eröffnet.
Franz. Volksfliegerei aufgelöst. Laut Notverordnung wird diese der Ausbildung und Organisation der französ. Luftwaffe unterstellt. Sechzehnjährige müssen sich auf drei Jahre verpflichten; ein Jahr technische, zwei Jahre vormilitärische Ausbildung.
Französ.-engl. Flugzeugproduktionsteilung will Luftminister Guy la Chambre, welcher nach London gereist ist, durchsetzen. Motoren soll England liefern und Frankreich gewisse Flugzeugzellen englischer Konstruktion. Ferner soll eine Aufstellung der franz. und engl. Rohstoffvorräte durchgeführt werden.
Rom—Addis Abeba-Geschwindigkeitsflug 4500 km ist ein Preis von der „Popolo d'Italia" ausgeschrieben, wer diese Strecke in kürzester Zeit durchfliegt. Ein paar Tage nach der Ausschreibung starteten zwei ital. Besatzungen. Leonardo Bonzi und Giovanni Zappetta auf Nardi F. N. 305 D und Giuseppe Mazzotto und Ettore Valenti auf Fiat Br. 20 L. Start der ersten Gruppe 17.10 h von dem Flughafen Guidonia bei Rom, Flugzeug Nardi F. N. 305 D, Motor Fiat A. 70 mit 180 PS, Leergewicht 650 kg, Zuladung 1050 kg, ohne Funkortung, überflogen nachts das Mittelländische Meer und Teile der Wüste Sahara und landeten in Addis Abeba am 6.3. um 13.59 h. Flugzeit 18 h 49 min, Durchschnittsgeschwindigkeit 240 km/h.
Start der Fiat BR. 20 L am 6. 3. 22.25 h in Guidonia. Der Fiat BR. 20 ist die Verkehrsausführung des Fiat BR, 20 Militärtyps. Ganzmetall-Zweimotor-Tiefdecker mit hochziehbarem Fahrwerk. Leergewicht 6400 kg Nutzlast 3500 kg mit Zusatz-tanks für diesen Flug. Führer Maner Lualdi, zwei Fluggäste, ein Mechaniker und ein Funker. Flughöhe 4500 m. Ankunft Addis Abeba 7.3. 11.05 h. Geschwindigkeit 400 km/h, Flugdauer 11 h 25 min.
Ambrogio Colombo t, in Spanien erfolgreicher ital. Flieger, früher Versuchspilot bei Breda, bei Versuchsflug mit einem neuen Typ bei Castiglione verunglückt.
Rom—Buenos Aires-Luftverkehrsvertrag der Ala Littoria mit Argentinien abgeschlossen. Wöchentlich einmal hin und zurück.

USA Lockheed XP—38 Jagdflugzeug, bei Probeflug zu Bruch gegangen.
Bild: Aviation
Jendrassik Gasturbine, Budapest, im Versuch 100 PS bei 16 400 U.
Lockheed XP-38 Jagdflugzeug, bisher geheim gehalten. Jagdeinsitzer, zwei flüssig gekühlte Allison-Motoren mit auspuffbetriebenen Kompressoren, von je 1000 PS mit zwei seitlichen Rümpfen, Dreiradfahrwerk. Schulterdecker mit dünnem Flügelprofil. Das Musterflugzeug ist nach einem Ueberlandflug auf dem Mitchell Field abgestürzt. Vgl. Abb. v. Lockheed.
USA Stearman X-100, gebaut von der Stearman Aircraft Division, Wichita, Kansas, 2 1400-PS-Pratt-&-Whitney-R-2180-Motoren, Dreiblatt-Verstellschraube. Spannweite 19,5 m, Länge 15,7 m, Höhe 3,6 m, Fluggewicht 9 t. Ganzmetallbau, Tiefdecker, hochziehbares Fahrwerk. Die Versuchsflüge sind beendet. Ueber Leistungen ist noch nichts bekannt.
Boeing-307-Stratosphären-Unfall. Wie bereits in der letzten Nummer berichtet, befanden sich unter den Opfern: Versuchspiloten von Boeing, Julius Barr, Doyle, Fergusson, Ingenieur Ralph Cram und Pearson, Verkaufschef der Firma, Harlan Hull, Chefpilot von „Transcontinental and Western Air", endlich Vertreter der K. L. M., M. Guionard, Mitarbeiter, P. Plesman, techn. Dir. der Ges., und Herr van Baumhauer.
Vega-Verkehrsflugzeug im Auftrag der Mid-Continent Airlines für den Preis von 30 000 $ im Bau. Ganzmetallbau, Motor Unitwin, 590 PS Startleistung, 5 Fluggäste. Reisegeschwindigkeit 290 km/h.
Argentin. Luftverkehrsges. Corp. Sudamericana de Servicios Aereos, Buenos Aires, ist, in Zusammenarbeit mit der gleichfalls neu gegründeteten „CAUSA" (Corporacion Argentina—Uruguay Servicios Aereos), in Betrieb genommen worden. Die Gesellschaft versieht den täglichen Passagier- und Luftpostdienst zwischen Buenos Aires und Montevideo (Uruguay). Zur Verwendung gelangen vier dreimotorige Junkers-Wasserflugzeuge und zwei zweimotorige „Macchi 94"-Flug-boote mit Alfa-Romeo-Sternmotoren 800 PS. In allernächster Zeit soll die Gesellschaft ihren Passagier- und Frachtdienst nach Paraguay und Brasilien erweitern, wozu in Europa mehrere Großwasserflugzeuge von 3300 PS für 30 Fluggäste in Auftrag gegeben worden sind.
Austral. Clyde Engineering Co. Ltd., Sydney, will ihrem Betrieb Flugzeugbau angliedern. Vertragsabschluß mit der Aircraft Development Co. Ltd., welche Armstrong Siddeley, Airspeed, Phillips & Powis und Heston Aircraft Co. in Australien vertritt. Fabrikflugplatz vorgesehen.
Short Brothers Australien Filialwerk am Macquarie-See (Neusüdwales) geplant.
Segelflug
Segelflug bei der Luftwaffe.
Segelfluggelände des NS.-Fliegerkorps wird für den Segelflugbetrieb der Luftwaffe, wie die „Luftwelt" mitteilt, nach Vereinbarungen mit dem Korpsführer des NSFK zur Verfügung gestellt. Bereits bei den großen Segelflugwettbewerben auf der Wasserkuppe saßen in den vergangenen Jahren mehrfach Luftwaffenangehörige in den Wettbewerbsmaschinen als Führer. Der Gleit- und Segelflugbetrieb in der Luftwaffe ist nunmehr durch besondere Richtlinien geregelt worden. Danach dient der Segelflugsport der Luftwaffe in erster Linie als Ausgleich für den ausschließlichen Bodendienst des nichtfliegenden Personals. Die Zusammenfassung der gleit- und segelflugtreibenden Angehörigen der Luftwaffe innerhalb der Dienststelle geschieht im Rahmen einer Segelfluggruppe.
Soldaten, Beamten, Angestellten und Arbeitern, die sich durch besonderen Diensteifer auszeichnen, und die das notwendige Interesse aufbringen, soll in erster Linie Gelegenheit zur Ausübung des Segelflugsportes gegeben werden. Bereits im Motorflug fliegerisch tätiges Personal (militärisches und ziviles) soll bei Eignung hauptsächlich als
Segelfluglehrer oder Schleppflugzeugführer Verwendung finden. Gegen eigene segelfliegerische Betätigung zur Erhaltung und Vervollkommnung der Kenntnisse bestehen keine Bedenken. Auch an Segelflugwettbewerben kann teilgenommen werden.
Die zivilen Angehörigen der Segelfluggruppen der Luftwaffe, also Arbeiter und Angestellte, müssen nach den Bestimmungen dem NS.-Fliegerkorps angehören. Selbstverständlich ist der Eintritt in die Segelfluggruppen freiwillig. Die Ausbildung erfolgt nach der Dienstanweisung für Segelflug, die der Korpsführer des NS.-FIiegerkorps herausgegeben hat.
Wettbewerbsausschreibung Ähön-Segelflug-Wettbewerb 1939 des NS.-FIiegerkorps
(20. Rhön). (Schluß von Seite 196).
Die Meldung der Bewerber zu 13 a) muß bis zum 9. Juni 1939, 12 Uhr, als Einschreiben bei der für die Bewerber zuständigen NSFK.-Qruppe eingegangen sein. Die NSFK.-Gruppen reichen die Meldungen als Einschreiben bis zum 12. Juni 1939 dem Korpsführer des NS.-FIiegerkorps ein.
Die Meldungen der Bewerber zu 13 b) sind als Einschreiben an den Korpsführer des NS.-FIiegerkorps zu richten und müssen bis zum 12. Juni 1939 beim Korpsführer des NS.-FIiegerkorps vorliegen.
Die Teilnahme der Luftwaffensportvereine wird von dem Korpsführer des NS.-FIiegerkorps mit dem Herrn Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe geregelt. Entsprechend dieser Regelung werden die in Frage kommenden Bewerber zur Meldung aufgefordert.
Ueber sämtliche Meldungen entscheidet der Korpsführer des NS.-FIiegerkorps. Die endgültige Annahme der Meldung wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt.
Es werden nur solche Meldungen angenommen, die vollständig und mit allen angeforderten Angaben eingereicht werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Meldungen als endgültig zu gelten haben. Der Korpsführer behält sich vor, unvollständige oder verspätete Meldungen zurückzuweisen und dafür andere Bewerber, die allen Vorbedingungen genügen, zuzulassen.
15. Durch Abgabe der Meldung erkennen die Bewerber die Ausschreibung und spätere vom Veranstalter oder seinen Beauftragten zu erlassende Bestimmungen als für sich und die Teilnehmer ihrer Mannschaften bindend an.
16. Alle Erklärungen minderjähriger oder unter Vormundschaft stehender Personen bedürfen der Anerkennung durch den gesetzlichen Vertreter. Die Verantwortung für die Erfüllung dieser Bedingung liegt beim Bewerber selbst. Der Veranstalter ist nicht zur Nachprüfung verpflichtet.
Beschränkung der Teilnehmerzahl.
17. Die Zahl der teilnehmenden Flugzeuge wird auf 60 beschränkt. Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung der Wettbewerbseignung der gemeldeten Flugzeuge und Flugzeugführer. Die Zahl der teilnehmenden Flugzeuge eines Bewerbers kann beschränkt werden. Die Auswahl der danach auszuscheidenden Flugzeuge bleibt dem Bewerber überlassen, der seine Entscheidung unverzüglich zu melden hat.
18. Zurückgewiesene Meldungen können bis zum Beginn des Wettbewerbes wieder aufgenommen werden, wenn sich die Teilnehmerzahl verringert. Segelflugzeugführer.
19. Zu dem in Punkt 14 angegebenen Meldetermin ist für jedes Segelflugzeug der Wettbewerbs-Segelflugzeugführer zu melden. Bei Doppelsitzern ist die Meldung für den ersten und zweiten Führer abzugeben. Die Meldung hat auf vorgeschriebenen Vordrucken zu erfolgen.
20. Für jedes Segelflugzeug kann nur ein Segelflugzeugführer (bei Doppelsitzern nur eine Besatzung) gemeldet werden. Die Meldung von Ersatz-Flugzeugführern ist nicht statthaft. Nach Ablauf des Meldetermines sowie während des Wettbewerbes kann auch eine Ummeldung oder Umbesetzung nicht vorgenommen werden.
21. Die Segelflugzeugführer müssen folgende Nachweise erbringen:
a) Besitz des silbernen Segelflieger-Leistungsabzeichens. (Diese Forderung entfällt für den Begleiter bei Doppelsitzern.)
b) Besitz eines über die Dauer des Wettbewerbes gültigen Luftfahrerscheines für Segelflugzeugführer mit eingetragener Schleppflugerlaubnis (auch für den Begleiter bei Doppelsitzern).
c) Besitz eines gültigen Reisepasses. Der Paß ist bei allen Flügen mitzuführen.
d) Besitz der Internationalen Sportlizenz für das Jahr 1939.
e) Minderjährige Segelflugzeugführer haben die schriftliche Erlaubnis des Vaters bzw. gesetzlichen Vertreters beizubringen (s. Punkt 16).
Segelflugzeuge.
22. Am Wettbewerb können nur Segelflugzeuge deutscher Herkunft teilnehmen, die über die Dauer des Wettbewerbes amtlich zugelassen sind. Segelflugzeuge, mit denen Höhenflüge über 4000 m über NN ausgeführt werden sollen, müssen mit betriebsklarem Höhenatmungsgerät ausgerüstet sein. Bei Doppelsitzern muß sich die Sauerstoffversorgung sowohl auf den ersten wie den zweiten Flugzeugführer erstrecken.
Die Mitnahme eines Fallschirmes ist Vorschrift.
Bei Doppelsitzern sind zwei Fallschirme mitzuführen.
Die Segelflugzeuge erhalten eine Wettbewerbsnummer, die an beiden Seiten des Seitenruders möglichst groß anzubringen ist. Der Veranstalter kann die Anbringung weiterer Unterscheidungszeichen vorschreiben. Zulassung der Segelflugzeuge.
23. Die Zulassung der Segelflugzeuge zum Wettbewerb erfolgt durch den Wettbewerbsleiter. Folgende Nachweise sind vorzulegen:
a) der amtliche Zulassungsschein für das Segelflugzeug,
b) der Zulassungsschein für Fallschirm und Fallschirmgurt,
c) eine Prüfbescheinigung.
24. Nach Annahme der Meldung werden die Segelflugzeuge in ihrem Heimatstandort durch einen vom Korpsführer des NS.-Fliegerkorps beauftragten technischen Prüfer auf ihren Bauzustand geprüft. Bei einwandfreiem Bauzustand bzw. nach Behebung vorgefundener Mängel wird die unter 23 c) geforderte Prüfbescheinigung ausgestellt. Die zum Wettbewerb gemeldeten Segelflugzeuge müssen zum 12. Juni 1939 prüffertig sein.
25. Beschädigungen oder Aenderungen eines zugelassenen Flugzeuges während des Wettbewerbes sind der technischen Leitung zu melden. Der Wettbewerbsleiter kann auf Grund eines Gutachtens der technischen Leitung aus Sicherheitsgründen die Zulassung eines Wettbewerbsflugzeuges aufheben und eine Nachprüfung anordnen.
Registriergerät.
26. Bei sämtlichen Wettbewerbsflügen ist ein Höhenschreiber mitzuführen. Die Höhenschreiber sind von den Bewerbern selbst zu stellen und müssen vor Beginn des Wettbewerbes von einem vom Veranstalter anerkannten Institut geeicht werden. Als solche Institute gelten:
a) die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, Berlin-Adlershof,
b) die Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug, Darmstadt, Flughafen.
Eine Eichung der Höhenschreiber auf der Wasserkuppe selbst kann nicht erfolgen. Es werden nur Höhenschreibgeräte mit Ruß schrieb (auf Papier oder Metallfolie) zugelassen.
Segelflugzeugführer, die keine oder keine geeichten Höhenschreiber auf ihren Flügen mitführen, setzen sich der Gefahr aus, daß ihre Flüge nicht gewertet werden.
27. Die Mitführung von zwei Höhenschreibern ist ratsam. In diesem Fall ist einer der beiden Höhenschreiber vor Antritt des Fluges als „maßgebender" Höhenschreiber zu bezeichnen. Der zweite Höhenschreiber gelangt nur zur Auswertung, wenn der „maßgebende" Höhenschreiber nicht richtig gearbeitet hat. Zur Beurkundung von Rekorden ist dies Vorschrift.
Aufstellung von Rekorden.
28. Segelflugzeugführer, die die Absicht haben, sich um die Anerkennung von Nationalen bzw. Internationalen Rekorden zu bewerben, haben für die Beurkundung sowie den Antrag auf Anerkennung selbst zu sorgen.
29. Bei Aufstellung von Rekorden muß das Höhenschreibgerät vor Antritt des Fluges dem Barographendienst zur amtlichen Aufbewahrung bis zum Start übergeben werden.
Klasseneinteilung.
30. Der Wettbewerb gelangt in zwei Klassen zur Durchführung: Klasse A: Einsitzer-Segelflugzeuge,
Klasse B: Doppelsitzig besetzte Segelflugzeuge.
Der Wettbewerb in der Klasse B findet nur dann statt, wenn wenigstens 10 Doppelsitzer gemeldet werden. Wird diese Zahl bei der Meldung nicht erreicht, so erhalten die Bewerber entsprechende Mitteilung. Unter diesen Umständen bleibt es den Bewerbern freigestellt, das doppelsitzige Segelflugzeug einsitzig besetzt zum Wettbewerb der Klasse A zu melden oder die Meldung durch ein Einsitzer-Segelflugzeug zu ersetzen. Die Meldung des für den Doppelsitzer genannten ersten Flugzeugführers bleibt dabei bestehen. Bewertung.
31. Die erflogenen Punkte werden dem Segelflugzeugführer (nicht Segelflugzeug) zugeschrieben. Die Bewertung der Leistungen erfolgt getrennt in den Klassen A und B nach Punkten. Es sind folgende Wertungsgruppen zu unterscheiden:
I. Streckenflüge,
II. Zielstreckenflüge,
III. Zielstreckenflüge mit Rückkehr zum Startort,
IV. Höhenflüge. Durchführung des Wettbewerbes.
32. Der Wettbewerb wird wie folgt durchgeführt:
a) Soweit vom Wettbewerbsleiter nicht anders bestimmt, können lediglich Streckenflüge (ohne Zielangabe) gemeldet werden.
b) Der Wettbewerbsleiter kann Wettbewerbstage bestimmen, an denen lediglich Zielflüge mit selbstgewähltem Zielort zugelassen sind. Hierbei müssen die Zielorte innerhalb eines Winkels liegen, der vor Startbeginn durch den Wettbewerbsleiter bekanntgegeben wird.
c) Der Wettbewerbsleiter kann Tage bestimmen, an denen ein bestimmter Zielort für alle Flugzeuge vorgeschrieben wird. An solchen Tagen können, außer den Zielflügen zu dem bestimmten Zielort, Zielstreckenflüge mit Rückkehr zum Startort sowie Verbandsflüge durchgeführt werden. Außerdem werden hierbei die Zielflüge mit kürzester Flugzeit mit Zusatzpunkten bewertet.
d) Der Wettbewerbsleiter kann als Tagesaufgabe Zusammenstellungen der unter a) bis c) genannten Möglichkeiten vornehmen.
Preise.
33. Die Reihenfolge der Bewerber in der endgültigen Bewertung ergibt sich aus den von den Segelflugzeugführern erflogenen Punktzahlen.
In Klasse A erhalten:
die 1.—3. Wettbewerbsmannschaft die Goldene Plakette des Korpsführers des NS.-Fliegerkorps mit Verleihungs-Urkunde,
die 4.—8. Wettbewerbsmannschaft die Silberne Plakette des Korpsführers mit Verleihungs-Urkunde,
die 9.—20. Wettbewerbsmannschaft die Bronzene Plakette des Korpsführers mit Verleihungs-Urkunde.
Alle übrigen Wettbewerbsteilnehmer erhalten die Erinnerungs-Plakette des Korpsführers.
In Klasse B (Doppelsitzer) erhalten:
die 1. Wettbewerbsmannschaft die Goldene Plakette des Korpsführers des NS.-Fliegerkorps mit Verleihungs-Urkunde,
die 2. Wettbewerbsmannschaft die Silberne Plakette des Korpsführers mit Verleihungs-Urkunde,
die 3.—4. Wettbewerbsmannschaft die Bronzene Plakette des Korpsführers mit Verleihungs-Urkunde.
Je nach der Anzahl der in der Klasse B teilnehmenden Flugzeuge kann durch das Preisgericht die Anzahl der Sieger-Plaketten für die Klasse B erhöht werden.
Geldpreise werden für den fliegerischen Wettbewerb nicht ausgeschrieben. Die Plaketten und Urkunden stehen als Ehrenpreise den Flugzeugführern bzw. Angehörigen der Mannschaften zu.
Außerdem können Sachpreise als Sonderpreise für besondere fliegerische Leistungen ausgegeben werden.
Punktabzüge.
34. Bei Bewertung der fliegerischen Leistungen im Wettbewerb werden denjenigen Segelflugzeugführern 10% der erflogenen Punktsumme abgezogen, die bereits:
mehr als 4000 km Ueberlandflugstrecke mit Segelflugzeugen aufweisen (bei
der Berechnung der Gesamtstrecke gelten alle Flüge über 30 km),
oder
an mehr als 3 Segelflug-Wettbewerben, die auf Leistungsflug ausgeschrieben waren, teilgenommen haben. (Hierzu gehören Rhön-Wettbewerbe, Zielstrecken-Segelflug-Wettbewerbe und internationale Wettbewerbsveranstaltungen.)
Alle Segelflugzeugführer haben hierzu eine schriftliche ehrenwörtliche Erklärung auf vorgeschriebenem Formblatt abzugeben. Punktwertung.
35. Die Ermittlung der Punktzahlen in den einzelnen Wertungsgruppen erfolgt nach folgenden Wertungsarten:
I. Streckenflüge.
Die Berechnung der Punktzahl erfolgt nach der Formel Punktzahl = (km — M) ϖ F
In dieser Formel bedeutet km die Entfernung in km, M ist die zu erfliegende Mindeststrecke und F der Tagesfaktor. Mindeststrecke und Tagesfaktor richten sich nach den Bestleistungen des Tages. Sie ergeben sich aus der mittleren Streckenleistung der fünf größten Streckenleistungen des Tages (Summe der fünf größten Streckenleistungen dividiert durch fünf), nach folgender Tabelle:
Mindeststrecke Tagesfaktor mittlere Streckenleistung
M F der Spitzengruppe in km
untere Grenze obere Grenze
30 2,5 0 km 75 km
35 2,0 75,1 „ 100 „
40 1,62 100,1 „ 135 „
45 1,35 135,1 „ 180 „
50 1,1 180,1 „ 255 „
55 0,9 255,1 „ 400 „
60 0,75 400,1 „ — „
Liegt die mittlere Streckenleistung weniger als 5% über der unteren Grenze, so wird der Tagesfaktor aus dem Mittelwert der sechs besten Streckenleistungen ermittelt.
Aufwertung von Weitstreckenflügen.
Bei allen Streckenflügen über 300 km Strecke wird dem Segelflugzeugführer für seinen Ausfall an dem darauffolgenden Wettbewerbstag eine Punktaufwertung zugeteilt. Diese ist gleich der mittleren Punktzahl aus der Punktsumme der 20 tagesbesten Segelflugzeuge des Ausfalltages.
II. Zielstreckenflüge.
Als Zielstreckenflüge gelten solche Flüge, bei denen der Landeort vor Beginn des Fluges auf der Meldekarte angegeben wird. Als Zielorte dürfen nur Flughäfen und amtlich zugelassene Segelfluggelände gewählt werden, die innerhalb des von der Wettbewerbsleitung vorgeschriebenen Zielwinkels oder Zielraumes liegen. Zielorte, die durch Begrenzungslinien des zugelassenen Winkels berührt werden, gelten als zugelassen. Die Startleitung ist nicht zur Ueberprüfung der Startmeldungen verpflichtet dahingehend, ob die gemeldeten Zielorte innerhalb des zugelassenen Winkels liegen.
Die Wertung der erfüllten Zielstreckenflüge erfolgt nach der Tageswertung der Streckenflüge mit einer Zusatzwertung von 50% Strecke.
Wird der Zielort nicht erreicht oder überflogen, so gilt als Wertungsstrecke die Entfernung vom Startort bis zu d e m Punkt der Kurslinie, der dem Landeort am nächsten liegt.
Als Kurslinie gilt die kürzeste Verbindungslinie vom trigonometrischen Punkt der Wasserkuppe bis zum angegebenen Zielort.
III. Zielstreckenflüge mit Rückkehr zum Startort.
Die Zielflüge mit Rückkehr zum Startort werden wie folgt durchgeführt: die Wettbewerbsleitung schreibt vor Startbeginn einen bestimmten Zielort für sämtliche Segelflugzeugführer vor.
a) Grundsätzlich werden diese Flüge als Zielflüge mit Rückkehr zum Startort
(Wasserkuppe) ausgeschrieben. (Bei Abgabe der Startmeldung ist also keine besondere Angabe erforderlich.)
Zielflüge mit Rückkehr zum Startort gelten als erfüllt, wenn sie von der Wasserkuppe zu dem vorgeschriebenen Zielort (Wendepunkt) und von dort zur Wasserkuppe zurück ohne Zwischenlandung ausgeführt werden. Als Rückkehr zum Startort gilt die Landung innerhalb eines Kreises von 1000 m Radius um den trigonometrischen Punkt oder auf dem Motorflugplatz der Wasserkuppe. Für die Beurkundung am Wendepunkt ergehen besondere Vorschriften durch die Wettbewerbsleitung. Der Wendepunkt gilt als erreicht, wenn die Beurkundung nach den Vorschriften der Wettbewerbsleitung erfolgen konnte. Nach der Landung auf der Wasserkuppe haben sich die Flugzeugführer umgehend bei der Startleitung zurückzumelden.
b) Bei nicht erfülltem Zielflug mit Rückkehr zum Startort kann der Flugzeugführer von dem Zielort (Wendepunkt) nach erneuter Startmeldung zum Rück-flug zur Wasserkuppe starten.
Die Startreihenfolge auf dem Zielflughafen richtet sich nach der Reihenfolge der abgegebenen Meldekarten. Der Start erfolgt mittels Flugzeugschlepp. Die Schlepphöhe bei diesen Flügen wird auf höchstens 500 m über Grund festgesetzt. In Ausnahmefällen kann die Sportleitung des Zielflughafens mit Genehmigung des Wettbewerbsleiters eine größere Schlepphöhe zulassen. Diese gilt sodann für alle startenden Flugzeuge.
Bezüglich der Wertung gilt zu a) und b):
Bei erfülltem Zielflug mit Rückkehr zum Startort wird die Gesamtstrecke
gewertet mit 50% Streckenzuschlag. Wird der Zielflug mit Rückkehr zum Startort
nicht erfüllt, so sind folgende Fälle zu unterscheiden:
Bei Landung auf dem Hinflug zu dem vorgeschriebenen Zielort wird der Wertung die zurückgelegte Wertungsstrecke zugrunde gelegt. Bei Landung in vorgeschriebenem Zielort erfolgt die Wertung gemäß Wertungsgruppe II mit einer Zusatzwertung von 50% Strecke. Bei erneutem Start vom Zielflughafen aus zum Rückflug zur Wasserkuppe erfolgt die Wertung getrennt für Hin- und Rückflug nach Wertungsgruppe II.
c) Verbandsflug.
Verbandsflüge werden nur gewertet bei erfüllten Zielflügen mit Rückkehr zum Startort. Als Verbandsflüge gelten gemeinsame Zielstreckenflüge von je 2 Segelflugzeugen. Verbandsflüge müssen auf der Startmeldung eingetragen sein. Beide Segelflugzeuge, die zum Verbandsflug starten, sind vor dem Start der Startleitung zu melden. Der Start beider Segelflugzeuge muß unmittelbar nacheinander erfolgen. Die Flugzeuge müssen gemeinsam auf Strecke gehen. Der Verbandsflug gilt als erfüllt, wenn der Flug gemeinsam durchgeführt wurde und die Landung beider Segelflugzeuge auf der Wasserkuppe mit einem zeitlichen Unterschied von höchstens 10 Minuten erfolgt ist. Bei erfülltem Verbandsflug wird zu der erflogenen Strecken-Punktzahl ein Punktzuschlag von 10% erteilt. Werden die Bedingungen nicht erfüllt, so entfällt die Zusatzwertung für den Verbandsflug, und die Flüge werden einzeln nach Bewertungsgruppe III a), b) bewertet.
d) Innerhalb der Bewertungsgruppe III werden zusätzlich bewertet die schnellsten Zielflüge mit Rückkehr zum Startort.
Es erhalten:
die Segelflugzeugführer mit der kürzesten und zweitkürzesten Flugzeit einen
Zuschlag von 10% Wertungsstrecke, die Segelflugzeugführer mit der drittkürzesten bis fünftkürzesten Flugzeit
einen Zuschlag von 5% Wertungsstrecke. Die Zeitmessung wird durch die Zeitnahme der Sportleitung vorgenommen. Die Flugzeit wird gemessen von Start,
das ist vom Augenblick des Abfallens des Gummiseiles beim Hangstart,
vom Augenblick des Abhebens des Segelflugzeuges vom Erdboden beim
Flugzeugschlepp bis Landung,
das ist das Aufsetzen des Segelflugzeuges auf dem Erdboden. IV. Höhenflüge.
Als Höhe wird der aus dem Barogramm zu entnehmende größte Höhengewinn gewertet. Bei jedem Fluge gibt es nur eine Höhenbewertung.
Für die ersten 500 m werden keine Punkte erteilt. Höhenflüge werden nur dann gewertet, wenn sie mit einem Streckenflug von wenigstens 20 km Strecke verbunden sind. Diese Forderung entfällt bei Flügen mit mehr als 2000 m Startüberhöhung.
Punktwertung:
Punktzahl
Höhenbereich über m
0
500 1500
2 500
3 000
3 500
4 500
bis m 500
1 500
2 500
3 000
3 500
4 500 unbeschränkt
Höchsterreichbare
je 25 m Punktzahl
0 —
0,5 20
0,75 50
1,0 70
1,5 100
2,5 200
3,0 unbeschränkt
Die Höhenwertung gilt als Zusatzwertung zu den Flügen der Wertungsgruppen I—III.
Für diejenigen Segelflugzeuge, die nicht mit Sauerstoffgerät ausgerüstet sind, wird eine Höhenwertung nur bis zu 4000 m über NN vorgenommen. Startarten, Startfolge.
36. Der Start der Segelflugzeuge erfolgt, wenn vom Wettbewerbsleiter nicht anders angeordnet:
in der Klasse A (Einsitzer) mittels Hangstart,
in der Klasse B (Doppelsitzer) mittels Flugzeugschlepp.
37. Die Startfolge richtet sich nach der Reihenfolge der abgegebenen Meldungen.
Startmeldung, Rückmeldung, Beurkundung.
38. Die Startmeldung erfolgt durch Abgabe der ausgefüllten Meldekarte an die Startleitung. Verantwortlich für die richtige Ausfüllung der Meldekarte ist der Segelflugzeugführer selbst. Bei unvollständig ausgefüllter Startmeldung setzt sich der Segelflugzeugführer der Gefahr aus, daß der Flug nicht gewertet wird.
39. Jeder Segelflugzeugführer hat sich nach erfolgter Landung telephonisch bei der Sportleitung zu melden. Bei Landungen im Ausland kann bei Vorliegen besonderer Gründe die Meldung auch telegraphisch erfolgen.
40. Nach der Landung im Tal oder auf dem Gelände der Wasserkuppe hat sich der Flugzeugführer persönlich oder durch einen zu der Mannschaft gehörigen Beauftragten bei der Sportleitung zurückzumelden. Jede weitere Startberechtigung für das betreffende Segelflugzeug ruht solange, bis die ordnungsgemäße Rückmeldung erfolgt ist.
41. Bei allen Strecken- und Zielstreckenflügen, die unter die Bewertung fallen, ist zur Beurkundung eine Landebescheinigung auf dem von der Wettbewerbsleitung ausgegebenen Vordruck zu erbringen. Die Landebescheinigung ist mit einer Skizze des Landeortes zu versehen, aus der die Lage des Landeortes zu solchen Merkpunkten hervorgeht, die aus einer Karte 1 : 300 000 zu entnehmen sind. Ist der genaue Landeort nicht einwandfrei erkennbar, so wird stets die für die Bewertung ungünstigste Lage angenommen. Erfolgte die Landung unter Bestätigung durch die Luftaufsicht auf einem Flughafen, so ist keine Skizze erforderlich.
42. Der plombierte Höhenschreiber sowie die Landebescheinigung ist unmittelbar nach Rückkehr zur Wasserkuppe der Sportleitung abzugeben. Sonderpreise.
43. Für die besten fliegerischen Leistungen innerhalb des Wettbewerbes werden Sonderpreise ausgeschrieben. Die Bestleistungen können in der Klasse A oder B erflogen werden. Die Sonderpreise werden für folgende Bestleistungen ausgeschrieben:
Leistungsart: Geforderte Mindestleistung:
1. größter Streckenflug 450 km
2. größte Höhe 4000 m über NN
3. größte Gesamtzielflugstrecke 3 Zielflüge über 100 km und
2 Zielflüge über 200 km.
Die Sonderpreise bestehen aus Ehrenpreisen. Die Ehrenpreise fallen, wenn nicht anders bestimmt, dem Flugzeugführer zu.
Die Ehrenpreise bestehen aus Goldenen und Silbernen Plaketten des Korps-führers des NS.-Fliegerkorps mit Verleihungs-Urkunde.
Ehrenpreise bei Doppelsitzern fallen dem Flugzeugführer (nicht dem Begleiter) zu.
44. Bewertung der technischen Leistungen.
1. Die Bewertung der technischen Leistungen erfolgt, um die Weiterentwicklung des Geräts für den Leistungssegelflug zu fördern. Ueber die Bewertung entscheidet ein Preisgericht auf Grund der eingereichten Bewerbungen und der Nachprüfung durch die Technische Leitung des Wettbewerbes.
2. Als Bewerber wird zugelassen, wer im Wettbewerb eingesetztes Gerät entwickelt oder verbessert hat. Ist der Bewerber keine Einzelperson, so sind als Mitbewerber der oder die Konstrukteure oder Erfinder (jedoch höchstens 2) anzugeben.
3. Bewerbungen um die Bewertung technischer Leistung haben auf vorgeschriebenen Formblättern zu erfolgen, die beim Korpsführer des NS.-FIiegerkorps, Wettbewerbsleistung des Rhön-Segelflug-Wettbewerbes 1939, anzufordern sind. Die Bewerbungen müssen in dreifacher Ausfertigung bis zum 4. Juli 1939 bei der Wettbewerbsleitung eingegangen sein. Für jedes Gerät ist eine gesonderte Bewerbung abzugeben. Bewertet werden nur solche technischen Leistungen, die aus den der Bewerbung beizufügenden Erläuterungen und Lichtbildern einwandfrei und vollständig ersichtlich sind.
4. Für technische Leistungen werden Geldpreise ausgeschrieben. Die Höhe der für den technischen Wettbewerb zur Verfügung stehenden Preissumme wird vor Wettbewerbsbeginn bekanntgegeben. Die Geldpreise fallen, sofern der Bewerber ein Gewerbebetrieb ist, zu 73 an den Bewerber, zu insgesamt V* an den oder die Mitbewerber. Andernfalls fallen zuerkannte Geldpreise in voller Höhe dem Bewerber zu.
5. Der Bewerber, sofern er eine Einzelperson ist, oder andernfalls der (oder die) Mitbewerber erhalten bei Bewertung ihrer Leistung eine Urkunde des Korpsführers des NS.-FIiegerkorps.
45. Bei der technischen Bewertung werden unterschieden:
1. Verbesserungen bereits vorhandener Flugzeugmuster,
2. neue Segelflugzeugmuster,
3. Zubehör, Ausrüstung und Bodengerät.
Als alte Segelflugzeugmuster gelten diejenigen, die bereits an einem Rhön-Segelflug-Wettbewerb teilgenommen haben. Zu 1.
Richtlinien zur Bewertung von Verbesserungen vorhandener Segelflugzeugmuster:
a) Maßnahmen zur Erhöhung der Flugsicherheit (z. B. Verringerung der Sturzfluggeschwindigkeit, Vereisungsschutz, Sichtverbesserung, Gleitwinkelverschlechterung, Sicherung gegen Hagelschäden usw.);
b) Maßnahmen zur Verbesserung der Flugeigenschaften (z. B. Verhalten im überzogenen Flug, Verbesserung der Stabilität, insbesondere um die Hochachse, Trimmbarkeit, Ruderwirksamkeit, Wendigkeit, Landeeigenschaften usw.);
c) Maßnahmen zur Erhöhung der Flugleistungen (z. B. Geschwindigkeitsspanne, Verringerung der Widerstände).
Zu 2.
Neue Segelflugmuster: a), b) und c) wie bei Ziffer 1.;
d) eigener Entwurf;
e) Bauausführung;
f) aussichtsreiche Anwendung von neuen, bisher im Segelflugzeugbau nicht angewandten einheimischen Werkstoffen;
g) Sonderbewertung für sinngemäße Konstruktionsneuerungen im Hinblick auf den Verwendungszweck des Flugzeuges (Höhen- oder Streckenflug, Blindflug).
Zu 3.
Zubehör, Ausrüstung und Bodengerät.
a) Maßnahmen zur Vereinfachung, Handhabung und Verbesserung von Zubehör und Ausrüstung;
b) Maßnahmen zur Verbesserung der Wartbarkeit der Flugzeuge;
c) Maßnahmen zur Vereinfachung und Verbesserung der Bodengeräte. Tagespreise und Prämien.
46. Ueber die Tagespreise verfügt der Wettbewerbsleiter. Die Tagespreise werden jeweils vor Startbeginn durch Aushang bekanntgegeben. Die Tagespreise bestehen aus Sachpreisen.
gez. Christiansen, General der Flieger.
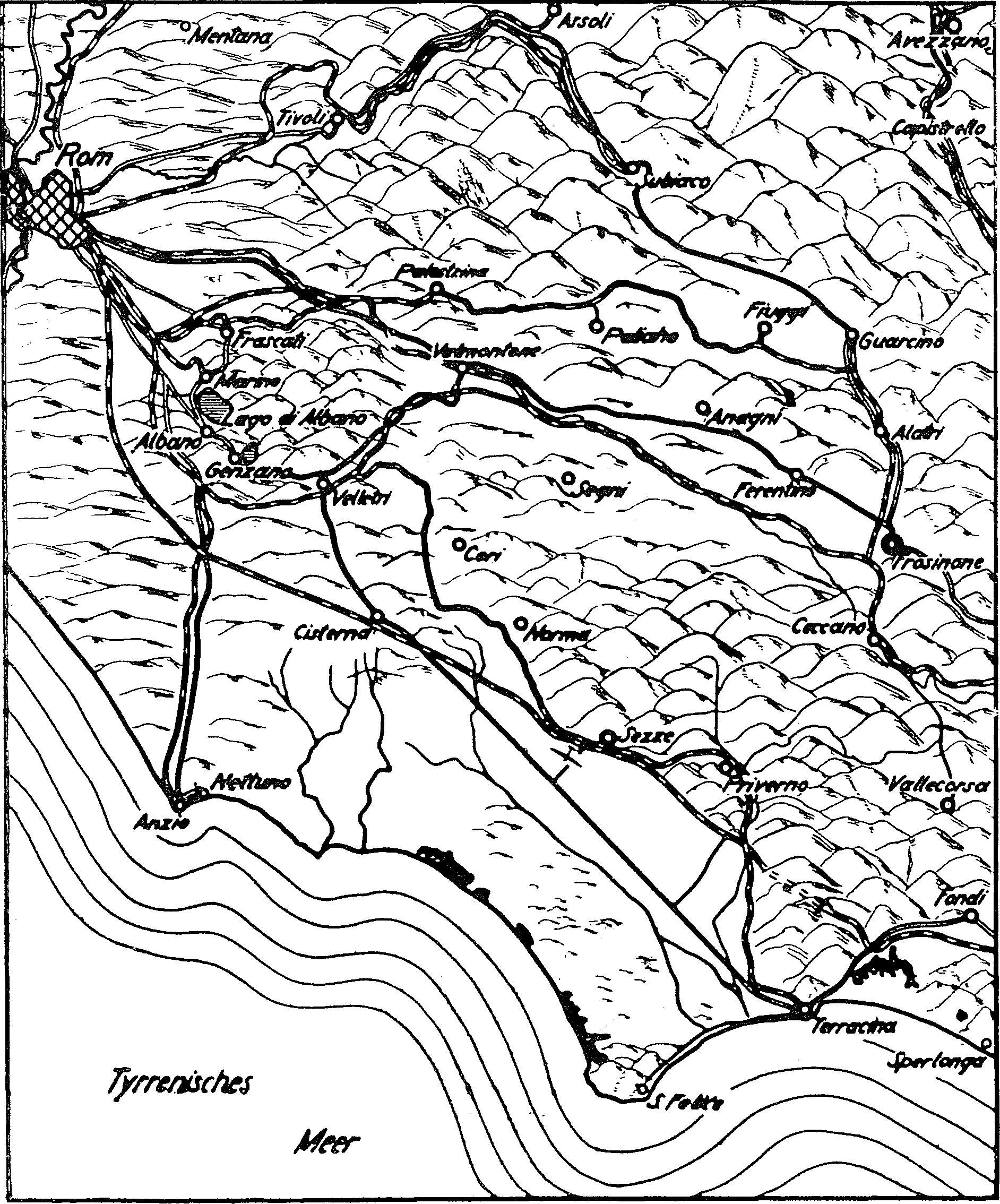
Olympia - Segelflugzeug-Zeichnungen und -Baubeschreibungen werden zur Zeit bei der DFS nach fertigungstechnischen Gesichtspunkten durchgearbeitet. Nach Abschluß dieser Arbeiten können die Bauunterlagen durch den Aero-Club von Deutschland, Berlin SW 11, Prinz-Albrecht-Str. 5, bezogen werden. Der Zeitpunkt dafür dürfte etwa der 1. Mai 1939 sein.
Lageplan des ital. Segelfluggeländes Sezze südöstlich von Rom, auf welchem das Vergleichsfliegen des Olympia-Segelflugzeuges stattfand.
Zeichnung Flugsport

Atmosphärische Luft. 21 Raumteile Sauerstoff + 79 Raumteile Stickstoff. Cinahöhe ist Maßstab für Luftwichte y. Internationale Normalhöhe (1 — 0,0065 h) 4,25
y =!-225 -m-
Birken-Flugzeug-Sperrholz, spezifisches Gewicht verschieden je nach der Sperrholzdicke zwischen 0,77 und 0,91. Am besten Sie lassen sich Muster senden und bestimmen das spezifische Gewicht selbst.
Berichtigung: In Nr. 7, S. 183 muß es heißen:-----Flugweg durch die
Luft (Kompaßkurs, Eigengeschw.),-----Flugweg über Grund (Grundkurs,
Grundgeschw.), —.—.—.—.— Windversetzung (Windrichtung, Windgeschw.).
Literatur.
(Die hier besprochenen Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Der Flieger von Rottenburg. Von Hans Maller. Gauverlag Bayerische Ostmark, Bayreuth. Preis RM 2.50.
In Rottenburg ist Max Müller, einer der erfolgreichsten Kriegsflieger an der Westfront, geboren. Aus eigener Kraft hat er sich emporgearbeitet, kommt zum berühmten Boelcke-Geschwader, vollbringt die größten Leistungen, wird Leutnant und erhält den Pour-le-merite. Sein letzter Luftkampf, er sprang in 400 m Höhe aus dem brennenden Flugzeug, ein Heldenleben ist zu Ende, aber in der Geschichte wird er weiterleben. Ein Buch für unsere Jugend.
Wir fliegen. Von Angelo Cesana. Verlag H. R. Sauerländer & Co., Aar au (Schweiz). Preis Fr. 6.20.
Der Verfasser führt uns in seinem Sportflugzeug über verschiedene Landesteile Europas, über die Alpen, nach Paris, London. Man liest englische Schilderungen über Flüge nach Afrika, Australien. Belehrend geschrieben.
Handbuch der Fliegerwetterkunde, Bd. III, Meßgeräte. Bearb. v. Daubert, Grunow, Habermehl, Kopp, Löhle, Noth, Seilkopf, Scherhag, Schinze, Schreiber und Schwerdtfeger, herausg. v. Ministerialrat Dr. R. Habermehl. Verlag Gebr. Radetzki, Berlin SW 38. Preis RM 3.—.
Im vorliegenden 3. Band des Handbuches der Fliegerwetterkunde wird ein Ueberblick über die im Wetterdienst angewandten Meßverfahren und das im praktischen Beobachtungsbetrieb verwendete Wetterdienstgerät gegeben. Dieses leicht faßlich geschriebene Buch ist ein praktisches Hilfsmittel und Wegweiser für den Unterricht und die Ausbildung des Personals im technischen Dienst sowie für alle, die mit den Fragen der meteorologischen Meßtechnik in Berührung kommen.
Das BS-Getriebe für Wasser- und Lufttreibschwingen und die natürliche Flugkraft. Von Franz Blicharski. Selbstverlag: Wien IV., Schikanedergasse 2.
Der Verfasser zählt zu den wenigen, die sich seit längerer Zeit mit der Schwingenfrage befassen. Im vorliegenden Buch sind die Blicharsky-Getriebe für Lufttreibschwingen behandelt.
Liliputflieger (Folge 1 und 2), Gleitflieger aus Karton. Entwurf Dr. Reinhard Voigt. Verlag H. Apitz K.-G., Berlin SW 68. Preis je Folge RM —.30.
I.Folge enthält: Einfaches Segelmodell, „Minimoa", Nurflügel, Ente; 2. Folge: Klemm-Tiefdecker, „Bremen", Doppeldecker, Focke-Wulf-Stösser. Die Segelmodelle sollen, ausgeschnitten und zusammengeklebt, als Lehrmittel dienen.

Auf der Höhe fliegerischen Könnens als Soldat und Lehrer fand
unser Kamerad
Kurt Hieckmann
am 18. März 1939 den Fliegertod.
Sein freudiges Bejahen jeder fliegerischen Aufgabe, sein unerschrockener Einsatz in Forschung und Erprobung verpflichtet uns, in seinem Geiste weiterzufliegen.
Segelfluggruppe Fliegerhorst Fürth i. B.
Konstrukteur
für Entwicklungsarbeiten mit Sperrholz und anderen neuen Werkstoffen für ein Spezialgebiet gesucht.
Ausführliche Angebote mit Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen und frühestem Eintrittstermin erbeten unter „Wiener Groß-Industrie, La. 41.255" an
Ala - Anzeigen-AktiengeseiIschaff, Wien, I., Wollzeile 16.
Erfahrener
zur Bearbeitung von Leichtmetallanstrichen, deren Entwicklung und Erprobung gesucht.
Herbig-Haarhaus Aktiengesellschaft Lackfabrik Köln-Bickendorf
Das deutsche segeilliegeriied
von G. Striedinger, für Gesang mit Klavierbegleitung, darf in keinem Ver* ein od. Familie fehlen. Preis incl. Porto RM 1.15. Zu bezieh, v. Verlag „Flugsport", Frankfurt««M., Hindenburgpl. 8, Postscheckkonto 7701, Frankfurt a. M.
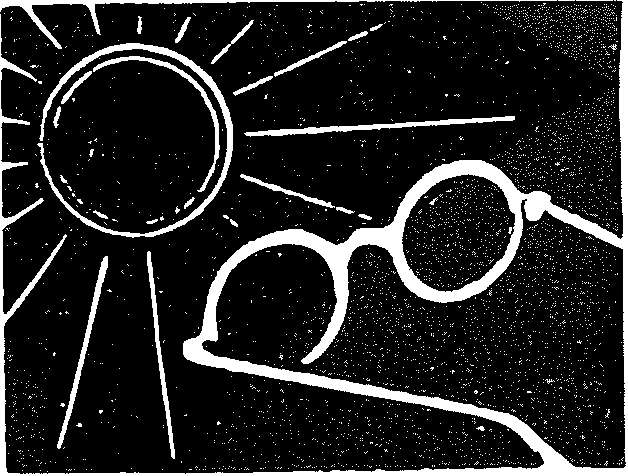
Flieger sagen: Neophan!
Weil kontrastreiche, plastische Boden- und Wolkensicht. Schutz gegen Sonnen-, Schnee- und Wasserstrahlung,
natürliche Farbeindrücke, denn: Blau bleibt Blau, Grün bleibt Grün, Rot bleibt Rot!
Heft 9/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro K Jahr bei Htäglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlas Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Ouellenangabe gestattet.
Nr. 9 26. April 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 11). Mai 1939
Leistungssteigerung.
Bei besonderen Gelegenheiten, wie bei der Parade vor dem Führer, hat die Oeffentlichkeit die Möglichkeit, Teilausschnitte aus der Entwicklung des Flugwesens und allem, was dazu gehört, zu sehen. Man ist erstaunt, was hier alles geschaffen worden ist. Die Leistungssteigerung erstreckt sich auf die Qualität und auf die Quantität, die mit allen Mitteln vorwärtsgetrieben werden muß. An Ingenieure und Facharbeiter werden gesteigerte Anforderungen gestellt. Hauptaugenmerk gilt hier neben der Heranziehung neuer Arbeitskräfte der Züchtung des Nachwuchses. Die Schulung in Technik und Handfertigkeit muß schon in den frühesten Jahren einsetzen. Aus HJ. und NSFK. werden die wichtigsten Kräfte herausgesiebt und geschult. Die Anlaufzeit ist bereits vorüber, und ein großer Teil des Nachwuchses ist bereits erfolgreich in der Industrie tätig. Der Ingenieur der heutigen Zeit ist vor die Aufgabe gestellt, mit allen Mitteln neben der Steigerung in der Leistung der Flugzeuge auch die Produktion zu steigern. Diese Notwendigkeit erkannte frühzeitig Ministerpräsident Generalfeldmarschall Hermann Göring, welcher den Reichswirtschaftsminister Funk mit allen Maßnahmen zur Steuerung und Leistungssteigerung beauftragt und den Reichsausschuß für Leistungssteigerung gegründet hat, durch den alle Wege zur Verbesserung der Betriebs-anlagen, Produktionsmittel und Produktionsmethoden überwacht werden.
Für alle Ingenieure ist es jetzt die vornehmste Aufgabe — jeder bei seiner Einzelaufgabe — daran zu denken: Wie kann die Leistung gesteigert werden? Mittel und Wege sind bereits durch die Normung, Typisierung und anderes gegeben. Die Zeiten mit unnützer Doppelarbeit sind vorbei. Gerade in der heutigen Gemeinschaftsarbeit ist es Pflicht, zu beobachten, was der andere leistet und wie man die eigene Leistung steigern kann. Wir aber in der Fliegerei dürfen stolz sein, daß wir diese Zeit, in der wir an der Leistungssteigerung mitgearbeitet haben, erleben durften.
Diese Nummer enthält Patentsammlung Nr. 7, Rand VIII.
Was wird mit dem 12-m-Segelflugzeug?
Schon von jeher hat das Kleinsegelflugzeug die Gemüter besonders beunruhigt. Die Größe und die damit verbundenen Materialkosten sind es, die immer wieder zu denken geben. Die Frage, kann die 12-m-Maschine ein Leistungssegelflugzeug sein, wurde aufgeworfen und auch positiv beantwortet. Mit der Zeit sind nun eine Reihe solcher Maschinen gebaut und geflogen worden, und es lohnt, wenn man die sich ergebenden Schwierigkeiten, die immer wieder auftreten, vor Augen führt. Daß eine so kleine Maschine leistungsfähig ist, zeigt das „Windspiel" der Darmstädter. Man muß sich auch darüber klar sein, daß ein DFS-Reiber mehr leisten muß. Die Wirklichkeit zeigt aber, daß die kleine leichte Maschine, wenn sie einmal einen „Bart" gefunden hat, viel schneller wegsteigt, als ein großer schwerer Kahn. Das kann für einen Streckenflug wichtig sein, da ein „Auf-der-Stelle-treten" viel kürzer ausfällt und so gewonnene Zeit in Strecke umsetzt. Dies ist nur einer von den vielen Vorteilen, die eine 12-m-Maschine vor den größeren hat.
Bei den Bestrebungen, das Gewicht der 12-m-Maschine zugunsten der Sinkgeschwindigkeit klein zu halten, hat sich gezeigt, daß man mit 80—100 kg noch gut hinkommt. Ein Leichtbau wird immer teurer werden und den einen Vorteil der kleinen Maschine aufheben. Die Mitteldeckeranordnung hat große Vorteile gebracht, diese äußern sich darin, daß man die Schultern des Piloten in den Flügelübergang einbeziehen kann. Mit einem max. Rumpfquerschnitt von 0,320 m2 kommt man mit der Platzfrage gut zurecht. W. Hütter hat mit seiner H 28 (die ja inzwischen weiter entwickelt wird) sozusagen den Löwen losgelassen, das ist eben die Richtung, die eingeschlagen werden muß. Verkleinert man ein Segelflugzeug so, daß man nur 8 m2 Fläche hat, so stößt man hier auf Schwierigkeiten rein fliegerischer Art, die beim normalen Segelflugzeug unbekannt sind. Durch die geringen Abmessungen und Gewichte fehlt der Maschine jede Dämpfung. Es gehört akrobatisches Können dazu, eine solche Maschine zu bändigen. Ich habe festgestellt, daß dies die einzigen Mängel sind. Daß man durch Böen in einer leichten Maschine besonders „geworfen" wird, bewahrheitet sich nicht. Es scheint, als ob der Rumpflänge Grenzen gesetzt sind, wenn man noch angenehme Flugeigen-
Kolitiri 12-m-Segelflugzeug. Oben links: Abnahme des hinteren Rumpfteiles. Unten: Hinterer Rumpfteil mit den Stoßstangen. Rechts: Abwerfbare Führerhaube,
Werkbilder
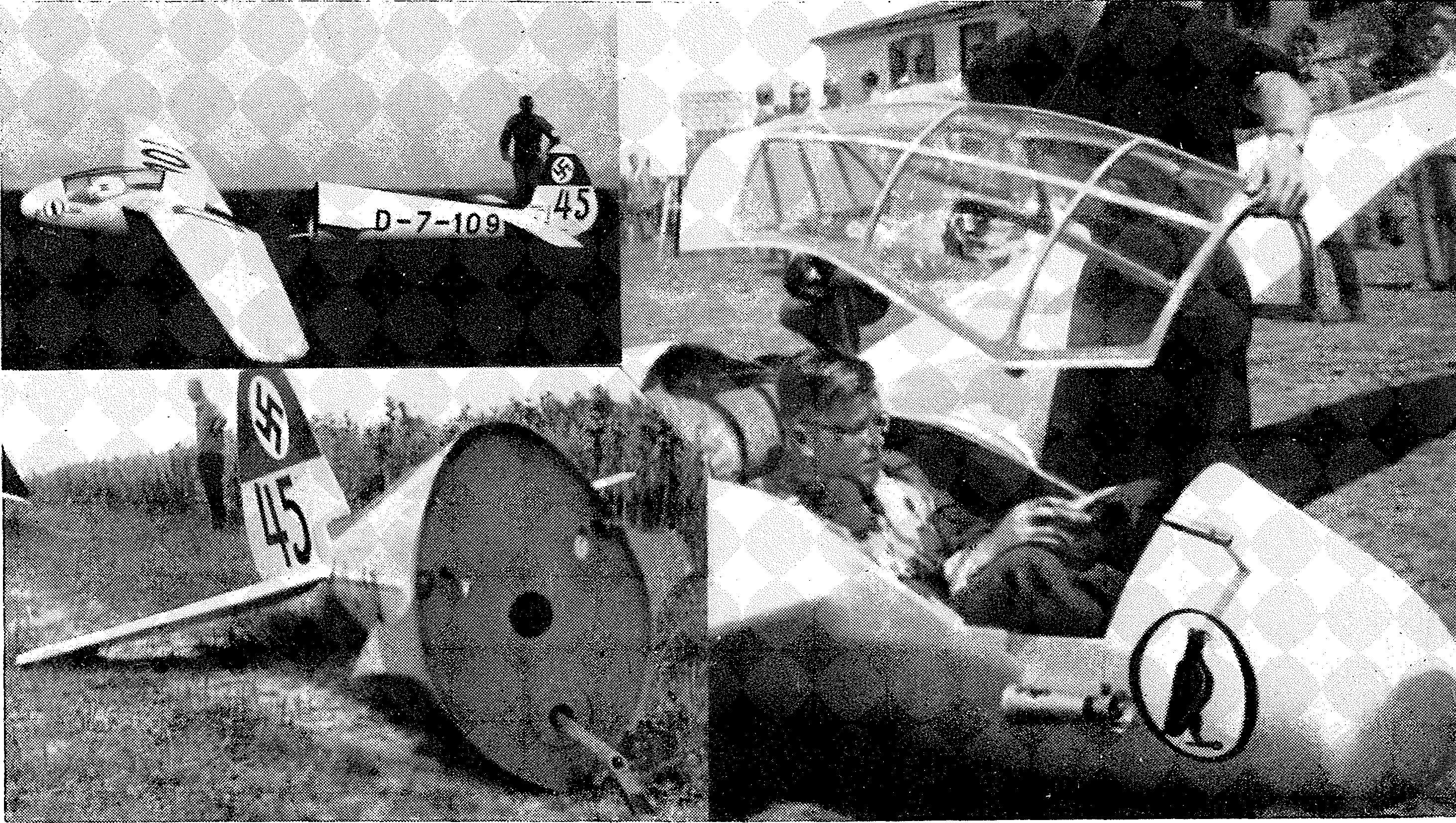
Schäften erreichen will. Diese Grenze liegt meiner Ansicht nach bei ca 5 50 m (3—3,5 m Leitwerkabstand). Daß es auch auf die Seitenprojektion des Rumpfes und auf die Spantenform ankommt, sei nur nebenbei erwähnt. Was der lange Rumpf schwerer ist, wird durch angenehmes Fliegen ausgeglichen. Neben dem „Windspiel" ist noch der „Kolibri" die nächstkleinste Maschine, die auch schon mittlere Streckenflüge von 150 km hinter sich hat. Auch bei dieser Maschine zeigten sich die typischen Eigenschaften dieser Klasse. Kleinste Steuerausschläge genügen, um die Maschine unruhig zu machen. Diese Eigenschaften und die an sich hohe Flächenbelastung ergibt ein schweres Auffinden der Thermikschläuche. Wenn man diese Mängel beheben will, so kommt man immer wieder auf den langen Rumpf. Genau wie der Kleinwagenbau eigene Wege im Aufbau gegangen ist, so ist es auch bei der 12-m-Maschine möglich. Der „Kolibri" zeigt in seiner Aufteilung einen solchen Weg. Zusammenfassend ist zu sagen, daß es eine dankbare Aufgabe ist, sich mit dem „Kleinsten" zu befassen. Durch geeignete Rudergrößen und Abstimmen der Ruder zueinander muß man auch diesen beschriebenen unangenehmen Eigenschaften zuleibe gehen.
Das 12-m-Leistungssegelflugzeug ist ein sehr leistungsfähiger Typ, wenn er richtig entwickelt und eingesetzt wird.
G. Blessing, Laucha a. d. Unstrut.

Ital. Hochl.-Segelflugzeug „Pellicano" während der Olympia-Prüfflüge auf dem
Flugplatz Sezze bei Rom. Werkbilder
Ital. Hochleistungs-Segelflugzeug Pellicano.
Für das Olympia-Vergleichsfliegen hatte die ital. Segelfluggruppe der Mailänder Studenten ein Hochleistungssegelflugzeug mit Knickflügel in 3 Monaten entworfen und gebaut.
Flügelprofil NACA 24, d. h. mit schwacher Wölbung. Holmflanschen lameliiert verleimt, vgl. Abb. Torsionsnase aus Sperrholz. Beide Flügelhälften durch zwei konische Bolzen verbunden. Befestigung am Rumpf wird durch besondere Schraubenbolzen bewirkt. Am Rumpf Diagonalverstrebungsrippe auf beiden Seiten mit Sperrholz beplankt. Bremsklappen weit ab vom Rumpf, um das Höhenleitwerk nicht zu beeinflussen. Bremsklappen sind so bemessen, um die Sturzgeschwindigkeit
Holm des ,,Pell,icano".
Werkbild
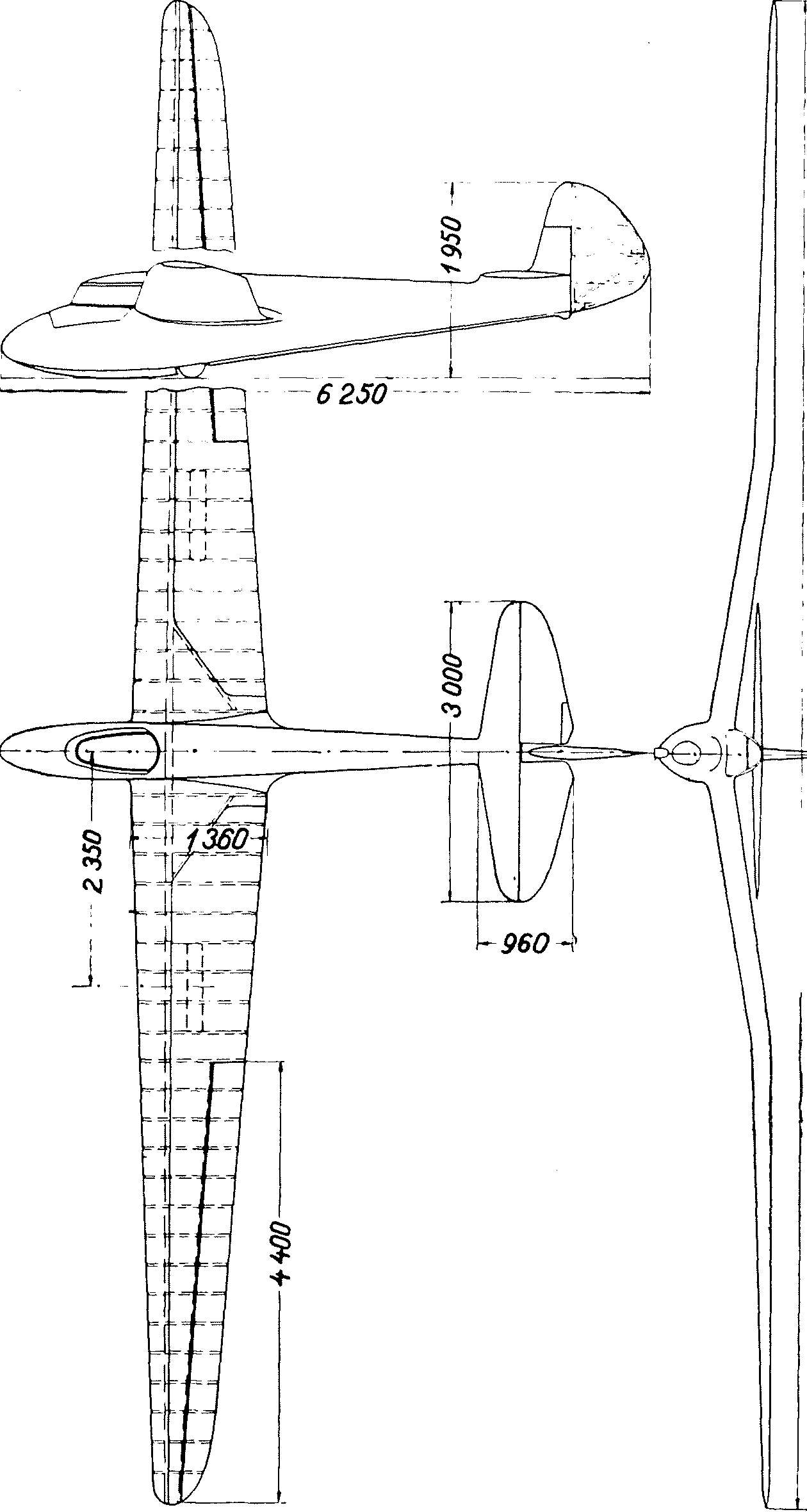
| Ital. Hochl.-§ Segelflug-§ zeug „Pellicano". m
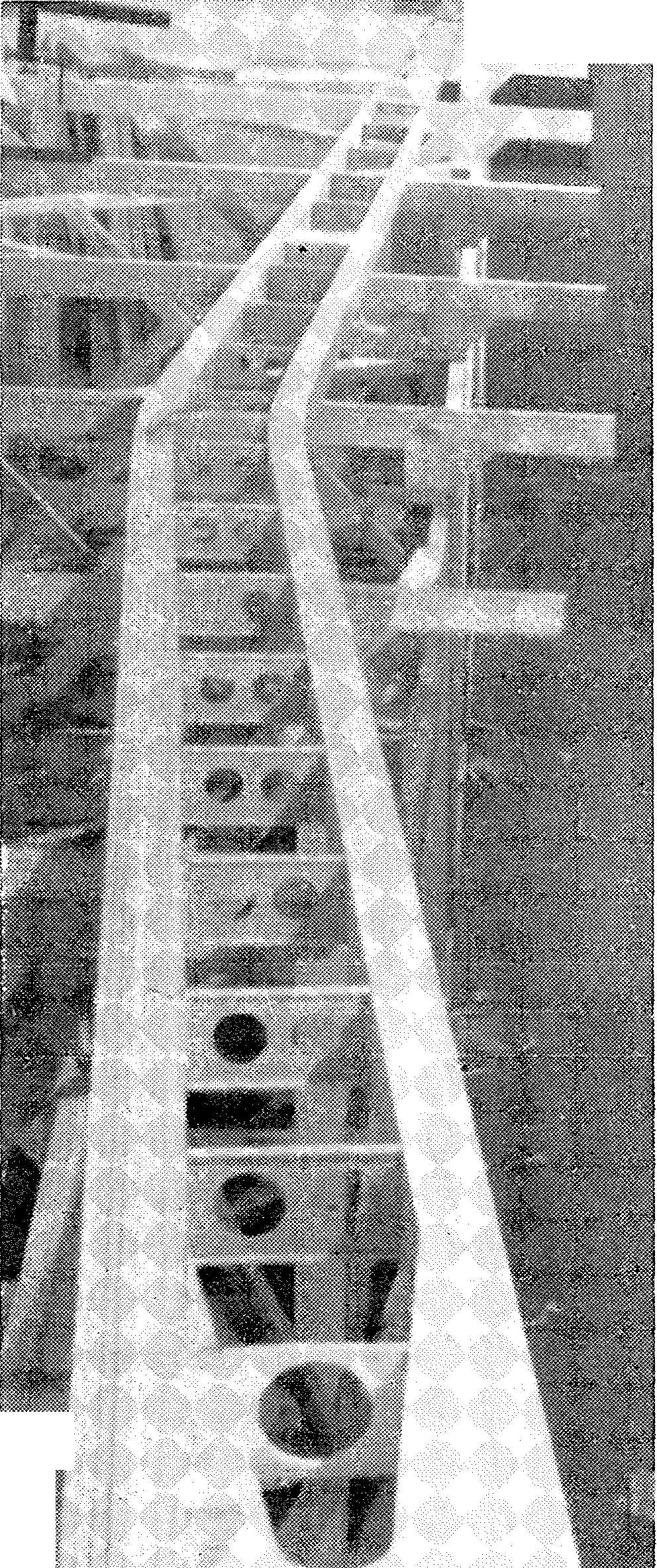
Zeichnung Flugsport
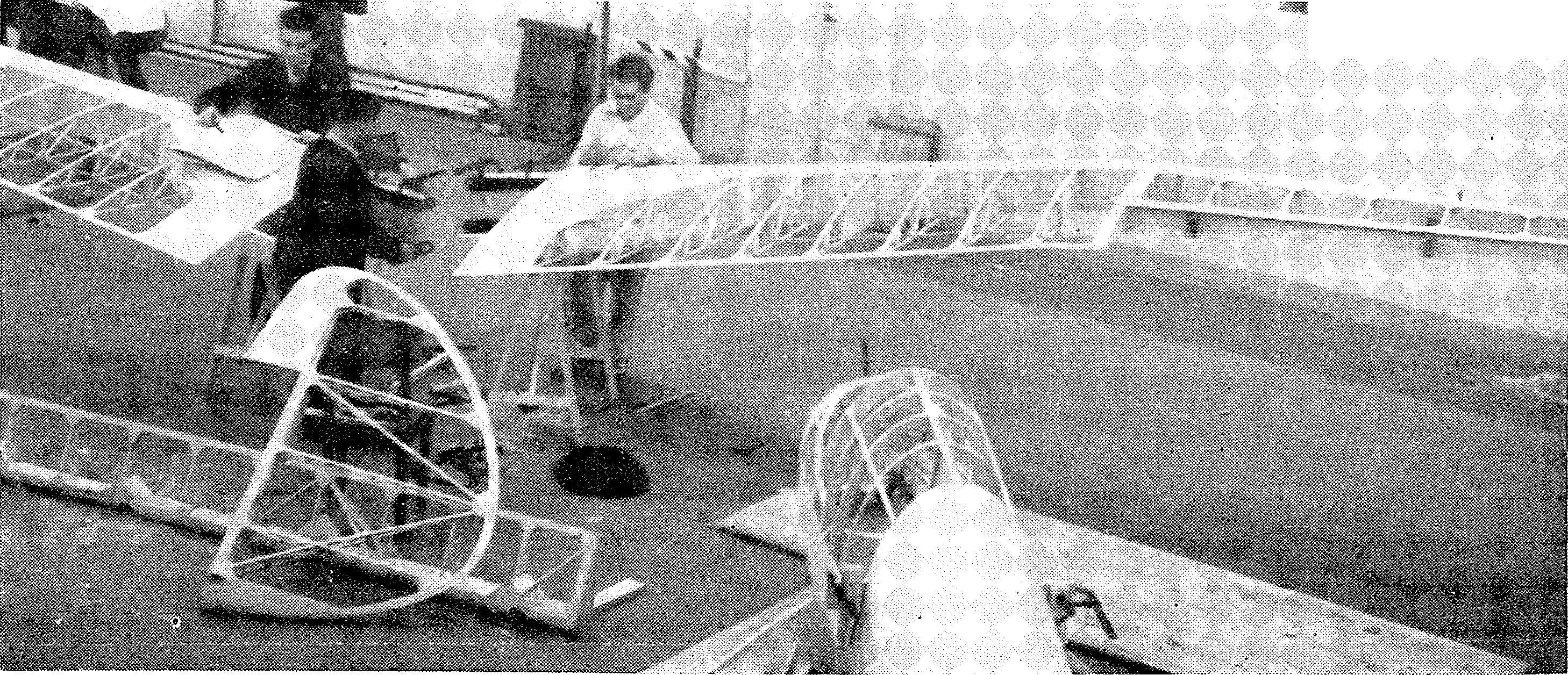
Ital. Hochl.-Segelflugzeug „Pellicano" in der Werkstatt.
Werkbild
auf 200 km/h herabzudrücken. Bei Versuchen ergab sich nur eine Maximalsturzfluggeschwindigkeit von 190 km/h. Durch mehr oder weniger Oeffnen der Bremsklappen kann die Sturzgeschwindigkeit reguliert werden.
Rumpf, eiförmiger Querschnitt, umschließt, ohne die Sicht zu hindern, vollständig die Sitzfigur. Im Schott hinter dem Führer Raum für Barographen und Werkzeug.
Höhenleitwerk Rumpfoberkante. Seitenruder statisch ausgeglichen.
Spannweite 15 m, Länge 6,25 m, Fläche 14/70 m2, Seitenverhältnis 15,3, Flügeltiefe maximal 1,36 m, minimal 0,58 m, Höhenleitwerk 1,864 m2, Seitenleitwerk 1,030 in2. Leergewicht 160 kg, Fluggewicht 255 kg, Sinkgeschwindigkeit 0,709 m/sec bei 56 km/h Geschwindigkeit.
Poln. Hochleistungs-Segelflugzeug „Orlik II".
Der vorliegende Typ, auch „Orlik-1939" genannt ist aus dem Serien-Leistungssegelflugzeug „Orlik" für das Olympia-Vergleichsfliegen entwickelt worden.
Mitteldecker, hochgezogener Knickflügel, leichte V-Stellung, um gute Seitenstabilität zu sichern. Zur Vereinfachung der Bauart ist die Rippenkonstruktion so gelöst, daß sich die Rippen auf die Holme aufziehen lassen. Klappen am Rumpf an der Vorderseite des Flügelprofils versteifen gleichzeitig den Flügel gegen Torsionsbeanspruchungen. Die Klappen sollen keine Störungserscheinungen auf Kiel- und Steuerflächen hervorrufen.
Rumpf oval, Spante aus Fichte und Birkensperrholz, mit 4 Fich-tenlängsträgern. Rumpf Verkleidung 1,5 mm Birkensperrholz, tragend. Alle Spanten, einfache Bauart, laufen parallel zueinander und verein-
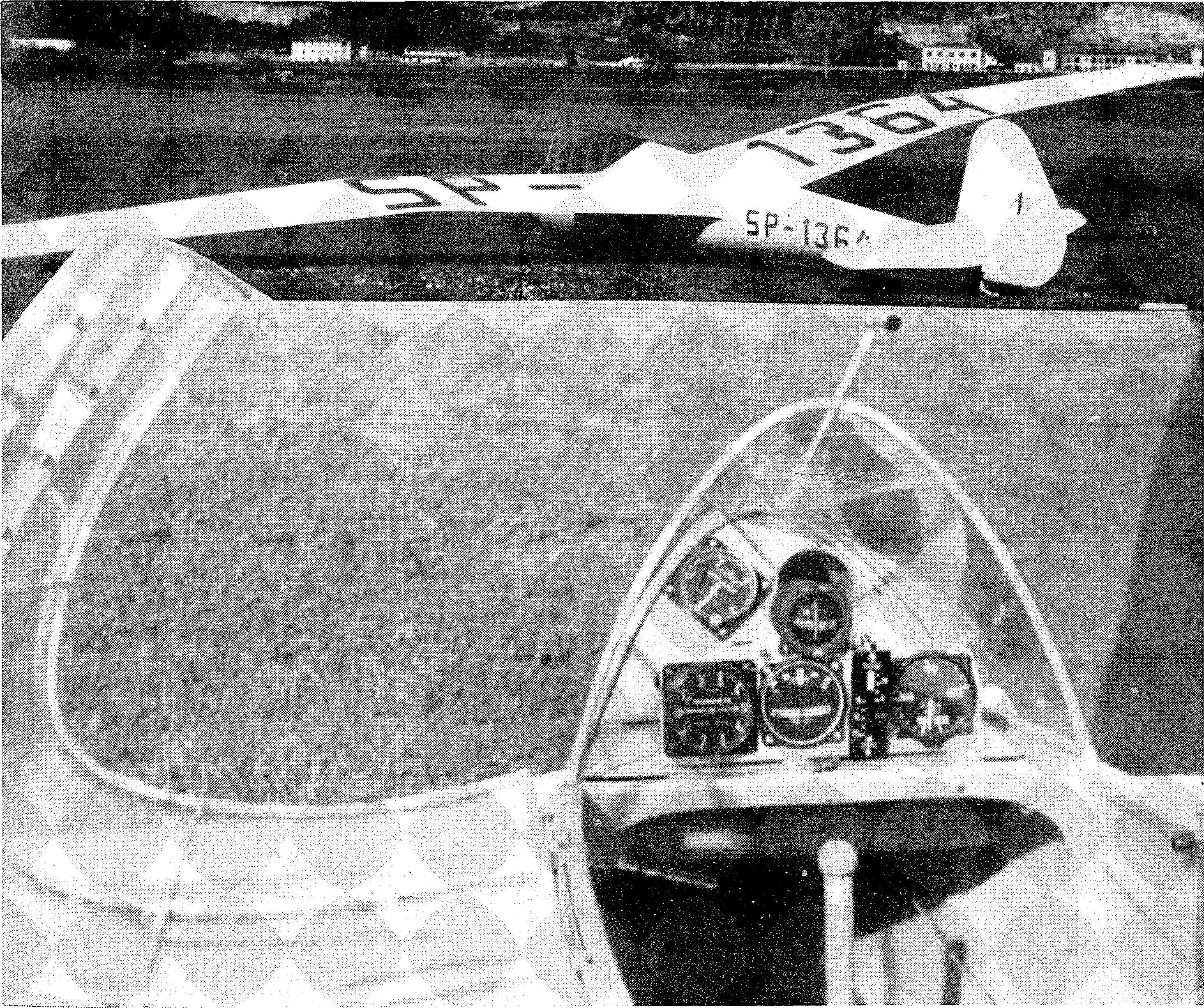
Poln. Hochleistungs-Segelflugzeug „Orlik II". Unten Führerraum mit Bordgeräten.
Bilder Sobierajski

Poln. Segelflugzeug „Orlik II", Pilot Mandelli, beim Olympia-Vergleichssegelfliegen, Sezze bei Rom. Oben rechts: Klappen auf der Flügelunterseite ausgefahren.
Bilder Sobierajski
fachen die Herstellung der einzelnen Teile sowie auch die Montage des ganzen Rumpfskeletts. Kabinenhaube Metallgerippe mit geraden Scheiben, um keine Lichtbrechung hervorzurufen. Oeffnungsmöglich-keit der Haube auf beiden Seiten, leichte Abwurfmöglichkeit. Kleiner Windschutz über den Instrumenten bleibt bestehen. Alle Leitungen der Instrumente liegen offen und sind im Fluge leicht kontrollierbar und zugänglich. Führersitz verstellbar. Der Mittelteil des Rumpfes enthält alle Hauptbeschläge für Fiügelträger, Steuer- und Klappenverbindungen, leicht zugänglich. Kufe durch 2 Luftpolster abgefedert.
Leitwerksflächen leicht auf-und abmontierbar. Verschlüsse automatisch.
Spannweite 15 m, Länge 6,5 m, Höhe 1 m. Gewicht leer 160 kg, belastet 245 kg. Flügelinhalt 14,8 m2, Flächenbelastung 16,55 kg/m2.
Sinkgeschwindigkeit 0,67 m/sec, bei 100 km/h 1,5 m/sec. Bei 230 km/h Fluggeschwindigkeit noch angenehme Steuerungseigenschaften. Auffallend gute Wirkung der Querruder bei kleinen Fluggeschwindigkeiten ermöglicht Kreisen in engen Auftriebsschläuchen. Beim Kreisen mit 50 m Radius 0,9 m Sinkgeschwindigkeit. Kleinster erreichter Kreis 23 m Durchmesser. Im Sturzflug mit Bremsklappen 200 km/h, mit geöffneten Klappen und kleiner Fluggeschwindigkeit wurde beim richtigen Kreisen Sinkgeschwindigkeit nur um ca. 30 m/sec vergrößert.
Pol. Segelflugzeug „Orlik II".
Werkzeichnung
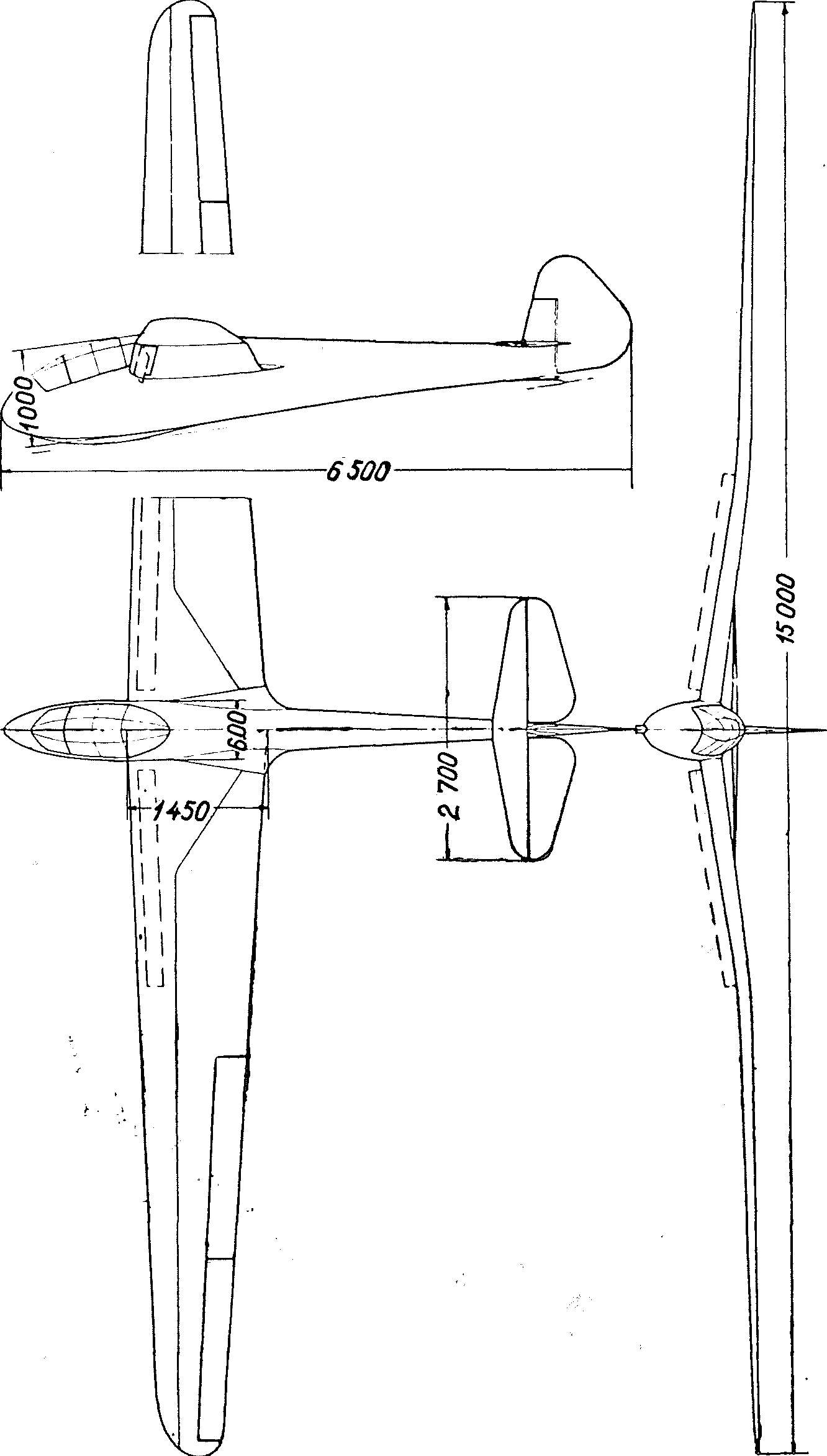
Schweiz. Motorsegler W. F. 23.
Der von Willi Farner, Grenchen, gebaute Motorsegler ist schon vor mehreren Jahren fertiggestellt. Bei den ersten Probeflügen, die bereits Anfang 1938 begannen, zeigten sich schwere Motorstörungen am AVA-Motor: Kolben angefressen, Kurbelwellenbruch u. a. m. Diese Störungen führten auch zum Bruch des Propellers und des beim Hochziehen begriffenen Fahrwerks. Die untenstehende Abbildung zeigt den W. F. 23 nach der Notlandung.
W. F. 23 ist ein Schulterdecker, freitragend, Segelflugzeugbauweise, mit franz. AVA-Motor, Viertakt, 2 Zylinder, 25 PS, Untersetzung 1 : 1,4, Propellernabe mit Freilauf und Kupplung, um bei Segelflug den Propeller unter geringstem Widerstand laufen zu lassen. Führersitz verkleidet mit Plexiglashaube. Einradfahrwerk, hochziehbar, davor eine Kufe.
Spannweite 18 m, Fläche 21,5 m2, Flächenbelastung 18,5 kg/m2, Leergewicht 300 kg, Fluggewicht 500 kg, Steigleistung 2 m/sec.

Schweiz. Motorsegler W. F. 23.
Werkbild
Parnall 382.
Dieses zweisitzige Schulflugzeug in Ganz-Holzbauweise ist mit Spaltflügeln und Landeklappen ausgerüstet worden, um die Piloten an die Start- und Landetechnik moderner Flugzeuge zu gewöhnen.
Verriegelbarkeit der Slots und niedriges Fahrwerk lassen darauf schließen, daß der Maximalauftrieb der Zelle zur Landung nicht ausgenutzt werden kann und soll. Außerdem wurde durch Fehlen einer Landeklappe am Flügelmittelstück die Höhenruderwirkung im Gleitflug mit ausgefahrenen Klappen stark verringert, so daß das Flugzeug wahr-
Eng;!. Schulflugzeug Parnall 382.
Zeichnung Flugsport
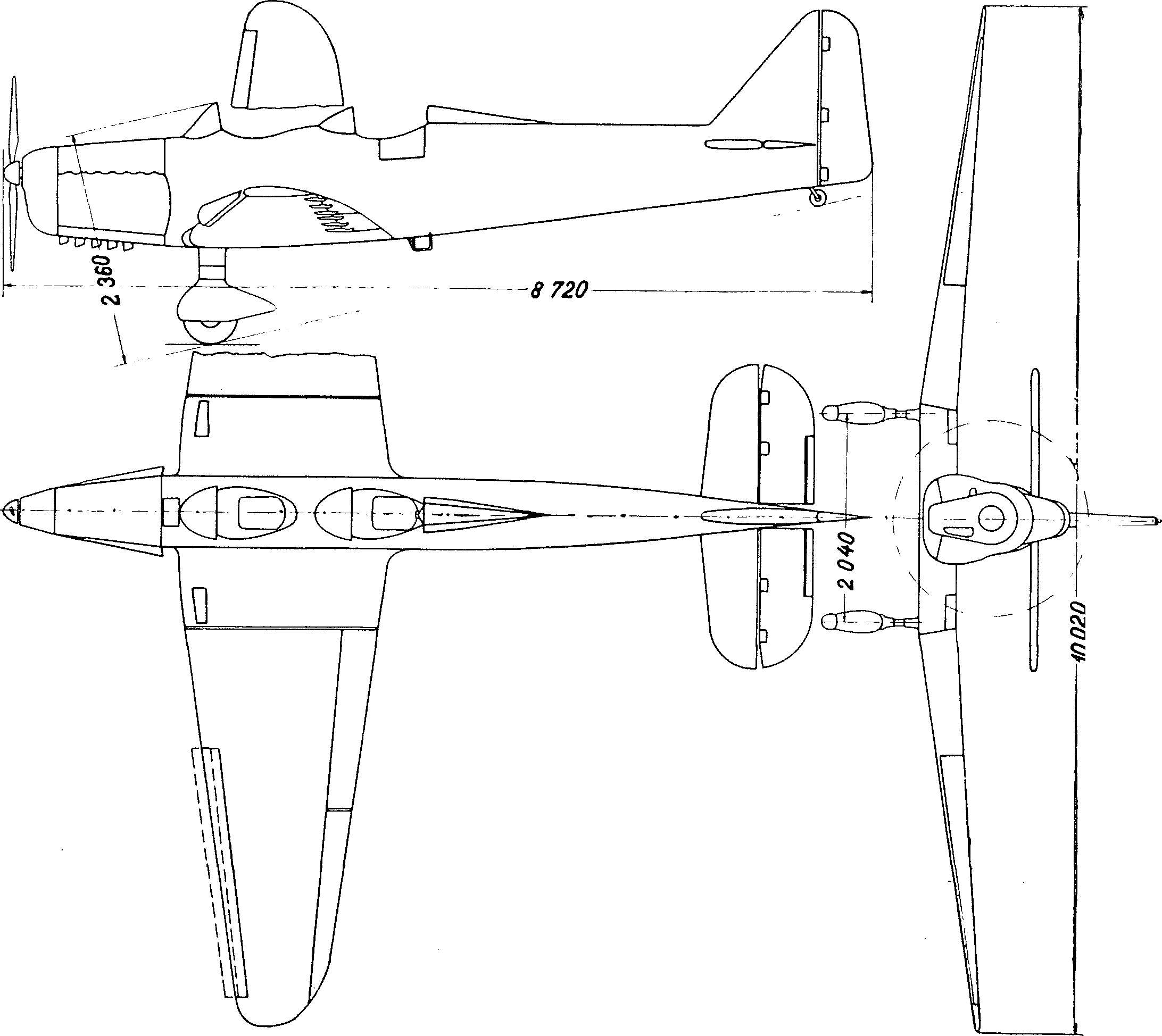
scheinlich gerade noch bis Dreipunktlage (a = 15°), aber nicht mehr bis zum Höchstauftriebswinkel von etwa 30° gezogen werden kann. Zur Erzielung dieser, für ein Schulflugzeug erwünschten Eigenschaften, waren allerdings ein langer Rumpf mit relativ großem Leitwerk notwendig, so daß der durch Slots erreichbare große Geschwindigkeitsbereich praktisch nicht ausgenutzt worden ist. Zweiholmiger Trapez-Schlitzflügel mit Schlitzquerrudern und Landeklappen bis zum Flügelmittelstück. Slots verriegelbar. Sperrholzbeplankt.
Zweisitziger, offener Sperrholzrumpf mit Längsholmen und Spanten. Der Sitz des Schülers kann zur Blindflugschulung mit einer übergeklappten Haube geschlossen werden.
Sehr großes Seitenleitwerk ohne aerodynamischen Ausgleich. Höhenruder mit schmalem Trimmflettner. Flossen: Holz, Ruder: Stahlrohr.
200 PS Gipsy Six. Spannweite 10,2 m, Länge 8,75 m, Flügelfläche 14,4 m2. Leergewicht 750 kg, Zuladung 360 kg, Fluggewicht 1110 kg. Flächenbelastung 77 kg/m2, Leistungsbelastung 5,6 kg/PS. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, Geringstgeschwindigkeit mit Gas und ausgefahrener Landeklappe 75 km/h.

Tschech. Jagdflugzeug Avia 35. (Vgl. Typenbeschreibung „Flugsport" 39, S. 204.) Man beachte den Bienenkorbkühlereinbau mit Klappenregulierung hinter dem Kühler, ferner den Oelkühler an der Flügelwurzelvorderkante des linken Flügels. Höchstgeschw. in 4000 m 492 km/h mit 860 PS, Belastung 141 kg/m2, Steigzeit auf 5000 m 6 min 13 sec. Der nächste Typ mit hochziehbarem Fahrwerk erhält einen
DB-601-Motor. Werkbild
Einfluß der Verstelluftschraube auf die Flugleistung.
Der kürzlich erflogene absolute Geschwindigkeitsrekord hat auch außerhalb der eigentlichen Fachwelt die Frage nach den Faktoren aufgeworfen, die für die Erreichung der neuzeitlich hohen Fluggeschwindigkeit von besonderem Einfluß sind.
Es ist allgemein bekannt, daß die Flugzeuge für derartige Geschwindigkeiten hinsichtlich ihrer Formgebung außerordentlich verfeinert worden sind. Weiterhin ist es selbstverständlich, daß die Steigerung der Fluggeschwindigkeit nur durch eine entsprechende Erhöhung der Flugmotoren-Leistungen erreichbar ist. Hierbei ist jedoch nicht nur die absolute Leistungssteigerung des Motors ausschlaggebend, sondern von erheblicher Bedeutung, mit welchem Wirkungsgrad diese hohe Motorenleistung in die Vortriebsleistung des Flugzeuges umgesetzt wird. Diese Aufgabe fällt der Luftschraube zu. Es ist über den engeren Fachkreis hinaus sehr wenig bekannt, daß der Entwurf neuzeitlicher Luftschrauben trotz ihrer äußerlich so einfach
erscheinenden Formgebung erhebliche wissenschaftliche und konstruktive Vorarbeiten bedingt. Die Theorie der Luftschraube wurde im Laufe der Jahre zu einem nahezu selbständigen Teilgebiet der allgemeinen Aerodynamik.
Bei der Umsetzung der Motorenleistung in die Vortriebsleistung des Flugzeuges zeigt sich, daß eine Luftschraube, sofern ihre Flügel nicht im Fluge verstellbar sind, in ihrer Leistungsaufnahme abhängig ist von ihrer jeweiligen Drehzahl, die wiederum von der Luftdichte und von der Geschwindigkeit des Flugzeuges beeinflußt wird, d. h. bei gleichbleibendem Ladedruck des Motors und gleichbleibender Flughöhe fällt und steigt die Motordrehzahl und somit die Leistungsaufnahme der Luftschraube mit der Fluggeschwindigkeit, die Luftschraube ist somit geschwindigkeitsabhängig. Der Vorgang ist folgender:
Die Luftschraube hat bei einer bestimmten Drehzahl eine bestimmte Spitzengeschwindigkeit. Für die einzelnen Flügelelemente, aus denen sich ein Luftschraubenblatt zusammensetzt, ergibt sich die betreffende Umfangsgeschwindigkeit aus der Verbindungslinie der Spitzengeschwindigkeit mit der Luftschraubenmitte (Abb. 1).
Nimmt man nun ein bestimmtes Luftschraubenelement heraus, so gehört zu diesem die Umfangsgeschwindigkeit u (Abb. 2), die man in einer bestimmten Größe als waagerechte Linie zu dem aufgezeichneten Luftschraubenelement, d. h. in der Luftschraubendrehebene aufträgt. Der von dieser Linie einerseits und von der Druckseite des Luftschraubenelementes andererseits gebildete Winkel ist der — Anblaswinkel der Luftschraube am Stand —. Besitzt nun das Flugzeug eine bestimmte Vorwärtsgeschwindigkeit, so ändert sich der Anblaswinkel wie folgt:
Die Vorwärtsgeschwindigkeit v des Flugzeuges als gerade Linie senkrecht zur Umfangsgeschwindigkeit u aufgetragen, ergibt mit dieser zusammen als Resultierende die tatsächliche Fortschritts-
Vom Weltrekordflug mit der fie 112 U. Flugkpt. Dieterle besteigt die He 112 U zum Rekordflug. Unten rechts: Landung des Jagdeinsitzers He 112 U nach dem Rekordflug auf dem Werkflugplatz Oranienburg. Bilder Schaller

.Geschwindigkeit des Luftschraubenelementes (Abb. 2). Unter Vernachlässigung der induzierten Störungsgeschwindigkeiten wird also der Anblaswinkel a für diese Geschwindigkeit von der Druckseite des Luftschraubenelementes und von dieser tatsächlichen Bewegungsebene des Luftschraubenelementes gebildet. Aus dieser Darstellung ist nun ohne weiteres zu ersehen, daß mit zunehmender Vorwärtsgeschwindigkeit des Flugzeuges Vi der Anblaswinkel abnimmt und «i wird.
Betrachtet man die dabei entstehenden Kräfte, so erhält man folgendes Bild:
Die bei einer Drehung der Luftschraube entstehenden Kräfte sind die Luftkraft L, die in einer bestimmten Größe als gerade Linie ungefähr senkrecht zur Bewegungsebene der Luftschraube aufzutragen ist und ihre beiden Komponenten, in Flugrichtung der Schub S und in Richtung der Luftschraubendrehebene die Drehkraft D, die vom Motor aufzubringen ist.
Da nun die — Luftkraft L proportional dem Anblaswinkel — ist und bei zunehmender Geschwindigkeit des Flugzeuges der Anblaswinkel kleiner wird, muß auch mit zunehmender Geschwindigkeit des Flugzeuges die Luftkraft entsprechend kleiner werden. Zu dem Anblaswinkel a± gehört demnach die Luftkraft Li, aus der wiederum die Komponenten Si und Di zu bilden sind. Daraus ist folgender Schluß zu ziehen: „Bei konstanter Drehzahl des Motors wird die Drehkraft der Luftschraube mit zunehmender Geschwindigkeit des Flugzeuges kleiner."
Nimmt man an, daß der Motor mit Vollgas arbeitet, wobei das Moment des Motors fast unabhängig von der Drehzahl konstant bleibt, dann muß bei dem konstanten Motormoment mit zunehmender Geschwindigkeit des Flugzeuges, da nach vorigem die Drehkraft der Schraube kleiner wird, die Drehzahl des Motors zunehmen. Eine feste Luftschraube wird demnach mit zunehmender Geschwindigkeit an Drehzahl aufholen oder umgekehrt. Auch die Vollgas-Standdrehzahl einer festen Schraube ist wesentlich geringer als die Drehzahl im Horizontalflug.
Aber auch der umgekehrte Fall kann eintreten, daß bei zunehmender Geschwindigkeit des Flugzeuges V2 (Abb. 2) — z. B. im Sturzflug
Abb. 2. a \
/
/
/
/
Abb. 1.
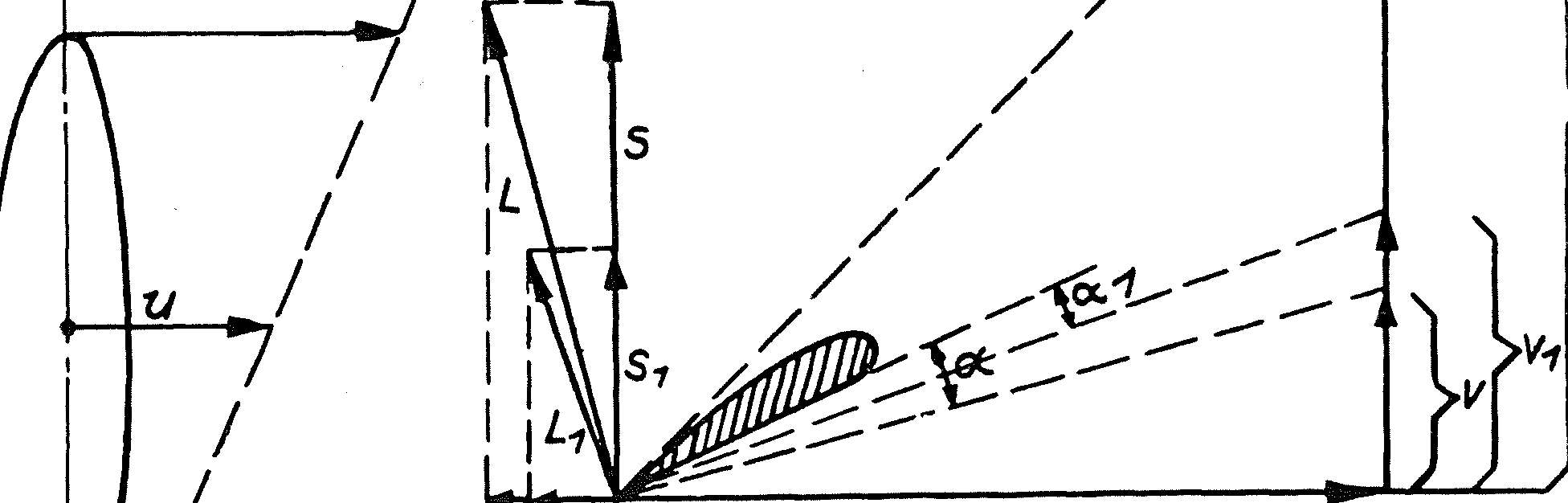
L u ftschrauben dreh rieh tung u* Umfangsgeschw.des
Luftschratubene/emenfes V Geschwindigkeit des
Flugzeuges oc* Anblaswinkel L ϖ Luftkraft 5* Schub D * Drehkraft
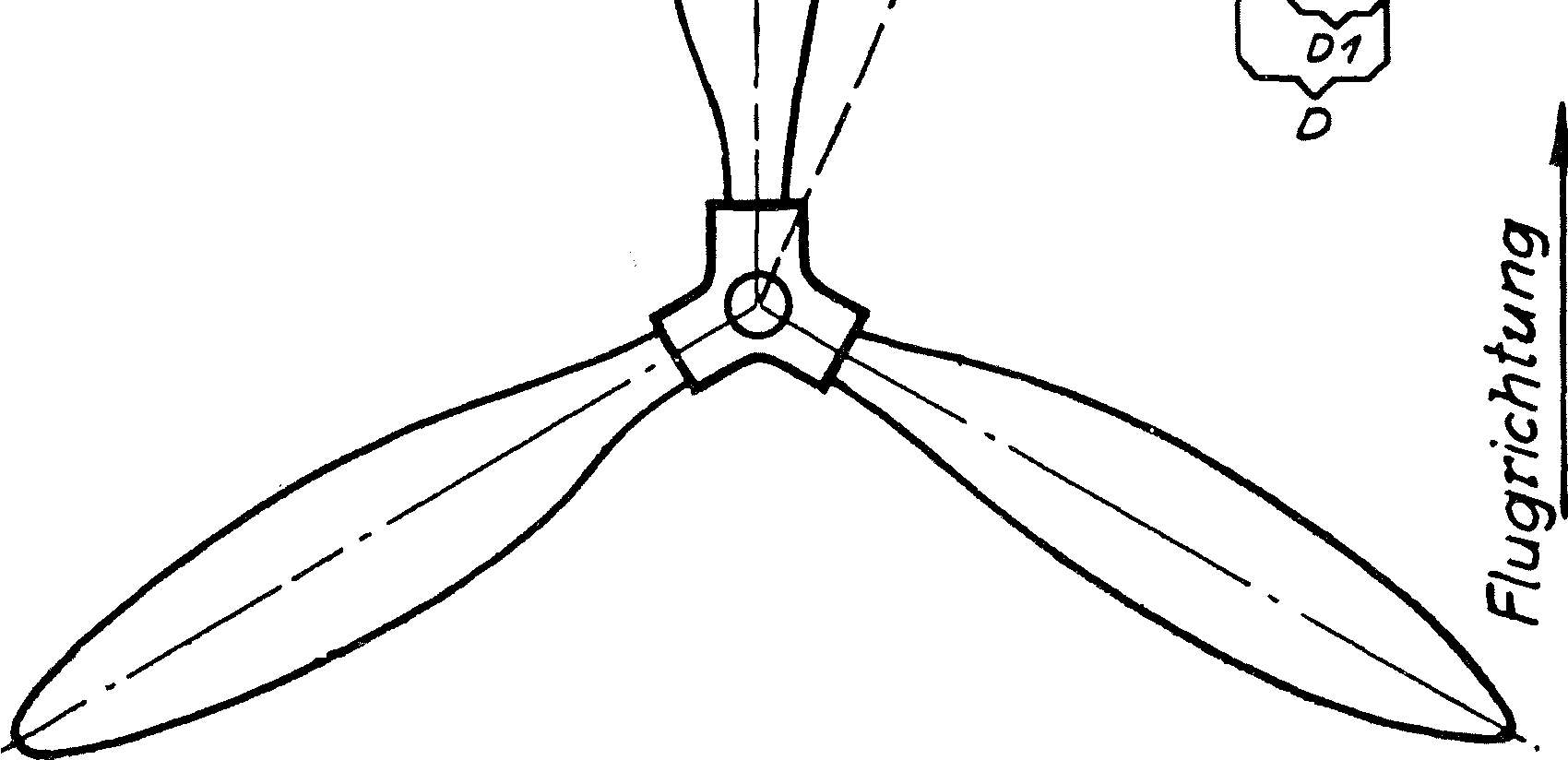
— Kräfte auftreten, die die Luftschraube antreiben, wobei — selbst im Leerlauf des Motors — die höchstzulässige Motordrehzahl überschritten wird. Die Schraube arbeitet in diesem Fall als Windmühle.
Da nun aber der Motor nur für eine bestimmte, ihm eigene Drehzahl die größte Leistung besitzt und eine höchstzulässige Drehzahl nicht überschritten werden darf, ist es nach vorigem notwendig, die Flügel der Luftschraube durch Verstellen während des Fluges der jeweiligen Geschwindigkeit des Flugzeuges anzupassen. Dies gilt besonders für den Start, wobei die Geschwindigkeit 0 ist, und für den Steigflug.
Wie schon erwähnt, ist die Drehkraft der Schraube nicht nur von der Geschwindigkeit des Flugzeuges abhängig, sondern auch von der Luftdichte, d. h. am Boden nimmt die Luftschraube mehr Leistung auf als in großen Höhen mit kleiner Luftdichte.
Bei Bodenmotoren gleicht sich diese geringere Leistungsaufnahme der Luftschraube durch die Leistungsabnahme des Motors in größeren Höhen infolge der geringeren Luftdichte wieder aus, d. h. die Drehzahl der Luftschraube bleibt bei Bodenmotoren mit zunehmender Höhe ungefähr gleich, da mit der Abnahme der Luftdichte auch die Leistung des Motors abnimmt. Bei Motoren mit Gebläse bleibt jedoch die Leistung bis zur Volldruckhöhe konstant und nimmt sogar noch etwas zu. Bei den Gebläsemotoren wird also erst von der Volldruckhöhe ab die Luftschraube von der sich mit der Höhe ändernden Luftdichte abhängig, so daß die abnehmende Leistungsaufnahme der Luftschraube sich bis zur Volldruckhöhe auf den Motor sehr ungünstig auswirkt, d. h. also, die Drehzahl der Luftschraube und somit die des Gebläsemotors steigt mit abnehmender Luftdichte bis zur Volldruckhöhe. Auch dies erfordert, wenn die Bestleistung des Motors erreicht werden soll, ein Anpassen der Stellung der Luftschraubenflügel an die jeweilige Flughöhe.
Der Zweck der im Fluge verstellbaren Luftschraube ist also, unabhängig von der Vorwärtsgeschwindigkeit oder der Flughöhe, durch Einhalten einer günstigsten Motordrehzahl die volle Leistung des Motors verfügbar zu machen, es kann dies sowohl die Höchstleistung als auch die wirtschaftlichste Reiseleistung des Motors sein.
Dies wird jedoch nur mit einer beliebig verstellbaren Luftschraube, nicht mit einer Zwei- oder Mehrstellungsluftschraube erreicht.
Aus dem oben Gesagten ergibt sich, daß die Flugleistung der neuzeitlichen Maschinen mit modernen Flugmotoren ohne Verstellluftschrauben nicht erreichbar wäre. Es ist daher begreiflich, daß überall in den letzten Jahren der Entwicklung der Verstellschraube besondere Aufmerksamkeit zugewandt wurde. Trotzdem gibt es auf der ganzen Welt nur wenige praktische Lösungen, die ihre Betriebssicherheit bewiesen haben.
Eine der besten Lösungen, die auch im Ausland viel Interesse gefunden hat, ist die im „Flugsport44 Nr. 10 Jahrg. 1938 S. 249—258 bereits beschriebene VDM-Verstellschraube, mit der die neue deutsche Luftwaffe derzeitig nahezu vollständig ausgerüstet wird. Mit diesem Gerät können die Vereinigten Deutschen Metallwerke AG., Frankfurt am Main-Heddernheim, bis zu dem jüngst erflogenen Geschwindigkeits-Weltrekord auf eine sehr beachtliche Erfolgsserie zurückblicken*).
Bereits bei dem erstmaligen geschlossenen Auftreten der deutschen Luftwaffe im Ausland anläßlich des Züricher Flugmeetings 1937 wurden bereits 7 entscheidende Wettbewerbssiege mit diesen Schrau-ben erflogen.
*) Siehe Seite 236.
Die überlegene Leistungsfähigkeit der VDM-Verstelluftschraube hat in Fachkreisen des Auslandes starke Beachtung gefunden. C. G. Grey bringt in seiner viel gelesenen Zeitschrift „The Aeroplane" eine genaue Beschreibung mit beifolgender Zeichnung, die wir in Abb. 3 und 4 wiedergeben.
Die Perspektivzeichnung Abb. 3 zeigt die Betriebsanordnung des „VDM"-Verstellgetriebes. Man beachte die hohle Luftschraubenwelle zur Aufnahme einer Kanone, das Enteisungsgerät und die patentierte, schnell abnehmbare Haube.
Zur Erläuterung ist in Abb. 4 eine rein schematische, auseinandergezogene Skizze, die das Prinzip des „VDM"-Verstellgetriebes mit größerer Deutlichkeit wiedergegeben.
Der Verstellantriebsring G, welcher auf der Luftschraubenwelle frei rotierbar ist und über biegsame Welle und Zahnrad C durch einen Elektromotor gedreht wird, trägt Planetenräder H, welche in das auf der Luftschraubenwelle befestigte Sonnenrad J eingreifen. Die Planetenräder H greifen zu gleicher Zeit auch in das Sonnenrad K ein, welches auf der Luftschraubenwelle frei beweglich ist. Dieses Rad K hat mehr Zähne als J (K 86 Zähne, J 82 Zähne), so daß die Planetenräder H, wenn sie um J und K umlaufen, bewirken, daß sich das Rad K um einen geringen Wert mit Bezug auf J vorwärts bewegt. So ergibt sich, daß K etwas schneller als J rotiert.
Das Sonnenrad K ist breit genug, um die Möglichkeit zu schaffen, daß auch ein zweiter Satz von Planetenrädern L in dieses eingreift, welche auf ihren eigenen Achsen frei rotieren, jedoch nicht um K umlaufen können. Sie sitzen auf der feststehenden Platte 0, die an dem Flugzeugmotor befestigt ist. Die Planetenräder L greifen gleichzeitig in den Ring M ein, der frei auf der Luftschraubenwelle sitzt und aus einem Stück mit dem Ring N ist. Der Ring N kämmt mit demjdeinen Zahnrad P, welches aus einem Stück mit der Schnecke ist, die mit dem Schneckenrad an der Blattwurzel kämmt.
So werden durch eine Bewegung von G, die durch das vom elektrischen VerStellmotor angetriebene Zahnrad C bewirkt wird, die Planetenräder H um J gedreht und K mit Bezug auf J wegen des Zähneunterschieds vorwärts- oder zurückbewegt. K rotiert die Planetenräder L, welche M und N antreiben. N greift in P ein, wodurch die Schnecke gedreht und die Steigung der Luftschraube verändert wird.
Wenn G stationär ist, laufen die Planetenräder H, durch J gedreht, lose auf ihren eigenen Achsen. So bewegt sich N mit der gleichen Geschwindigkeit wie J ohne jede Relativbewegung. Somit ist, da P sich auch mit der Luftschraube dreht, keine Relativbewegung zwischen N und P und somit auch keine Steigungsveränderung vorhanden.
Bei der „VDM"-Enteisungsvorrichtung in der oberen Zeichnung
*) Weltrekorde mit deutschen Flugzeugen, gestartet mit VDM.-Verstellluftschrauben:
Messerschmitt (11. 11. 37) 611.004 km. Größte Geschwindigkeit auf Basis über 3 km.
Heinkel (22. 1,1. 37) 504 km. 1000 km ohne Nutzlast; 1000 km mit 500 kg; 1000 km mit 1000 kg.
Heinkel (19. 3. 38) 1000 km ohne Nutzlast; 1000 km mit 500 kg; 1000 km mit 1000 kg; 1000 km mit 2000 kg; 2000 km ohne Nutzlast; 2000 km mit 500 kg; 2000 km mit 1000 kg; 2000 km mit 2000 kg.
Dornier Do 18 (27.-28. 3. 38) 8400 km Langstrecken - Weltrekord in 43 Std. (ca. 200 km/Std.).
Junkers (Ju 90 „Großer Dessauer" (5. 6. 38) 9312 m Höhe mit 5 t Nutzlast;
7242 m Höhe mit 10 t. Heinkel (7. 6. 38) über 100 km 634,37 km/Std.
wird eine Enteisungs-Glykol-Flüssigkeit in der kreisförmigen Rinne R, die mit der Haube rotiert, infolge der Fliehkraft die Röhre S hinaufgedrängt und aus ihr heraus an die Luftschraubenblätter.
Inzwischen wurde bei der Entwicklungsabteilung an der weiteren Vervollkommnung dieses Gerätes gearbeitet und vielversprechende Lösungen gefunden, die weitere Fortschritte auch auf diesem Gebiet, in Kürze erhoffen lassen.
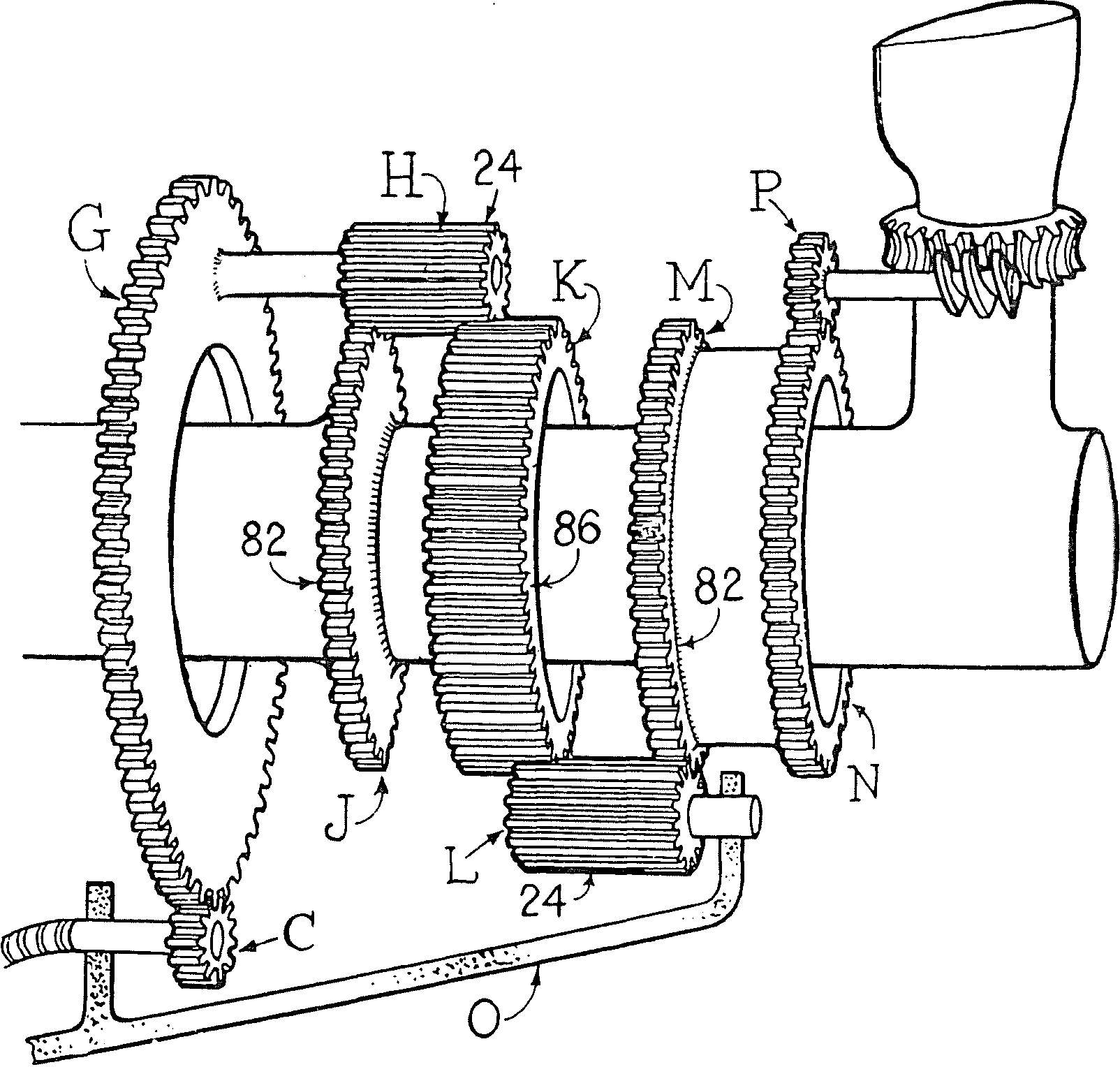
Abb. 4.
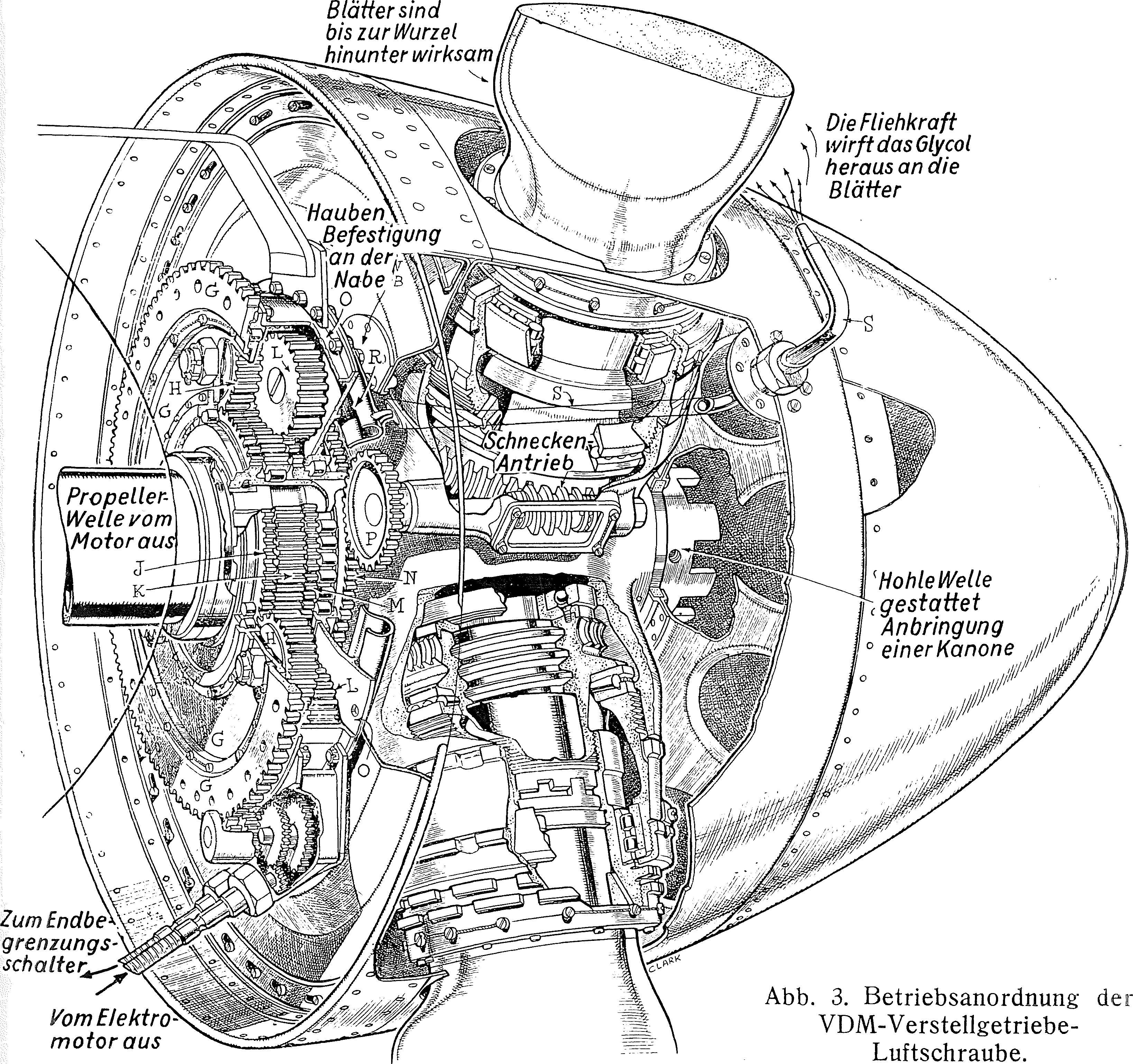
KQN5TRUKTIQN5 INZELHHTBI
Konstruktionselemente aus dem Segelflugzeugbau,
Von Ing. Herbert Lück, DFS. So sehr sich auch die einzelnen Gleit- und Segelfingzeugmuster in der Konstruktion voneinander unterscheiden, so kommen doch eine Reihe von Konstruktionselementen immer wieder vor. Aus diesem Grunde lohnt sich eine Vervollkommnung dieser Details auch dann, wenn es sich um kleine und, verglichen mit der gesamten Konstruktionsarbeit, nebensächliche Teile handelt. Im folgenden sollen einige Konstruktionselemente mitgeteilt werden, die sich in dieser Form bewährt haben.
Deckelverschluß für Segelflugzeuge.
Der in nebenstehenden Abb. 1—3 dargestellte Verschluß (Idee v. Meister Müller) eignet sich für Handlochdeckel sowie für sonstige
Abb. l.
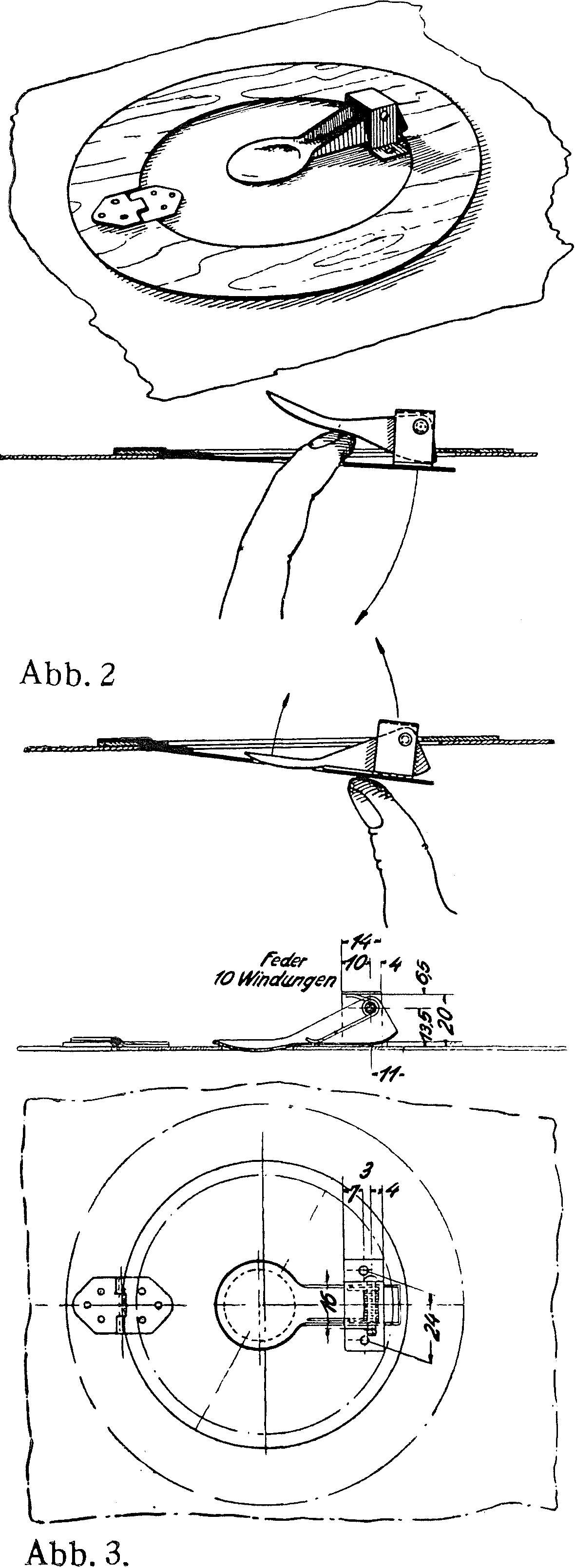
Zeichnungen DFS.
Deckel, Klappen usw., wie sie im Segelflugzeugbau vorkommen. Er hat gegenüber bekannten Ausführungen folgende Vorteile:
An der Außenseite des Deckels sind keine vorstehenden Teile vorhanden. Der Deckel enthält keine Löcher, durch die man mit den Fingern hindurchgreifen muß, um den Verschluß zu erreichen. Der Deckel kann nicht durch etwa vorhandenen Unterdruck (infolge der Strömung) geöffnet werden. Der Verschluß schließt selbsttätig (Schnapper), wenn man den Deckel einfach zudrückt (Abb. 2). Der Verschluß ist in der Herstellung sehr billig.
Mit diesem Verschluß ausgerüstete Handlochdeckel für Segelflugzeuge sind vor kurzem vom NSFK. in der Technischen Mitteilung Nr. 16 (Arbeitsunterlagen für Segelfluggerät) bekanntgegeben worden. Sie werden in Massenanfertigung von Benninghoven, Velbert (Rhld.), hergestellt und sind zum Preise von RM 0.75 für runde und RM 0.80 für ovale Deckel bei der Beschaffungsstelle des NSFK. bzw. für Industriewerke bei der Herstellerfirma selbst zu beziehen. Einstellbarer Rollenbock.
Jeder Konstrukteur und jeder Werkstattmann kennt die Schwierigkeit, einen Rollenbock zu konstruieren und richtig einzubauen, dessen Seil-Auf- und -Ablauf in einer Ebene liegt, die nicht parallel und nicht senkrecht zu der Ebene des Bauteils liegt, an dem der Rollen-
Abb. 4u. 5.
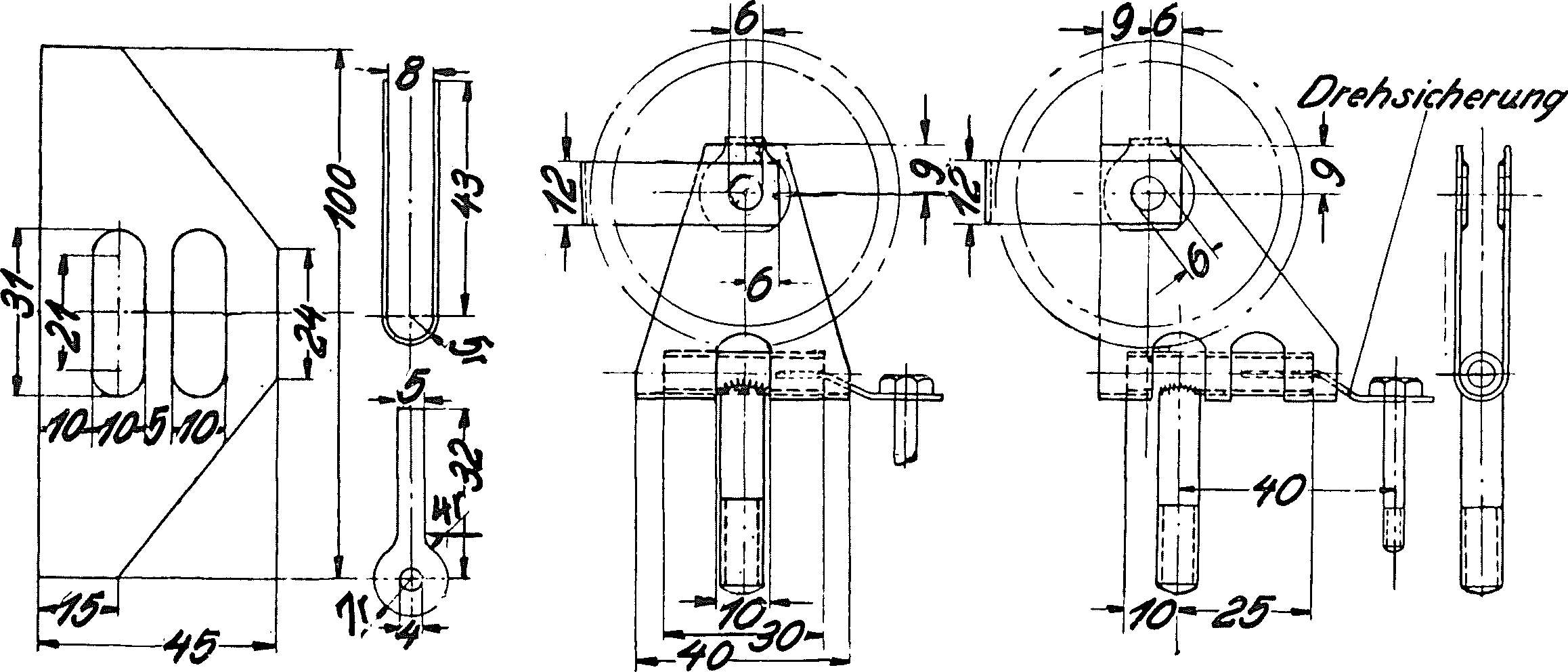
bock befestigt werden soll. Die in solchen Fällen erforderlichen schiefen Rollenböcke pflegen meistens nicht genau zu sein, so daß das Seil nicht einwandfrei abläuft. Der in Abb. 4 (vgl. auch „Flugsport", S. 152, Abb. 10) dargestellte Rollenbock ist in jeder Richtung einstellbar. Vor dem Ansetzen wird in den Bauteil, an dem er befestigt werden soll, ein Loch von 8 mm 0 gebohrt, in das der Rollenbock mittels seiner Befestigungsschraube eingesetzt wird. Da er nur diese eine Befestigungsschraube hat, ist er, solange die Schraube nicht fest angezogen ist, um diese drehbar. Gleichzeitig kann er um seine Schwenkachse geschwenkt werden, so daß also eine genaue Einstellung möglich ist. Erst danach wird die Mutter der Befestigungsschraube gut angezogen, so daß der Rollenbock sich etwas ins Holz eingräbt und in der gewünschten Stellung stehen bleibt. Um bei ungenügender Reibung ein Verdrehen um die Befestigungsschraube im Betrieb zu verhindern, ist eine Drehsicherung vorgesehen, die aus einer Sicherungsscheibe und einer Schraube M4 besteht. Diese Drehsicherung wird ganz zum Schluß angebracht.
Die Seilsicherung ist ebenfalls einstellbar, so daß sie für jede Seilrichtung paßt. Sie wird durch eine Sicherungsscheibe gegen Verdrehen gehalten.
Der Konstrukteur braucht die Lage der Rolle nicht mehr durch exakte Konstruktionsmethoden zu bestimmen. Für das Vorsehen von Füllklötzen in dem Bauteil, der die Rolle trägt, und für die Kontrolle, ob die Rolle von anderen Bauteilen genügend klar geht, genügt ein Abschätzen der ungefähren Rollenlage. In der Werkstattzeichnung wird nur die Bohrung für die Befestigungsschraube vermaßt. Die Lage der Rolle wird nur angedeutet.
Abb. 5 zeigt den Rollenbock in anderer Ausführung, so daß er für die verschiedensten Seilrichtungen verwendbar ist. Voraussetzung ist jedoch, daß die resultierende Seilkraft keine gegen die Befestigungsebene gerichtete Komponente hat. Denn eine solche könnte ihn infolge Labilität gegen die Befestigungsebene klappen. Er ist in dieser Hinsicht mit den bekannten schwenkbaren Rollenböcken zu vergleichen, wenn auch die durch die Befestigungsschraube hervorgerufene Reibung ihn am Schwenken hindert.
Kugelführung für Stoßstange'1*).
Bei Leistungsflugzeugen erfordert eine erstrebte Verbesserung der Flugeigenschaften oftmals eine Erhöhung der Steifigkeit in den Steuerleitungen. Das führt zwangsläufig zur Verwendung von durchgehenden Stoßstangenantrieben, Sind solche Stoßstangen aber mehr als 1,5 m lang, so bedeutet das erhebliches Mehrgewicht, wenn man nicht durch geeignete konstruktive Maßnahmen die freie Knicklänge verkürzt. Man kann das z. B. dadurch machen, daß man die Stoßstange an Hebeln aufhängt, die man zweckmäßig in einem Abstand von etwa
*) Zum Patent angemeldet.
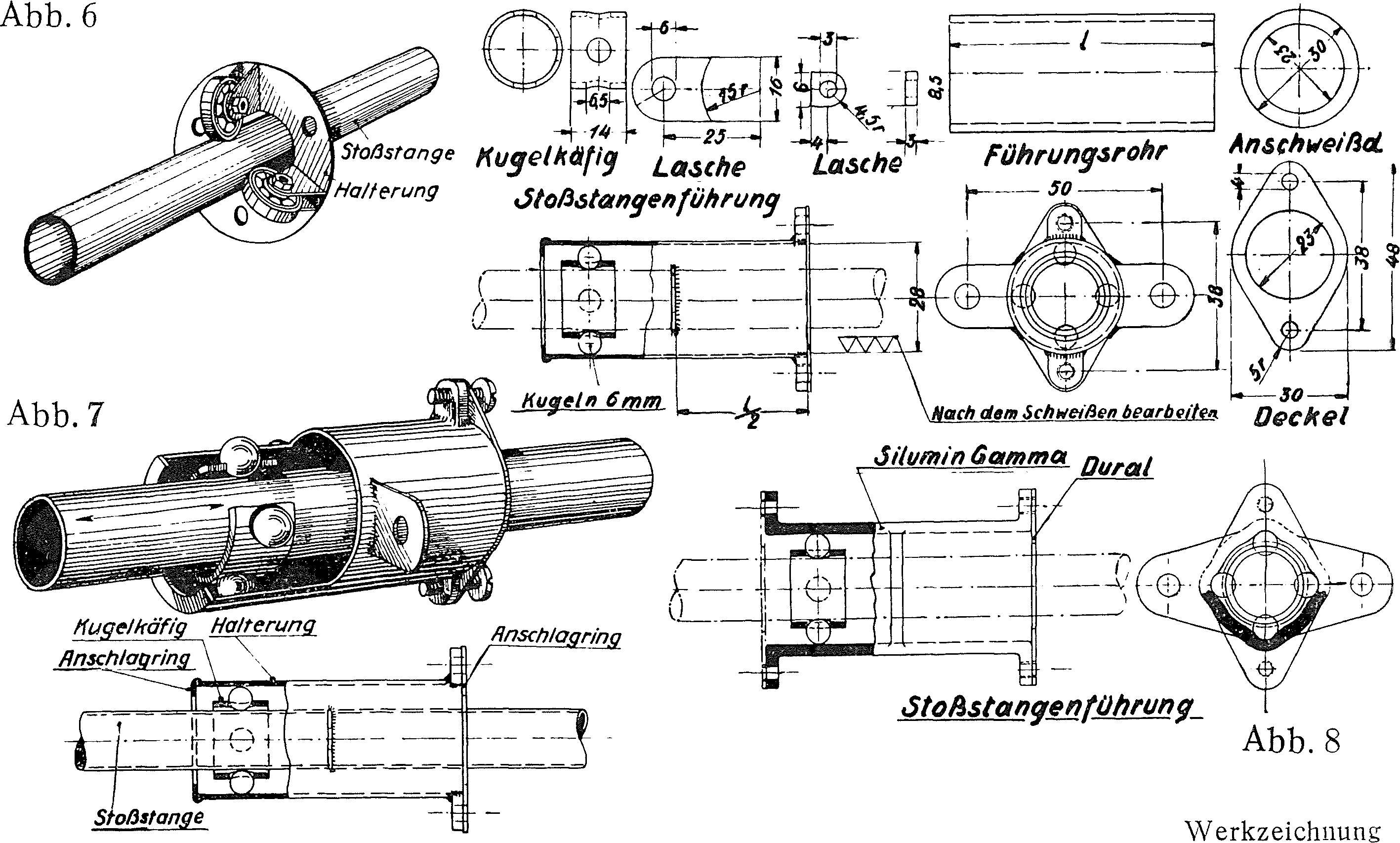
Abb. 7. 1 = 0 s angenwe^ g^ Außendurchm. der Stoßstange 16 mm.
Gewicht der Führung für Stoßstange von 15 mm & bei Ausführung in Stahl, geschweißt (einschl. Kugeln): 60 g.
1 m anordnet und die gegen seitliches Ausknicken sicher sind. Ein weiteres Mittel ist die in Abb. 6 dargestellte Rollenführung, die im Motorflugzeugbau allgemein üblich ist. Diese beiden Konstruktionsarten sind aber, leichten Gang der Steuerung und daher Kugellagerung vorausgesetzt, verhältnismäßig schwer und teuer.
Die in Abb. 6 und 7 gezeigte Kugelführung ist in dieser Hinsicht billiger. Das Gewicht pro Führung beträgt etwa 55 g. Die Herstellungskosten sind bei Serienherstellung erheblich billiger als sie bei den oben erwähnten Konstruktionsarten sein können, z. B. kann man die Führung aus Siluminguß herstellen (Abb. 8).
Bei der Höhensteuerleitung des Segelflugzeugmusters DFS-Reiher wurden weitgehend Kugelführungen verwendet. So wurde auch das hintere Ende des Torsionsrohres der Handsteuerung als Kugelführung ausgebildet.
Selbsttätig gesicherte Stoßstangenkupplung**).
Segelflugzeuge müssen bekanntlich sehr oft ab- und aufmontiert werden, besonders wenn sie für Streckenflüge eingesetzt werden. Nicht immer gelingt es, einen geeigneten Landeplatz zu erreichen, von dem aus das Segelflugzeug nach seinem Startplatz zurückgeschleppt werden kann. Noch unangenehmer ist es, wenn man im Wettbewerb den erhofften Anschluß nicht bekommt, sondern kläglich absäuft. Dann heißt es eilig, eilig abmontieren. Jede Minute ist dabei kostbar, denn inzwischen erwischt die Konkurrenz die herrlichsten Barte und geht auf Strecke.
Es ist aus diesem Grunde Aufgabe des Konstrukteurs von Leistungssegelflugzeugen, nach Mitteln zu suchen, die geeignet sind, die Montagezeit des Segelflugzeugs zu verkürzen. Besondere Schwierigkeit bereiten dabei die Anschlüsse von Quersteuer- und Bremsklappenleitung, die ja beim Lösen des Flügels vom Rumpf getrennt werden müssen. Es gibt verschiedene brauchbare Konstruktionen, die diesen Anschluß selbsttätig herstellen. Sie sind aber teuer, so daß sie nur für teure Höchstleistungsflugzeuge in Frage kommen. Abb. 9 und 10 zeigen solche Konstruktionen.
**) Zum Patent angemeldet.
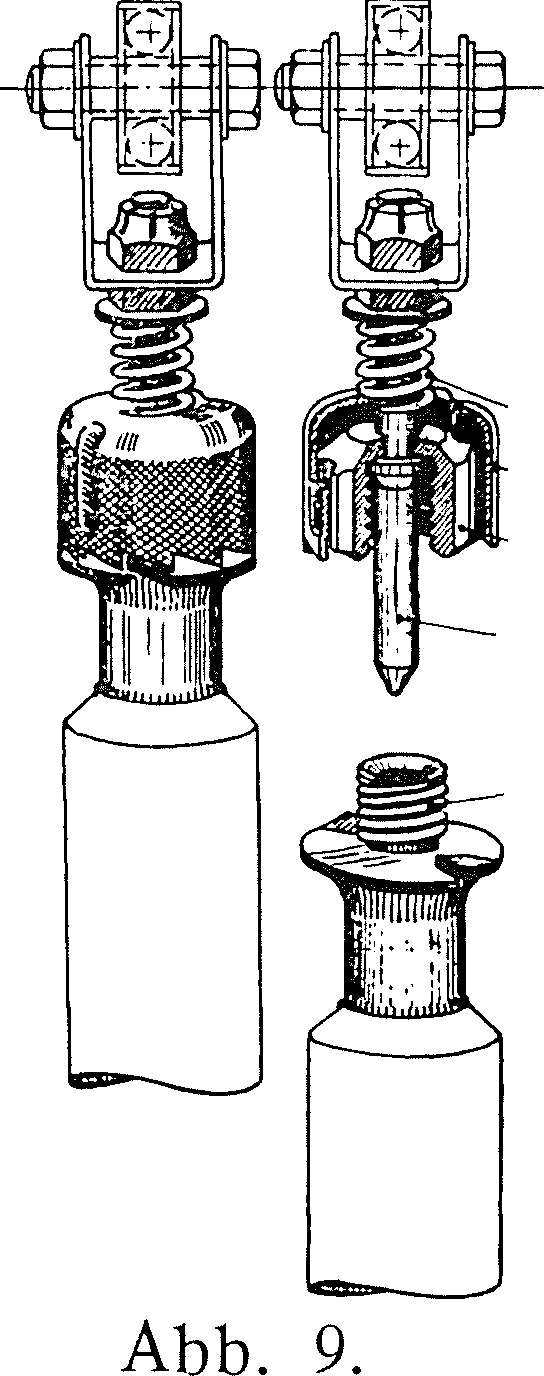
Feder-
Sicherungskappe Überwurfmutter
Führungsdorn dewindestück
Die im folgenden beschriebene selbsttätig gesicherte Stoßstangenkupplung erfordert unter Verzicht auf den vollautomatischen Anschluß nur einige einfache Handgriffe, durch die die Montage höchstens V2 Minute längert dauert als bei vollautomatischem Anschluß. Dadurch wird es ermöglicht, ein verhältnismäßig billiges Leistungssegelflugzeug in einer Zeit von 2—3 Minuten zu montieren.
Bei der in Abb. 9 dargestellten selbsttätig gesicherten Stoßstangenkupplung wird die Verbindung der zu kuppelnden Teile durch eine an dem einen Teil befindliche Ueberwurfmutter hergestellt, die auf ein Gewindestück des anderen Teils aufgeschraubt wird. Auf der Ueberwurfmutter ist eine Sicherungskappe so angeordnet, daß sie in achsialer Richtung verschiebbar ist, während sie bei Drehung (Gewinde andrehen bzw. lösen)
die Ueberwurfmutter infolge einer vorgesehenen Nut mitnehmen muß. Die Sicherung erfolgt dadurch, daß eine Verzahnung der Sicherungskappe hinter vorstehende Teile des Gewindestücks hakt. Die Sicherung wird durch eine Feder im Eingriff gehalten.
Durch Rändelung ist die Sicherungskappe so griffig, daß das Los-nnd Festdrehen von Hand und ohne Werkzeug erfolgen kann. Beim Zusammenbringen der beiden Kupplungsteile wird die Ueberwurfmutter durch einen Führungsdorn, der sich in das Gewindestück hineinschiebt, so an dieses herangeführt, daß das Gewinde immer sofort fassen muß. Dadurch wird erreicht, daß die Verbindung an schwer zugänglichen Stellen mit Leichtigkeit auch einhändig und ohne hinzusehen hergestellt und gelöst werden kann.
Die Sicherung erfolgt selbsttätig. Auch beim Lösen der Verbindung ist für das Entsichern kein besonderer Handgriff erforderlich. Es ist nur nötig, die Sicherungskappe unter gleichzeitiger rückdrehender Bewegung (zum Losschrauben der Ueberwurfmutter) in achsialer
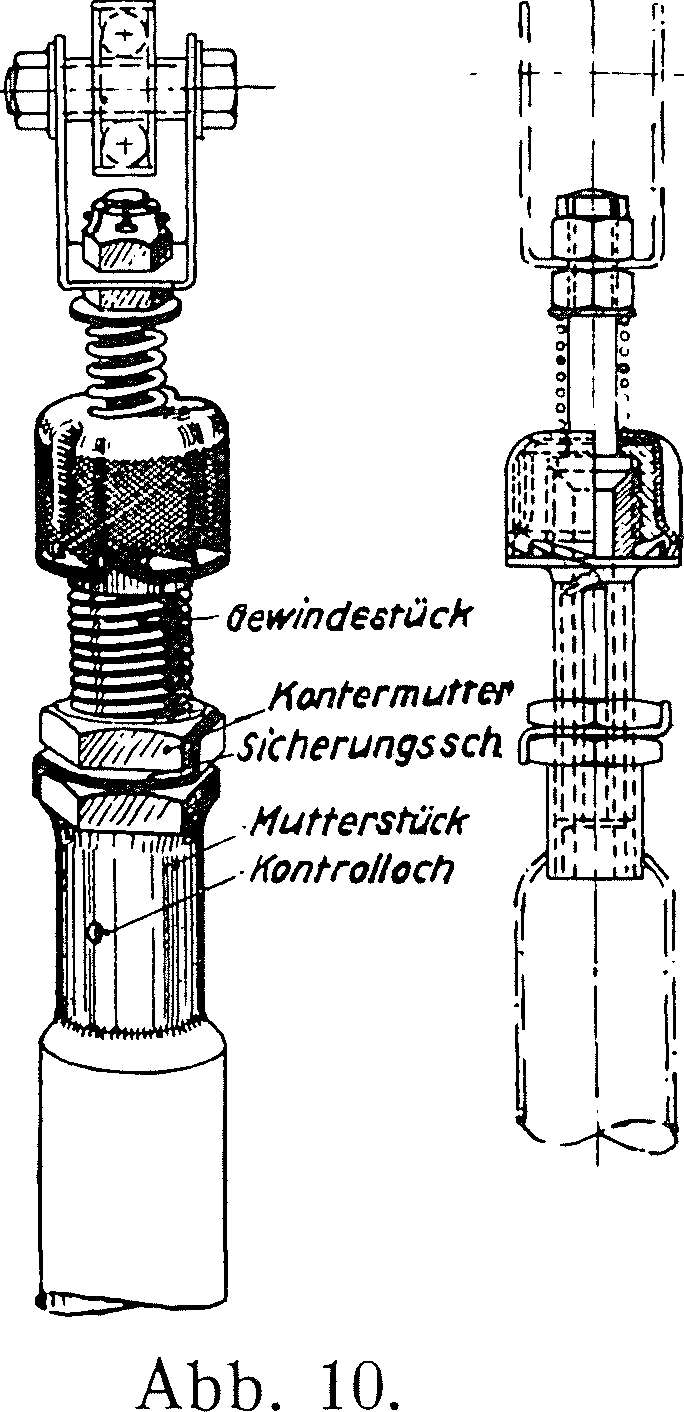
Kupplung einschl. Längenverstellung: 78 g.
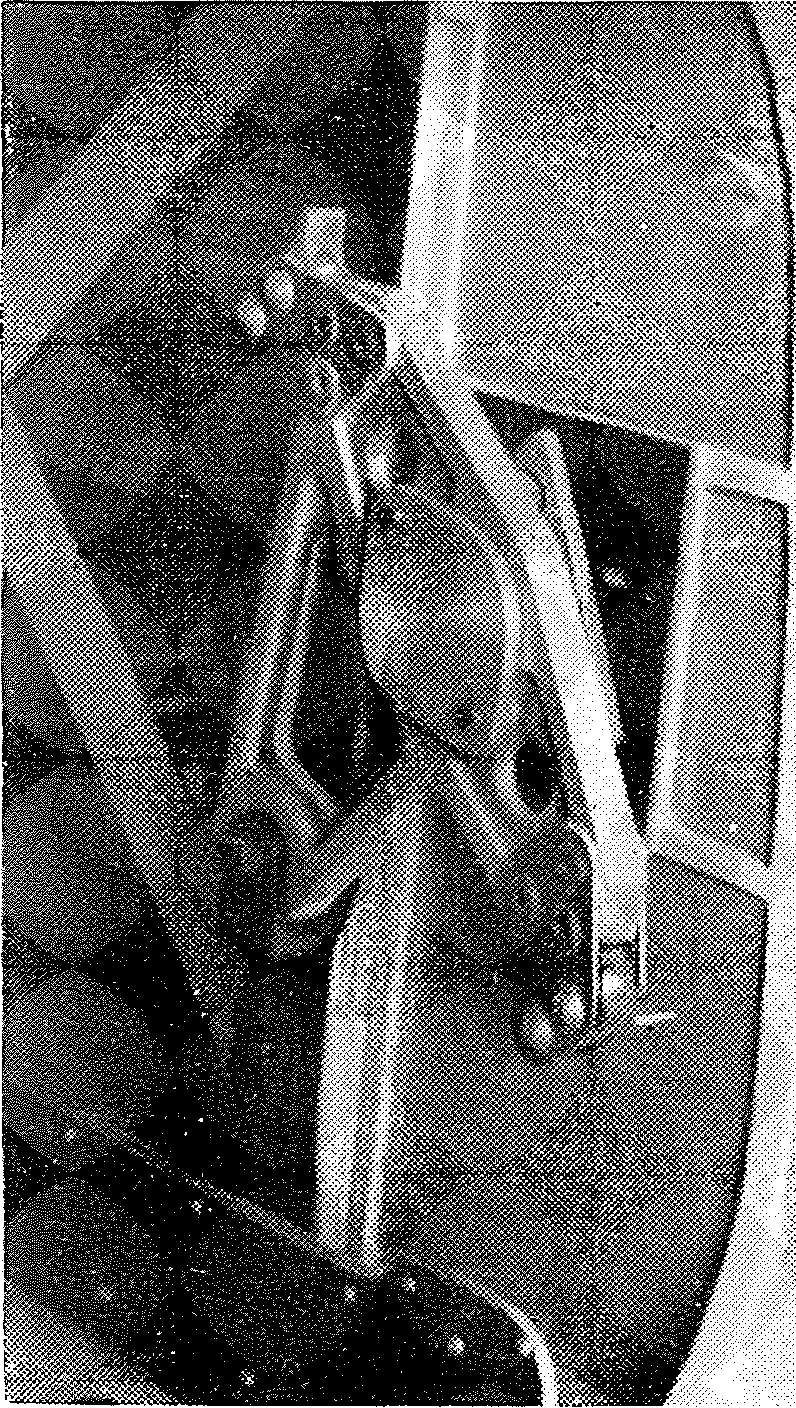
Abb. 11.
Anschlüsse von Querruder-
Abb. 12.
Steuer- und Bremsklappenleitung.
Bilder DFS
Richtung und entgegen dem Federdruck zurückzuschieben, und zwar so lange, bis die Verzahnung der Sicherungskappe nicht mehr auf der Gegenseite (Gewindestück) einhaken kann.
Bei gelöster Stoßstangenkupplung sind keine losen Einzelteile, z. B.: Bolzen, Muttern, Scheiben, Splinte usw., die verloren gehen können, vorhanden. Die Qualität der Verbindung ist nicht von hochgradigen Passungen abhängig. Durch Abnutzung im Betrieb kann kein zusätzliches Spiel in der Verbindung entstehen, da es trotz Abnutzung immer möglich ist, die Ueberwurfmutter fest anzuziehen.
Die selbsttätig gesicherte Stoßstangenkupplung kann auch mit einer Vorrichtung zum Verstellen der Stoßstangenlänge kombiniert werden (Abb. 10). Zu diesem Zweck wird das Gewindestück nicht fest mit der Stoßstange verbunden, sondern in ein mit der Stoßstange fest verbundenes Mutterstück eingeschraubt,
Hawker, hochziehbares Fahrwerk*).
Das radtragende Element eines Flugzeugfahrwerks ist um eine einzige Achse angelenkt, welche, wie man aus der Zeichnung ersieht,
beim Hochziehen seitlich, rückwärts und aufwärts schwingt.
Das Federbein c ist mit Achse a angelenkt, die zur Längsachse des Flugzeugs und zur Fläche leicht geneigt ist. Abb. Hebel b ist mit dem Federbein c fest verbunden. Der um die Achse e drehbare hydraulische Druckzylinder d bewegt das in g gelagerte Dreieck h, wodurch über Glied i das Fahr werk ein-bzw. ausgefahren wird. *) Engl. Pat. vom 13. 7. 37 unter Nr. 19 414 (Klasse 4).
Elastische Flugmotorenlagerung Barenyi.
Verstrebte Flugmotorenaufhängungen mit Gummipuffern oder Gummimanschetten, ebenso Einbau von schwingungsdämpfenden Strebengliedern sind bereits mehrfach ausgeführt worden. Barenyi schlägt nun den Einbau hoch- und allseits flexibler Gummilager mit verhältnismäßig großer Lagerungsbasis vor.
Nebenstehende Abb. zeigt eine solche elastische Motorenaufhängung nach der französischen Patentschrift Nr. 823 562, wobei unter Verwendung eines ausladenden Trägers eine möglichst große Abstüt-zungsbasis als Vorbedingung für eine vollelastische Lagerung erreicht wird. Die Abb. 1 und 2 zeigen einige Ausführungen.
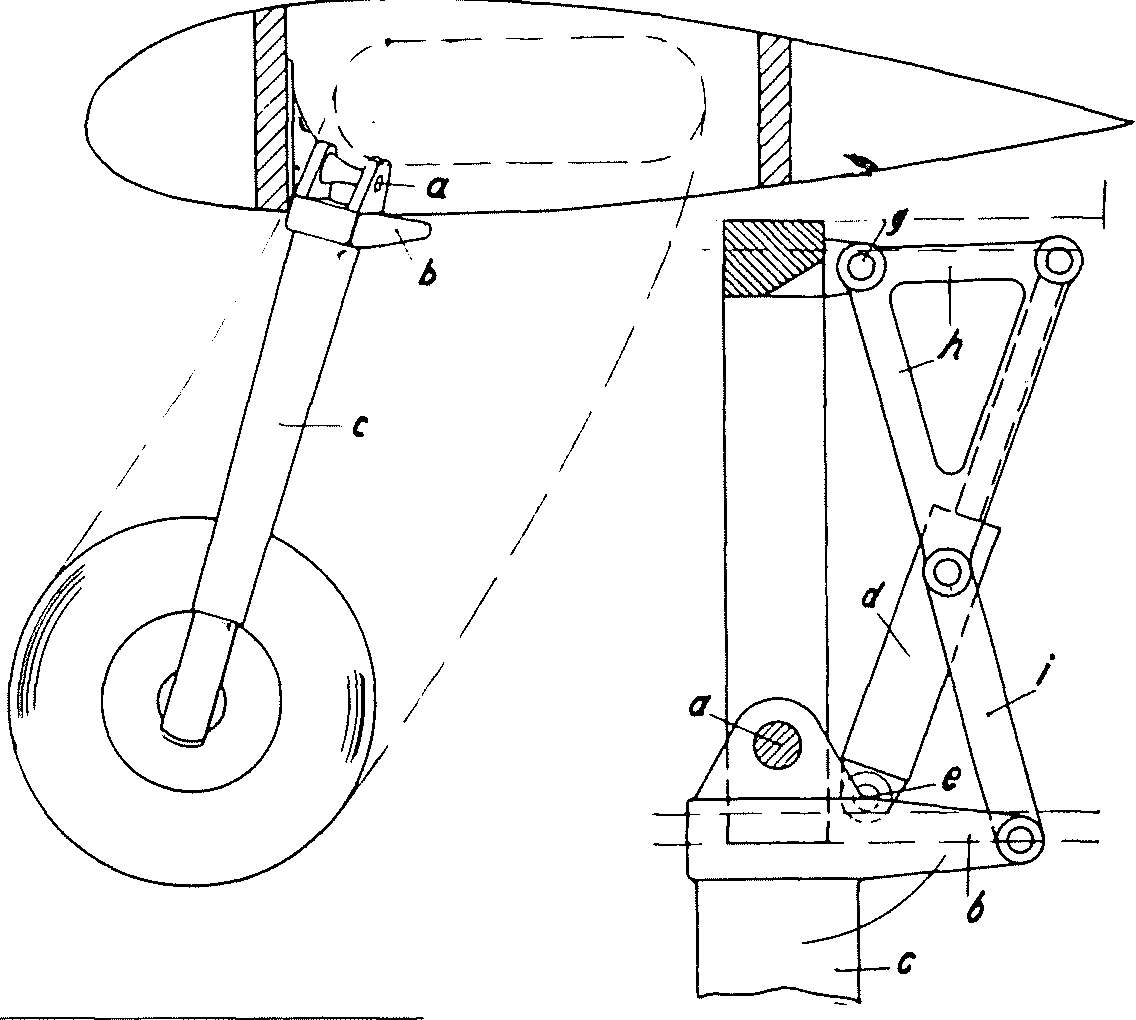
h 9
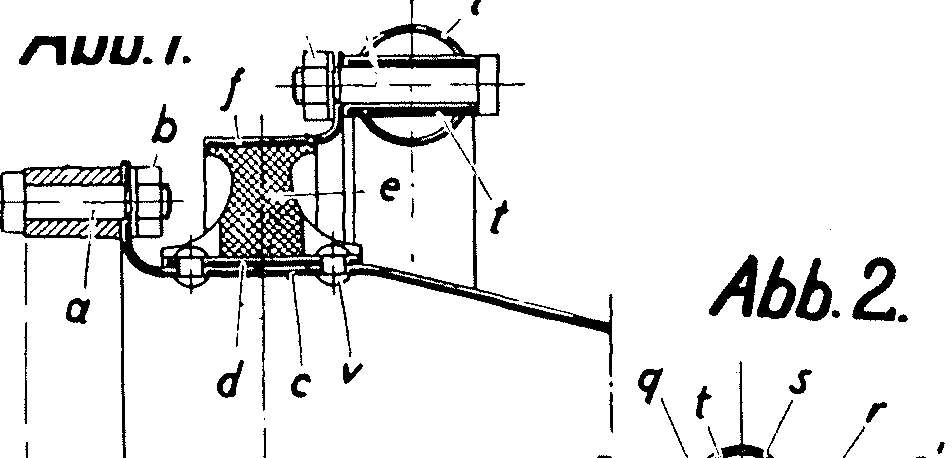
Flugmotorenlagerung Barenyi.
Zeichnung Flugsport

Abb. 1. Mittels Bolzen a und Mutter b ist der Motor am Flansch befestigt. Auf den Flansch ist zur Verstärkung ein Ring d genietet, auf welchem der Gummiring e aufvulkanisiert ist. Um diesen spannt sich der umgebördelte Ring f, der wieder mittels Bolzen g und Mutter h am Montagering i angeschraubt ist.
Abb. 2 (Fortsetzung von Abb. 1). Ueber das trompetenförmige Stück j ist eine Schale k gestülpt, diese ist durch die Bolzen 1 und die Muttern m mit einer Gegenschale k' verbunden. Um die beiden Schalen liegen unter Zwischenschaltung eines Metallringes n die Gummiringe o und o'. Die Gummiringe werden geführt und gehalten durch die umgebördelten Ringe p und p', die mittels Bolzen q und Mutter r fest mit dem Montagering s verbunden sind. Der Gummi ist nach einem besonderen patent. Verfahren aufvulkanisiert, t = Buchse: u = Führungsring; v = Niet. Hauptaufgabe bei der praktischen Ausführung war, die Lagerung axialflexibel zu gestalten sowie eine einwandfreie „Bindung" zwischen den Gummifedern und den sie begrenzenden Platten zu erzielen. Die vom Motorblock ausladenden Träger bestehen aus Stahlblech bzw. Dural-Rohren, die Platten der Gummi-Metall-Federn aus gestanztem Dural-Blech.

Askania-Rekord-Meßstation.
Bei der Aufstellung des neuen Weltrekords von 746,66 km/h von Dieterle auf Heinkel-Flugzeug mußten die 3 km der Rekordstrecke in knapp 15 sec durchflogen werden. Es war daher notwendig, die Durchgänge auf hundertstel und womöglich auf tausendstel Sekunden genau zu messen. Dazu kommt noch, daß die Meßeinrichtng bestimmten Anforderungen der FAI genügen muß, weil die Ergebnisse internationale Anerkennung finden sollen, somit muß der Hersteller der Meßgeräte eine besonders große Verantwortung übernehmen.
Grundsätzlich ist das Meßverfahren einfach, indem nämlich der Durchgang des Flugzeuges durch zwei Zielebenen und die dazugehörigen Zeiten bildmäßig festgehalten werden; die Schwierigkeiten liegen nur darin, daß die Zeitbestimmung jedes Durchganges auf Bruchteile einer hundertstel Sekunde genau erfolgen muß. Mit der Askania-Rekord-Meßstation ist es gelungen, sogar die Genauigkeit von etwa Viooo Sekunde zu erreichen, dabei bleiben das Gewicht der Geräte und der Kraftbedarf unter dem sonst für solche Zwecke erforderlichen Aufwand.
Die Rennstrecke (vgl. Abb. 1) war durch 2 in einer Entfernung von 3000 m einbetonierte Meßstangen von 10 m Höhe bezeichnet. Rechtwinklig dazu standen im Abstand von 200 m je 2 gleichhohe Stangen, wodurch sich ein Rechteck von 3000X200 m ergab. In Verlängerung der kurzen Seiten dieses Rechteckes, 50 m vor den vorderen Meßstangen, wurden zwei Askania-Hochfrequenz-Kinokammern*) mit Motorantrieb aufgebaut (vgl. Abb. 1). Die Stangen in jeder Zielebene bildeten dabei gewissermaßen Kimme und Korn, die durch das Objektiv der Kamera anvisiert wurden. Der Bildwinkel der Kino-Objektive
*) Hochfrequenz-Kinokameras sind solche, bei denen die Bildzahl in der Sekunde über die normale Zahl von 24 hinaus bis auf etwa 100 hochgetrieben werden kann.
war so gewählt, daß ein Bildfeld von 90X120 m — an der hinteren Meßstange gedacht — auf dem Kinofilm zur Aufnahme kam. In jedem Filmbild wurden also das Flugzeug, die vordere Stange und die beiden im Bild unmittelbar rechts und links daneben erscheinenden hinteren Meßstangen aufgenommen (vgl. Abb. 1). Mit den Kameras war noch ein Oszillograph (vgl. Abb.), mit diesem ein Chronometer elektrisch verbunden.
Entsprechend den internationalen Vorschriften durfte das Flugzeug nicht hoher als 75 m über dem Erdboden fliegen. Die Anlaufstrecke betrug 500 m in gleicher Höhe, beim Wenden durfte eine Höhe von 400 m nicht überschritten werden. Die Meßstrecke wurde in jeder Richtung zweimal durchflogen und der Mittelwert aus den 4 Messungen dem Ergebnis zugrunde gelegt.
An jeder Kamera stand ein Beobachter, der durch Feldfernsprecher über die Entfernung des Flugzeugs von der Zielebene unterrichtet wurde. 500 m vor dem Anflug wurde dann die erste Kamera auf 50 Bilder in der Sekunde geschaltet. Bei Eintritt des Flugzeugs in das Bildfeld löste der Beobachter durch Handkontakt ein Blinkzeichen in der Kamera aus, das neben jeder Aufnahme auf dem Filmstreifen einen Lichtpunkt abbildete. Damit übereinstimmend wurden auf dem Registrierstreifen des Oszillographen Zeitmarken aufgezeichnet. Jede dieser Zeitmarken ist also einem Bild zugeordnet (vgl. Abb. 2). Zur Feststellung des Zeitpunktes einer Einzelaufnahme wird nun die zugehörige Zeitmarke mit den fortlaufenden Zeitmarken verglichen, die von einer Kontaktuhr und einem Schwingungserzeuger für 500 Hz auf denselben Oszillographenstreifen aufgeschrieben werden. Während die Kontaktuhr beispielsweise die vollen Sekunden angibt, dient die Wellenlinie von 500 Schwingungen in der Sekunde zur Unterteilung der vollen Sekunden in Tausendstel. Selbstverständlich müssen die Zeichen des Kontaktchronometers auf etwa Viooo Sekunde genau einsetzen. Die mit dem vorliegenden Verfahren erreichte Genauigkeit ist damit wesentlich höher als die durch die internationalen Bedingungen vorgeschriebene von Vioo Sekunde.
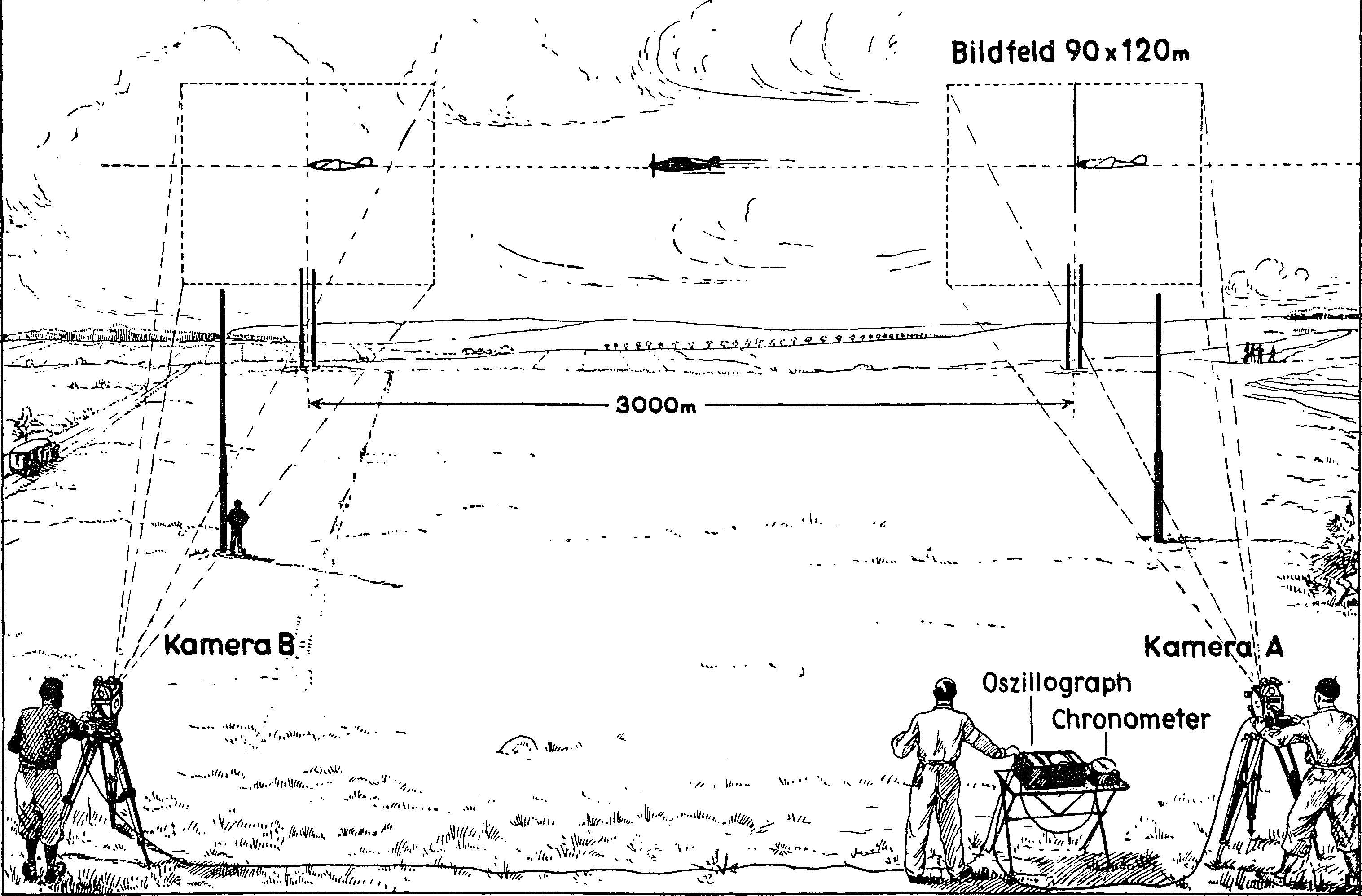
Abb. 1. Askania-Rekord-Meßstation.
Nachdem das Flugzeug die erste Meßebene bzw. das Bildfeld verlassen hatte, wurde die Kamera A stillgesetzt, und nach wenigen Sekunden, wiederum bei 500 m Abstand des Flugzeugs von der zweiten Meß ebene, wurde die Kamera B eingeschaltet. Nun wiederholte sich durch die Kontaktgabe an der Meßstelle B der Vorgang in dem Oszillographen.
Bei der Auswertung werden die zusammengehörigen Zeitmarken auf dem Oszillographenstreifen und den Filmstreifen ermittelt. Dann
werden die Filmbilder, die das Flugzeug auf den gleichen Punkt bezogen zeigen, ausgesucht und ihr Zeitpunkt nach den Zeitmarke n des Chronometers bestimmt, Die vollen Sekunden sind sehr einfach abzulesen, die Bruchteile werden durch genaues Auszählen der Schwingungsausschläge ermittelt (vgl. Abb. 2). So wurde es möglich, die durchzogene Zeit mit 14,464 Sek. zu errechnen.
Die Askania - Rekord-Meßstation hat neben ihrer hohen Genauigkeit den Vorteil, daß sie gegenüber umfangreichen und teuren Meßeinrichtungen des Auslandes in sehr kurzer Zeit zusammengestellt werden kann, weil sie normale Kinoaufnahmeapparate benutzt.
Abb. 2. Registrierstreifen der Askania-Rekord-Meßstation-Geräte.
Filmstreifen
Oszillographenstreifen
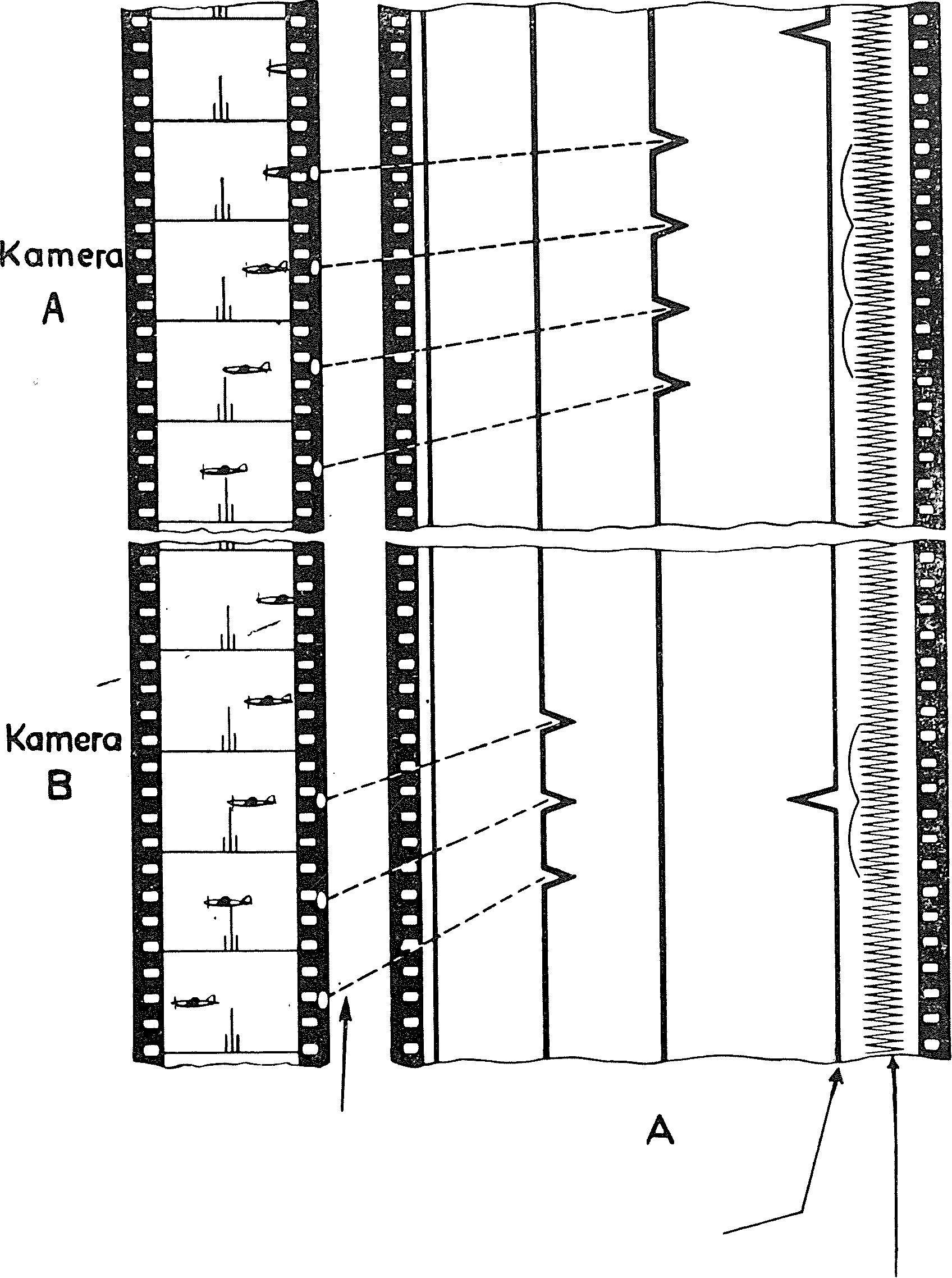
Belichtungs-Zeitpunkte B
Sekundenmarken des Kontakt-Chronometers

FLUG UM1SCH
V500sec-Zei+marken
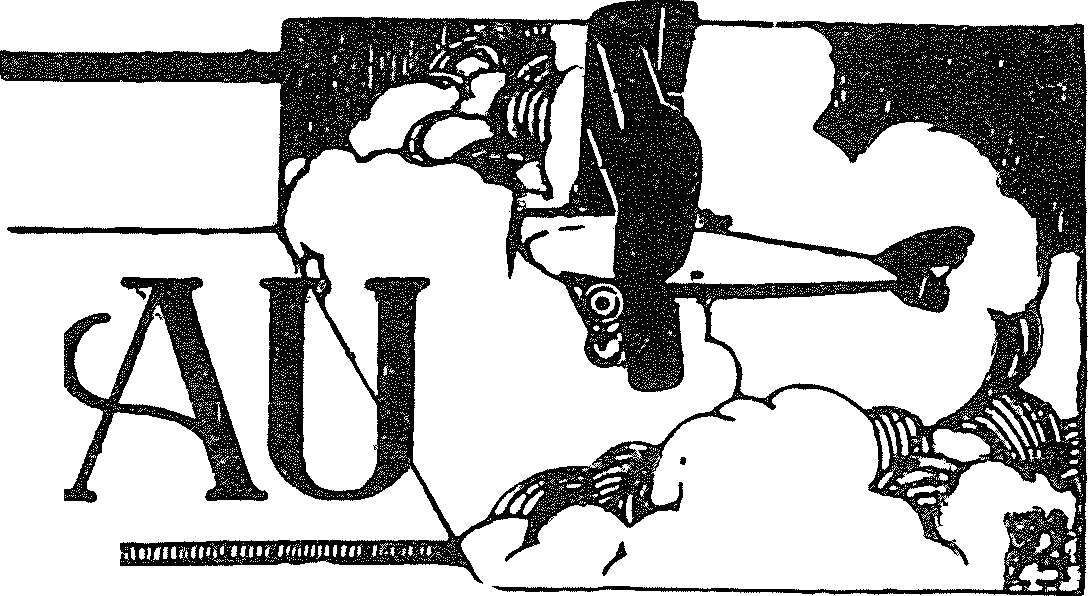
Inland.
Beförderungen in der Luftwaffe durch den Führer und Obersten Befehlshaber der Wehrmacht mit Wirkung vom 1. April 1939:
Zu Generalen der Flieger: die Generalleutnante Keller. Kühl;
zum General der Flakartillerie: den Generalleutnant von Schröder;
den Charakter als General der Flieger hat erhalten: der Generalleutnant Thomsen;
ferner sind befördert:
zum Generalleutnant: der Generalmajor Geisler;
zu Generalmajoren: die charakterisierten Generalmajore: von Römer, Freiherr von Freyberg-Eisenberg-Allmendingen, Walz, Freiherr von Bülow; die Obersten: Feyerabend, Harmjanz, Barlen, Keßler, Schauer, Suren, Mackensen von Astfeld, Mooyer;
zu Obersten: die Oberstleutnante: Pultar, Seebauer, Fröhlich, Ortner-Wei-
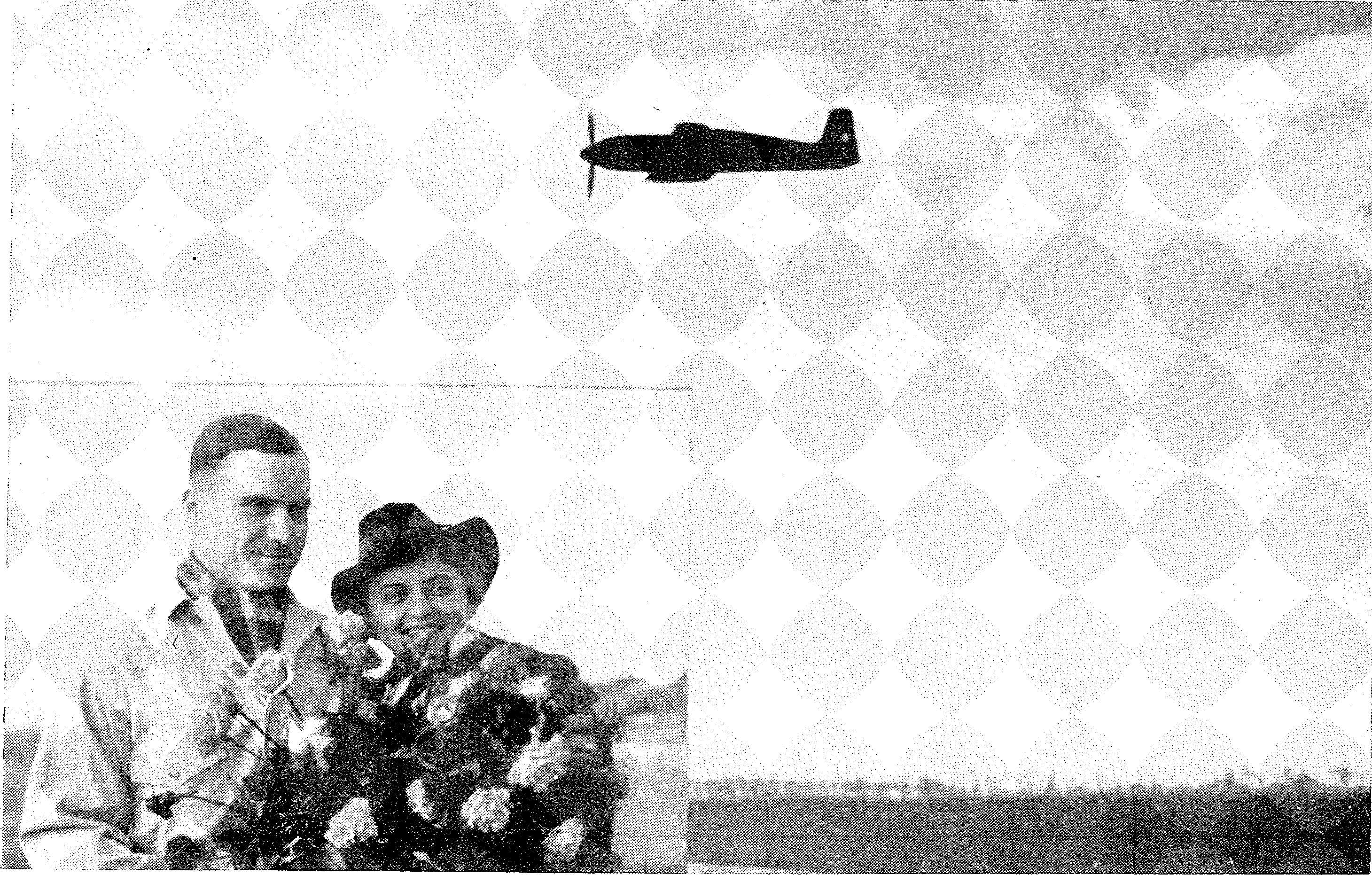
Heinkel He 112 U, Mot. DB 601, VDM-Prop, flog am 30. 3. 39 mit Dieterle am Steuer 746,66 km/h. Unten links das strahlende Ehepaar Dieterle.
Werkbilder
gand, Dimmel, Seifert, Kramer, Thym, Hein, Brunner, Böhm, Schörgi, Franz, Schilffarth, Reimann, von Rantzau, Kettner, von Arnim, Kuen, Dr. Sommer, Diplom-Ingenieur Cech, Klein, Erß, Banse, Diplom-Ingenieur Raithel, Korten, Boenicke, Diplom-Ingenieur Becker, Olbrich, Rieke, Baier, Metzner, Eichler, Navarre, Lukaseder, Riva, Garcke, Brandt, Dal Lago, Voitl, von Malortie, Witte, von Egan-Krieger, Heyrowsky.
4 Flugwettbewerbe finden auf Anordnung des Korpsführers des NSFK. an Stelle des ausfallenden Deutschlandfluges 1939 statt. (Vgl. „Flugsport" 1939, S. 212.) Außer dem Küstenflug an der Nordsee und an der Ostsee finden noch folgende Wettbewerbe statt:
Nordostdeutscher Rundflug am 10. und 11. Juni, der folgende NSFK.-Gruppen-gebiete berührt: NSFK.-Gruppe 2, NSFK.-Gruppe 4, NSFK.-Gruppe 6. Der Start ist auf dem Reichsflughafen Rangsdorf, Zielflughafen ist am 10. Juni der Flugplatz Wismar und Endziel der Flughafen Breslau. Beteiligt sind 29 NSFK.-Standarten.
Westdeutscher Rundflug am 24. und 25. Juni 1939, der folgende NSFK.-Gruppengebiete berührt: NSFK.-Gruppe 3, NSFK.-Gruppe 8, NSFK.-Gruppe 10, NSFK.-Gruppe 11, NSFK.-Gruppe 13, NSFK.-Gruppe 15, NSFK.-Gruppe 16. Der Start ist auf dem Flugplatz Konstanz, Zielflughafen am 24. Juni der Flugplatz Kassel und Endziel der Flughafen Köln. Beteiligt sind 32 NSFK.-Standarten.
Ausländ. Fliegeroffiziere waren am 19. 4. abends anläßlich der Feier des 50. Geburtstages des Führers im Haus der Flieger Gäste des Reichsministers für Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe, Generalfeldmarschall Göring. General der Flieger Pellegrini vom italienischen Luftministerium in Begleitung von Oberst Senzadenari und Commandatore Caco Pardo, der Chef der jugoslawischen Luftwaffe, Generalleutnant Jankovic (in Begleitung von Oberstleutnant Bakic), der Chef der bulgarischen Luftwaffe, Oberst Boideff, und der Chef des Stabes der spanischen Luftwaffe, Oberst Moreno, weilten im Kreise ihrer deutschen Fliegerkameraden.
Luftverkehr mit Sudetenland nach dem ab 16. 4. in Kraft tretenden Sommerflugplan an das Luftverkehrsnetz der Deutschen Lufthansa angeschlossen. Linien Berlin—Karlsbad—München, ferner Reichenberg—Dresden—Berlin. Weiterhin füh-
50. Geburtstag des Führers. Große Parade der Wehrmacht vor dem Führer. Oben: Teile der Luftwaffeneinheiten über der Gradestraße. Mitte und unten: Panzerwagen und Scheinwerferabteilungen während der Vorbeifahrt vor dem
Führer. Bilder: Weltbild
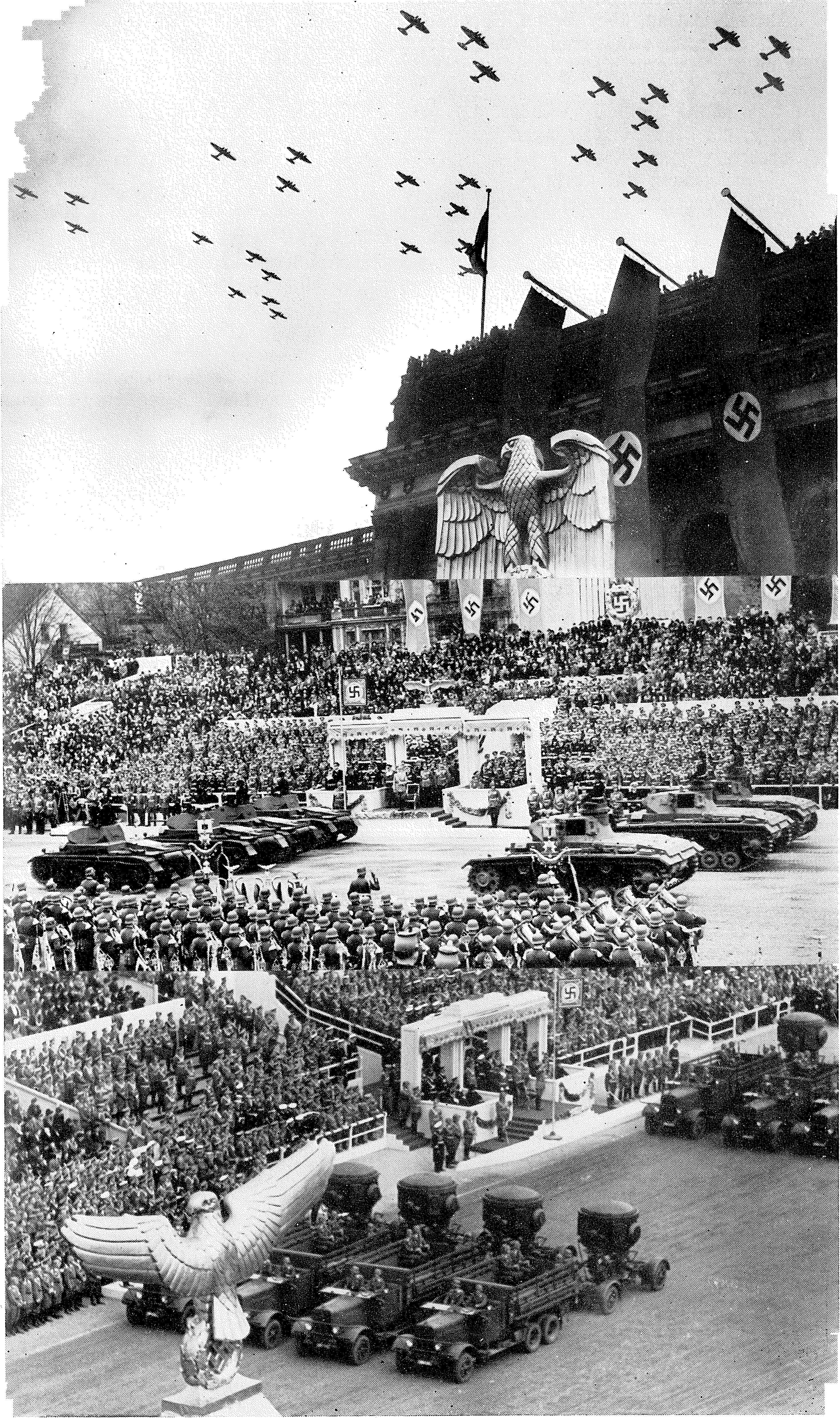
50. Geburtstag des Führers.
ren Flugstrecken von Prag nach Berlin, Wien, Halle/Leipzig, über Olmtitz nach Mährisch-Ostrau, über Brünn, Zlin nach Pistyan und über Preßburg nach Budapest. Schlesien erhält vom 16. 4. an eine neue Flugverbindung Breslau—Qleiwitz— Wien, die es ermöglicht, die Ostmark von Breslau aus in zwei Stunden zu erreichen.
Richard Steif! f, Mitbegr. d. Firma Margarete Steift G.m.b.H., Giengen -Brenz, ein begeisterter Fluganhänger, im 63. Lebensjahr in Jackson, Mich., USA., Herzschlag gestorben.
Aufermann auf „Erla 5 D" hat die Alpen und das Mittelmeer programmmäßig überflogen und setzt seinen Streckenflug in Afrika fort.
Was gibt es sonst Neues?
Wrede & Wiedenhold Flugzeugwerk, Eger-Sudetengau, errichtet. Empire Air Day, 20. 5., 78 Flugplätze, 63 RAF.-Stationen umfassend, freigegeben für Besuch.
Luftpostverkehr Salamanca, Sevilla und Barcelona im Anschluß an das Europanetz der Deutschen Lufthansa wieder aufgenommen.
185,35 km/h erreichte Kleinflugzeug „Stürmer" mit 1,8-1-Motor bei einem Probeflug zwischen Rothenburg und Delmenhorst. Konstr. H. G. Möller, Bremen. Tiefdecker. Spannw. 7,6 m (Landeklappen). Rekordfl. bei FAI angemeldet.
Ausland»
Yankee Clipper, Boeing 314, ist von Baltimore am 26. 3. gestartet und am 4. 4. in Southampton mit einer Besatzung von 12 Mann und 9 Fluggästen (Vertreter der Pan-American, Boeing, Curtiss-Wright, Civil Aeronautlcs Authority und U. S. Air Service) gewassert. Am 12. 4. Start der Boeing 314 von Southampton zur Rückkehr nach New York. In 5 Etappen legte das Flugzeug die 3400 km über Irland, Lissabon, über den Atlantik, die Azoren und die Bermuden benutzend, zurück und landete am 16. 4. in Baltimore.
Belg. Regierung bestellte bei Hawker Aircraft 12 Hurricanes.
Spitfire will Guy la Chambre zu Versuchsflügen nach Frankreich bringen, um diesen und den Rolls Royce Merlin-Motor eventuell später in Lizenz zu bauen; Motoren in den französ. Ford-Werken.
Franz. Luftlinie Paris — Belgrad — Bukarest wird, da die jugoslawische Regierung ab 1.4. den Vertrag mit der Air-France nicht verlängert hat, eingestellt.
Louis Breguet, Meldung über das Ableben ist unzutreffend. Verstorben ist vielmehr Jacques Breguet +, der Bruder des Generaldirektors Louis Breguet, der auch 30 Jahre in dem Werk Breguet beschäftigt war.

Der neue Präsident des Aero-Clubs von Deutschland Ital. Fallschirm „Salvator". General der Flieger z. V. Zander (links) vom Vater Werkbild
des bisherigen Präsidenten Exzellenz von Gronau (rechts) begrüßt. In der Mitte Oberstltn. von Gronau, jetzt Luftattache in Japan. Weltbild
Liesel Bach Flughafen Grenoble bei ihrem Rückflug von Cannes auf einen Tag zurückgehalten. Da keinerlei Zwischenlandung nachgewiesen werden konnte, wurde das Flugzeug am 17. 4. wieder freigegeben.
Ital. Salvator D. 39 Fallschirm, trägt den gesteigerten Beanspruchungen von 250—300 km/h auf 450/500 km/h Rechnung, Erfordernis war sofortiges Oeffnen, Erhöhung der Bremswirkung, Verteilung des Stoßes gleichmäßig auf den ganzen Körper. Zusammensetzung aus 16 Teilen von je 4 diagonal genähten Stücken; 16 Aufhängeseile, Belastung je Seil 180 kg. Dazu ein unter Federdruck stehender sich selbst öffnender Hilfsfallschirm aus Seide, welcher ein sicheres Entfalten des Hauptfallschirms gewährleiset. Neuartig ist die Anordnung der Schulter- und Beingurte zum Hauptraggurt, an dem wiederum zwei Traggurte nach der Sammelaufhängung, die über den Kopf des Springers zu liegen kommen, führen. Die gleichmäßige Stoßverteilung auf den Körper in jeder Lage ist hierdurch gesichert. Die Beingurte können bei der Landung leicht geöffnet und die Fallschirmgurtung von dem Körper leicht gelöst werden. Fallschirmpaket, vgl. Abb. S. 248, sehr klein. Gewicht 8 kg.
R. A. I. „Registro Aeronautico Italiano" (Flugregister) gegründet und dem italien. Luftminister unterstellt. Betrifft Ueberwachung, Konstruktion, Bau und Betrieb von Flugzeugen für Verkehr und Sport. Angegliedert ist eine juristische Abteilung.
Italien. Flugzeugausfuhr 1938: 153 Flugzeuge, Wert 116 272 000 Lires.
20 deutsche Luftiahrtechniker und -Wissenschaftler aus dem Kreise der Lilienthal-Gesellschaft besuchten als Gäste der ital. Aerotechnischen Gesellschaft „AIDA" vom 11.—19. April wichtige Erzeugerwerke des ital. Flugzeug- und Motorenbaues sowie die wichtigsten Forschungsanstalten.
Garcia Morato f, span. Fliegerkommandant, Sieger in 30 Luftkämpfen, bei Schauflügen über Madrid am 4. 4. tödlich verunglückt.
Major Ibarra f, bekannter span. Flieger, im Flugzeug mit 4 Begleitern bei einem Zusammenstoß in der Nähe von Saragossa verunglückt.
Lockheed 16, als viermotorige Verkehrsmaschine, in der Größe der Douglas D. C. 5 entsprechend, im Bau.
Stinson Sportdreisitzer mit Lycoming 75-PS-Motor für 160 km/h im Bau.
Harlow-Viersitzer Tiefdecker Ganzmetall mit Warner Super Scarab 145-PS-Motor für 250 km/h bei der Harlow Engineering Corporation, Los Angeles, im Bau. Billige Bauweise, Flügel aus einem Stück. Klappen und Fahrwerk elektrische Betätigung. Landegeschwindigkeit mit Klappen 77 km/h. Spannweite 10,5 m, Länge 7 m, Leergewicht 690 kg, Fluggewicht 1130 kg. Max. Geschwindigkeit 270 km/h.
Südamerik. Flugverkehrsges. Vasp bestellt 2 Junkers Ju 52 mit Staatsbeihilfe,
Japan. Luftverkehrslinie „Nippon Jusen Kaisha" Japan—Italien (Yokohama— Genua) 1. 2. eingerichtet.
China bestellte bei der United Aircraft für 15 Millionen Dollar Flugzeuge.
Lockheed XP-38 Jagdeinsitzer, welcher Anfang März bei einem Versuchsflug mit Ltn. Bejamin S. Kelsey zu Bruch ging. Dieser Jagdeinsitzer mit zwei 1000-PS-Allison-Motoren hat bei dem Versuchsflug 640 km/h. Das ist bei 2X1000 PS etwas wenig. Vgl. „Flugsport" 1939, S. 213/14 und die untenstehende Abb.
Seg elflug
362 km im Fernzielsegelflug, Doppelsitzer, flog NSFK.-flauptsturmführer Braeutigam 21. April mit Fluglehrer Mayer. Start Segelflugschule Großrückers-walde bei Chemnitz im doppelsitzigen Segelflugzeug Muster „Kranich" über Böhmen—Mähren nach der Ostmark (Wien, Flugplatz Aspern) 5^ Std.
Engl. Segelfluggelände Beacon Hill site wird in zunehmendem Maße von dem Oxford Gliding Club bevorzugt. Hangsegelflugmöglichkeiten von Süd-West West, bis Nord und Nord-Ost.
Ital. Capt Laurin Silber-C auf „A. L. 3" in Guidonia. Höhe 2100 m, Entfernung 75 km.
Italien. Segelflugwesen ist seit 1. 2. der RUNA (Reale Unione Nazionale Aeronautica) unterstellt.
Edmee Jarlaud, franz. Segelfliegerin, durch Zusammenstoß im Segelflugzeug in 60 m Höhe tödlich verunglückt. Ihr Gatte ist der Konstrukteur der bekannten franz. AVIA-Typen. Mme. Jarlaud, welche noch vor kurzem einen Kursus auf dem Hornberg mitmachte, war eine der besten französischen Segelfliegerinnen. Intern. Studienkommission für motorlosen Flug Istus-Tagung, Warschau.
Vortragsfolge:
Samstag, 13. Mai, 10.30 h: A. Lippisch, Deutschland, „Sichtbare Aerodynamik".
Sonntag, 14. Mai, 16.00—18.30 h: Ausbildungsaufgaben des Segelfluges: 1. Otto Fuchs, Dipl.-Ing., Deutschland, „Segelflug und Ingenieurausbildung". 2. M. Eichenberger, Dr., Schweiz, „Entwicklung und Bestrebungen des Segelflugs in der Schweiz". 3. Stefan Knappe, Dr. med., Polen, „Psychotechnische Versuche im Segelflug".
Montag, 15. Mai, 17.00—19.30 h: Medizinische Fragen im Segelflug: 1. W. Sawicz, Dr. med., Polen, „Die Verletzungen im Segelflug und ihre Vorbeugungsmaßnahmen". 2. Ruff, Dr. med., Deutschland, „Innere Verletzungen und ihre Verhütung bei Bruchlandungen während der Segelflugschulung". 3. Strughold, Prof. Dr., Deutschland, „Medizinische Höhenprobleme".
Dienstag, 16. Mai, 15.30—19.30: Eigenschaften und Leistungen von Segelflugzeugen: 1. A. Maksymowicz, Polen, „Versuche über Flügelwiderstände". 2. Wanner, Dipl.-Ing., Deutschland, „DFS Sturzflugbremsen". 3. Merle, cand. ing., Deutschland, „Anwendungen von Klappen bei Segelflugzeugen". 4. Spilger, Dipl.-Ing., Deutschland, „Leistungsmessung mit verschiedenen Segelflugzeugen". 5. Szukiewicz, Polen, „Flugzeugpolaren und ihr Gebrauch bei Streckenflügen".
Donnerstag, 18. Mai. 9.00—11.30 h: Festigkeitsfragen im Segelflugzeugbau: 1.
Krzywoblocki, Dipl.-Ing., Polen, „Einfluß der Flügelausmaße auf die Schwingungsmöglichkeit". 2. Grzedzielski, Dipl.-Ing., Polen, „Schub- und Torsionsmittelpunkt des Flügels". 3. Pieler, Dipl.-Ing., Deutschland, „Untersuchung über die günstigste Ausführung von Flügelanschlüssen bei Segelflugzeugen". 4. Winter, cand. ing., Deutschland, „Ist die Metallschalenbauweise beim Segelflugzeug berechtigt?"
11.30—12.00 h: Motorsegler: Wünscher, Ing., Deutschland, „Entwicklung und Konstruktion eines Motorseglers mit faltbarer Luftschraube". Freitag, 19. Mai, 9,00—12.00 h: Meteorologie und Segelflug: 1. Bieniek, Dr., Polen, „Fotografien der Strömung mittels Schlierenmethode". 2. Kochanski, Dr., Polen, „Wellenbewegung in der freien Atmosphäre". 3. Höhndorf, Dr., Deutschland, „Neue Wege des Segelfluges in größere Höhen". 17.00—19.00 h: 4. Berger, Dr., Schweiz, „Orographische Einflüsse der Alpen und des Juras auf das Wetter in der Schweiz". 5. Rafalowski, Mgr., Polen, „Die synoptische Karte und die Vorbereitung für Streckensegelflüge". 6. Gezatoth, Ungarn, „Die meteor. Verhältnisse in Ungarn hinsichtlich der SegeL flugmöglichkeiten".
Samstag, 20. Mai, 9.00—12.00 h: Segelflugschulung: 1. Slater, Dr., England, „Windenstart und thermische Strömungen". 2. Stamer, Deutschland, „Entwicklung der Schulungsmethodik im Segelflug". 3. Lopatniuk, Polen, „Der Gebrauch des Radio zur Segelflugschulung",

Goldene Plakette und Wanderpreis des Korpsführers des NS.-Fliegerkorps im Reichswettbewerb für Segelflugmodelle auf der Wasserkuppe (Rhön) wird für die beste Gesamtleistung eines Teilnehmers der Wettbewerbsmannschaft zugesprochen.
Wakefield Pokal USA. 6. 8. 39. Von der National Aeronautical Association gestifteter Preis 250 $ für gewinnendes Team.
Belg. Intern. Saalmodellwettbewerb, Brüssel, 16. April.
Vertreten waren Belgien, Holland, Frankreich, Deutschland, letzteres durch NSFK.
Ergebnisse der verschiedenen Klassen: Kategorie I Klasse A: 1. Chabot (Frankr.) 11 min 43 sec; 2. Aubry (Belg.) 11 min 20 sec; 3. Mischke (Deutschi.) 10 min 20 sec; 4. Vincre (Frankr.) 9 min 50 sec; 5. Bougueret (Frankr.) 9 min 29 sec; 6. Hebel (Deutschi.) 9 min; 7. Fiere-mans (Belg.) 8 min 51 sec; 8. Roussel (Frankr.) 8 min 47 sec; 9. Bougueret (Frankr.) 8 min 45 sec; 10. Faniel (Belg.) 8 min; 11. Poitevin (Frankr.) 7 min 50 sec; 12. Mischke (Deutschi.) 7 min 42 sec; 13. Mittelstaedt (Deutschi.) 7 min
41 sec; 14. Vincre (Frankr.) 7 min 9 sec; 15. Devillez (Belg.) 6 min 54 sec: 16. Warny (Belg.) 6 min 38 sec; 17. Warny (Belg.) 5 min 44 sec; 18. Emmerich (Deutschi.) 5 min 12 sec; 19. Anthöfer (Deutschi.) 4 min 51 sec; 20. Devillez (Belg.) 4 min 46 sec; 21. Emmerich (Deutschi.) 4 min 30 sec; 22. Hebel (Deutschi.) 3 min 56 sec; 23. Van Wymersch (Belg.) 3 min 27 sec; 24. Middeleer (Frankr.) 3 min 25 sec; 25. Faniel (Belg.) 3 min 20 sec; 26. Poitevin (Frankr.) 3 min 9 sec.
Klasse B: 1. Devillez (Belg.) 8 min 53 sec; 2. Vincre (Frankr.) 7 min 42 sec; 3. Mischke (Deutschi.) 5 min 44 sec; 4. Faniel (Belg.) 5 min 32 sec; 5. Chabot (Frankr.) 5 min 27 sec; 6. Van Wymersch (Belg.) 5 min 27 sec; 7. Müller (Deutschl.) 4 min 46 sec; 8. Roussel (Frankr.) 4 min 30 sec; 9. Middeleer (Frankr.) 3 min 26 sec.
Klasse C: 1. Bougueret (Frankr.) 4 min 41 sec; 2. Anthöfer (Deutschi.) 3 min 38 sec.
Sonderklasse: 1. Devillez (Belg.) 8 min 53 sec; 2. Vincre (Frankr.) 7 min
42 sec; 3. Mischke (Deutschi.) 5 min 44 sec.
Kategorie II: 1. Mac Kinney (Belg.) 4 min 5 sec; 2. Mac Kinney (Belg.) 3 min 36 sec; 3. Nuyens (Belg.) 2 min 48 sec; 4. Nuyens (Belg.) 2 min 36 sec;
5. Dehaen (Belg.) 2 min 35 sec; Labruere (Belg.) 2 min 18 sec; 7. Lenders (Belg.) 2 min 2 sec.
Preise:
1) Preis des Herzogs von Brabant für Dauerflüge: 1. Chabot (Frankr.) 11 min 43 sec; 2. Aubry (Belg.) 11 min 20 sec; 3. Mischke (Deutschi.) 10 min 30 sec; 4. Vincre (Frankr.) 9 min 50 sec; 5. Bougueret (Frankr.) 9 min 29 sec:
6. Hebel (Deutschi.) 9 min; 7. Devillez (Belg.) 8 min 53 sec; 8. Fieremans (Belg.) 8 min 51 sec; 9. Roussel (Frankr.) 8 min 47 sec; 10. Bougueret (Frankr.) 8 min 45 sec.
2) Preis der Prinzessin Josephine-Charlotte für Modelle von 5 g: 1. Devillez (Belg.) 8 min 53 sec; 2. Vincre (Frankr.) 7 min 42 sec; 3. Mischke (Deutschi.) 5 min 44 sec; 4. Faniel (Belg.) 5 min 32 sec; 5. Van Wymersch (Belg.) 5 min 27 sec; 6. Chabot (Frankr.) 5 min 27 sec; 7. Müller (Deutschi.) 4 min 46 sec; 8. Roussel (Frankr.) 4 min 30 sec; 9. Anthöfer (Deutschi.) 3 min 38 sec; 10. Middeleer (Frankr.) 3 min 26 sec.
3) Preis des Prinzen Albert von Liege für den besten der belgischen Schüler: Labruyere (Belg.).
4) Preis der Stadt Brüssel für die beste Durchschnittsleistung: 1. Aubry (Belg.) 8 min 52 sec; 2. Chabot (Frankr.) 8 min 45 sec; 3. Hebel (Deutschi.) 8 min
43 sec; 4. Bougueret (Frankr.) 7 min 43 sec; 5. Mittelstaedt (Deutschi.) 7 min 15 sec; 6. Fieremans (Belg.) 7 min 12 sec; 7. Mischke (Deutschi.) 6 min 55 sec; 8. Faniel (Belg.) 6 min 52 sec; 9. Bougueret (Frankr.) 6 min 25 sec; 10. Warny (Belg.) 5 min 59 sec.
5) Preis der Nationen für die nationalen Mannschaften mit der besten Gesamtleistung: 1. Franz. Mannsch. 31 min 3 sec; 2. Belg. Mannsch. 29 min 4 sec; 3. Deutsche Mannsch. 27 min 12 sec.
6) Preis für Mikrostabmodelle Spannweite max. 0,8 m, Handstart: Mischke (Deutschi.) 10 min 30 sec.
Literatur,
(Die hier besprochenen Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Jahrbuch 1938/1939 der Deutschen Akademie der Luftfahrtforschung. Unt. Leit. d. Kanzlers d. Akad. zusammengest. u. bearb. v. Walter Boje u. Karl Stuchtey. Verlag R, Oldenbourg, München. Preis RM 12.—.
In vorliegendem Jahrbuch findet man alles Wissenswerte: Satzungen, Zusammensetzung, Mitgliederverzeichnis der Deutschen Akademie der Luftfahrtforschung, in dem wissenschaftlichen Teil Vorträge über Probleme des Höhenfluges, Bau von Höhenflugzeugen, die Rolle der Zusammendrückbarkeit bei der strömenden Bewegung der Luft, Aufgaben der Hochgeschwindigkeitstechnik, das Trag- und Hubschraubenproblem, Probleme des Schnellfluges, Fortschritte und Ausblicke auf dem Gebiet der Treibstoffe und Schmierstoffe für Flugmotoren, elektrische Wellen im Zentimetergebiet, praktische Bedeutung der Mikrowellen, Grenzen und Entwicklungsrichtung der Flugmotoren, über die tiefsten heute erreichbaren Temperaturen, einige neuere optische Untersuchungen und über Schallausbreitung bei rasch bewegten Körpern.
Schriften der Deutschen Akademie der Luftfahrtforschung, Heft 1 u. 2. Von Walter Boje u. Leit. d. Kanzlers d. Akademie zusammengest. u. bearb. Verlag R. Oldenbourg, München. Preis Heft 1 RM 2.70, Heft 2 RM 2.90.
Heft 1 enthält die wörtliche Wiedergabe der Ansprache des Präsidenten der Deutschen Akademie der Luftfahrtforschung Generalfeldmarschall Hermann Göring sowie Vorträge über die Entwicklung der Flugleistungen v. Willy Messerschmitt und über Entwicklungsrichtung des Flugmotors v. Otto Mader mit Abbildungen.
Heft 2 enthält die Ansprache des Vizepräsidenten der Deutschen Akademie der Luftfahrtforschung Generaloberst Ehrhard Milch in der 3. öffentlichen Sitzung am 17. 6. 38 zum Gedenken an die 100. Wiederkehr des Geburtstages des Grafen Zeppelin, ferner Vorträge über Maßnahmen zur Verbesserungen der Zeppelin-Luftschiffe für den Fernverkehr v. Ludwig Ferdinand Dürr und über die Entwicklung des Zeppelin-Luftschiffes zum Fernverkehr v. Albert Ehrle.
Wir jagten den Feind. Von Hans Brzenk. Mit 30 Bildern. Vorhut-Verlag, Otto Schlegel, Berlin SW 68. Preis kart. RM 3.60, geb. RM 4.50.
Beginnend mit Berichten von Boelcke und Immelmann, hat es der Verfasser ausgezeichnet verstanden, lebendige Bilder aus der Feldfliegerei wiederzugeben. Für die Helden gab es keine Schule. Man fühlt, wie jeder auf sich selbst gestellt die richtige Entscheidung im gegebenen Moment als etwas Selbstverständliches finden mußte.
Expedition des wf w Cf A 17^7Df #^V1T Expedition des
'^Ta0^ KLEINE ANZEIGEN >>FF^faor
Die drelgespaltene MIHIme*er~2Selle leostet 25 Pfennig.
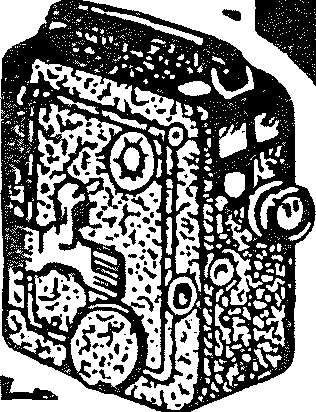
Jetzt
noch preisgünstiger
Die Freuden, die das Selbstfilmen Ihrer eigenen Erlebnisse bietet, sind noch leichter erreichbar durch Nizo 8 E-S, die neue, preisgünstige 8-mm-Kinokamera mit Auswechseloptik 1:2,5 auch für Zeitdehneraufnahmen und dem neuen lichtstarken, überaus kleinen und leichten Nizo-Projektor 8 NL - Druckschrift Nr. M 33 kostenlos von Herstellerfirma
Fallschirme
aller Art
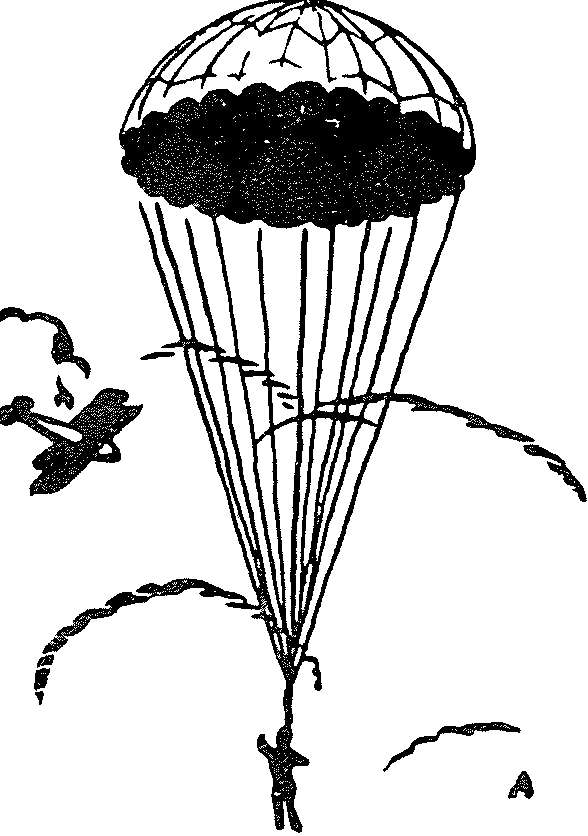
SCHROEDEK & CO,
Berliii-Xeukölln
Bergstraße 93-95
Älteste Flugzeug* Fallschirm-Fabrik der Welt
ngenieur-schule
IMaschinenbau / Automobil- u. Flugtechnik Elektrotechnik. Programm kostenlos
Eingebunden ist der „Flugsport ein Nachschlagewerk von Wert!
F
ernschule für
lugzeugbau
I
Theoret. Vorbereitung für Bauprüfer, Flugzeugführer, Ingenieure sowie für den gesamten Flugdienst. Sonderlehrgänge für Jungflieger. Abjchlußprü* fungen - Abschlußzeugnisse. Studien-progr. Nr. 145 durch das Sekretariat,
Fernschule G.m.b.H. BerlinW15
KurfUrstendamm 66 p.
G. m. b. H. MÜNCHEN 23
„FLUGSPORT"
Birken-Flugzeug
Sperrholzplatten
„CAWIT"
«üeiifwrtics Fabrikat
bei Rekordflügen erprobt, in den Qualitäten: AVIATIC, SPEZIAL, GLEITFLUG in allen Stärken von 0,4-8 mm liefert prompt ab Lager
Georg Herte BerlinsCharlottenburg
Kaiser Friedrich-Straße 24 Ftrnspr.-Sammelnummer: 34 5841 Telßf.-Adr.: Fliegerhölzer Berlin
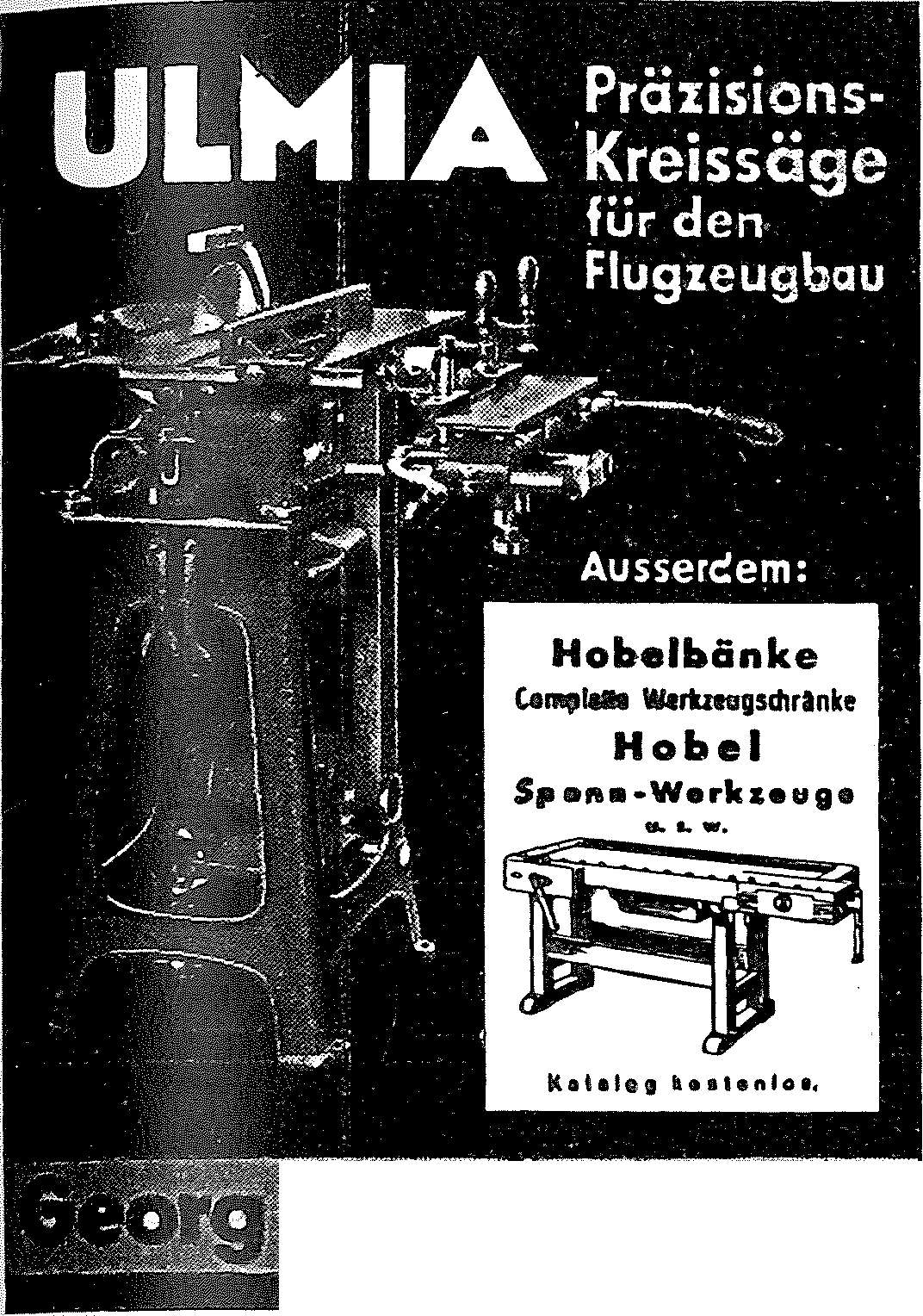
FLUGZEUGKONSTRUKTEUR
aus dem Zellen- oder Triebswerkbau für unser Berliner Entwicklungsbüro gesucht. Begabten zielstrebigen Herren wird gut ausbaufähige Stellung geboten. Bewerbungen, auch jüngerer Herren, sind mit Zeugnisabschriften, Lichtbild und Gehaltsansprüchen zu richten an Anton Flettner G. m. b. H.( Flugzeugbau, Berlin-Johannisthal
^^^^^^^i^^^^^Ü^HMMM^^^^^P^^^^^W Segelfliegeidamm 27
|
> sucht ; |
|
|
zum baldigen Eintritt |
|
|
V |
einige tüchtige |
|
Diplom - Ingenieure |
|
|
als Aerodynamiker für aerodynamische ! |
|
|
Abteilung. |
|
|
Ausführliche Bewerbungen mit Licht- |
|
|
bild, Zeugnisabschriften und Angabe der |
|
|
Gehaltsansprüche sowie des frühesten |
|
|
Eintrittstages sind unter Kennwort |
|
|
„TZ-TAe" zu richten an |
|
|
ARADO- |
FLUGZEUGWERKE G.M.B.H. |
|
WERK BRANDENBURG (HAVEL) |
|
Ei üb and d ecken
Leinen und mehrfarbig, Preis RM S.Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M.
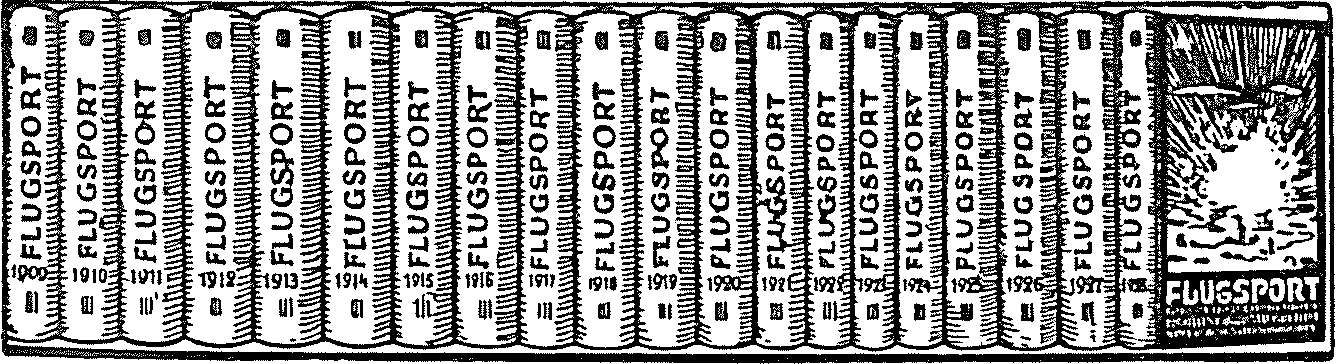
Preß- u. Stanzteile
aus Eisen, Stahl, Leichtmetall usw. warm oder kalt gepreßt, geprägt und gezogen, roh oder bearbeitet fertigt zeichnungsgemäß an
Stephan Witte & Co.
Abtlg. Iserlohner Preß- und Stanzwerke
Gegr. 1785 Iserlohn Gegr. 1785
ORIGINAL - RHÖN - ROSSITTEN ■
STARTS EILE ^
DR. W. KAMPSCHULTE & CIE. SOLINGEN
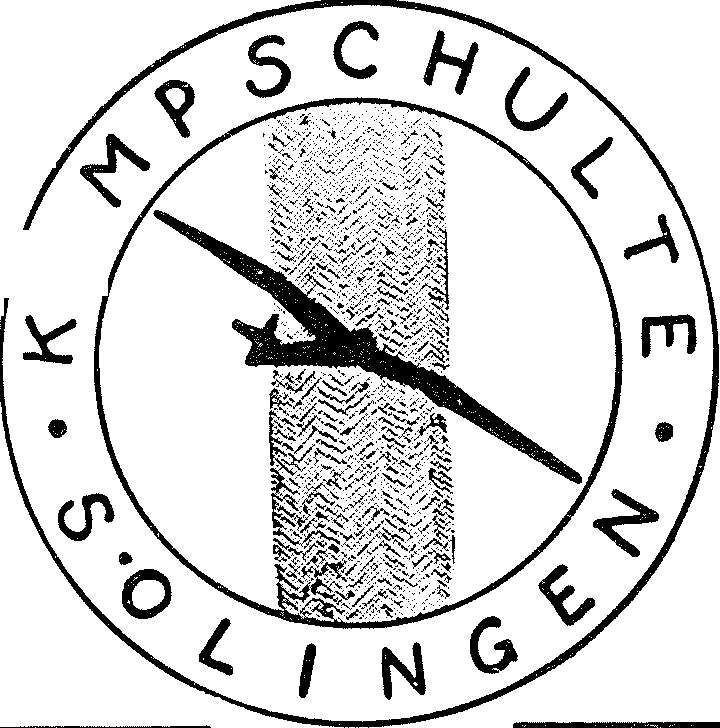
VERLANGEN SIE KOSTENLOS: MUSTER, DRUCKSCHRIFTEN U. ANSCHAUUNGSMATERIAL
Heft 10/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro K Jahr bei Htäglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ,.Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Ouellenangabe gestattet.
Nr. 10 10. Mai 1939 XXXI. Jahrgang
^Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 24. Maj_1939_
755,11 km/h.
Wieder wurde die Welt durch eine deutsche Leistungssteigerung im Flugwesen überrascht. Am 26. April 1939 erreichte der 24jährige Flugzeugführer Fritz Wendel auf Me 109 R eine Geschwindigkeit von 755,11 km/h und überbot damit den am 30. 3. 1939 aufgestellten Rekord des lieinkelflugzeuges He 112 U um 8,45 km/h. Der Rekord wurde von Sportzeugen des Aero-Clubs von Deutschland beurkundet und der FAI zur Bestätigung gemeldet.
Einen hervorragenden Anteil an der großen Leistung des Messerschmitt-Flugzeuges Me 109 R hat der Daimler-Benz-Motor DB 601, der unter der Nennleistung von 1175 PS bekannt wurde, und dessen Weiterentwicklung in der Zwischenzeit das Erreichen derartiger Geschwindigkeit ermöglichte. Ein nicht zu unterschätzender Helfer war auch die Luftschraube, ein VDM-Propeller der Vereinigten Deutschen Metallwerke, wie er allgemein in der deutschen Luftwaffe eingeführt ist. Der Führer und der Reichsminister der Luftfahrt, Hermann Göring, haben neben vielen anderen offiziellen Persönlichkeiten dem Konstrukteur der Maschine, Prof. Messerschmitt, den Daimler-Benz-Werken, dem jungen Flugzeugführer Wendel und VDM-Heddernheim ihre Glückwünsche ausgesprochen. In Anerkennung seiner Verdienste wurde Wendel vom Reichsminister der Luftfahrt zum Flugkapitän ernannt.
Generalluftzeugmeister Udet äußerte sich nach dem Flug, daß Deutschland nunmehr über zwei Modelle von Serienmaschinen verfüge, die mit diesem Rekord weit über dem Durchschnitt anderer Länder stünden. Der neue Rekord zeige eindeutig, daß die Bestleistung der Heinkel kein Zufall gewesen sei, sondern das Ergebnis einer planmäßigen Arbeit innerhalb der deutschen Luftfahrtindustrie. In friedlichem Wettstreit hätten die beiden Firmen — beide Namensträger, Heinkel und Messerschmitt, haben, wie man sich erinnert, während des letzten Parteitages den Nationalpreis erhalten — fast die gleichen Ergebnisse erzielt, ein Beweis dafür, daß sie den richtigen Weg gingen. Wiederum habe es sich um ein Landflugzeug gehandelt, das von normalen Flugplätzen starten und landen könne.
Diese Nummer enthält Patentsammlung Nr. 8, Band VIII, und Reportsammlung Nr. 12

Neuer Geschwindigkeits-Weltrekord 755,11 km/h auf Jagdeinsitzer Me 109 R. Oben links: Die Me 109 R im Fluge. Unten: Prof. Messerschmitt und sein
Rekordflieger Wendel. Werkbilder
Hochleistungs-Segelflugzeug Mü 17 55Merlea-
Das Segelflugzeug Mü 17 „Merle" ist eine Konstruktion der FFQ München, eine Weiterentwicklung der Mü 10 „Milan" und der Mü 13 „Merlin". — Die Mü 17 entspricht im Bau den olympischen Formeln, die von der ISTUS im Mai 1938 in Bern für die Olympiade 1940 aufgestellt wurden. Maßgebend war einfachste Konstruktion bei einfachster Herstellung und Montage. Muster Mü 17 ist hauptsächlich als Wettbewerbsmaschine gedacht, jedoch läßt sie sich wegen der vor-
1 züglichen Flugeigenschaften und der einfachen und robusten Bauweise auch als Uebungsmaschine für Leistungsflüge gut verwenden.
Mü 17 ist als freitragender Schulterdecker in Gemischtbauweise ausgeführt. Der Rumpf ist in Stahlrohrbauweise, das Trag- und Leitwerk in Holz gebaut. Durch die Wahl des Stahlrohrrumpfes wurde sowohl einfache und billige Bauweise als auch die geforderte Sicherheit für den Piloten erzielt. Die verwen-s- deten Rohre von 1 mm Wandstärke § lassen sich leicht schweißen und sind * bei Brüchen leicht zu reparieren. Das tragende Rumpffachwerk ist im vorderen Teil bis zum Hauptspant trapezförmig und hinter diesem auf dreieckigen Querschnitt gebracht. Die Dreiecksform ist aerodynamisch günstig und im Bau äußerst einfach. Zur Erleichterung und Beschleunigung der Flügelmontage sind
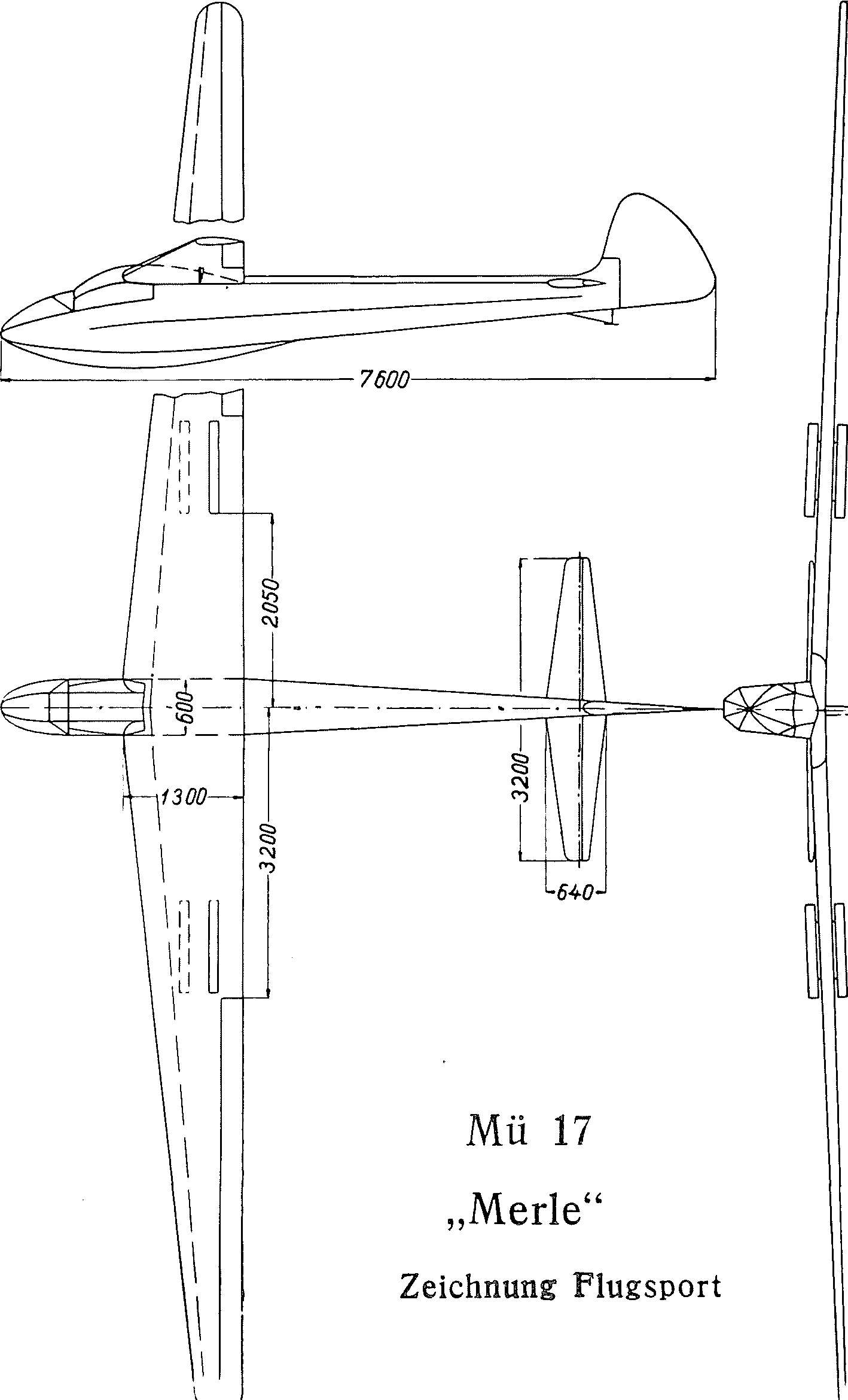
Mü 17 „Merle" Hochleistungssegelflugzeug. Werkbilder
am Rumpf 4 Bolzen fest angebracht, auf die der Flügel geschoben wird. Der Rumpf ist mittels Kufe und Fußball weich abgefedert. Ein einziehbares Fahrwerk kann nachträglich leicht eingebaut werden.
Durch Führerhaube sehr gute Sicht, da der Pilot, wie bei der Mü 10, vor dem Flügel sitzt. Das Haubengerüst aus Stahlrohr ist mit Astralon beplankt.
Flügel Kastenholm mit seitlichen Aufleimungen. Nasenrippen sind einseitig mit Sperrholz beplankt, Schwanzrippen sind Fachwerkrippen mit Sperrholzecken. Der Hilfsholm trägt im Außenteil die Querruder (vgl. Abb.). Die Verbindung zwischen Flügel und Rumpf wird durch selbsttätige Kupplung der Querruder und Bremsklappenanschlüsse sowie durch feste Aufhängebolzen am Rumpf möglichst vereinfacht. Die Teilung der Fläche ist symmetrisch unter Verwendung von je zwei
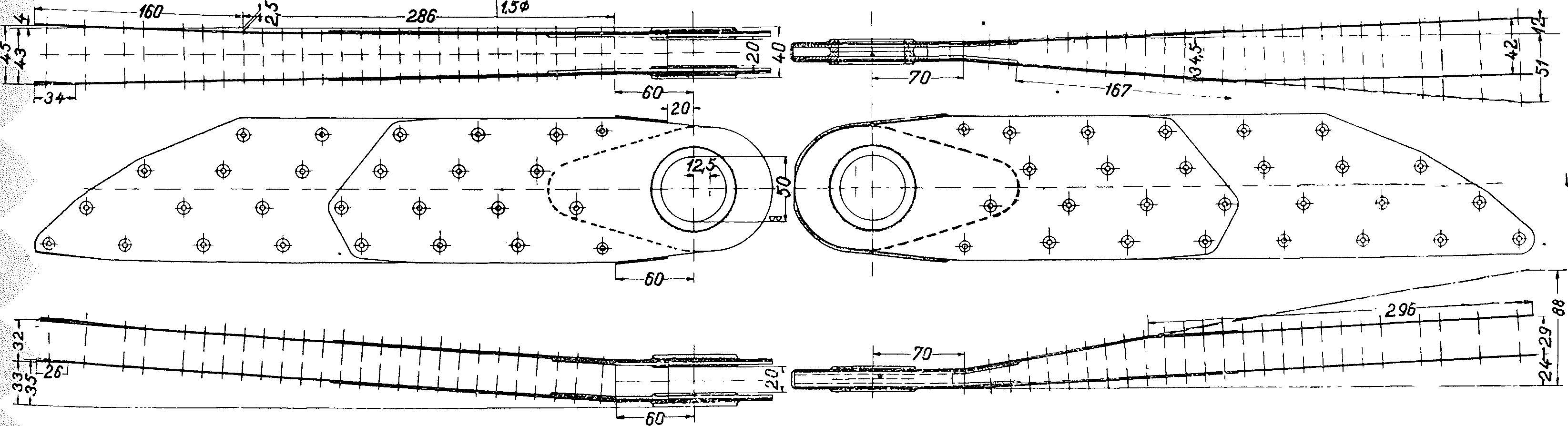
FFG. München: Mü 17 Flügelbeschläge links und rechts.
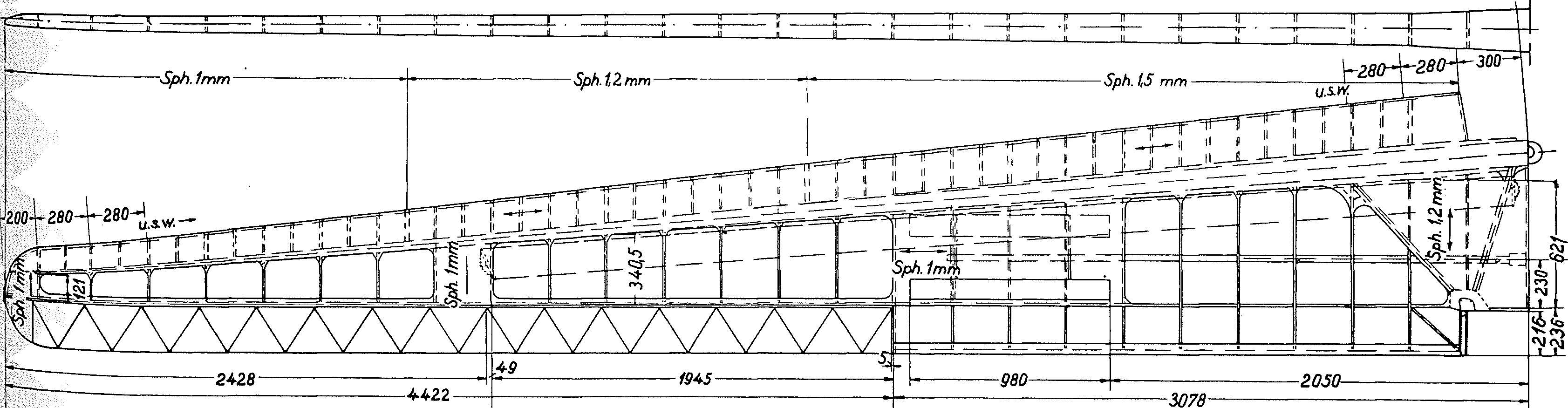
7500-
FFQ. München: Mü 17 Flügelübersicht. Zeichnungen Flugsport
gleichen Beschlägen und eines Kupplungsautomaten, wie bei derMül3. Das Montagewerkzeug läßt sich so bis auf einen Rohrgriff vereinfachen. Eine Fokkernadel ist der einzige lose Teil.
Querruder höchst einfache Bauweise. Tiefe und Dicke sind durchgehend gleich. Beiderseits sind sie diagonal mit Sperrholz beplankt und mit 5 Scharnieren am Hilfsholm aufgehängt.
Höhenruder gedämpft. Seitenruder ungedämpft. Montage wie bei der Mü 13. Bremsklappen aus Holz auf einer Torsionsachse mit Stoßstangenantrieb im Rumpf.
Beim Steuerwerk sind möglichst Rohre verwendet, um gebördelte Bleche zu vermeiden. Eingebaute Pendelkugellager erleichtern den
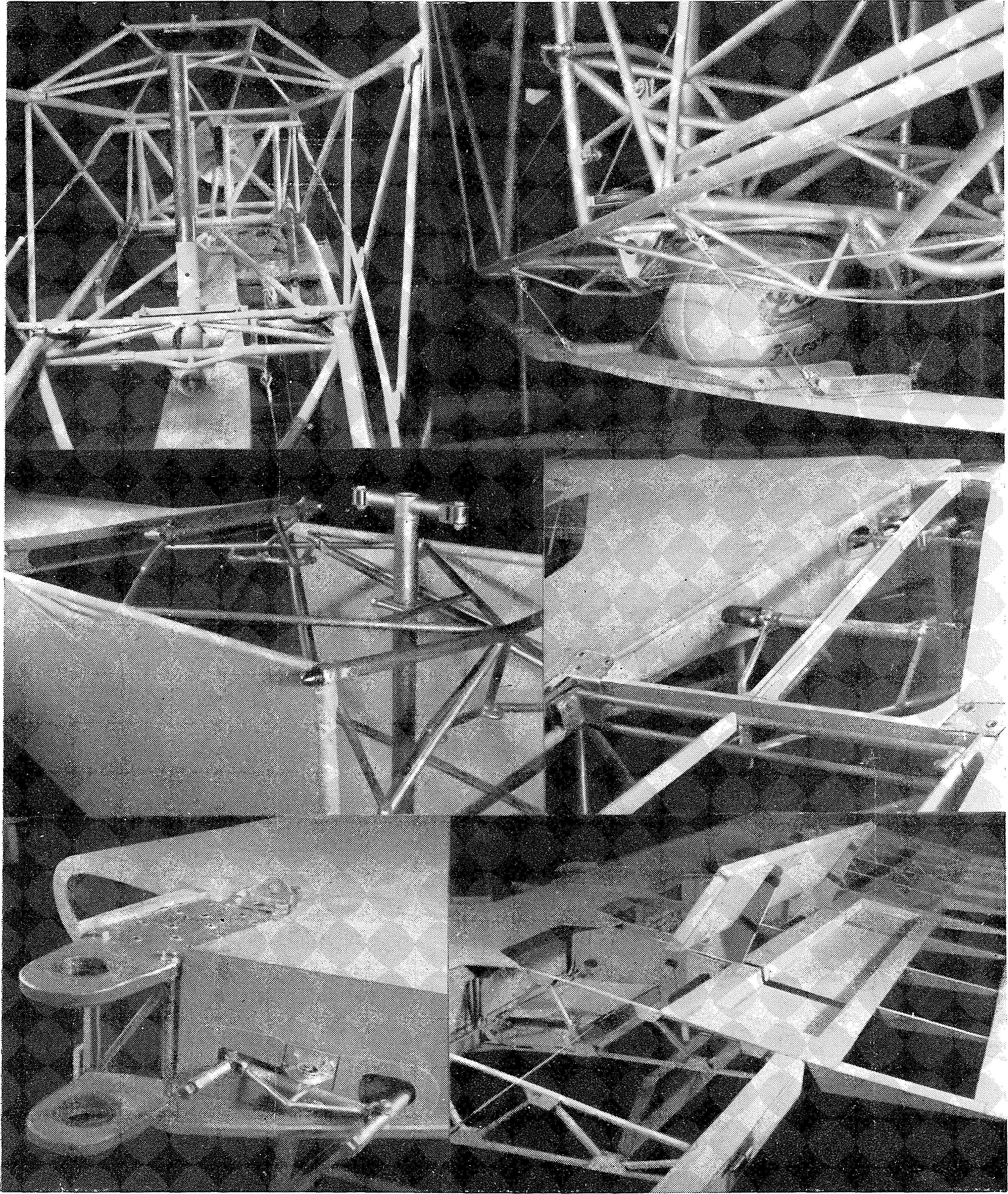
Mü 17 „Merle" Hochleistungssegelflugzeug, Stahlrohrbauweise. Oben links: Vorderer Rumpfteil, Steuerknüppel, dahinter Fußpedale für Seitenruder. Rechts: Kufenabfederung mit Fußball. Man beachte die Umlenkrollen für die Seilführung. Mitte links: Rumpfmittelteil mit Einzelteilen vom Steuerwerk. Rechts: Stoßstangenführung im Flügel. Unten links: Flügelbeschlag und Stoßstangenanschluß. Rechts: Bremsklappen ausgeschlagen. Werkbilder
Bau und die Wartung. Die Knüppellagerung ist als quer im Rumpf liegender Kasten ausgebildet und treibt Querruder und Höhenruder über Seile an. Die Ueberleitung der Querruderkräfte von Rumpf auf Fläche wird von einem Torsionsrohr mit Automat übernommen. Die Querruder sind im Verhältnis 1 : 2 differenziert.
Die Fußsteuerung ist am Boden verstellbar.
Spannweite 15 m, Länge 7,6 m, Höhe 1,27 m, Rumpfbreite 0,6 m, Fläche 13,3 m2, Profil eigenes, Rüstgewicht 160 kg, Fluggewicht 255 kg, Zuladung 95 kg, Flächenbelastung 19,2 kg/m2, Seitenverhältnis 16,8, Pfeilform 6°, V-Form 3°.
Geringste Geschwindigkeit 51,0 km/h, geringste Sinkgeschwindigkeit 0,63 m/sec bei 54,3 km/h, beste Gleitzahl 1 : 26 bei 64,3 km/h.
Leicht-Einsitzer „Stürmer".
Der „Stürmer", Konstruktion und Bau Ing. H. G. Möller, Hamburg, ist aus dem „Storno 3" (vgl. Typenbeschr. „Flugsport" 1937 S. 657 und 687), welcher in Rangsdorf zum erstenmal vorgeführt wurde, hervorgegangen. Durch den Flug am 26. 4. auf der 1000-km-Meß-strecke Bremen—Schwessin, wobei eine Geschwindigkeit von 187,776 km/h erreicht wurde, ist die Leistungsfähigkeit dieses Flugzeugmusters unter Beweis gestellt worden. Bei diesem Flug lief der Motor mit etwa 2200 U/min, was einer Leistung von 35 PS entspricht.
Durch Einbau eines 42 PS-Zündapp-Motors wurde die Leistungsreserve, welche bei 18 PS unzureichend war, erhöht. Bei einer Flächenbelastung von 34,4 kg pro m2 liegen die Steiggeschwindigkeiten Start- und Landestrecken in einem günstigen Verhältnis zu den maximalen Fluggeschwindigkeiten. Zur Vermeidung einer allzu großen Schränkung wurde als Umriß des Flügels eine Ellipse ermittelt, deren Enden abgestumpft sind. Die Pfeilform des Flügels bringt gute Querruderwirkung und kleinen Einfluß der Schwerpunktswanderungen. Durch kleine Profildicken (14—9%>) ist eine Fläche geschaffen, die ein Maximum an Wirkungsgrad ergibt.
Der zurückgezogene tiefliegende Flügel, die richtige Dimensionierung der Querruder, Höhen- und Seitenruder sowie der Einbau einer Trimmvorrichtung am Höhenleitwerk, geben gute Flugeigenschaften. Die häufig bei starkgezogenen Fluglagen eintretende Leitwerksabschirmung wurde durch Hochlegen des Höhenleitwerkes vermindert. Um die Trimmung gering zu halten, wurde der Sitz so angeordnet, daß der Pilot sich nahezu im Schwerpunkt der Maschine befindet. Sichtmäßig ist die Lösung durch den gebogenen Innenflügel gut ausgefallen. Außerdem brachte der tiefliegende gebogene Flügel kleine Bauhöhen für das Fahrwerk, und i
somit kleine Kräfte und geringe Widerstände. Sollte bei einer Bruchlandung das Fahrwerk
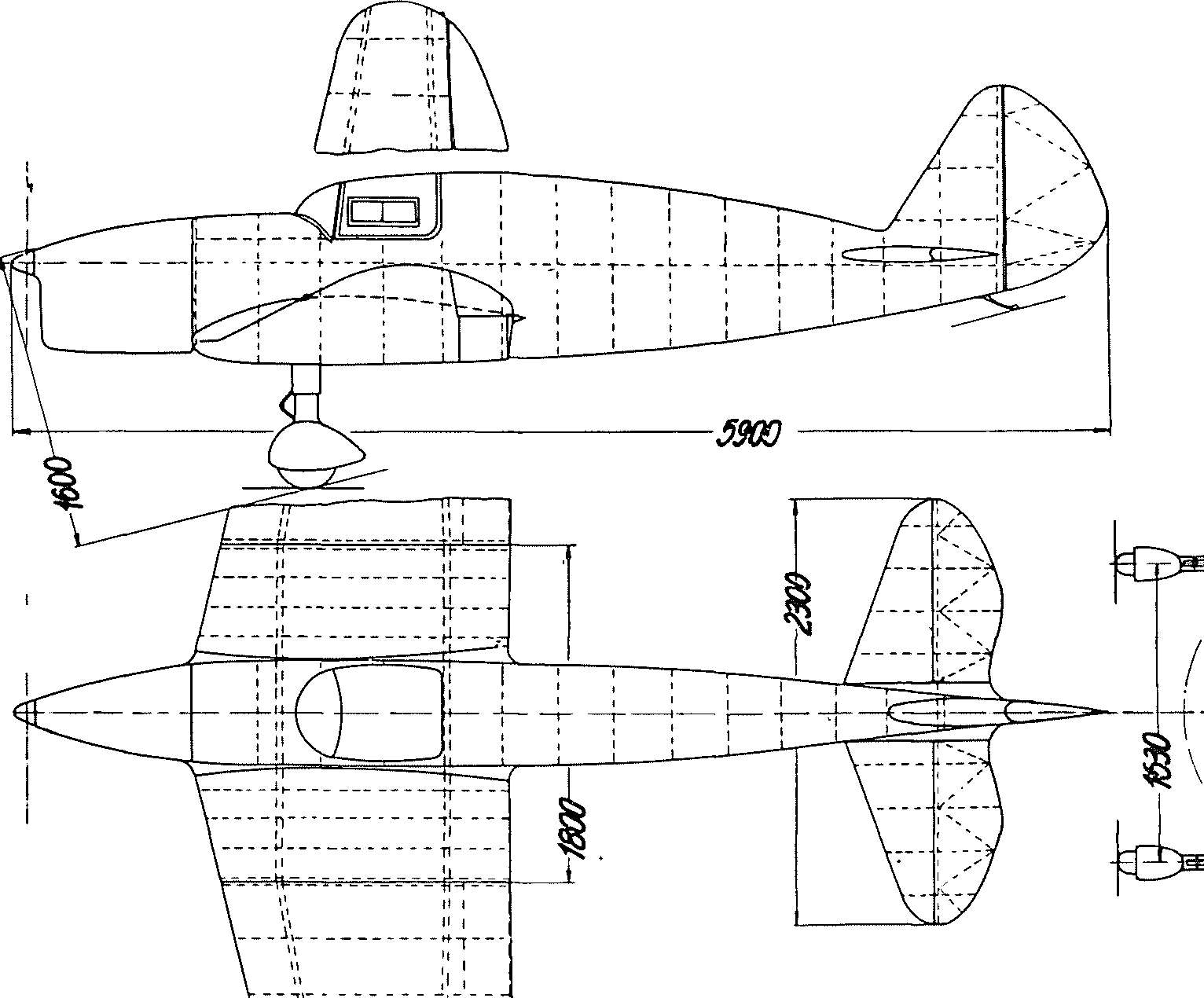
Leicht-Einsitzer „Stürmer".
Zeichnung Flugsport
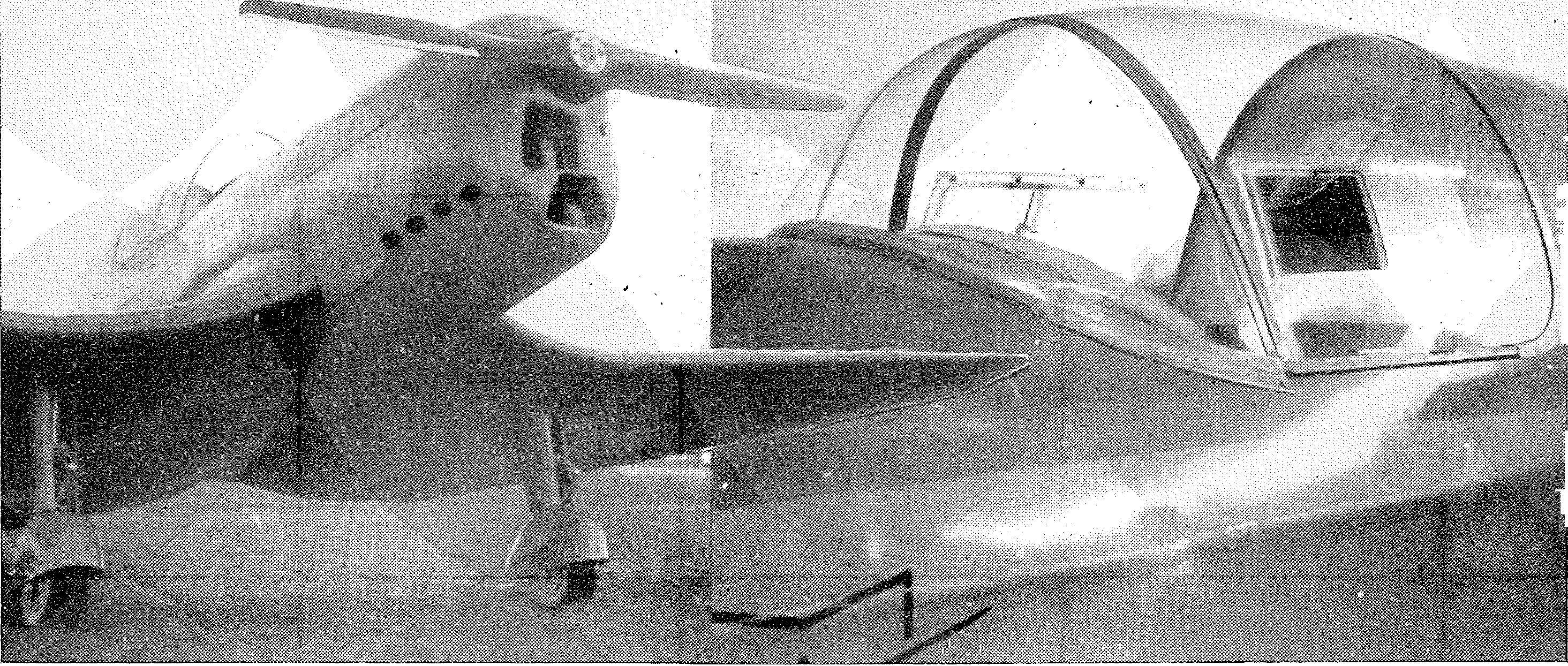
Leicht-Einsitzer „Stürmer". Links: Man beachte die kurzen Fahrwerksbeine und die Motorverkleidung. Rechts: Führersitzverkleidung mit Schiebefenstern an
beiden Seiten. Werkbilder
beschädigt werden, so ist bei dieser Anordnung der Pilot weitgehendst geschützt. Zur Verringerung der Start- und Landestrecken ist der Einbau von Landeklappen möglich, und zwar von Querruderanfang bis zum Fahrwerk. Es hat sich aber gezeigt, daß auch beim Fliegen ohne Landeklappen die Landegeschwindigkeit gering genug ist, um auch auf jedem kleinen Platz zu landen.
Flügel einholmige Bauweise mit Hilfsholm und Torsionsnase. Bemessung für Beanspruchungsgruppe S 5. Zwei Außenflügel und mit dem Rumpf fest verbauter Innenflügel, an welchem auch die Fahr-werksbeschläge befestigt sind. Die Holme'sind in Kastenbauweise ausgeführt. Der Hilfsholm hat die Aufgabe, die Querruderkraft und im Innenflügel die Torsion zum Teil aufzunehmen. Die Kräfteüberleitung vom Flügel zum Rumpf wird durch die feste Verbindung der Holme mit dem Hauptrumpf Spanten einwandfrei durchgeführt. Brennstoff tank von 30 1 in den Flügelstümpfen.
Der Rumpf Schalenbauweise. Spante in Abständen von etwa 300 mm sorgen für die Formhaltung. Vier kräftige Längsgurte, im Bereich des Sitzes sogar sieben Längsgurte, geben dem vollständig mit Sperrholz beplankten Rumpf eine hohe Festigkeit. Der Rückenspant enthält Ausschnitte für Fallschirm und Kofferraum. Zwischen Haupt- und Rückenspant liegen zwei Längsträger, auf welchen der
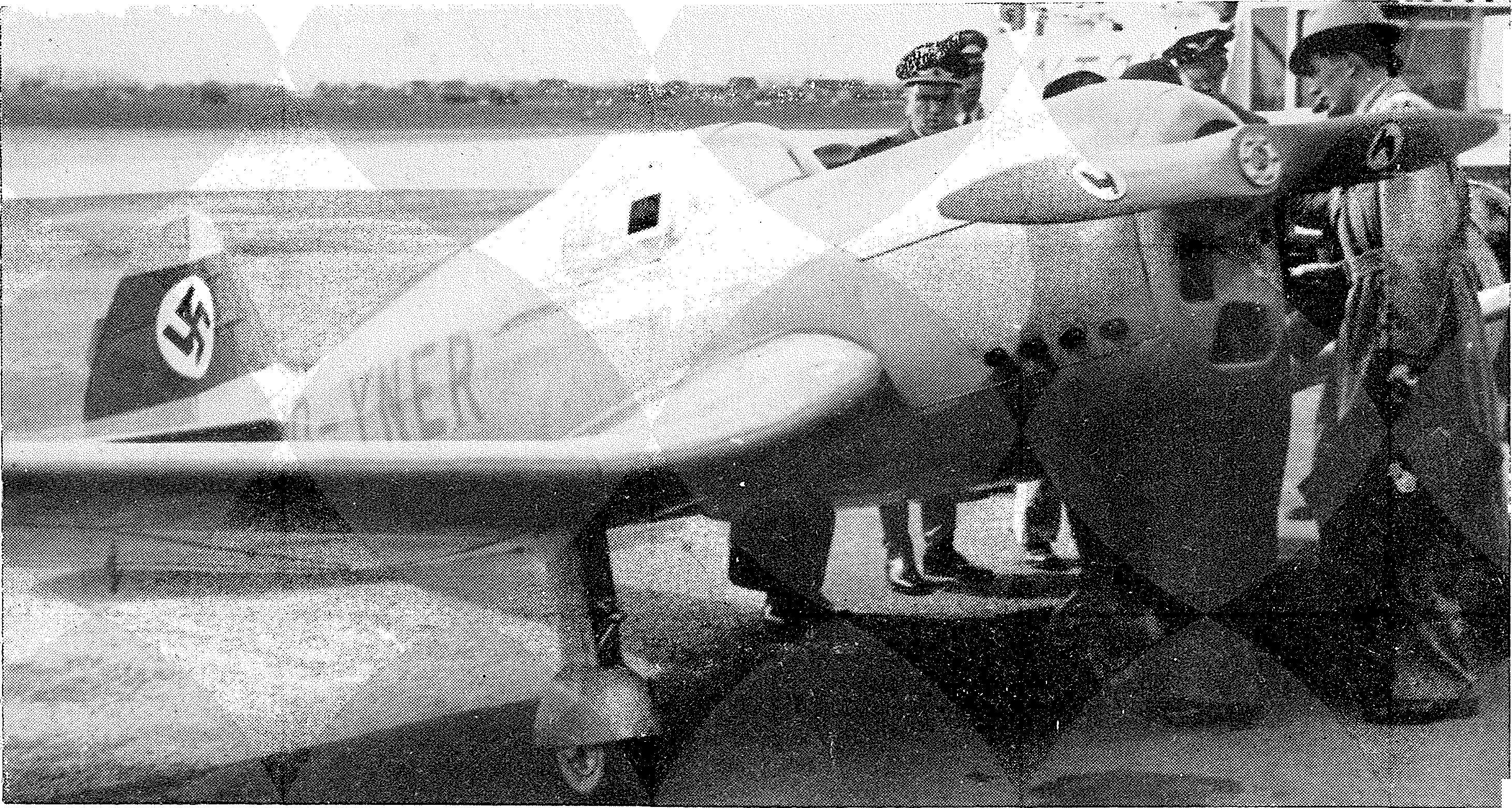
Leicht-Einsitzer „Stürmer",
Werkbild
Leicht-Einsitzer „Stürmer".
Werkbild
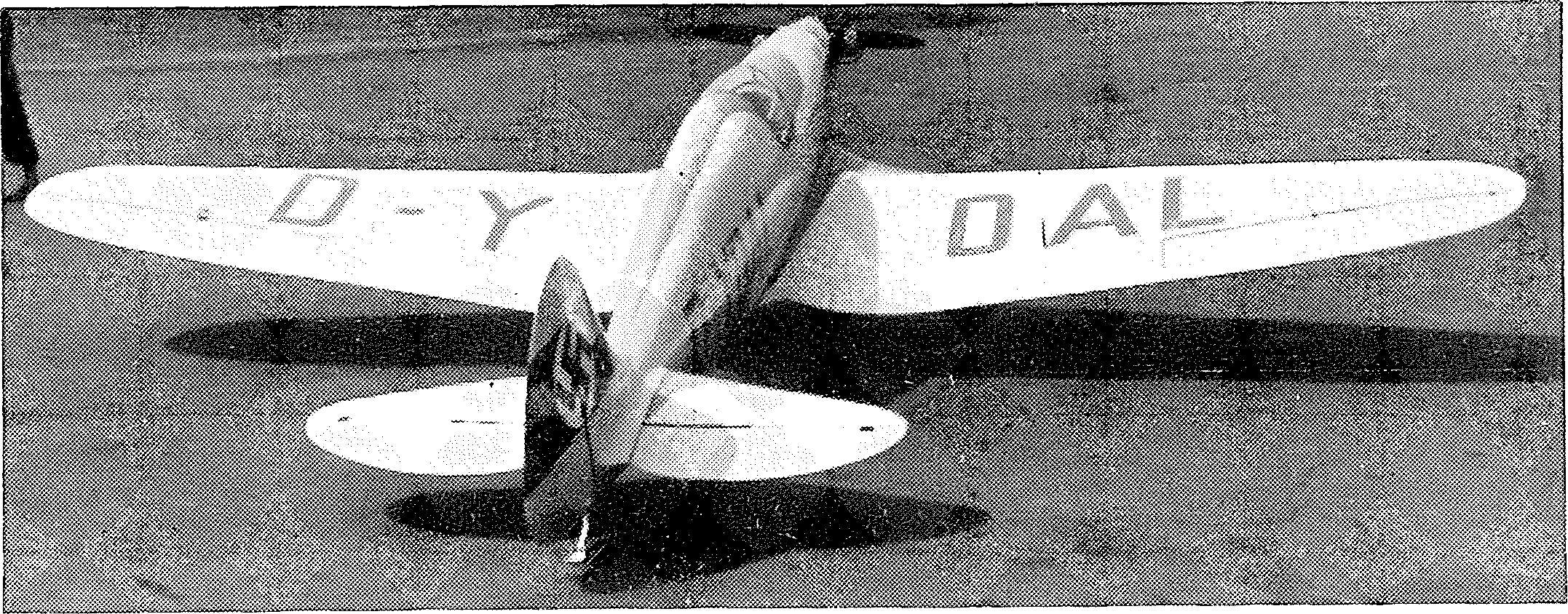
Sitz befestigt ist. Im Bereich des Sitzes ist der Rumpf innen mit Kunstleder ausgekleidet. Plexiglashaube, im Notfall abwerfbar.
Einbein-Fahrwerk. Rad 380X150 mit Rollenlagern und mecha-nischen Bremsen. Die Hauptstrebe, an welcher die Radgabel befestigt ist, liegt 900 mm aus Rumpfmitte. Je zwei Gummiringe sorgen für die Aufnahme der Kräfte bei entsprechendem Federweg. Die getriebene Bekleidungsbleche können leicht abgebaut werden und ermöglichen somit eine ständige Fahrwerkskontrolle.
Höhendämpfungsfläche einholmig, wird aus I-Rippen und Sperrholzbeplankung in normaler Bauweise ausgeführt. Das Haupttrag- und Antriebsrohr ist an zwei Stellen durch Beschläge mit Kugellagern mit dem Holm verbunden. Höhenruder stoffbespannt.
Seitenruder stoffbespannt. Unteres Lager Kugellager, oberes aus einem Stahlbeschlag und einem Gabelbolzen. Der Spalt zwischen der Dampfungsfläche und der kreisförmigen Nasenverkleidung des Ruders wird durch Sperrholzstreifen, die an den Rumpf geleimt sind, abgedeckt. Dämpfungsfläche des Seitenruders ist organisch in Schalen-bauweise mit dem Rumpf gebaut.
Querruder Fachwerksbauweise. Zur Festigkeitserhöhung trägt die Nasenverkleidung bei; stoffbespannt. Ruderspalt ist durch Sperrholz abgedeckt. Ruderlagerung drei Stahlbeschläge mit Kugellagern.
Landeklappen werden nur auf Wunsch eingebaut, Fachwerksbauweise mit Stoff bespannt. Es ist ein Ausschlag bis 65° möglich. Der Antrieb geschieht durch Kniegelenke mittels Seilzügen und Hebeln. Normale Knüppelsteuerung für Höhen- und Querruderbetätigung. Antrieb des Höhenruders durch Seilzüge, Antrieb des Querruders durch Stoßstange bis zur Flügeltrennstelle. Das Höhenruder wird durch ein Hauptrohr, an welches eine Seilauflaufscheibe befestigt ist, bedient. Antrieb der Landeklappen durch einen Hebel, der links neben dem Führersitz angebracht ist. Ein Seilzug zieht an dem Kniehebelgelenk und drückt
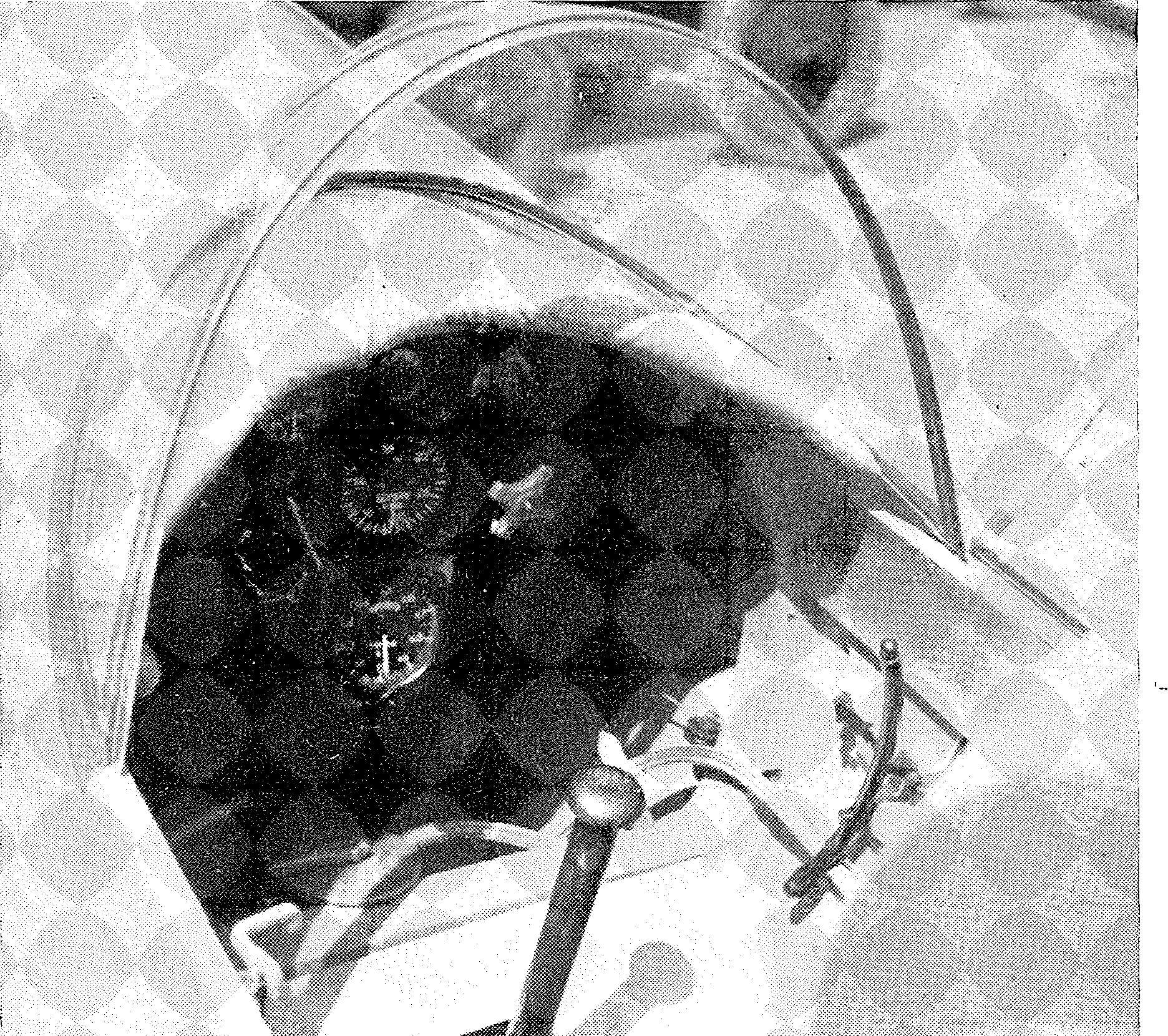
Blick in den Führer räum des „Stürmer",
Seite 260
.FLUGSPORT4
Nr. 10/1939, Bd. 3L
die Klappe heraus; Zurückholen der Klappe geschieht durch Gummikabel.
Ausrüstung: Fahrtmesser, Höhenmesser, Drehzähler, Kompaß, Borduhr, Zündschalter, Feuerlöscher.
Spannweite 7,6 m, Flügelfläche 9,6 m2, Zündapp-Motor N max = 53 PS bei n = 2500 U/min, Fluggewicht 330 kg. Höchstgeschw. am Boden 215 km/h, Reisegeschw. 210 km/h, Landegeschw. (Klappen) 65 km/h, Steiggeschw. 5,4 m/sec, Steigzeit auf 1000 m 3,4 min, Reichweite (ohne Zusatztanks) 650 km.
Einige neuere Ergebnisse der Widerstandsforschung*
Die großen Leistungssteigerungen der Flugzeuge in den letzten Jahren sind in der Hauptsache zurückzuführen auf die Ergebnisse der aerodynamischen Forschung im allgemeinen und auf die Herabsetzung des schädlichen Widerstandes im besonderen. Nachstehend sollen einige Forschungsergebnisse mitgeteilt werden, dabei werden sich gleichzeitig diejenigen Probleme ergeben, die eine klare Lösung bisher noch nicht gefunden haben.
Vor einigen Jahren war es noch nicht möglich, eine befriedigende Erklärung für die Differenzen verschiedener Windkanalmessungen einerseits und dem wirklichen Verhalten im Fluge andererseits zu geben, heute haben diese Fragen durch die Erforschung der Vorgänge in der Grenzschicht eine eindeutige Lösung erfahren.
Nehmen wir einen völlig glatten Flügel an, so ist der auftretende Widerstand reiner Formwiderstand und als solcher abhängig von der jeweiligen Profilform, durch die die Druckverteilung und die Lage des Umwandlungspunktes von laminarer in turbulente Strömung bestimmt ist. Sind also die letzteren Faktoren bekannt, könnte auf einfache Weise eine Berechnung des Profilwiderstandes stattfinden. Es gibt, aber noch kein theoretisches Verfahren, das unter Berücksichtigung der verschiedensten Turbulenzgrade der Windkanäle oder der freien Atmosphäre eine derartige Berechnung möglich machte. Einblick in diese Zusammenhänge konnte vielmehr erst auf experimentellem Wege am fliegenden Flugzeug gewonnen werden. Es haben sich die folgenden Beziehungen ergeben. Der Umwandlungspunkt von laminarer in turbulente Strömung liegt in der freien Atmosphäre weiter nach hinten als im Windkanal, bei gleicher Reynold'scher Zahl, so daß der Widerstand im Windkanal relativ zu groß gemessen wird. Die Lage des Ablösepunktes der laminaren Strömung ist abhängig vom Druckgradienten und somit von der Profilform.
Hinsichtlich der Nutzanwendung dieser Erkenntnis ergeben sich zwei Fragen: In welchem Maße besteht eine Abhängigkeit der Lage des Umwandlungspunktes von der Reynold'schen Zahl, und ist eine Beeinflussung durch Aenderung der Profilform möglich? Die Beantwortung der ersteren Frage ist insofern schwierig, als die idealen Versuchsbedingungen im Fluge — Ausschaltung des Einflusses des Propellerstrahles, der Querruder und Landeklappen — sich nicht einfach verwirklichen lassen. Dagegen kann die zweite Frage eindeutig beantwortet werden. Der Umwandlungspunkt liegt um so weiter nach vorn, je dünner der Flügelschnitt ist; bei einer ebenen Platte liegt er praktisch an der Eintrittskante, und zwar bei Reynold'schen Zahlen von 5.106 (nach Messungen im Ueberdruckwindkanal. Bei einem 25% dicken Flügel konnte eine mittlere Rücklage, etwa in 20% der Tiefe, beobachtet werden. Beim Großversuch erhöhte sich der Wert auf 40%. Der Umwandlungspunkt kann im günstigsten Falle bis zu der durch Ablösung der laminaren Grenzschicht gekennzeichneten Zone zurückwandern. Dieser Punkt kann rechnerisch bestimmt wer-
den, eine Berechnung für ein Tragflügelprofil ist indessen noch nicht erfolgt.
Voraussetzung für eine günstige Lage des Umwandlungspunktes ist eine große Rücklage des Druckminimums, wie dies beispielsweise für symmetrische Profile mit 40% Wölbungsrücklage zutrifft. Bei ihrem Erscheinen beurteilte man die symmetrischen Profile wegen ihres geringen Auftriebsmaximums ungünstig, ein Nachteil, der durch Einführung auftriebserhöhender Klappen weitgehend behoben wurde. Zur Vermeidung des Abreißens der Strömung an der Flügelspitze sollen nicht zu dünne Profile Verwendung finden. In diesem Zusammenhang ist die Feststellung von Bedeutung, bis zu welchem Grade man die Profildicke und somit auch die Rücklage des Umwandlungspunktes steigern kann, ohne daß sich störende Einflüsse bemerkbar machen; zur Klärung dieser Verhältnisse bedarf es noch der Ausführung von Windkanal- und Flugversuchen.
Die Grenzschicht ist sehr empfindlich für Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, eine hohe Oberflächengüte ist daher wesentlich für die Ausbildung einer laminaren Grenzschicht und den Kleinstwert des Reibungswinderstandes. Durch den Schraubenstrahl wird sich immer eine ungünstige Beeinflussung der Grenzschicht ergeben, anzustreben ist daher Druckschraubenantrieb. Neben dem Oberflächenwiderstand wird der Kühlungswiderstand einen erheblichen Anteil des Gesamtwiderstandes ausmachen; sowohl für luftgekühlte, als auch für wassergekühlte Motoren sind die Bedingungen für einen vorteilhaften Einbau bekannt. Diese Einflüsse treten naturgemäß bei kleinen Flugzeugen stärker in Erscheinung. Das Ideal wäre die vollständige Einbeziehung des Motors in das Zelleninnere, um so stetige Umrißlinien zu erhalten, eine Forderung, die sich baulich nicht immer verwirklichen läßt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die moderne Grenzschichttheorie das Widerstandsproblem im wesentlichen gelöst hat und weitere Hinweise für eine erfolgreiche Weiterarbeit gibt. nico.
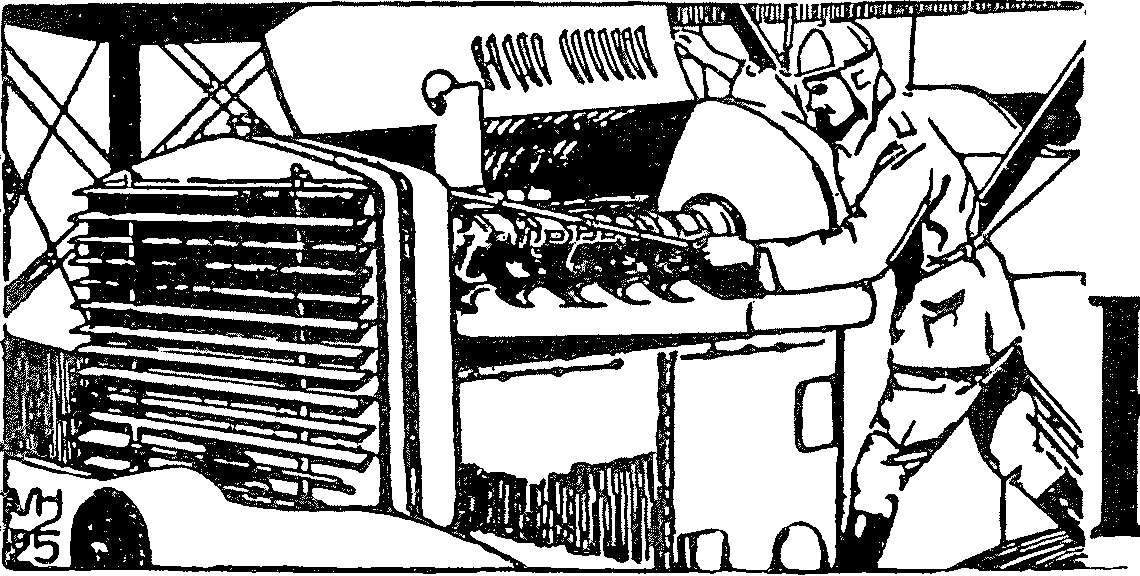
KOWRUKTIO« INZELHEITEM
Elektrisches Verschwindfahrwerk Air-Equipement.
Bei einem Fahrwerk unterscheidet man Art der Federbeinverstrebung, des Hochziehens und Herablassens und Art der Verriegelung. Wichtig ist dabei, schnelles und bequemes Ab- und Anmontieren. Der Vorteil der vorliegenden Konstruktion beruht in der Hauptsache auf einer Federbeinkonstruktion in undeformierbarem Dreiecksverband, der beim Hochklappen durch Veränderung der Dreiecksglieder möglichst geringen Raum einnimmt und in der einfachen elektrischen Betätigung.
Die Einrichtung ist in nebenstehender Abbildung 1 dargestellt.
Abb. 1. Elektr. Verschwindfahrwerk Air-Equipement.
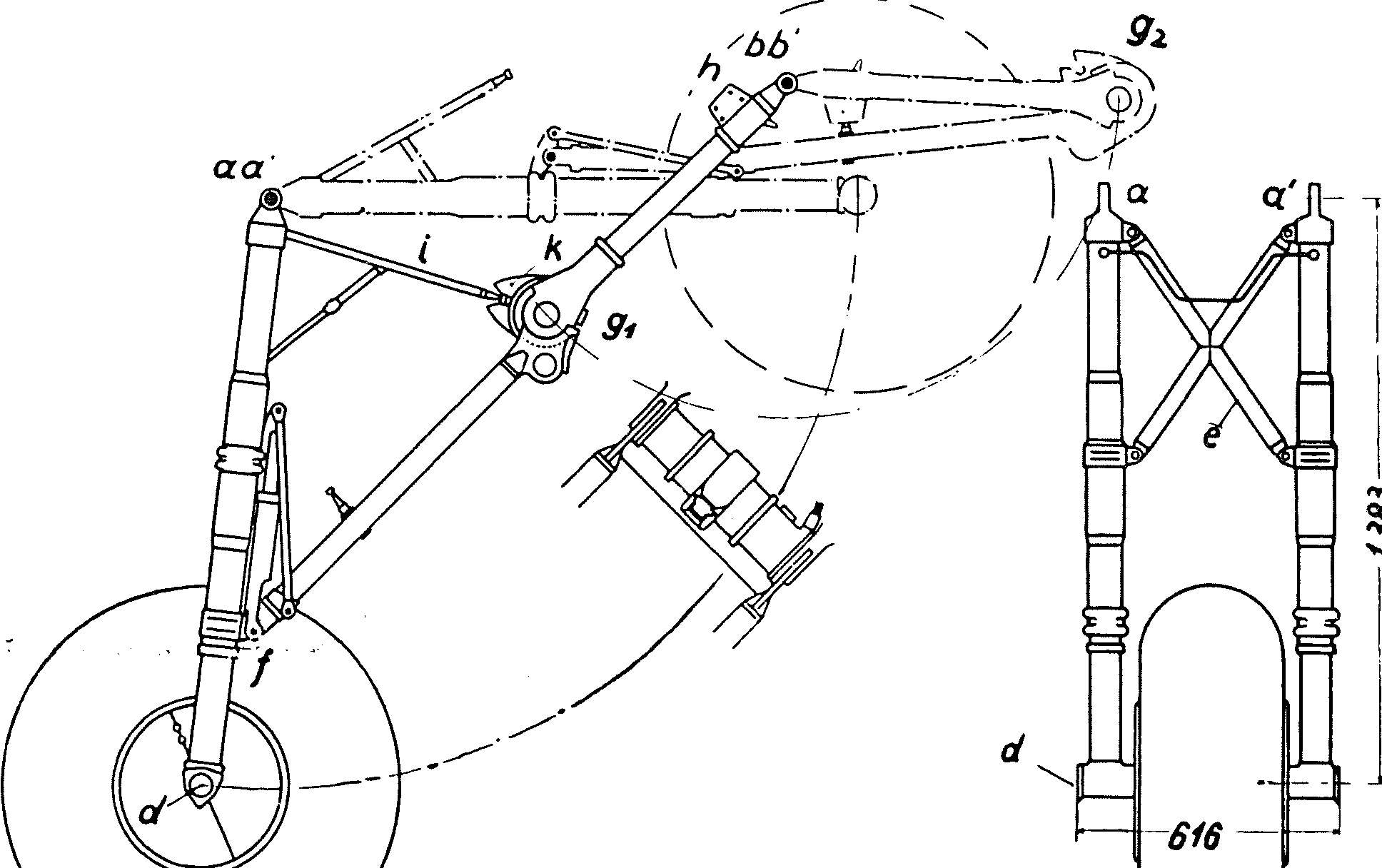
Abb. 2. Elektr. Verschwindfahrwerk Air-Equipement. Links: Ganz heruntergelassen (man beachte an der Strebe des Versuchsstandes die Steuereinrichtung, welche sonst neben dem Führersitz angeordnet ist). Rechts oben: Halb heruntergelassen.
Rechts unten: Ganz eingezogen. Werkbilder
Die beiden Federstreben sind bei aa' gelagert und werden durch eine Knickstrebe, die am Flugwerk bei b b' am Federbein bei f befestigt ist, in ihrer Lage gehalten. In der Knickstelle der Strebe (genou electri-que, das elektrische Knie genannt) ist ein sehr kleiner Elektromotor eingebaut, der mit einem Zahnrad-Uebersetzungsgetriebe von 1 : 5000 das Knie aus seiner gestreckten Stellung in die zusammengeknickte Stellung, wie gestrichelt eingezeichnet, bewegt1).
In der gestreckten Stellung des Knies (Abb. 1) schnappt die Arretierstange i in die Raste k und bildet mit der halben Knickstrebe und dem Federbein einen festen Dreiecksverband2)3).
Das Herablassen des Federbeins kann nun auch mit Motorkraft bewirkt werden, oder durch Auskuppeln des kleinen Elektromotorgetriebes durch Herabfallen des Gewichtes und den hierfür vorgesehenen pneumatischen Rückholzylinder, welcher sich am unteren Teil des Federbeins befindet. Die Luft wird beim Hochholen des Fahrwerkes in den Zylinder zusammengepreßt, so daß sie beim Herablassen das Federbein wieder nach unten beschleunigt.
*) h, Anschlag der eingezogenen Streben.
2) Die Federbeine sind durch den Kreuzverband starr miteinander verbunden.
3) Zur Demontage des Rades kann die Achse d seitlich herausgezogen werden.
Landeklappen mit Schlitzöffnung, Patent
eines Angehörigen der französ. Wehrmacht. Die einfache Kinematik zeigt nebenstehende Abbildung nach „Les Ailes".
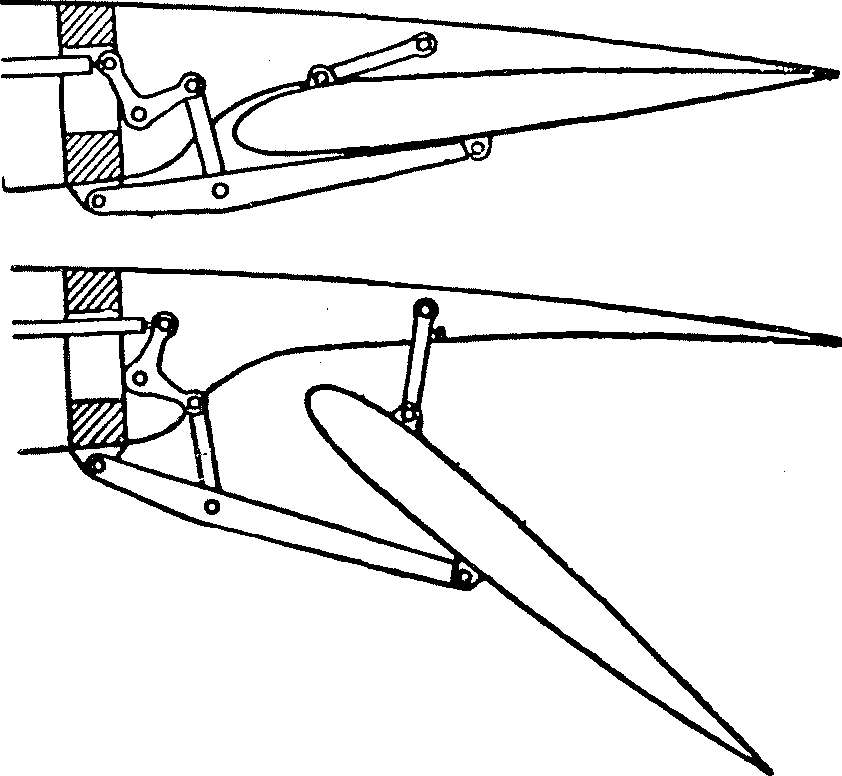
Blechkantenformer wurde hauptsächlich, um den Bedürfnissen der Flugzeugindustrie zu entsprechen, von der L. Schuler AG., Göppingen (Württ), entwickelt. Mit dieser Maschine können alle Abkantarbeiten an beliebig geformten Blechen (gerade Kanten, Winkel und Gegenborde, ferner Falzen, Absetzen, Randumlegen und -einrollen sowie Drahtein-legen) ausgeführt werden. Abb. 1 zeigt den äußeren Aufbau der Maschine.
Aehnlich der Bearbeitung mit einem Handhammer geschieht das Abkanten durch eine rasch hin-und herschlagende Hammerbacke, die kreisförmig geführt ist und schrittweise das Blech hochkantet.
Abb. 1. Blechkantenformer.
Werkbilder
Abb. 2.
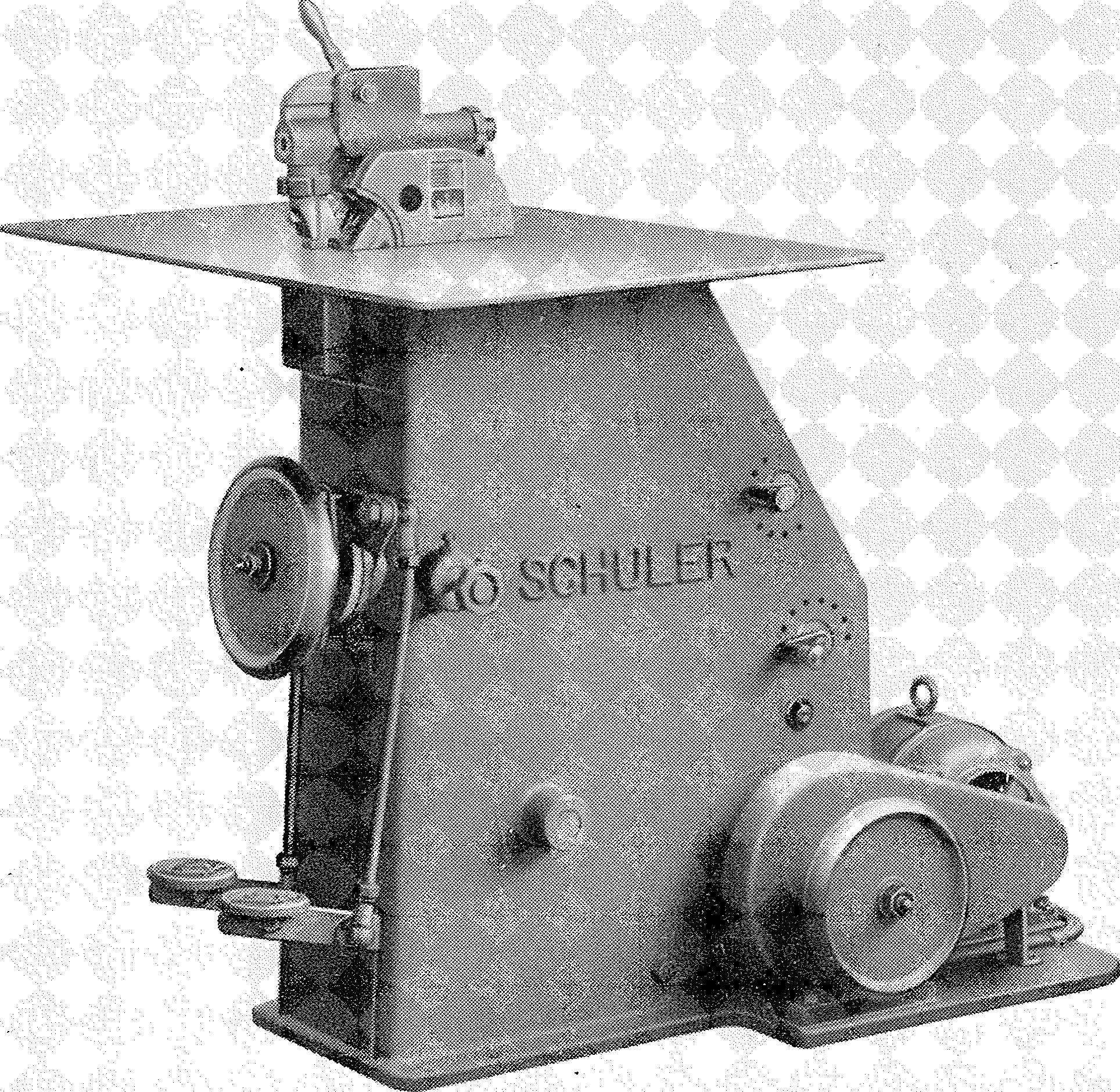
Abb. 3.
Blechkantenformer Schuler.
Abb. 4.
Das Arbeitsstück wird dabei von Hand unter einem der Hammerbacke gegenüberliegenden Blechhalter entlang einem am Blechhalter angeordneten bogenförmigen Führungsfinger hindurchgeführt. Der Blechhalter spannt vor jedem Schlag das Blech auf dem Tisch fest und dient als Gegenhaltung für den Hammerschlag. Das Hochkanten geschieht zur Schonung des Materials oder bei kleinen Krümmungen zur Verhütung der Faltenbildung je nach der Blechstärke in mehreren Arbeitsgängen. Zu diesem Zweck kann der Schlagwinkel der Hammerbacke mittels Fußtritt oder Handrad während des Betriebs auf jeden gewünschten Winkelgrad bis zu 93° verstellt werden. Der am Blechhalter angeordnete Führungsfinger besitzt einen Bogenradius, der die Höhe des Bordes bestimmt und Schablonen entbehrlich macht.
Abb. 2 zeigt schematisch den Kopf der Maschine mit Blechhalter, Anschlagfinger und Hammerbacke sowie die verschiedenen Arbeitsgänge zum Aufstellen eines Bordes, gradlinig oder fassoniert. Die Auswechslung der Werkzeuge, welche den bestimmten Arbeiten entsprechen und an Läuferbacke und Niederhalter angeordnet sind, ist leicht und schnell durchzuführen. Zum Einrichten der Maschine bzw. der Werkzeuge ist lediglich der Niederhalter senkrecht und waagrecht auf die Materialstärke und die Hammerbacke einzustellen. Die neuartige und geschützte Befestigung des Blechhalters ermöglicht dies mühelos in kürzester Zeit. Der Antrieb erfolgt durch einen eingebauten, polum-schaltbaren Drehstrommotor oder mittels Gleichstrommotor und Regulieranlasser. Die Schlagzahl der Hammerbacke kann dadurch in weiten Grenzen verändert werden. Sie beträgt bei polumschaltbarem Drehstrommotor minütlich 215 und 445 und bei Gleichstrommotor mit Regulieranlasser 250 bis 425. Mit diesen Schlagzahlen können Leistungen erzielt werden, welche die Anschaffung der Maschine in kurzer Zeit bezahlt machen. Die Maschine kann überall aufgestellt werden, da für den Anschluß eine gewöhnliche Steckdose genügt. Das Bedienen der Maschine, die sich hauptsächlich für das Bearbeiten von einzelnen Stücken, für die sich die Anschaffung von Spezialmaschinen nicht lohnt, eignet, ist sehr einfach. Abb. 3 u. 4 zeigen Arbeitsbeispiele.
Bördelhöhe bis 35 mm, größte Blechstärke bei Material mit einer Festigkeit von 40 kg/mm2 3 mm, kleinster Krümmungsradius, je nach Blechstärke und Bördelhöhe, bis 45 mm, Kraftbedarf etwa 1 PS.
Luftverkehrs-Verordnung.
Ueberlandflüge, Abfertigung zu —n.
Ausführungsbestimmungen zu § 94 Abs. 1 der Verordnung über Luftverkehr.
I.
A. Der Erlaubnis nach § 94 Abs. 1 LuftVO.1) bedarf es nur zu Ueber-landflügen, d. h. zu allen Flügen über die Flughafenzone des Startflughafens hinaus; sie wird durch den Abfertigungsvermerk im Bordbuch erteilt. Vorbehaltlich einer Regelung in der Verordnung über Luftverkehr bedarf es zu Platzflügen von Landeplätzen oder Segelfluggeländen aus keiner Abfertigung.
Vor der Abfertigung zu einem Ueberlandflug ist von dem Führer des Luftfahrzeuges der Nachweis der Wetterberatung zu fordern.
Dieser Nachweis ist erbracht, wenn
1. das Bordbuch den Stempel der örtlichen Wetterwarte enthält: „Flugwetter einwandfrei (Datum und Uhrzeit) Wetterwarte X (Unterschrift)", oder
2, der Führer des Luftfahrzeuges eine schriftliche Beratung der örtlichen Wetterwarte vorlegt.
Wird die Wetterberatung von einer außerhalb des Luftfahrtgeländes gelegenen Wetterwarte eingeholt, so ist bei der Abfertigung ein entsprechender Vermerk in das Bordbuch einzutragen. Die Wetterberatung ist durch den RLAD. einzuholen; dem beratenden Meteorologen und dem Flugzeugführer ist hierbei gegebenenfalls Gelegenheit zur unmittelbaren Verständigung zu geben. Vgl. NfL. (Nachrichten für Luftfahrer) 36/36. 1, S. 634.
Ausnahmen. Des Nachweises der Wetterberatung bedarf es nicht,
a) wenn der Flug nach der Wetterlage offensichtlich durchführbar erscheint und der Flugweg bis zum Zielort oder, wenn es sich um den Flug eines ausländischen Flugzeugführers in das Ausland handelt, der Flugweg bis zur Reichsgrenze weniger als 150 km vom Startort entfernt sind.
Bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Fluges ist die Erfahrung des Flugzeugführers zu berücksichtigen;
b) wenn sich keine Wetterwarte auf dem Luftfahrtgelände befindet und die Einholung der Wetterberatung von einem anderen Luftfahrtgelände mit erheblichem Zeitaufwand verbunden ist, vorausgesetzt, daß der Flug ausgeführt wird:
aa) mit einem Flugzeug, welches mit einer betriebsfähigen Blindflugausrüstung versehen ist und ein mit ihrer Handhabung vertrautes Personal an Bord hat; oder
bb) von einem Flugzeugführer (auch Ausländer), der durch schriftliche Unterlagen mindestens 300 Flugstunden nachweist.
Als Nachweis genügt eine Bescheinigung nach folgendem Muster: „Bescheinigung: Dem...........wird bescheinigt, daß er hinreichende Erfahrung besitzt (über 300 Flugstunden), um auch bei ungünstiger Wetterlage Ueberlandflüge sicher durchzuführen. (Ort, Datum, Dienststelle.)
Zur Ausstellung einer solchen Bescheinigung sind befugt: Der Korpsführer des NS.-Fliegerkorps für die Mitglieder des NS.-Fliegerkorps, der Aero-Club von Deutschland für seine Mitglieder und die ausländischen Gäste des Aero-Clubs von Deutschland, das zuständige Luftamt (§ 18 Luft-VO.)2) in allen übrigen Fällen. Die Bescheinigung gilt für das ganze Reichsgebiet. B. Die Erlaubnis wird versagt (§ 1 LA Ges.)3)
1. aus Witterungsgründen:
a) wenn der Nachweis der Wetterberatung, soweit er nach Abschnitt A erforderlich ist, nicht erbracht ist;
b) wenn die Person des Flugzeugführers keine hinreichende Gewähr für die ordnungsmäßige Durchführung des Fluges bietet (z. B. wenig erfahrene Flugzeugführer, Flugschüler).
Von einem Startverbot aus Witterungsgründen ist abzusehen, wenn der Flug ausgeführt wird: mit einem Flugzeug, welches mit einer betriebsfähigen Blindflugausrüstung versehen ist und ein mit ihrer Handhabung vertrautes Personal an Bord hat, oder von einem Flugzeugführer (auch Ausländer), der durch schriftliche Unterlagen mindestens 300 Flugstunden auf Motorflugzeugen nachweist; als Nachweis genügt die oben unter A. erwähnte Bescheinigung.
Die Bestimmungen über Startverbot bei „Schlechtwetterlage" sowie über „Schlechtwetterflüge" (FBO., Anhang XVI)4) bleiben unberührt;
2. bei so mangelhafter Beschaffenheit des Rollfeldes, daß der Start mit Gefahr für Luftfahrzeug und Insassen verbunden wäre (z. B. Rollfeldhindernisse, Ueberschwemmungen);
3. bei offensichtlichen Schäden am Luftfahrzeug, durch welche die Verkehrssicherheit gefährdet ist.
Das Luftamt (Außenstelle) hat den Zulassungsschein dem Inhaber abzunehmen und die Weiterverwendung des Luftfahrzeuges vorläufig zu verhindern.
In den Fällen des § 17 Abs. 1 Ziff. 2 der Prüf Ordnung für Luftfahrtgerät5), in denen eine Nachprüfung unterbleiben kann, ist der einbehaltene Zulassungsschein dem Berechtigten wieder auszuhändigen, sobald der Schaden behoben ist. Ein entsprechender Vermerk ist im Bordbuch in dem für „Luftfahrtstörungen ......." vorgesehenen Raum einzutragen.
In anderen Fällen ist der Zulassungsschein unter Angabe des Grundes der Wegnahme sofort an das RLM. — Prüfstelle für Luftfahrzeuge — zu senden; das Luftfahrzeug darf erst wieder in Betrieb genommen werden, nach-
2) Vgl. NfL. 36/36. 1, S. 625.
3) Vgl. NfL. 39/7. 1, S. 291.
4) Vgl. NfL. 39/6. 33, S. 257.
5) Vgl. NfL. 36/37. 2, S. 665.
Seite 266
.FLUGSPORT"
Nr. 10/1939, Bd. 31

dem die Prüfstelle oder die von ihr beauftragte Stelle die Verkehrssicherheit bescheinigt hat;
4. aus Gründen, die in der Person des Luftfahrers liegen (z. B. Verdacht einer strafbaren Handlung, Trunkenheit);
5. aus anderen Gründen der Luftaufsicht (z. B. Beanstandung von Bordpapieren, Verhinderung strafbarer Handlungen).
Das Startverbot muß bei seiner Bedeutung für den Luftverkehr in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Zweck stehen und ist nur dann zu verhängen, wenn andere Mittel den Zweck nicht erreichen.
II.
Die Befugnis des Luftamtes (Außenstelle), den Start zu Flügen innerhalb der Flughafenzone aus Gründen der Luftaufsicht zu verbieten (§ 1 LAGes.)6), bleibt unberührt.
III.
Die Verkehrsbestimmungen für Flugzeuge im Dienste der Luftwaffe (Luftwaffenverordnungsblatt 1937, Seite 315, Nr. 718) bleiben unberührt. (LB 2 II, 900/39.)
FLUG
umscHÄ
Inland.
Generalfeldmarschall Göring hat als Schirmherr der Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung den Staatssekretär der Luftfahrt und Generalinspektor der Luftwaffe, Generaloberst Milch, zum Ehrenpräsidenten der Lilienthal-Gesellschaft und den Generalluftzeugmeister Generalleutnant Udet zum Präsidenten der Gesellschaft ernannt, zum wissenschaftlichen Vizepräsidenten der Akademie der Luftfahrtforschung Prof. Messerschmitt und zum außerordentlichen Mitglied der Akademie Dr.-Ing. Todt, Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen.
Ju 52 „Hans Loeb" D-ANJH, Besatzung Frhr. v. Gablenz, Flugkpt. Helm, Oberflugzeugfunker Kober und Oberflugmaschinist Wolschke, welche am 22. 4. 0.47 h vom Flughafen Berlin-Tempelhof nach Tokio, Flugweg über Belgrad, Athen, Beirut, Bagdad, Djask, Karachi-Kalkutta, Alahabad-Rangoon, Bangkok und Hanoi gestartet war, ist m 3. 5. 6 h auf dem Flughafen bei Tokio gelandet. Bei den Zwischenlandungen in Fukuoka auf Kiuschiu und Taihoku auf Formosa wurden die Flieger von den städtischen Behörden und der Bevölkerung aufs herzlichste begrüßt.
Rudolf Heinemann f. Ing. und alter Flieger, ist in Freiburg i. Brsg. nach einer längeren Krankheit im Alter von 55 Jahren gestorben. Heinemann, einer der Vorkriegsflieger und Fluglehrer, welcher seinerzeit 1914 den großen Boelcke in Halberstadt schulte, war in letzter Zeit bei der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug in Darmstadt tätig gewesen. Wir werden diesen treuen Kameraden nie vergessen.
Wirtschaftsführer durch Oberbefehlshaber der Luftwaffe wurden ernannt die Betriebsführer: Dr. Alfred Teves, i. Fa. Alfred Teves G. m. b. H., Frankfurt a. M., und Dir. Erich Plesse, i. Fa. Vereinigte Deutsche Metallwerke AG., Zgn. Heddernheimer Kupferwerke, Frankfurt a. M.-Heddernheim. Durch Erlaß vom Oberbefehlshaber der Kriegsmarine zu Wirtschaftsführern ernannt die Betriebsführer: Dr. jur. Waldemar Braun, i. Fa. Hartmann & Braun AG., Frankfurt a. M.
CS. Normenausschuß und Deutscher Normenausschuß hat im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsministerium folgende Vereinbarung getroffen mit dem Ziele, die zukünftige Zusammenarbeit in freundschaftlichem Geiste möglichst erfolgreich zu gestalten:
1. Die bisherige CS. Normungsgesellschaft (Cesko-slovenskä normalisacni spolecnost) ändert ihren Namen auf Ceskomoravskä spolecnost normalisacni (Böhmisch-Mährische Normungsgesellschaft), gekürzt CSN. Als solche ist sie die Zentralstelle für die Normung auf dem Gebiete des Protektorates Böhmen und
Vgl. NfL. 39/7. 1, S. 291.
Mähren, wo sie allein berechtigt ist, die gesamte Normung zu organisieren und gegenüber dem DNA bzw. der reichsdeutschen Normung zu vertreten.
2. Die CSN bleibt direktes Mitglied der ISA.
3. Firmen, die sich auf dem Gebiete des Protektorates Böhmen und Mähren befinden, können nur dann als Mitglied des DNA aufgenommen werden, wenn sie Mitglieder der CSN sind. Umgekehrt können reichsdeutsche (z. B. sudetendeutsche) Firmen, die an der Normung in Böhmen und Mähren interessiert sind, nur dann Mitglieder der CSN werden, wenn sie Mitglieder des DNA sind.
4. Die Herausgabe von Normen auf dem Gebiete des Protektorates Böhmen und Mähren bleibt ausschließlich der CSN vorbehalten. Diese Normen erscheinen in tschechischer Sprache.
Bei der Aufstellung neuer Normen werden die beiden Normungskörperschaften die Zusammenarbeit anstreben, um möglichst eine übereinstimmende Fassung der Normen zu bekommen.
5. Die bisher erschienenen CS-Normen (CSN) gelten auf dem Gebiet des Protektorates Böhmen und Mähren weiter als böhmisch-mährische Normen. Die CSN wird nach Bedarf Vergleichslisten zwischen CSN-Normen und DIN-Normen aufstellen. Vor allem erscheinen solche Vergleichslisten für Grundnormen Maschinenelemente erwünscht. Die Angleichung zwischen diesen Normen und den DIN-Normen ist von Fall zu Fall zu prüfen und gegebenenfalls zu vereinbaren.
6. Bestellungen auf CSN-Normen beim DNA und beim Beuth-Vertrieb sind zur Auslieferung an CSN abzugeben. Bestellungen auf DIN-Normen bei der CSN sind zur Auslieferung an Beuth-Vertrieb abzugeben.
7. Sämtliche aus diesem Uebereinkommen sich ergebenden Einzelfragen werden durch direkte Verhandlung zwischen CSN und DNA gelöst.
187,76 km/h über 1000 km flog Max Brandenburg auf „Stürmer" von FL G. Möller-Hamburg mit 42 PS Zündapp-Motor in der 2-1-Klasse (Einsitzer) am 26. 4. Geflogen wurde auf der Meßstrecke Bremen—Schwessin (Pom.) und zurück. Flugzeit 5 h 19 min 33 sec.
Was gibt es sonst Neues?
Istus-Tagung Warschau 1939 voraussichtlich verschoben.
50 Südatlantikflüge haben die drei Transozean-Flugzeuge von Blohm & Voß, Baumuster „Ha 139" und „Ha 139b", im Dienste der Deutschen Lufthansa ausgeführt.
Ital. Flieger haben in Spanien insges. 943 feindliche Flugzeuge vernichtet. Ital. Verlust 86 Flugzeuge.
Ausland.
Monospar-Unterdruckkabine zeigt nebenstehende Abbildung im Rohbau. Die Kabine für drei Mann Besatzung, seitliche Einsteigschottentür. Das hintere Rumpfgerüst ist an dem kugelförmigen hinteren Teil der Kabine angenietet. Das Versuchsflugzeug Monospar St-25 ist mit zwei Pobjoy Niagara von je 95 PS ausgerüstet.
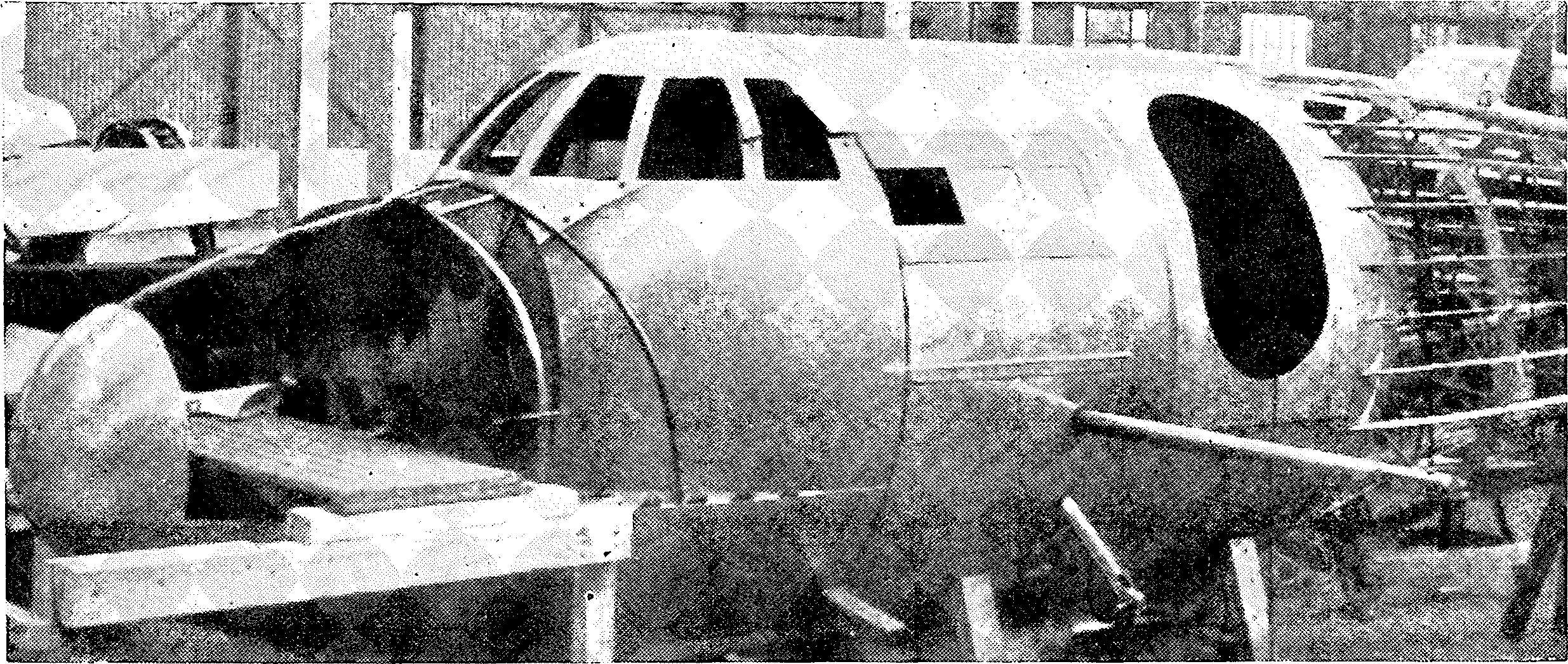
Monospar Unterdruckkabine. Bild"- The Aeroüiane
Short Brothers 30jähriges Bestehen. Beginnend mit dem Bau einer Wright-Maschine 1908 „Short 1", folgten Militärlieferungen von 6 Wright-Maschinen. Hiernach folgten weitere Doppeldecker, wrightähnlich, an Stelle der Verwindung Querruder. 1915 die ersten Wasserflugzeuge und 1924 die ersten Flugboote, freitragend, teilweise beeinflußt durch deutsche Konstrukteure. Aus letzter Zeit sind noch bekannt 1926 die Doppeldecker-Flugboote Singapoor, Calcutta, die Empire-
Flugboote Canopus u. a., die wir bereits mehrfach im „Flugsport" besprochen haben.
Royal Aeronautical Society's Gartenpartie findet am 14. 5. auf dem Great West Aerodrom von Fairey in der Nähe von Hayes, Middlesex, statt. Man wird Vorführungen von Boulton Paul Defiant, Blackburn Skua Sturzbomber, Hawker Hurricane, Westland Lysander II, Miles Master, D. H. Moth Minor, eines neuen Arpin, Chilton, Wicko, des Monospar St. 25 mit der Unterdruckkabine, des Percival Q-6, Willoughby Delta und vieler anderer sehen können.
Flugplatz Ratcliffe, Leicester, nach West Bromwich und zurück segelte W. B. Murray vom London Gliding Club am 7. 4.
Ungarische Flieger folgen einer Einladung nach England vom 13. 5. bis 17. 5., wo sie Gäste des Aero-Clubs und der Automobil-Association sind.
Deutsch-italien. Luftverkehrsvereinbarungen auf 10 Jahre während der Anwesenheit des Luftgeschwadergenerals Pellegrini in Berlin am 26. 4. fest abgeschlossen. Gegenstand der Vereinbarung: Ausgestaltung des wechselseitigen Betriebs der Luftverkehrslinien zwischen Italien und Deutschland.
Signor Zerbi t> Konstrukteur des Fiat-Flugmotors, mit dem die Schneider-Trophäe gewonnen wurde, am 11. 3. gestorben.
F. A. I.-Sitzung Ende Sept. 1939 in Athen beschlossen. Als Sekretär wurde Colonel Liossis bestimmt. Für die Segelflug-Coupe Bibesco wird 1939 der Aero-Club von Deutschland beauftragt.
Mochet-Fahrrad mit Stromlinienverkleidung wurde von Mochet gebaut und experimentiert und von Francis Faure gefahren. Ohne Verkleidung wurden über eine Versuchsstrecke von 4 km 45 km/h erreicht.
Bei einem ersten provisorischen Umbau wurden 48 km/h erreicht.
Bei einer zweiten Verkleidung mit verkleinerter Kopföffnung (daß gerade der Kopf durch die Oeffnung ging) 49,700 km/h.
Bei der dritten Ausführung der Verkleidung wurde die Unterseite so weit wie möglich geschlossen. 53 km/h.
Vierte Ausführung, Karosserie, wurde besser geformt und vor allen Dingen die Oberfläche durch Lackierung geglättet. 55,400 km/h.
Fünfte Ausführung, Verkleidung des Kopfes, 56,500 km/h.
Bei den Versuchen ergaben sich folgende Feststellungen: Bei Anbringen der Kopfverkleidung trat eine merkwürdige Abnahme der Gleichgewichtswahrnehmung ein. Bei Abnahme der Kopfhaube wurde die Gleichgewichtswahrnehmung sofort wieder besser.
Nach Mochets Ansicht sind mit dieser Maschine 60 km/h ohne weiteres zu erreichen.
American Export Airlines beabsichtigt einen Versuchsflug von New York nach Marseille mit einem Consolidated PB2Y-Flugboot mit zwei .1200 PS Pratt & Witney Twin Wasp. Bei günstigem Ausfall der Versuche soll zunächst ein Postdienst eingerichtet werden.
Lockheed „Excalibur, ein neues Verkehrsflugzeug, vier Pratt & Whitney Wasp-600-PS-Motoren für 21—28 Fluggäste und 3 Mann Besatzung, Fluggewicht 13 t, Spannweite 28,5 m, Länge 22,50 m, Reisegeschwindigkeit 350 km/h, Höchstgeschwindigkeit 385 km/h, Aktionsradius 3300 km. Das erste Baumuster soll Frühjahr 1940 fertig werden.
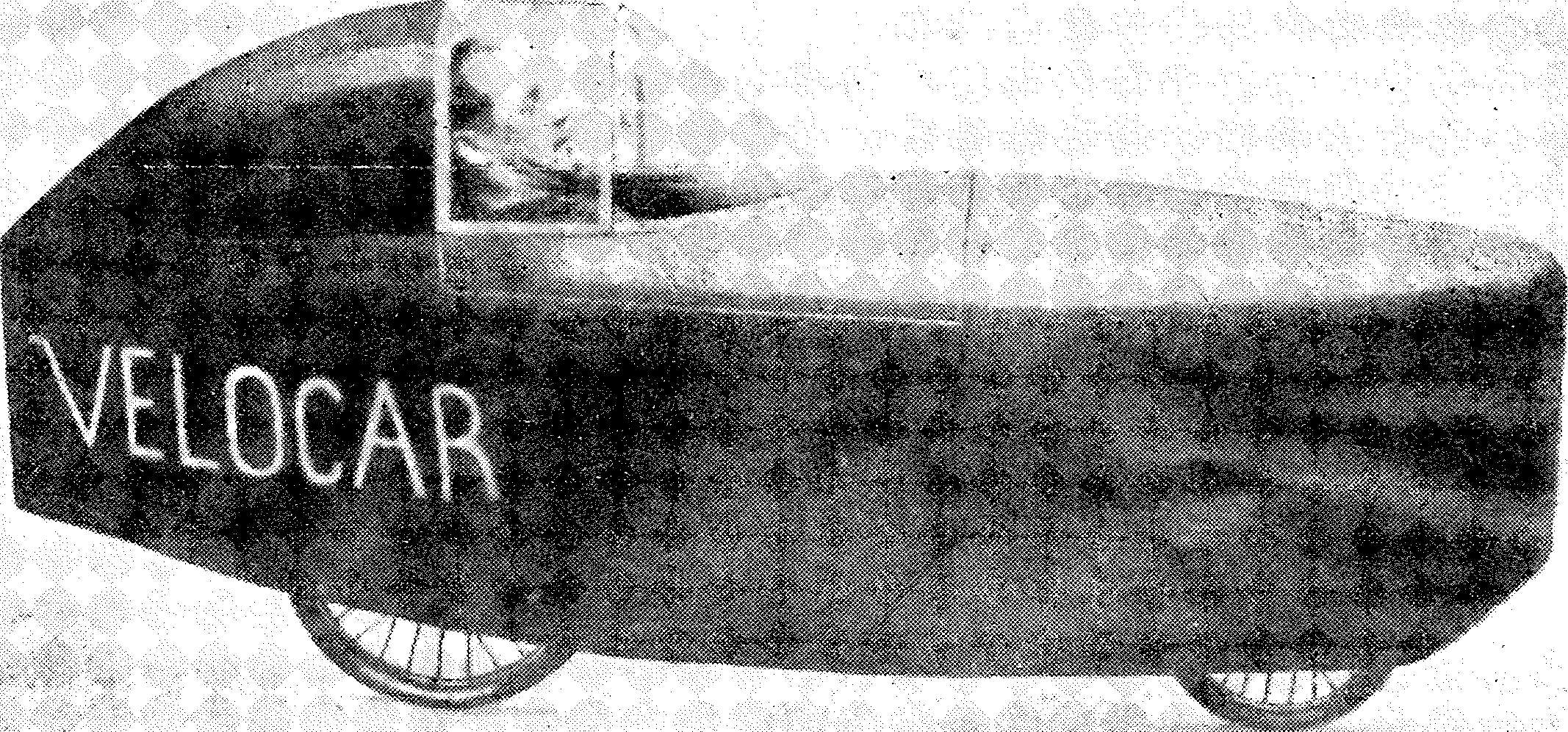
Bild:
Les Ailes
Franz. verkleidetes
Fahrrad „Velocar".
USA-Luftwaffenauftrag 50 Mill. $, darunter allein bei Curtiss Wright 13 Millionen $ für einmotorige Jagdflugzeuge. Gesamtflugzeugbestand soll auf 6000 gebracht werden.
Lindbergh, der bekannte amerik. Flieger, hat über den Stand der amerik. und europäischen Flugzeugindustrie ein Urteil abgegeben. Nach Ansicht Lindberghs stehe, wie „Paris Midi" berichtet, Deutschland in der Flugzeugindustrie an erster Stelle, während Amerika erst vor der Sowjetunion liege, die ganz weit ins Hintertreffen geraten sei. Das Pariser Mittagsblatt zeigt sich nicht sehr begeistert über die Einschätzung, deren Richtigkeit es jedoch in keiner Weise bezweifelt. Man nimmt sogar Bezug auf die von Frankreich und England getätigten Flugzeugkäufe in Amerika und schreibt, derartige Wertungen der amerikanischen Flugzeugindustrie würden in Frankreich sicherlich nicht gern gehört. In England sei es allerdings bereits ein öffentliches Geheimnis, daß man seit Aufnahme der amerikanischen Flugzeuglieferungen an den Illusionen über die Güte dieser Industrie jenseits des Ozeans einige Abstriche habe machen müssen.
„ANT-25" wurde von der Sowjetregierung für die kommende Weltausstellung nach New York gesandt. Beim Auspacken der Maschine stellte sich heraus, daß die frühere Bezeichnung dieses historischen Flugzeugs ,,Ant-25" in „NO-25-1" abgeändert ist.
Non-stop-Flug Moskau—New York über Island—Neufundland zur New Yorker Weltausstellung ist durch Notlandung infolge Benzinmangels unterbrochen worden. Notlandeplatz noch unbekannt. Das sowjetrussische Flugzeug war am 28. 4. 4.33 h Moskauer Zeit mit 2 Mann Besatzung gestartet.
Peter Lippmann vom NSFK. 2/75 ließ sich am 23. 4. in Frankfurt a. M. an den Hochtaunus heranschleppen und segelte am Hang von Ober-und Niederreifenberg 2 Std.
470 km von der Wasserkuppe segelte Ltn. d. Luftwaffe Paselak auf einem ,,Rhön-Bussard" und landete in Stargard i. Pom. Größte erreichte Höhe 4350 m. Weiter flog ein 17jähriger Lehrgangteilnehmer der Flieger-HJ. mit einem „Rhön-Bussard" 189 km bis Glauchau in Sachsen.
310 km segelte auf „Minimoa" Karl Bauer, Segelfluglehrer, vom Heppacher Kopf bei Waidlingen in das Reichsprotektorat bis Pilsen.
18 000 Starts ergab Gleitflugwettbewerb Gruppe 11 NS.-Fliegerkorps. 19. 2. bis 16. 4. beteiligt 25 Stürme und die fliegerisch betreute Einheiten der Flieger-HJ. In den kommenden Jahren soll dieser Gleitflugwettbewerb regelmäßig durchgeführt werden, und es ist anzunehmen, daß er von sämtlichen anderen NSFK.-Gruppen in der gleichen Art übernommen wird. Folgende Stürme stehen in der Punktwertung an bester Stelle: NSFK.-St. 1/77 Darmstadt, 7061 Pkt.; NSFK.-St. 3/72 Trier, 5253 Pkt.; NSFK.-St. 1 und 2/75 Frankfurt a. M., 4961 Pkt.
Weg zur Fliegertruppe. Vom 12.—14. Jahre melden bei den Modellflug-Arbeitsgemeinschaften des Jungvolks. Schulung im praktischen Modellbau und Modellflug. Leitung: NSFK.-Männer. Vom 15.—18. Lebensjahr Uebertritt zur Flieger-HJ. Bau und Schulung auf Gleit- und Segelflugzeugen. Leitung: NSFK.-Männer. Auswahl zur Ausbildung im Segelflug. Vom 18. Lebensjahr ab Eintritt als NSFK.-Männer in das NS.-Fliegerkorps. Ausbildung in halbjährigen Kursen auf Motorflugzeugen. Von hier aus Ueberführung zur Fliegertruppe.
Madame Jarlaud wurde nach ihrem Tode zum Ritter der Ehrenlegion ernannt.
Geoffrey Stevenson segelte über den Kanal in einem Kirby Gull am 22. 4. von Dunstable nach Le Wast bei Boulogne. Er wurde in Dunstable auf 120 m geschleppt und erreichte in Folkestone, wo er schon viel Höhe verloren hatte, eine Aufwindzone unter den Wolken, so daß er in 1800 m sich entschloß, den Flug über den Kanal zu wagen. Entfernung betrug 184 km.
205 km segelten Ltn. Colin, franz. C-Pilot, und Melleton, franz. D-Pilot, am 23. 4. 39 auf Castel 24 S (Segeldoppelsitzer des Club Olympique de Billancourt, Paris, gebaut 1936 von Arbeitern der Renaultwerke) von Etampes nach Bar sur Aube in 53/4 Std. Damit wurde der franz. Entfernungsrekord für Doppelsitzer, der bisher 91 km betrug, geschlagen.

Segelflug
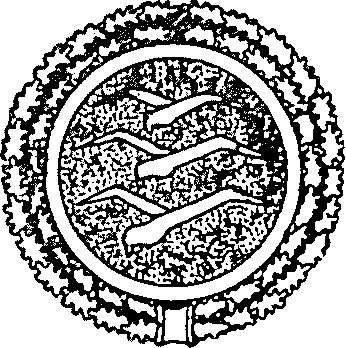
Engl. Ostersegelfliegen Cambridge Gliding Club in Pewsey, Witshire. Es nahmen 25 Mitglieder teil. Thermik ungünstig, nur Hangsegeln.
Die Segelflugveranstaltung auf dem gemieteten Flugplatz Ratcliffe, Leicester, brachte 5 Ueberlandflüge. Größte Entfernung 64 km. Godfrey Slater, 15 Jahre alt, Sohn eines bekannten Segelfliegers, wurde auf 600 m geschleppt und flog bis Nottingham.
Istus-Tagung Warschau (vgl. „Flugsport" 39 Nr. 9 S. 250). Die Internationale Studienkommission für den motorlosen Flug teilt mit, daß der Teil der Tagung, der für Kattowitz vorgesehen war, einschließlich des Segelflugwettbewerbes, nach Lemberg verlegt wird. Für Warschau bleibt das Programm unverändert. Der übrige Teil des Programms bleibt im wesentlichen derselbe; Aenderungen werden rechtzeitig zu Beginn der Tagung mitgeteilt.
Soweit es zeitlich möglich ist, werden folgende, bei der Istus noch nachträglich eingegangene Vorträge in das Vortragsprogramm aufgenommen: 1. Prof. Eula: Trudeleigenschaften der Segelflugzeuge. 2. Prof. Eredia: Die vertikalen Thermikgradiente in Bodennähe. 3. Ing. Simone: Der internationale Wettbewerb des Olympia-Segelflugzeuges. 4. Col. Nuvoli: Die Möglichkeit, die Flügelbeanspruchungen bei Segelflugzeugen zu vermindern. 5. Dr. Eichenberger: Aero-logisches Treffen auf den Rochers de Naye im August 1938.
Auskunft wegen Unterkunft erteilt der Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej, Krolewska Nr. 2, Warschau/Polen.
Rumänischer Segelflug.
Segelflugschule San-Petru/Brasov, 1937 von der Federatia Aeronautica Regala A Romaniei gegründet. Die Leitung übernahm der Aeroclub von Brasov, der durch seine hervorragenden Leistungen in der Motorflugabteilung auch im Ausland einen guten Ruf hat. Die, für die kurze Zeit ihres Bestehens, recht beachtlichen
Ergebnisse verdankt die Schule hauptsächlich Dipl.-Ing. V. Timc-sencu als Leiter und Ernst Philipp als Segelflughauptlehrer.
Das Fluggelände ist verhältnismäßig klein und niedrig. Aber seine bevorzugte Lage in einem ca. 15—20 km flachen Kessel erlauben ab 7 m/s Windstärke Flüge in jeder Windrichtung. Das Gelände eignet sich ausgezeichnet für A-B-C-Schulung im Hangstart. Eine in unmittelbarer Nähe gelegene Weide wird mit Erfolg für Windenschleppschulung be-
Rumän. Lageplan Segelflugschule San-Petru/Brasov.
Zeichnung Flugsport
nützt. Für Flugzeugschlepp kann der ca. 10 km abgelegene Motorflugplatz des Aeroclubs verwendet werden.
Der von der hohen Karpathenkette umschlossene Platz hat natürlich weniger gute Wind- und Thermikverhältnisse als eine freigelegene Gegend. Bei entsprechender Ausrüstung der Schule und Ausnutzung aller Möglichkeiten des Geländes hofft man auf eine Jahres-Gesamtflugstundenzahl von 1000 zu kommen. Für 6 Schulgleiter und 4 Segelmaschinen stellen die erflogenen Zeiten ein recht schönes Ergebnis dar.
1937: 112 Segelflugstd., 6 Fünfstd.-Flüge, 3 Flüge mit über 1000 m Startüberhöhung. 1938: 320 Segelflugstd., 5 Fünfstd.-Flüge, 1 Zehnstd.-Flug, 1 Leistungsabzeichen, 32 amtl. C-Prüfungen, 40 amtl. B-Prüfungen. Dabei wurden 8 Segelflug- und 17 Gleitfluglehrer ausgebildet. Ein Beweis für den erfreulichen Aufschwung des Segelflugwesens in Rumänien.
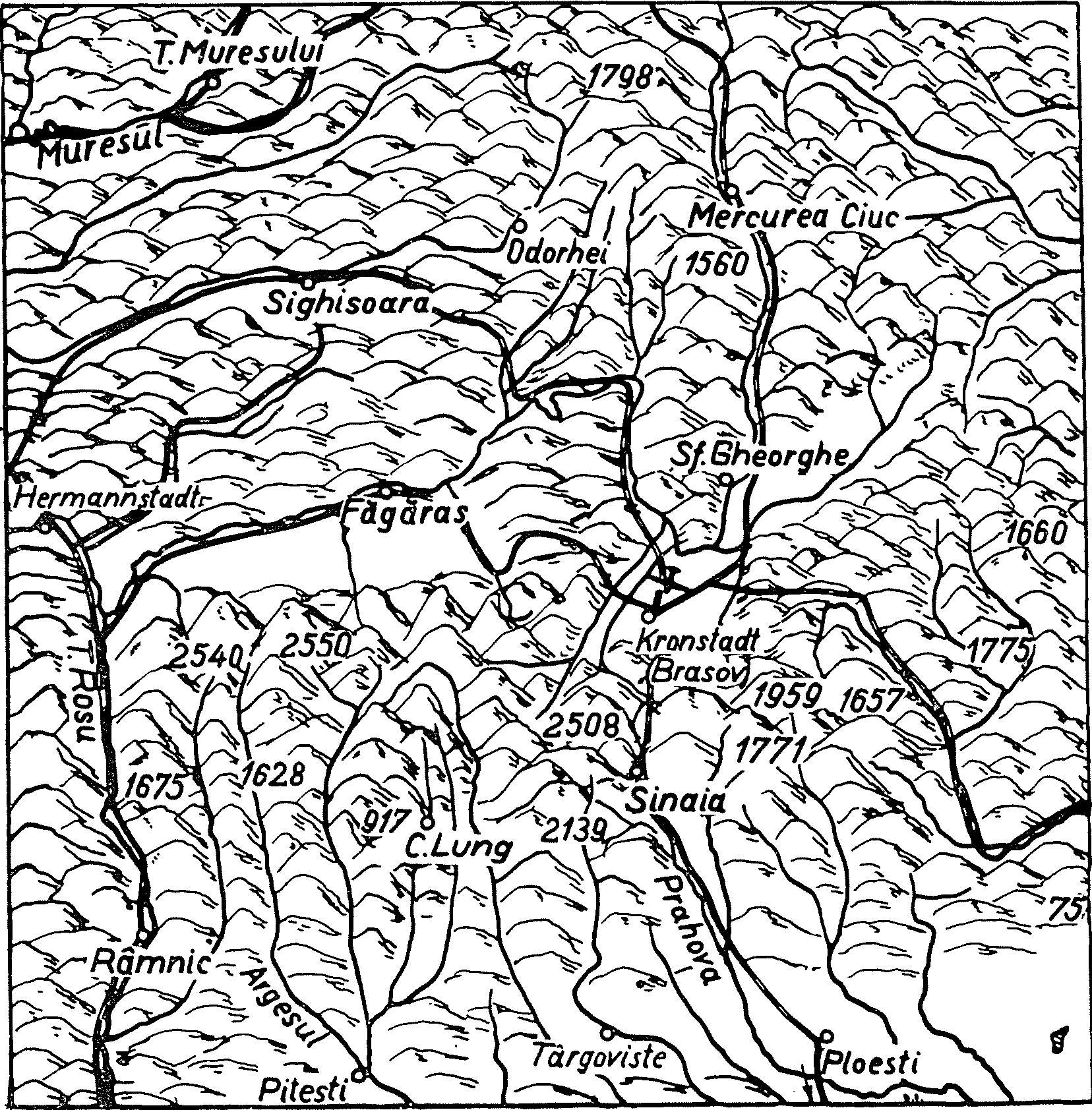
)ach Bukarest
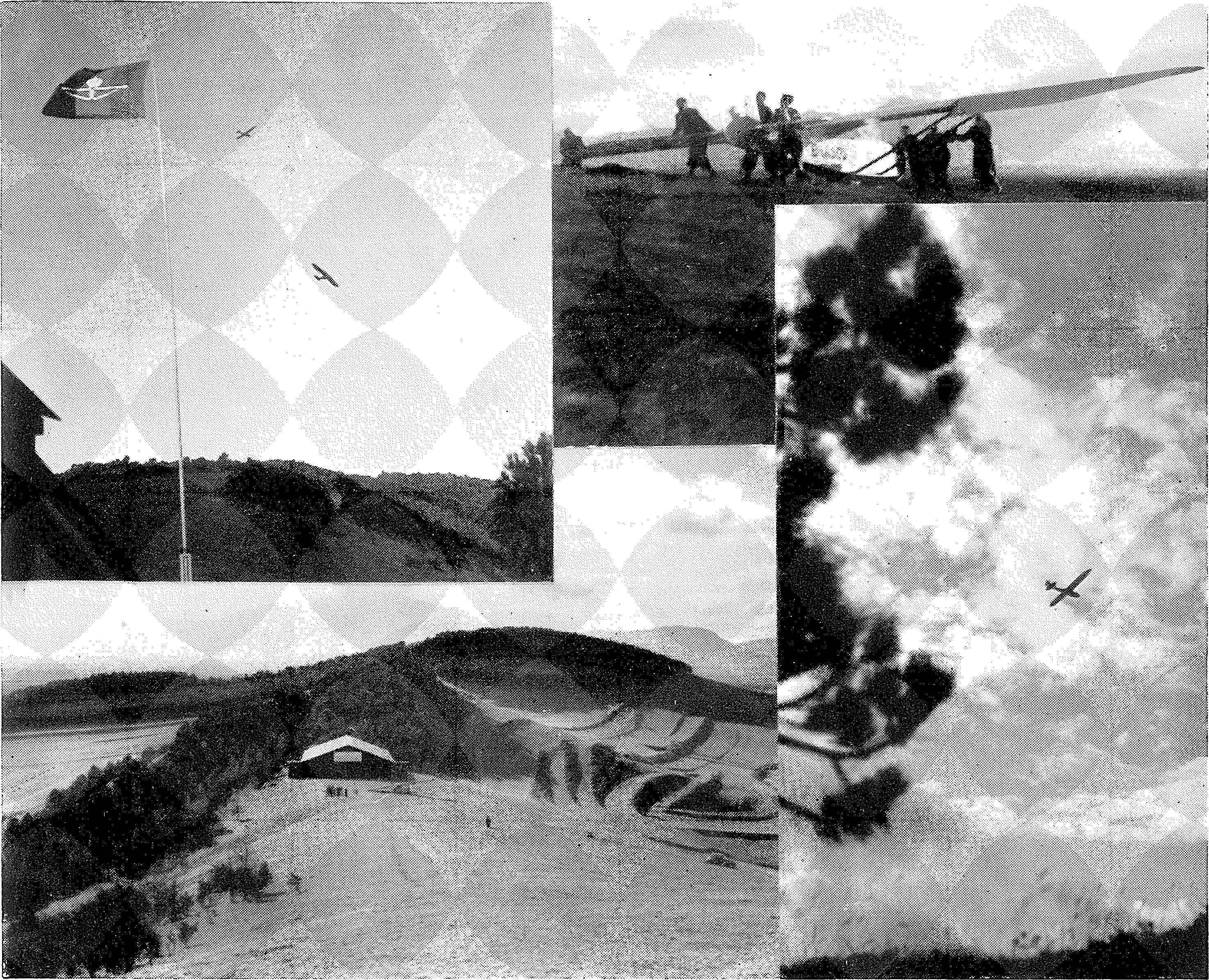
Segelflug in Rumänien. Von der rumän. Segelflugschule San Petru, Brasov. Oben links: Flugbetrieb bei Ostwind 12—14 m. Rechts: Rücktransport zur Startstelle. Unten links: Teilansicht des Fluggeländes mit der Halle. Rechts: Grunau-
Baby A am Südhang.
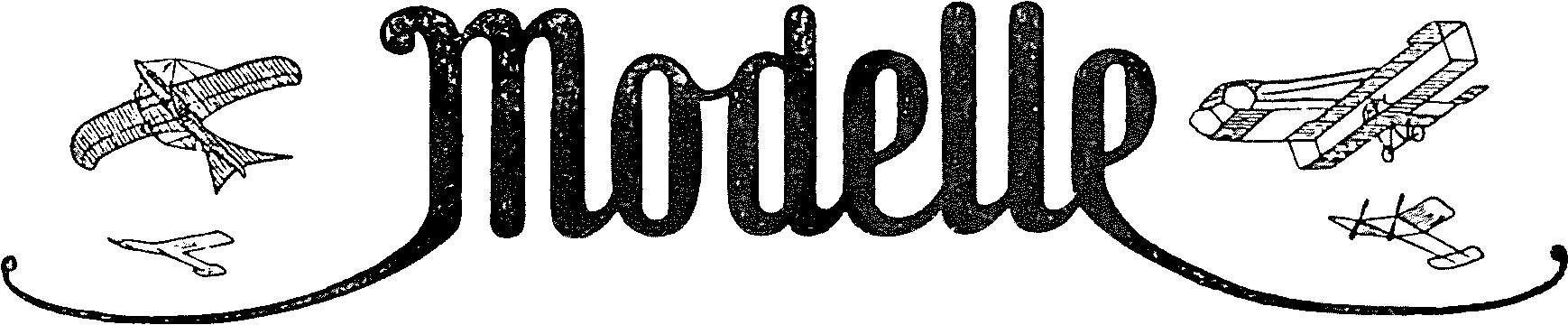
Flugmodellbau an den Berliner Schulen wurde betrieben 1935 an 232, 1936 an 361, 1937 an 429, 1938 an 435 Schulen. Zahl der Baugruppen 1935 556, 1936 998, 1937 1291 und 1938 1515. Zahl der teilnehmenden Schüler 1935 9691, 1936 17 137, 1937 22 712 und 1938 27 280. Diese Entwicklung ist vor allen Dingen der Zähigkeit des Stadtschulrats Dr. Meinhausen zu danken.
Internat. Modellwettbewerb um den „Preis des Königs (Leopold III. v. Belgien), Veranstalter Föderation de la Petite Aviation, findet am 18. 6. in Liege statt.
Belg, internat. Wettbewerb für Segelflugmodelle 3. 9. 39 in Frasnes-les-Couvin, Veranstalter Aviation Beige.

Schichtholzplatten werden hauptsächlich in Dicken von 8—60 mm, in Breiten von 200—450 mm und in Längen von 1200—5000 mm hergestellt. Hierin liegt bereits ein Teil der Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem gewöhnlichen Sperrholz. Verwendungszweck des Schichtholzes: für hochbeanspruchte Bauteile, wie Flügelholme und Luftschrauben. Durch die Schichtung hohe und gleichmäßige Festigkeitseigenschaften, durch entsprechende Wahl der Schichtung der Fourniere (5—100 je cm Dicke) wird Festigkeit erhöht. Verleimung durch wasserfesten, schimmelbeständigen Kunstharzfilm. Vgl. die Veröffentlichungen über Holzver-
gütung „Flugsport" 1938 S. 16 sowie über mittlere Festigkeitswerte von Buchenschichtholz 1938 S. 67.
Literatur.
(Die hier besprochenen Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Abenteuer zwischen Himmel und Erde. Von Gustav Bahr. Ein Buch von 200 Fallschirmabsprüngen und Sportfliegerei. Verlag E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW 68. Preis kart. RM 2.85, geb. RM 3.80.
Verfasser schildert seine Erlebnisse aus der Sportfliegerei, beginnend mit seiner Tätigkeit als „Flugtag-Luft-Zigeuner", im Sportflugzeug, mit der Fliegerkamera bis heute. Praktische Erfahrung ist alles, von dem Niederkämpfen des eigenen Schweinehundes angefangen. Vorsicht ist keine Laurigkeit, sondern Notwendigkeit. Eine Menge praktischer Winke werden vermittelt. Wieder ein lebenswertes Buch aus der Praxis.
„Kadett", Anfänger-Motorflugmodell, v. Helmuth Kirschke. (Bauplan-Sammlung erprobter Flugmodelle, Nr. 5.) Verlag Klasing öl Co. G. m, b, H., Berlin Wr 35. Preis RM —.60.
Ein einfaches Stabmodell, freitragend, Drahtfahrgestell, durchschnittliche Leistung in 30 Sek. 200 m Strecke.
Neue Wege der Flugtechnik, v. Henrich Focke. (Schriftenreihe „Deutsches Museum, Abhandlungen u. Berichte", 10. Jahrg., H. 6.) VDI-Verlag G.m.b.H., Berlin NW 7. Preis RM —.90.
In diesem Heftchen (22 Seiten) vermittelt der bekannte Konstrukteur interessante Einzelheiten über schwanzlose Flugzeuge, Enten und Hubschrauber.
Segelflugmodell „Minimoa" v. Erich Linke (Schäfers Bauplanreihe freifliegender Flugmodelle). Verlag Moritz Schäfer, Leipzig C 1. Preis RM 1.—.
Naturgetreues Modell, in natürlicher Größe gezeichnet ohne Maße. Spannweite 1900 mm, Länge 810 mm, Tragfläche 22,5 dm2, Gewicht 600 g.
Luftfahrt-Forschung Bd. 16, Lfg. 3 u. 4. Herausg. v. d. Zentrale für wissenschaftliches Berichtswesen über Luftfahrtforschung (ZWB) Berlin Adlershof. Verlag R. Oldenbourg, München. Preis je Lfg. RM 2.50.
Lieferung 3 enthält: Uebertragung gemessener Druckverteilungen auf beliebige Anstellwinkel v. A. Walz; Auftriebsverteilung und daraus abgeleitete Größen f. Tragflügel i. schwach inhomogenen Strömungen v. K. Bausch; Ueb. d. Bestimmung d. Zirkulationsverteilung f. d. zweidimensionalen Tragflügel b. beliebigen periodischen Bewegungen v. K. Jaeckel; Ueb. Resonanzschwingungen i. d. Ansaug- u. Auspuffleitungen v. Reihenmotoren v. O. Lutz; Der Flugweg i. Blind-flugkurven, insbes. b. Schlechtwetterlandungen v. H. Nautsch.
Lieferung 4: Ergebnis d. Preisausschr. d. Lilienthal-Ges. f. Luftfahrtforschung 1937/38; Ueb. d. Strömungsvorgänge an steil angestellten u. überzogenen Tragflügeln b. Parallelbewegung u. Drehung v. M. Kohler; Kräfte u. Momente schrägangeströmter Tragflügel v. S. Hoerner; Auftriebsberechnung u. Strömungsvorgänge b. Ueberschreiten d. Maximalauftriebes v. P. Jordan; Z. Berechnung d. symmetr. Längsbewegung eines Flugzeugs v. K. Solf; D. Geschwindigkeitsfeld eines beliebigen dünnen u. schwach gewölbten Tragflügelprofils v. K. Jaeckel, Kathodenvakuumdestillation v. Flugmotorenölen v. M. Richter.
Fliegen, v. F. L. Neher. Verlag F. Bruckmann, München. Preis RM 9.50.
Im Plauderton behandelt Verfasser in diesem Buch, unterstützt von ausgezeichneten Zeichnungen von E. v. Saalfeld, 2300 Jahre Fluggeschichte, der Mensch lernt fliegen, der vollendete Flug, Sicherheit, Fliegen und Bestehen, Flug von morgen.
Expedition des WT W W W A mTf7I?f/^W Expedition des
Die drei gespaltene Millf meter~.2Seile kostet 25 Pfennig.
Segelfluglehrer,
Werkstattleiter für Gleit- und Segelflugzeugbau, Führerschein I, II u. III
"rÄ sucht Stellung.
Angebote unt. Ziffer 4039 an den Verlag des „Flugsport", Frankfurt-M-, erbeten.
Tüchtigen
Flugzeug-Tischlermeister
auf sof. od. spät, für mein. Flug-zeug-Versuchsb.ges.Ing. Möller, Hamburg39,Maria-Louisenstr.65
Werde Mitglied der NSV.!
Modell-Benzinmoior
Kratmo 4, f. neu, f. RM 42.- zu verk. Ferner gebr. Baupläne. J. Schönleitner Aichkirchen Post Lambach Oberdonau.
„FLUGSPORT'
Erfahrener technischer
KAUFMANN
mit erstkl. Referenzen für aufstrebendes unternehmen (Flugzeug-Versuchsbau) auf sofort oder später gesucht.
Ingenieur Möller, Hamburg 39
Maria-Louisenstrafje 65
(Salmson A D 9) in tadell. Verfassung, geeign. für Sport, Reise und Schulung, gute Instr.-Ausstattung, Bosch-Anl., zugelass., versieh, und
kompl. Ersatzteile-Motor
verkaufe sehr günstig im Auftr.
H. Ruchay, Lötzen/Ostpr.
Automstr. Karlstraße
Ein so gut wie fabrikneuer
Köller-Flugmotor
Muster Kroeber M 4
zu verkaufen. Angebote erbittet die
Ingenieurschule Weimar.
Flugzeug ^Spann lacke
Marke „Cellemit", liefert seit 1911
Dr. Quittner & Co.
Berlin*Lichtenberg Rittergutstrafje 152, Fernr.612562
Mittweida
Ingenieur, schule
IMaschinenbau / Automobil- u. Flugtechnik Elektrotechnik._Programm kostenlos
Das deutsche Segelfliegerlied
von G. Striedinger, für Gesang mit Klavierbegleitung, darf in keinem Ver* ein od. Familie fehlen. Preis incl. Porto RM L15. Zu bezieh, v. Verlag „Flug« sport", Frankfurt/M., Hindenburgpl. 8, Postscheckkonto 7701, Frankfurt a. M.
Fernschule für lugzeugbau
Theoret. Vorbereitung für Bauprüfer, Flugzeugführer, Ingenieure sowie für den gesamten Flugdienst. Sonderlebr-gängefür Jungflieger. AbJdiußPrüfungen - Abschlußzeugnisse. Studien-progr. Nr. 145 durch das Sekretariat.
Fernschule G.m.b.H. Berlin W15
Kurfürstendamm 66 p.
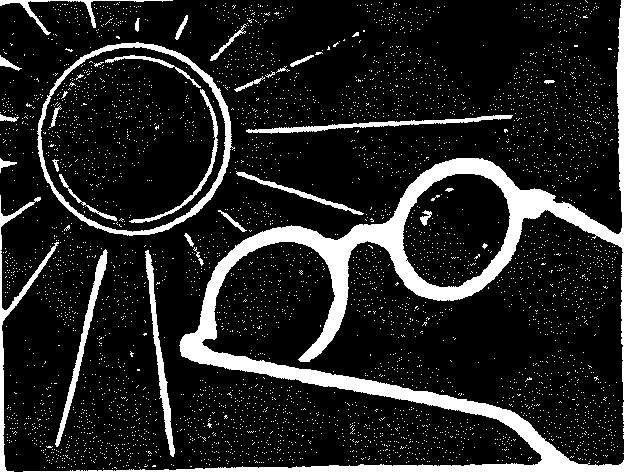
Flieger sagen: Neophan!
Weil kontrastreiche, plastische Boden- und Wolkensicht. Schutz gegen Sonnen-, Schnee- und Wasserstrahlung,
natürliche Farbeindrücke, denn: Blau bleibt Blau, Grün bleibt Grün, Rot bleibt Rot!
Auergesellschaft - Aktiengesellschaft,
BERLIN N 65
2
SchuUSeaeHlug**»*8 - 1
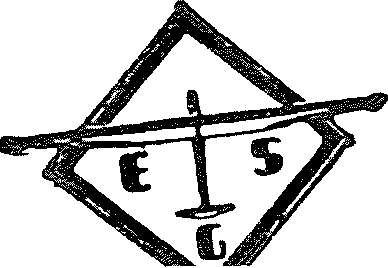
9 UrpSengeozm
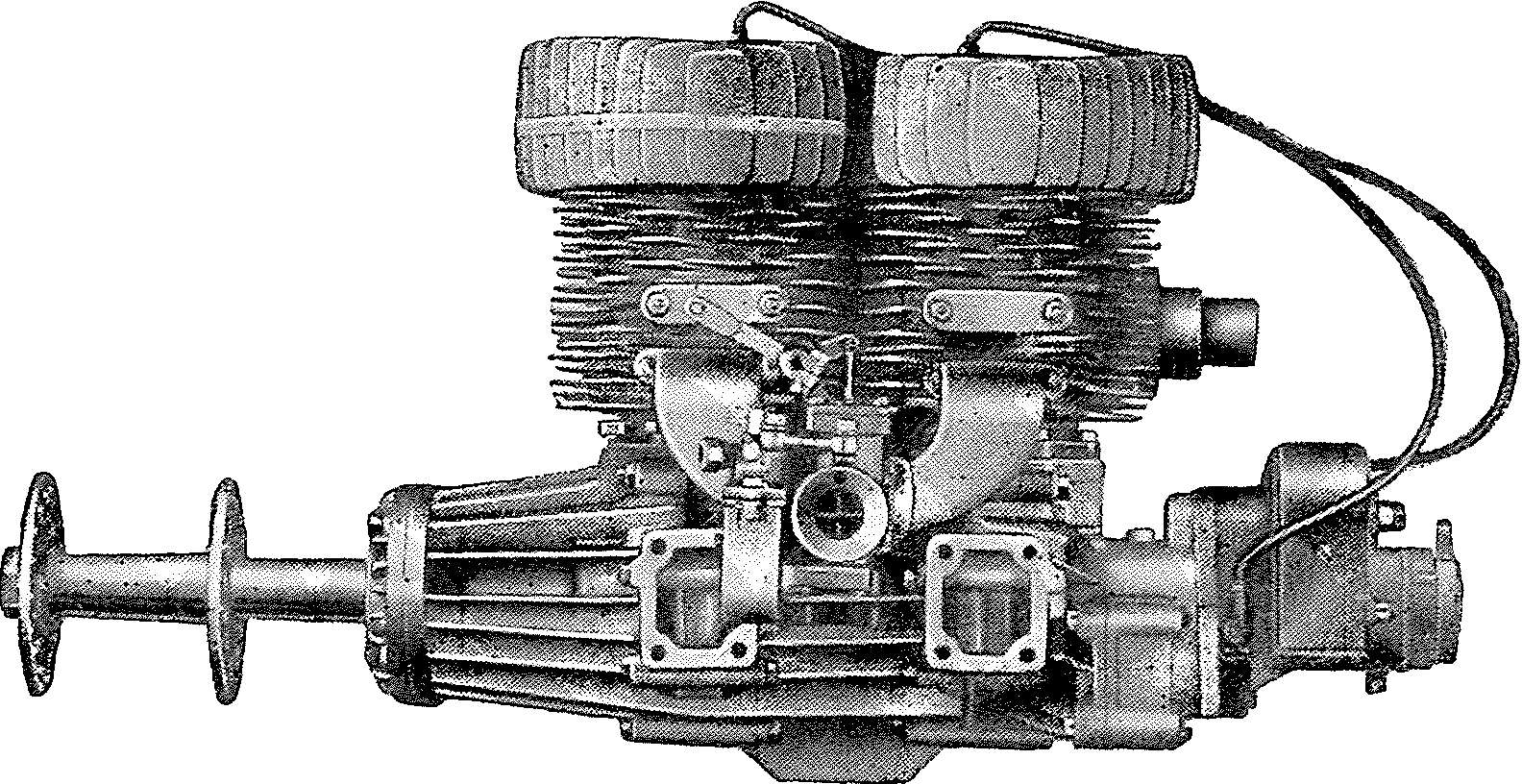
Seld-Motor 1000 cem 36 PS / 3300 n
Zweizylinder — Zweitakt — luftgekühlt — Leichtbau
Höchstleistung 36 PS
Dauerleistung für Automotoren........35 PS
Flugmotoren........30 PS
stationäre und Bootsmotoren . . 33 PS
Motoren für alle Verwendungszwecke
Automotoren, Kleinflugmotoren, stationäre Motoren, Bootsmotoren
Seid Kompressorenbau r;„k Heidelberg
General-Vertreter: Mestwerdt & Co., Hamburg 1, Seeburg

Hochleistungs-
Segelflugzeug
13
Stahlrohrbau: sicher - leicht - billig
SCHWARZWALD-FLUGZEUGBAU Willeme DONA UESCHINGEN
Heft 11/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro Y\ Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Teleir.-Adresse: Ursimis — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalten und Verlar Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ,,Nachdruck verboten" versehen. _nur mit genauer Ouellenancabe gestattet._
Nr. 11 24. Mai 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 7. Juni 1939^
Pfingsten Wasserkuppe.
Der Winter ist vorbei, der Schnee schon weggeschmolzen. Die Wiesen auf der Kuppe haben überraschend schnell sich mit einem saftigen Grün überzogen. Ein neuer Jahresabschnitt des Schaffens beginnt — — — so wie jedes Jahr mit dem Reichsmodellwettbewerb für Segelflugmodelle vom 27.—29. Mai*), dem Pfingstwettbewerb in der Rhön.
510 durch Gruppenwertung ausgewählten Männern mit ihren Modellen aus HJ. und NSFK. ist es vergönnt, an dem nun auch schon traditionell gewordenen Pfingstmodellwettbewerb auf der Wasserkuppe teilzunehmen. Außer Ehren- und Geldpreisen für Hand-, Hochstart, Dauer sind bronzene, silberne und goldene Plaketten und der Wanderpreis des Korpsführers ausgesetzt.
Wie in früheren Jahren wird auch diesmal der Korpsführer, Generalltn. Christiansen, zugegen sein, um sich über den Stand der Ausbildung seines Nachwuchses ein Bild machen zu können. Die vom Führer dem Korpsführer gestellten Aufgaben sind in den letzten Jahren bedeutend gewachsen. Zu diesen gehört als allerwichtigste die Vorschulung des Nachwuchses für die Luftwaffe. Gleichzeitig wird von dem Nachwuchs im Durchschnitt noch mehr verlangt als früher, eine Leistungssteigerung auf breiter Basis. Es ist Pflicht aller Flugbegeisterten und irgendwie im Flugwesen Tätigen, an dieser gewaltigen Aufgabe mitzuwirken.
Der diesjährige Wettbewerb, zu dem auch andere führende Persönlichkeiten erscheinen werden, wird einen würdigen Auftakt zu den Veranstaltungen des Korpsführers auf der Wasserkuppe bilden.
*) Zeitfolge des Reichsmodellwettbewerbs für Segelflugmodelle 1939: Freitag, 26. 5., Eintreffen der Teilnehmer; Sonnabend, 27. 5., ab 9 Uhr Technische Prüfung der Flugmodelle; Sonntag, 28. 5., 8.30—8.45 Uhr Wettbewerbseröffnung vor dem Qroenhoff-Haus, 9.30 Uhr Eröffnung der Startstellen, 18 Uhr Startschluß, 21—21.30 Uhr Fackelzug und Feier am Fliegerdenkmal; Montag, 29. 5., 8.30 Uhr Eröffnung der Startstellen, 15 Uhr Startschluß, 15—17 Uhr Auswertung der Wettbewerbsflüge, Segel- und Motorflug-Vorführungen, 17.30 Uhr Preisverteilung, 18.30 Uhr Wettbewerbsschluß.
Diese Nummer enthält Patentsammlung Nr. 9 und Report-Sammlung Nr. 13.
Uebungs-Segeldoppelsltzer Muster ?9GoevIeru9 Sitze nebeneinander.
In einer mehr als einjährigen, sorgfältigen Entwicklungsarbeit wurde im Sportflugzeugbau Schempp-Hirth in Göppingen und Kirchheim/Teck das neue Uebungssegelflugzeug Muster „Goevier" geschaffen. Die Konstruktion wurde vom Sportflugzeugbau durchgeführt unter Leitung von Wolf Hirth und Dipl.-Ing. Wolfgang Hütter. Der Abschluß der Musterprüfung und die Zulassung durch das RLM erfolgte im Februar 1939. Das Muster befindet sich jetzt im Serienbau.
Die gestellte Aufgabe lautete: Entwicklung eines zweisitzigen Uebungssegelflugzeuges mit nebeneinander liegenden Sitzen und Doppelsteuerung, mit 14,8 m Spannweite, mit fest eingebautem Einradfahrwerk vor dem Schwerpunkt und mit Leistungen, die den normalen Uebungs-Segelflugzeugen, also etwa den Typen „Grünau Baby IIa" oder „Göppingen 1, Wolf" entsprechen. Diese Forderungen wurden nicht nur erfüllt, sondern in den Leistungen noch übertroffen, also ein Doppelsitzer geschaffen, der insbesondere in unseren Segelflugschulen vorteilhaft eingesetzt wird, wo es auf eine gründliche und rasche Schulung innerhalb einer begrenzten Zeit ankommt. Die Doppelsitzerschulung ist in Verbindung mit der Einsitzer-Schulung besonders da fördernd, wo ein „großer Schritt" in der Schulung zu tun ist und wo naturgemäß Hemmungen auftreten, also z. B. beim Liebergang von einer Startmethode zur andern, beim Auto-Winden- und Flugzeugschlepp, dem Uebergang von einer reinen Schleppschulung zum Hangflug oder umgekehrt, der Einführung in den thermischen Segelflug und insbesondere bei der Blindflugschulung. Der enge Kontakt zwischen Fluglehrer und Schüler durch die Anordnung der Sitze nebeneinander ist für eine rasche und erfolgreiche Schulungsarbeit besonders günstig. Weitere Vorteile sind gleich gute Sichtverhältnisse für beide Flugzeugführer und nur eine Instrumentierung.
Das Fahrwerk mit Bremse liegt direkt unter den Führersitzen und damit vor dem Schwerpunkt. Dadurch werden motorflugzeugähnliche Start- und Landeeigenschaften erzielt, also eine Erleichterung für die Umschulung vom und zum Motorflug.
Für die im Ausland übliche rasche Schleppflugschulung dürfte dieser Doppelsitzer sich besonders eignen, um so mehr, da bis heute ein derartig gleichhochwertiges Baumuster nicht vorhanden ist. Auf jeden Fall wird das Bruchrisiko bei der Doppelsitzerschulung ver-
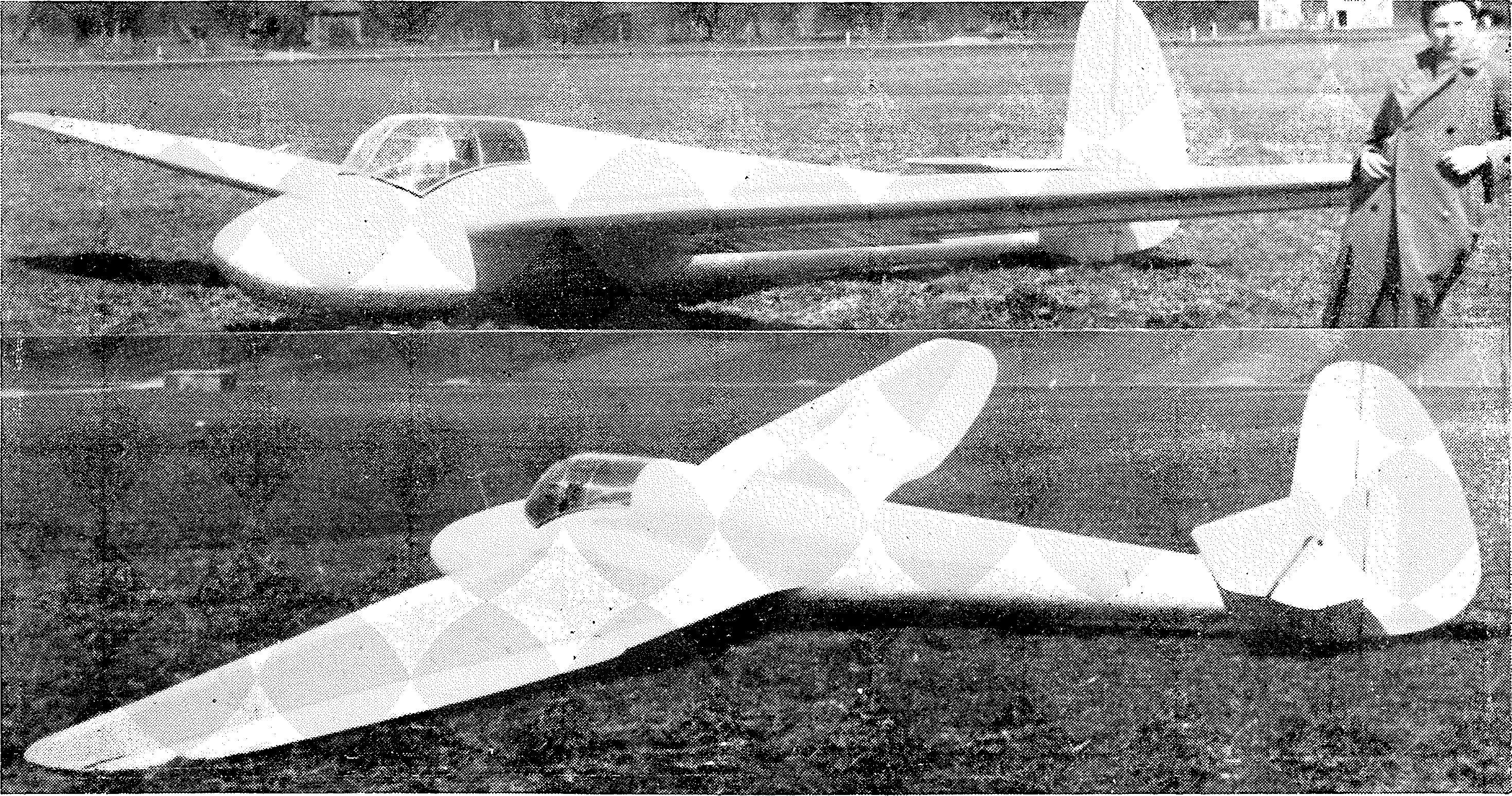
Uebungs-Segeldoppelsitzer „Goevier". Werkbilder
mindert. Der Doppelsitzer gibt gleichzeitig die Möglichkeit, auch Nichtsegelfliegern die Schönheiten eines Segelfluges bei Passagierflügen erleben zu lassen.
Zu unserer Beschreibung mit Uebersichtszeichnung und Abbildung im „rlugsport" 1938 S. 122—24, wäre noch folgendes nachzutragen: Die freitragenden Tragflügel besitzen einen offenen _J~Holm und die normale Sperrholztorsionsnase. Der Querruderantrieb erfolgt zum Teil mittels Stoßstangen (mit Faudi-Kugelgelenken) und zum Teil mit Steuerseilen. Die Flügel besitzen die bewährten Schempp-Hirth Sturzbremsen, (kurz S-H Bremsen), welche die Endgeschwindigkeit auf 200 km/h begrenzen. Die besonderen Vorteile dieser Bauart sind: einfache und billige Holzbauweise der Bremsklappen. Auch ein evtl. Verziehen der Klappen wirkt sich nicht ungünstig auf die Flügelglätte aus. Der gegen das Flügelinnere wasserdicht abgeschlossene Schacht, in dem die Bremsklappen in vertikaler Lage untergebracht sind, besitzt nur eine schmale Oeffnung auf Ober- und Unterseite der Flügel. Gesamtgewicht der S-H Bremsen nebst ihrem Antrieb nur 6—7 kg*). Ein senkrechter Sturzflug mit voll ausgefahrenen Klappen (Knüppel voll gedrückt) wird nur äußerst selten nötig sein. Wesentlicher als die Begrenzung der Endgeschwindigkeit ist die stabilisierende Wirkung, durch die man in kritischen Augenblicken die Maschine schnell wieder in die Hand bekommt. Läßt man alle Steuer los und zieht die Bremsen voll, so geht das Flugzeug in ein sehr stabiles Kreisen mit etwa 80 km/h Geschwindigkeit über. Bei der Landung und in Bodennähe muß man allerdings die S-H Bremsen unbedingt mit „Gefühl" betätigen. Die Sinkgeschwindigkeit mit ausgefahrenen Klappen bei Normalgeschwindigkeit beträgt nämlich 5 m/sec gegenüber nicht ganz 1 m/sec ohne ausgefahrene Klappen. Dadurch lassen sich aber mit etwas Uebung Landungen in besonders kleinen, von Hindernissen umgebenen Plätzen durchführen.
*j Die S-H Bremsen wurden auch bei dem Olympia-Segelflugzeug „Meise" der DFS verwendet. Vgl. „Flugsport" 1939, S. 148.
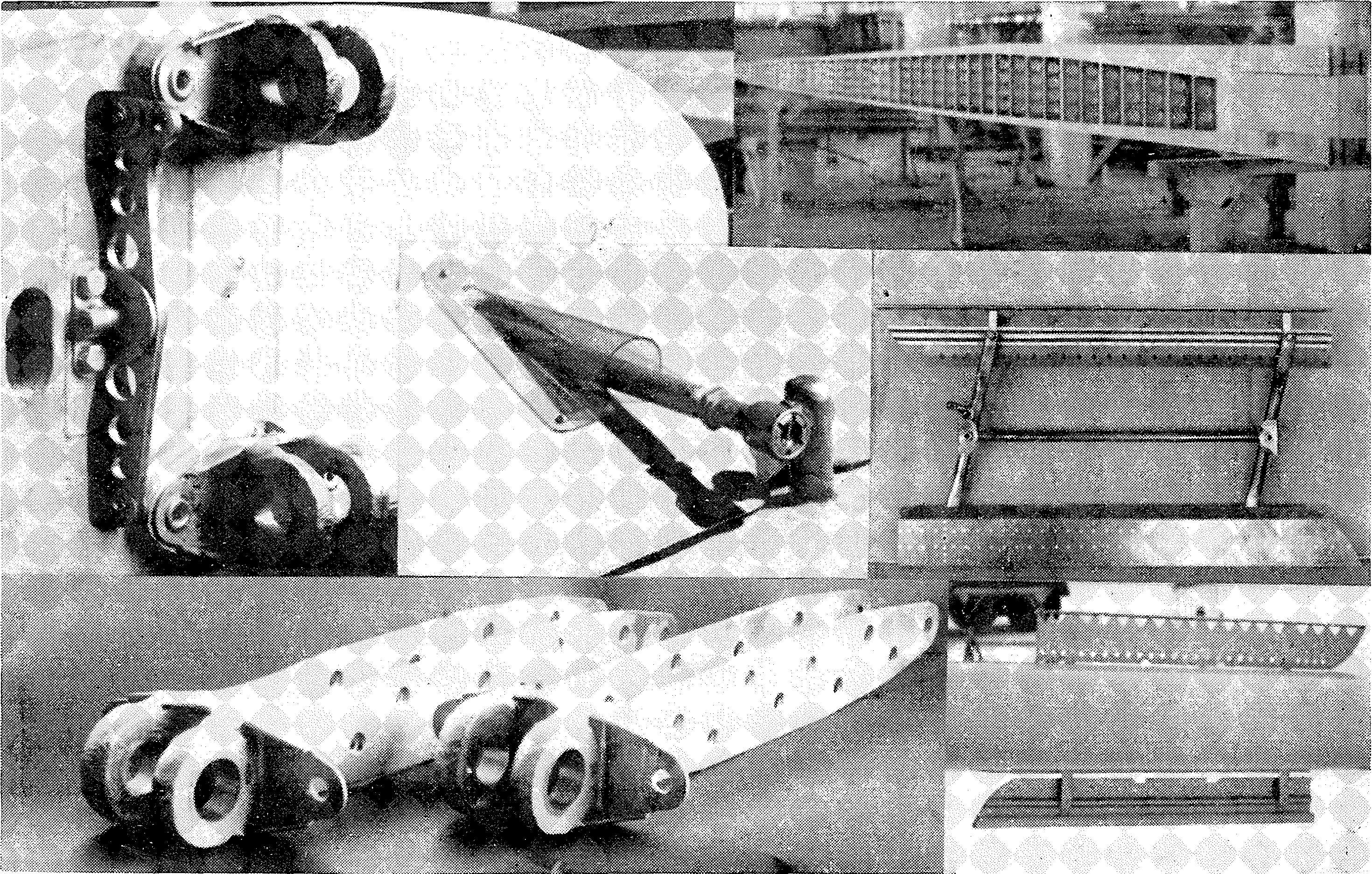
Segel-Doppelsitzer „Goevier". Oben links: Flügelbeschlag und Querruderkipphebel' aus Dural mit Kugellager. Unten Flügelanschlußbeschläge. Rechts: Hauptholm. Darunter Querruderantrieb mit Stoßstange und Winkelgelenke (Dural). Unten: Sturzflugbremsen ausgefahren. Mitte: Sturzflugbremsen ausgebaut. Werkbilder
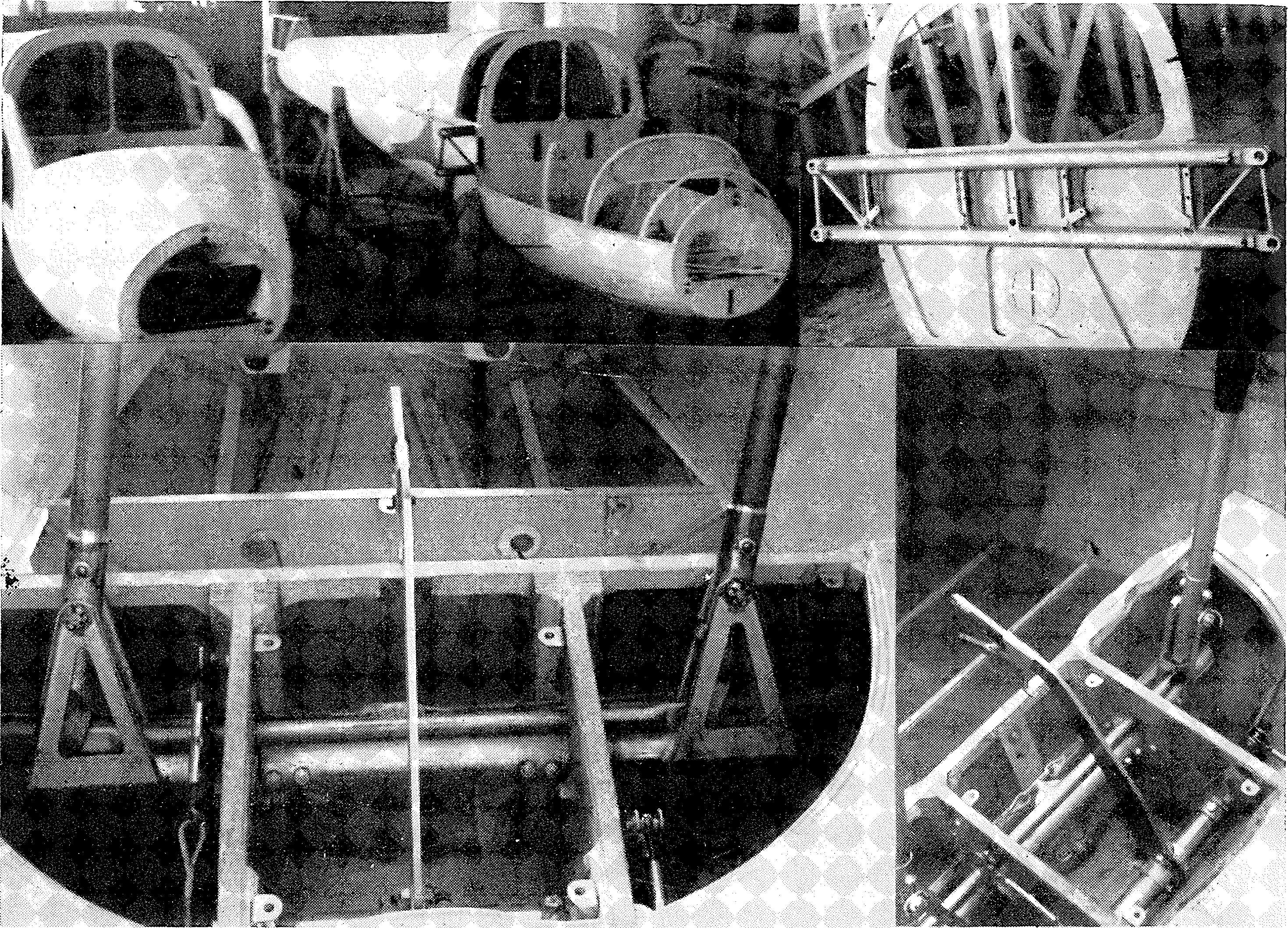
Segel-Doppelsitzer „Goevier". Oben links: Rumpf im Bau. Rechts: Hauptspant mit Rohrbrücke für Flügelanschluß. Unten links und rechts: Blick in den Führersitz auf die gekuppelte Doppelsteuerung (ohne Sitz- und Bodenbrett). In der Mitte der Antriebshebel für die Sturzflugbremsen (aus Dural). Werkbüder
Der Klappenantriebshebel wird in Ruhestellung: eingerastet, so daß ein unfreiwilliges Ausfahren der Bremsen nicht möglich ist.
Der Rumpf in der üblichen Sperrholzausführung hat ovalen Querschnitt. Um diesen so klein als möglich zu halten und doch genügend Raum für beide Flugzeugführer zu schaffen, wurden die Flügelstummel am Rumpf so abgesetzt, daß darin bequem ein Arm und eine Schulter des Piloten auf jeder Seite Platz findet. Es konnte aus diesem Grund
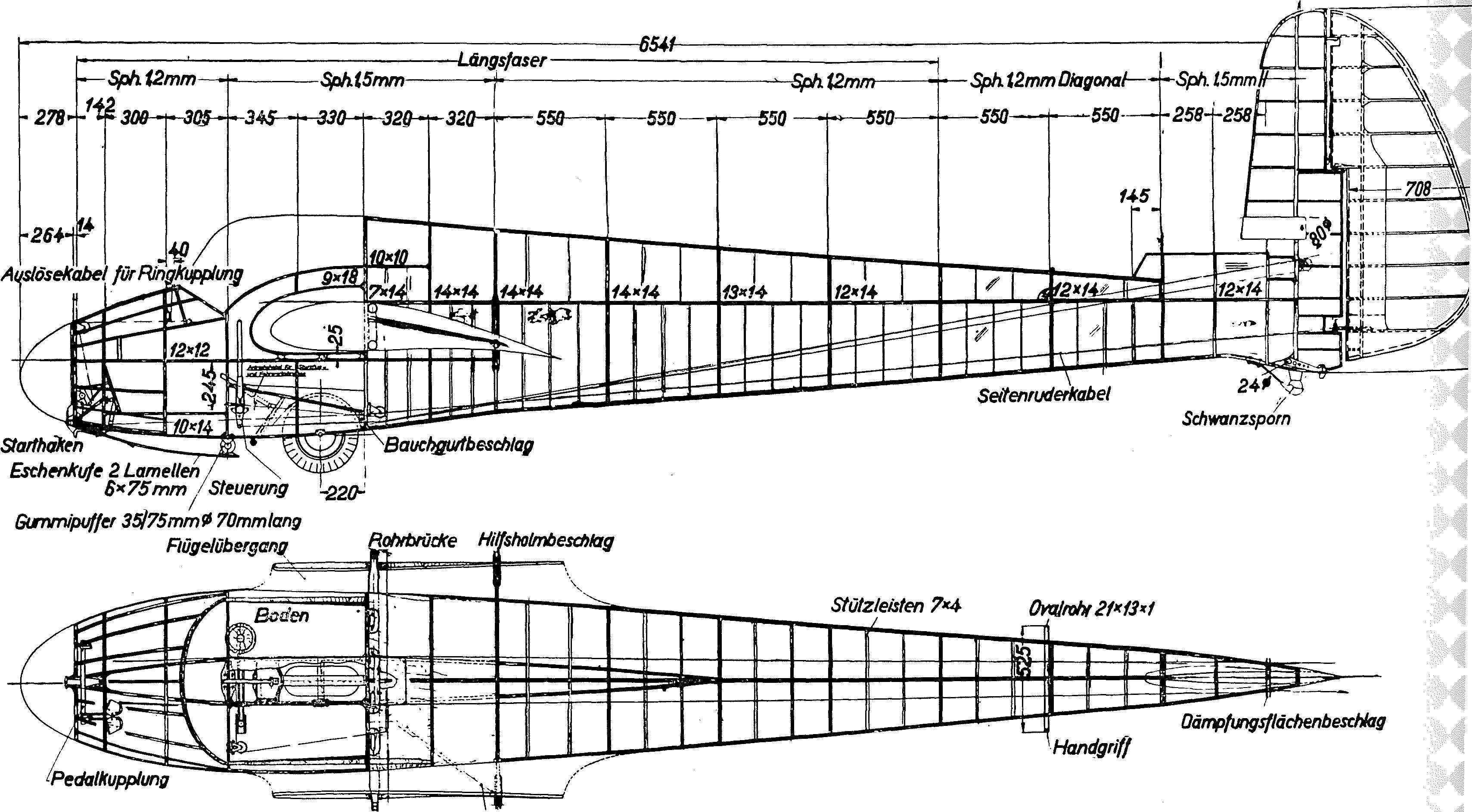
Ausfreungsstreben 18*t
Segel-Doppelsitzer „Goevier" Rumpfübersicht. Zeichnung Flussport
67J0-
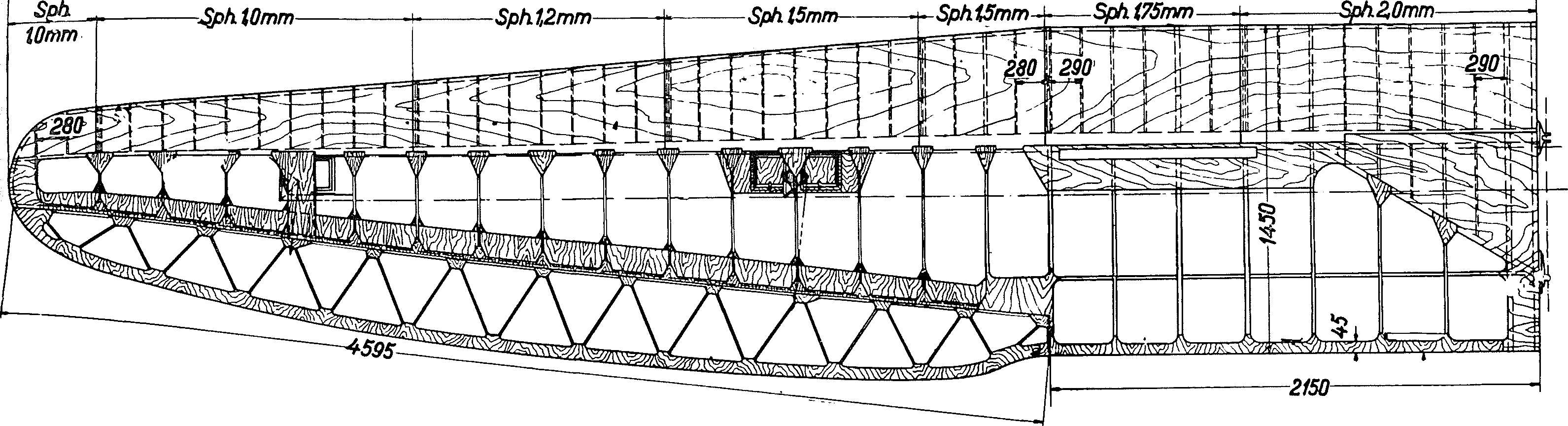
Segel-Doppelsitzer „Goevier" Flügelübersicht. Zeichnung Flugsport
trotz girier maximalen inneren Rumpfbreite von nur 88 cm sogar auf eine Staffelung der Führersitze verzichtet werden. Zwischen den beiden Führern liegt der Antriebshebel für die Sturzflugbremsklappen, der gleichzeitig nach vollem Ausschlag der Klappen auch die Radbremse betätigt.
Die große, ganz abnehmbare Führersitzhaube aus Stahlrohr ist teils mit Astralon, teils mit Plexiglas beplankt und gibt für beide Flugzeugführer eine ausgezeichnete Sicht auch nach vorne unten, da die Rumpfspitze sehr stark nach unten gezogen ist. Die Haube ist mit Profilgummi abgedichtet.
Sämtliche Steuerzüge liegen im Führerraum verdeckt unter Sitz und Boden. Die Kipphebel für Querruder- und Klappenantrieb sind aus Dural mit Kugellagern. Das fest eingebaute Ballonrad liegt direkt

Segel-Doppelsitzer „Goevier". Oben links: Führersitz ohne Haube. Man erkennt die Ausnutzung der Flügelübergänge. Darunter Instrumentenbrett. Unten: Form für die Verleimung der Rumpfflügelübergänge. Von rechts oben nach unten: Geschickte Raumausnutzung für die Insassen. Führersitzhaube mit geöffneten Sichtfenstern vorn und an den Seiten. Unten: Führerhaube Stahlrohrgerüst mit Astralon und Plexiglas. Mitte: Instrumentenbrett und Fußpedale. Werkbilder
unter dem Führersitz, so daß die Hauptkräfte beim Landestoß, das Gewicht der beiden Führer, direkt ohne Umwege aufgenommen werden können.
Das Rad besitzt eine Steckachse und kann daher zwecks Reinigung des Radkastens leicht herausgenommen werden. Hinter dem Führerraum liegt ein großer, bequem zugänglicher Gepäckraum, in dem auch Sauerstoffflaschen für 2 Höhenatmungsgeräte untergebracht werden können.
Das Muster „Goevier" kann auch einsitzig geflogen werden. Dazu wird ein 25 kg schweres Trimmgewicht mitgeliefert, das auf dem Boden mit dazu eingebauten Beschlägen befestigt wird. Die Sinkgeschwindigkeit wird bei einsitzigem Flug um ca. 10% kleiner.
Die sorgfältig ausgebildeten Flügelübergänge, wie auch die große Rumpfnase, wird nach einem besonderen Verfahren aus verschiedenen Lagen von Baumwollstoff hergestellt, der durch eine Kauritleimträn-kung in der gewünschten Form hart und wasserfest wird. Dieses Verfahren ist bedeutend billiger als die frühere Ausführung aus Sperrholz oder Leichtmetall, auch werden störende Kanten vermieden.
Das Seitenleitwerk liegt hoch und besitzt ein gutes Seitenverhältnis. Dadurch konnte zusammen mit dem langen Rumpf eine gute Kursstabilität erzielt werden. Das Seitenruder besitzt Doppelflügel mit Luftkraftausgleich. Das Höhenleitwerk ist in der bei Uebungssegel-flugzeugen üblichen Form und Bauweise nach unten abgestrebt. Die Dämpfungsfläche ist einholmig und ganz mit Sperrholz beplankt. Der Schwanzsporn ist in bewährter Weise mit einem Tennisball abgefedert.
Der Hauptanschlußbeschlag für die Flügel am Rumpf ist als durchgehende Rohrbrücke aus Chrom-Molybdän-Stahlrohr 50 X 2 mm ausgebildet. Dadurch konnte der Hauptspant selbst sehr einfach und leicht gebaut werden. Der Anschluß der Flügel geschieht durch konische Stahlbolzen, wobei zur Demontage eine Abziehvorrichtung verwendet
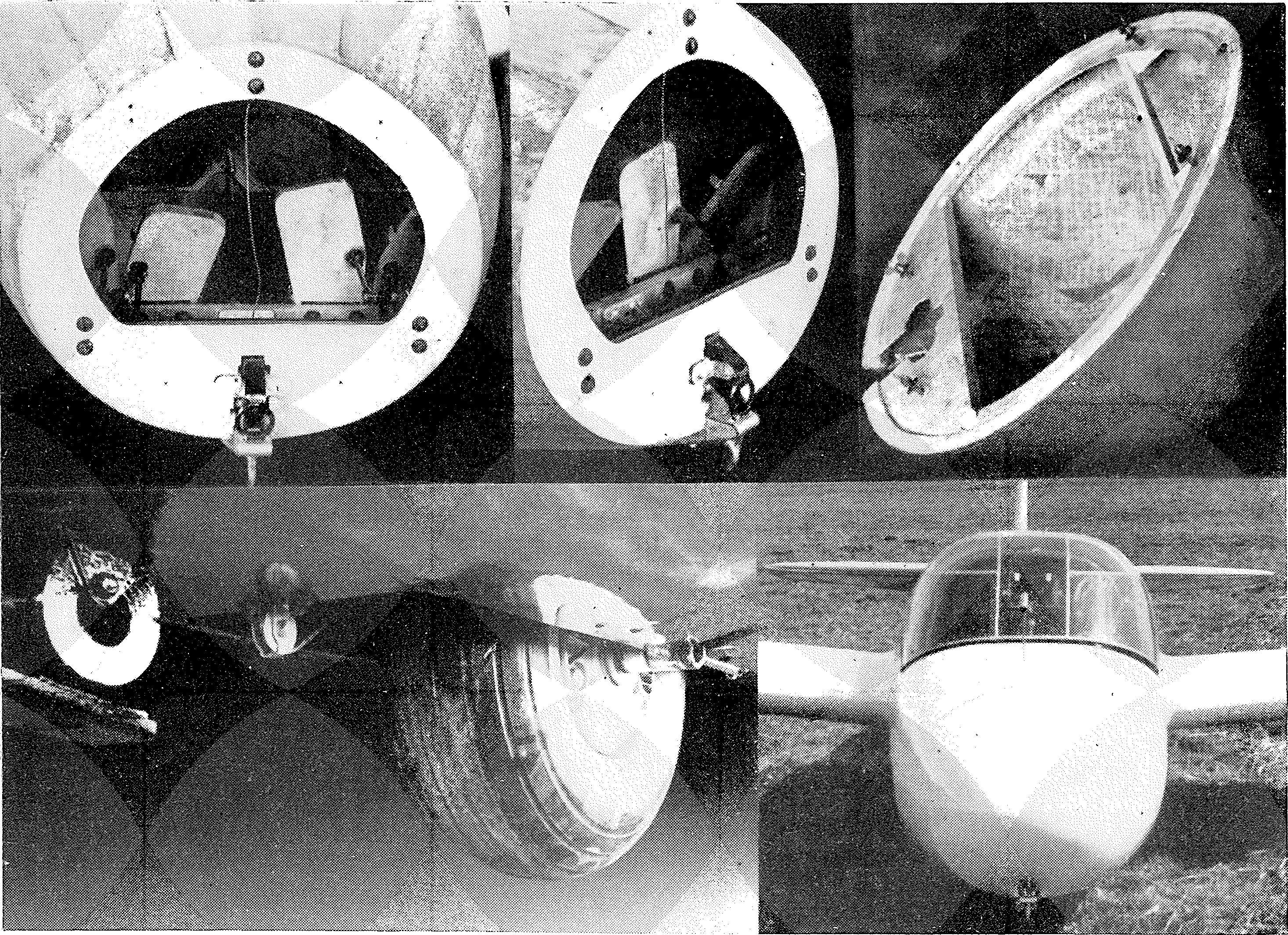
Segel-Doppelsitzer „Goevier". Oben links: Gekuppelte doppelte Seitenpedale und Starthaken. Rechts: Rumpfnase aus Baumwollgewebe, mit Kauritleim getränkt. Unten: Einradfahrwerk mit Bremse. Rechts Rumpfnase. Man beachte Formgebung und Flügelanschlüsse. Werkbilder

Segel-Doppelsitzer „Goevier". Leitwerk. Rechts: Seitenleitwerk mit Doppelflügel und Luftkraftausgleich (Uebergangsverschalung ist abgenommen). Werkbilder
wird. Die Spaltabdeckung: für den Flügelanschluß ist aus Leichtmetall und wird durch eine einfache Vorrichtung stramm gespannt und gesichert.
Die Hauptanschlußbeschläge der Baureihe 2 des Musters „Goevier" werden neuerdings auf eine Festigkeit von 80 kg/cm2 vergütet, wodurch die mögliche Zuladung auf 210 kg ansteigt, also ohne weiteres für zwei Flugzeugführer mit Fallschirmen und Höhenatmungsgeräten genügt. Die „Goevier" kann deshalb besonders für die Blindflugschulung in den Wolken und die Erreichung großer Höhen eingesetzt werden.
Bei den Flugeigenschaften ist besonders zu erwähnen, daß die „Goevier" nur „gezwungen" ins Trudeln geht und dieses sofort wieder beendet. Sie kann beim Kreisen „hingehängt" werden und sackt beim Ueberziehen durch, ohne „auf die Fläche zu gehen".
Durch das bei der großen Festigkeit geringe Gewicht von 200 kg und das Einradfahrwerk ist die „Goevier" sehr handlich im Bodenbetrieb, 3 Mann genügen auf der Ebene.
Jede „Goevier" wird vom Herstellerwerk gründlich eingeflogen und erprobt. Die Lieferung erfolgt erst, wenn sich bei Ueberschlag, Turns, Trudeln, Sturzflug mit Bremsen, beim Kreisen, bei Steilspiralen und im Freihandflug keine Mängel gezeigt haben. Die Normalausführung ist mit gespachtelter und geschliffener Elfenbein-Emaillackierung.
Spannweite 14,8 m, Länge 7,26 m, Höhe 1,88 m, Fläche 19 m2. Rüstgewicht 200 kg. Baureihe I: Zuladung 180 kg, Gesamtgew. 380 kg, Flächenbelastung 20 kg/m2; Baureihe II: Zuladung 210 kg, Gesamtgewicht 410 kg, Flächenbelastung 21,6 kg/m2. Sinkgeschw. 0,95 m/sec, Gleitzahl 19, Mindestgeschw. 50 km/h, Geschw. bei geringster Sinkgeschwindigkeit 60 km/h, Geschw. bei bester Gleitzahl 65 km/h, Flug-zeugschleppgeschw. 100 km/h.
Fiat F. L. 3. Sportzweisitzer.
Bei der Konstruktion des F. L. 3. wurde Wert auf einfachste Ausführung und billigste Herstellung gelegt, wobei Motoren von 45 bis 90 PS eingebaut werden können.
Flügel trapezförmig, Tiefdeckeranordnung, zweiholmig, Holzbauweise. Torsionsfeste Sperrholznase. Hinter Vorderholm Leinwandbedeckung. Querruder über die halbe Länge des Flügels.
Rumpf Holzbauweise vierholmig, sperrholzbedeckt. Sitze nebeneinander. Gewölbte Kabinenverkleidung mit großen Sichtfenstern nach
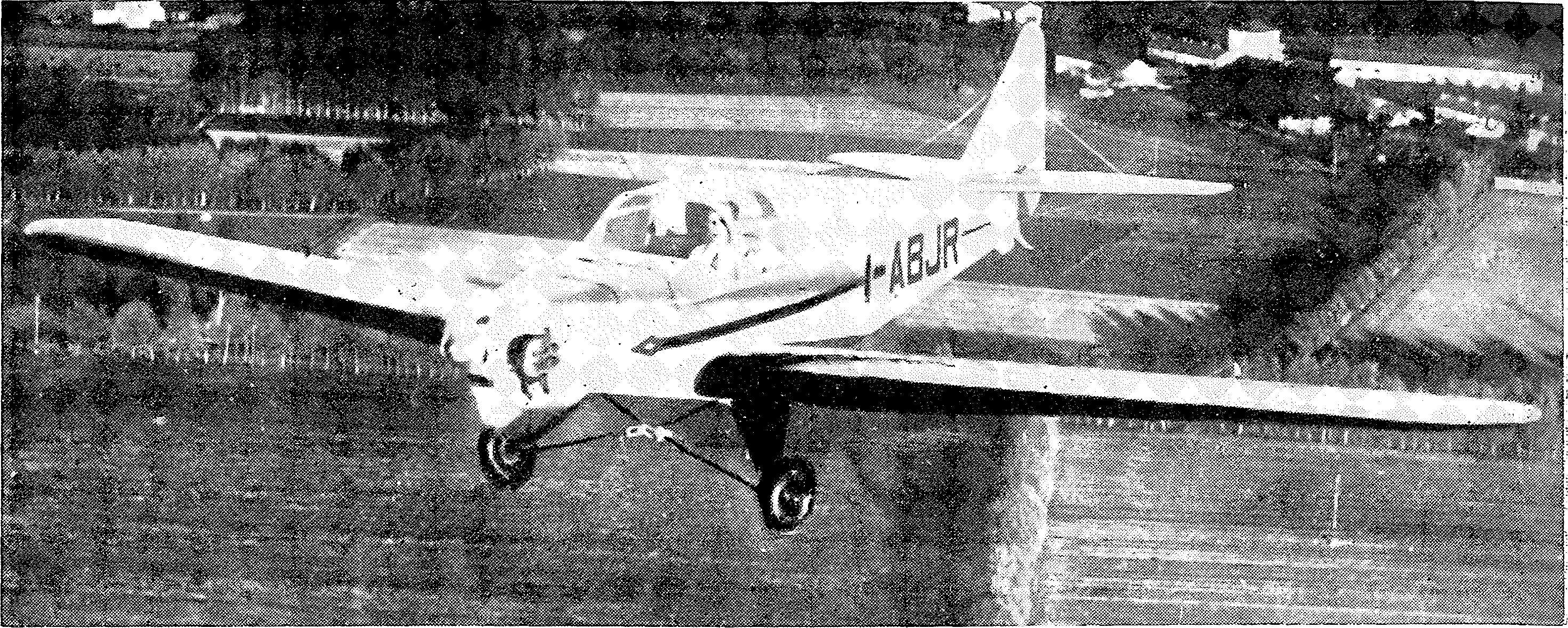
Ital. zweisitziges Sportflugzeug Fiat F. L. 3. Werkbild
vorn. Motorbock Stahlrohr, am Rumpf mit zwischengeschalteten Gummistoßaufnehmern befestigt. Motor Verkleidung Duraluminblech.
Fahrwerk fest, V-Streben Fahrwerksachsen mit zwei Hilfsstreben im Dreiecksvefband gegen den Rumpf abgefangen. Einfache Gummiringabfederung. Schwanzkufe einfache Ausführung mit Ringfederung.
Höhen- und Seitenleitwerk gegeneinander verspannt. Holzbauweise mit Leinwand bedeckt.
Spannweite 10 m, Länge 6,56 m, Höhe 1,75 m, Flügelinh. 14,35 m2, Leergewicht 300 kg, Fluggewicht 525 kg. Flügelbelastung 36,5 kg/m2. Mit 60-PS-Motor Höchstgeschwindigkeit 160 km/h, Reise 135 km/h, Flugdauer 3% Std. Sicherheitsfaktor 7.
USA Jagdflugzeug Bell P-39.
Die Bell Aircraft Corp. Buffalo, welche durch ihre zweimotorigen Flugzeuge bekannt geworden ist, hat jetzt einen Jagdeinsitzer, Typ P-39, fertig gestellt, welcher auf dem Wright Field, Dayton, von dem Army Air Corps versucht wird. Charakteristisch an dieser Jagdmaschine ist die Verwendung eines Dreiradfahrwerkes, wobei das Schwanzrad wegfällt. Es scheint, daß in USA die hohen Landegeschwindigkeiten und das viele Ueberkopfgehen der Maschinen untragbar geworden ist.
Flügel freitragend, Ganzmetallbauweise. Führerverkleidung mit
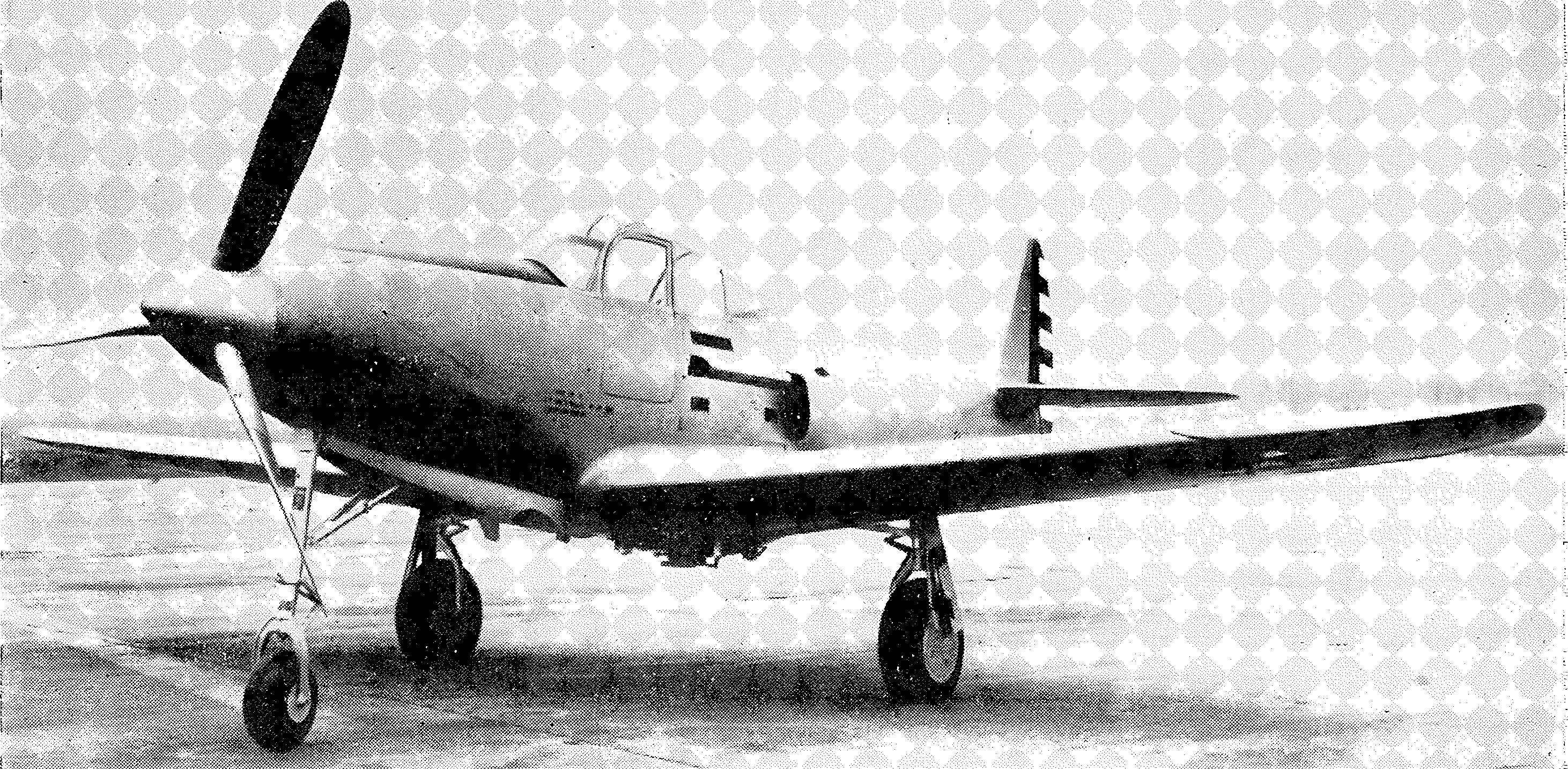
USA. Jagdflugzeug Bell P-39. Werkbild
guter Sicht auch nach hinten. Neuartig ist die große seitliche Einsteigtür, wodurch ein Abwerfen der Haube vermieden wird.
Ueberkomprimierter flüssigkeitsgekühlter Motor Allison 12 Zyl. 1000 PS, Dreiblattpropeller, nicht verstellbar. Kabine heizbar, Führer mit Sauerstoffatmungsgerät. Dreiradfahrwerk hochziehbar.
Engl, Zweimotor-Schulflugzeug Reid and Sigrist
Dieser von Reid and Sigrist Ltd., ursprünglich Instrumentenfirma, gebaute Zweimotor ist als Umschulungsflugzeug auf Zweimotorflugzeuge mit den Flugeigenschaften, wie sie die englischen RAF-Flugzeuge besitzen, gebaut. Er dient gleichzeitig als Uebungsflugzeug für Navigation, Bombenflug, Nachtflug und Uebungsschießen für den hinteren MG.-Schützen.
Rumpf drei Sitze hintereinander, mittlerer Sitz, Lehrersitz, erhöht, so daß dieser über den vorderen Sitz, Schüler, hinwegsehen kann. Hinterer Sitz MG.-Stand. Im Boden des Rumpfes große Oeffnung unter dem mittleren Sitz für Bombenabwurf.
Flügel dreiteilig. Mittelstück mit Motoren und Betriebstoffbehälter zwischen den Holmen. Vorderer Hauptholm, innerhalb des Rumpfes Gitterstege, außen gewöhnlicher Kastenholm. Hinterer Holm, an dem außen die Querruder sitzen, im Rumpf durchgehend nach oben durchgekröpft, um Raum für die Bomben zu gewinnen.
Außenflügelbefestigung Vorderholm zwei senkrechte Bolzen, Hinterholm ein Bolzen. Flügelrippen Sperrholzstege. Bedeckung des Flügels Sperrholz. Landeklappen und Querruder fast von gleicher Tiefe. Querruder im ersten Drittel, infolge der sich verjüngenden Flügel, gebrochen, mit Kardangelenk verbunden. Betätigung von Klappen und Querruder durch ineinanderliegende Torsionsrohre. Querruderrohr innen, Landeklappenrohr außen. Landeklappenbetätigung durch Handrad, Uebertragung durch Kette, Schnecke und Schneckenrad.
Rumpf elliptischer Querschnitt, vier Längsholme, Sperrholzauflage, sehr hoher Kabinenaufbau. Vorderer Teil nach hinten verschiebbar. Hinterer Teil für den MG.-Schützen aufklappbar.
Doppeltes Seitenleitwerk. Uebliche Ausführungsform. Zwei Motoren Gipsy Six auf Stahlrohrgerüst.
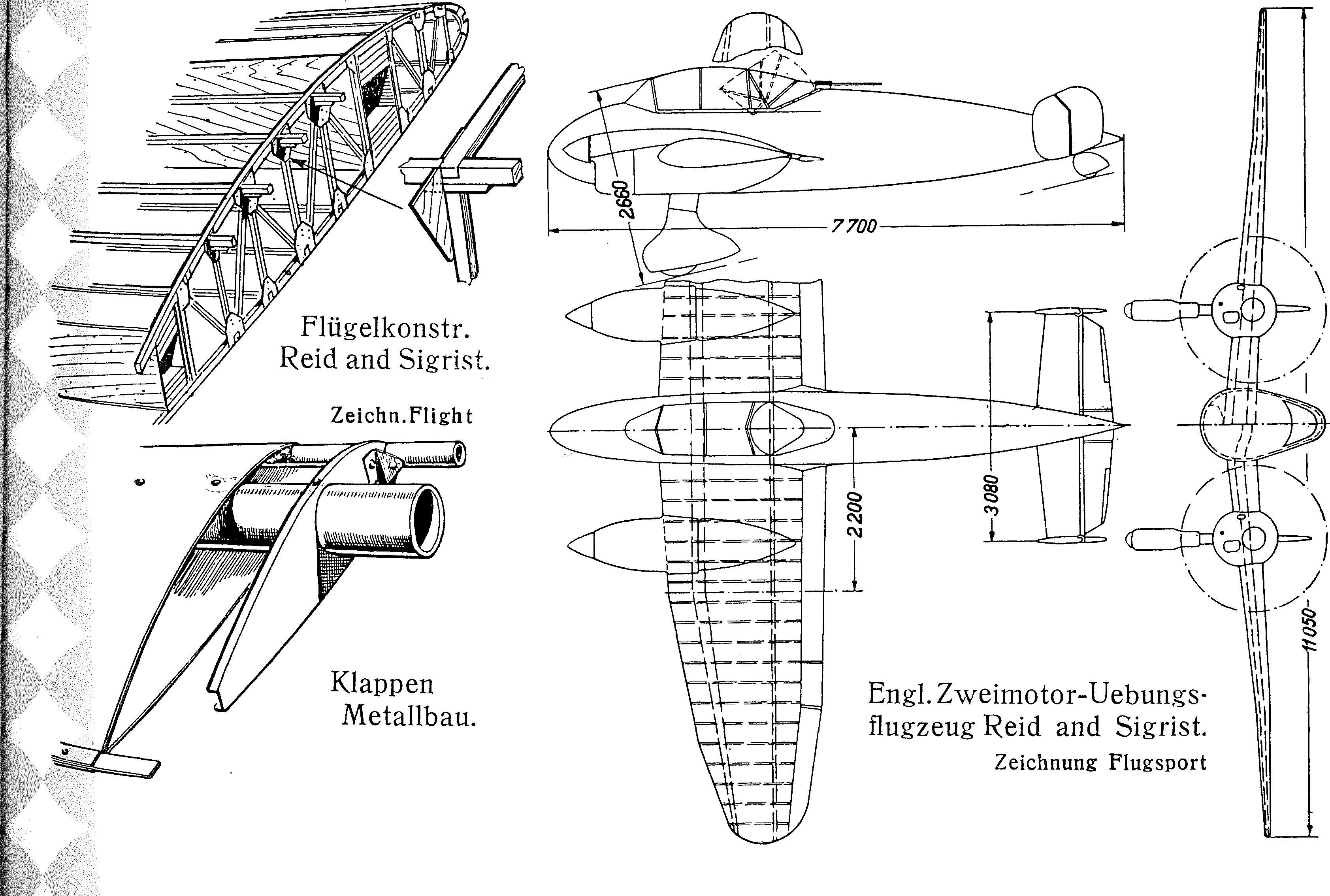
Engl. Zweimotoren-Schulflugzeug Reid and Sigrist. nr^e Aeroolane
Spannweite 11,05 m, Länge 7,7 m, Höhe 2,71 m, Flügelinh. 22,85 m2, Seitenverhältnis 6,25 : 1. Leergewicht 1360 kg, Fluggewicht 2220 kg.
Höchstgeschwindigkeit in Seehöhe 330 km/h, mittlere 305 km/h mit 75% Motorleistung in 1830 m Höhe, Landegeschwindigkeit belastet 104 km/h, Steigfähigkeit 6,76 m/sec. Dienst-Gipfelhöhe 5500 m, absolute Gipfelhöhe 6100 m. Aktionsradius 1285 km, Dauer mit 305 km/h 4 Std. 25 Min.
Start mit auf 20° angestellten Landeklappen 160 m, Auslauf ISO m.
Das Flugzeug wurde auf dem Fairey-Flugplatz in Hammondsworth auf der Garden Party der Royal Aero-nautical Society am 14. 5. zum erstenmal der Oeffentlichkeit gezeigt. Höhen- und Seitenleitwerk des Reid and Sigrist. Aus der nebenstehenden Darstellung erkennt man den kombinierten Seil- und Stoßstangenantrieb von Seiten- und Höhenruder sowie die Verstellung der Trimm-klappen am Höhenruder durch Bowdenzug.
Zeichnung: The Aeroplane
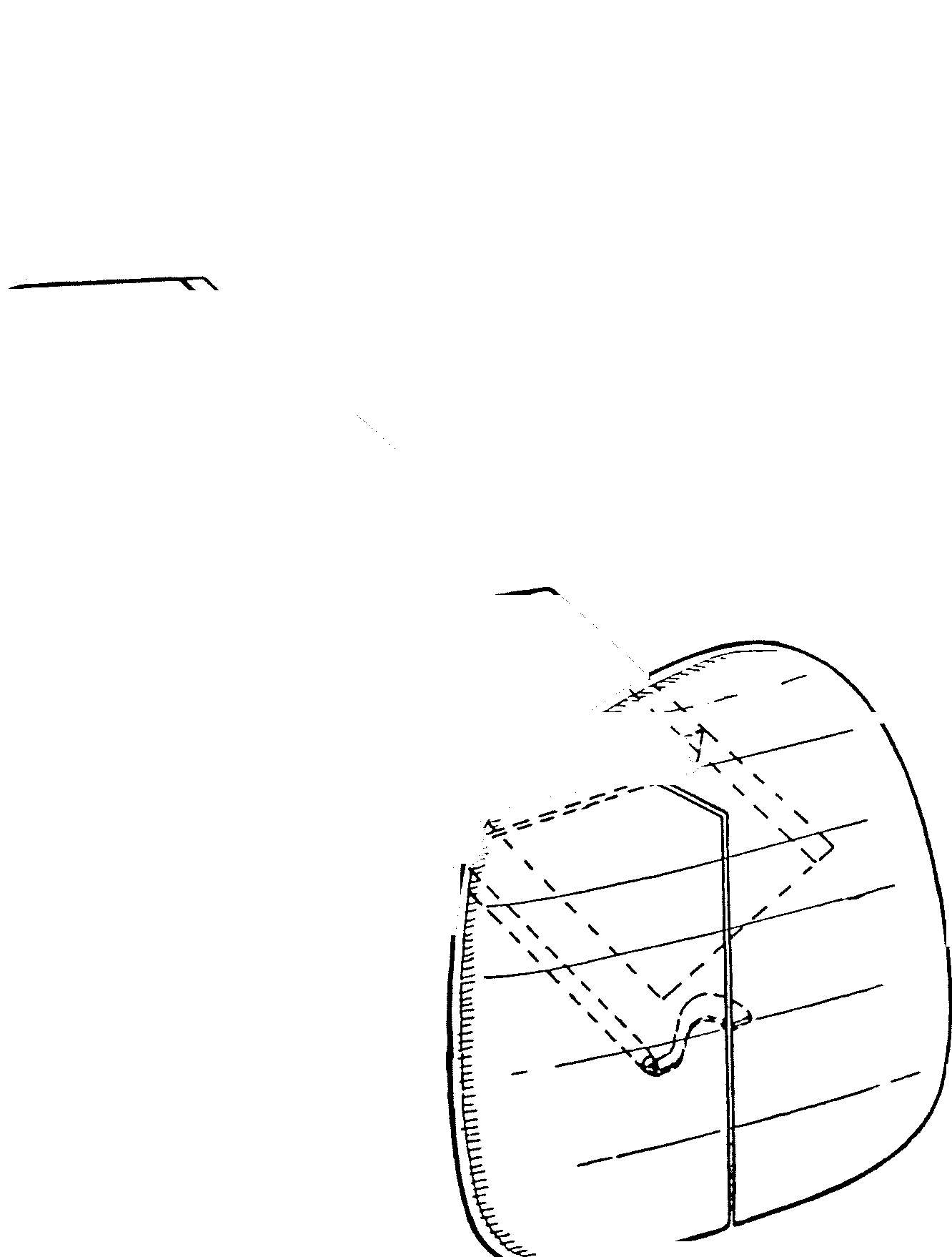
KONSTRUKTION INZELHBTEN
Ballerio-Luftbremse.
Aerodynamische Bremsen sind an den verschiedensten Stellen des Flügels bereits mit Erfolg versucht und im Flugbetrieb in Verwendung. Der italienische Flieger Q. M. Ballerio hat, um die Landegeschwindigkeit und damit die Rollstrecke zu verrringern, eine zu beiden Seiten des Rumpfes angebrachte Luftbremse konstruiert und versucht. Die Bremse besteht aus einer Klappe a, welche gegen den Fahrtwind aus der Fläche b herausgeklappt wird (Abb. 1). Ihr Ausschlag ist durch die Seitenflächen c begrenzt. An der angelenkten Seite befindet sich ein schmaler Schlitz. Der schematische Strömungsverlauf ist in Abb. 2 dargestellt. Die Bremswirkung kann man sich sehr gut vorstellen.
Die Ballerio-Bremsen waren in einer Breda Bd. 15 eingebaut. Ein Start mit aufgeklappten Taschen war unmöglich, auch wenn der Pilot die Klappen erst kurz vor dem Abheben öffnete; die Bremswirkung war zu groß. Man hat dann versucht, während einer Wendung zu landen, einmal beide Klappen geöffnet, das andere Mal nur mit einer geöffneten Klappe, die dabei entstehenden Abweichungen mit dem Seitensteuer korrigierend. In beiden Fällen soll die Landung ungewöhnlich leicht gewesen sein. Die Rollstrecke betrug, ohne Abbremsen der Räder, 24 m.
Abb. 1 u. 2.
Schematische Darstellung der Ballerio-Luftbremse.
Zeichnung Flugsport
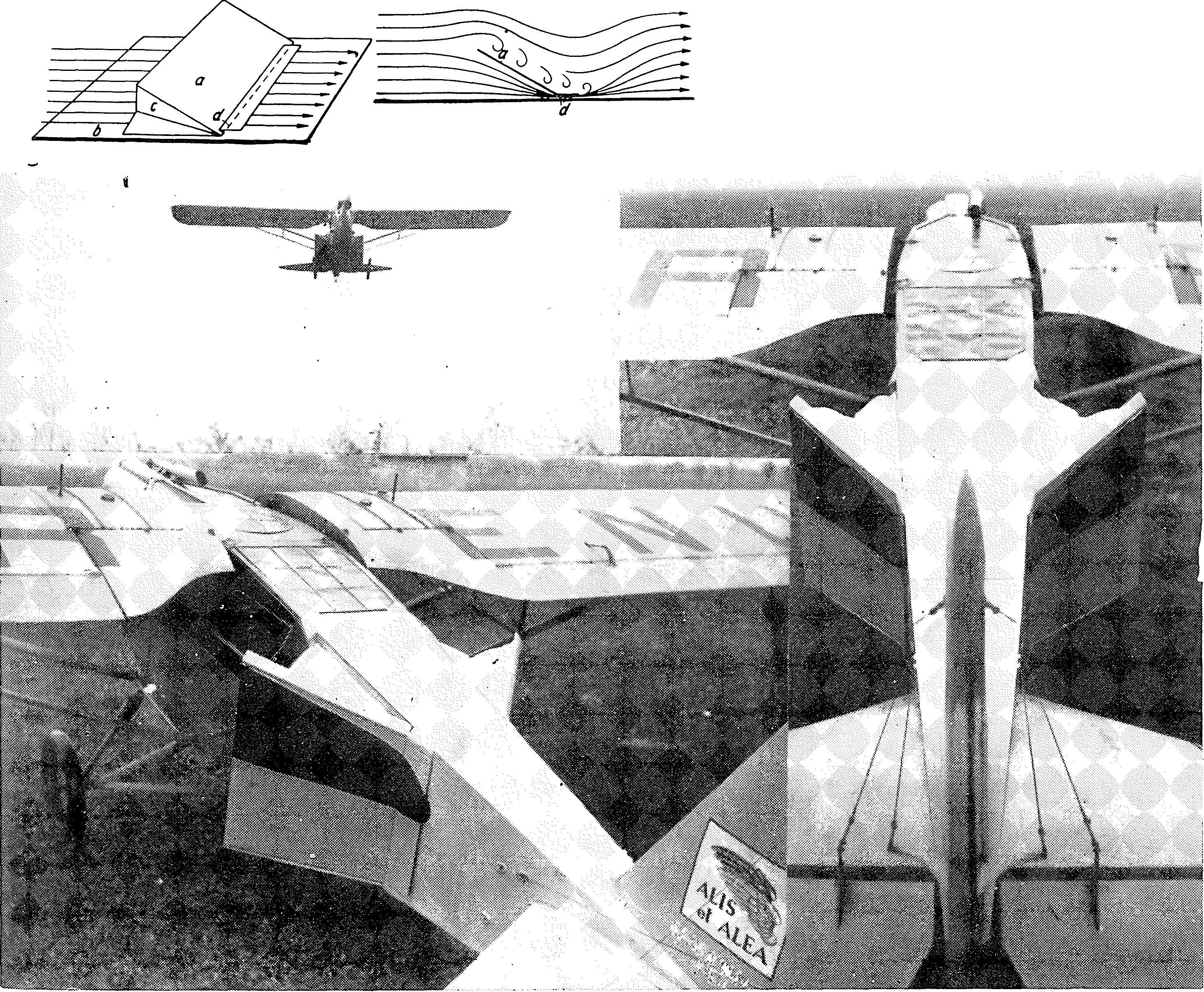
Abb. 3. Ballerio-Luftbremsen am Rumpfe eines Breda-Hochdeckers. Werkbilder
Die starke Bremswirkung beim Herausklappen im Flug verursachte keinerlei Neigung zum seitlichen Abgleiten oder Flachtrudeln. Beim Rollen wird der Schwanz nach unten gedrückt, was die Gefahr des Ueberschlagens vermindert.
Versuche mit Klappen an den Flügeln sind im Gange und haben bisher erfolgversprechende Ergebnisse gezeigt. U. a. ist es möglich, „Tiefsprünge" auszuführen, um beim Einziehen der Klappen gleich wieder in den Horizontalflug überzugehen.
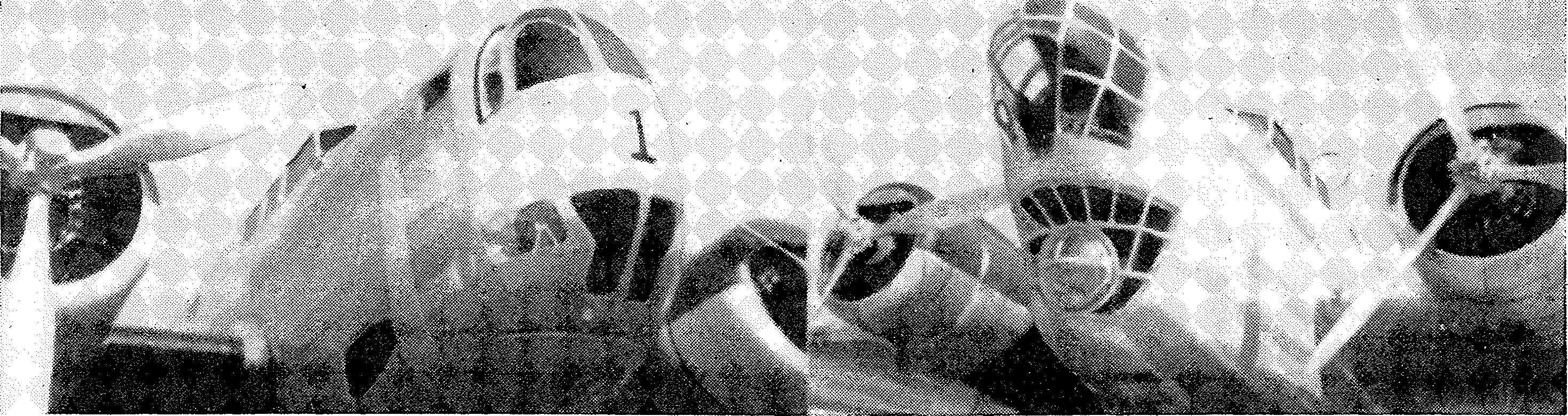
USA. Douglas-Bomber mit zwei Cyclone-Motoren. Archiv Flugsport Links: Ausführung der Rumpfnase des Typs B-18, rechts B-18A.

„Tachoskop" — Original Bruhn.
Zur Untersuchung periodischer Bewegungsvorgänge und Ermittlung von Rotations- und Schwingungsfrequenzen hat „Original Bruhn", Berlin-Schöneberg, ein stroboskopartiges Prüfgerät unter der Bezeichnung „Tachoskop" herausgebracht. Bei diesem Prüfinstrument dreht sich vor der Schauöffnung eine mit Schlitzen versehene Scheibe. Die Drehgeschwindigkeit der Schlitzscheibe ist innerhalb der Grenzen des jeweiligen Meßbereiches, auf den das „Tachoskop" eingestellt ist, regulierbar. Entspricht diese Geschwindigkeit der des beobachteten Gegenstandes, d. h. ist die gleiche Bewegungsphase erfaßt, so steht derselbe scheinbar still; die Geschwindigkeitsfolge der Schlitze entspricht dann der Frequenz des Prüflings und ist auf dem Zifferblatt ablesbar.
Mit der Frequenzbestimmung ist zugleich eine äußerst genaue Prüfung auf Frequenzkonstanz verbunden, denn jede Aenderung der Geschwindigkeit macht sich sofort durch eine Bewegung des beobachteten Gegenstandes im Schaubild bemerkbar. Das „Tachoskop" gestattet daher, insbesondere kleine Schwankungen der Frequenz oder überlagerte Schwingungen zu ermitteln. Auf diese Weise werden auch die geringsten Aenderungen im Bewegungszustand sichtbar.
Der Antrieb dieses Gerätes erfolgt durch ein von Hand zu betätigendes Federwerk (Uhrwerk), das gegen „Ueberziehen" gesichert ist (vgl. die nebenstehende schematische Abb. 1). Das Federwerk dreht einen Kegel, dessen Umlaufgeschwindigkeit mittels eines Reglers konstant gehalten wird. Von dem Kegel wird ein Rädchen mitgenommen, das durch einen Drehknopf („Einstellrändel") längs des Kegelmantels verschoben werden kann. Die von dem Rädchen angetriebene Schlitzscheibe wird in dieser Weise auf verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt. Der Drehknopf bewirkt gleichzeitig die Zeigereinstellung
am Zifferblatt, so daß die gefundene Drehgeschwindigkeit (Frequenz) abgelesen werden kann.
Das „Tachoskop" — Original Bruhn — wird geliefert als Modell I für Messungen bis 12 000 U/min (entsprechend 200 Hz), unterteilt in zwei Meßbereiche (beliebig umschaltbar): 1. von 400 bis 2400 U/min, 2. von 2000 bis 12 000 U/min; als Modell II für Messungen bis 18 000 U/min (entsprechend 300 Hz), unterteilt in zwei Meßbereiche (beliebig umschaltbar) 1. von 600 bis 3600 U/min, 2. von 3000 bis 18 000 U/min.
Durch Drehen am Knopf B Abb. 2 u. 3 erscheint in der Schauöffnung der Augenmuschel die niedrige oder die hohe Meßbereichangabe, die auf der freischwingenden Schlitzscheibe eingraviert sind. Erscheint die niedrige Bereichsangabe und ist diese die gesuchte, so ist das Gerät gebrauchsfertig. Wird jedoch der hohe Meßbereich benötigt, so muß zur Arretierung der Schlitzscheibe Knopf A eingedrückt werden und gleichzeitig Knopf B nach rechts — zunächst bis zum fühlbaren Anschlag — und darüber hinaus mit einiger Kraftanwendung weitergedreht werden, bis die hohe Bereichsangabe im Schlitz erschienen ist. Dann werden beide Knöpfe losgelassen, die Schlitzscheibe schwingt wieder frei, und das „Tachoskop" ist für Messungen im hohen Bereich gebrauchsfertig. Soll das Gerät vom hohen auf den niedrigen Bereich umgeschaltet werden, so wiederholt sich der Vorgang mit dem Unterschied, daß Knopf B statt nach rechts nach links gedreht wird.
Das Aufziehen des Uhrwerks geschieht durch — im Anfang recht lebhaftes — fortdauernd wiederholtes Niederdrücken und Loslassen des federnden Aufzughebels C, und zwar ohne übersteigerte Kraftanwendung. Sobald das Uhrwerk surrend läuft, wird das Einstellrändel D für die Zeigereinstellung an der Front solange nach rechts oder links gedreht, bis die Zeigerspitze auf die etwa vermutete Meßzahl an der Skala zeigt. (Auch während der Zeigereinstellung darf die Betäti-
Abb. l.
Schauöffnung
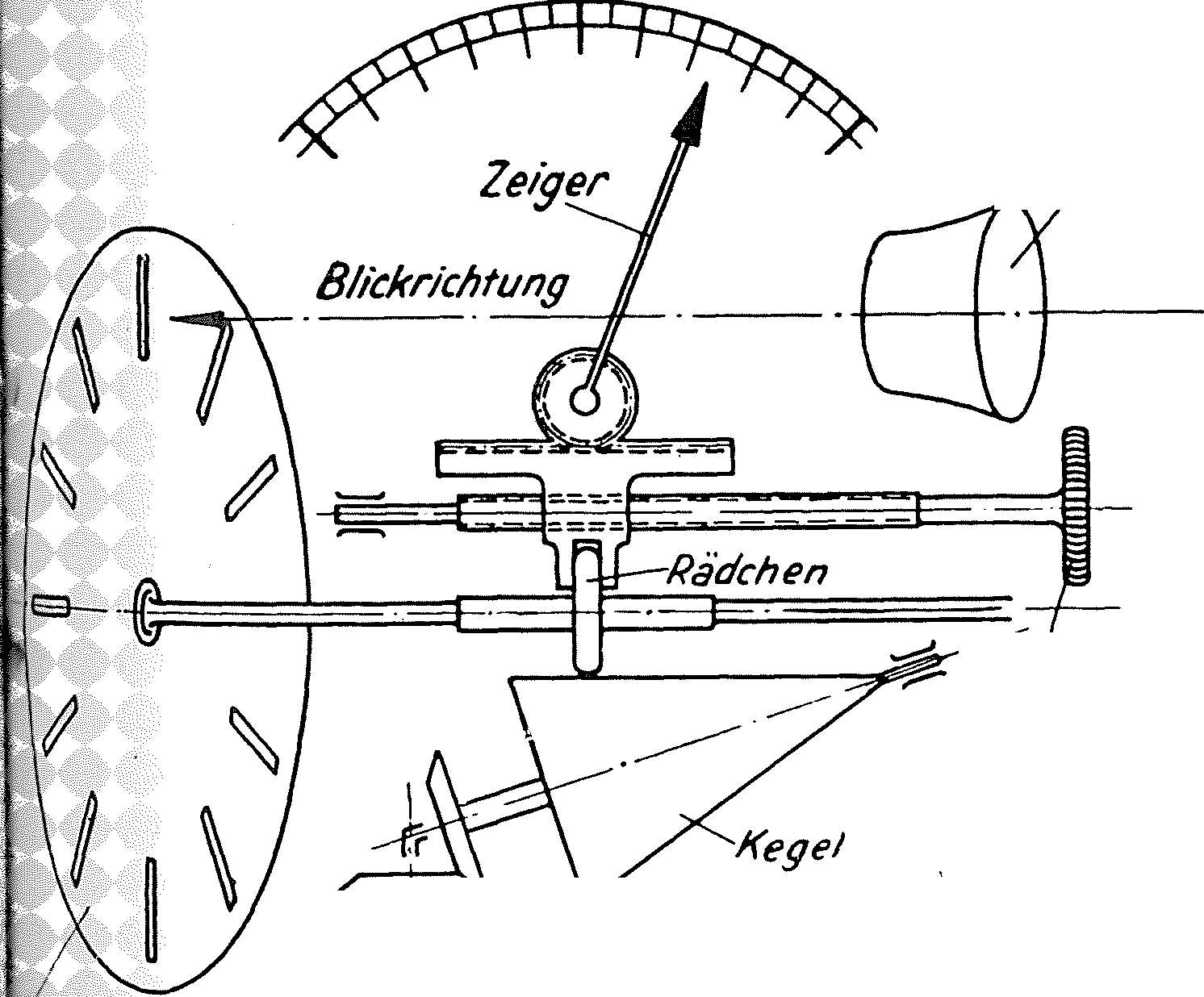
Einstellrändel
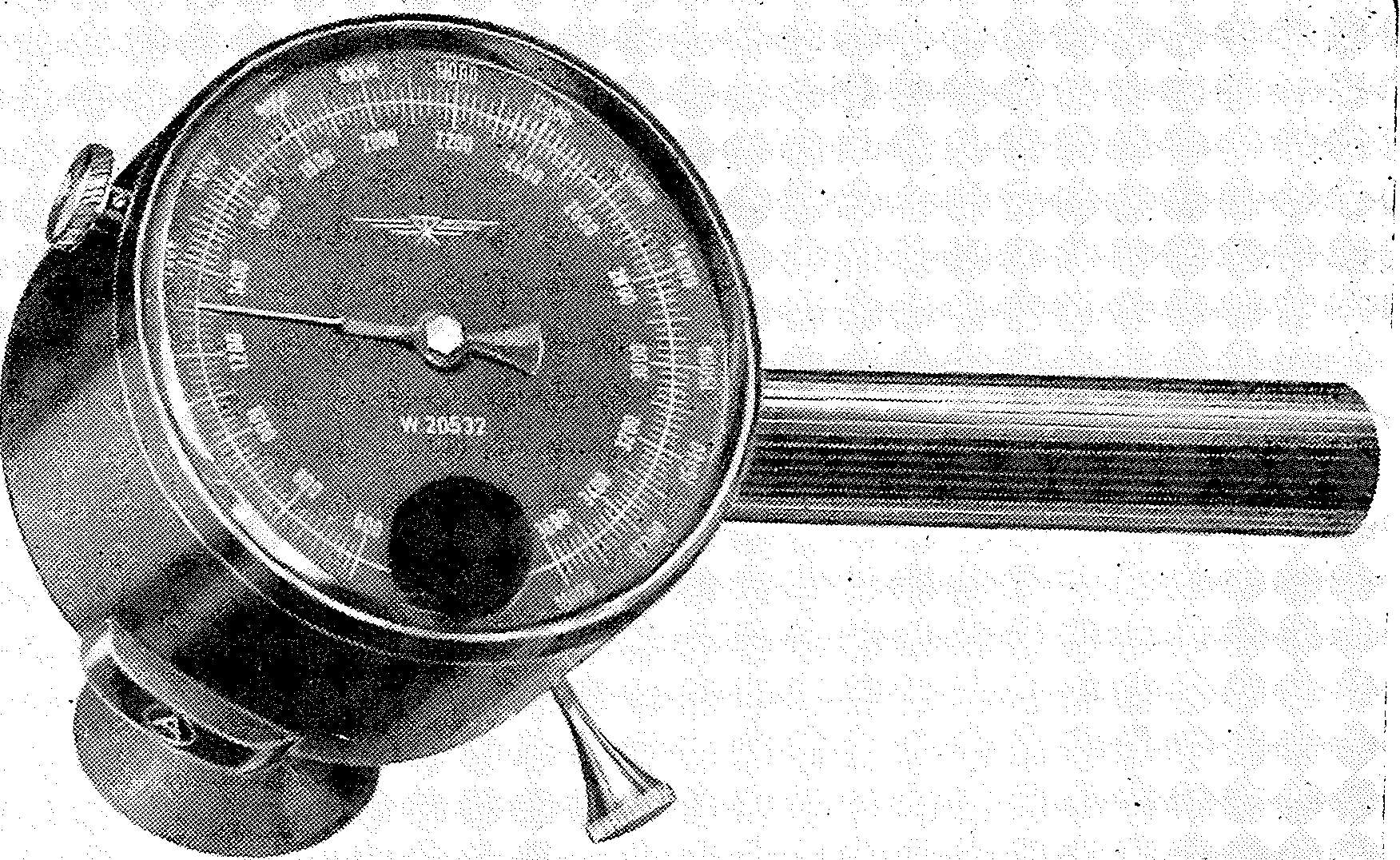
V'^scheiöe
|
tili |
||||
Fliehkraftregler
- Uhrwerk Aufzugshebel
Abb. 2 u. 3.
j1 achoskop Bruhn. Vorder- und Hinteransicht.
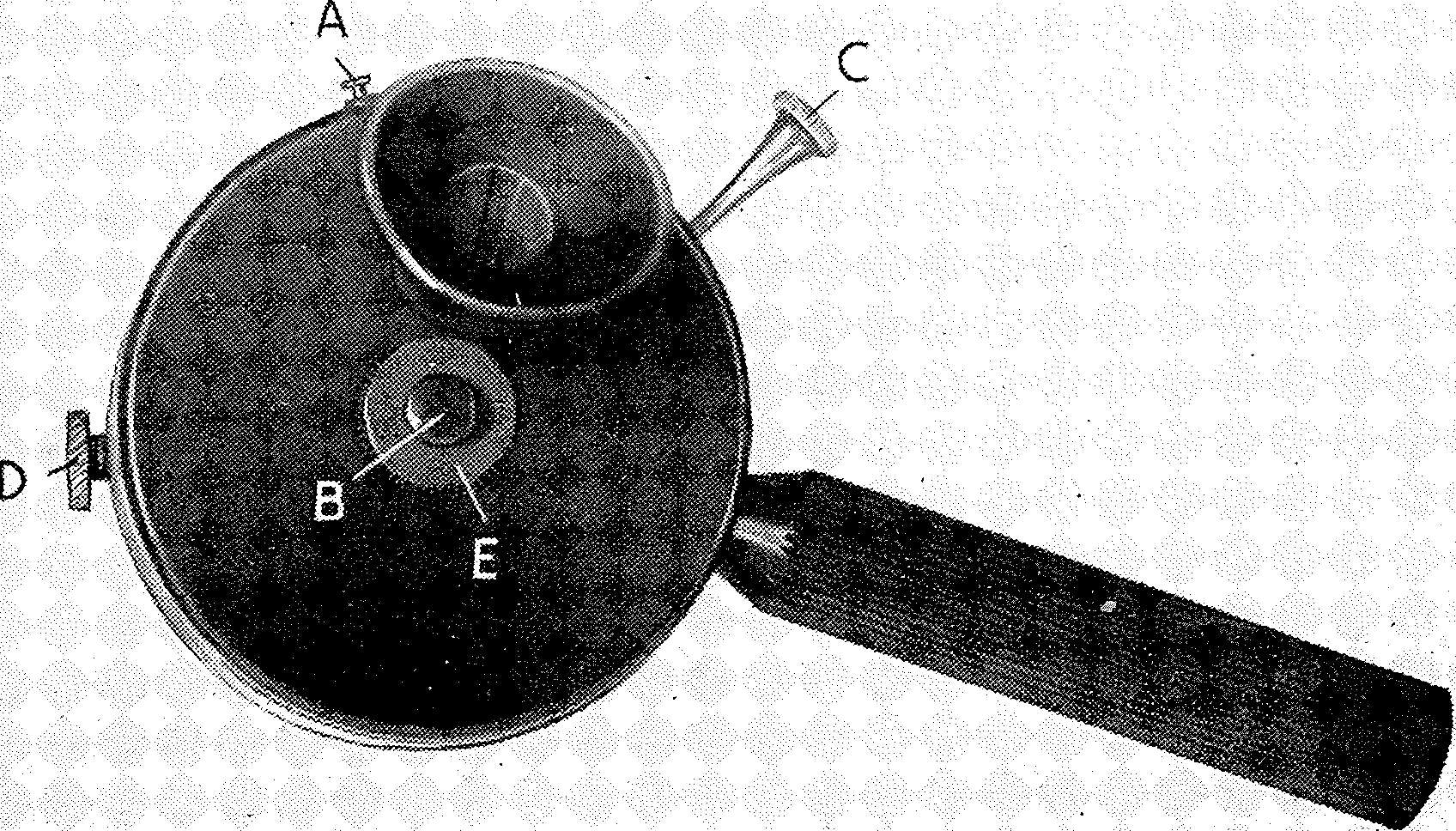
Werkbild
gung des Uhraufzugshebels nicht vergessen werden, denn das Uhrwerk darf dabei nicht stehen bleiben.)
Zur Vornahme der Messung wird das „Tachoskop" mit der Augenmuschel rechtshändig dicht an das Auge gesetzt und auf das Untersuchungsobjekt gerichtet. Dabei wird das Uhrwerk fortdauernd gemäß obiger Anweisung mit dem rechten Zeigefinger in Gang gehalten und das Einstellrändel D mit der Linken langsam solange nach links oder rechts gedreht, bis der bewegte Gegenstand sich dem beobachtenden Auge in Gestalt eines stillstehenden Bildes darbietet, das alle seine Einzelheiten und seinen Umriß klar und scharf wiedergibt. Ablesegenauigkeit ± 0,2%.
Anordnung zur allgemeinen Einführung des metrischen Gewindes
vom 21. April 1939 (Deutscher Reichsanzeiger Nr. 94) § 1
Schrauben, Muttern und Fassonteile (Dreh-, Preß- und Stanzteile) aller Art mit Innen- und Außengewinde bis einschließlich 10 mm Durchmesser jeder Art dürfen für den Inlandsbedarf nur mit metrischem Gewinde nach den DIN-Blättern Nr. 13 und 14 bzw. mit metrischem Feingewinde nach den DIN-Blättern Nr. 243, 517 bis 521 hergestellt werden.
Schrauben, Muttern und Fassonteile (Dreh-, Preß- und Stanzteile) aller Art mit Innen- und Außengewinde über 10 mm Durchmesser jeder Art sollen für den Inlandsbedarf möglichst mit metrischem Gewinde nach den DIN-Blättern Nr. 13 und 14 bzw. mit metrischem Feingewinde nach den DIN-Blätern Nr. 243, 516 bis 521 hergestellt werden.
Ausgenommen von der Bestimmung des § 1 ist die Herstellung von einzelnen Schrauben, Muttern und Fassonteilen für den Reparaturbedarf.
§ 2
In besonders begründeten Einzelfällen kann der Reichswirtschaftsminister oder die von ihm beauftragte Stelle auf schriftlichen Antrag Ausnahmen zulassen. Die Anträge sind über die zuständige Wirtschaftsgruppe bzw. den zuständigen Reichsinnungsverband einzureichen.
§ 3
Zuwiderhandlungen gegen § 1 Abs. I dieser Anordnung werden gemäß II Abs. 1 der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans vom 5. November 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 936) bestraft.
§ 4
Die Anordnung tritt am 1. Oktober 1940 in Kraft, jedoch mit der Maßgabe, daß vom 1. April 1940 an für die Neuanfertigung von Gewinden, die nicht zur Erfüllung laufender Aufträge hergestellt werden, die Vorschriften dieser Anordnung gelten.
Berlin, den 21. April 1939
Der Reichswirtschaftsminister Walther Funk.

FLUG UMSCHÄ
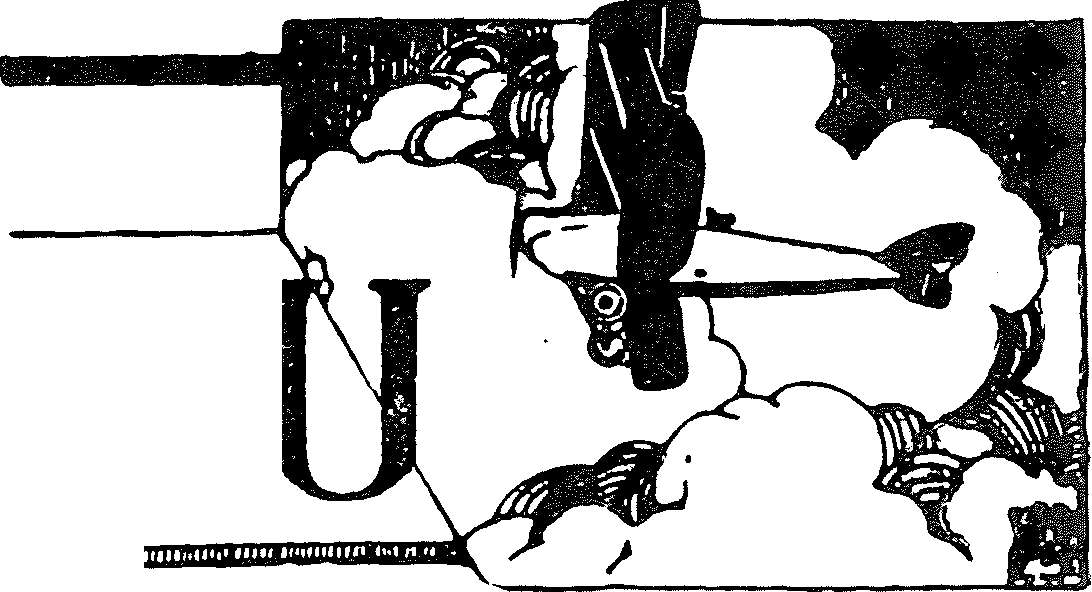
Inland.
Deutscher Westwall an der Westgrenze Deutschlands mit den Befestigungsanlagen aus Stahl und Beton von der holländischen bis zur Schweizer Grenze, Länge über 500 km. Hinter diesen, mit allen Mitteln einer modernen Befestigungsanlage ausgestatteten Sperrzone aber liegt dann die Luftverteidigungszone West, ein weiteres wichtiges Glied im Rahmen der Westbefestigungen. Die in großer Tiefe angelegte Erdverteidigung hat hinter sich in der Luft eine Sperre von noch nie dagewesener Stärke und Ausdehnung, in der zahlreiche leichte und schwere Flakgeschütze tiefgestaffelt eingebaut sind und in ihren Wirkungsbereichen sich
LANDE
ffilomefep
überschneiden. Eingegliederte Scheinwerferbatterien bilden eine dem Flakeinsatz entsprechende Leuchtzone. Darüber hinaus stehen in besonders wichtigen Verteidigungsabschnitten Luftsperrverbände als „Minenfelder der Luft" mit Drachen und Sperrballonen an Drahtseilen zur wirksamen Abwehr von Angriffen. Gut durchdachte Warn- und Meldeorganisationen melden rechtzeitig auch überraschende Angriffe, und zahlreiche Jagdverbände bekämpfen in Verbindung mit der Flakartillerie auch jeden bis hierher gelangenden Feind. So schützen denn die Westbefestigungen und die Luftverteidigungszone West, die gigantischen Werke des Führers, nicht nur Operationsund Aufmarschgebiete des Heeres, sondern wirksam auch die Bevölkerung und die Industrie großer Gebiete und damit auch das gesamte deutsche Vaterland.
Deutscher Westwall an der Westgrenze Deutschlands.
Zeichnung Weltbild-Qliese
Unten: Hochseeschwimmerflugzeug Blohm & Voß Ha 139 über dem Lufthansa-Haus Bathurst.
Werkbild

90 Atlantikflüge, davon 40 auf dem Nordatlantik und 50 auf dem Südatlantik, sind von den Blohm &. Voß-Hochseeflugzeugen Ha 139 und Ha 139 B, die sich im Besitze der Deutschen Lufthansa befinden, ausgeführt worden.
Auf der Strecke Afrika—Südamerika wurde eine Gesamtdurchschnittsgeschwindigkeit von 280,79 km/h, auf der Strecke Südamerika—Afrika*) ein Durchschnitt von 246,20 km/h, d. h. ein Gesamtdurchschnitt von 264,0 km/h erzielt. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten des „Nordstern" lagen auf beiden Strecken mit 303,4 km/h bzw. 262,5 km/h und einem Gesamtdurchschnitt von 282,95 km/h bedeutend höher.
In diesem Zusammenhang ist von Interesse, daß das Baumuster Ha 139 B „Nordstern", das für einen Schleuderstart mit 17 550 kg und einem Wasserstart für den Südatlantikverkehr von 16 050 kg gebaut wurde, im Febr. 1939 in Bathurst bei völliger Windstille und 30° C im Schatten mit 16 500 kg vom Wasser startete (Startzeit 90 Sek.) und in Natal, allerdings bei leichtem Gegenwind, mit 16 800 kg in 52 Sek. vom Wasser frei kam.
Kameradschaft „Ferdinand Schulz'* der Akademischen Fliegergruppe an der Technischen Hochschule in Danzig feierte vom 5. bis 7. Mai ihr 15jähriges Bestehen. Die Akaflieg hatte es sich zur Aufgabe gemacht, mit allen Mitteln die Sportfliegerei, wissenschaftliche Arbeit und Konstruktionstätigkeit auf Danziger Boden aufrecht zu erhalten. Wir wünschen den Danziger Kameraden für die Zukunft weiterhin verstärkten Auftrieb.
v. Hiddessen, NSFK.-Gruppenführer, ist vom Korpsführer des NSFK. Christiansen mit der Führung der NSFK-Gruppe 16 (Südwest) beauftragt worden, v. Hiddessen, welcher 1910 bei Euler fliegen lernte (Pilotenzeugnis Nr. 47), war
*) Bathurst—Natal 3040 km, Bathurst—Recife 3193 km.
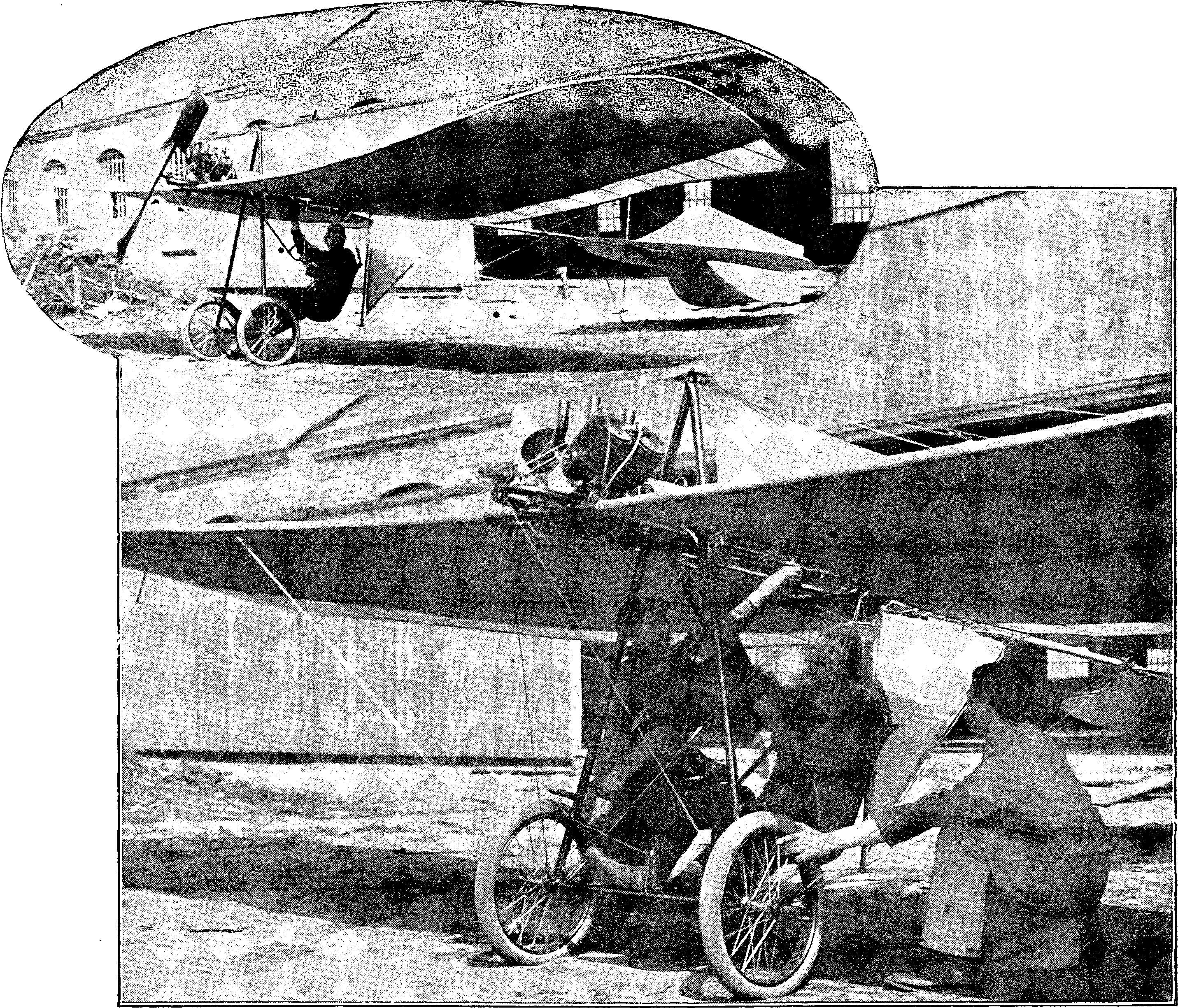
Zu Grades 60. Geburtstag (17. 5. 39). Obenstehende Abb. zeigt die erste im Mai 1910 fabrikmäßig hergestellte Grade-Maschine, wie sie an ihren Besteller, die damalige Ikarus-Gesellschaft, abgeliefert und von Ing. Schwandt geflogen wurde. Das Höhenruder war nicht mehr wie bei der allerersten Maschine spitz zulaufend, sondern abgerundet ausgebildet. Ebenso waren bei den Drahtzügen, die über Rollen führten, Ketten zwischengeschaltet, um den vorzeitigen Verschleiß der Drähte zu verhindern — für damalige Zeiten große Verbesserungen! (Vgl. „Flugsport" 1910 Nr. 10, S. 309.) Archiv Flugsport

Lehrbeauftragte Professoren für Luftfahrtmedizin an den Deutschen Hochschulen während der Tagung auf der Wasserkuppe.
1913 Sieger im Prinz-Heinrich-Flug und führte den ersten Luftpostflug zwischen Frankfurt a. M. und Darmstadt aus.
VII. Tagung der Lehrbeauftragten für Luftfahrtmedizin an den Deutschen Hochschulen fand unter der Leitung von Professor Lottig (Sanitätschef des NS.-Fliegerkorps) vom 5.—7. Mai 1939 in der Reichssegelflugschule des NS.-Flieger-korps auf der Wasserkuppe statt. Das Hauptthema der Tagung lautete „Nervensystem und Psyche", wobei insbesondere die luftfahrtmedizinischen Seiten der Fliegerauslese sowie Fragen des Unfallschutzes behandelt wurden. Neben den luftfahrtmedizinischen Vorträgen nahmen fachkundige Darstellungen über die Grundlagen und die Durchführung des Leistungssegelfluges einen besonderen Platz ein. Die wissenschaftlichen Erörterungen wurden lebendig unterbaut durch den Einsatz der Tagungsteilnehmer im praktischen Segelflugbetrieb. Den Höhepunkt der Tagung bildete eine Ansprache des Rhönvaters Ursinus, der am nächtlichen Lagerfeuer packende und mitreißende Worte über die Entwicklung der

Besuch aus Fernost bei Focke-Wulf. Dir. Dr. Naumann (dahinter Dir. Dr. Tank) begrüßt die japanischen Gäste (von links nach rechts) Oberstlt. Jijima (Jap. Botschaft Berlin), Oberstlt. Mori (Dai Nippon K. K.), Sekt.-Chef Okubo (Tokio, Luftamt).
deutschen Segelfliegerei und über die Verpflichtung gegenüber den alten Segel-Ilugpionieren fand. Die Tagung, an der auch der Gruppenführer der Gruppe 8 des NS.-Fliegerkorps, Gruppenführer von Eschwege als Ehrengast teilnahm, gestaltete sich für alle zu einem eindrucksvollen Erlebnis. P.
Was gibt es sonst Neues?
Vorkriegsfliegertreffen findet vom 29. bis 30. 7. 39 in Frankfurt a. M. statt.
Arado Flugzeugwerke, Dipl.-Ing. Walter Blume zum Geschäftsführer bestellt, ausgeschieden Erich Serno.
Belg, internat. Militär-Meeting 9. Juli in Brüssel anläßlich der 25jährigen Entwicklung des Militärflugwesens.
Ausland.
Parade der gesamten spanischen Luftwaffe vor General Franco fand auf dem Flugplatz Barajas im Norden von Madrid am 12. 5. statt. An dem Vorbeimarsch der Einheiten nahmen neben den spanischen Formationen auch deutsche und italienische Freiwilligenverbände teil, die von den Tausenden von Zuschauern begeistert gefeiert wurden. General Franco verlieh den deutschen Freiwilligen als Zeichen seines Dankes und im Namen des spanischen Volkes eine Fahne.
Nach einer Ansprache des Oberbefehlshabers der spanischen Luftwaffe, General Kindelan, heftete General Franco persönlich den deutschen und italienischen Freiwilligen-Fliegern die Militärmedaille an, wobei er jedesmal den Satz wiederholte: „Für bewiesene Tapferkeit und technisches Können innerhalb der Luftwaffe im Kreuzzug gegen den Kommunismus zeichne ich Sie aus".
Anschließend erinnerte General Franco in einer kurzen Ansprache an die ersten Wochen des Krieges, als auf nationaler Seite die ersten Flieger mit ungeheurem Heldenmut den damals aussichtslosen Kampf gegen die rote Luftwaffe eröffnete und dabei Beweise einer Tapferkeit gaben, die schon legendär geworden sind. Während das nationale Spanien zu diesem Befreiungskampf angetreten sei, seien zu seiner Unterstützung alte Frontsoldaten aus den Ländern Europas, Deutschland und Italien, herbeigeeilt, die selbst die Zerrissenheit und den Befreiungskampf ihres eigenen Vaterlandes miterlebt hätten, um nun uneigennützig Seite an Seite mit den spanischen Kameraden gegen den Kommunismus zu kämpfen. General Franco ging dann auf die Zukunft der spanischen Luftwaffe ein, die weiter ausgebaut werden solle, so daß dereinst Spaniens Verteidigung in der Luft in jeder Weise gesichert sein werde. Franco forderte von der Luft-
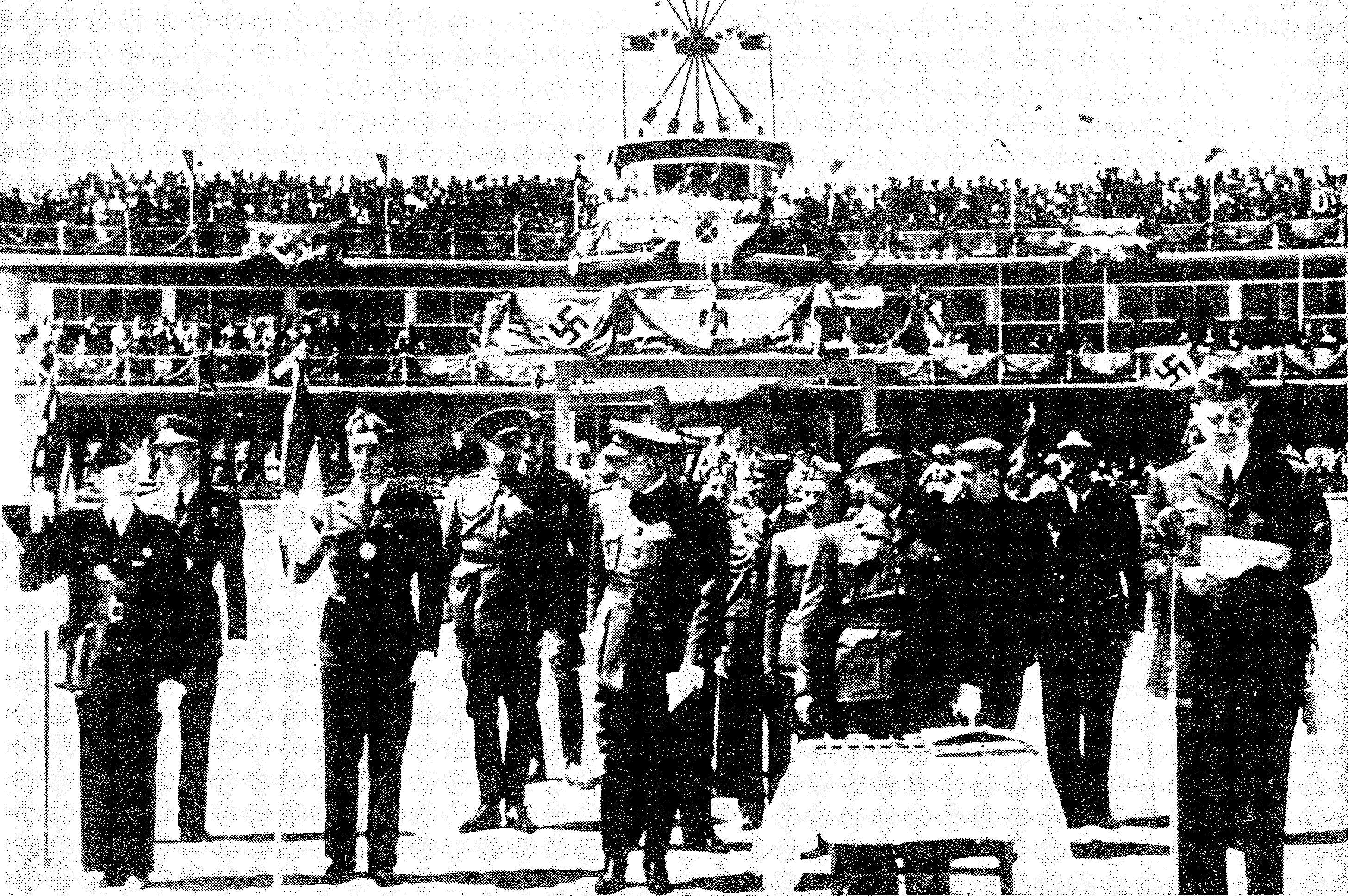
Franco zeichnet deutsche Freiwillige aus. General Franco (hinter dem Tisch) während der Feier auf dem Flughafen. Neben dem spanischen Staatschef Kriegsminister General Davila und General Martin Moreno. Weitbild
Nr. 11/1>39, Bd. 31 „FLUGSPORT"
Seite 291
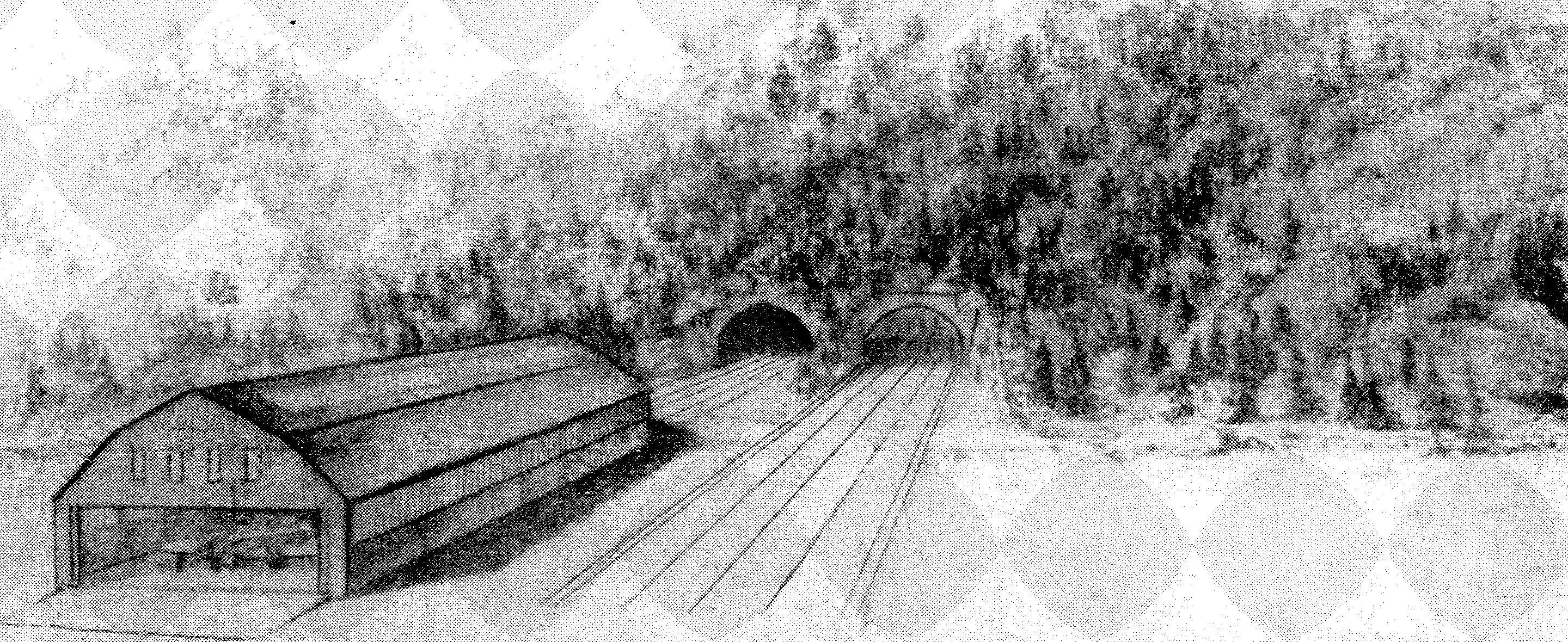
Schiebeflugzeughallen System Qazda der Schweizer Pilatus-Flugzeugwerke.
Fiight
waffe Disziplin und jederzeitige Einsatzbereitschaft, denn nur eine solche Luftwaffe könne Spanien groß machen. Der spanische Staatschef schloß seine Ansprache mit dem Kampfruf: „Ariba Espana" und mit Hochrufen auf Deutschland und Italien. Die Nationalhymnen der drei befreundeten Nationen beendeten die eindrucksvolle Kundgebung.
König von England bestellte für persönlichen Gebrauch einen De Havilland Flamingo (Typ D. H. 95).
Engl. Admiral Reginald Henderson t am 2. 5., kam als Kommandeur des ersten Flugzeugträgers Courageous 1931 zum Marineflugwesen.
Engl. Flughafen Guernsey am 5. 5. in Betrieb genommen.
Schwimmendes Dock Southampton beabsichtigt die American Airways für ihre Atlantik-Großflugboote zu errichten.
Rolls Royce Motoren neue Fabrik in Hillington zwischen Glasgow und Ren-fi ew im Bau. Belegschaft 20 000 Arbeiter. Soll 1940 in Betrieb genommen werden.
Imperial Airways Atlantik-Postdienst infolge verspäteter Fertigstellung der bestellten Empire-Boote auf nächstes Jahr verschoben.
274,223 km/h erreichte Lallemand auf Mauboussin M-200 mit Regnier 130 PS Motor in Etampes am 6. 5. auf einer Strecke über 100 km. Am 7. 5. erreichte er mit der gleichen Maschine auf der 1000-km-Strecke 255,358 km/h. Leergewicht des Mauboussin M-200 378 kg, Fluggewicht 600 kg, theoret. Höchstgeschwindigkeit 285 km/h, Reichweite 1000 km.
Coupe Aerienne Le Mans, verbunden mit dem berühmten Motorwagen-Rennen Le Mans 17. 6., organisiert vom Aero Club de la Sarthe.
Itah Luftbudget für 1. 7. 39 bis 30. 6. 40 2 190 060 000 Lire. Das sind 900 Mill. Lire mehr als im Jahr 38/39.
Ital. Flugplatz Novara-Camari mit Hallen für Unterbringung von mehreren Hundert Flugzeugen hat der Duce am 18. 5. eingeweiht.
Schweizer Pilatus-Flugzeugwerke beabsichtigen, ihre Flugzeughallen, Konstruktion Gazda, auf Schiebebühnen montiert, in große Aussparungen bei Bombengefahr zu verschieben. Obenstehende Abbildung zeigt ein Ausführungsbeispiel. Hallenlänge 74 m, Breite 24,6 m. Die vorderen Schiebetore sind mit Stahlplatten gegen Bombensplitter bewehrt.
Der Direktion der Schweizer Gesellschaft gehören an der Präsident des Schweizer Aero-Clubs E. Meßner als Präsident der Gesellschaft, und als Vize-Präsident Herr A. Gazda, der Export-Manager der Oerlikon Maschinen- und Werkzeugfabrik Bührle & Co.
Packman, schwed. Flieger, startete am 16. 5., 8.40 Uhr Ortszeit, in St. Johns zu einem Atlantikflug Neufundland—Stockholm (3700 km) in einem Kleinflugzeug mit nur 175 km/h Geschwindigkeit, ohne Funkanlage. Bis 22. 5. überfällig.
Neufundland Hattie's Camp Flughafen jetzt ausgebaut, liegt 60 km westlich von Botwood, 3170 km von Foynes (Irland) entfernt. Er wurde zum Flughafen für den Ozeanflugverkehr wegen seiner günstigen geographischen Lage ge-
wählt und nach modernen Grundsätzen ausgebaut. Während die Ostküste Neufundlands wegen häufiger Nebel berüchtigt ist, gibt es in Hattie's Camp überhaupt keinen Nebel. Sommer und Winter herrscht gemäßigtes Klima. Das Hauptgebäude des Flughafens enthält die meteorologische Abteilung, Büros und dient zur Beherbergung des Stabes. Zur Unterbringung der Angestellten ist ein Dorf in kanadischem Stil gebaut. Die asphaltierten Startbahnen des Flughafens sind 160 m lang und mehr als 6 m breit. Der Platz ist auch für Nachtlandungen eingerichtet.

Boston /Jtj/^ - i nlfi-
«cNew York
Neufundland Hattie's Camp.
Bücker „Student" flog 1938 25 000 km unter schwierigsten Verhältnissen quer durch Afrika. Betriebskosten pro km 5 Rpf. Die Abb. zeigen Landung in einem Negerdorf. Neugierig wird das Flugzeug von Eingeborenen betrachtet. Die Scheu vor den weißen Göttern, die plötzlich vom Himmel heruntergefallen sind, ist schnell verflogen.
Werkbilder
K. L. M. weitere beantragte Australienlinie wurde neben der bestehenden K. N. I. L. M. Linie Batavia—Sydney, von der australischen Regierung abgelehnt. Statt dessen wurde der K. L. M. die Uebernahme der einen der beiden wöchentlichen Fluglinien der K. N. I. L. M. bewilligt.
United Aircraft Corporation umfaßt die Firmen: Pratt & Whitney Air-craft, Chance Vought Aircraft, Hamilton Standard Propellers, Hamilton Export Division, Sikorsky Aircraft und United Airports.
USA. Havard-Trainingsflugzeuge mit Pratt & Whitney Wasp Motoren und Hamilton Standard Propeller wurden 2 mal 200 von der engl. Regierung bestellt.
Chile-Luitlinie Santiago—Puerto Monpt, betrieben von der Linea Aerea Na-zional (L. A. N.), wird demnächst zwei neue, jetzt zur Ablieferung gelangende Junkers Ju 86 einsetzen.
300 chinesische Militärflieger werden zur Zeit in der sowjetrussischen Fliegerschule Iii (Singkiang), welche im November 1938 gegründet und aus der bereits 260 Flieger für die chinesische Luftwaffe hervorgegangen waren, ausgebildet.
9200 m im Segelflug erreichte Peter Glöckner vom Deutschen Forschungsinstitut in Prien am Chiemsee. Infolge Mangels an Sauerstoffvorrat mußte der Höhenflug vorzeitig abgebrochen werden. Start erfolgte im Motorschlepp, Ausklinken in 5500 m Höhe am Großglockner. Trotzdem der Flieger auf eine Höhe von 5000 m abgesoffen war, gelang es ihm wieder, auf 9200 m zu steigen.
Soaring Society of America hat über die ISTUS alle Segelflugpiloten der zur ISTUS gehörigen Länder zur Teilnahme an dem 10jährigen Segelflug-Wettbewerb in Elmira vom 24. 6. bis 9. 7. eingeladen. Die Hauptpreise können nur von den nationalen Wettbewerbern gewonnen werden. Es sind jedoch einige Sonderpreise ausgeschrieben, an denen sich auch Ausländer beteiligen können.
Engl. Segelfliegerprüfungen 1938: 329 A, 236 B, 139 C, 20 Leistungsabzeichen.
Franz. Segel-Kunstflug-Wettbewerb 28. 5. Geldpreis des „Petit Parisien", umfassend halbe Loopings, Rückenflug, halbe Rollen, Immelmann Turns und langsame Rollen, findet gemäß den Bestimmungen der F. A. I. in St. Germain-en-Laye bei Paris statt.
Franz. Segelflugmeisterin Girod t ist in der Nähe des Flugplatzes Coulom-rniers mit ihrem Segelflugzeug, welches angeblich in den Propellerwind eines anderen Flugzeugs geriet, tödlich abgestürzt.
Peter Riedel, Washington, segelte in der Nähe der Stadt gelegenen Flugplatz über 2 Std., wobei er Loopings und andere Flugfiguren ausführte. Riedel beabsichtigt, von Kalifornien Zielflüge von Flugplatz zu Flugplatz bis nach New York auszuführen.
Wasserflugmodell H. Antusch. Schulterdecker, Baustoff Hartbalsa, Tonking und Japanpapier. Tragflügel 6° Pfeil- und 12° V-Form. Nasenleiste besteht aus 5X5 mm, Hauptholm und die Endleiste aus 3X9 mm Hartbalsa. Profil RAF 32. Die Rippen wurden aus 1,5 mm starken Brettchen ausgeschnitten. Bespannung dünnes Japanpapier, einmal zelloniert. Tragflügel ist ungeschränkt. Rumpf rechteckiger Querschnitt hat 4 Längsgurte von 4 X 4mm, Rumpfstege und Diagonalen aus 3X4 mm Balsa. Bespannung besteht aus zweimal imprägniertem Seidenpapier. Höhenruder, Profil Clark Y, ist tragend ausgebildet. Schwimmwerk besteht aus Schwimmwerkstreben aus Tonking und 1 mm Stahldraht, der ohne Zwirnwicklung, nur mit Rudol 333 angeklebt ist. Flachbodenschwimmer sind aus 1,5 mm Balsa-Seitenwänden, die mit 0,8 mm Balsa beplankt sind, hergestellt. Schwimmer wurden mit Seidenpapier beklebt und 3X zelloniert. Befestigung an den Schwimmwerkstreben wurde mit dem gleichen Klebstoff vorgenommen und hat sich gut
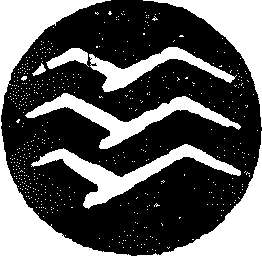
Segelflug
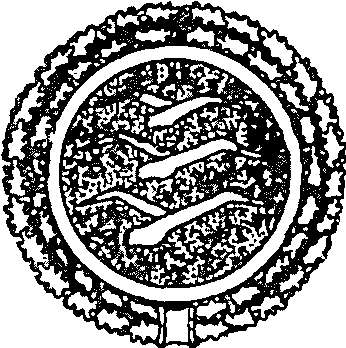
bewährt. Hinterer Stützschwimmer ist am unteren Seitenleitwerk befestigt. Luftschraube Durchmesser 360 mm, Steigung 400 mm. Antrieb besteht aus 12 Fäden
deutschen Gummis 1X4 mm. Da der Gummi länger ist als der Hakenabstand, wurde er gezwirnt. Fluggewicht 150 g,
Flächenbelastung 13.27 g pro dm2, Trag-flügelinhalt 11,33 dm2. Das Modell wassert nach 2—3 m einwandfrei ab und fliegt ohne äußere Einwirkungen durchschnittlich 90 Sek. Am 6. 5. 39 flog das Modell, nach dem Start aus einem 1 m breiten, 4 m langen und 15 cm tiefen künstlichen Wasserbecken, einen neuen deutschen Rekord mit 7 Min. 9,5 Sek. Flugdauer.
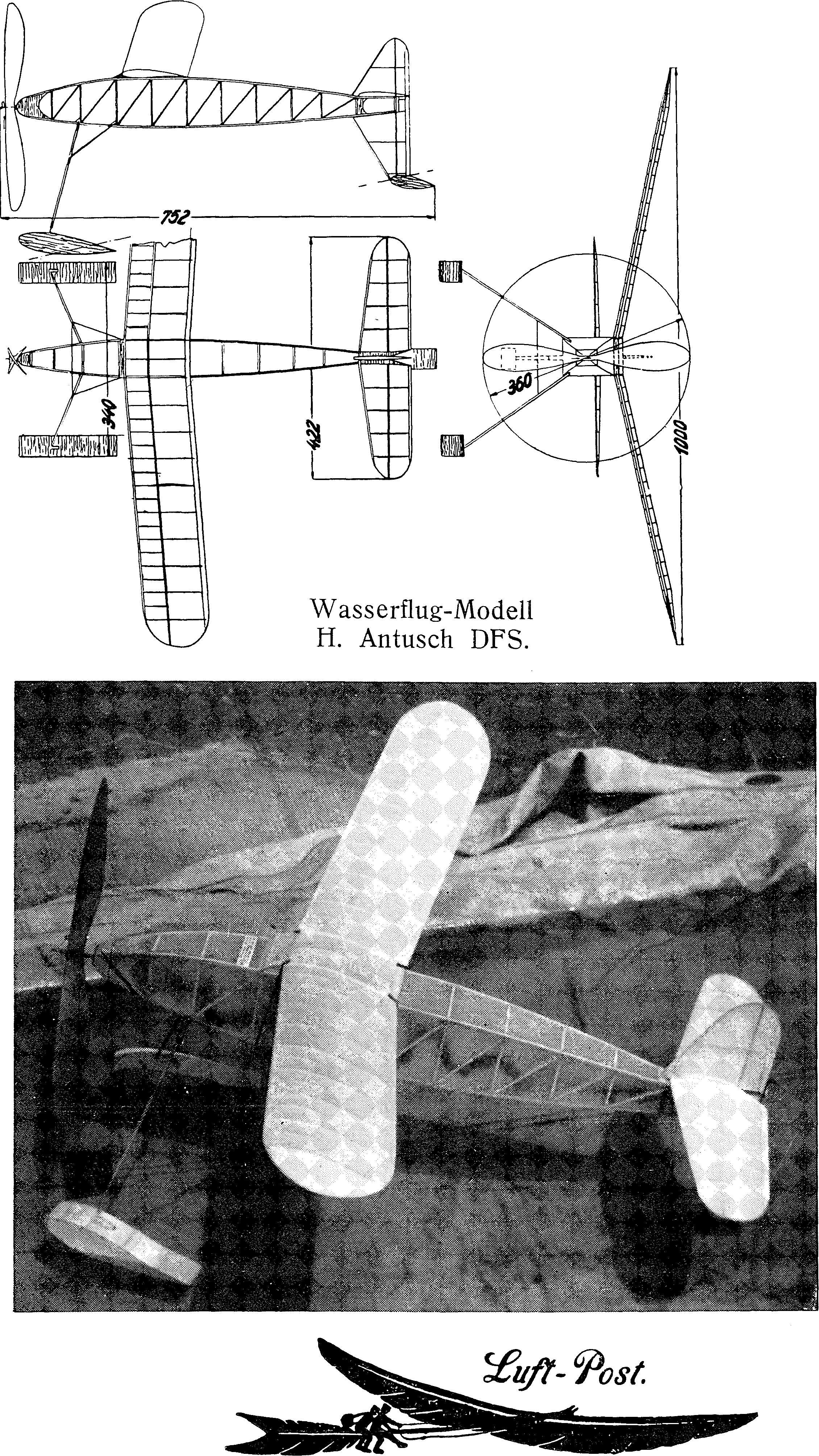
Wasserflug-
Modell H. Antusch. DFS.
Leitwerkslasten für das Segelflugzeugmuster DFS-Kranich: Höhenleitwerksbruchlast 381 kg, Seitenleitwerksbruchlast 205 kg; aus der Seitenleitwerksbelastung resultierendes Bruchtorsionsmoment für den Rumpf Mo = 115 m/kg.
Ellehammer-Flugmaschine, Typenbeschreibung mit Abbildungen finden Sie im „Flugsport" 1912, Seite 337.
Troposphäre reicht bis 11 km. Sauerstoffmangel, der durch Preßsauerstoff ausgeglichen wird, setzt bereits bei 4000 m ein. Höhenfestigkeit ist bei den Menschen verschieden. Gut trainierte und eingewöhnte Flieger brauchen oft bis 7000 m keine Sauerstoffzufuhr. Verschiedene geübte Meteorologenflieger haben es schon bis auf 9000 m gebracht. Luftzusammensetzung: Stickstoff 78,03%, Sauerstoff 20,99%, Kohlendioxyd 0,03%, Wasserstoff 0,01%.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Spiel und Lebensziel. Der Lebensweg des ersten deutschen Motorfliegers Hans Grade. Von Rolf Italiaander. Vorwort von Generalltn. Ernst Udet. Gustav Weise Verlag G. m. b. H., Berlin SW 68. Preis RM 3.60.
Am 17. Mai feierte Hans Grade seinen 60. Geburtstag. Es war höchste Zeit, daß endlich einmal ein Buch über diesen ältesten Pionier, auf den wir stolz sein können, erschien. Die Leistungen Grades aus der damaligen Zeit sind um so höher einzuschätzen, als Grade zunächst, bevor er an den Bau des Flugzeugs herangehen konnte, sich erst einen Motor bauen mußte. Und dabei gab es keine Vorbilder. Ich habe oft in dieser Zeit über Grades Geduld und Ausdauer gestaunt. Die wenigsten der damaligen Zeitgenossen haben begriffen, was dieser stille, bescheidene Mann, Motorbauer, Flugzeugbauer, Monteur, alles in einer Person, geleistet hat. Die folgende Generation hat bereits im Jahre 1932 eine Dankesschuld abgetragen und Grade auf dem Krakauer Anger in Magdeburg im Auftrag des damaligen Deutschen Modell- und Segelflug-Verbandes ein Denkmal gesetzt. Die vorliegende Biographie ist gleichzeitig ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des deutschen Flugwesens. U.
Luftwaffe in Front. Luftstrategie englisch gesehen. Von Cpt. Norman Mac-millan. 154 S. m. 6 Kartenskizzen. Verlag Dr. M. Matthiesen & Co., Berlin SW 68. Preis RM 3.—.
England ist keine Insel mehr. Die Luftwaffe hat die Vorherrschaft der Flotte beseitigt und die Verhältnisse wesentlich umgestaltet. Norman Macmillan hat mit klarem Blick die Aenderung der Kräfteverhältnisse erkannt. Das Buch gibt einen Blick über das Kräftespiel in der heutigen Zeit. Einzelne Gedankengänge Mac-millans sind schon Wirklichkeit geworden. Ein lesenswertes Buch.
Die deutsche Luftwaffe. Ein Bilderwerk v. Dr. Eichelbaum, Hptm. i. RLM, m. Geleitwort von Generalfeldmarschall Hermann Göring. Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin-Steglitz. Preis RM 4.80.
Ein für den Anfänger in Form und Inhalt lesenswertes Einführungsbuch. An Hand von ausgezeichneten Abbildungen bekommt der Fernstehende einen Begriff über unsere moderne Luftwaffe, Ausbildung und Zusammensetzung der Fliegertruppe, Flugzeugtypen, Motorstärken, Bombenlast, Reichweite und anderes mehr.
Expedition des »FLUGSPORT« Frankfurt a. M.
KLEINE ANZEIGEN
Die dreige spalten.© Mlllf isieter~,2^eile kostet 25 Pfennig.
Expedition des »FLUGSPORT«
Frankfurt a. M.
5n9IS-Mi«weida
IMaschinenbau / Automobil- u. Flugtechnik I Elektrotechnik. Programm kostenlos]
BirkervFIugzeug
Sperrholzplatten
deutsches Fabrikat
bei Rekordflügen erprobt, in den Qualitäten: AVIATIC, SPEZIAL, GLEITFLUG in allen Stärken von 0,4-8 mm liefert prompt ab Lager
Georg Herte Berlin*Charlottenburg
Kaiser Friedrich-Straße 24 Fernspr.-Sammelnummer: 34 5841 Telir.-Adr.: Fliegerhölier Berlin
Werde Mitglied der NSV.!
Hochschulinstitut für Leibesübungen in Halle (S.) stellt sofort
für die Abteilung Luftfahrt ein.
Bedingungen: Mindestens Gesellenzeugnis im Metall- oder Holzgewerbe, Anerkennung als Werkstattleiter des NSFK. für Gleit- und Segelflugzeuge, Führerschein für Personenwagen und Lastkraftwagen, Segelfluglehrer, möglichst Segelflughauptlehrer.
Besoldung: Nach Gruppe VII bezw. Gruppe Via der TOA, zuzüglich Fliegerzulage. Reise- und Umzugskosten sowie gegebenenfalls Trennungsentschädigung nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften, Lebenslauf und Lichtbild sind zu richten an
Hochschulinstitut für Leibesübungen, Halle (S.)
Heft 12/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro % Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalten und Verlas Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Ouellenangabe gestattet.
Nr. 12 7. Juni 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 21. Juni 1939
Legion Condor.
In Spanien ist der Krieg aus. Die „Legion Condor" ist heimgekehrt und hat einen neuen Freund, Nationalspanien, mitgebracht.
Drei Jahre haben unsere Freiwilligen in dem sonnigen Süden verbracht. Nur wenigen Fernstehenden war es vergönnt, wenn sie nicht selbst Jungens unten hatten, diesen Kampf schweigend mitzuerleben.
Es war im Juli 1936, als der Führer beschloß, die nationalspanische Bewegung unter General Franco im Kampf gegen den Bolschewismus zu unterstützen. Damals verließen bei Nacht und Nebel 85 ausgesuchte Freiwillige unter Führung des Oberstleutnants v. Scheele") Deutsch-
*) Alexander v. Scheele, geb. 18. 3. 1887, Mainz, Pilotenzeugnis Nr. 169 v. 14. 3. 1912 Zweidecker (Albatros) Flugplatz Johannisthal.
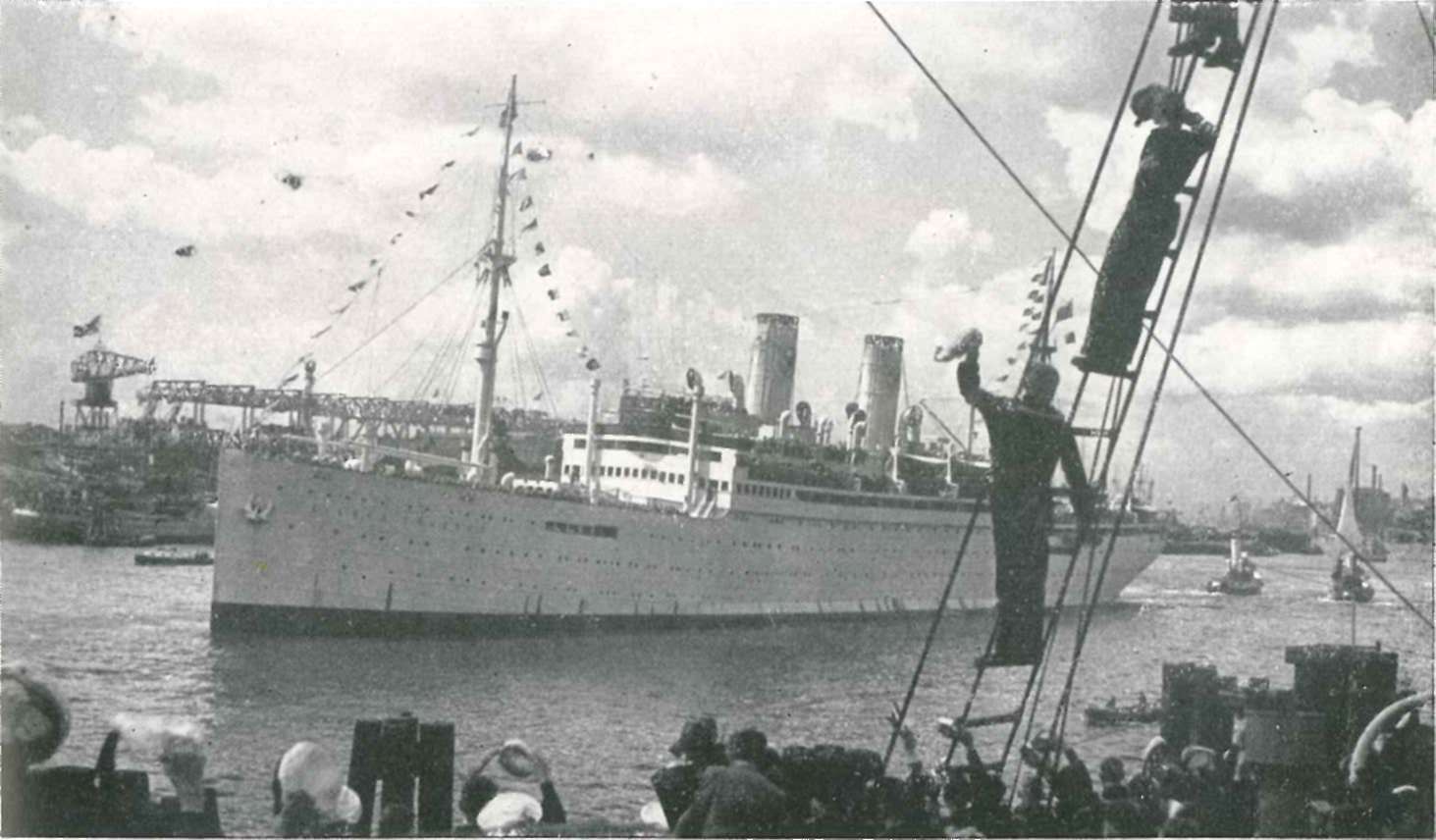
Einlaufen der Heimkehrer-Flotte mit den Spanienkämpfern an Bord
im Hamburger Hafen. Weltbild
Diese Nummer enthält Din-Sammhmg Nr. 5 und Tafel I Do 26.
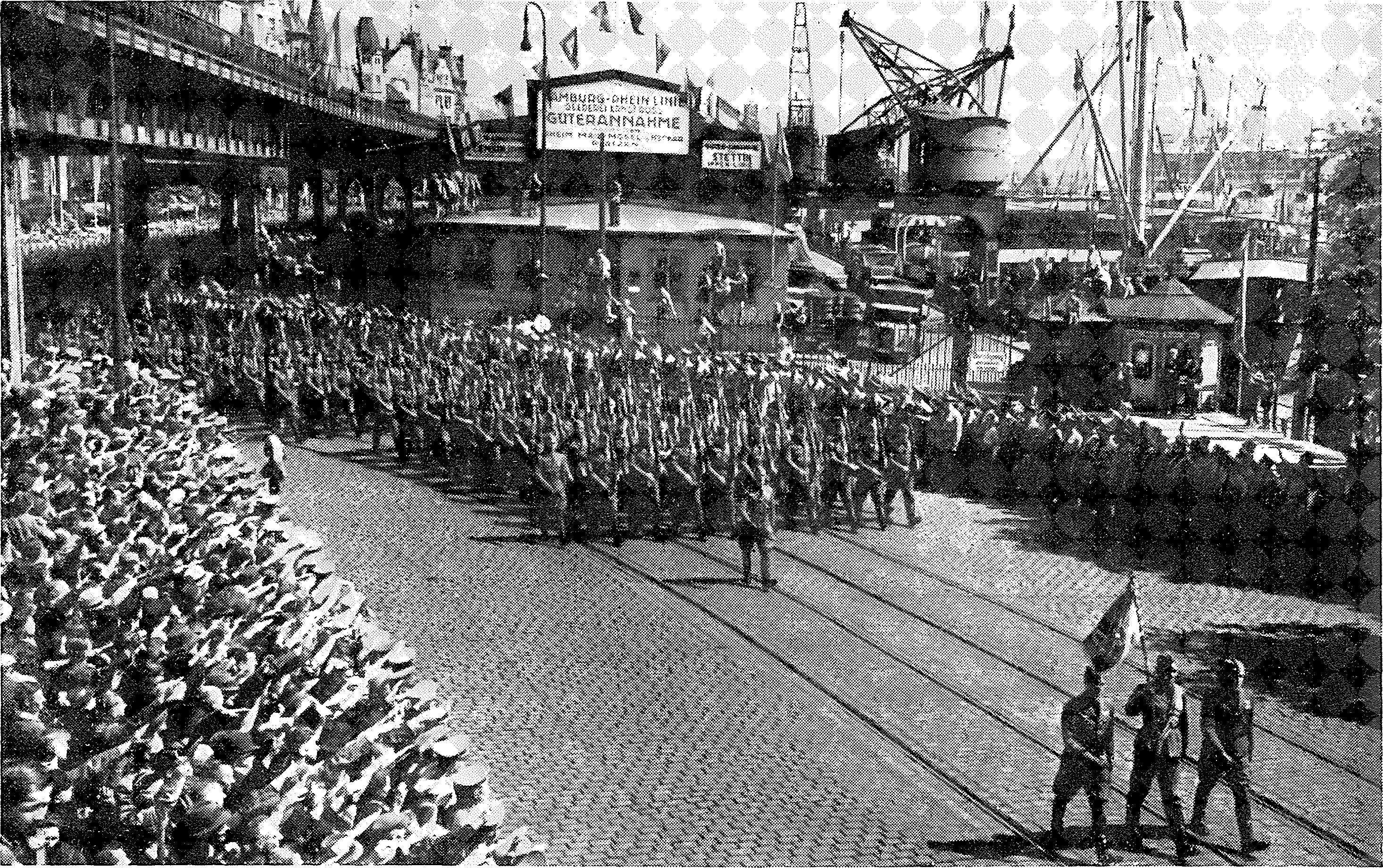
Marsch der deutschen Legion durch die Straßen Hamburgs.
An der Spitze die Standarte der Legion. Weltbild
land und nahmen 20 Junkers-Transportmaschinen auf dem Luftwege mit, um als reines Transportunternehmen 15 000 Mann nationalspanische Luftstreitkräfte von Spanisch-Marokko innerhalb weniger Wochen auf das Festland herüberzuschaffen. Die Beschießung dieser Mannschaftstransporte durch die roten Flotteneinheiten zwang die begleitenden Jäger der Transportstaffeln zur Abwehr und weiterer Gegenwirkung.
Ueberau kämpfte man sich durch. Das kleine Unternehmen wuchs aus sich heraus. Bereits im September kamen dazu weitere Jäger, Auf-
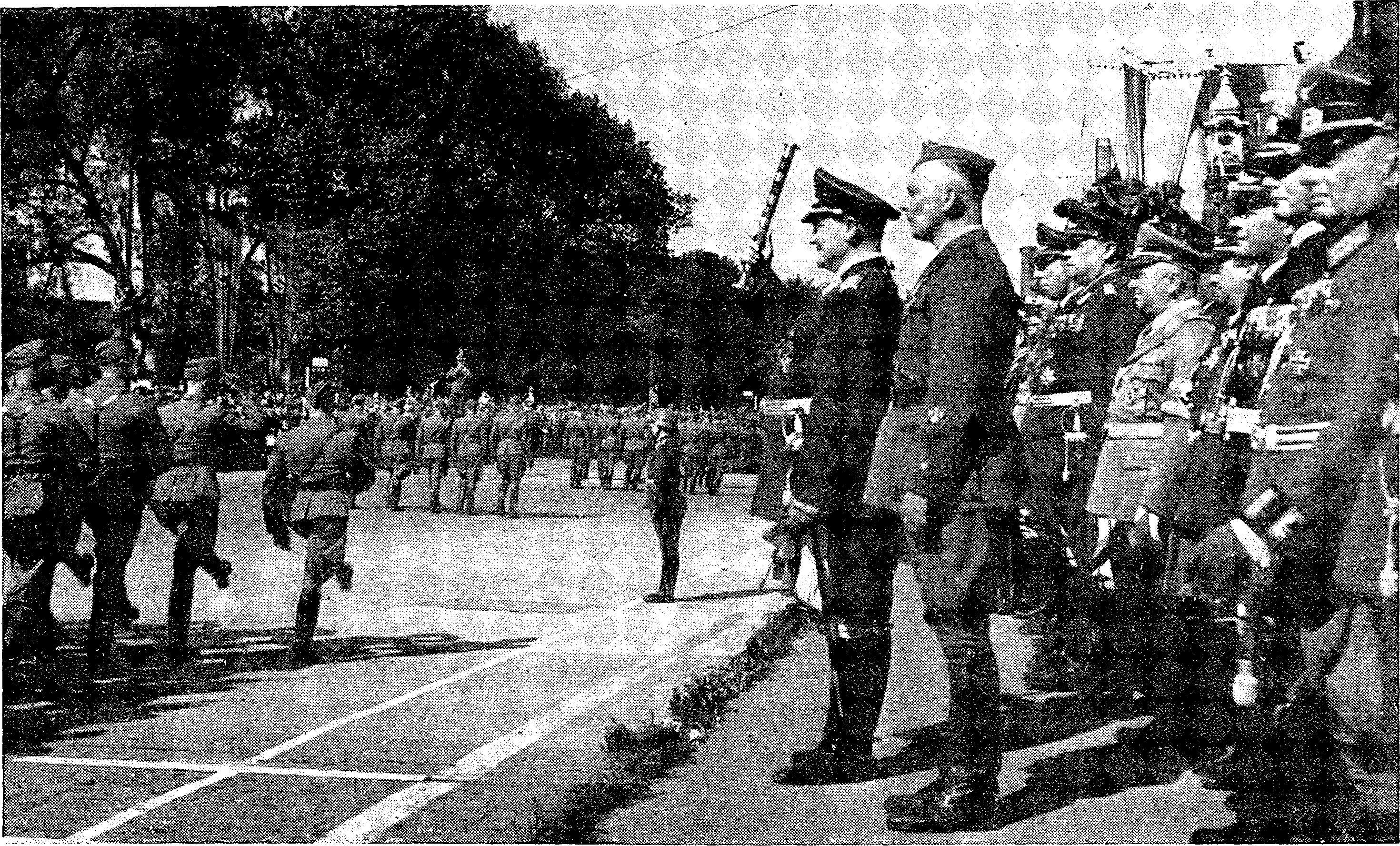
Die deutsche „Legion Condor" marschiert vor Generalfeldmarschall Qöring am 31. 5. auf dem Karl-Muck-Platz vorbei. Daneben die drei Kommandeure der Legion General der Flieger Frhr. v. Richthofen, General der Flieger Sperrle
und General der Flieger Volkmann. Weltbild

Vom Einzug der deutschen Spanienkämpfer in Hamburg. Generalfeldmarschall Göring begrüßt auf der Ueberseebrücke den Führer der Legion Condor,
Generalmajor Freiherrn von Richthofen. Weltbild
klärungsstaffel, schwere Flakbatterie, Panzerkompanien u. a. m. Oberst Warlimont wird vom Führer als bevollmächtigter Vertreter der deutschen Wehrmacht zum Kommandeur des Freiwilligenkorps entsandt. Im November folgen weitere geschlossene Ergänzungskampfgruppen unter dem Kommando von Generalmajor Sperrte.^ Von, nun am heißt i es v „Legren, Condor". OEihsaitzsfeHe vorerst /Zehtralfront -bei

Spanienfreiwillige erhalten von Generalfeldmarschall Göring die vom Führer für die Legion gestifteten Orden angeheftet. Weltbild

Spanienkämpfer berichten ihren Kameraden von der Luftwaffe.
Weltbild
Ueberau wird bald der Einsatz der Formation „Condor" verlangt, tiberall hilft sie zum Erfolg. Qeneral Sperrle wird in der Heimat benötigt und durch Generalmajor Volkmann ersetzt. Der Frontzipfel von Teruel war bedroht. Die verzweifelten Angriffe der Roten werden abgewehrt. Im Jahre 1938 holt Franco zu neuem Schlage südlich des Ebro aus, und nun geht es unaufhaltsam vorwärts, dem Ende entgegen.
Nachdem General der Flieger Volkmann durch Generalmajor Frhr. v. Richthofen abgelöst war, erfolgte dann der Angriff auf Katalonien. Weihnachten an der Front. — Jedes Hindernis wird überwunden: 15. 1. 39 fällt Tarragona, 26. 1. Barcelona, am 9. 2. sind die Pyrenäen erreicht, und das rote Heer und die Luftwaffe Kataloniens sind auf französisches Gebiet geflüchtet und geschlagen.
Am 10. 2. 39 beginnt Franco den Endkampf um Zentralspanien, 27. 3. erfolgt der Angriff bei Toledo. Am 29. 3. 39 melden die Flugzeuge der „Legion Condor": „Weiße und Nationale Flaggen über ganz Spanien". Arriba Espania, viva Alemania!
Japan. Segelflugzeug Hikariö Zweisitzer.
Dieser Schulterdecker, zwei Sitze nebeneinander, wurde gebaut von den Fukuda Mayeda Leichtflugzeugwerken, Osaka. Konstrukteur Ing. Takagi.
Holzbauweise. Konstruktion und Aufbau lehnt sich an deutsche Muster an. Flügel im ersten Drittel starker Knick. Lange schmale Querruder über 2/3 des Flügels.
Rumpf fast kreisrunder Querschnitt. Vordere Windschutzscheibe fest. Kabinenaufbau nach hinten verschiebbar. Hinterer stromlinienförmiger Teil fest, mit Cellon verkleidet.
Feste Höhenleitwerksfläche. Ein Laufrad unter den Sitzen.
Spannweite 16 m, Länge 7,12 m, Höhe 1,25 m, Fläche 20 m2, Flügelschnitt NACA 64012, Leergewicht 260 kg, Zuladung 160 kg, Gleitwinkel 21,4, Sinkgeschwindigkeit 0,85 m.
Erfolgreicher Schleppversuch am 3. 3. zwischen Osaka und Yamanashi, 400 km in 3 Std. 41 Min.
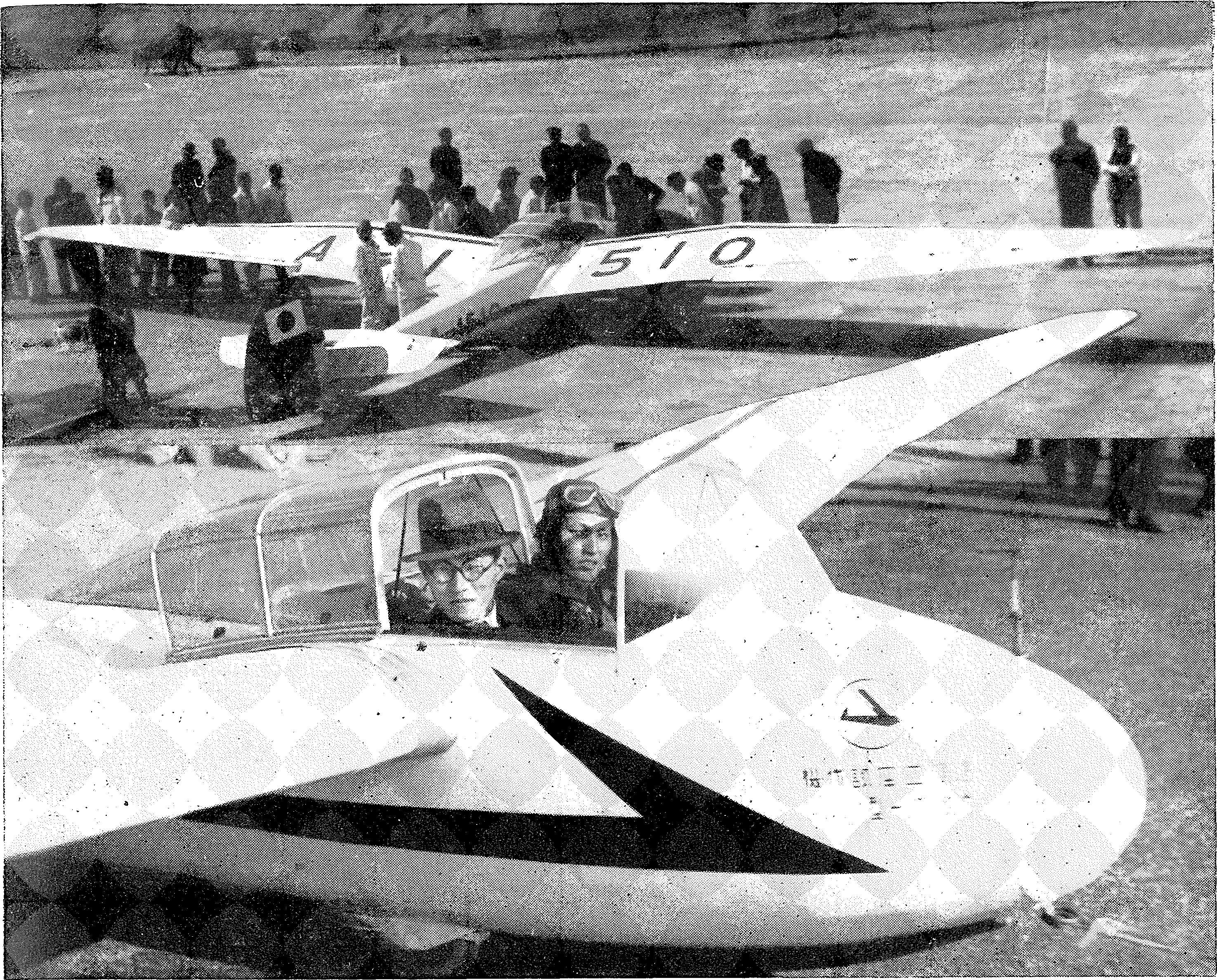
Japan. Segelflugzeug Hikari 6 Zweisitzer. Archiv Flugsport
Engl. Jagdflugzeug „Spitfire".
Der Hochgeschwindigkeitstyp Spitfire (vgl. „Flugsport" 1936 S. 327) ist von Vickers-Supermarine, welche schon früher Maschinen für Hochgeschwindigkeit entwickelt haben, gebaut. Es sei nur an die Coup-Schneider-Zeit, Konstrukteur Mitchell, erinnert. Wenn auch das Flugzeug auf dem letzten Pariser Salon ausgestellt war, so wurden Konstruktionseinzelheiten immer noch geheimgehalten.
Motor Rolls-Royce „Merlin" II 1050 PS, Flüssigkeit gekühlt.
Flügel einholmig, Flügelnase mit Holm
Abb. 1. Spitfire I, Motor Rolls-Royce Merlin II.
Zeichnung Flugsport
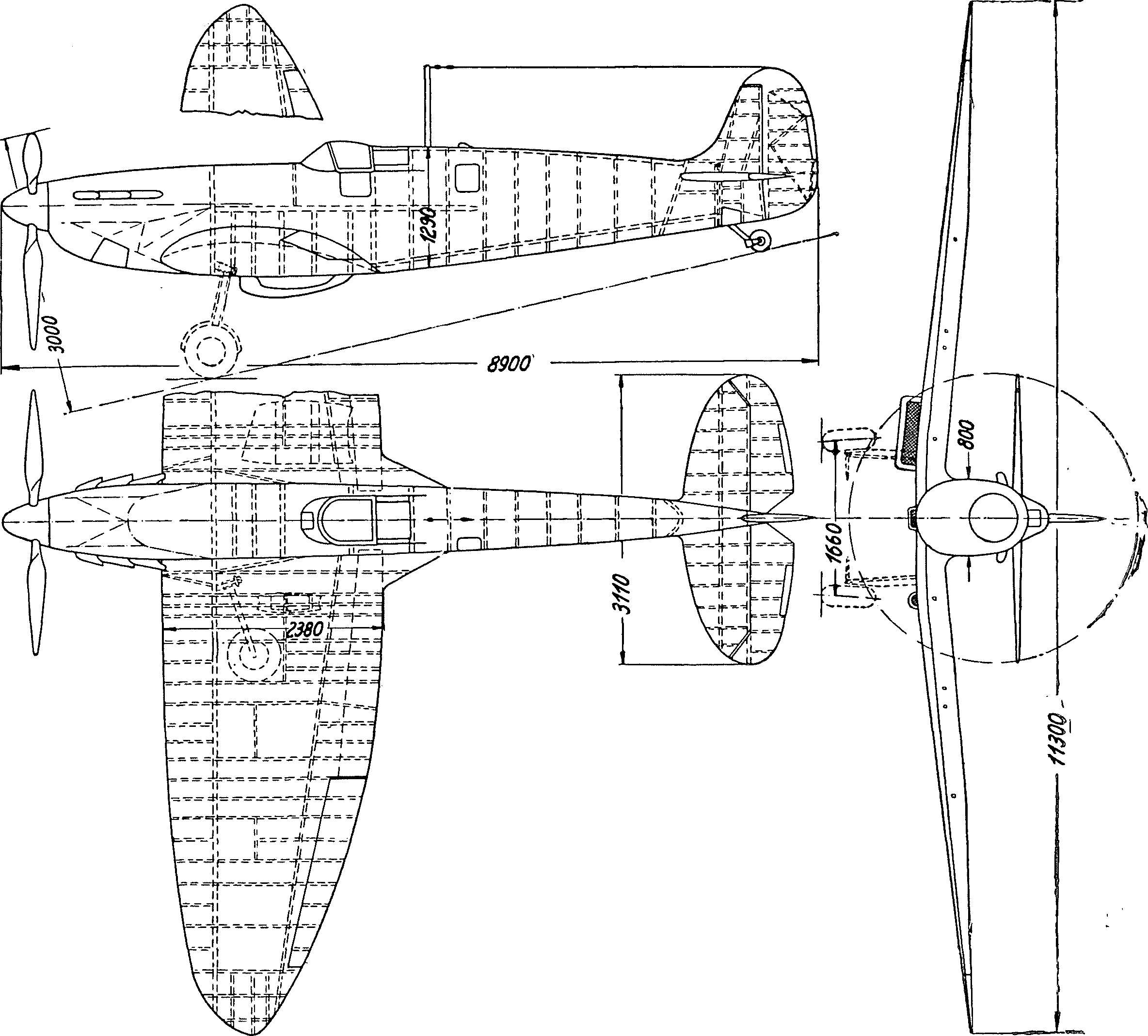
Abb, 2. Engl. Jagdflugzeug Spitfire. Oben: Flügelbau. Man erkennt die Lagerung des hochziehbaren Fahrwerks. Mitte: Rumpfbau, Rumpf und Schwanzende abnehmbar. Unten links: Höhenflosse in der Schablone. Rechts: Seitenruder.
A_ ^ Werkbilder
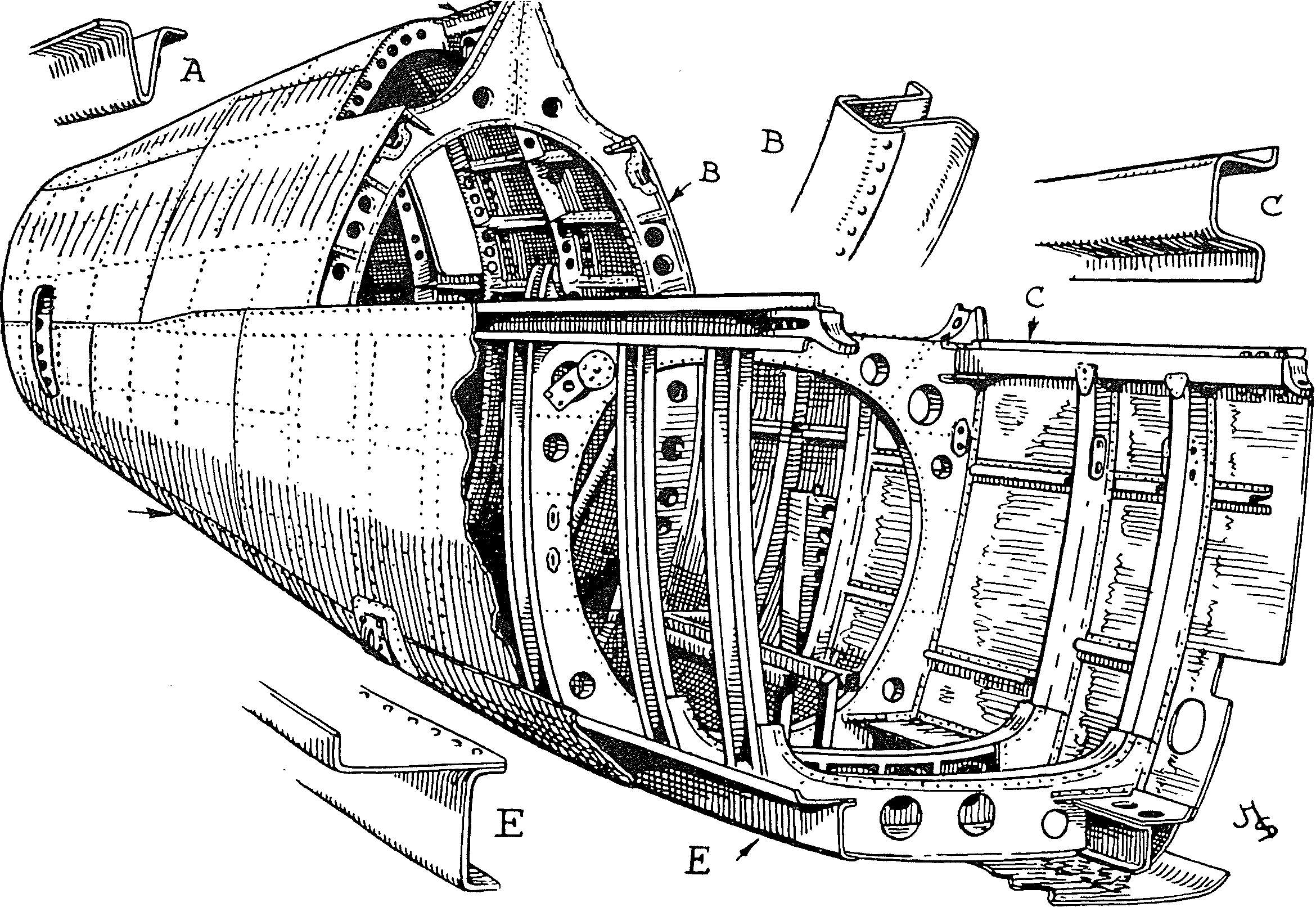
Abb. 3. Engl. Jagdflugzeug Spitfire. Rumpfaufbau. Man beachte A Rumpfholm hinter dem Kopfabfluß, B Profilring, C oberen
Rumpflängsholm, D untere Rumpflängsholme, E unteren Längsholm.
Aircraft Engineering
torsionsfester Teil. Rippen mit Streben im Dreiecksverband genietet. Nach den Flügelenden zu Blechstege mit runden Aussparungen. Jede Rippe zeigt in ihrem Aufbau andere Form und Konstruktion.
Rumpf besteht aus Mittelstück, abnehmbarem Motorvorderbau und abnehmbarem Leitwerksstück, siehe Abb. 2. Rumpfversteifung zwei obere und zwei untere Längsholme. Profilschnitte vgl. Abb. 3, Versteifung durch Profilringe und Schotten, alles genietet. Außenhaut im Vorderteile des Rumpfes flache Nietköpfe, hinten leicht gerundete Köpfe.
Den Aufbau des Leitwerksendstückes zeigt Abb. '2. Wird mit vier Schrauben am hinteren Rumpfmittelstück befestigt.
Aufbau von Höhenflosse und Seitenruder vergl. Abb. 2.
Der Spitfire in Ganzmetallbauweise wird in Gemeinschaft mit Unterlieferanten, bei denen Einzelteile wie Flügel, Leitwerksteile, Fahrwerk hergestellt werden, in Serie gebaut.
Vorderteil des Rumpfes Heston Aircraft Ltd., Motorvorderbau Singer Motors.
Flügel Supermarine Works, General Aircraft Ltd., Pobjoy Aircraft und Airmotors Ltd., Querruder und Höhenruder Aero Engines Ltd., Seitenruder Pobjoy Airmotors und Aircraft Ltd., Klappen Heston Aircraft Ltd.
Gesamtmontage und Einfliegen in Eastleigh.
Spannweite 11,24 m, Länge 9,12 m, Höhe 3,35 m, Fläche 22 m2, Fahrwert Spurweite 1,73 m, Fluggewicht 2600 kg, Flügelbelastung 118 kg/m2, Leistungsbelastung 2,5 kg/PS. Höchstgeschwindigkeit in 4900 m Höhe 582 km/h, Reisegeschwindigkeit 530 km/h, Landegeschw. 110 km/h, Steigzeit auf 3350 m 4 min 8 sec, Aktionsradius 1000 km. Bestückung 8 MG.
Dornler Transozeanflugboot Do 26.
(Hierzu Tafel I.)
Um dem Fernstehenden einen Begriff von der Größe und inneren Ausgestaltung eines Ozeanflugbootes zu geben, bringen wir in nachstehender Tafel I einige Schnittzeichnungen der Do 26 (vgl. Typen-
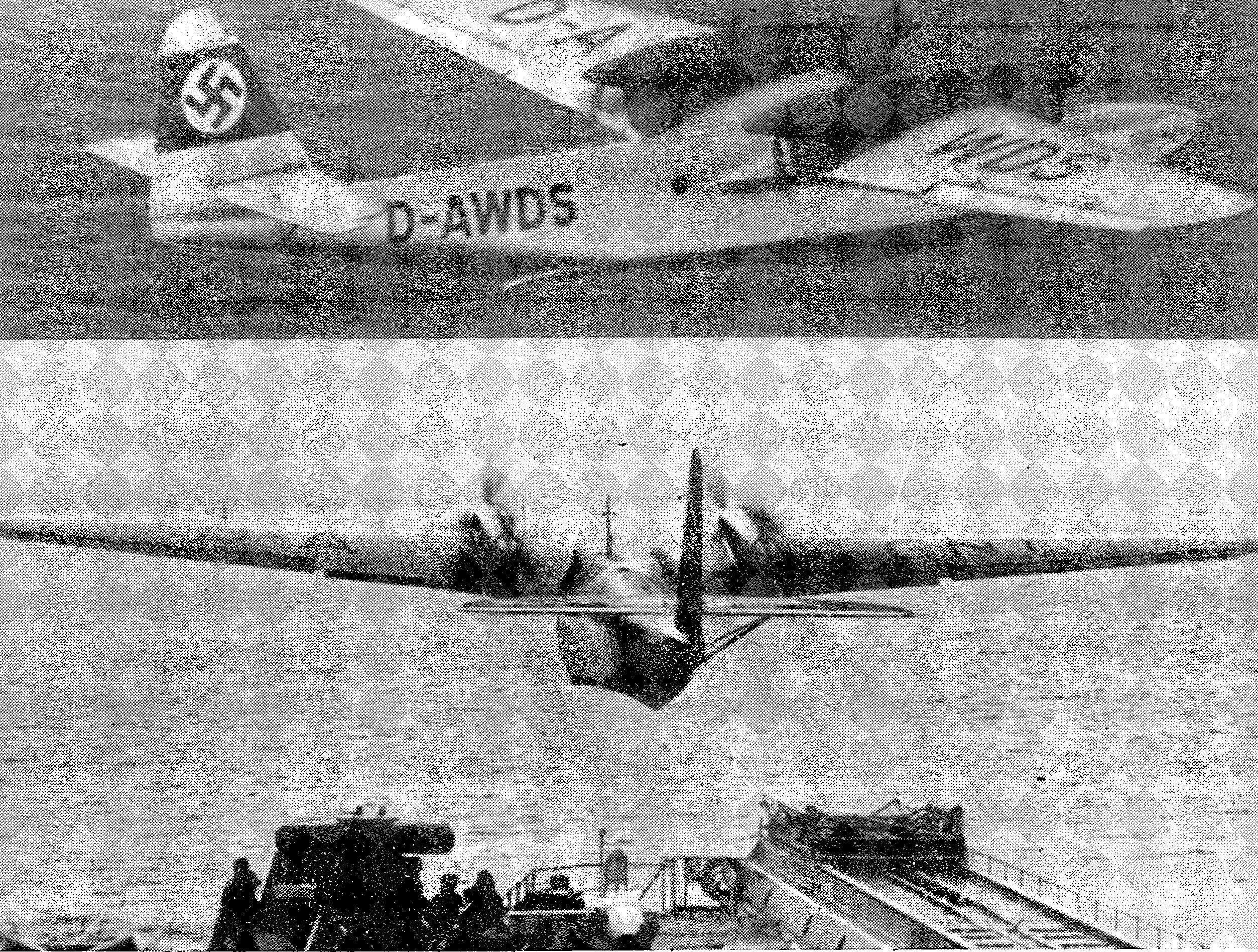
Transozeanflugboot Dornier Do 26. Unten: Nach dem Schleuderstart. Werkbilder
beschreibung „Flugsport" 1938 Heft 19, S. 505). Die Do 26, eine Weiterentwicklung der Do 18 und Do 24, soll im Transozean-Post- und Frachtflugverkehr eingesetzt werden. Die Vielseitigkeit der Einrichtung steht der eines Schiffes kaum nach. Das Boot mußte folgende Bedingungen erfüllen:
1. Bei kräftigem Gegenwind mit einer Fluggeschwindigkeit von 300 km/h und normaler Postladung eine Reichweite von Europa bis New York besitzen.
2. Gefahrloses Wassern auch auf hoher See.
3. Katapultstart; ein Selbststart auf dem Wasser braucht nur mit verringertem Fluggewicht ausgeführt zu werden.
4. Es sollte ein Gebrauchsboot und keine Spitzenleistung darstellen.
Bei 900 kg Postlast und 300 km/h Geschwindigkeit ist die Reichweite bei Windstille 9000 km, also eine Reserve, die unter allen Umständen ausreichend ist.
Durch die Tandemanordnung der vier Schwerölmotoren (Jumo 205, je 600 PS) ist es gut möglich, die Maschine auch bei Ausfall von 2 Motoren auf einer Seite ohne allzu großes Seitenruder in einwandfreiem Geradeausflug zu halten. Durch hintereinanderliegende Motoren geringerer Stirnwiderstand und bequeme Zugänglichkeit zu allen Motoren, auch während des Fluges. Leitungen und Gestänge sind übersichtlich und leicht erreichbar verlegt. Der Zugmotor liegt vor der Flügelnase. Die Dural-Tragkonstruktion des vorderen Motorgerüstes ist mit ihrem vorderen Abschlußspant auf den Vorderholm aufgesetzt, während der hintere Abschlußspant auf zwei Hauptrippen gelagert ist. Die Druckmotoren, zwischen den beiden Holmen, bilden mit Motorbock, Verlängerungswelle und Gerüst zu deren Abstützung eine konstruktive Einheit, die in der Nähe ihres Schwerpunktes, über dem Hinterholm, drehbar gelagert ist. Die Verstellung geschieht mittels elektr. betriebener Spindeln, die in der vorderen Aufhängung angreifen, wo das Aggregat in einfachen Gleitschienen geführt wird. Wasser-
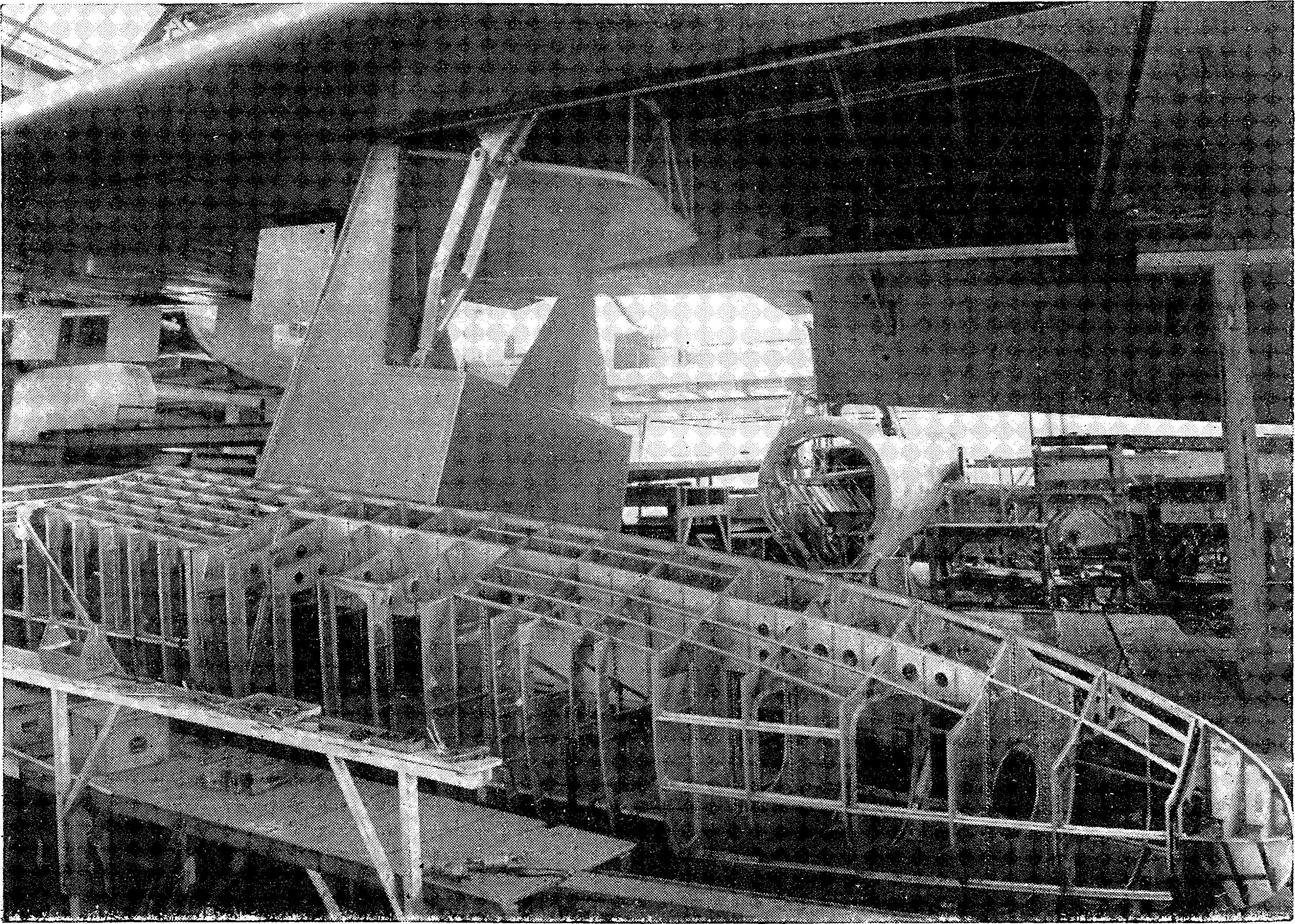
Transozeanflugboot Dornier Do 26. Seitliche Stützschwimmer ausgefahren.
Unten: Spantaufstellung vom Boot. Werkbild
und Oelkühler hängen seitlich unter den Motoren (s. Taf.) und sind durch Klappen sowohl elektr. als auch im Notfall von Hand zu regulieren (Schnitt H).
Flügel: Spannweite 30 m, Pfeilform mit gerader Hinterkante, Streckungsgrad: 7,5 (Do 18 — 6,2), Flächenbelastung 166,7 kg/m2 (Do 18 — 102 kg/m2). Der V-förmige Ansatz bezweckt ein Höherlegen der Motoren (der hintere Motor wird beim Start außerdem noch
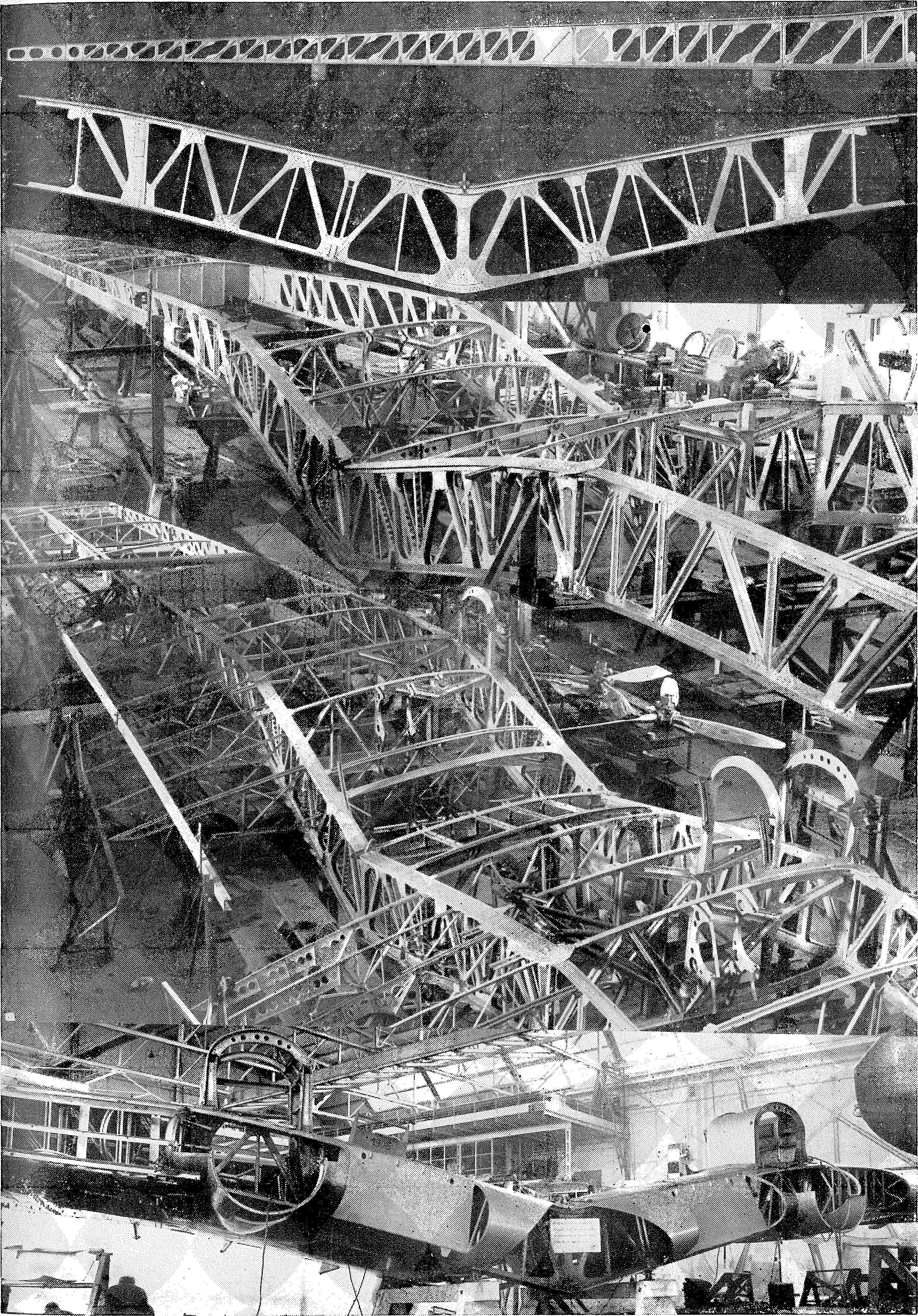
Viermotor. Transozeanflugboot Dornier Do 26. Flügelbau. Von oben nach unten: Höhnende, Holmmittelstück. Mitte: Flügelgerippe, Ansicht schräg von vorn und schräg von hinten. Unten: Flügelmittelstück. Werkbilder
10° nach oben geschwenkt) und eine günstige Führung der Strömung um die Flügelinnenteile. Flügel in drei Teile zerlegbar, Motoren vom Mittelstück getragen. Reiner Zweiholmer mit tragendem Kasten, Nasen und Endrippen angesetzt. Glattblechhaut aus Schwimmfähigkeitsgründen teilweise dicht genietet. Holme als Fachwerkträger gebaut. Der Flügel ist an vier Punkten am Bootsrumpf aufgehängt.
Der Rumpf besitzt zwei bis etwa zur hinteren Stufe durchlaufende, als Blechwandträger ausgebildete Kielträger. Im Bereich des Flügelmittelstückes ist der Bootskörper als Kraftstoffbehälter ausgebildet. Außer Verringerung des Raumbedarfs und der damit verbundenen Gewichtsersparnis kann das Boot leichter gehalten werden, da bei der Wasserung mit vollen Behältern die angreifenden Wasserkräfte mit den Massenkräften des Kraftstoffes in unmittelbarem Gleichgewicht stehen ohne Zwischenbeanspruchung der Bootskonstruktion.
Einzieh-Stützschwimmer an Stelle der bekannten Dornier-Stum-mel, die einen breiten Rumpf bedingen, verbesserten die aerodynamische Form wesentlich. Das kommt besonders in dem schmalen Rumpf zum Ausdruck. Als Anhalt für die Gleitbodenbelastung eines Bootes gilt das Verhältnis Fluggewicht : Hauptspannweite, bei Do 26 = 80 kg/cm (beim Empire-Boot: 60,4 kg/cm, bei 131,5 kg/cm2 Flächenbelastung). Die stufenlosen neuartig durchgebildeten Stützschwimmer werden zwischen die beiden Holme eingezogen. Sie sind als biegungssteife Blechkörper mit tragender Haut ausgeführt (hydraul. Einziehvorrichtung s. Schnitt G. Tafel I).
Einrichtung und Ausrüstung sind nach den von der Deutschen Lufthansa bei ihren Ozeanflügen gesammelten Erfahrungen ausgeführt. Führer, Funker und Maschinist sind in einem Raum untergebracht. Besondere Bequemlichkeiten, wie Betten (s. Schnitt E), verstellbare Führersitze, bei denen die Führer eine Ruhelage einnehmen können, ohne ihren Platz verlassen zu müssen, selbsttätige Kurssteuerung, die durch Vollsteuerung ersetzt werden kann usw. sind vorgesehen. Die Kabinen werden geheizt, was auf den langen Ozeanflügen ja unerläß-
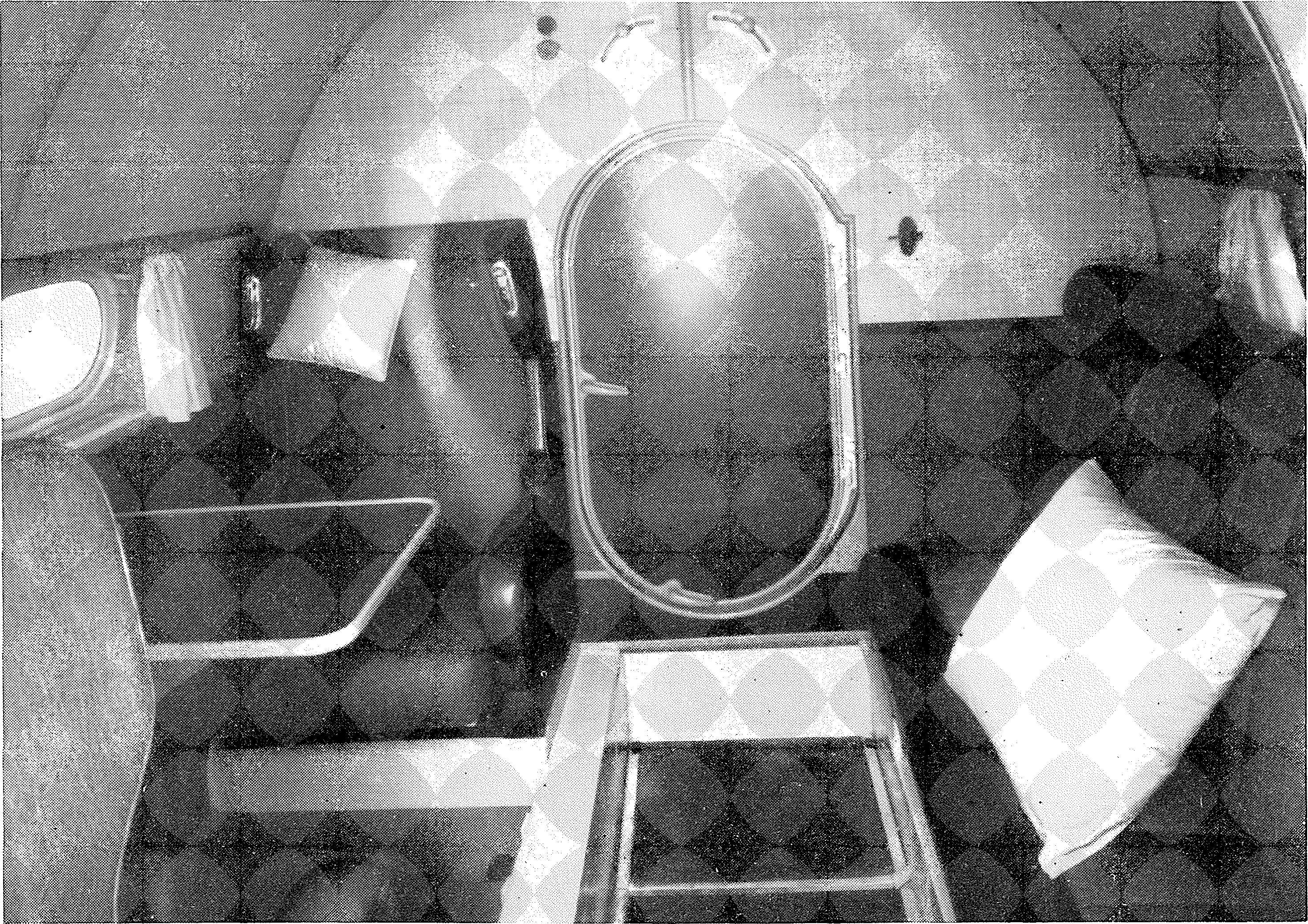
Transozeanflugboot Dornier Do 26. Eine der neuen Passagierkabinen.
Rechts: Schlafstätte. Werkbild
r
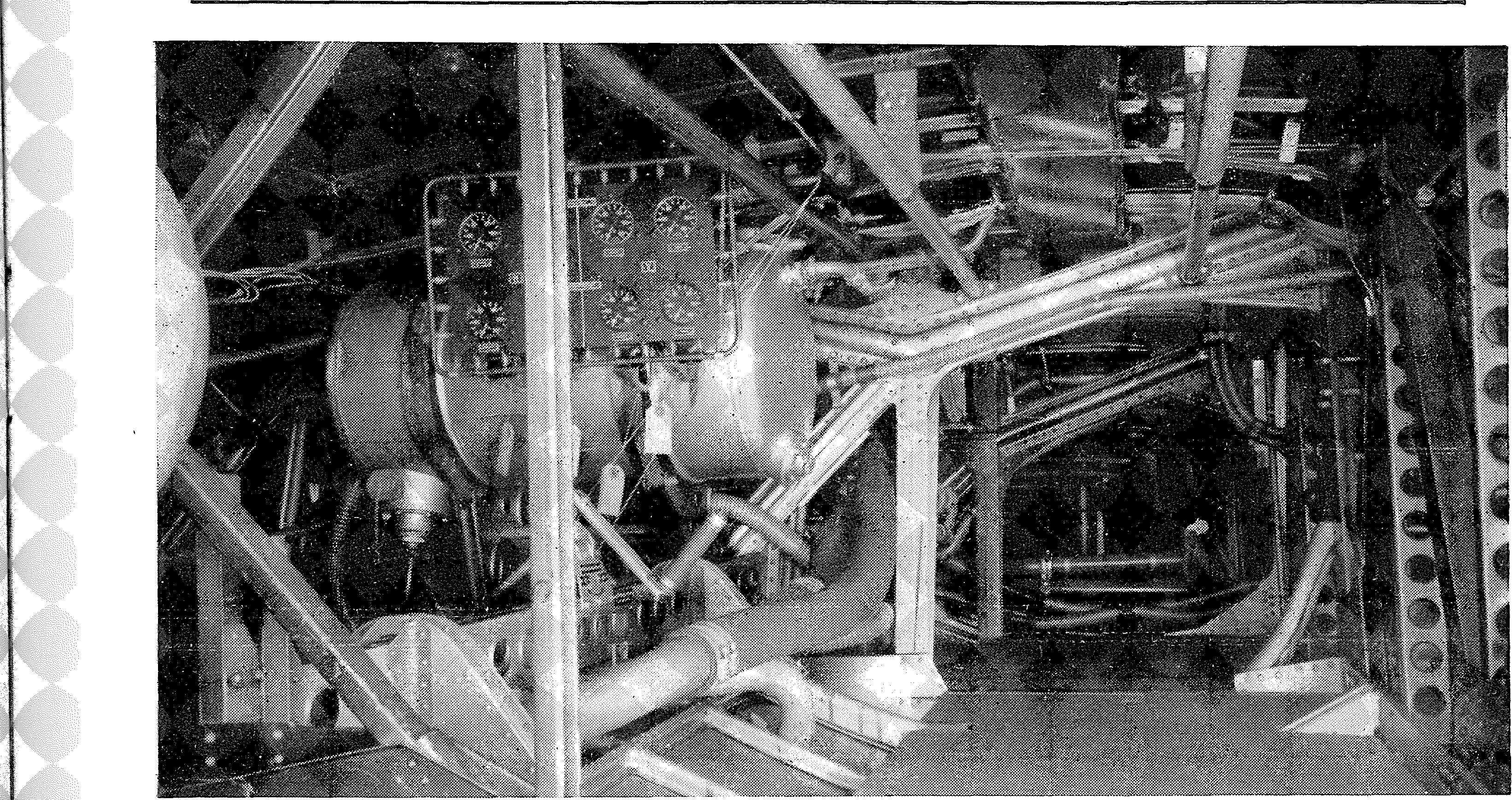
Transozeanflugboot Dornier Do 26. Kriechgang nach den Motoren. Werkbild
lieh ist. Die gesamten Instrumente für Triebwerk-, Kraft- und Schmierstoffanlage, auf einem besonderen Anzeigebrett untergebracht, werden vom Maschinisten überwacht. Zur Sicherheitsausrüstung gehören u. a. Schlauchboote, Schwimmwesten, Notproviant und Notsendegerät.
Engl Caunter, Typ C, 60 PS Flugmotor.
In England rechnet man bei kleinen Motoren ungefähr als Preis in £ das Doppelte in PS-Stärken. Bei vorliegender Zweitaktkonstruktion von 60 PS hofft man infolge der einfachen Konstruktion gegenüber dem Viertaktmotor mit 80 £ auszukommen.
Der Zweitakter, Konstrukteur C. Caunter, Farnborough, soll sich bis auf 500 U ohne zu knallen drosseln lassen. Verträgt 500 Betriebsstunden und dann normale Ueberholungszeit 2 Std.
Betriebsstoffverbrauch bei 50 PS 14,75 1/h. Oelverbrauch 0,568 1/h.
Kurbelgehäuse Elektron, enthält vier getrennte Kurbelkammern. Die beiden Kurbelhälften werden durch 4X4 = 16 gleichzeitig die Zylinderflanschen fassende Schrauben zusammengehalten. Welle in 8 Rollenlagern gelagert. Pleuel stahlgeschmiedet, Rollenlager.
Zylinder Leichtmetall, eingeschraubte Bronzebuchsen für die Zündkerzen. Schmierung durch Niederdruck-Oelpumpe. Betriebsstoff 77 Oktan. Zenithvergaser. Doppelzündung, B. T. H.-Magnete. Automatische Zündmomentverstellung.
Kompressionsverhältnis 10 : 1. Auspuff und Vergaserleitung auf der rechten Seite, nahe aneinanderliegend. An der unteren Kurbelgehäusehälfte Flanschen zur Befestigung an dem Motorbock.
Engl. Flugmotor Caunter Typ C, 60 PS.
Werkbild
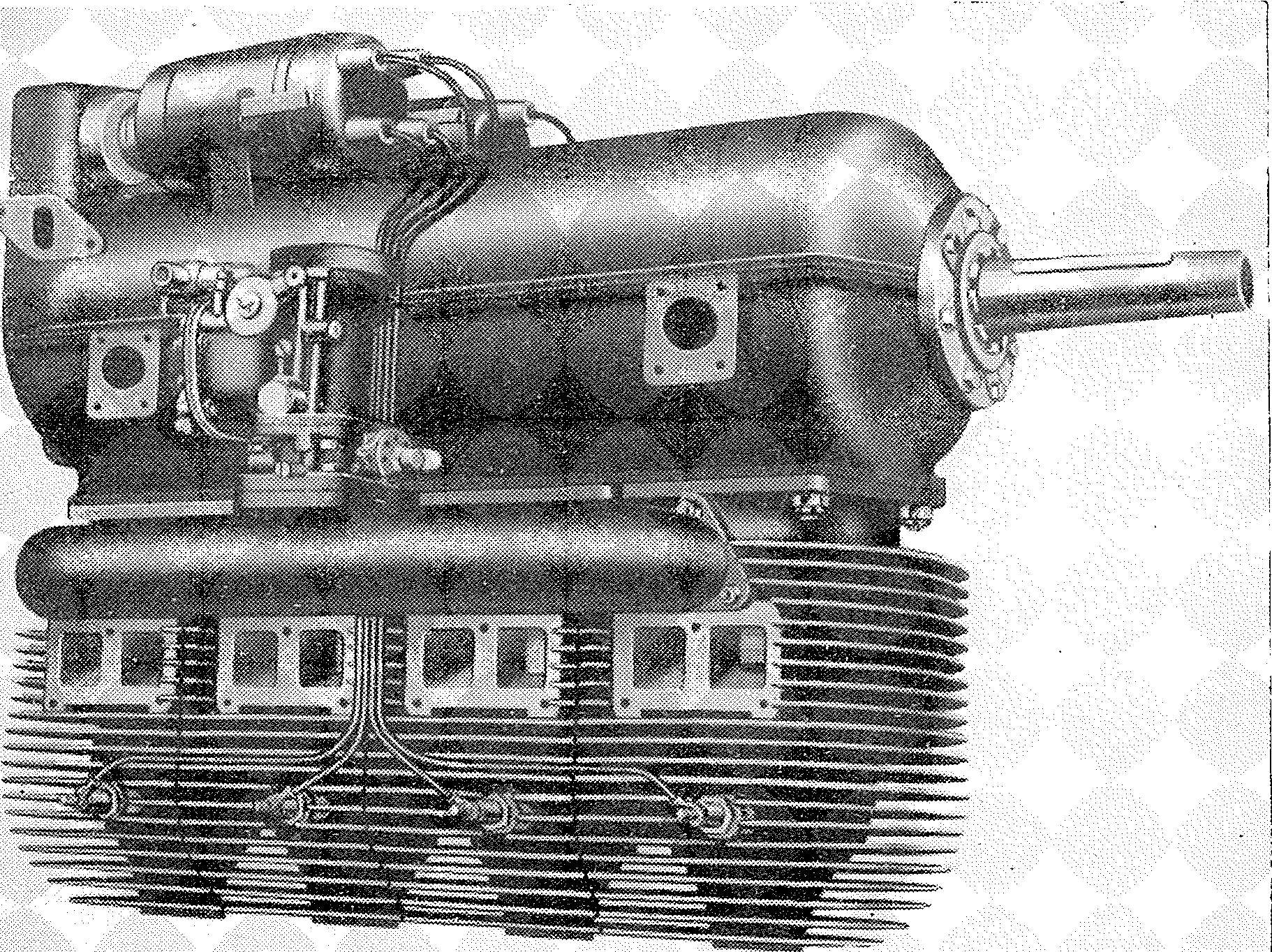
1
i
Am hinteren Ende der Kurbelwelle und des Gehäuses einfacher Stirnradantrieb für Betriebsstoffpumpe, Drehzähler, Oelpumpe, Magnet. Elektrischer Starter kann eingebaut werden.
Bohrung 82 mm, Hub 100 mm, 2,3 1, max. Leistung 60 PS bei. 2700 U, Normalleistung 50 PS bei 2400 U. Gewicht 53,5 kg.
USA-Flagzeug-Maschinenkanorie.
1936 veröffentlichten wir auf Seite 423 des „Flugsport" einige Abbildungen der 37-mm-Abwehr-Maschinenkanone für Bombenflugzeuge, und 1937 auf Seite 52 brachten wir eine Beschreibung der drei von der amerikan. Armement Corporation versuchten 37-mm-Kanone von 740, 1110 und 1850 mm Rohrlänge. Heute sind wir in der Lage, noch folgendes nachzutragen.
Die AAC 37-mm-Flugzeug-Maschinenkanone, Type M, ist für Bomber zur Abwehr gegen Jagdflugzeuge mit 20 oder 25-mm-Kanone gedacht. Diese M-K kann im Bug des Rumpfes oder hinter den Flügeln oberhalb des Rumpfes in einem Drehturm montiert, mit durchsichtiger Kuppel, untergebracht werden.
Drehbar um 360°, schwenkbar 15° nach unten und 60° nach oben.. Einbau zeigen die nebenstehenden Abbildungen. Kanone mit Sitz in einem horizontalen Ring drehbar, Kanone und Sitz drehen sich zusammen. Betätigung durch Handkurbel mit der rechten Hand. Höhenverstellung durch Handrad linker Hand. Schütze sitzt seitlich links von der Kanone. Das Okular mit großem Gesichtsfeld für die Visiereinrichtung bleibt unverändert zur Stellung des Schützen.
Für Feststellung des Drehturmes Arretiervorrichtung mit Betätigung des rechten Fußes. Abzug für die M-K mit dem linken Fuß.. Vergleiche Abbildung. Magazin für 5 Schuß. Automatische Schußfolge. Letzter Schuß kann nur abgefeuert werden, wenn neues Magazin eingeführt ist.
Hydraulischer Zylinder kann mit automatisch arbeitender Heizvorrichtung für größere Höhen versehen werden.
Für Nahverteidigung wird außer Sprenggranaten eine Munition mit Schrapnellwirkung benutzt.
Kaliber 37 mm (Länge 740 mm), Rohrrücklauf 254 mm, Rückstoß 455 kg, Feuergeschwindigkeit 125 Schuß/Min. (Ladegeschwindigkeit nicht angegeben). Rückstoßaufnehmer kombiniert hydraulisch mit Federn. Geschoßgewicht 0,5 kg. Treibladung 2453 g, fünf Kartuschen
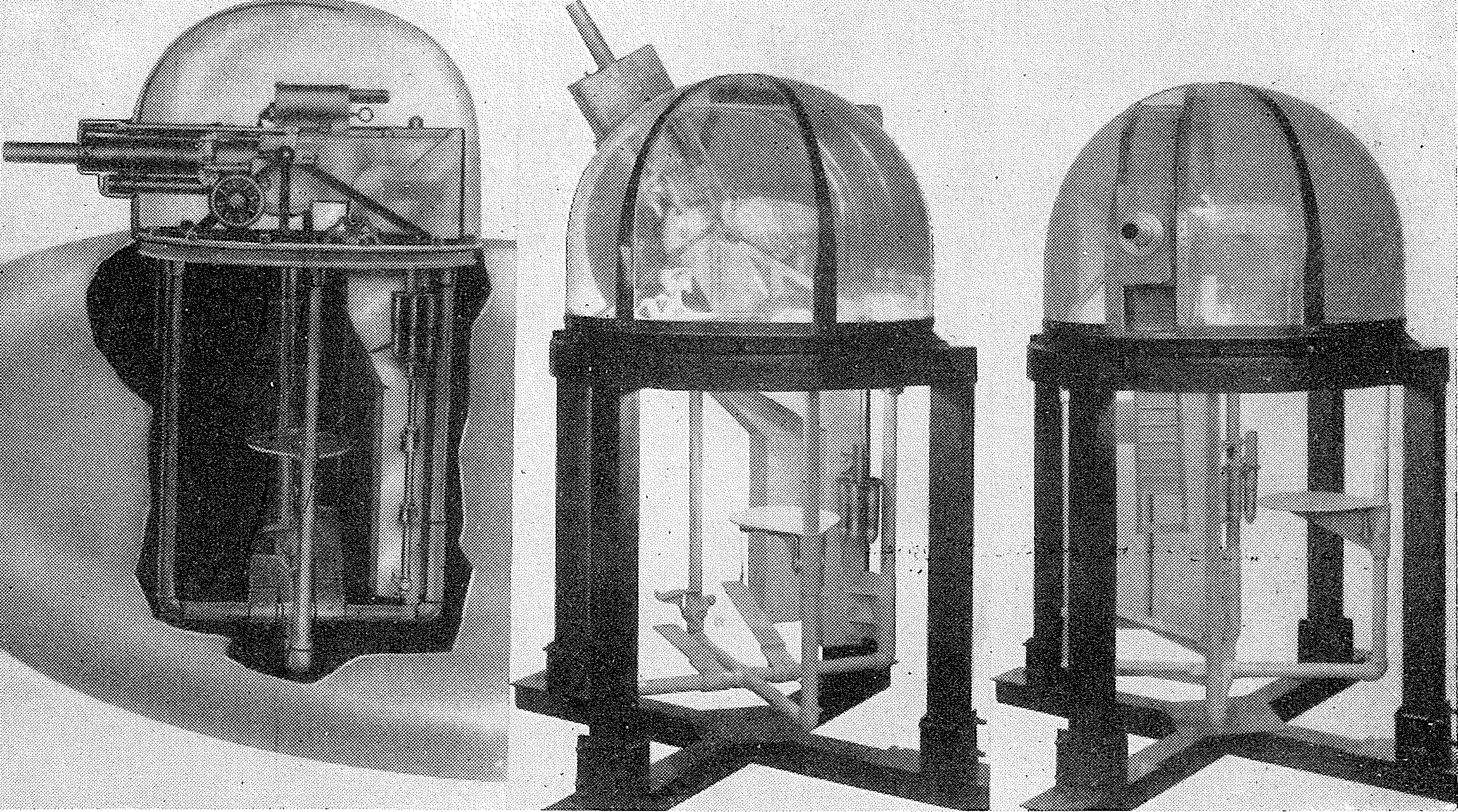
USA-Flugzeug-Maschinenkanone AAC 37 mm Type M. Werkbild
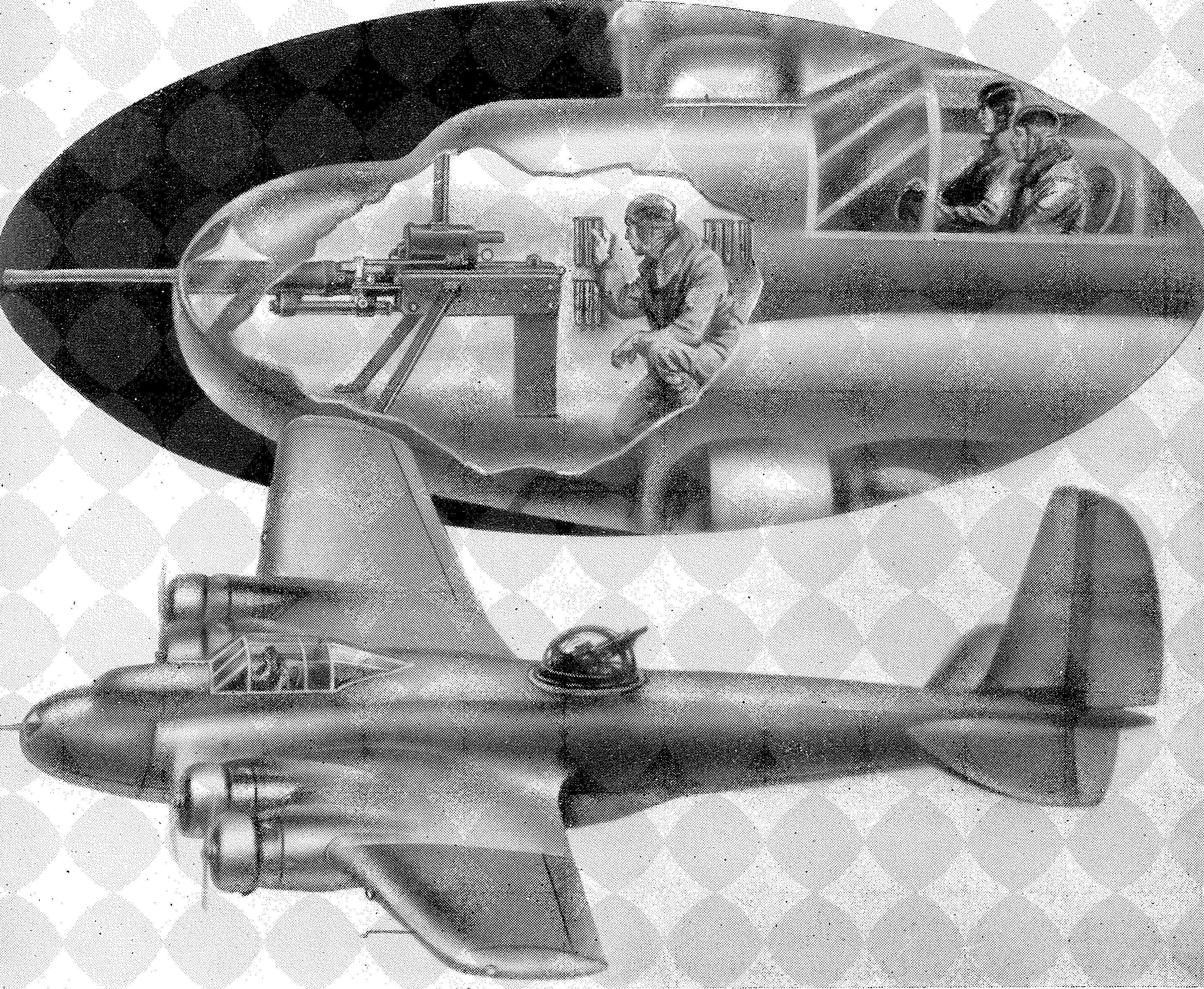
USA-Flugzeug-Maschinenkanone AAC 37 mm Type F. Werkbild
3,8 kg. Mündungsgeschwindigkeit 381 m/sec. Gewicht komplett mit Einbauteilen 113,6 kg, ohne Einbau 61 kg.
Das schon 1937 von uns beschriebene Modell F mit 1850 mm Rohrlänge für festen Einbau hat bis heute keine wesentlichen Aende-rungen erfahren. Nebenstehende Abbildung zeigt die 37 mm Type F, fest eingebaut in der Nase eines Bombers.
Kaliber 37 mm (Länge 1850 mm). Mündungsgeschwindigkeit 823 m/sec, Geschoßgewicht 0,50 kg, Rohrrücklauf 381 mm, Rückstoß 771 kg, Gewicht ohne Einbau 163,3 kg, Feuergeschwindigkeit 90 Schuß/Min. Gesamtlänge der Kanone einschließlich Rücklauf 2,54 m.
FLUG
UrtDSCHAl
Inland.
Staatssekretär der Luftfahrt Generaloberst Milch begab sich am 24. 5. im Flugzeug mit einer deutschen Offiziersabordnung nach Rom, wo er von Staatssekretär General Valle und seinem Offiziersstab empfangen wurde. Am Abend fand im Fliegerhaus zu seinen Ehren ein Essen statt. Am folgenden Tag besuchte Generaloberst Milch mit der deutschen Abordnung in Begleitung des italienischen Unterstaatssekretärs für das Flugwesen, General Valle, die Fliegerstadt Gui-donia, wo die Anlagen und Versuchsstationen besichtigt wurden. Am 26. 5. wurde Generaloberst Milch in Begleitung der deutschen Offiziersabordnung von Mussolini im Palazzo Venezia empfangen.
BV 222 von Blohm & Voß, Konstrukteur Dr.-Ing. Richard Vogt, ist ein neues 45 Tonnen-Großflugzeug, das bei einer Reichweite von 7000 km in etwa

20 Flugstunden auf der Strecke Lissabon — New York eingesetzt werden und mit Beginn nächsten Jahres betriebsfertig sein soll.
Deutschland—Tokio-Flug ist beendet. Die Ju 52 „Hans Loeb", die am 12. 5. auf dem Flugplatz Haueda bei Tokio gestartet war, ist am 22. 5. mit der Besatzung Flugkpt. Helm, Oberflugzeugfunker Kober und Oberfunkmaschinist Wolschke in Tempelhof wieder eingetroffen. Der Direktor der Lufthansa, Freiherr v. Gablenz, der an dieser Expedition teilnahm, hatte die Mannschaft in Hongkong verlassen, um die amerikanische Pazifiklinie zu studieren. Flugkapitän Helm bestätigte, daß Motor und Maschine sich ausgezeichnet bewährt hätten. Bei der Ankunft nach 60 reinen Flugstunden in Tokio sei keinerlei Reparatur notwendig gewesen. Die Ueberwindung der Strecke nach Tokio, im ganzen etwa 34 000 km, böte heute keinerlei Schwierigkeit mehr, so daß mit einem Flugverkehr mit dem Fernen Osten bald zu rechnen sei. Ueberau waren die Deutschen mit großer Begeisterung empfangen worden. Tsuneo Kodama, der Präsident der Manchuria Aviation Co. Ltd., hieß auf dem Flugplatz Hsinking Freiherr v. Gablenz und seine Begleiter in der Hauptstadt der Mandschurei als Besatzung des ersten ausländischen Flugzeugs zu ihrem ersten Besuch willkommen. Kodama wies darauf hin, daß Freiherr v. Gablenz schon einmal die große Strecke von 14 000 km flugplanmäßig zurückgelegt habe, und daß dieser Besuch die Freundschaft zwischen den beiden Antikominternmächten, Mandschukuo und Deutschland, noch verstärken werde. Freiherr v. Gablenz wurde mit der 3. Klasse des „Ordens vom Heiligen Schatz" ausgezeichnet.
I. Intern. Flugwettbewerb f. Journalisten, Rom 4. 6. 39. (Vergl. „Flugsport" 1939, S. 190/91 „I. Weltkongreß d. Luftfahrtpresse, Rom"). Vertreter der deutschen Mannschaft Ob.-Reg.-Rat Dr. Orlovius. Teilnehmer:
1. D-EJZK: Kl 25 Flgzf. Seyboth, Schriftl. „Der deutsche Sportflieger", Bgl. Re-chenberger.
2. D-EEJD: Si 202 Flgzf. Winkler, Schriftl. „Modellflug", Bgl. NSFK.-Stbf. Anders.
3. D-ESFO: Kl 32 Flgzf. Heibig, Ob.-Reg.-Rat i. Reichsmin. f. Wissensch., Erzieh, u. Volksb., Bgl. Schulze, Pressest. RLM.
4. D-EPBC: Ar 79 Flgzf. Matthaei, Aero-Cl. v. Deutschi., Bgl. Dr. Orlovius, Ob.-Reg.-Rat, RLM Pressest.
5. D-EPKX: Si' 202 Flgzf. Glardon v. Siebel-W., Bgl. Dr. Kredel, „Völkischer Beobachter", Bln.
6. Erla 5D Flgzf. Tidick, „Königsberger Allgemeine Zeitung".

Ein Vortrupp vom Stab der Legion Condor in Hamburg. Weltbild Die Kameraden der Luftwaffe betrachten interessiert die Auszeichnungen.
7. D-EOYG: Si 202 Flgzf. Liebscher, , Ciaassen, Schriftl. „Wehrfront".
8. D-EDFQ: Si 202 Flgzf. Wellershaus, schach.
9. D-EMIR: Kl 32 Flgzf. Nitschke, Bgl.
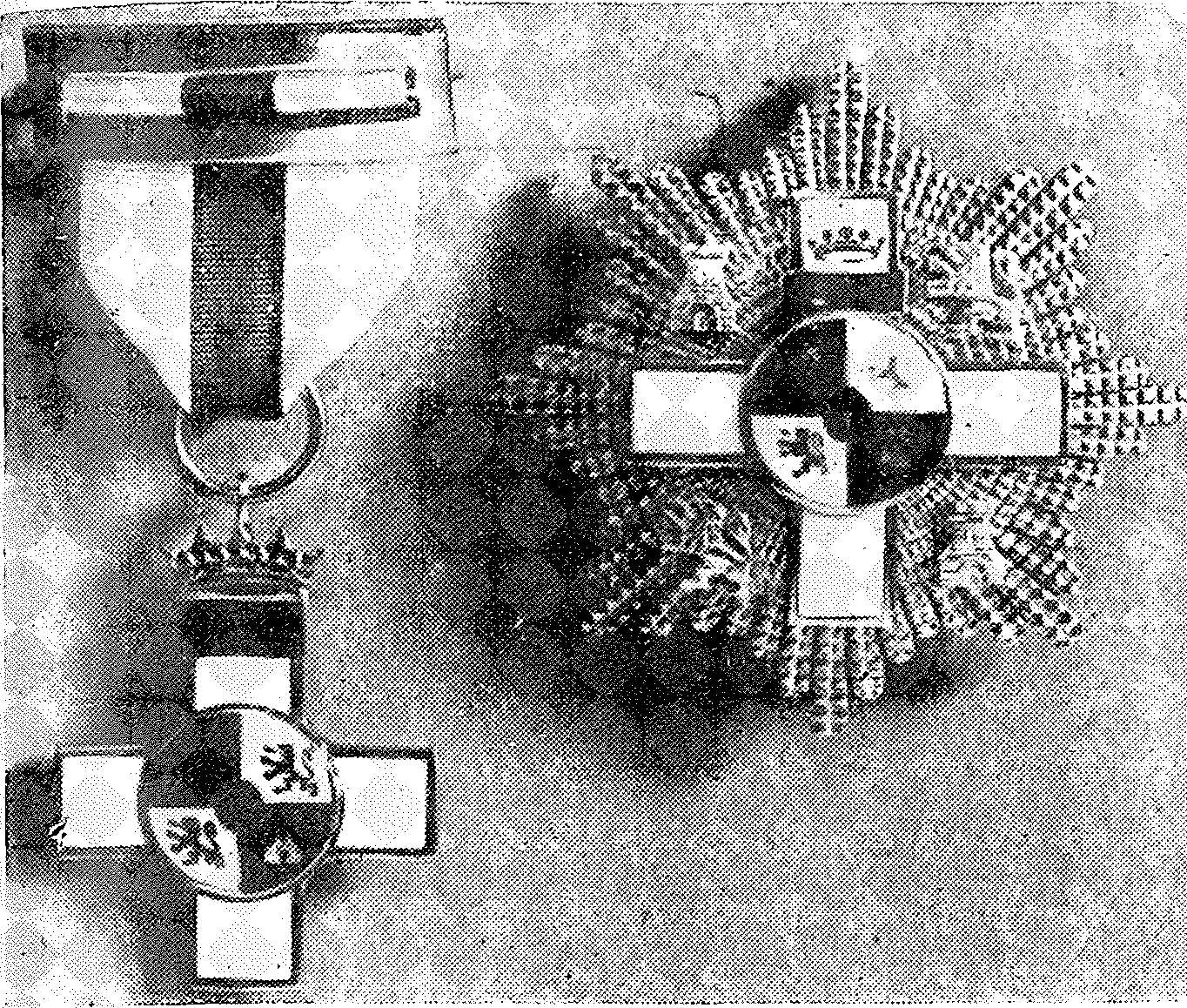
Abb. oben: Spanische Auszeichnungen für die deutschen Freiwilligen. Rechts die 3. Klasse des Weißen Militärverdienstkreuzes in Gold. Links die 1. Klasse dieser Auszeichnung. 2. Klasse wird in
Silber getragen. Abb, rechts: Spanische Auszeichnungen
für die deutschen Freiwilligen. Oben links die Militärmedaille (1. Klasse und niedrigste Stufe), oben rechts das Militärkreuz 2. Klasse. Unten links das Rote Militärverdienstkreuz 3. Klasse und unten rechts das Feldkreuz 4. Klasse und höchste Stufe. Weltbild
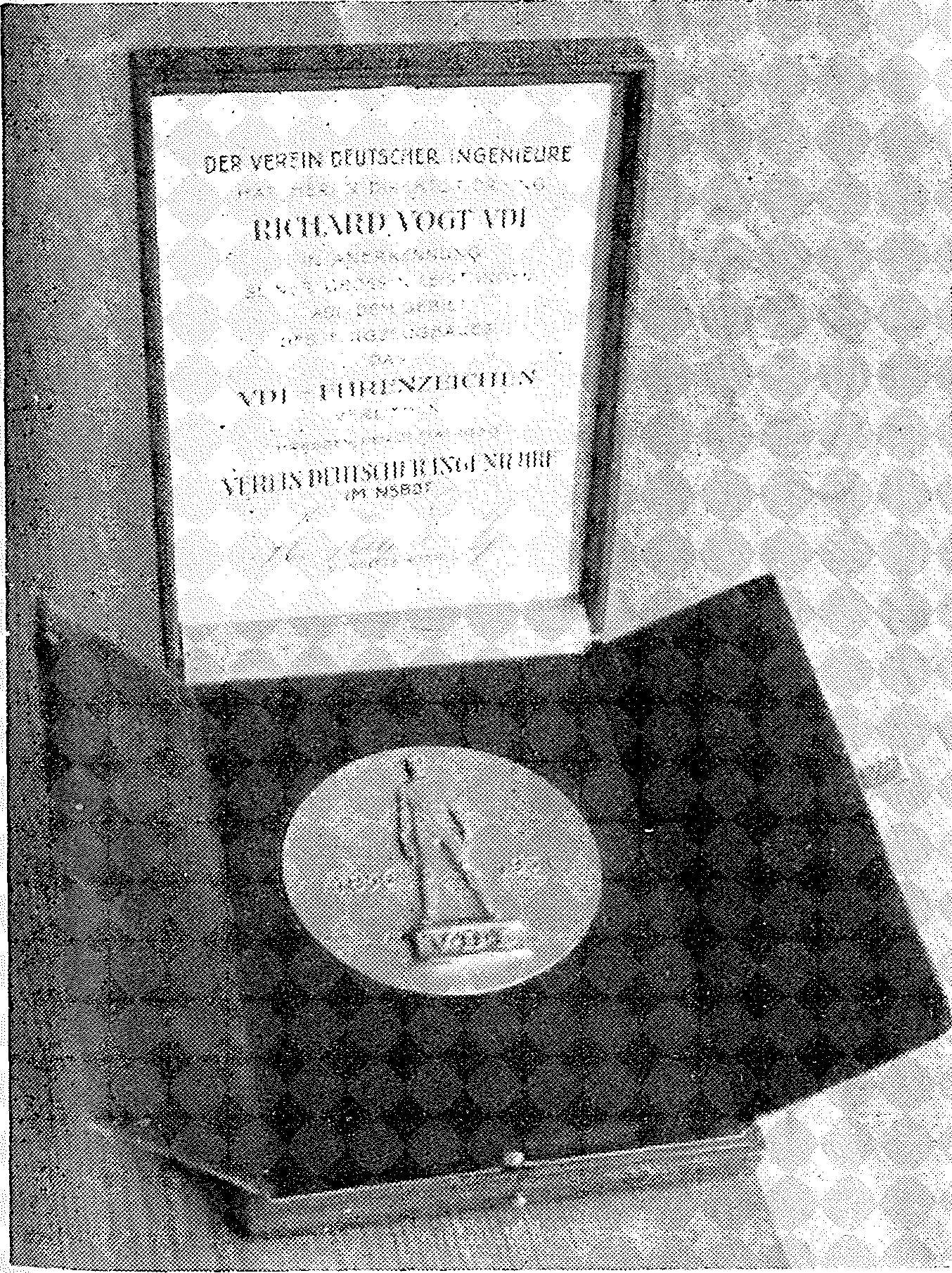
VDI-Ehrenzeichen für Dr.-lng. Vogt.
Abb. unten: Das Deutsche Spanienkreuz mit Schwertern, das in Bronze, Silber und Gold den Spanienfreiwilligen verliehen wurde. Weltbild (3)
,Fränkische Tageszeitung" Nürnberg, Bgl. NSFK, Bgl. Dr. Keller, Ztgsd. Graf Rei-Jentkiewicz, Hauptschriftl. „Die Luftreise".
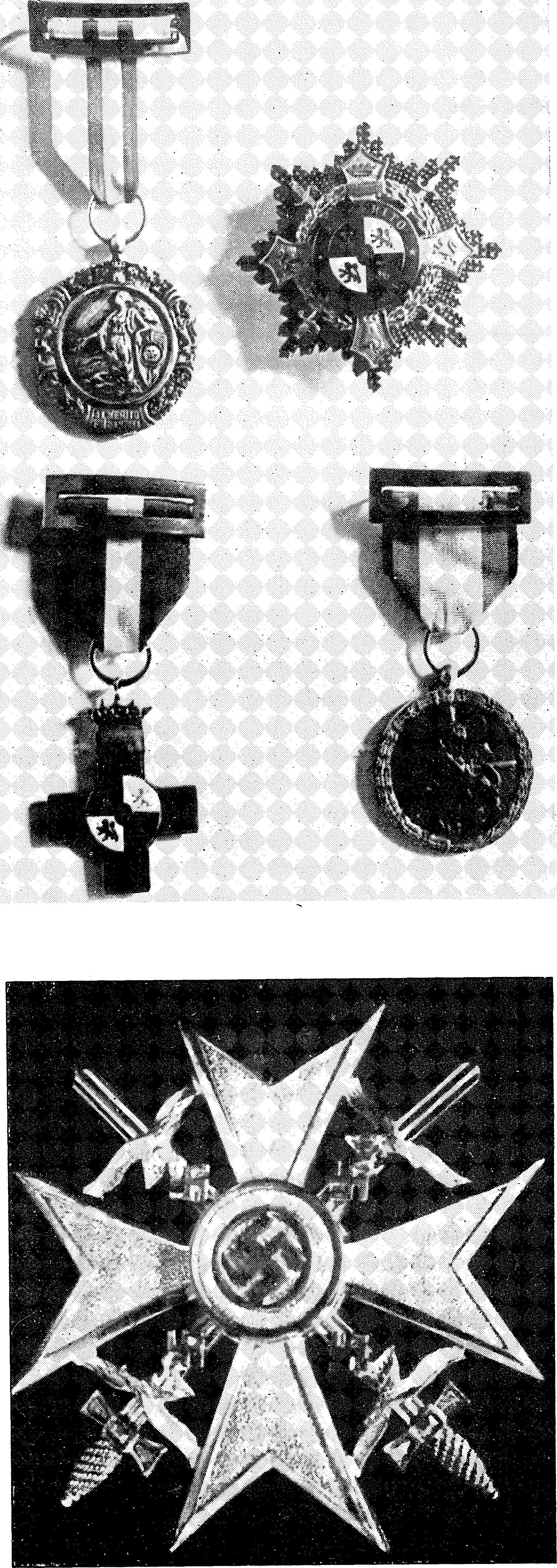
Franz Klasen, Vors. des Vorst, d. Deutsch-Amerikanischen Petroleum-Gesellschaft am 27. 5. 60 Jahre alt.
Was gibt es sonst Neues?
Dr.-Ing. Richard Vogt, Chefkonstrukteur und Direktor der Abt. Flugzeugbau bei Blohm & Voß, wurde von Dr.-Ing. Todt das VDI-Ehrenzeichen verliehen. Aufermann auf Erla von Afrikaflug zurück.
Stürmer mit Zündapp kostet 7650.— Mark, mit Seidmotor 6850.— Mark. Royal Aeronautical Society, Mr. Fedden, Präsident der Gesellschaft, wurde für 39/40 wiedergewählt.
Ausland.
Short 14438 „Stratosphären-Airliner", Mitteldecker, bestimmt für Höhenflug in 7500 m, mittlere Geschwindigkeit 450 km/h, 6 Fluggäste und erhebliche Frachtlast, Aktionsradius 4800 km, im Auftrag des Air Ministry, im Bau.
Engl. Bristol-Beaufort-Zweimotor, Bristol Taurus 14 Zyl. Schiebermotor, Geschwindigkeit angeblich 480 km/h. Wird in England im Serienbau mit Unterlieferanten, Endmontage Bristol, aufgelegt. Mitteldecker, Ganzmetallbau, 4 Mann Besatzung. Hydraulisch betätigte Landeklappen. Fahrwerk und Schwanzrad einziehbar. Der Beaufort soll auch in Australien in Serie gebaut werden.
Engl. Empire-Airday, veranstaltet auf 63 RAF.-Stationen, brachte 850 000 Besucher.
Engl. Flugzeugkonstrukteure besuchten französ. Flugzeug-Industrie. Führer Mr. Handley-Page, Präsident der British Aircraft Constructors, und Sir Bruce-Gardner. Besucht wurden: die Societe Nationale de Constructions Aeronautiques du Sud-Est in Clinchy, Societe des Moteurs Gnome et Rhone, Paris, die S. N. C. A. du Nord in Meaulte, die S. N. C. A. du Ouest in Nantes-Bouguenais, die S. N. C. A. du Centre in Bourges und die S. N. C. A. du Sud-Ouest in Chateauroux.

Langstrecken-Luftverkehrs-Erkundungsflüge nach der Mandschurei. Oben: Die von Frhrn. v. Gablenz geführte Ju 52 auf dem Flugplatz in Mukden. Darunter von vorn nach hinten: „Hayabusa" Manchoukuo, Heinkel „Togo-Go" Nippon, Ju 52 v. Gablenz. Unten: Heinkel „Togo-Go". Archiv Flugsport
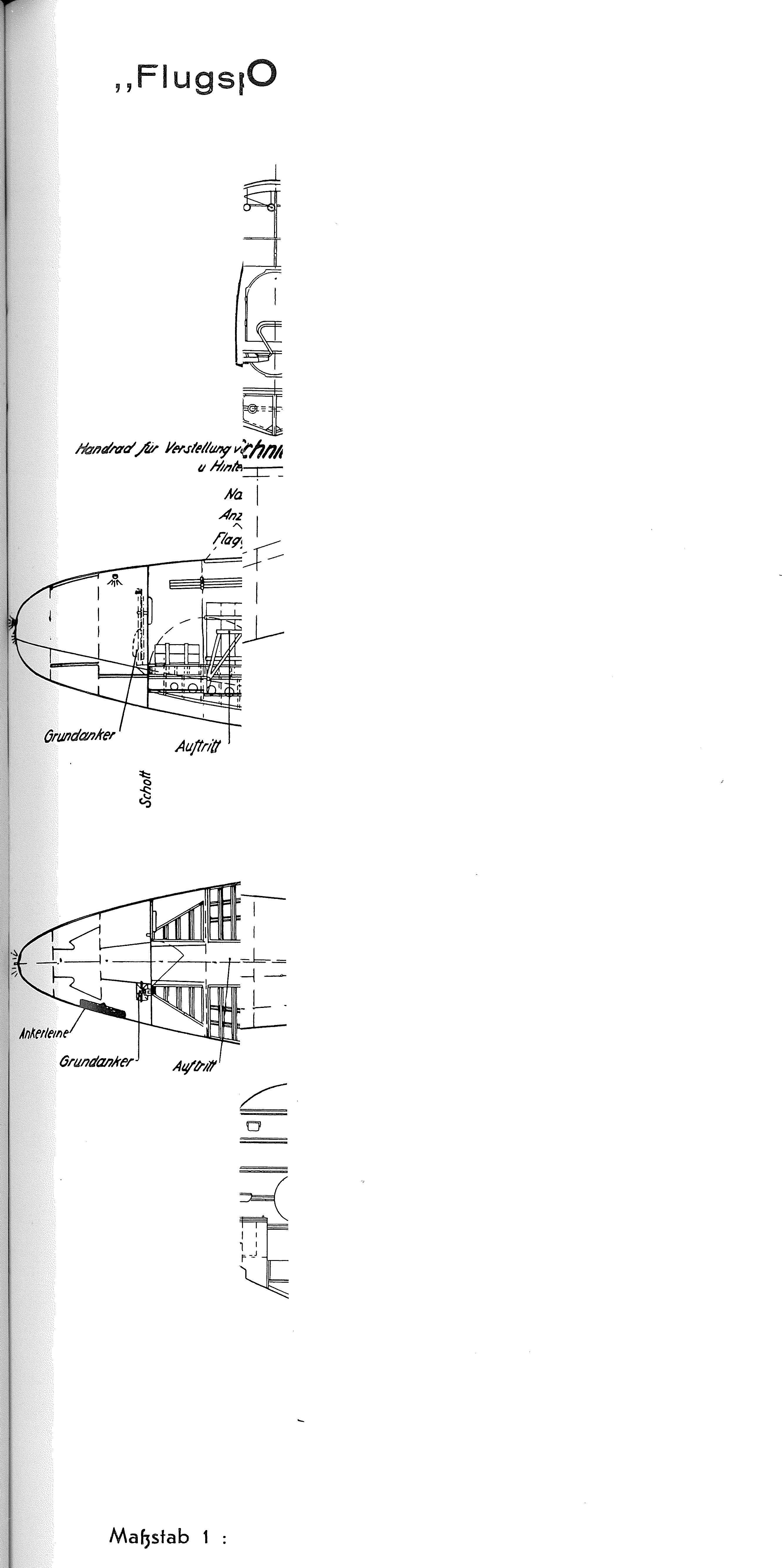
Zeichnung „F
^Flugsport" 1939, XXXI. Jahrgang
Dornier Transozean-Flugboot Do 26
Tafel I
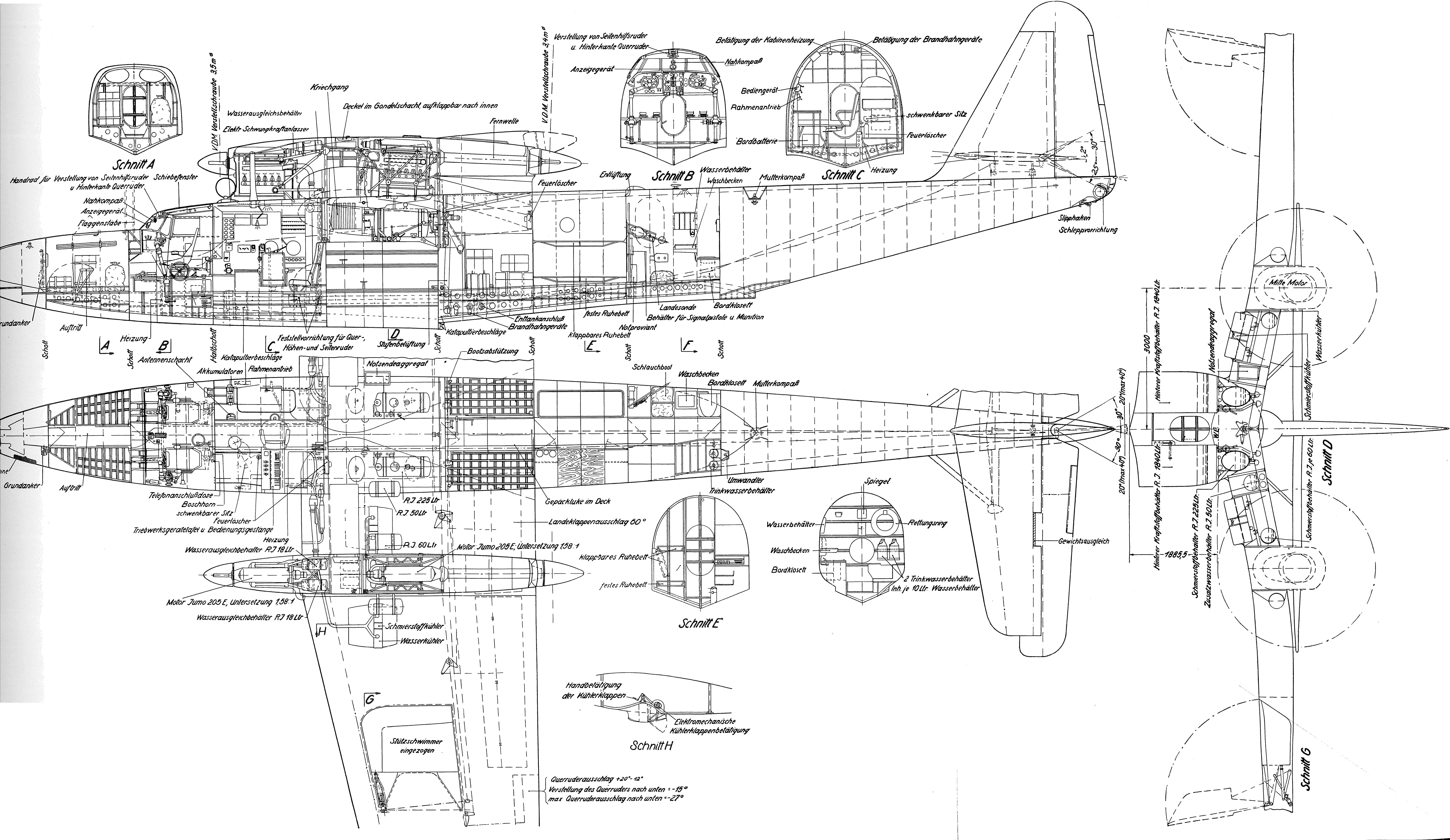
Maßstab 1 : 75
hnung „Flugsport"
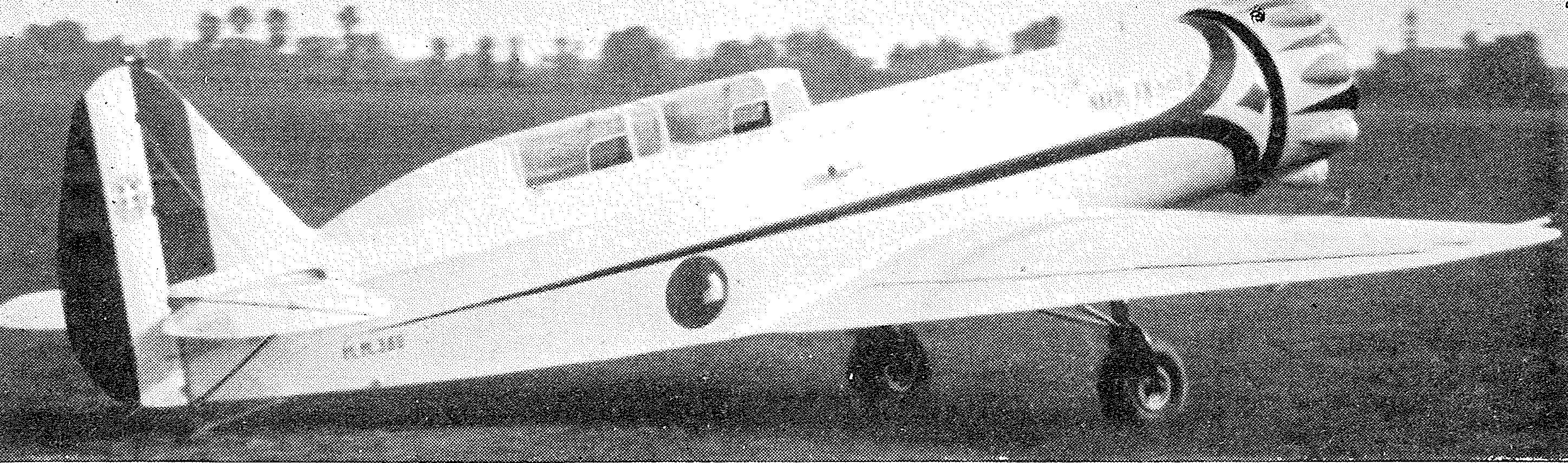
Ital. Sportflugzeug Nardi 305 D, welches im Ohnehaltflug Rom—Addis Abeba,
4500 km, flog. Archiv Flugsport
Constant Speed Airscrews Ltd., baut VDM-Verstellschrauben in Lizenz.
Imperial Airways Stadtbüro ab 5. 6. Buckingham Palace Road, früher Victoria Station, London.
Irish Sea Airways bestellte bei Lockheed zwei Lockheed 14 Verkehrsflugzeuge für ihre Linie Dublin—London.
Tanken in der Luft wird ausgeführt, um zu vermeiden, daß das Flugzeug für den Fernflug mit Vollast startet. Untenstehende Abbildungen zeigen unten: das viermotorige Langstreckenflugboot „Cabot" der Imperial Airways und darüber das Tankflugzeug R. A. F. Harrow. Von oben nach unten: Tanker wirft den Schlauch ab. Der Schlauch wird in das Flugzeug eingezogen. Die beiden Flugzeuge während des Tankens.
Lieutenant-de-Vaisseau-Paris flog von Biscarosse nach New York. Start Biscarosse am 16. 5. über Lissabon ,Azoren, Bermuden, Landung in New York am 18. 5. Qesamtflugzeit der Ozeanüberquerung (7552 km) 37 Std. 19 Min. Besatzung 8 Personen.
Pauline Ossipenko t, sowjetrussische Fliegerin, am 12. 5. abgestürzt.
Rom—Addis Abeba, 4500 km im Ohnehaltflug, flogen Leonardi Bonzi und Giovanni Zapetta am 5. 3. auf Nardi 305 D-Sportflugzeug mit 240 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Typenbeschreibung siehe „Flugsport" 1937, S. 70.
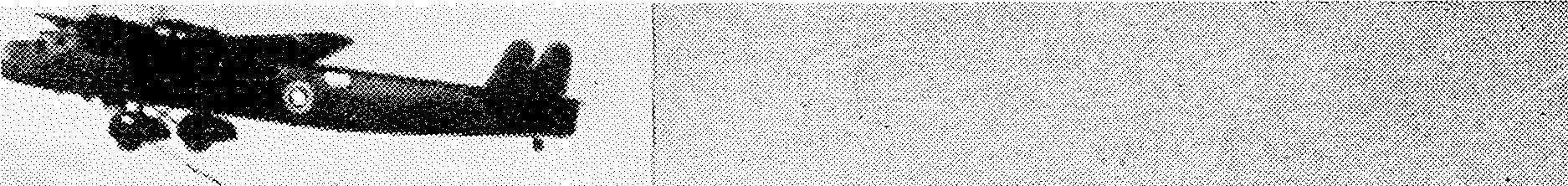
Betriebsstoffübernahme während des Fluges. imp. Airways
Thomas Smith, Atlantikflug, mit einer 65 PS-Sportmaschine, ist am 29. 5. 3.30 h in Irland gelandet. Smith, welcher am 28. 5. 4.50 h ostamerikanischer Zeit heimlich auf dem Flugplatz Old Orchard (Maine) gestartet war und nur wenigen Freunden sein Reiseziel London angegeben hatte, verwendete ein Flugzeug von 140 km/h Geschwindigkeit mit einem Brennstoffverbrauch von 21 1/h.
Luftgekühlte und flüssigkeitsgekühlte Reihenmotoren sollen, wie gerüchtweise verlautet, die USA-Firmen Wright Aeronautical Corp. und Pratt öl Whitney Aircraft Division entwickeln.
„Yankee-Clipper" der Pan-American Airways, Postflug von New York nach Marseille. Außer 110 000 Briefen 14 Mann Besatzung. Start New York 20. 5. Nach Betriebstoffaufnahme in Horta und Zwischenlandung in Lissabon, Landung in Marseille am 22. 5. Gesamtflugzeit 45 Std. 33 Min.
Atlantic-Clipper, Boeing 314, startete 27. 5. um 21 h 26 in New York, traf nach Zwischenwasserungen auf den Azoren und Lissabon am 29. 5. 14 h 17 in Marseille ein.
„Guba" Consolidated 28 Expeditionsflugboot flog im Dienste des USA Naturgeschichtlichen Museums 1938 nach Neu-Guinea, 6 Mann Besatzung, Leitung Richard Archbold, um Zentral-Neu-Guinea zu erforschen. Unter anderem wurden über 100 Interessenten nach einem 3500 m hoch liegenden See gebracht und regelmäßig versorgt. Weiterflug von Neu-Guinea erfolgte am 11. 5. 39 über Sydney, Onslow, über den Indischen Ozean mit Landungen auf den Kokosinseln, Chagos- und Sechellen. Danach wird Afrika überquert von Kisumu nach Lagos— Dakar, über den Süd-Atlantik nach Natal bis Miami. Wie „Les Ailes" berichtet, dient der Flug über den Indischen Ozean besonders dazu, eine neue Ausweichfluglinie, falls England von Indien abgeschnitten sein sollte, zu erkunden.
Sacramento Flugbasis, 25 Flugminuten von San Francisko am 30. 4. in Betrieb genommen.
Amerikanische Rekorde verblüffen mitunter durch ihre naive Grundlage. So berichten Zeitschriften von drüben, daß eine charmante Frau Soundso drei Rekorde aufgestellt habe, nämlich 1. den ersten Senkrechtflug mit Muskelkraft, 2. denselben als von einer Frau geleistet und 3. einen Aufstieg in Höhe eines Achtelzolls, also 3 Millimeter! „Auf jeden Fall ist dies ein Anfang" sagt der Reporter des uns vorliegenden weit verbreiteten technischen Journals. Die Abbildung zeigt ein Paar Hub Schraubenflügel an der Spitze eines Rohres, das unten, von einer leicht bekleideten Dame eingenommen, Sitz und Fahrradkurbeln hat und von einem dreibeinigen Gestell dicht unterhalb der Flügel gehalten wird; die Flügel sind verstellbar.
Der 3 mm - Muskelkraft - „Rekord" ist offenbar dadurch erreicht worden, daß die Flügel bei Nullstellung in immer rascheren Umlauf versetzt und dann plötzlich in einen Hubwinkel eingestellt worden sind, worauf die Schwungkraft den Hubschrauber prompt einen Hopser machen läßt, wie beim Tragschrauber-Sprungstart. Daß das ein mehr als bescheidener Anfang ist, erkennt man, wenn man sich vorstellt, was aus der Miß America geworden wäre, wenn der Hubschrauber sich so wenig ritterlich gezeigt hätte, weiter zu steigen; das Rohr hätte sich dann entgegengesetzt gedreht und sie abgeschleudert. G.
Goldenes Leistungsabzeichen bis zum 11. März 1939 erhielten folgende Segelflieger: 1. Heini Dittmar, Darmstadt, 2. Hermann Zitter, Darmstadt, 3. Philip Wills, London, Engl., 4. Eric Nessler, Paris, Frankr., 5. Heinz Peters, Wasserkuppe, 6. Rudolf Opitz, Darmstadt, 7. Wolfgang Späte, Darmstadt, 8. Karl Schieferstein, Darmstadt, 9. Heinrich Huth, Hamburg-Fuhlsbüttel, 10. Arno Kuhnold, Laucha, 11. Peter van Husen, Grünau, 12. Kurt Schmidt, München, 13. Otto Bräutigam, Gr.-Rückerswalde, 14. Franz Pomper, Königsberg, 15. Rudolf Steinert, Poppitz, Sa., 16. Günther Lemm, Berlin, 17. Ernst-Günther Haase, Dortmund, 18. Gerhard Sauerbier, Breslau, 19. Oblt. Flakowski, Merseburg, 20. Heinz Schubert, Darmstadt, 21. Werner Fick, Perleberg, 22. Gotthold Peter, Berlin, 23. Karl Treu-ter, Jena, 24. Hermann Winter, Johannesburg, Afrika. 25. Eugen Wagner, Breslau.

Segelflug
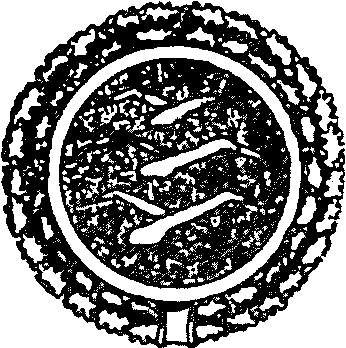
Inhaber des Segelflieger-Leistungsabzeichens
(veröffentlicht im „Flugsport" 1936, S. 103, Nr. 1—200, S. 681, Nr. 201—300 und 1938, S. 308, Nr. 301—845).
|
846. Ernst Berlik, Berlin |
15. |
7. |
38 |
910. M. Elis. v. Mutius, Albrechtsdorf |
29. |
7. |
38 |
|
847. Hans-Joach. Baeumer, Hirschberg |
15. |
7. |
38 |
911. Josef Jörg, Fürth, Bayern |
29. |
7. |
38 |
|
848. Werner Backhaus, Leinefelde |
15. |
7. |
38 |
912. Erich Kasten, Hamburg |
30. |
7. |
38 |
|
849. Fritz Leifheit, Hannover |
15. |
7. |
38 |
913. Walter Lassen, Berlin |
2. |
8. |
38 |
|
850. Artur Franke, Krefeld |
15. |
7. |
38 |
914. Franz Pfeffer, Gotha |
3. |
8. |
38 |
|
851. Andr. Szokolay, Budapest, Ungarn 15. |
7. |
38 |
915. Moritz Wurst, Gotha |
3. |
8. |
38 |
|
|
852. Herbert Leschantz, Leoben |
15. |
7. |
38 |
916. Fritz Gehrmann, Copiehnen |
3. |
8. |
38 |
|
853. Max Müller, Magdeburg |
15. |
7. |
38 |
917. Otto Müller I., Leysuhnen |
3. |
8. |
38 |
|
854. Karl Feil, Hornberg |
15. |
7. |
38 |
918. Otto Müller IL, Gilgenau |
CO |
8. |
38 |
|
855. Karl Josef Koch, Hamburg |
18. |
7. |
38 |
919. Paul Gerhardt, Dresden |
3. |
8. |
38 |
|
856. Eustace Thomas, Brooklands, Engl. 18. |
7. |
38 |
920. Helmut Hauck, Saarbrücken |
4. |
8. |
38 |
|
|
857. J. Pasold, Langley, England |
18. |
7. |
38 |
921. Josef Solbe, Halle |
4. |
8. |
38 |
|
858. Dr. H. T. Edmunds, Slongh, Engl. 18. |
7. |
38 |
922. Hans-Joachim John, Greifswalde |
4. |
8. |
38 |
|
|
859. Capt. J. C. Dent, Aldershot, Engl. 18. |
7. |
38 |
923. Friedrich Franke, Merseburg |
4. |
8. |
38 |
|
|
860. S.H. Barker, Norton-on-Tees, Engl. 18. |
7. |
38 |
924. Wilhelm Koch, Nieder-Modau |
5. |
8. |
38 |
|
|
861. D. F. Qreig, Hounslow, England |
18. |
7. |
38 |
925. Karl Irmert, Freiburg |
5. |
8. |
38 |
|
862. Emil Buchwald, Hamm |
18. |
7. |
38 |
926. Karl Hopfenbeck, Hesselberg |
5. |
8. |
38 |
|
863. Josef Doetsch, Dessau |
18. |
7. |
38 |
927. Viktor Schuback, Hamburg |
5. |
8. |
38 |
|
864. Karl Müller, Stettin |
18. |
7. |
38 |
928. Otto Jecke, Laucha |
6. |
8. |
38 |
|
865. Aloys Bücken, Würselen |
18. |
7. |
38 |
929. Karl Stiller, Bochum |
6. |
8. |
38 |
|
866. Wilhelm Bender, Berlin-Tempelhof 20. |
7. |
38 |
930. Benno Claus, Mörs-Meerburg |
6. |
8. |
38 |
|
|
867. Kurt Streletzki, Berlin-Spandau |
20. |
7. |
38 |
931. Karl Blankert, Wuppertal-Ronsdorf 8. |
8. |
38 |
|
|
868. Herbert Tietze, Warnemünde |
20. |
7. |
38 |
932. Robert Fischer, Schwäbisch-Gmünd |
8. |
8. |
38 |
|
869. Franz Nekes, Aachen |
21. |
7. |
38 |
933. Karl Hekeler, Owen-Teck |
8. |
8. |
38 |
|
870. Wilhelm Wenthe, Ballenstedt |
21. |
7. |
38 |
934. Hans Rascher, Wasserkuppe |
9. |
8. |
38 |
|
871. Warren Merboth, Qlen Rock, USA 22. |
7. |
38 |
935. Hans-Joachim Paulmann, Leuna |
10. |
8 |
38 |
|
|
872. Robert Stanley, San Diego, USA |
22. |
7. |
38 |
936. Herbert Adomeit, Hamburg- |
|||
|
873. Theodore Bellak, Newyork, USA |
22. |
7. |
38 |
Langenhorn |
10. |
8 |
38 |
|
874. Stanley Corcoran, Hollywood, USA 22. |
7. |
38 |
937. Hans Müller, Seestadt Rostock |
10. |
8 |
38 |
|
|
875. Robert Auburn, Buffalo, USA |
22. |
7. |
38 |
938. Adolf Rietz, Düsseldorf |
10. |
8. |
38 |
|
876. Julian Hadley, USA |
22.. |
7. |
38 |
939. Helga Hoffmann, Liegnitz |
11. |
8. |
38 |
|
877. Floyd Sweet, Elmira, USA |
22. |
7. |
38 |
940. Gustav Junker, Bln.-Charlottenburg 12. |
8 |
38 |
|
|
878. Bernhard Maurer, Schwerte |
23. |
7. |
38 |
941. Karl Erik Oevgard, Soderskra, |
|||
|
879. Heinrich Breyhan, Göttingen |
23. |
7. |
38 |
Schweden |
12. |
8 |
38 |
|
880. Heinz Wernicke, Berlin |
23. |
7. |
38 |
942. Karl Schneider, Ebingen |
12. |
8 |
38 |
|
881. Werner Leßner, Zella-Mehlis |
28. |
7. |
38 |
943. Albert Winters, Göttingen |
15. |
8 |
38 |
|
882. Hugo Bärwinkel, Geraberg |
23. |
7. |
38 |
944. Adolf Niemeyer, Gitter, Harz |
15. |
8 |
38 |
|
883. Ludwig Färber, Kaufbeuren |
23. |
7. |
38 |
945. Hans Klingowski, Quakenbrück . |
16. |
8 |
38 |
|
884. Otto Vandieken, Kaufbeuren |
23. |
7. |
38 |
946. Dr. Gerhard Pitschak, Halle |
16. |
8 |
38 |
|
885. Ferdinand von Nickisch-Roseneyk, |
947. Johannes Schmidtmeier, Halle |
16. |
8 |
38 |
|||
|
Kuchelberg bei Liegnitz |
23. |
7. |
38 |
948. Wilhelm Walgenbach, Bottrop |
16. |
8 |
38 |
|
886. Dr.-Ing. Rößger, Berlin-Steglitz |
23. |
7. |
38 |
949. Edmund Griesmeier, Bielefeld |
16. |
8 |
38 |
|
887. Fritz Kurtz, Oldenburg i. O. |
23. |
7. |
38 |
950. Otto Walter, Warnemünde |
16. |
.8 |
38 |
|
888. Hermann Wolff, Woltersdorf |
4. |
8. |
38 |
951. Josef Bruchhäuser,. Essen |
18. |
8 |
38 |
|
889. Ernst Koehler, Worms |
25. |
7. |
38 |
952. Erich Lorenz, Berlin |
19. |
8 |
38 |
|
890. Gerhard Hübner, Merseburg |
27. |
7. |
38 |
953. Heinrich Siebald, Griesheim |
19. |
8 |
38 |
|
891. Werner Weigert, Neubrandenburg |
25. |
7. |
38 |
954. Kurt Schneider, Braunschweig |
19. |
8 |
38 |
|
892. Heintz Oetzbach, Königsberg |
25. |
7. |
38 |
955. Czerny Jerzy, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
893. Ludwig Becker, Münster i. W. |
25. |
7. |
38 |
956. Bylinski Engeninsz, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
894. Rolf Paegel, Hamburg |
27. |
7. |
38 |
957. Kuzmicki, Mieczytlaw, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
895. Lorenz Schmid, München |
28. |
7. |
38 |
958. Maczynski, Jan, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
896. Gerald Kober, Berlin |
1. |
5. |
38 |
959. Derengowski, Tadeusz, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
897. Helmuth Riebeling, Münster i. W. |
28. |
7. |
38 |
960. Inz. Cywinski, Stanislaw, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
898. Eberhard Meyer, München |
28. |
7. |
38 |
961. Dobrowolanski, Boleslaw, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
899. Karl Zimmermann, Worms |
28. |
7. |
38 |
962. Dzierzbicki, Lech, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
900. Kurt Dinges, Frankfurt a. M. |
28. |
7. |
38 |
963. Felkerzam, Michael, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
901. Walther Schürmann, Köln |
28. |
7. |
38 |
964. Rusko, Tadeusz, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
902. Otto Starke, Mülheim a. d. Ruhr |
28. |
7. |
38 |
965. Tulak, Zygmunt, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
903. Helmut Holtz, Genthin |
30. |
8. |
38 |
966. Zukowski, Tadeusz, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
904. Ludwig Etzel, Köln-Mülheim |
28. |
7. |
38 |
967. Ruba, Stanislaw, Polen |
19C |
8 |
. 38 |
|
905. Albrecht Merker, Kap.-Ltt., Laucha 10. |
8. |
38 |
968. Kpt. Orzeckowsky, Jerzy, Polen |
19. |
8 |
. 38 |
|
|
906. Hans Noll, Remscheid |
28. |
7. |
38 |
969. Kozlonsky, Josef, Polen |
19. |
8 |
38 |
|
907. Erich Schönthal, Erfurt |
28. |
7. |
38 |
970. Dabek, Josef, Polen |
19. |
8 |
. 38 |
|
908. Jutta Everth, Rüdersdorf |
28. |
7. |
38 |
971. Frau Kozierska, Wieslawa, Polen |
19. |
8 |
. 38 |
|
909. Christ, v. Mutius, Albrechtsdorf |
28. |
7. |
38 |
972. Las, Crestaw, Polen |
19. |
8 |
. 38 |
973. Makosz, Konstanty, Polen 19.
974. Popesen, Valentin, Polen 19.
975. Wismowski, Edward, Polen 19.
976. Dzwonek, Jan, Polen 19.
977. Herburt, Tadeusz, Polen 19.
978. Janik, Franziszek, Polen 19.
979. Siemaszko, Witold, Polen 19.
980. Wielgus, Stanislaw, Polen 19.
981. Lewandowsky, Mieczyslaw, Polen 19.
982. Wesolowski, Stanislaw, Polen 19.
983. Karl Beck, Ludwigsburg 20.
984. Gustav Rolf, Detmold 23.
985. Martin Ebert, Zittau 23.
986. Erwin Stehmeier, Bremen 24.
987. Dr. Otto Zumbansen, Wilmersdorf 24.
988. Werner Treusch, Darmstadt 25.
H. fi. Sachs, Enschede, Holland 25. Hassan Said, Kmil, Aegypten 30. Adolf Sonnenberg, Braunschweig 2. Wilhelm Bonengel, Stuttgart 2. Franz Schröer, Dülmen 2. Hans Bluder, Hesselberg 5. Gerhard Tripke, Kottbus 5. Albert Lorenz, Glochau 5. Ernst Hartmann, Gelsenkirchen 5. Carl-Heinz Büttner, Weimar 5. Georg Radatz, Elbing 5. Walter Philipp, Elbing 5. Paul Heyse, Elbing 5. Peter Petzalis, Arnstadt 5. Herbert Müller, Döllnitz 6. J. J. Deane-Drummond, England 6. A. Ivanoff, Luton, England 6. A. W. Lacey, Luton, England 6. Michael H. Maufe, Hambrook, Engl. 6.
I. Parker, Cambridge, England 6. Eric H. Taylor, Combs, England 6. Detlof Schulze, Lüneburg 6. Adolf Janßen, Westerland 6. Franz Müller, Mainz-Kastel
989. 990. 991. 992. 993. 994. ' 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027.
1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1938. 1039, 1040. 1041. 1042.
9. 9.
6. 9. 6. 9.
Eckart Wenzel, Berlin-Lichterfelde 6. 9. 38
9. 9. 9.
Dipl.-Ing. Ernst Michel, Hamburg Dr. Rudolf Klein, Frankfurt a. M. Bruno Matzke, Meiningen Hans Irlinger, Burghausen, Obb. Heinrich Korn, Frankfurt a. M. Karl Erwin Betzier, Chemnitz Walter Brinkmann, Osnabrück, Albert Jahnke, Berlin Robert Schmidt, Allenstein Paul Volkmann Hans Steffens, Paderborn Gustav Wittstock, Prenzlau M. Paul Crujanski, Deveti, Jugosl. Erwin Primavesi, Prag, Sudeten-Deutschland
Fritz Weinberger, Plattling Paul Wittenbecher, Schwangau Otto Schneider, München Hermann Geul, München Eduard Euler, Linz Karl Schilling, Hamburg Karl Geisbe, Münster, Westfalen Josef Roithmeier, Bayreuth Arnold Müller, Bralitz, Oder Wolfgang Döring, Berlin Nalborczyk Jan, Polen Puzej Borys, Polen Wood Charles M., Polen Turkowski Adam, Polen Szymannski Stanislaw, Polen
8.38 1043. Stan v. Ilie, Polen 26.
8.38 1044. Rokitnicki Witold, Polen 26.
8. 38 1045. Palowski Wladislaw Boleslaw,
8. 38 Polen 26.
8. 38 1046. Golebiowski Witold, Polen 26.
8.38 1047. Sworniowski Adam, Polen 26.
8. 38 1048. Frey Jan, Polen 26.
8. 38 1049. Siegfried Albert, Erfurt 26.
8. 38 1050 Emil Schutza, Gablenz, O.-L. 26.
8. 38 1051. Johannes Petzold, Weimar 26.
8. 38 1052. Stefan Krcker, Badenau 26.
8. 38 1053. Heinz Hirsch, Danzig 26.
8. 38 1054. Ernst Maslo, Wasserkuppe 26.
8. 38 1055. Otto Bentrupp, Borkenberge 28.
8. 38 1056. Heinz Powilleit, Fulda 1.
8.38 1057. Hans Witting, Zierenberg- 1.
8. 38 1058. Ingrid Aßmann, Berlin 1.
8. 38 1059. Franz Linher, Wien 1.
9. 38 1060. Hans Müller, Erfurt 10. 9. 38 1061. K. M. Chirgwin, London, England 10. 9. 38 1062. R. Pasold, Langley, Bucks, Engl. 10. 9.38 1063. T.W.S. Pringle, Cambridge, Engl. 10. 9. 38 1064. J. A. Rooper, Guilford, England 10. 9. 38 1065. Karl-Heinz Kortum, Prenzlau 13. 9. 38 .1066. Erich Kleber, Eberswalde 15. 9. 38 1067. M. Tanasije Krnjajic, Deveti, 9.38 Jugoslawien 17. 9. 38 ,1068. Franz Gruber, Wien 17. 9. 38 1069. Albert Eggert, Rheine 17. 9. 38 1070. Rudolf Scheffel, Hornberg 17. 9. 38 1071. Hans Ast, Schneidemühl 18. 9. 38 1072. Tomaszewski Jannsz, Polen 18. 9. 38 1073. Kochanowsky Boleslaw, Polen 18. 9. 38 1074. Kurt Queitsch, Groß-Rückers-9. 38 walde 18. 9.38 1075. Humen Wlodzimierz, Polen 18.
ϖ 38 1076. Kopinski Stefan, Polen 18.
. 38 1077. Brochocki Kazimierz, Polen 18.
. 38 1078. Dabrowsky Zygmunt, Polen 18.
. 38 1079. Mazur Wladislaw, Polen 18.
1080. Golabek Stanislaw, Polen 18.
6. 9.38 1081. Dobrzonski Leonhard, Polen *18.
6. 9. 38 1082. Peszke Wiktor, Polen * 18.
6. 9. 38 1083. Friedrich Schmaus, Stade 20.
6. 9. 38 1084. Marcel Pimbert, Paris, Frankreich 24.
14. 9. 38 1085. Louis Gelinean, Paris, Frankreich 24.
7. 9. 38 1086. Camille Guyot, Paris, Frankreich 24.
15. 9. 38 1087. Waldemar Jacob, Blaichach 27. 15. 9. 38 1088. Hubert Clompe, Göppingen 29. 15. 9. 38 1089. Günther Tschüter, Berlin 31. 15. 9.38 1090. M. Israel, Paris, Frankreich 15.
15. 9. 38 1091. Gerhard Petri, Berlin 3.
16. 9. 38 1092. Hermann Peiffer, Münster 25.
17. 9. 38 1093. John Saffery, England 24.
1094. P. M. Thomas, England 24.
19. 9. 38 1095. C. L. Raphael, England 24.
19. 9. 38 1096. Alan Davies, England 24.
20. 9. 38 1097. Karl Häfele, Fürth i. B. 26. 20. 9. 38 1098. Heri Lescure, Paris, Frankreich 29.
20. 9. 38 1099. Jean Noirtin, Paris, Frankreich 29.
21. 9. 38 1100. Charles Clamamus, Paris, Frankr. 29. 21. 9. 38 1101. Georges Abrial, Paris, Frankreich 29.
21. 9. 38 1102. Marcel Bouriquet, Paris, Frankr. 29.
22. 9. 38 1103. Herbert Vollmer, Hannover 7. 24. 9. 38 1104. Anton Longen, Trier 9. 24. 9. 38 1105. Adam Wiemann 9. 26. 9. 38 1106. Herbert Puschmann, Schweidnitz 12. 26. 9. 38 1107. Friedrich Nahrgang, Gitter 16. 26. 9. 38 1108. Alois Derendingen Schweiz 22. 26. 9. 38 1109. Golesen Mihai, Polen 22. 26. 9. 38 1110. Bronislaw Krotoszyuski, Polen 22.
38 38 38 38
9. 38 9. 38 9. 38
9. 38
9. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38
10, 38 10. 38 10. 38
10. 38
10. 38 10. 38 10, 38 10. 38 10. 38 10. 38
10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38 10. 38
10. 38
11. 38 11. 38 11. 38 11. 38 11. 38 11. 38 11.38 11. 38 11. 38 11.38 11. 38 11. 38
11. 38
12. 38 12. 38 12. 38 12. 38 12. 38 12. 38 12. 38 12. 38
1111. Maria Kornacka, Polen 22. 12. 38
1112. Bohdan Zajac, Polen 22. 12. 38
1113. Piotr Ostaszewski, Polen 22. 12. 38
1114. Stanislaw Murlowski, Polen 22. 12. 38
1115. Alfred Kasprowski, Polen 22. 12. 38
1116. Konrad Sztuka, Polen 22. 12. 38
1117. Marian Shalski, Polen 22. 12. 38
1118. Henri Marbleu, Paris, Frankreich 9. 1. 39
1119. Emile Manduech, Tunis, Frankreich 9. 1. 39
1120. Karl Qruda, Zierenberg 12. 1. 39
1121. Wilhelm Jachmich, Duisburg 14. 1. 39
22. 12. 38 1122. Heinrich Bräker, Borkenberge 17. 1. 39
22. 12. 38 1123. Karl-Heinz Nitschack, Breslau 21. 1. 39
22.12.38 1124. Jean Melleton, Paris, Frankreich 3. 3.39
22. 12. 38 1125. Harry Landers, Kassel-Rothwesten 3. 3. 39
22. 12. 38 1126. J. A. Mayhew, South-Afrika 3. 3. 39
22. 12. 38 1127. R. C. Rainey, South-Afrika 3. 3.39
22. 12. 38 1128. E. Dommisse, South-Afrika 3. 3. 39
9. 1. 39 1129. Hans Witzel, Frankfurt a. M. 9. 3. 39
l 9. 1. 39 1130. Erich Hader, Laucha 13. 3.39
12. 1. 39 1131. F. Doleviczeug, Ungarn 15. 3. 39
14. 1. 39 1132. B. Bollmann, Ungarn 15. 3. 39
Leistungsabzeichen in Silber. Ab 15. April 1931 bis zum 31. 3. 1939 wurden insgesamt 1132 an folgende Länder verliehen: Deutschland 823, Polen 159, England 50, Frankreich 32, Schweiz 19, USA 17, Ungarn 11, Jugoslawien 4, Finnland 3, Holland 3, Tschecho-Slowakei 3, Afrika 3, Brasilien 1, Schweden 1, Rumänien 1, Aegypten 1, Litauen 1.
Gruppen-Segelflugwettbewerbe des NS.-Fliegerkorps v. 26. 5.—4. 6. ergaben beachtenswerte Leistungen. So erreichte von der Gruppe 11 des NSFK. vom Flughafen Darmstadt aus NSFK.-Obertruppführer Kühn mit 106 km die größte Strecke in der Sonderklasse. Andere legten Strecken von 60—100 km zurück. In der Wettbewerbsgruppe segelte Flugzeugführer Koch von der Segelflugschule Hummerich 125 km nach dem Segelfluggelände Gillenfeld in der Eifel. Die anderen Segelflieger erreichten durchschnittlich Strecken von 60—70 km. Von der Gruppe 4 des NSFK. vollbrachte Obersturmführer Schmidt mit seinem Flug Trebbin—München—Holzkirchen (505 km) auf „Reiher" D/4—800 eine neue deutsche Höchstleistung im Zielstreckenflug. Eine weitere Höchstleistung im reinen Streckensegelflug erreichte Hauptsturmführer Vergens auf „Minimoa" D/4—795 auf der Strecke Segelflugschule Rhinow—Tiefenried b. Augsburg (530 km). Ferner führte der Obergefreite Mudin v. Luftwaffen-SV. einen Zielstreckenflug Trebbin-Nürnberg (350 km) bei ungünstiger Thermik in 7 Std. durch. NSFK.-Scharf. Schmidt überhöhte nach Schleppstart die Startstelle um 2450 m.
Am 8. Laucha-Segelflugwettbewerb der Gruppe 7 des NSFK. nahmen 26 Mannschaften teil, darunter auch Angehörige der sudetendeutschen Standarte 40 (Teplitz-Schönau). Im Streckenflug erreichten am 28. 5. Petzold-Zwickau auf „Minimoa" 75 km, Ehret-Merseburg auf „Rhönadler" 54 km, Bülow-Laucha 51 km. Am 29. 5. flog Ludwig-Rückerswalde 117 km nach Mitwetz b. Kronach i. Thür., Biskup-Oschatz erzielte 110 km, Hasenknopf-Mittweida 92 km, Bülow-Laucha 87 km, Ehret-Merseburg 84 km, Holtschke-Leipzig 42 km und Frenzel-Leipzig 22 km.
10. Elmira-Segelflug-Wettbewerb 24. 6.-9. 7.. Zuvor 19.—23. 6. Uebungskurs für weniger Fortgeschrittene. Nenngebühr für Nichtmitglieder der Soaring Society, 10 Dollar. Zugelassen im Hauptwettbewerb Gruppe I: Leistungsabzeichen, Gruppe II B- u. C-Prüf. Gewertet werden in Gruppe II Flüge über 300 m Höhe, 8 km Entfernung und eine Stunde Dauer. Gruppe 1 Mindestleistung: 930 m Höhe, 51 km Entfernung und 5 Std. Dauer. Punktwertung.
Segelflugbetrieb im Club Olympique, Billancourt. 14. 5. Colin 150 km Strecke Etampes—Bourges, ebenso Refregier, beide Teilflüge für Leistungsabzeichen, La-casse Zielflug Etampes—Orleans 55 km mit 1000 m Startüberhöhung.
14 h 13 min segelte NSFK.-Sturm-Bannführer Settgast in der Rhön am 23. 5.
Reichswettbewerb für Segelflugmodelle auf der Wasserkuppe, 27.—29. 5. 39.
Die vom Korpsführer des NSFK. General der Flieger Christiansen zugelassenen 510 Modelle füllten die Hermann-Göring-Halle auf der Wasserkuppe, wo am Samstag, dem 27. 5., die Abnahmeprüfung stattfand. Es war eine Freude, das farbenprächtige Bild aufzunehmen, zu sehen, wie die Jungen bis zu den Jüngsten mit ihren sauber gearbeiteten Modellen mit erwartungsvollen Gesichtern in langen Reihen standen, um ihre Zulassungsbescheinigung zu empfangen.
Die Ausschreibung (s. „Flugsport" 1939, S. 197) umfaßte alle Möglichkeiten, um die verschiedensten Flugzeugarten in der Entwicklung vorwärtszutreiben. Der Entwicklung von eigenen Gedanken war in der Klasse Eigenkonstruktion
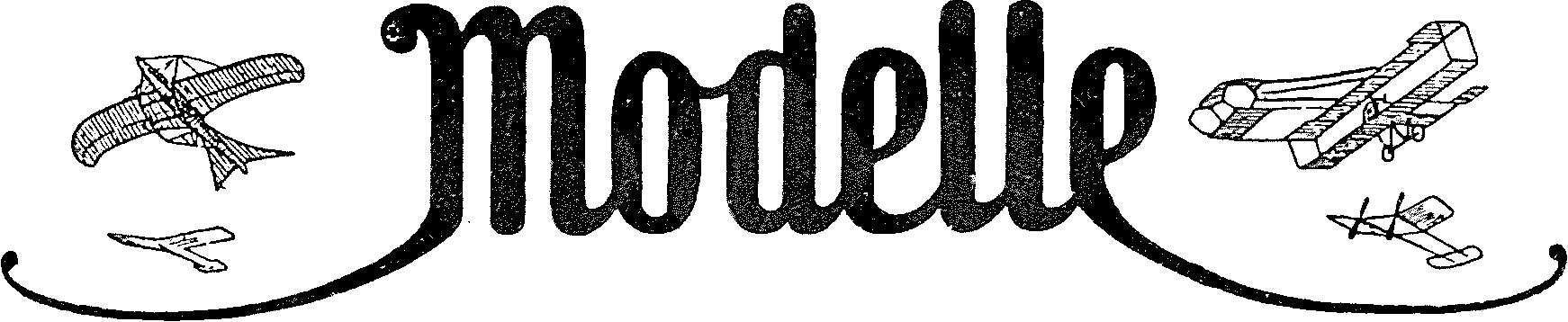
weitestgehend freie Bahn gelassen. Es ist ein gutes Zeichen, daß allein an Eigenkonstruktionen 179 Flugmodelle und mit Selbststeuerung 50 Modelle vertreten waren. Der fliegerische Nachwuchs wird hiermit schon von Anfang an gezwungen, sich bis in die kleinsten Einzelheiten, und zwar schon mit höherer Physik, Mechanik, Elektrotechnik und was es sonst noch für Wissenschaften gibt, vertraut zu machen. Und wenn die jungen Konstrukteure ihre selbstgesteuerten Modelle erklärten, mußten schon Fachleute genau aufpassen, um manchmal folgen zu können.
Man sah gesteuerte Modelle mit Licht-, Schall- und Funkwellen- sowie Kreisel- und Magnet-Steuerungen. Hier zeigten sich überall neu begangene Wege, fortschrittliche Arbeiten. Die Verfeinerung in der Konstruktions- und Werkstattarbeit war auffallend.. Die hier geleistete Arbeit in Feinmechanik war überraschend. Neuartig war eine Kompaß-Düsensteuerung von NSFK.-Obf. Hillebrecht, Göttingen, ferner eine Kompaß-Steuerung mit Zeitschaltung von Paul Leifhelm-Münster (NSFK.-Gr. 10) und eine Kompaß-Steuerung von Joachim Schmidt-Allen-stein (NSFK.-Gr. 1). Lichtzellensteuerungen und akustische Steuerungen waren in mehreren Ausführungen vertreten.
Am Vormittag des ersten Wettbewerbstages wurde dem jüngsten Nachwuchs, welcher zum erstenmal auf der Wasserkuppe war, auch einmal dichte Knofe vorgeführt, welche gegen Mittag abbestellt wurde. Um 11 h begann bereits die Nebelkappe zu schwinden, und es wurde sofort der Startbetrieb an 8 Startplätzen, trotz des sehr starken Windes von 8 schwankend bis 18 m/sec, eröffnet. Günstiger war der zweite Wettbewerbstag. 15 h Startschluß. Insgesamt
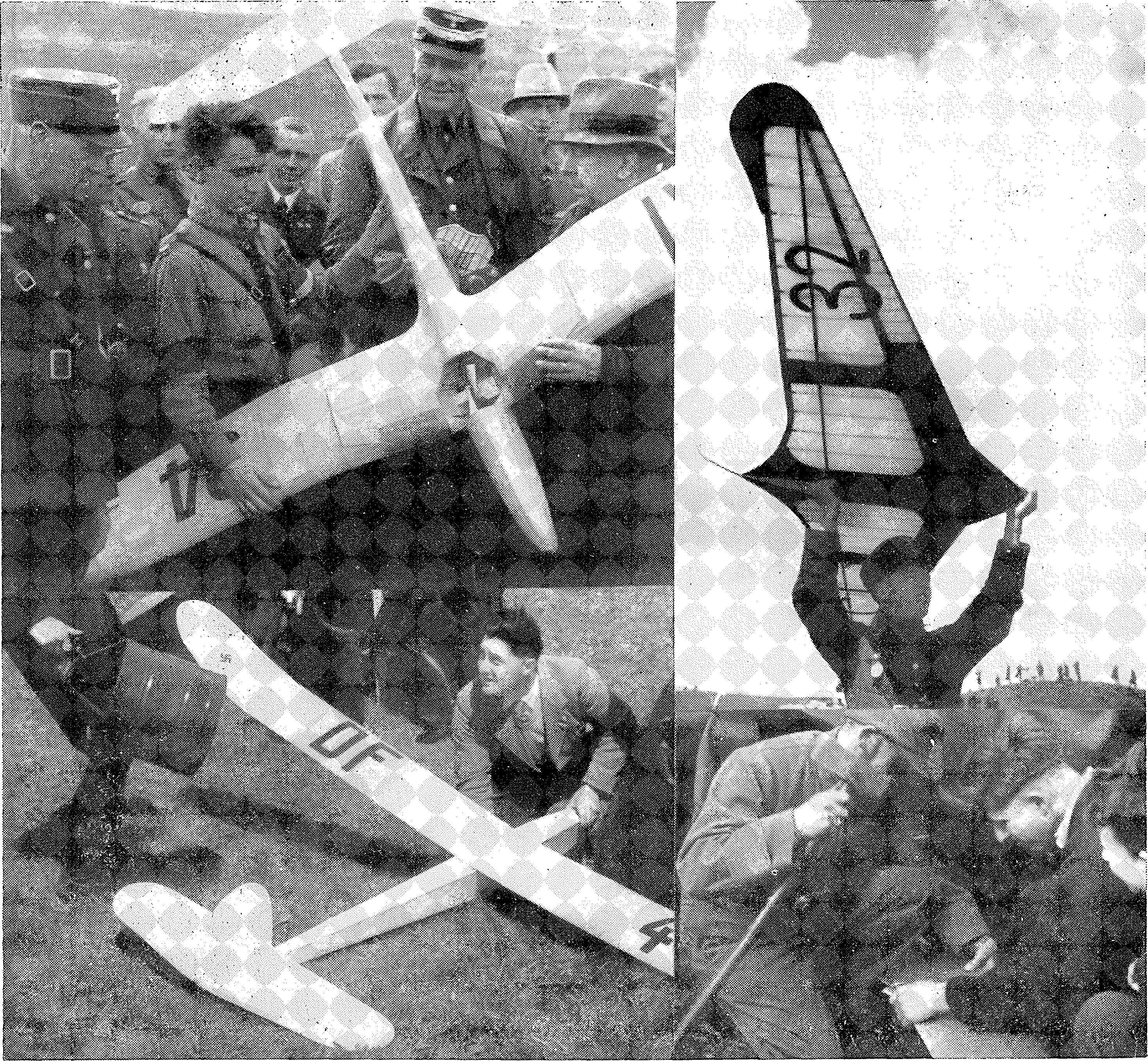
Vom Reichswettbewerb für Segelflugmodelle auf der Wasserkuppe, 27.—29. 5. 39. Oben links: Kompaßgesteuertes Segelflugmodell. In Mitte: Gruppenführer v. Eschwege. Unten: Schallwellengesteuertes Segelflugmodell. Rechts a. d. Kante: Schwanzflosse. Unten: Eine schwerfällige Reparatur. Winkelser 4 Bilder

Vom Reichswettbewerb für Segelflugmodelle auf der Wasserkuppe.
wurden 1702 Starte durchgeführt. 17 h Preisverteilung durch NSFK.-Gruppenführer Krüger.
Als Sieger des Reichswettbewerbs und Gewinner der Goldenen Plakette des Korpsführers des NSFK. ging die NSFK.-Gr. 10 (Westfalen) mit 215 Pkt. hervor; eine silberne Plakette erhielt die an 2. Stelle liegende NSFK.-Gr. 1 (Ostpreußen) mit 193 Pkt. Bronzene Plaketten erhielten die NSFK.-Gruppen 4 (Berlin) m. 176 Pkt., 8 (Mitte) m. 159 Pkt., 7 (Elbe-Saale) m. 144 Pkt. Gewinner des Wanderpreises des Korpsführers für die beste Gesamtleistung eines Teilnehmers war der Hitler junge Gotthard Irmer aus Freiberg i. Sa. von der NSFK.-Gr. 7 (Elbe-Saale), der insgesamt 15 Flugminuten und diese in bezug auf die ungünstigen Flugverhältnisse ausgezeichnete Zeit mit einer Eigenkonstruktion erreichte.
2 Std. 20 Min. flog Segelflugmodell des Wiener Sarrazin, wie „Les Ailes" vom 25. 5. berichtet.
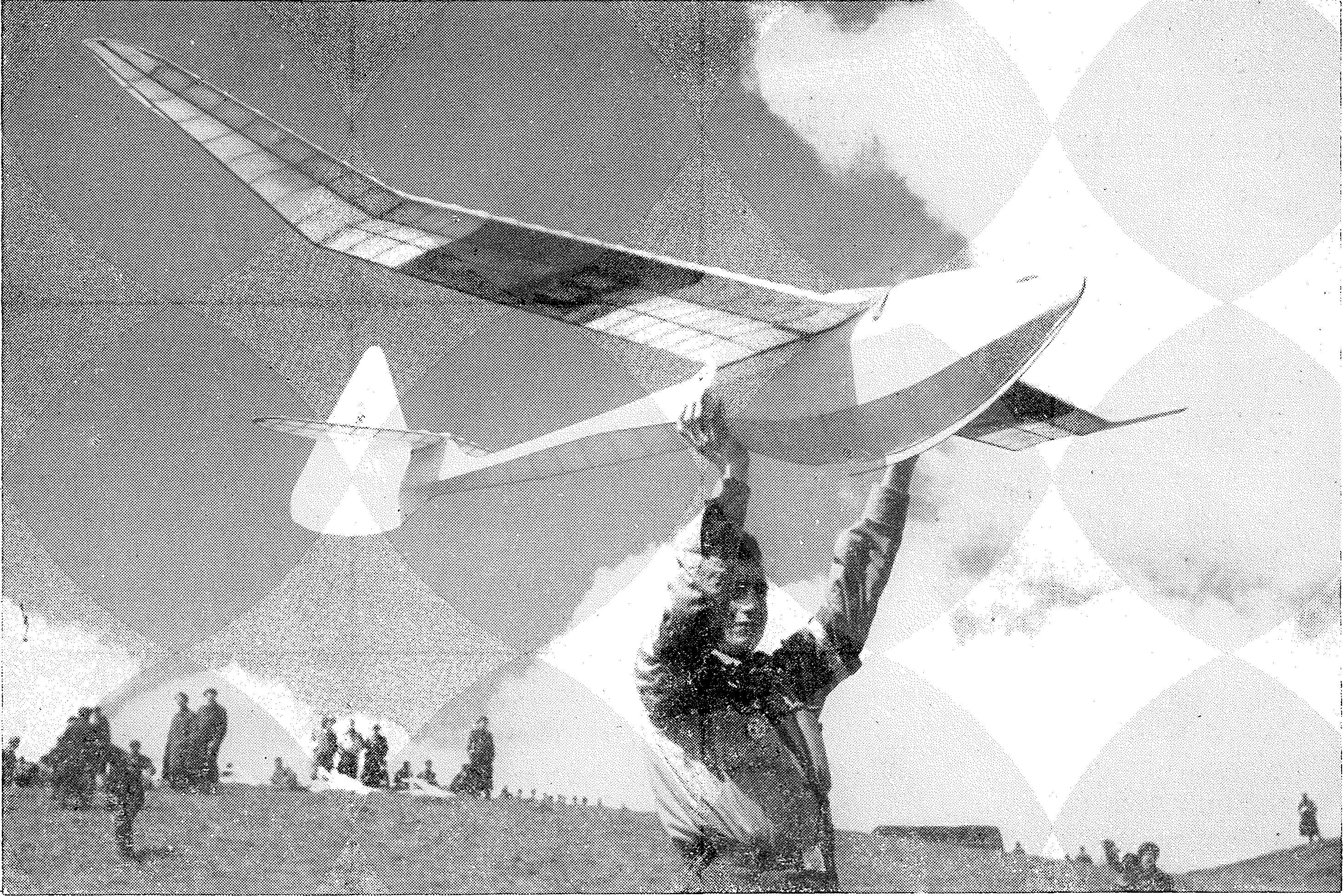
Vom Reichswettbewerb für Segelflugmodelle auf der Wasserkuppe, 27.—29. 5. 39. Formgebung und Werkstattarbeit zeigten überall Fortschritte.

Vom Reichswettbewerb für Segelflugmodelle auf der Wasserkuppe, 27.—29. 5. 39.
Am Nordosthang.
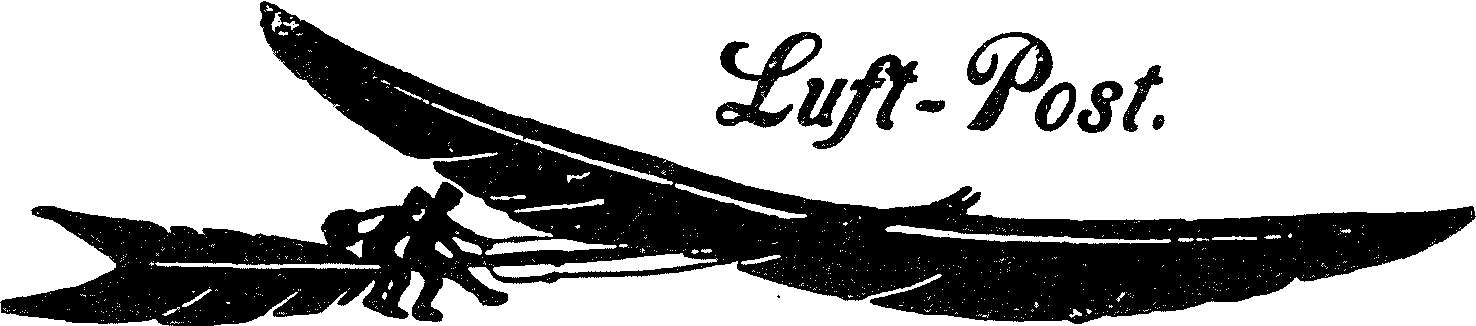
Kältewindkanal befindet sich in der Aerodynamischen Versuchsanstalt Göttingen, wo Enteisungsmöglichkeiten untersucht werden.
Turbulenzströmung = durchwirbelte, Laminare = unverwirbelte Strömung.
Focke-Hubschrauber Fw 61, Steiggeschw. am Boden 3,6 m/s, Fluggew. 950 kg, Motor 5 h 14 a.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Deutscher Flugzeugbau. Handbuch der Luftfahrttechnik, Exporthandbuch der Luftfahrtindustrie. Herausg. von Dipl.-Ing. 0. Hombach, Hauptschriftl. d. Zeitschr. „Luftwissen" i. Zus.-Arb. m. d. Wirtschaftsgr. Luftfahrtindustrie. Verlag Naturkunde u. Technik Fritz Knapp, Frankfurt a. M. Preis RM 15.—.
Der Aufschwung der deutschen Luftfahrtindustrie ist vom Ausland besonders aufmerksam verfolgt worden. Flugzeuge, Motoren und Ausrüstungsgeräte haben in verhältnismäßig kurzer Zeit einen Stand der Entwicklung erreicht, wie er in der Welt einzig dasteht. Es ist daher begreiflich, wenn vom Ausland versucht wird, sich diese Errungenschaften zunutze zu machen und die hochentwickelten deutschen Erzeugnisse zu kaufen. Die Kenntnis der deutschen Entwicklung war nur kleinen Kreisen des Auslandes bekannt. Mit der Herausgabe dieses Handbuches wurden vor allen Dingen die Wünsche des Auslandes erfüllt und ein Ueberblick über die wichtigsten deutschen Luftfahrtgeräte gegeben. Aufbau und Wirkungsweise der Geräte sind leichtverständlich an Hand von Schemabildern und Teilansichten erläutert. Flugzeuge, Motoren, Bodenanlagen wurden teilweise an Hand von Beispielen beschrieben. Das vorliegende Werk ist ein vorzügliches Handbuch für die Angehörigen der Luftwaffe, des Luftsports, Studierende an Fach- und Hochschulen, Techniker, Flugzeugführer, insbesondere auch für die Hersteller und Lieferwerke der Luftfahrtindustrie und alle, welche an der Entwicklung des Flugwesens interessiert sind. Wertvoll sind die kurzen sechssprachigen Ueberschriften, verbunden mit einem Sachregister, in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. Ferner ist am Schluß ein Verzeichnis der wichtigsten Herstellerwerke angefügt. Ein wirkliches Handbuch der Luftfahrttechnik und -Industrie.
Heft 13/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Briöf-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro X Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
TeleL: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ..Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Ouellenangabe gestattet.
Nr 13 21. Juni 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 5. Julj_1939
Fliegerische Arbeit.
Die Legion Condor ist am 6. 6. vor dem Führer vorbeimarschiert. Den Abschluß bildete die Heldenehrung im Lustgarten.
Die Leistungssteigerung im Flugzeugbau und Fliegerei geht zuversichtlich unaufhaltsam vorwärts. Man muß schon mitten in der Sache drinstehen, um alles miterleben zu können.
Jetzt haben die Veranstaltungen des NSFK. begonnen. Der Ostland- und nordostdeutsche Rundflug sind zur Zufriedenheit des Korpsführers, General der Flieger Christiansen, verlaufen.
Jetzt folgen weitere Veranstaltungen des NS.-Fliegerkorps: 18. 6. bis 2.7. Zielstrecken-Segelflug-Wettbewerb 1939. Flugstreckenführung: Flugplatz Freiburg i. B. — Offenburg — Karlsruhe — Mannheim — Wertheim a. M. — Bad Kissingen — Meiningen — Erfurt — Bad Frankenhausen — Magdeburg — Süd-Brandenburg — Berlin-Rangsdorf — Finowfurt — Stettin/Altdamm.
23.—25. 6. Westdeutscher Rundflug, Streckenführung: Konstanz
— Friedrichshafen — Karlsruhe — Worms — Traben-Trarbach — Koblenz — Wasserkuppe — Gotha — Kassel — Bremen — Münster
— Geseke — Köln.
23. 7.-6. 8. Rhön-Segelflug-Wettbewerb 1939 (20. Rhön)*).
Weltkongreß der Luftfahrtpresse.
In Rom trafen sich vom 5. bis 13. 6. etwa 400 Luftfahrtjournalisten aus 22 Nationen. Betreut von der unübertrefflichen, herzlichen Gastfreundschaft Italiens gestalteten sich die Tage zu einem tiefen, nachhaltigen Erlebnis. In zahlreichen Vorträgen wurden neben Standesund Organisationsfragen alle Gebiete der Luftfahrtjournalistik eingehend behandelt. Darüber hinaus wurden die Beziehungen der Luftfahrt zur
*) Ueber weitere kleinere Veranstaltungen in der gleichen Zeit vgl. Flugsport Nr. 1, 1939, Seite 21.
Verehrte Leser des Flugsport! Bitte sparen Sie unnütze Nachnahmespesen und senden Sie uns die fällige Bezugsgebühr für das III. Vierteljahr 1939, RM 4.50, möglichst auf unser Postscheckkonto 7701 Frankfurt a. M. Nach dem 5. Juli werden wir diese zuzüglich 30 Pf. Spesen durch Nachnahme einziehen.
Diese Nummer enthält Patentsammlung Nr. 10, Bd. VIII, und Reportsammlung Nr. 14
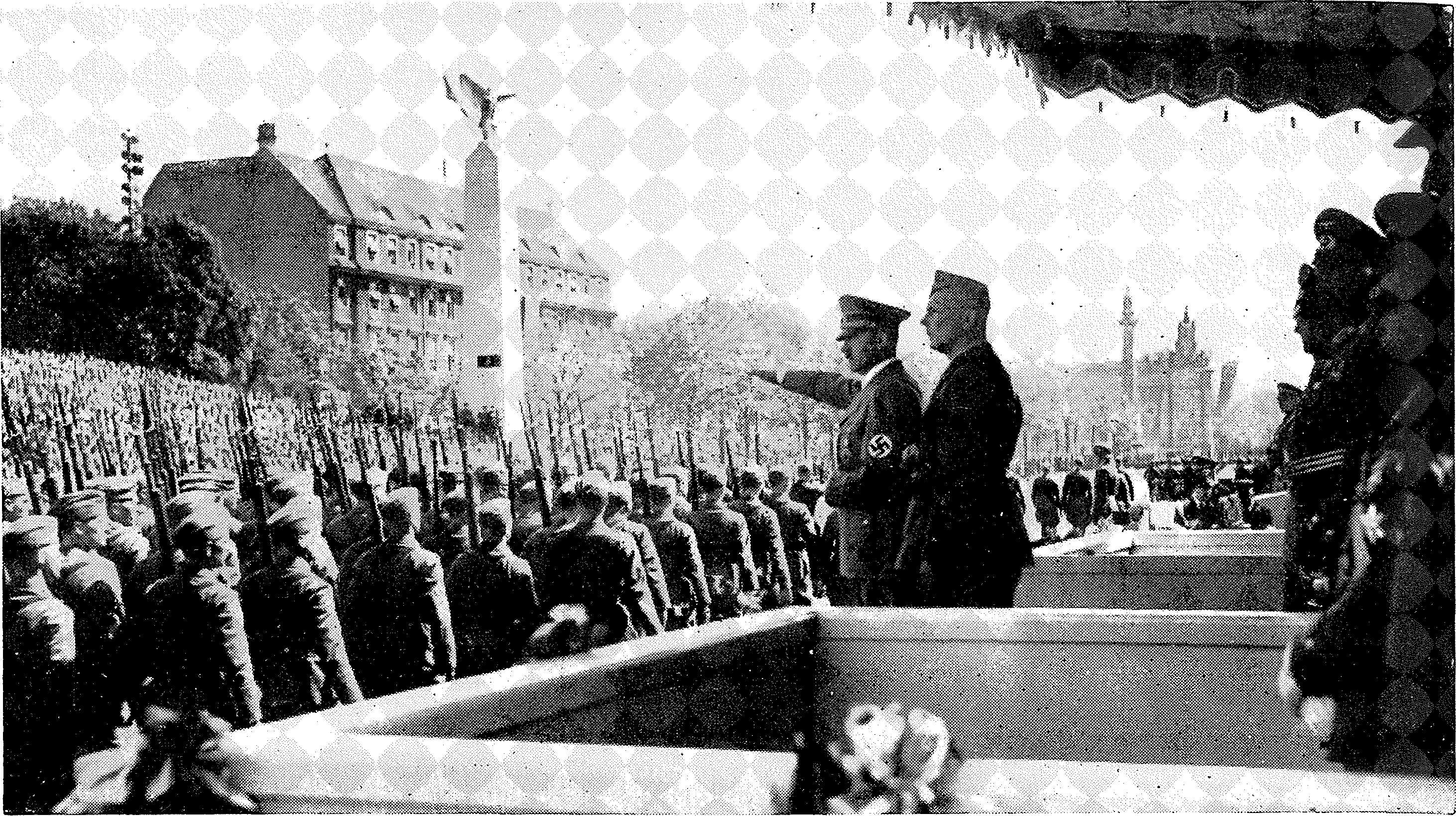
Einzug der „Legion Condor" in Berlin 6. 6. Der Führer nimmt vor der Techn. Hochschule den Vorbeimarsch der „Legion Condor" ab. Neben dem Führer der letzte Befehlshaber der Legion Condor, Generalmajor Dr. Freiherr v. Richthofen.
Kunst, zur Technik, zur Wirtschaft und zum Rundfunk herausgestellt. Energisch wurde das Sensationsbedürfnis der Presse in seine Schranken verwiesen. Höhepunkt der Tagung war der Besuch von Quidonia und die erstaunlichen Vorführungen der italienischen Kunstflugstaffel, dem der Duce persönlich beiwohnte. Das hohe Interesse, das Mussolini als Journalist und Flieger dem Kongreß entgegenbrachte, fand seinen Ausdruck darin, daß er die Leiter der Delegationen an Bord eines schweren 3-motorigen Bombers über sein Land flog.
Eine Ausstellung von Flugpostmarken mit wertvollem neuen und alten Material, eine Ausstellung über das Thema Flug und Kunst in
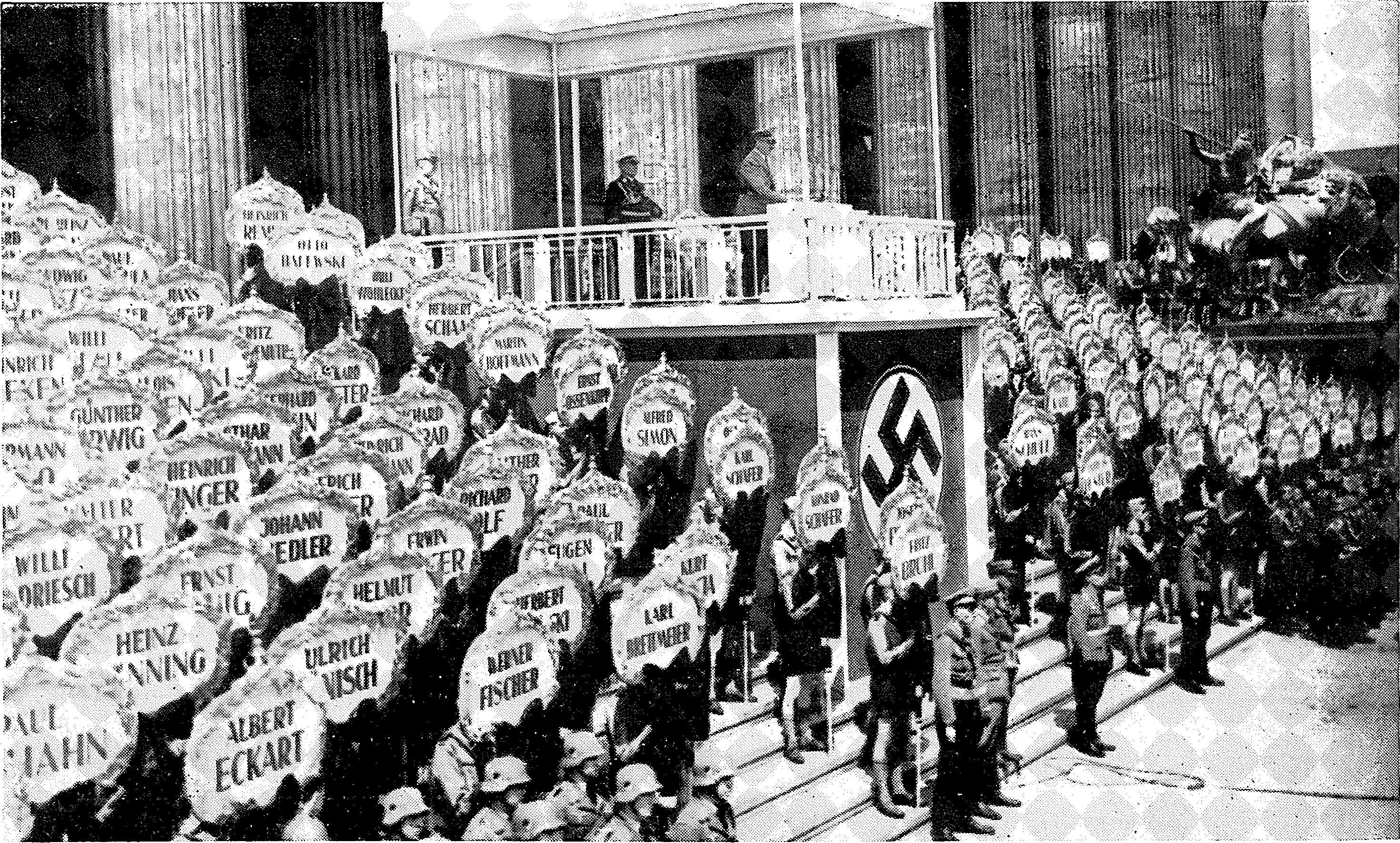
Heimkehr der „Legion Condor". Der feierliche Staatsakt im Lustgarten. Der Führer spricht. Hinter dem Führer Generalfeldmarschall Göring. Zu beiden Seiten rieht man auf Schildern, die von Hitlerjungen getragen werden, die Namen der in Spanien gefallenen deutschen Helden. Weltbild 2.
einer unerhörten Kühnheit der Komposition, eine leider von Deutschland sehr spärlich beschickte Flugphotoschau, ein Konzert von Musikstücken, die von fliegerischem Geiste inspiriert sind unter Molinari (u. a. Beethoven, Wagner, Mussorgsky), eine Theateraufführung des Ikarus Mythos zeigen neben zahlreichen gesellschaftlichen Veranstaltungen die farbenprächtige, den Flug total sehende Ausweitung des Kongresses. Ein Empfang beim Botschafter von Mackensen und ein Zusammensein der deutschen Delegation mit den italienischen Kollegen standen im Zeichen herzlicher deutscher Freundschaft in Rom. 1940 soll der Kongreß in Berlin, 1941 in Amsterdam und 1942 anläßlich der großen Weltausstellung wieder in Rom stattfinden.
Beim Sternflug ist der Erfolg der Siebel Werke, Halle, deren Bau-rnuster „Hummel" den ersten und dritten Platz belegte, besonders hoch zu werten.
Der Kongreß wird als Anfang einer internationalen Luftfahrtjournalisten-Gemeinschaft bedeutsam und wegweisend in die Geschichte des Flugwesens eingehen. Er hat Fragen aufgeworfen, deren Diskusion noch nicht abgeschlossen ist und deren Erledigung sich fruchtbringend für die Völker auswirken wird. Der Dank der deutschen Teilnehmer an ihre Gastgeber in Rom ist um so herzlicher, als die italienischen Staatsmänner der deutschen Luftfahrt schon in einer Zeit großes Interesse entgegenbrachten, als Versailles noch die fliegerischen Kräfte gefesselt hielt. So konnte beim Abschied der verdienstvolle und umsichtige Leiter der deutschen Delegation, Oberregierungsrat Dr. Or-lovius, den Dank der Teilnehmer in einem aufrichtigen Bekenntnis zur deutsch-italienischen Freundschaft zusammenfassen. Dr. Haanen.

Vom ; Weltkongreß der Luftfahrtpr-esse* Oben: ~F!tfgzeugpara4e ϖ Guidoniä. -Unterk Mitglieder der deutschen Delegation in Guidonia. X Dr. Orlovius.
Bilder: Flugsport

Vom Weltkongreß der Luftfahrtpresse. Bild: Flugsport
Der Duce sieht den Kunstflug von 30 Flugzeugen.
Holland. Segelflugzeug V-20.
Das Muster V-20 der N. V. Vliegtuigbouw, Deventer (Holland), soll verwendet werden als Uebungsmaschine für Thermik-, Wolken-, Blind- und einfachen Kunstflug.
Gemessene Leistungen: Sinkgeschw. 0,70 m/sec bei 56 km/h, Gleitwinkel 1 : 23 bei 72 km/h, mit ausgefahrenen Bremsen: Sinken 1,50 m/sec bei 55 km/h, minimal Fluggeschw. etwa 45—48 km/h.
Flügelumriß nahezu elliptisch, mit Wurzelprofil G-535 bis zum Stiel-Anschluß: von da gestrakt auf NACA M-6 (= G-676) am Ende. Geometrische Schränkung der Profilskelettsehnen gleich null. Jeder Flügel hat 2,5° V-Stellung zwecks Spiralstabilität.
Große, lange Querruder, mit mäßigem Differential angetrieben. Querruder in der Länge geteilt, wobei jeder Teil gesondert angetrieben wird. Beim hochgehenden Querruder macht der äußere Teil einen größeren Ausschlag als der innere. Diese Anordnung ergibt eine außerordentliche Rollwendigkeit. Kleine normale Querruderausschläge, somit geringe Handkräfte.
Der Rumpf wurde absichtlich sehr lang gewählt, um, zusammen mit großen horizontalen Schwanzflächen, gute Flugeigenschaften zu geben, für Führergewicht von 50—100 kg. Die Trimmklappe kann dann im Fluge benutzt werden, um auf verschiedene Geschwindigkeiten zu trimmen. Es stellt sich jedoch heraus, daß im Flugzeugschlepp nicht besonders nachgetrimmt zu werden brauchte. Es kann freihändig geschleppt werden mit 90—120 km/h bei normaler Trimmung (auf 60 km/h im freien Fluge).
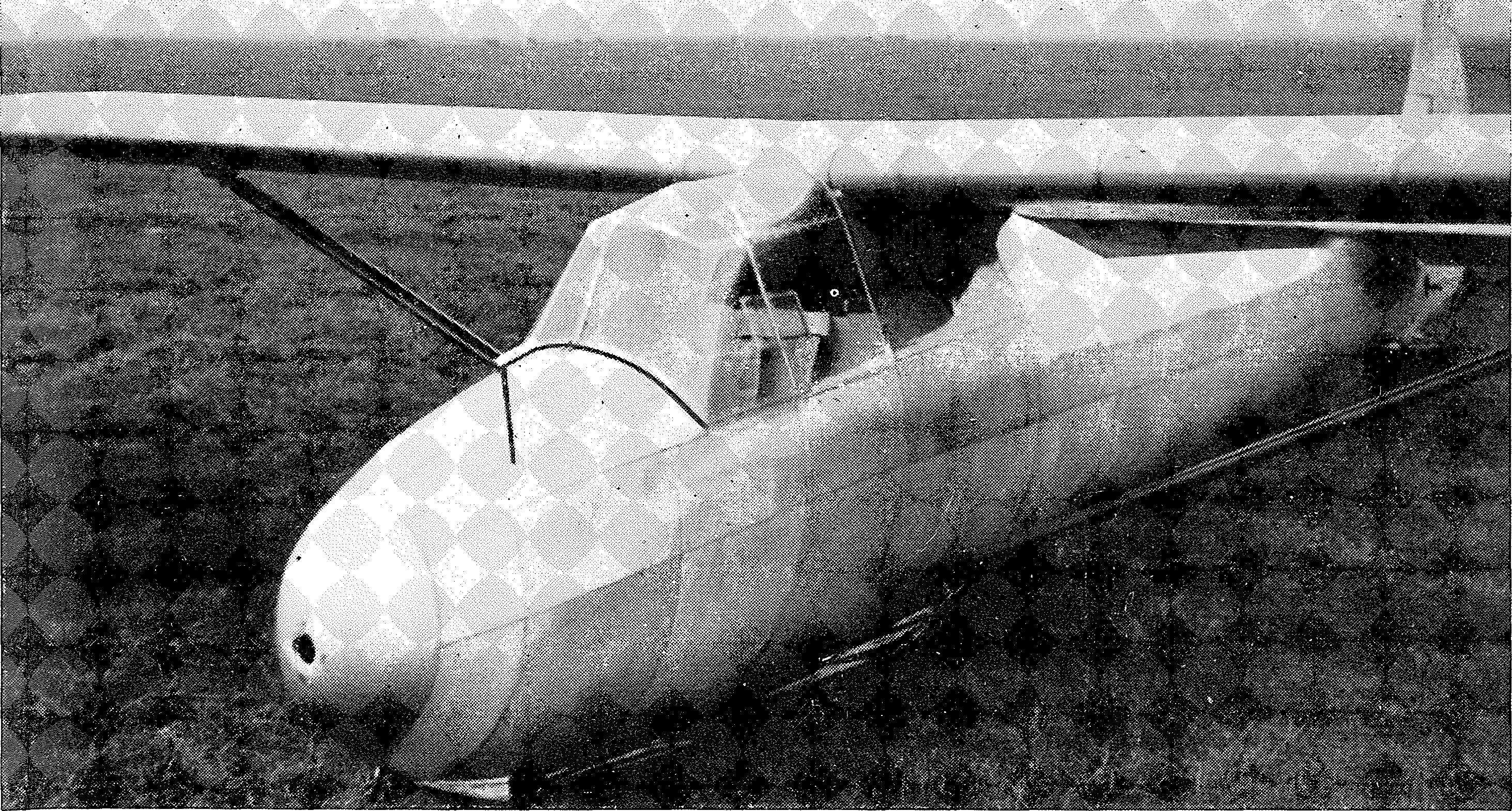
Holland. Segelflugzeug V-20. Werkbild
Die Sturzflugbremsen sind bei 60 km/h vollkommen ausbalanciert und geben, voll ausgefahren, einen Gleitwinkel von ungefähr 1 : 10. Einfluß auf Trimmung ist nicht vorhanden und die Wirkung ist augenblicklich und sanft, auch bei plötzlichem Schließen oder bei teilweise ausgefahrenem Stand.
Sicheres Lastvielfache: n = 4,5 über dem ganzen Abfangbereich im Sturzflug 200 km/h, sowohl mit als auch ohne ausgefahrene Sturzflugbremsen.
Für Rückenflug: n = 2,25, über dem ganzen „negativen" Abfangbereich im Sturzflug 200 km/h.
Flügel, ein Holm mit langem Diagonal (bis zum Stiel), Rippen am Holm geteilt, Fachwerkaufbau. Kastenholm mit viel Schotten. Sperrholznase parallel ausgezogen (zwecks Vereinsreparaturen!) — einfache Anschlußbeschläge. Bremsklappen sind oben und unten an durchgehende S-förmige Träger aus Stahlrohr angeschlossen, welche auf einem gemeinsamen Torsionsrohr angeschweißt sind. Diese sehr billige Bauart ergibt einfachen Einbau im Flügel. Das Torsionsrohr ist, neben den S-Trägern, in zwei verstärkten Rippen gelagert ^SS^^^£S^ und geht durch bis zum Rumpfanschluß. Bedienung im Sitzraum durch Handhebel, ohne Sperrklinke oder Feststelleinrichtung, während des Anschwebens kann jetzt frei „gespielt" werden mit den Bremsen, da Handkraft praktisch null ist.
Holland. Segelflugzeug V-20.
Zeichnung Flugsport
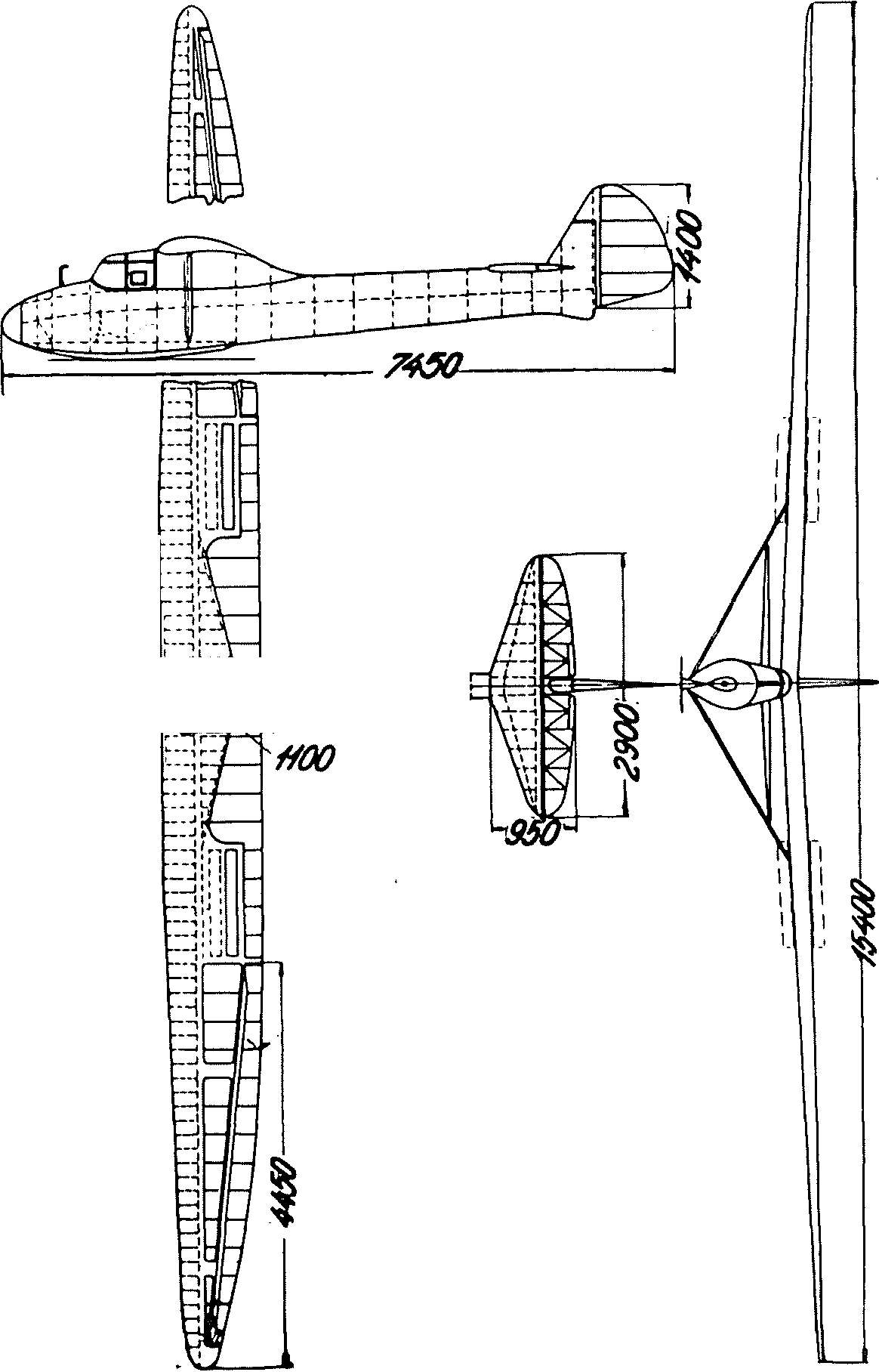
Querruder Torsionsnasen und Kasten. Dämpfungsfläche voll sperrholzbeplankt, mit verstärkter Nase zum Anheben des Rumpfes. Rumpfan Schluß auf drei konische Bolzen. Höhenruder- und Trimmklappen-
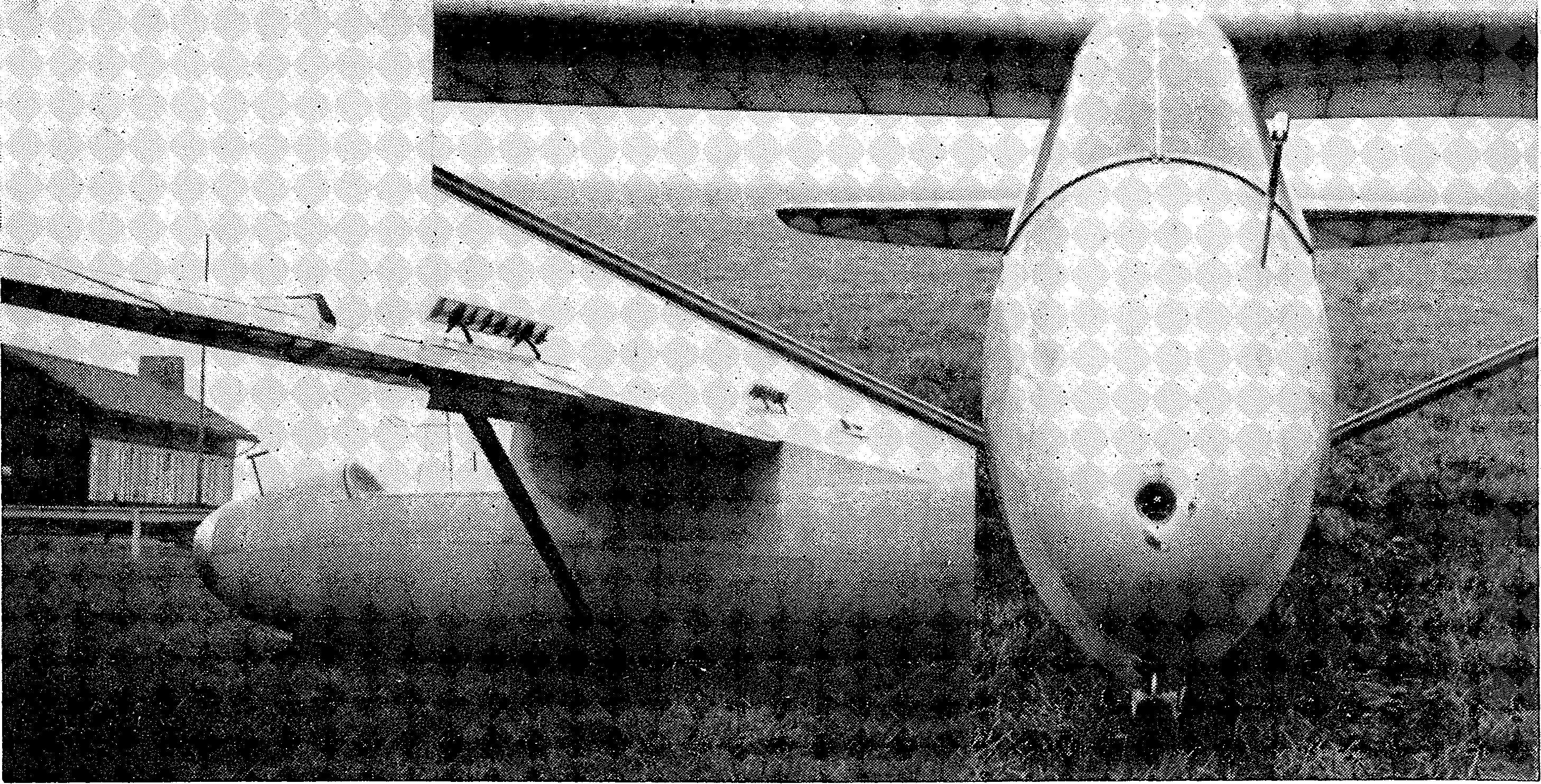
Holland. Segelflugzeug V-20. Links mit ausgefahrenen Bremsklappen.
Werkbilder
hebel kuppeln automatisch. Seitenruder mit Sperrholztorsionsnase und Diagonale.
Kielfläche mit Rumpf zusammengebaut, voll sperrholzbeplankt. Im Führersitz durchgehende Innenbeplankung. Flügelstiel aus Profilrohr — 80X40X1 — und oben und unten gelenkig angeschlossen.
Sitzausschnitt 840X540 mm — Haube sehr weit heruntergezogen, bis 100 mm unter Schulterlinie. Gute Sicht — auch nach unten und schräg rückwärts. Haubengerippe aus Stahlrohr 5X1 mm zusammengeschweißt, Cellon mit Cellonnietstreifen aufgenietet. Das Flugzeug kann mit oder ohne Haube ohne Aenderungen der Flugeigenschaften geflogen werden.
Bei Normalgeschwindigkeit „rauscht" die Haube etwas — noch vor dem Ueberziehen wird sie ganz still — auf höhere Geschwindigkeiten gedrückt, fängt sie an zu heulen, linear mit Fahrt zunehmend.
Spannw. 15,40 m, Länge 7,10 m, Flügelfläche 14,1 m2, Flügel-Schlankheit = b2/F 16,8, Dämpfungsfläche horiz. 0,98 m2, Höhenruder 1,00 m2, Querruder je 1,1 m2, Kielfläche 0,2 m2, Seitenruder 0,99 m2, Leergewicht 160 kg, Fluggew. max. 275 kg.
Handley Page „Hampden".
Eine kurze Beschreibung des Handley Page Hampden Bombers mit einigen Bildern haben wir 1938 Seite 431 veröffentlicht.
Die Maschine ist inzwischen in ihrem Aufbau auf Serienherstellung zugerichtet worden. Beauftragt sind die Baufirmen Short, Harland, English Electric Co. und in Kanada die Canadian Central Aircraft Corporation. Flügel dreiteilig, mittlerer Flügel mit dem Rumpf aus einem Stück. Landeklappen Typ Friese mit Schlitz pneumatisch betätigt Ansatzflügelbefestigung am Mittelstück mit vier Bolzen, Querruder über die ganze Länge des Ansatzflügels mit Schlitzen mit Flettner-Trimmklappen. Ein Hauptholm in I-Konstruktion. Hilfsholme für die Nase, an welchen die Schlitzklappen montiert sind und Trägerholm für das Querruder. Alles mit Glattblech bedeckt. Das Mittelstück des Flügels ist in der Rumpfbreite bis zum Vorderholm ausgespart, daß es von vorn bei abgenommener Rumpfnase in den Rumpf hineingeschoben werden kann.
Rumpf sehr schmal und hoch, hinter dem Flügel quadratisch. 4 Mann Besatzung, Führer, Beobachter, gleichzeitig Bombenschütze, Funker und MG.-Schütze. Führerverkleidung Schiebehaube nach hin-
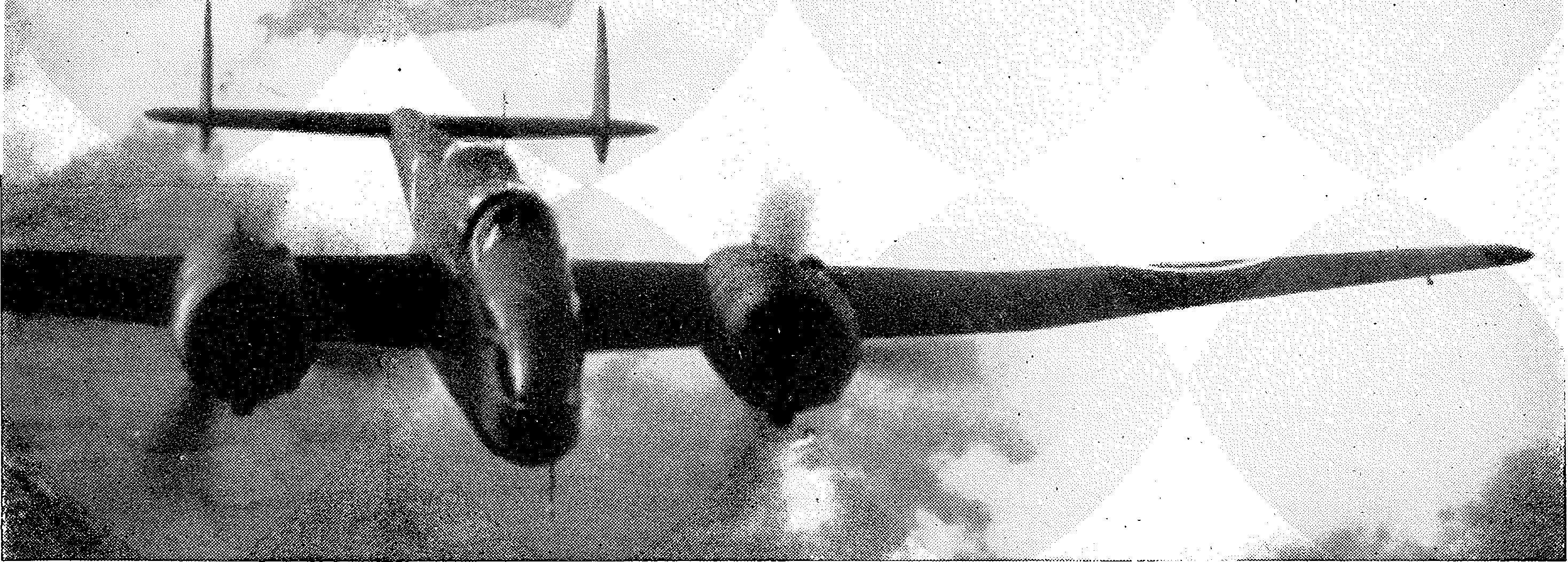
Handley Page Hampden Bomber.
Archiv Flugsport
teri. Bombenschütze in der Rumpfnase drehbarer Sitz, daneben MG.-Stand. In greifbarer Nähe Hebel für die Bombenabwerfeinrichtung und Photogerät. Hinter dem vorderen Beobachtungsraum Navigationsraum und Laufgang unter dem Führersitz hinweg nach den hinteren, oberen und unteren MG.-Ständen. Besondere Heizungs- und Belüftungsvorrichtung in dem Laufgang sowie an allen Posten Sauerstoffversorgung.
Rumpf dreiteilig, durchsichtiges Nasenstück, im Mittelstück Hauptaufenthaltsraum, Leitwerksträger bestehend aus zwei Schalenhälften mit senkrechten Trennfugen.
Feste Leitwerksfläche, zwei Seitenleitwerksflächen und Ruder. Zwei Bristol „Pegasus" XVIII Motoren überkomprimiert von je 975 PS,
Startleistung 1000 PS, Dreiblatt de Havil-land Schrauben.
Betriebsstoffbehälter 3000 in den Flügeln, Oelbehälter 1461 hinter den Motoren.
Fahrwerk, je zwei Federbeine mit dazwischenliegendem Lauf- lu4^---—t v
rad mit Brem-^Bg^gmmMieiffit sen, nach hinten nSt—^L3-m k
hinter die Motorverkleidung hochziehbar.
Ebenso Schwanzrad.
Handley Page Hampden Bomber.
Zeichnung Flugsport
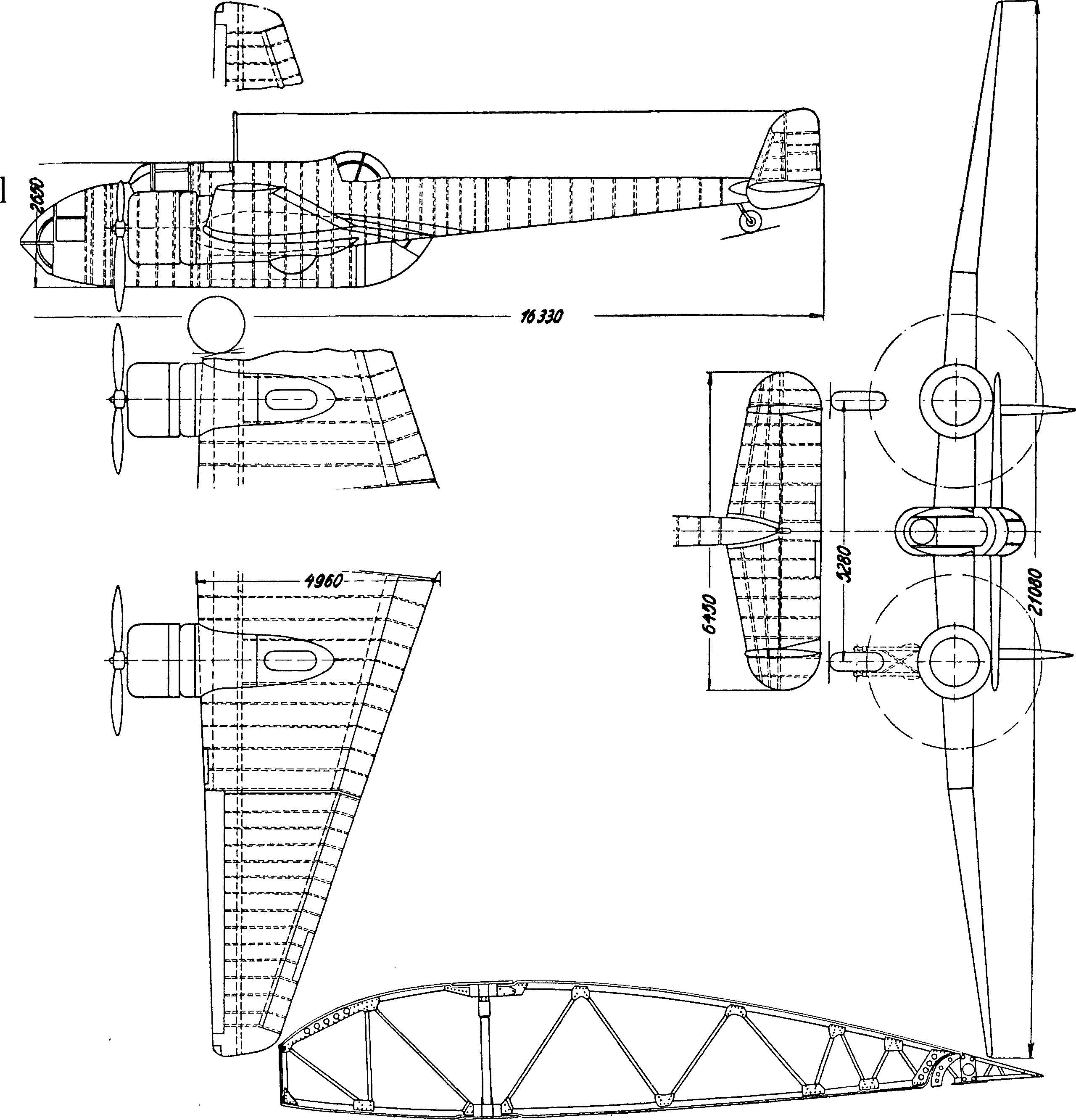
Handley Page Hampden: Oben links: Rumpf scha-lenhälfte des hinteren Rumpfteiles. Oben rechts: Hochziehfahrwerk. Mitte: Uebersichtsskizze der Einzelstücke. Am mittleren Rumpfstück und hinteren Leitwerksträger-rumpfteil erkennt man die Trennstellen der beiden Rumpfhälften. — Unten links: Versteifung des oberen mittleren Rumpfteiles. Unten rechts: Unterer Rumpfteil mit Uebergang zum Flügel.
Flieht
Spannweite 21,03 m, Länge 16,33 m, Höhe 5,28 m, Fläche 62 m2, Leergewicht 5354 kg, Fluggewicht normal 8525 kg, max. 9550kg.
Flächenbelastung 137 kg/m2, Leistungsbelastung 4,4 kg/PS. Leistungen mit 8525 kg
Fluggewicht (mit 9550 kg Fluggewicht): Max. Geschwindigkeit in 4700 m 427 km/h, Reise 350 km/h (341 km/h), Lande- 117 km/h, Steigzeit auf 4600 m 18 min 9 sec Startlänge mit 15 m Hin-
(27 min 2 sec), Gipfelhöhe 6900 m (5950 m),
dernis 500 m (740 m), Reichweite 600 bis 3000 km (800 bis 3200 km).
Bristol Beaufort Torpedo-Bomber.
Dieser Typ wurde während des Empire Airdays in Northolt gezeigt. Gebaut von Bristol Co. Zweimotor, Mitteldecker, als Torpedo-und Bombenträger. Am Ende des Rumpfaufbaues runde drehbare MG.-Kup-pel. Ganzmetallbauweise eingerichtet für Serienfabrikation mit Unterlieferanten. Flügel vierteilig, die äußeren Ansatzflügel leicht
Bristol Beaufort Torpedo-Bomber.
Zeichnung Flugsport
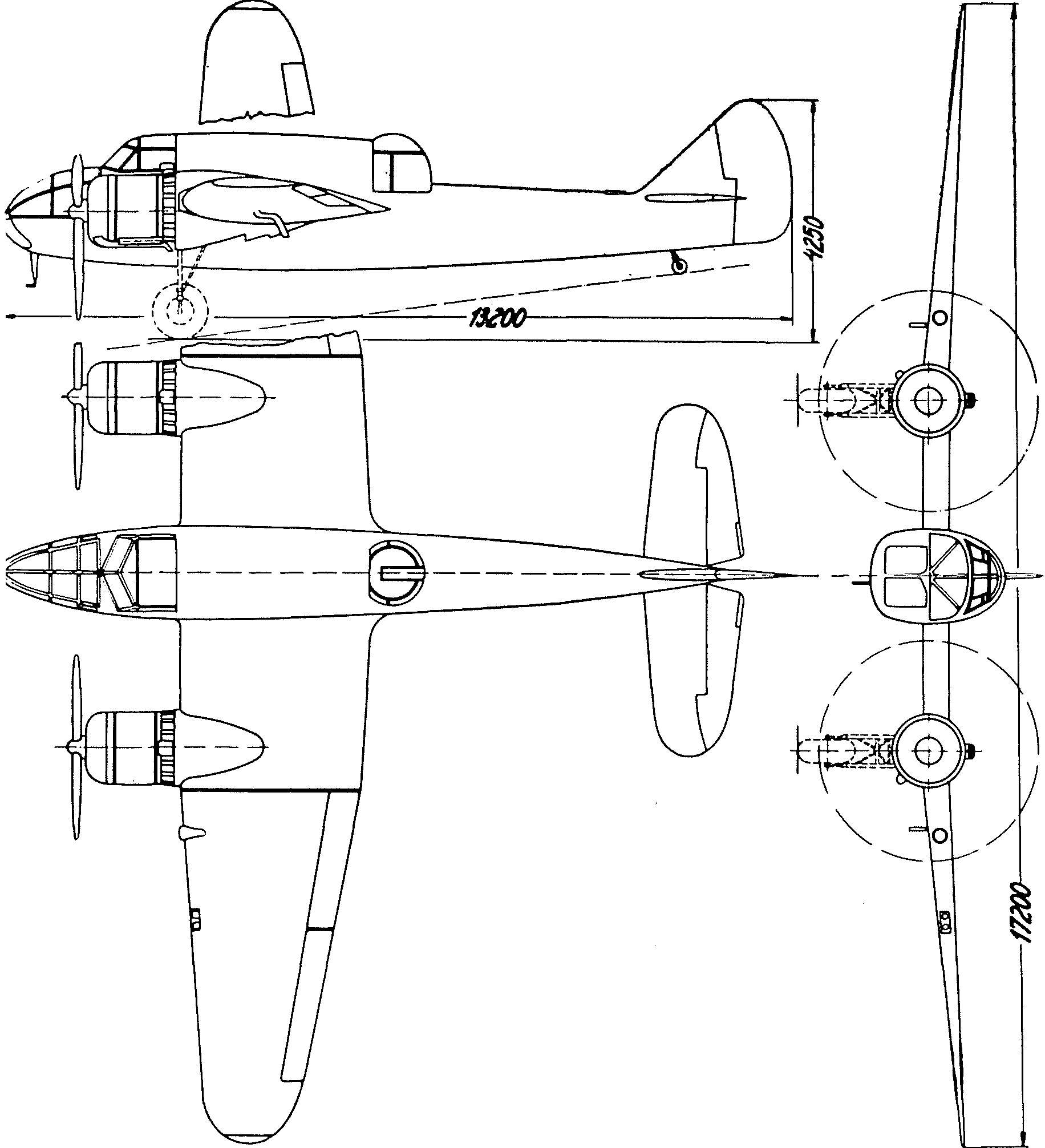
Bristol Beaufort Torpedo-Bomber mit zwei Bristol Taurus Schieber-Motoren.
Werkbild
V-förmig gestellt. Querruder mit Gewichtsausgleich, Landeklappen hydraulisch betätigt. Unter den Motoren nach hinten hochziehbares Fahrwerk. Schwanzrad hochziehbar.
Zwei Taurus doppelreihige Schiebermotoren, 14 Zyl., je 1000 PS, Sterndurchmesser 1,17 m. Hinter den Motoren regelbare Kragenklappenverstellung. Aggregate für pneumatische und elektrische Betätigung. Besatzung Führer, Beobachter, Schütze und Funker. Spannweite 17,2 m, Länge 13,2 m, Höhe 4,25 m. Geschwindigkeit annähernd 500 km/h. Bombenmagazin innerhalb des Rumpfes am Boden.
Englische Ueberdruckkabinen-PIugzeugprojekte.
Die Zeitschrift „Aeroplane" veröffentlicht drei Flugzeugprojekte der „General Aircraft Ltd." mit Ueberdruckkabinen.
Die Rümpfe sind vollkommene Drehkörper und auf Grund von Messungen mit dem Modell des Luftschiffes R 101 entworfen worden. Alle drei Entwürfe haben Druckkabinen, einziehbare Dreiradfahrwerke und Fowlerflügel. Für die Kabinenaufladung ist ein besonderes Aggregat, bestehend aus 2 luftgekühlten Motoren von je 25 PS, vorgesehen, das außerhalb der Druckkabine im Rumpfende untergebracht ist. Entwurf I und II sind Tiefdecker, Entwurf III ist als Hochdecker vorgesehen. Die Leistungen und Abmessungen von I und III stimmen überein.
Tiefdeckeranordnung gewährt, größere Sicherheit bei Notlandungen, nicht zuletzt durch die Ausbildung eines Luftpolsters kurz über dem Erdboden. Bei dem immer mehr zur Anwendung kommenden Dreiradfahrwerk bietet jedoch der Hochdecker Vorteile: größere Bodenabstände der Luftschrauben, bessere Sicht aus der Kabine und günstige Be- und Entlademöglichkeiten.
Abmessungen und errechnete Leistungen: Entwurf I: Spannweite 35 m, Länge 25 m, Flügelfläche 148 m2, Seitenverhältnis 8 3:1, Profildicke, Wurzel 16%, Spitze 9%. Rüstgewicht 14 200 kg, zahlende Last 1000 kg, Fluggewicht 21 700 kg.
Triebwerk: 4 Bristol „Herkules IVc" Schiebermotoren, 14 Zyl. in Doppelsternanordnung. Startleistung 4X1400 PS bei n = 2800 U/min; Dreiblattpropeller konstanter Drehzahl, 3,8 m-er.
Höchstgeschwindigkeit in H = 1400 m 425 km/h, Reisegeschwindigkeit in 11 = 900 m 400 km/h, Reisegeschwindigkeit bei 75% N in H = 3050 m 380 km/h. Gipfelhöhe viermotorig 8400, dreimotorig 5900 m, zweimotorig (einseitig) 2000 m. Steigzeit auf 3650 m: 10,9 min, Reichweite in H = 3650 m bei 320 km/h 4400 km, bei 260 km/h 4700 km.
Entwurf II und III: Spannweite 28,75 m, Länge 22,4 Flügelfläche 102 m2, Seitenverhältnis 8,1:1.
Rüstgewicht 8400 kg, zahlende Last 700 kg, Fluggewicht 13 000 kg. Triebwerk: 2 Bristol „Herkules 4c", Startleistung 2X1400 PS bei n = 2800U/min; Dreiblattpropeller konst. Drehz. 3,8 m Höchstgeschwindigkeit in H = 1400 m 370 km/h, Reise-geschw. in H = 3050 m 325 km/h, Reisegeschw. bei 75% N in H = 1500 m 310 km/h. Dienstgipfelhöhe 6100 m zweimot, 900 m einmotorig. Reichweite in H = 3600 m bei 290 km/h 3800 km, in H = 1500 m bei 310 km/h 800 km.
Entwurf I. Engl. Ueberdruck-Flugzeugprojekte.
The Aeroolane
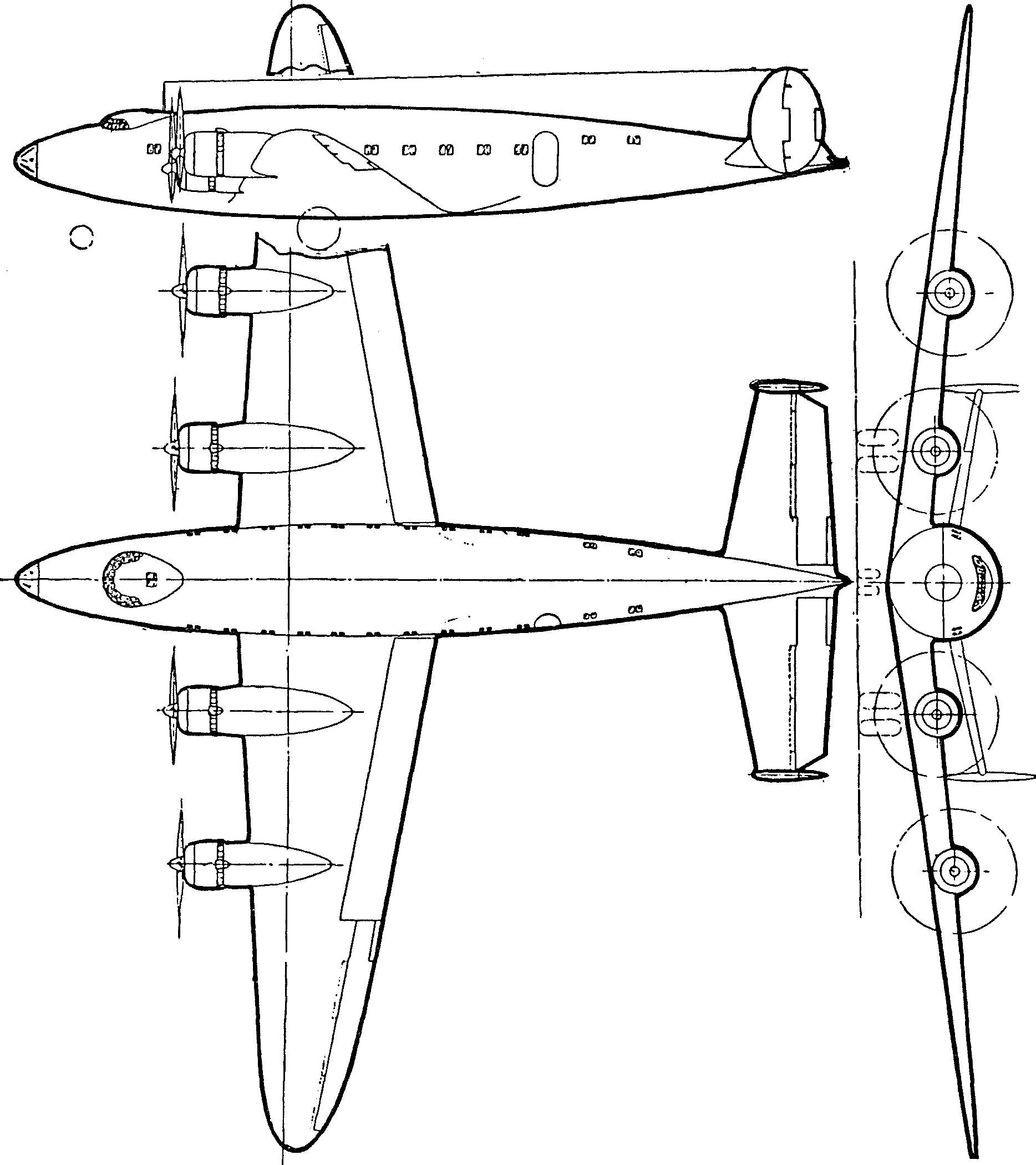
Entwurf IL Entwurf III.
Engl. Ueberdruck-Flugzeugprojekte.
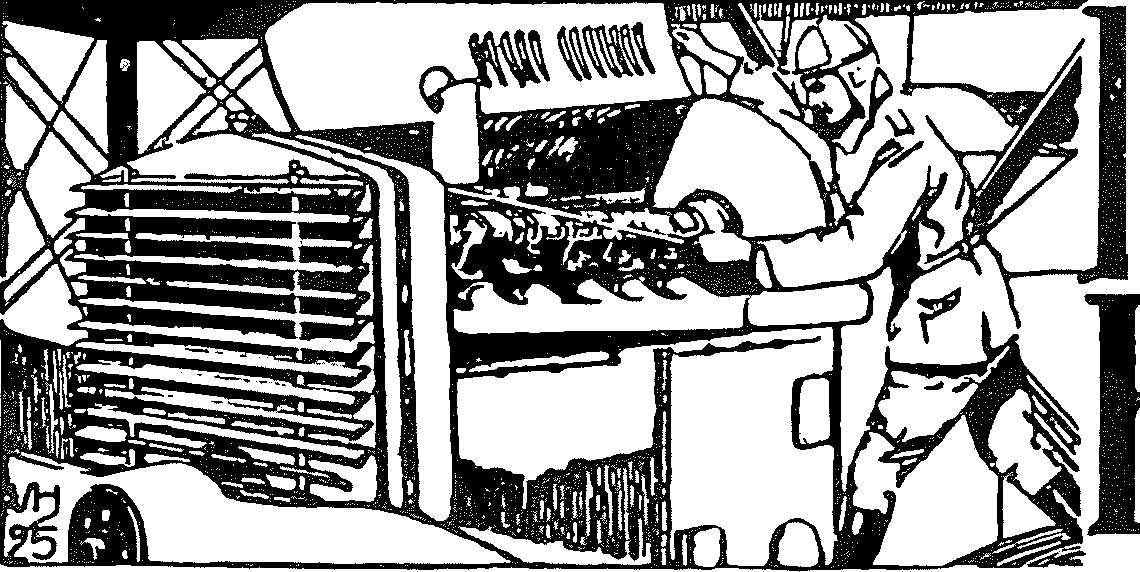
^QNSTRUKTIONS INZELHEITEM
Bristol Sternmotoren Luftkühlung.
Bristol hat hauptsächlich für die Perseus luftgekühlten Schieber-Stern-Motoren Versuche in den verschiedensten Richtungen angestellt, um die Wärme abzuführen. Notwendig erwies sich eine gesonderte Abführung der Wärme von dem ringförmigen vor dem Motor liegenden Auspuff-Sammelrohr. Zu diesem Zweck wurde der Auspuffsammel-ring mit einem besonderen Kühlmantel umgeben. Ein Teil der in der Stirnseite des Motors einströmenden Luft tritt bei a, vgl. die untenstehende Abb. 3, in den Ringmantel ein, umströmt das Ringsammel-rohr c und tritt bei b wieder aus.
Die seit 1932 durchgeführten Versuche ergaben insgesamt bessere Wärmeabführung und günstigere Kühlverhältnisse für die dahinter-
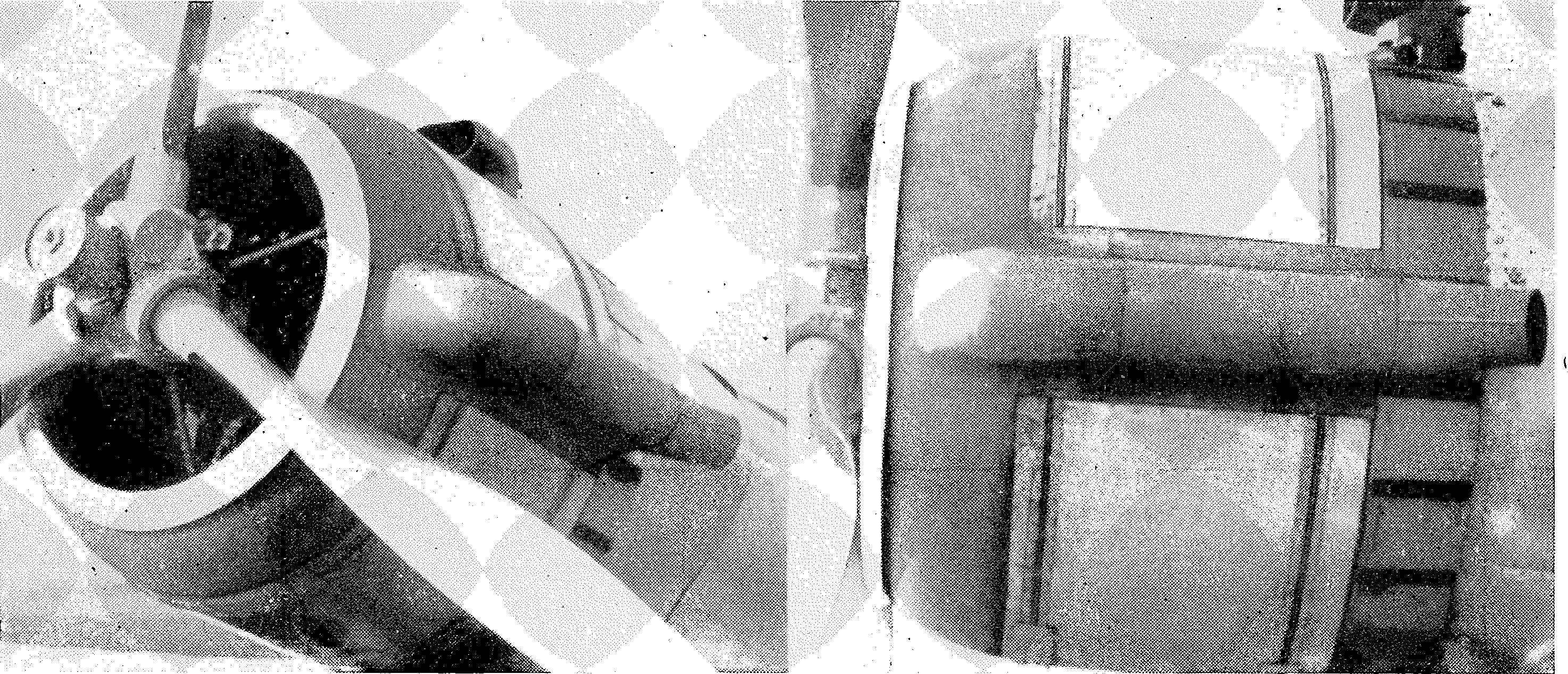
Abb. 1 u. 2. Bristol Motoren Kühlverkleidung. Archiv fiukspo:
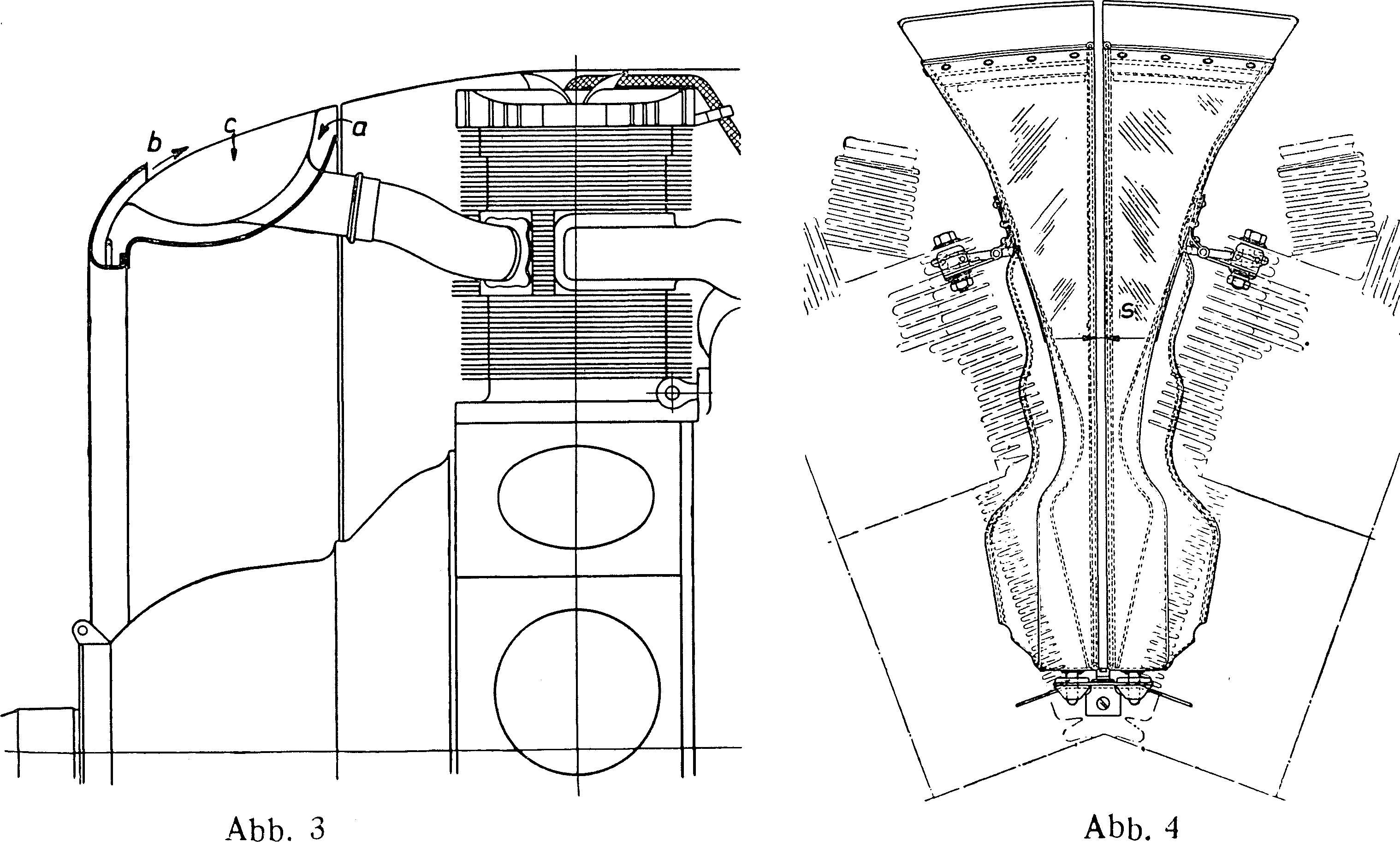
liegenden Zylindersterne. Hierbei wurden verschiedene Modelle mit verschieden großen Kanälen zwischen Auspuffsammeiring und Luftmantel versucht. Bei Verwendung in den Tropen ergab sich eine Vergrößerung der Kühlluftmenge um 15%. Luftmantel aus Duralumin in 5 Stücken, leicht abnehmbar.
Abb. 4 zeigt die Anordnung der Bristol Luftleitbleche für die präzise Kühlung der Zylinder. Der Abstand, vgl. nebenstehende Abb., kann je nach der Außentemperatur von 2,5 bis 5 mm von Hand eingestellt werden.
Curtiss Hawk 75,
TOT
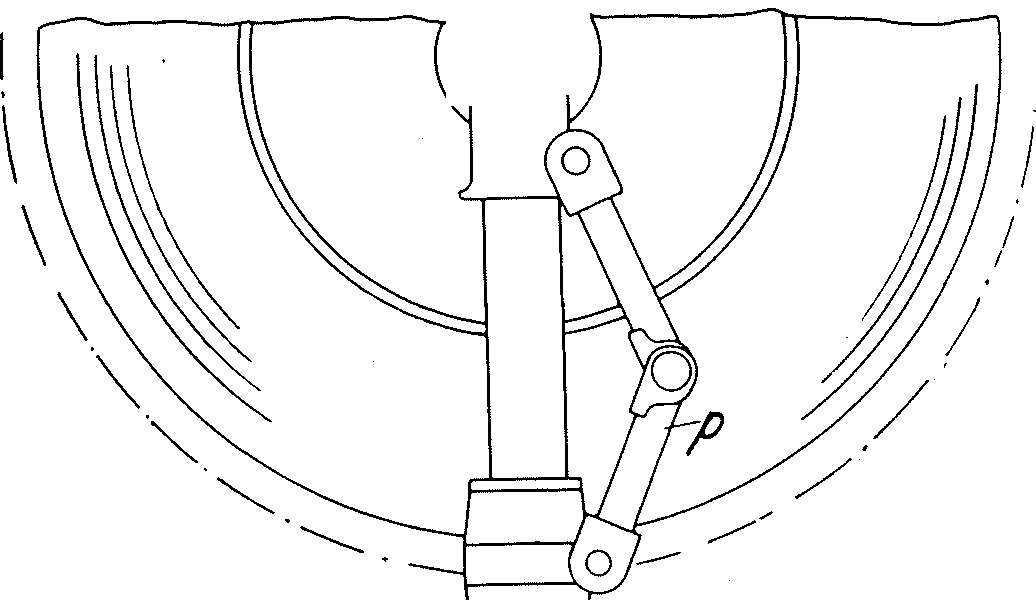
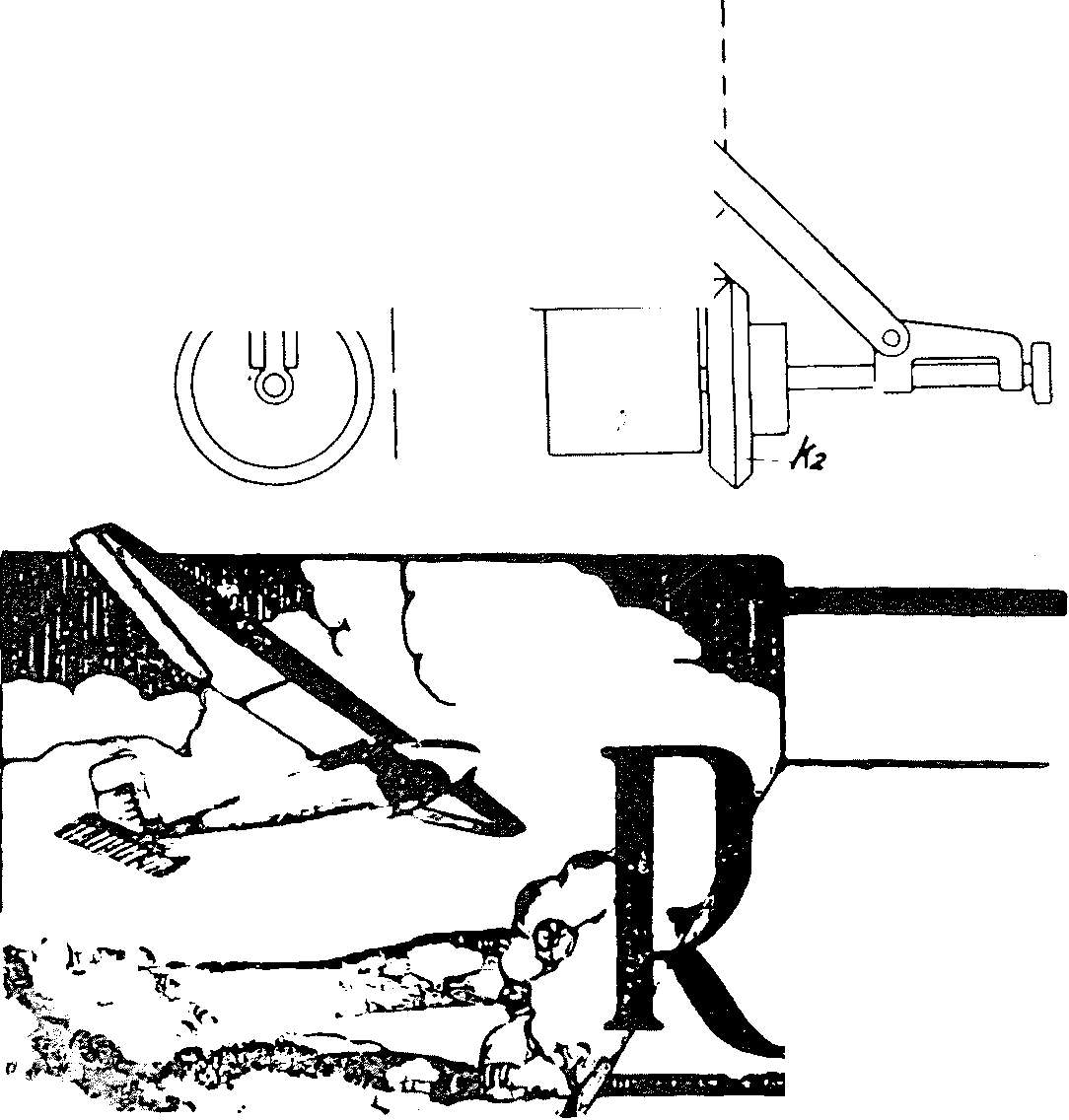
Einziehfahrwerk zum Einschwenken in den ,Flügel nach hinten oben, wobei das Rad um j 90° um die Achse des Federbeins gedreht werden muß. In der nebenstehenden Abbildung, Ansicht von unten auf den Flügel, ist rechts das Federbein hochgezogen, das Laufrad um 90° in der Ebene geschwenkt, dargestellt. Die Verdrehung des Federbeins um 90° wird durch Abrollen des Kegelrades K 1 um ein feststehendes Kegelrad K 2 erreicht. (Vgl. die Seitenansicht links in der Abbildung.) Das Fahrwerk wird mittels des Gestänges g ein- und ausgefahren. Die senkrechte gestrichelte Linie ist die Unterseite des Tragflügels. Ueber Einziehfahrwerke vgl. „Flugsport" 1937 S. 515—517.
FUJG
imSCHAl
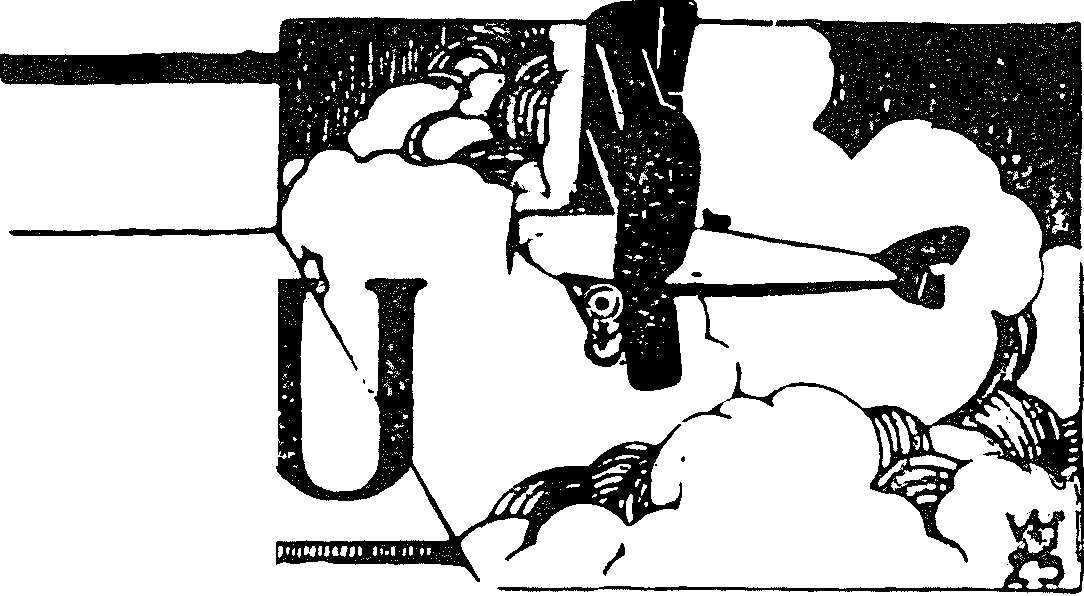
Inland.
Internationale Rekordanerkennungen. Klasse C, 4. Kategorie. Geschwindigkeit über 100 km (Deutschland).
Flugzeugführer: Max Brandenburg. Flugzeug: Storno 3, D-YNER. Motor: Zündapp Z 9-090, 1,8057 1. Strecke: Rotenburg—Delmenhorst, den 19. April 1939, 185,204 km/h.
Geschwindigkeit über 1000 km (Deutschland).
Flugzeugführer: Max Brandenburg. Flugzeug: Storno 3, D-YNER. Motor: Zündapp Z 9-090, 1,8057 1. Strecke: Bremen—Schwessin, den 26. April 1939, 187,746 km/h.
Ital. Jagdstaffel Führung Oberst Reglieri auf Einladung des Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe Generalfeldmarschall Göring nach Zwischenlandungen in Schleißheim und Merseburg in Döberitz als Gäste des Jagdgeschwaders Richthofen eingetroffen.
Fritz Achterberg t» Dipl.-Ing., ist am 12. 6. vorm. bei einer Notlandung mit einem Privatflugzeug bei Angermünde tödlich verunglückt. Der zweite Insasse wurde nur leicht verletzt. Achterberg trat 1935 34jährig in die Geschäftsleitung der Junkers Flugzeug- und -Motorenwerke ein. 1937 wurde er Mitglied des Vorstandes und Betriebsführer, wobei er sich für die beschleunigte Entwicklung des Schwerölflugmotors besonders einsetzte. Mit besonderer Energie trieb er die Erprobungsfernflüge mit der Ju 86 Schwerölflugmotoren von Dessau nach
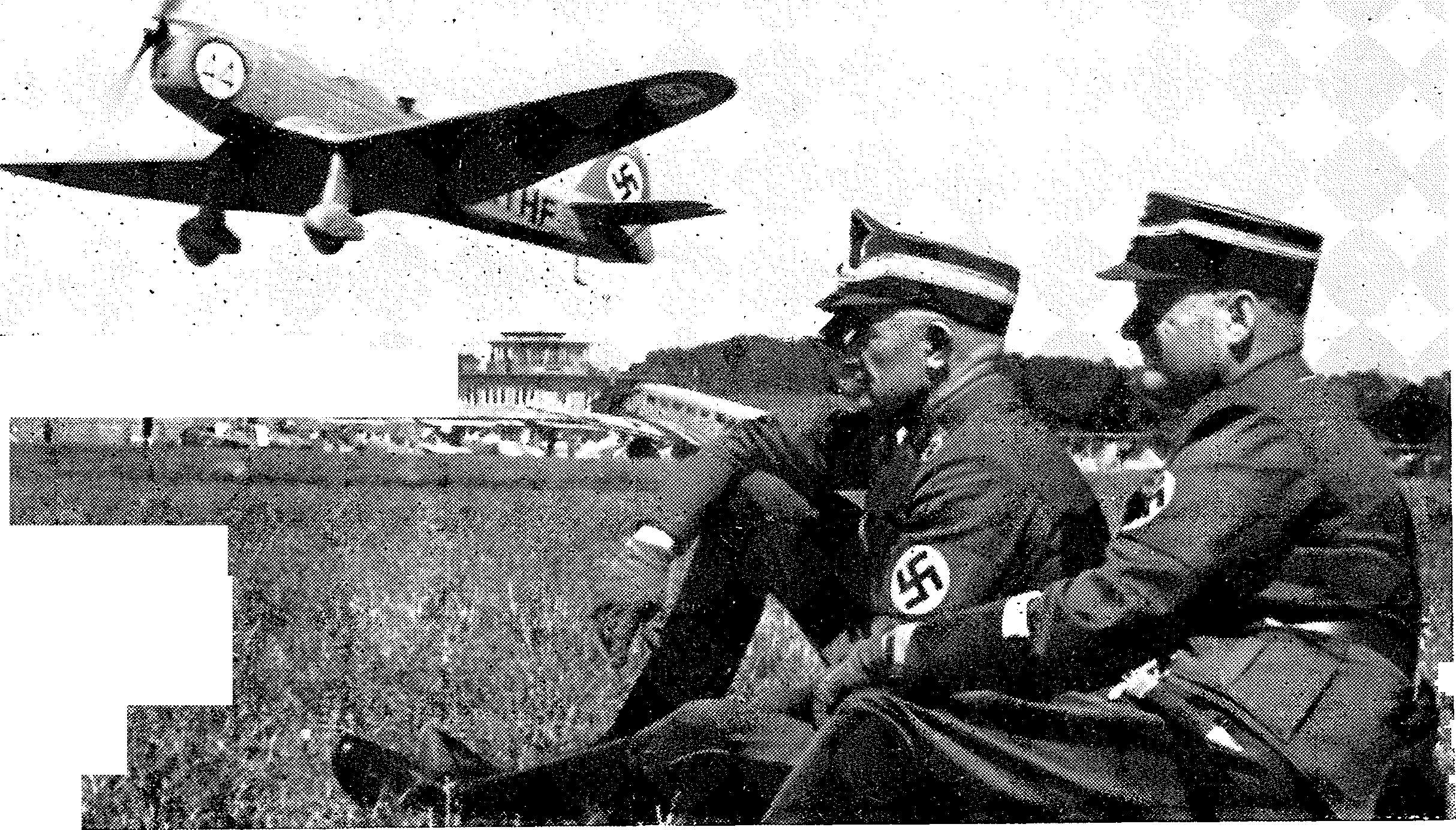
! ■ ;®£isb v.-; - Vtw: All
Start zum Nordostdeutschen Rundflug. Der Korpsführer des NSFK. General der
Flieger Christiansen, links Oberführer Hiss.
Weltbild
Bathurst vorwärts, an denen er als zweiter Flugzeugführer neben seinem Freund Flugkapitän Untucht teilnahm.
Was Acliterberg beim Aufbau der deutschen Luftwaffe durch Zusammenfassung aller Kräfte geleistet hat, ist nur in eingeweihten Kreisen bekannt geworden. Line echte Führerpersönlichkeit! Alle seine Kameraden und Freunde werden ihn nie vergessen! —
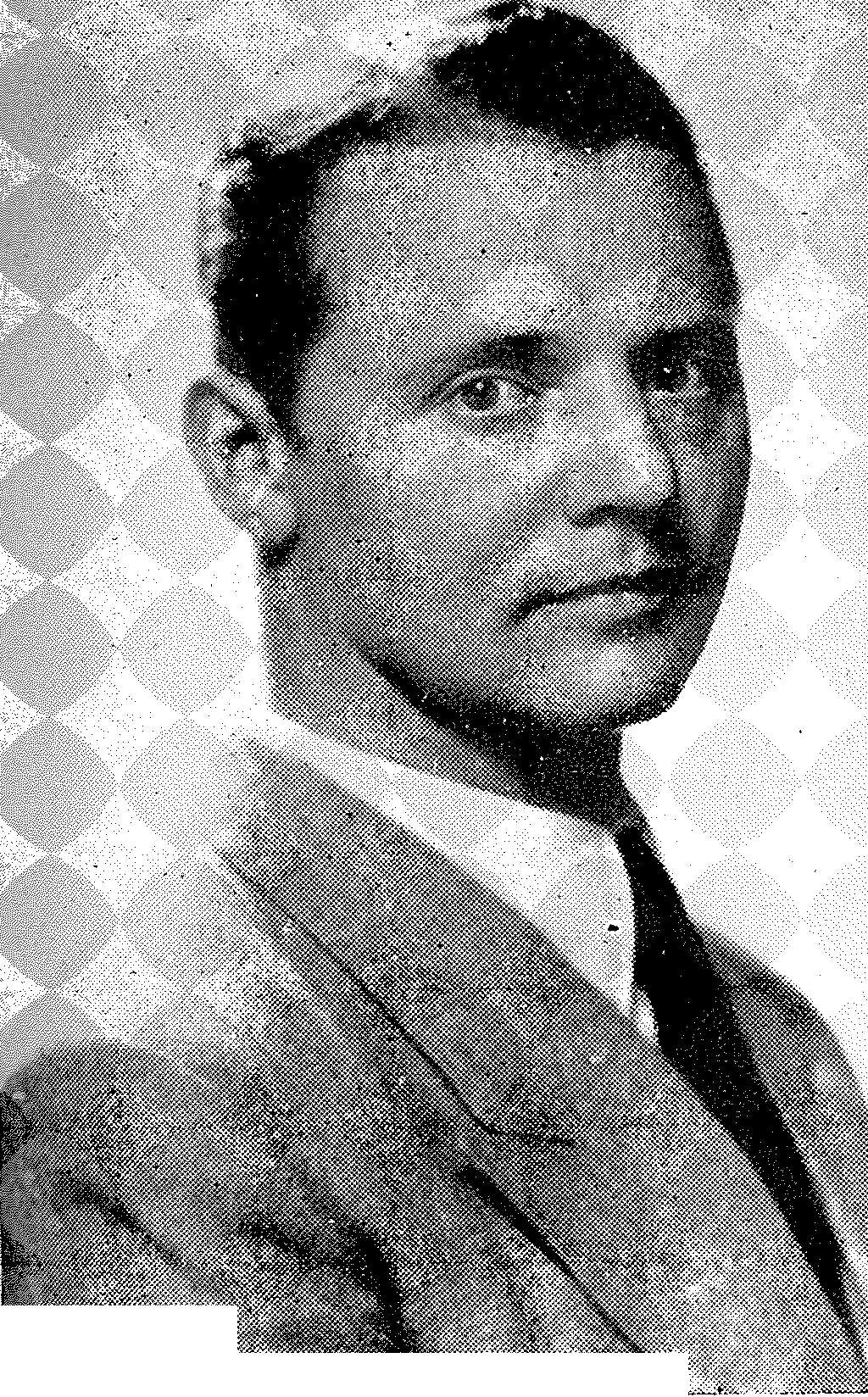
3-
V
Fritz Achterberg t.

Vom Freundschafts- und Verkehrs-Erkundungsflug Berlin—Tokio. Dir. d. DLH., Freiherr v. Gablenz, bei
der Ankunft in Hsinking. ^ie Einrichtung einer Flugstrecke Berlin—Tokio gehört zu den nächsten Aufgaben der Lufthansa.
Archiv Flugsport

Von Generalfeldmarschall Göring ging bei den Junkers-Werken folgendes Telegramm ein:
„Tief erschüttert über die Nachricht von dem tragischen Tod des Herrn Direktor Achterberg übermittle ich Ihnen und den Junkers-Werken meine tiefempfundene Anteilnahme. Sie selbst wissen, wie unersetzlich dieser Verlust nicht nur für Sie, sondern auch für mich und die ganze deutsche Luftfahrt ist. Ich werde diesem so überaus verdienten und wertvollen Mitarbeiter stets ein ehrendes Andenken bewahren. G ö r i n g, Generalfeldmarschall."
Nordostdeutscher Rundflug dieses Jahr veranstaltet an Stelle des großen Deutschlandfluges, begann programmgemäß am 10. 6. in Rangsdorf. Zugelassen waren 60 Sportflugzeuge, davon 40 vom NS.-Fliegerkorps und 20 von der Luftwaffe. Flugstrecke 1300 km Rangsdorf — Stettin — Wismar — Brandenburg — Kottbus — Görlitz über das Riesengebirge nach Breslau. Noch schwieriger wie die Geschicklichkeitsprüfung in Hindernislandungen in Rangsdorf waren die Orteraufgaben, wobei in der Nähe von Schweidnitz in der Nähe eines Flugplatzes eine andere freie Landefläche als Flugplatz getarnt, in seinen Größenabmessungen erkundet werden sollte. Es gab hier allerhand Verlustpunkte.
Sieger im Wettbewerb wurde die Luftwaffenbesatzung Oberltn. Lorch mit Ltn. Münzeberg vom Kampfgeschwader Hindenburg auf Focke-Wulf Stieglitz, Bramo-SH-14a-Motor, welche die goldene Hermann-Göring-Plakette des NS.-Fliegerkorps gewann. Ferner wurden Zweiter Hauer-Reiter von der NSFK.-Stan-darte 33 Jägersdorf auf Bücker-Jungmann, Hirth-Motor HM 6 R, Dritter Ltn. Mößner Ltn. Hülse von der Luftkriegsschule Gatow auf Focke-Wulf-Stieglitz.
Ostlandflug, 20. und 21. 5., Sieger die Dresdener Besatzung Obertrf. Goetz und Oberstmf. Hinz auf KL 35 B mit Hirth-Motor. Sie erhielten die Goldene Plakette des Korpsführers und den Ehrenpreis der Stadt Königsberg.
Elly Beinhorn-Rosemeyer von ihrem Alleinflug nach Bangkok auf der Rückkehr in Teheran gelandet, hielt Vortrag vor der Deutschen Kolonie.
Spanienkreuz in Gold mit Brillanten wurde von Generalfeldmarschall Göring während der Empfangsfeierlichkeiten für die Spanienfreiwilligen den früheren Befehlshabern der Legion Condor, General der Flieger Sperrle, General der Flieger Volkmann und Generalmajor Freiherrn von Richthofen überreicht.
Abwerfen von Gegenständen aus Luftfahrzeugen nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 80 Luft-VO.) — außer Ballast — verboten. Gesuchen um Ausnahmen von diesem Verbot, die bei den Luftämtern anzubringen sind, kann grundsätzlich nur in besonders begründeten Einzelfällen stattgegeben werden, wenn das Abwerfen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in keiner Weise beeinträchtigt, Abwerfen ausschließlich gemeinnützigen Zwecken dient und durch das Abwerfen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in keiner Weise beeinträchtigt werden.
Was gibt es sonst Neues?
Walter Rethel, Obering., 1. Juli 25 Jahre Flugzeugbau. 1914 Chefkonstr. Kondor, 1920 Fokker, 1925 Arado, jetzt Konstrltr. Messerschmitt. Vorkriegsflieger-Treffen Frankfurt a. M. 29.—30. Juli. King's Cup Rennen, Start Birmingham Flugplatz, 2. 9. Handley Page Ltd. 30jähriges Bestehen 17. 6. Fokker G. 1 Serie von holländischer Regierung bestellt. Major Mayo, techn. Berater der Imperial Airways.
Ausland.
Internationale Normentagung ISA (International Federation of the National Standardizing Associations)
vom 26. 6. bis 8. 7. 1939 in Helsingfors in Finnland. Die ISA, die ihre letzte Hauptsitzung bekanntlich im Juni 1938 in Berlin abhielt, faßt die Nationalen Normenausschüsse von 20 Ländern zusammen. Ziel ist die Angleichung der nationalen Normen, um den Warenaustausch von Land zu Land zu erleichtern.
In Helsingfors werden folgende 16 ISA-Komitees tagen: Federringe. — Beratung über Größen, Toleranzen und technische Lieferbedingungen.
Holzschrauben. — Weiterbehandlung der Vorschläge der Tagung in Berlin 1938
über Größen und Gewinde. Wälzlager. — Größen, Toleranzen für Kugel- und Rollenlager, Lagergehäuse.
Schiffbau. -— Bestimmungen über Poller, Rettungsboote, Lufttanks und Lotsenleitern, Ankerketten, Trossen, Fenster, Lastbäume, Kohlenluken, Reeling usw.
Technische Zeichnungen. — Vereinheitlichung der Bestimmungen für die Ausführung von Zeichnungen, u. a. Sinnbilder, Maßeintragung, Schraffierungen.
Wellenenden. — Passungen von Wellenenden für Kupplungen, Riemenscheiben, Zahnräder usw.
Keile. — Toleranzen für Keile, Keilstahl und Keilnuten.
Normaldurchmesser. — Feststellung von Normaldurchmessern unter 1 mm und über 500 mm.
Petroleumprodukte. — Weiterbehandlung der in früheren Sitzungen aufgestellten Vorschläge: Regeln für die Untersuchung der Säurezahl, Verseifungszahl und die Menge an fester Asche und Verunreinigungen, Beförderung, Lagerung und Verteilung.
Werkzeuge. — Gewindebohrer und Spiralbohrer, Toleranzen für Werkzeugstahl und Schleifscheiben.
Meßdüsen. — Aenderungen früherer Beschlüsse über Meßdüsen.
Terminologie. — Aufstellung eindeutiger Begriffsbestimmungen für technische Wörter und Ausdrücke, Vorbereitung der Veröffentlichung eines internationalen technischen Wörterbuches.
lextilwesen. — Umrechnungstabellen für Garnnummern, mechanisch-technische Prüfungsmethoden, Konditionierungsbestimmungen.
Werkzeugmaschinen. — Werkzeugbefestigung an Fräsmaschinen, Wellenenden für elektrische Kraftübertragung, Umlaufzahl und Antrieb, T-Nuten, Bewegungsrichtungen der Bedienungsteile.
Polstermaterial. — Beratungen über den zweiten internationalen Vorschlag für Prüfungs-, Güte- und Lieferbestimmungen für Polstermaterial aus Tierhaaren oder Tierhaarmischungen für Tapezierer- und Sattlerzwecke.
Siebe. — Weiterbehandlung der in früheren Sitzungen aufgestellten Vorschläge.
Es werden etwa 300 Vertreter aus 21 Ländern erwartet. Der Deutsche Normenausschuß wird ebenfalls durch verschiedene Fachleute vertreten sein.
Sir Philip Sassoon t, engl. Unterstaatssekr. im Air Ministry, im Alter von 50 Jahren am 3. 6. gestorben.
Engl. Weekend-Flug nach Ungarn als Gegenbesuch der Ungarn in England 24.-29. 6.
Louis Weiller von der Societe Gnome soll angeblich Lizenzen nach dem Ausland verkauft haben. Diese Affäre hat der französ. Tagespresse ausgiebigen Stoff gegeben.
Fluglinie Paris—Bukarest der Air France mit Zwischenlandungen in München, Budapest und Arad. Verkehr täglich in jeder Richtung. Seit 12. 6. in Betrieb.
Ital. Luftwaffe im Spanienkrieg nahmen teil 5699 Offz., Uffz. u. Mannschaften, 312 Zivilpersonen. Ausgeführt wurden 86 420 Flüge, Sprengstoff ab wurf 11 584,4 t, 1 042 712 Patronen verfeuert, 266 Luftkämpfe, 5318 Bombenflüge, 2170 Erkundungsflüge, 155 Bombenangriffe: 224 rotspan. Schiffe getroffen, 903 Flugzeuge abgeschossen, weiterhin auf Flugplätzen 40 zerstört. Eigener Verlust 86 Flugzeuge, 175 Tote, 192 Verwundete.
Bloch 161, 37 Tonner, Viermotor für 33 bis 35 Fluggäste in der Konstruktion.
Franz. Luftministerium bestellte zwei Lockheed 14 für 11 Fluggäste für die
Denkmal für den nationalspanischen General Mola, welcher vor 2 Jahren tödlich abstürzte, an der Unfallstelle in Alcocero. Der mittlere Bogen trägt den Namen General Molas, die übrigen die seiner Kameraden.
Weltbild
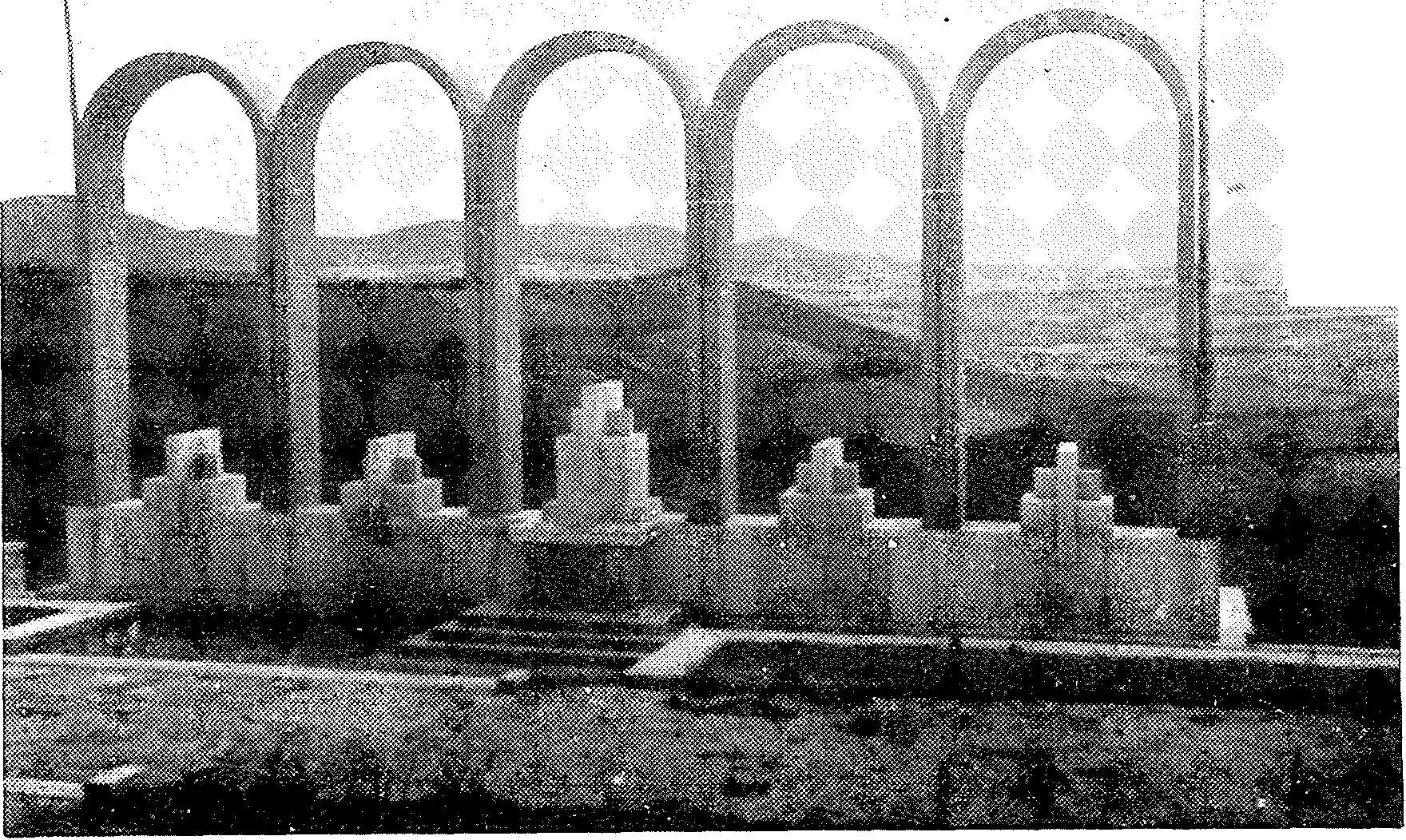
Linie „Air—Afrique", die von dem Luftministerium subventioniert wird. Höchstgeschwindigkeit 400 km/h, Reise 360 km/h, Reichweite 1850 km.
Spanien Luitverkehr der Deutschen Lufthansa wieder im Betrieb. „Visa special" nicht mehr erforderlich. Reisepaß muß Vermerk der zuständigen Polizeibehörde „gültig für Reisen nach und durch Spanien" enthalten. Z. Zt. werden folgende Flughäfen in Spanien angeflogen: Madrid, Barcelona, Burgos, Malaga, Sevilla, Saragossa, Cadiz, Palma de Mallorca, Vitoria und Pollenza.
Douglas DC 6 soll ein Verkehrsflugzeug mittlerer Größe, 4 Wasp Junior Motoren, 14 000 kg Fluggewicht, werden.
Thomas Smith überfällig, verwendete Maschine soll eine Aeronca gewesen sein.
Consolidated will Atlantik-Flugversuche auf der Strecke New York—Bisca-rosse und New York—Terre Neuve—Großbritannien machen, vermutlich mit dem neuen Consolidated Modell 31.
Segelflug
Italien. Segelflug untersteht RUNA. Ausbildungsplan 5 Klassen. 1. Klasse theoretische u. prakt. Ausbildung, Gleitflugzeugbau. Klasse 2 Schulung A u. B, soweit Gelände vorhanden ist. Klasse 3 Schulung A u. B. mit eigenem Schulgelände, gleichzeitig Ausbildung von Lehrern für Gleit- und Segelflugschulen. Klasse 4 Schulung C u. D, Segelflugschule Asiago nach festgesetzten Lehrgangsplänen. Klasse 5 Schulung C u. D in Sezze Littoria, ebenso Sonderschulung vor Wettbewerben.
Engl, nation. Segelflug-Wettbewerb in Camphill, 8.—16. 7, Derbyshire, Veranstalter British Gliding Association.
16 Std. M Min. segelte Manduech bei Tunis am 28. 5. Damit wurde der fianz. Dauerrekord, den Neßler bisher mit 16 Std. 5 Min. hielt, um 25 Min. geschlagen.
II. Schweiz, nationale Segelflugmeisterschaft 1939, 23.-29. 4. 1939, Flugplatz Bern-Belpmoos, Veranst. Berner Aero-Club. Teilnehmer: Spalinger, Gr. Baden, S. 18; Waithard, Gr. Baden, S. 19; Godinat, Gr. Zürich, Spyr III; Guenat, Gr. Neu-chatel, S. 18; Widmer, Gr. Gränichen, S. 18; Haberstich, Gr. Brugg, S. 18;

Jochen Kühn landete am 28. 5. auf einer Mü 13 in der Reichsgartenschau in Stuttgart nach Zurücklegung von 106 km. Ueber den Flug berichteten wir bereits im „Flugsport" Nr. 12 S. 317. Ursprünglich wollte Jochen Kühn auf dem Flugplatz landen. Als er jedoch in der Höhe über der Gartenschau kreiste, lockten ihn die grünen Flächen, und bald landete er inmitten prächtiger Gärten auf dem Edelrasen — ohne Eintrittskarte!
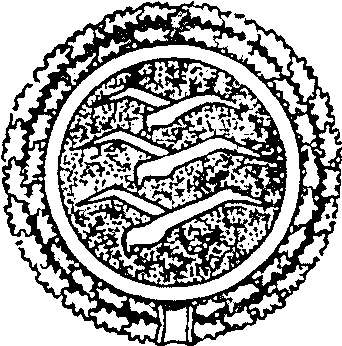
Schäfer, Gr. Basel, Bussard; Hohl, Gr. Lenzburg, S. 15; Derendinger, Gr. Gren-chen, S. 15K. Höchstleistungen 5 Std. 58 Min. (Widmer); Höhe 1860 m (Waithard); Strecke 161 km (Godinat). Insgesamt 99 Starts. Gesamtflugdauer 17 Std. 6 Min. Gesamtstrecke 1385,4 km. Schweiz. Segelflugmeister wurde Rolf Waithard und erhielt den Wanderpreis des Eidg. Luftamtes. Dann folgten Godinat, Spalmger, Guenat, Derendinger.

Kompaß-Absaugsteuerung.
In den letzten Jahren gewann die Steuerung der Flugmodelle mittels Kompaß immer mehr Verwendung; denn die mangelhafte Richtungsstabilität der Modelle ist ohne mechanische Beeinflussung nicht zu beseitigen. Die Ausführungen sind mehr oder weniger geschickt. In allen Fällen bedient man sich der elektrischen Ueber-tragung. Diese Art der Steuerung bringt viele Störquellen mit sich, z. B. mangelhafter Kontaktdruck, Kleben der Nadel an den Kontakten oder zu großer Luftdruck auf Ruder oder Störklappe. Außerdem ist diese Steuerung durch die Batterie zeitlich gebunden und verursacht bei jedem Flug Unkosten. Ich habe
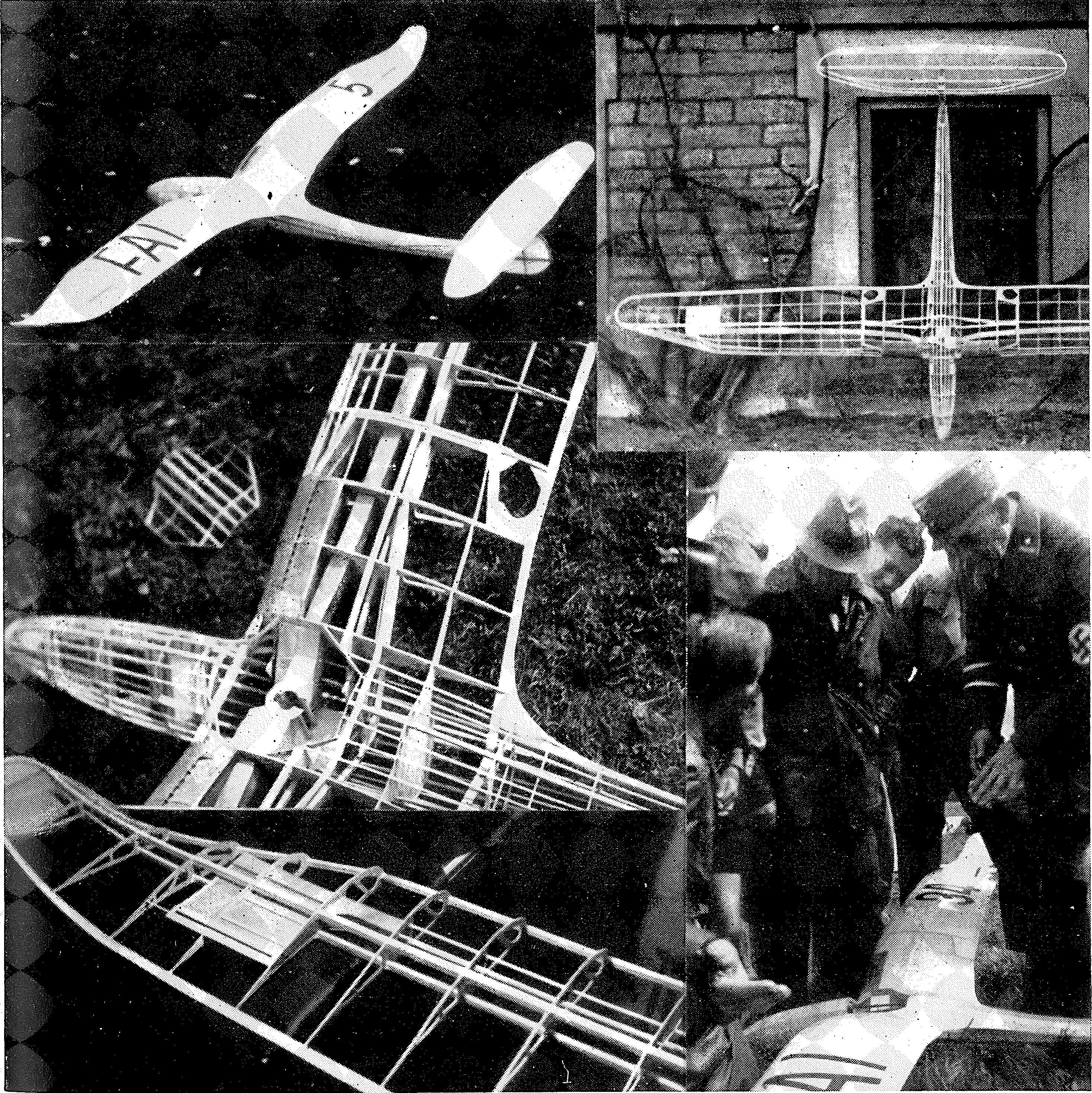
Vom Reichswettbewerb für Segelflugmodelle auf der Wasserkuppe 27.—29. 5. 39. Herold Modell mit Kompaß-Absaugsteuerung. In der Abb. links Mitte erkennt man den nach den Flügelenden führenden Luftkanal mit der Oeffnung für den zylindrischen Steuerungsschieber. Rechts unten Oberscharführer Hillebrecht.
Archiv Flugsport
ein Modell gebaut, bei dem die Druckunterschiede am Tragflügel ausgenutzt werden.
Beiderseits des Rumpfes befindet sich in der Flügelnase ein 450 qmm großer Schlitz. Der Abstand zwischen beiden beträgt 300 mm. Diese Schlitze sind durch zwei sich kreuzende Kanäle mit zwei am Flügelende liegenden Schlitzen verbunden. Letztere haben 1860 mm Abstand und sind 380 qmm groß. Beide Kanäle können während des Fluges geöffnet oder geschlossen werden. Das geschieht durch einen Drehschieber, welcher von einer 120 mm langen Magnetnadel gesteuert wird. In normaler Flugrichtung sind beide Kanäle geschlossen. Weicht das Modell vom Kurs ab, so wird einer der beiden Kanäle geöffnet. Jetzt wird die Luft vom am Flügelende liegenden Schlitz durch den geöffneten Kanal aus dem am Flügelübergang liegenden Schlitz gesogen. An dem äußeren, im hinteren Teil des Flügels liegenden Schlitz ist im Notfall die Luft verwirbelt. Im Fall der Absaugung lösen sich die Wirbel auf. Ueber dem Flügelteil tritt eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit ein, der Auftrieb vergrößert sich und bringt das Modell durch Querlage wieder in die gewünschte Flugrichtung. Man könnte die Wirkung noch vergrößern, wenn man durch einen Stauschlitz die Luft im anderen Kanal in entgegengesetzter Richtung strömen ließe. Jedoch würde dann die Steuerkraft der Magnetnadel überlastet. Die Kurseinstellung erfolgt durch Verdrehen der Kompaßnadel mit dem Drehschieber.
Der Drehschieber besteht aus zwei untereinander liegenden Hohlzylindern, durch welche die Drehschieberwelle in achsialer Richtung führt. An jedem Zylinder befinden sich zwei gegenüberliegende Oeffnungen, deren Breite gleich Vi des Zylinderumfanges ist. An der spitzengelagerten Drehschieberwelle sind die Kompaßnadel, der Anschlag (verhindert Gegenkursfliegen) und zwei Scheiben, die den rechteckigen inneren Querschnitt des Zylinders ausfüllen. Die Oeffnungen beider Zylinder liegen genau untereinander. Bei Kursflug schließen die Ränder der 90° versetzten Scheiben mit den achsialen Kanten der Zylinderöffnungen ab und versperren somit beide Oeffnungen. Dagegen steht bei mehr als 45° Kursabweichung eine Scheibe quer zur Oeffnung (diese bleibt also versperrt), während in der anderen Oeffnung nur die Dickte der Scheibe steht, die Luft also beiderseits der Scheibe vorbeiströmt.
Einige Daten des Modells: Spannweite 2500 mm, Fläche 62 qdm, Gewicht 2100 g, Flügelprofil Gö 535, mittlerer Einstellwinkel 2°, Einstellwinkel an den äußeren Schlitzen 6°.
Inzwischen haben viele Flüge das einwandfreie Arbeiten der Steuerung bewiesen. W. Herold.
National, u. internat. Modell-Wettbewerb Ostende, Flugplatz Steene, 2. 7. Offen für Belgier und Ausländer im Besitz der Sportlizenz. Im internat. Wettbewerb sind Modelle aller Kategorien, Motor- und Segelflugmodelle, soweit sie der Formel der FAI. 1939 entsprechen, zugelassen. Nennungsschluß 15. 6. Preise im internat. Wettbewerb: 1. Großer Preis der Stadt Ostende in Bronze. Kunstgegenstand, Wert 675.— Fr. 2. Pr. 400.— Fr., 3. Pr. 300.— Fr., 4. Pr. 250.— Fr., 5. Pr. 150.— Fr., 6. Pr. 100.— Fr.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Luftmacht Deutschland. Luftwaffe — Industrie — Luftfahrt. Von Heinz Bongartz. Mit einem Geleitwort d. Reichsmin. d. Luftfahrt u. Oberbefehlshabers d. Luftwaffe Generalfeldmarschall Hermann Göring. 180 Abb. Essener Verlagsanstalt G. m. b. H., Essen. Preis RM 9.60.
In diesem Buch werden zum erstenmal Einzelheiten über die geheimen Anfänge der deutschen Luftmacht sowie über den gewaltigen Aufstieg seit 1933 bis heute der Oeffentlichkeit vermittelt. Die großdeutsche Luftwaffe ist Wirklichkeit geworden. „Ohne den Nationalsozialismus", sagte Generaloberst Milch, „gäbe es unsere stolze Luftwaffe nicht. Die Wichtigkeit dieser unserer machtvollsten Waffe hat der Führer als einer der ersten erkannt. Schon lange vor 1933 hat er in Gesprächen mit mir seine Gedanken über die damals noch nicht vorhandene deutsche Luftmacht dargelegt. Ihre Schaffung übertrug er seinem stärksten Manne, unserem Generalfeldmarschall Göring. Die deutsche Luftwaffe ist in ihrem Werden und in ihrem Aufstieg von nationalsozialistischem Wollen und nationalsozialistischer Leistung getragen worden. Und sie kann deshalb nur eines sein: nationalsozialistisch, eine dem Nationalsozialismus verschworene Gemeinschaft". Am 2. 2. 33 hatten sich die großen Flieger des Krieges zusammen-
gefunden. Hierbei wurde die zufällig stattfindende Festsitzung des Aero-Clubs zu einem denkwürdigen Ereignis für den Wiederaufstieg der deutschen Luftfahrt; denn noch unter dem Eindruck der allgemeinen Freude über den Anbruch einer neuen fliegerischen Blüte für Deutschland verpflichtete Hermann Göring in Milch und Udet, in Loerzer und Christiansen seine ersten Mitarbeiter. In dieser Stunde traten die alten Kameraden zusammen, scharten sich um den letzten Kommandeur des Richthofengeschwaders, den Sieger in 22 Luftkämpfen und Träger des Ordens pour le merite, der im November 1918 im Stiftskeller zu Aschaffenburg seinen auseinandergehenden Kameraden zugerufen hatte: „Stolz auf das, was wir gemeinsam geleistet haben, wollen wir weiter zusammenstehen. Ich werde nicht ruhen und rasten, Kameraden, bis unser Geschwader und die deutsche Luftfahrt wieder auferstanden ist." Ueber die Entwicklung der Luftwaffe und Flugzeuge, die gewaltigen Anstrengungen, vermittelt das Buch viele bisher unbekannte Vorgänge. Das Buch ist eine der besten Erscheinungen über die Entwicklung der Luftmacht Großdeutschlands.
„Albsperber" Segelflugmodell. Bauplan und Baubeschr. von Karl Schmid. (Schreibers Flugmodell-Baupläne Nr. 5.) Verlag J. F. Schreiber, Eßlingen a. N. Preis RM 1.50.
Rumpfmodell, Flügel mit Knick nach oben, 2200 mm Spannweite, 1480 mm Länge, Gewicht mit Papierbespannung 1200 g, mit Seidenbatist 1500 g. Wettbewerbsmodell, ausführliche Baubeschreibung.
Flugmodell JS-7 „Ostland" mit Verbrennungsmotor von Joachim Schmidt, bearb. von Curt Möbius. (Schreibers Flugmodell-Baupläne Nr. 7.) Verlag J. F. Schreiber, Eßlingen a. N. Preis RM 1.50.
Rumpfmodell mit Verbrennungsmotor, Spannweite 2066 mm, Länge 1275 mm. Wettbewerbsmodell.
Das große Radio-Bastelbuch und Rundfunk-Praktikum. Herausg. von Otto Kappelmayer u. Jacob Schneider. 320 S. m. 222 Abb., 40 Taf. u. Tab. (Deutsche Radio-Bücherei, Bd. 6.) 16. Auflage. Verl. Deutsch-Literarisches Institut J. Schneider, Berlin-Tempelhof. Preis kart. RM 5.50, Leinen RM 6.80.
Die vorliegende Neuauflage ist die 16. Die Radiotechnik hat sich im letzten Jahrzehnt in außerordentlich schnellem Tempo entwickelt. Im heutigen Zeitalter muß jeder mit dem Wichtigsten vertraut sein. Alle Fragen der Ausbreitungsbedingung der Rundfunkwellen, Verbesserung alter Empfänger und in der Neuauflage besonders der Kurzwellenempfang, sind ausführlich behandelt. Wer sich in diese Materie vertiefen will, muß basteln, und dazu ist dieses Buch ein ausgezeichneter Ratgeber.
So sah ich unsere Südsee. Von Senta Dinglreiter. 280 S., 42 Abb., 1 Karte, v. Hase öl Koehler Verlag, Leipzig C 1. Preis RM 2.85.
Die bekannte Verfasserin ist von einer Studienfahrt aus der Südseewelt zurückgekehrt. Es ist an der Zeit, daß wir über das Mandatsgebiet Neuguinea mit den vielen Inseln wieder etwas hören und diesem näher gerückt werden. Man vernimmt die Sagen und Urgründe der wilden Sitten der Kopfjäger und bekommt einen Ueberblick über den heutigen Stand der Entwicklung. Ausgezeichnete Photographien vermitteln ein lebenswahres Bild.

Wir suchen einen
Segeliliiglehrer
Kl.25od. Kl.35, passend zuHirth-Motor HM 60 R in gutem flugfähigem Zustand, zugelassen, baldmöglichst zu kaufen gesucht. Angebote unter Nr. 4050 an die Exp. des „Flugsport", Frankfurt a. Main, Hindenburgpl. 8, erbet.
der gleichzeitig die
Leitung einer Werkstatt
übernehmen kann (evtl. Bauprüfer). Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Gehaltsansprüchen erbeten an
Eingebunden ist der „Flugsport" ein Nachschlagewerk von Wert!
Reparaturwerk Erfurt G. m. b. H.9 Erfurt,
Mittelhäuserstraße 76/77
Heft 14/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro Vi Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalten und Verlas Uer Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet.
Nr. 14
5. Juli 1939
XXXI, Jahrgang

INTERNATIONAL .
AERONAUTIQUI
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 19. Juli 1939
II. Internationaler Salon Brüssel 1939*). Vorschau.
8.-23. Juli 1939. Die praktische Betätigung der Belgier im Flugwesen führt bis auf das Jahr 1909 zurück, wo bereits eine kleine Ausstellung für Luftfahrt gezeigt wurde. Mit Beginn dieses II. Internationalen Salons — der erste fand 1937 statt — sind über 30 Jahre vergangen. Die Begeisterung für die Fliegerei in Belgien ist die gleiche geblieben und die Entwicklung der Luftfahrt in Belgien hat auf allen Gebieten Schritt gehalten.
Die Ausstellung ist wie 1937 im Palais du Centenaire untergebracht. Am 9. 7., am Eröffnungstage, findet gleichzeitig anläßlich des 25jährigen Bestehens des belg. Militärflugwesens das internat. Flugmeeting auf dem Flugplatz Evere bei Brüssel statt. Während im ersten Salon, 1937, nur 22 Flugzeuge ausgestellt waren, werden diesmal 50 Flugzeuge, darunter die neuesten Erzeugnisse, zu sehen sein. Offiziell sind folgende Länder vertreten außer Belgien: Deutschland, England, Frankreich, das Protektorat Böhmen und Mähren und Holland.
Neben den vielen ausländischen Ausstellern werden die Besucher des II. Internationalen Salons Brüssel auch eine würdige belgische Abteilung mit der Aeronautique Militaire an der Spitze vorfinden. Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Königs. Qeneral-sekretariat: 30, Rue Montagne-aux-Herbes Potageres, Brüssel.
Deutschland*
Die deutsche Luftfahrt-Industrie wird auf der Brüsseler Ausstellung durch den Reichs verband der Deutschen Luftfahrt-Industrie ver-treten sein, und zwar werden nicht nur Modelle ausgestellt, sondern
*) Vgl. die Ausstellungsberichte über den I. internationalen Salon Brüssel „Flugsport" 1937 Nr. 11 und 12.
Diese Nummer enthält Patentsammlung Nr. 11, Band VT11.
die Besucher werden sechs Flugzeuge in natürlicher Größe studieren können. Es stellen aus von den
Flugzeugfirmen: Arado — Originalflugzeug Ar 79, Dornier — verschiedene Flugzeugmodelle, Focke-Achgelis — Modell „Focke 61",
Focke-Wulf — Präzisionsmodell des Großverkehrsflugzeugs Fw 200 „Condor",
Gothaer Waggonfabrik — Originalflugzeug Go 150, Henschel — Modell Hs 126,
Junkers — Originalflugzeug Ju 87, Schnittmodell Jumo 211-Motor, Klemm — Originalflugzeug Kl 105, Modell Kl 35, Messerschmitt — Originalflugzeug „Taifun",
Siebel — Originalflugzeug Si 202 „Hummel", Modelle Siebel Fh 104 und Si 202.
Flugmotorenfirmen:
Argus — 2 Motoren, 1 Verstelluftschraube, 1 Prüfstand, verschiedene Zubehörteile,
BMW und Bramo — Bramo „Fafnir" 323 A, Sh 14 A 4, BMW 132 K.
Daimler-Benz —- Flugmotor „DB 601",
Hirth — 1 Flugmotor HM 508 D, Motoratrappe HM 512.
Junkers — Schnittmodell Jumo 211-Motor.
Segelflugzeugfirmen:
Sportflugzeugbau Schempp-Hirth, Göppingen/Württ. — Modell „Minimoa",
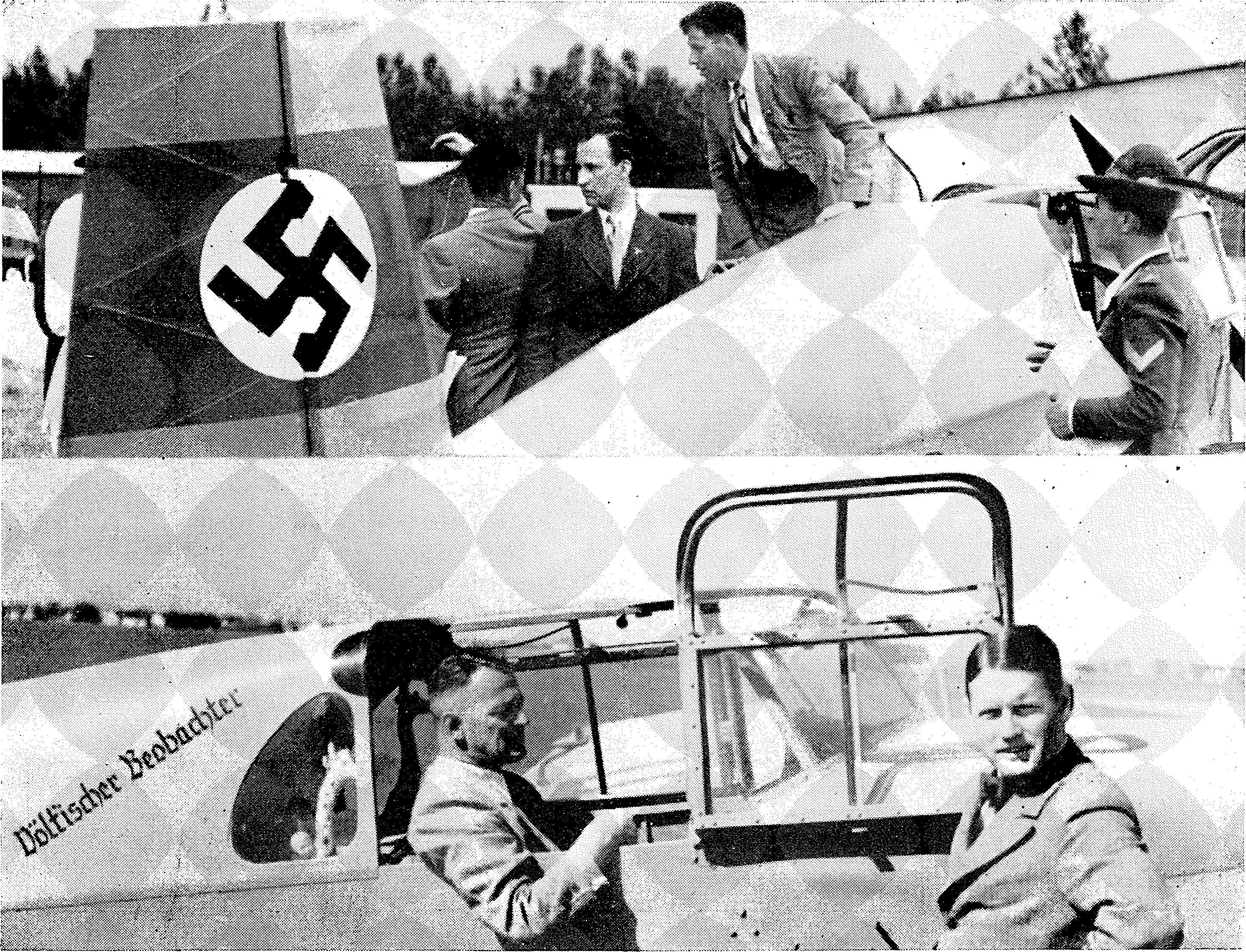
Sieger beim Intern. Sternflug für Journalisten, Rom, ca. 8500 km in 10 Tg. mit Si 202 „Hummel", 50 PS Zündapp. Oben: Links Dr. Keller, Berichterst., rechts Wellershausen, Flugzeugf., erhielten den Pokal des Duce. Unten: Rechts Glardon, Flugzeugf. d. Siebel-Flugzeugwerke, links Dr. Kredel, Berichterst. „Völkischer Beobachter", gleichfalls auf Si 202 „Hummel". Werkbilder
Segelflugzeugbau Edmund Schneider, Grunau/Riesengeb. — Modell
„Grünau Baby II A", Schwarzwald-Flugzeugbau Wilh. Jehle, Donaueschingen — Modell
„Mü 13",
Karl Schweyer A. G., Abt. Flugzeugbau, Ludwigshafen — Modell „Weihe". Von der
Luftfahrt-Ausrüstungs-Industrie,
deren Erzeugung einen großen Umfang angenommen hat, können die Firmen nur einen geringen Teil ihrer Erzeugnisse ausstellen. Es werden vertreten sein:
Askania — verschiedene Flugzeugbordgeräte, Kinotheodolite, Kurssteuerungsanlage Lstz 14,
Bosch — Lichtmaschinen, Magnetzünder, Kerzen,
Deuta — Fern-Tachometer, Blindlande-Instrumente, Anemometer, Kontroll-Instrumente, Handtachometer, biegsame Antriebwellen,
Dürener Metallwerke — Halbzeuge und Fertigteile aus Schwer- und Leichtmetall,
Elektron-Co. — Fahrzeugräder, Fahrzeugbeine., kompl. Fahrwerke, Spornaggregate, Flugmotorenkolben, kompl. hydraulische Einziehanlagen,
Fuess — Luftfahrtinstrumente, meteorologische Geräte, optische
Apparate für die Werkstoffprüfung. Goetzewerk — Kolbenringe und Dichtungen,
v. Kehler & Stelling — Fallschirm 30 I S 24 B, 1 Rettungsschlauchboot
RS 2,2 m, 1 Schlauchboot „Jäger", Kronprinz — Fahrgestellhälfte für Ju 87, Ringfederbeine für Sporn
Ju 52, Spornräder mit und ohne Bereifung, Flugzeugrohre, Lorenz — 2 Bordstationen, 1 Bodenstation, „Oigee" — Zielgeräte, Reflexvisiere,
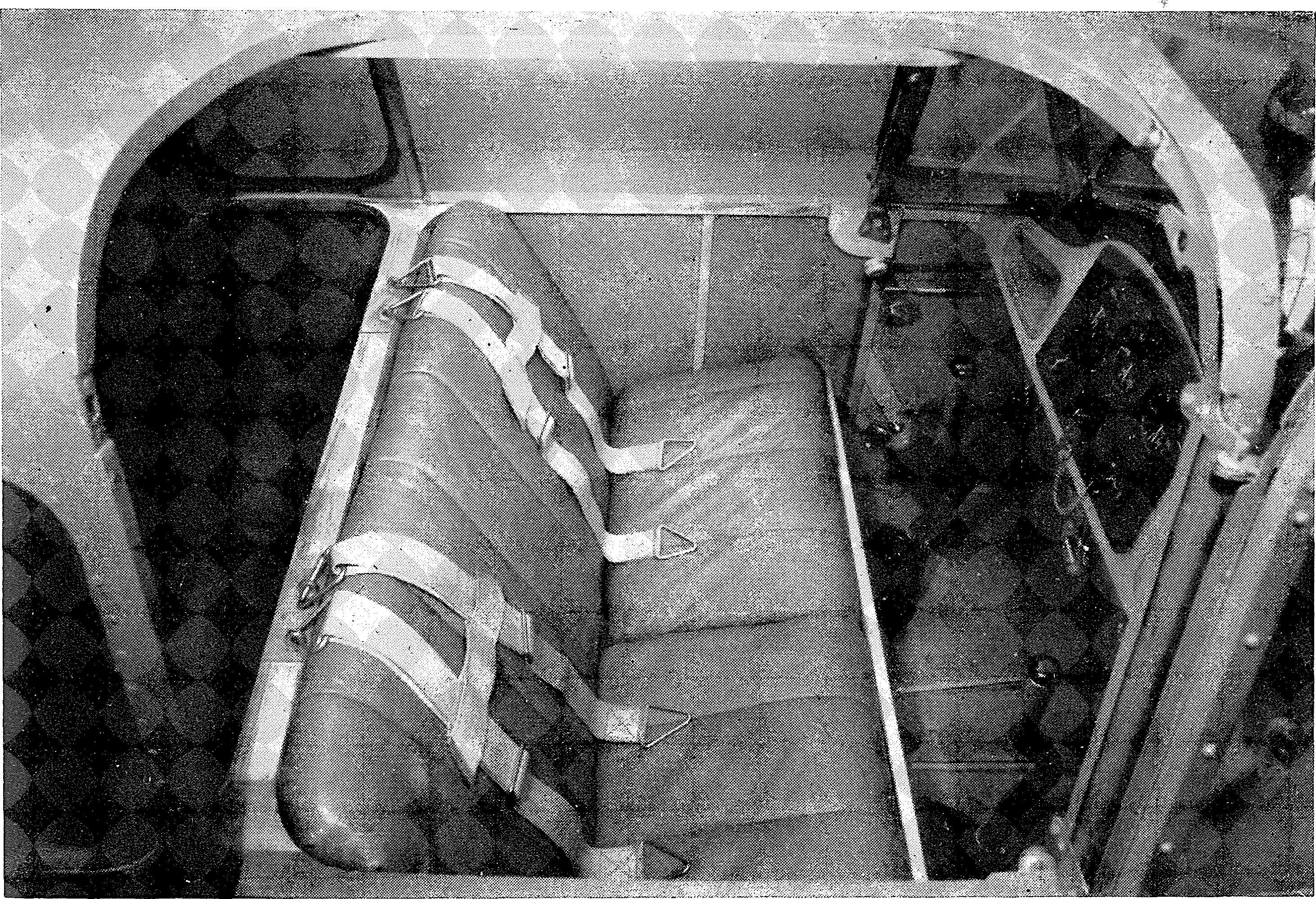
Si 202 „Hummel". Blick in die geräumige Kabine. Man beachte die einfache Bauweise. Doppelsteuerung, links unten Feuerlöscher. Ausführt. Typenbeschreibung der Si 202 „Hummel" vgl. „Flugsport" 1939 Nr. 4, S. 91/93. Werkbild
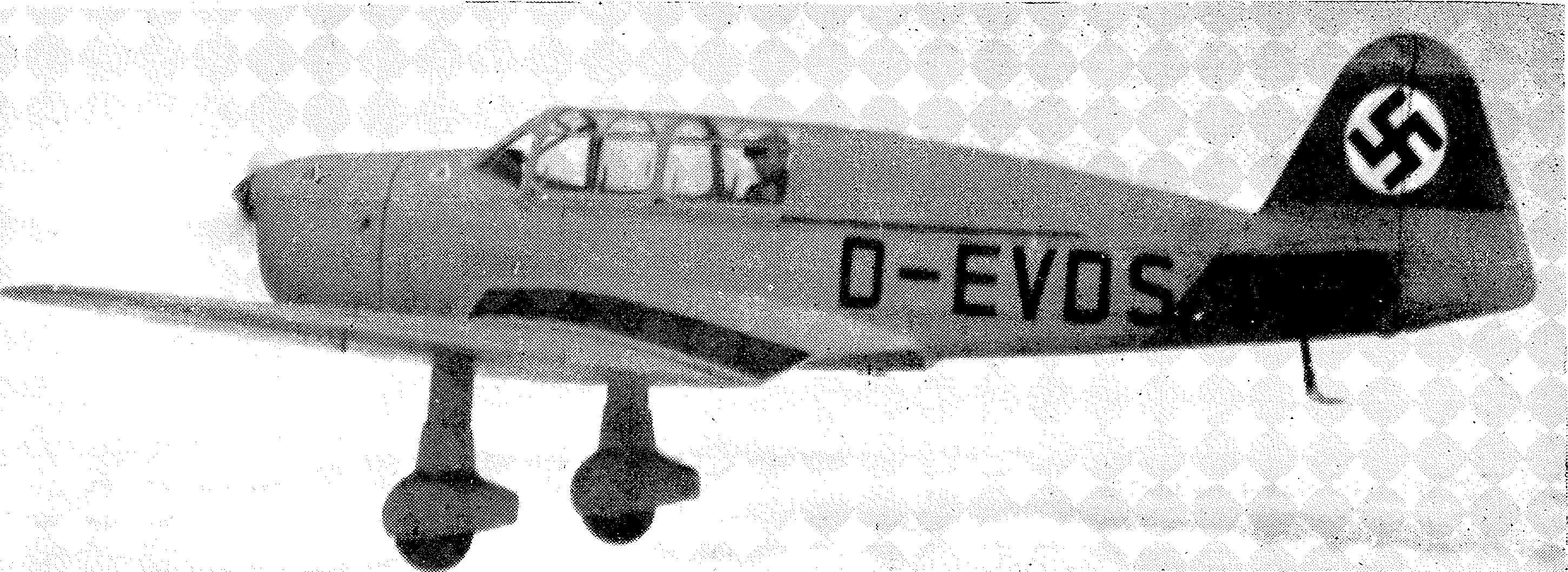
Klemm Kl 35 b. Ausführung mit Schiebekabine. Werkbild
Propellerwerk Schwarz — Einzelflügel und mehrflügelige Luftschrauben,
Telefunken — 5 Gestelle mit montierten Flugzeuggeräten und Teilanlagen,
Vereinigte Deutsche Metallwerke — Verstelluftschrauben, einbaufertige Flügel, Federbeine, Spornrad, Spornfederbein, Luftschraubenhaube u. a.,
Vereinigte LeichtmetalKverke — Tiefziehteile, Bleche, Profile, Spezial-bleche in Blank- und Mattausführung, verschiedenste Preßteile, Bearbeitungsmuster von Drehwerkzeugen, Halbzeuge aus Pantal, Luxal u. dgl.
England
stellt aus: 1 Airspeed Oxford, 1 Moth Minor, 1 G. A. C. Cygnet, 1 Miles Magister und 1 Reid and Sigrist Schulflugzeug Zweimotor. Motoren: Alvis Leonides and Pelides, CirrusMajor, Siddeley Cheetah, Bristol Pegasus XVIII, Taurus, D. H. Gipsy Twelve mit Verstell-schrauben, Napier Dagger und Rolls Royce Merlin. Zubehör stellen aus: Aedes and Pollock Ltd., Automotive Products Ltd., Gallay Ltd., High Duty Alloys Ltd., Jablo Propellers Ltd., Rotax Ltd., Shackleton Ltd., Short and Mason Ltd., Smiths Aicraft Instruments, Vokes Ltd.
Frankreich.
Flugzeuge: 6 nationale Gesellschaften und Societe Louis Breguet.
Motoren: Societe Nationale de Construction de Moteurs, Hispano Suiza, Gnome-Rhone, stellen die neuesten Motoren aus.
Zubehörteile: 36 Aussteller (Fabricants d'Accessoires), darunter Aviorex, Aerazur etc., Paulstra (elastische Motoraufhängung) und die Societe d'Etudes Industrielles.
Auf einem großen Sonderstand die Societe Duralumin.
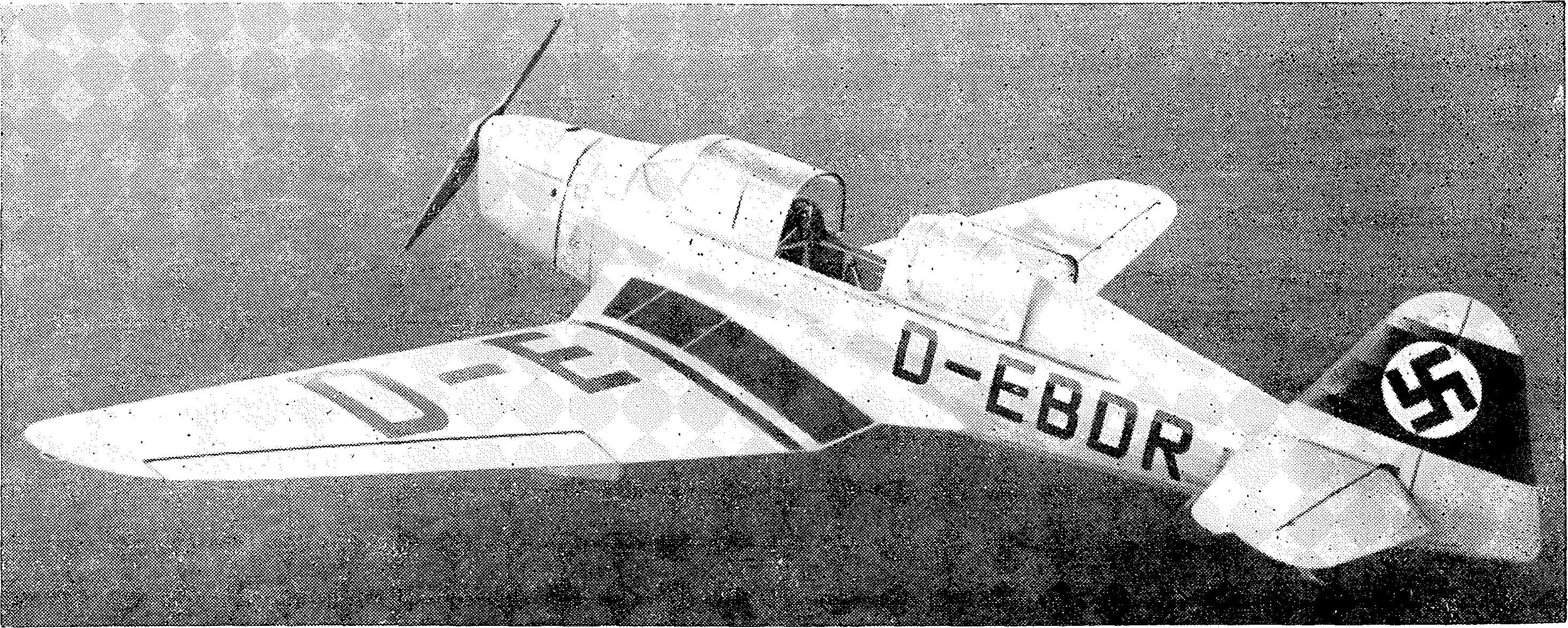
Klemm Kl 35 b mit Schiebehaube. Werkbild
Klemm Kl 105, Kabinenzweisitzer, 50 PS Z 9-92.
Dieses Baumuster ähnelt in der Konstruktion dem Muster Kl 107. Trotz des verhältnismäßig schwachen Triebwerkes 50 PS Zündapp ergaben sich gute Start- und Steigleistungen bei einer Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h.
Rumpf, Ausführung als Kabinenflugzeug, mit zwei nebeneinanderliegenden Sitzen und abnehmbaren Flügeln, in Klemm-Teilschalenkon-struktion. Ausreichend bemessener Gepäckraum, Doppelsteuerung. Lastigkeitsänderung durch ein während des Fluges verstellbares Hilfsruder. Schwingachsenfahrwerk mit gedämpfter Federung. Niederdruckreifen, Bremsen.
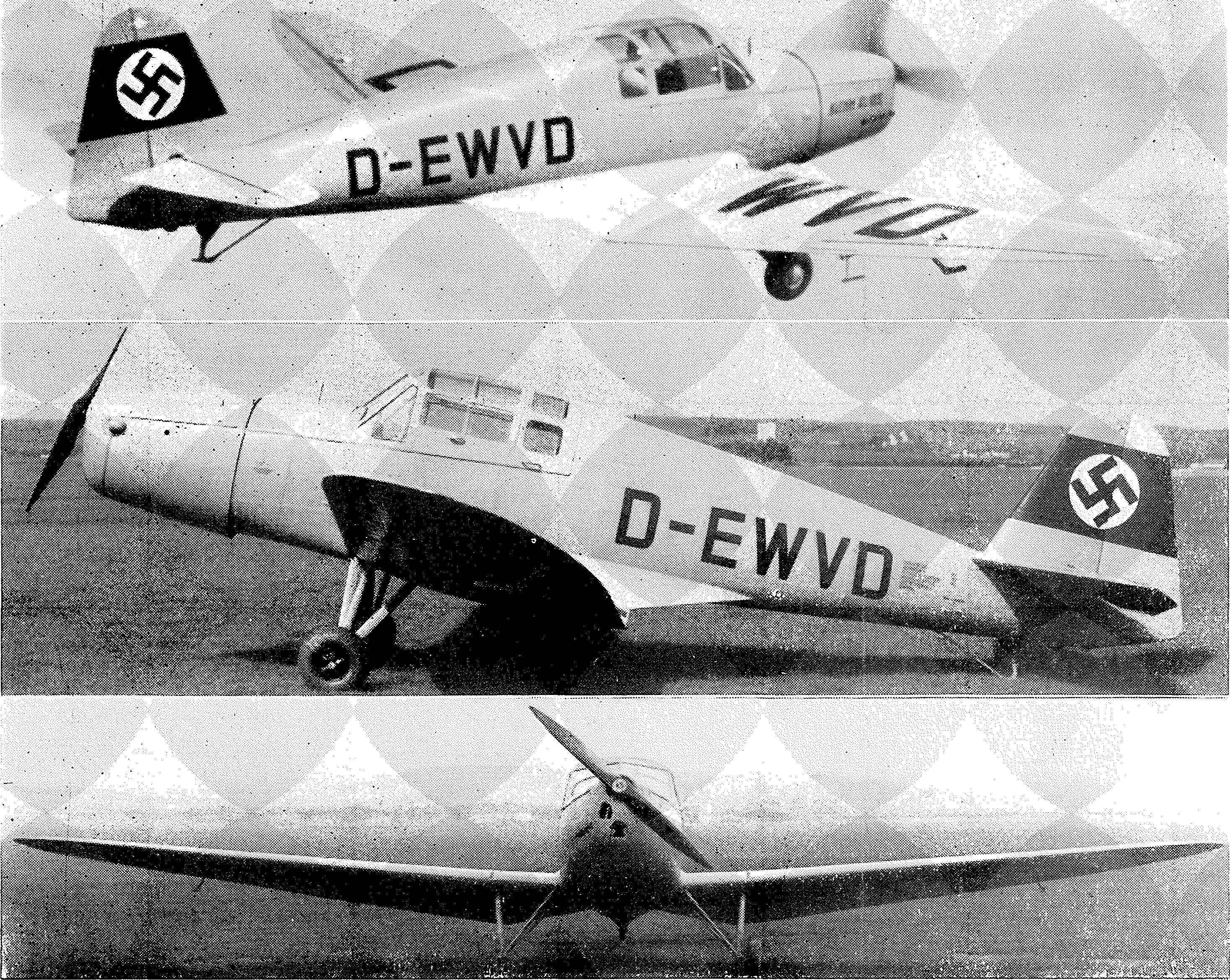
Klemm Kl 105 Kabinenzweisitzer 50 PS Z 9—92. Werkbilder
Spannweite 10,92 m, Länge 7,35 m, Höhe 2 m, Tragfläche mit Querruder 15 m2, Flügelstreckung 8, Inhalt d. Kraftstoffbeh. 55 1, Inhalt d. Schmierstoffbeh. 4 1.
Rüstgewicht 340 kg, Zuladung 220 kg, Fluggewicht 560 kg, Flächenbelastung 39 kg/m2, Leistungsbelastung 11 kg/m2, Flächenleistung 3,5 PS/m2. Höchstgeschw. 150 km/h, Reisegeschw. 135 km/h, Lande-geschw. 65 km/h, Flugdauer 3,6 h, Flugweite 500 km, Kraftstoffverbrauch 11 1/100 km, Steigzeit auf 1000 m 11 min, Steiggeschw. in Bodennähe 1,7 m/sec, Dienstgipfelhöhe 3100 m.
Koolhoven F. K. 56.
Das von N. V. Koolhoven Vliegtuigen, Rotterdam, ausgestellte Flugzeug F. K. 56 ist ein Militärtrainingsflugzeug für Jagdflieger mit einziehbarem Fahrwerk. Diesen Typ haben wir bereits im „Flugsport" 1938, S. 243, und zwar mit festem und hochziehbarem Fahrwerk, an Hand einer Uebersichtsskizze beschrieben,
Beanspruchung: Fall A 8,5 (Druckpunkt so weit wie möglich nach vorn), Fall B 6 (max. Horizontalgeschw. 306 km/h), Fall C 2 (senkrechter Sturzflug, max. Geschwindigkeit 504 km/h).
Rumpf Stahlrohr: Vorderteil mit Aluminium, hinten mit Leinwand bedeckt. Kabine Schiebehaube, vgl. Abb. Führersitz mit Platz für Fallschirm, verstellbar. Dahinter Beobachterraum. Als Trainingsflugzeug ist F. K. 56 mit Doppelsteuerung versehen, in diesem Falle ohne Bewaffnung ; für Schießübungen mit festem und beweglichem MG. Für Bombenabwurftraining Bombengewicht 4X20 kg.
Flügel zwei Kastenholme mit Sperrholzrippen, alles mit Sperrholz beplankt. Flügelenden etwas aufgebogen.
Fahrwerk nach hinten in besondere Verkleidung im Knick einziehbar. Betriebsstoffbehälter im Vorderteil des Rumpfes 270 1. Oel-behälter 36 1 hinter dem Motor vor dem Brandspant. Der Behälter ist mit einer besonderen Heizungskammer, welche durch Klappe abgeschlossen werden kann, versehen. Die Heizungskammer wird beim Warmlaufen des Motors geöffnet, so daß immer die gleiche Menge Oel durch den Motor strömt. Nach Erreichen der normalen Betriebs-öltemperatur wird die Kammer geschlossen, so daß sich das warme Oel des Motors mit dem Oel im Behälter mischt.
Motor Armstrong Siddeley „Cheetah" X, Untersetzung 1 : 1, Maximalleistung in 2280 m Höhe 350 PS bei einer Drehzahl von 2425 U/min, Brennstoffverbrauch bei Reisegeschw. 61,5 kg/h. In der Luft verstellbare Metallschraube.
Spannweite 11,5 m, Länge 7,85 m, Höhe 2,3 m, Flächeninhalt 20 m2, Spurweite 3,5 m, Flächenbelastung 86 kg/m2, Leistungsbelastung 4,85 kg/PS, Flächenleistung 17,5 PS/m2, Rüstgewicht 1150 kg, fest eingeb. Zulad. 50 kg, Besatzung m. 2 Fallschirmen 180 kg, Brennstoff 185 kg, Oel 25 kg, Bewaffnung 110 kg, Fluggewicht 1700 kg.
Höchtgeschw. in 2280 m bei 2425 U/min 305 km/h, Reisegeschw. in 2280 m 275 km/h, Kleinstgescbw. a. Boden 110 km/h, Landegeschw. 105 km/h, Anlauflänge bei 2,5 m/sec Windgeschw. 170 m, Auslauflänge bei 2,5 m/sec Windgeschw. 185 m.
Koolhoven F. K. 56. Oben mit einziehbarem, unten mit festem Fahrwerk. Werkbilder
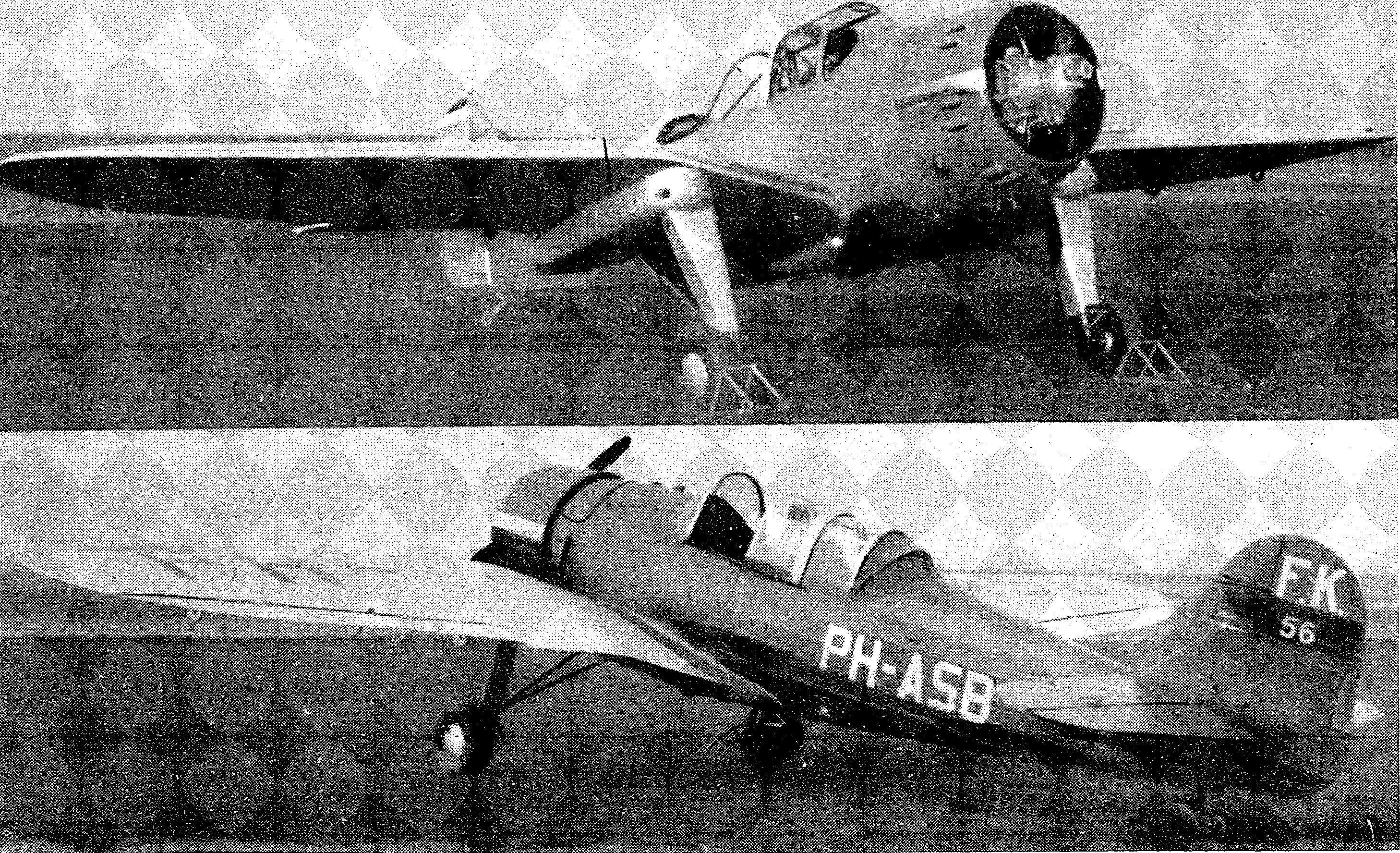
Steiggeschwindigkeit am Boden 5,5 m/sec, in 2000 m 5,9 m/sec, in 4000 m 4 m/sec, in 6000 m 2 m/sec. Steigzeit auf 1000 m 3 min, 2000 m 5,9 min, 3000 m 9 min, 4000 m 12,7 min, 6000 m 24,1 min, Gipfelhöhe praktisch 7600 m, theoret. 8100 m, Aktionsradius b. Reisegeschw. in 2280 m 850 km.
Messerschmitt-Verstell-Propeller V, P. 7.
Der zweiflügelige Messerschmitt-Verstell-Propeller V. P. 7 ist mit zwei Schwarz-Leichtholzmantel-Luftschraubenblättern Größe 1 und genormter Schwarz-Flügellagerung ausgerüstet. Ungeteilte Stahlnabe, die durch Hirth-Verzahnung und Differentialmutter mit dem Nabenhals verbunden und mittels 6 normalen Flanschbolzen am Argus-Motor angeschlossen ist.
Bauart sehr einfach. Durch eine kardanisch aufgehängte, ring-
Hirth HM 508 D, Achtzylinder V, 225/280 PS. 105 mm Bohrung,
115 mm Hub, 0,996 1 Hubraum, 7,96 1 Gesamthubraum. Verdichtungszahl 6:1. Vgl. Typenbeschr. m. Schnittzeichnung „Flugsport" 1938, S. 567 cf.
Werkbild
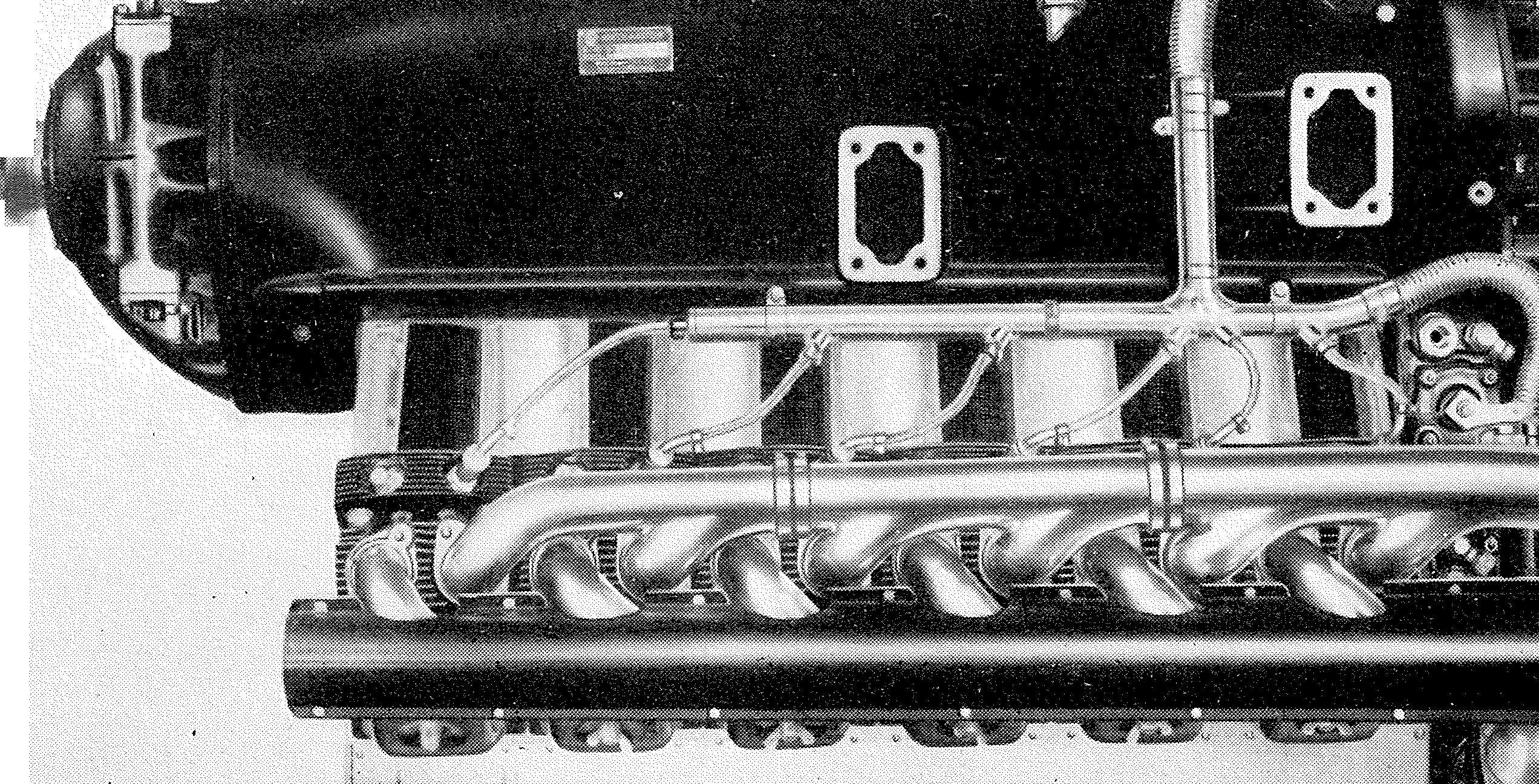
llllliilHiBtä
Hirth HM 512, Zwölfzylinder, 400/360 PS. Typenbeschr. „Flugsport" 1938, S. 642.
Werkbild
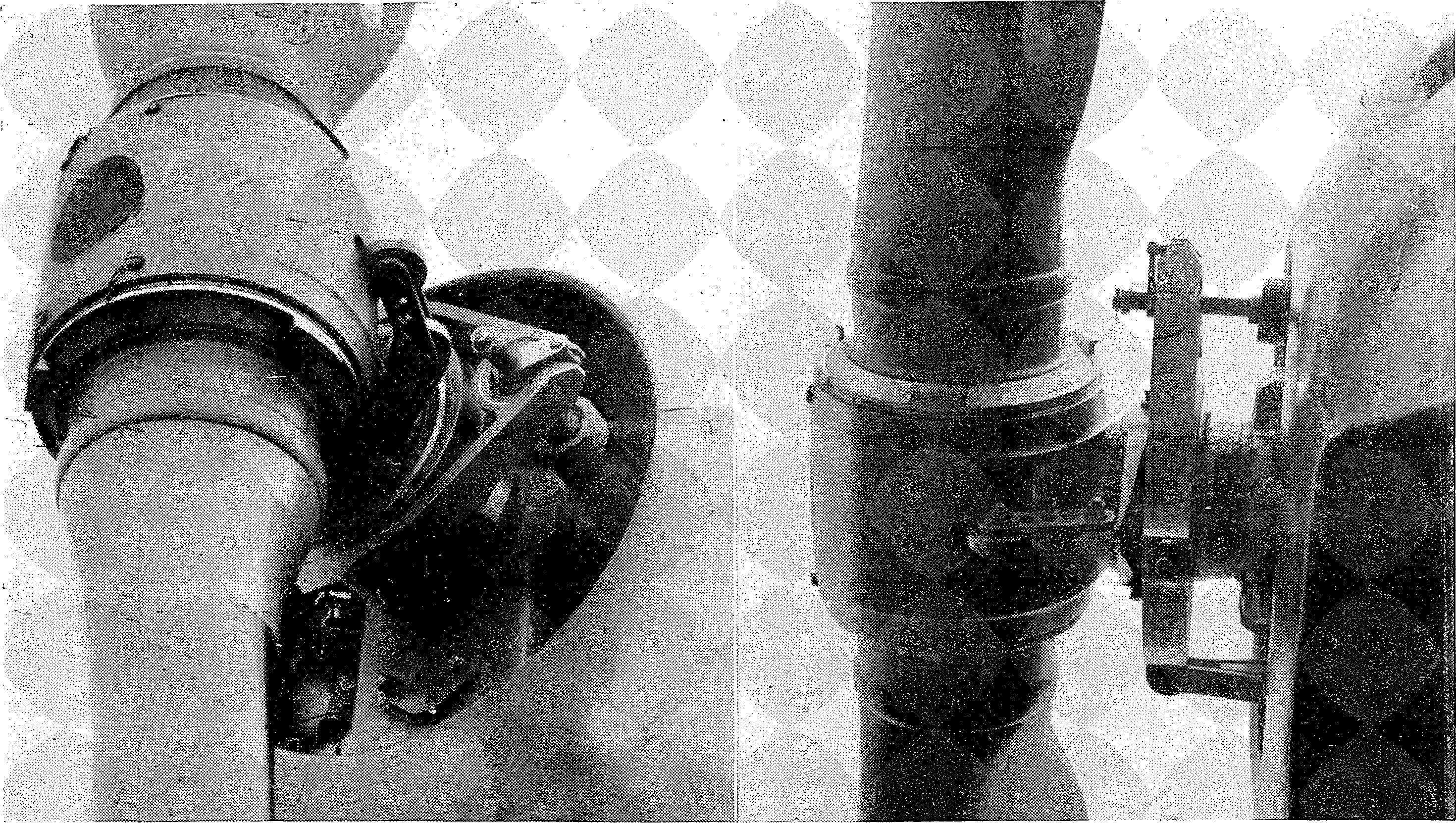
Abb. 1 u. 2. Messerschmitt Versteilpropeller.
Werkbilder
förmige Verstelltraverse wird, in Verbindung mit einem selbsthem-menden Spindelantrieb, ein Radiax-Kugellager auf dem Nabenhals in der Flugrichtung oder umgekehrt verschoben.
Durch diese Längsbewegung werden die Anstellwinkel der beiden Luftschraubenblätter in einfachster Weise über je einen Lenker verändert (Abb. 1).
Die Verstelltraverse ist durch zwei Lagerböcke an der Motorvorderseite gelagert, ohne daß jedoch das normale Motorgehäuse irgendwie geändert zu werden braucht (Abb. 2).
Die Verstellspindel an der Nabe wird über eine, an der linken Motorseite entlanggeführte Wellenleitung a, die mit Wernergelenken ausgestattet ist, durch eine Handkurbel am Instrumententisch betätigt (Abb. 3 u. 4).
In Ruhestellung wird die Handkurbel automatisch im oberen Teil des Kurbelkreises festgehalten und dadurch eine Behinderung des Steuerknüppels vermieden.
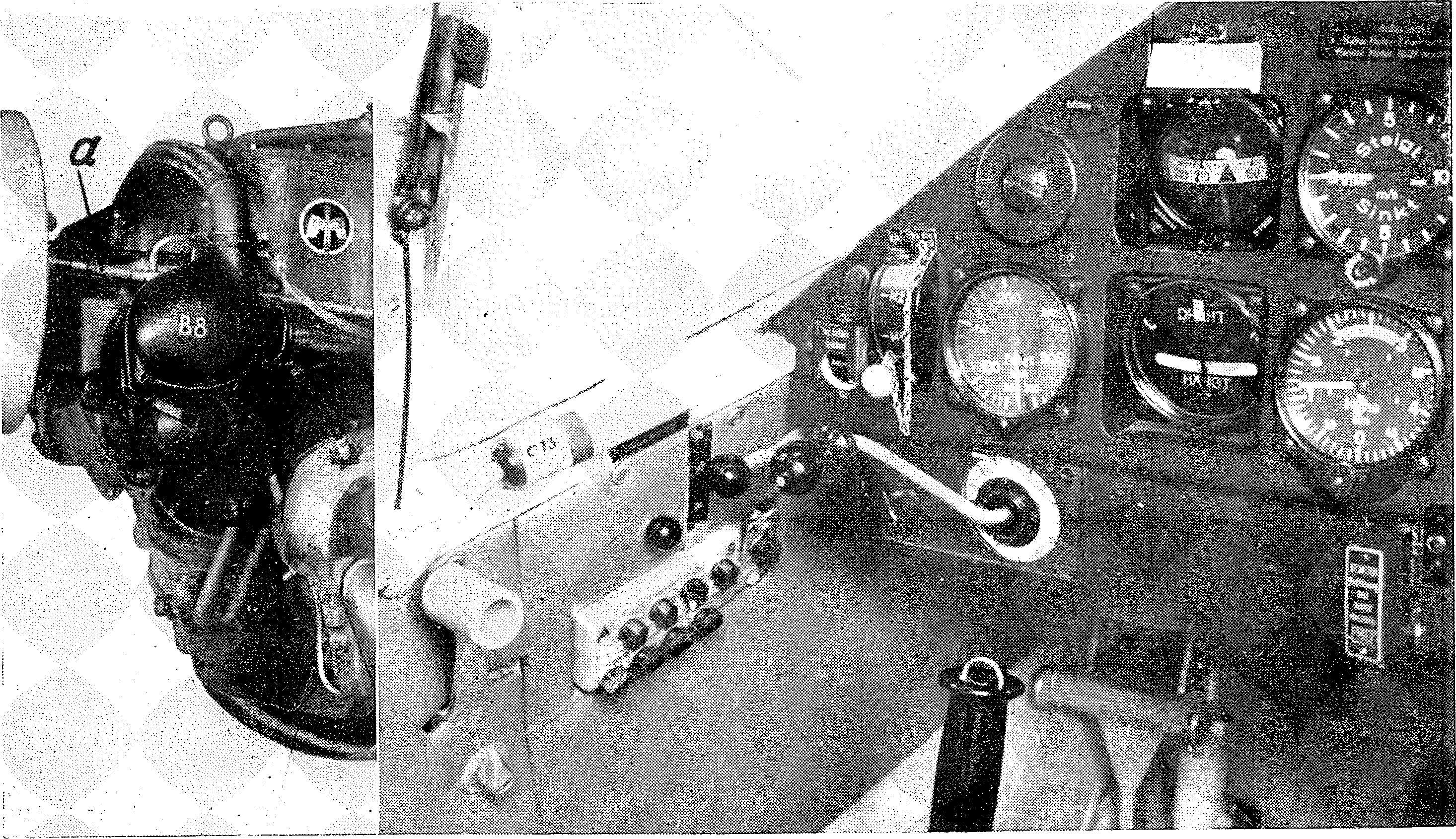
Abb. 3 u. 4. Messerschmitt Verstellpropeller V. P. 7. Links erkennt man die Wellenleitung a, rechts im Führersitz die Handkurbel. Werkbilder
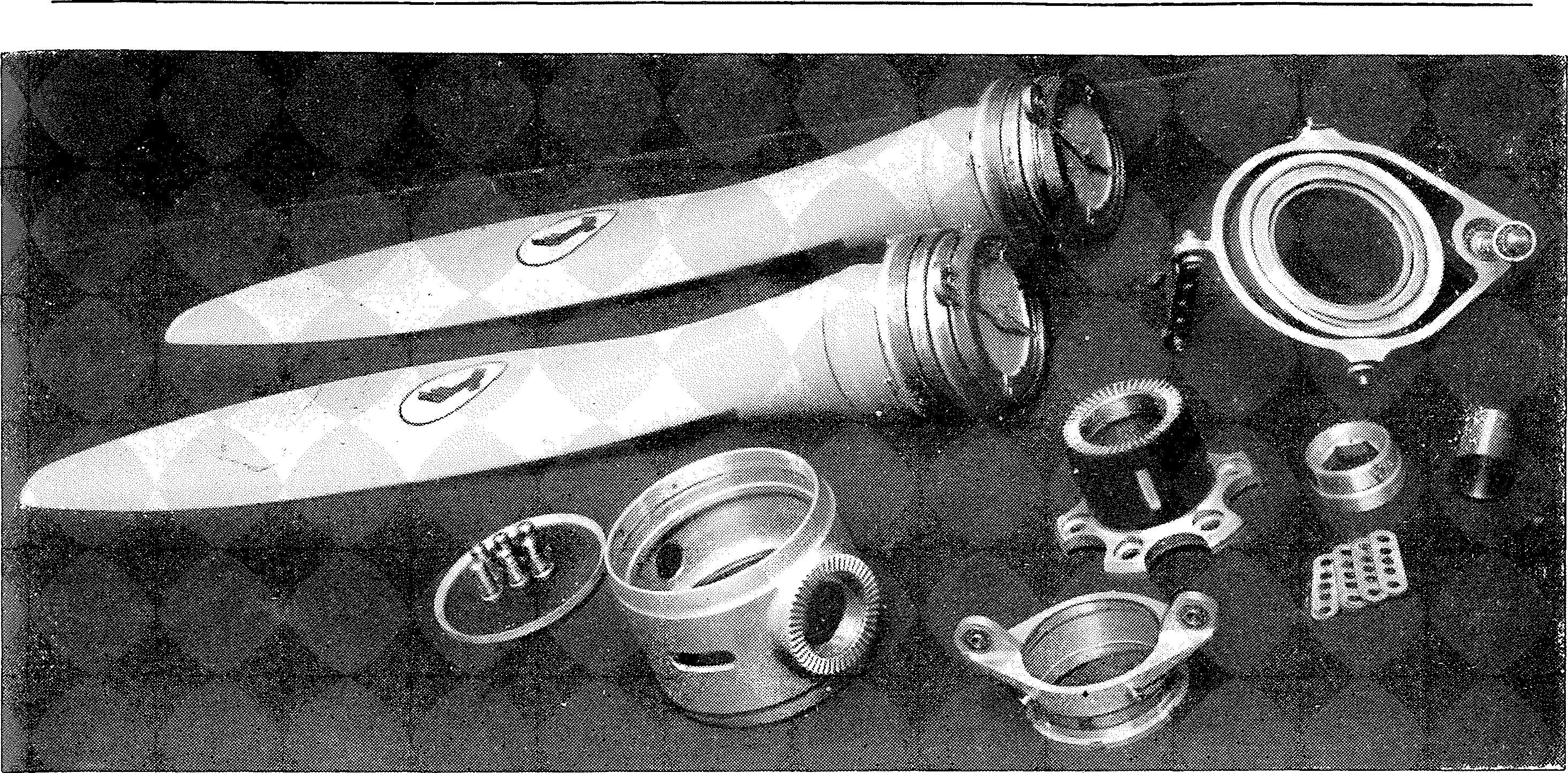
Abb. 5. Austauschbare Einzelteile des Messerschmitt Verstellpropellers.
Werkbild
Mit der Kurbel ist eine Anzeigevorrichtung verbunden, auf der die Stellungen für „Start" und „Reise" besonders gekennzeichnet sind.
Abb. 5 zeigt lehrenhaltige und ohne jede Nacharbeit austauschbare Teile des Messerschmitt-Verstellpropellers V. P. 7.
Innerhalb weniger Arbeitsstunden kann jede normale Luftschraube durch den Messerschmitt-Verstellpropeller V. P. 7 ersetzt werden, der mit einer Haube ausgerüstet ist, die mit wenigen Handgriffen zerlegt werden kann (Abb. 6 u. 7).
Ab- und Anbau des Me V. P. 7 ist in wenigen Stunden durchführbar. Geringe Wartung, nach 100 Flugstunden Schmierung der wichtigsten Stellen, wie Gleitbüchse, Radiaxlager u. a. Bedienung außerordentlich einfach.
Das Verstellen des Me Verst.-Prop. V. P. 7 auf größte Steigung geschieht durch Drehen der Handkurbel nach rechts; das Verstellen auf kleinste Steigung durch Drehen der Handkurbel nach links.
Beim Abbremsen des Motors muß der Verstellpropeller so eingestellt werden, daß die Anzeigeuhr „Start" anzeigt. In dieser Einstellung der Luftschraube erfolgt der normale Start.
Soll zum Reiseflug übergegangen werden, so ist durch Drehen der Handkurbel die Steigung solange zu verstellen, bis die Anzeigeuhr die Stellung „Reise" anzeigt.
Die beste Steigleistung wird bei Stellung „Start" erreicht.
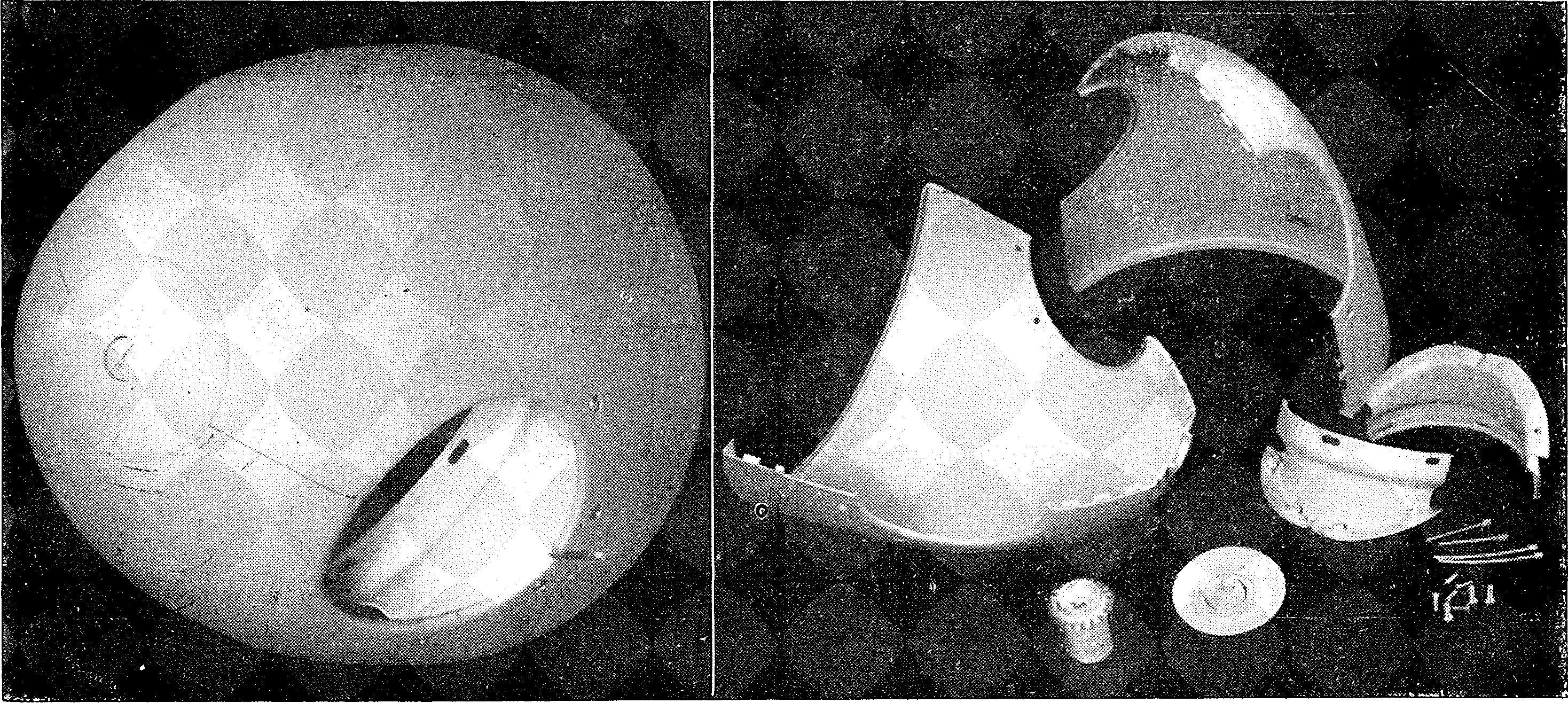
Abb. 6 u. 7. Haube und ihre Einzelteile des Messerschmitt Verstellpropellers.
Werkbilder
Durchmesser 2,35 m, Standdrehzahl 1750, Verstellbereich 10° + 2° Reserve, Gesamtgewicht 37,45 kg, d. i. ca. 20 kg mehr, als bei einer normalen Festschraube.
Zubehör,
Der Argus-Parkschalter
dient dazu, die Bremsen beim Parken des Flugzeugs auf längere Zeit festzustellen, und zwar eignet sich dieser sowohl für pneumatisch als auch für hydraulisch betätigte Bremsen. Wird der Hebel des Parkschalters nach Betätigen der Bremsen auf „geparkt" gelegt, so bleiben diese beliebig lange in angezogenem Zustande. Gewicht des Gerätes 0,28 kg. Vergl. nebenstehende Abb.
HebelausscMag s0o
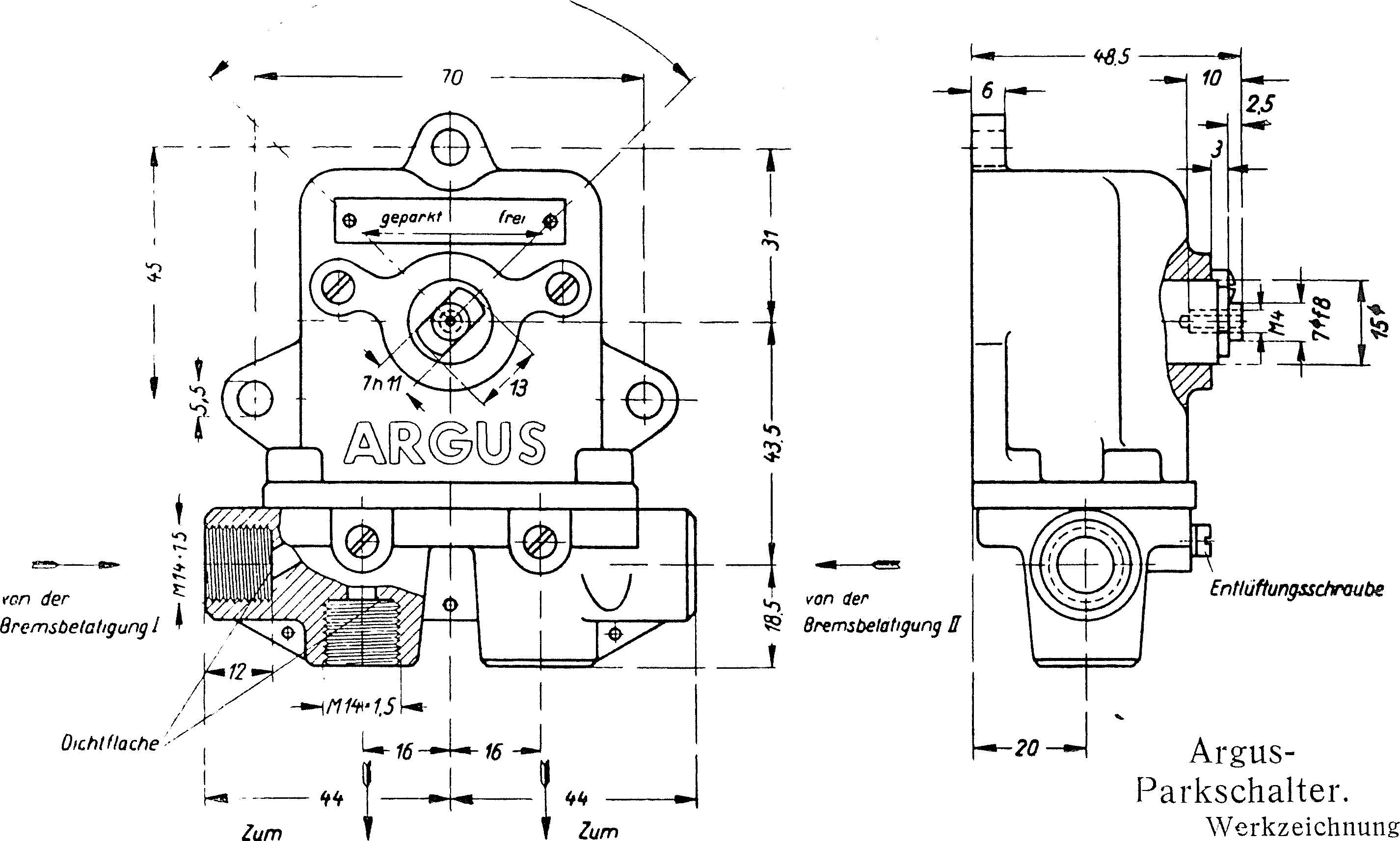
Bremsrad L Bremsrad 1
Argus-Hochdruckschlauchleitungen
für Betriebsdrücke bis 150 kg/cm2 wurden in Gemeinschaft mit Spezialfirmen entwickelt. Der aus synthetischem Kautschuk hergestellte Schlauch eignet sich innerhalb des Temperaturbereiches von
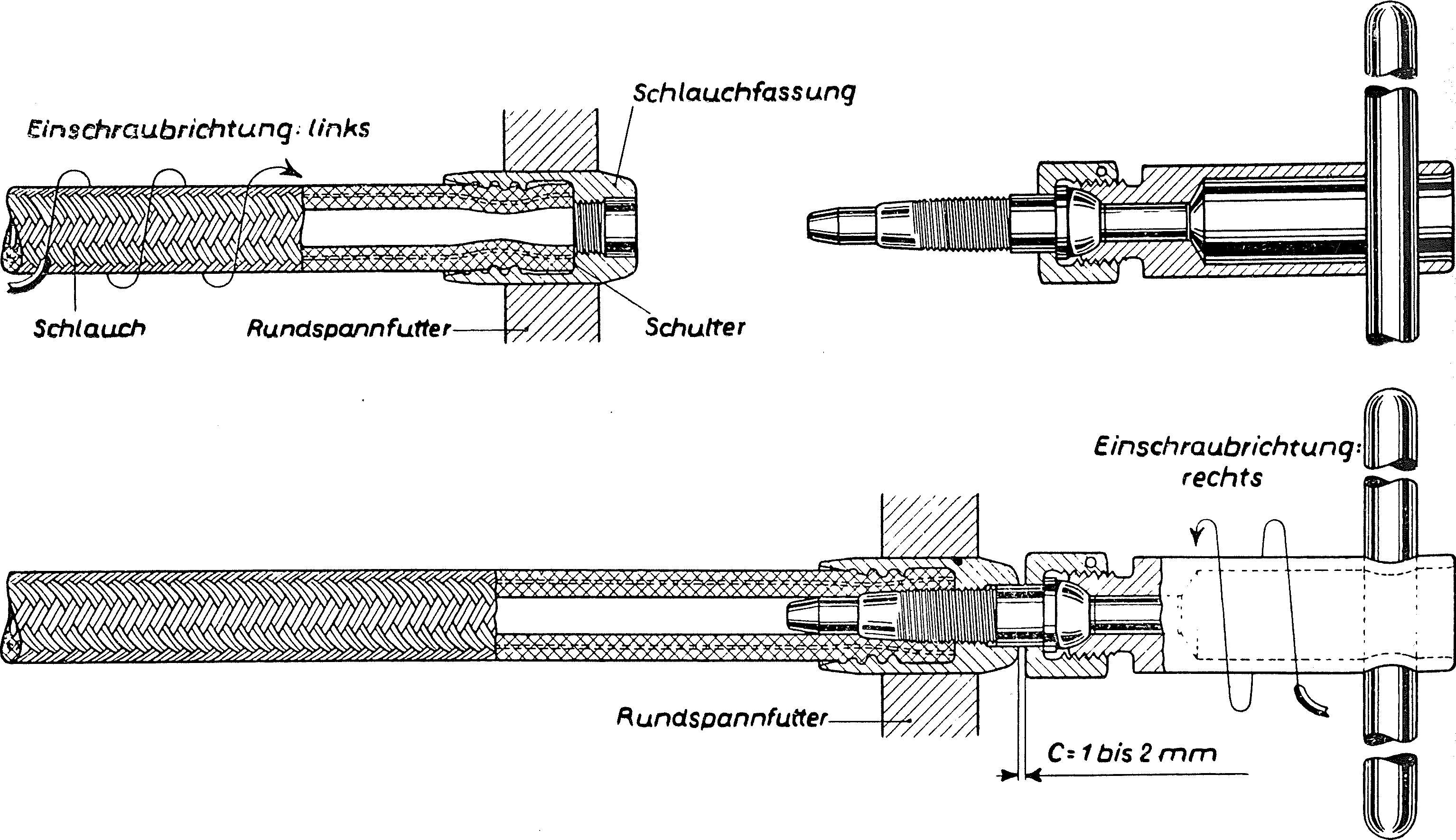
Abb. l u. 2. Argus-Hochdruckschlauchleitungen. Werkzeichi
—60° bis +170° C für Kraftstoffe (Benzolgehalt bis zu 50%), mineralische und pflanzliche Schmierstoffe und Hydrauliköle, Gasöl, Feuerlöschmittel, Wasser, Luft und andere Flüssigkeiten und Gase. Die leichte und schnelle Montage der Schlauchfassungen mittels eines einfachen Montagedornes gestattet, in den Ersatzteillagern lediglich Schlauchhalbzeug und Schlauchanschlußteile zu führen, während bisher meistens Schlauchleitungen für die verschiedenen Verwendungszwecke in jeweils bestimmten Längen auf Lager gehalten wurden. Der Schraubnippel wird auf den Montagedorn aufgeschoben und mit der Ueberwurfmutter festgezogen. Man taucht den Schraubnippel in eine Paste aus Graphit und Oel und führt ihn unter ständigem Rechtsdrehen in das freie Ende der Schlauchfassung ein, bis das Gewinde gefaßt hat. Alsdann schraubt man den Nippel so weit in die Fassung, bis der Abstand „c" erreicht ist. Nach Lösen der Ueberwurfmutter wird der Montagedorn herausgezogen, und damit ist der Anschluß fertiggestellt.
Bordgeräte.
Die Firma R. Fuess, Berlin-Steglitz, zeigt in Brüssel einige neuentwickelte Meßgeräte, von denen der Dosen-Ladedruckmesser und der elektrische Temperaturschreiber besonders erwähnt seien.
Der Dosen-Ladedruckmesser ist ein zum festen Einbau in das Gerätebrett bestimmtes Rundgerät der großen internationalen Norm, das unabhängig von der Flughöhe den Ladedruck des Kompressormotors anzeigt. Zum Unterschied von den bisher üblichen Ladedruckmessern wird der zu messende Druck jedoch nicht in das Gehäuse, sondern nur in einen Dosensatz geleitet, so daß das Gehäuse, das in hochfestem Preßstoff ausgeführt wird, nicht druckdicht zu sein braucht. Der fälschende Einfluß des Luftdruckes wird durch einen zweiten Dosensatz aufgehoben, der über einen Differentialhebel auf die Anzeigevorrichtung arbeitet. Es ist ein besonderer Vorzug des Geräts, daß es unempfindlich gegen Ueberflutung mit Treibstoff oder Oel aus der Druckleitung ist. Der elektrische Temperaturschreiber (vgl. Abb 1) dient zur praktisch trägheitsfreien Aufzeichnung der Temperatur der Außenluft und ist auch in schnellfliegenden Flugzeugen anwendbar. Er kann ohne weiteres an übliche Widerstandsgeber von 100 Ohm Widerstand angeschlossen und auch zur Registrierung anderer Temperaturen verwendet werden. Zur wissenschaftlichen Lufttemperaturmessung wurde ein Spezialwiderstandsgeber entwickelt, der sich
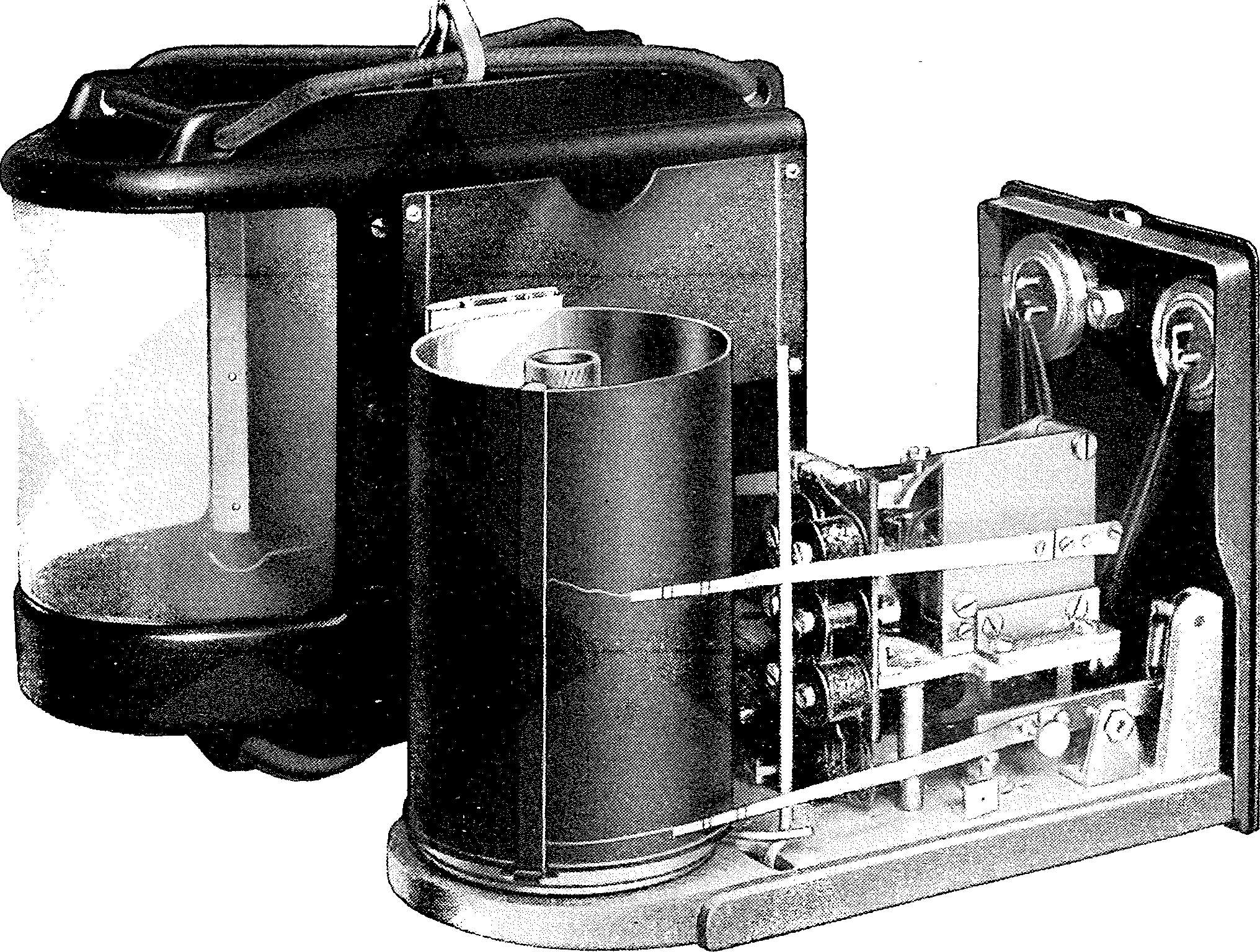
Abb. 1. Elektr. Temperaturschreiber.
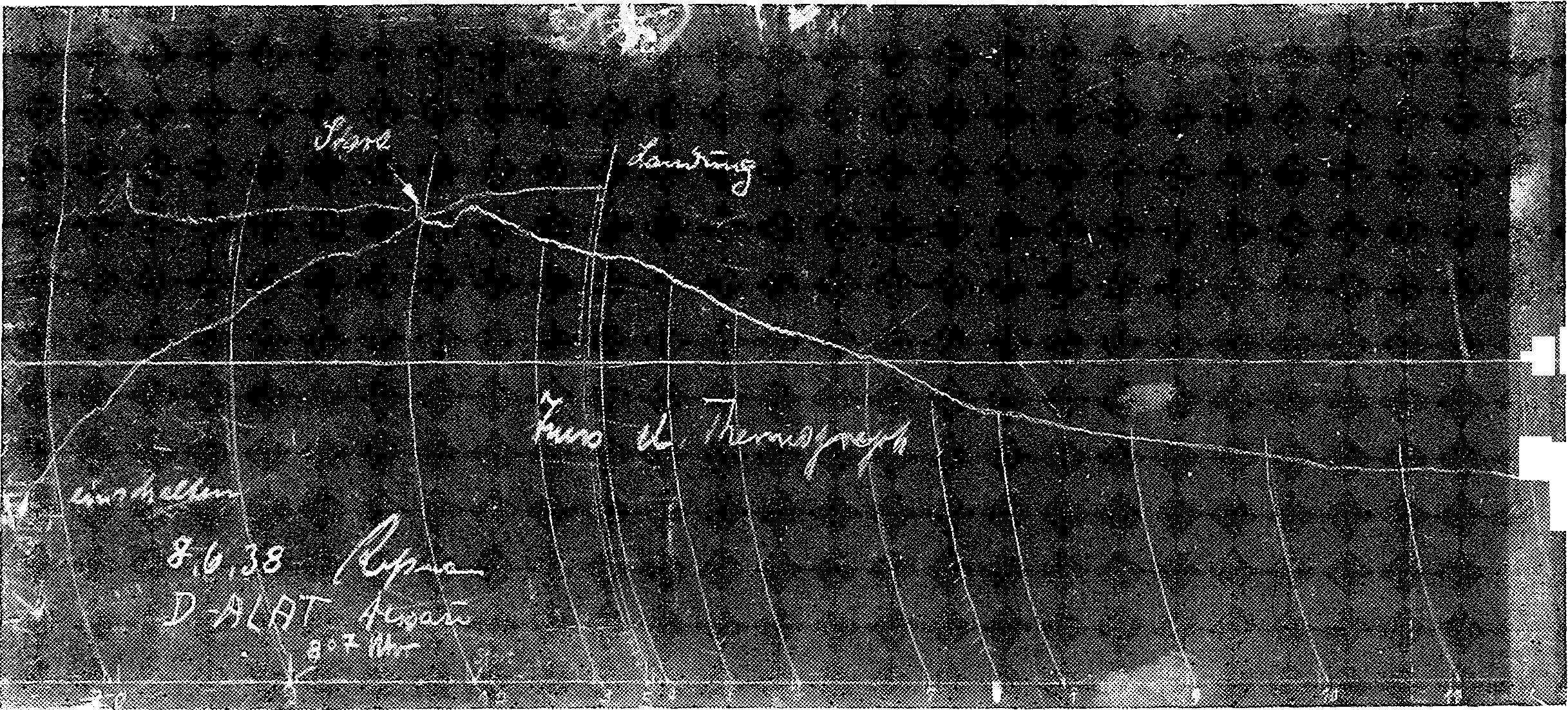
-7! elektr.Temperaturschreibers S| Rekordflug der i .Iu90. Juli 1938.
Schrieb des
Archiv Flugsport
Abb. 2.
durch verschwindend kleine thermische Trägheit auszeichnet — dafür allerdings nicht vereisungssicher ist.
Der Temperaturschreiber enthält eine Wheatstone'sche Brücke mit einem Null-Galvanometer in der bekannten Kompensationsschaltung, bei der die Brücke sich ständig selbsttätig auf Stromlosigkeit des Galvanometers abgleicht. Die Messung bleibt daher unbeeinflußt von allen möglichen Störungen, insbesondere von Schwankungen der Meßspannung — die die Bordbatterie liefert — sowie von der Temperatur des Schreibgeräts und des Galvanometers.
Die Schreibvorrichtung besteht aus einer von einem kältebeständigen Uhrwerk angetriebenen Trommel, auf deren Schreibstreifen — berußte Metallfolie — der Schreibhebel eine praktisch kontinuierliche Kurve großer Feinheit aufzeichnet. Abb. 2 ist die Wiedergabe einer Originalaufzeichnung des Geräts, die bei dem bekannten Rekordflug der Ju 90 im Juli 1938 mit 10 000 kg Last auf mehr als 7000 m Höhe gewonnen wurde. _
Dornier Do 215 Mehrzwecke-Kampfflugzeug.
Dornier Do 215, ein zweimotoriger Ganzmetallschulterdecker mit dem besonders kennzeichnenden langen schmalen Rumpf, ist aus dem Do 17, dessen Leistungen bedeutend übertroffen werden, hervorgegangen. Gegenüber dem Do 17 (vgl. Typenbeschr. „Flugsport" 1938, S. 35) sind je nach den verwendeten Motoren Höchstgeschwindigkeit, Zu-ladefähigkeit und Reichweite gesteigert. Infolge der hohen Geschwindigkeit, Wendigkeit, großen Gleitgeschwindigkeit, Stabilität um alle Achsen eignet sich der Do 215 besonders als schwerer Bomber, Fernbomber, Fernaufklärer, kombinierter Bombenaufklärer, Tiefangriffsflugzeug und unter Ausnutzung seiner hervorragenden Wendigkeit und Bewaffnung als Zerstörer.
Flügel freitragend, blechbeplankt, Trapezform mit abgerundeten Ecken. Anordnung der Querruder und Landeklappen erkennt man aus nebenstehender Abbildung.
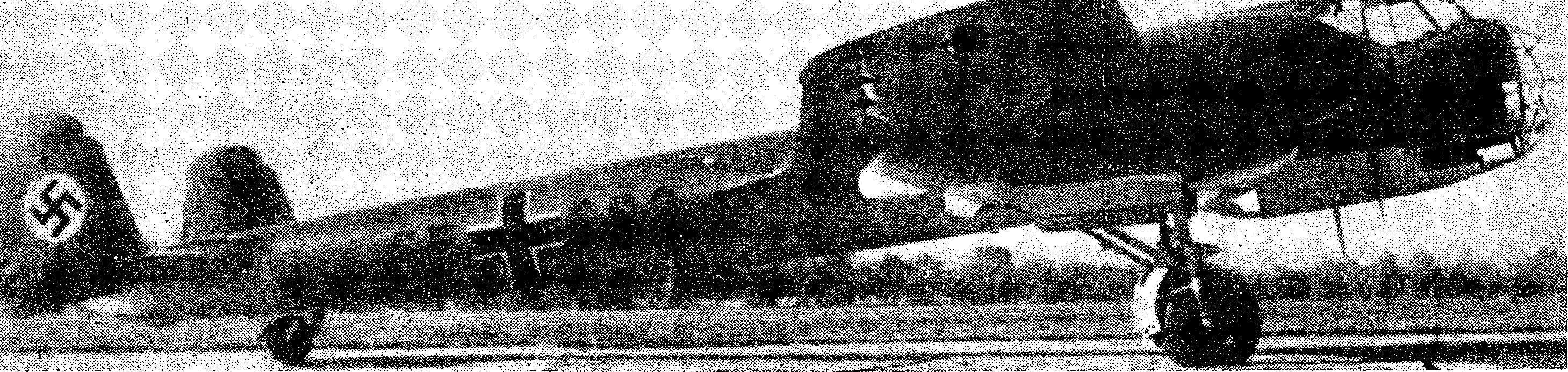
Dornier Do 215 Kampfflugzeug.
Werkbild
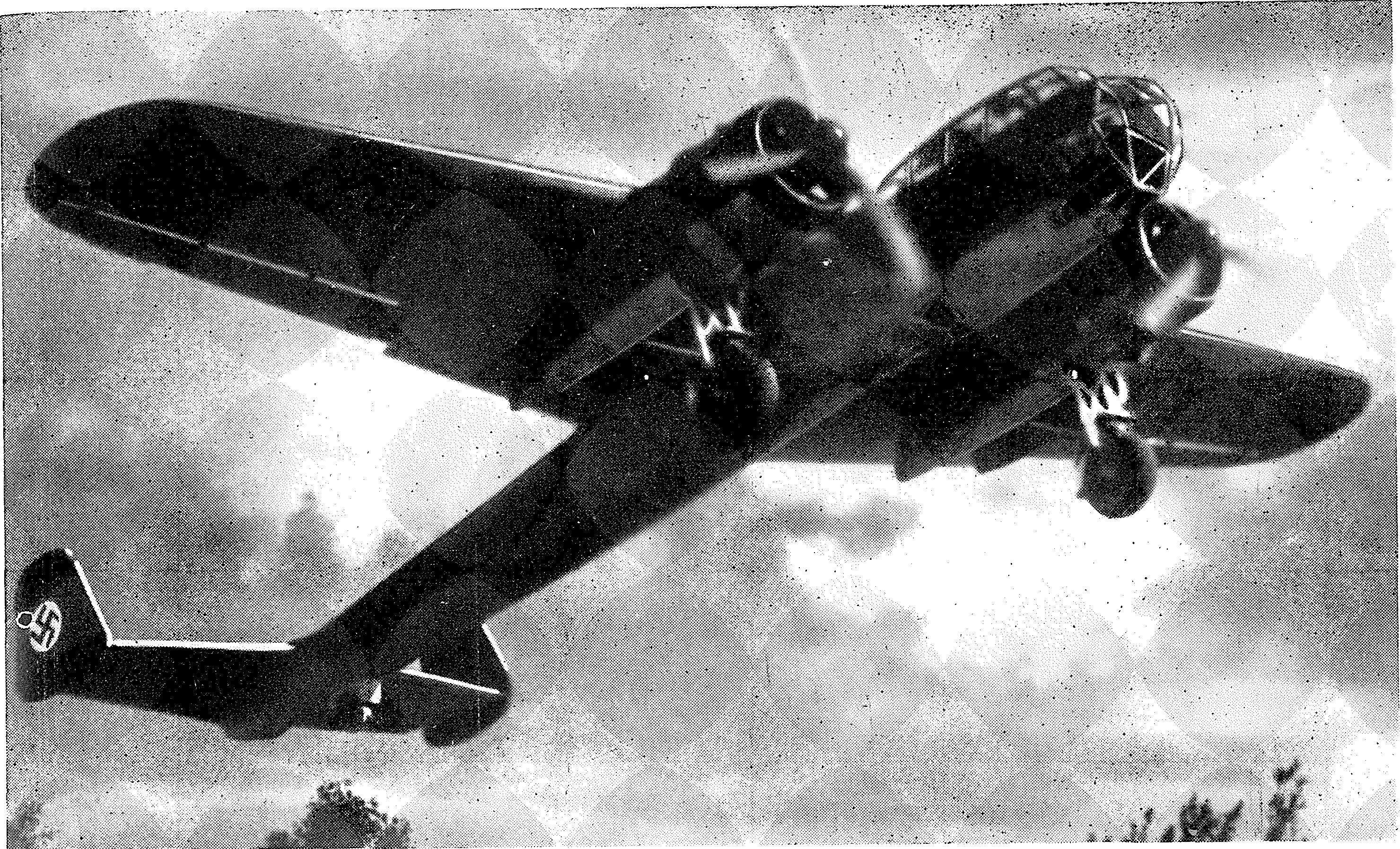
Dornier Do 215 Kampfflugzeug, zweimotoriger Ganzmetall-Eindecker mit planverglastem, noch vor der Schraubenebene liegendem Kopf. Werkbild
Rumpf Schalenbauweise mit Glattblechbeplankung. Rumpfkopf, in verstärktem Maße vor der Schraubenebene liegende neuartige Vollsichtkanzel mit planverglasten Scheiben, bietet völlig freies unverzerrtes Blickfeld in allen .Richtungen. An dem
durch geschickteste "Raumausnutzung viel Arbeitsraum bietenden Rumpfkopf sind in besonders leistungsfähiger Anordnung die Waffen vorgesehen, die bei der hier angewendeten neuen Gruppierung beste Schußfelder und damit' hervorragende Kampfkraft verbürgen. Im Kommandofenster auf ■ Deck und unten am Kopf sind bewegliche MGs so angeordnet, daß sich ein ideales Schußfeld ergibt. Hinter dem Führer- und Besatzungsraum liegen die mit horizontalen Bombenaufhängungen versehenen Bombenräume.
Dornier Do 215 Kampfflugzeug mit charakteristischer Vollsichtkanzel, die ein freies und ungehindertes Blickfeld nach allen Seiten bietet.
Werkbild
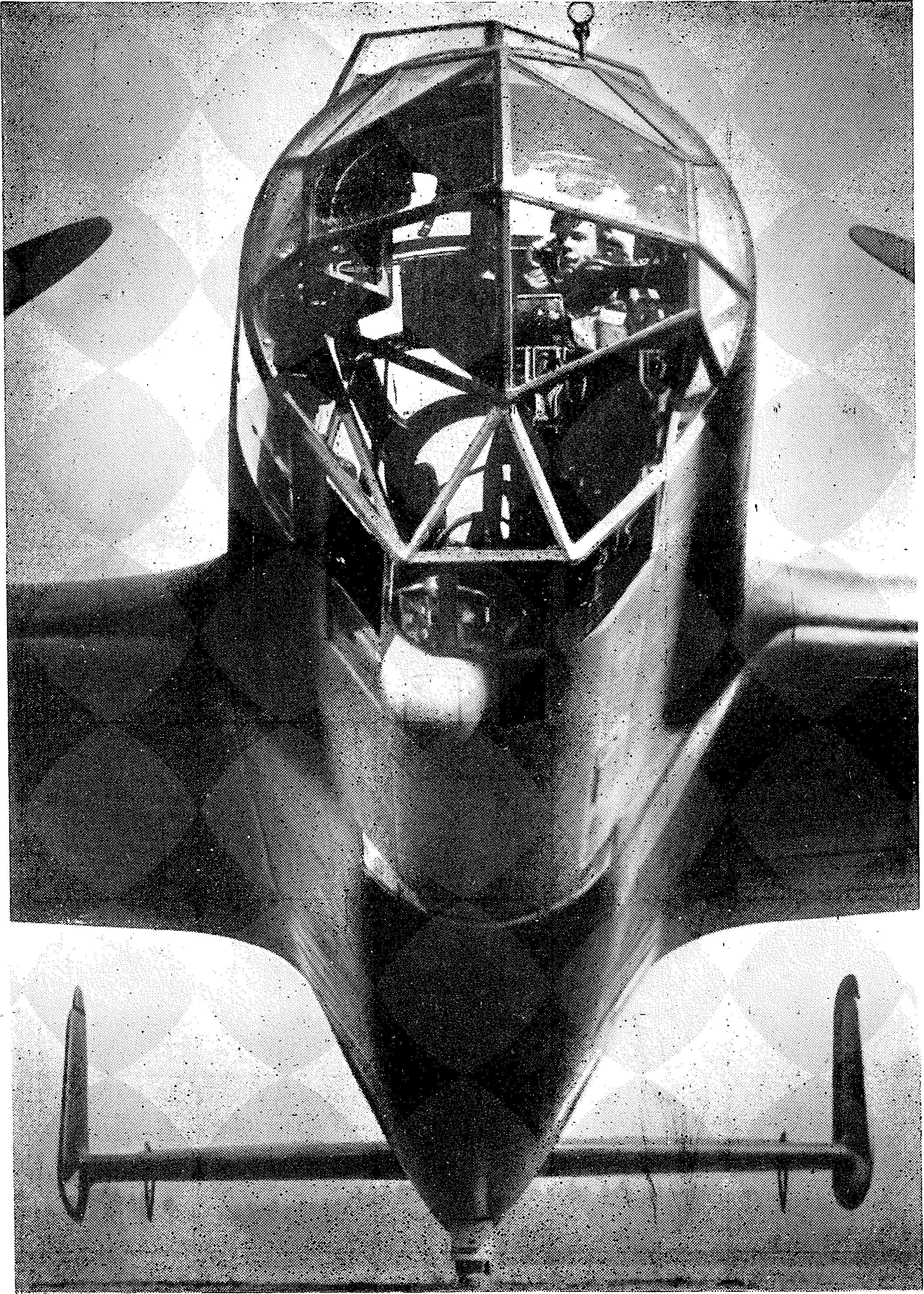
Dornier Do 215 Kampfflugzeug 500 km/h. Werkbilder
Leitwerk freitragend, Höhenflosse mit angelenktem Höhenruder und doppeltem Endscheiben-Seitenleitwerk mit verstellbarem Hinterkantenausgleich. Sämtliche Ruder gewichtlich und aerodynamisch ausgeglichen.
Fahrwerk unter den Motoren angeordnet, mit. bremsbaren Rädern versehen, einziehbar. Die Räder schwenken nach hinten in die Verkleidung ein, wobei sich die Oeffnung in der Flügelunterseite durch zwei selbsttätige Klappen schließt. Am Rumpfende abgefedertes einschwenkbares Spornrad.
Zwei Motoren vor der Flügelvorderkante in je einer Motorgondel. Je nach Wunsch werden luft- oder wassergekühlte Motoren von 700 bis 1100 PS eingebaut. Abwärme dient zur Innenraumheizung und zur Heizung der Flügelvorderkante als Vereisungsschutz. Als Zugschrauben dienen dreiflügelige, stetig verstellbare Metallpropeller.
Spannweite 18 m, Länge 16,3 m, Höhe 4,8 m, Flügelfläche 55 m2, Fluggewicht 8600 kg, Gesamtlast bis 3300 kg, Höchstgeschwindigkeit über 500 km/h, Landegeschwindigkeit 110 km/h, Dienstgipfelhöhe 9000 m, Reichweite 3000 km.
Curtiss P-40 Jagdflugzeug.
Curtiss P-40 ist das letzte Erzeugnis der Curtiss Wright Corp., gebaut in Buffalo, von denen die USA-Luftwaffe Serien im Werte von 12 872 398 $ bestellt hat. Viele Konstruktionsteile sind von dem P-36 und P-37 übernommen. Gegenüber dem P-37 ist der „General Elec-tric"-Kompressor ganz weggefallen.
Ganzmetallbau, Tiefdecker, Querruder, Höhen- und Seitenruder leinwandbedeckt. Flügel ein Hauptholm, zwei Nebenholme, Glattblechbekleidung. Landeklappen Ganzmetall, Ausschlag nach unten 30°,
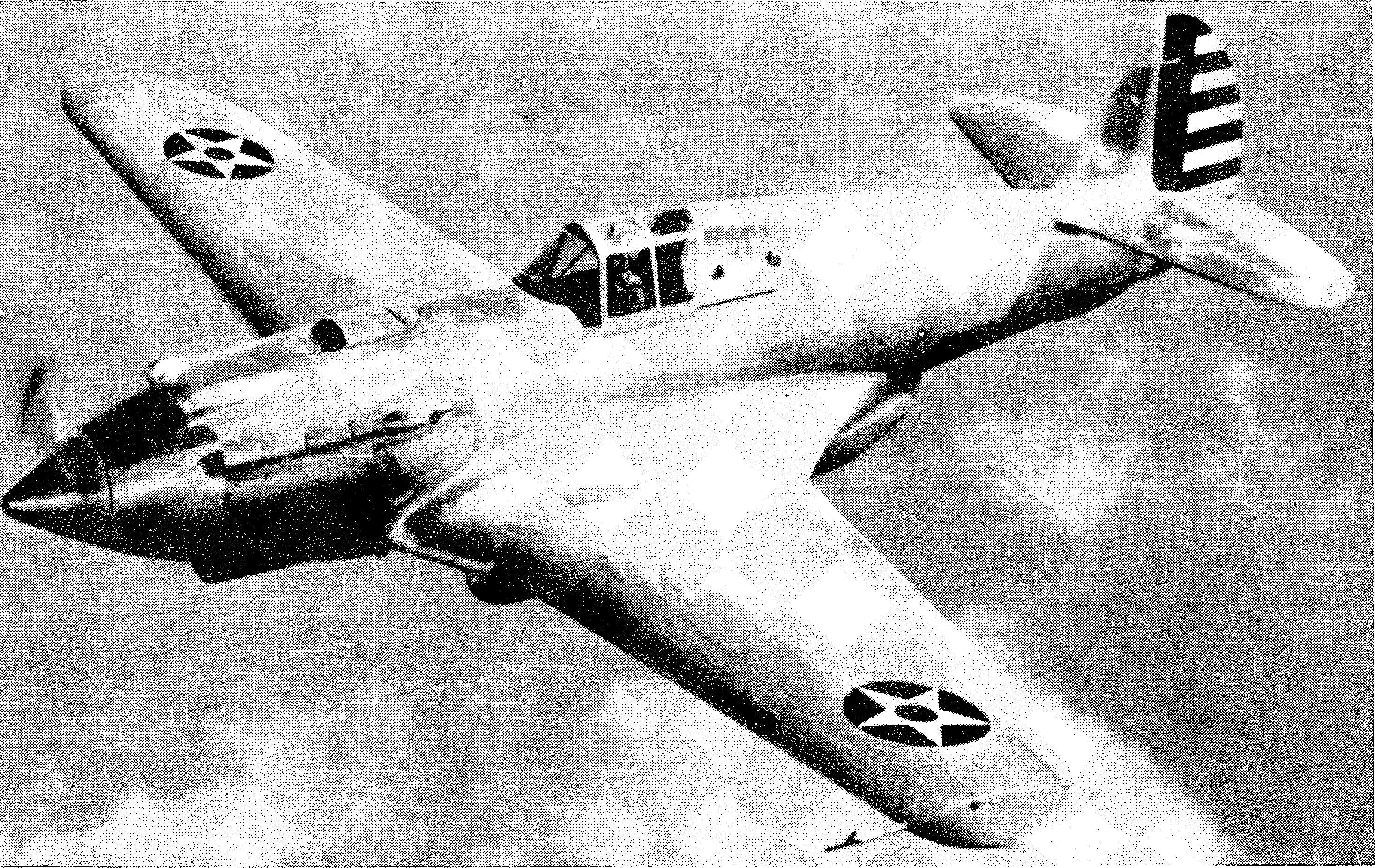
U. S. A. Curtiss Jagdflugzeug P-40. Werkbüd
Einbeinfahrwerke, nach hinten hochziehbar in den Flügel, mit Schwenkung des Laufrades um 90°. Vergleiche das Curtiss Hawk Einziehfahrwerk, „Flugsport" 1939, Nr. 13, S. 332. Schwanzrad nach hinten hochziehbar mit Deckblech.
Führersitz in der Mitte des Rumpfes vor der Hinterkante des Flügels. Windschutzaufbau nach hinten verschiebbar, ähnlich wie bei den früheren Jagdflugzeugtypen. Hinter dem Führersitz Betriebsstoffbehälter. Weitere Betriebsstoffbehälter im Flügel. Oelbehälter hinter dem Motor. Im Führerraum Atemgeräte, besondere Einrichtung für Heizung und Ventilation vom Führer regulierbar. Die im Steig- und Sturzflug sowie bei Höhenflügen bis auf 9120 m entstehenden Temperaturdifferenzen können hiermit ausgeglichen werden.
Funkeinrichtung für Verständigung mit den anderen Piloten und Bodenabwehrstationen.
Motor 12-Zyl.-V-Form-Allison QV-1760D 1260 PS. Flüssigkeitskühler. Oelkühler unter
der Rumpfnase. Kompressor hinter dem Motor. Curtiss-Verstell-schraube 3,45 m Durchmesser.
In der obenstehenden Abbildung erkennt man die zwei auf der Rumpfoberseite durch den Propeller feuernden MKs Browning Modell MQ-53, Kaliber 50.
Curtiss P-40 Jagdeinsitzer.
Zeichnung Flugsport
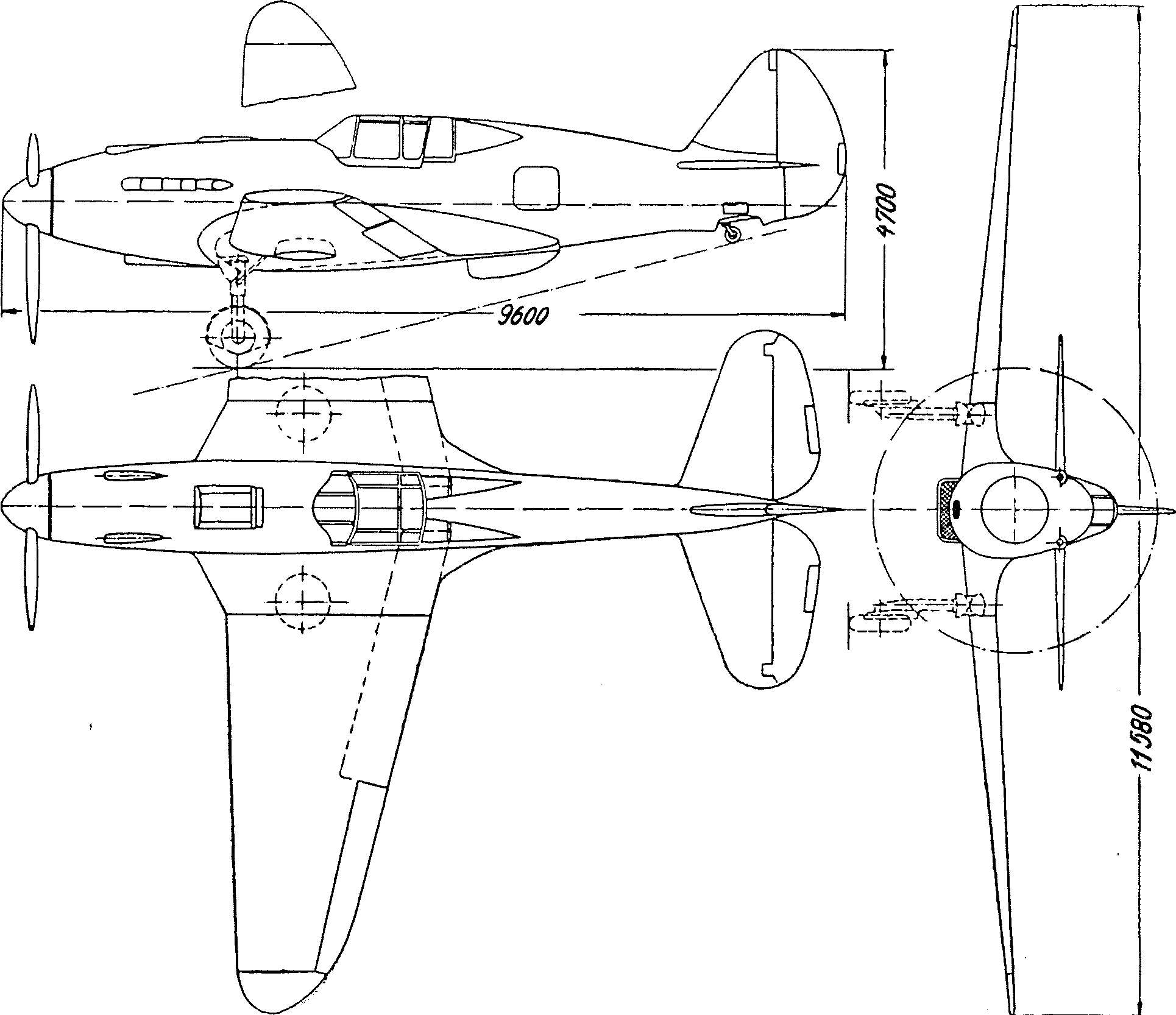
Spannweite 11,58 m, Länge 9,60 m, Höhe 3,45 m, Leergewicht 1800 kg, Nutzlast 555 kg, Fluggewicht 2355 kg. Max. Geschwindigkeit 644 km/h, Reisegeschw. 587 km/h, Steiggeschw. 1824 m/min, absolute Gipfelhöhe 10 082 m, praktische 9272 m, Aktionsradius 1000 km.
Kanad. Jagdflugzeug PDB-L
Dieser kanadische Versuchs-Jagdeinsitzer FDB-1, gebaut von der Canadian Car & Foundry Ltd., soll als Jagdeinsitzer und Sturzbomber verwendet werden. Konstrukteur Michael Gregor. Ganzmetallbau, Doppeldecker leicht gestaffelt. Oberflügel nach der Oberseite des Rumpfes leicht nach unten gekröpft.
Kanad. Jagdflugzeug FDB-1. Weltbild
Motor in der Versuchsmaschine 750 PS Pratt & Whitney Wasp Junior. Rumpf nach hinten stark verjüngt. Bauweise, Profilringe mit Schotten, Profillängsträger mit Glattblechauflage. Führersitz verstellbar. Die übliche Ausrüstung, Fahrwerkshochziehkontrollen, elektrischer Starter u. a. m.
Flügelaufbau zwei Duralholme und Rippen in sich verspannt. Flügelnase Duralbedeckung, hinten Leinwandbedeckung. Oberflügel Schlitzklappen 500 mm und an der Hinterkante Spreizklappen 2,5 m. Am Unterflügel Querruder.
Höhen- und Seitenleitwerk Metallkonstruktion freitragend; Ruder
Geteiltes Fahrwerk, seitlich in den Rumpf ein-ziehbar. Hydraulische Stoßaufnehmer und Bremsen. Schwanzrad vom Führersitz aus feststellbar.
Betriebsstoffbehälter 440 1, zwei nebeneinander liegende Tanks vor dem Führersitz. Oelbehälter 77 1.
Bewaffnung zwei MGs 13 mm, 1000 Schuß, zwei 50-kg-Bomben.
Kanad. Jagdflugzeug FDB-1.
Zeichnung Flugsport
leinwandbedeckt, Trimmklappen.
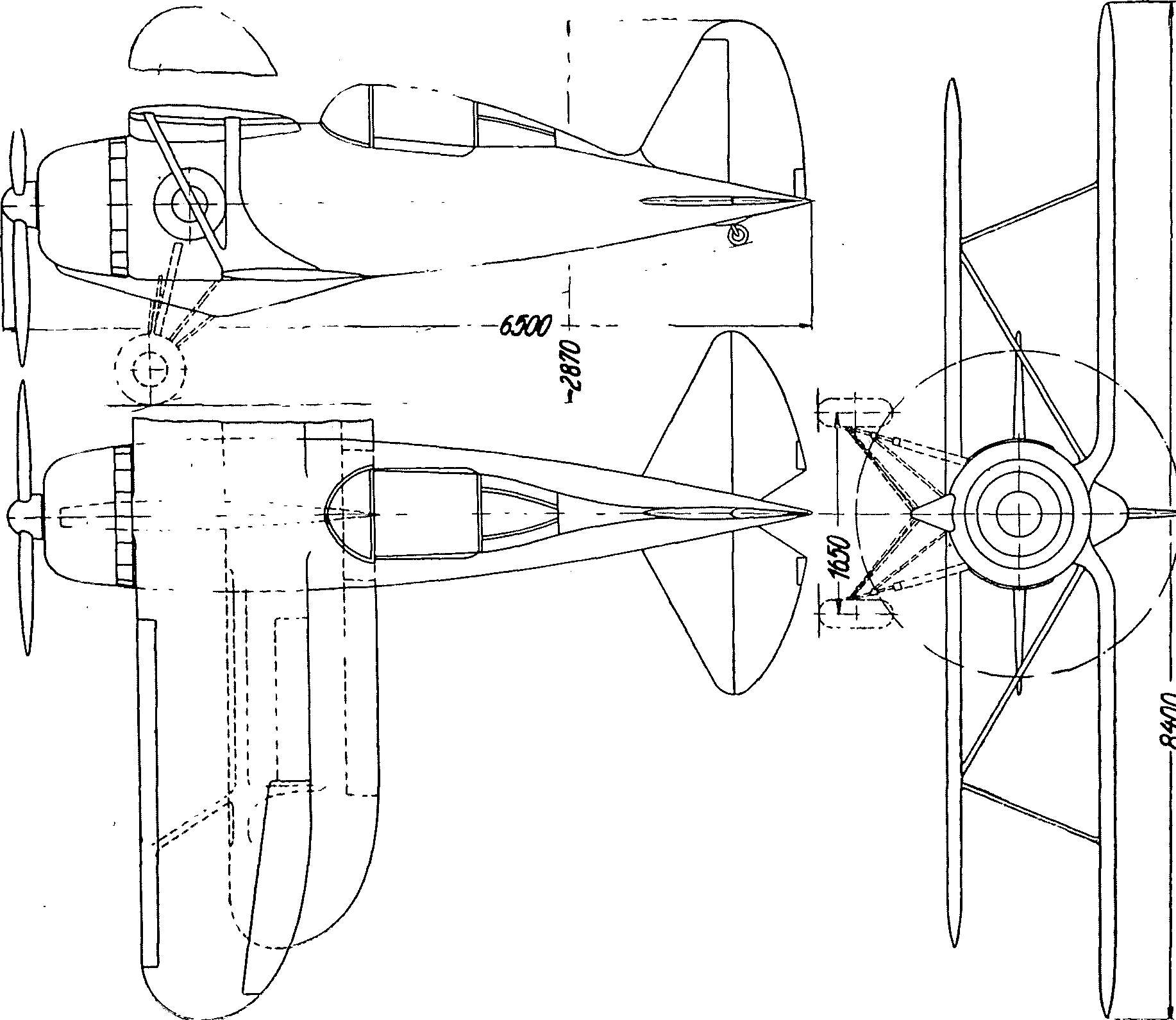
Kanad. Jagdflugzeug FDB-1
Bilder Aviation.
Spannweite 8,4 m, Länge 6,5 m, Höhe 2,8 m. Fläche 18 m2. Leergewicht 1360 kg, Fluggewicht 1920 kg. Max. Geschwindigkeit in 2300 m Höhe 480 km/h, mittlere Geschwindigkeit mit 67% Motorleistung 410 km/h, Landegeschw. 120 km/h. Steigfähigkeit 1050 m/min, Gipfelhöhe 9000 m. Aktionsradius 1540 km. Erreichte Sturzfluggeschwindigkeit wird mit 900 km/h angegeben.
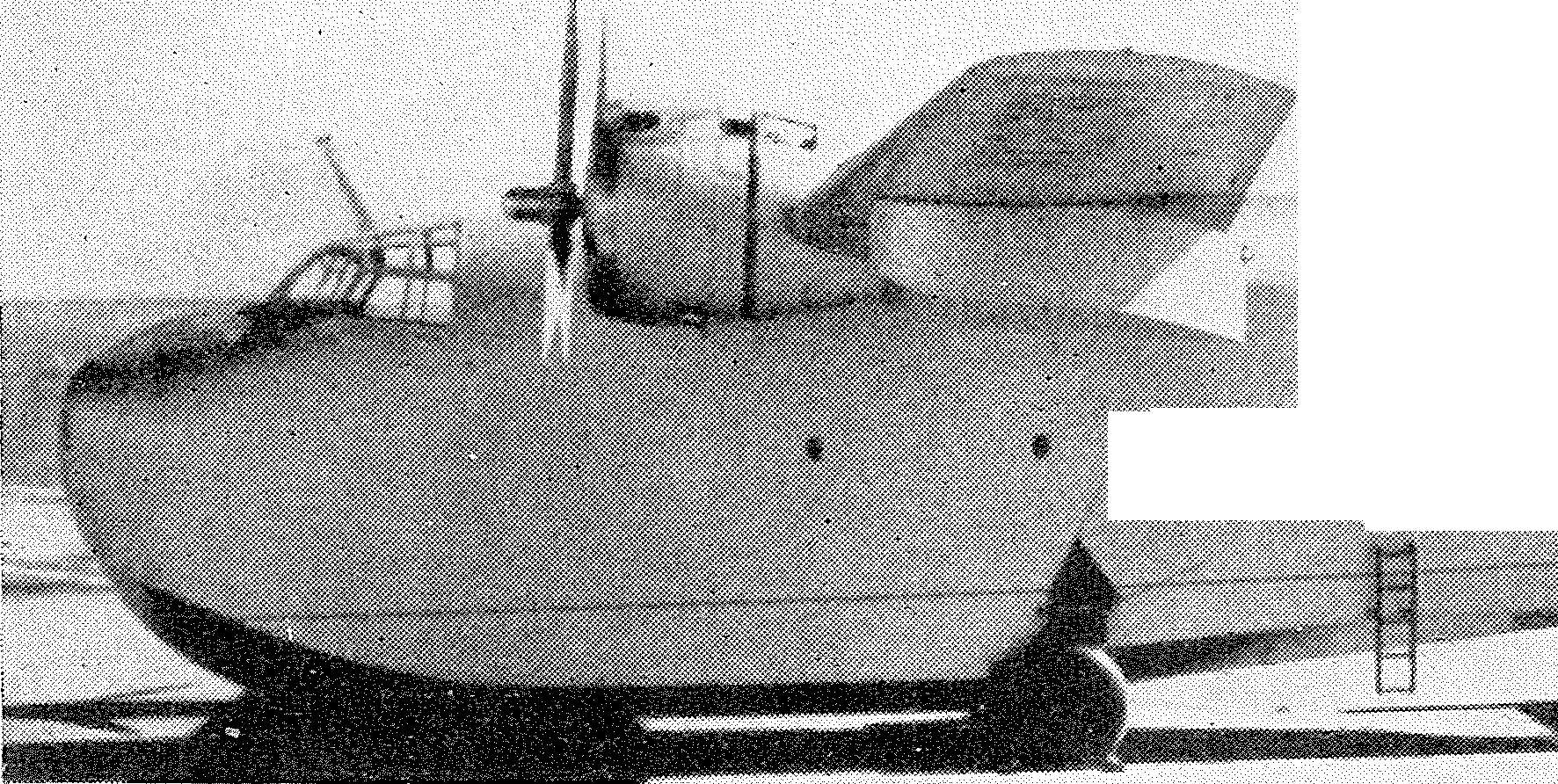
USA. Consolidated 31 Flugboot, zwei 18 Zyl. Wright Cyclone Doppelstern 2000 PS.
Werkbild
Mayo Schnellpostflugzeug-Entwurf.
Ueber die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Einsatzes des Mayo Doppelflugzeuges ist man heute in Fachkreisen noch geteilter Meinung. Daran ändern auch die gelungenen Probeflüge und die Ozeanüber-querung nichts. Es ist daher verständlich, daß man eine größere Leistungsfähigkeit der oberen Einheit, die gegenwärtig als Schwimmerflugzeug gebaut wird, zu erreichen versucht. Aerodynamisch hochwertig kann aber nur ein Landflugzeug gebaut werden. In folgendem sollen die Hauptdaten dieses als Landflugzeug gebauten „Idealflugzeuges44 angegeben werden.
Die Berechnungen haben zur Grundlage einen Postverkehr zwischen London und New York, mit einer Reisegeschwin-
Mayo-Schnellpostflugzeug-Entwurf.
Zeichnung Flugsport
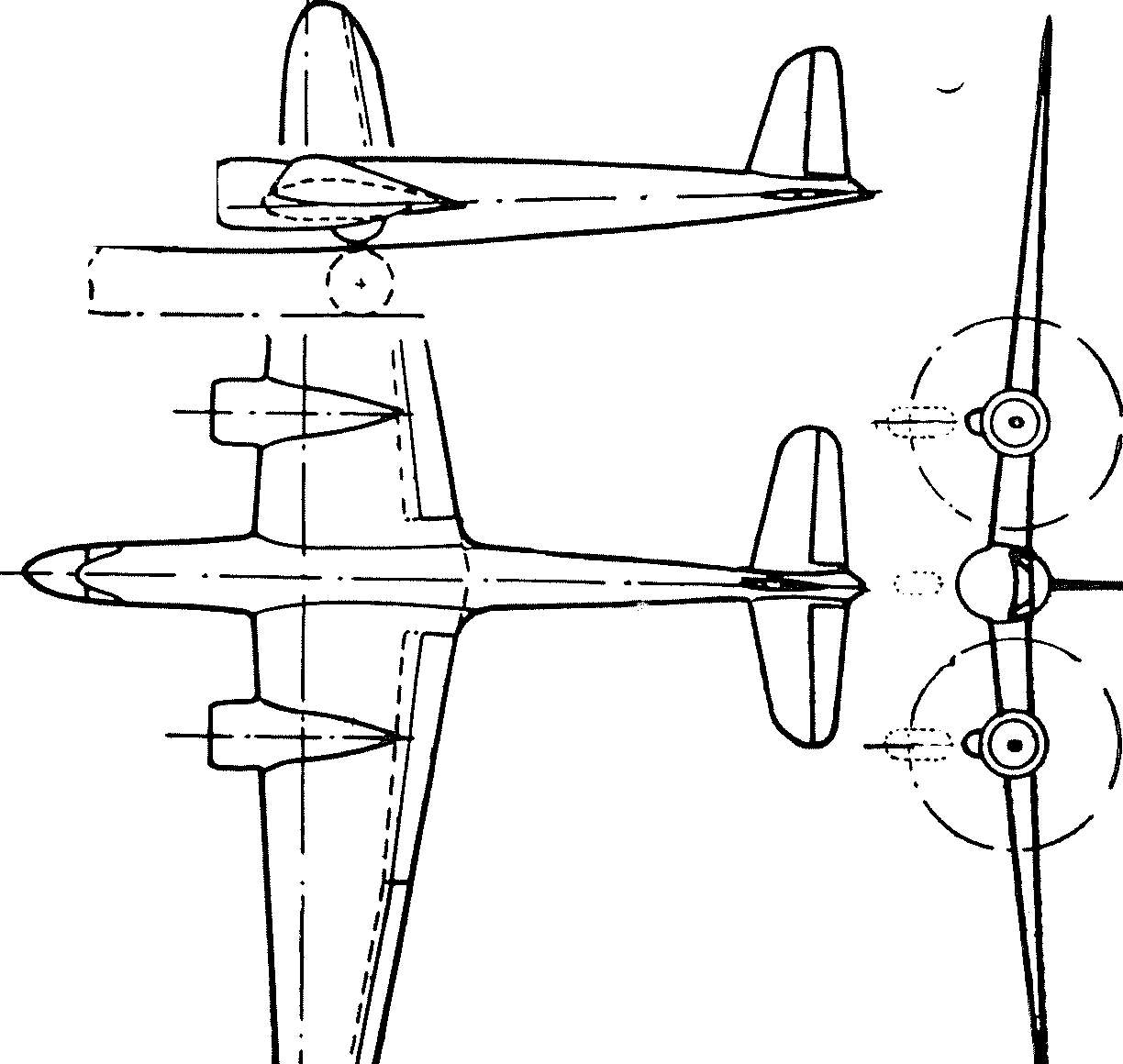
digkeit von 400 km/h über eine Entfernung von 6000 km, einschließlich Windeinfluß.
Abmessungen und errechnete Leistungen: Spannweite 22,4 m, Länge 16,4 m, Flügelfläche 65 m2. Gewichte: Zelle 3600 kg, Triebwerksanlage 2400 kg, Ausrüstung 445 kg, Leergewicht 6500 kg; Besatzung (3) 275 kg, Post 1700 kg, Kraftstoff 7050 kg, Oel 440 kg, Fluggewicht 16 000 kg. Flächenbelastung, Start 245 kg/m2, Landung 136 kg/m2, Leistungsbelastung, Start 5,7 kg/PS, Reiseflug 9,3 kg/PS. Triebwerk: 2 Bristol „Hercules 4" Schiebermotoren zu je 1400 PS Startleistung und 850 PS Reiseleistung in H = 1500 m.
Reisegeschwindigkeit km/h nach dem Start 370 (Ende des Fluges 400), Anfangssteiggeschw. m/min 370 (780), Steiggeschw. in H =--910 m 210 (540), Dienstgipfelhöhe m 4100 (7600), absol. Gipfelhöhe m 4650 (7900).
Menasco Unitwin Doppelmotor, 580 PS.
Unitwin-U-520 Motor gebaut von der Menasco Manufacturing Co., Los Angeles, ist ein Motorenaggregat, bestehend aus zwei C6S-5-Menasco-Motoren von 260 PS, arbeitend auf einem mit Kuppelungen versehenen Untersetzungsgetriebe. Das Getriebe ist so konstruiert, daß die Motoren nicht mit genau gleicher Drehzahl zu arbeiten brauchen. Ebenso hat bei Stillstehen eines Motors das veränderte Drehmoment keinen Einfluß auf die Arbeitsweise des anderen Motors, und ebenso wird der stillstehende Motor durch Reaktionsmomente nicht beeinflußt.
Gewicht des Gesamt-12-Zyl.-Aggregats 625 kg. Normalleistung Seehöhe bei 2300 U 520 PS, in 1500 m bei 2300 U 520 PS, Startleistung 1 min 2400 U 580 PS, Betriebsstoff 87 Oktan, Oelverbrauch 11,2 g/PS/h. Luftschraubenwelle Untersetzung 1,28 : 1.
Typenbeschreibung des Menasco C6S Bucaneer siehe „Flugsport"
1934, Seite 276, 445, 525. Bohrung 114 mm. Hub 130 mm, Kompressionsverhältnis 5,5 : 1, Vorverdicht. 10,4:1. Der Motor wurde
in verschiedene Flugzeuge, so in das fünfsitzige Passagierflugzeug Ve-ga 2, eingebaut Geradeausflug mit einem Motor in 3000 m Höhe. Start mit einem Motor, erreichbare Gipfelhöhe 3000 m, Steigfähigkeit mit beiden Motoren 390 m/min, Höchstgeschwindigkeit 320 km in 1500 m.
USA. Unitwin Doppelmotor, 580 PS.
Werkbild
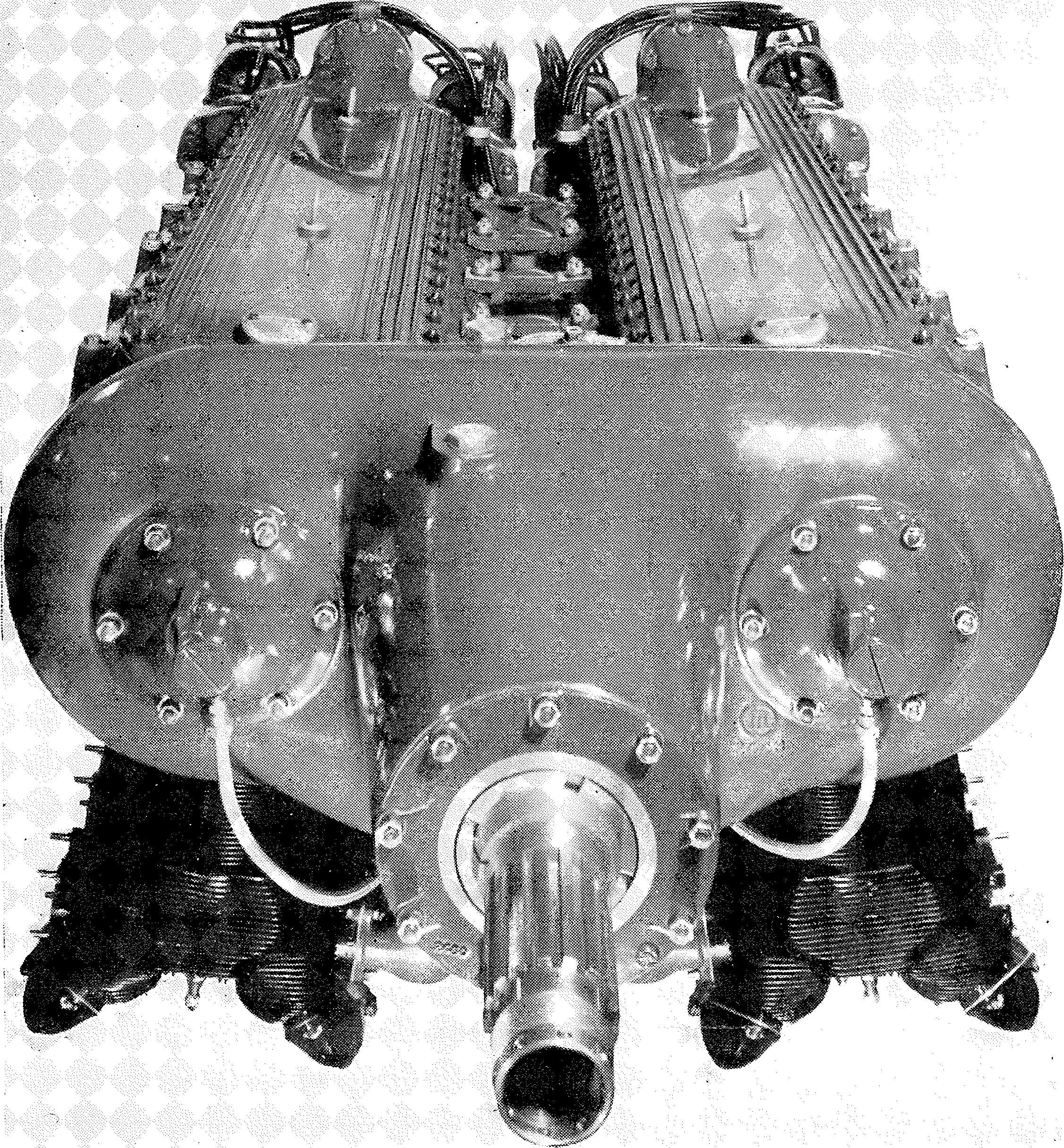
25 Jahre Dornier Metallbau.
1910 kam Dr.-Ing. e. h. Claudius Dornier als Ingenieur zum Zeppelinbau, baute Luftschiffhailen, entwarf 1913 ein Transozeanluftschiff, und 1914 übertrug ihm der Graf den Bau eines Wasserflugzeuges. Von Anfang an versuchte Dornier, in Metall zu bauen. Nach unendlichen Mühen entstand die heutige Dor-nier-Bauweise. Den Lesern dieser Zeitschrift ist die Entwicklung bekannt. Vieles wird der Erinnerung entschwunden sein. Nachstehend geben wir, um die Dornier-Entwicklung in Erinnerung zu rufen, einen Ueberblick Über Claudius Dornier, geb. 14. 5. 1884, Kempten die wichtigsten Dornier-Typen. Die Entwicklung von 1914 mit dem ersten RS I bis zum Transozeanflugboot Do 26 hat viel Pionierarbeit erfordert — ein schöner Erfolg.
Do Rs I Riesenflugboot 1914/15-
Spannw. 43 m, Länge 29 m, Fläche 328,40 m2. Motor 3X145 PS.
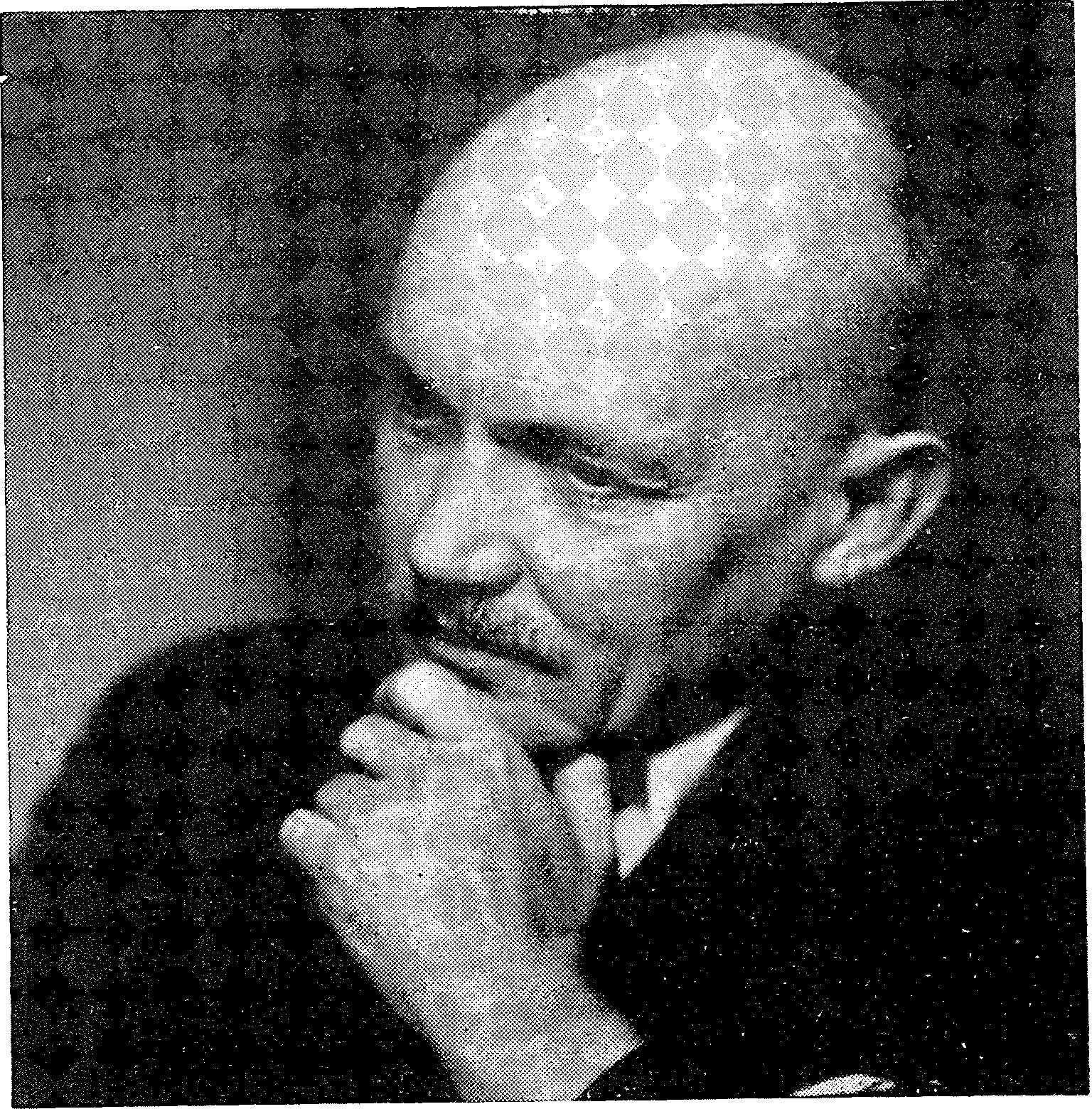
Do Rs II Riesenflugboot 1915/16.
Spannw. 33,20 m, Länge 23,9 m, Fläche 257 m2. Motor 4X240 PS. Höchstgeschw. 130 km/h.
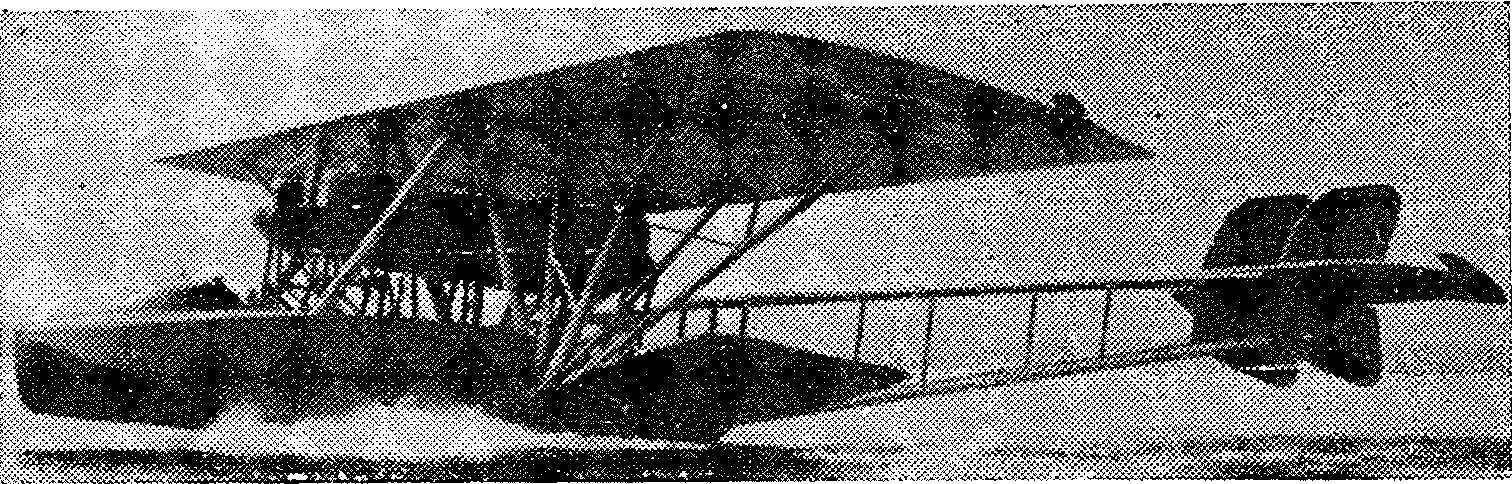
"A3
Do Rs III Riesenflugboot 1917.
Spannw. 37m, Länge 22,7m, Fläche 226 m2. Motor 4X260 PS. Höchst- t, geschw. 145 km/h.
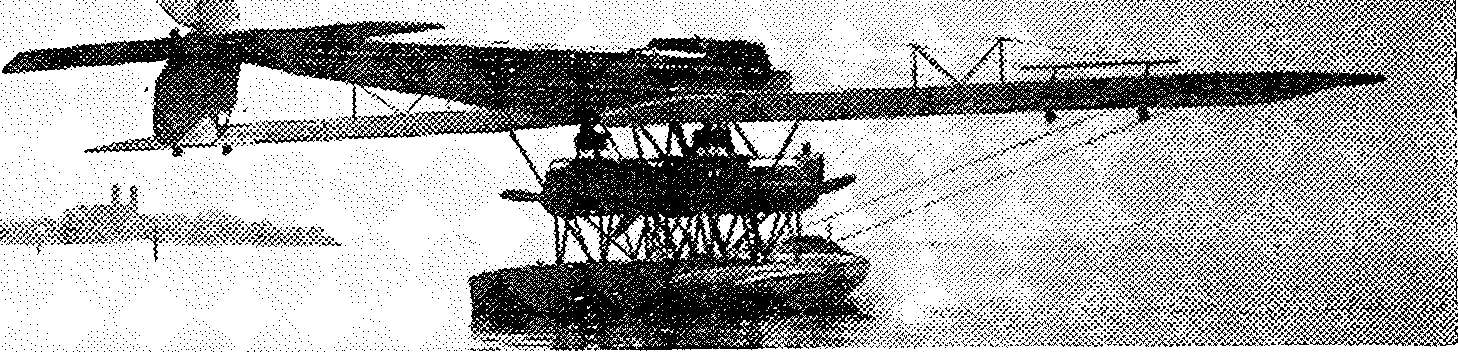
Do Cs I Seeflugzeug 1917. >Ar
Spannw. 13,18 m, Fläche 29,80 nr. " ^ Motor 1X195 PS. Höchstgeschw. 150 km/h.
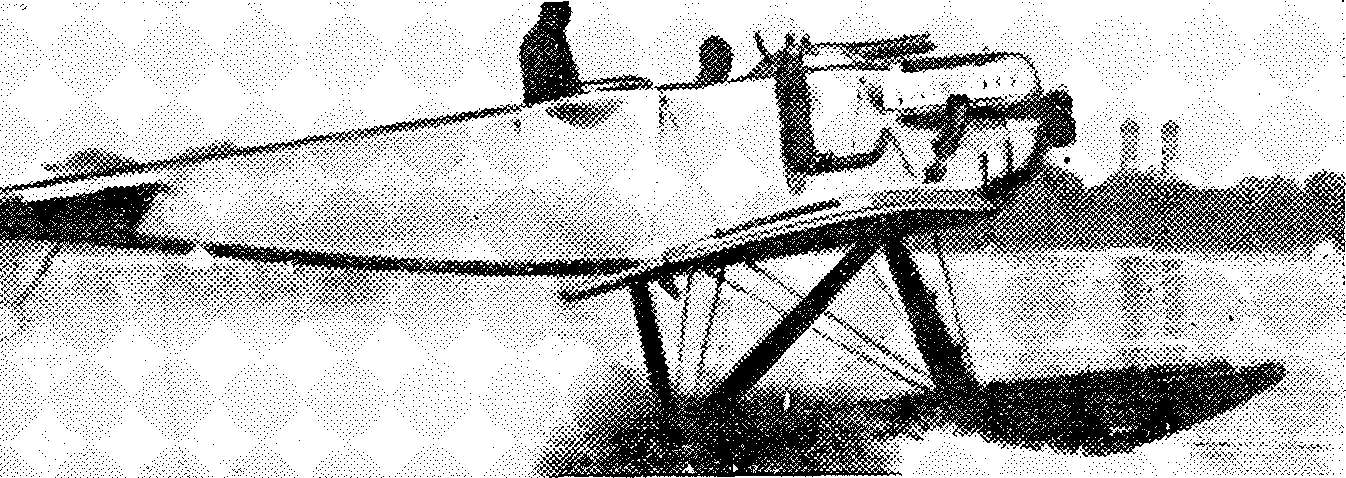
Do Cl I Aufklärungsflugzeug 1917.
Spannw. 10,50 m, Fläche 25,70 m2. Motor 1X160 PS. Höchstgeschw. 160 km/h.
Do Rs IV Riesenflugboot 1918.
Spannw. 37 m, Länge 22,3 m, Fläche 226 m2. Motor 4X270 PS. Höchstgeschw. 145 km/h.
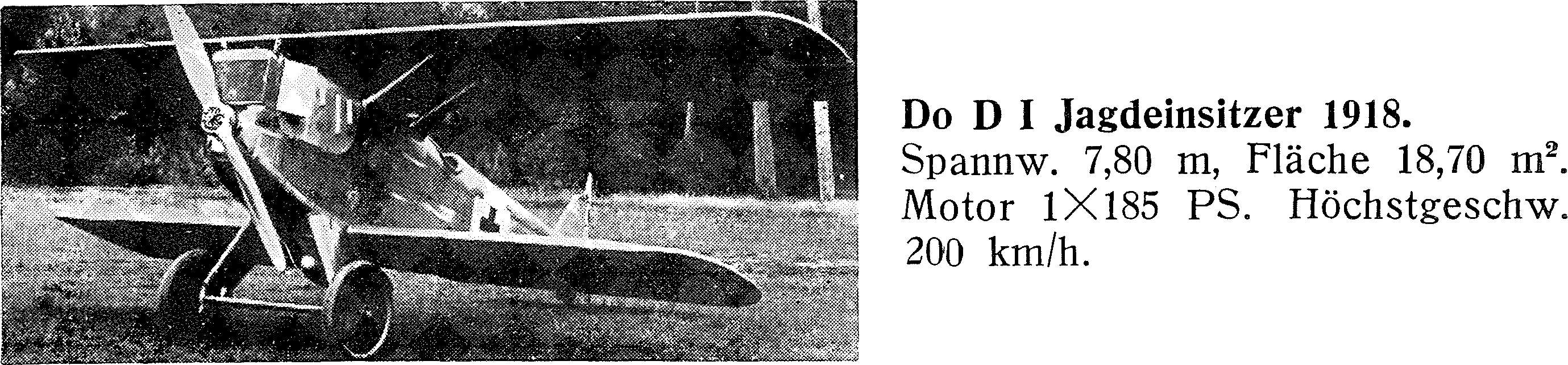
Do Gs I Verkehrsgroßflugboot 1919.
Spannw. 21m, Länge 15,3m, Fläche 79 m2. Motor 2X260 PS. Höchstgeschw. 160 km/h.
Delphin I Verkehrsflugboot 1920.
Spannw. 17,10, Länge 9,1 m, Fläche 49 m2. Motor 1X185 PS. Höchstgeschw. 140 km/h.
Libelle I, Sportflugboot 1921.
üi Spannw. 8,5 m, Fläche 14 m2. Motor 1X50 PS. Höchstgeschw. 125
km/h.
Do Komet Verkehrsflugzeug 1921.
Spannw. 17 m, Länge 12 m, Fläche 49 m2. Motor 1X240 PS. Höchstgeschw. 150 km/h.
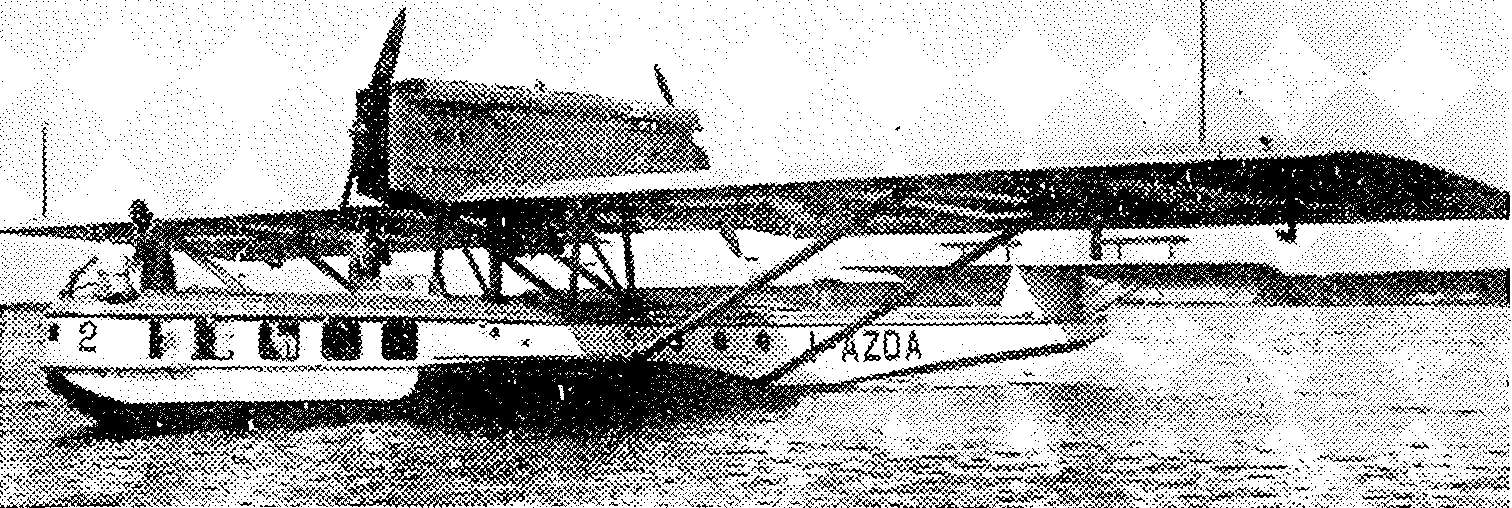
Wal Großflugboot 1922.
Spannw. 22,5 m, Länge 18,2 m, Fläche 96,0 m2. Motor 2X360 PS-Höchstgeschw. 180 km/h.
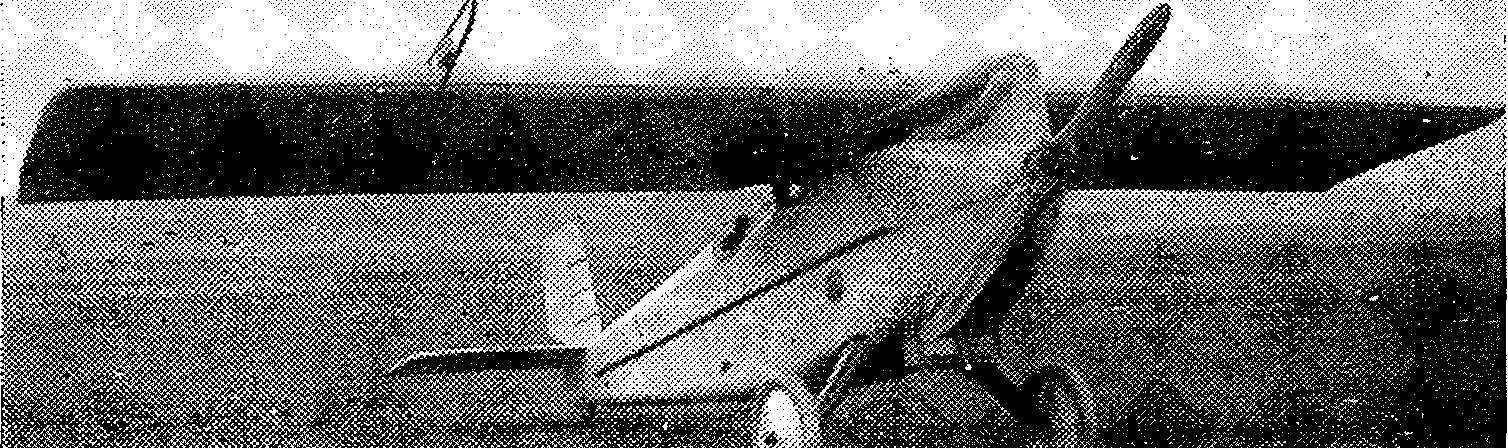
Falke Jagdeinsitzer 1922.
Spannw. 10 m, Fläche 20 m2. Motor 1X300 PS. Höchstgeschw.
260 km/h.
Do Spatz Schul- u. Sportflugzeug 1923.
Spannw. 9,8 m, Länge 6,9 m, Fläche 15,5 m2. Motor 1X80 PS. Höchstgeschw. 160 km/h.

Do E Flugboot 1924.
Spannw. 17 m, Fläche 53,30 m2. Motor 1X 420 PS. Höchstgeschw. 170 km/h.
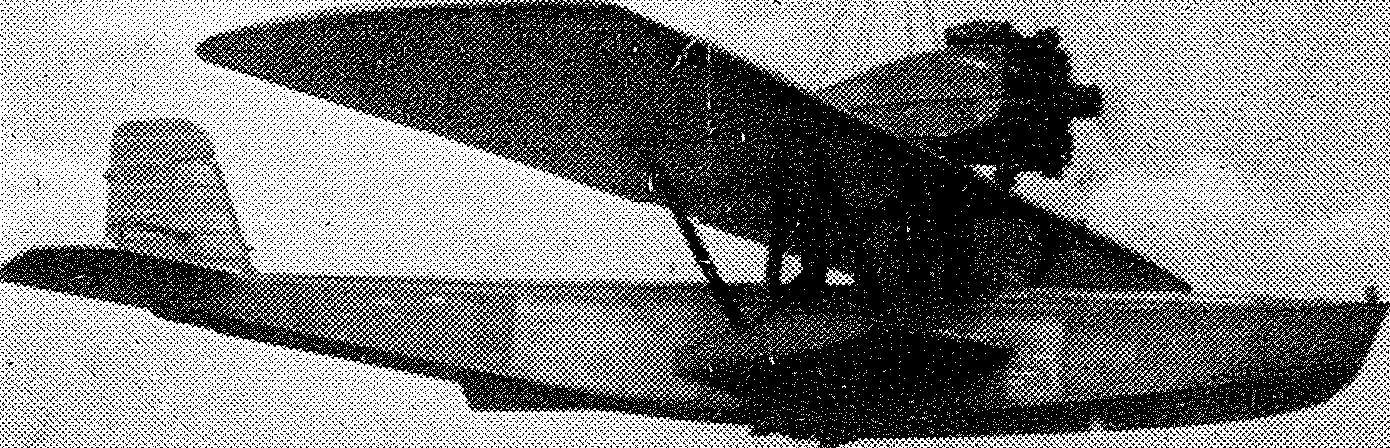
Do N Bomben-Großflugzeug
1925/26.
Spannw. 26,80 m, Fläche 129 m2. Motor 2X600 PS. Höchstgeschw. 190 km/h.
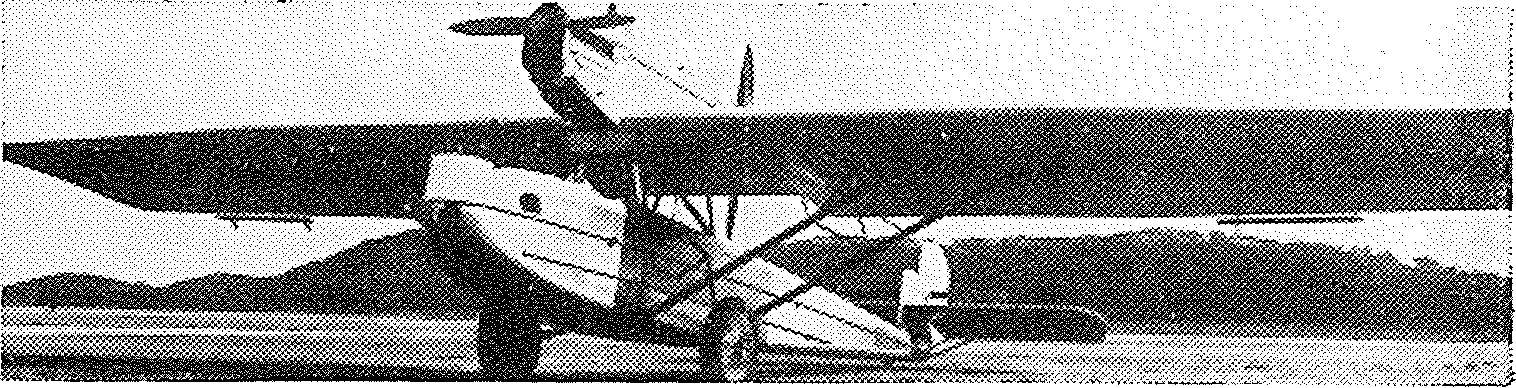
Merkur Verkehrsflugzeug 1926.
Spannw. 19,60 m, Länge 12,5 m, Fläche 62,40 m\ Motor 1X600 PS. Höchstgeschw. 195 km/h.

Delphin III Verkehrsflugboot 1927.
Spannw. 19,60 m, Länge 14,35 m, Fläche 62,40 m2. Motor 1X650 PS. Höchstgeschw. 170 km/h.
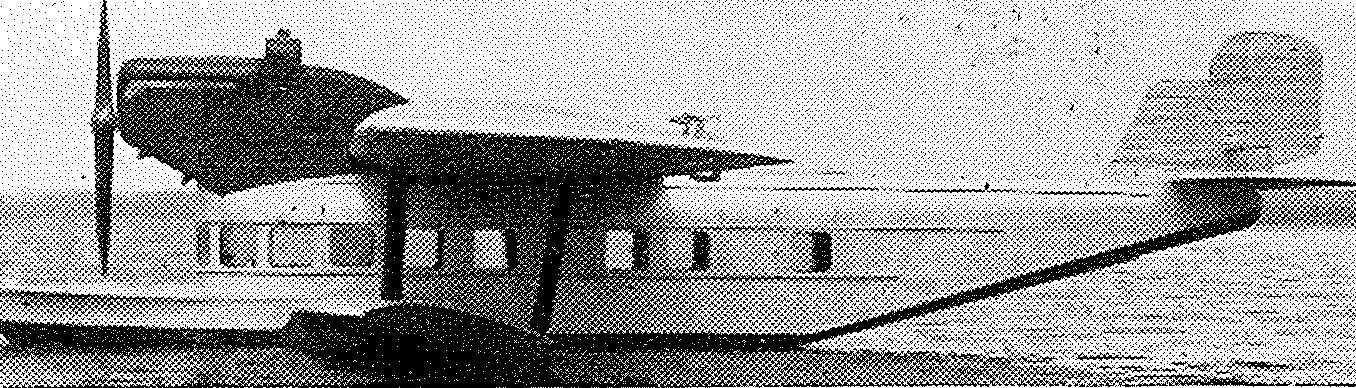
Superwal Verkehrsflugboot 1927/28.
Spannw. 28,6 m, Länge 25,7 m, Fläche 137 m2. Motor 4X500 PS. Höchstgeschw. 220 km/h.

Do D Torpedoschwimmerflugzeug 1928.
Spannw. 19,60 m, Fläche 62,40 m2. Motor 1X600 PS. Höchstgeschw. 195 km/h.
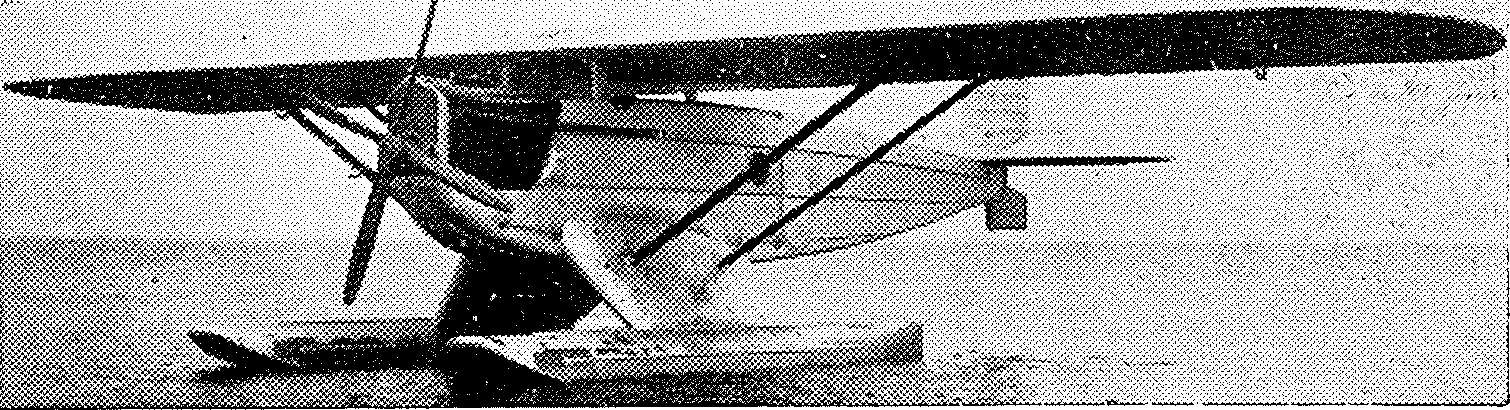
Do X Flugschiff 1929/30.
Spannw. 48 m, Länge 40 m, Fläche 450 m2. Motor 12X600 PS. Höchstgeschw. 212 km/h.
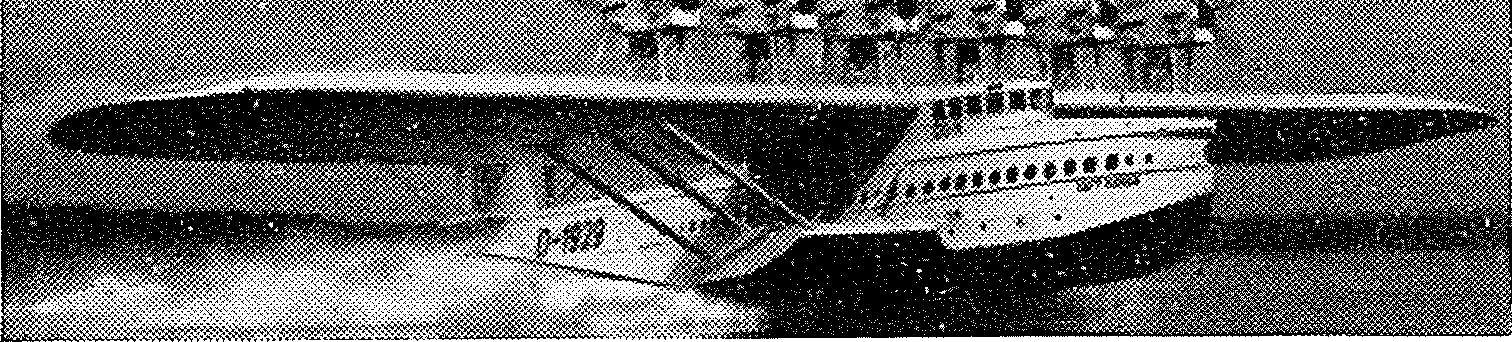
Do K Verkehrsflugzeug 1930/31.
Spannw. 25m, Länge 16,5 m, Fläche 89 m2. Motor 4X240 PS. Höchstgeschw. 230 km/h.
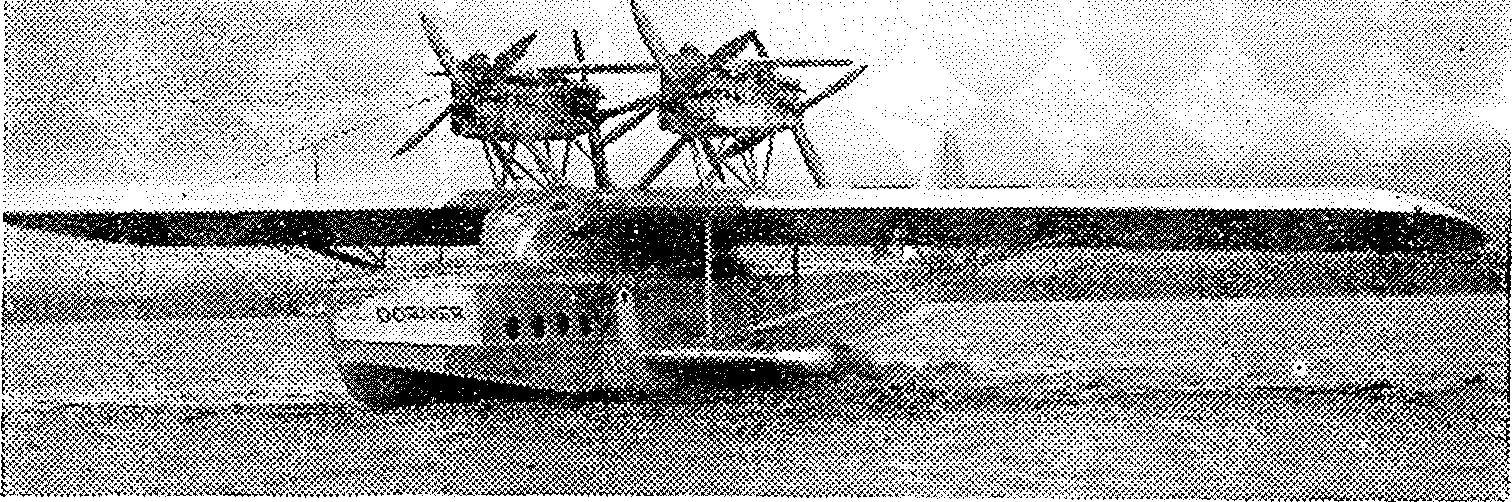
Do S Großflugboot 1930.
Spannw. 31 m, Länge 25,75 m, Fläche 186 m2. Motor 4X600 PS. Höchstgeschw. 210 km/h.
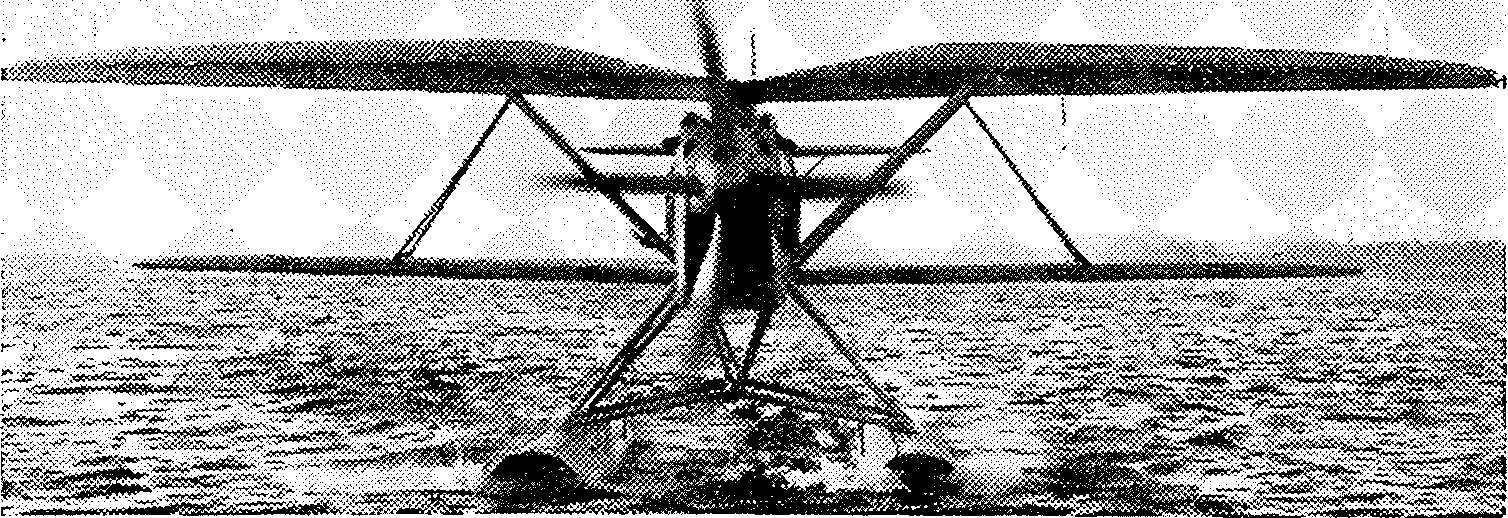
Do CII Kampfzweisitzer 1930/31.
Spannw. 15 m, Fläche 32,85 m2. Motor 1X650 PS. Höchstgeschw. 290 km/h.
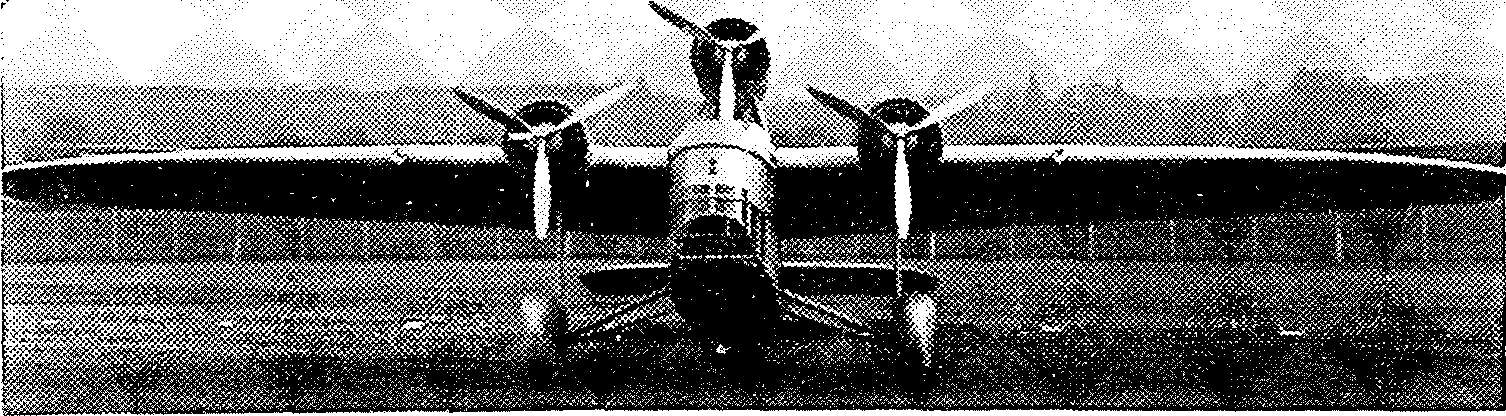
Do Y Fracht- u. Bomben-Großflugzeug 1931.
Spannw. 28 m, Länge 18,20 m, Fläche 111 m2. Motor 3X510 PS. Höchstgeschw. 240 km/h.
iiiiiisisiii
Do 12 Libelle II Amphibium-Sport-flugzeug 1932.
Spannw. 13 m, Länge 8,9 m, Fläche 25 m2. Motor 1X270 PS. Höchstgeschw. 208 km/h.

Do F Frachtflugzeug 1932/33.
Spannw. 28 m, Länge 18 m, Fläche 108 m2. Motor 2X650 PS. Höchstgeschw. 250 km/h.
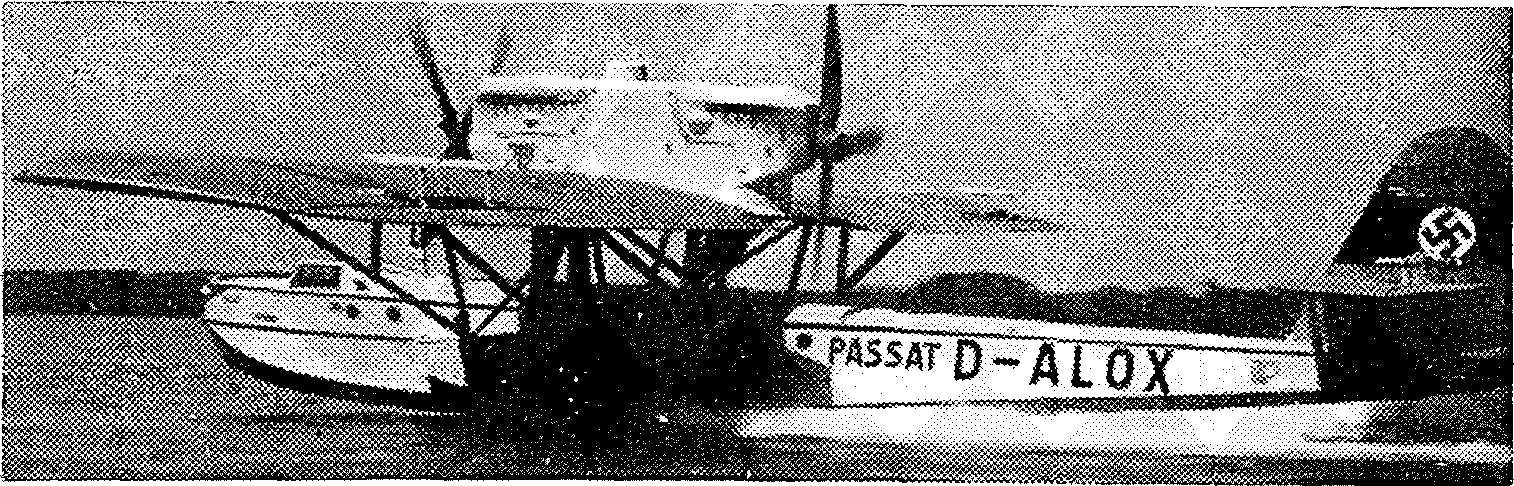
10-t-Wal Großflugboot 1933.
Spannw. 27,2 m, Länge 18,2 m, Fläche 113,2 m2. Motor 2X660 PS. Höchstgeschw. 230 km/h.

Do 22 Seeaufklärungs- u. Torpedoflugzeug 1934.
Spannw. 16,2 m, Länge 13 ra. Fläche 45 nr. Motor 1X850 PS. Höchstgeschw. 340 km/h.
Do 23 Bomben-Großflugzeug 1934.
Spannw. 25,60 m, Länge 18,8 m, Fläche 108,10 m2. Motor 2X700 PS. Höchstgeschw. 262 km/h.

Do 18 Langstreckenflugboot 1935.
Spannw. 23,70 m, Länge 19,28 m, Fläche 98 m2. Motor 2X560 PS. Höchstgeschw. 260 km/h.

Do 17 Kampfflugzeug 1936.
Spannw. 18 m, Länge 16,9 m, Fläche 55 m2. Motor 2X950 PS. ©IL "Höchstgeschw. 500 km/h.
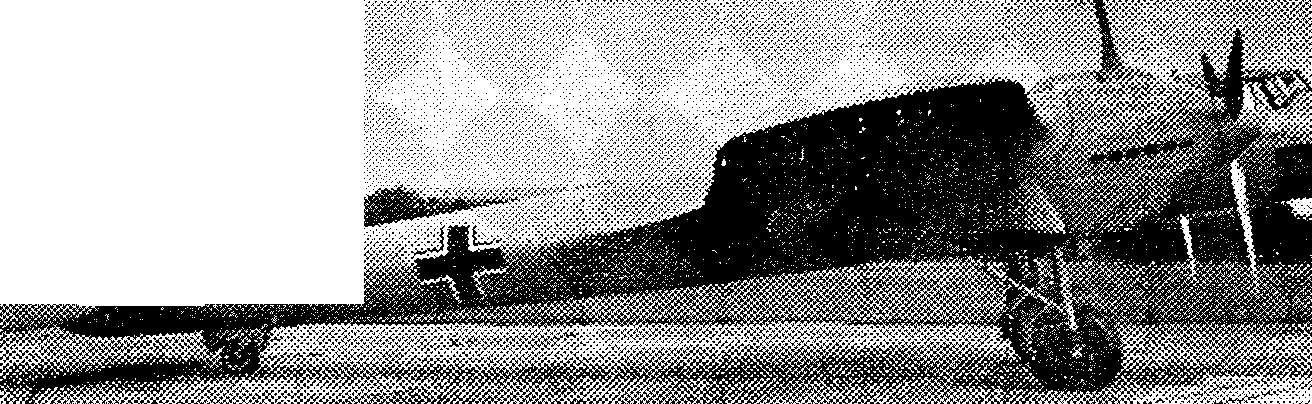
J9l
Do 19 Großkampfflugzeug 1936.
Spannw. 35 m, Länge 25,45 m, Fläche 162 m2. Motor 4X850 PS. Höchstgeschw. 380 km/h.
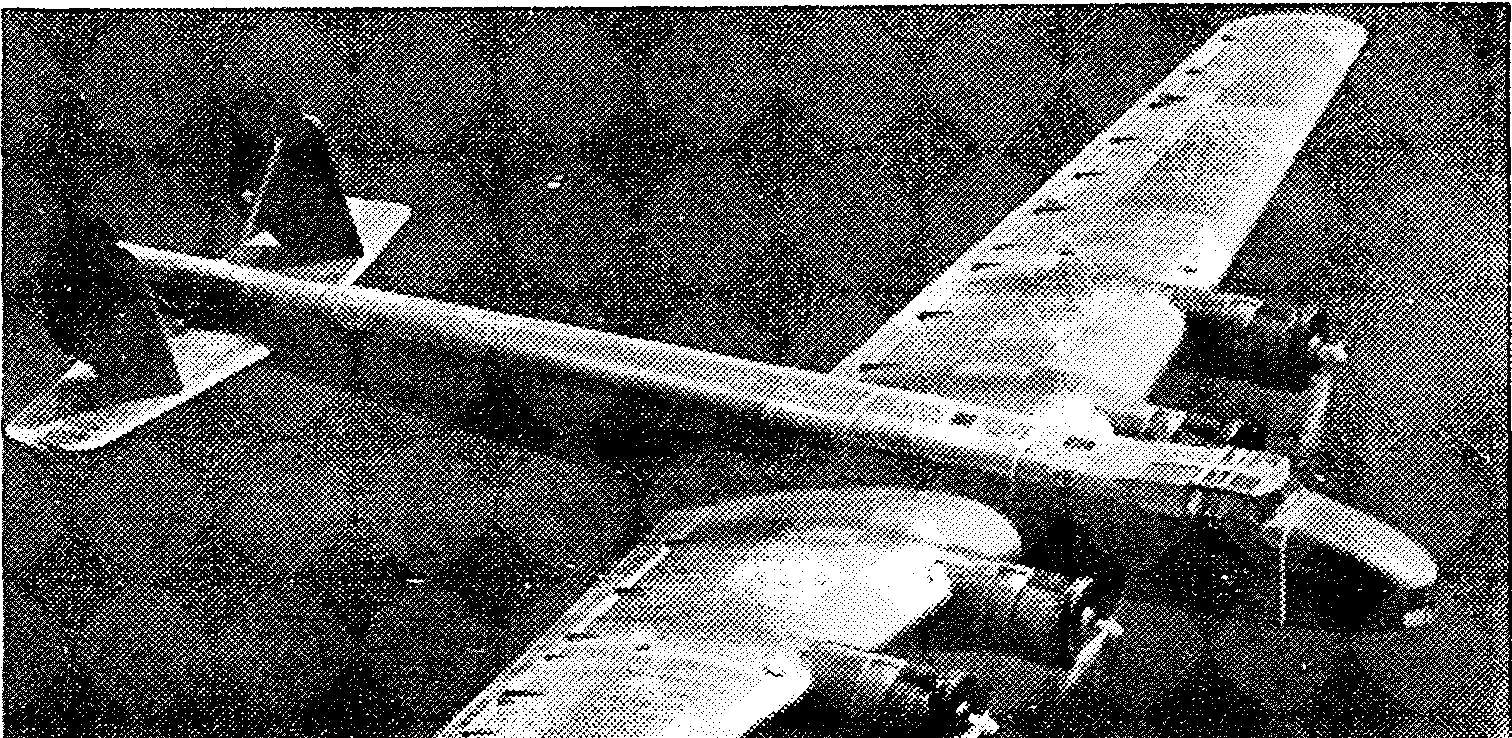
Do 24 Großflugboot 1937.
Spannw. 27 m, Länge 22 m, Fläche 108 m2. Motor 3 X 750/900 PS. Höchstgeschw. 340 km/h.
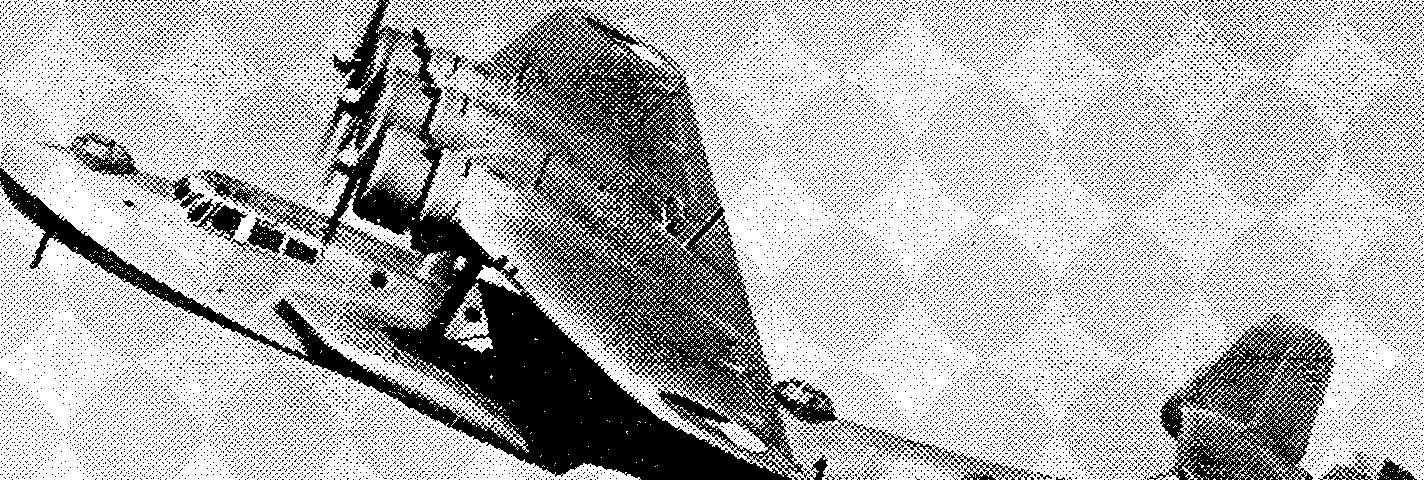
Do 26 Transozeanflugboot 1938.
Spannw. 30 m, Länge 24,5 m, Fläche 120 m2. Motor 4X600 PS. Höchstgeschw. 335 km/h.
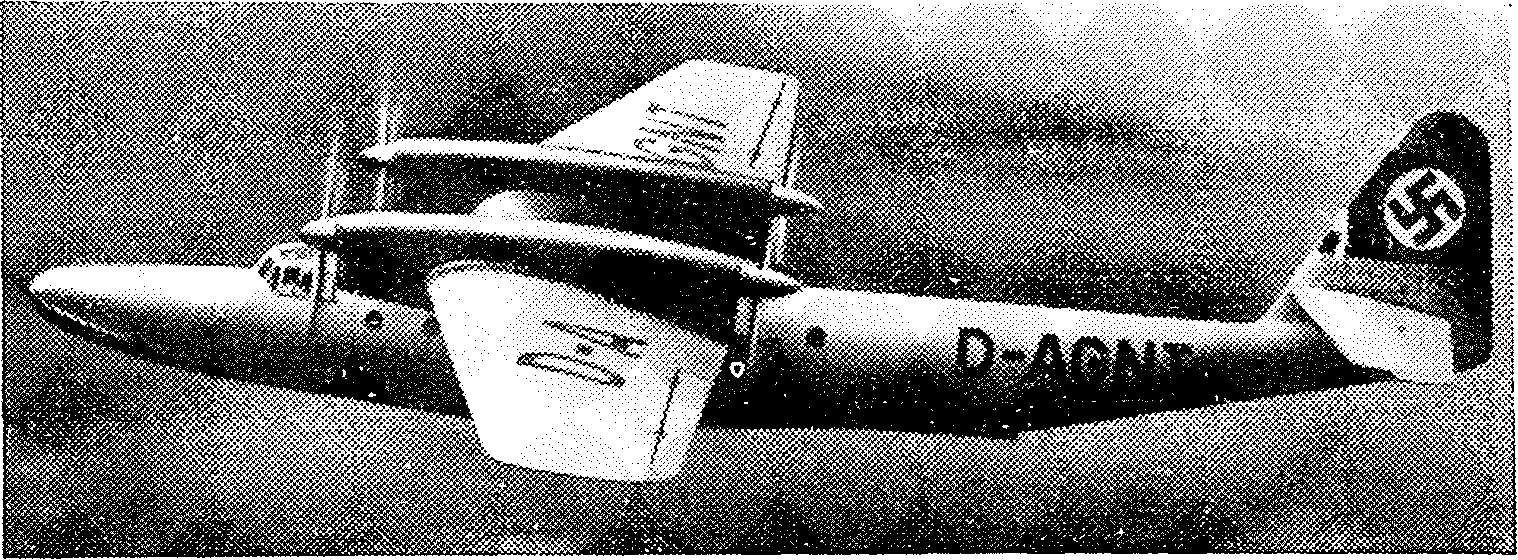
Do 215 Kampfflugzeug 1939.
Spannw. 18,00 m, Länge 16,30 m, Fläche 55 m2, Motor 2X1100 PS. Höchstgeschw. über 500 km/h.
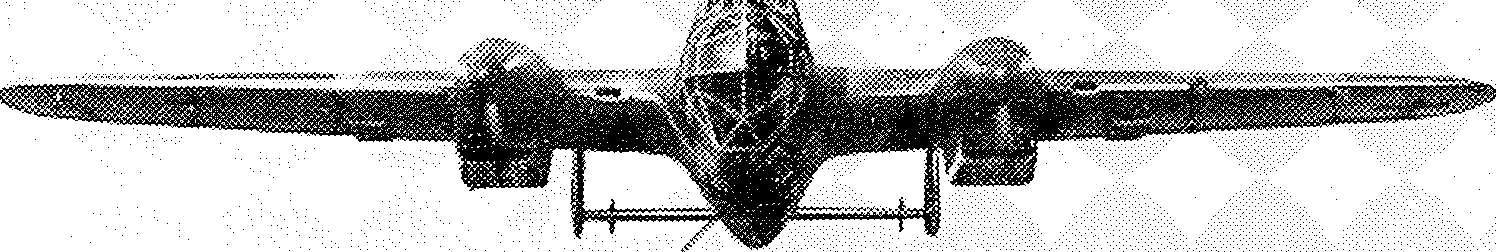
FLUG
umseht
Inland.
Internationale Rekordanerkennung. Klasse D, 2. Kategorie. Entfernung mit festem Ziel (Deutschland).
Flugzeugführer: Otto Braeutigam. Begleiter: Hannes Meyer. Segelflugzeug:: Kranich, D—7—244. Strecke: Großrückerswalde—Wien/Aspern, den 21. April 1939, 363,798 km.

Ital. Jagdflieger, Gäste des Generalfeldmarschalls Göring, führten am 20. 6. dem' Jagdgeschwader Richthofen ihre Maschinen vor. Die ital. Jagdflieger fertig
zum Start. Weltbild

Luftarmeegeneral Valle traf auf Einladung von Generalfeldmarschall Göring am 24. 6. Flugplatz Staaken ein, wo er von Staatssekretär Generaloberst Milch
empfangen wurde. Weltbild
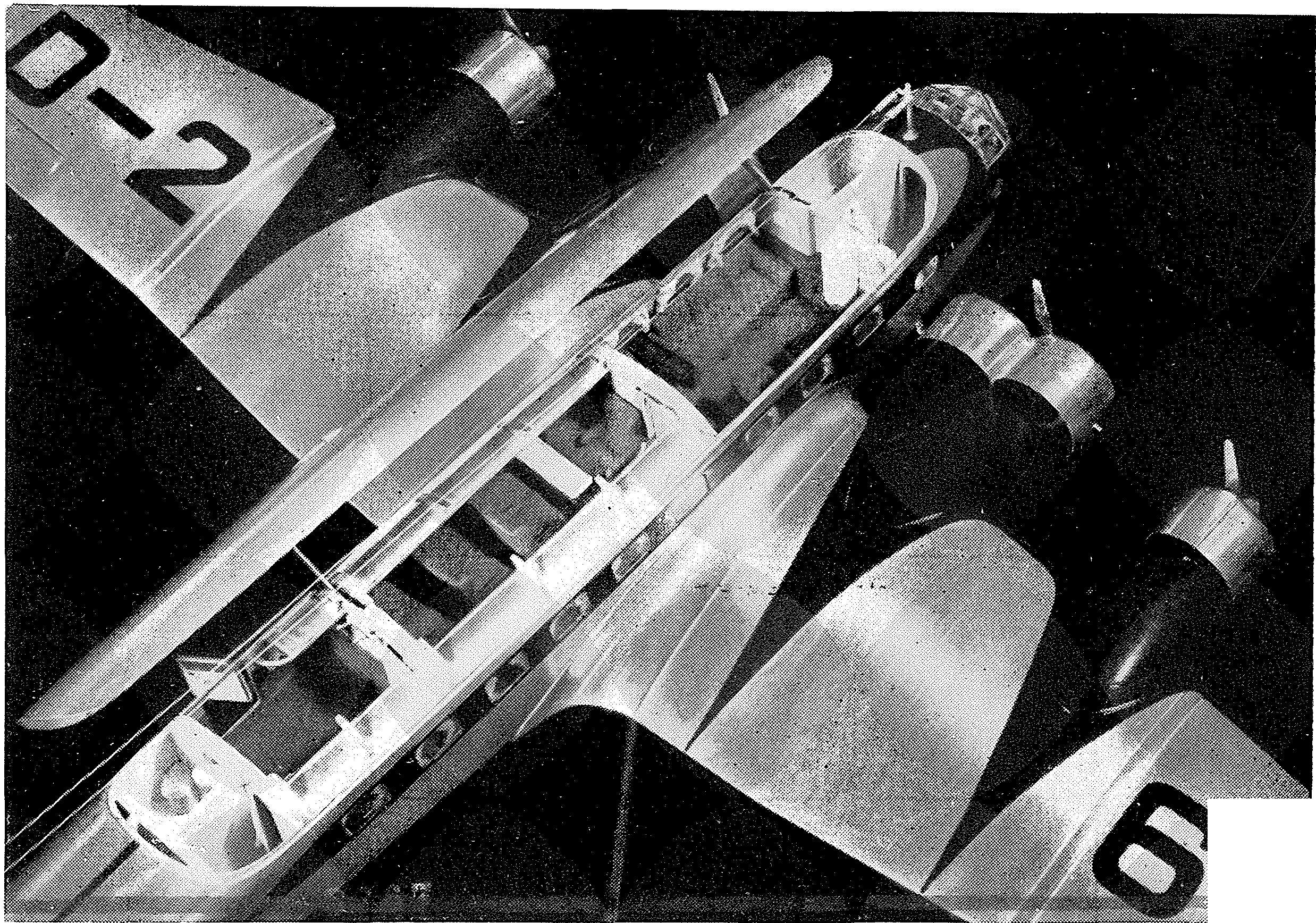
-,,Condor"-Flug-zeug für den Führer. Die Abb. zeigt ein Modell, wie es dem Führer anläßlich seines 50.
Geburtstages von Flugkapitänen zum Geschenk gemacht worden war. Durch Aufklappen des Oberteiles ist die Inneneinrichtung sichtbar gemacht. Modell ist in Brüssel ausgestellt.
Berlin—Brasilien, 28 Std., flog Focke-Wulf-Großflugzeug Fw 200 „Condor" D-AXFO „Pommern". Der „Condor" startete am 27. 6. 22.30 h in Berlin-Tempelhof und traf 29. 6. 6.2.1 h (MEZ) auf dem Landflughafen von Natal in Brasilien ein. Es handelte sich um ein normales Landverkehrsflugzeug Focke-Wulf Fw 200, welches vom Condor-Syndikat erworben und einfach über den Südatlantik überführt wurde. Die Besatzung der „Pommern" war Flugkapt. Henke von der Deutschen Lufthansa, bekannt durch seine Flüge nach New York und Tokio, sowie Günter Schuster vom brasilianischen Condor-Syndikat, welcher mehr als IV2 Millionen Flug-km bereits zurückgelegt hat. Dieses normale Streckenflugzeug D-AXFO „Pommern" ist mit 4 BMW-132-L-Motoren von 750 PS, mit Askania-Kurssteuerung, Funkgeräten von Lorenz und Telefunken ausgerüstet. Für Besatzung von 4 Mann und 26 Fluggäste eingerichtet. Eine weitere Focke-Wulf Fw 200 „Condor" soll in wenigen Wochen nach Brasilien überführt werden. Die Gesamtflugzeit für die Ueberführung von Berlin nach Rio de Janeiro, 11 105 km, betrug 36 h 4 min.
Luftsporti. Veranstaltungen Köln 1940 finden anläßlich der Intern. Verkehrs-Ausstellung (IVA) statt. General der Flieger Christiansen wurde vom Reichsverkehrsminister Dr. Dorpmüller zum Vorsitzenden des Ausschusses Luftsport für die IVA berufen. Das luftsportliche Programm umfaßt nationale Rundflüge, internationale Luftrennen und Fliegertreffen u. a. m. Während der IVA werden "vom NS.-Fliegerkorps regelmäßige Motor- und Segelflugvorführungen veranstaltet.
I. G. Karl Schmidt & Co., Solingen, neue Firma, umfaßt auch die Abteilung Sportgeräte der Firma Dr. W. Kampschulte &. Cie. als selbständiges Unternehmen. Da die bisherigen Fabrikräume den gesteigerten Ansprüchen nicht mehr genügen, werden Ringe, Gummikabel und Startseile in neuen Fabrikanlagen hergestellt.
Was gibt es sonst Neues?
Oskar Knofe, Polizeioberst, jetzt Inspektor d. Ord. Pol. für Sachsen und Anhalt. Dienststelle Magdeburg.
Elly Beinhorn-Rosemeyer von Kalkuttaflug, 34 000 km, 30. 6. 39 zurück Tempelhof.
20 Jahre K. L. M. Am 7. 10. 1919 flog auf einer gemieteten Koolhoven B. A. T. der Pilot Turner von London nach Amsterdam.
Ausland.
„Golden Hind" erstes Short-Atlantik-Flugzeug der G-Klasse, 17. 6. ersten Probeflug. Spannweite 40,8 m, Länge 30,6 m, Fluggewicht 32 t, Reisegeschwindigkeit 290 km, max. 315 km. Vier Herkules-Motoren von 5500 PS. Die drei bestellten G-Boote werden von der neuen British Overseas Airways Corp. übernommen werden.
Rolls-Royce-Motorenwerke sollen für 4 000 000 £ in Hillington, Schottland, ■errichtet werden. Anfangsarbeiterzahl 3000, nach vollständigem Ausbau 10 000 Mann.
British Overseas Airways umfaßt in der Zusammenarbeit für den Atlantikflugverkehr die Imperial Airways und die British Airways. Diese neue Gesellschaft soll jährlich bis zu 4 Millionen £ Regierungsbeihilfe für die nächsten 15 Jahre erhalten.
Short Nordatlantikflugboot „Connemara" fing beim Tanken in der Basis von Hythe bei Southampton Feuer am 19. 6. und wurde vollkommen vernichtet.
Saunders-Roe Lerwick Zweimotorenflugboot, insgesamt 2800 PS, Serienauftrag für R. A. F. Hochdecker, zwei seitliche Stützschwimmer, zweistufig, hintere Stufe unter dem Höhenleitwerk. MG.-Stand in der Rumpfnase und auf der hinteren Rumpfoberseite.
Nicholas Comper f, der bekannte engl. Flugzeugkonstrukteur, wurde-am 18. 6. mit schwerer Verletzung in bewußtlosem Zustand in Hythe aufgefunden. Man vermutet, daß Comper von einem unbekannten Angreifer niedergeschlagen wurde. Comper ist als Konstrukteur zum erstenmal 1923 mit seinem „Cran-well II" an die Oeffentlichkeit getreten. Aus Begeisterung für das Kleinflugzeug konstruierte er mehrere Maschinen, darunter den in Sportkreisen beliebt gewordenen „Comper Swift". In letzter Zeit konstruierte er für die Studenten der Aeronautical Engineering einen kleinen Eindecker mit hinten liegendem Motor. Comper war ein Idealist und Fliegerkamerad, dem wir ein ehrendes Andenken; bewahren.
Moräne 406 Jagdflugzeug ist eine Umkonstruktion des Moräne 405 für Serienbau. Die äußere Formgebung ist dieselbe geblieben. Man hat hierbei Einzelteile von anderen Flugzeugen, die bereits in Serien gebaut wurden, für die Serien-herstellung des 406 verwendet. Fertigherstellung in den Werken der S. N. C. A. de l'ouest in Nantes-Bouguenais.
Dewotine 530, Hochgeschwindigkeits-Eindecker, entwickelt aus dem Typ 520, siehe „Flugsport" 1939, Seite 203, in 'Toulouse gebaut, z. Z. versucht. Motor vermutlich Hispano Suiza 12-4, 1800 PS.
Bloch 161, Tiefdecker, 33 Passagiere, für Atlantikverkehr soll demnächst versucht werden. Indienststellung erfolgt 1941. Versuchsmaschine vier Gnome-Rhone K. 18 Motoren von je 1000 PS. Später 1000 PS Wright Cyclone Motoren. Geschätzte Geschwindigkeit 354 km/h. Max. Geschwindigkeit 425 km/h. Fluggewicht 16 800 kg.
Louis Hirschauer t> zuletzt Generalinspektor der franz. Luftarmee, im Alter von 58 Jahren in Cannes gestorben.
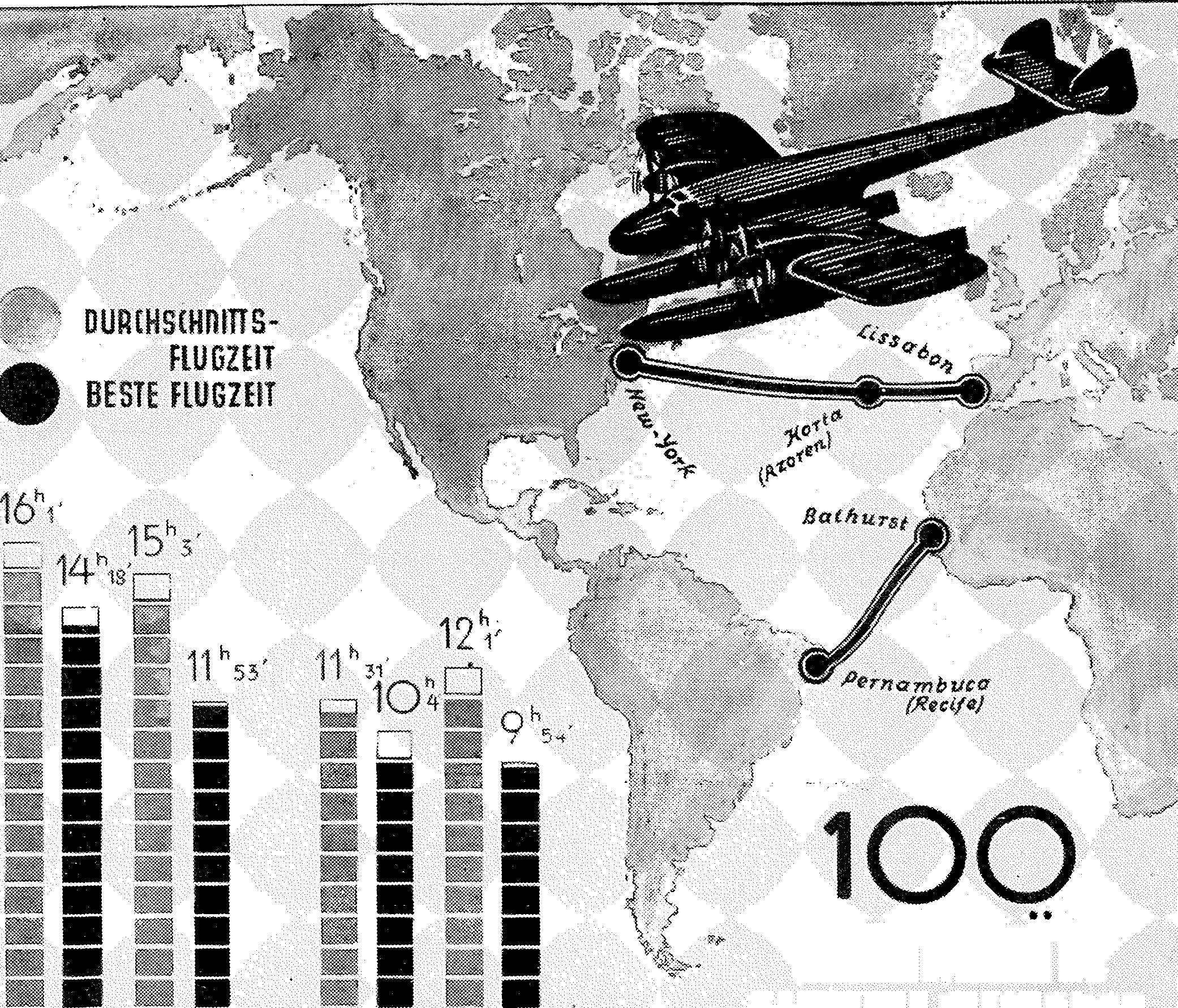
Douglas TBD-1, Torpedotiefdecker,
kommt in USA bei"
Flugzeugträgern zur Verwendung.. Torpedo innerhalb
des Rumpfes.
Spannweite 15 mr Länge 10,5 m, Höhe 3,4 m. Leergewicht 2280 kg, Fluggew. 3900 kg..
Geschwindigkeit 300 km/h, Reise 270 km/h, Landeetwas über 100km/h. Gipfelhöhe 6000 m. Aktionsrad. 650 km.
üf m m i
m m %d ■ 5
1937 1938 1
nORDRTlflnTIH si
■ B
mm mm
1938 1959 iUDRTIMIK
«TINGE DEUTSCHE lUFTHflflSQ
BlOHflt 8 UOSS FLUGZEUGE n
mit
Südafrikan. Luft-rennen 24. 6. Rennen über 2300 km, zwei Tage, Erster E. U, Brierley auf B. A. Double Eagle, Zweiter H. A. Dal-rymple auf Leopard Moth.
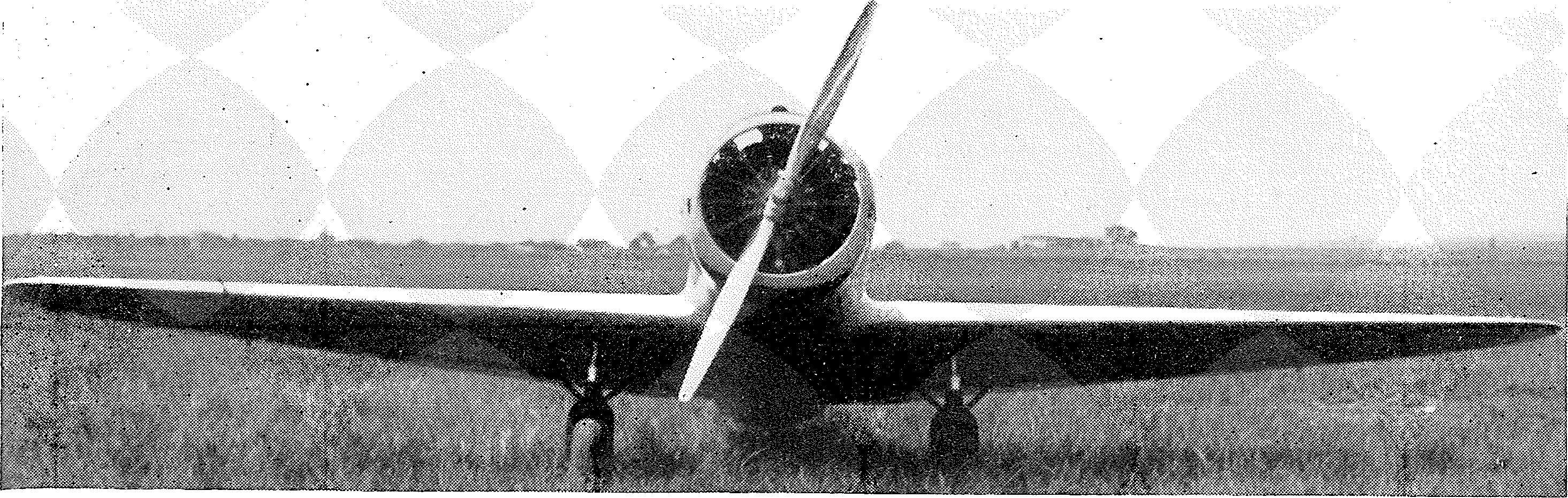
Ital. Nardi FN 305. Archiv Flussport
Flughafen Beyrouth 6. 6. eröffnet.
Austrat. Luftwaffe, 8 Geschwader, insgesamt 97 Flugzeuge, soll bis 1941 auf 19 Geschwader mit 212 Flugzeugen erhöht werden.
Austral. Beaufort-Bomber werden mit Taurus-Motoren ausgerüstet. 80 austral. Monteure gehen zur Werksausbildung in die Bristol-Werke.
Neuseeland-Luftwaffe, 4 Geschwader. 1938 Gesamtbestand an Flugzeugführern in Neuseeland 546 „A" und 74 „B".
Neuseeland-Luftverkehrslinien sind alle in den Besitz der Union Airways übergegangen.
Segelflug
NSFK.-Zielstreeken-SegelHug-Wettbewerb 18. 6.-2. 7. 1939
ist beendet. (Streckenführung vgl. „Flugsport" 1939, S. 321.) Trotz der ungünstigen Wetterlage landeten 14 Segelflieger in Stettin: Schmidt, Braeutigam, Flinsch, Huth, Reukauf, Reutsch, Fick, Zitter, Beck, Hof-mann, Kraft, Peters, Flakowski und Qeul. Die 840 km lange Strecke wurde von Schmidt und Braeutigam in 5 Tg. bewältigt. Die an der Spitze liegenden Flugzeugtypen sind: „Mü 13" (Schmidt), „Weihe" (Braeutigam), D. 30 Darmstadt (Flinsch), „Reiher" (Huth).
Ergebnisse:
1. Oberstuf. Schmidt (NSFK.-Qr. 16) 5 Tage, 560 Wertungspkt. ; 2. Hptstuf. Braeutigam (NSFK.-Gr. 7) 5 Tg., 531 Pkt.; 3. Segelflgzf. Flinsch (DVL-Darmstadt) 6 Tg., 466 Pkt.; 4. Oberstuf. Huth (NSFK.-Qr. 3) 6V2 Tg., 450 Pkt.; 5. Obtruppf. Reukauf (NSFK.-Qr. 9) 6V2 Tg., 426 Pkt.; 6. Flugkpt. Reitsch (DFS-Darmstadt) 7 Tg., 404 Pkt.; 7. Obtruppf. Fick (NSFK.-Qr. 2) 7 Tg., 386 Pkt.; 8. Oberstuf. Beck (NSFK-Qr.15) 7 Tg., 378 Pkt.; 9. Segelflgzf. Zitter (DFS-Darmstadt)
7 Tg., 361 Pkt.; 10. Sturmi Kraft (NSFK.-Qr. 15) 7 Tg., 354 Pkt.; 11. Sturmf. Hofmann (NSFK.-Gr. 4) 8 Tg., 329 Pkt.; 12. Oberstuf. Medicus (NSFK.-Qr. 13) 7 Tg., 271 Pkt.; 13. Hptstuf. Peters (NSFK.-Qr. 8) 8 Tg., 268 Pkt.; 14. Truppf. Kracht (NSFK.-Gr. 12) 7 Tg., 221 Pkt.; 15. Obltn. Flakowski (Luftwaffe) 7 Tg., 219 Pkt.; 16. NSFK.-Mann Pomper (NSFK.-Qr. 1) 8 Tg., 215 Pkt.; 17. Segelflgzf. Qeul (DVL-München) 7 Tg., 206 Pkt.; 18. Sturmf. Philipp (NSFK.-Qr. 6)
8 Tg., 200 Pkt.; 19. Ogefr. Mudin (Luftwaffe) 7 Tg., 139 Pkt.; 20. Uffz. Scheidhauer (Luftwaffe) 7 Tg., 125 Pkt.; 21. Segelflgzf. Lerche (DVL-Berlin) 7 Tg., 51 Pkt.; 22. Ltn. Wendt (Luftwaffe) 7 Tg., 42 Pkt.
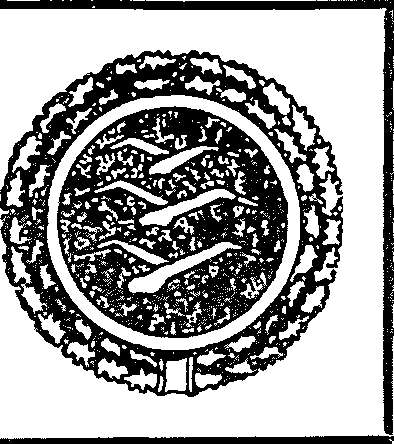
fertiggestellt und das 100. an das NS.-Fliegerkorps dieser Tage abgeliefert.
Leistungs-Segelflug-zeugeMuster „Minimoa"
wurden
100
Pick, engl. Segelflieger, vom Yorkshire Qliding Club startete auf dem Privat-Flugplatz Walburn Hall im Flugzeugschlepp. In 80 m Höhe ging das Motorflugzeug über den Flügel und riß das Segelflugzeug, dessen Flügel brachen, mit nach unten. Beide tödlich verunglückt.
Peter Riedel hatte bei seinem Etappensegelflug von der Westküste zur Ostküste der Vereinigten Staaten, trotz der Ueberwindung von großen Höhenunterschieden, beträchtliche Streckenleistungen erzielt. Er erreichte in den südkalifornischen Bergen in der Nähe von San Jancinto 3600 m Höhe und bei seinem Flug von Albuquerque (Neu-Mexiko) nach Hereford, 370 km Entfernung, 5500 m Höhe.
Engl. nat. Segelflugwettbewerb 8. bis 16. 7. in Camphill, Derbyshire. 28 Meldungen.
Klasse: Rumpfsegelflugmodelle.
Handstart-Strecke: W. Saerbeck, Borghorst, 43 000 m. — Handstart-Dauer: E. Bellaire, Mannheim, 20 min. 13 sec. — Hochstart-Strecke: W. Bretfeld, Hamburg, 91 200 m. — Hochstart-Dauer: H. Kummer, Düben, 55 min. Klasse: Nurflügel-Segelflugmodelle.
Handstart-Strecke: A. Herrmann, Nordhausen, 2375 m. — Handstart-Dauer: K. Schmidtberg, Frankfurt a. M., 37 min 41 sec. — Hochstart-Strecke: H. Kolenda, Essen, 10 400 m. — Hochstart-Dauer: H. Kolenda, Essen, 11 min. Klasse: Rumpfflugmodelle mit Gummimotor.
Bodenstart-Strecke: W.Bauer, Köln, 1030 m. — Bodenstart-Dauer: A. Menzel, Dresden, 14 min 55 sec. — Handstart-Strecke: O. Michalicka, Dresden, 24 000 m. — Handstart-Dauer: A. Lippmann, Dresden, 1 h 8 min. Klasse: Rumpfflugmodelle mit Verbrennungsmotor.
Bodenstart-Strecke: H. G. Holl, Essen, 112 400 m. — Bodenstart-Dauer: J. Schmidt, Allenstein, 1 h 15 min 33 sec. Klasse: Rumpfwasserflugmodelle mit Gummimotor.
Wasserstart-Dauer: H. Antusch, Griesheim, 7 min 9 sec. Klasse: Rumpfwasseflugmodelle mit Verbrennungsmotor.
Wasserstart-Dauer: B. Kocea, Essen, 11 min 14 sec. Klasse: Schlagflügel-Flugmodelle mit Gummimotor.
Bodenstart-Dauer: Liegen zur Zeit noch keine Ergebnisse vor. — Handstart-Dauer: Liegen zur Zeit noch keine Ergebnisse vor.

Deutsche Flugmodell-Höchstleistungen. Stand vom 1. Juli 1939.
Klasse: Schlagflügel-Flugmodelle mit Verbrennungsmotor.
Bodenstart-Dauer: A. Lippisch, Griesheim, 4 min 15 sec. — Handstart-Dauer: A. Lippisch, Griesheim, 16 min 8 sec. Klasse: Saalflugmodelle mit Gummimotor.
Handstart-Dauer: H. J. Mischke, Königsberg, 10 min 30 sec.
F. d. R. F. Alexander, NSFK.-Sturmführer.
Internat. Modellwettbewerb Lüttich, 18. 6., Sieger Paul de Neck, Brüssel, gewann die Coupe du Roi mit 37 min 21 sec.
Sovfet-Motormodell flog 135,4! km von Moskau nach Yaroslav in 1 h 31 min.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
„Das NS.-Fliegerkorps", Ausgabe B der „Luftwelt", eine Monatsschrift, herausgegeben vom Korpsführer des NSFK., ist für die Angehörigen des NS.-Flieger-korps bestimmt. Nach dem Geleitwort von Korpsführer General der Flieger Christiansen soll die Zeitschrift zu dem einzelnen NSFK.-Mann sprechen, ihn belehren, schulen und mit der Zeit eine Unterstützung der praktischen Arbeit in den Stürmen und Trupps werden. Diese Monatsschrift soll ein Sprachrohr sein, um alle NSFK.-Angehörigen untereinander eng zu verbinden, die praktischen Erfahrungen zu vermitteln und einen Gedankenaustausch herbeizuführen.
„Motor-Kiek", Anfänger-Motorflugmodell, unter Anlehnung an das Modell „Kiek in die Welt" von Curt Möbius. (Schreibers Kleine Flugmodell-Baupläne Nr. 1.) Verlag J. F. Schreiber, Eßlingen a. N. Preis RM —.35.
Einfaches Stabmodell mit Gummimotor, 570 mm Spannweite, 480 mm Länge, richtig gebaut, Flüge von 80—100 m.
Expedition des T Jk ^TTÜf/^UM Expedition des
ϖ■KäESTPS*« IVJLEINE ANZEIGEN ^n?f*?aosT«
Die dreigespaliene MI Iii meler^Zelle kostet 25 Pfennig.
Kl 26 V
zugelassen, neuwertig, Sh 13a-Motor, i. Herstellerwerk grundüberholt, sofort abzugeben. Angebote unter 4052 an den Verlag des „Flugsport", Frankfurt a. Main, Hindenburgplatz 8, erbeten.
Argus Klemm Kl 26 ¥
zugelassen, dreisitzig, sofort verkä uf lieh. Zuschriften unter Ziffer 4053 an den Verlag des „Flugsport"? Frankfurt um Main, erbeten.
Flugzeug Zelle
Kl. 25 od. Kl. 35, passend zu Hirth-Motor HM ßO R in gutem flugfähigem Zustand, zugelassen, baldmöglichst zu kaufen gesucht. Angebote unter Nr. 4050 an die Exp. des „Flugsport", Frankfurt a- Main, Hindenburgpl. 8, erbet.
}nqIsMfowida
IMaschinenbau / Automobil- u. Flugtechnik Elektrotechnik. Programm kostenlos
Lesezirkel
FLUGWESEN
Prospekt Nr. 23 frei! „ Journaiistikum", Planegg-München 16
Lassen Sie den „Flugsport" einbinden!
Verschlüsse u. Beschlagteile
für den Flugzeugbau fabrizieren Preß- und Stanzwerk Büscher & Claussen
Inh.: Heinrich Büscher & Hans Wessel
Iserlohn in Westfalen

Hochleistungs-Segel f lugzeug
Mül3ä
Stahlrohrbau: sicher - /eicht - billig
SCHWARZWALD-FLUGZEUGBAU wilh.jeh,e DONA UESCHINGEN
Heft 15/1939

Illustrierte ligtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Bri#f-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro % Jahr bei 14tärlid***n Erscheinen RM 4M
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursmus — Postscheck-Konto ankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalien uad Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet.
Nr. 15
19. Juli 1939
XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 2. August 1939
Zur 20. Rhön.
Die gleitfliegerische Betätigung nach dem Kriege wäre nicht möglich gewesen, wenn wir, wie vor dem Kriege, beliebig mit Motorflugzeugen hätten weiterfliegen können. Die unerhörte auf der Wasserkuppe entfachte fliegerische Begeisterung unserer Jugend ;.^nte nur aus dem durch das Versailler Diktat veranlaßten Motor-: verbot geboren werden. Viele werden sich noch der Zeiten erinnern, wo durch die Ueberwachung auch der Qleitfliegerei auf der Wasserkuppe durch die Kontrollkommission die jungen Männer auf der Wasserkuppe noch enger kameradschaftlich aneinanderge-schweißt wurden und sich gelobten: Nun erst recht! Bereits 1920 zeigten sich Spuren der nationalsozialistischen Begeisterung auf der Kuppe unter den Segelfliegern. Man war daher gar nicht überrascht, als eines Morgens das Segelflugzeug von Eugen von Loeßl, mit einem Hakenkreuz bemalt, zum Start gezogen wurde. In der Abbildung erkennt man das frühere Hakenkreuz, welches später von sich herumtreibenden andersgesinnten Unbekannten wieder übermalt wurde,
Der Unfall von v. Loeßl konnte die flugbegeisterten jungen Männer nicht abhalten, unentwegt weiterzuarbeiten. Man sann nach Mitteln, die Gefahrenmöglichkeit herabzumindern. Die im Motorflugbetrieb übliche Schulpraxis war für den Segelflugbetrieb ungeeignet. Man sammelte immer mehr Erfahrungen. Von den im Deutschen Modell- und Segelflug-Verband führenden segelfliegerisch tätigen Vereinen, Frankfurter Flugtechnischer Verein, Stuttgarter Flugtechnischer Verein, Breslauer Verein und anderen, wur-
den Schulregeln aufgestellt._
Eugen von Loeßl t, das erste Segelflugopfer nach Lilienthal am Westhang 9. 8. 1920.

Die im Schulbetrieb verwendeten Maschinen waren primitiv und hatten eine sehr geringe Lebensdauer. Um sie schnell wieder aufbauen zu können, mußten sie denkbar einfach konstruiert sein.
Bereits der erste Wettbewerb 1920 war richtunggebend. Es erwies sich als notwendig, daß vor Beginn des Wettbewerbs geschult werden mußte, und vor allem, daß die Männer, die zum Wettbewerb erschienen, tüchtig trainiert hatten. Eine bestimmte Richtung für die Entwicklung einer Schulmaschine war 1921 noch nicht zu erkennen.
Ueberau wurde experimentiert. Im folgenden Jahre erschienen auf der Wasserkuppe die Weltensegler und Arthur Martens, um, jeder für sich, einen Flugbetrieb einzurichten. Etwas später siedelten Harth und Messerschmitt vom Heidelstein nach der Kuppe über und bauten sich eine kleine Halle.
Richtunggebei^ für die Schulentwicklung war in dieser Zeit das Erscheinen von einigen dazumal in der Oeffentlichkeit unbekannten Zivilisten. Damals machten wir uns keine Gedanken über deren wirkliche Begeisterung an der Segelfliegerei. Indessen war man 1921 sehr überrascht, die gleichen Gesichter in dem damals unerwartet entstandenen Weltensegierschuppen in allerhand Räuberzivil auftauchen zu sehen.
Es ist an der Zeit, diese Namen, die damals fast nie bekannt wurden, aus der Geschichte herauszukramen. Hptm. Student, jetzt Generalmajor, Inspekteur im RLM und Kommandeur der Fliegerdivision 7.
Zu den damaligen Gleitflugbegeisterten unter Führung von Student sind zu nennen: Jeschonek, heute Oberst und Chef des Generalstabes der Luftwaffe. Raithel, Oberst und Luftattache. Bassenge,
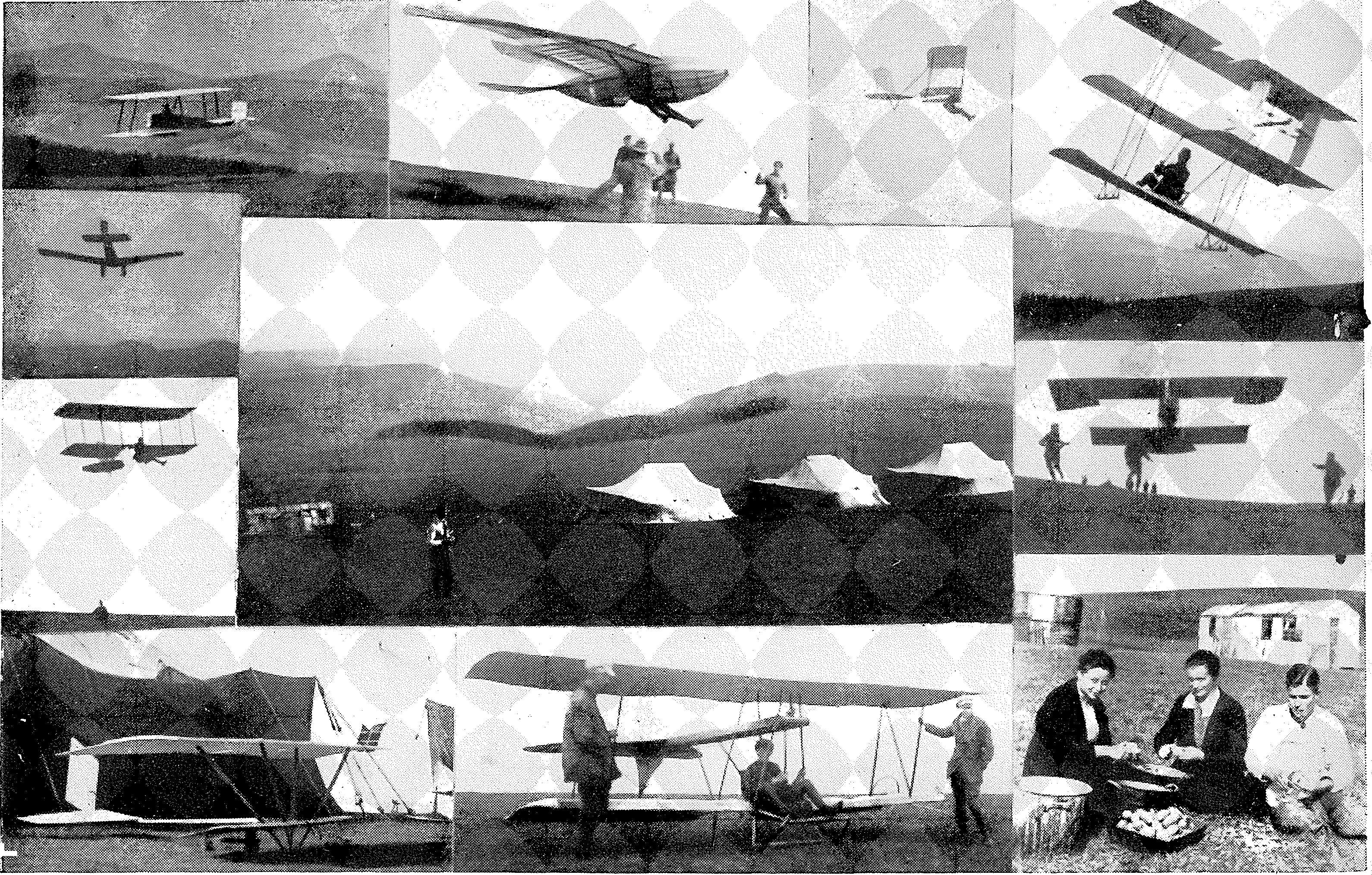
Vom 1. Rhön-Segelflug-Wettbewerb 1920. In der Mitte das Lager. Oben von links: Eugen v. Loeßls letzter Flug, Zeise mit Vortriebsschwingen, Pelzner, Richter. Mitte links: Klemperer auf Akaflieg, Aachen. Darunter: Pelzner. Mitte rechts: Peter Riedel. Unten von links nach rechts: Poelke, Drude, die erste Küche auf der grünen Wiese. Mitte: Rhönmutter, daneben: Koch Menzer.

Aus den ersten Anfängen der Gleit- und Segelflugschulung auf der Wasserkuppe 1921. Im Führersitz Oberstltn. Schwartzkopff, links davon General und damaliger Schulleiter Hauptm. Student, daneben Oberstltn. Schwarz, rechts Martens, daneben Oberstltn. Bassenge. Unten links vom Führersitz Oberstltn. Kumme, daneben Oberstltn. Junck und Oberst Raithel, rechts halb liegend Oberst Lorenz.
Archiv Flugsport
jetzt Oberstleutnant, Chef des Stabes, Luftgaukommando 17; Junck, jetzt Oberst und Inspekteur der Jagdflieger, v. Schönebeck, jetzt Oberstleutnant und Luftattache, Lorenz, jetzt Oberst der Luftwaffe.
Student war damals Sachbearbeiter für Flugzeugbauwesen im Reichswehrministerium. Zu diesen stieß 1926 als ingenieurmäßiger Mitarbeiter Lucht, heute Hauptstabsingenieur.
Diese Männer haben dazu beigetragen, die Flugbegeisterung der deutschen Fliegerjugend in der schwierigsten Zeit wachzuhalten, und zwar waren es nicht nur Zuschauer, sondern alle genannten Männer begannen schon in dieser Zeit, auf primitiv gebauten Gleitflugzeugen zu schulen.
Neben der rein technischen Entwicklung des Segelfluges gab es noch andere schwierige Aufgaben und das waren wirtschaftliche. Offizielle finanzielle Unterstützung für den Bau von Segelflugzeugen gab es nicht. Jeder mußte selbst sorgen, wie er sich das nötige Material zusammenholte. Und dann kamen die Schwierigkeiten der Durchführung des Wettbewerbs. Das schleichende Gift der Markentwertung spürte
Von den ersten Anfängen der Gleit- und Segelflugschulung auf der Wasserkuppe 1921. Junck fliegt die „Frohe Welt" ein.
Archiv Flugsport

man auf der Wasserkuppe schon in den ersten Zeiten. Die Flieger auf der Wasserkuppe und alles, was dazu gehörte, konnten wohl entsagen und versuchen, mit der primitivsten Nahrung auszukommen. Wenn aber einer Bruch machte und mit Verletzungen ins Krankenhaus kam, dann war der Fall sehr schwierig. Wir steuerten unsere paar Qroschen dann zusammen und versuchten, wenigstens die ersten Tage des Krankenhauses zu bestreiten.
Retter in der Not waren Flieger aus dem Kriege, die irgendwie sich einen Erwerb gesucht hatten und mit begeisterten Herzen versuchten, der jungen Segelfliegergemeinde auf der Wasserkuppe beizuspringen. So wurde ich z. B. von dem Kapitän eines Schiffes, welches nach Südamerika den Verkehr vermittelte, gebeten, ihm einige gute Aufnahmen von der Segelfliegerei auf der Wasserkuppe zu senden, um durch Vorträge hierfür zu werben und Passagiere für die gute deutsche Sache zu gewinnen. Zu meiner Ueberraschung ging bereits nach einigen Monaten ein Brief ein, in dem der Kapitän mir 89 Dollar übersandte. In jenen Tagen lag gerade ein junger Segelflieger mit komplizierten Bein- und Beckenbrüchen im Krankenhaus in Fulda, dessen Kosten unbedingt bezahlt werden mußten. Mit einem Schlage war uns geholfen. Und dieser Helfer, der erste Förderer des Segelfluges, war der damalige Kapitän Christiansen, unser heutiger Korpsführer.--
Und heute hat General der Flieger Christiansen in seinem NS.-Fliegerkorps die Segelfliegerei in die Hand genommen. Heute zur 20. Rhön ist eine gewaltige Steigerung in der Leistung sowie in der Zahl der Teilnehmer zu verzeichnen. 1920 flogen 20 junge Männer, heute sind es 20 000. 1920 flogen wir 1 km, heute fliegen wir 500mal so weit. 1920 flogen wir 50 m hoch, heute sind es über 8000 m. Die Zahlen sprechen für sich selbst. Und so wird der Segelflug, den wir aus eigener Kraft der Welt geschenkt haben, das Uebungsmittel sein für unseren Fliegernachwuchs.
Heute denken wir zurück an den Wunsch Lilienthals: „Es möchten sich recht viele junge Leute mit meinem Apparat beschäftigen". So ist durch die Begründung der Segelflugbewegung und durch die Entwicklung in den letzten 20 Jahren der Wunsch unseres großen Meisters in Erfüllung gegangen. Ursinus.
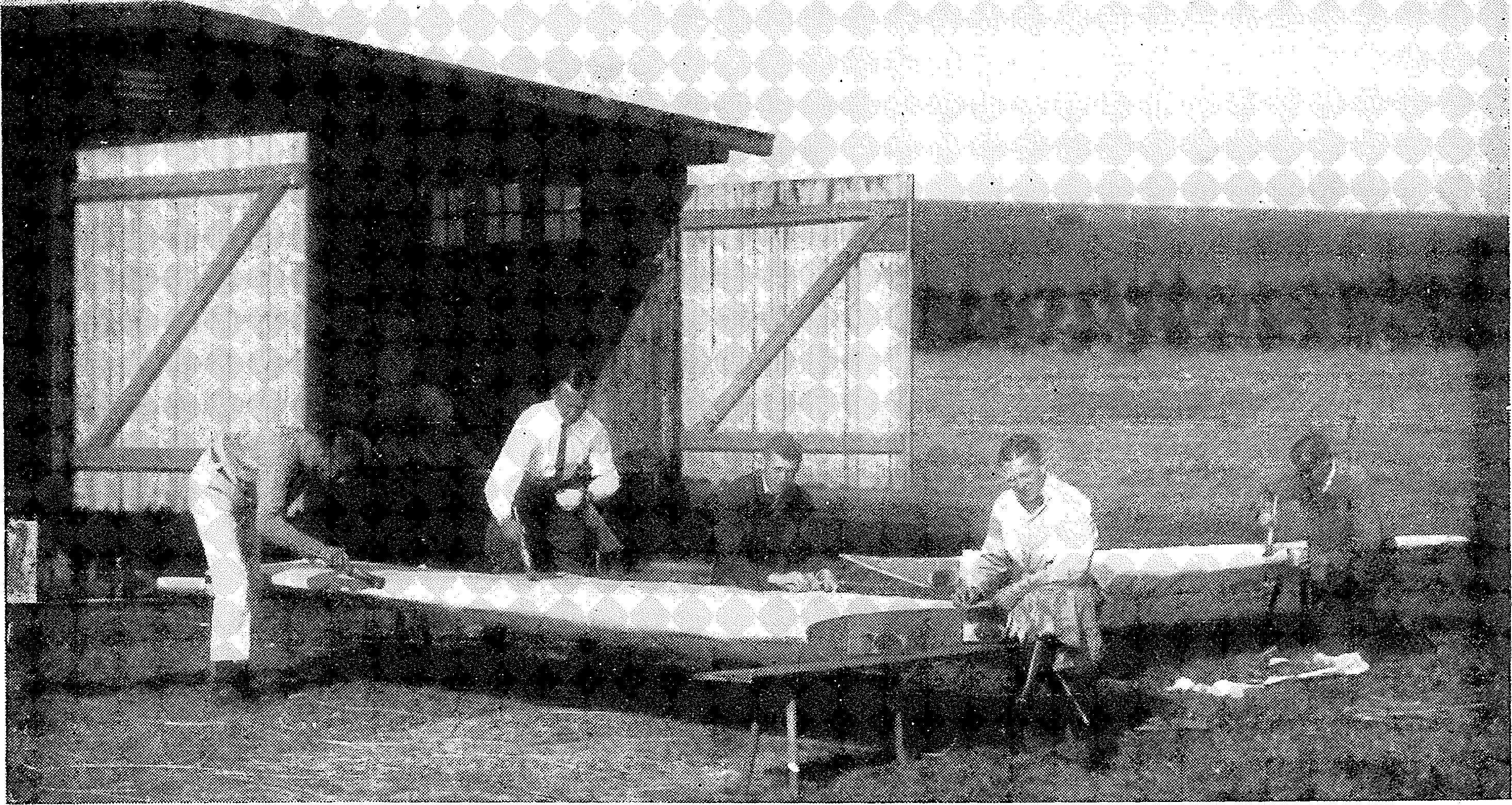
Aus den ersten Anfängen der Gleit- und Segelflugschulung auf der Wasserkuppe 1921. Von links nach rechts: Stamer, Student, Johannesson, Bassenge, Scharmann.
Archiv Flugsport
Meldeliste
Rhön-SegelfluK-Wettbewerb 1939 (20. Rhön).
|
Wett* |
Segelflugzeug |
|||
|
bew. Nr. Klasse |
Bewerber |
Segelflugzeugführer |
Muster |
Kennzeich. |
|
A: Einsitzer |
||||
|
1 |
NSFK.-Qr. 1 |
NSFK.-Mann Pomper |
Rheinland |
D-l-337 |
|
2 |
2 |
„ Rottenf. Baumann |
Mül3d |
D-2-382 |
|
3 |
2 |
„ Truppf. Fick |
Reiher |
D-7-261 |
|
4 |
3 |
„ Obersturmf. Huth |
Reiher III |
D-3-407 |
|
5 |
4 |
„ Sturmf. Hofmann |
Weihe |
D-4-772 |
|
6 |
4 |
„ Sturmf. Heinemann |
Reiher III |
D-4-800 |
|
7 |
4 |
„ Sturmf. Haase |
Condor III |
D-4-891 |
|
8 |
6 |
Obertruppf. Sauerbier |
Mü 13 d |
D-6-684 |
|
9 |
6 |
Obersturmf. Ziller |
Weihe |
D-6- |
|
10 |
7 |
„ Hauptsturmf. Bräutigam |
Condor III |
D-7-334 |
|
11 |
7 |
„ Hauptsturmf. Ludwig |
Mü 13 d |
D-7-331 |
|
12 |
8 |
„ Sturmf. Treuter |
Weihe |
D- |
|
13 |
9 |
„ Obertruppf. Reukauf |
Weihe |
D-9- |
|
14 |
9 |
Truppf. Boy |
Mü 13 d |
D-9-524 |
|
15 |
10 |
„ Obertruppf. Bock |
Mü 13 d |
D-10-837 |
|
16 |
10 |
„ Truppf. Henning |
Minimoa 38 |
D-10-895 |
|
17 |
11 |
Obersturmf. Opitz |
Weihe |
D-ll-875 |
|
18 |
11 |
„ Mann Schubert |
Minimoa 38 |
D-U-850 |
|
19 |
12 |
Mann Urban |
Rheinland |
D-12-352 |
|
20 |
13 |
Sturmf. Habicht |
Mü 13 d |
D-13-429 |
|
21 |
14 |
Mann von Treuberg |
Weihe |
D-14- |
|
22 |
15 |
„ Obersturmf. Beck |
Minimoa 39 |
D-15-1122 |
|
23 |
15 |
Sturmf. Kraft |
Reiher III |
D-15-1037 |
|
24 |
15 |
„ Truppf. Bauer |
Mü 13 d |
D-15-1091 |
|
25 |
16 |
Obersturmf. Schmidt |
Condor III |
D- |
|
26 |
16 |
Truppf. Hauck |
Minimoa 38 |
D-15-1089 |
|
27 |
17 |
Truppf. Fiedler |
Mü 13 b |
|
|
28 |
NSFK-Gr. |
|||
|
Lufthansa |
Mann Bender |
Mü 13 d |
D-4-665 |
|
|
29 |
DFS. |
Segelflugzeug! Schieferstein |
Reiher III |
D-ll-233 |
|
30 |
., |
„ Späte |
Reiher V 2 |
D-ll-167 |
|
31 |
Luftwaffe |
Oberltn. Flakowski |
Horten III b |
D-4-683 |
|
32 |
Oberfeldw. Geitner |
Horten III b |
D-4-687 |
|
|
33 |
Uffz. Scheidhauer |
Horten III b |
D-4-681 |
|
|
34 |
Gefr. d. Res. Peter |
Horten III b |
D-4-682 |
|
|
35 |
Ltn. Mössinger |
Minimoa 38 |
D-l-345 |
|
|
36 |
Flieger Karch |
Mü 17 V 2 |
D-14-252 |
|
|
37 |
D.V. L. |
Segelflugzeugf. Schuchardt |
B 6-Berlin |
D-4-635 |
|
38 |
„ Wenzel |
B 8-Berlin |
D-4-694 |
|
|
39 |
Ebert |
Gö 2-Göttingen D-9-539 |
||
|
40 |
„ Flinsch |
Mü 17 V 2- Darmstadt |
D-14-251 |
|
|
41 |
„ Engel |
C 11-Chemnitz |
D-7-237 |
|
|
42 |
Wende |
FVA 13-Darmstadt |
D-12-403 |
|
|
Klasse B: Doppelsitzer: |
||||
|
44 |
NSFK.-Qr. 1 |
NSFK.-Sturmf. Bödecker Obertruppf. Zander |
Kranich |
D-l-33 |
|
45 |
3 |
„ Sturmf. Güssefeld „ Oberscharf. Torke |
D-3-292 |
|
|
46 |
4 |
Hauptsturmf. Vergens „ Mann Malchow |
D-4-879 |
|
|
47 |
6 |
Truppf. Widlok Uffz. Noske |
D-6-452 |
|
|
48 |
»■ 7 |
Sturmf. Ktihnold Rottenf. Schröder |
D-7-452 |
|
|
49 |
8 |
Sturmf. Budzinski |
D-ll-201 |
|
Truppf. Leuber
|
Weit» |
Segelflugzeug |
||
|
bew. XTi- |
Bewerber |
Segelflugzeugführer Muster |
Kennzeidi. |
|
iST. 50 |
NSFK.-Gr. 10 |
NSFK.-Obersturmf. Fulda Kranich |
D-10-924 |
|
„ J.G. Krämer |
|||
|
51 |
11 |
„ Sturmf. Erb ,, |
D-ll-181 |
|
„ Rottenf. v. Malapert |
|||
|
52 |
12 |
Mann Tuliszka „ |
D-12-408 |
|
„ Scharf. Ruhbrauk |
|||
|
53- |
13 |
„ Truppf. Deeg „ |
D-13-41 |
|
„ Oberscharf. Krämer |
|||
|
54 |
14 |
Sturmf. Romeis |
D-14-425 |
|
Truppf. Schäffler |
|||
|
55 |
15 |
Truppf. Knöpfle |
D-15-1036 |
|
„ Sturmf. Boecker |
|||
|
56 |
17 |
„ Truppf. Kahlbacher |
D-17-313 |
|
„ Mann Kaleta |
|||
|
NSFK.-Gr. |
„ Mann Bayer „ |
D-4-606 |
|
|
57 |
Lufthansa |
„ Mann Specht |
|
|
58 |
Luftwaffe |
Obergefr. Mudin |
D-4-622 |
|
Obergefr. Deleurant |
|||
|
59 |
5J |
Major Stein |
D-8-154 |
|
NSFK.-Mann Fröhlich |
|||
|
60 |
JJ |
Gefr. Abel „ |
D-ll-132 |
|
Feldwebel Hübner |
|||
|
61 |
JJ |
Feldwebel Lander „ |
D-ll-163 |
|
Obergefr. Oberschachtsiek |
|||
|
Segelflug-Wettbewerb der Nachwuchsflieger |
|||
|
anläßlich des Rhön-Segelflug-Wettbewerbes 1939. |
|||
|
A |
NSFK.-Gr. 1 |
NSFK.-Scharf. Steinmann Mü 113 d |
D-l-345 |
|
B |
2 |
„ Truppf. Sosniers Mü 13 d |
D-2-385 |
|
C |
3 |
„ Oberscharf. Hannoschöck Mü 13 d |
D-3-363 |
|
D |
4 |
„ Truppf. Kober Mü 13 d |
D-4-866 |
|
E |
8 |
„ Anwärter Essau Rhönadler |
D-ll-168 |
|
F |
10 |
„ Truppf. Altmeyer Gö 3 |
D-10-921 |
|
G |
„ 11 |
„ Mann Lippmann Mü 13 d |
D-ll-238 |
|
Ii |
12 |
Mü 13 d |
D-12-354 |
|
J |
13 |
„ Rottenf. Päsold Mü 13 d |
D-13-386 |
|
K |
14 |
Truppf. Bauer Minimoa 38 |
D-14-295 |
|
L |
16 |
Mann Moos Minimoa 38 |
D-15-996 |
|
M |
17 |
Mann Zanko Minimoa 38 |
|
|
N |
9 |
Mann Werner Rhönadler |
D-9-525 |
|
wtmm |
-......- - ^4^7^^£71 |
||
Der Verband Deutscher - Modell* nt\4 Gleitflug-Vereine
\ tot auf Gmnd®Mmv„MM® Herrn - -'-'M.. ^v'iiu-i- .
3^€$ ellsi <sir . A U S W © H ©
Nummer Ü^Pliüil verliehen. Das Präsidium des V. D. M.> G. V.j
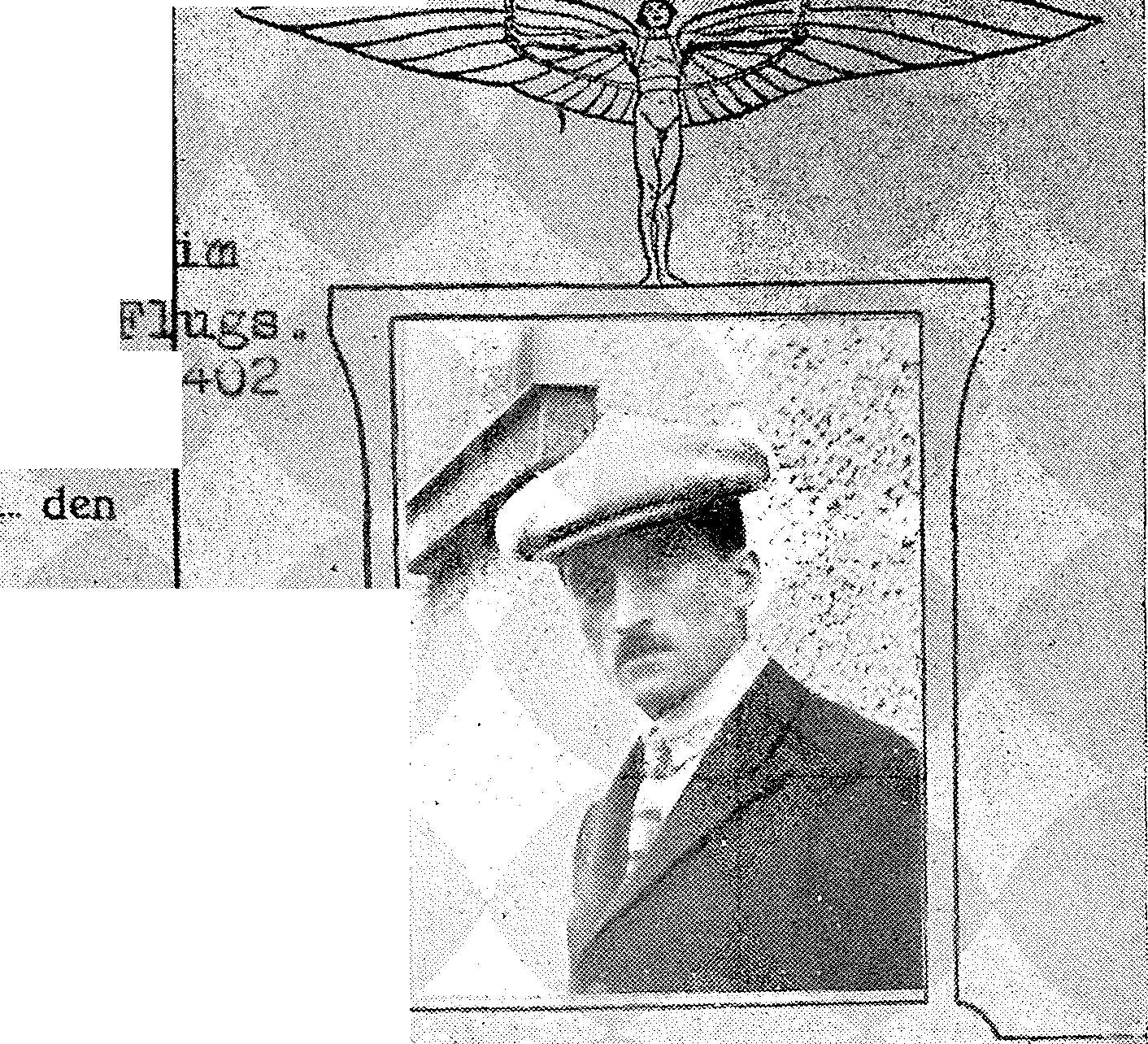
Wie die ersten
Segelflieger-Ausweise aussahen.
II. Internationaler Salon Brüssel 1939*) Bericht
In Anwesenheit des Staatssekretärs für Luftfahrt, General der Flieger Milch, sowie einer gößeren Anzahl führender deutscher und ausländischer Persönlichkeiten fand die Eröffnung des Salons am 8. 7. um 15 Uhr statt.
Die Ausstellung ist" in diesem Jahre im größten Ausstellungsbau auf dem Gelände der Weltausstellung 1934 untergebracht. Ihr Umfang geht über den ersten Salon weit hinaus und stempelt sie zu einem internationalen Luftfahrtereignis ersten Ranges. Deutschland
Die vom R,._D. L. I. organisierte Kollektivschau der deutschen Firmen macht in ihrer einheitlichen Geschlossenheit wiederum einen tadellosen Eindruck. Im Gegensatz zu den Ständen verschiedener anderer Nationen waren die deutschen Aussteller auch rechtzeitig mit den Aufbauarbeiten fertig. Organisatorische und künstlerische Leitung: Generalsekr. Cesar und Frl. van Vloten vom R. D. L. I.
Gleich rechts vom Eingang findet man zunächst den Junkers
*) Vergleiche Vorschau, Brüsseler Salon, Nr. 14, S. 341.
Ausstellungshalle des Brüsseler Salon.
Unten: Sicht durch die Halle.
Bilder: Flugsport
Vom Brüsseler Salon. Me 108 mit Verstellpropelle-r^
Bild: Flugsport
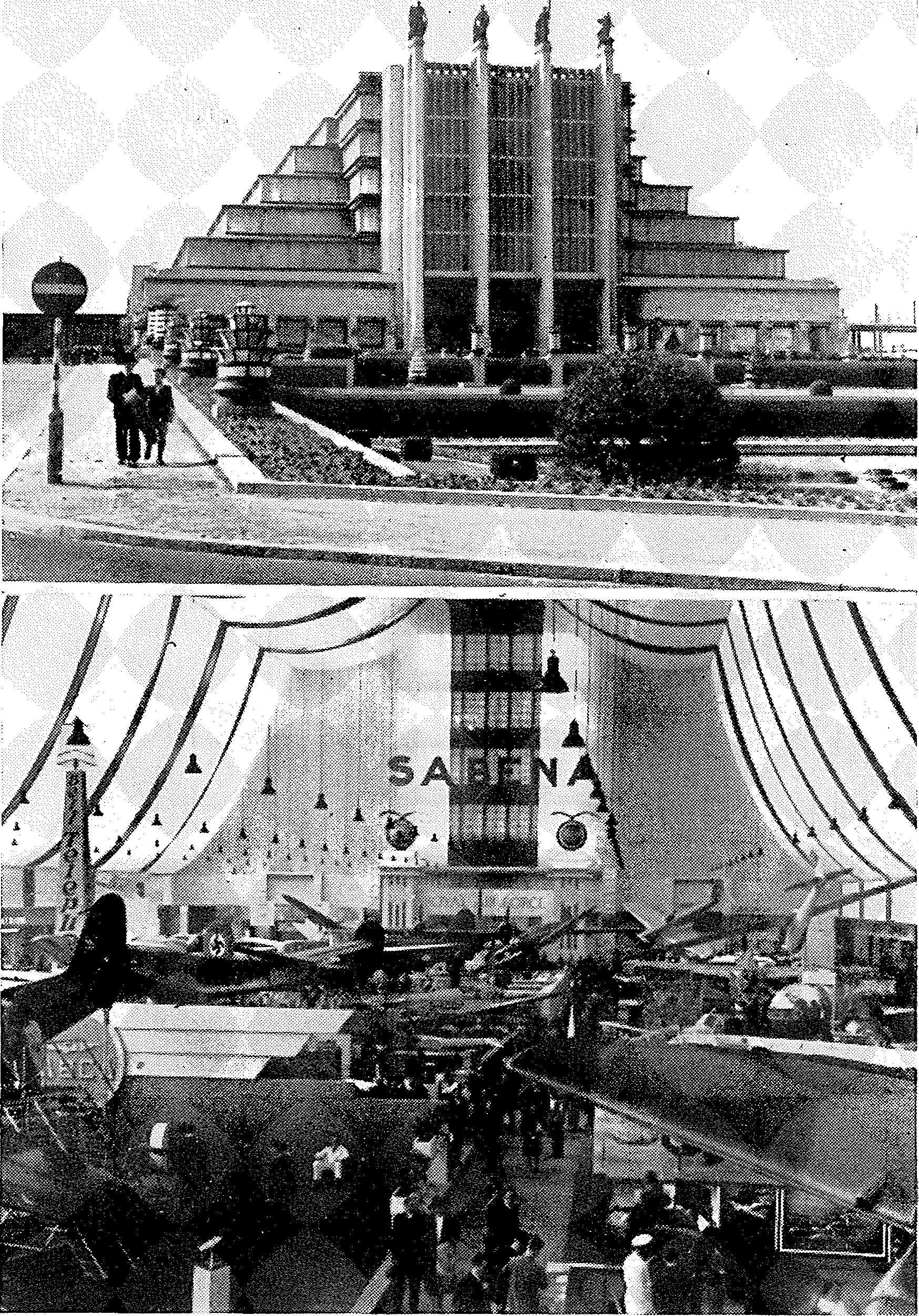
Sturzbomber Ju 87.
Die Maschine ist sehr geschickt aufgehängt und läßt die Halterung der angebrachten Bombenlasten gut erkennen.
An Originalflugzeugen sind auf dem deutschen Stand weiterhin zu finden:
Me 108, Ar 79, Go 150, Si 202, Kl 105
und ein Olympia-Segelflugzeug „Meise" von der DFS. Wie man aus der Zusammenstellung der Typen ersieht, wurde weniger auf militärische Repräsentation, sondern hauptsächlich auf Ausstellung von exportfähigen Serienflugzeugen gesehen.
Erstmalig erschienen unter dem deutschen Hoheitszeichen die Erzeugnisse der Luftfahrtindustrie des Protektorats Böhmen und Mähren.
Letov S. 50
(Chefkonstrukteur Smolik) ist ein zweimotoriges, dreisitziges Beobachtungsflugzeug in Dural-Schalenbau mit festem Fahrwerk, das mit zwei Avia-Motoren von je 420 PS eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h erreicht. Beachtenswert ist die Ausführung des rückwärtigen Schußkanals für das untere Beobachter-MG., die ein sehr günstiges Schlußfeld nach hinten unten ergibt (s. Abb. S. 381). Eine versuchsweise aufgebrachte Kanalverkleidung soll die Leistungen nicht verbessert haben, womit erwiesen wäre, daß der untere Rumpfausschnitt keinen wesentlichen Mehrwiderstand einbringt. Vgl. Typenbeschr. Seite 711 Jahrg. 1938. Der Jagdeinsitzer
Avia 135
ist in Gemischtbauweise ausgeführt und sieht sehr sauber aus. Die
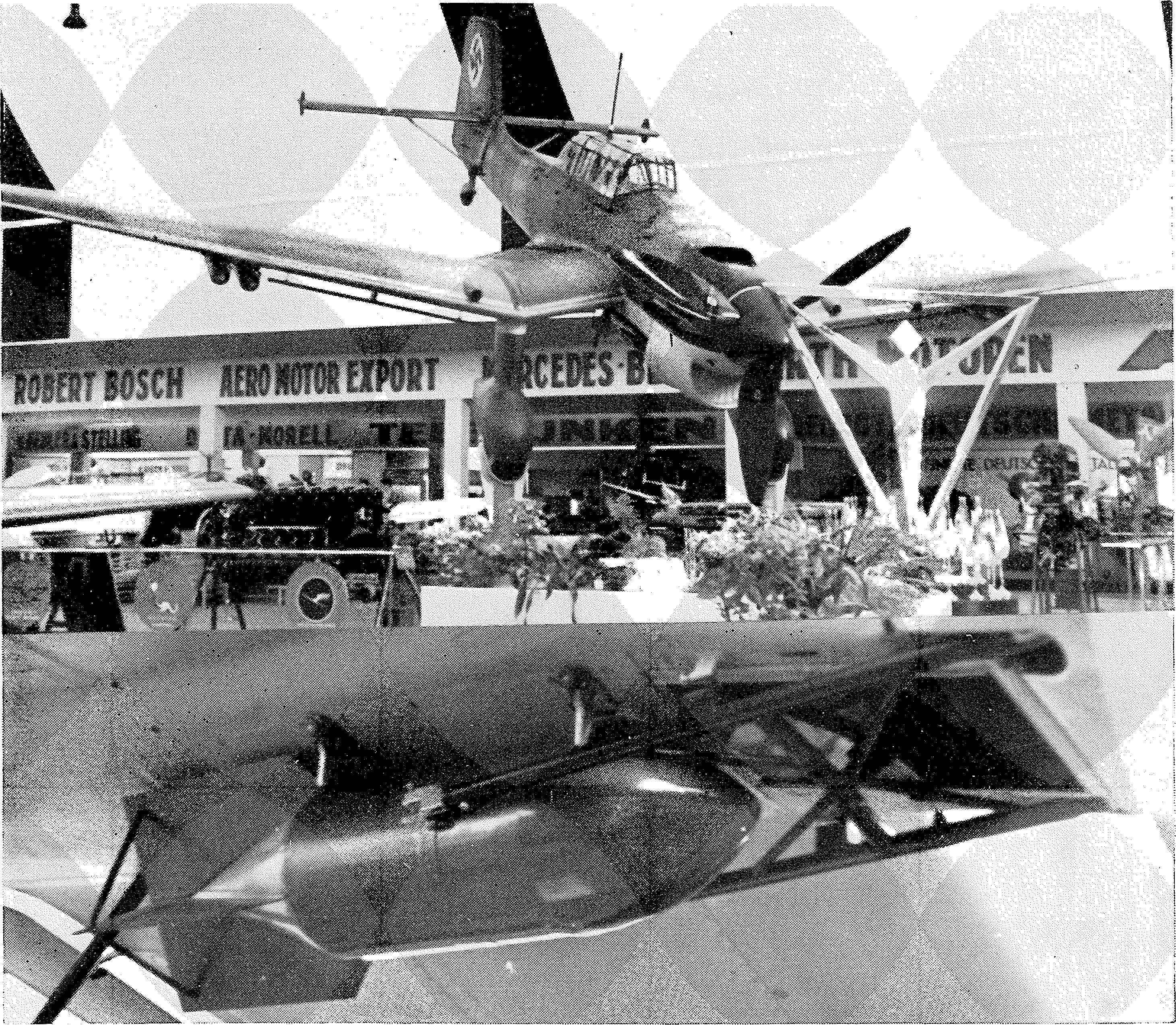
Vom Brüsseler Salon. Ju 87. Unten: Mittelbombenaufhängung.
Bild: Flugsport
Höchstgeschwindigkeit wird mit Avia-Motor 650/850 PS zu 535 km/h in 4000 m Höhe angegeben. Bewaffnung: Zwei gesteuerte MG, Type VZ 30, eine Kanone HS 404, Kaliber 20 mm, Waffenauslösung elektromagnetisch; 6 Bomben zu je 20 kg oder 2 Bomben zu 50 kg, Auslösung mit Druckluft. Ausrüstungsgewichte: 2 MG 24 kg, 500 Schuß 17 kg, Kanone 43 kg, 60 Schuß (20 mm) 25,7 kg. Flügelprofil beinahe symmetrisch. Auffallend sind die geschickt untergebrachten Flüssigkeits- und Oelkühler (Fabrikat: F. Kratina, Kralupy). Vgl.
Vom Brüsseler Salon. Oben links: Daimler-Benz DB 601a, Einspritzmotor, ermöglicht geringen Betriebsstoffverbrauch. Unter dem Motor lag ein großer Spiegel, damit die Besucher den Motor im Spiegelbild von unten sehen konnten, wie die darunter stehende Abb. zeigt. Rechts: Staatssekretär General der Flieger Milch mit General der Flieger Wenninger. Darunter: Oberst Polte erklärt Luftverkehrsprobleme. Unten: Oberst Polte studiert die Bremsanlage auf dem Stand von Argus. Unten links: Neue Preßluftstauchmaschine von Junkers.
Bilder: Flugsport
Abbildung und Typenbeschr. Seite 204. Die bekannte „Zlin 12" ist in der neueren Ausführung mit Walter-„Mikron"-Motor ausgestellt.
Unter den gezeigten Modellen fällt auf dem geschmackvoll ausgestatteten Dornier-Stand besonders die S. 352 eingehend beschriebene Do 215 auf (Weiterentwicklung Do 17). Bei Junkers ist an einem Rumpfmodell Ju 90 die Anschlußart der beiden Außenflügel sehr schön zu sehen. Junkers hat außer dem Rohölmotor Jumo 205 ein Schnittmodell des Benzinmotors Jumo 211 ausgestellt, bei dem die Gehäuseteile teilweise aus Plexiglas bestehen, wodurch ein guter Einblick in das Triebwerk ermöglicht wird. Der Einspritzmotor DB 601 A, mit dem die Geschwindigkeitsweltrekorde für Deutschland erobert wurden, ist ebenfalls ausgestellt.
Das von der Firma Walter (Protektorat) gezeigte vielseitige Motorenbauprogramm bedeutet für die Triebwerksauswahl in Deutschland sicherlich gute Baumöglichkeiten. Die verschiedenen bekannten Walter-Motore haben sich in den Grundzügen nicht verändert, wurden aber mit kleinen Verbesserungen ausgestattet, die ihren Gebrauchswert erhöhen. In Lizenz wird noch der englische Bristol „Mercury"-Motor gebaut. Wenig bekannt ist, daß zum Fabrikationsprogramm der Firma Walter auch Anlasser, Luftpresser und Sogpumpen gehören.
Bei Junkers ist neben der bekannten Einziehmaschine mit elektrischem Antrieb eine neue, ganz leichte Maschine (Abb. S. 379) mit Preßluftantrieb zu sehen. Die Maschine kann, ähnlich wie die bekannte Hand-Stauchzange, auf Ständer benutzt werden und ist leicht
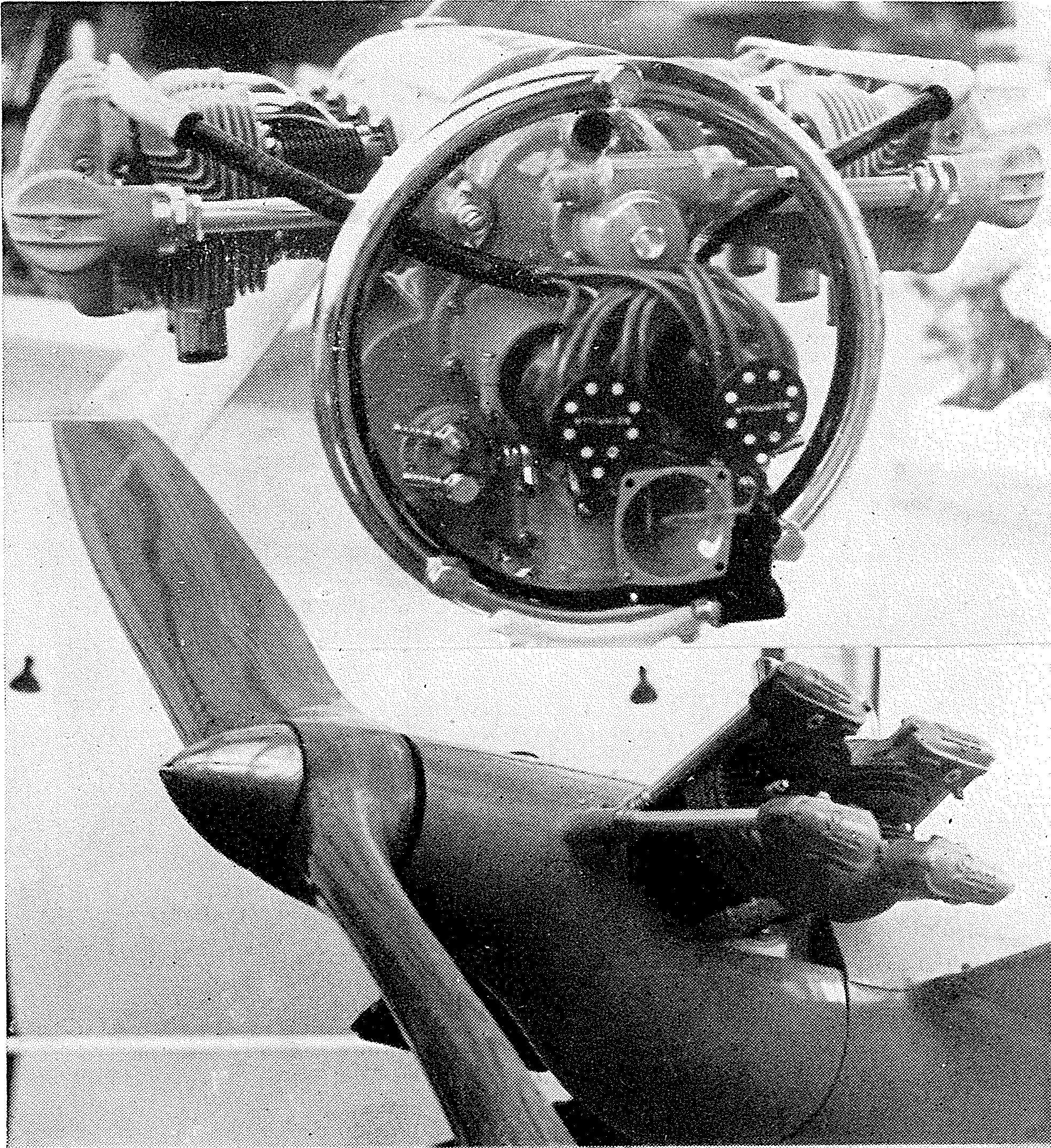
zu transportieren. Gegenüber der Stauchzange dürfte sie wesentliche Ersparnisse an Arbeitszeit ermöglichen.
Bei Argus sieht man einen Versuchsbremsstand, auf dem Laufradbremsen unter genau der Wirklichkeit nachgebildeten Bedin-
Vom Brüsseler Salon. Stand
Protektorat.
Oben: Avia-Motor, 8 Zyl., gegenläufig. Mitte: Avia-Mo-
tor für Flügeleinbau.
Unten: Oelkühler an Flügel-
nase beim Avia 135.
Bilder: Flugsport
Vom Brüsseler Salon. Stand
Protektorat (Seite 381).
Konstruktionseinzelheiten
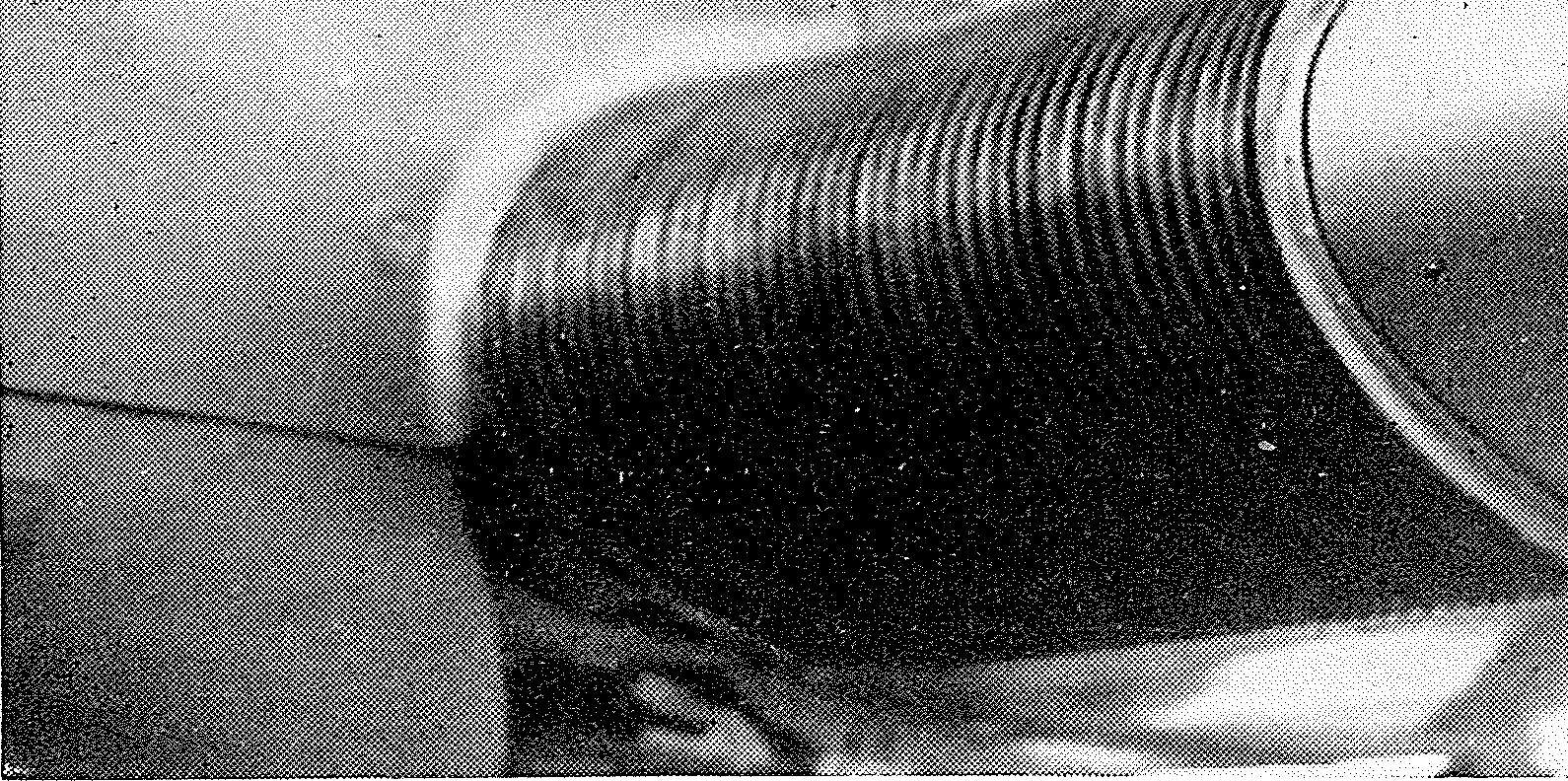
vom Letov S. 50. Oben links und rechts: Einstiegklappe. Darunter: Rumpfnase und hintere MG.-Kuppel. Darunter: Leitwerk und Fahrwerk. Darunter links: Bombenaufhängung, rechts: MG.-Stand und unten hinterer MQ.-Stand unten am Rumpf mit Schußkanal für MG.
nach hinten.
Bilder: Flugsport
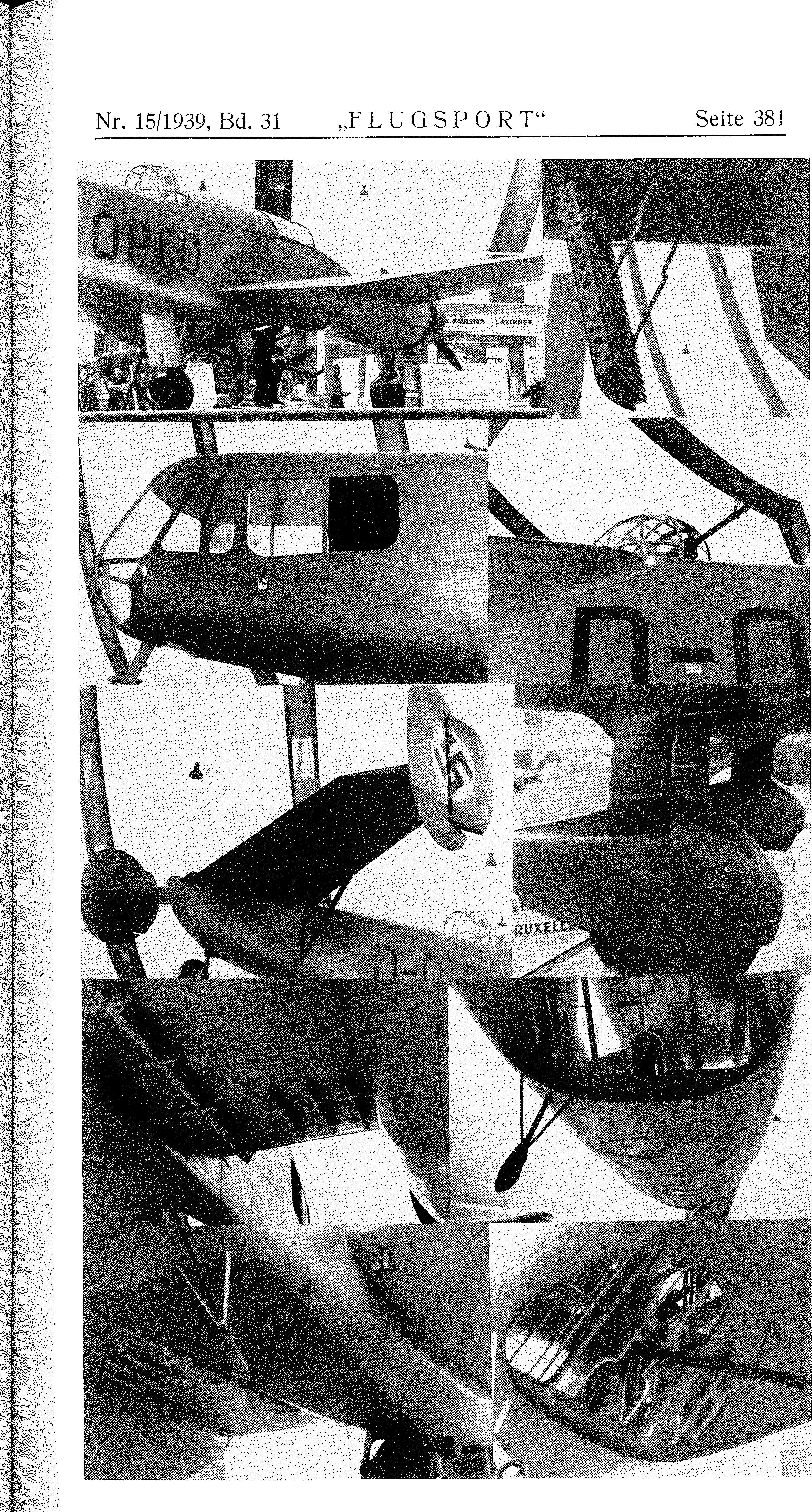
gungen erprobt werden können. Das Versuchsrad (hier ein Rad für Me 108) fällt unter Landestoß-Belastung auf rotierende Trommeln, die eine „Landegeschwindigkeit" von 130 km/h haben. Die mit den Trommeln verbundene Schwungmasse entspricht der Masse des Flugzeugs und muß durch die Bremsarbeit abgestoppt werden.
Bei Letov sah man Gabelspannmuttern für Profil- und Runddrähte, bei denen ein Verdrehen des Drahtes nicht mehr möglich ist. Das Spannen wird an einem Vierkant der Spannmutter vorgenommen, während der Draht selbst beiderseits gegen Drehung gesichert ist (siehe Skizze).
Ein Rettungs-Schlauchboot ist neben sonstigem Rettungsgerät bei von Kehler & Stelling ausgestellt. Das für 2 Personen bestimmte Boot kann zusammengefaltet im Flugzeug mitgeführt werden. Im Bedarfsfalle genügt die Betätigung eines Handgriffes, um das Ventil der zugehörigen Kohlensäureflasche zu öffnen, wodurch dann das Schlauchboot aufgeblasen wird. In einem Verpackungssack sind Metallriemen und Notproviant sicher untergebracht.
Auf dem Stand der DFS. ist neben der Meise und einem Trudel-windkanal ein Stahlrohrrumpf ausgestellt, in dem die neue Seileinholevorrichtung eingebaut ist. Das Seil spult sich nach dem Ausklinken selbsttätig in den Flugzeugrumpf hinein. Zum neuen Schlepp kann es ohne Schwierigkeiten wieder herausgezogen werden, da der Trommelantrieb durch den Fahrtwind erfolgt.
Belgien.
Von der SABCA sieht man erneut den schon in Paris gezeigten leichten Bomber
Vom Brüsseler Salon. Stand Belgien. Vordergrund Sabca S. 40, hinten Sabca S. 47.
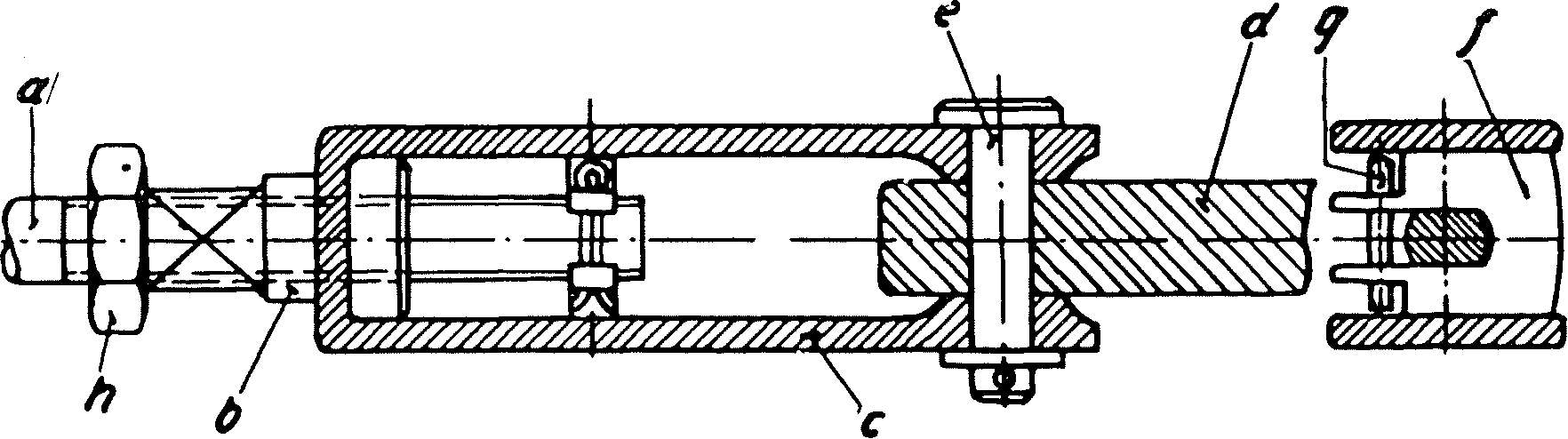
Letov - Gabelspannmutter (Prinzipskizze). a) Spanndraht, b) Spannmutter, c) Gabel, d) Anschlußlappen, e) Splintbolzen, f) Drehsicherung, g) Splint
für Drehsicherung, h) Kontermutter.
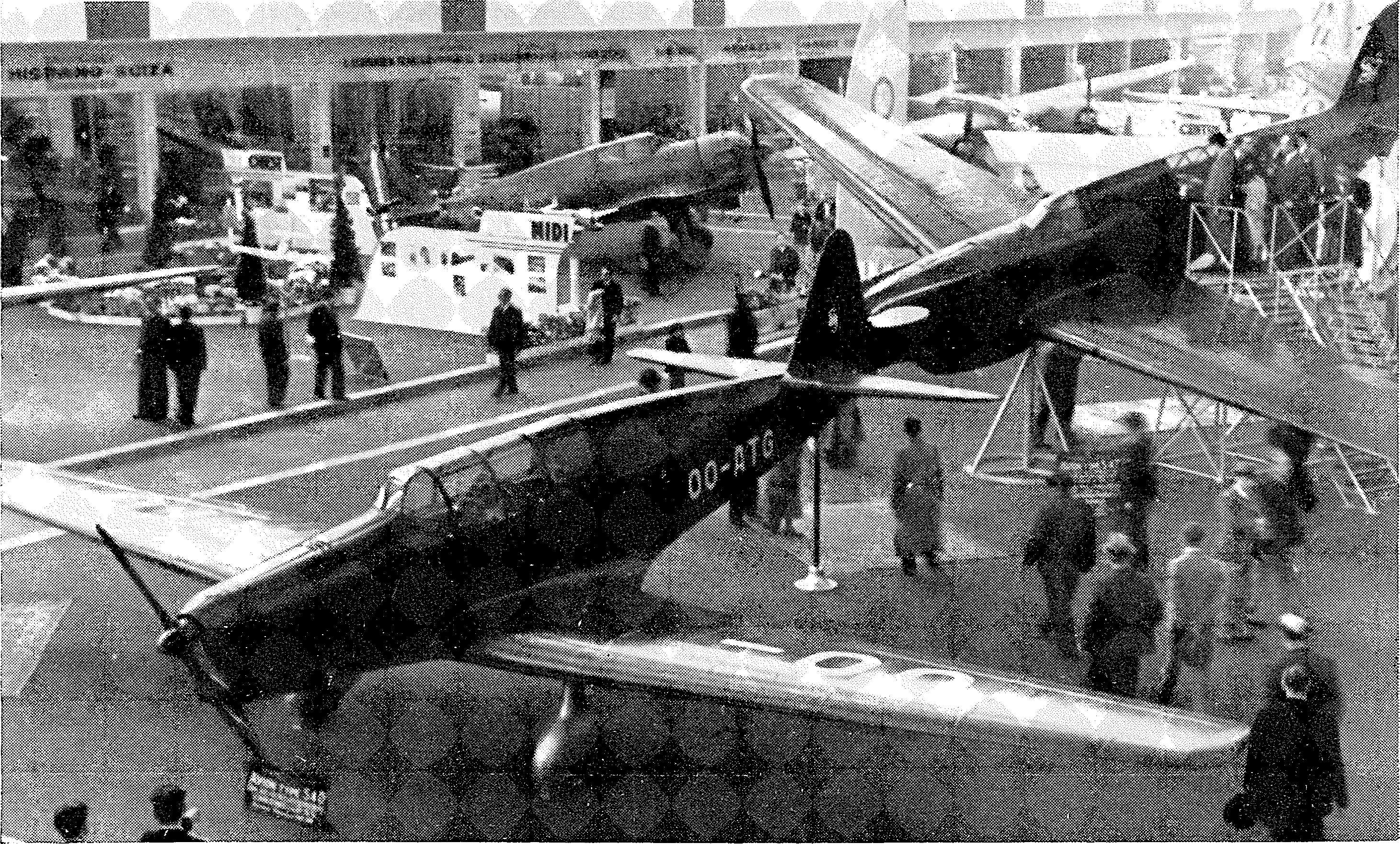
Bild: Flugsport
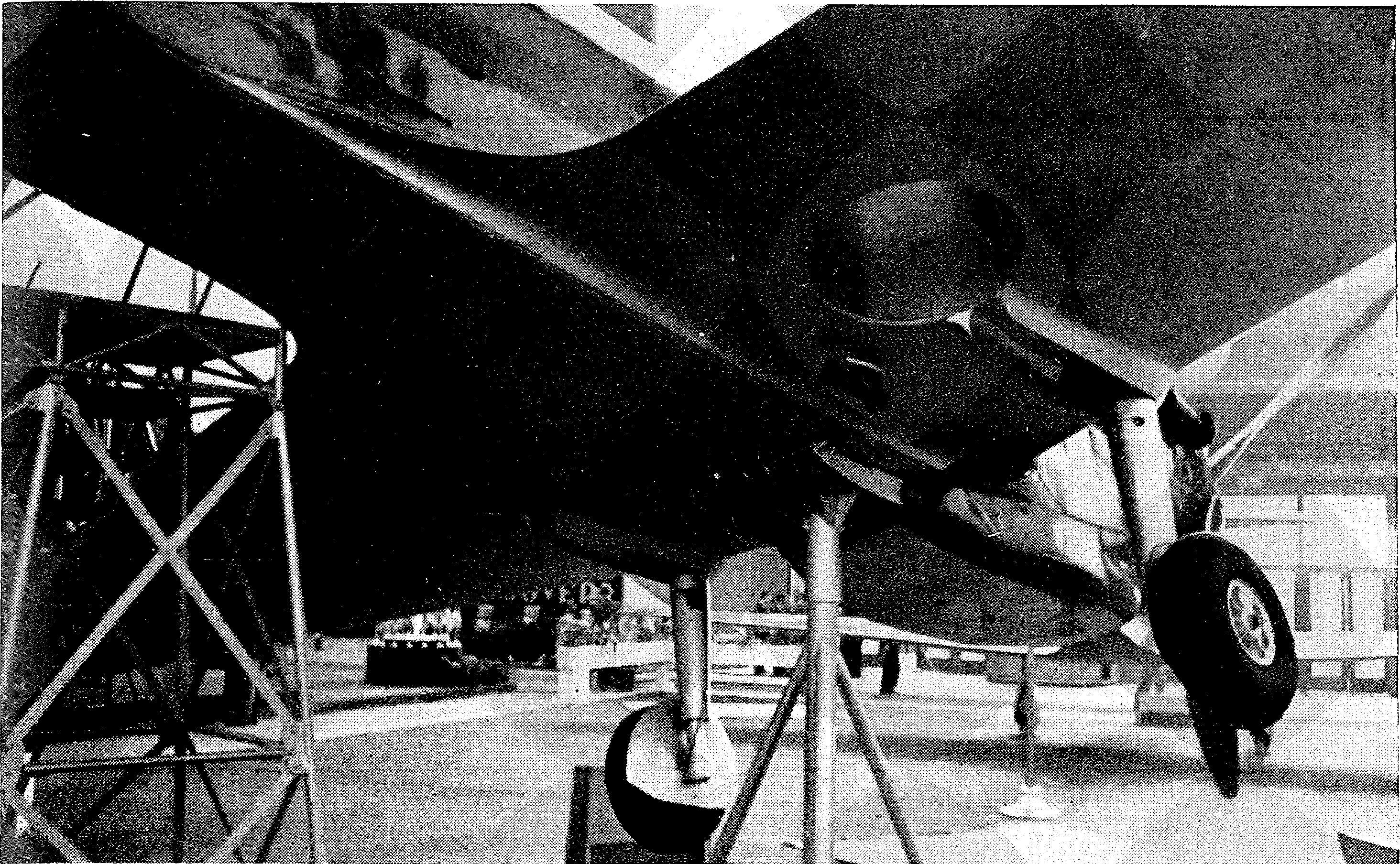
Vom Brüsseler Salon. Stand Belgien. Sabca S. 47 - Fahrwerk.
Bild: Flugsport
S. 47,
der äußerlich dem „Battie" ähnelt, aber Gemischtbauweise aufweist. Ausführl. Typenbeschr. S. 120.
Schul-Zweisitzer S. 40
in Gemischtbauweise ausgeführt. Motor Renault 140 PS, freitragender Tiefdecker mit Einbein-Fahrwerk. Sitze hintereinander in Kabine. Verwendungszweck: Blind- und Kunstflugschulung. Bei Fairey sieht man neben der bereits bekannten
Tipsy BC
mit Walter Mikron einen neuen Schulzweisitzer mit Kabine und hintereinanderliegenden Sitzen. Typenbezeichnung Tipsy M, Gemischtbauweise, hinterer Sitz mit Elindflughaube versehen, Kabine
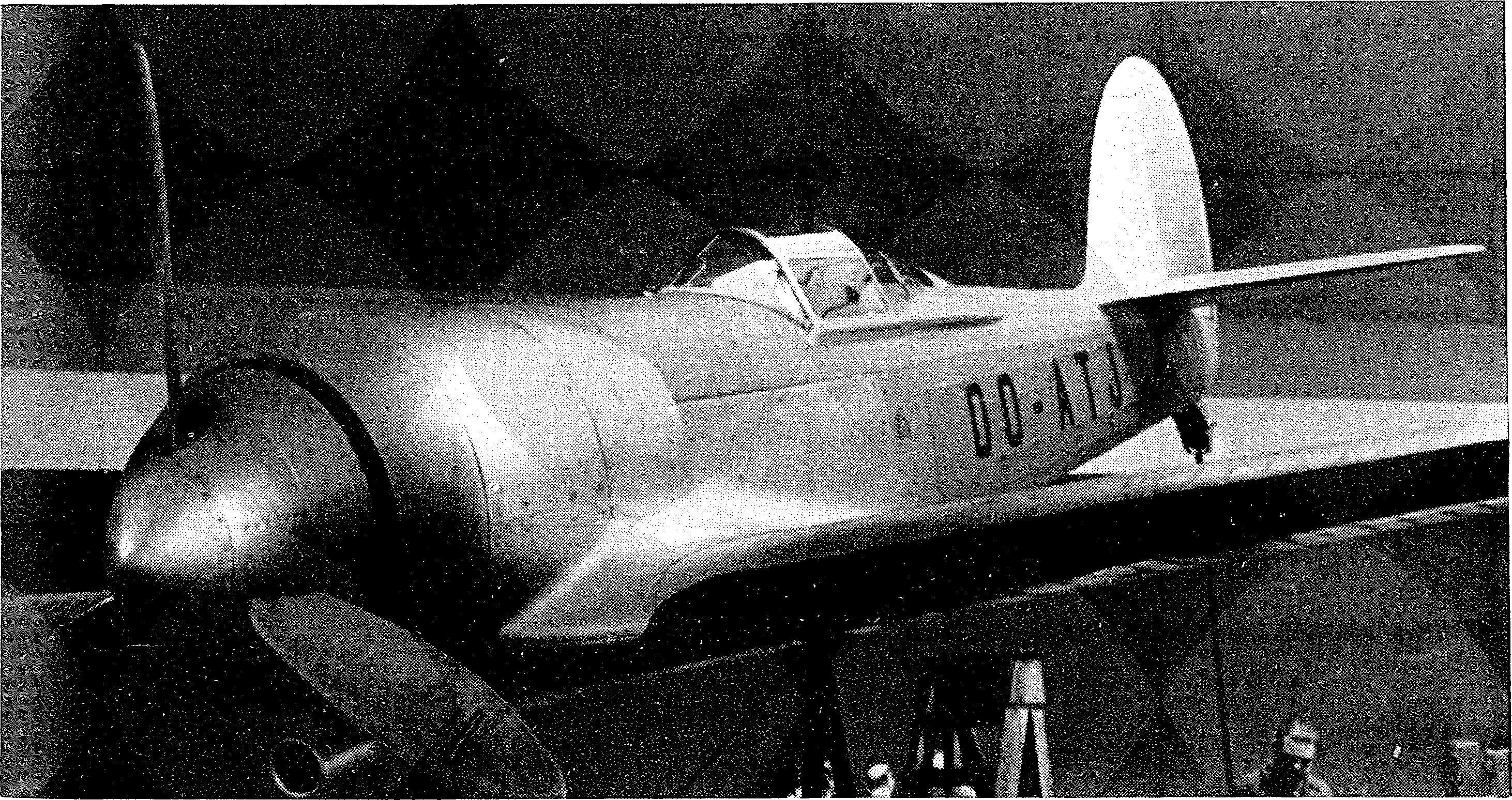
Vom Brüsseler Salon. Stand Belgien. Renard R 37.
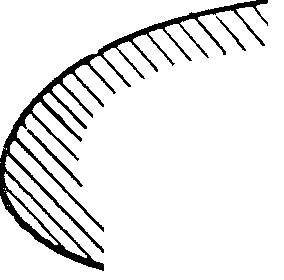
Spreizklappe „Tipsy M".
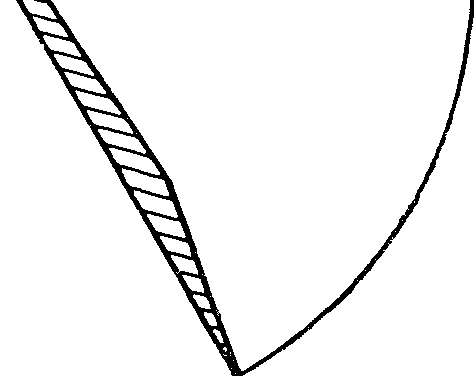
zurückschiebbar. Querruder ohne Differential sind seilgetrieben und haben viel Reibung. Sammelauspuff schalldämpfend, Spreizklappe unter dem Rumpf durchgehend. (Klappenart siehe Skizze.)
In der Nebenhalle des Ausstellungsbaues findet man noch den Renard-Jagdeinsitzer R. 37, der aus dem vor zwei Jahren ausgestellt gewesenen Renard 36 (Typenbeschr. S. 313 Jahrg. 1937) entwickelt wurde. An Stelle des Reihenmotors ist jetzt ein Gnome-Rhone-Sternmotor 950 PS mit Ringverkleidung eingebaut (s. Abb.). Gesamtaufbau und Formen sind ähnlich geblieben. Der Renard R. 36 ist bekanntlich bei der Musterflugerprobung nach zunächst befriedigenden Ergebnissen zu Bruch gegangen.
Auffallend an dem Renard R. 37 ist die Flügelwurzelverkleidung auch an der Vorderseite der Flügelnase zum Rumpf.
In einer Nebenhalle findet man einen belgischen Hubschrauber.
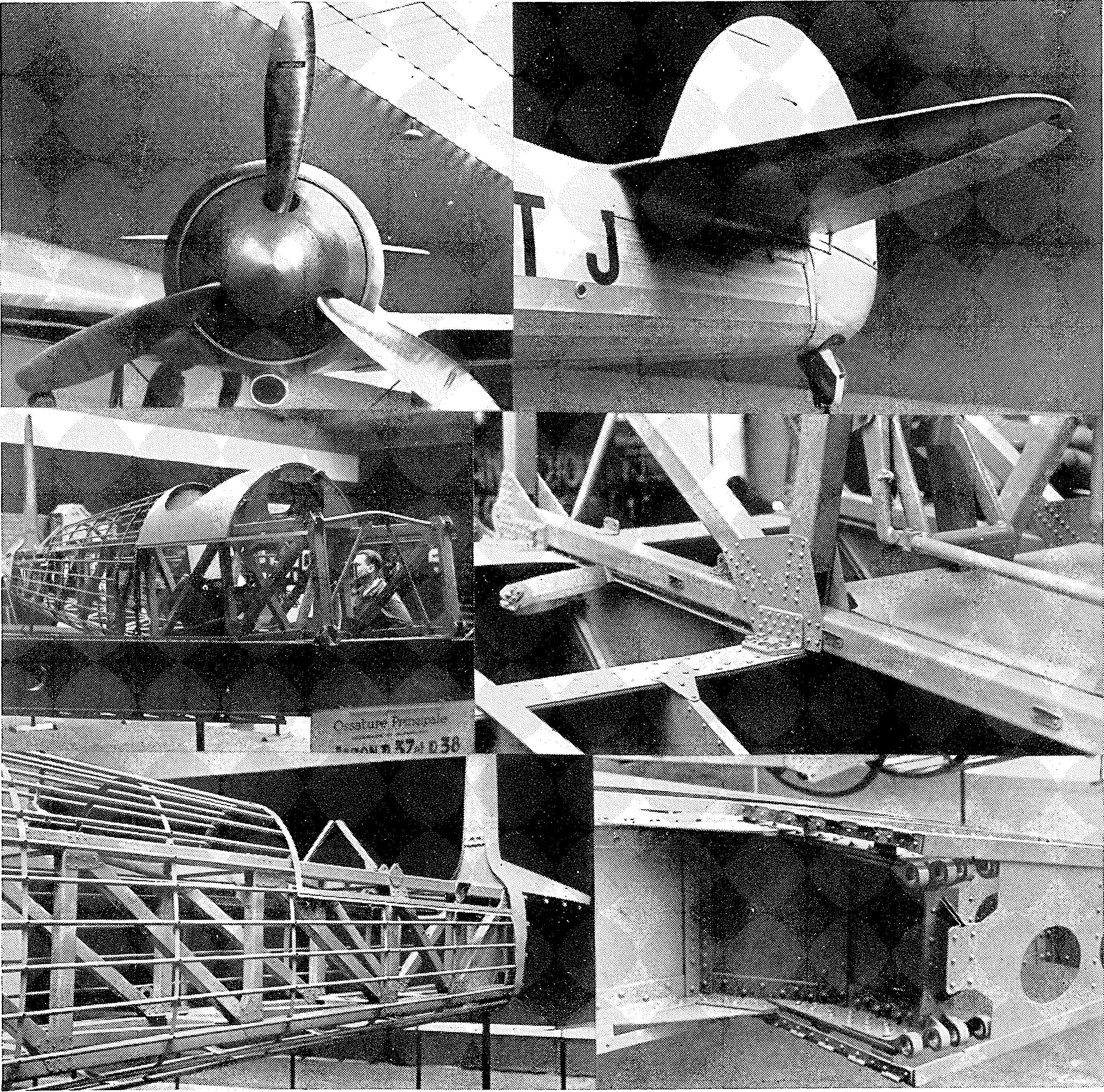
Vom Brüsseler Salon. Stand Belgien. Renard R37. Oben links: Kühlluft für den Motor strömt durch eine runde Oeffnung unter der Haube ein und wird durch den Spalt zwischen Luftschraubennabe und NACA-Haübe abgesaugt. Rechts: Leitwerk. Links Mitte und unten: Rumpfaufbau. Rechts: Hinterholm, Rumpfverbindung, Knotenpunkte im Mittelstück. Unten: Hinterholm-Anschluß. Bilder: Flugsport
Es handelt sich um einen Typ mit zwei gegenläufigen Schrauben, deren Achsen voneinander mehrere Meter Abstand haben und an beiden Enden eines unverkleideten Stahlrohrrumpfes gelagert sind. Antrieb erfolgt durch zwei Salmson-AD-9-Motore. Die Maschine erinnert an den seinerzeit in Belgien gebauten Florine-Hubschrauber (vgl. Abhandlung S. 226 Jahrg. 1934), weist aber ein Leitwerk zur Steuerung des Horizontalfluges auf. S. Abb. S. 389.
Hollands
Der Koolhoven FK 56
ist bereits in der letzten Nummer des „Flugsport" ausführlich beschrieben.
Großen Eindruck macht infolge seiner Größe der in der Haupthalle stehende Torpedo-Bomber Fokker TW 8.
Bei diesem Typ ist der Torpedo nicht mehr außerhalb des Rumpfes untergebracht, sondern in einem durch zwei Klappen verschlossenen Hohlraum desselben. Neben aerodynamischer Verbesserung scheint man einen Schutz des empfindlichen Torpedos vor Kälte und Spritzwasser anzustreben. Typenbeschreibung Seite 391.
Auf dem Fokker-Stand findet man noch die „Spinne", ein Fok-kerflugzeug aus dem Jahre 1911, entstanden in Johannisthal.
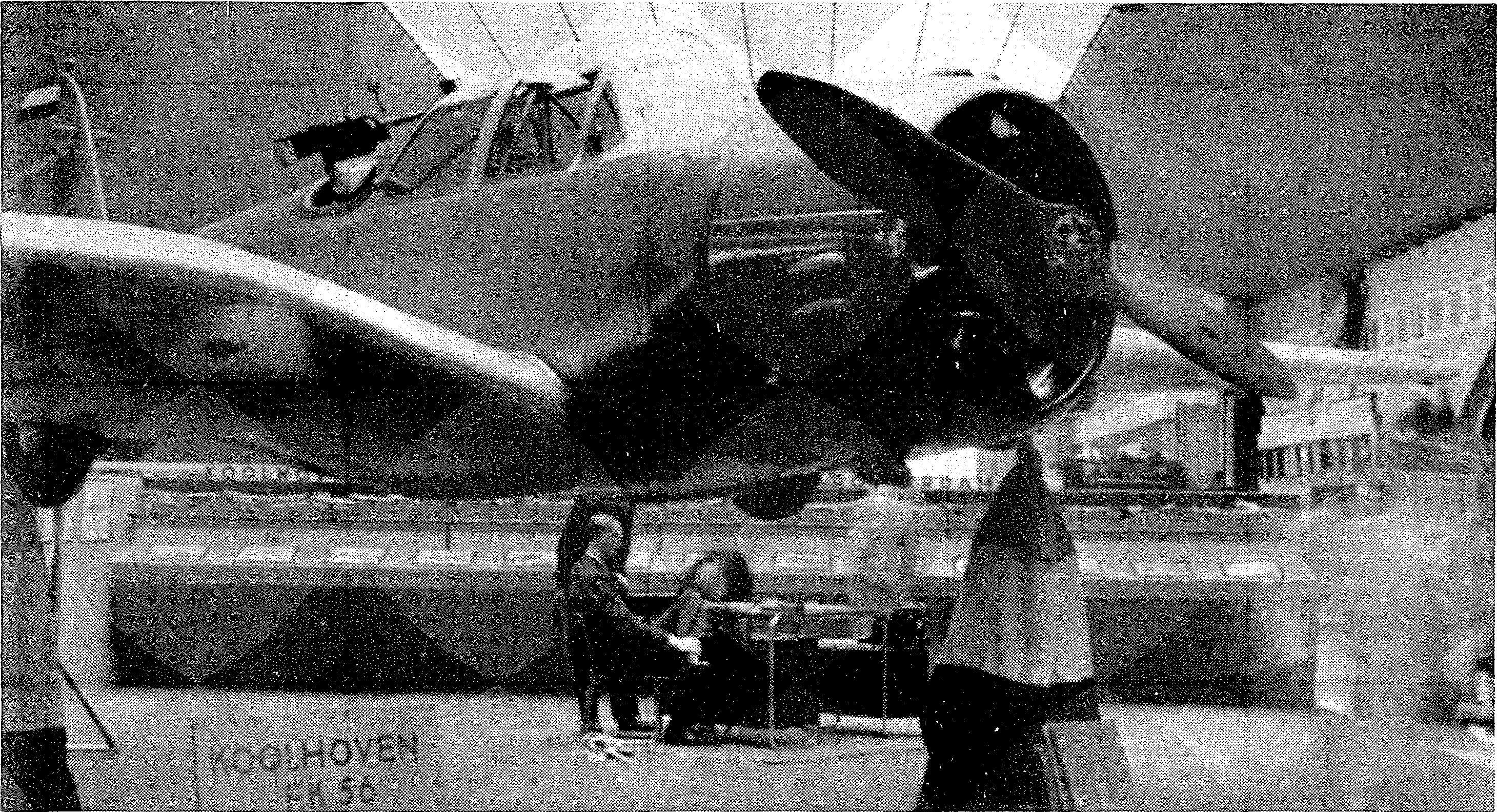
Koolhoven F. K. 56. Man beachte den einfachen Einbau des hinteren MQ.
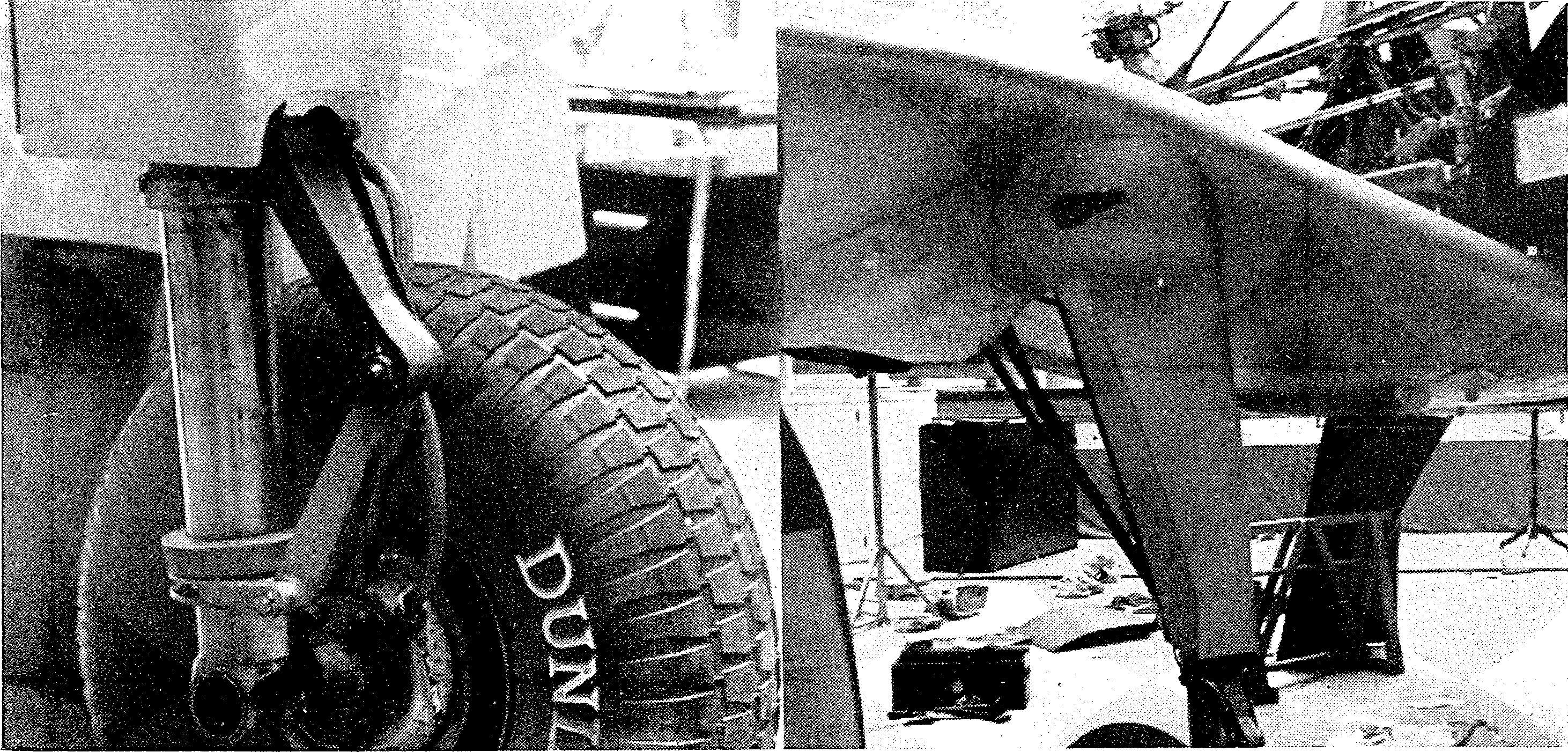
Vom Brüsseler Salon. Holland. Koolhoven F. K. 55 - Fahrwerk. Bilder: Flugsport
England.
England zeigt seine neuesten Typen. Als größtes Flugzeug der Ausstellung ist der Vickers-„Wellington"-Bomber in geodätischer Bauweise zu nennen, auf den wir noch ausführlich später zurückkommen. Die Gesamtausführung des Flugzeugs, das mit Bombenaufhängevorrichtungen und mit Bombenwinden versehen ist, macht einen serienreifen Eindruck.
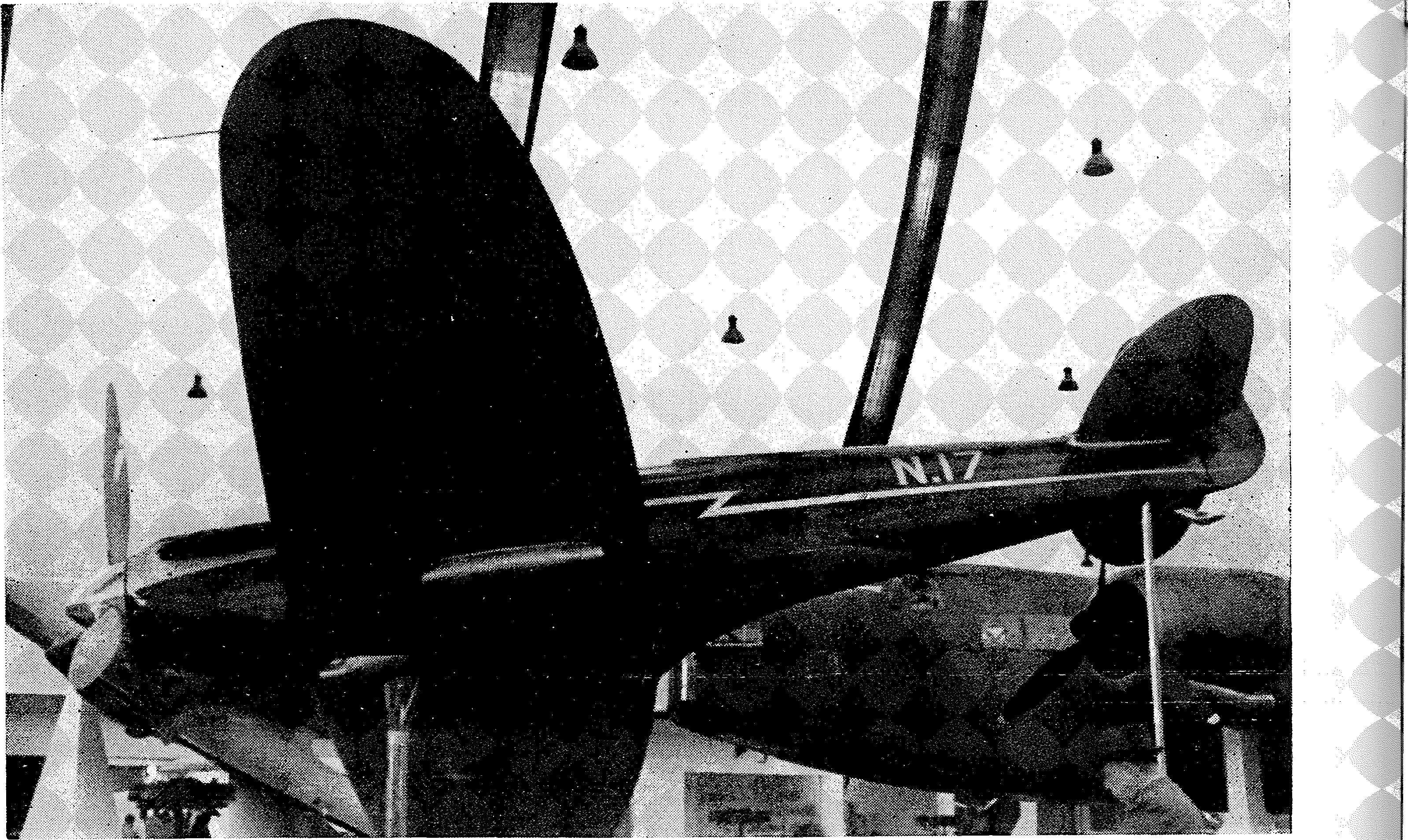
Vom Brüsseler Salon. England. Supermarine „Spitfire". Unter dem Rumpf zwischen Fahrwerk Ansaugschacht für Vergaser.
Bild: Flugsport
Vom Brüsseler Salon. England. Supermarine „Spitfire". Oben:Rumpf-vorderteil. Man beachte die schuppen-förmig hintereinander liegenden Auspuffrohre und Verkleidungen vor den Propellerblattwurzeln. Unten: Führerhaube und Flügelübergänge zum Rumpf.
Bilder: Flugsport
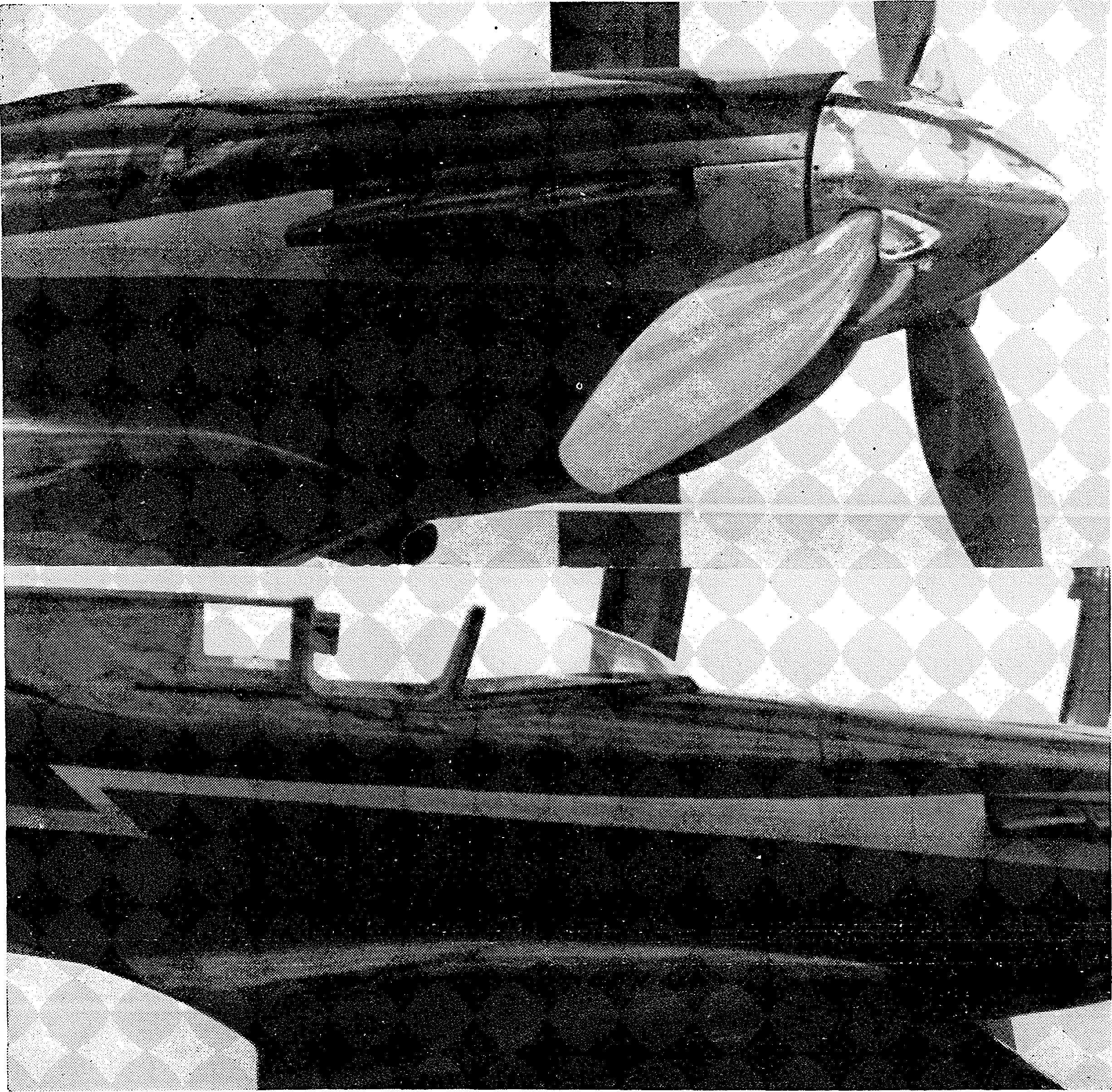
Der Supermarine „Spitfire"
(vgl. Abb. und Typenbeschreibung Seite 301) hat gegenüber der im Vorjahr in Paris gezeigten Ausführung wesentliche Veränderungen durchgemacht. Die Form der Kabine ist jetzt sehr günstig geworden. An Stelle des unter dem rechten Flügel vorhanden gewesenen Flüssigkeitskühlers ist nur noch ein kleiner runder Kühlschacht zu sehen, der anscheinend einen Oelkühler aufnimmt. Die zweiflügelige feste Holzschraube hat einer dreiflügeligen verstellbaren Metallschraube Platz gemacht, deren Blattwurzeln an der Luftschraubenhaube nochmals besonders verkleidet sind. Das ausgestellte Flugzeug ist im Gegensatz zu dem Tarnfarbenanstrich der übrigen englischen Militärflugzeuge spiegelblank lackiert. Dieser neue Typ hat den Namen „Speed Spitfire" erhalten.
Hawker „Hurricane" ist als komplettes Flugzeug und als Zellen-Rohbau ausgestellt (siehe Abbildungen und Typenbeschreibung S. 291 Jahrg. 38). Der von der Gerätefirma Reid & Sigrist kürzlich herausgebrachte zweimotorige Tiefdecker für Schulzwecke ist ebenfalls ausgestellt. Beschreibung siehe „Flugsport" Seite 281.
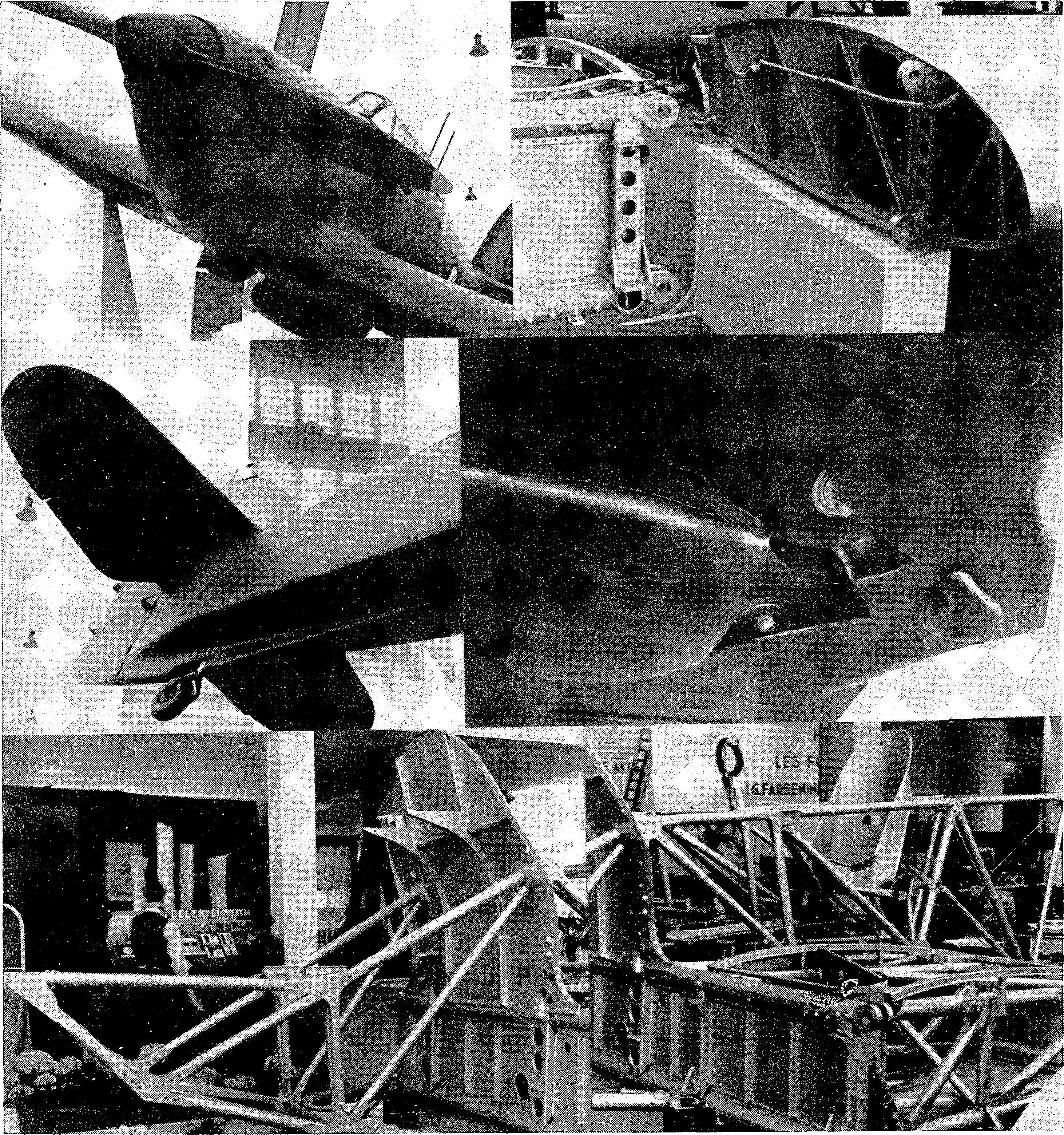
Vom Brüsseler Salon. Oben: Engl. Hawker „Hurricane". Rechts: Flügelanschluß. Mitte links: Leitwerk, Rad verschwindet im kielförmigen Luftabfluß. Rechts: Fahrwerk hochgezogen, dahinter Kühler. Unten links: Motorbock. Rechts: Flügelmittelstück des Rumpfes. Bilder: Flugsport
Vom Brüsseler Salon. Oben: Engl. Vickers „Wellington". Unten: Heck, Leitwerk mit Heck-MG.-Stand.
Bilder: Flugsport
Fairey zeigt seinen leichten Bomber „P. 4", der hauptsächlich für Tageinsatz gedacht ist. Der zwei-bis dreisitzige Typ ist an den „Battie" angelehnt und wie dieser in Metall-Schalenbau
ausgeführt. Motor Rolls-Royce „Merlin". Nutzlast: 4 Bomben zu je 120 kg. Schließlich ist noch
ein
Airspeed „Oxford"
zu sehen. Das zweimotorige Schulflugzeug ist in Holzbauweise hergestellt und wird für die RAF in Serien fabriziert. Sorgfältig sind die Kabinenöffnungen für Schlechtwetterflug ausgebildet. Außer dem normalen Schiebefenster ist in der Windschutzscheibe noch ein nach oben zu öffnendes Klappfenster angeordnet worden, um ein Fliegen
bei schlechtestem Wetter zu ermöglichen, ohne daß der Führer dauernd seitwärts aus dem Schiebefenster heraussehen muß. Typenbeschreibung S. 7.
An Zivilflugzeugen hat England noch den
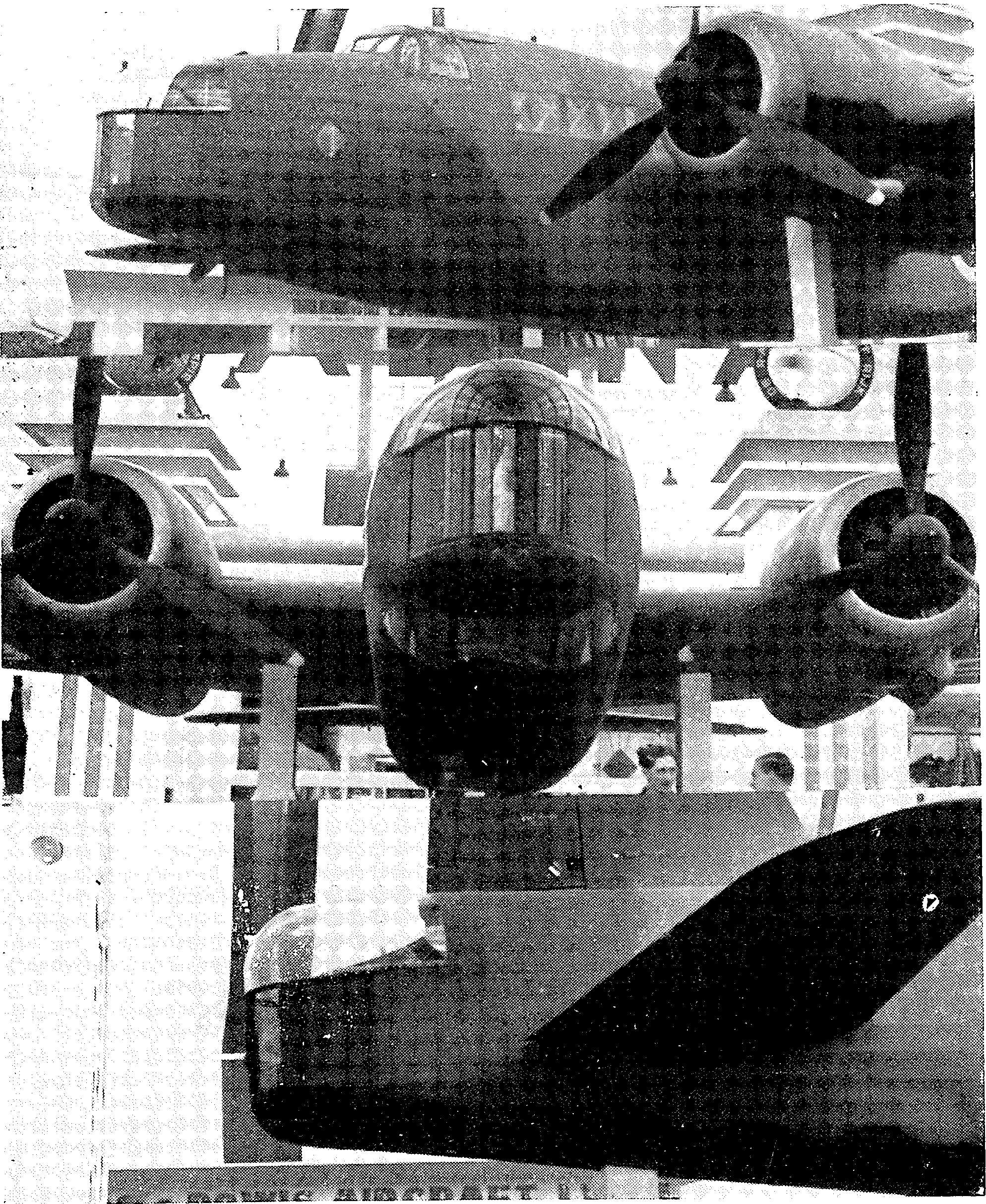
Vom Brüsseler Salon. Oben: Engl. Airspeed „Oxford". Unten: NACA-Haube, doppeltes Blech, Kipphebelgehäuse eingelassen.
Bilder: Flugsport
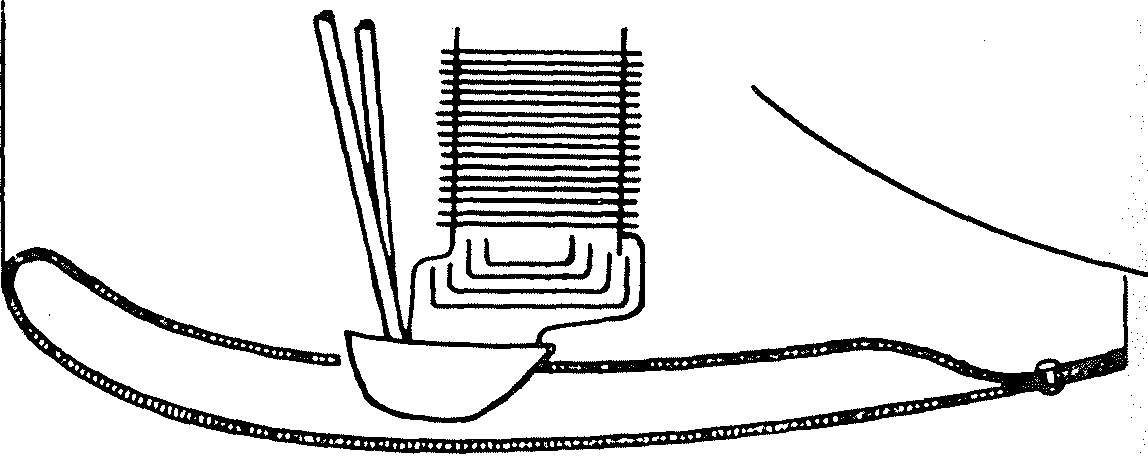
Zeichnung Flugsport
Miles „Magister" sowie die Moth „Minor"
herübergebracht. An beiden Flugzeugen sind die in die Höhenflosse überleitenden seitlichen Verkleidungen an der Rumpfoberseite auffallend.
Die ausgestellten englischen Motoren sind bereits durch frühere Ausstellungen bekannt._
Vom Brüsseler Salon. Bilder rechts von oben: Staatssekretär General der Flieger Milch. Rechts: C. G. Grey, der Seniorschriftleiter der bekannten englischen Zeitschrift „The Aeroplane". Darunter: Belgien. „Tipsy M". Man beachte die Landeklappen. Sammelauspuff der „Tipsy M". Unten: Belg. Hubschrauber Florine, Drehkopf mit den Flügeln.
Bilder links: Franz. Stand. Oben: Fahr werk. Unten: Hanriot. An Stelle eines Kühlluftkragens sind zu beiden Seiten der Motorgondeln unter dem Flügel zwei Oeffnungen vorgesehen.
Hanriot, Spornrolle. Mitte: Potez 63,
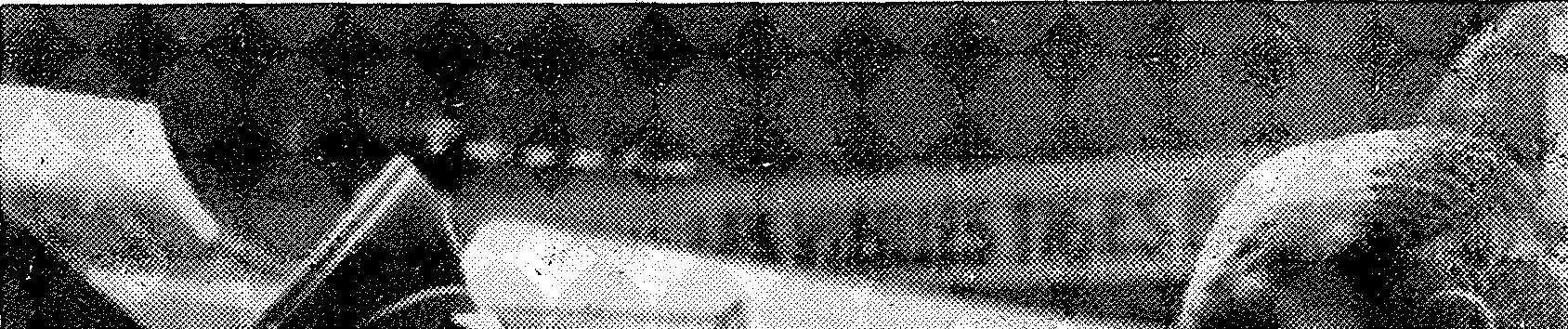
Vom Brüsseler Salon. Oben: Engl. „Moth Minor", rechter Flügel zurückgeklappt, mit Distanzseil und Flügelverriegelung. Unten: Miles „Magister", Leitwerk. Man beachte die Luftführung für die Höhenflosse am Rumpf.
Bilder: Flugsport
Frankreich
Die französische Beteiligung ist nicht besonders groß. Ausgestellt sind:
Potez 63, Bloch 151 C 1 s, mit Qnome-Rhone 14 N,
Hanriot NC 600, Kellner-Becherau,
Flugzeuge, die durchweg schon von früheren Gelegenheiten her bekannt sind. Die Potez 63 erweckt den Eindruck eines nunmehr in Produktion begriffenen Serienflugzeuges. Für den Hanriot, der mit zwei doppelreihigen Sternmotoren Gnome-Rhone 14 MARS versehen ist, wird eine Höchstgeschwindigkeit von 540 km/h angegeben. Die Kühlluft tritt bei diesem Baumuster nicht aus dem üblichen Ringquerschnitt einer NACA-Haube aus, sondern beiderseits der Motorgondel aus besonderen Luftschächten.
Weiter werden noch mehrere Modelle gezeigt, NC 110 mit vier Hispano 12 YS Motoren, je zwrei hintereinander angeordnet. Loire Nieuport 10 ist ein Zweischwimmerflugzeug, ähnelt Blohm und Voß.
Fokker T. 8-W, Torpedoflugzeug.
Bei der Konstruktion des Torpedoflugzeugs T. 8-W der Neder-landschen Vliegtuigenfabriek wurde Wert auf Geschwindigkeit und Aktionsradius gelegt, um längere Suchflüge durchführen zu können.
Aufbau Mitteldecker freitragend, zwei Motoren, zwei Schwimmer, 3 Mann Besatzung.
Flügel zwei Kastenholme, Spruceflanschen, Sperrholzstege, Flügelbedeckung Bakelitsperrholz. Landeklappen zwischen Querruder und Rumpf. Flügel wasserdicht abgeschottet. Mittelstück des Flügels mit dem Rumpf fest verbunden. ϖ Rumpf dreiteilig, Vorderteil nichtrostender Stahl, Schalenbau-
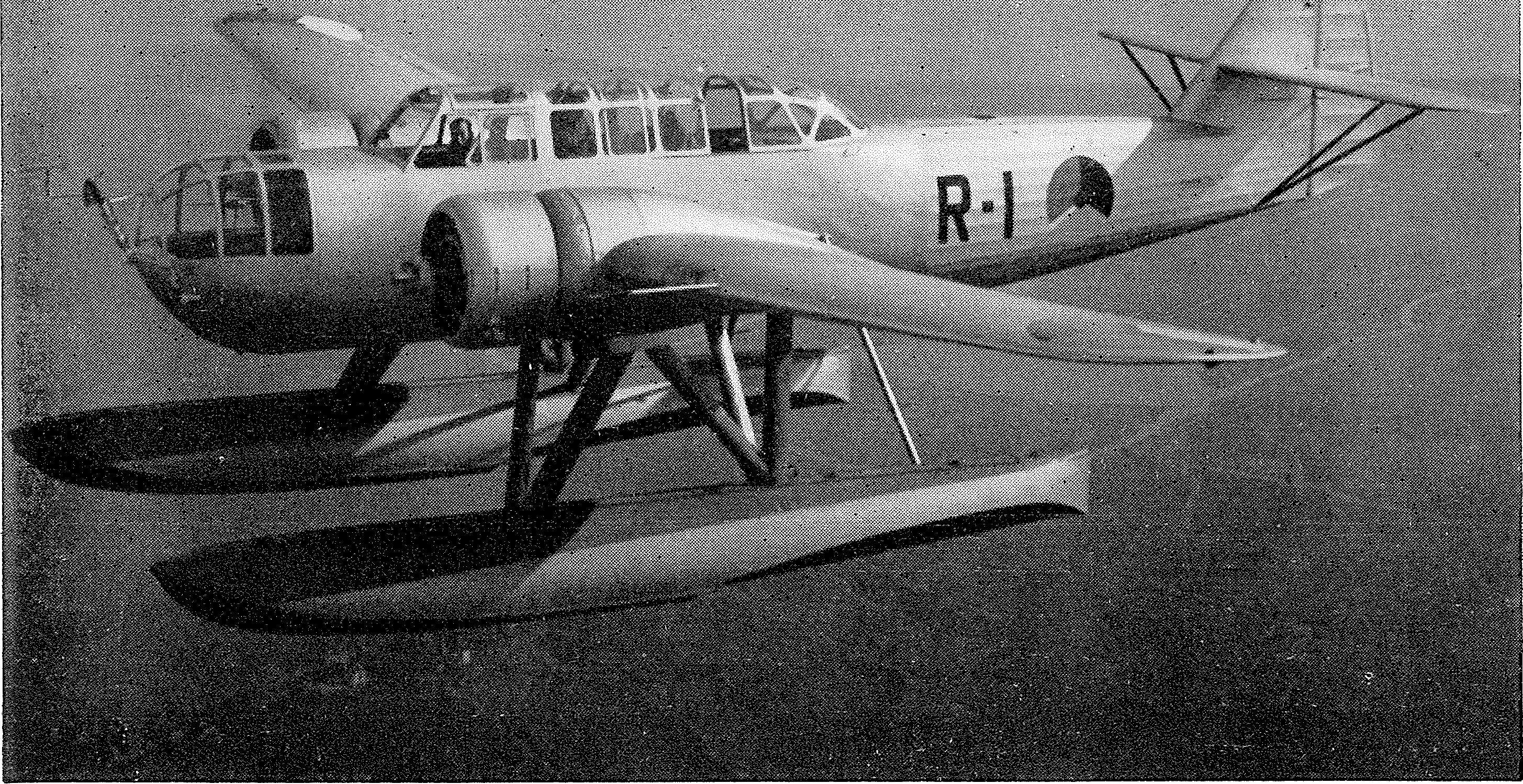
Fokker T. 8 - W. Torpedoflugzeug. Werkbüd
weise mit Versteifungsringen. Mittelstück Holzkonstruktion. Bei Ausführung des Flügels in Metallbau, Rumpf gleichfalls Metallbau. Hinteres Rumpfstück Duralumin. Oberer Teil der Rumpfnase mit Plexiglas verkleidet. Im Rumpfnasenboden Sichtfenster und Oeffnungen für den Einbau von Geräten. Ferner in der Mitte aufgehängtes Instrumentenbrett, Bomben und Torpedo, Ziel- und Auslöseeinrichtung, klappbarer Navigationstisch. Führersitz in der linken Rumpfseite an der Vorderkante des Flügels. Rechts im Rumpf Laufgang zwischen Rumpfnase und Hinterteil Rumpf. Führersitz in der Höhe verstellbar. Abzug für das feste MG. am linken Knüppelhandgriff. Führersitzverkleidung Plexiglas, abwerfbar.
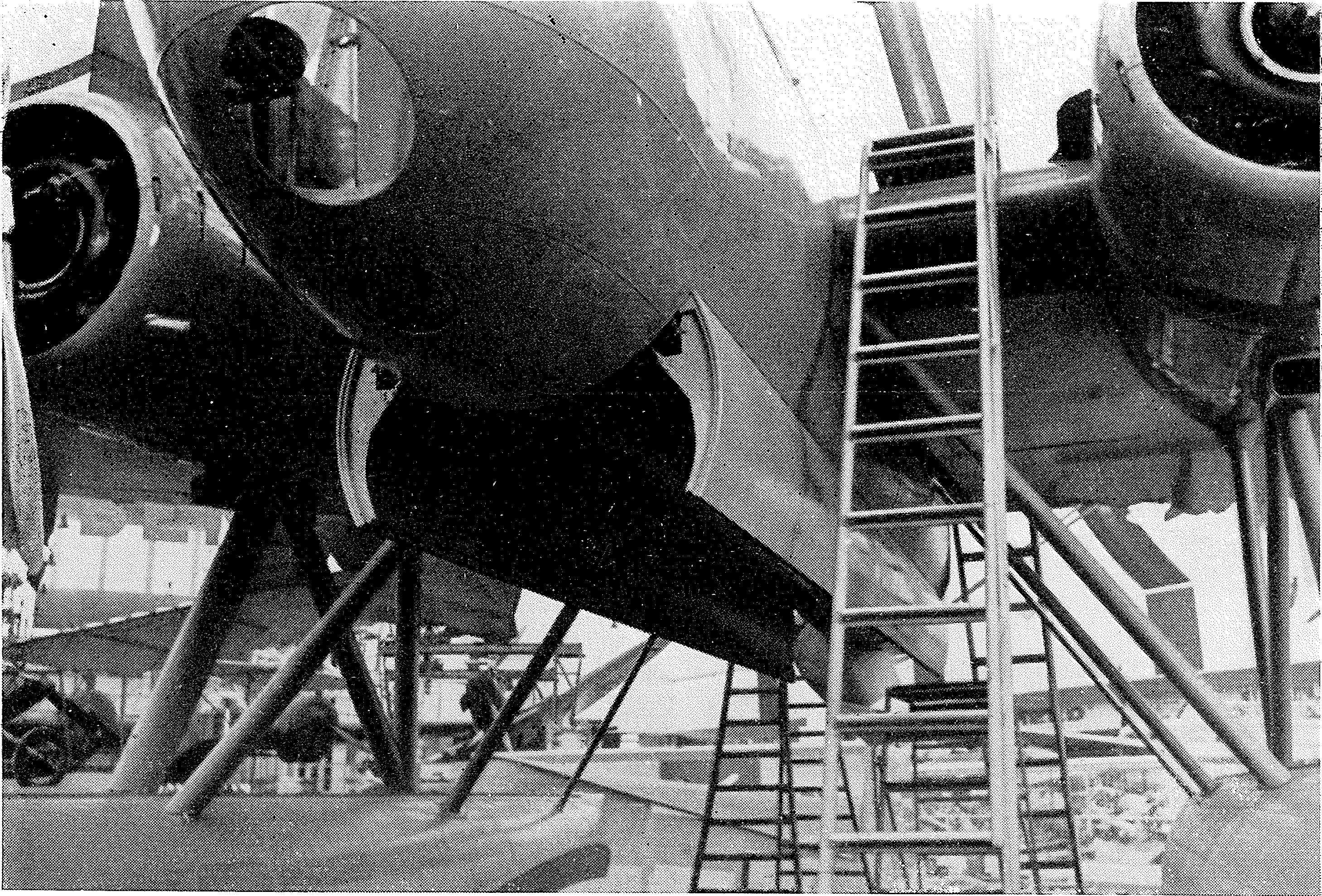
Vom Brüsseler Salon. Fokker T.W. - 8, Torpedoraum im Rumpf, Klappen geöffnet.
Bild: Flugsport
Hinter dem Führer zwischen den Flügelholmen Sitz für den Funker und hinteren MG.-Schützen. Hinter dem Funkerraum MG.-Lagerung mit Schiebefenster. Weiter nach hinten im Rumpf Raum für Verstauung von Marine-Ausrüstung, ferner wasserdichter Raum für Ankergerät.
Querruder Stahlrohr, statisch und aerodynamisch ausgeglichen. Ausschlag nach oben größer als nach unten. Landespreizklappen Duralumin, in drei Stellungen feststellbar.
Höhenleitwerksflosse zweiteilig, Duralumin, nach dem Rumpf verstrebt und nach der Seitenflosse durch Stromliniendrähte verspannt. Höhen- und Seitenruder Stahlrohr, mit Leinwand bedeckt, ausgeglichen. An der Hinterkante Trimmklappen.
Zwei Schwimmer, nichtrostende Bauweise, je sechs Schotten. Jeder Schwimmer ist zwischen Motoren und Rumpf für sich verstrebt, so daß der Raum für die Aufhängung des Torpedos frei bleibt.
Das Torpedo ist im Innern des Rumpfes verschlossen durch zwei parallel zur Längsachse des Rumpfes sich öffnende Klappen untergebracht. Vergleiche die Abbildung.
Sternmotoren von 400—750 PS.
Betriebsstoffbehälter zwischen den Flügelholmen, können bis zu 1200 1 untergebracht werden. Oelbehälter hinter dem Brandschott der Motoren.
Bewaffnung festes MG. 7,9 mm in der Rumpfnase, ein bewegliches MG. 7,9 mm hinter dem Funkerraum.
Spannweite 20 m, Länge 15,2 m, Höhe 5,4 m, Fläche 52 m2, Leergewicht 4525 kg, Nutzlast 2075 kg, Fluggewicht 6600 kg, Flügelbelastung 127 kg/m2, Leistungsbelastung 3,7 kg/PS. Max. Geschw. 358 km/h, mittlere Geschw. 267 km/h. Steigzeit auf 1000 m in 2,4 Min., auf 2000 m in 4,8 Min., auf 3000 m in 7,8 Min., auf 4000 m in 11,5 Min., auf 5000 m in 16,5 Min. Gipfelhöhe absolut 7200 m, praktische 6800 m. Absolute Gipfelhöhe mit einem Motor 1600 m. Aktionsradius 1700 km.
Douglas DC 5, Verkehrsflugzeug.
Den DC—5, Verkehrsflugzeug für 16 Fluggäste, welcher Anfang 1939 die Versuchsflüge erledigen sollte, haben wir im Flugsport 1939 Nr. 3, Seite 66 und 67, beschrieben.
Wie die nebenstehenden Abbildungen erkennen lassen, ist das vordere Stoßrad des Dreibeinfahrwerks nach hinten hochziehbar,
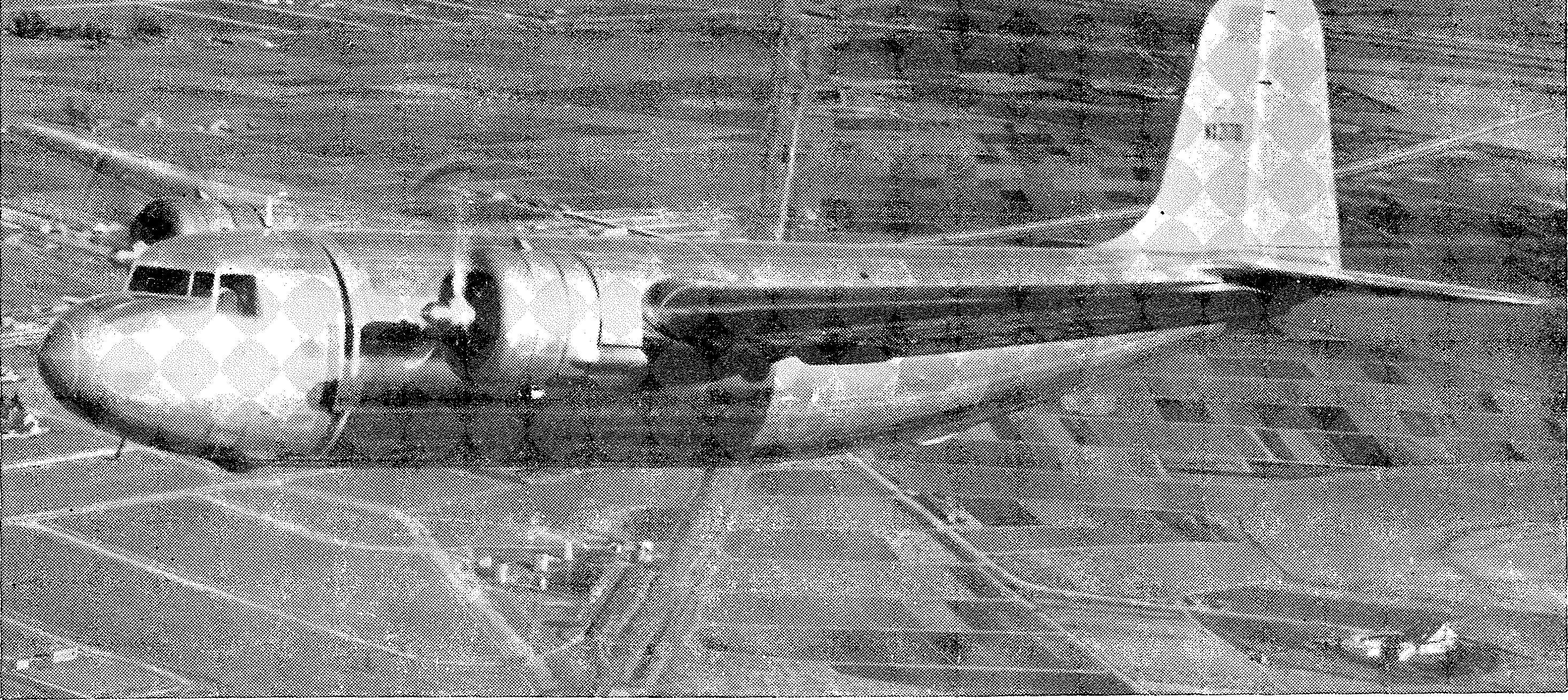
Douglas DC-5. Verkehrshochdecker.
Werkbild
Douglas DC-5 Landeklappenlagerung. Ueber der Lagerung erkennt man den hydraulischen Zylinder für die Betätigung.

4; r-0/p
* ϖ
IHHHHHi
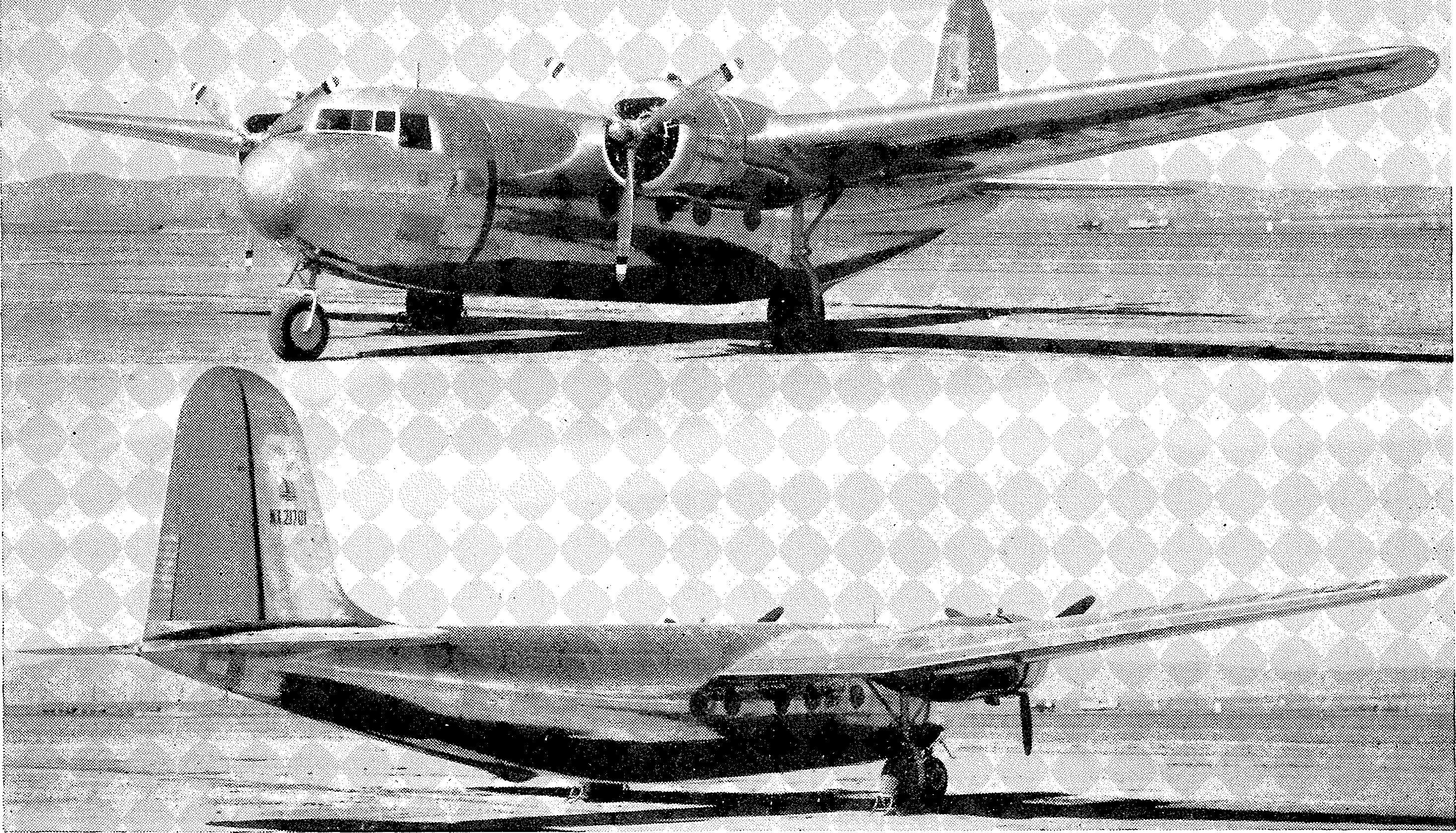
Douglas DC-5. Verkehrshochdecker. Werkbilder
während die Federbeine des Fahrwerkes seitlich nach außen in die Ansatzflügel hochgezogen werden. Der hintere Teil der Rumpfunterseite ist für etwaige Schwanzlandungen kufenartig bewehrt.
Die Bullaugen der Passagierkabine sind am Rumpf weit nach unten gerückt, um eine fast senkrechte Sicht nach dem Boden zu erhalten.
Zu den früher angegebenen Leistungen mit Cyclone Hörnet Motor bringen wir nachstehend die mit Pratt & Whitney Twin Wasp 1830 — SIC 3-G. Betriebsstoff Oktan 95, Großgewicht wird auch für frühere Motoren mit 8800 kg angegeben. Nutzlast beim Pratt & Whitney 2660 kg, Maximal-Geschwindigkeit 390 km/h, Geschwindigkeit mit 50% Motorleistung 300 km/h, mit 65% 337 km/h, mit 75% 358 km/h. Steiggeschwindigkeit 540 m/min. Gipfelhöhe 8400 m. Gipfelhöhe mit einem Motor 4500 m. Startlänge ohne Klappen 235 m.
Funkgerät für Segelflugzeuge.
Bei den Vorbereitungen für die in diesem Frühjahr durchgeführte deutsch-italienische Segelflugexpedition nach Libyen, die den Zweck hatte, die vertikalen Luftbewegungen über geologisch-einheitlichem, starker Sonneneinstrahlung ausgesetztem Gelände zu erforschen, ergab sich die Notwendigkeit, die Segelflugzeuge mit einem neuen Funkgerät großer Reichweite einzurichten. Auf Grund eines früher entwickelten und mit Erfolg eingesetzten Kleinfunkgeräts wurde die Flug-
technische Fachgruppe Stuttgart von der DVL. beauftragt, ein für die Expedition geeignetes Funkgerät zu entwickeln, da ein derartiges Gerät bis jetzt noch nicht vorhanden war.
Die Forderungen, die an das Gerät gestellt wurden, waren möglichst kleines Gewicht bei geringsten Ausmaßen, unbedingte Betriebssicherheit, Verwendbarkeit für Telegraphie und Telephonie, Anpassung an jede Antenne, einfachste Bedienung durch den Piloten. Außerdem mußte das Gerät staubdicht sein. Die von der Expeditionsleitung gewünschten Mindestreichweiten waren: im Flug 20 km Sprechverkehr, 100 km Telegraphieverkehr, bei gelandetem Flugzeug 25 km Telegraphieverkehr. Außerdem mußte das Gerät in den verschiedensten Segelflugzeugtypen gut zugänglich und gut bedienbar unterzubringen sein.
Das Gerät hat die Typenbezeichnung FES 3 und enthält einen dreistufigen Empfänger, einen einstufigen Sender, der durch einen Varioquarz gesteuert wird, und ein Antennenanpassungsglied. Der Sender gibt eine Hochfrequenzleistung von ca. 5 Watt ab. Weiter ist ein Zerhacker mit Gleichrichter eingebaut, der die Anodenspannung für den Senderteil liefert. Gespeist wird der Zerhacker von einem 6-Volt-Bordakkumulator, der auch der Heizung der Röhren dient. Der Empfänger erhält seine Anodenspannung aus einer Zwerganodenbatterie von 90 Volt, da die bei Mitvervvendung des Zerhackens nötigen Siebmittel schwerer würden, als die Zwerganodenbatterie. Moduliert wird der Sender über einen einstufigen ModulationsVerstärker. Sämtliche Röhren des Flugzeuggerätes sind Stahlröhren. Dadurch wurde Erschütterungsunempfindlichkeit bei geringem Raumbedarf erreicht. Das Gerät wiegt 4,5 kg. Die Ausmaße des Gerätes sind 17X17X22 cm. Stromquellen, Kopfhörer, Antennen und Taste wiegen zusammen etwa 5,6 kg.
Durch diese Formgebung war es möglich, das Gerät in dem einzigen Raum unterzubringen, der fast bei allen Segelflugzeugen nicht voll ausgenützt ist und vom Piloten bequem erreicht werden kann, nämlich vor dem Sitz unter den Knieen. Ist auch dort kein Platz vorhanden, so kann das Gerät im Rumpf aufgehängt und über biegsame Wellen bedient werden.
Die Antenne des Gerätes weicht von den bisher üblichen Antennenformen ab. Statt Schleppantenne oder sonstigen Außenantennen wurde eine neue Antennenform mit günstigen Strahlungseigenschaften,
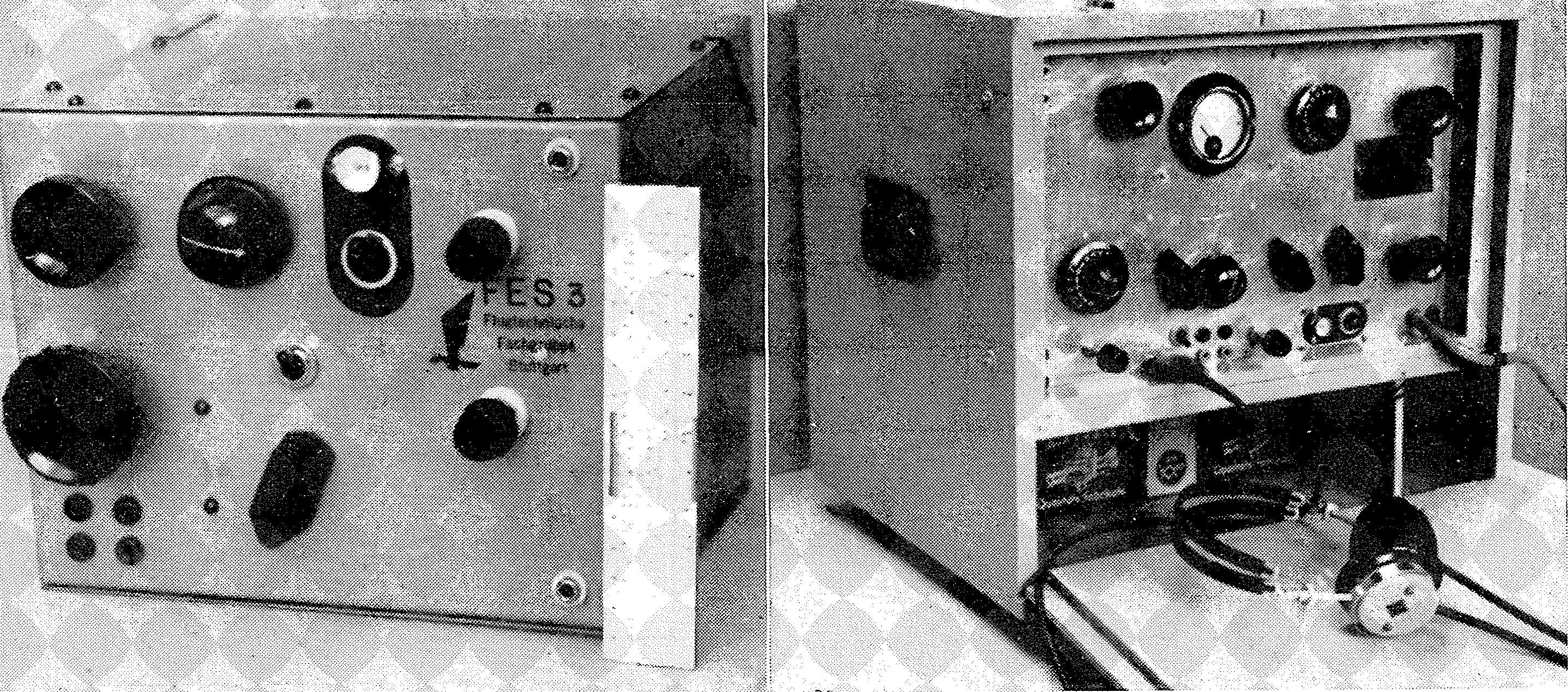
Links: Flugzeuggerät FES 3. Der angelehnte Taschenrechenschieber gibt einen Größenvergleich. Bedient werden nur die beiden Drehknöpfe auf der linken Seite des Geräts. Rechts: Bodenfunkstation AES 3. Sie hat die Ausmaße 42X36X31 cm.
Werkbilder
vor allem geringer Richtwirkung, entwickelt. Die Antenne ist vollkommen in Flächen und Rumpf eingebaut. Die aerodynamische Form wird deshalb nicht gestört.
Bei der Erprobung waren die sicheren Reichweiten des Gerätes wesentlich größer, als von der Expeditionsleitung verlangt. Im Flug wurden auf ca. 50 km Sprechverkehr, 200 km Telegraphieverkehr erreicht. Bei gelandetem Flugzeug etwa 20 km Sprechverkehr, 120 km Telegraphieverkehr. Die bisher größte überbrückte Entfernung betrug sogar 550 km bei gelandetem Flugzeug. Das Gerät kann auch zum Verkehr von Flugzeug zu Flugzeug verwendet werden, z. B. bei Kettenflügen.
Gleichzeitig mit diesem Flugzeuggerät wurde noch ein zweites gebaut, nämlich eine größere Bodenfunkstation, die dem Verkehr mit den Flugzeugen dient. Diese Station kann im Kraftwagen eingebaut werden, und ist, wie das Flugzeugfunkgerät, aus 6-Volt-Akkumulatoren gespeist, also völlig netzunabhängig. Auch im Motorflugzeug kann dieses Bodengerät ohne Schwierigkeiten eingebaut werden und dort zum Beispiel als Leitsender für die Segelflugzeuge Verwendung finden.
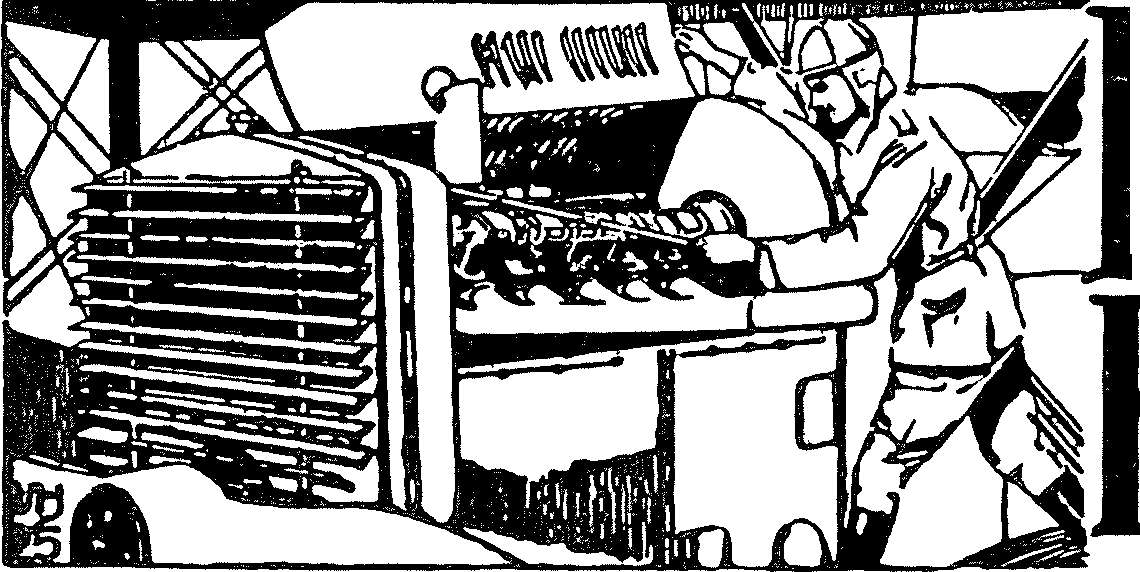
KONSTRUKTION INZHiHHTEH
Lockheed Flügelslots
beim Muster Lockheed 14 gewährleisten bei voll ausgeschlagenen Querrudern im normalen Anstellwinkelbereich volle Steuerbarkeit. Bemerkenswert ist, daß durch diese Anordnung keine zusätzliche Widerstandserhöhung auftritt. Ein Ausführungsbeispiel zeigt Abb. 1 und 2.
Bei a hat die Strömung noch hohe Geschwindigkeit, die bei b schon verringert ist; durch c strömt Luft höherer Geschwindigkeit (Düsenwirkung), die sich mit der Außenströmung mischt, so daß bei .^^Zlir^^ d höhere Strömungs-
*------tr
geschwindigkeit herrscht. Diese Geschwindigkeits-zunahme bleibt bis e wirksam; die Grenzschichtablösung bei großen Ruderausschlägen wird vermieden. (Aero Digest, Band 34, Nr. 5/ 1939.)
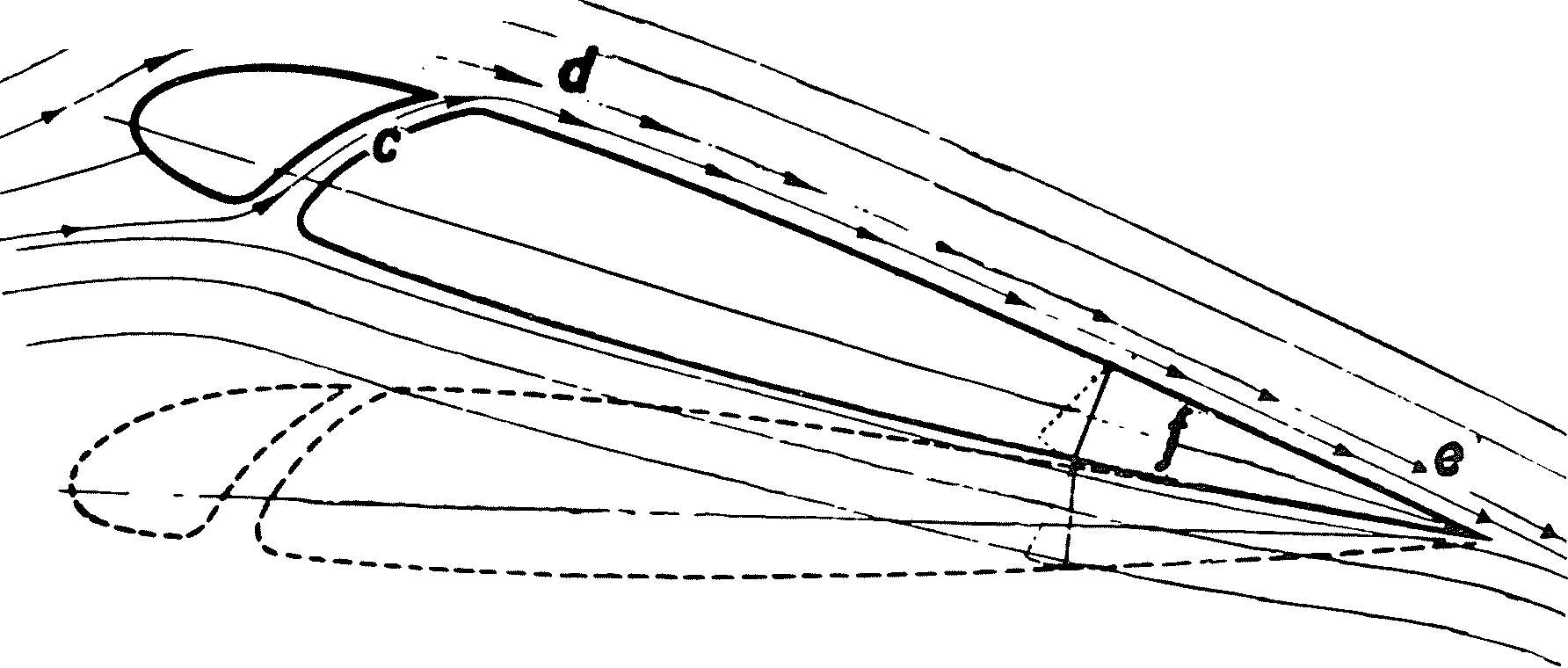
Abb. 1. Strömungschema Lockheed Flügelslot. Abb. 2. Lockheed Flügelslot.

—FLUG"
UMDSCHAl
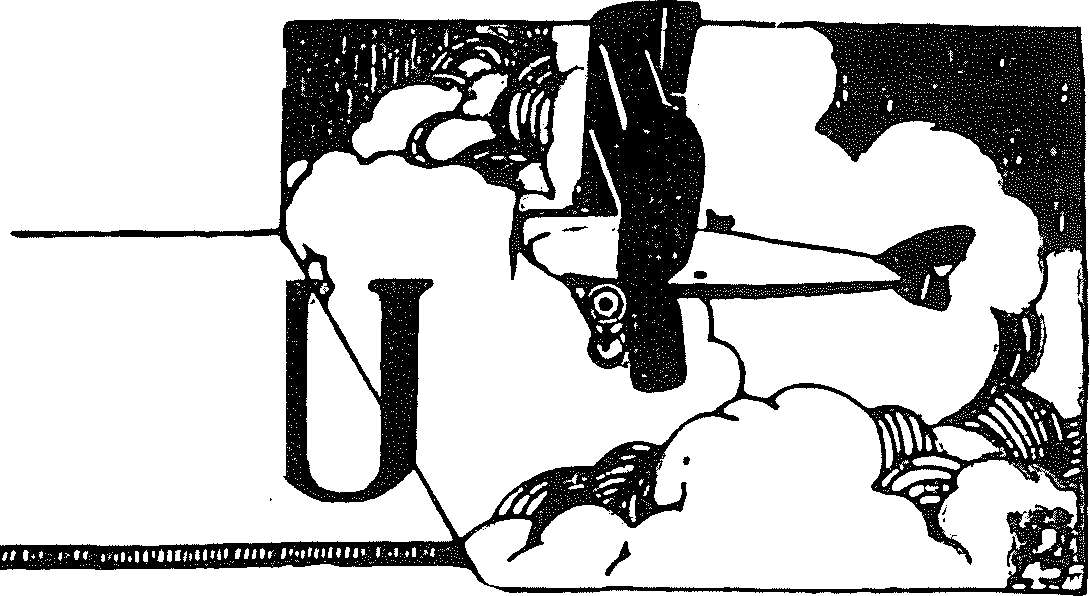
Inland.
Der Führer und Oberste Befehlshaber besichtigte am 3, 7. in Gegenwart des Oberbefehlshabers der Luftwaffe, Qeneralfeldmarschall Göring, die Erprobungsstelle der Luftwaffe Rechlin. Der Generalluftzeugmeister der Luftwaffe, Generalleutnant Udet, unterrichtete den Führer über den neuesten Entwicklungsund Erprobungsstand der deutschen Luftwaffentechnik. Zahlreiche neueste Flugzeuge wurden am Boden vorgeführt und zeigten ebenso in der Luft Spitzenleistungen an Schnelligkeit, technischer Leistungsfähigkeit und fliegerischem Schneid ihrer Besatzungen.
Der Führer gab wiederholt seiner höchsten Bewunderung und Anerkennung über den hohen Leistungsstand der deutschen Flugzeugtechnik und das fliegerische Können der deutschen Luftwaffe Ausdruck.
An der Besichtigung nahmen ferner u. a. teil der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generaloberst Keitel, der Staatssekretär der Luftfahrt und Generalinspekteur der Luftwaffe, Generaloberst Milch, General der Flakartillerie Rudel, der Chef der Luftwehr, General der Flieger Stumpft, der Chef des Ausbildungswesens der Luftwaffe, General der Flieger Kühl, der Chef des Ministeramtes im Reichsluftfahrtministerium, Generalmajor Bodenschatz, der Chef des Generalstabes der Luftwaffe, Oberst Jeschonek, sowie von der Begleitung des Führers u. a. Reichsleiter Bormann und die persönlichen und militärischen Adjutanten des Führers.
Am 8. Juli sah man von allen Seiten Flugzeuge der verschiedensten Typen dem Wyker Flugplatz zustreben. Am Traditionsflugtag des Korpsführers des NS.-Fliegerkorps, des Generals der Flieger, Christiansen, an dem Luftwaffe und NS.-Fliegerkorps mitwirkten, war wieder alles da. Bis zum Abend des 8. Juli hatten sich 133 Flugzeuge in Wyk a. Föhr eingefunden, vom kleinsten Sportflugzeug mit 45 PS bis zu den großen mehrmotorigen Maschinen der Luftwaffe. Am Abend fand im Kurhaus ein Begrüßungsabend statt, auf dem der Korpsführer des NS.-Fliegerkorps die Teilnehmer und Gäste willkommen hieß, unter diesen besonders den General der Flieger und Chef der Luftflotte 1 Kesselring und den Gauleiter von Schleswig-Holstein, Pg. Lohse, der erstmalig diesem Traditionsflugtag beiwohnte, General Ritter von Greim, den Inspekteur des NS.-Fliegerkorps, Gruppenführer v. Bülow, sowie die Gruppenführer.
Zwar wehte am Sonntag ein kräftiger Wind, aber Regen blieb glücklicherweise aus, und so konnte unter stärkster Beteiligung des von nah und fern herbeigeeilten Publikums der Flugtag mit einem Raketenschuß eröffnet werden. Sofort brausen die Ketten von drei Flugzeugführerschulen des NS.-Fliegerkorps über den Platz, und von nun ab rollt das Programm in ununterbrochener Folge ab. Emil Kropf, der nun auf seinem Focke-Wulff „Stößer" startet, hält sich genau an die Worte des Korpsführers vom Vorabend, nach denen die Flieger einmal ganz
7. Traditionsflugtag in Wyk auf Föhr.
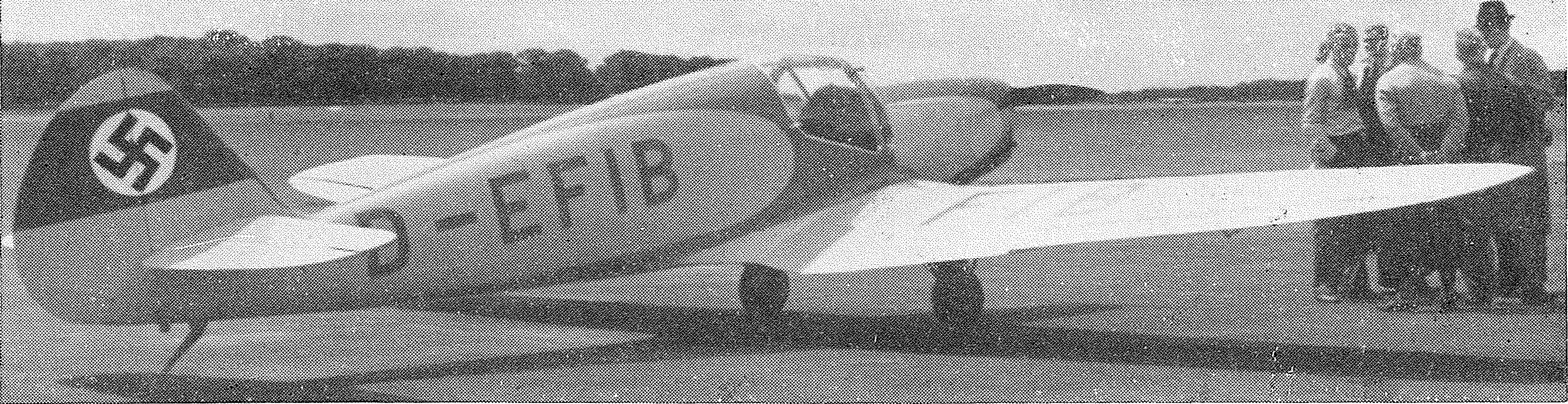
„Stromer" Tiefdecker, Knickflügel, zwei Sitze nebeneinander, Motor Zündapp.
Werkbild
Vom 7. tradition. Flugtag
Wyk auf Föhr. Der deutsche Meister im Geschicklichkeitsflug, Oberfeldwebel Falderbaum.
nach Herzenlust fliegen sollten. Mit einem Einradstart leitet NSFK.-Sturm-führer Kropf seine „Kindlichen Spiele im Freien", wie er selbst es nennt, ein, um dann mit einem vielseitigen Kunstflugprogramm die Zuschauer abwechselnd in Staunen und Begeisterung zu versetzen. Unterdessen ist schon der NSFK.-Hauptsturmführer Bräutigam mit seinem „Habicht", dem kunstflugtauglichen Segelflugzeug, im Schlepp eines Motorflugzeuges aufgestiegen. Kaum ist Kropf gelandet, da klinkt Bräutigam in Wolkenhöhe aus, und nun zeigt er mit seinem „Habicht", daß ein Segelflieger von Format auch ohne Motor die ganze hohe Schule des Kunstfluges vorführen kann. Mit eleganten Loopings, Turns und Rollen bis in Bodennähe erobert sich Hauptsturmführer Bräutigam die Herzen der Zuschauer, die ihn bei seiner Landung mit herzlichem Beifall begrüßen.
Jetzt steigt Generalmajor Ritter v. Greim auf mit einem Sturzkampfflugzeug. Die ungeheure Steigfähigkeit dieses Flugzeugtyps wird auch denjenigen unter den Zuschauern deutlich, die nichts von Fliegerei verstehen. In wenigen Minuten hat das Flugzeug die Wolken erreicht, völlig ist es den Blicken der Zuschauer entzogen, plötzlich stürzt es sich wie ein Raubvogel herab, wird kurz über dem Boden abgefangen und jagt wieder dem Himmel entgegen. Wie eine weitende Hornisse umbraust es die Zuschauer, um schließlich ruhig und sicher auf dem Rollfeld aufzusetzen. Schon sehen wir die neuesten Typen der kleinen Sportflugzeuge starten. Wie die schnellen Nordseemöwen umkreisen sie den Flugplatz, die Siebel „Hummel", Bücker „Student", Zlin „Go 150" und Möllers „Stromer". Und schon eine neue Sensation, der deutsche Meister im Kunstflug, Oberfeldwebel Falderbaum, braust mit seinem „Bücker Jungmeister" himmelwärts. Dieser junge Feldwebel flog seine Figuren mit einer derartigen Exaktheit und solchem Elan, daß sowohl Laien wie auch die Leute vom Fach rückhaltlos begeistert waren. Gleich nach seiner Landung starteten 9 Flugzeuge zum Luftrennen, das über den Dreieckkurs Niblum—Ziegelei Boldixum—Flugplatz geht. Der Kurs ist dreimal zu umfliegen, die Flugzeuge erhalten je nach Type Vorgaben. Sieger wird die Flugzeugführerschule Bielefeld auf Bücker „Jungmann". Und nun erheben sich „2 Störche", geführt vom Konstrukteur NSFK.-Standarten-führer Fieseier selbst und dem Chefingenieur des Reichsluftfahrtministeriums Lucht. Was diese beiden Flugzeuge in der Luft vorführten, sprach allem Fluggefühl Hohn. Stillstehen in der Luft, durchsacken bis zum Boden, dann steil hochgehen und stillstehen, seitwärts, ja bei dem Wind auch rückwärtsfliegen. Man kam aus dem Staunen gar nicht heraus. Zu schnell für alle erfolgte der Start zum Abschiedsflug, eine „Ago Kurier", eine Heinkel „He 70", eine „Me 108", „Go 150", „Arado 79" und „Klemm 32" brausten vorüber, dann löst sich ein Raketenschuß und 5 Hakenkreuzfahnen flattern an Fallschirmen zur Erde und künden, daß der 7. Traditionsflugtag in Wyk auf Föhr beendet ist.
2. Internat. Luftrennen, Deutsche Meisterschaft im Geschicklichkeitsflug 28.—30. 7. 1939 und Großflugtag 30. 7. 1939, Frankfurt a. M.
Die NSFK.-Gruppe 11 (Hessen-Westmark) veranstaltet in Frankfurt a. M. 28.—30. Juli auf dem Flughafen Rebstock wieder ein Luftrennen, Austrag der Deutschen Meisterschaft im Geschicklichkeitsflug mit anschließendem Flugtag, zu dem diesmal auch die deutschen Vorkriegsflieger, die „Alten Adler", eingeladen sind. Schirmherr Reichsstatthalter und Gauleiter Sprenger. Der Korpsführer des
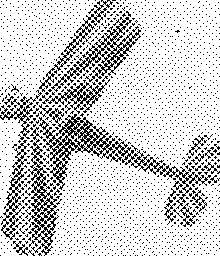
NSFK., General der Flieger Christiansen, wird, wie auch das letzte Mal, an der Veranstaltung teilnehmen.
28. 7. Eintreffen der Teilnehmer des 2. Internat. Luftrennens und der Wettbewerber um die Meisterschaft im Geschicklichkeitsflug 1939 auf dem Flughafen Frankfurt a. M.-Rebstock.
28. u. 29. 7. Ausscheidung um die Deutsche Meisterschaft im Geschicklichkeitsflug auf dem Flughafen Darmstadt. Vorfliegen des Pflichtprogramms und Ermitteln der sechs besten Bewerber.
30. 7., vormittags 10 h. 1. Vorgabe-Rennen (Rennen b). 13.30 h Start der ersten 3 Bewerber um die Meisterschaft im Geschicklichkeitsflug. Anschließend Vorführungen der Luftfahrt-Industrie. Nachmittags 15 h „Graf Zeppeline-Vorführung, Formationsschlepp von 9 Segelflugzeugen, Entscheidung der letzten 3 Bewerber um die Deutsche Meisterschaft im Geschicklichkeitsflug, Altmeister Grade startet mit seinem Eindecker, 2. Vorgabe-Rennen (Rennen a),Vorführungen der Luftwaffe, Start des Deutschen Meisters im Geschicklichkeitsflug 1939.
Westdeutscher Rundflug 23.—25. 6. 39. Streckenführung: Konstanz-Friedrichshafen — Karlsruhe —Worms — Traben-Trarbach — Koblenz —Wasserkuppe— Gotha—Kassel—Bremen—Münster—Geseke—Köln. 1. NSFK.-Gruppenführer Zahn mit NSFK.-Sturmführer Winter auf Klemm Kl 35 b mit HM 504, 406 Punkte; 2. NSFK.-Truppführer Willberg mit NSFK.-Mann Herrmann (NSFK.-Stand. 75 Frankfurt a. M.) auf Klemm Kl 35 b mit HM 504, 384 Pkt.; 3. NSFK.-Gruppenführer v. Bülow, Inspekteur d. NSFK., mit NSFK.-San.-Brigadeführer Lottig auf Focke-Wulf „Stieglitz" mit Sh 14 A, 374 Pkt.
8048 m Höhe auf Go 150 Kleinflugzeug mit 2 Zünd.-Motoren je 50 PS erreichte am 5. 7. 1939 Dr. Platz auf dem Flugplatz Gotha. Der bisherige internationale Höhenrekord für Leichtlandflugzeuge Klasse C, 3. Kategorie (2—4 Zyl. Inhalt), der von Mai. K. Brazda, Brünn, mit 7470 m auf Tatra 101 mit HM 504 aufgestellt worden war, wurde hiermit um 580 m überboten.
Start 7.30 h, Aufstieg dauerte 1 h 28 min, wobei bis 7000 m nur 45 min, für die restlichen 1048 m jedoch 39 min notwendig waren. Typenbeschr. der Go 150, Konstrukteur Kalkert, siehe „Flugsport" 1938 S. 426 u. 636.
„Stromer" zweisitziges Reise- und Schulflugzeug, Konstrukteur Ing. H.-G. Möller, Hamburg, wurde auf dem Flugtag Wyk a. F. am 9. 7. vorgeführt. Sitze liegen bei dieser Maschine nebeneinander. Neuartig ist die Fahrwerksanordnung. Max Münk, Direktor Beru-Werk, Ludwigsburg, bestellt. Adolf R. Rohrbach t» Dr.-Ing. h. c, 51 Jahre alt, plötzlich gestorben. Rohrbach, geboren 1889 in Gotha, widmete sich schon frühzeitig dem Flugzeugbau. Den Lesern dieser Zeitschrift sind seine erfolgreichen Rohrbach-Typen, mit denen u. a. 1924 14 Welthöchstleistungen aufgestellt wurden, noch in Erinnerung.
Der deutsche Flugzeugbau, insbesondere die Weser-Flug-jjj zeugbau-Gesellschaft, wo er mit wichtigen Aufgaben be-' traut war, verliert mit ihm einen seiner besten Konstrukteure.
9125 m Höhe auf Messerschmitt „Taifun" Me 108 \ I mit Hirth 8-Zyl.-Kompressor-Motor HM 508 C, 270 PS, er-\ reichte Illg auf dem Flugplatz Böblingen bei Stuttgart. ;.j Die bisherige im Ausland aufgestellte Höchstleistung im Höhenflug für Leichtflugzeuge der Klasse C, Kategorie 1, ix 1 wurde hierdurch um 1200 m überboten.

Adolf R. Rohrbach t.
Go 150 erreichte 8048 m Höhe am 5. 7. 39.
Was gibt es sonst Neues?
Lilienthal-Ges. Hauptversammlung 11.—13. 10. Wien. Teilnehmer-Anmelde-schluß 15. 9.
Maison des Ailes, Klubhaus für Flieger, am 30. 6. in Brüssel eröffnet. BMW 650 PS Schwerölmotor, wie „Les Ailes" berichtet, im Bau. Flughafen Birmingham 8. 7. eröffnet.
Ausland.
Engl. Willoughby Delta „F" Nurflügelflugzeug mit seinem Konstrukteur tödlich abgestürzt. Zwei Menasco C-4-Motoren von 250 PS, Spannweite 10,3 m, Gewicht leer 720 kg, belastet 1050 kg. Geschwindigkeit 220 km.
Alexandria — Karachi-Fluglinie soll, statt der bisher verwendeten Landmaschinen, mit drei neuen Flugbooten mit Perseus - Schiebermotoren versehen werden.
International Air Congress in Stratford-on-Avon 8.—13. 7. 1940, organisiert von Royal Aeronautical Society. Anfragen an Organising Secretary, International Air Congress 1940, 4, Hamilton Place, London, W. I.
Engl. Hercules 14 Zyl. wird von französ. Motorenkonzern Societe Industrielle Generale de Moteurs d'Aviation in Lizenz gebaut.
Henry-Farman-Denkmal in Mourmelom-le-Grand errichtet.
„Lieutenant de Vaisseau Paris" Großflugboot, Baujahr 1928, flog im Ohne-haltflug 5850 km in 28 h 28 min, Start Port Washington (New York) 14. 7., 9.49 h, Wasserung Flughafen Biscarosse, südlich von Arcachon, 15. 7., 14.17 h. Startgewicht 42 t, Betriebsstoff 25 000 1, Betriebsstoffverbrauch 24 450 1. 6 Hispano-Suiza-Motoren 920 PS. Durchschnittsgeschw. 205 km/h. Eine beachtliche Leistung.
Lory Vierreihen-Sternmotor, 24 Zyl., 1600 PS, bei der Societe Nationale de Constructions de Moteurs im Bau. N = 3000, Sterndurchmesser 1 m. Eine Kurbelwelle.
Belg. Militärfliegertreffen anläßlich des 25jährigen Bestehens der belgischen Luftwaffe fand 9. 7. auf dem Flugplatz Evere statt. Anwesend waren der belgische König, der belgische Verteidigungsminister Generalltn. Denis, der deutsche Botschafter v. Bülow-Schwandte, Staatssekretär der Luftfahrt und Generalinspekteur der Luftwaffe, Generaloberst Milch, der franz. Luftwaffenchef und der britische Luftmarschall.
Die deutsche Kunstflugstaffel, Kommandeur Hptm. Trübenbach, auf 9 Bücker „Jungmeister", zeigte Flugfiguren von größter Präzision. Von der belgischen Luftwaffe wurden verschiedene Kampf- und Bombenflugzeuge in Geschwaderflügen vorgeführt. Die Franzosen zeigten Patrouillenflüge mit Jagd- und Bombenflugzeugen und die Engländer ihre schweren Vickers-Wellington-Bomber.
Der deutsche Teilnehmer Hptm. Wille geriet während einer Rolle über den linken Flügel und mußte außerhalb des Flugplatzes in steilem Gleitflug landen, wonach er schwerverletzt im Krankenhaus verstarb. Der belgische König verlieh Wille den Leopold-Orden, welchen Landesverteidigungsminister Generalltn. Denis, in Begleitung hoher Offiziere der belgischen Militärluftfahrt, dem toten Offizier anheftete.
Bemerkenswert ist, daß die deutsche Kunstflugstaffel trotz des Ausfalls von Hptm. Wille ihr Programm ohne Unterbrechung zu Ende flog.
Thomas Corpe, Verkaufs- und Propaganda-Organisation, früher bei General Motors, jetzt Lockheed Co.
„Condor" Aero Club de Planeadores, Astra (Chubut), Argentinien, hat in letzter Zeit seinen Präsidenten M. Ebert durch Brandunfall in seinem Hause verloren. Wir bewahren ihm ein ehrendes Angedenken. Aufgabe der Club-Mitglieder ist, unentwegt weiter zu bauen und zu fliegen.
Aero-Club Do Parana (Brasilien), gemäß Versammlungsbeschluß 8. 5. gewählt: Ehrenpräs. Plinoi Raulino De Oliveira, Präs. Euripides Garcez Do Nasci-mento, 1. Vizepräs. Salvador Roses Lizarralde, 2. Vizepräs. Rubens Pereira Munhoz, Instrukt. Dir. Henrique De Castro Neves, Vize-Instrukt. Dir. Tenente Itamar Rocha, Generalsekr. David Da Silva Muricy, 1. Sekr. Jose Zagonel Passos, 2. Sekr. Caio Flavio De Lemos, Schatzmeister 1. Jose Felix Maria Bianco, 2. Horacio Mancini, 3. Aluizio Finzetto. Technischer Beirat: Präs. Tenente Coronel Plinio Raulino De Oliveira, Vizepräs. Major Godofredo Vidal.
© Segelflug
Transvaal Pioneer Gliding Club, Johannesburg im Mai 7 Ueberlandflüge ausgeführt, darunter ein Hin- und Rückflug: 7. 5. Kunze auf Minimoa nach Lyden-burg 280 km in 6 K StdL, 3000 m H.; 7. 5. Harturg auf Wolf nach Geduld 42 km in 1>2 Std., 2000 m H.; 14. 5. Kunze auf Wolf nach Pretoria und zurück 130 km in 3^ Std., 2800 m. H.; 14. 5. Hakl auf Minimoa nach Halfway H. 32 km in 1 Std., 200 m. H.; 18. 5. Kunze auf Minimoa nach Potchefström 120 km in 43^ Std., 2500 m. H.; 28. 5. Winter auf Minimoa nach Ventersdorp 120 km in A% Std., 2500 m. H.; 28. 5. Michaelis auf Wolf nach Greenlands 70 km in 3^ Std., 2700 m H. Startplatz bei Alberton liegt 10 km südlich von Johannesburg, Startart Auto-
schlepp. Von den genannten Fliegern haben Kunze, v. Michaelis und Hakl das silberne, H. Winter das goldene C-Abzeichen.
Uebersichtsskizze Segelflüge in Südafrika—Johannesburg.
Zeichnung Flugsport
48 Y* Std. segelte Führinger, NSFK.-Truppführer (Gruppe 17 Wien), mit NSFK.-Scharführer Hof mann am 1. Juli. Start 12.42 h am Spitzerberg bei Wien. Man wollte 60 Std. in der Luft bleiben. Landung, durch Abflauen des Windes erzwungen, erfolgte am 3. Juli, 13.30 h. Die bisher größte Dauerflugleistung im Segeldoppelsitzer, 50 Std. 15 Min., wurde bekanntlich von NSFK.-Truppführer August Bödecker und NSFK.-Truppführer Karlheinz Zander auf Doppelsitzer „Kranich" vom 9. bis 11. 12. 38 in Rossitten vollbracht.
D 30 „Cirrus", Konstruktion der Flugtechnischen Fachgruppe (Akaflieg) an der Techn. Hochschule Darmstadt, konnte unter Führung von Flinsch auch in diesem Jahre einige beachtliche Flüge durchführen. So flog Flinsch am 9. 6. 39 die 406 km lange Strecke Hannover—Eichstätt (Bayern) in knapp 6 Std. Während des Zielstrecken-Segelflug-Wettbewerbes erreichte Flinsch am 21. 6. 39 von Mannheim aus in einem Gewitter eine Höhe von 3600 m NN (3150 m ü. Start). Mit diesem Flug erfüllte Flinsch die zweite Bedingung für das goldene Leistungs-abzeichen. Er erhielt das Abzeichen mit der Nr. 25.
341 km von Fürth LB. nach Gersdorf in der Mark segelte Unteroff. Phenn (Sil. Gr. d. Fliegern. Fürth i. B.) mit Begleiter am 30. 6. 39.
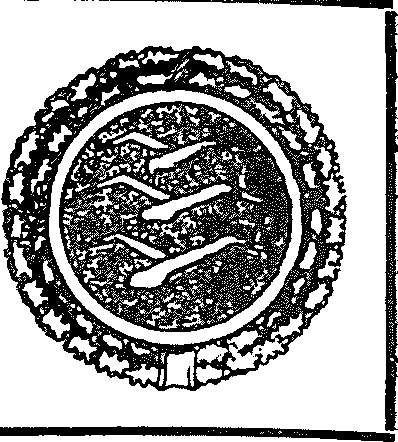
Grünau Baby IIa unterscheidet sich vom Typ II durch die größeren Querruder, ferner Führersitzdeckel abnehmbar. Die Bordinstrumente sind nicht am Deckel, sondern am Rumpf der Maschine befestigt. Beim Typ IIa bestehen sämtliche Steuerlager aus Preßstoffbüchsen. Werkbild
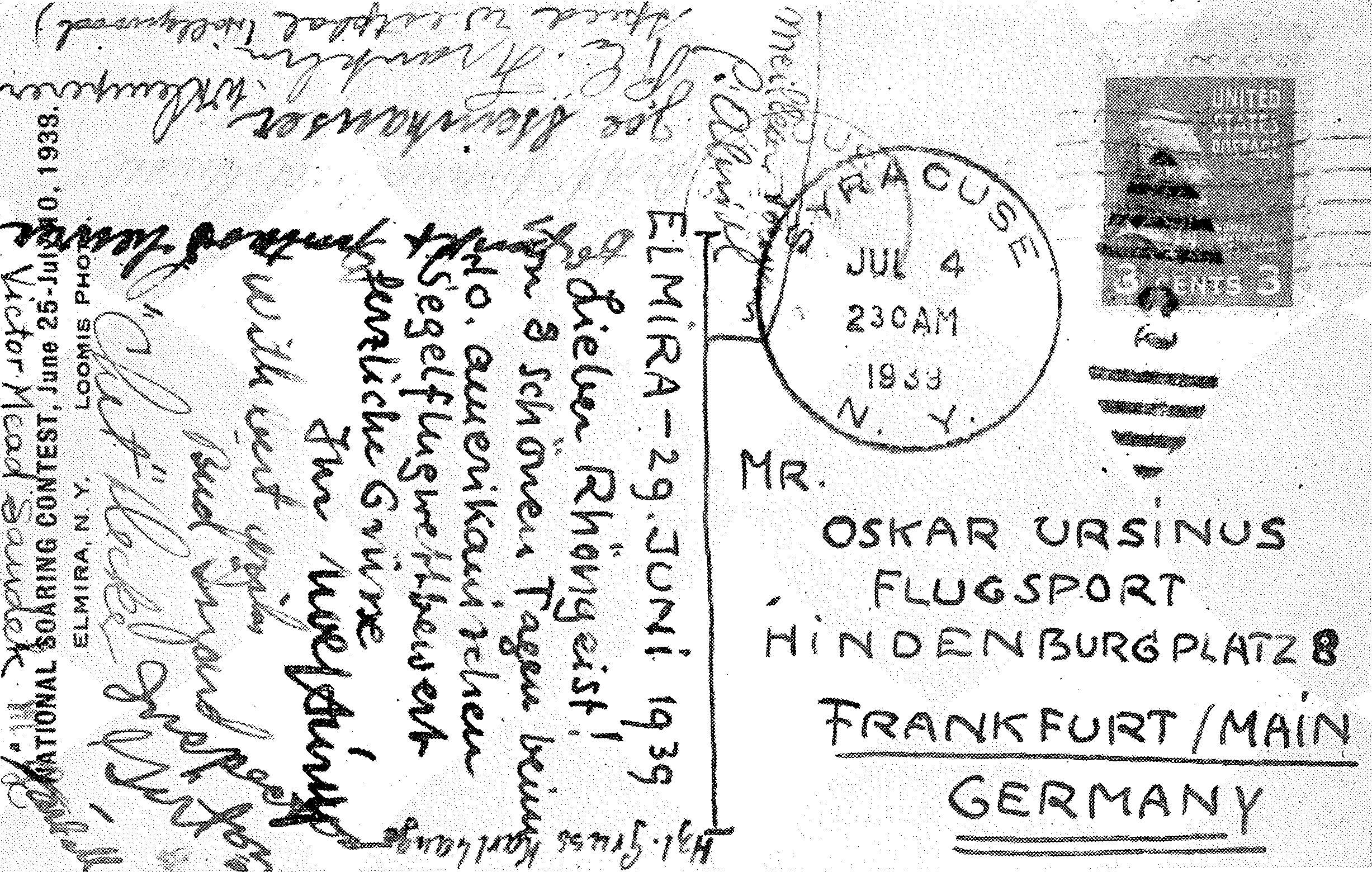
4325 m Höhe segelte Wills am 2. 7. in Dunstable auf Minimoa.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Horch — der Wind. Von Anne Morrow Lindbergh. Mit Vorwort u. Karten-zeichn. von Charles A. Lindbergh. 317 S. Orell Füssli Verlag, Zürich u. Leipzig. Preis brosch. RM 3.60, Leinen RM 4.70.
Oberst Lindbergh erhielt bekanntlich vor mehreren Jahren den Auftrag, einen Erkundungsflug rund um den nördlichen Atlantik zum Zwecke der Einrichtung von Fluglinien durchzuführen. Seine Frau, Anne Morrow Lindbergh, welche ihn als Hilfspilot und Bordfunker auf diesem 48 000-km-Flug begleitete, gibt eine lebendige bis in alle Einzelheiten gehende Schilderung. Das Buch wurde von Karl Eugen Brunner aus dem Amerikanischen übersetzt.
Eine Frau fliegt mit... Von Inge Stölting. Verlag Gerhard Stalling AG., Oldenburg i. 0.
Inge Stölting, als fliegende Berichterstatterin, mit Otto Brindlinger, als Flugzeugführer, und Horst von Salomon, als Expeditionsleiter, durchflogen 44 000 km auf Messerschmitt „Taifun" den amerikanischen Kontinent von Rio de Janeiro über den Aconcagua, Barranquilla bis New York. Diese Flugstrecke war nicht einfach. Hohe Gebirgszüge, große Urwald-, Wüsten- und Wasserstrecken waren zu überwinden. Die lebendige Schilderung mit den ausgezeichneten Bildern läßt den Leser den Flug miterleben.
Flugzeugberechnung, Bd. I u. II. Von Dr.-Ing. Rudolf Jaeschke. 2. Auflage mit 152 Abb. und 59 Zahlentafeln. Verlag R. Oldenbourg, München und Berlin. Preis RM 13.—.
Vorliegende Ausgabe umfaßt Band I und II in einem Band. Bd. I enthält Grundlagen der Strömungslehre und Flugmechanik, Bd. II Bearbeitung von Entwürfen und Unterlagen für den Festigkeitsnachweis. Behandelt sind Strömungslehre, Kräftegleichgewicht und Flugleistungsberechnung, Momentengleichgewicht und Stabilitätsberechnung, Flugzeugbauarten, Entwerfen von Flugzeugen, Belastungsannahmen. Interessant ist hier der Abschnitt Profilauswahl für viele Anfänger, die nach eingehendem Studium bald zu der Anschauung kommen, daß man nicht jedes günstig erscheinende Profil einfach verwenden kann. Beiden Bänden ist ein Sachverzeichnis angefügt. Dieses handliche Werkchen ist auch Anfängern zu empfehlen.
Aerodynamik und ihre praktische Anwendung am Flugzeug. Von Ing. Otto Leib, Unterrichtsl. u. techn. Lehrer a. d. Flugzeugführerschule (See) Warnemünde. 74 Abb., 154 S. Dr. M. Matthiesen & Co., Berlin SW 68. Preis RM 3.75.
In vorliegendem Werkchen ist alles Wissenswerte für den praktischen Unterricht über Aerodynamik, Flugmechanik, Motorenleistung, Luftschraube, Flugleistungsberechnung, Grundbelastungsfälle, Vereisung leicht verständlich zusammengefaßt.
Du und der Motor. Eine moderne Motorenkunde für jedermann. Von Edwin P. A. Heinze. Mit 170 Zeichn. von Fritz Dippert und 32 Tafeln. Deutscher Verlag, Berlin. Preis brosch. RM 6.75, geb. RM 8.75.
Endlich wieder einmal ein richtiggehendes zeitgemäßes Lehrbuch. Motorenkenntnis muß in der heutigen Zeit jeder besitzen. Für den Anfänger ist es schwer, aus der Fülle der vielen Erscheinungen das Richtige herauszugreifen. Meistenteils findet man eine Zusammenstellung aus Preislisten und Katalogen mit mehr oder weniger guten Beschreibungen. Bereits beim Durchblättern des vorliegenden Buches fallen die sauber hergestellten Zeichnungen mit ihrer gleichmäßigen Beschriftung auf. Man sieht, hier ist ein Fachmann am Werke gewesen. Alles leicht verständlich und beinahe spannend geschrieben. Ein wirklich gutes Buch, das wir jedem empfehlen können.
Die Luftmächte Europas, Asiens, Amerikas, Afrikas, Australiens. (Europa-Kräfte und Wirkungen, Bd. 2.) Verlag Bernard & Qraefe, Berlin SW 68. Preis RM 1.75.
Die Kenntnis des Standes der Entwicklung der Luftmächte in den verschiedenen Staaten erfordert ein umfangreiches Studium und war bisher nur Fachleuten vorbehalten. Verfasser gibt hier zum ersten Male für den Fernstehenden eine knappe Einführung über den Zustand der fremden Luftmächte.
Flugzeugtischler Schlosser (Schweiß.)
für sofort gesucht.
Naumburger Flugzeugwerke G.m.b.H. Naumburg (Saale).
Argus Klemm Kl 26 V
zugelassen, dreisitzig, sofort verkäuflich. Zuschriften unter Ziffer 4053 an den Verlag des „Flugsport", Frankfurt am Main, erbeten.
KONDOR I
umgebaut nach den Bestimmungen, kaum geflogen, um RM500-zu verkaufen; dazugehörende Askaniageräte, noch nicht geflogen, Neuwert RM 560.-, Höhenmessers km,Fahrtmesserbis 120 km, Wendeanzeiger, Variometer u. Kompaß „Fränzchen" zu RM 300.-zu verkauf. Angebote unter 4055 an die Exp. des ..Flugsport".
Fiu 44 (Foche-Ulull „Min
fast neu, ca. 30 Flugstunden, Spezialausrüstung, Blindfluggerät, Landescheinwerfer, Fallschirm, Normal- und Kunstflug-Vergaser, sofort bes. Umstände halber zu verkaufen. Offerte unter 4056 an die Exped. des „Flugsport", Frankfurt a. Main.
Segelflugzeug
«JlhöiilMissarcl"
billig zu verkaufen, da nur noch zugelassen für Hangstart, Anfragen unter 4057 an die Expedition des „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgpl. 8, erbet.
Segelflieger oder Segelfliegertisdiler
der selbständig den Bau eines neuartigen Segelflugzeugs nach Zeichnung gegen bare Entschädigung bei vorhandenem Material vornehmen will und kann, bitte ich, sich zu melden unter 4058 an die Expedition des ,,Flugsport"
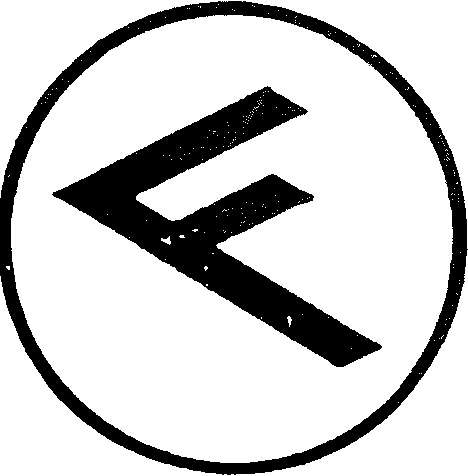
Gesucht werden zum bald igen Eintritt
Statiker
für den Flugzeugbau.
Gefordert werden gute Kenntnisse der neueren statischen und Festigkeits-Berechnungen des Leichtbaues sowie technische Erfahrungen.
Erwünscht sind Kenntnisse des Flugzeugbaues.
Geboten wird bei Bewährung eine entwicklungsfähige, verantwortungsvolle Stelle.
Kennwort: St 4.
Angebote mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften, Angabe der Gehaltsansprüche und frühestem Eintrittstermin sind zu richten an
Gerhard Fieseier Werke G. m. b. h. Kassel
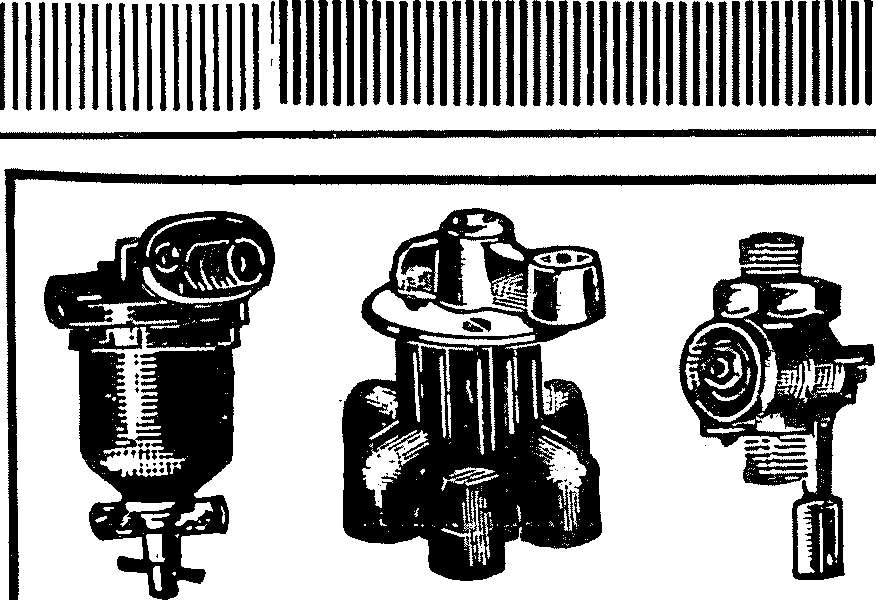
SEPPELER
LEICHTARMATUREN WASSER ÖL BRENNSTOFF
Seit 10 Jahren im Flugzeugbau tausendfach bewährt 1 SPEZIALITÄT: Vielwegeschälter für Brennstoff. Dauerdicht Arnold Seppeier Apparate-u.Versuchsbau Stutfga rt-Berg Mühlenstr.3
„FLUGSPORT"
Ein tragischer Unglücksfall riß heute aus vielversprechender Fliegerlaufbahn unseren Chefpiloten und Kameraden
Helmut Kalkstein.
Er erlitt in treuester Pflichterfüllung den Fliegertod.
Wir verlieren in ihm einen hervorragenden Mitarbeiter, dessen ausgezeichnete fliegerische Fähigkeiten ihn trotz seiner Jugend überall im In- und Ausland bekanntmachten. Sein immer freundliches und kameradschaftliches Wesen verschaffte ihm überall Freunde; seine vorbildliche Dienstauffassung, seine Verantwortungsfreudigkeit und sein großes Pflichtgefühl brachten ihm Anerkennung und Auszeichnung ein.
Sein unerwarteter Tod bedeutet für uns einen schweren Verlust. Er wird bei uns als treuer und guter Kamerad unvergessen bleiben.
Böblingen, den 5. Juli 1939.
Betriebsführung und Gefolgschaft der Firma
HANNS KLEMM FLUGZEUGBAU Leichtflugzeugbau Klemm
Fallschirme
Flugzeug-Baumaterial
Teile nach DIN- und soweit bestehend, auch nach anderen Normen
Flugzeug - Instrumente
Bordtelefone
Ausrüstungen
für Flugzeug und Besatzung
AUTO FLUG
Inhaber Gerhard Sedlmayr
BERLIN- TEMPELHOF
Berliner Straf;* 1 « 7 / 1 » B
C.PLATH
HAMBURG-BAHREN FELD
BAHRENFELDER CHAUSSEE 139
Fernspr. 49 45 42 / Drahtwort: Kompaß Hamburg
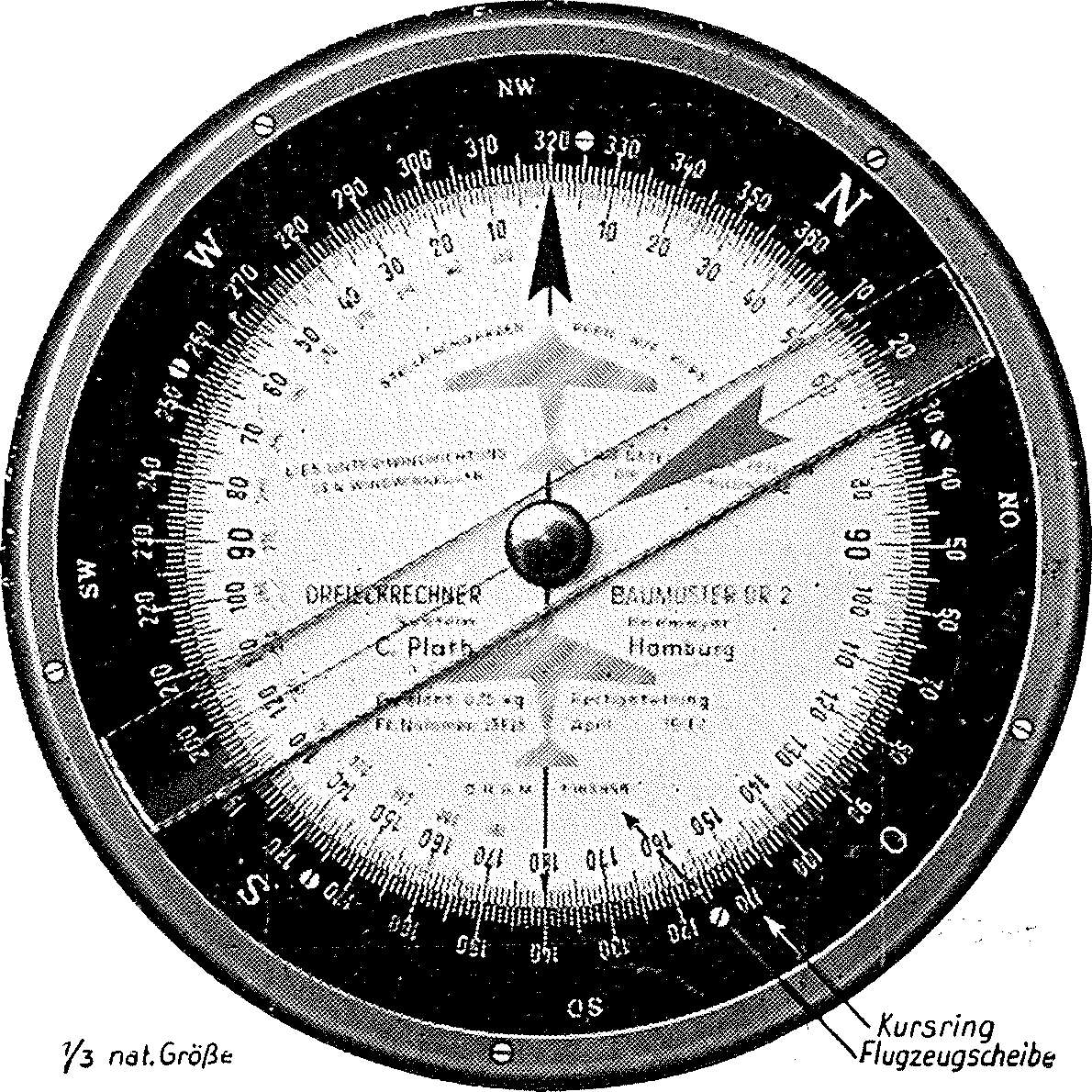
Dreieckrechner System Knemeyer Kompasse - Sextanten Abtriftmesser - Koppler usw.
Heft 16/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro % Jahr bei Htäglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adreise: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu bezichen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet.
Nr. 16 2. August 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 16. August 1939
20. Rhön.
1920 — eine grüne Wiese mit drei Zelten. — Heute am Eröffnungstage des 20. Rhönsegelflug-Wettbewerbes, Weihestunde vor dem Mittelbau des Lilienthalhauses, vor der Ehrenhalle des NS.-Fliegerkorps. Im großen Innenhof der Segelfliegerburg auf der Wasserkuppe steht der Korpsführer des NSFK., General der Flieger Christiansen, mit seinen Gruppenführern, Ehrengästen, 72 Flugzeugführern und annähernd 500 Männern seines Fliegerkorps.
Gruppenführer von Eschwege meldet dem Korpsführer die
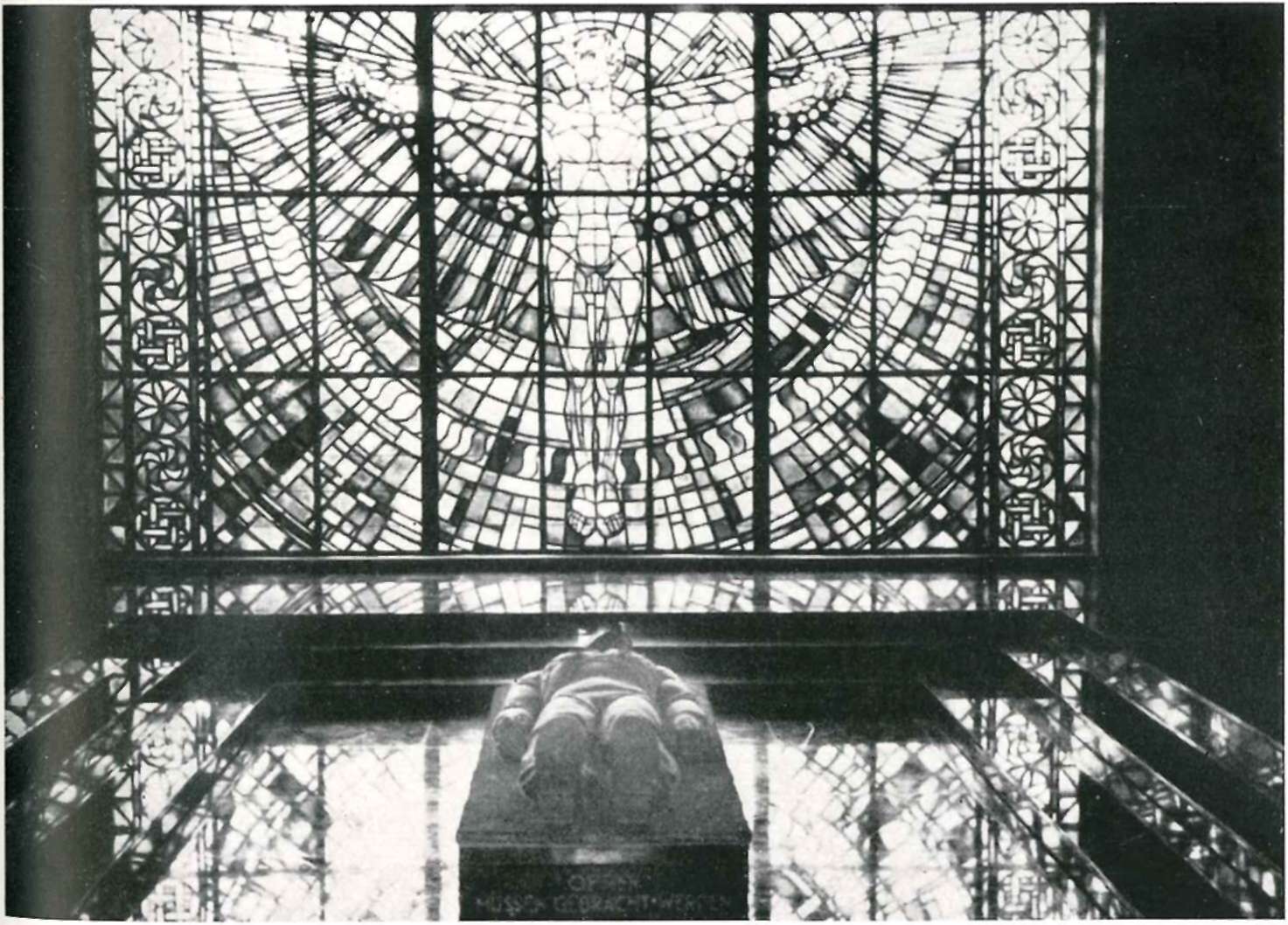
Inneres der „Ehrenhalle der Flieger" auf der Wasserkuppe. Bild: Flussport
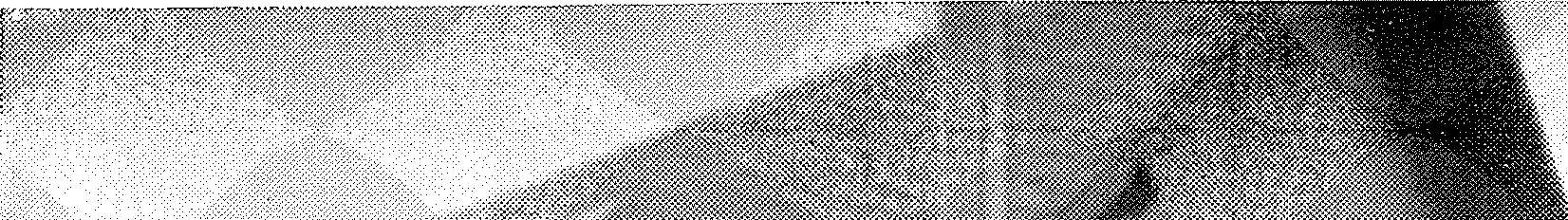
Fertigstellung der Ehrenhalle und übergab dem Korpsführer, der die Einweihung der Ehrenhalle vornahm, den Schlüssel. Eine denkwürdige Stunde.
Wolkenfetzen jagten über die Kuppe. Und der Korpsführer gedachte der Männer, die für den Segelflug gearbeitet und gefallen
sind. „Und diese Männer, die ihr Leben für Deutschlands Luftgeltung eingesetzt und verloren haben, sollen uns allzeit ein mahnendes Vorbild bleiben!"
Und dann öffneten sich unter dem Klang des Liedes vom guten Kameraden die Tore der Ehrenhalle. Der Korpsführer, General der Flieger Christiansen, näherte sich dem Sarkophag der Ehrenhalle und legte einen Lorbeerkranz im Auftrag des Generalfeldmarschalls Göring nieder.
Die Flaggen, die auf Halbmast standen, gingen hoch. Es wird weiter geflogen!
Einzelne Sonnenstrahlen blitzten durch die Wolken, und der 20. Rhönsegelflug - Wettbewerb nahm seinen Anfang.
*
Der Zustrom zum diesjährigen Rhön-Wettbewerb von Fliegern, Flugzeugen und allem, was dazu gehört, vollzog sich wie in den letzten Jahren ohne Schwierigkeiten. Schon in der weiteren Umgebung der Wasserkuppe sah man überall Schilder „Zum 20. Rhön-

Einweihung des Ehrenmals im Mittelbau des Lilienthal-Hauses. Der Korpsführer empfängt von Gruppenführer von Eschwege den Schlüssel zum Ehrenmal. Die Flagge steht auf Halbmast.

Einweihung der „Ehrenhalle der Flieger" auf der Wasserkuppe" am 23. 7. durch den Korpsführer General der Flieger Christiansen.

Einweihung der „Ehrenhalle der Flieger" auf der Wasserkuppe" am 23. 7. durch den Korpsführer General der Flieger Christiansen. Oben: Gruppenführer von Eschwege während seiner Ansprache. Unten: Gruppenführer des NSFK. Bilder: Flugsport
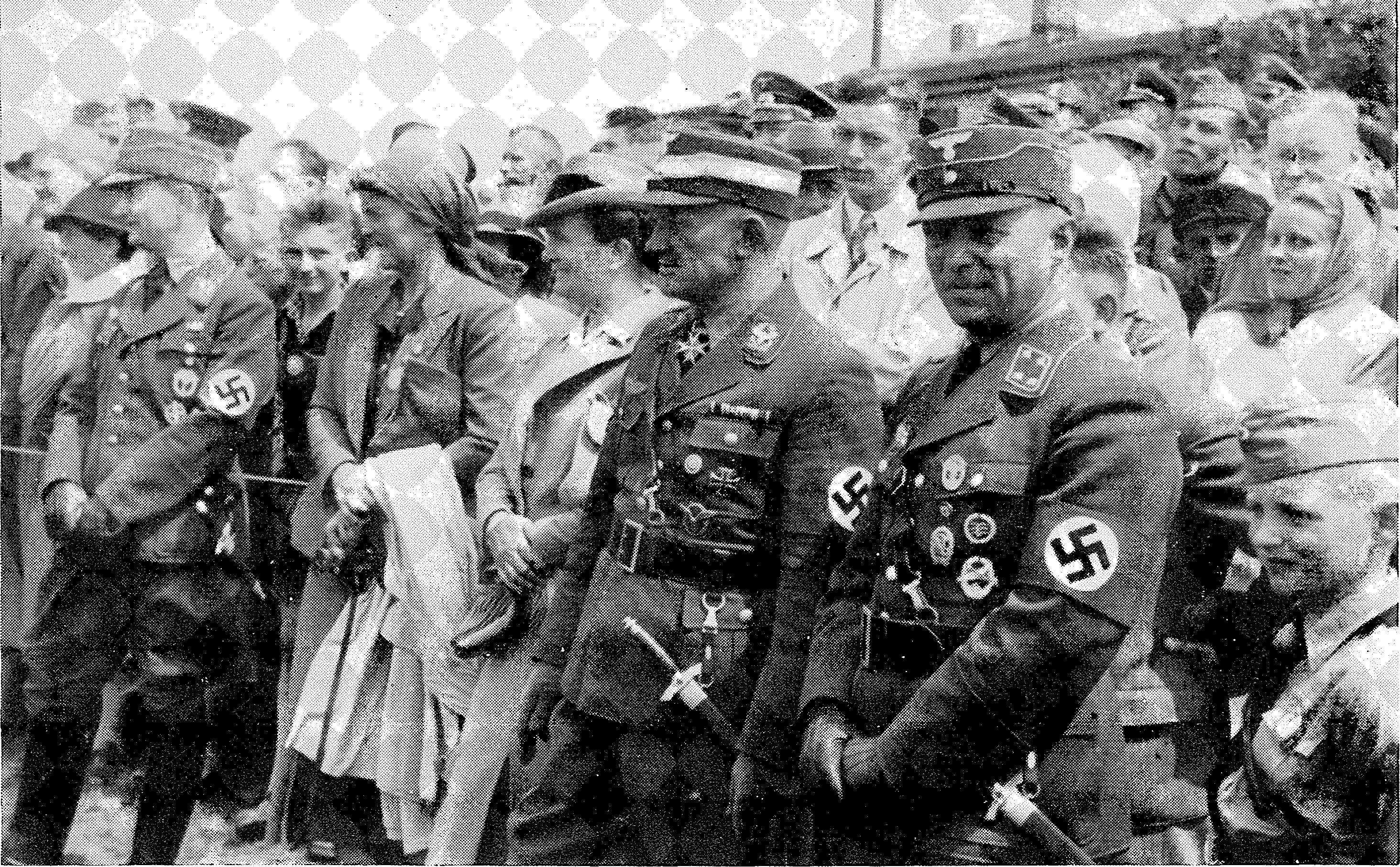
20. Rhön. Der Korpsführer am Start. Bild: Flugsport
segelflug-Wettbewerb". Angenehm berührte der gute Zustand der Straßen. Alte, liebgewordene scharfe Straßenkurven und Schilder wie „Vorsicht Schlaglöcher" waren plötzlich verschwunden. Die
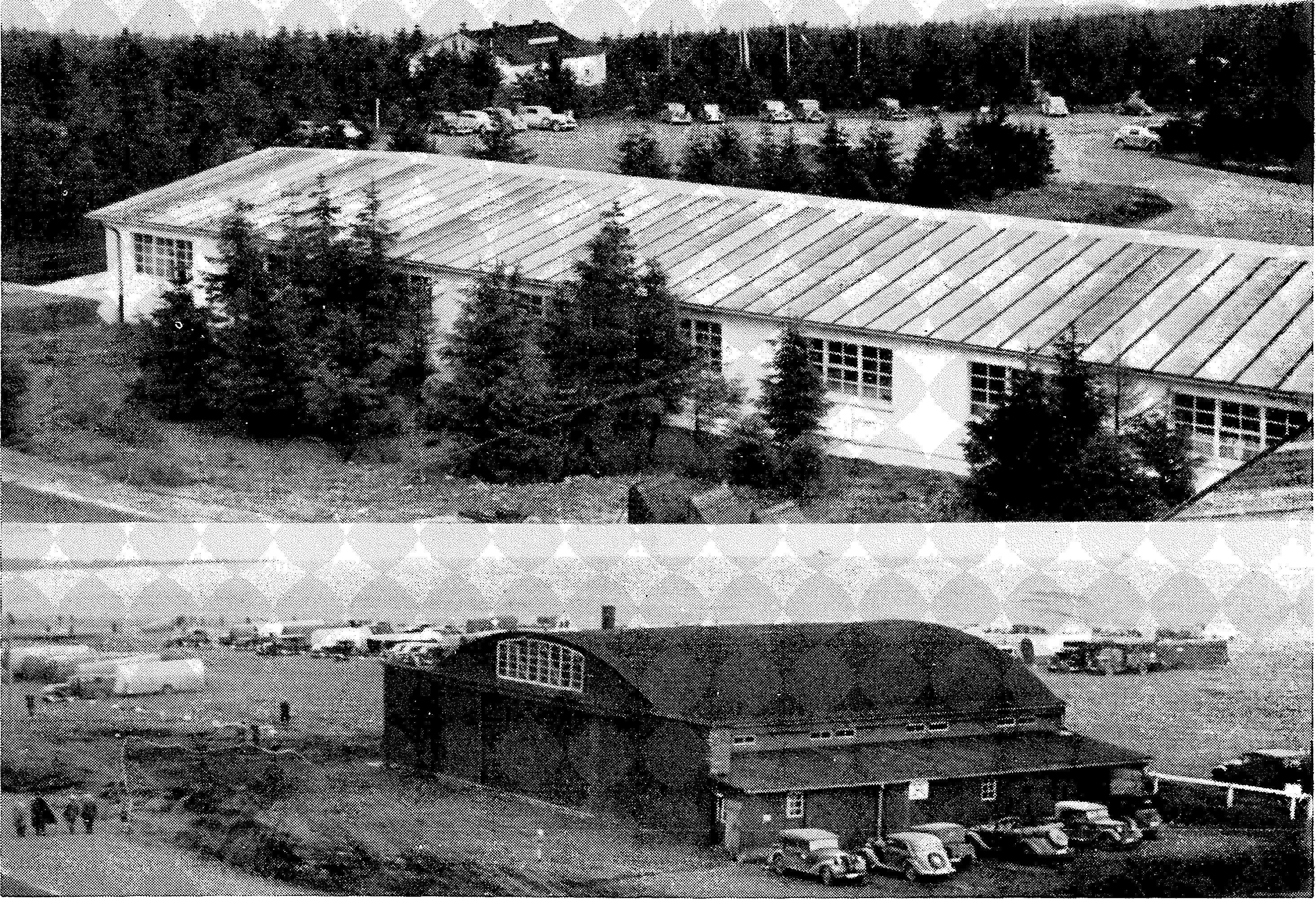
20. Rhön. Rundblick. Oben: Parkplatz. Im Hintergrund „Waldfrieden". Davor Werkstatt. Unten: Parkplatz für die Segelflugzeug-Transportwagen, mit Motorhalle
im Vordergrund. Bilder: Flugsport
Stadt Uersfeld prangte im Flaggenschmuck „Willkommen zur 20. Rhön". Eine Hauptüberraschung war das wieder veränderte Bild der Lagerbauten. Schon am Eingang neben der Qöringhalle sind Fichtenanlagen mit schönen Einfassungen aus Basaltmauerwerk entstanden.
Und wenn man durch den Durchgang den großen Innenhof mit Freischwimmbad und Ehrenhalle betrat, so sah man wieder ein vollständig verändertes Bild. Das alte Fliegerringhaus ist verschwunden und an dessen Stelle ist ein zweistöckiges Unterkunftsgebäude in dem Baustil der anderen Teile, mit Schindeln bedeckt, entstanden. In der Mitte wechseln Rasenflächen mit Buntsandsteinplatten-Belagen und glatten Aufstellplätzen ab. Außen um das Gebäude herum sieht man neue gerade ausgerichtete Grünflächen eingefaßt mit beleuchtungskörpertragenden Basaltmauern.
Verwaltungs-, Unterkunfts- und Verpflegungseinrichtungen sind in mustergültigem Betrieb. Wenn man auch an die schöne alte Zeit, wo alles sehr primitiv war, mit Wehmut zurückdenkt, so machen sich doch die neu geschaffenen Anlagen recht angenehm fühlbar. Das zeigte sich besonders in den ersten Tagen des Wettbewerbes, wo bei niedrigen Temperaturgraden, Regen und Gewitterschauern der Flugbetrieb ohne die geringste Unterbrechung, ohne diese Wet-
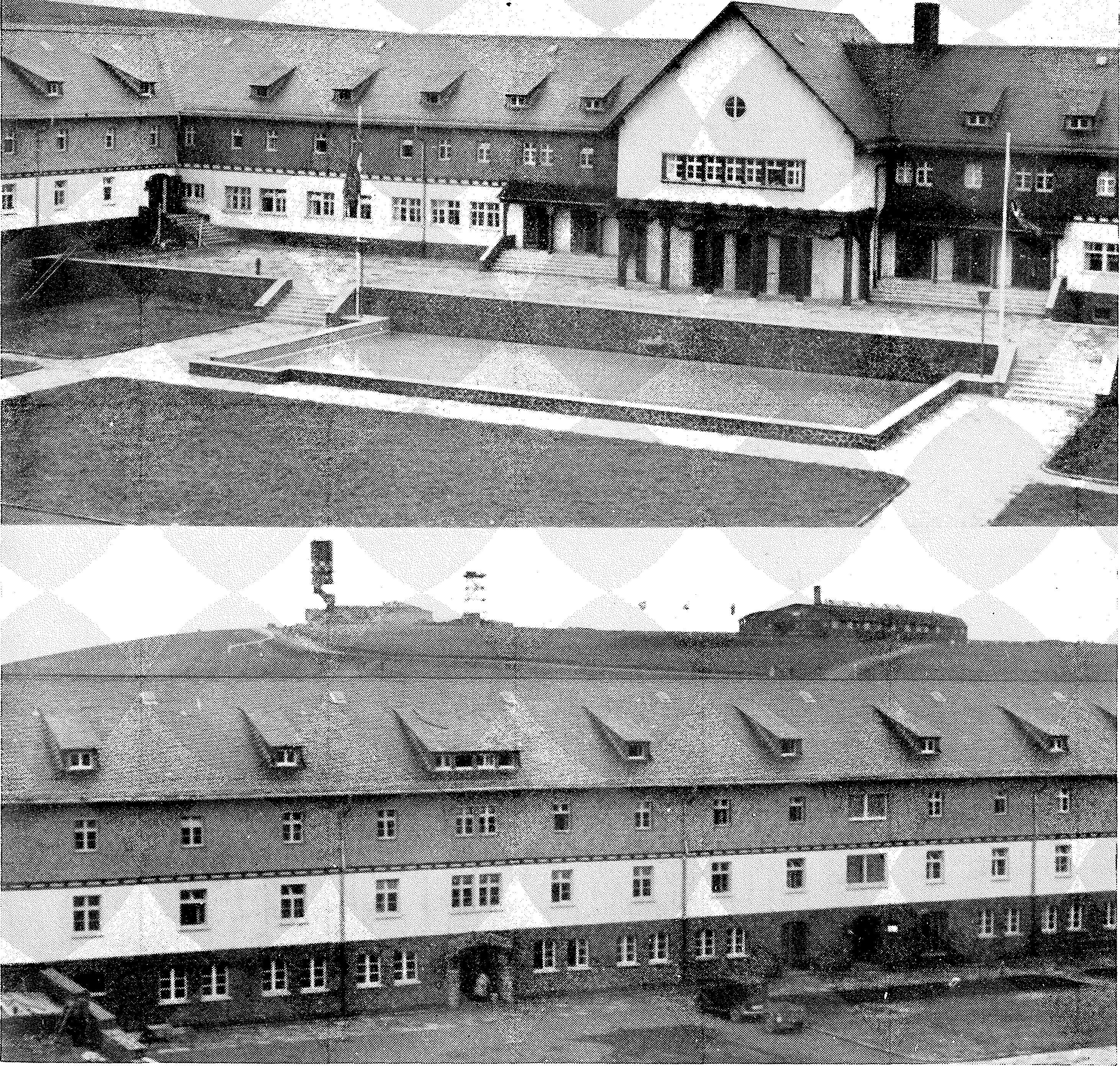
20. Rhön. Oben: Lilienthal-Haus mit Ehrenhalle und Freischwimmbad. Unten:
Das neue Fliegerringhaus. Bilder: Flugsport
terlage unangenehm zu empfinden, unverändert weiterging und trotz ungünstigen Segelflug-Wetterbedingungen recht beachtliche Leistungen vollbracht wurden.
Flieger und Flugzeuge, Transportwagen und ihre Besatzungen waren mustergültig. Alles war auf das sorgfältigste vorbereitet. Die Transportmannschaften mit ihren Wagen haben sich auf die schwersten Anforderungen gefaßt gemacht. Die NSFK.-Gruppe 8, Eschwege, war sogar mit einem Werkstattwagen vertreten, in dem die schwierigsten Arbeiten, Schweißen, Löten — und alle sonstigen Schlosserarbeiten, sogar Aufladen von Akkus, durchgeführt werden konnten. Schon in den ersten Tagen wurden von den einzelnen Gruppen hiervon so eifrig Gebrauch gemacht, daß Werkmeister Adolf sogar des nachts durcharbeitete.
Die geschlossene Unterbringung der Mannschaften wurde durch die vergrößerten Unterkunftsmöglichkeiten sehr erleichtert.
Start A am Westhang, B (Motorschlepp) am Motorlandeplatz und C Ablaufplatz Trenkhof (Märchenwiese).
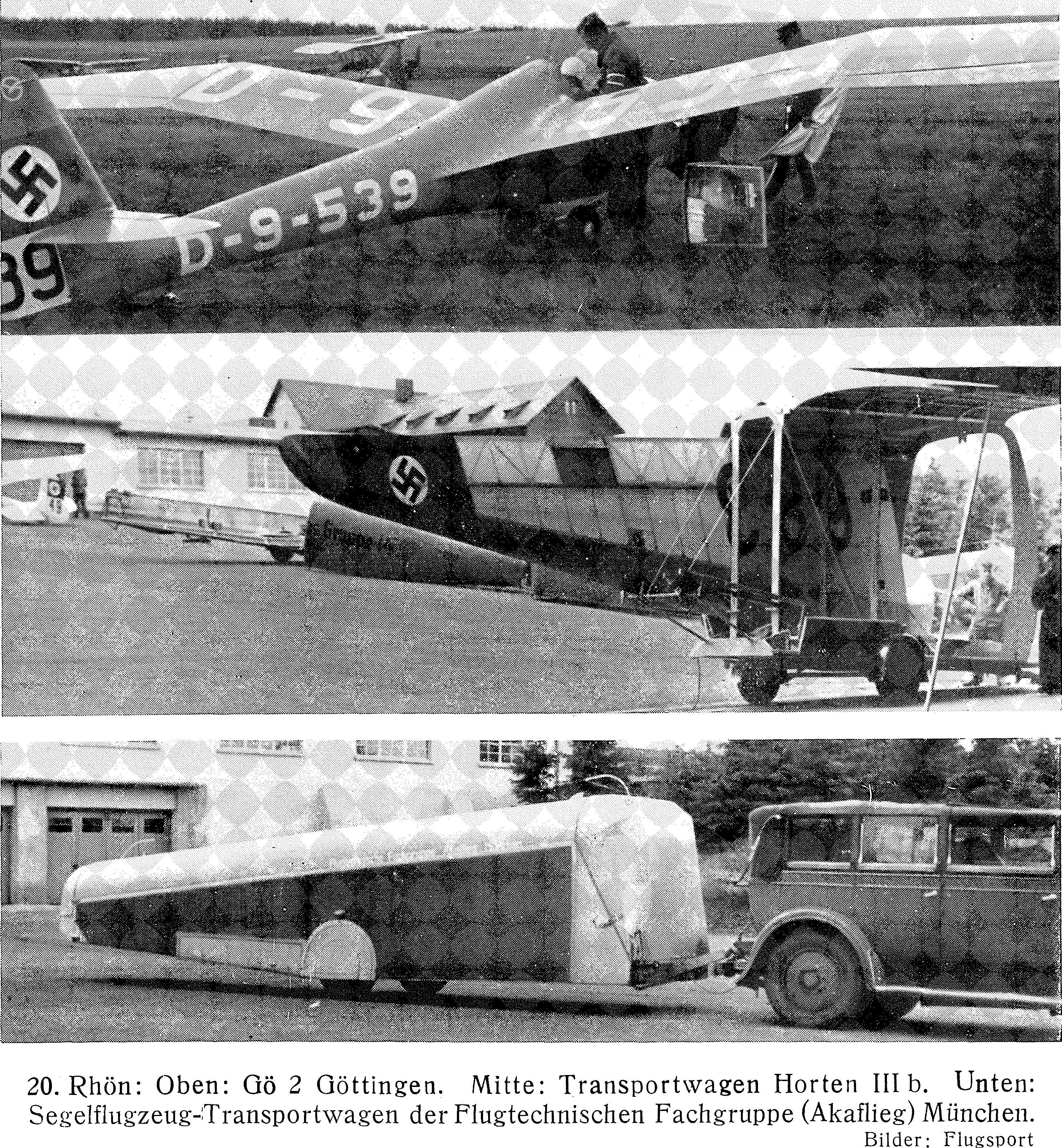
Tagesberichte vom Rhön-Segelflug-Wettbewerb
vom 23. Juli 1939.
Wett* bew°
Nr.
Flugzeug* führer
Flugzeit
Lande*
ort
Strecke km
Höhe
Gew.
|
1 |
Philipp |
Platz |
|||
|
2 |
Baumann |
1°46' |
Ohrdruf |
66 |
|
|
3 |
Fick |
4°53' |
Trebbin |
297 |
1080 |
|
4 |
Huth |
5°25' |
Oderin |
320 |
2030 |
|
5 |
Hofmann |
6°01' |
Pirna |
284 |
2560 |
|
6 |
.Heinemann |
1°23' |
Herrenbreitungen 41 |
||
|
7 8 |
Haase Sauerbier |
Platz |
|||
|
9 |
-Ziller |
Reichenbach |
47 |
490 |
|
|
10 |
Bräutigam |
Waku |
|||
|
10 |
Bräutigam |
5°48' |
Hartmannsdorf |
321 |
1340 |
|
11 |
Ludwig |
33' |
Reulbach |
||
|
11 |
Ludwig |
2°19' |
Erfurt-Bdslbn. |
90 |
800 |
|
12 |
Treuter |
6°37' |
Neu-Zauche |
332 |
1900 |
|
13 |
Müller |
2°41' |
Erfurt-Nord |
97 |
760 |
|
14 |
Boy |
6°06' |
Redlin |
271 |
1600 |
|
15 |
Bock |
2°29' |
Silberhausen |
98 |
740 |
|
16 |
Henning |
Waku |
|||
|
16 |
Henning |
Waku |
|||
|
16 |
Henning |
Waku |
|||
|
17 |
Opitz |
2° 13' |
Rohda |
97 |
1340 |
|
18 |
Schubert |
43' |
Wohlmuthausen |
21 |
610 |
|
19 |
.Meier zu Bentrup |
Waku |
|||
|
19 |
Meier zu Bentrup |
2°07' |
Eisenach |
62 |
750 |
|
20 |
Habicht |
5°40' |
Torgau |
246 |
|
|
21 |
v. Treuberg |
7°01' |
Werneuchen |
360 |
1080 |
|
22 |
Beck |
7°00' |
Welzow |
320 |
850 |
|
23 |
Kraft |
3°42' |
Moßdorf |
210 |
1520 |
|
24 |
Bauer |
58' |
Rosa |
33 |
580 |
|
25 |
Schmidt |
6°12' |
Neuendorf |
331 |
1980 |
|
26 |
Hauck |
Waku |
|||
|
26 |
. Hauck |
1°36' |
Benshausen |
49 |
660 |
|
1 |
Philipp |
15' |
Waku |
||
|
27 |
Fiedler |
3°23' |
Bad Kosen |
146 |
|
|
28 |
Bender |
1°20' |
Solz |
31 |
|
|
30 |
Späte |
5°35' |
Meißen |
263 |
2380 |
|
31 |
Flakowski |
Waku |
|||
|
32 |
Qeitner |
Waku |
|||
|
32 |
Qeitner |
W'aku |
|||
|
33 |
Scheidhauer |
Waku |
|||
|
33 |
Scheidhauer |
Waku |
|||
|
33 |
Scheidhauer |
Waku |
|||
|
33 |
Scheidhauer |
1°42' |
Arnstadt |
82 |
980 |
|
34 |
Peter |
Waku |
|||
|
35 |
Mößinger |
Waku |
|||
|
35 |
Mößinger |
1°28' |
Wasungen |
37 |
|
|
36 |
Karch |
Waku |
|||
|
37 |
Schuchardt |
5°23' |
Brehna |
201 |
2370 |
|
38 |
Wenzel |
1°08' |
Niederschmalkalden |
40 |
|
|
39 |
Ebert |
Waku |
|||
|
39 |
Ebert |
13' |
Waku |
||
|
39 |
Ebert |
Waku |
|||
|
40 |
Flinsch |
2°54' |
Diemstedt |
94 |
990 |
|
41 |
Engel |
1°57' |
Gotha |
77 |
1300 |
|
42 |
Wende |
Waku |
|||
|
42 |
Wende |
57' |
Fambach |
41 |
|
|
44 |
Bödeker/Zander |
2°52' |
Gotha |
77 |
|
|
45 |
Qüssefeld/Torke |
WTaku |
|||
|
46 |
Vergens/Malchow |
1°46' |
Mechterstädt |
65 |
|
|
47 |
Widlok/Noske |
Waku |
|||
|
47 |
Widlok/Moske |
1°11' |
Weilar |
34 |
|
|
48 |
Kühnold/Schröder |
1°21' |
Schmalkalden |
45 |
|
|
49 |
Budzinski/Leuber |
3°24' |
Riethnordhausen 139 |
||
|
51 |
Erb/v. Malapert |
Waku |
|||
Wett* bew. Nr.
Flugzeug^ führer
Flug, zeit
Lande* ort
Strecke Höhe km Gew,
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
Waku |
||
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
Waku |
||
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
Waku |
||
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
Waku |
||
|
53 |
Deeg/Krämer |
Waku |
||
|
53 |
Deeg/Krämer |
2°53' |
Auerstädt |
135 |
|
54 |
Romeis/Prestele |
2°21' |
Ohrdruf |
67 |
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
1°21' |
Haindorf |
43 |
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
Waku |
||
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
14' |
Brand |
4 |
|
57 |
Bayer/Specht |
Waku |
||
|
57 |
Bayer/Specht |
Waku |
||
|
58 |
Mudin/Deleurant |
1°30' |
Sättelstädt |
64 |
|
59 |
Stein/Fröhlich |
1°13' |
Schwarzbach |
30 |
|
60 |
Abel/Hübner |
Waku |
||
|
60 |
Abel/Hübner |
Waku |
||
|
61 |
Lander/ Oberschachtsiek |
Waku |
||
|
61 |
Lander/ Oberschachtsiek |
Waku |
||
|
A |
Steinmann |
Waku |
||
|
A |
Steinmann |
Waku |
||
|
B |
Sosniers |
Waku |
||
|
B |
Sosniers |
24' |
Waku |
|
|
C |
Hannoschöck |
1°43' |
Weilar |
34 |
|
D |
Kober |
2°25' |
Frienstedt |
85 |
|
E |
Esau |
Waku |
||
|
E |
Es au |
3°04' |
Bretleben |
133 |
|
G |
Lippmann |
1°45' |
Reichenbach |
47 |
|
H |
Urban |
3° 15' |
Kahla |
122 |
|
J |
Päsold |
1°59' |
Gotha |
77 |
|
K |
Bauer |
1°18' |
Schnellbach |
50 |
|
L |
Zechin |
1°22' |
Marksuhl |
50 |
|
M |
Zanko |
Waku |
||
|
M |
Zanko |
Waku |
||
|
M |
Zanko |
Waku |
||
|
vom 24. Juli 1939. |
||||
|
2 |
Baumann |
1°45' |
Brüheim |
74 |
|
2 |
Baumann |
1°05' |
Waku |
|
|
2 |
Baumarin |
41' |
Tränkhof |
|
|
4 |
Huth |
2°45' |
Erfurt-Nord |
97 |
|
5 |
Hofmann |
2°24' |
Schallenburg |
109 |
|
6 |
Heinemann |
18' |
Tränkhof |
|
|
6 |
Heinemann |
2°42' |
Ammern |
92 |
|
9 |
Ziller |
39' |
Mahlerts |
12 |
|
9 |
Ziller |
2°45' |
Mingerode |
120 |
|
10 |
Bräutigam |
1°24' |
Gotha |
78 |
|
11 |
Ludwig |
17' |
Tränkhof |
|
|
11 |
Ludwig |
2°32' |
Erfurt-Nord |
97 |
|
12 |
Treuter |
3°03' |
Erfurt-Nord |
97 |
|
13 |
Müller |
42' |
Rödergrund |
13 |
|
13 |
Müller |
2°10' |
Erfurt-Nord |
97 |
|
14 |
Boy |
36' |
Tränkhof |
|
|
14 |
Boy |
1°28' |
Dönges |
45 |
|
15 |
Bock |
17' |
Tränkhof |
|
|
15 |
Bock |
— |
— |
— |
|
15 |
Bock |
27' |
Tränkhof |
|
|
15 |
Bock |
— |
— |
|
|
16 |
Henning |
18' |
Tränkhof |
|
|
16 |
Henning |
25' |
Ruprot |
|
|
16 |
Henning |
46' |
Tränkhof |
|
|
17 |
Opitz |
16' |
Tränkhof |
|
|
17 |
Opitz |
16' |
Tränkhof |
|
|
17 |
Opitz |
2°36' |
Erfurt-Nord |
97 |
|
18 |
Schubert |
14' |
Tränkhof |
|
|
18 |
Schubert |
1°30' |
Kupfersuhl |
48 |
760
2020 1060
670
1530 1820
1110 950
1430
510
|
Wette Flugzeug* |
Flug» |
Lande* |
Strecke Höhe |
Wettfl Flugzeug* |
Flug* |
Lande» |
Strecke Höhe |
||||
|
bew. führer |
zeit |
ort |
km |
Gew. |
bew. führer |
zeit |
ort |
km |
Gew. |
||
|
Nr. |
Nr. |
||||||||||
|
19 |
Meier z. Bentrup |
14' |
Tränkhof |
53 |
Deeg |
10' |
Waku |
||||
|
19 |
Meier z. Bentrup |
14' |
Tränkhof |
53 |
Deeg |
2°18' |
Rosa |
33 |
|||
|
19 |
Meier z. Bentrup |
1°45' |
Vacha |
83 |
540 |
54 |
Romeis |
1°59' |
Kreuzburg |
69 |
|
|
20 |
Habicht |
14' |
Tränkhof |
54 |
Romeis |
11' |
Waku |
||||
|
20 |
Habicht |
2°30' |
Bad Franken- |
55 |
Knöpfle |
2°40' |
Mühlberg |
75 |
|||
|
hausen |
127 |
1810 |
56 |
Kahlbacher |
5' |
Waku |
|||||
|
21 |
v. Treuberg |
1°52' |
Wachstedt |
94 |
1380 |
56 |
Kahlbacher |
5' |
Waku |
||
|
22 |
Beck |
2°27' |
Erfurt-Nord |
97 |
870 |
56 |
Kahlbacher |
17' |
Waku |
||
|
23 |
Kraft |
3°10' |
Halle |
180 |
2280 |
56 |
Kahlbacher |
— |
— |
ϖ — |
— |
|
24 |
Bauer |
35' |
Reulbach |
56 |
Kahlbacher |
1°47' |
Kreuzburg |
66 |
|||
|
24 |
Bauer |
2°42' |
Erfurt-Nord |
97 |
2170 |
57 |
Bayer |
37' |
Reulbach |
||
|
27 |
Fiedler |
18' |
Tränkhof |
58 |
Mudin |
— |
— |
— |
|||
|
27 |
Fiedler |
— |
— |
58 |
Mudin |
1°18' |
Gotha |
78 |
|||
|
27 |
Fiedler |
3° 13' |
Seligenthal |
49 |
1010 |
59 |
Stein/Fröhlich |
15' |
Waku |
||
|
28 |
Bender |
3e35' |
Gotha |
78 |
690 |
59 |
Stein/Fröhlich |
13' |
— |
— |
— |
|
30 |
Späte |
2°21' |
Herges |
46 |
1070 |
59 |
Stein/Fröhlich |
11' |
Waku |
||
|
31 |
Flakowski |
— |
— |
— |
— |
59 |
Stein/Fröhlich |
38' |
Tränkhof |
||
|
31 |
Flakowski |
1°18' |
Liebenstein |
46 |
840 |
59 |
Stein/Fröhlich |
1°31' |
Schweina |
46 |
|
|
32 |
Qeitner |
35' |
Motorplatz |
60 |
Abel |
— |
— |
— |
— |
||
|
32 |
Qeitner |
1°06' |
Kieselbach |
41 |
550 |
60 |
Abel |
3°05' |
Seligenthal |
49 |
|
|
33 |
Scheidhauer |
7' |
Waku |
61 |
Lander |
9' |
Waku |
||||
|
33 |
Scheidhauer |
6' |
Waku |
61 |
Lander |
V |
Waku |
||||
|
33 |
Scheidhauer |
2°27' |
Sollstedt |
112 |
790 |
61 |
Lander |
1°45' |
Herleshausen |
60 |
|
|
34 |
Peter |
1°40' |
Heiligenroda |
43 |
A |
Steinmann |
1°21' |
Tränkhof |
|||
|
35 |
Mössinger |
12' |
Tränkhof |
A |
Steinmann |
1°20' |
Melborn |
65 |
|||
|
35 |
Mössinger |
52' |
Tränkhof |
B |
Sosniers |
— |
— |
— |
— |
||
|
35 |
Mössinger |
28' |
Batten |
8 |
B |
Sosniers |
2°06' |
Merkers |
40 |
||
|
37 |
Schuchardt |
33' |
Tränkhof |
C |
Hannoschöck |
2°14' |
Göttingen |
118 |
|||
|
37 |
Schuchardt |
4°19' |
Laucha |
148 |
3220 |
D |
Kober |
31' |
Lindenau |
28 |
|
|
38 |
Wenzel |
16' |
Tränkhof |
E |
Esau |
1°50' |
Eisenach |
60 |
|||
|
38 |
Wenzel |
1°13' |
Phillipsthal |
38 |
640 |
G |
Lippmann |
1°25' |
Gerstungen |
54 |
|
|
39 |
Ebert |
— |
— |
— |
— |
H |
Urban |
52' |
Thann |
18 |
|
|
39 |
Ebert |
— |
— |
— |
— |
K |
Bauer |
12' |
Tränkhof |
||
|
39 |
Ebert |
22' |
Tränkhof |
K |
Bauer |
— |
— |
— |
■ — |
||
|
39 |
Ebert |
1°21' |
Eisenach |
60 |
440 |
K |
Bauer |
— |
— |
— |
|
|
40 |
Flinsch |
12' |
Tränkhof |
M |
Zanko |
1°54' |
Unterweid |
15 |
|||
|
40 |
Flinsch |
1°55' |
Tennstedt |
97 |
2030 |
||||||
|
41 |
Engel |
43' |
Tränkhof |
vom 25. Juli 1939. |
|||||||
|
41 |
Engel |
lp47' |
Marksuhl |
50 |
2 |
Baumann |
22' |
Waku |
|||
|
42 |
Mende |
18' |
Tränkhof |
2 |
Baumann |
42' |
Hollstadt |
29 |
510 |
||
|
42 |
Mende |
1°19' |
Theobaldshof |
20 |
3 |
Fick |
1° |
Römhild |
45 |
970 |
|
|
44 |
Bödeker |
1°38' |
Wutha |
61 |
4 |
Huth |
2°03' |
Schönau |
18 |
690 |
|
|
45 |
Qüssefeld |
9' |
Waku |
5 |
Hofmann |
33' |
Waku |
||||
|
45 |
Qüssefeld |
— |
— |
— |
— |
5 |
Hofmann |
49' |
Eibstadt |
37 |
590 |
|
45 |
Qüssefeld |
8' |
Abtsroda |
6 |
Heinemann |
21' |
Waku |
||||
|
46 |
Vergens |
2° 14' |
Marksuhl |
50 |
6 |
Heinemann |
20' |
Waku |
|||
|
47 |
Widlok/Noske |
6' |
WTaku |
7 |
Haase |
13' |
Waku |
||||
|
47 |
Widlok/Noske |
10' |
Waku |
7 |
Haase |
1°41' |
Aisleben |
49 |
1160 |
||
|
47 |
Widlok/Noske |
1°11' |
Kieselbach |
40 |
8 |
Sauerbier |
1°37' |
Exdorf |
43 |
||
|
47 |
Widlok |
— |
_ |
— |
9 |
Ziller |
1°18' |
Heustreu |
28 |
800 |
|
|
48 |
Kühnold |
— |
— |
— |
— |
10 |
Braeutigam |
8' |
Waku |
||
|
48 |
Kühnold |
— |
— |
— |
— |
10 |
Braeutigam |
1°38' |
Sendebach |
80 |
1970 |
|
48 |
Kühnold |
2°38' |
Erfurt |
97 |
11 |
Ludwig |
12' |
Waku |
|||
|
49 |
Budzinski |
— |
— |
— |
— |
11 |
Ludwig |
30' |
Schönau |
18 |
|
|
49 |
Budzinski |
1°55' |
Gerblingerode |
115 |
12 |
Treuter |
4°27' |
Neuhaus |
112 |
2500 |
|
|
50 |
Fulda |
5' |
Waku |
13 |
Müller |
17' |
Waku |
||||
|
50 |
Fulda |
6' |
Waku |
13 |
Müller |
1°20' |
Saal |
35 |
740 |
||
|
50 |
Fulda |
4' |
Waku |
14 |
Boy |
11' |
Waku |
||||
|
50 |
Fulda |
— |
— |
— |
— |
14 |
Boy |
1°22' |
Friesenhausen |
54 |
1780 |
|
51 |
Erb |
10' |
Waku |
15 |
Bock |
49' |
Ostheim |
20 |
|||
|
51 |
Erb |
— |
— |
— |
— |
16 |
Henning |
50' |
Hausen |
13 |
|
|
51 |
Erb |
25' |
Tränkhof |
17 |
Opitz |
25' |
Waku |
||||
|
51 |
Erb |
— |
— |
— |
— |
17 |
Opitz |
1°29' |
Alsleben |
49 |
540 |
|
52 |
Tuliszka |
9' |
Waku |
18 |
Schubert |
1°25' |
Neubrunn |
39 |
820 |
||
|
52 |
Tuliszka |
6' |
Waku |
19 |
Meier z. Bentrup |
1°44' |
Sandberg |
17 |
670 |
||
|
52 |
Tuliszka |
1°01' |
Waku |
20 |
Habicht |
45' |
Waku |
||||
|
52 |
Tuliszka |
— |
— |
— |
__ |
20 |
Habicht |
57' |
Salz |
28 |
|
|
52 |
Tuliszka |
2°33' |
Oberdorf |
120 |
21 |
v. Treuberg |
2°49' |
Themar |
48 |
730 |
|
Wert* Flugzeug* Flug« Lande* Strecke Höhe bew. führer zeit ort km Gew.
Nr.
|
22 |
Beck |
2°48' |
Schweinshaupten |
57 |
630 |
|
23 |
Kraft |
15' |
Waku |
||
|
23 |
Kraft |
2° |
Breitengüsbach |
88 |
980 |
|
24 |
Bauer |
1°41' |
Römhild |
44 |
580 |
|
25 |
Schmidt |
2°15' |
Coburg |
80 |
|
|
27 |
Fiedler |
2°39' |
Roßfeld |
60 |
|
|
28 |
Bender |
12' |
Waku |
||
|
28 |
Bender |
1°16' |
Maßbach |
42 |
640 |
|
31 |
Flakowski |
59' |
Eyershausen |
46 |
1000 |
|
32 |
Qeitner |
7' |
Waku |
||
|
35 |
Mössinger |
1° |
Gersfeld |
||
|
36 |
Karch |
40' |
Waku |
||
|
37 |
Schuchardt |
1°33' |
Nordheim |
34 |
580 |
|
38 |
Wenzel |
1°01' |
Wüstensachsen |
||
|
39 |
Ebert |
16' |
Waku |
||
|
40 |
Flinsch |
34' |
Gersfeld |
||
|
40 |
Flinsch |
— |
u |
||
|
41 |
Engel |
29' |
Schönau |
18 |
|
|
42 |
Mende |
43' |
Waku |
||
|
42 |
Mende |
53' |
Seibrigshausen |
41 |
550 |
|
44 |
Bödeker/Zander |
20' |
Waku |
||
|
45 |
Güssefeld/Torke |
7' |
Waku |
||
|
45 |
Güssefeld/Torke |
1°04' |
Strahlungen |
31 |
|
|
46 |
Vergens/Malchow |
1°49' |
Hollstadt |
31 |
|
|
47 |
Widlok/Noske |
16' |
Waku |
||
|
47 |
Widlok/Noske |
10' |
Waku |
||
|
48 |
Kühnold/Schröder |
2°06' |
Sulzfeld |
42 |
|
|
49 |
Budzinski/Leuber |
46' |
Kollertshof |
21 |
|
|
50 |
Fulda/Krämer |
1°23' |
Sulzfeld |
42 |
|
|
51 |
Erb/v. Malapert |
22' |
Mosbach |
|
Wett« Flugzeug* |
Flug« |
Lande« |
Strecke |
|
|
bew. führer |
zeit |
ort |
km |
|
|
Nr. |
||||
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
10' |
Waku |
|
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
14' |
Waku |
|
|
53 |
Deeg/Krämer |
9' |
Waku |
|
|
53 |
Deeg/Krämer |
1°14' |
Hohn |
26 |
|
54 |
Romeis/Prestele |
26' |
Bischofsheim |
11 |
|
55 |
Knöpfle/Boeker |
52' |
Salz |
28 |
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
17' |
Waku |
|
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
7' |
Waku |
|
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
5' |
Waku |
|
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
1°35' |
Schweinshof |
23 |
|
57 |
Bayer/Specht |
49' |
Wegfurth |
11 |
|
58 |
Mudin/Deleurant |
45' |
Waku |
|
|
58 |
Mudin/Deleurant |
39' |
Kollertshof |
21 |
|
60 |
Abel/Hübner |
17' |
Waku |
|
|
60 |
Abel/Hübner |
36' |
Bischofsheim |
11 |
|
61 |
Lander/ |
|||
|
Oberschachtsiek |
11' |
Waku |
||
|
B |
Sosniers |
52' |
Heustreu |
28 |
|
C |
Hannoschöck |
1°29' |
Herbstädt |
44 |
|
D |
Kober |
16' |
Waku |
|
|
D |
Kober |
42' |
Hollstadt |
30 |
|
E |
Esau |
2°24' |
Münnerstadt |
32 |
|
F |
Altmayer |
14' |
Waku |
|
|
F |
Altmayer |
12' |
Waku |
|
|
G |
Lippmann |
1°39' |
Eyershausen |
46 |
|
H |
Urban |
1°55' |
Stadtlauringen |
45 |
|
J |
Päsold |
1°07' |
Bibra |
35 |
|
K |
Bauer |
3°02' |
Heldburg |
61 |
|
L |
Zanko |
41' |
Wegfurth |
15 |
Höhe Gew.
Beförderungswagen AZE für Horten „Nurflüger.
Mit der Entwicklung der schwanzlosen Horten-Maschine machte sich auch eine besondere Entwicklung von Rückholwagen notwendig. Für den bisherigen Transport konnten in einem Wagen nur die Flügel und in einem zweiten Wagen das Mittelstück untergebracht
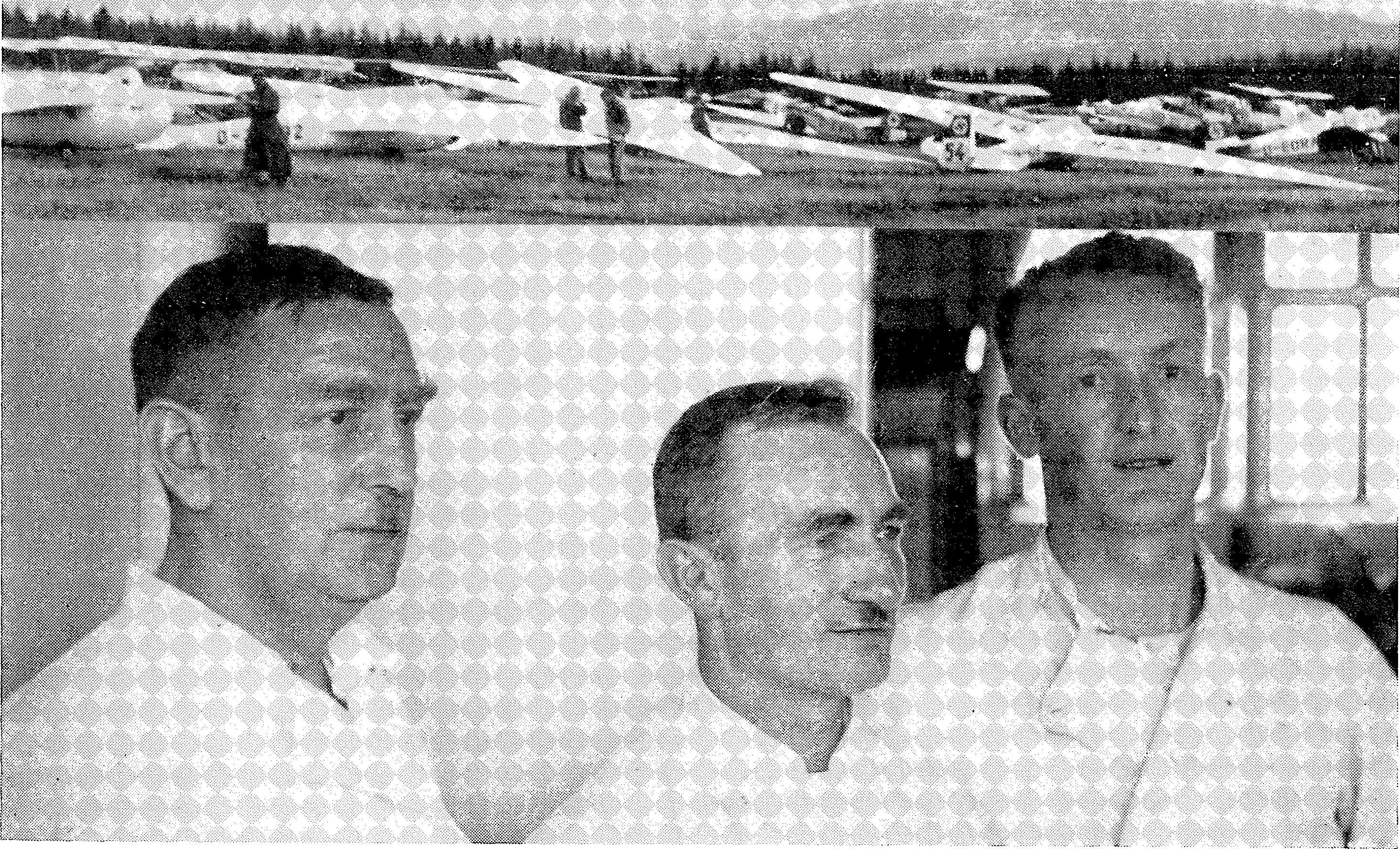
20. Rhön. Oben: Gedränge zum Schlepp auf dem Motorlandeplatz. Unten: Männer, die für Betriebsstoff sorgen. In der Mitte der Küchenchef. Bilder: Flugsport
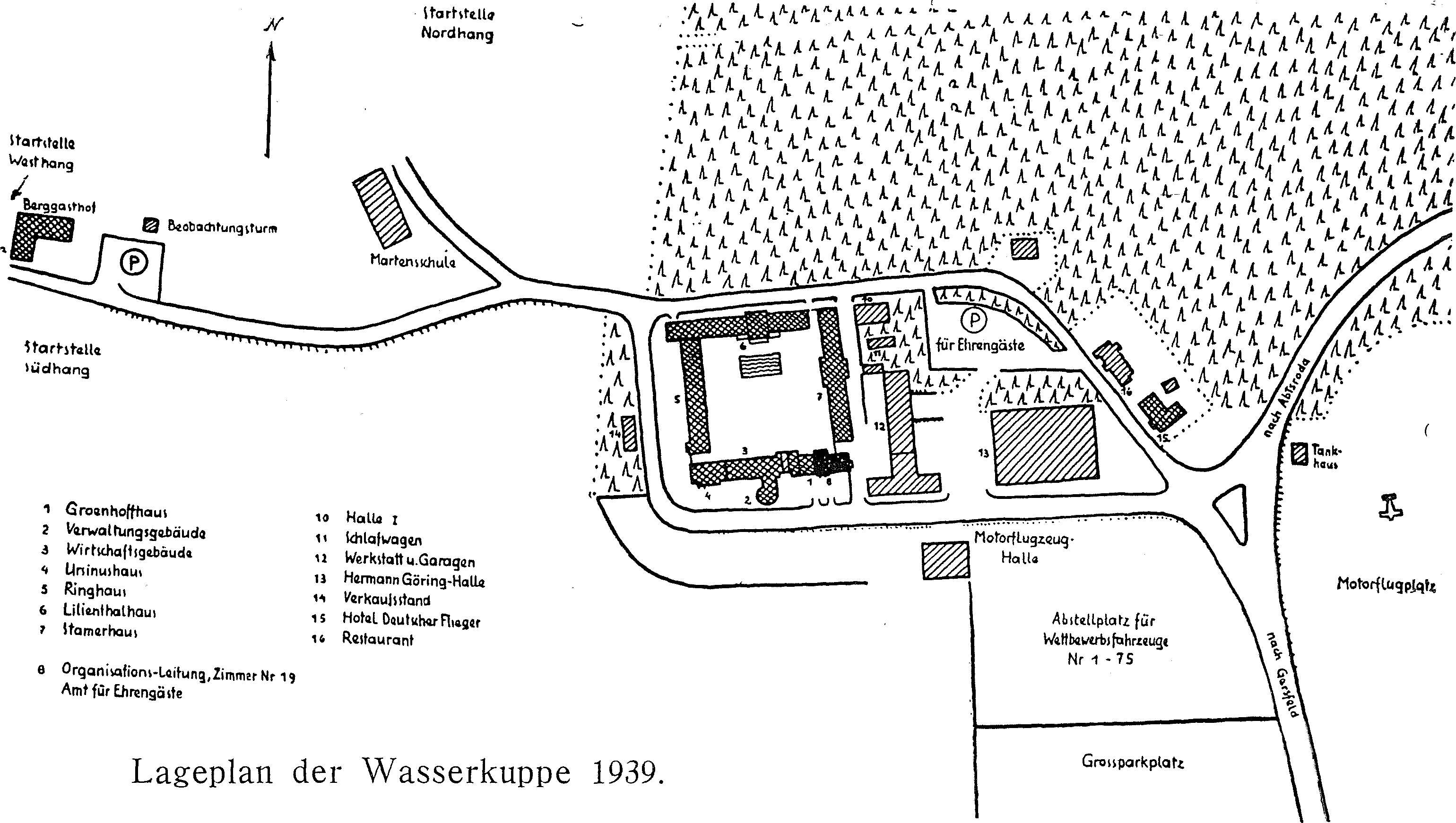
werden. Der neue von Qebrüder Eberle, Schorndorf (Württ), konstruierte Beförderungswagen, Baumuster AZE, ist aus dem AZ als Allzweckwagen mit aufklappbaren Seitenwänden und dem Stromlinien-Haubenwagen Efag 2 mit abnehmbaren Sperrholzschalen entwickelt worden.
Eine andere Verladung in geschlossenem Wagen bei möglichst minimaler Bauhöhe, als von seitlich außen her, konnte nicht in Frage kommen. Es waren also deshalb für die Konstruktion die Erfahrungen aus den vorangegangenen Baumustergattungen sehr wertvoll. Auch war wegen des großen Querschnittes und dem damit verbundenen großen Luftwiderstand unbedingt eine windschnittige Formgebung nötig.
Die Abmessungen sind ganz dem „Nurflügel" angepaßt. Größte Länge 13 m, Breite 2,35 m, Höhe 3,4 m.
Der Mittelteil des Wagens (vgl. Abb. S. 408) trägt auf einem weit ausgebauchten Bogenträger und zwei Trapezspanten das sperrholzbeplankte Dach. Dieser feste Aufbau ist seitlich mit den aufklappbaren segelleinenbespannten Wänden abgedeckt, unter welchen die Flügel untergebracht sind. Innerseitlich der Trapezspanten befindet sich das Flugzeugmittelstück. Der Vorderteil des Wagens ist mit einer abnehmbaren mit einer Türe versehenen Haube und die etwa 6 m lang überstehenden Flügelenden mit der hinteren freitragenden Vollschalen-Haube abgedeckt.
Die Verladung geht sehr zweckmäßig und in kurzer Zeit vonstatten. Die Straßenlage ist trotz der großen Bauhöhe gut, was auch die Geschwindigkeitsversuche ergaben, die an die 100 km/h-Grenze heranreichten.
Fahrbare Werkstatt der Gruppe 8 (Mitte).
Entwurf Gruppenführer v. Eschwege, Fahrgestell von Daimler-Benz, 55 PS Diesel-Motor. Arbeiten des Aufbaues und Einrichtung von „Lueg", Bochum. Seitenwände aufklappbar und als Arbeitstische eingerichtet. Werkbank des Wagens, auf Karosserie fest aufmontiert, enthält sämtliche Werkzeuge, um Kraftfahrzeuge, Segel-und Motorflugzeuge reparieren zu können. Reichliches Ersatzteillager, Schweißapparat, Batterie-Ladestation, Bohrmaschine und Abschleppwagen, mit dem man sämtliche beschädigten Fahrzeuge ab-
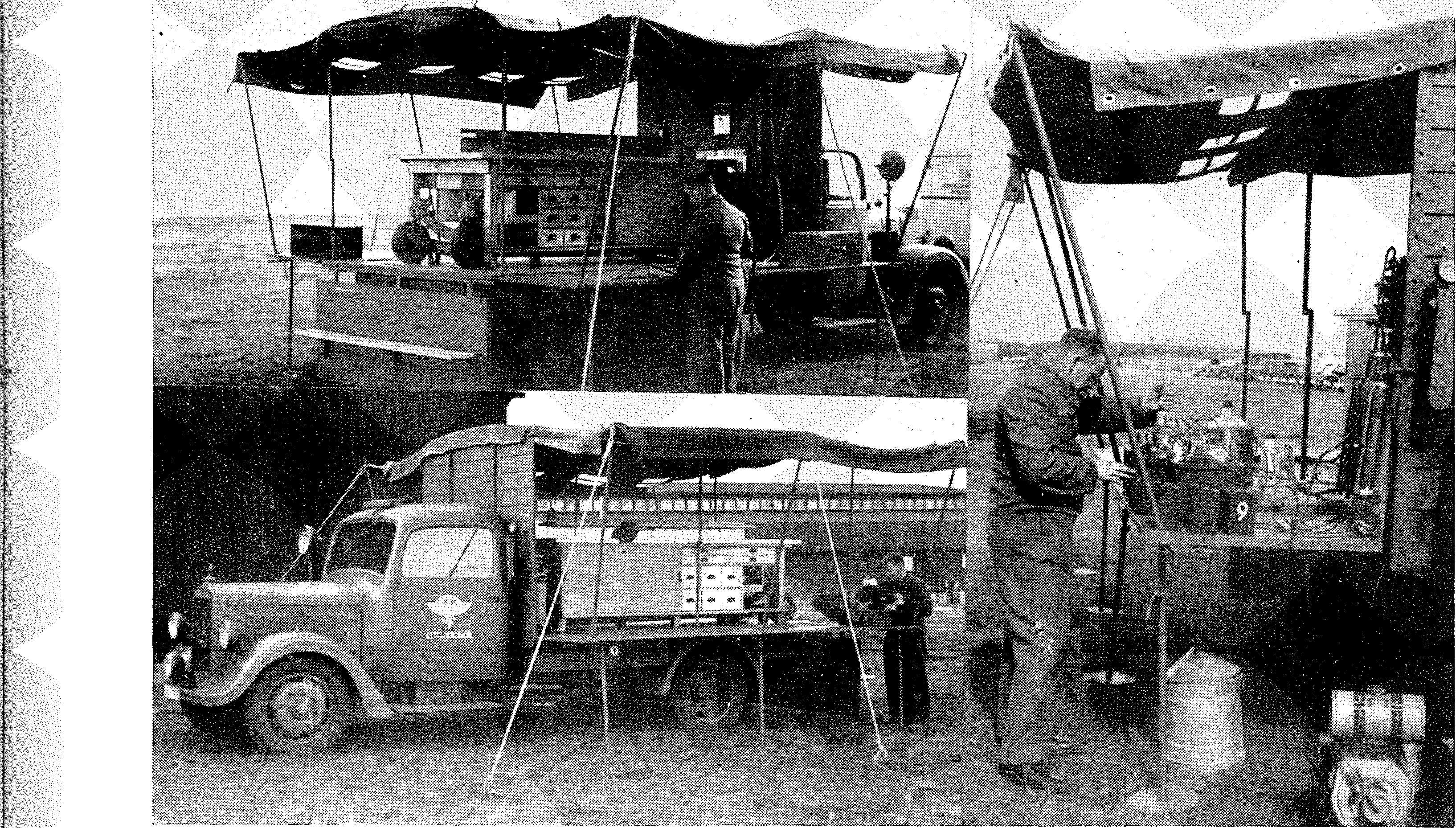
Werkstattwagen der Gruppe 8 (Mitte).
schleppen kann. Ferner Einrichtung für großen Scheinwerfer, um auch nachts taghelle Beleuchtung zu haben. Verdeck gleichzeitig als Zelt.
USA-Ryan XPT-16 Jagdschulflugzeug.
Ryan-XPT-16-Trainings Jagdflugzeug, entwickelt aus dem Ryan-S-T-Sportflugzeug, ist ein verspannter Tiefdecker mit 125-PS-Me-nasco-C-4-Motor.
Flügel Metallbau, leinwandbedeckt, durch doppelte Stromliniendrähte über das feste Fahrwerk verspannt. Die Fahrwerkstöße sind noch weiter durch eine von der Oberseite des Flügels nach der Rumpfoberseite führenden Strebe abgefangen. Flügelprofil NACA 2412. Rumpf Metallbau. Blechverkleidung genietet, Sitze hintereinander. Betriebsstoffbehälter im vorderen Teil des Rumpfes. Leitwerk Metallbau leinwandbedeckt.
Spannweite 9,10 m, Länge 6,5 m, Höhe 2,1 m, Fläche 11,5 m2, Spurweite des Fahrwerks 1,68 m, Betriebsstoff 91 1, Oel 7,6 1.
USA. Ryan XPT - 16.
Werkbild
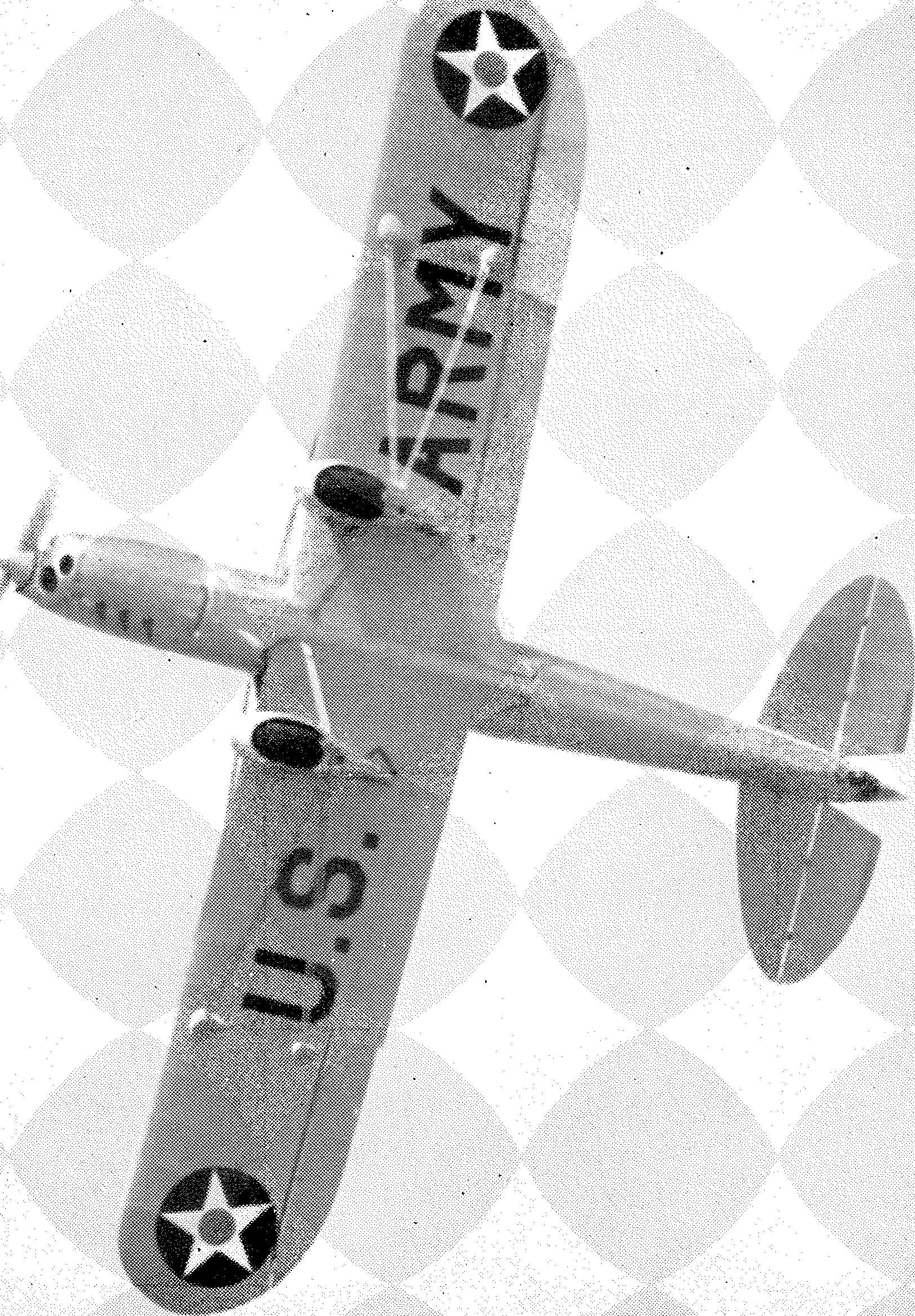
USA. Ryan XPT-16 Jagdschulflugzeug.
Archiv Flugsport
USA Vega-2, Fünfsitzer-Verkehrsflugzeug.
Maßgebend bei der Konstruktion dieses kleinen Verkehrstiefdeckers der Vega Aeroplane Co., Burbank, Kalifornien, war, die Vorteile eines zweimotorigen Flugzeuges, erhöhte Sicherheit bei Ausfall eines Motors, zu erreichen, und andererseits die Nachteile des Zweimotoren-Flugzeuges, erhöhter Widerstand und seitlicher Zug des aus der Rumpfachse liegenden Motors, zu vermeiden.
Zur Verwendung gelangte der in Nr. 14 S. 358 dieser Zeitschrift beschriebene Unitwin-Motor, bestehend aus zwei nebeneinander angeordneten Menasco 6 Zyl'.-Motoren mit einem gemeinschaftlichen Getriebe auf einer Schraube. Die Verringerung des Stirnwiderstandes bei Vergleichsflugzeugen zwischen einem Zweimotor und einem Einmotor betrug für den Einmotor 8%.
Trotz des höheren Gewichtes des Motoraggregates durch das Getriebe ergab sich durch Verwendung nur eines, wenn auch größeren Propellers, erhebliche Gewichtsersparnis durch zwei getrennte Motoreinbauten mit den dazugehörigen Reguliereinrichtungen und Motorverkleidungen. Durch Verringerung des Stirnwiderstandes war es wiederum möglich, mit geringerer Fläche auszukommen. Die Tiefdeckerbauart in Gemischtbauweise zeigt verschiedene
Eigenarten. Der tragende Teil des mittleren Rumpfstückes wird durch ein unter dem Fußboden der
Kabine liegendes Stahlrohrträgerwerk gebildet, an dem auch die Flügel und der Motorbock mit Bolzen befestigt sind. Das hintere Rumpfstück ist gleichfalls an diesem Trägerwerk befestigt. Durch
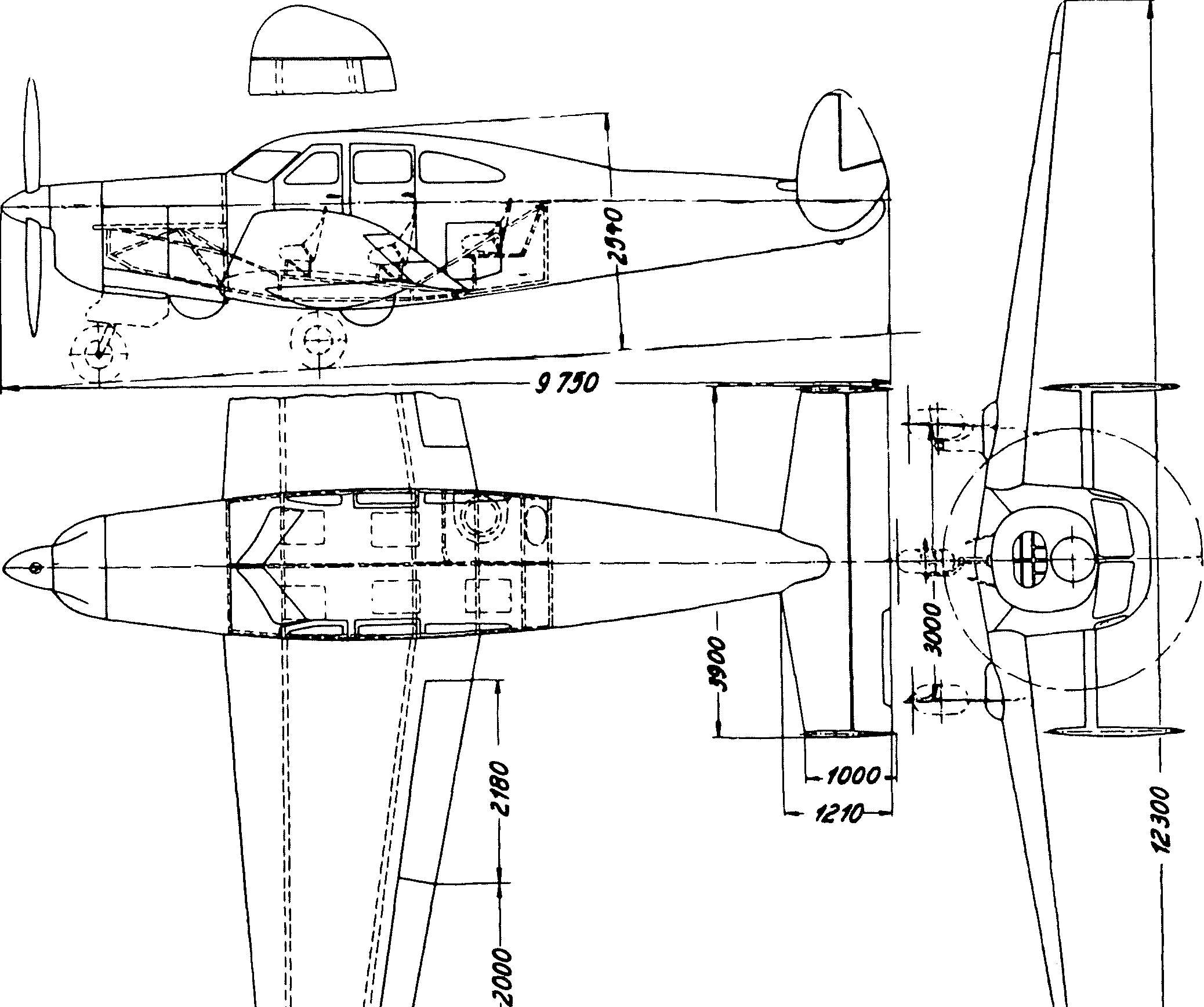
USA. Vega - 2 Fünfsitzer-Verkehrsflugzeug.
Zeichnung Flugsport
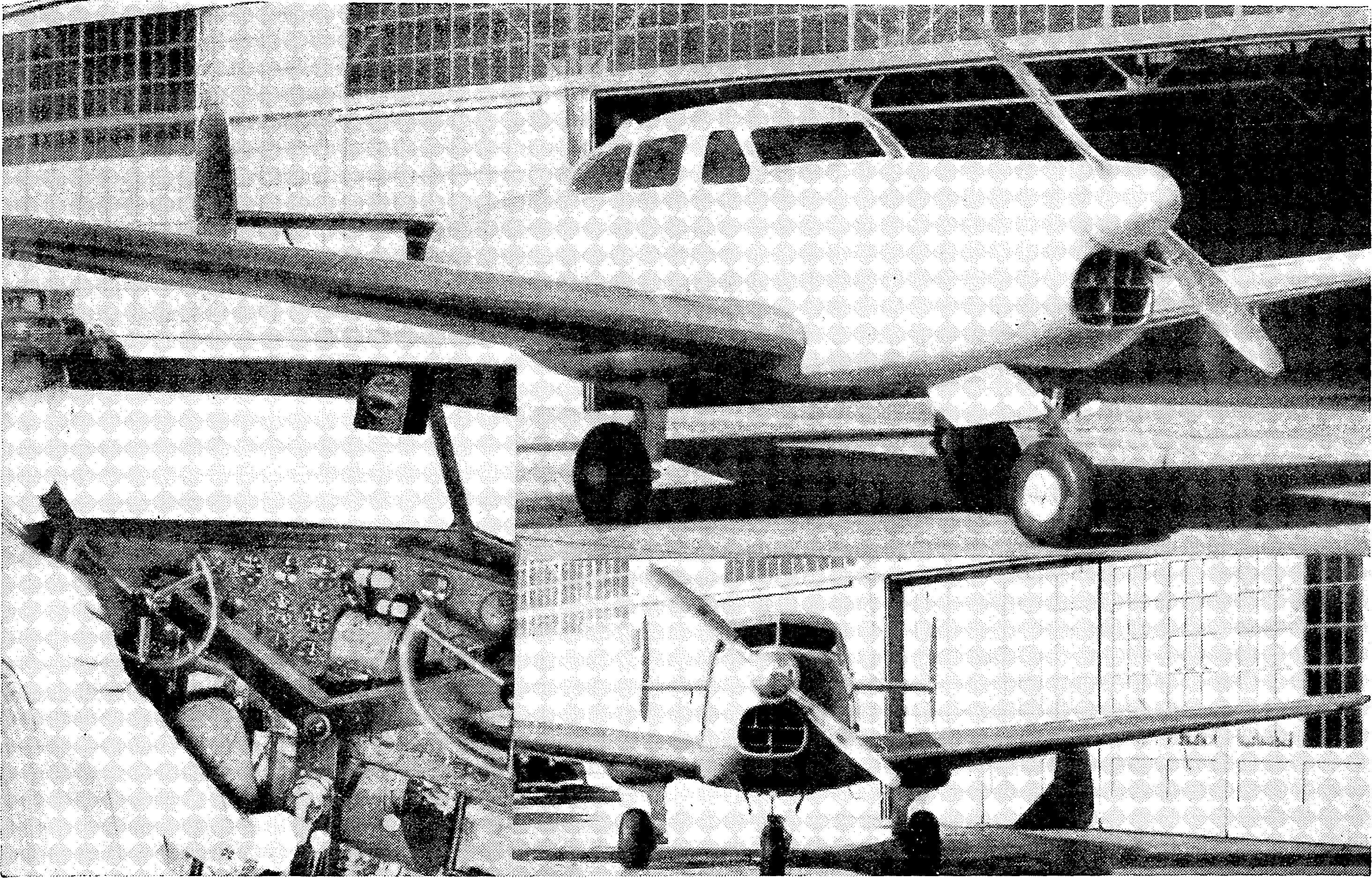
USA. Vega 2 Fünfsitzer-Verkehrsflugzeug mit Unitwin-Motor. Man beachte in der Rumpfnase die Luftverteilerbleche für die beiden Motoren. Unten links: Führerraum mit Doppelsteuerung. Werkbilder
das Innere der Kabine bzw. durch die Kabinenumhüllung gehen keinerlei kraftübertragende Streben. Normal ist die Maschine fünfsitzig, bei Zubringerdienst sechssitzig geflogen.
Fahrwerk zwei hintere Laufräder und ein vorderes Stoßrad. Alle drei hochziehbar, Knickhebelausführung. Im hochgezogenen Zustande der Räder sehen diese noch so weit hervor, daß bei etwa festsitzendem Fahrwerk die Maschine noch rollen kann.
Spannweite 12,51 m, Länge 9,7 m, Höhe 2,59 m, Fläche 27,35m2. Leergewicht 1940 kg, Fluggewicht 2700 kg. Max. Geschwindigkeit 315 km/h, in 3000 m Höhe 338 km/h, Reisegeschwindigkeit 287 km/h, Landegeschwindigkeit (mit Klappen) 100 km/h, Steigfähigkeit auf 3000 m in 10 min., Gipfelhöhe mit zwei Motoren 7000 m, mit einem Motor 3000 m, Reichweite 1030 km = 4 h.
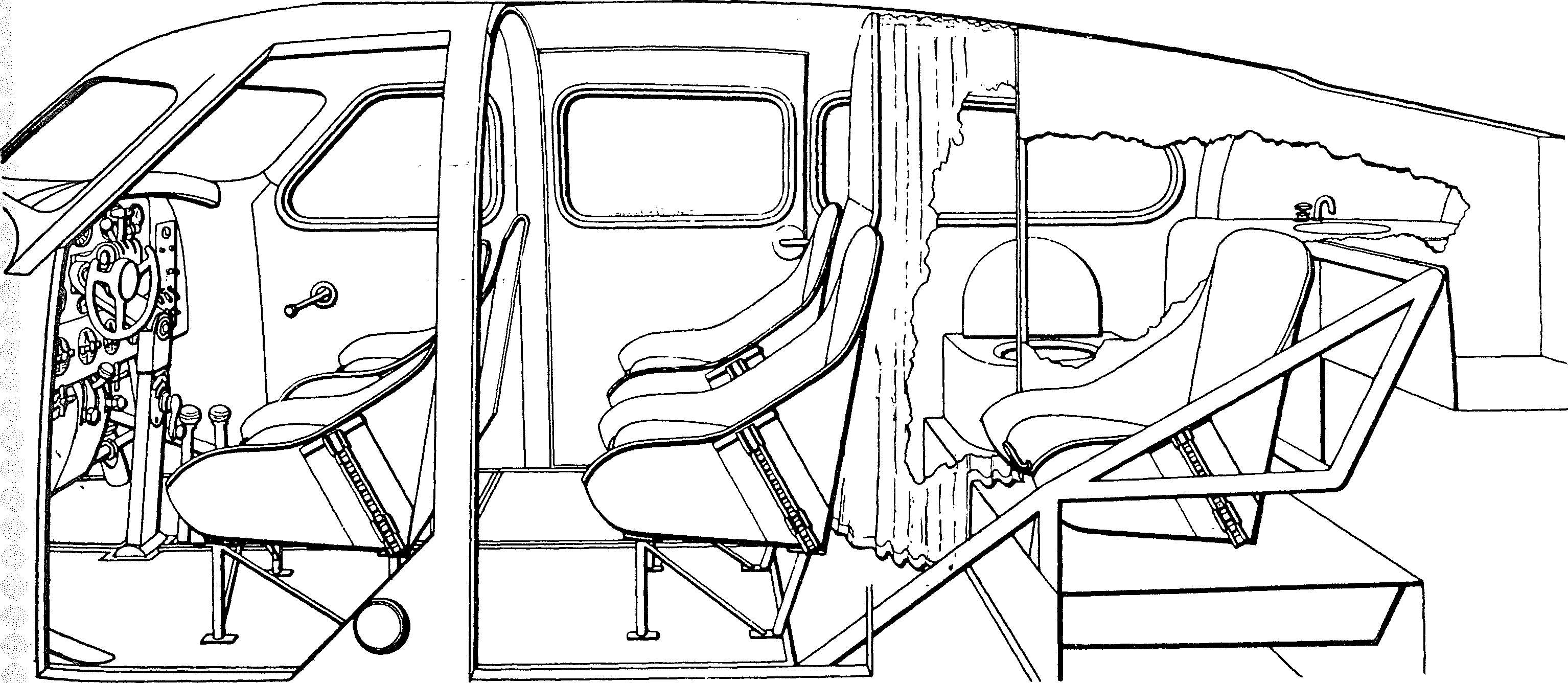
USA. Vega -2 Fünfsitzer-Verkehrsflugzeug. Werkzeichnung
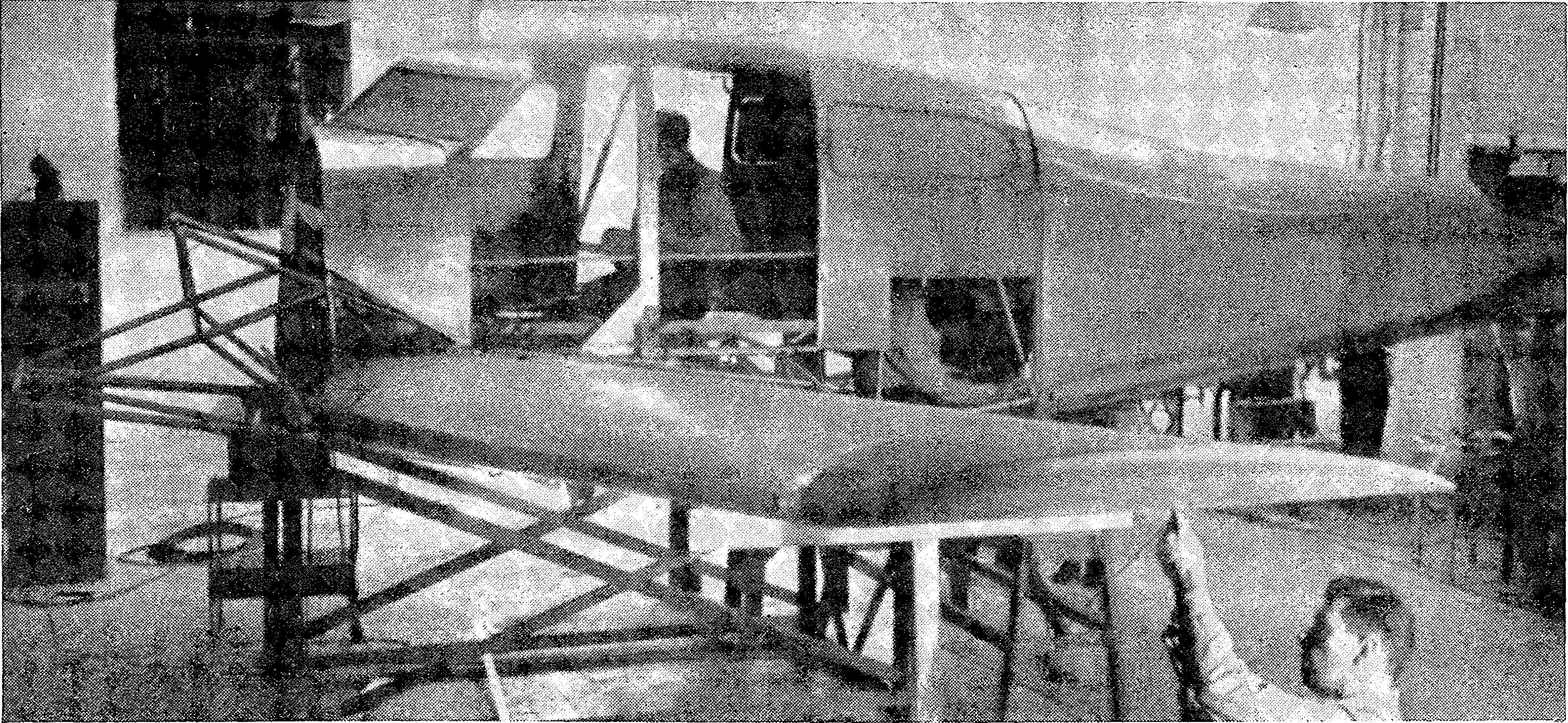
USA. Vega - 2.
Bild: Aviation
USA Consolidated-Zweimotor-FIugboot, Modell 3L
Der neue Typ, Modell 31, der Consolidated Corp., San Diego, von der Firma selbständig entwickelt in der Hoffnung, daß es später von der Marine angenommen wird, ist ein Zweimotor-Schulter-decker. Flügel von verhältnismäßig geringer Tiefe und geringer Profilhöhe, größte Wölbung im ersten Drittel, entworfen von Davis. Zwischen Querrudern und Rumpf hydraulisch betätigte Fowler-Klappen. Qlattblechflügelhaut, Querruder und Klappen leinwandbedeckt. Betriebsstoffbehälter im Mittelstück, seitliche Stützschwimmer an die Unterseite der Ansatzflügel hochziehbar. Motorachse des Motorenvorbaus geht durch den Flügel. Verkleidung infolge Einbeziehung von Oelkühler, Vergasereinlaß, etwas elliptisch.
Zwei 18 Zyl. Wright-Doppelstern-Duplex-Cyclone-Motore von je 2000 PS Startleistung. Zwei Dreiblatt-Hamilton-Hydromatic-Luftschrauben von 4,87 m Durchmesser. Boot, zwei Decks. Oben Raum für 2 Führer, 1 Ingenieur, 1 Funker und Navigator. Unterdeck acht Abteile, normal für 28 Fluggäste für Ozeanverkehr, max. 52 Fluggäste für kürzere Strecken. Bootunterseite stark gekielt,
einstufig hinter der Stufe in eine senkrechte Schneide auslaufend. (Do X-Erfahrung.)
Leitwerk, Metallbau, leinwandbedeckt. Fahrwerk hydraulisch hochziehbar, vordere Bugräder doppelt, hintere beiden Räder seitlich in den Rumpf einziehbar. Im hochgezogenen Zustand sind die Räder durch Türen verdeckt.
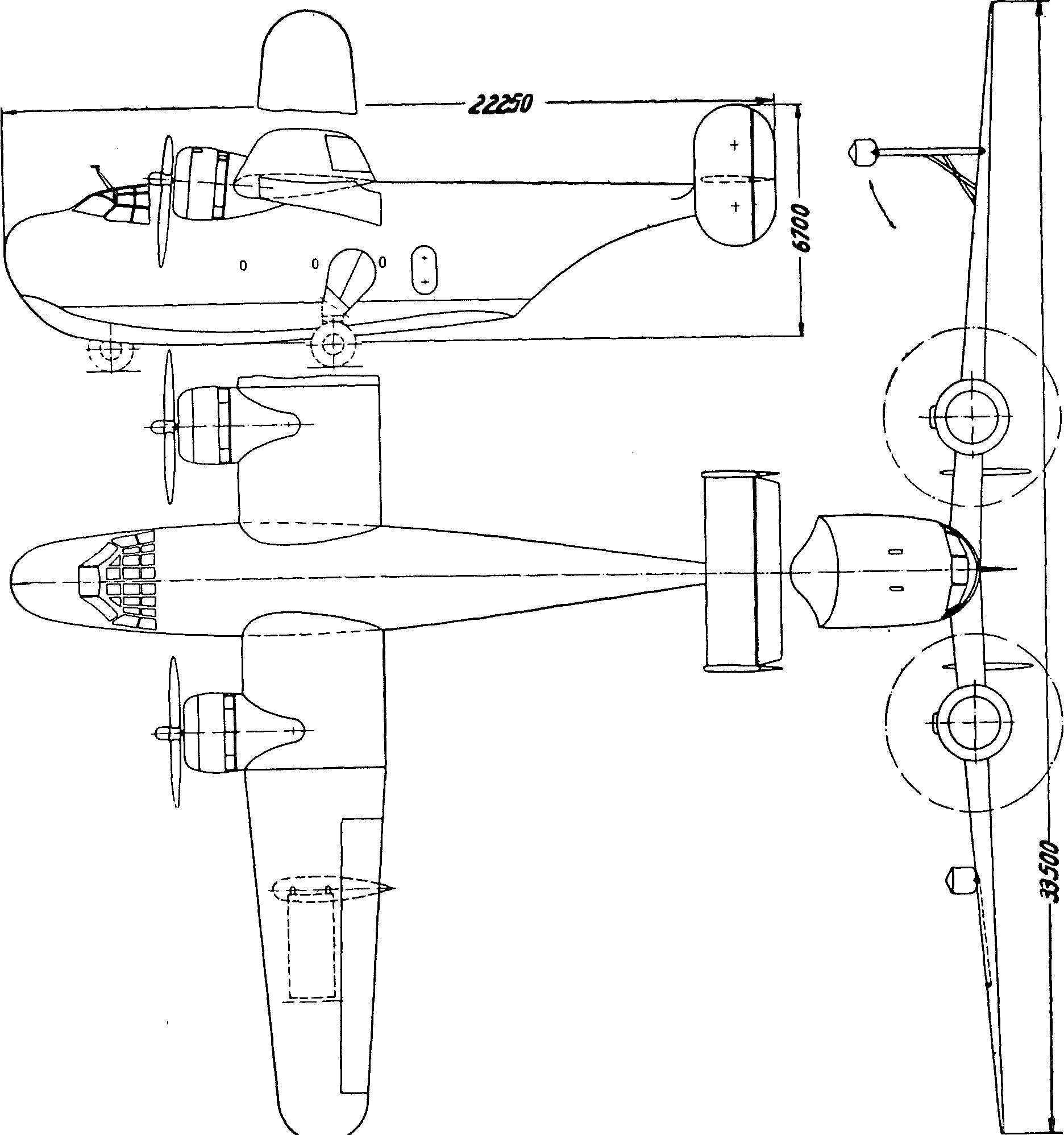
USA. Consolidated Flugboot Modell 31.
Zeichnung Flugsport
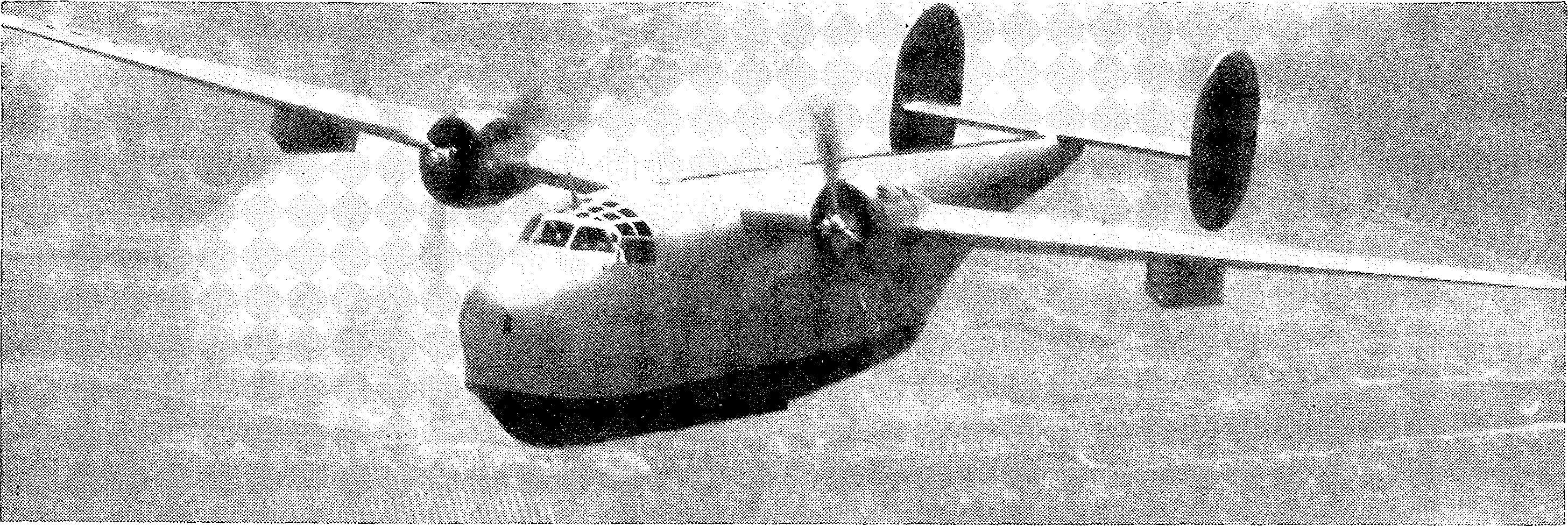
USA. Consolidated Zweimotor-Flugboot Typ 31. Werkbüd
Spannweite 33,52 m, Länge 22,3 m, Höhe 6,70 m5 max. Flügeltiefe 4,26 m, Fluggewicht 22 660 kg, Flächenbelast. 225 kg/m2. Man hofft, eine Geschwindigkeit von 450 km zu erreichen.
Engl. Marine-Zweisitzer Blackburn „Roc".
Die engl. Marine hat einen Zweisitzer, konstruiert von Blackburn, als Schiffsbei-, Land- und Zweischwimmerflugzeug entwickelt. Das seitlich hochklappbare Fahrwerk bei der Landmaschine kann gegen zwei nicht hochziehbare Schwimmer ausgewechselt werden. Das Flugzeug ist als Katapultflugzeug mit stationären kleinen Sondereinrichtungen ausgestattet. Der Roc gleicht in seinem konstruktiven Aufbau, dem Skua - Sturzbomber. Flügel zurückklappbar, Rumpf mit tragender Außenhaut und wasserdichten Schotten. Seitenflosse und Ruder sehr weit vor der Höhenflosse liegend. Ueber dem Führersitz Schiebehaube, dahinter drehbarer MG-Turm, Zugang vom Führerraum.
Der hinter dem MG-Turm liegende gewölbte Luftabfluß, in der Abbildung durch die Flügelspitze teilweise verdeckt, kann im Gefecht, um das Schußfeld zu vergrößern, in den Rumpf eingezogen werden.
Spannweite 13,9 m, Länge 10,6 m, Höhe 3,6 m. Herstellerwerk für Serie Boulton-Paul.
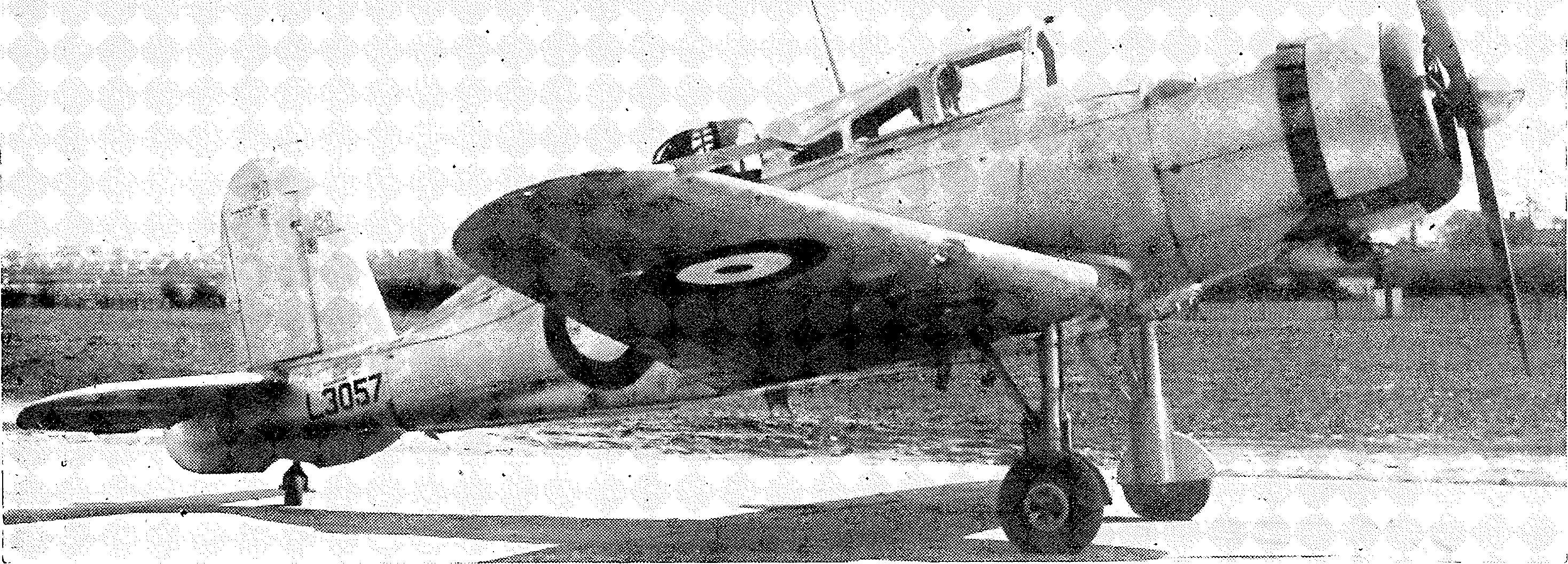
Engl. Marine-Zweisitzer Blackburn „Roc".
Archiv Flugsport
USA Allison 24 Zyl. 2600 PS.
Die Allison Engineering Co., Indianapolis, Ind./USA, hat ein Motorenaggregat aus zwei nebeneinander gelagerten, auf einer Schraubenwelle arbeitenden Allison - Motoren herausge-
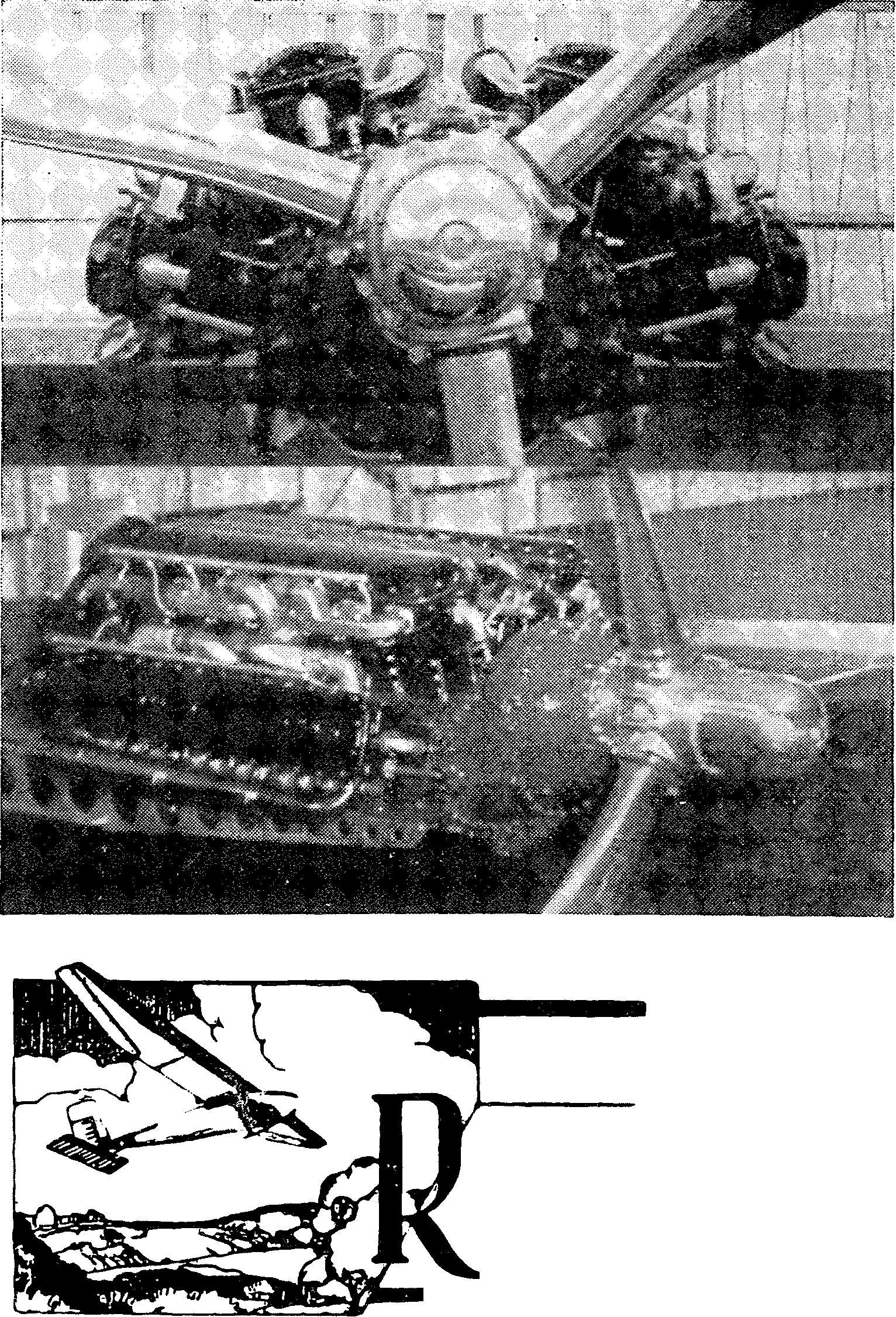
bracht. Der einzelne Motor der neuen Allison-Serie, 29 1, entwickelt 1280 PS. Die beiden gekuppelten Motoren zusammen 2600 PS. Untersetzungsgetriebe 2 : 1. Dreiflügelige Ha-milton-Schraube von 5,52 m Durchmesser. Vorverdichter liegt hinter dem Motor und wird durch eine lange, biegsame Welle von der Vorderseite des Motors angetrieben.
Hubvolumen 58 1, Leistung 2150 PS am Boden und 2600 PS in 7500 m. Flüsigkeitgekühlt. Höhe 1,05 m, Breite 1,85 m.
Allison XB- 3420.
Archiv Flugsport
PLUG
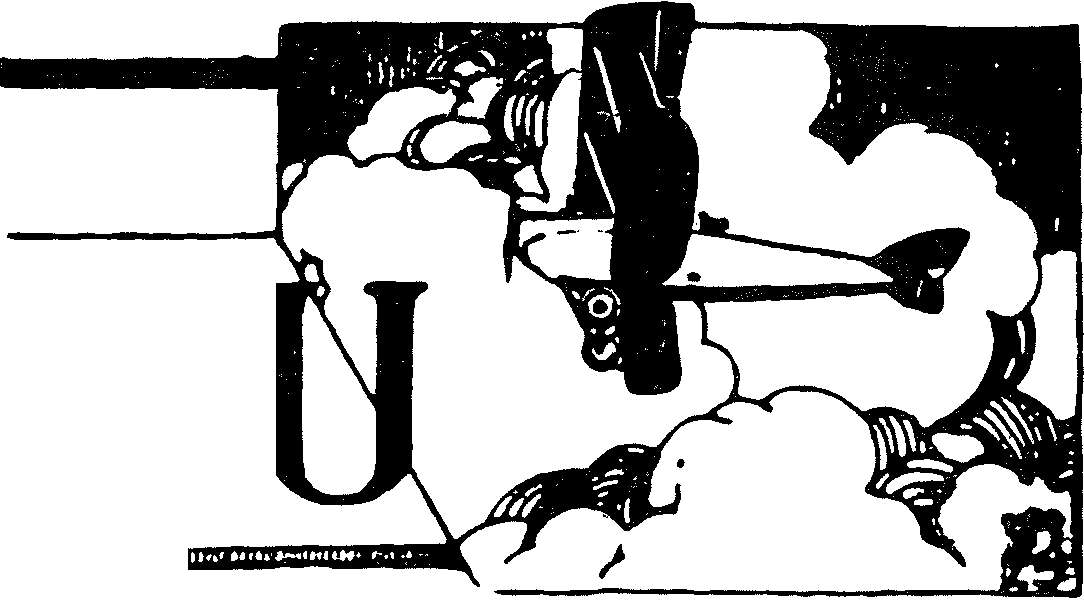
Inland.
Frankfurter Fliegertage.
In den Tagen vom 28.—30. Juli war auf den beiden Flugplätzen, Flughafen Rhein-Main und dem Flugplatz Rebstock, Großbetrieb. Der Korpsführer veranstaltete das zweite internat. Luftrennen und die deutsche Geschicklichkeitsflugmeisterschaft 1939. Weiter hatte der Aero-Club die internationalen Sportflieger nach Frankfurt am Main eingeladen. Und damit die „alten Adler" etwas von der heutigen Fliegerei zu sehen bekamen, fand das Jahrestreffen der Vor-

Frankfurter Fliegertage. Von links: Der Schirmherr Gauleiter Sprenger mit dem Korpsftihrer General der Flieger Christiansen. Bild Winkelser

Frankfurter Fliegertage. Links: Fliegende Generale. Rechts: Stoppuhren an der
Zielkontrolle. Bil(ier: Winkeiser
kriegsflieger 1939 in Frankfurt statt. Die „alten Adler" waren fast vollzählig zur Stelle. Nach einer Kranzniederlegung am Ehrenmal und Besichtigung der Frankfurter Flugplätze fand am 29. mittags ein Empfang durch den Oberbürgermeister Staatsrat Dr. Krebs im Bürgersaal und ein Kameradschaftsabend der „alten Adler" im Frankfurter Hof statt.
Oberbürgermeister Dr. Krebs erinnerte in seiner Begrüßungsrede, von der ILA ausgehend, an die Verdienste um die Entwicklung

Frankfurter Fliegertage. Vom Luftrennen. Links: Rennen Klasse ß, Neubürger, Dresden, auf F 5. Rechts: Matthiesen, Rangsdorf, auf Kl 35 A und Hptm. Nestemeyer, Rechlin, auf Qo 150. Bilder rWinkelser
des deutschen Flugwesens der Stadt Frankfurt und seiner Bürger. Staatssekretär a. D. Dr. Euler und Hans Grade gaben Ueberblicke über die geschichtliche Entwicklung der deutschen Fliegerei. Walter Mackenthun dankte namens der „alten Adler" für den herzlichen Empfang in Frankfurt. Anschließend erfolgte die Ehrung der 25jährigen Jubilare.
Zu dem internationalen Sportfliegertrefffen trudelten auf dem Flughafen Rhein-Main annähernd 200 Ausländer ein, darunter allein 60 Engländer, denen es in früheren Jahren so gut in Frankfurt gefallen hatte, daß sie dieses Jahr unbedingt wieder dabei sein wollten. An dem Empfang am 28. im Frankfurter Hof schloß sich am 29. eine Rheinfahrt, am 30. Besuch des Internat. Rennens und am 31. Besuch der Wasserkuppe an. Die Teilnehmer waren von ihrem Frankfurter Besuch begeistert und werden im kommenden Jahre unbedingt wieder dabei sein.
Den Höhepunkt bildete am Sonntag das Luftrennen auf dem Flugplatz Rebstock, welches über eine Dreiecksstrecke von 30 km führte. Rennen Klasse A für Flugzeuge mit mindestens 200 km/h, über 150 km, wobei die Rundstrecke 5mal, und Klasse B für Flugzeuge bis 140 km/h über 120 km, wobei die Strecke 4mal zu umfliegen ist.
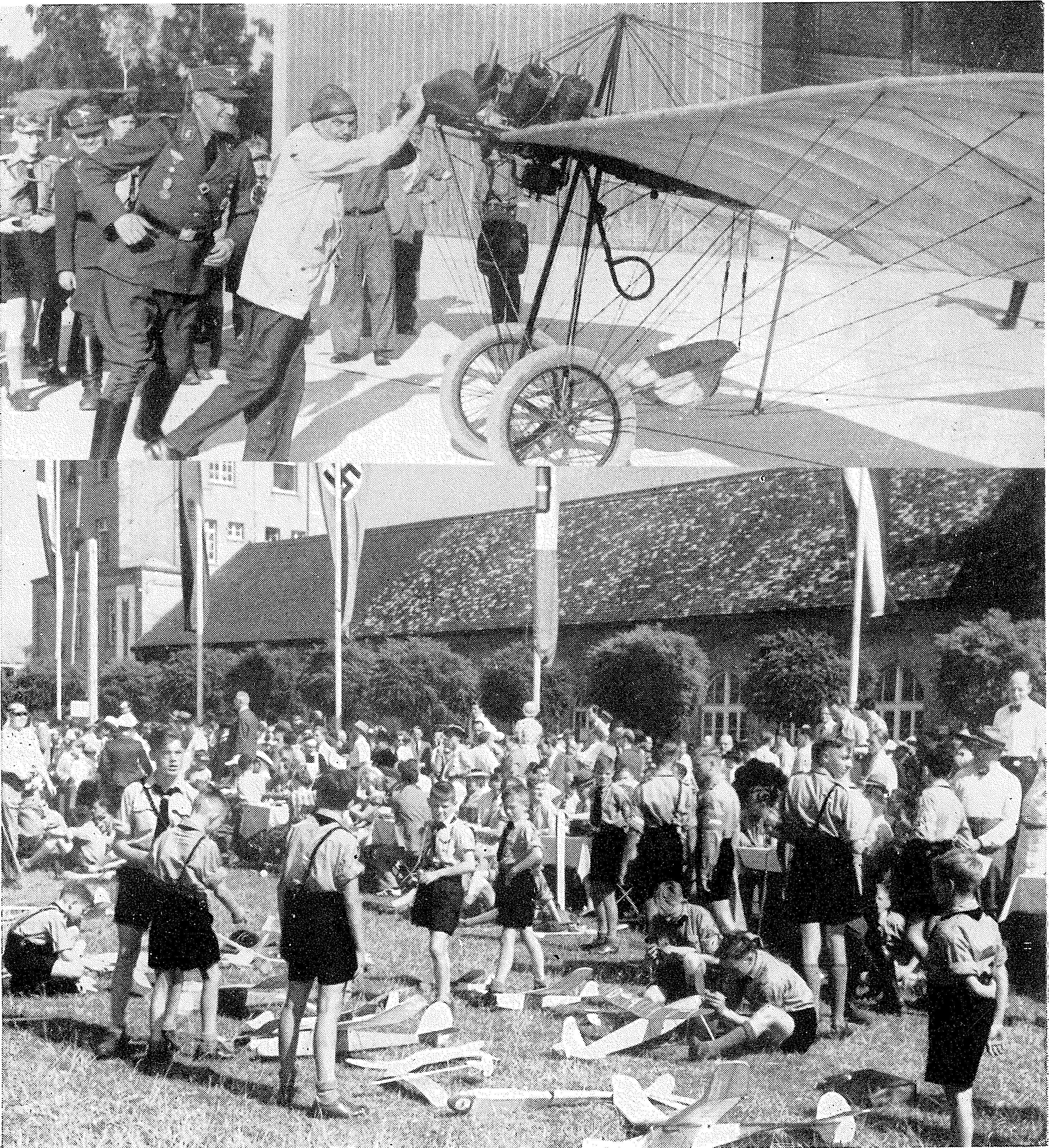
Frankfurter Fliegertage. Oben: Alte Zeit der alten Adler. Grade wirft seinen Motor an. Unten: Neue Zeit: HJ. mit ihren Modellen. Bilder:Winkelser
Der Großflugtag auf dem Rebstock mit über 150 000 Zuschauern war die größte fliegerische Veranstaltung dieses Jahres.
Nach der Siegerehrung überreichte der Korpsführer allen Teilnehmern die Erinnerungsplakette und später dem Gauleiter Reichsstatthalter Sprenger die goldene Förderernadel des NSFK. Hiernach sprach der Korpsführer zu Herzen gehende Worte an alle Beteiligten:
„Wir wissen, daß jeder fliegerische Erfolg ein Werk der Gemeinschaft ist. Wenn heute die ausländischen Kameraden in ganz großer Zahl zu uns gekommen sind, so können wir feststellen, daß die fanatische Fliegerkameradschaft alle Flieger über alle Grenzen hinaus beseelt. Die Sieger in dem heutigen Wettbewerb waren ohne Ausnahme Deutsche. Wenn wir unter ausländischen Kameraden keine Sieger finden, da darf ich darauf hinweisen, daß ich heute vormittag beim Start bereits sagte: Einer muß vorn sein, die andern sind in der Mitte, und einer muß am Schluß aufpassen, daß keiner zurückgeblieben ist."
In Zukunft sollen alle Kämpfe um die Deutsche Meisterschaft im Geschicklichkeitsflug und das alljährliche internat. Luftrennen in Frankfurt a. M. durchgeführt werden. Der Veranstaltungsrahmen der fliegerischen Schau soll im nächsten Jahr noch größer werden. Nachdem der Korpsführer auf die Fliegerkameradschaft zwischen allen Nationen hingewiesen hatte, ehrte er den beim Luftrennen tödlich verunglückten Taxis, dessen Leben für jeden jungen Flieger ein Vorbild sein soll. Vom Führer ging folgendes Telegramm ein:
„Den in Frankfurt a. M. zur Flugveranstaltung des NS.-Flieger-korps und zur Wiedersehensfeier versammelten Vorkriegsfliegern danke ich für die mir übermittelten Grüße, die ich in kameradschaftlicher Verbundenheit herzlichst erwidere. Adolf Hitler."

Vom Mitteldeutschen Rundflug. Oben links: Dresden-Heller. Rechts: Zwischenlandung Regensburg. Unten links: Zwischenlandung Karlsbad. Rechts: Sieger auf Focke-Wulf „Stieglitz": Oberltn. Schulz (Lfl. Kdo. 3) und Ltn. v. Kiesling (links),
Bilder NSFK.-Qruppe 8
Ergebnisse:
Kunstflugmeisterschaft: Erster OberfeldwebelFalderbaum mit 1256,49 Punkten, hiernach folgen Oberltn. Eckerle mit 958,66 Pkt., NSFK.-Sturmführer Friedrich mit 947,99 Pkt., Ltn. Molenaar, Wien, mit 826,99 Pkt., NSFK.-Sturmführer Weichelt, Fürth, mit 805,33 Pkt. und NSFK.-Obersturmführer Helm, Ulm, mit 723,50 Pkt.
Im 2. internat. Luftrennen, Klasse A Sieger NSFK.-Sturmf. Kuhn, Brandenburg; 2. Oberstltn. Junck RLM.; 3. Mücke, Gotha. Klasse B Sieger NSFK.-Sturm-bannf. Neubürger, Dresden; 2. NSFK.-Sturmbf. Gerbrecht, Essen; 3. Rapp, Gotha.
501 km/h mit 2000 kg Nutzlast erreichten am 30.7. auf Junkers-Bomber Flugzf. Ernst Seibert und Kurt Heintz. Gleichzeitig sind mit diesem Flug 2 weitere internat. Rekorde über der 2000-km-Strecke aufgestellt, und zwar mit 1000 kg und ohne Nutzlast. Die Meßstrecke Dessau—Zugspitze 500 km wurde viermal durchflogen. Start 5 h, Landung 9 h.
Internationale Rekordanerkennung. Klasse C. Größte Geschwindigkeit über Grundstrecke (Deutschland): Flugzeugführer: Flugkapitän Fritz Wendel. Flugzeug: Messerschmitt Bf 109 R. Motor: DB 601 1000 PS. Augsburg, 26. April 1939, 755,138 km/h.
Mitteldeutscher Rundflug 15.—16. 7. Auf dem Flugplatz Dresden-Heller starteten 46 Flugzeuge. Flugstrecke 1. Tag: Karlsbad—Nürnberg—Regensburg— Marienbad (letzterer Uebernachtungsflughafen). Unterwegs waren verschiedene Orteraufgaben zu lösen. 2. Flugtag: Marienbad—Bautzen—Dresden nach Braunschweig—Waggum, welches nachmittags erreicht wurde. Ueber dem Steinhuder Meer gab es noch einen Zielabwurf, Mindesthöhe 5 m. Die letzte Aufgabe war Ziellandung: Drosseln des Motors in 300 m Höhe auf Leerlauf und ohne Gasgeben in einem 200X30 m messenden Zielfeld landen, in dessen Mitte ein Kreuz ausgelegt war. Gewertet wurde der Abstand des Flugzeugs vom Kreuz. Diese Verfügung wurde einer Luftwaffenbesatzung, die bis Braunschweig an erster Stelle führte, zum Verhängnis. Durch zu stark blockierte Bremsen stellte sich die Maschine auf den Kopf, und der Wettbewerber schied aus.
Ergebnisse: 1. Obltn. Schmitz u. Lt. v. Kiesling (Geschwader Ansbach) auf Fw 44 „Stieglitz", 438 Pkt.; 2. NSFK.-Rottenf. Ferger u. NSFK.-Truppf. Schmidt (NSFK.-Gr. 2) auf Klemm Kl 35b, 418Pkte.; 3. Obltn. Lignitz u. Obfeldw. Schmidt (Luftkriegsschule Dresden) auf Fw 44 „Stieglitz", 411 Pkt.; 4. Uoffz. Kössinger u. Lt. Wagner (Aufklärungsgr. 222) auf Fw 44 „Stieglitz", 379 Pkt.; 5. Uoffz. Wraage u. Lt. z. See Manke (Küstenaufklärungsstaffel 2/606) auf Fw 44 „Stieglitz", 378 Pkt.; 6. NSFK.-Sturmmann Anders u. NSFK.-Sturmmann Limbach (NSFK.-Gr. 7) auf Siebel „Hummel", 372 Pkt.
„Condor"-Südamerika-Ueberführungsflug Focke-Wulf D-ABSK erfolgte am 26. 7. mit Uebernachtungen in Sevilla und Dakar. Landung Natal am 28. 7. 17,55 h. Erzielte Reisegeschwindigkeit 314 km/h. Besatzung Flugkpt. Kramer v. Clausbruck, Flugkpt. Grüttering, Obflugmasch. Rosinski, Obflugzgfunk. Stein, Obfunk-masch. Salz. Weiterflug Rio de Janeiro 29. 7.
Was gibt es sonst Neues?
Lucht, Fliegerhauptstabsingenieur, leitender Chefingenieur beim Generalluftzeugmeister, wurde am 3. 7. 39 vom Generalfeldmarschall zum Fliegerchefingenieur befördert.
Mr. C. G. Grey, der Begründer und langjährige Herausgeber der ausgezeichneten engl. Zeitschrift ''The Aeroplane" überträgt seine Tätigkeit Ende August Edwin Colston Shepherd, bisher Flugwesen-Korrespondent der Times.
Friedrichshafen-Luftschiffbau hat, wie „Flight" vom 20. 7. berichtet, Flugzeugbau aufgenommen. Bau des LZ. 131 eingestellt.
3. Mailänder Salon 2,—17. 10. Neben der ital. und deutschen Flugzeugindustrie wird auch England, Frankreich und Amerika beteiligt sein.
Alfa-Romeo-Verstellschraube mit genauer Einstellbarkeit, bis zur Segelstel-Inn* feststellbar. Ausland.
Engl, Geschwaderflüge über Frankreich und zurück, bestehend aus 5 Geschwadern Vickers Wellington, 2 Geschwadern Armstrong Whitworth Whitley, verschiedenen Geschwadern Bristol Blenheim, am 11.7.108 Flugzeuge, am 19.7. 95 Flugzeuge.
Flughafen Boulogne 29. 1, eröffnet.
Langstreckenflug Rossi, Start Istres 27. 7. 4,57 h, ist in der Nacht zum 28. 7. 0,38 h nach einem Flug von 19 h 41 min und Zurücklegung von 5180 km wegen Störung des linken Motors durch Notlandung in Cagliari auf Sardinien abgebrochen worden.
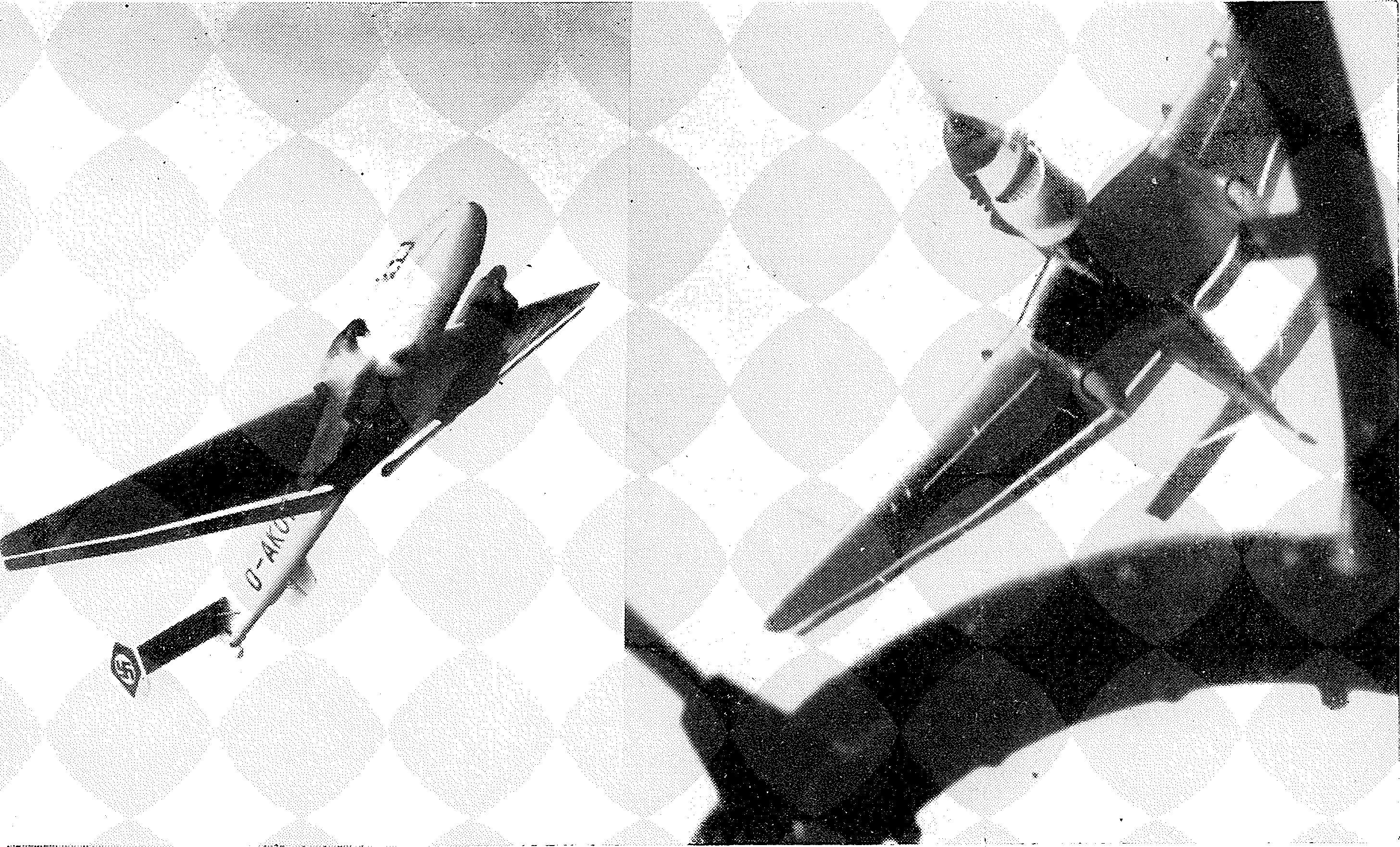
Von den Flugzeugtypenvorführungen in Evere (Brüssel). Links; Schnellverkehrsflugzeug Junkers Ju 86 mit zwei Junkers-Schwerölmotoren. Flugzeugführer Arthur Link macht Loopings und andere Kunstflugfiguren. Rechts: Die Vorführung des Junkers-Sturzkampfflugzeuges Ju 87 bildete den Höhepunkt der Veranstaltung.
Freigegeben durch RLM JFM/Dessau.
Coupe Deutsch: Teilnehmende Flugzeuge: 1 Holste, 1 Regnier, 3 LigneL 1 Payen, 2 Cie. de Productions et Realisations Aeronautiques, 1 Bugatti.
Sportflugzeuggruppen in Belgien: Brüssel: Club d'Aviations de Bruxelles und Club National d'Aviation; Antwerpen: Antwerp Aviation Club; Lüttich: Cercle Liegeois d'Aviation de Tourisme; Courtrai: Golden River Aviation Club; Gosselies: Club Aeronautique Caroloregien; St. Hubert: Les Ailes Afdennaises; Gent: Ghent Aviation Club und Section Gantoise de Vol sans Moteur; Tirlemont: Le Milan. Fünf dieser Clubs haben auch Schulungskurse, die dem belg. Staat unterstehen.
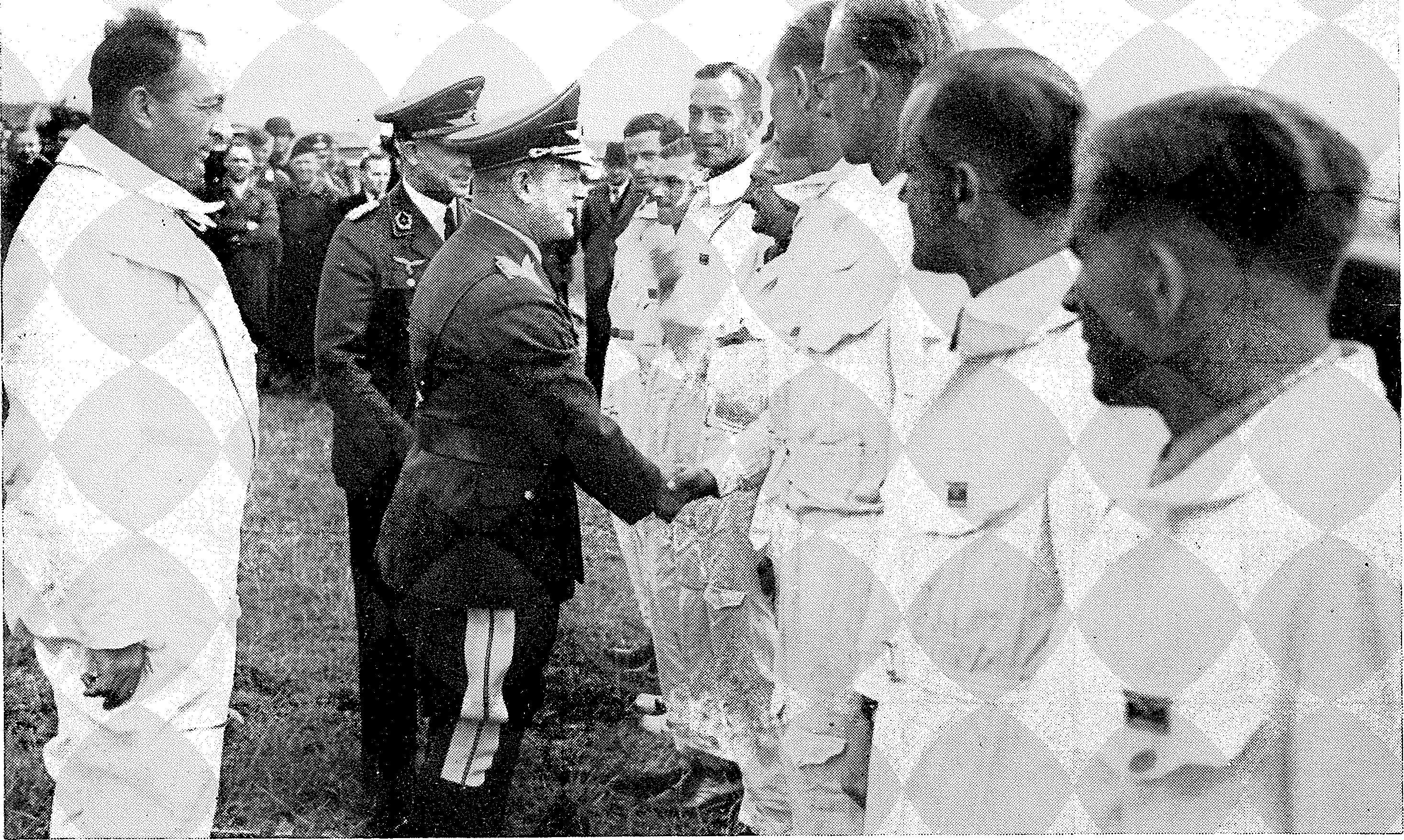
Staatssekretär Generaloberst Milch begrüßt die erfolgreichen deutschen Italienrundflieger bei ihrer Rückkehr auf dem Flughafen Tempelhof. Weltbild
Flugzeugtypenvorführung in Evere, 18. 7., wurde beherrscht durch die Vorführungen der Deutschen. liier überraschten die Kunstflugvorführungen mit der Klemm 35, Hanna Reitsch mit dem Habicht und die mit einer Junkers Ju. 86. Flugzeugführer Link flog mit der Ju 86 mit zwei Junkers-Schwerölmotoren Loopings und andere Kunstflugfiguren vor und anschließend abwechselnd mit stehendem rechten und linken Motor. Auch unter diesen Bedingungen zeigte die Ju 86 noch verblüffendes Steigvermögen und eine überraschend gute Steuerbarkeit. So wurden z. B. im Einmotorenflug noch hochgezogene Steilkurven einwandfrei ausgeführt.
Die Vorführung des Junkers-Sturzkampfflugzeuges Ju 87 bildete den Höhepunkt der Veranstaltung. Engl, und französ. Fachleute gaben zu, noch nie einer solchen Sturzflug-Vorführung beigewohnt zu haben, wie sie Flugkapitän Matthies mit der Ju 87 aus 3000 m Höhe vorführte. Auch das mit der Ju 87 vollendet vorgeflogene schwierige Kunstflugprogramm, das u, a. einen halben Looping aus der Rückenlage nach oben mit anschließender Rolle enthielt, fand uneingeschränkte Bewunderung.
Ital. Flugwettbewerb „Raduno del Littorio" war eine außerordentlich scharfe Leistungsprüfung für Maschinen und Flugzeugführer. Zunächst die technischen Prüfungen bestanden aus Landung, Nachtflug und 1200-km-Gleichmäßigkeitsprüfung, um eine Gewähr für den zivilen Luftverkehr zu erbringen. Die Reihenfolge zum Geschwindigkeitsrennen am letzten Tage erfolgte nach dem Stand der Punktbewertung. Hier mußte eine Rundstrecke zehnmal, entsprechend 500 km, durchflogen werden. Aus dem erbitterten Kampf zwischen Dietrich auf Messerschmitt „Taifun" mit Hirth-Motor HM 508 D und Parodi auf SAI 7 ging Dipl.-Ing. Dietrich, der Gewinner des Vorjahres, als Sieger hervor. Dietrich, zugleich Sieger in der Gesamtprüfung, erhielt die Coppa Mussolini, Parodi den Preis des Kaisers und Königs von Italien. Bemerkenswert war, daß sämtliche Flugzeuge mit Hirth-Motoren ausgerüstet waren.
Macchi C 3CÖ, Jagdflugzeug, mit Fiat A 74 R. C. 30, 840 PS, Einsitzer, Metallbauweise, Verschwindfahrwerk, Spannweite 10,58 m, Länge 8,19 m, Höhe 5,51 m, Fläche 16,80 m2. Leergewicht 1770 kg, Nutzlast 430 bis 700 kg, max. Geschwindigkeit in 4800 m 505 km/h, Landegeschwindigkeit .125 km/h, Steigfähigkeit auf 6000 m in 6 min 30 sec, Gipfelhöhe 10 400 m, Start 180 m, Auslauf 475 m, Reichweite 700 km.
USA-Luftwaffe bestellte Motoren bei Allison Engineering Co. für 15 Millionen $, bei Wright Aeronautical Corp. für 9 Millionen $ und bei Pratt & Whitney für 1 Million $.
Boeing B-17B, Viermotor-Bomber ist der gleiche Typ wie B-17A, welcher am Anfang des Jahres abstürzte, vgl. „Flugsport" Seite 191, 1939. Die nebenstehende Abbildung zeigt den letzten Typ B-17B. Motoren vier Wright Cyclone je 1000 PS. Spannweite 31,5 m, Länge 21 m, Höhe 4,5 m. Fluggewicht 22 t. Bestückung 5 MGs. Eins in der Rumpfnase und vier in MG-Nestern oben seitlich und unter dem Rumpf. Besatzung 7—9.
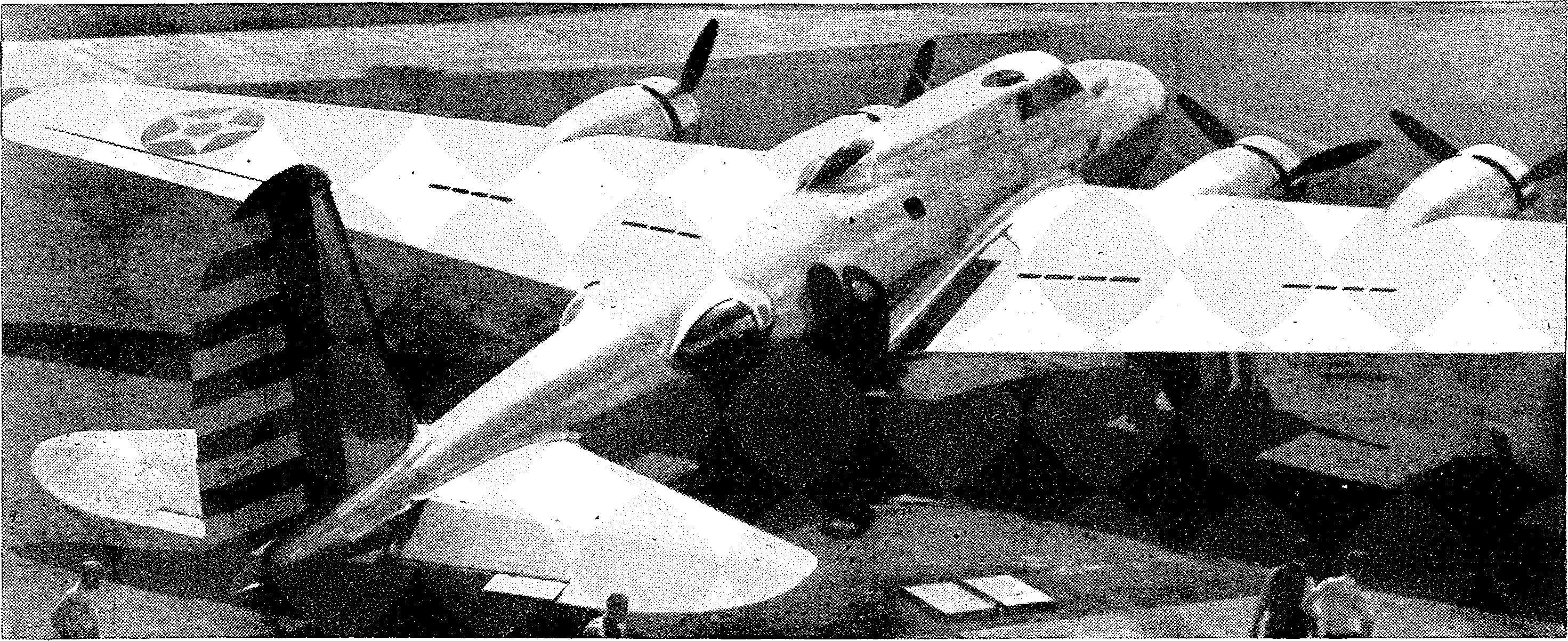
Boeing B-17B Viermotor-Bomber. Werkbild
© Segelflug
6000 m Höhe segelte Hartmann, NSFK.-Truppf., Leistungslager Bautzen, auf „Minimoa"'. Maschine vereiste und wurde durch Hagel beschädigt. Flug mit Barograph.
Rolf Mink, Eschwege, 11 Jahre, legte im Gelände der Segelflugschule Harsberg B-Prüfung ab. Mithin wohl der jüngste Segelflieger.
Engl. Segelflugwettbewerb Great Hucklow, 8.—16. 7. Sieger Nicholson, längster Flug 250 km Great Hucklow—Southampton Flughafen; Zweiter wurde P. Wills mit einem Flug nach Southend Airport 236 km. Am 11.7. segelte Joan Price 110 km in die Nähe von Boston. Leider war bei diesem 10. engl. Segelflugwettbewerb ein Todesopfer, Frank Charles, zu beklagen.
Intern. Wettbewerb für Segelflugmodelle Jämi-Järvy, im finnischen Segelfluggelände, nahmen 40 Finnen, 6 Schweden, je 1 Litauer, Estländer und Lettländer sowie 3 Vertreter der NSFK.-Gruppen 15, 8 und 13 teil. Sieger wurde Hitlerjunge Gebhard Müller (NSFK.-Gr. 15), bekannt aus seinen Erfolgen im Pfingstmodellwettbewerb 1939 auf der Wasserkuppe.
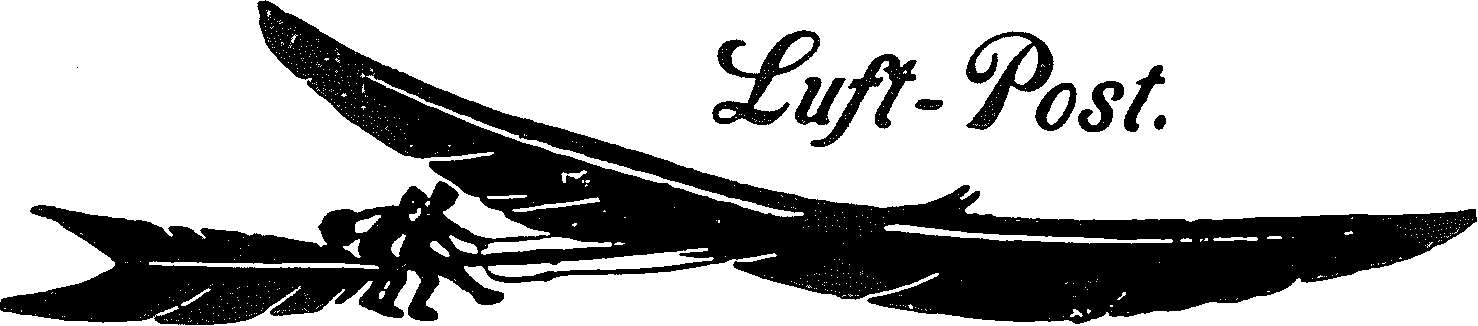
Flugwegrekorde sind Geschwindigkeitsrekorde auf einem von derF.A.I. anerkannten Flugweg. Für Deutschland auf dem Wege Berlin—New York, Berlin--Buenos Aires, Berlin—Kapstadt, Berlin—Saigoon, Berlin—Tokio.
Werkstätten, um Ideen von Erfindern von Schwingenflugzeugen und anderen auszuführen, gibt es zur Zeit nicht. Es ist unmöglich, die vielen Ideen der Erfinder, von denen jeder behauptet, seine sei die beste, in einer Versuchsabteilung auszuführen, denn dazu würden nicht unerhebliche Mittel und Fachleute gehören. Auch würden die Arbeiten bei einer solchen Versuchsabteilung anders ausfallen, als sie der Erfinder beabsichtigt hat.
Hier gibt es nur eins: Es muß sich jeder selbst die nötige Handfertigkeit, wenn es auch mit großen Mühen verbunden ist, aneignen, denn schließlich erfordert jede neue Idee, hauptsächlich auf dem Gebiete des Schwingenfluges, neuartige, der Erfindung angepaßte Bauweise bzw. Handfertigkeit, die eben immer erst wieder erfunden und geübt werden muß. Zeit, Geduld und Ausdauer sind hier Selbstverständlichkeit. Es bleibt Ihnen daher nichts anderes übrig, als es eben auch wie alle anderen zu machen, sich selbst an die Werkbank zu stellen und zu arbeiten.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Die große Rundfunk-Fibel. Eine leicht verständliche und doch gründliche Einführung in die Rundfunktechnik, von Dr.-Ing. F. Bergtold. 3. Auflage. Verlag Deutsch-Literarisches Institut J. Schneider, Berlin-Tempelhof. Preis kart. RM 4.50, Leinen RM 6.—.
Rundfunkempfangstechnik sollte heute jeder beherrschen. Verfasser vermittelt in leicht verständlicher Weise einen Ueberblick über die wichtigsten Zusammenhänge. Die Rundfunk-Fibel ist ein wirklich gutes Lehrbuch für den Anfänger, der sich ohne Schwierigkeit auf diesem an und für sich umfangreichen Gebiete zurechtfinden kann. In der vorliegenden 3. Auflage sind die neuesten Errungenschaften der sich fortgesetzt ändernden Rundfunktechnik berücksichtigt.
Flug und Flieger im Pflanzen- und Tierreich. Von Dr. Reinhold Schmidt. 115 S. mit 100 Zeichn. Verlag Klasing & Co., Berlin. Preis RM 4.60.
Der Bücher über den natürlichen Flug gibt es viele; eine unübersehbare Menge scharfsinniger Beobachtungen ist in ihnen niedergelegt, teils unmittelbar,
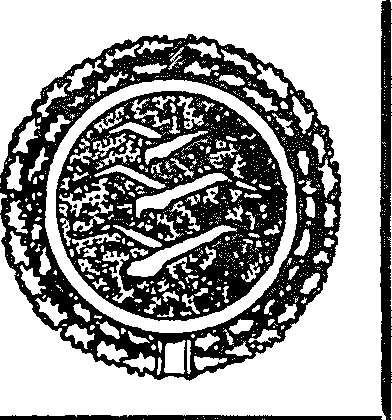
teils durch Reihenbildaufnahmen gewonnen. Man geht jedoch als Flugtechniker mit einem gewissen Vorurteil an Neuerscheinungen dieser Art heran, denn es war bisher schwer, aus dem nicht immer geordnet dargebotenen Material- herauszufinden, was dem Schwingen-Kunstflug, diesem immer noch ungelösten Problem, zu dienen vermag. Wenn Otto Lilienthals Meisterwerk „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst" vor nunmehr 50 Jahren zum ersten Male die Brücke zwischen Natur- und Kunstflug zu schaffen gesucht hat, so ist — wenigstens in Deutschland — nur ganz vereinzelt und nicht immer mit hinreichendem Können hieran weitergearbeitet worden. Es ist ein Verdienst Dr. Reinold Schmidts, mit dem soeben erschienenen Buch eine den neuzeitlichen aerodynamischen Anschauungen gerecht werdende Einführung in das Gebiet hauptsächlich des Tierfluges für unseren fliegerischen Nachwuchs geschaffen zu haben, um so mehr, als das Buch mit seiner prägnanten Darstellungsweise und seiner klaren Gliederung sich vorteilhaft aus dem bezüglichen Schrifttum heraushebt.
Einem Abschnitt über im Winde treibende Pflanzen und Tiere mit fallverzögernden Organen schließt sich ein anderer über flügelschlagloses Gleiten und Steigen von Tieren mit Darlegungen auch über Körperbau und Befiederung, über Luftkräfte, Gleitwinkel, Sinkgeschwindigkeiten u. a. m. an, um dann auf den Schwingenflug, also den Flug mit schlagenden Flügeln überzugehen. Hier wird Ruderflug und Hubflug (Rütteln), Landung und Flugleistung der Vögel, ferner der Flug der Fledermäuse und Insekten je für sich behandelt. Das Buch schließt mit einer Schrifttumszusammenstellung. In dieser vermissen wir leider Veröffentlichungen des „Flugsports", der einzigen deutschen Zeitschrift, die den Schwingenflug über drei Jahrzehnte lang aus dem sensationellen Zeitungsniveau herauszubringen bemüht war. Das hindert jedoch nicht, anzuerkennen, daß das Schmidtsche Buch für den Natur- und Flugfreund anschaffenswert ist. Go.
I! Volo in Italia. Von F. V a 11 i und A. F o s c h i n i. 405 S. mit zahlr. Abbildungen. Luftfahrtverlag Rom. Preis 10 Lire.
In dem vorliegenden Band, der als Festschrift anläßlich des ersten Weltkongresses der Luftfahrtpresse in Rom herausgegeben wurde, geben die Verfasser einen umfassenden Ueberblick über die historische Entwicklung der Luftfahrt in Italien. Der Anteil Italiens an der Eroberung der Luft ist wahrlich bedeutend. An Hand einer Reihe künstlerischer Bilder erleben wir den sieghaften Aufbruch des Fluggedankens von der Antike bis zur heutigen Zeit. Aus den Urtagen menschlicher Naturerkenntnis ist uns die Ikarussage überliefert, in den folgenden Jahrhunderten läßt die Sehnsucht, zu fliegen, den Menschen nicht mehr los. In der Kunst mit ihrer Darstellung fliegender Menschen wird dieser Sehnsucht immer von neuem Ausdruck gegeben. Allein, die Fluggedanken dieser Tage müssen Phantasie bleiben; es fehlt dem Geist die Erkenntnis und der Stoff. Erst viele Jahrhunderte später beginnen diese Gebilde greifbare Formen anzunehmen: Leonardo da Vinci entwirft kühne Pläne von Flugmaschinen, darunter auch ein Hubschrauber. Unserem Zeitalter ist es vorbehalten, in grandiosem Anlauf die jahrtausendalte Sehnsucht zu verwirklichen und zu einem sieghaften Abschluß zu bringen. co.
Deutscher Ingenieur-Kalender 1939. 29. Jahrgang. Buch I, II u. III. Bearb. v. Dr.-Ing. Adolf R e i t z. Verlag Uhlands Technische Bibliothek, Stuttgart. Preis RM 10.—.
Die vorliegende 29. Auflage ist entsprechend den gesteigerten Anforderungen in Wissenschaft, Technik und Industrie erweitert worden. Buch I, Band 1 enthält Grundbegriffe der Mathematik, Physik, Chieme; Band 2 Metallkunde, Rohstoffe und Austauschwerkstoffe, Oele, Schlagwortverzeichnis. Buch II, Band 3, gehört auf den Konstruktionstisch, enthält die üblichen mathematischen Festigkeits- und Normungstabellen, Gewindeherstellung, Hydraulik, technische Wärmelehre, Kraft-und Festigkeitslehre, Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren und Schleudergebläse sind besonders berücksichtigt. Buch III, Band 4—6, Maschinenteile, Dampfkesselanlagen, Kraft- und Arbeitsmaschinen, Werkstatt und Betrieb, Wasser- und Dampfturbinen, auch wieder mit Schlagwortverzeichnis. Ein ungeheures Material und somit ein Nachschlagebuch auf den verschiedensten Gebieten, welches, ohne lange in der Bibliothek zu wälzen, Aufschluß gibt und als Ratgeber unentbehrlich ist.
.FLUGSPORT'
Expedition des »FLUGSPORT« Frankfurt a. M.
KLEINE ANZEIGEN
Ole cireigespaiieiie MIHI meier~^elle leosief 2.3 Pfennig.
Expedition des ❖FLUGSPORT«« Frankfurt a. M.
KI26Y
zugelassen, neuwertig, Sh 13a-Motor, i. Herstellerwerk grundüberholt, sofort abzugeben. Angebote unter 4052 an den Verlag des „Flugsport", Frankfurt a. Main, Hindenburgplatz 8. erbeten.
Soeben erschien: -
Luftwaffe in Front, 152 Seiten mit 6
Kartenskizzen . . Preis RM 3.—
Aerodynamik, 154 Seiten mit 6 Kartenskizzen. Preis RM 3 75 (in Kunstled. geb.)
Flugzeug-Typenbuch, 636 Seiten mit
600 Abbildungen Preis RM 8.—
Joh. Schönleitner, Aichkirchen,
Post Lambach, Oberdonau
Lesezirkel
FLUGWESEN
Prospekt Nr. 23 frei! „Journalistikum", Planegg-Manchen 16
RIVISTA AERONAUTICA'
Illustrierte monatliche Zeitschrift
Herausgegeben durch italienisches
Luftfahrtministerium Ministero dell'Aeronautica, Roma
Enthält Orig.-Abhandlungen üb. den Luftkrieg u. üb. die Luftfahrttechnik, weitere Nachrichten über den internationalen Luftverkehr auf dem militärischen, wissenschaftlichen u. Handelsgebiet, sowie zahlreiche Buchbesprechungen.
Abonnementspreis für Italien u. Kolonien it. L. 64,80 für Ausland .... it. L. 144,—
Ein separates Heft
für Italien.....it. L. 9 —
für Ausland .... it. L. 19,—
Fallsdhrirmleger
fiir sofort gesucht«
Angebote mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild, Angabe der Gehaltsansprüche und des frühesten Eintrittstermins erbeten an Flugtechnisches Institut an der Technischen Hochschule Stuttgart
=■ Ruit über Eßlingen
F
I
ernschule für
lugzeugbau
Tbeoret. Vorbereitung für Bauprüfer, Flugzeugführer, Ingenieure sowie für dengesamten Flugdienst. Sonderlehrgänge für Jungflieger. Abschlußprüfungen - Abschlußzeugnisse. Studien-progr. Nr. 145 durch das Sekretariat,
Fernschule G.m.b.H. BerlinW15
Kurfürstendamm 66
I
Eingebunden ist der „Flugsport" ein Nachschlagewerk von Wert!
Birken-Flugzeug
Sperrholzplatten
deutsches Fabrikat
bei Rekordflügen erprobt, in den Qualitäten: AVIATIC, SPEZIAL, GLEITFLUG in allen Stärken von 0,4-8 mm liefert prompt ab Lager
Georg Herfe
BerlinssCharloffetiburg
Kaiser Friedrich-Straße 24 Fernspr.-Sammelnummer: 34 5841 Telgr.-Adr.: FlieKerhölzer Berlin
Flugzeugtischler Schlosser (Schweiß.)
für sofort gesucht.
Naumburger Flugzeugwerke G.m.b.H. Naumburg (Saale).
Werde Mitglied der NSV.!
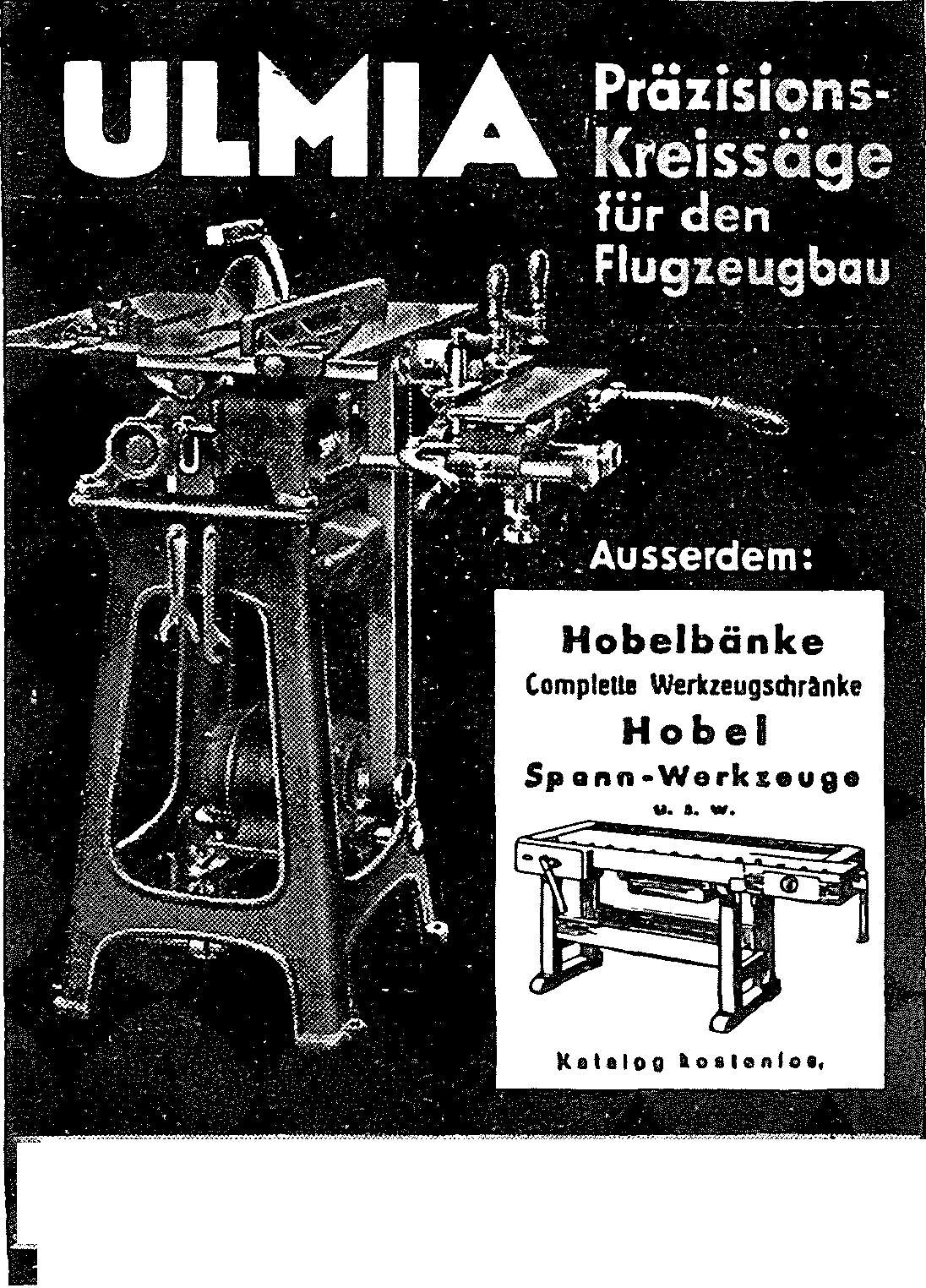
TACHOSKOP
stroboskopisches Handgerät zur Messung oon ümdrehungss und Schwingungszählen Normäläusführung 600 — 18000 Ulmin
.ORIGINAL BRUHN'
Hauptverwaltung :
Berlin-Schöneberg
Eisenadier Straße 56
Heft 17/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
» Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8
Bezugspreis für In- und Ausland pro Vi Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Tclef.: 34384 — Telesr.-Adresse: Ursmus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ..Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Ouellenangabe gestattet.
Nr. 17 16. August 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 30. August 1939
20. Rhön Ende.
Nun ist auch die 20. Rhön beendet. Trotz der ungünstigen Wetterlage, wobei mit Ziel- und Dreiecksflügen besonders schwierige Aufgaben gestellt waren, wurden insgesamt 75 000 km zurückgelegt.
Man müßte ein Buch schreiben, um die vielen Einzelleistungen festzuhalten. Zwischen den Spitzenfliegern Kraft, Schmidt, Braeu-tigam, Haase und Hofmann-Berlin entwickelte sich gegen Ende des Wettbewerbs ein scharfer Kampf.
Die Nachwuchsflieger zeigten mit ihren Leistungen, daß sie der alten Garde in nichts nachstehen. Wenn man die Tagesberichte studiert, muß man staunen, was alles geleistet worden ist. Man erlebte alle Tage dasselbe Bild. Meistenteils war früh die Wasserkuppe noch in Nebel gehüllt, und doch standen schon die Mannschaften mit ihren Flugzeugen einsatzbereit am Hang, um bei Eröffnung des Startes möglichst schnell startbereit zu sein. Nach kurzer Zeit waren regelmäßig Kuppe und Hallen leer. Dann begannen die Lautsprecher, welche die ersten Landungen verkündeten, daran zu erinnern, daß die Segelflieger auf Strecke waren. Und dann füllte sich der Lande-Kasten vor dem Groenhoff-Haus mit den Meldungen. Die Entfernungszahlen stiegen, die Spannung wuchs. — Alles fieberte und wartete: Wer wird heute wieder die größte Leistung vollbringen? Und dann setzte der Rücktransport ein, der sich regelmäßig die Nacht durch bis zum Morgen hinzog. Schnell mußte geschlafen werden, um wieder am andern Tage einsatzbereit zu sein.
Es war ein steter Kampf. So kam Schmidt, von Cottbus zurückgeschleppt, kurz nach 11h an. Schnell wurde seine Maschine wieder auf den Westhang gebracht und, ein Stück Brot verschlingend, setzte er sich 11 h 50 in die Maschine und orientierte sich über die Lage auf der Wasserkuppc, was überhaupt da oben gespielt wurde. Und dann wieder: Ausziehen! Laufen! Los! Schmidt war wieder verschwunden. Wer an der Spitze bleiben wollte, mußte sich eilen.
Diese Nummer enthält Patentsammlung Nr. 13, Bd. VIII.
Es war ein scharfer Endkampf. Unsere Segelflieger haben wieder einmal gezeigt, was sie können.
Neben der fliegerischen Leistungssteigerung haben Forschung und technische Entwicklung Schritt gehalten. Für unseren Ingenieurnachwuchs war bisher die Konstruktionstätigkeit in der Segelfliegerei ein ausgezeichnetes Schulgebiet der erfinderischen und konstruktiven Betätigung. So war gemäß Absatz 44 u. 45 der Ausschreibung besondere Bewertung der technischen Leistung vorgesehen. Die Anträge auf technische Bewertung von Verbesserungen an Flugzeugen, in Flugzeugzubehör und Transportgeräten waren außerordentlich umfangreich und vielseitig. Die in der Ausschreibung aufgestellten Richtlinien zur Bewertung von Verbesserungen haben mehrfach zum Ziel geführt. Ueber die Bewertung der technischen Leistungen wird an anderer Stelle dieser Zeitschrift berichtet werden.
Während des Wettbewerbs konnte man so richtig beobachten, wie schnell sich die einzelnen Segelflieger mit Blindflug-Ausrüstung, Funkgeräten zur Verständigung der Transportmanrischaft und Höhenatmungsgerät (System Auer) für Höhenflüge vertraut machten. Eine bessere Vorschule für den Motorflug kann es wirklich nicht geben.
Es ist begreiflich, wenn allerhöchste Stellen der Luftwaffe diesen Arbeiten in der Rhön größte Beachtung schenkten. Auf der Wasserkuppe hatten sich eingefunden der Chef des Ausbildungswesens der Luftwaffe, General der Flieger Kühl, Generalluftzeugmeister Udet, General der Flieger Kesselring, die Generale Dr. Weißmann, Andree, Zander, letzterer Präsident des Aero-Clubs von Deutschland. Man sah Generale, die vielfach in den Flugzeugen herumkletterten, sich die neugeschaffenen technischen Einzelheiten und Konstruktionen für Blindflug, Funkgeräte erklären ließen und sich mit den Jüngsten unterhielten. Ein zeitgemäßes Bild, welches die Verbundenheit der höchsten Spitzen der Wehrmacht mit dem Nachwuchs so recht zum Ausdruck brachte.

20. Rhön. General der Flieger Kesselring bei den Segelfliegern auf der Wasserkuppe. Oben und unten links: Besichtigung des Nurflügelflugzeugs Horten IIIb. Rechts: Flugzeugschleppstart auf dem Motorflugplatz Tränkhof am Fuße des Pferdskopfes.
Bilder: Flugsport
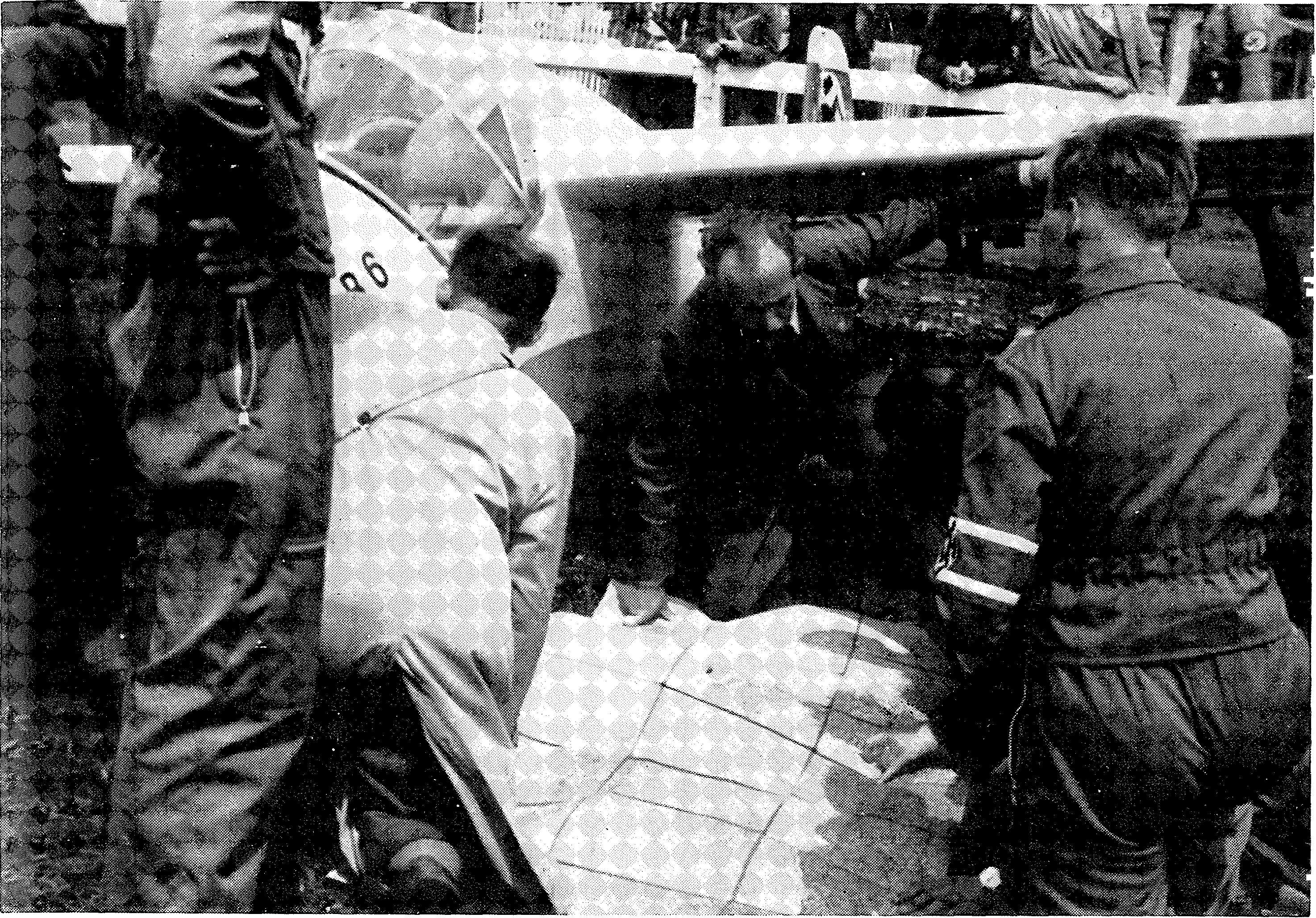
20. Rhön. Kurz vor dem Start wird schnell noch mal die Flugstrecke studiert.
Bild: Flugsport
Am 6. 8., dem letzten Wettbewerbstag;, nahm bei dichtestem Nebel unter starken Regenschauern der Stabsführer des NS.-Flieger-korps NSFK.-Qruppenführer Krüger in Anwesenheit von Ehrengästen aus Partei, Staat und Wehrmacht, darunter auch wieder mehrere Generale, nach einem feierlichen Schlußappell die Preisverteilung vor. Stabsführer Krüger umriß in seiner Ansprache Zweck und Ziele des NS.-Fliegerkorps und seine große Bedeutung als Horter des Fluggedankens in der deutschen Jugend, die in ihm die vormilitärische Ausbildung für die deutsche Luftwaffe erhielte. Er dankte allen Männern, die an der Lösung dieser Aufgaben mit-

20. Rhön. Links: Flugzeugrückschleppwinde auf dem Motorflugplatz (Märchenwiese) Tränkhof. Rechts: General Weißmann mit dem jüngsten Segelflieger Mink.
Bilder: Flugsport
gearbeitet haben. NSFK.-Standartenführer Kunz, der rührige Wettbewerbsleiter, hob an der Spitze der Siegerverkündungen die große Gesamtleistung dieses größten segelfliegerischen Wettstreites der Welt hervor, Die Transport-Mannschaften haben insgesamt 312 000 km in Tag-und Nachtfahrten zurückgelegt und es ihren Piloten auf diese Weise ermöglicht, jeden Morgen wieder auf der Wasserkuppe neu in den Wettbewerb eingreifen zu können. Das NS.-Fliegerkorps ehrte die Arbeit dieser Männer, indem es den Transport-Mannschaften die gleichen Siegerplaketten wie ihren Flugzeugführern verlieh.
Wertungsliste.
Klasse A
|
Lfd. |
Bewerber |
Flugzeugführer Wettb. |
FJgzg.» erflogene |
Flug* |
|||
|
Nr. |
Nr. |
muster |
Punkte |
km |
|||
|
1 |
NSFK.-Gr. |
15 |
NSFK.-Sturmf. Kraft |
23 |
Reiher III |
2550,2 |
2521 |
|
2 |
NSFK.-Gr. |
16 |
NSFK.-Ostuf. Schmidt |
25 |
Condor III |
2533,7 |
2346 |
|
3 |
NSFK.-Gr. |
8 |
NSFK.-Stuf. Treuter |
12 |
Weihe |
2331,2 |
2898 |
|
4 |
NSFK.-Gr. |
4 |
NSFK.-Stuf. Haase |
7 |
Condor III |
2295,0 |
2073 |
|
5 |
NSFK.-Gr. |
7 |
NSFK.-Hstuf. Braeutigam |
10 |
Condor III |
2256,7 |
2232 |
|
6 |
NSFK.-Gr. |
4 |
NSFK.-Stuf. Hofmann |
5 |
Weihe |
2185,0 |
2262 |
|
7 |
DVL. |
Segelflgzf. Schuchardt |
37 |
B6 |
2175,5 |
1814 |
|
|
8 |
NSFK.-Gr. |
14 |
NSFK.-Mann v. Treuberg |
21 |
Weihe |
2168,2 |
2191 |
|
Q |
DFS. |
Segelflgzf. Späte |
30 |
Reiher V 2 |
2094,5 |
2034 |
|
|
10 |
DVL. |
Segelflgzf. Flinsch |
40 |
Mü 17 |
2057,0 |
1637 |
|
|
11 |
NSFK.-Gr. |
11 |
NSFK.-Ostuf. Opitz |
17 |
Weihe |
2037,2 |
1702 |
|
12 |
NSFK.-Gr. |
3 |
NSFK.-Ostuf. Huth |
4 |
Reiher III |
1983,0 |
2134 |
|
13 |
NSFK.-Gr. |
7 |
NSFK.-Hptstuf. Ludwig |
11 |
Mül3d |
1941,7 |
1993 |
|
14 |
NSFK.-Gr. |
15 |
NSFK.-Ostuf. Beck |
22 |
Mül3d |
1781,5 |
2003 |
|
15 |
NSFK.-Gr. |
15 |
NSFK.-Truppf. Bauer |
24 |
Mül3d |
1745,0 |
1736 |
|
16 |
NSFK.-Gr. |
2 |
NSFK.-Truppf. Fick |
3 |
Reiher |
1571,7 |
1460 |
|
17 |
NSFK.-Gr. |
9 |
NSFK.-Otruppf. Mixllzr |
13 |
Weihe |
1515,5 |
1612 |
|
18 |
NSFK.-Gr. |
13 |
NSFK.-Stuf. Habicht |
20 |
Mül3 |
1284,0 |
1501 |
|
19 |
NSFK.-Gr. |
4 |
NSFK.-Stuf. Heinemann |
6 |
Reiher III |
1134,7 |
1542 |
|
20 |
NSFK.-Gr. |
6 |
NSFK.-Otruppf. Sauerbier |
8 |
Mül3d |
996,5 |
1201 |
|
21 |
NSFK.-Gr. |
17 |
NSFK.-Truppf. Fiedler |
27 |
Mü 13 d |
984,7 |
1357 |
|
22 |
Luftwaffe |
Uoffz. Scheidhauer |
35 |
Horten 3 b |
956,2 |
942 |
|
|
23 |
Luftwaffe |
Flieger Karch |
36 |
Mül7 |
900,0 |
1066 |
|
|
24 |
DVL. |
Segelflgzf. Engel |
41 |
C 11 |
842,7 |
1054 |
|
|
25 |
NSFK.-Gr. |
6 |
NSFK.-Ostuf. Ziller |
9 |
Weihe |
832,5 |
976 |
|
26 |
NSFK.-Gr. |
11 |
NSFK.-Mann Schubert |
18 |
Minimoa 38 |
826,5 |
1084 |
|
27 |
DVL. |
Segelflgzf. Mende |
42 |
FVA13 |
737,2 |
1148 |
|
|
28 |
NSFK.-Gr. |
2 |
NSFK.-Rottf. Baumann |
2 |
Mül3d |
590,0 |
943 |
|
29 |
NSFK.-Gr. |
1 |
NSFK.-Otruppf. Philipp |
1 |
Rheinland |
569,5 |
918 |
|
30 |
Luftwaffe |
Ltn. Mössinger |
35 |
Minimoa 38 |
542,0 |
896 |
|
|
CO |
NSFK.-Gr. |
9 |
NSFK.-Truppf. Boy |
14 |
Mül3d |
503,7 |
1015 |
|
32 |
DVL. |
Segelflgzf. Wenzel |
38 |
B8 |
489,0 |
680 |
|
|
33 |
Luftwaffe |
Obltn. Flakowski |
31 |
Horten 3 b |
455,5 |
699 |
|
|
34 |
NSFK.-Gr. |
16 |
NSFK.-Truppf. Hauck |
26 |
Minimoa 38 |
428,2 |
598 |
|
35 |
NSFK.-Gr. |
12 |
NSFK.-Oschf.Meier z.Bent. 19 |
Rheinland |
415,0 |
633 |
|
|
36 |
NSFK.-Gr. |
10 |
NSFK.-Otruppf. Bock |
15 |
Mül3 |
362,0 |
776 |
|
37 |
Lufthansa |
NSFK.-Mann Bender |
28 |
Mül3d |
179,5 |
417 |
|
|
38 |
DVL. |
Segelflgzf. Ebert |
39 |
Gö2 |
161,5 |
399 |
|
|
39 |
NSFK.-Gr. |
10 |
NSFK.-Truppf. Henning |
16 |
Minimoa 38 |
79,0 |
299 |
|
40 |
Luftwaffe |
Gefr. d. R. Peter |
34 |
Horten 3 b |
61,5 |
257 |
|
|
41 |
Luftwaffe |
Ofeldwebel Geitner |
32 |
Horten 3 b |
46,0 |
226 |
|
Nr. 1— 3 goldene Plakette, außerdem Nr. 3 silberne Plakette für zweitgrößte Höhe 5625 m;
Nr. 4— 8 silberne Plakette, außerdem Nr. 4 goldene Plakette als Sonderpreis für
größte Zielflugstrecke 1268 km; Nr. 9—20 bronzene Plakette und außerdem Nr. 16 goldene Plakette für größte
Höhe 5790 m.
i
|
Lfd. Nr. |
Bewerber |
|
1 |
NSFK.-Gr. 7 |
|
2 |
NSFK.-Gr. 14 |
|
3 |
Luftwaffe |
|
4 |
NSFK.-Gr. 4 |
|
5 |
NSFK.-Gr. 12 |
|
6 |
NSFK.-Gr. 8 |
|
7 8 |
NSFK.-Gr. 10 NSFK.-Gr. 15 |
|
9 |
NSFK.-Gr. 13 |
|
10 |
NSFK.-Gr. 1 |
|
11 |
Luftwaffe |
|
12 |
NSFK.-Gr. 3 |
|
13 |
NSFK.-Gr. 17 |
|
14 |
NSFK.-Gr. 6 |
|
15 |
NSFK.-Gr. 11 |
|
16 |
Luftwaffe |
|
17 |
Lufthansa |
|
18 |
Luftwaffe |
Klasse B
Flugzeugführer
Wettb.
Nr.
NSFK.-Sturmf. Kühnold / NSFK.-Rottf. Schröder 48 NSFK.-Sturmf. Romeis / NSFK.-Truppf. Prestele 54 Ogefr. Mudin / Ogefr. Deleurant 58
NSFK.-Hptstuf. Vergens / NSFK.-Mann Malchow 46 NSFK.-Mann Tuliszka / NSFK.-Scharf. Rubrauk 52 NSFK.-Sturmf. Budzinski / NSFK.-Truppf. Leuber 49 NSFK.-Ostuf. Fulda / NSFK.-Jg. Krämer 50
NSFK.-Truppf. Knöpfle / NSFK.-Sturmf. Böcker 55 NSFK.-Truppf. Deeg / NSFK.-Oscharf. Krämer 53 NSFK.-Sturmf. Bödecker / NSFK.-Otruppf. Zander 44 Gefr. Abel /
Feldw. Hübner 60
NSFK.-Sturmf. Güssefeld / NSFK.-Oscharf. Torke 45 NSFK.-Truppf. Kahlbacher / NSFK.-Mann Kaleta 56 NSFK.-Truppf. Widlok / Uoffz. Noske 47
NSFK.-Sturmf. Erb / NSFK.-Rottf. v. Malapert 51 Feldw. Landers / Obgefr. Oberschachtsiek 61 NSFK.-Mann Bayer/ NSFK.-Mann Specht 57 Major Stein /
NSFK.-Mann Fröhlich 59
|
Flgzg.s muster |
erflogene Punkte |
Flugs km |
|
Kranich |
1105,0 |
1260 |
|
Kranich |
995,0 |
1226 |
|
Kranich |
705,0 |
956 |
|
Kranich |
639,5 |
1223 |
|
Kranich |
594,0 |
894 |
|
Kranich |
587,0 |
921 |
|
Kranich |
420,0 |
760 |
|
Kranich |
325,7 |
813 |
|
Kranich |
322,0 |
807 |
|
Kranich |
315,0 |
755 |
|
Kranich |
290,0 |
575 |
|
Kranich |
217,0 |
646 |
|
Kranich |
150,0 |
530 |
|
Kranich |
108,0 |
435 |
|
Kranich |
39,0 |
230 |
|
Kranich |
39,0 |
226 |
|
Kranich |
12,0 |
225 |
|
Kranich |
_ |
263 |
Segelflug-Wettbewerb der Nachwuchsflieger.
|
Lfd. |
Bewerber |
Flugzeugführer |
Wettb. |
Flgzg. |
erflogene |
Flug* |
|
Nr. |
Kr. |
muster |
Punkte |
km |
||
|
1 |
NSFK.-Gr. 13 |
NSFK.-Rottf. Päsold |
J |
Mül3d |
527 |
893 |
|
2 |
NSFK.-Gr. 12 |
NSFK.-Mann Urban |
H |
Mül3d |
445 |
806 |
|
3 |
NSFK.-Gr. 3 |
NSFK.-Oscharf. |
||||
|
Hannoschöck |
C |
Mül3d |
434 |
757 |
||
|
4 |
NSFK.-Gr. 14 |
NSFK.-Truppf. Bauer |
K |
Mu 13d |
314 |
552 |
|
5 |
NSFK.-Gr. 8 |
NSFK.-Anwärt. Esau |
E |
Rhönadler |
300 |
755 |
|
6 |
NSFK.-Gr. 4 |
NSFK.-Truppf. Kober |
D |
Mül3d |
236 |
672 |
|
7 |
NSFK.-Gr. 2 |
NSFK.-Truppf. Sosniers |
B |
Mül3d |
153 |
557 |
|
8 |
NSFK.-Gr. 1 |
NSFK.-Scharf. Steinmann |
A |
Mül3d |
144 |
386 |
|
9 |
NSFK.-Gr. 11 |
NSFK.-Mann Lippmann |
G |
Mül3d |
101 |
468 |
|
10 |
NSFK.-Gr. 17 |
NSFK.-Mann Zanko |
M |
Minimoa |
62 |
307 |
|
11 |
NSFK.-Gr. 10 |
NSFK.-Truppf. Altmayer |
F |
Minimoa 38 |
61 |
244 |
|
12 |
NSFK.-Gr. 16 |
NSFK.-Mann Zechin |
L |
Minimoa 38 |
0 |
93 |
Gesamtergebnis.
Erflogene Gesamt-Kilometer 74 532 km. Erflogene Gesamt-Zielflug-KHometer 16 181 km. Gesamt-Startzahl 1257,
davon: Gummiseilstart 627, Flugzeugschlepp 630.
Gesamt-Flugzeit 2150 Stunden.
Größte Strecke v. Treuberg 392 km nach Greiffenberg (Schles.). Größte Zielstrecke Wettbew.-Nr. 3, 7, 10, 17, 23, 37: 361 km nach Görlitz.
Größte Höhe über NN: Fick 5790 m.
Anzahl der Zielflüge 99, und zwar: Görlitz 361 km 6, Bautzen 324 km
1, Welzow 320 km 1, Dresden 278 km 4, Regensburg 225 km 10, Magdeburg 213 km 2, Chemnitz 211 km 13, Halle-Leipzig 190 km
2, Halle-Nietleben 180 km 1, Zwickau 180 km 2, Ith 164 km 13, Laucha 148 km 4, Nürnberg 140 11, Frankenhausen 124 km 2, Saalfeld 100 km 1, Erfurt 97 km 14, Schweinfurt 54 km 12.
Gesamt-Fahrkilometer: 312 000 km.
Anzahl der Flüge über: 350 km 11, 300 km 12, 250 km 21, 200 km 75. Anzahl der Zielflüge über: 350 km 6, 300 km 2, 250 km 4, 200 km 25,
150 km 18, 100 km 18, 50 km 26. Anzahl der Höhenflüge mit Höhe über NN: über 5500 m 2, über
5000 m 1, über 4500 m 3, über 4000 m 3, über 3500 m 10, über
3000 m 31.

20. Rhön. Ausländische Flieger vom Intern. Fliegertreffen Frankfurt a. M. besuchen
die Wasserkuppe. Bilder: Flugsport
Tagesberichte vom Rhön-Segelflug-Wettbewerb
(Fortsetzung von Seite 411.)
|
vom 27. Juli 1939. |
|||||
|
Wett« Flugzeug* |
Flug» |
Lande« |
Strecke Höhe |
||
|
bew. führer |
zeit |
ort |
km |
Gew. |
|
|
Nr. |
|||||
|
1 |
Philipp |
1°17' |
Neustadt |
26 |
|
|
2 |
Baumann |
3°04' |
Haßfurt |
67 |
610 |
|
3 |
Fick |
3° |
Bellingshausen |
48 |
|
|
4 |
Huth |
3°07' |
Maßbach |
42 |
|
|
5 |
Hofmann |
3°17' |
Willersdorf |
112 |
780 |
|
6 |
Heinemann |
2°49' |
Neustadt |
26 |
510 |
|
7 |
Haase |
22' |
Waku |
||
|
7 |
Haase |
2°13' |
Schweinfurt |
54 |
|
|
8 |
Sauerbier |
54' |
Gersfeld |
||
|
9 |
Ziller |
16' |
Waku |
||
|
9 |
Ziller |
4°03' |
Schweinfurt |
54 |
800 |
|
10 |
Bräutigam |
13' |
Waku |
||
|
10 |
Bräutigam |
16' |
Waku |
||
|
10 |
Bräutigam |
19' |
Waku |
||
|
10 |
Bräutigam |
2°05' |
Bamberg |
94 |
1800 |
|
11 |
Ludwig |
1°29' |
Kissingen |
33 |
650 |
|
12 |
Treuter |
3°20' |
Untertheres |
64 |
470 |
|
13 |
Müller |
2°55' |
Schweinfurt |
54 |
965 |
|
14 |
Boy |
2°25' |
Schweinfurt |
54 |
800 |
|
15 |
Bock |
22' |
Waku |
||
|
15 |
Bock |
33' |
Waku |
||
|
15 |
Bock |
14' |
Waku |
||
|
16 |
Henning |
39' |
Waku |
||
|
16 |
Henning |
56' |
Bischofsheim |
11 |
|
|
17 |
Opitz |
2°55' |
Schweinfurt |
54 |
590 |
|
18 |
Schubert |
2°05' |
Bamberg |
93 |
1300 |
|
19 |
Meier zu Bentrup |
Gersfeld |
|||
|
20 |
Habicht |
2°44' |
Schweinfurt |
54 |
1120 |
|
21 |
v. Treuberg |
2°26' |
Schweinfurt |
54 |
690 |
|
22 |
Beck |
1°02' |
Schönau |
11 |
|
|
22 |
Beck |
Neustadt |
26 |
||
|
23 |
Kraft |
3°13' |
Erlangen |
123 |
980 |
|
24 |
Bauer |
1°38' |
Neustadt |
26 |
|
|
25 |
Schmidt |
4°37' |
Nürnberg |
140 |
2140 |
|
26 |
Hauck |
29' |
Waku |
||
|
26 |
Hauck |
37' |
Kollertshof |
21 |
|
|
27 |
Fiedler |
3°30' |
Kollertshof |
21 |
|
|
28 |
Bender |
25' |
Waku |
||
|
28 |
Bender |
1°15' |
Kollertshof |
21 |
|
|
30 |
Späte |
31' |
Waku |
||
|
30 |
Späte |
2°57' |
Schweinfurt |
54 |
|
|
31 |
Flakowski |
56' |
Waku |
||
|
32 |
Qeitner |
6' |
Waku |
||
|
32 |
Qeitner |
7' |
Waku |
||
|
32 |
Qeitner |
11' |
Waku |
||
|
33 |
Scheidhauer |
17' |
Bischofsheim |
11 |
|
|
34 |
Peter |
40' |
Bischofsheim |
11 |
1260 |
|
36 |
Karch |
42' |
Schönau |
17 |
|
|
37 |
Schuchardt |
2°38' |
Kremmeldorf |
99 |
1755 |
|
38 |
Wenzel |
52' |
Bischofsheim |
11 |
485 |
|
39 |
Ebert |
6' |
Waku |
||
|
39 |
Ebert |
5' |
Waku |
||
|
40 |
Flinsch |
1°30' |
Frauenroth |
26 |
|
|
41 |
Engel |
59' |
Gersfeld |
||
|
42 |
Mende |
1°33' |
Schweinfurt |
54 |
700 |
|
44 |
Bödeker/Zander |
17' |
Waku |
||
|
44 |
Bödeker/Zander |
24' |
Bischofsheim |
11 |
|
|
45 |
Qüssefeld/Torke |
1°44' |
Waku |
||
|
46 |
V ergens/Malchow |
3°14' |
Kollertshof |
21 |
|
|
47 |
Widlok/Noske |
15' |
Waku |
||
|
47 |
Widlok/Noske |
15' |
Waku |
||
|
47 |
Widlok/Noske |
49' |
Löhrieth |
31 |
|
|
48 |
Kühnold/Schröder |
3°10' |
Lebenhan |
23 |
|
|
49 |
Budzinski/Leuber |
20' |
Waku |
||
|
Wett* Flugzeuge |
Flug« |
Landes |
Strecke Höhe |
||
|
bew. führer |
zeit |
ort |
km |
Gew. |
|
|
Nr. |
|||||
|
49 |
Budzinski/Leuber |
12' |
Waku |
||
|
50 |
Fulda/Krämer |
45' |
Schönau |
17 |
|
|
51 |
Erb/v. Malapert |
32' |
Waku |
||
|
51 |
Erb/v. Malapert |
59' |
Mosbach |
||
|
52 |
Tuliszka/Ruh- . |
||||
|
brauck |
1°35' |
Maßbach |
42 |
||
|
53 |
Deeg/Krämer |
15' |
Waku |
||
|
53 |
Deeg/Krämer |
23' |
Waku |
||
|
53 |
Deeg/Krämer |
1°29' |
Münnerstadt |
32 |
|
|
54 |
Romeis/Prestele |
40' |
Waku |
||
|
54 |
Romeis/Prestele |
27' |
Waku |
||
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
47' |
Wegfurth |
16 |
|
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
7' |
Waku |
||
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
11' |
Waku |
||
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
6' |
Waku |
||
|
57 |
Bayer/Specht |
45' |
Bischofsheim |
11 |
|
|
58 |
Mudin/Deleurant |
31' |
Waku |
||
|
58 |
Mudin/Deleurant |
1°09' |
Schweinfurt |
54 |
|
|
59 |
Stein/Fröhlich |
1°37' |
Bischofsheim |
11 |
|
|
60 |
Abel/Phrenn |
11' |
Waku |
||
|
60 |
Abel/Phrenn |
12' |
Waku |
||
|
60 |
Abel/Phrenn |
52' |
Bischofsheim |
15 |
|
|
61 |
Lander/ Oberschachtsiek |
5' |
Waku |
||
|
61 |
Lander/ |
||||
|
Oberschachtsiek |
1°12' |
Pfersdorf |
43 |
||
|
A |
Steinmann |
2°14' |
Haßfurt |
67 |
|
|
B |
Sosniers |
1°17' |
Prehmich |
21 |
|
|
C |
Hannoschöck |
1°07' |
Bischofsheim |
11 |
|
|
D |
Kober |
2°29' |
Haßfurt |
67 |
|
|
E |
Es au |
9' |
Waku |
||
|
E |
Esau |
50' |
Hettenhausen |
10 |
|
|
F |
Altmayer |
28' |
Waku |
||
|
F |
Altmayer |
22' |
Wraku |
||
|
G |
Lippmann |
1°18' |
Rheinfelshof |
33 |
|
|
H |
Urban |
21' |
Waku |
||
|
H |
Urban |
1°18' |
Volkershausen |
45 |
|
|
J |
Päsold |
58' |
Bischofsheim |
11 |
|
|
K |
Bauer |
1°15' |
Prehmich |
21 |
|
|
L |
Zanko |
37' |
Waku |
||
|
L |
Zanko |
14' |
Waku |
||
|
vom 28. |
Juli 1939. |
||||
|
1 |
Philipp |
23' |
Waku |
||
|
1 |
Philipp |
20' |
Tränkhof |
||
|
1 |
Philipp |
4° |
Möhrendorf |
122 |
830 |
|
2 |
Baumann |
12' |
Tränkhof |
||
|
2 |
Baumann |
26' |
Tränkhof |
||
|
2 |
Baumann |
3°58' |
Nürnberg |
140 |
1270 |
|
3 |
Fick |
2°52' |
Hammermühle |
131 |
2400 |
|
4 |
Huth |
5°27' |
Regensburg |
225 |
2100 |
|
5 |
Hofmann |
5°57' |
Regensburg |
225 |
2660 |
|
6 |
Heinemann |
33' |
Tränkhof |
||
|
6 |
Heinemann |
4°42' |
Nürnberg |
140 |
1400 |
|
7 |
Haase |
5°30' |
Regensburg |
225 |
2350 |
|
CO |
Sauerbier |
54' |
Tränkhof |
||
|
8 |
Sauerbier |
3°17' |
Nürnberg |
140 |
1100 |
|
9 |
Ziller |
5°25' |
Nürnberg |
140 |
2290 |
|
10 |
Bräutigam |
6°51' |
Plattling |
282 |
2210 |
|
11 |
Ludwig |
5°57' |
Gr. Etzenberg |
214 |
1440 |
|
12 |
Treuter |
6°42' |
Regensburg |
225 |
2950 |
|
13 |
Müller |
34' |
Tränkhof |
||
|
13 |
Müller |
3°11' |
Nürnberg |
140 |
2350 |
|
14 |
Boy |
1' |
Tränkhof |
||
|
14 |
Boy |
3°43' |
Altershofen |
151 |
2150 |
|
15 |
Bock |
9' |
Tränkhof |
||
|
Wett« Flugzeug» |
Flug* |
Lande* |
Strecke Höhe |
||
|
bew. führer |
zeit |
ort |
km |
Gew. |
|
|
Nr. |
|||||
|
15 |
Bock |
19' |
Tränkhof |
||
|
15 |
Bock |
2°39' |
Bamberg |
94 |
790 |
|
16 |
Henning |
15' |
Tränkhof |
||
|
16 |
Henning |
1°23' |
Prehmich |
21 |
|
|
17 |
Opitz |
6°18' |
Regensburg |
225 |
2740 |
|
18 |
Schubert |
23' |
Waku |
||
|
18 |
Schubert |
3°18' |
Nürnberg |
140 |
2220 |
|
19 |
Meier zu Bentrup |
37' |
Tränkhof |
||
|
20 |
Habicht |
14' |
Tränkhof |
||
|
20 |
Habicht |
1°02' |
Hollstadt |
29 |
|
|
20 |
Habicht |
28' |
sTränkhof |
||
|
20 |
Habicht |
47' |
Tränkhof |
||
|
21 |
v. Treuberg |
6°50' |
Hängersberg |
297 |
2830 |
|
22 |
Beck |
5°52' |
Regensburg |
225 |
1430 |
|
23 |
Kraft |
4°45' |
Regensburg |
225 |
1390 |
|
24 |
Bauer |
7°14' |
Schleißheim |
276 |
2630 |
|
25 |
Schmidt |
5°21' |
Obertraubling |
225 |
2370 |
|
26 |
Hauck |
15' |
Tränkhof |
||
|
26 |
Hauck |
4°44' |
Nürnberg |
140 |
2520 |
|
27 |
Fiedler |
2°08' |
Oberlauringen |
44 |
1580 |
|
28 |
Bender |
30' |
Tränkhof |
||
|
28 |
Bender |
2°48' |
Niederndorf |
98 |
1370 |
|
30 |
Späte |
6°01' |
Regensburg |
225 |
2580 |
|
31 |
Flakowski |
15' |
Waku |
||
|
32 |
Geitner |
13' |
Waku |
||
|
32 |
Geitner |
17' |
Waku |
||
|
32 |
Geitner |
7' |
Waku |
||
|
32 |
Geitner |
45' |
Tränkhof |
||
|
33 |
Scheidhauer |
3°03' |
Weißenstein |
103 |
2790 |
|
34 |
Peter |
1°26' |
Bad Kissingen |
34 |
1200 |
|
35 |
Mössinger |
26' |
Südtal |
||
|
35 |
Mössinger |
7' |
Tränkhof |
||
|
35 |
Mössinger |
31' |
Tränkhof |
||
|
35 |
Mössinger |
2°46' |
Stettfeld |
81 |
|
|
36 |
Karch |
16' |
Tränkhof |
||
|
36 |
Karch |
2°46' |
Münchhof |
94 |
1310 |
|
37 |
Schuchardt |
4°22' |
Erlangen |
127 |
1720 |
|
38 |
Wenzel |
3°32' |
Gaustadt |
93 |
1510 |
|
39 |
Ebert |
4' |
Waku |
||
|
39 |
Ebert |
1°08' |
Milz |
45 |
690 |
|
40 |
Flinsch |
4°45' |
Regensburg |
225 |
2410 |
|
41 |
Engel |
24' |
Tränkhof |
||
|
41 |
Engel |
3°44' |
Nürnberg |
140 |
1780 |
|
42 |
Mende |
10' |
Tränkhof |
||
|
42 |
Mende |
4° |
Erlangen |
127 |
1300 |
|
44 |
Bödeker/Zander |
8' |
Waku |
||
|
44 |
Bödeker/Zander |
48' |
Oberweißenbrunn 10 |
||
|
45 |
Güssefeld/Torke |
9' |
Waku |
||
|
45 |
Güssefeld/Torke |
2°34' |
Trunstadt |
85 |
|
|
46 |
Vergens/Malchow |
9' |
Waku |
||
|
46 |
Vergens/Malchow |
3°21' |
Forchheim |
117 |
|
|
47 |
Widlok/Noske |
7' |
Waku |
||
|
47 |
Widlok/Noske |
12' |
Waku |
||
|
47 |
Widlok/Noske |
20' |
Waku |
||
|
47 |
Widlok/Noske t |
2°25' |
Schweinfurt |
54 |
|
|
48 |
Kühnold/Schröder |
15' |
Waku |
||
|
48 |
Kühnold/Schröder |
3°02' |
Bubenreuth |
124 |
|
|
49 |
Budzinski/Leuber |
Heidelstein |
9 |
||
|
49 |
Budzinski/Leuber |
3°01' |
Trunstadt |
86 |
|
|
50 |
Fulda/Krämer |
17' |
Tränkhof |
||
|
50 |
Fulda/Krämer |
53' |
Tränkhof |
||
|
50 |
Fulda/Krämer |
2°50' |
Scheßletz |
96 |
|
|
51 |
Erb/v. Malapert |
48' |
Hohe Rhön |
10 |
|
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
13' |
Waku |
||
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
17' |
Waku |
||
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
8' |
Waku |
||
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
11' |
Waku |
||
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
17' |
Waku |
||
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
15' |
Waku |
||
|
Wett* Flugzeug* |
Flug» |
Lande» |
Strecke |
Höhe |
|
|
bew. führer |
zeit |
ort |
km |
Gew. |
|
|
Nr. |
|||||
|
53 |
Deeg/Krämer |
1°05' |
Rügheim |
59 |
|
|
54 |
Romeis/Prestele |
18' |
Waku |
||
|
54 |
Romeis/Prestele |
11' |
Waku |
||
|
54 |
Romeis/Prestele |
3°47' |
Nürnberg |
140 |
|
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
10' |
Waku |
||
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
2°28' |
Eltmann |
79 |
|
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
2°42' |
Oberhaid |
90 |
|
|
57 |
Bayer/Specht |
Steinach |
26 |
||
|
58 |
Mudin/Deleurant |
10' |
Waku |
||
|
58 |
Mudin/Deleurant |
3°50' |
Nürnberg |
140 |
|
|
59 |
Stein/Fröhlich |
4' |
Waku |
||
|
59 |
Stein/Fröhlich |
29' |
Heidelstein |
10 |
|
|
59 |
Stein/Fröhlich |
26' |
Tränkhof |
||
|
60 |
Abel/Phrenn |
7' |
Waku |
||
|
60 |
Abel/Phrenn |
13' |
Waku |
||
|
60 |
Abel/Phrenn |
3°07' |
Oberschneitach |
76 |
|
|
61 |
Lander/ |
||||
|
Oberschachtsiek |
2°31' |
Rannungen |
41 |
||
|
A |
Steinmann |
42' |
Waku |
||
|
A |
Steinmann |
2°46' |
Coburg |
79 |
|
|
B |
Sosniers |
35' |
Tränkhof |
||
|
B |
Sosniers |
3°19' |
Bamberg |
94 |
|
|
C |
Hannoschöck |
30' |
Tränkhof |
||
|
C |
Hannoschöck |
1°04' |
Waku |
||
|
D |
Kober |
Höchstadt |
109 |
||
|
E |
Esau |
25' |
Rotholz |
||
|
E |
Esau |
3°44' |
Bamberg |
94 |
|
|
F |
Altmayer |
8' |
Tränkhof |
||
|
F |
Altmayer |
3°30' |
Prölsdorf |
85 |
|
|
G |
Lippmann |
31' |
Tränkhof |
||
|
G |
Lippmann |
51' |
Fladungen |
15 |
|
|
H |
Urban |
54' |
Bad Naustadt |
28 |
|
|
H |
Urban |
47' |
Tränkhof |
||
|
H |
Urban |
35' |
Volkershausen |
45 |
|
|
J |
Päsold |
21' |
Tränkhof |
||
|
J |
Päsold |
3°20' |
Schweinfurt |
54 |
|
|
K |
Bauer |
38' |
Schönau |
17 |
|
|
K |
Bauer |
52' |
Oberspreu |
27 |
|
|
M |
Zanko |
13' |
Tränkhof |
||
|
M |
Zanko |
2°18' |
Rottenhausen |
40 |
|
|
vom |
29. Juli 1939. |
||||
|
1 |
Philipp |
5°38' |
Gr. Korbetha |
171 |
910 |
|
2 |
Baumann |
4°56' |
Dennheritz |
182 |
1270 |
|
CO |
Fick |
3°56' |
Laucha |
148 |
1000 |
|
4 |
Huth |
7° 17' |
Nossen |
245 |
1130 |
|
5 |
Hofmann |
6°48' |
Wechselburg |
207 |
1150 |
|
6 |
Heinemann |
6°28' |
Frankenau |
217 |
1225 |
|
7 |
Haase |
45' |
Dermbach |
27 |
|
|
8 |
Sauerbier |
6°33' |
Frankenberg |
224 |
1060 |
|
9 |
Ziller |
5°49' |
Weidensdorf |
188 |
1265 |
|
10 |
Bräutigam |
6°44' |
Cunnersdorf |
231 |
1140 |
|
11 |
Ludwig |
6°52' |
bei Dresden |
270 |
1080 |
|
12 |
Treuter |
5' |
Waku |
||
|
12 |
Treuter |
4°42' |
Zwickau |
180 |
1115 |
|
13 |
Müller |
6°44' |
Arndsdorf |
231 |
1475 |
|
14 |
Boy |
6°29' |
Heiersdorf |
192 |
930 |
|
15 |
Bock |
2°10' |
Waltershausen |
66 |
1065 |
|
16 |
Henning |
3°32' |
Erfurt |
89 |
1095 |
|
17 |
Opitz |
27' |
Wüstensachsen |
||
|
17 |
Opitz |
4°55' |
Altenburg |
189 |
1290 |
|
18 |
Schubert |
4' |
Waku |
||
|
18 |
Schubert |
3' |
Waku |
||
|
18 |
Schubert |
3°50' |
Laucha |
148 |
980 |
|
19 |
Meier zu Bentrup |
2°03' |
Fischbach |
23 |
|
|
19 |
Meier zu Bentrup |
2°06' |
Metzels |
40 |
835 |
|
20 |
Habicht |
1°48' |
Helmers |
36 |
805 |
|
21 |
v. Treuberg |
6°39' |
Dresden |
278 |
1090 |
|
22 |
Beck |
6°34' |
Dresden |
278 |
1385 |
|
Wett« Flugzeug« |
Flug- |
Lande* Strecke Höhe |
|||
|
bew. föhrer |
zeit |
ort |
km |
Gew. |
|
|
Nr. |
|||||
|
23 |
Kraft |
6°28' |
Dresden |
278 |
1285 |
|
24 |
Bauer |
5°56' |
Chemnitz |
211 |
1450 |
|
25 |
Schmidt |
5°32' |
Bräunsdorf |
198 |
1285 |
|
26 |
Hauck |
3°50' |
Teuchnitz |
103 |
995 |
|
27 |
Fiedler |
6°27' |
Oberlungwitz |
200 |
1430 |
|
28 |
Bender |
2°07' |
Herrenbreitungen 42 |
735 |
|
|
30 |
Späte |
7°02' |
Nossen |
244 |
1330 |
|
Flakwoski |
4' |
Waku |
|||
|
31 |
Flakowski |
1°57' |
Tambach |
59 |
790 |
|
32 |
Qeitner |
8' |
Waku |
||
|
32 |
Qeitner |
2°58/ |
Tränkelhof |
63 |
770 |
|
33 |
Scheidhauer |
16' |
Waku |
||
|
34 |
Peter |
2° 20' |
Wandersleben |
78 |
790 |
|
35 |
Mössinger |
4°46' |
Halle-Nietl. |
179 |
|
|
36 |
Karch |
4°57' |
Törpla |
148 |
980 |
|
37 |
Schuchardt |
13' |
Waku |
||
|
37 |
Schuchardt |
5°04' |
Mühlau |
203 |
1225 |
|
39 |
Ebert |
3' |
Waku |
||
|
39 |
Ebert |
2' |
Waku |
||
|
39 |
Ebert |
3' |
Waku |
||
|
39 |
Ebert |
5' |
Waku |
||
|
39 |
Ebert |
2°47' |
Gotha |
77 |
1010 |
|
40 |
Flinsch |
6°29' |
Riesa |
250 |
1040 |
|
41 |
Engel |
8' |
Waku |
||
|
41 |
Engel |
4°02' |
Stadtroda |
132 |
1030 |
|
42 |
Mende |
5°25' |
Altenburg |
185 |
845 |
|
44 |
Bödeker/Zander |
30' |
Waku |
||
|
44 |
Bödeker/Zander |
4°33' |
München- |
||
|
bernsdorf |
145 |
||||
|
45 |
Güssefeld/Torke |
11' |
Waku |
||
|
45 |
Güssefeld/Torke |
27' |
Waku |
||
|
45 |
Güssefeld/Torke |
4°04' |
Kleinuntersdorf |
120 |
|
|
46 |
Vergens/Malchow |
6°17' |
Tanneberg |
253 |
|
|
47 |
Widlok/Noske |
23' |
Waku |
||
|
47 |
Widlok/Noske |
4°47' |
Rodameuschel |
139 |
|
|
48 |
Kühnold/Schröder |
5°51' |
Kalbitz |
236 |
|
|
49 |
Budzinski/Leuber |
13' |
Waku |
||
|
49 |
Budzinski/Leuber |
15' |
Waku |
||
|
49 |
Budzinski/Leuber |
14' |
Waku |
||
|
49 |
Budzinski/Leuber |
4°13' |
Triptis |
140 |
|
|
50 |
Fulda/Krämer |
11' |
Waku |
||
|
50 |
Fulda/Krämer |
5°15' |
Etzdorf |
150 |
|
|
51 |
Erb/v. Malapert |
3° |
Mühlberg |
76 |
|
|
52 |
Tuliszka/ |
||||
|
Ruhbrauck |
1°01' |
Dermbach |
27 |
||
|
52 |
Tuliszka/ |
Weimar- |
|||
|
Ruhbrauck |
1°01' |
schmieden |
19 |
||
|
53 |
Deeg/Krämer |
1°26' |
Eckarts |
31 |
|
|
54 |
Romeis/Prestele |
5°20' |
Gößnitz |
180 |
|
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
16' |
Waku |
||
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
5' |
Waku |
||
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
4°09' |
Neustadt/Orla |
131 |
|
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
10' |
Waku |
||
|
57 |
Bayer/Specht |
17' |
Waku |
||
|
57 |
Bayer/Specht |
15' |
Waku |
||
|
57 |
Bayer/Specht |
2°59' |
Gotha |
77 |
|
|
58 |
Mudin/Deleurant |
1°30' |
Kaltensundheim |
19 |
|
|
59 |
Stein/Fröhlich |
6' |
Waku |
||
|
59 |
Stein/Fröhlich |
11' |
Waku |
||
|
59 |
Stein/Fröhlich |
14' |
Waku |
||
|
59 |
Stein/Fröhlich |
3°03' |
Breitungen |
40 |
|
|
60 |
Hübner/Abel |
24' |
Waku |
||
|
60 |
Hübner/Abel |
3°06' |
Molschieben |
83 |
|
|
61 |
Lander/ |
||||
|
Oberschachtsiek |
48' |
Kaltennordheim |
20 |
||
|
A |
Steinmann |
1°06' |
Unterweid |
16 |
|
|
A |
Steinmann |
14' |
Waku |
||
|
B |
Sosniers |
53' |
Waku |
||
|
B |
Sosniers |
3°01' |
Sondershausen |
118 |
|
Wett* Flugzeug* Flug* Lande* Strecke Höhe bew. führer zeit ort km Gew.
Nr.
|
c |
Hannoschöck |
4°40' |
Burgwerben |
166 |
|
|
D |
Kober |
3°59' |
Schwarza |
45 |
|
|
E |
Esau |
5°23' |
Oepitz |
118 |
|
|
F |
Altmayer |
3°57' |
Roda |
71 |
|
|
G |
Lippmann |
1°26' |
Rosa |
28 |
|
|
H |
Urban |
5°23' |
Waldenburg |
195 |
|
|
J |
Päsold |
5°30' |
Borna |
193 |
|
|
K |
Bauer |
39' |
Waku |
||
|
K |
Bauer |
3°36' |
Erfurt |
97 |
|
|
L |
Zechin |
11' |
Waku |
||
|
M |
Zanko |
23' |
Heppenhausen |
||
|
M |
Zanko |
1°58' |
Floh |
48 |
|
|
vom |
30. Juli 1939 |
||||
|
1 |
Philipp |
3°21' |
Rockstedt |
107 |
1590 |
|
3 |
Fick |
15' |
Tränkhof |
||
|
3 |
Fick |
3° |
Tilleda |
135 |
1000 |
|
4 |
Huth |
5°02' |
Nedlitz |
241 |
1180 |
|
5 |
Hofmann |
4°47' |
Schermen |
236 |
1129 |
|
6 |
Heinemann |
5°11' |
Magdeburg-Süd |
214 |
800 |
|
7 |
Haase |
43' |
Tränkhof |
||
|
7 |
Haase |
4°20' |
Roitzsch |
205 |
1280 |
|
8 |
Sauerbier |
4°25' |
Halle-Nietleben |
180 |
970 |
|
9 |
Ziller |
3°24' |
Ernderode |
109 |
850 |
|
10 |
Bräutigam |
5°12' |
Zerbst/Anh. |
230 |
1020 |
|
11 |
Ludwig |
5°16' |
Dessau-Flgpl. |
219 |
1220 |
|
12 |
Treuter |
5°35' |
Cöthen-Flgpl. |
214 |
1035 |
|
13 |
Müller |
4°30' |
Bottendorf |
140 |
845 |
|
14 |
Boy |
2°53' |
Kölleda |
121 |
1120 |
|
15 |
Bock |
3° 16' |
Wasserthaleben |
110 |
960 |
|
16 |
Henning |
13' |
Tränkhof |
||
|
16 |
Henning |
21' |
Tränkhof |
||
|
16 |
Henning |
15' |
Tränkhof |
||
|
17 |
Opitz |
9' |
Tränkhof |
||
|
17 |
Opitz |
2°36' |
Schernberg |
116 |
870 |
|
18 |
Schubert |
31' |
Unter rippersbach |
13 |
580 |
|
19 |
Meier zu Bentrup |
23' |
Tränkhof |
||
|
19 |
Meier zu Bentrup |
2°28' |
Großenehrich |
107 |
1460 |
|
20 |
Habicht |
5°09' |
Schlettau |
190 |
1360 |
|
21 |
v. Treuberg |
5°36' |
Zerbst/Anh. |
230 |
1230 |
|
22 |
Beck |
5°31' |
Dessau-Flgpl. |
219 |
1565 |
|
23 |
Kraft |
16' |
Tränkhof |
||
|
23 |
Kraft |
2° 48' |
Uffrungen |
135 |
1080 |
|
24 |
Bauer |
7' |
Tränkhof |
||
|
24 |
Bauer |
5°22' |
Doelau |
179 |
620 |
|
25 |
Schmidt |
5°16' |
Zerbst/Anh. |
230 |
890 |
|
26 |
Hauck |
7' |
Tränkhof |
||
|
26 |
Hauck |
2°38' |
Goldbach |
76 |
1360 |
|
27 |
Fiedler |
3°32' |
Nordhausen |
127 |
905 |
|
28 |
Bender |
19' |
Tränkhof |
||
|
28 |
Bender |
38' |
Tränkhof |
||
|
28 |
Bender |
33' |
Tränkhof |
||
|
30 |
Späte |
2°01' |
Mechterstädt |
67 |
780 |
|
31 |
Flakowski |
3°07' |
Tieftal |
94 |
1290 |
|
32 |
Geitner |
2' |
Tränkhof |
||
|
33 |
Scheidhauer |
3°06' |
Trebra |
116 |
1010 |
|
34 |
Peter |
8' |
Waku |
||
|
34 |
Peter |
9' |
Waku |
||
|
34 |
Peter |
21' |
Spahl |
18 |
420 |
|
35 |
Mössinger |
8' |
Tränkhof |
||
|
35 |
Mössinger |
1°44' |
Seebach |
87 |
|
|
36 |
Karch |
2°51' |
Holzdahleben |
107 |
750 |
|
37 |
Schuchardt |
4°19' |
Dessau-Flgpl. |
219 |
980 |
|
39 |
Ebert |
2' |
Tränkhof |
||
|
39 |
Ebert |
55' |
Winters/Tann |
19 |
|
|
40 |
Flinsch |
5° 13' |
Zerbst-Flgpl. |
230 |
1320 |
|
41 |
Engel |
3°03' |
Tennstedt |
98 |
930 |
|
42 |
Mende |
1°37' |
Bad Liebenstein |
47 |
860 |
Wett« Flugzeug» Flug« Lande* Strecke Höhe bew. führer zeit ort km Gew.
Nr.
|
44 |
Bödeker/Zander |
14' |
Waku |
|
|
44 |
Bödeker/Zander |
31' |
Dernbach |
28 |
|
45 |
Güssefeld/Torke |
2°19' |
Dachwig |
93 |
|
45 |
Güssefeld/Torke |
9' |
Waku |
|
|
47 |
Widlok/Noske |
40' |
Dernbach |
28 |
|
48 |
Kühnold/Schröder |
10' |
Waku |
|
|
48 |
Kühnold/Schröder |
52' |
Dernbach |
28 |
|
49 |
Budzinski/Leuber |
17' |
||
|
49 |
Budzinski/Leuber |
12' |
||
|
49 |
Budzinski/Leuber |
29' |
Tränkhof |
|
|
50 |
Fulda/Krämer |
1°18' |
Vacha |
38 |
|
51 |
Erb/v. Malapert |
35' |
Unterbernhard |
|
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
19' |
Waku |
|
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk 1°09' |
Wölferbütt |
31 |
|
|
53 |
Deeg/Krämer |
36' |
Unterrückelsbach |
13 |
|
57 |
Bayer/Specht |
39' |
Motzlar |
21 |
|
58 |
Mudin/Deleurant |
29' |
Tann |
18 |
|
58 |
Mudin/Deleurant |
11' |
Waku |
|
|
58 |
Mudin/Deleurant |
7/ |
Waku |
|
|
58 |
Mudin/Deleurant |
12' |
Waku |
|
|
53 |
Deeg/Krämer |
7' |
Tränkhof |
|
|
54 |
Romeis/Prestele |
1°19' |
Schweina |
47 |
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
1°52' |
Mihla |
72 |
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
9' |
Waku |
|
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
44' |
Wenigentaft |
30 |
|
59 |
Stein/Fröhlich |
36' |
Unterweid |
15 |
|
60 |
Abel/Phrenn |
15' |
Tränkhof |
|
|
60 |
Abel/Phrenn |
13' |
Waku |
|
|
60 |
Abel/Phrenn |
36' |
Tränkhof |
|
|
61 |
Lander/ |
|||
|
Oberschachtsiek |
14' |
Tränkhof |
||
|
61 |
Lander/ |
|||
|
Oberschachtsiek |
8' |
Tränkhof |
||
|
61 |
Lander/ |
|||
|
Oberschachtsiek |
35' |
Tränkhof |
||
|
B |
Sosniers |
2°13' |
Gumpelstadt |
46 |
|
C |
Hannoschöck |
1°44' |
Waku |
|
|
c |
Hannoschöck |
51' |
Tränkhof |
|
|
D |
Kober |
2°50' |
Langensalza |
86 |
|
E |
Esau |
Tann |
18 |
|
|
F |
Altmayer |
1° |
Tränkhof |
|
|
F |
Altmayer |
18' |
Tränkhof |
|
|
G |
Lippmann |
|||
|
G |
Lippmann |
25' |
Eckweißbach |
9 |
|
H |
Urban |
2°07' |
Otzbach |
28 |
|
J |
Päsold |
3° |
Tennstedt |
98 |
|
K |
Bauer |
44' |
Tränkhof |
|
|
K |
Bauer |
2°02' |
Lahrbach |
15 |
|
M |
Zanko |
3' |
Tränkhof |
|
|
M |
Zanko |
1°35' |
Geisa |
25 |
vom 31. Juli 1939
|
1 |
Philipp |
1°06' |
Arnstadt |
80 |
570 |
|
2 |
Baumann |
3°32' |
Gr. Neuhausen |
121 |
820 |
|
3 |
Fick |
4°21' |
Dessau |
219 |
860 |
|
4 |
Huth |
4°19' |
bei Bitterfeld |
207 |
1720 |
|
5 |
Hofmann |
2°53' |
bei Naumburg |
150 |
1520 |
|
6 |
Heinemann |
3°19' |
Bachra |
127 |
1190 |
|
7 |
Haase |
4°46' |
Gr. Lissa |
199 |
920 |
|
8 |
Sauerbier |
1° |
Fambach |
41 |
|
|
9 |
Ziller |
2°21' |
Ingersleben |
85 |
775 |
|
10 |
Bräutigam |
4°28' |
Kamenz |
183 |
1540 |
|
11 |
Ludwig |
4°19' |
Leipzig-Mockau |
201 |
1070 |
|
12 |
Treuter |
2°212' |
Sundhausen |
71 |
610 |
|
13 |
Müller |
1°57' |
Wechmar |
74 |
600 |
|
14 |
Boy |
1°57' |
Nirmsdorf |
127 |
1170 |
|
15 |
Bock |
31' |
Waku |
||
|
15 |
Bock |
13' |
Waku Brüchs |
16 |
Wert* Flugzeug» Flug» bew. führer zeit
Nr.
|
16 |
Henning |
11' |
|
17 |
Opitz |
3°32' |
|
18 |
Schubert |
3°25' |
|
19 |
Meier zu Bentrup |
1°38' |
|
20 |
Habicht |
3°25' |
|
21 |
v. Treuberg |
2°40' |
|
22 |
Beck |
4°06' |
|
23 |
Kraft |
1°50' |
|
25 |
Schmidt |
2°12' |
|
26 |
Hauck |
20' |
|
27 |
Fiedler |
2°16' |
|
28 |
Bender |
|
|
28 |
Bender |
25' |
|
30 |
Späte |
6' |
|
30 |
Späte |
37' |
|
31 |
Flakowski |
1°08' |
|
32 |
Geitner |
37' |
|
32 |
Geitner |
28' |
|
33 |
Scheidhauer |
33' |
|
34 |
Peter |
35' |
|
35 |
Mössinger |
32' |
|
36 |
Karen |
2°35' |
|
37 |
Schuchardt |
3°41' |
|
38 |
Wenzel |
37' |
|
38 |
Wenzel |
11' |
|
39 |
Ebert |
19' |
|
39 |
Ebert |
5' |
|
39 |
Ebert |
21' |
|
40 |
Flinsch |
20' |
|
40 |
Flinsch |
1°09' |
|
40 |
Flinsch |
2°25' |
|
41 |
Engel |
2°44' |
|
42 |
Mende |
11' |
|
42 |
Mende |
42' |
|
44 |
Bödecker/Zander |
31' |
|
45 |
Güssefeld/Torke |
26' |
|
45 |
Güssefeld/Torke |
20' |
|
45 |
Güssefeld/Torke |
1°27' |
|
46 |
Vergens/Malchow |
2°24' |
|
47 |
Widlok/Noske |
1°27' |
|
48 |
Kühnold/ |
|
|
Schröder |
3°28' |
|
|
49 |
Budzinski/Leuber |
12' |
|
49 |
Budzinski/Leuber |
1°51' |
|
50 |
Fulda/Krämer |
39' |
|
50 |
Fulda/Krämer |
1°53' |
|
51 |
Erb/v. Malapert |
8' |
|
51 |
Erb/v. Malapert |
12' |
|
51 |
Erb/v. Malapert |
13' |
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
1°09' |
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
1°26' |
|
53 |
Deeg/Krämer |
2°56' |
|
54 |
Romeis/Prestele |
1°07' |
|
54 |
Romeis/Prestele |
1°25' |
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
1°53' |
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
1°06' |
|
57 |
Bayer/Specht |
1°52' |
|
58 |
Mudin/Deleurant |
3°07' |
|
59 |
Stein/Fröhlich |
17' |
|
59 |
Stein/Fröhlich |
19' |
|
59 |
Stein/Fröhlich |
50' |
|
E0 |
Abel/Phrenn |
1°31' |
|
61 |
Lander/ |
|
|
Oberschachtsiek |
17' |
|
|
61 |
Lander/ |
|
|
Oberschachtsiek |
20' |
Lande« Strecke Höhe ort km Gew.
Waku
|
Hohnstedt |
171 |
880 |
|
Naumburg |
150 |
810 |
|
Herren- |
||
|
breitungen |
41 |
460 |
|
Herrengosser- |
||
|
stedt |
41 |
790 |
|
Roßleben |
139 |
860 |
|
Merseburg |
174 |
840 |
|
Stahmel |
194 |
950 |
|
Freiburg/Unstr. |
151 |
1050 |
|
bei Apolda |
126 |
870 |
|
Waku |
||
|
Gottstedt |
87 |
870 |
|
Reulbach |
||
|
Altenfeld |
||
|
Waku |
||
|
Haindorf |
42 |
610 |
|
Hallenberg |
49 |
810 |
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Aschenhausen |
22 |
|
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Tannroda |
100 |
990 |
|
Niedertrebra |
133 |
1800 |
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Wüstensachsen |
||
|
Denstedt |
117 |
850 |
|
Bibra |
118 |
1040 |
|
Waku |
||
|
Aschenhausen |
22 |
|
|
Schafhausen |
22 |
|
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Schmalkalden |
45 |
|
|
Rastenberg |
129 |
|
|
Suhl |
54 |
|
|
Erfurt |
97 |
|
|
Waku |
||
|
Markvippach |
110 |
|
|
Waku |
||
|
Hallenburg |
49 |
|
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Nesselberghaus |
54 |
|
|
Bürgel |
136 |
|
|
Waku |
||
|
Tambach |
59 |
|
|
Arnstadt |
80 |
|
|
Walldorf |
34 |
|
|
Wahles |
44 |
|
|
Naumburg |
152 |
|
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Waku |
||
|
Gotha |
73 |
Waku Waku
|
Wett« Flugzeug» |
Flug« |
Lande» |
Strecke Höhe |
||
|
bew. führer |
zeit |
ort |
km |
Gew. |
|
|
Kr. |
|||||
|
61 |
Lander/ Oberschachtsiek |
12' |
Waku |
||
|
A |
Steinmann |
16' |
Waku |
||
|
A |
Steinmann |
2°35' |
Möbisburg |
88 |
|
|
B |
Sosniers |
3°54' |
Schöndorf |
115 |
|
|
C |
Hannoschöck |
3°06' |
Leubingen |
117 |
|
|
D |
Kober |
37' |
Aschenhausen |
22 |
|
|
E |
Esau |
1°27' |
Zella-Mehlis |
54 |
|
|
F |
Altmayer |
29' |
Reulbach |
||
|
F |
Altmayer |
38' |
Fischbach |
23 |
|
|
0 |
Lippmann |
1°13' |
Eckarts |
34 |
|
|
J |
Päsold |
3°06' |
Unterneusulza |
140 |
|
|
M |
Zanko |
3°05' |
Obergrunstädt |
108 |
|
|
vom |
1. August 1939 |
||||
|
1 |
Philipp |
1°28' |
Neusitz |
73 |
860 |
|
2 |
Baumann |
2°35' |
Miesitz |
137 |
1130 |
|
3 |
Fick |
1°18' |
Henfstädt |
46 |
1160 |
|
4 |
Huth |
5°01' |
Dresden |
278 |
2645 |
|
5 |
Hofmann |
3°39' |
Dresden |
278 |
2270 |
|
6 |
Heinemann |
4°30' |
Rochlitz |
211 |
1730 |
|
7 |
Haase |
5°09' |
Dresden |
278 |
2010 |
|
8 |
Sauerbier |
4°16' |
Chemnitz |
211 |
1210 |
|
10 |
Bräutigam |
4°16' |
Mohorn |
253 |
2570 |
|
11 |
Ludwig |
5°51' |
Markarsdorf |
256 |
2180 |
|
12 |
Treuter |
6°18' |
Lübau |
344 |
1850 |
|
13 |
Müller |
5°12' |
Dorfwehlen |
292 |
3060 |
|
15 |
Bock |
17' |
Waku |
||
|
15 |
Bock |
2°54' |
Serba |
142 |
1270 |
|
16 |
Henning |
V |
Tränkhof |
||
|
16 |
Henning |
2°44' |
Allendorf |
88 |
1030 |
|
17 |
Opitz |
3°06' |
Lehmar |
186 |
1965 |
|
18 |
Schubert |
5°05' |
Tanneberg |
253 |
1900 |
|
19 |
Meier zu Bentrup |
4°08' |
Chemnitz |
211 |
2040 |
|
20 |
Habicht |
4°02' |
Mittweida |
222 |
1400 |
|
21 |
v. Treuberg |
1°52' |
Angelroda |
71 |
650 |
|
22 |
Beck |
4°05' |
Chemnitz |
211 |
1470 |
|
23 |
Kraft |
4°43' |
Bautzen |
324 |
1570 |
|
24 |
Bauer |
5°23' |
Siebenlehn |
247 |
2420 |
|
25 |
Schmidt |
5°51' |
Qrötsch |
353 |
2730 |
|
26 |
Hauck |
2°38' |
Kahla |
122 |
1980 |
|
27 |
Fiedler |
4°39' |
Ebersdorf |
217 |
1540 |
|
28 28 |
Bender Bender |
23' 46' |
Finkenhain Tränkhof |
||
|
28 |
Bender |
20' |
Melpertz |
||
|
30 |
Späte |
5°22' |
Bautzen |
324 |
2630 |
|
31 |
Flakowski |
2°56' |
Langenwiesen |
76 |
1420 |
|
33 |
Scheidhauer |
3°28' |
Teuchern |
164 |
2540 |
|
34 |
Peter |
7' |
Waku |
||
|
35 |
Mössinger |
4°01' |
Wiederoda |
229 |
|
|
36 |
Karch |
4°23' |
Langenau |
238 |
2920 |
|
37 |
Schuchardt |
4°49' |
Görlitz |
361 |
2590 |
|
38 |
Wenzel |
4°01' |
Zwickau |
180 |
1270 |
|
39 |
Ebert |
12' |
Tränkhof |
||
|
39 |
Ebert |
4' |
Tränkhof |
||
|
39 |
Ebert |
19' |
|||
|
39 |
Ebert |
27' |
Tränkhof |
||
|
40 |
Flinsch |
5°19' |
Dresden |
278 |
2370 |
|
41 |
Engel |
11' |
Tränkhof |
||
|
41 |
Engel |
3°28' |
Chemnitz |
211 |
1520 |
|
42 |
Mende |
14' |
Fränkhof |
||
|
42 |
Mende |
3°57' |
b. Zwickau |
180 |
945 |
|
44 |
Bödeker/Zander |
3°11' |
Gera |
158 |
|
|
45 |
Qüssefeld/Torke |
3°18' |
Remschitz |
202 |
|
|
46 |
Vergens/Malchow |
5°25' |
Siebenleben |
248 |
|
|
47 |
Widlok/Noske |
1°27' |
Mehlitz |
54 |
|
|
48 |
Kühnold/Schröder |
5°19' |
Lauske |
340 |
|
|
49 |
Budzinski/Leuber |
8' |
Waku |
||
|
49 |
Budzinski/Leuber |
3°54' |
Chemnitz |
211 |
|
|
Wett* Flugzeugs |
Flug* |
Lande« |
Strecke |
Höhe |
|
|
bew. führer |
zeit |
ort |
km |
Gew. |
|
|
Nr. |
|||||
|
50 |
Fulda/Krämer |
1°56' |
Teichel |
102 |
|
|
51 |
Erb/v. Malapert |
1°51' |
Radscher |
53 |
|
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
4° 14' |
Chemnitz |
211 |
|
|
53 |
Deeg/Krämer |
3°03' |
Zehma |
184 |
|
|
54 |
Romeis/Prestele |
4°14' |
Chemnitz |
211 |
|
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
2°28' |
Freienorla |
118 |
|
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
8' |
Waku |
||
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
45' |
Meiningen |
36 |
|
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
6' |
Waku |
||
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
1°02' |
Sülzfeld |
30 |
|
|
58 |
Mudin/Deleurant |
3°40' |
Cossen |
208 |
|
|
59 |
Stein/Fröhlich |
1°42' |
Meiningen |
36 |
|
|
59 |
Stein/Fröhlich |
26' |
Tränkhof |
||
|
60 |
Abel/Phrenn |
1°20' |
Seeba |
27 |
|
|
61 |
Lander/ Oberschachtsiek |
9' |
Waku |
||
|
A |
Steinmann |
1°17' |
Meiningen |
34 |
|
|
B |
Sosniers |
1°42' |
Eußenhausen |
27 |
|
|
C |
Hannoschöck |
4°10' |
Zwickau |
180 |
|
|
D |
Kober |
7' |
Tränkhof |
||
|
D |
Kober |
53' |
Tränkhof |
||
|
D |
Kober |
43' |
Untermaßfeld |
33 |
|
|
E |
Esau |
4°28' |
Steinpleiß |
175 |
|
|
F |
Altmayer |
32' |
Tränkhof |
||
|
F |
Altmayer |
15' |
Tränkhof |
||
|
F |
Altmayer |
14' |
Tränkhof |
||
|
F |
Altmayer |
22' |
Tränkhof |
||
|
G |
Lippmann |
1°31' |
Wichshausen |
46 |
|
|
H |
Urban |
51' |
Tränkhof |
||
|
H |
Urban |
50' |
Helmershausen |
22 |
|
|
J |
Päsold |
2°35' |
Saalfeld |
102 |
|
|
K |
Bauer |
47' |
Bettenhausen |
31 |
|
|
L |
Zechin |
45' |
Saba |
27 |
|
|
M |
Zanko |
32' |
Tränkhof |
||
|
M |
Zanko |
24' |
Tränkhof |
||
|
vom |
2. August 1939 |
||||
|
1 |
Philipp |
4°30' |
Altenburg |
190 |
1230 |
|
2 |
Baumann |
1°21' |
Themar |
46 |
640 |
|
3 |
Fick |
5°17' |
Görlitz |
361 |
5140 |
|
4 |
Huth |
3°21' |
Kaufungen |
199 |
1040 |
|
5 |
Hofmann |
2°50' |
Hartmannsdorf |
208 |
2115 |
|
6 |
Heinemann |
5°34' |
b. Chemnitz |
216 |
1025 |
|
7 |
Haase |
6°38' |
Görlitz |
361 |
2025 |
|
CO |
Sauerbier |
4°01' |
Glauchau |
187 |
1045 |
|
10 |
Bräutigam |
5°47' |
Görlitz |
361 |
2780 |
|
11 |
Ludwig |
3°27' |
Meerane |
184 |
1110 |
|
12 |
Treuter |
2°52' |
Endschütz |
159 |
4675 |
|
13 |
Müller |
3°23' |
Steinbrücken |
156 |
1120 |
|
15 |
Bock |
3°05' |
Gr. Lübichau |
132 |
1120 |
|
16 |
Henning |
2°57' |
Mehlis |
53 |
650 |
|
17 |
Opitz |
5°57' |
Görlitz |
361 |
3805 |
|
20 |
Habicht |
2°43' |
Köstritz |
153 |
860 |
|
21 |
v. Treuberg |
6°10' |
Greiffenberg |
392 |
3965 |
|
22 |
Beck |
5°49' |
Chemnitz |
211 |
1600 |
|
23 |
Kraft |
5°24' |
Görlitz |
361 |
3185 |
|
24 |
Bauer |
4°22' |
Chemnitz |
211 |
2530 |
|
25 |
Schmidt |
3°10' |
Zschopau |
222 |
3810 |
|
26 |
Hauck |
2°07' |
Zella-Mehlis |
54 |
1180 |
|
27 |
Fiedler |
1°54' |
Mühlberg |
75 |
980 |
|
28 |
Bender |
2°06' |
Königsee |
84 |
1500 |
|
30 |
Späte |
5° |
Reichenberg |
365 |
4120 |
|
31 |
Flakowski |
3°07' |
Waldenburg |
194 |
3260 |
|
32 |
Geitner |
1°06' |
Wasungen |
36 |
1015 |
|
33 |
Scheidhauer |
5°51' |
Bürstein |
332 |
3060 |
|
34 |
Peter |
13' |
Waku |
||
|
35 |
Mössinger |
3°11' |
Rönneburg |
163 |
|
|
36 |
Karch |
28' |
Waku |
||
|
36 |
Karch |
3°34' |
Mülsen |
188 |
2740 |
|
Wett* Flugzeug» bew. führer Nr. |
Flug«-zeit |
Lande« Strecke Höhe ort km Gew. |
Wett* Flugzeug» bew. führer Nr, |
Flug« , zeit - |
Lande* Streck ort km |
|||||
|
38 |
Wenzel |
4°21' |
Meerane |
184 |
2250 |
23 |
Kraft |
12' |
Tränkhof |
|
|
39 |
Ebert |
2°56' |
Gera |
157 |
1120 |
23 |
Kraft |
4°58' |
Langen- |
|
|
40 |
Flinsch |
5°20' |
Welzow |
320 |
3600 |
weddingen |
207 |
|||
|
41 |
Engel |
4°03/ |
Oberlungwitz |
201 |
24 |
Bauer |
26' |
Waku |
||
|
42 |
Mende |
2°49' |
Hainspitz |
145 |
1180 |
24 |
Bauer |
4°40' |
Erfurt |
97 |
|
44 |
Bödeker/Zander |
4°06/ |
Seeligstädt |
166 |
25 |
Schmidt |
5°25' |
Magdeburg-Ost |
222 |
|
|
45 |
Güssefeld/Torke |
1°31' |
Bernbach |
51 |
26 |
Hauck |
25' |
Tränkhof |
||
|
46 |
Vergens/Malchow |
3°19' |
Gera |
156 |
26 |
Hauck |
14' |
Tränkhof |
||
|
48 |
Kühnold/Schröder |
27' |
Waku |
26 |
Hauck |
18' |
Tränkhof |
|||
|
48 |
Kühnold/Schröder |
1°42' |
Elxleben |
89 |
26 |
Hauck |
11' |
Tränkhof |
||
|
50 |
Fulda/Krämer |
3°29' |
Chemnitz |
211 |
27 |
Fiedler |
4°41' |
Laucha |
148 |
|
|
51 |
Erb/v. Malapert |
1°48/ |
Tann |
14 |
28 |
Bender |
40' |
Sommerberg |
||
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
4°52' |
Brabschätz |
272 |
28 |
Bender |
8' |
Tränkhof |
||
|
53 |
Deeg/Krämer |
49' |
Meiningen |
37 |
30 |
Späte |
4°31' |
Magdeburg |
213 |
|
|
53 |
Deeg/Krämer |
1°06' |
Waku |
31 |
Flakowski |
11' |
Tränkhof |
|||
|
54 |
Romeis/Prestele |
3°41' |
Chemnitz |
211 |
31 |
Flakowski |
7' |
Waku |
||
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
56' |
Fladungen |
18 |
35 |
Mössinger |
31' |
Tränkhof |
||
|
59 |
Stein/Fröhlich |
10' |
Rüdersdorf |
149 |
35 |
Mössinger |
1°55' |
Schmalkalden |
43 |
|
|
60 |
Abel/Phrenn |
1°24' |
Waku |
36 |
Karch |
1°37' |
Hilders |
10 |
||
|
61 |
Lander/ |
36 |
Karch |
11' |
Tränkhof |
|||||
|
Oberschachtsiek |
6' |
Meiningen |
37 |
37 |
Schuchardt |
3U10' |
Sachsenburg |
125 |
||
|
61 |
Lander/ |
38 |
Wenzel |
1°48' |
Meiningen |
37 |
||||
|
Oberschachtsiek |
41' |
Waku |
39 |
Ebert |
8' |
Waku |
||||
|
61 |
Lander/ |
40 |
Flinsch |
43' |
Hilders |
|||||
|
Oberschachtsiek |
47' |
Schleusingen |
57 |
40 |
Flinsch |
28' |
Tränkhof |
|||
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
3°23' |
Waku |
41 |
Engel |
21' |
Tränkhof |
|||
|
58 |
Mudin/Deleurant |
12' |
Waku |
41 |
Engel |
7' |
Tränkhof |
|||
|
59 |
Stein/Fröhlich |
1°07' |
Hilders |
42 |
Mende |
3°29' |
Breitenstein |
145 |
||
|
A |
Steinmann |
1°35' |
Meiningen |
37 |
44 |
Bödeker/Zander |
7' |
Waku |
||
|
B |
Sosniers |
1°22> |
Hohenkirchen |
68 |
44 |
Bödeker/Zander |
2°10' |
Barschfeld |
43 |
|
|
C |
Hannoschöck |
1°51' |
Martinsroda |
72 |
45 |
Güssefeld/Torke |
10' |
Waku |
||
|
D |
Kober |
3° 13' |
Zeulenroda |
146 |
45 |
Güssefeld/Torke |
26' |
Waku |
||
|
E |
Esau |
1°53' |
Belrieth |
39 |
45 |
Güssefeld/Torke |
2°07' |
Haindorf |
42 |
|
|
F |
Altmayer |
36' |
Waku |
46 |
Vergens/Malchow |
12' |
Waku |
|||
|
F |
Altmayer |
1°35' |
Gehlberg |
65 |
46 |
Vergens/Malchow |
40' |
Güthers |
19 |
|
|
G |
Lippmann |
2°49' |
Dorndorf |
136 |
48 |
Kühnold/Schröder |
1°09' |
Kaltennordheim |
21 |
|
|
H |
Urban |
3°58' |
Chemnitz |
212 |
49 |
Budzinski/Leuber |
11' |
Waku |
||
|
J |
Päsold |
3°02' |
Gößnitz |
182 |
49 |
Budzinski/Leuber |
1°22' |
Trusen |
||
|
K |
Bauer |
3°59' |
Chemnitz |
211 |
50 |
Fulda/Krämer |
25' |
Tränkhof |
||
|
L |
Zechin |
1°03' |
Wendershausen |
16 |
50 |
Fulda/Krämer |
45' |
Tränkhof |
||
|
L |
Zechin |
5' |
Waku |
50 |
Fulda/Krämer |
36' |
Morles |
16 |
||
|
M |
Zanko |
1°28' |
Suhl |
56 |
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk |
18' |
Waku |
||
|
vom |
3. August 1939 |
52 53 |
Tuliszka/Ruhbrauk Deeg/Krämer |
1°27' 21' |
Dorndorf Waku |
40 |
||||
|
2 |
Baumann |
Ii' |
Tränkhof |
53 |
Deeg/Krämer |
52' |
Oepfershausen |
27 |
||
|
2 |
Baumann |
3° |
Brotterode |
52 |
54 |
Romeis/Prestele |
2°54' |
Erfurt |
97 |
|
|
4 |
Huth |
4°51' |
Laucha |
148 |
2320 |
55 |
Knöpfle/Bödeker |
3°59' |
Erfurt |
97 |
|
3 |
Fick |
17' |
Tränkhof |
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
11' |
Waku |
|||
|
3 |
Fick |
2°35' |
Dachrieden |
94 |
840 |
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
8' |
Waku |
|
|
5 |
Hofmann |
4°30' |
Magdeburg |
213 |
58 |
Mudin/Deleurant |
2°25' |
Erfurt |
97 |
|
|
6 |
Heinemann |
2°32' |
Erfurt |
97 |
1610 |
59 |
Stein/Fröhlich |
14' |
Waku |
|
|
7 |
Haase |
5°24' |
Schkeuditz |
190 |
1060 |
59 |
Stein/Fröhlich |
7' |
Tränkhof |
|
|
8 |
Sauerbier |
13' |
Tränkhof |
60 |
Abel/Phrenn |
41' |
Kaltensundheim |
20 |
||
|
8 |
Sauerbier |
45' |
Kaltennordheim |
21 |
61 |
Lander/ |
||||
|
9 |
Ziller |
8' |
Waku |
Oberschachtsiek |
18' |
Tränkhof |
||||
|
9 |
Ziller |
2°40' |
Buttlar |
29 |
A |
Steinmann |
18' |
Tränkhof |
||
|
10 |
Bräutigam |
11' |
Tränkhof |
A |
Steinmann |
21' |
Tränkhof |
|||
|
10 |
Bräutigam |
2°34' |
Kölleda |
119 |
1555 |
B |
Sosniers |
12' |
Tränkhof |
|
|
11 |
Ludwig |
2°27' |
Laucha |
147 |
1025 |
B |
Sosniers |
47' |
Schachen |
|
|
12 |
Treuter |
5°30' |
Schkeuditz |
190 |
1470 |
C |
Hannoschöck |
1°05' |
Tränkhof |
|
|
13 |
Müller |
3°38' |
Laucha |
148 |
2265 |
C |
Hannoschöck |
55' |
Unterweid |
15 |
|
15 |
Bock |
1°14' |
Diedorf |
22 |
D |
Kober |
8' |
Tränkhof |
||
|
16 |
Henning |
12' |
Tränkhof |
D |
Kober |
1°31' |
Kaltennordheim |
21 |
||
|
16 |
Henning |
12' |
Tränkhof |
E |
Esau |
2°20' |
Kaltennordheim |
21 |
||
|
16 |
Henning |
23' |
Tränkhof |
F |
Altmayer |
16' |
Tränkhof |
|||
|
18 |
Schubert |
3°23' |
Erfurt |
97 |
860 |
F |
Altmayer |
12' |
Tränkhof |
|
|
20 |
Habicht |
3°18' |
Frankenhausen |
125 |
800 |
F |
Altmayer |
14' |
Tränkhof |
|
|
21 |
v. Treuberg |
2° 32' |
Sättelstädt |
64 |
530 |
G |
Lippmann |
1°05' |
Kaltensundheim |
20 |
|
22 |
Beck |
59' |
Hilders |
10 |
H |
Urban |
2°24' |
Herges |
47 |
|
Wett* Flugzeug* Flug* bew. führer zeit
Nr.
|
J |
Päsold |
10' |
|
K |
Bauer |
58' |
|
L |
Zechin |
11' |
|
M |
Zanko |
1°05' |
|
vom |
4. A |
|
|
1 |
Philipp |
6°36' |
|
2 |
Baumann |
1°24' |
|
3 |
Fick |
59' |
|
3 |
Fick |
2°18' |
|
4 |
Huth |
1°08' |
|
4 |
Huth |
2°16' |
|
5 |
Hofmann |
5°56' |
|
6 |
Heinemann |
5°24' |
|
7 |
Haase |
9' |
|
7 |
Haase |
11' |
|
7 |
Haase |
7' |
|
7 |
Haase |
4°35' |
|
00 |
Sauerbier |
17' |
|
8 |
Sauerbier |
4°03' |
|
9 |
Ziller |
5°14' |
|
10 |
Bräutigam |
56' |
|
10 |
Bräutigam |
3°54' |
|
11 |
Ludwig |
17' |
|
11 |
Ludwig |
5°05' |
|
12 |
Treuter |
7°05' |
|
13 |
Müller |
4° 12' |
|
15 |
Bock |
2°44' |
|
16 |
Henning |
11' |
|
16 |
Henning |
34' |
|
17 |
Opitz |
5°30' |
|
18 |
Schubert |
56' |
|
18 |
Schubert |
1°29' |
|
19 |
Meier zu Bentrup |
9' |
|
19 |
Meier zu Bentrup |
1°49' |
|
20 |
Habicht |
5°33' |
|
21 |
v. Treuberg |
4°22' |
|
22 |
Beck |
5°13' |
|
23 |
Kraft |
5°38' |
|
24 |
Bauer |
4°49' |
|
25 |
Schmidt |
7°07' |
|
26 |
Hauck |
30' |
|
26 |
Hauck |
1°42' |
|
27 |
Fiedler |
7°04' |
|
28 |
Bender |
1°02' |
|
30 |
Späte |
5°58' |
|
31 |
Flakowski |
4°52' |
|
32 |
Qeitner |
24' |
|
32 |
Qeitner |
2°20' |
|
34 |
Peter |
1°48' |
|
35 |
Mössinger |
1°32' |
|
25 |
Mössinger |
59' |
|
36 |
Karch |
6°16' |
|
37 |
Schuchardt |
4°28' |
|
38 |
Wenzel |
16' |
|
38 |
Wenzel |
13' |
|
38 |
Wenzel |
4°21' |
|
39 |
Ebert |
2°42' |
|
40 |
Flinsch |
5°21' |
|
41 |
Engel |
16' |
|
42 |
Mende |
7' |
|
42 |
Mende |
4°20' |
|
44 |
Bödeker/Zander |
1°21' |
|
45 |
Güssefeld/Torke |
13' |
|
45 |
Qüssefeld/Torke |
2°34' |
|
46 |
Vergens/Malchow |
4°52' |
|
48 |
Kühnold/Schröder |
23' |
|
48 |
Kühnold/Schröder |
3°48' |
|
49 |
Budzinski/Leuber |
20' |
Lande* Strecke Höhe
|
ort |
km |
|
Tränkhof |
|
|
Kaltennordheim |
21 |
|
Tränkhof |
|
|
Hilders |
10 |
|
gust 1939 |
|
|
Dassel |
149 |
|
Burghaun |
29 |
|
Rudolfshau |
25 |
|
Niederscheden |
11 |
|
Fulda |
22 |
|
Dennhausen |
92 |
|
Beverungen |
203 |
|
Negenborn |
161 |
|
Waku |
|
|
Waku |
|
|
Waku |
|
|
Ith |
164 |
|
Waku |
|
|
Holzminden |
154 |
|
Ith |
164 |
|
Fulda |
20 |
|
Wangelnstedt |
157 |
|
Waku |
|
|
Ith |
164 |
|
Holtensen |
210 |
|
Uslar |
134 |
|
Waltersbrück |
76 |
|
Waku |
|
|
Steinhaus |
18 |
|
Naensen |
157 |
|
Oberbimbach |
28 |
|
Aua |
54 |
|
Waku |
|
|
Kassel |
94 |
|
Negenborn |
160 |
|
Ith |
164 |
|
Ith (unten) |
164 |
|
Uslar |
196 |
|
Ith |
164 |
|
Dramfeld |
220 |
|
Waku |
|
|
Schlitz |
33 |
|
Oserwald |
182 |
|
Marbach |
21 |
|
Iber |
190 |
|
Eschershausen |
135 |
|
Waku |
|
|
Fritzlar |
86 |
|
Mörshausen |
74 |
|
Rudolfshau |
25 |
|
Hersfeld |
44 |
|
Ith |
164 |
|
Ith (unten) |
164 |
|
Waku |
|
|
Waku |
|
|
Witzenhausen |
98 |
|
Herleshausen |
60 |
|
Uslar |
196 |
|
Schakau |
|
|
Waku |
|
|
Meinbrexen |
141 |
|
Angersbach |
38 |
|
Waku |
|
|
Reichenbach |
77 |
|
Uslar |
134 |
|
Waku |
|
|
Göttingen |
118 |
|
Sickels |
21 |
|
Wett* Flugzeug* |
Flug* |
Lande* Streck |
||
|
bew. führer |
zeit |
ort |
km |
|
|
Nr. |
||||
|
49 |
Budzinski/Leuber |
23' |
Fulda |
22 |
|
50 |
Fulda/Krämer |
2°10' |
Angersbach |
39 |
|
51 |
Erb/v. Malapert |
1°50' |
Hilgershausen |
77 |
|
52 |
Tuliszka/Ruhbrauk 3°10' |
Hann.-Münden |
106 |
|
|
53 |
Deeg/Krämer |
2°01' |
Kassel |
94 |
|
54 |
Romeis/Prestele |
4°55' |
Uslar |
134 |
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
10' |
Waku |
|
|
55 |
Knöpfle/Boecker |
3°02' |
Lispenhausen |
57 |
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
9' |
Waku |
|
|
56 |
Kahlbacher/Kaleta |
2°29' |
Niederbeisheim |
68 |
|
57 |
Bayer/Specht |
10' |
Waku |
|
|
57 |
Bayer/Specht |
1°01' |
Oetzhausen |
35 |
|
58 |
Mudin/Deleurant |
3°18' |
Münden |
106 |
|
59 |
Stein/Fröhlich |
1°08' |
Landenhausen |
38 |
|
60 |
Abel/Phrenn |
4°31' |
Ith |
164 |
|
61 |
Lander/ |
|||
|
Oberschachtsiek |
3°02' |
Feldberg |
82 |
|
|
A |
Steinmann |
42' |
Poppenhausen |
|
|
A |
Steinmann |
15' |
Waku |
|
|
B |
Sosniers |
16' |
Poppenhausen |
|
|
C |
Hannoschöck |
55' |
Hettenhausen |
|
|
D |
Kober |
28' |
Waku |
|
|
D |
Kober |
7' |
Wraku |
|
|
D |
Kober |
17' |
Waku |
|
|
E |
Esau |
25' |
Waku |
|
|
E |
Esau |
7' |
Waku |
|
|
E |
Esau |
25' |
Poppenhausen |
|
|
F |
Altmayer |
8' |
Waku |
|
|
F |
Altmayer |
6' |
Waku |
|
|
G |
Lippmann |
35' |
Waku |
|
|
Q |
Lippmann |
1°05' |
Poppenhausen |
|
|
H |
Urban |
45' |
Waku |
|
|
H |
Urban |
47' |
Waku |
|
|
J |
Päsold |
39' |
Oberrod |
|
|
J |
Päsold |
57' |
Weesen |
|
|
K |
Bauer |
1°06' |
Waku |
|
|
K |
Bauer |
34' |
Waku |
|
|
K |
Bauer |
55' |
Poppenhausen |
|
|
L |
Zechin |
1°19' |
Waku |
|
|
M |
Zanko |
43' |
Waku |
|
|
M |
Zanko |
13' |
Waku |
|
|
vom |
5. August 1939 |
|||
|
4 |
Huth |
10' |
Tränkhof |
|
|
5 |
Hofmann |
20' |
Tränkhof |
|
|
7 |
Haase |
16' |
Tränkhof |
|
|
7 |
Haase |
10' |
Tränkhof |
|
|
9 |
Ziller |
21' |
Tränkhof |
|
|
9 |
Ziller |
13' |
Tränkhof |
|
|
10 |
Bräutigam |
11' |
Tränkhof |
|
|
10 |
Bräutigam |
18' |
Tränkhof |
|
|
11 |
Ludwig |
6' |
Tränkhof |
|
|
11 |
Ludwig |
14' |
Tränkhof |
|
|
12 |
Treuter |
24' |
Tränkhof |
|
|
13 |
Müller |
11' |
Tränkhof |
|
|
17 |
Opitz |
7' |
Tränkhof |
|
|
18 |
Schubert |
7' |
Tränkhof |
|
|
20 |
Habicht |
29' |
Tränkhof |
|
|
23 |
Kraft |
4' |
Tränkhof |
|
|
25 |
Schmidt |
24' |
Tränkhof |
|
|
30 |
Späte |
10' |
Tränkhof |
|
|
36 |
Karch |
4' |
Tränkhof |
|
Klein-Leistungs-Segelflugzeug Hütter 28.
Das Klein-Leistungsflugzeug H 28, ein Entwurf aus dem Jahre 1935 (s. „Flugsport" 1935 S. 577), wurde von Wolfgang und Ulrich Hütter den modernen Erfordernissen angepaßt und von NSFK.-Mann Richard Knoth zum 20. Rhön-Wettbewerb zur techn. Bewertung gemeldet.
Hervorzuheben ist bei dieser Konstruktion die Sturzfluggeschwindigkeitsbegrenzung durch SH-Hütter-Sturzflugbremsen mit neuartigem Antrieb (Versuch Oeldruck), dadurch Vereinfachung des Anschlusses am Flügelübergang, Oeldruckübertragung durch die Querruderstoßstange. Infolge der Kürze der Zeit wurde an Stelle der hydraulischen Betätigung eine mechanische eingebaut. Durch die kleine Spannweite sollte bessere Wendigkeit und Handlichkeit erreicht werden, ferner durch Verminderung der gesamten benetzten Oberfläche auf 33,5 m2 (Minimoa oo 63 m2) Widerstandsverminderung.
Der Bau wurde in Gemeinschaftsarbeit von 5 NSFK.-Angehöri-gen ausgeführt. Verwendet wurden u. a. genormte Preßstoffprofile, besonders bei den Bremsklappen. Von neuen Konstruktionseinzelheiten sind zu nennen: Schnellverschlüsse, neuartige Flügeldiagonalbeschläge (Buchse in vergütetem Holz), Neigungsmesser über elektr. Wendezeiger für Blindflug. Atmungs- bzw. Funkgeräte können in der Torsionsnase des Flügels untergebracht werden.
Flügelaufbau Doppel-T-Holm mit Kiefer und vergüteter Buche lameliiert. SH - Hütter - Sturzflugbremsen, Leichtmetall - Querruder (torsionssteif, an den Gelenken biegeweich). Unterbringung der Ellbogen im Flügelübergang. Vorne durchsichtige Spaltverkleidung (Sicht nach unten).
Spannweite 13,3 m, Fläche 10 m2, Seitenverhältnis 1 : 18, Rüstgewicht mit B-Klappen 115 kg, Zuladung 85 kg, Fluggewicht 200 kg, Flächenbelastung 20 kg/m2, Rumpflänge 5,3 m.
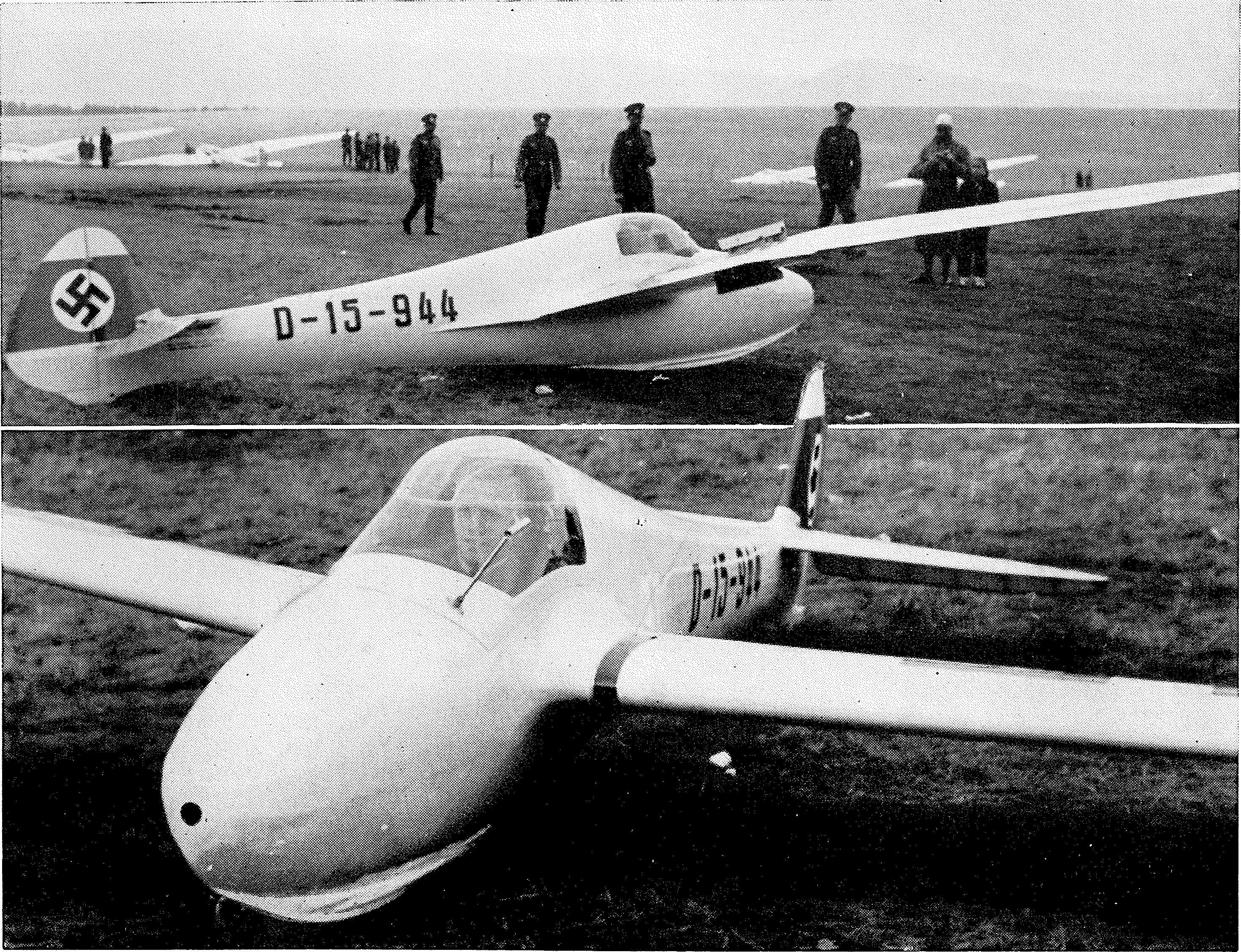
Klein-Leistungs-Segelflugzeug Htitter 28.
Bilder: Flugsport
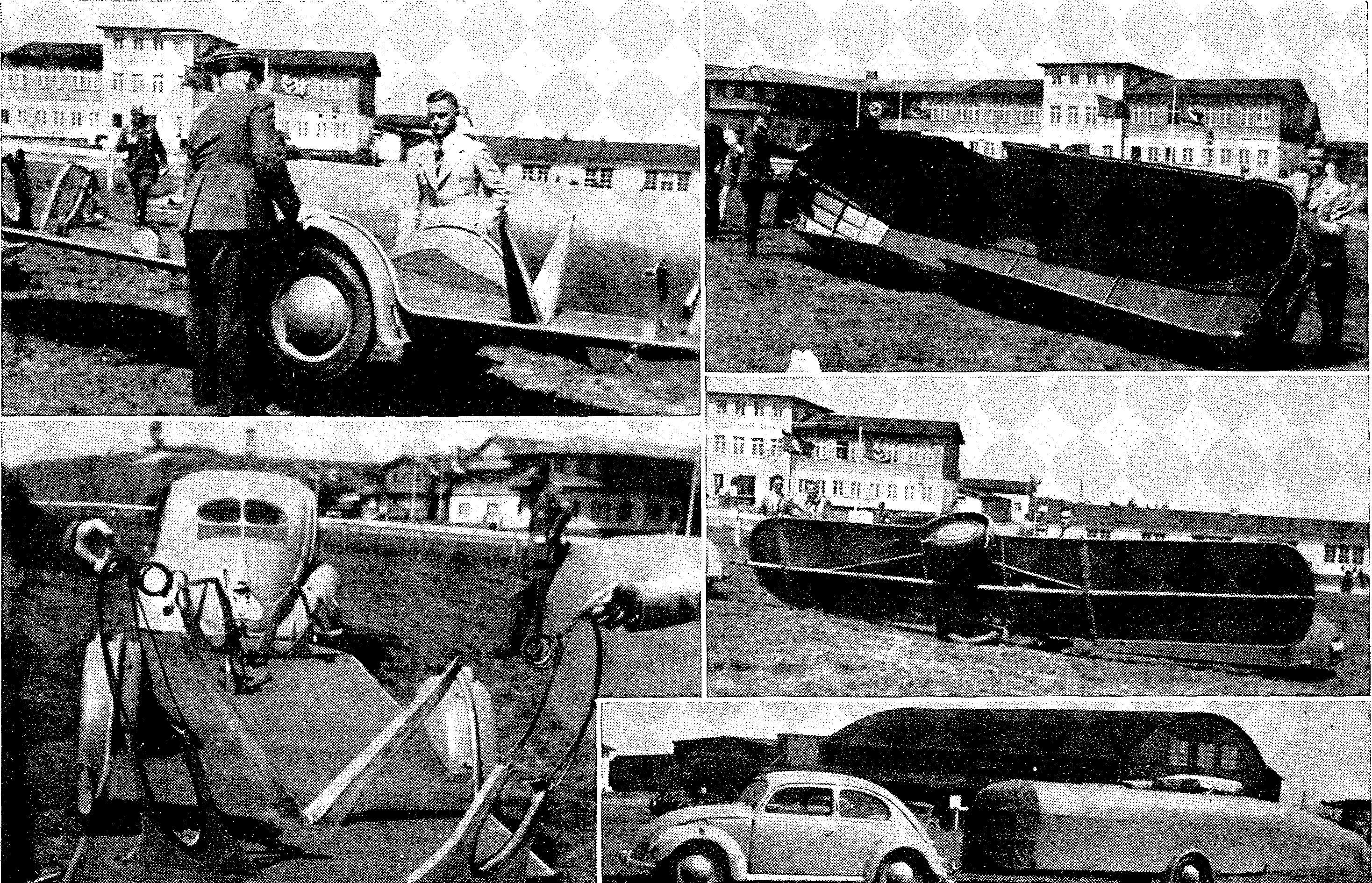
Transportwagen für Hütter 28 mit Volkswagen. Gesamtkosten Flugzeug mit Transportwagen und Volkswagen RM 5000.—. Bilden Flugsport
Dem Entwicklungsgedanken lag gleichzeitig die Absicht zugrunde, durch ein leichtes Flugzeug auf leichtem Transportwagen, welcher durch einen Volkswagen gezogen wird, eine handliche, in der Anschaffung und besonders im Betrieb billige Qeräteinheit zu schaffen.
Der Transportwagen, Entwurf A. Haag, hat einen Zentral-Rohr-Rahmen mit gedämpfter Torsionsstabfederachse (Porsche). Aufbau Stahlblechkasten-Scheren mit vollständig abnehmbarer segeltuchüberzogener Stahlrohrhaube. Zugwagenbereifung 4X50X16. Hervorzuheben ist die vollständig seitwärtige Verlademöglichkeit, Austauschbarkeit der Räder und Achsenteile bei etwaiger Verwendung des Volkswagens.
Konstruktions-Einzelheiten 20. Rhön-Wettbewerb.
SH-Hütter-Sturzflugbremsen.
In der technischen Bewertung beim 20. Rhön-Wettbewerb wurden die von Wolf gang und Ulrich Hütter bei Schempp-Hirth entwickelten Sturzflugbremsen, die in eine „Minimoa 39" eingebaut waren, ausgezeichnet.
Diese neuen SH-Sturzflugbremsen haben folgende Vorteile: Einfacher Aufbau, geringer Platzbedarf und daher günstig einzu-
Ktappen eingefahren
Schnitt SH-Hütter-Sturzflugbremsen.
Zeichnung Flugsport
Ausgefahren
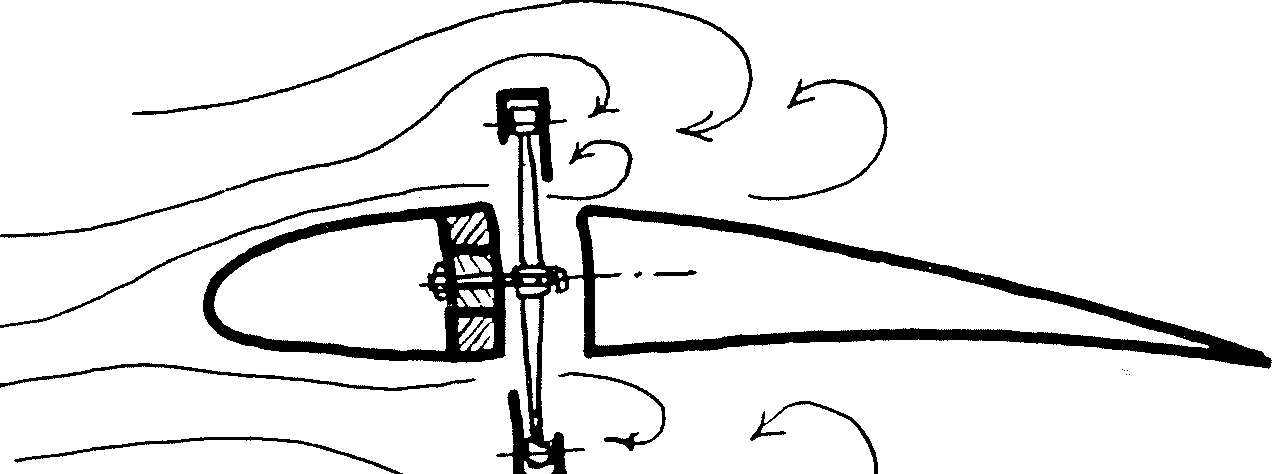
___Antrieb
Majopen hatb-ausgefahren {Ansicht)
bauen, sowohl in aerodynamischer Hinsicht (man kann die Klappen weit vorne einbauen), als auch in statischer Hinsicht. Die Luftkräfte wirken fast senkrecht zur Betätigungsrichtung. Es kommen daher nur ganz geringe Kräfte in das Antriebsgestänge. Einfache Holzbauweise. Das Klappenfach ist gegen das Flügelinnere vollständig abgedichtet. Der Antrieb erfolgt mittels Stoßstangen.
Die in der diesjährigen Rhön-Ausschreibung gegebenen Anregungen zur Verbesserung der Segelflugzeug-Transportwagen und -gerate haben die Konstrukteure zu den verschiedenartigsten Verbesserungen veranlaßt.
Preßluftantrieb für Wendezeiger oder künstlichen Horizont.
Braeutigam hat für den Zielstrecken-Wettbewerb einen Antrieb des künstlichen Horizontes (Sperry), nach eingetretener Vereisung der Antriebsdüse, erprobt und für den technischen Wettbewerb gemeldet.
Der Antrieb erfolgt durch eine doppelseitig arbeitende Saugpumpe von etwa 500 cm3 Hubraum. Selbst auf dem Boden genügen wenige Pumpenzüge, um den „Sperry" auf ausreichende Umdrehungszahlen zu bringen. Im Flug genügt dann ganz langsames Pumpen, um das Kreiselgerät nach eingetretener Vereisung der Düse in einwandfreiem Lauf zu halten. Eine selbsttätig arbeitende Ventilanordnung schließt bei Benutzung des Düsenantriebes die Saugleitung zur Pumpe und umgekehrt.
Die Pumpe wurde leicht beweglich auf dem Boden des Führersitzes befestigt und wird mit der linken Hand bedient.
Segelflugzeug-Transportwagen „Mü 17".
Die Flugtechnische Fachgruppe München hat zu der „Mü 17" einen besonderen Transportwagen entwickelt, bei dem durch besondere Vorrichtung die Verladezeit auf wenige Minuten gebracht werden konnte. Der Wagen kann auch für andere Segelflugzeuge mit 15 m Spannweite verwendet werden.

20. Rhön. Links: Blick in den Führerraum der Maschine von Braeutigam. Man erkennt links die Handluftpumpe zum Antrieb des Wendezeigers oder künstlichen Horizontes. Rechts oben: Flinsch in „Mü 17" mit eingebautem Kurzwellensender und -empfänger, Wellenlänge 49 m, zur Verständigung mit seiner Rückholmann-schaft. Unten: Die Startmannschaft ist vor Starteröffnung angetreten.
Bilder: Flugsport
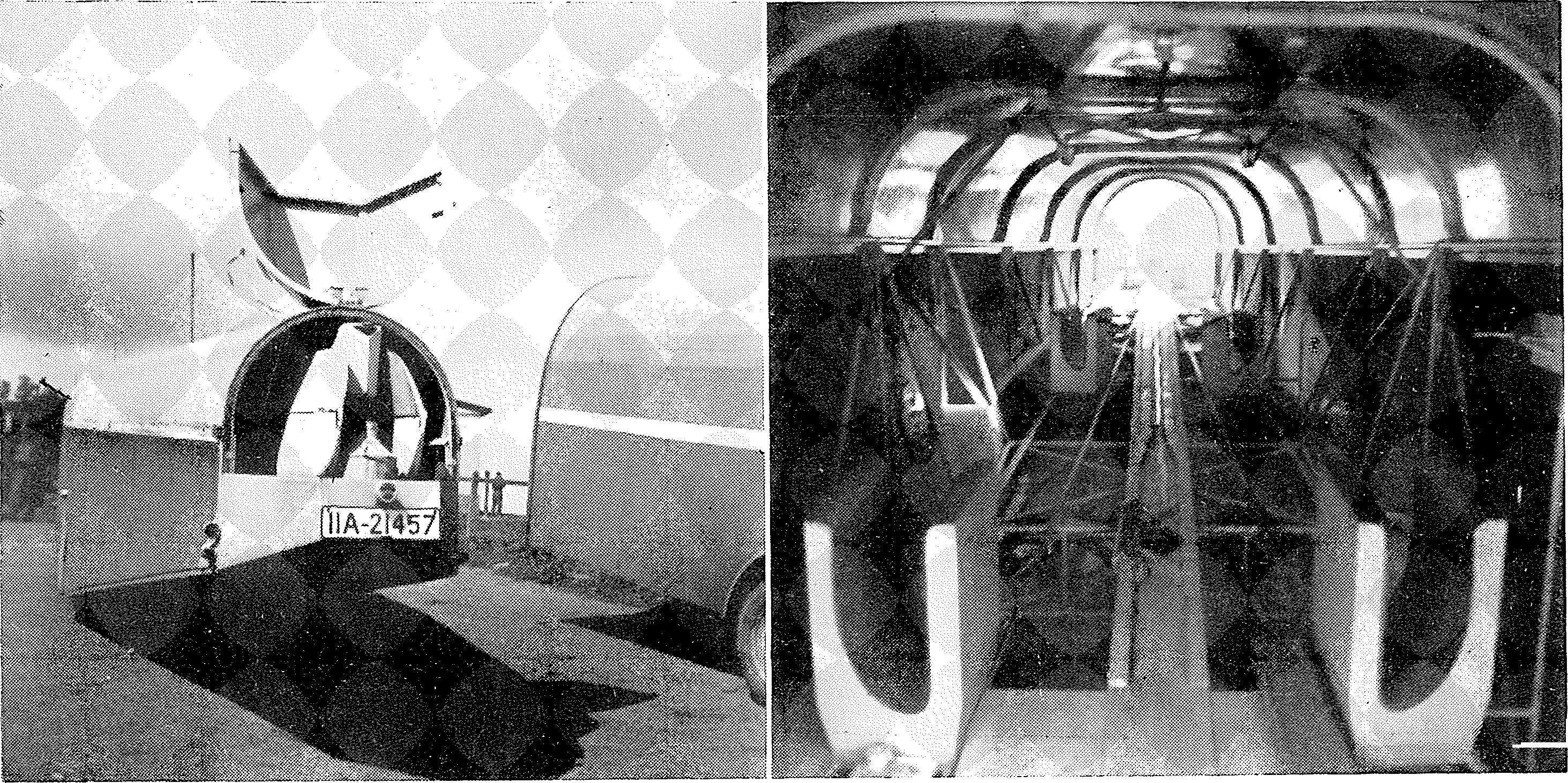
Segelflugzeug-Transportwagen „Mü 17". Bilder: Flugsport
Das nach außen verlegte und tragende Stahlrohrfachwerk schützt bei Unfällen das Flugzeug weitgehend vor Beschädigung. Das Dach ist mit Sperrholz beplankt, für Seitenwände wurden Segelplane gewählt. Auflaufbremsen entlasten den Zugwagen. Durch die tiefe Schwrerpunktslage wurden außerordentlich gute Fahreigenschaften erzielt.
Der Boden und die Seitenwände bis zu drei Viertel der Höhe sind aus Stahlrohr aufgebaut. Der obere Teil besteht aus Holzspanten mit Segeltuchbespannung bzw. mit Sperrholzbeplankung. Vordere und hintere Türe des Wagens sind als Klappen ausgebildet und geben nach oben geschwenkt die ganzen Stirnöffnungen des Wagens frei.
Die Flügel lagern mit ihren Enden in je einem auf Schienen laufenden Rollbock, während sie mit der Wurzel in feste Böcke gelegt werden. An den Hauptbeschlägen befestigte Riemen verhindern ein Wandern der Flügel. Der Rumpfsporn gleitet beim Einladen auf einer in der Längsachse des Wagens angeordneten Holzschiene, die Rumpfspitze wird sodann an einem an der Wagendecke hängenden Gestänge festgelegt. Für Hauben- und Seitenruderaufhängung sind an der Wagendecke bzw. -wand besondere Paßstücke vorgesehen, die ein schnelles Einhängen möglich machen. Gewicht des Wagens 325 kg.
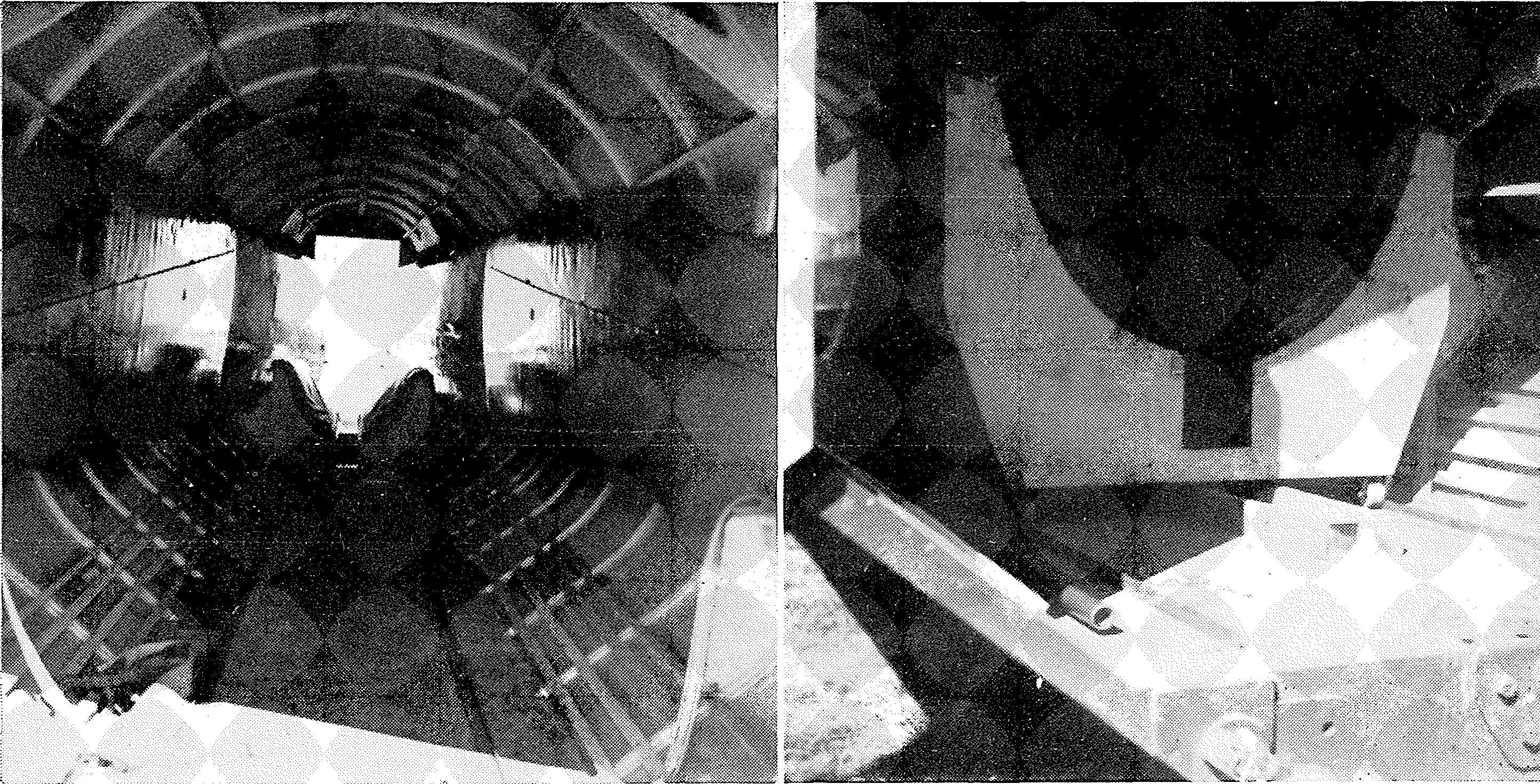
Segelflugzeug-Transportwagen „Göttingen 2". Bilder: Flugsport
Segelflugzeug-Transportwagen „Göttingen 2".
Bewerber NSFK.-Mann Heinz Eggink. Die Schale des völlig geschlossenen Wagens (vgl. Abb.) besteht aus Spanten mit Sperrholzbeplankung. Die Rumpfspitze wird in einem auf Schienen laufenden kleinen Wagen gelagert. Auf diese Weise läßt sich der Rumpf leicht einschieben. Am Ende der Schiene schnappt eine Haltevorrichtung in einen Haken ein, der beim Ausladen der Maschine von der Stirnseite aus mittels Seilzug ausgelöst werden kann. Auch die Unterbringung der Flügel ist sachgemäß. Der Wagen ist geschickt und zweckmäßig konstruiert.
Segelflugzeug-Transportwagen „Gu 5".
Bewerber Oberstuf. Wohldorf hat die Unterseite des Wagens gegen Staub und Spritzwasser vollkommen abgedeckt. In diesem Wagen können verschiedene Segelflugzeugmuster, auch solche mit Knickflügel, untergebracht werden. Der Vorteil gegenüber geschlossenen Wagen besteht darin, daß die Flächen von außen aufgelegt werden und Beschädigungen, die häufig beim Einfahren in enge Wagen auftreten, vermieden werden. Für Kurztransporte offen, für lange Transporte mit Plane, die im Werkzeugkasten mitgeführt wird. Werkzeugkasten in Wagenmitte, von beiden Seiten zu öffnen» Hierbei gleichzeitig Kontrolle und Wartung der Federn ohne Abschrauben eines Deckels. Gewicht des Wagens 280 kg.
Mannschafts-Transport- und Schleppwagen „Opel-Blitz".
Die NSFK.-Gruppe 4, NSFK.-Sturmbannführer Sievers, hat normale W2 t „Opel-Blitz" Lkw., die sonst mit einfachen Sitzbänken ausgerüstet sind, für den besonderen Einsatz zum Wettbewerb umgebaut. Der Neueinbau und -aufbau berücksichtigt die besonderen Anforderungen, die beim Rückholen von Segelflugzeugen an Kraftfahrer, Flugzeugführer usw. gestellt werden.
Unter Verwendung von einfachsten Mitteln, ohne den bisherigen Aufbau des Kraftfahrzeuges im wesentlichen zu ändern, sind 4 Sitze für Mannschaften, eine Schlafgelegenheit und 2 Werkzeugkisten, die zu gleicher Zeit die Rückwand des Wagens bilden, eingebaut. Das Fahrzeug ist gegen Zugluft abgedichtet. Sämtliche Einbauten können nach Lösung der Schraubverbindungen in kürzester Zeit entfernt werden, so daß das Fahrzeug wieder für Mannschaftstransporte eingesetzt werden kann. Auf Bequemlichkeit ist, soweit dies möglich war, Rücksicht genommen worden. Vgl. Abb. unten.
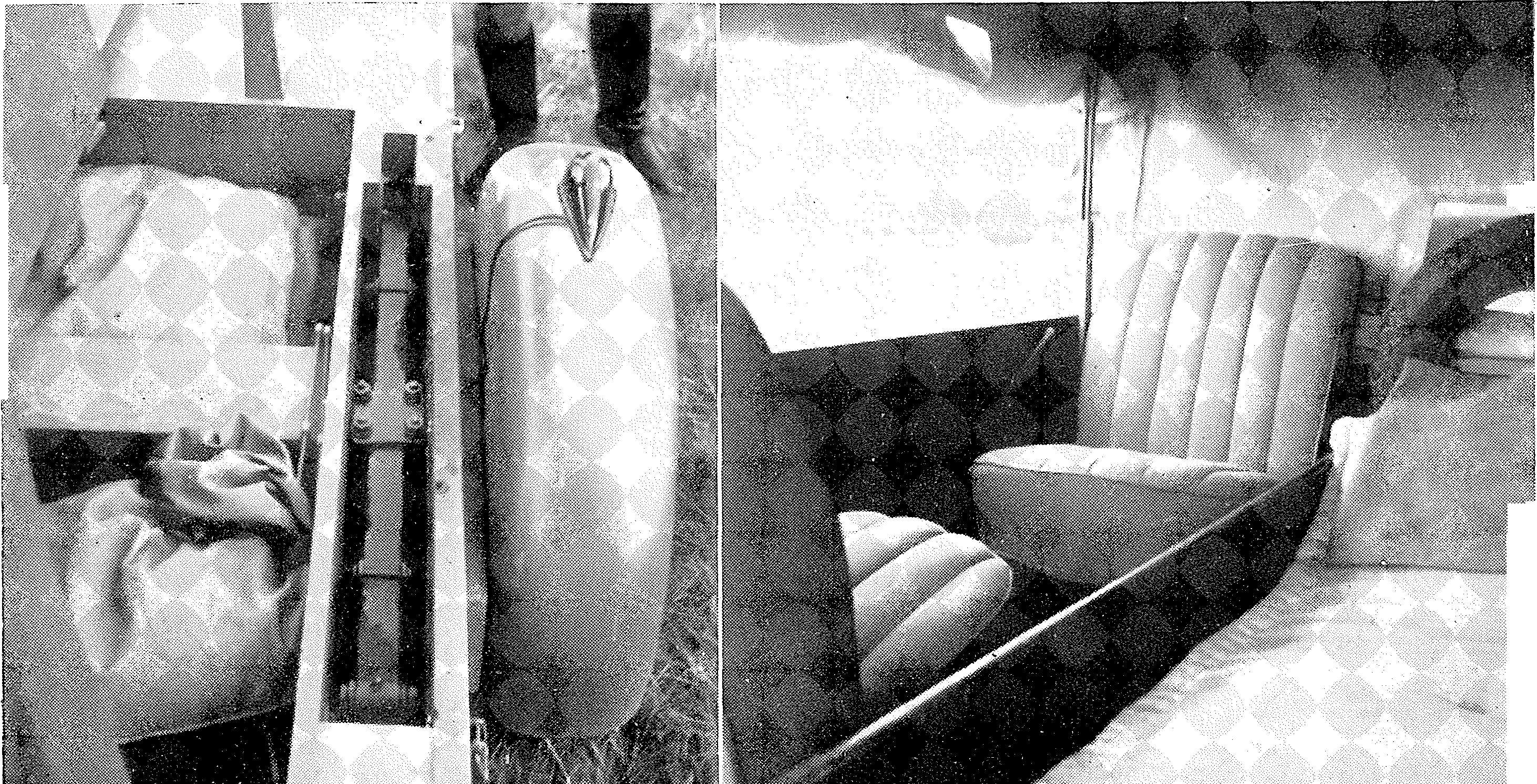
Segelflugzeug-Transportwagen „Gu5" (links). Mannschafts-Transport- und Schleppwagen „Opel-Blitz" der NSFK.-Gruppe 4 (rechts).
Bilder: Flugsport
Die Abdichtung der Plane erfolgt derart, daß ein angenähter Bund durch Klemmleisten an den Bordwänden dicht befestigt wird. Die Festklemmung ist einwandfrei und läßt sich durch einfaches Herausziehen der Leisten leicht lösen.
Japan. Mitsubishi Frachtflugzeug.
Mitteldecker in Ganzmetallbau. Zwei Stern-Motoren Mitsubishi Kinsei 900 PS luftgekühlt.
Rumpf elliptischer Querschnitt. Uebliche Glattblechbauweise. Besatzung 3 bis 5. Doppeltes Seitenleitwerk. Fahrwerk hochziehbar.
Spannweite 25 m, Länge 16 m, Höhe 3,7 m, Gewicht 5000 kg. Reisegeschwindigkeit 260 km/h, Dauer 10 Std.
Ein Flugzeug dieser Type mit der Bezeichnung Soyokaze (Brise) flog im April und Mai 39 von Tokio nach Teheran und zurück.
Japan. Frachtflugzeug Mitsubishi.
Archiv Flugsport
Engl. Flugboot Lerwick.
Die Flugboottype Lerwick ist von Saunders Roe als Küsten-und Seefernaufklärer entwickelt und in Serienbau genommen worden. Dieser Typ scheint infolge der großen Bestellung für das Royal Air Force von diesem besonders bevorzugt zu werden. Um den vorliegenden Serienauftrag auszuführen, mußten erst noch weitere Werkstätten gebaut werden.
Hochdecker mit freitragendem Flügel, zwei Bristol Hercules 14 Zyl. Schiebermotoren 1375 PS, ziemlich weit vor der Flügelnase. Zwei seitliche Stützschwimmer fest mit zwei kräftigen V-Streben. Boot einstufig, stark gekielt, mit weit nach hinten gezogenem Endkiel.
Besatzung 7 Mann. Drei hydraulisch drehbare Türme für Maschinenkanonen. Spannweite 24,4 m, Länge 19 m, Höhe 6 m.
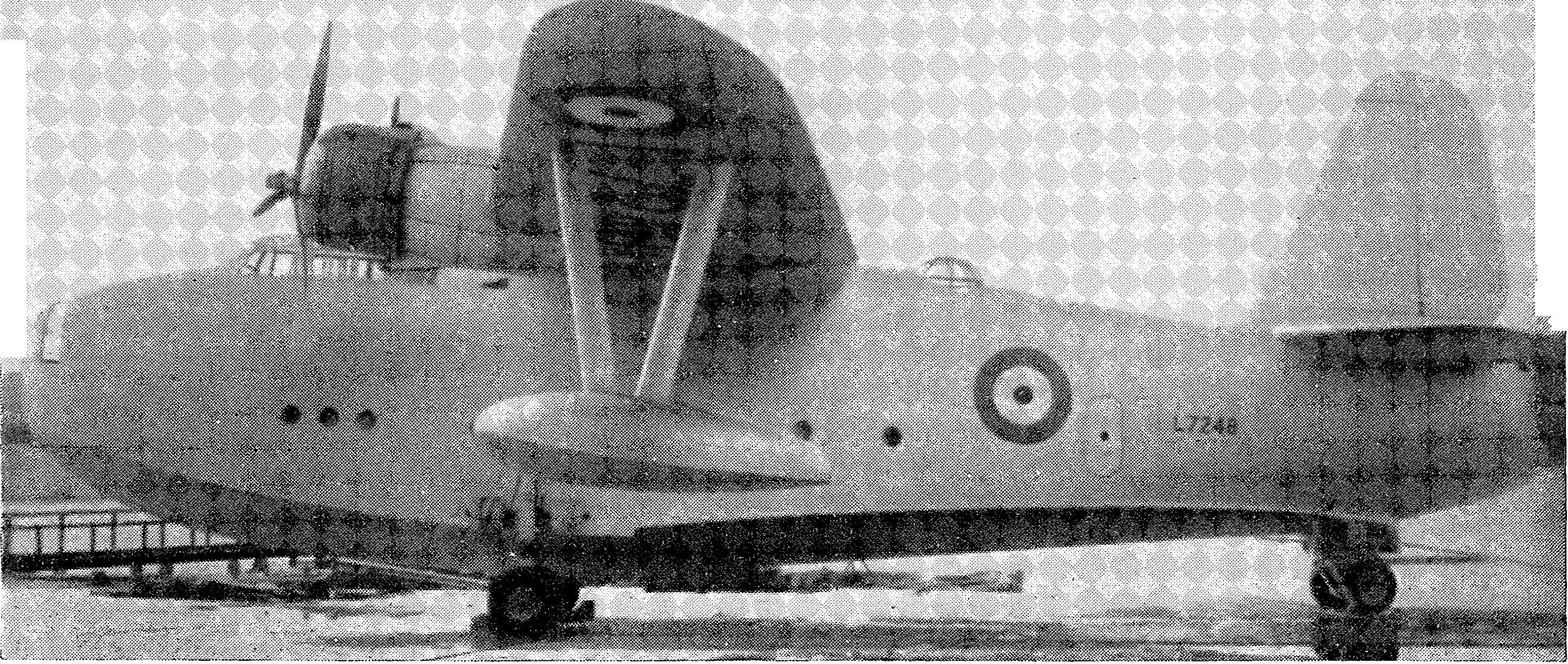
Engl. Saunders-Roe Lerwick Flugboot. Zwei Bristol-Hercules-Schieber-Motoren.
Werkbild

L-TFLUG— UM1SCHÄ1
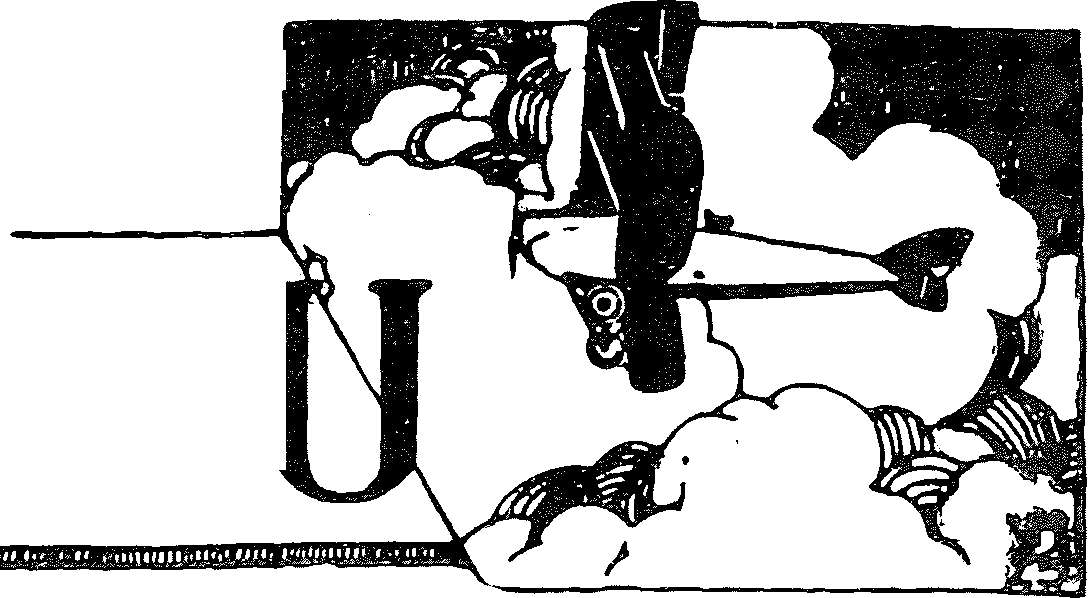
Inland.
Tagesbefehl an die Luftwaffe vom 2. August.
Kameraden! Heute vor fünfundzwanzig Jahren zog die deutsche Armee ins Feld, um die Heimat vor den rings an den deutschen Grenzen aufmarschierten feindlichen Mächten zu schützen. In dieser Armee auch eine Fliegertruppe. Klein, wenn man sie nur in Zahlen werten wollte, aber groß, wenn wir den Geist, der sie beseelte, als Maßstab anlegen. In diesem Geist, der sich in den Heldengestalten eines Boelcke und Richthofen verkörperte, hat die deutsche Fliegertruppe vier Jahre gekämpft. Sie stritt gegen eine vielfache Uebermacht, gegen die unerschöpflichen Reserven von Mensch und Material einer Welt von Feinden. Aber wenn auch auf einen deutschen Flieger drei, fünf, ja zehn Gegner kamen — die deutschen Flieger kämpften mit unerschüttertem Mut, sie kämpften und siegten bis zuletzt.
Dann brachte schmählicher Verrat das bittere Ende. Ein Friedensdiktat zerschlug unsere Wehr zur Luft und verbot Deutschland jede, auch die geringste Luftverteidigung. Jedoch: Man konnte wohl die Flugzeuge und die Motoren zerschlagen, nicht aber den deutschen Fliegergeist.
Der deutsche Fliegergeist marschierte mit der nationalsozialistischen Bewegung, denn im Nationalsozialismus erstanden ja alle die Tugenden und seelischen Kräfte, die unsere Flieger im Weltkrieg zu ihren herrlichen Taten befähigt hatten.
Der Führer schenkte dem deutschen Volke die deutsche Luftwaffe. Und er gab mir ihren Oberbefehl. Ich habe in den vergangenen Jahren mein Bestes getan, um unsere Luftwaffe zu der größten und mächtigsten der Welt zu machen. Ihre Stärke und Einsatzbereitschaft hat nicht zuletzt die Schaffung unseres Großdeutschen Reiches ermöglicht.
Geboren aus dem Geist der deutschen Flieger des großen Krieges, verschworen der Idee unseres Führers und Obersten Befehlshabers, so steht heute die deutsche Luftwaffe, bereit jeden Befehl des Führers blitzschnell und mit ungeahnter Stoßkraft durchzuführen. Unser Gedenken gilt heute dem Tag vor fünfundzwanzig Jahren, unser Blick aber ist voraus gerichtet in die Zukunft unseres ewigen Deutschlands. Göring,
Generalfeldmarschall.
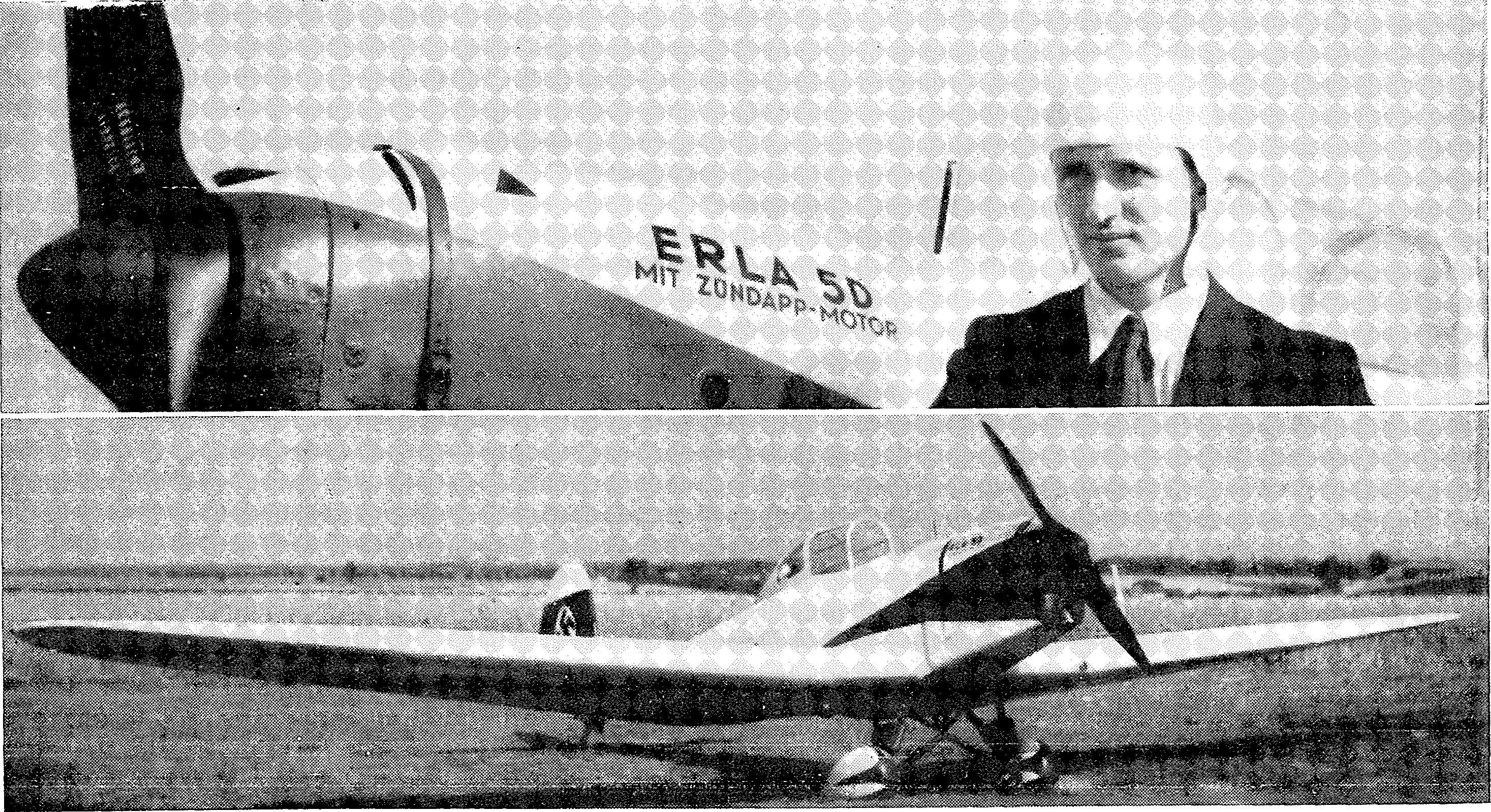
Langstreckenflug Gabler 1915 km. Oben Gabler. Unten „Erla 5 D".
Werkbilder
216 km/h über 10 000 km Strecke Weltbestleistung mit Heinkel-Flugzeug He 116 aufgestellt. Flugzeugbesatzung Oberltn. d. R. Rolf Jöster, Oberfunker Arthur Suppa von der DLH und Hirth-Motorenfachmann Hans Lausmann. Meßstrecke Zinnowitz—Leba. Am 30. 7. 6.05 h überflog das Flugzeug den 1. Kontrollpunkt und beendete am 1. 8. 4.23 h nach 46 h 18 min den Flug über 10 000 km in geschlossener Bahn. Mit dieser Leistung wurde der seit Mai 1938 von Japan mit 186,2 km/h gehaltene Rekord um 30 km überboten. Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Generalfeldmarschall Göring, sandte folgendes Telegramm: „Mit Freude und stolzer Genugtuung habe ich davon Kenntnis genommen, daß Sie den internationalen Geschwindigkeitsrekord über die 10 000-km-Strecke für Deutschland errungen haben. Ich beglückwünsche Sie und alle Beteiligten zu diesem Erfolg und spreche insbesondere der wackeren Besatzung für die tagelange Einsatzfreudigkeit Dank und Anerkennung aus.
Luitmanöver in Norddeutschland 1.—3. 8 fanden unter Leitung des Chefs der Luftflotte 2, General der Flieger Felmy, im Räume zwischen Aachen, Bonn und Paderborn im Süden, Bremerhaven und Emden im Norden statt. Beteiligt waren Kampf-, Jagd- und Aufklärungsverbände, Flieger-Nachrichtentruppe und Flak-Artillerie. Die genannten Städte begrenzten das gekennzeichnete „Blauland", zu dem auch die ostfriesischen Inseln gehörten, das mit dem östlich der Elbe liegenden „Rotland" Krieg führte, so daß also die beiden kämpfenden Parteien durch das zwischen Weser, und Elbe gelegene „neutrale Grünland" und das sich nördlich der Elbemündung und Lübeck erstreckende gleichfalls „neutrale Gelbland" getrennt waren. Die neutralen Länder bildeten eine Barriere, die nicht überflogen werden durften.
1915 km auf Kleinflugzeug „Erla 5 D" flog Gabler am 2. 8. 39. Start 1.30 h Friedrichshafen, Landung 16 h Flugplatz Vännäs (Nordschweden). Mit diesem Flug wurde der USA-Langstreckenrekord von 1631 km erheblich überboten. „Erla 5 D" ist ein einsitziges Kleinflugzeug der Erla-Maschinenwerk G. m. b. H. Leipzig, Konstrukteur Xaver Mehr. Motor 50 PS Zündapp.
Berlin —Rio de Janeiro flog Großflugzeug Focke-Wulf-Condor D-ABSK „Arumani", am 29. 7. eintreffend, in 35 h 14 min.
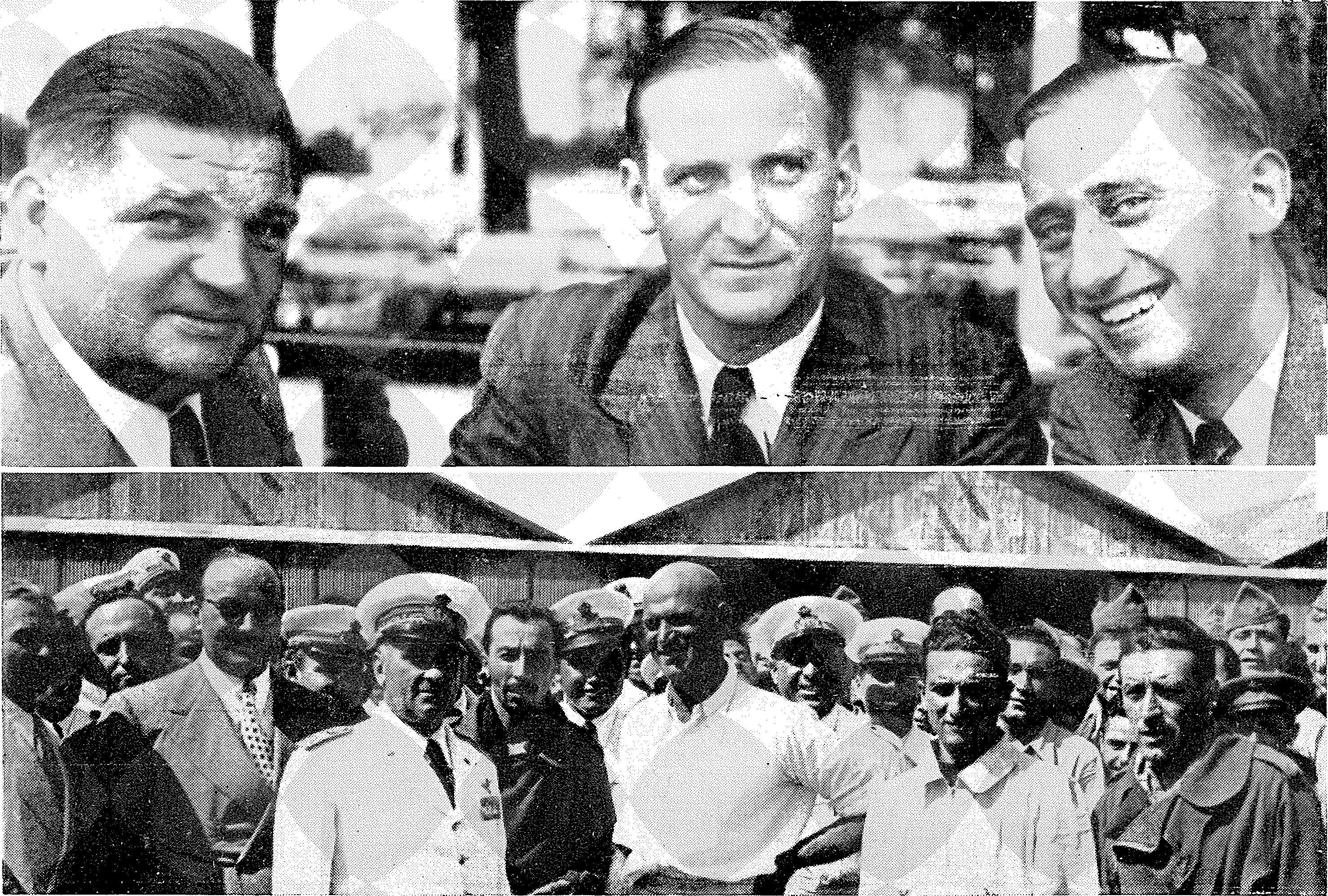
Geschwindigkeitshöchstleistung über 10 000 km Strecke. Oben: Die Besatzung des Heinkel-Flugzeuges He 116, die 216 km am 1.8. erreichte. Von links: Oberf. Arthur Suppa, Oberltn. d. R. Rolf Jöster und Motorenspezialist Hans Lausmann. Unten die erfolgreiche ital. Besatzung, welche die 10 000 km mit 226 km/h am 1.8. zurücklegte. Die Besatzung bestand aus: Lt. Col. Angelo Tondi, Cpt Roberto Dagasso, Pilot Ferruccio Vignoli und Srg. Aldo Stagliano.
Weltbild / Archiv Flugsport
Seite 448
,F L U Q S P 0 R Tu Nr. 17/1939, Bd. 31
Von den großen Uebungen der Luftwaffe in Nordwestdeutschland. Eines der schnellen deutschen Kampfflugzeuge tankt an einer unterirdischen Tankstelle, um sofort wieder zum Feindflug zu starten. Um dem Flugzeugführer das schnelle Erkennen der Tankstelle zu ermöglichen, ist sie durch ein buntes Segel gekennzeichnet. Weltbild
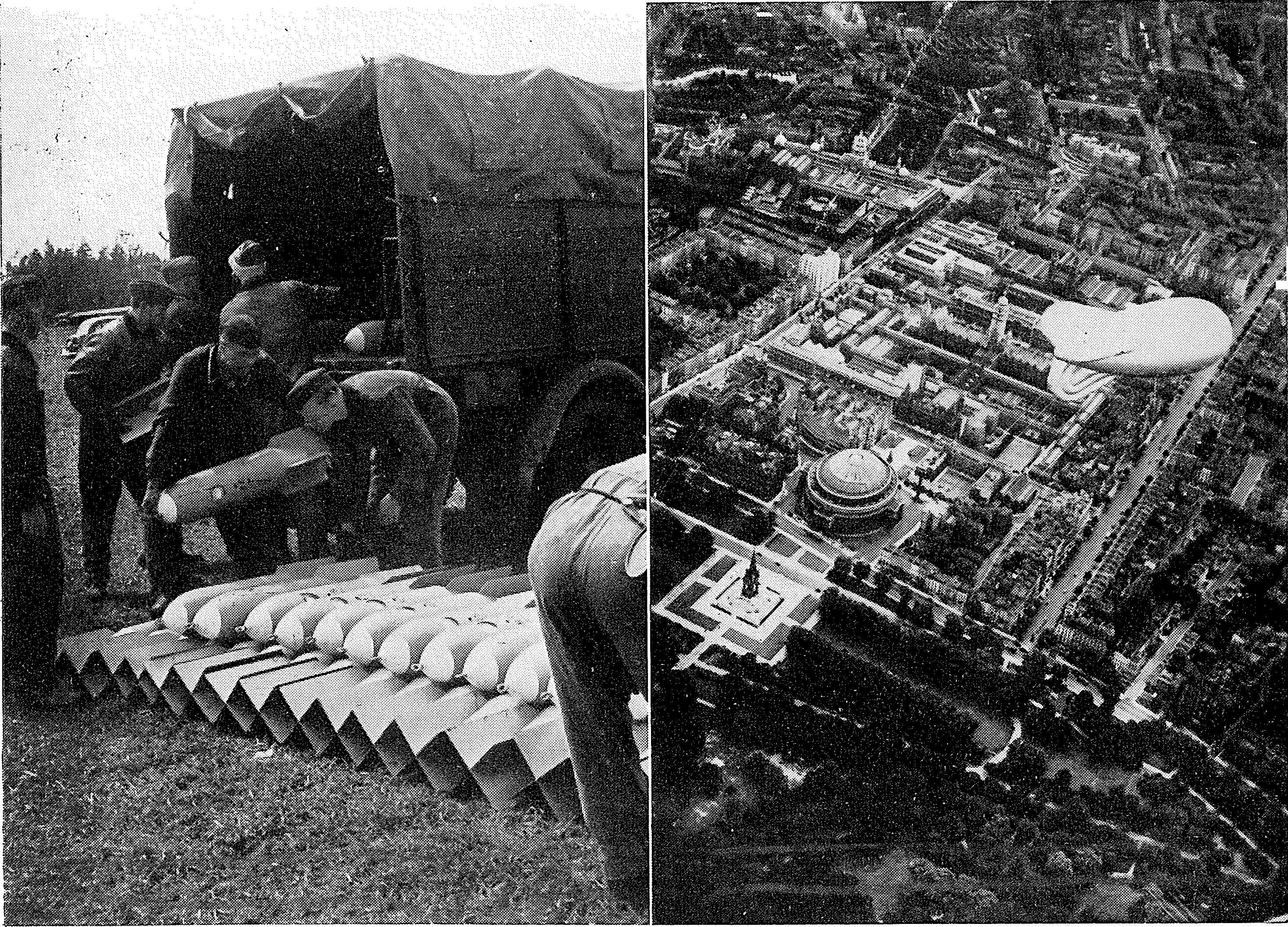
Links: Von den großen Uebungen der Luftwaffe in Nordwestdeutschland. Ein schwerer Kraftwagen hat die Uebungsbomben zum Flugplatz gebracht. Schnell werden sie vom Bodenpersonal gestapelt und nach der Rückkehr des Geschwaders vom Feindflug sofort in die Kampfflugzeuge verladen. Rechts: Ballonsperre-Uebungen über London begannen am 28. 7. Während der nächsten zwei Monate wird im Umkreis von 7 Meilen von der Towerbrücke in London die Ballonsperre rings um die Hauptstadt ständig aufrechterhalten. Weltbild (2)
Prosper L'Orange t> Prof. Dr. Ing. e. h., Dipl.-Ing., 63 Jahre alt, Stuttgart, nach kurzer Krankheit gestorben. L'Orange hat sich durch seine Arbeiten mit kompressorlosen Dieselmotoren einen Namen gemacht. Wir werden auf die letzten Arbeiten von L'Orange noch zurückkommen.
Was gibt es sonst Neues?
Blohm & Voß B. V. 222, wie „Flight" vom 10. 8. berichtet, bei Blohm öl Voß im Bau. 6 Motore, Fluggewicht 45 t. Max. Aktionsradius 7000 km mit einer Anzahl Fluggästen und Post. Reisegeschwindigkeit bei größeren Strecken 275 km/h.
Boulogne-sur-Mer, Flughafen eröffnet Anfang August.
Mailand—Brüssel - Luftlinie am 2. 8. von der Avio Linee eröffnet.
Ausland.
Engl. King's Cup Rennen 2. 9. 12 Maschinen und Wakefield Ch all enge Trophy 2. 9. 14 Maschinen gemeldet. Für das King's Cup Rennen: Percival Mew Gull, Miles Hawk Speed VI, Percival Vega Gull, D. H. T. K. 2, Percival Gull, Reid öl Sigrist Trainer, Miles Falcon VI, Miles Hawk, Airspeed Courier, Hendy 302- Comper Swift und Miles Sparrow-Hawk. Für die Wakefield Challenge Trophy: 3 Chilton, D. H. Hörnet Moth, Mothcraft Sports, Mothcraft Trainer, D. H. Moth Miner, Avro Avian IV M, Cygnet, Luton Major, Hawker Tomtit, 2 Tipsy, Blackburn Bluebird.
Rossi auf Amiot 370 beabsichtigte am 27. 7. den 10 000 km Rekord anzugehen, mußte aber nach 6000 km wegen Motorstörung aufgeben.
7254 m mit 5000 kg auf Boeing Viermotor USA. Höchstleistung am 22. 7. Langley Field aufgestellt. Der Weltrekord 9132 m mit 5000 kg wird von Deutschland (Flugzeugführer Kindermann und Wendel) auf Ju-90 gehalten.
Train 4E-01 Vierzylinder Reihenmotor, 50/55 PS Typenlauf 100 Std. ausgeführt.
„Hans Wende" Flugzeug D-AUJG 4. 8. zwischen Barcelona und Madrid bei Hospitalet zerstört aufgefunden. Ums Leben kamen hierbei Oberst v. Scheele, Luftattache bei der deutschen Botschaft in Spanien, Ehepaar Kirschner und Besatzung Flugkpt. Mack, Funkermasch. Beßmann, Flgzfunk. Hansel und Monteur Bartsch.
237 km/h über 10 000 km wurden gleichfalls am 1.8. nachmittags auf einem dreimotorigen Flugzeug der italienischen Luftwaffe aufgestellt. Auf einer geschlossenen 1000-km-Bahn wurden in insgesamt 57 h 1 min 52 sec 12937,77 km mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 236,97 km/h zurückgelegt und damit die deutsche Leistung überboten. Flugzeugführer Oberst Angelo.
„Hans Loeb" Flugzeug D-ANJH 3. 8. bei Landung Rangun beschädigt, geriet in Brand. Fluggäste sowie Besatzung unverletzt.
Alexejew f, der bekannte russische Einflieger, welcher im Jahre 1936 im Ohnehaltflug von Moskau nach Omsk und zurück flog und auch als Inhaber eines internationalen Höhenflugrekords in Fliegerkreisen bekannt geworden ist, mit Flugzeug tödlich verunglückt.
USA. nationale Luftrennen 2. 9. Bendix Trophy Race (Los Angeles—Cleveland) ; 3,9. Greve Trophy Race (Cleveland) und 4.9. Thompson Trophy Race (Cleveland, Ohio).
USA., 30 Jahre Militärfliegerei 2.8. in Dayton gefeiert.
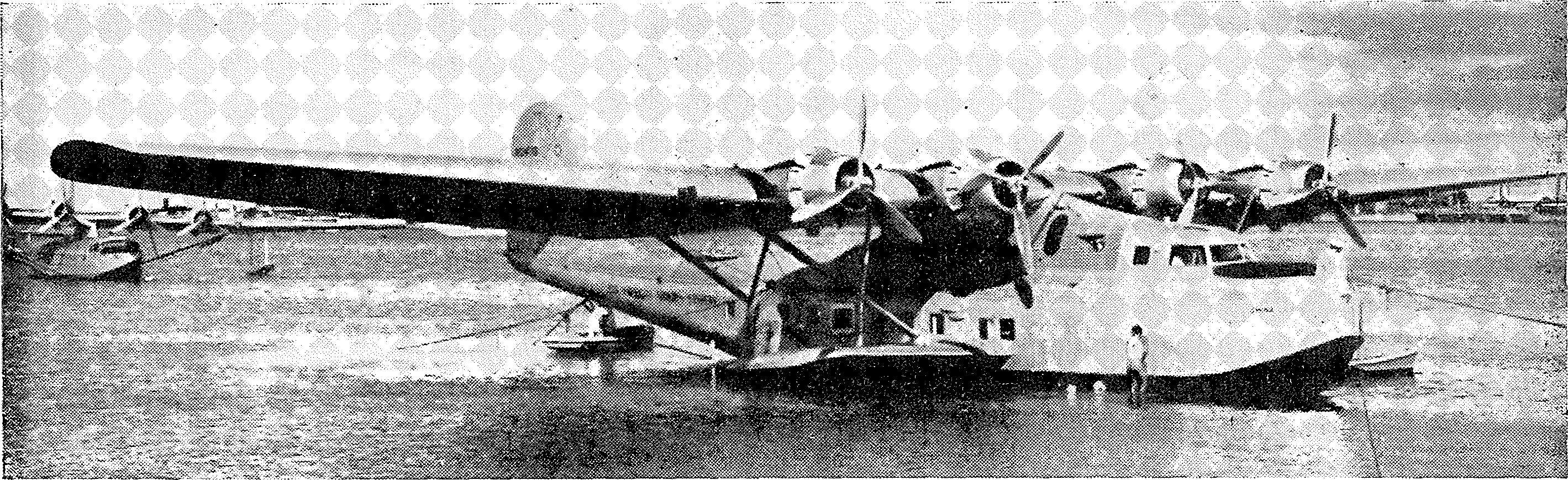
Glenn Martin Flugboot wird im Hafen Cavite, Manila, Philippinen, auf den Schwimmponton gezogen. Diese Flugzeugtype mit 4 Pratt öl Whitney Wasp-Motoren fliegt die Strecke San Franzisco—Hongkong der Pan American Airways. Im Hintergrund sieht man ein Sikorsky S-42B mit 4 Pratt öl Whitney Hornet-Motoren derselben Gesellschaft, das ebenfalls auf dieser Strecke fliegt und auch die Transatlantikflüge der Pan American Airways im Jahre 1937 ausgeführt hat.
Bild Shell
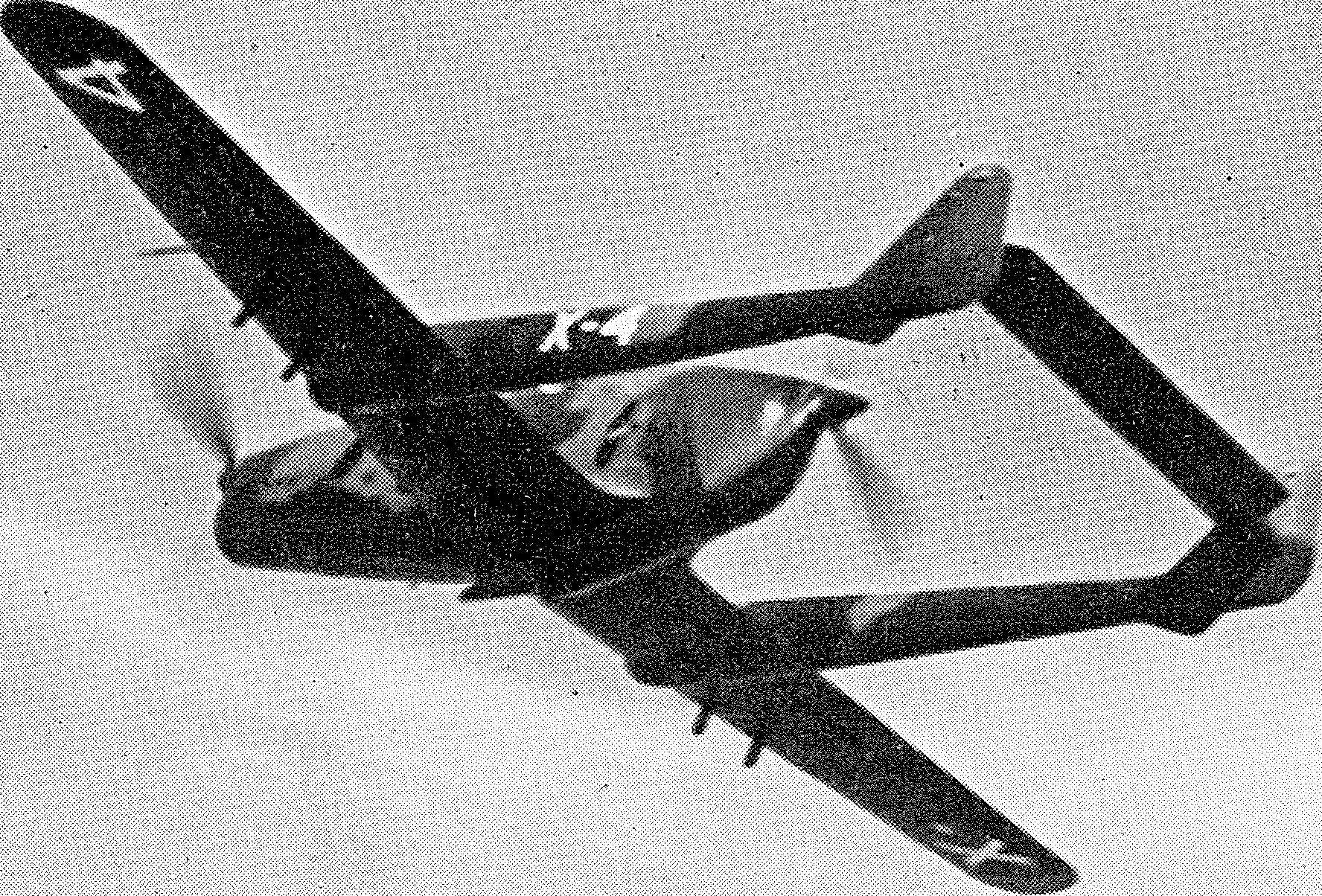
Fokker D 23 zweimotoriger Jagdeinsitzer mit 2 Walter-Sagitta-Motoren in letzter Ausführung. Vgl. Typenbeschr. „Flugsport" 1938, S. 675. Werkbilder
Segelflug
Nehring-Wanderpreis erhielt NSFK.-Oberstuf. Ziller für seinen Höhensegel-flug vom 21. .11. 38, wobei er 8600 m erreichte.
Banne d'Ordanche, Segelflugwettbewerb, in 20 Tagen wurden 3679 km von 14 Segelfliegern zurückgelegt.
Berichtigung: Liste der Inhaber des Segelflieger-Leistungsabzeichens, veröffentlicht in Nr. 12 des „Flugsport" 1939, S. 315—317, muß es unter Nr. 974 richtig heißen „Popescu, Valentin, Rumänien" statt „Popesen, Valentin, Polen"; unter Nr. 1043 „v. Stan, Ilie, Rumänien" statt „Stan v. Ilie, Polen" und unter Nr. 1109 „Golescu, Mihai, Rumänien" statt „Golesen Mihai, Polen".
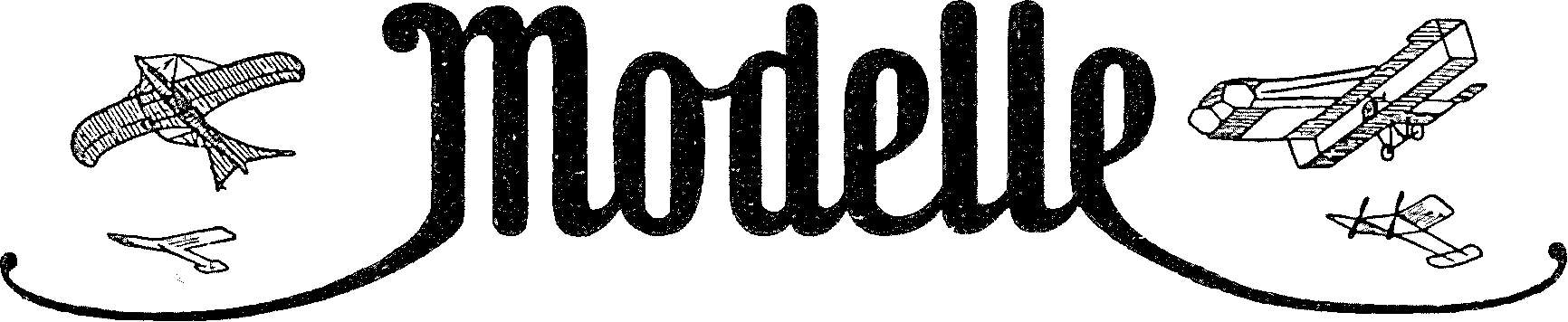
Intern. Modell-Wettbewerb König Peter II Cup. 22.-23.7. auf Fairey's Great West Aerodrom. Teilnehmer Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Holland, Jugoslawien und Schweiz. Sieger franz. Mannschaft, Zweiter England und Dritter Deutschland.
HJ.-Vergleichsmodellfliegen Dresden - Heller 5.8.39 anläßlich eines achttägigen Sonderlehrgangs unter Anleitung von Modellbaulehrern der NSFK.-Gruppe 7 fand auf dem Dresdner Flugplatz Heller statt. Man sah sehr schöne Arbeiten, so ein Schwingenflugmodell mit Benzinmotorantrieb eines 17jährigen Gefolgschaftsführers. Das anschließende Vergleichsmodellfliegen von 30 ausgewählten Pimpfen und Hitlerjungen ermöglichte eine Beurteilung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Jungen.
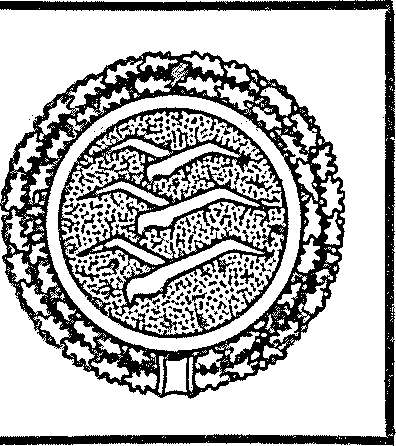
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Wie berechnet, konstruiert und baut man ein Flugzeug? Von Dipl.-Ing. 0. L. Skopik. 5. erweit. und. verb. Auflage. 154 Abb. im Text, 32 Lichtb., Baupläne und Daten v. 43 dt. Flugzeugbaumustern. Verlag Richard Carl Schmidt & Co., Berlin W 62. Preis RM 12.—.
Das Buch ist mehr für die breite Masse der am Flugzeugbau Interessierten bestimmt. Auch Leser mit geringeren mathematischen Vorkenntnissen können den beigefügten Rechnungsbeispielen folgen. Hervorzuheben sind die klaren Abbildungen mit sauberer Beschriftung.
Der Vogelflug. Von Dr. Max Stolpe u. Dr. Karl Zimmer. 127 Abb. Akademische Verlagsgesellsch. m.b.H., Leipzig. Preis brosch. RM 11.—, geb. RM 12.60.
Die meisten Erscheinungen auf diesem Gebiete sind veraltet. Die vorliegende Arbeit, die biologische Erforschung des Vogelfluges durch die Anwendung der Gesetze der modernen Aerodynamik aus der bisherigen rein spekulativen Betrachtung in exakte Bahnen zu lenken, ist sehr zu begrüßen. Wertvoll sind die Tafeln über Körpergewicht, Herzgewicht im Verhältnis zum Körpergewicht, Geschwindigkeiten u. a. m.
Flugzeugtischler Schlosser (Schweiß.)
für sofort gesucht.
Naumburger Flugzeugwerke G.m.b.H. Naumburg (Saale).
F
ernschule für
lugzeugbau
Tbeoret. Vorbereitung für Bauprüfer, Flugzeugführer, Ingenieure sowie für den gesamten Flugdienst. Sonderlehrgängefür Jungflieger. Abschlußprüfungen - Abschlußzeugnisse. Studien-progr. Nr. 14s durch das Sekretariat.
Fernschule G.m.b.H. BerlinWl5
Soeben erschien:-
Jahrbuch der Deutschen Luftfahrt-Forschung. 1. 252 Seilen. 2. 204 Abbild, in Leinen gebunden ... RM 50.—
Grundlagen der Flugzeug-Navigation. 2 Aufl., kart. RM 16.—
Die Grundlagen der Flugsicherung ... . rm 7.— Jon. Schönleitner, Aichkirchen-PisdorMI
Post Lambach, Oberdonau

itfweida
Maschinenbau / Automobil- u. Flugtechnik I I Elektrotechnik. Programm kostenlos I
Gelegenheit!
iviiies Whitney siraigfii
eine moderne 2 sitzige Kabine mit Doppelsteuer, 130 PS Gipsy, ca. 200 km Reisegeschwindigkeit, nur 165 Betriebsstunden, aus erster Hand preisgünstig
abzugeben. Anfragen an Je Schechner,
Saarbrücken, Flughafen.
Industrieunternehmen sucht
rer
und
Bordfunker
(Monteur)
zum baldigen Antritt.
Bewerbungen mit Lichtbild, handgeschr. Lebenslauf, Zeugnisabschriften sowie Angaben über Gehaltsforderung u. frühesten Eintrittstermin erbeten unter 7833 an die Expedition d. Zeitschr.
I AA
zum baldigen Eintritt
Einflieger
mit Ei r f a h r u n g im Einfliegen von Mustermaschinen. Technische Begabung und inge-nieurmäfjige Kenntnisse erwünscht. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen und Angabe des frühesten Eintrittstages an Anton FSettner G.m. b-H-Flugzeugbau, Berlin-Johannisthal, Segelfliegerdamm 27

Heft 18/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro V\ Jahr bei Htäglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ..Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet.
Nr. 18 30. August 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 13. Sept. 1939
Stand 1939.
Deutschland marschiert im Flugwesen an der Spitze. Charles Lindbergh hat die deutschen Flugforschungsanstalten nach seinem T3esuch in Deutschland als mustergültig erklärt und darauf hingewiesen, daß in USA., um Schritt zu halten, Anstrengungen gemacht werden müßten. Der bekannte Kriegsflieger Rickenbacher sagte jetzt nach seiner Rückkehr nach Amerika: Die deutsche Luftflotte ist die stärkste von Europa. Und wenn man den Stand des Flugwesens nach den internationalen Rekorden beurteilen würde, so wären Italien und Deutschland international ebenso führend. Für die Entwicklung des Flugwesens im Ausland standen ganz andere Mittel zur Verfügung als bei uns in Deutschland. Vieles in der deutschen fliegerischen Entwicklung ist dank der nationalsozialistischen Begeisterung aus Nichts geschaffen worden. Und dabei darf und wird in Deutschland die Entwicklung nicht stillstehen. Das wichtigste ist hierbei die Nachwuchsschulung, und diese ist im nationalsozialistischen Staat so organisiert, daß sie den Bedürfnissen in der kommenden Zeit nachkommen wird.
Deutschland besitzt den Nachwuchs für die Luftwaffe. Wir sind daher in der Lage, den Vorsprung in der Fliegerei nicht nur einzuhalten, sondern noch zu vergrößern.
Spätere Geschlechter werden, wenn erst mal die Einzelheiten über die Zeitergebnisse der Oeffentlichkeit überliefert werden, staunen, was die jetzige Generation unter der nationalsozialistischen Führung, Schaffung der Luftwaffe durch Vierjahresplan und anderes, in der Leistungssteigerung vollbracht hat. Durch Massenfabrikation nach althergebrachtem Muster ohne den heutigen Zeitgeist wäre der Hochstand unserer heutigen deutschen Fliegerei nie möglich gewesen.
Miles Master zweisitziges Schulflugzeug.
Der Miles Master, gebaut von Phillips and Powis, Reading, ist aus dem Miles Kestrel Trainer, Beschreibung siehe „Flugsport" 1938, Seite 646, entwickelt worden. Auf Grund der Erfolge dieses
Diese Nummer enthält Patentsammlung Nr. 14, Bd. VIII, u. Reportsarnmlung Nr. 15.
ersten Typs hatte das Air Ministry einen Serienauftrag erteilt. Die ersten Teillieferungen wurden mit Rolls Royce Kestrel XXX und die folgenden mit Rolls Royce Kestrel XVI ausgerüstet.
Der Miles Master zeigt gegenüber dem Kestrel Trainer folgende Aenderungen: Kühlerverlegung von der Nase nach der Rumpfmitte. Qrund Gewichtsverlegung. Rumpfende und gleichzeitig Höhenleitwerk erhöht. Beide Führersitze zur besseren Sicht beim Landen höher gerückt.
Mr. Miles, der Konstrukteur, ist ein fanatischer Anhänger der Holzbauweise und der Ansicht, daß man bei Holzbauweise mehr Materialauswahl habe als bei Metallbauweise. Ebenso läßt sich durch einfache Konstruktion, gute Schablonen und geschickte Fabrikationseinrichtungen schnellere Serienarbeit erreichen als bei Metallbauweise. Man muß schon anerkennen, daß Mr. Miles mit seinem „Master" ein Flugzeug von aerodynamischer Sauberkeit geschaffen hat. Wie es sich im Militärbetrieb indessen mit den verschiedenen Witterungsverhältnissen bewähren wird, ist eine andere Frage, die erst die Praxis erweisen muß.
Flügel zwei Kastenholme, sperrholzbedeckt. Verhältnismäßig große Holmhöhe. Profil NACA 230 nach den Enden verjüngt in Tiefe und Dicke. Flügel dreiteilig. Mittelstück durch den Rumpf gehende Holme. An der Hinterkante des Mittelstücks Spreizklappen hydraulisch betätigt. Klappenausschlag bei Start 25°, bei Landung 90°. Klappenausschlag im Führersitzanzeiger erkenntlich. Querruder zwecks größerer Steifigkeit mit Sperrholz bedeckt.
Rumpf ovaler Querschnitt, Holzbauweise bis zum Brandschott. Zwei Sitze hintereinander. Lehrer sitzt bei Beginn des Schulens vorn und später hinten. Windschutzverkleidung rechts nach Steuerbord ausschwingbar und auch teilweise längsverschiebbar. Obere Dachverkleidung des hinteren Sitzes bei Start und Landung aufklappbar, hierbei kann der hintere Sitz 30 cm in der Höhe verstellt werden, um ein besseres Gesichtsfeld nach vorn zu erhalten. Zwischen den beiden Sitzen befindet sich ein starker Elektronbügel zum Schutze bei Ueberschlag. Im Windschutz sind noch kleinere Hilfssichtfenster zum Aufklappen bei beschlagenem undurchsichtigem Windschutz vorgesehen.
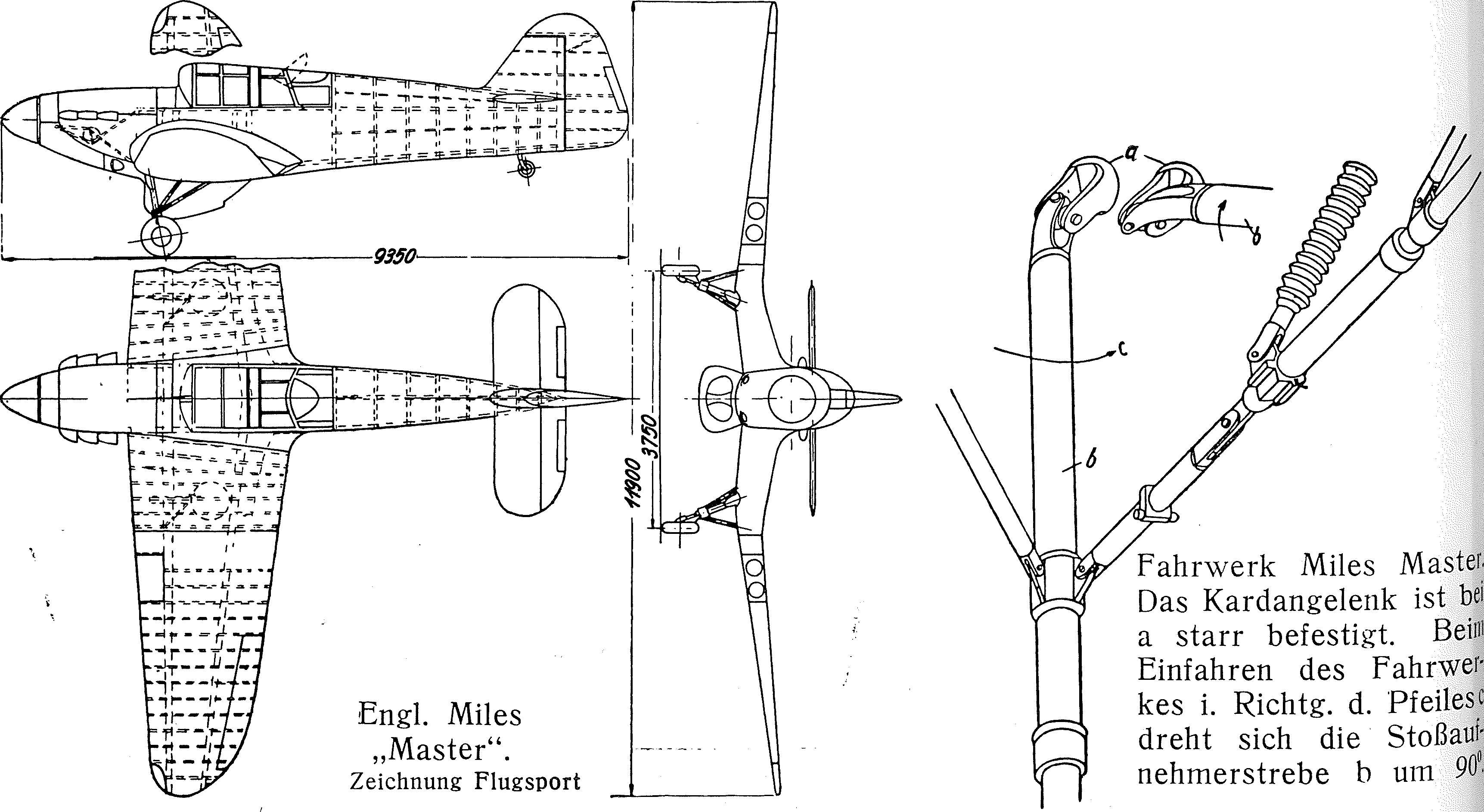
Engl. Miles „Master", zweisitziges Schulflugzeug. Werkbild
Höhen- und Seitenleitwerk freitragend. Sperrholzbedeckte gute Formgebung. Höhen- und Seitenruder Trimmklappen vom Führersitz zu verstellen.
Fahrwerk Bauart Lockheed, gebaut von der Automotive Products Ltd., das erste, das in Serienfabrikation verwendet wurde. Das hydraulische Fahrwerksbein ist am Flügelholmanschlußbeschlag des Mittelstücks kardanisch gelagert und wird von einem Lenker und einer Knickstrebe hydraulisch betätigt so nach oben geführt, daß sich das Laufrad um 90° dreht und zwischen die Holme zu liegen kommt, wo es in einer Arretiervorrichtung einschnappt. Die Stellung des Fahrwerkes ist durch einen mechanischen und elektrischen Anzeiger zu erkennen.
Motor Rolls Royce Kestrel XXX, überkomprimiert, 12 Zyl. „Vu-Type, wassergekühlt. Max. Startleistung 715 PS bei 2750 U, Normalleistung 635 PS bei 2400 U. Der Motoreinbau in Stahlrohr wird bei der Lieferung von Rolls Royce komplett mitgeliefert, so daß er nur an vier Punkten am Brandschott befestigt werden muß. Schraube Rotöl Dreiblatt, nicht verstellbar. Schraubenblätter Lizenz Schwarz. Zwrei Betriebsstoffbehälter, je 155 1, in den Flügelwurzeln. Oelbehälter vor dem Brandschott.
Von dem Motor werden angetrieben: eine Lockheed hydraulische Pumpe für das Hochziehfahrwerk und die Klappenbetätigung, ferner eine Vakuumpumpe für den Antrieb der gyroskopischen Instrumente, sowie ein elektrischer Stromerzeuger 500 Watt.
Spannweite 11,9 m, Höhe 3,05 m, Länge 9,35 m, Spurweite 3,75 m, Fläche 20,1 m2. Leergewicht 1887 kg, Fluggewicht 2494 kg. Flügelbelastung 124 kg/m2, Leistungsbelastung 3,49 kg/PS. Max. Geschwindigkeit 403 km/h in 4500 m, Reise mit 66% Motorleistung 347 km/h, Lande 103 km/h, Gipfelhöhe 8534 m, Start 268 m, Auslauf mit Klappen und Bremsen 215 m. Steigfähigkeit auf 1600 m in 3 min., auf 3000 m in 6 min. 20 sec, auf 4500 m in 10 min. Aktionsradius 700 km.
USA Fairchild M-62 Uebungsflugzeug.
M-62, Uebungsflugzeug für Fortgeschrittene, ist nach einjähriger Entwicklungsarbeit fertig gestellt worden.
Rumpf Stahlrohr geschweißt. Vorn Metall, hinten Leinwandbedeckung. Sitze hintereinander, in der Höhe verstellbar. Doppelsteuerung.
Flügel dreiteilig. Mittelstück leichte V-Form, durch den Rumpf gehend. Der Stahlrohrrumpf ist unten für die Aufnahme ausgespart. Holzbauweise, zwei-holmig, Sperrholzbeplankung. Flügelprofil an der Wurzel NACA 2416, verjüngt sich nach den Flügelenden auf Profil NACA 4408.
Slots und Spreizklappen
am Mittelstück. Querruder statisch und aerodynamisch ausgeglichen, leinwandbedeckt.
Fahrwerk große Spurweite, Fahrwerksbeine fest. Stromlinienverkleidung. Hydraulische Bremsen.
Motor Ranger 165 PS bei 2450 U/Min. Zwei Betriebsstoffbehälter von je 113 1 in den Flügeln.
Spannweite 10,8 m, Länge 8,4 m, Höhe 2 m, Fläche 18,5 m2. Leergewicht 735 kg, Fluggewicht 1040 kg. Aktionsradius 5 Std.
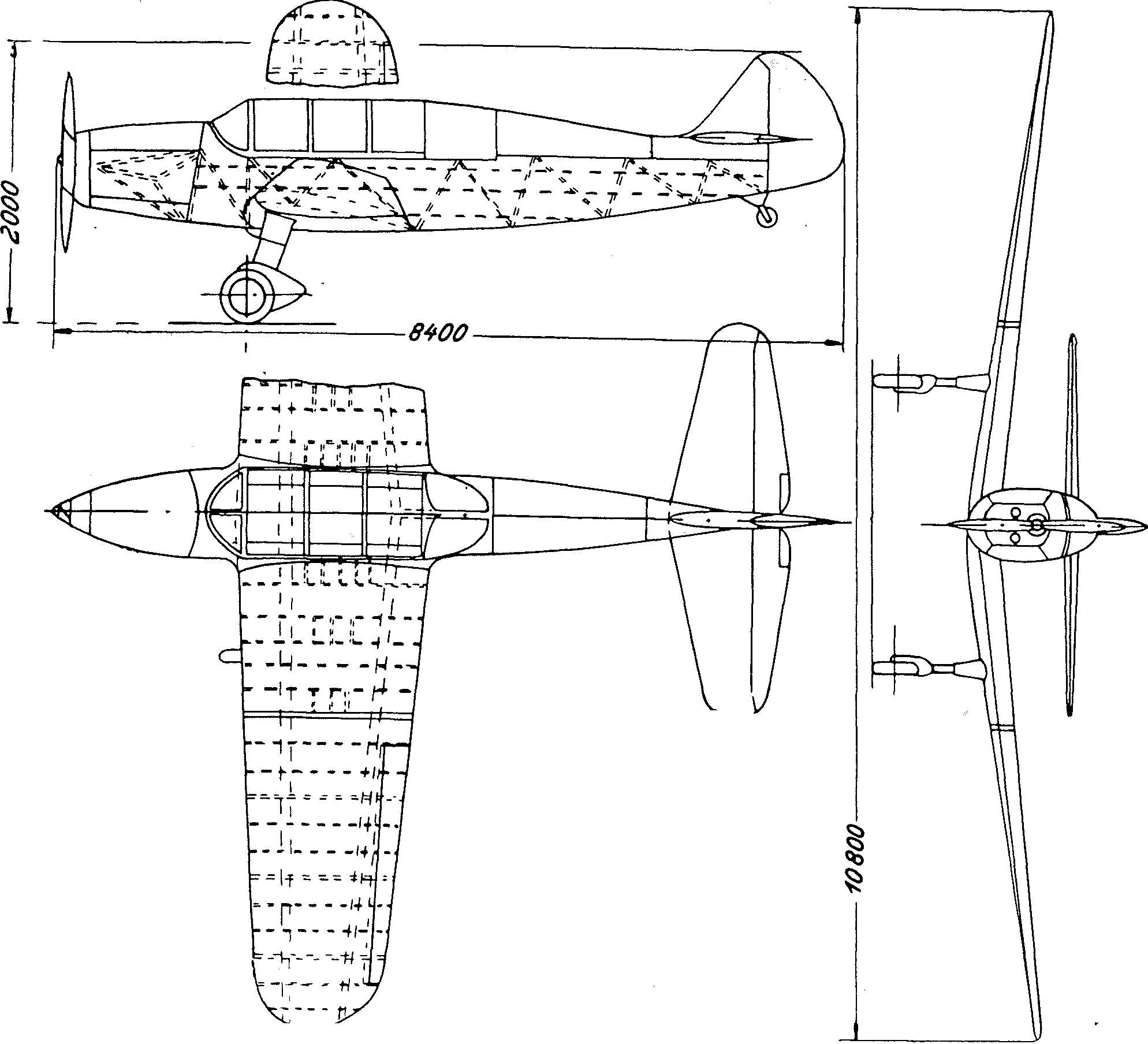
USA Fairchild M 62
Zeichnung Flugsport
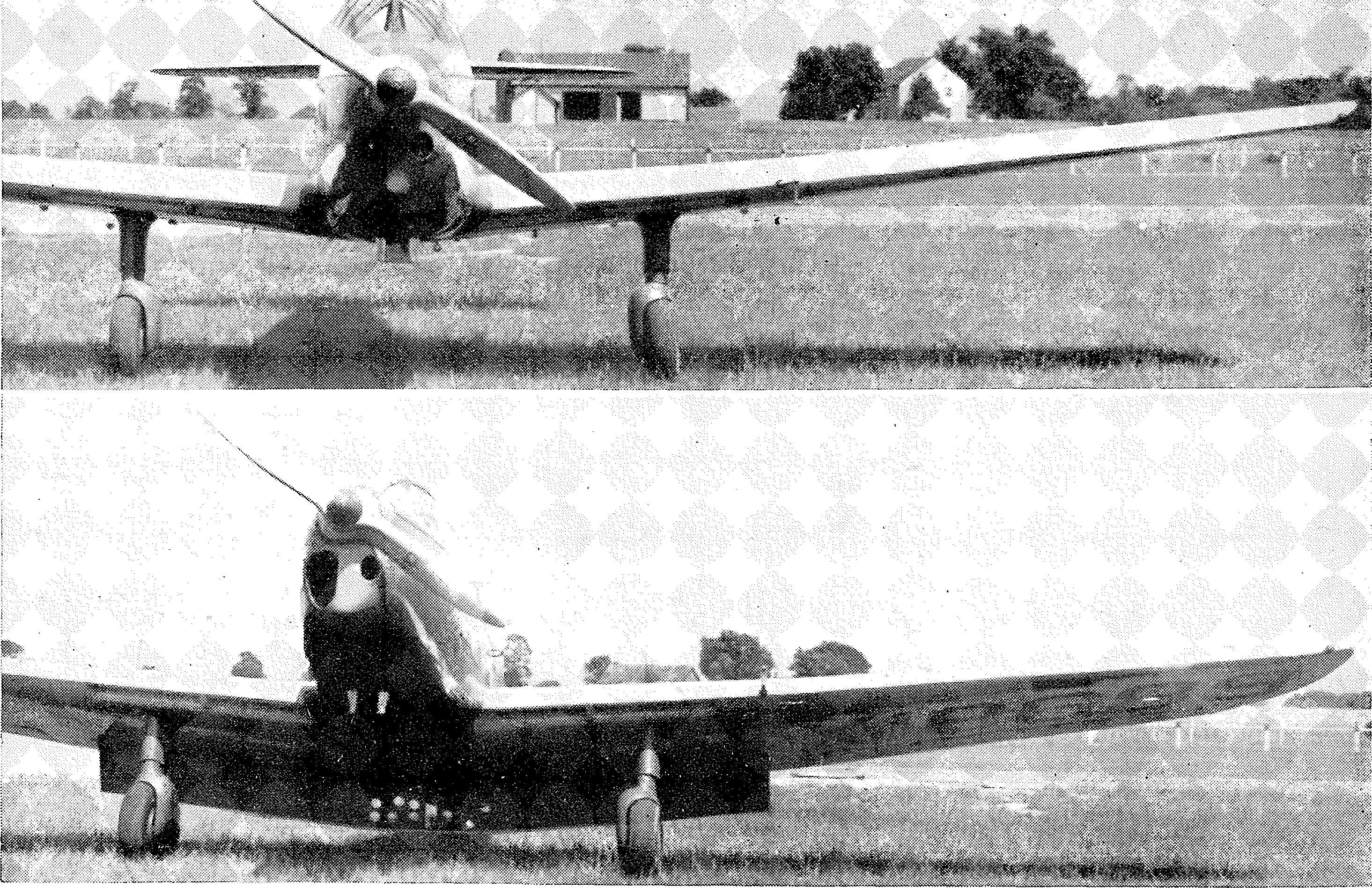
Fairchild M-62 Uebungsflugzeug. Werkbilder
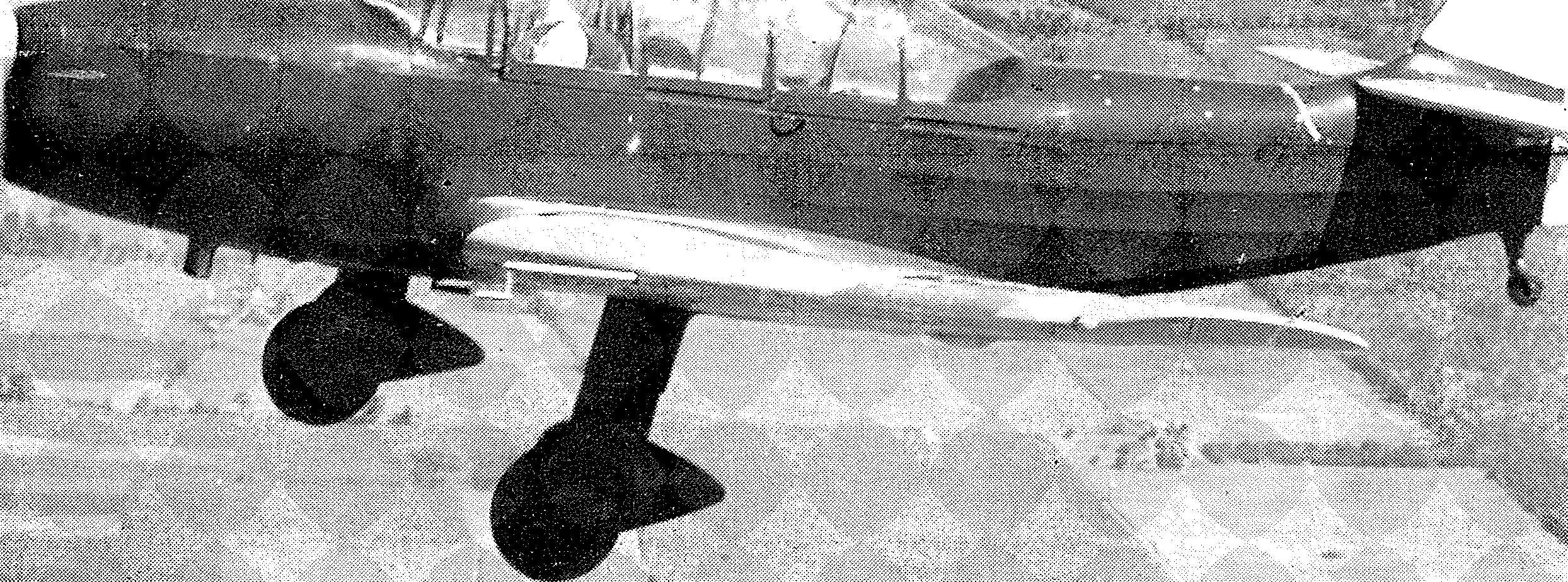
Fairchild M-62 Uebungsflugzeug. Werkbüd
USA Harlow PJC-1, 4-sitz. Kabinenflugzeug.
Nach vierjähriger Entwicklungsarbeit hat die Harlow Engineering Corp., Alhambra, Cal., ein Qanzmetall-Kabinenflugzeug fertiggestellt. Je nach Erfordernis wird die Maschine zwei- oder vier-sitzig geliefert.
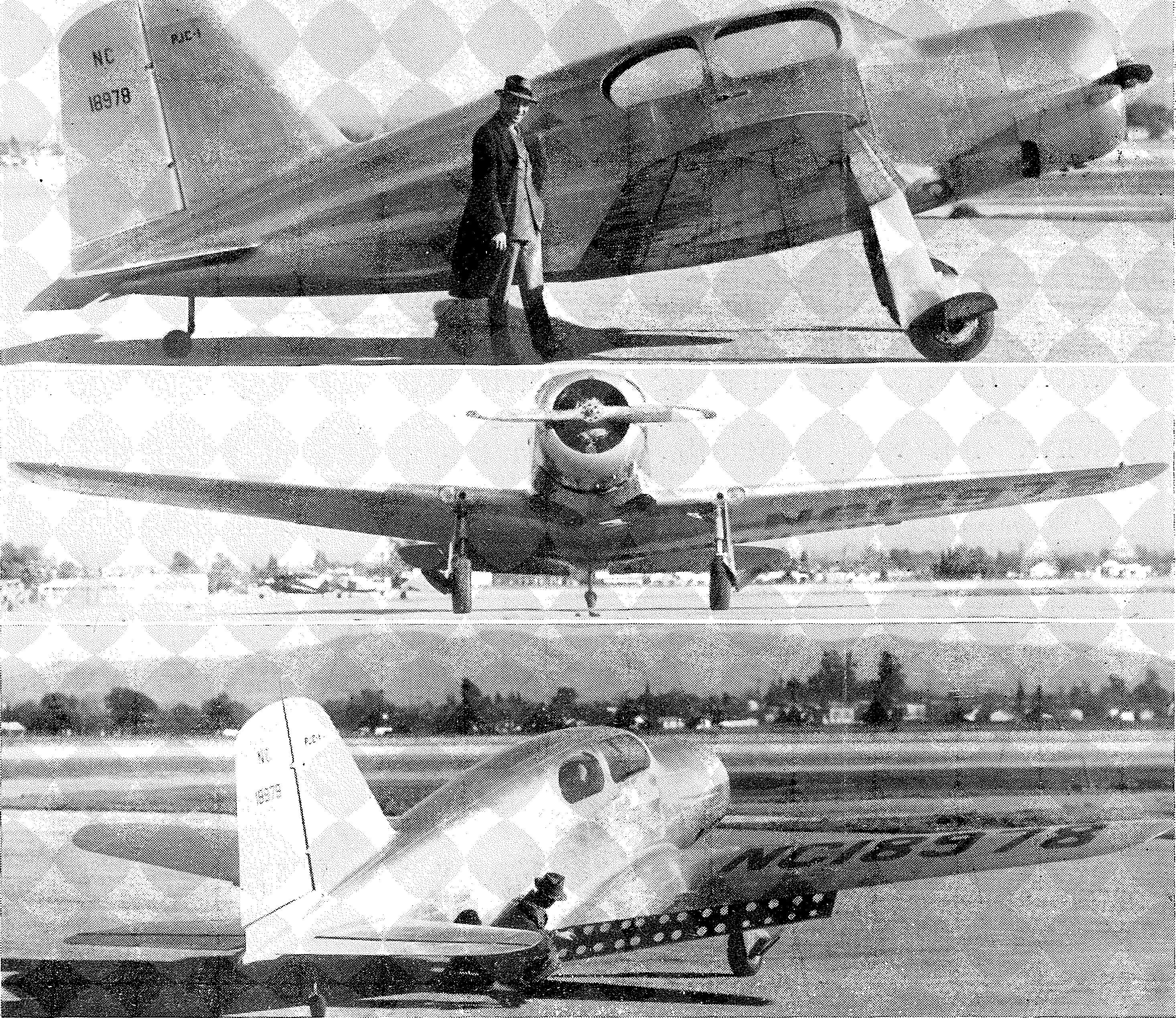
USA Harlow PJC-1, viersitziges Kabinenflugzeug. Werkbilder
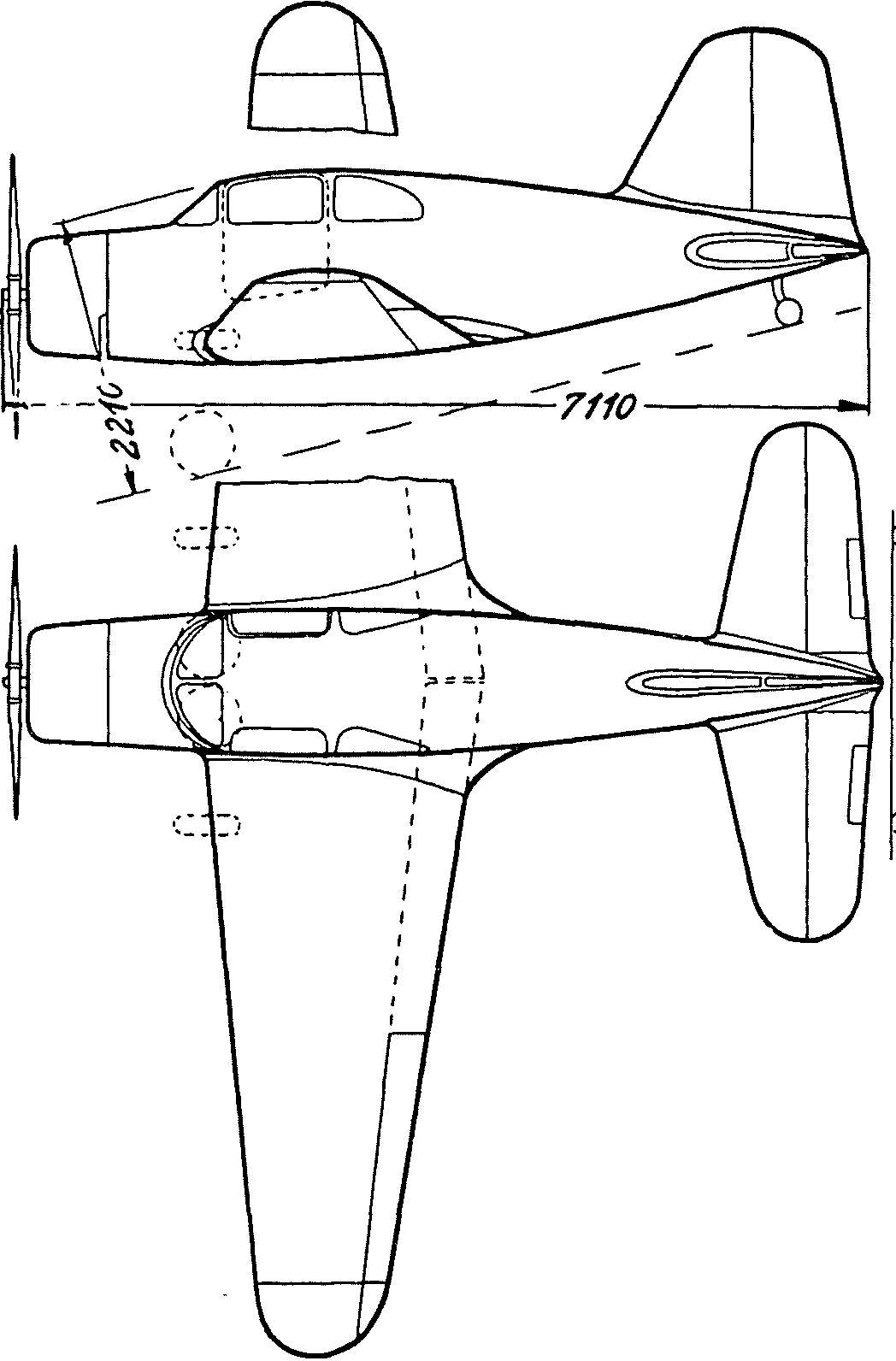
USA Harlow PJC-1 Viersitzer
Zeichnung Flugsport
Flügel, leichte V-Form, auf der Rumpfunterseite durchgehend, mit abnehmbaren Flügelspitzen, großen, elektrisch betätigten Landeklappen.
Rumpf, infolge des verwendeten 145-PS-Warner-Super-Scarab-Sternmotors, erlaubt breite Kabine.
Fahrwerk seitlich nach dem Rumpf hochziehbar, elektrisch betätigt. Abdeckbleche an den Oleo-Stoßaufnehmerstreben.
Spannweite 10,91 m, Länge 7,11 m, Höhe 2,21 m, Fläche 17,19 m2,
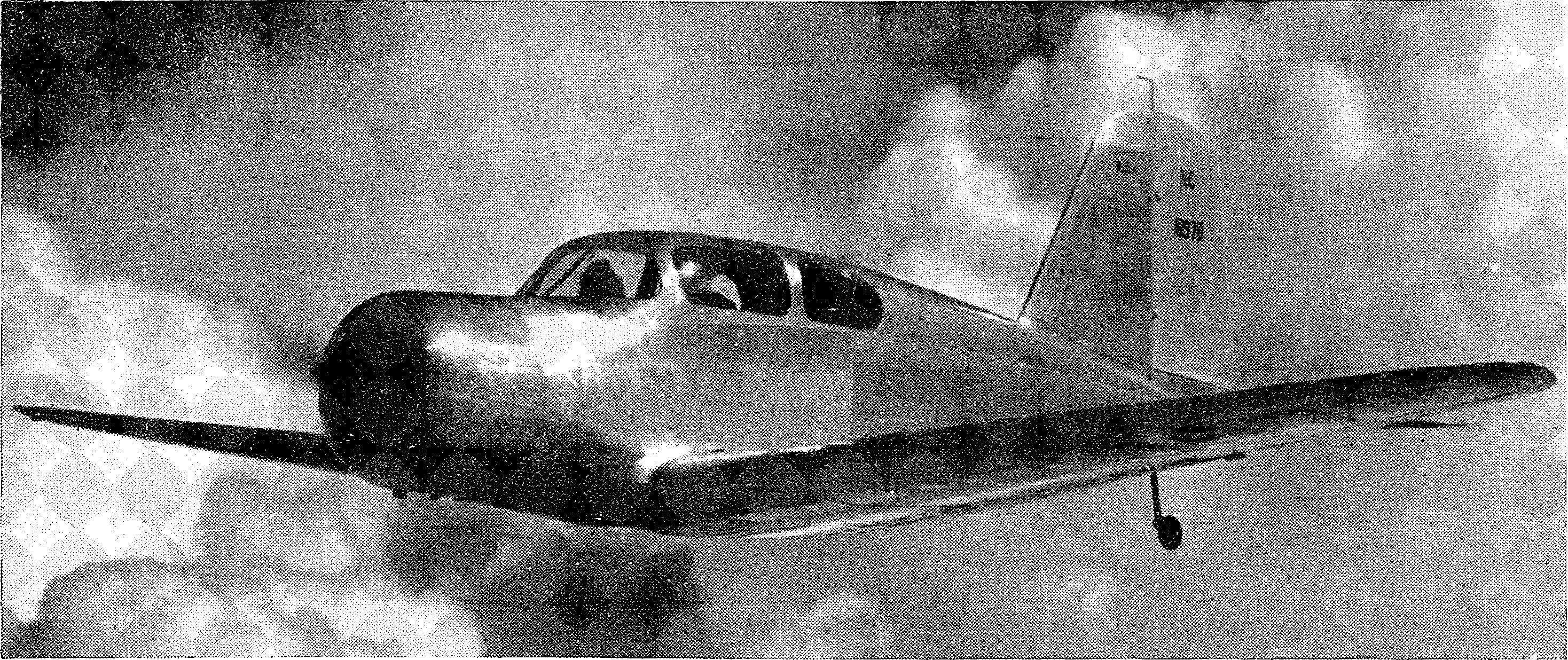
USA Harlow PJC-1, viersitziges Kabinenflugzeug. Werkbild
Flügelbelastung 59,5 kg/m2, Leistungsbelastung 7,04 kg/PS, Leergewicht 729 kg, Zuladung 312 kg. Betriebsstoff 128,7 1, Oel 15,15 1. Max. Geschwindigkeit 273,5 km/h, Reisegeschw. 246 km/h, Lande-geschw. (mit Klappenbetätigung) 72,4 km/h, Auslauf mit Klappen 75 m. Dienst-Gipfelhöhe 5030 m, Steigfähigkeit 259 m/min, Aktionsradius 966 km.
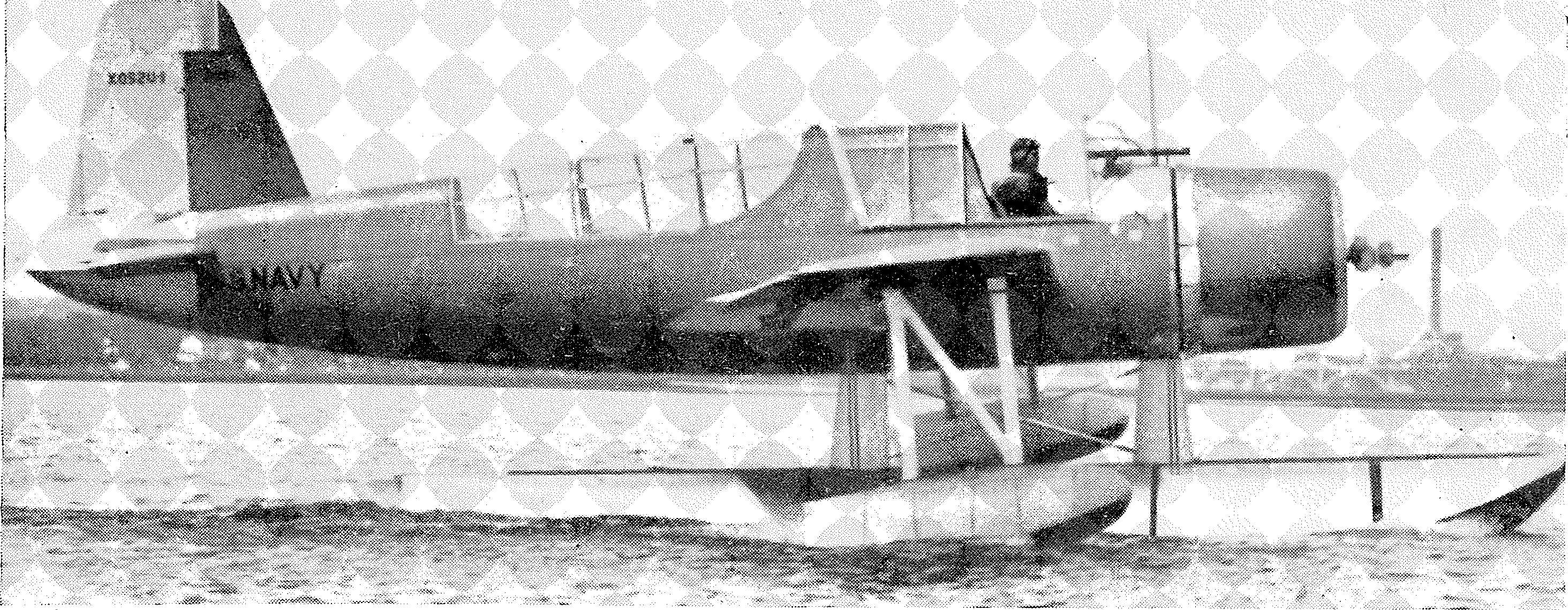
USA Vought-Sikorsky XOS 2U-1.
Werkbild
Vought Sikorsky X0S2U-1 Seeflugzeug.
Vought Sikorsky XOS2U-1 Seeflugzeug ist in Serie (für 2 103 800 $) für die US.-Marine als Kriegsschiff-Beiflugzeug in Auftrag gegeben und wird in Stratford gebaut. Dieses Einschwimmer-
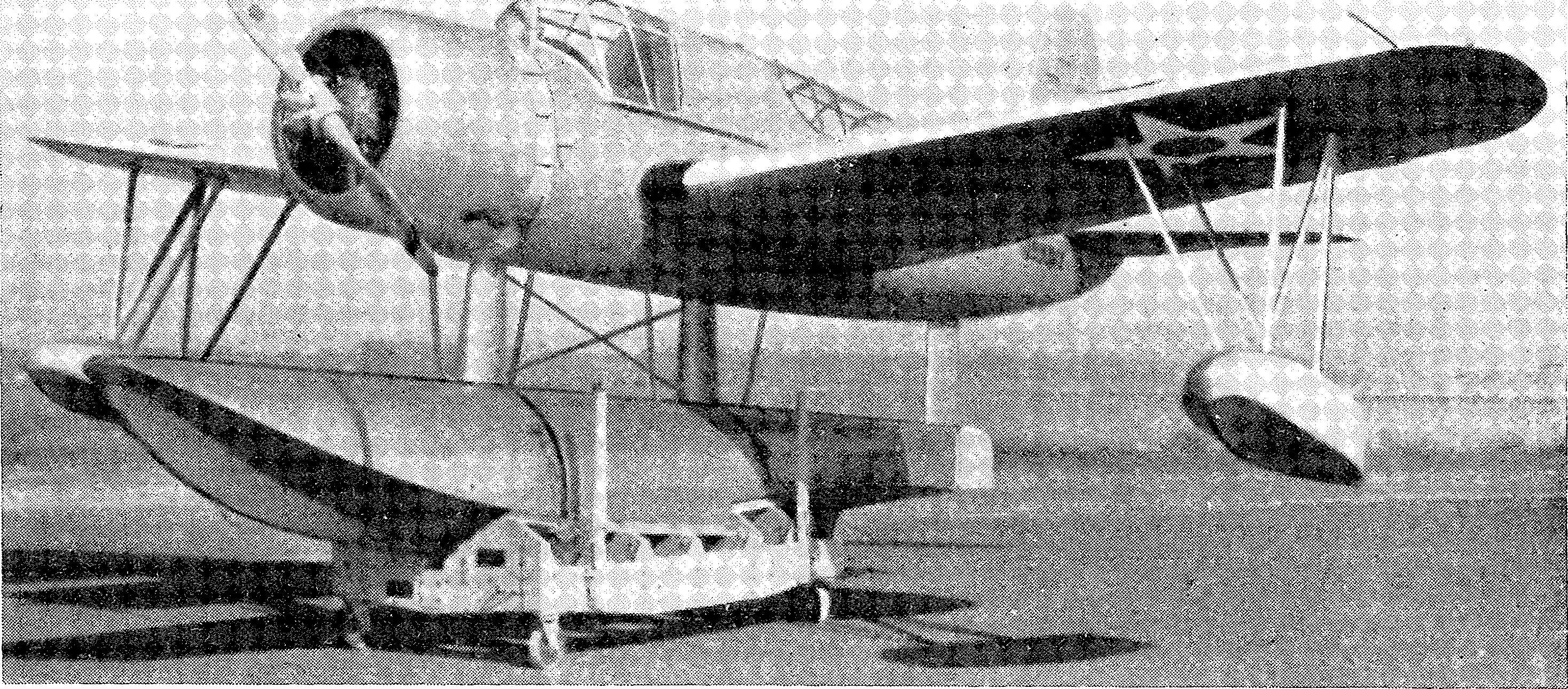
Vougrit-Sikorsky 400 PS Pratt & Whitney Wasp Junior. Werkbild
flugzeug mit zwei seitlichen Stützschwimmern ist für Katapultstart eingerichtet. Es kann auch als Landflugzeug fliegen.
Zur Verringerung der Startgeschwindigkeit Querruder und Landeklappen mit Schlitzen, im Prinzip ähnlich wie bei Junkers.
Metallbauweise, punktgeschweißt. Motor Pratt & Whitney Wasp Junior 400 PS. Rumpf runder Querschnitt, nach, hinten eiförmig, zweisitzig. Schwimmer stark gekielt, einstufig mit Wasserruder.
Spannweite 10,5 m, Länge 10 m als Seeflugzeug (9 m als Landflugzeug). Fluggewicht 2150 kg als See- und 2050 kg als Land-ilugzeug.
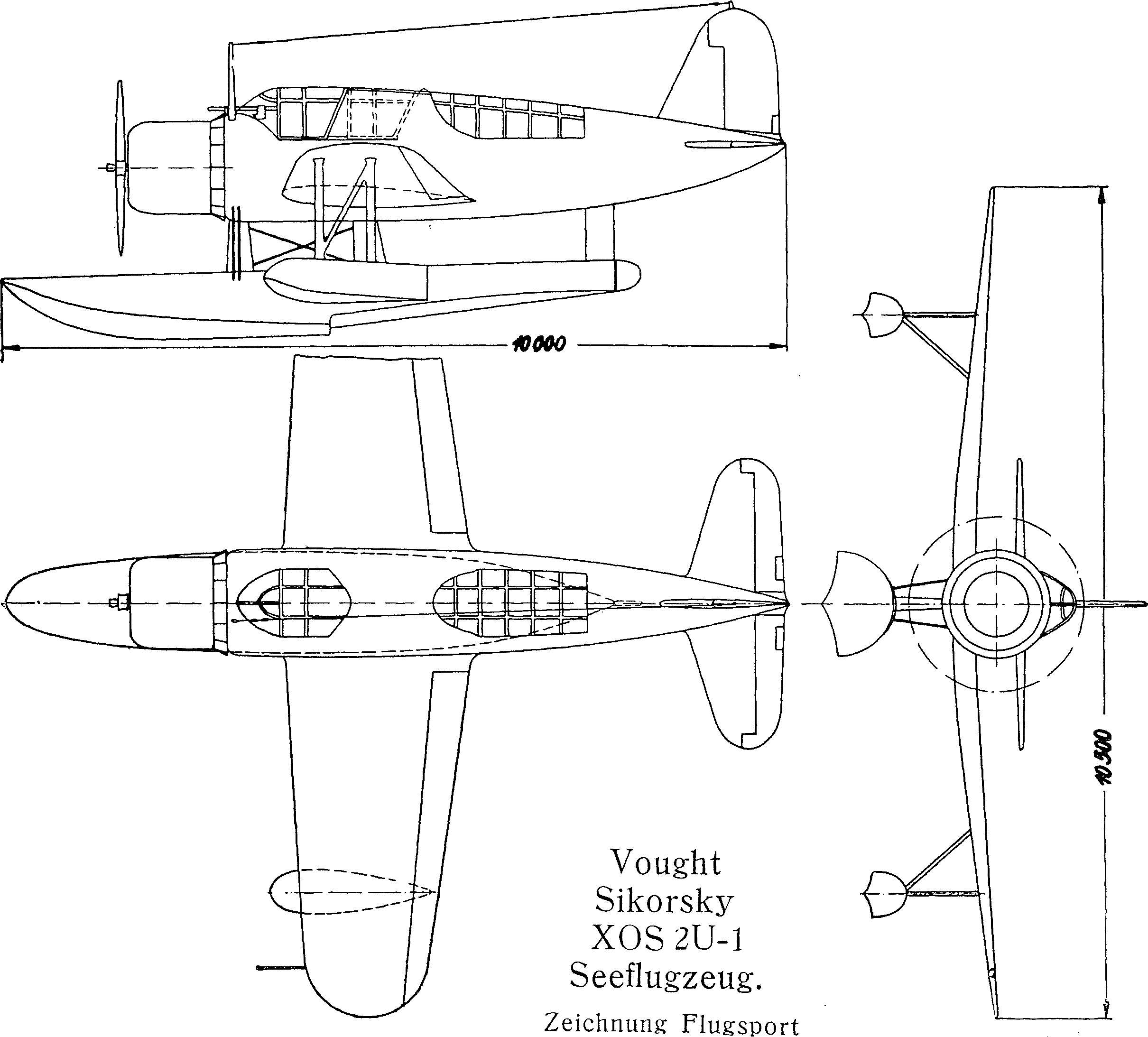
Franz. Dewoitine 33S Großflugzeug für 22 Personen, welches auf der Strecke
Berlin—Paris eingesetzt ist. Werkbild
Engl. Rotol-Verstell-Luftschraube.
Die im Juni 1937 von den Firmen Bristol Aeroplane Co., Ltd. und Rolls-Royce, Ltd. in Qloucester gegründete Gesellschaft Rotöl Airscrews, Ltd. befaßt sich, auf Erfahrungen aufbauend, die die beiden oben genannten Firmen bei der Entwicklung von Versteilschrauben gesammelt hatten, mit der Herstellung verschiedener Größen und Typen leistungsfähiger ölbetätigter Luftschrauben gleicher Drehzahl. Im folgenden wird kurz die Wirkungsweise des Verstellmechanismus und der allgemeine Aufbau einer solchen (dreiflügeligen) Schraube dargestellt.
Die einteilige Nabe (a) ist mit ihrer Rückseite an einem Flansch
Weise durch Kegelsitz zentriert und mit einer Mutter gegen Achsialverschiebung gehalten. Das Drehmoment wird vom Flansch auf die Nabe durch einige Kegelbolzen übertragen, die gleichzeitig auch den Schraubenschub aufnehmen. Der vordere, dünner abgesetzte Teil der Muffe trägt einen mit Lederdichtung versehenen Kolben (c), der in bezug auf das Nabengehäuse fest-
Abb. 1. Engl. Rotol-Verstell-Luftschraube.
Werkbild
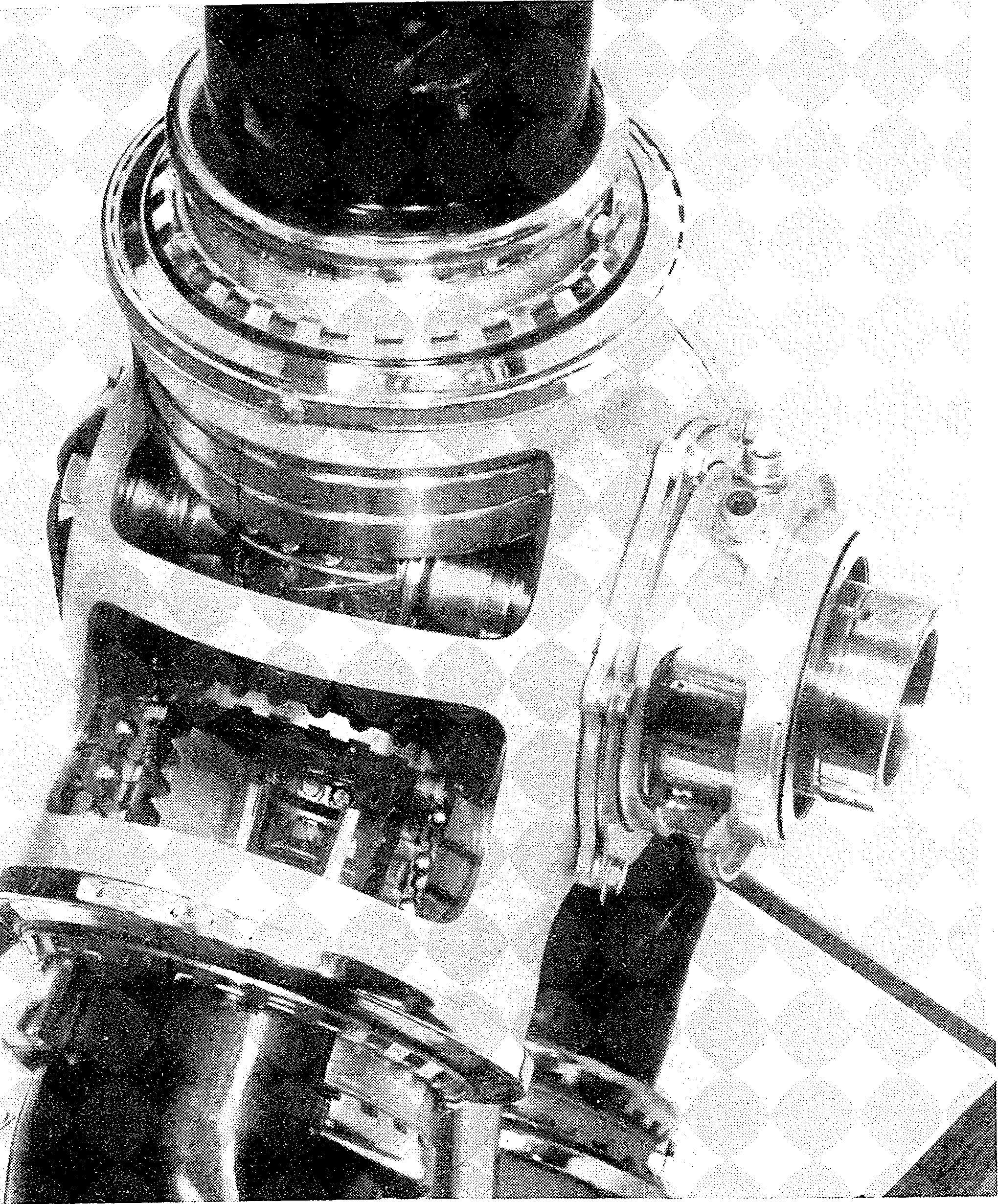
steht, während der durch einen Deckel (e) vollkommen geschlossene Zylinder (d) frei über ihn gleiten kann. Sowohl der Kolbenschaft als auch die Zylinderenden sind durch Dichtungen geschlossen. Es muß dabei noch erwähnt werden, daß der Zylinder (d) aus Stahl und der Kolben (c) sowie der Zylinderdeckel (e) aus Phosphorbronze sind, so daß immer zwei verschiedene Metalle aufeinander gleiten, wodurch die Möglichkeit des Fressens weitgehend herabgesetzt wird.
Durch je vier an der Vorder- und Rückseite der Kolbenflanschwurzel mündende Bohrungen (1, 2) wird das Oel in den betreffenden Zylinderraum geleitet. Weitere vier Bohrungen (3) enden in einer Ringnut, die sich am Kolbenschaft befindet, und stellen eine Verbindung her mit einer ähnlichen Nut (4) am größeren der beiden vorderen Muffendurchmesser: es sind die Ablaufleitungen, die in den Kolben- bzw. Zylinderendstellungen von der Zylindernabe freigegeben werden, und die zu hohen Oeldruck verhindern und etwa im Oel enthaltene Luft entweichen lassen sollen. Diese insgesamt zwölf Bohrungen sind in der Muffe bis zum rückwärtigen Ende derselben in achsialer Richtung fortgeführt, und zwar enden die Ablaufleitungen im Motorgehäuse, während die im Zylindervorderteil mündenden Bohrungen (1) in die letzte (6) und die im hinteren Raum (2) mündenden in die erste (7) der beiden hinten liegenden Ringnuten führen. Um diese liegt ein schwimmender Ring (f) mit zwei Lochreihen und um das Ganze ein Gehäuse (g), das mit einem Beschlag am Motorschild befestigt wird. In dieses Gehäuse führen vom Geber aus zwei Oelleitungen (h, i), die mit je einer der beiden hinteren Ringnute über den schwimmenden Ring in Verbindung stehen. (Das durch die rechte Leitung [i] kommende Oel treibt den Zylinder nach hinten, das durch die linke [h] kommende nach vorn. Sind beide geschlossen, so bleibt der Zylinder, da kein Oel umlaufen kann, stehen.)
Die Nabe besitzt drei Fassungen, in die die Luftschraubenblätter (k) unter Zwischenschaltung von Kugellagern eingesetzt sind. Von diesen werden die Fliehkräfte aufgenommen, unter deren Wirkung sich die Innenringe verengern, die Außenringe erweitern und da-
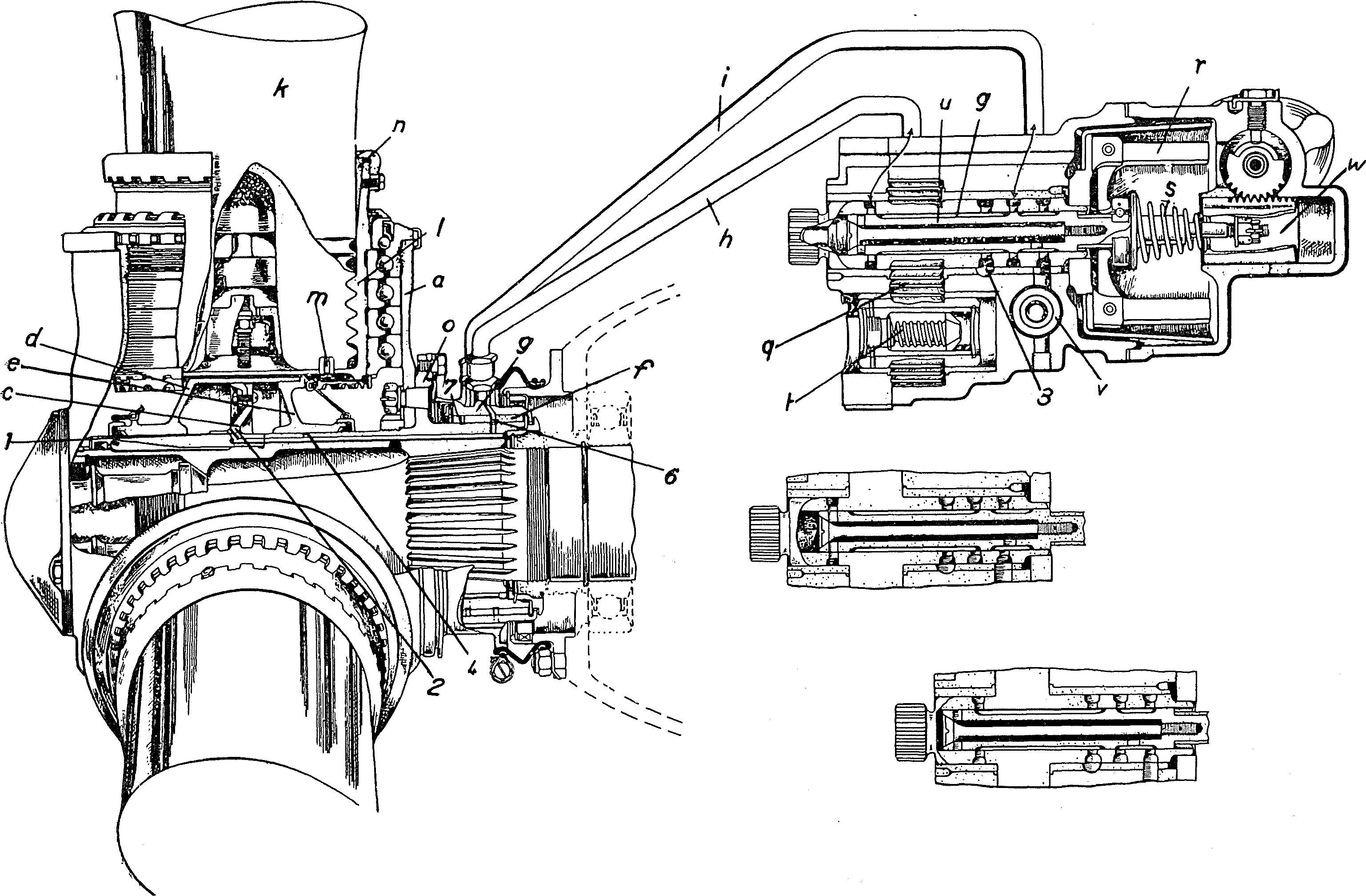
Abb. 2. Engl. Rotol-Verstell-Luftschraube. Werkzeichnung
m
i
durch die ganze Halterung fester ziehen. Ferner gestatten sie eine leichte Drehung zur Verstellung der Blätter. Das äußere, kleinere Kugellager ist zur Nachstellung vorgesehen, damit etwa auftretendes Spiel im Kugellagersatz zur Vermeidung des Ratterns, besonders bei niedriger Drehzahl, behoben werden kann.
Die Wurzel der aus einer Magnesiumlegierung hergestellten Blätter (k) ist in eine Stahlbüchse (1) geschraubt und durch Stifte (m) gegen Drehung in derselben gesichert. Im äußeren Büchsenhals umfaßt eine Kegelmanschette (n) aus Preßmasse, die mit Hilfe einer Sternnutmutter nachgestellt werden kann, den Blattschaft, wodurch ein fester Sitz, eine gute Kräfteverteilung im Uebergang und damit ein wirksamer Kerbwirkungsschutz gewährleistet wird. Außerdem wird der Werkstoffabrieb (durch die immer auftretenden Bewegungen) gänzlich verhindert.
An der Stahlbüchse eines jeden Blattes ist auf einer Platte ein Zapfen (o) angebracht, der in seiner Lage zum Blatt in bestimmten Grenzen verstellt werden kann. Alle drei Zapfen sind in Büchsen gelagert, die ihrerseits auf Böcken ruhen, mit denen der frei bewegliche Zylinder versehen ist. Auf diese Art wird die Achsial-bewegung des Zylinders in eine Drehbewegung eines jeden Blattes, überführt.
Der Oeldruck für die Betätigung des Zylinders wird nun durch die „Rotol-constant-speed"-Einheit erzeugt, die am Motorgehäuse sitzt, durch den Motor getrieben wird und auch das Oel von ihm bezieht.
Diese Regler-Pumpen-Einheit besteht im wesentlichen aus einer Hochdruck-Zahnradpumpe (q) und einem Regler, der durch Fliehgewichte (r) und durch den Druck einer Feder (s) betätigt wird. Das. treibende Zahnrad der Pumpe hat eine lange Spindel, an deren Ende das vom Motor getriebene Ritzel sitzt; das getriebene Rad
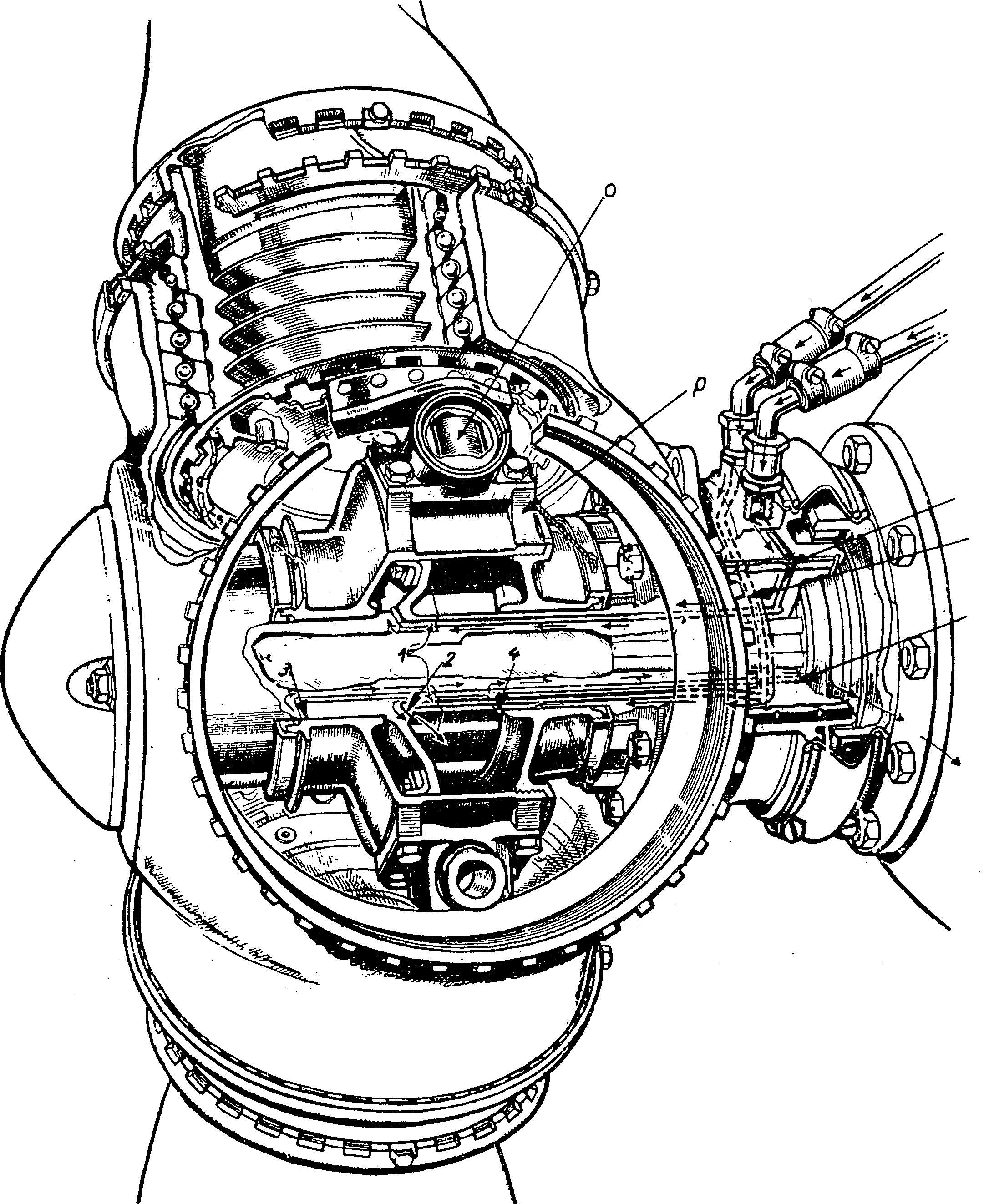
enthält in seiner hohlen Achse ein Druckminderventil (t), durch das das Oel vom Motor in die Pumpe gelangt. Es geht zur Saugseite derselben und wird dann in die Ringnut (8) der Spindel befördert. Diese
■6 Nut steht in Ver-
7 bindung mit einer Ringkammer, die # von der Spindelbohrung und dem Hals eines in der Spindel gleitenden Kolbens (u) gebildet wird. Der Kolben, der durch die wechselnde Kraft
Abb. 3. Engl. Rotol-Verstell-Luftschraube.
Zeichnung „Fligfat""
der Fliehgewichte (r) und der Feder (s) betätigt wird, steuert die Oelausgänge und damit den Oeldruck in den einzelnen Bohrungen, wodurch der Zylinder dann verschoben wird. Hat die Luftschraube die richtige Stellung für eine vorgegebene Drehzahl, so geht das Oel von der Druckseite der Pumpe durch ein Zwischenventil (v) zurück zur Saugseite. Die Fliehgewichte sind in einem Gehäuse am Ende der Treibspindel untergebracht; darin befindet sich auch die Feder zwischen der vom Führersitz aus verschiebbaren Zahnstange (w) und der Scheibe, an der die Hebel der Gewichte liegen.
Weil die durch die Gewichte ausgeübte Kraft von der Drehzahl abhängig und die Federkraft durch die Bewegung der Zahnstange zu verändern ist, so kann mit Hilfe des Hebels im Führerraum Gleichgewicht zwischen den Kräften für eine gegebene Drehzahl herbeigeführt werden. Wenn beide Kräfte ausgeglichen sind, dann ist der Kolben in Mittelstellung, beide Oelleitungen geschlossen und der Zylinder und mit ihm die Schraubenblätter festgehalten. Durch irgendeine Vergrößerung oder Verkleinerung der vom Flugzeugführer bestimmten Drehzahl, z. B. durch Aenderung der Fluggeschwindigkeit, der Drosselstellung usw., wird der Gleichgewichtszustand aufgehoben und der Kolben betätigt, so daß Oel in den entsprechenden Zylinderraum geschafft wird und die Blätter sich verdrehen.
Zum Schluß seien noch einmal die Vorzüge der Rotol-Luft-schraube zusammengestellt:
1. Die Verstellung der Blätter erfolgt im Fluge selbsttätig; der Flugzeugführer stellt nur den Hebel auf die gewünschte DrehzahL
2. Die Tatsache, daß bewegliche Teile auf eine Mindestzahl zurückgeführt und nur dort vorhanden sind, wo Drucköl hinkommt, macht ein Fressen fast unmöglich.
3. Durch den dauernden Umlauf warmen Motoröles ist die Wirksamkeit der Verstellung selbst bei niedrigsten Temperaturen erhalten. Z.
Abb. 4. Dreiflügelige Rotol-Verstell-Luftschraube an einem engl. Jagdeinsitzer.
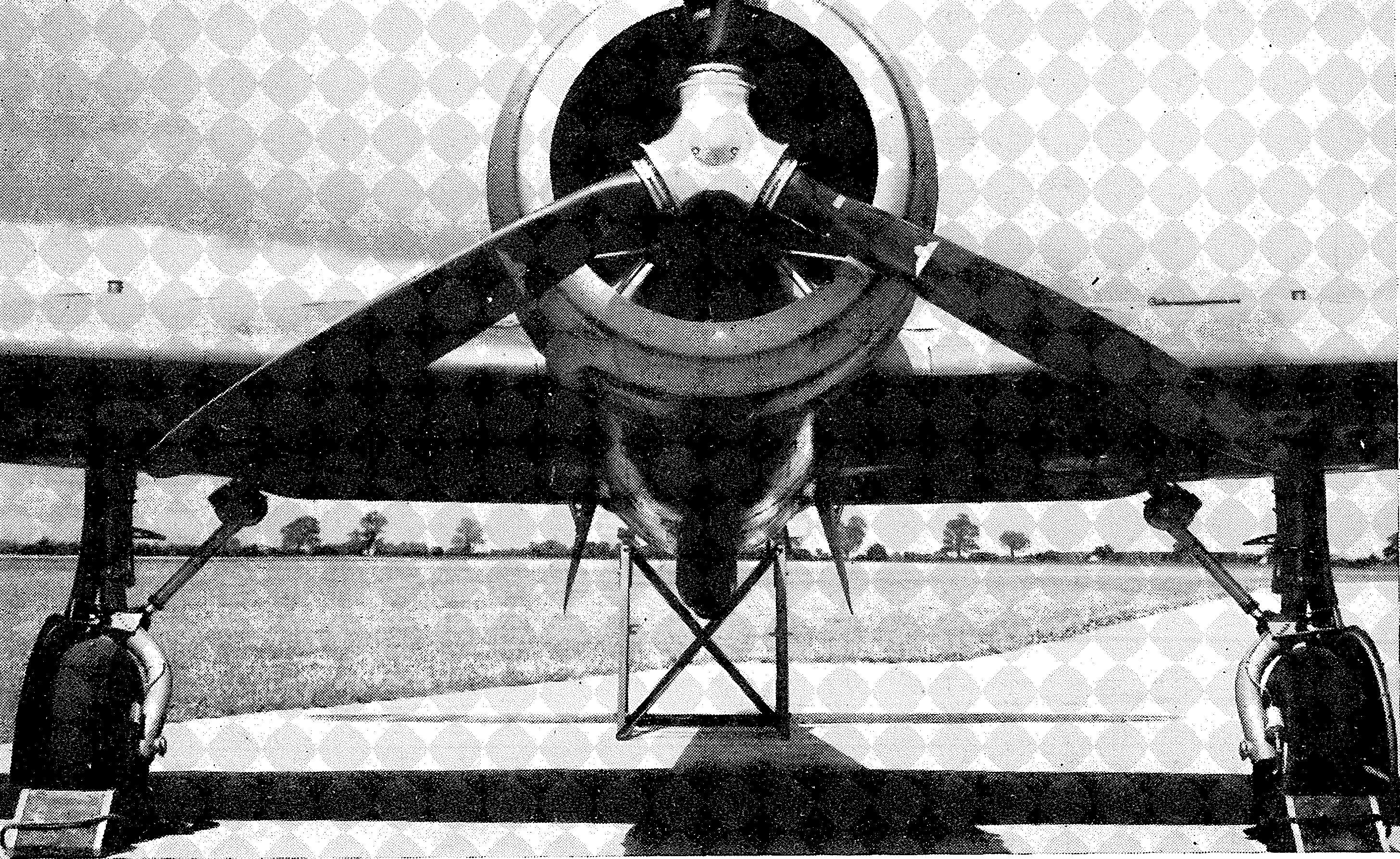
Werkbild
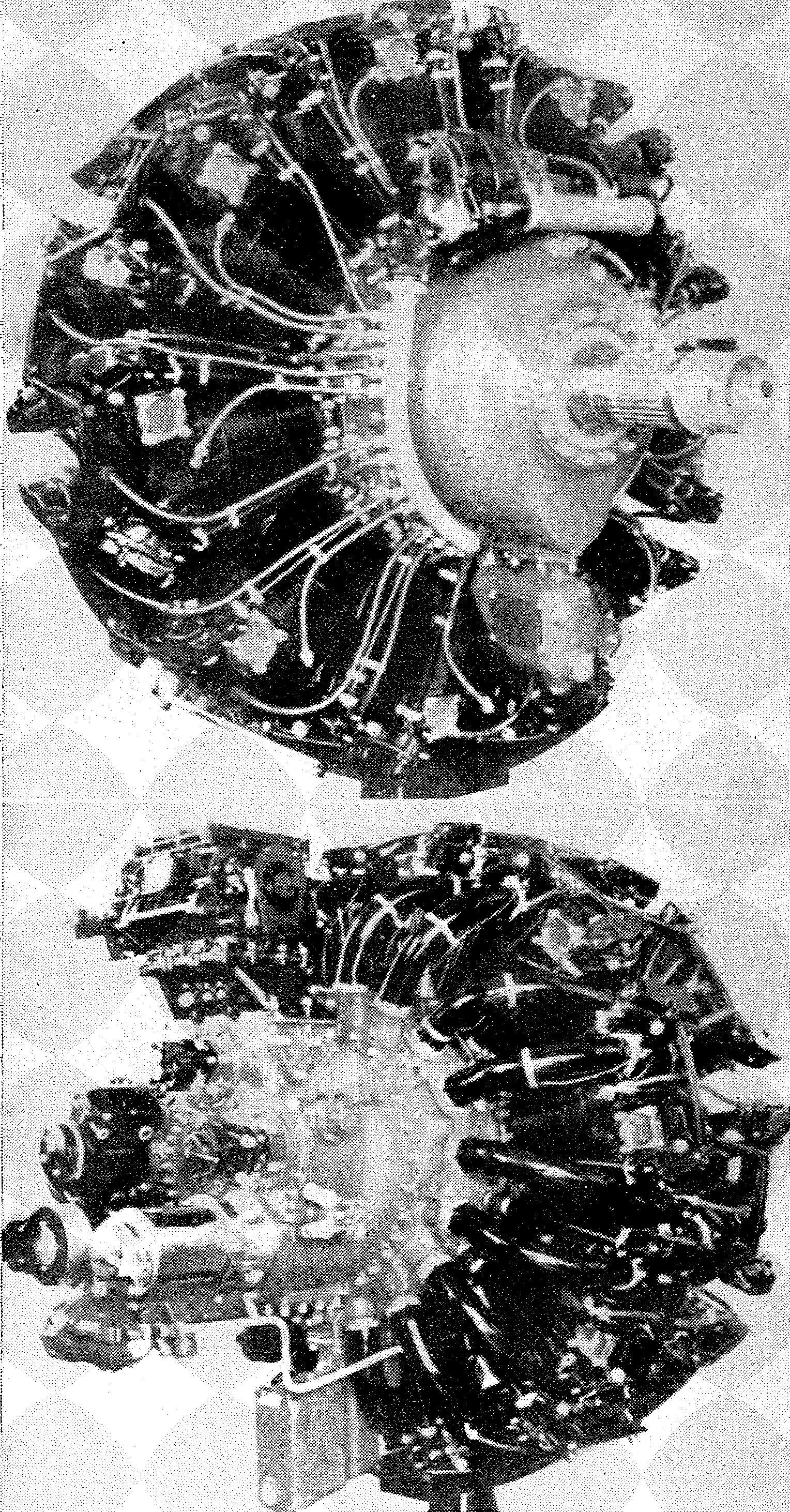
Wright „Duplex-Cyclone" 2000 PS, zweireihig.
Wright „Duplex-Cyclone*6 2000 PS zweireihig.
Der 2000 - PS - Doppelsternmotor der Wright Aeronautical Corp., Paterson, 18 Zyl., ist nach langer Versuchszeit in Serienbau genommen worden. Bei den Versuchsläufen zeigten sich allerhand Schwierigkeiten, auch in der Vergasung, wobei zu berücksichtigen ist, daß hier je Minute 14 1 Benzin zu vergasen sind. Diese Schwierigkeiten sind in Deutschland, wo vollständig neue Wege begangen sind, durch das Einspritzverfahren überwunden. Leistung 33,5 PS/1. Schraubenwelle untersetzt. Auf Rückseite: Stromerzeuger, Anlasser, Betriebsstoffpumpe, MG.-Antriebe.
Der Zündmagnet ist infolge der großen Hitze, wie die Abbildung erkennen läßt, vor den Zylinderstern verlegt. Bohrung 155,6 mm, Hub 174 mm, Zylinderinhalt 59,8 1, Stern-Durchmesser 1,4 m.
Wright G-200 Cyclone 1200 PS, einreihig.
Der einreihige Neunzylinder G-200 Cyclone 1200 PS besitzt 301
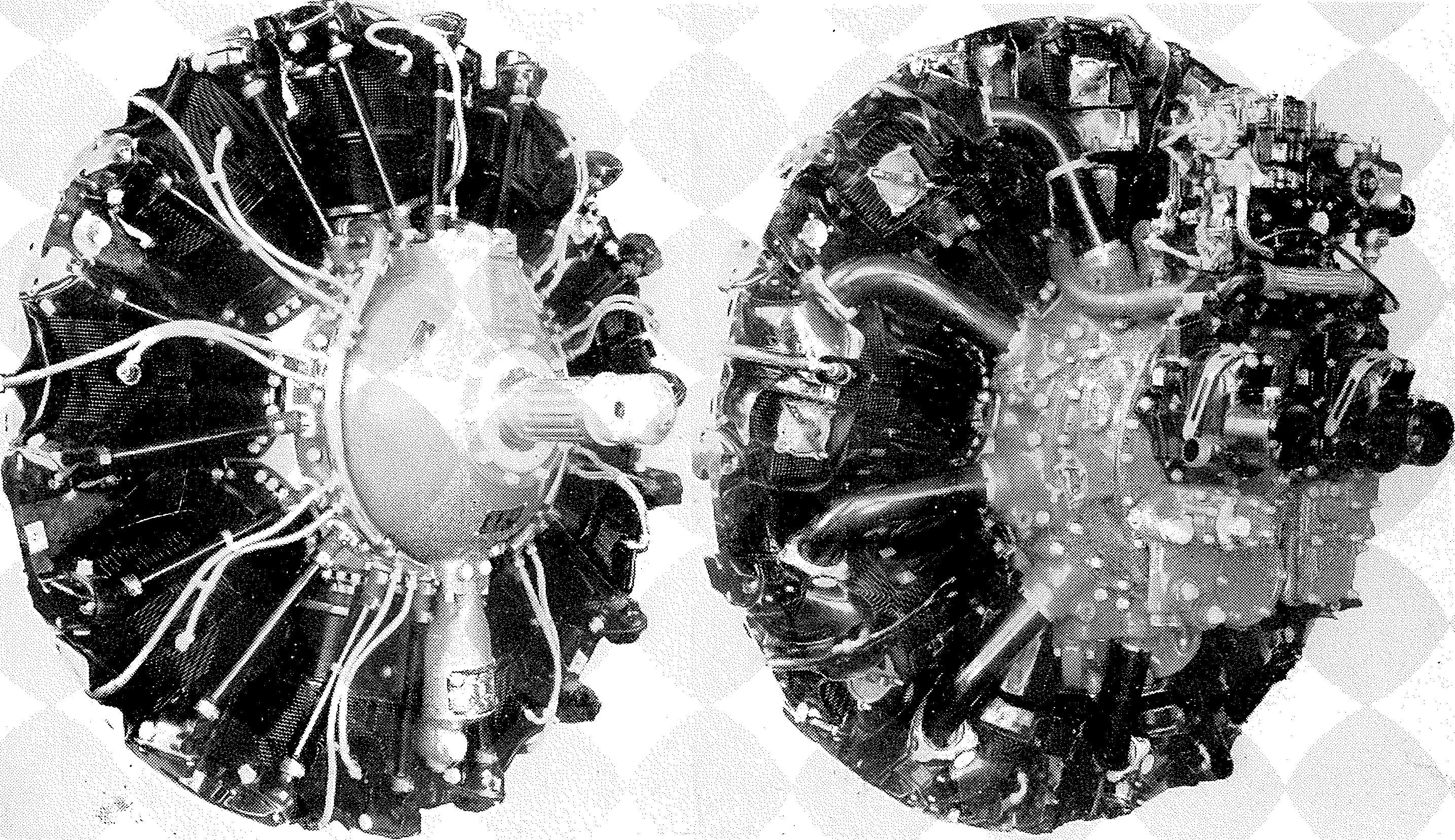
Wright G-200 Cyclone 1200 PS einreihig.
Werkbilder
Gesamtvolumen. Der erste Cyclone vor 8 Jahren, der G-400, leistete 575 PS bei dem gleichen Zylindervolumen.
Stahlzylinder, gegenüber dem Typ G-100, höhere und dichter gestellte Kühlrippen. Ebenso sind in den Zylinderköpfen die Kühlrippen erhöht. Ein- und Auslaßventile im Durchmesser vergrößert.
Hauptkurbelgehäuse zur Befestigung der Zylinder aus Stahl. Hintere und vordere Gehäuseteile sind aus Elektron.
Kurbelwelle zweiteilig mit neuen Wright-Dämpfergegengewich-ten an beiden Kurbelarmen, welche ohne Vibrationserscheinungen höhere Drehzahlen beim Start ermöglichen.
Kolben Duralumin geschmiedet, drei Kompressions- und zwei Oelabstreifringe.
Antriebe: Starter 1 : 1, Zubehörantrieb 1,5 : 1, Magnete 1,125 : 1, Maschinengewehrantrieb 16 : 9 oder 3 : 2. Betriebsstoffpumpe 1 : 1, Tachometer 1 : 1 oder 5 : 1.
Je ein Magnet für die vordere und hintere Zündkerzenreihe. Zündkerzen BG298J3.
Injektionsvergaser Stromberg.
Bohrung 154 mm, Hub 172 mm, Kompression 6,7 : 1. Zweistufiger Kompressor. Startleistung bei 2500 U 1200 PS, in 1550 m Höhe 1000 PS, in 4200 m 900 PS. Ausführung mit Lintersetzungsgetriebe 3 : 2 oder 16 : 9. Trockengewicht 590 kg.
FLUG
Inland.
Beschießung von deutschen Verkehrsflugzeugen wurde am 23. 8. gemeldet. Das dreimotorige Großflugzeug D-ABHF der DLH wurde am 23. 8. während des Fluges von Danzig nach Berlin, 20 km von der Küste entfernt, in 1500 m Höhe über der Ostsee von polnischen Küstenbatterien und einem polnischen Kriegsschiff beschossen. Besatzung Flugkpt. Böhner, Flugmasch. Nickel und Flugzeugfunker Suppa, ferner 17 Fluggäste, darunter 4 Kinder.
Ebenso wurde durch das „Deutsche Nachrichtenbüro" aus Danzig berichtet: Das deutsche Verkehrsflugzeug D-APUP „von Bieberstein", welches am 23. 8. 12.02 h nach Danzig und Königsberg gestartet war, wurde auf dem Flug nach Danzig um 14.28 h außerhalb des polnischen Hoheitsgebiets in der Nähe der Danziger Grenze von polnischer Flak beschossen. Wie der Flugzeugführer, Flugkpt. Gutschmidt, berichtete, krepierten die Geschosse in unmittelbarer Nähe rechts und links von der Verkehrsmaschine.
Weiter ist um 14.18 h ein drittes Flugzeug, und zwar die Verkehrsmaschine Hamburg—Danzig beschossen worden. Auch dieses Flugzeug hatte polnisches Gebiet nicht überflogen.
Flugverkehrs-Einschränkung über deutschem Hoheitsgebiet.
Durch Verordnung des Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe vom 26. 8. ist der gesamte Luftverkehr mit inländischen und ausländischen Luftfahrzeugen über dem deutschen Hoheitsgebiet mit sofortiger Wirkung verboten. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf Luftfahrzeuge im Gebiete der deutschen Wehrmacht. Für diese Luftfahrzeuge findet Sonderregelung statt. Sie findet ferner keine Anwendung auf Regierungsflugzeuge und den Fluglinienverkehr. Für das Befliegen der Flughäfen Berlin-Tempelhof und Königsberg-Devau gelten besondere Anflugbestimmungen. Weitere Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe. In jedem Falle, ausgenommen bei Flügen im Dienste der Wehrmacht, ist bei Erdsicht nicht über 500 m über Grund zu fliegen. Zuwiderhandlungen sind strafbar.

Vom Küstenflug 1939. Links: Korpsführer General der Flieger Christiansen mit NSFK-Stubaf. Sachsenberg. Mitte: NSFK-Sturmf. Harmens (Gruppe 8) und NSFK-Förderer Erstenmeyer (Orter) Sieger auf Go 150 mit 1023,1 Pkt. Rechts: NSFK-Oberstubaf. Förster (Gruppe 10) und Oberltn. Roos wurden auf Fw. 44 mit
1011,3 Pkt. Zweiter. Bilder: NSFK
Deutscher Küstenflug 1939, 12.—13. 8., veranstaltet vom Korpsführer des NS.-Fliegerkorps, an dem General der Flieger Christiansen selbst außer Wettbewerb teilnahm, war am 13. 8. in Wyk a. Föhr beendet. Flugstrecke: Borkum—t Norderney—Wangerooge (Zielabwurf)—Bremen (Uebernachtung)—Husum (Melde-' beutelabwurf) —Kiel-Holtenau — Bothkamp (Zielabwurf) — Fehmarn-Marienleuchte (Ziellinie) —Hamburg — Wyk a. Föhr.
Ergebnisse: 1. Preis Goldene Hermann-Göring-Plakette des NSFK. NSFK.-Sturmf. Harmens (NSFK.-Gr. 8) auf Gotha Go 150 mit 1025 Pkt.; 2. Preis Silberne Hermann-Göring-Plakette des NSFK. Oberstubaf. Förster auf Focke-Wulf Fw 44 „Stieglitz" mit 1011,3 Pkt.; 3. Preis NSFK.-Gruppenf. Gieler (NSFK.-Gr. 10) auf Klemm Kl 31 mit 1001 Pkt.
Der nächstjährige deutsche Küstenflug wird, wie Korpsführer General der Flieger Christiansen mitteilte, mit 200 Maschinen stattfinden, während auch 1940 der Deutschlandflug in Gemeinschaft mit der Luftwaffe und Flieger-HJ. mit 500 Flugzeugen durchgeführt werden wird.
Zuverlässigkeitsflug 1939 für deutsche Sportfliegerinnen, Start 12. 8. Fehmarn/Marienleuchte, Zwischenlandungen Hamburg/Altona und Husum, am 13. 8.. in Wyk a. Föhr beendet. Sämtliche Teilnehmerinnen landeten im Zielhafen. 1. Liesel Bach auf Bücker „Student" mit 536 Pkt., 2. Luise Harden auf Siebel „Hummel" mit 509 Pkt., 3. Beate Köstlin auf Bücker „Student" mit 431 Pkt.
Bezugsfertige Normblätter. In letzter Zeit sind folgende Normblätter herausgegeben worden und beim Beuth-Vertrieb, Berlin SW 68, Dresdener Straße 97, beziehbar: Maschinenbau: DIN 617 Lagernadeln, Nadellager; DIN 1442 Schmierlöcher für Bolzen, Baumaße; Kunststoffe: DIN 7702 Ueberwachungszeichen für typisierte Preßmassen und Preßstoffe; DIN 7703 Vornorm Lager aus Kunstharz-Preßstoff, Technische Lieferbedingungen. (Träger: Fachausschuß für Kunst- und Preßstoffe des VDI; für DIN 7702 ferner: Technische Vereinigung der Hersteller typisierter Preßmassen und Preßstoffe e. V., Fachgruppe 7 „Isolierstoffe" der Wirtschaftsgruppe Elektroindustrie, Verband Deutscher Elektrotechniker E.V.)
Kundt, M, d. R., bekannter Abgeordneter aus dem Sudetenland, mit Wirkung vom 1. Juli zum Hauptmann d. Reserve d. Fliegertruppe ernannt.
Ausland.
Engl. Avro-„Manchester"-Jagdflugzeug soll mit einem noch in Erprobung befindlichen Rolls-Royce-3000-PS-Motor ausgerüstet werden.
200 Blenheim-Bombenflugzeuge wurden nach einer Meldung von „Scannews" in der zweiten Augustwoche nach Warschau überführt.
Manöverflug England 200 franz. Militärflugzeuge. Strecke Paris—Harwick— Manchester—Liverpool—Birmingham—Bristol—Oxford—London—Paris am 18. 8.
Verkehrsflugzeug der brit. Imperial Airways, Lockheed „Electra", stürzte am 18. 8. J.3,3r0' h auf der Strecke Hamburg—Kopenhagen, in der Nähe der Storsjrömbrücke, etwa 800 -m von" der Küste der Insel Falster entfernt, ins Meer, Der engl. Flugzeugführer Wright wurde gerettet, während ''die übrigen 5 Insassen, Mechaniker und 4 Fluggäste, Reuß-Deutschland, Simonton-USA, Crossby-England, Castello-Mexiko, ums Leben kamen.
311 km/h über 10 000 km flog Rossi auf Amiot-370 mit Hispano-Suiza 12-Y 960 PS am 18. 8.
Französ. Regnier 12 Zyl. V sind für die Coupe Deutsch, Leistung bei 4000 U 420 PS, Gewicht 231 kg.
III. Intern. Luftfahrtausstellung Mailand, 2.—17. Okt., wird sich auch England und USA beteiligen. Von den ital. zur Ausstellung gelangenden Maschinen werden schon heute genannt die „Breda 88", „Fiat 42", Macchi 200, ein SAI 6 usw.
Alfa Romeo 135 R. C.-32, 18 Zyl. Doppelstern, Zylinderinhalt 48,2 1. In Bodennähe 1250 PS bei 2400 U/min, in 3400 m Höhe 1400 PS. Startleistung 1500 PS. Gewicht 950 kg, Durchmesser 1,315 m, Betriebsstoffverbrauch bei Normalleistung 265 ig am Boden und 250 g in 3400 m. Untersetzungsgetriebe 1 : 2.
■: Russ. Riesenflugzeug „U. R. S. S. L. 1760" wird von Novikov und Schwartz eingeflogen. Spannweite 63 m, Höhe 7 m, Leergewicht 31 t, Fluggewicht 45 t. Sechs Motoren von je 1000 PS. Im Rumpf zwei große und ein kleiner Aufenthaltsraum, hinten Küchenraum. In den Flügeln vier Kabinen mit 4 Sitzen.
Russ. Flugvorführungen vor der franz.-engl. Militärkommission, etwa 1000 Flugzeuge, fanden am 18. 8. in Moskau statt.
USA-Kriegslieferung nach Frankreich betrug nach einer Veröffentlichung in-Washington 612 Flugmotoren. Bestellt sind 1345. USA-Fabriken sollen zur Zeit durchschnittlich monatlich 400 Motoren für Frankreich liefern.
USA-Ozeanflieger Alex Loeb, 32 Jahre, und Dick Becker, 23 Jahre, sind am 11. 8. mit einem veralteten Flugzeug von St. Peters (Neuschottland) gestartet, um nach Irland zu fliegen. Das Flugzeug ist bis heute überfällig.
USA X-100. Bomber der Stearman Aircraft Division der Boeing Airplane Co. in Wichita, Kansas, ist ein Hochdecker, Ganzmetall, zwei Motoren Hörnet R-2180 von je 1400 PS mit Dreiblattverstellschraube. Besatzung vier Mann, Bewaffnung MKs. Spannweite 19,81 m, Länge 18,85 m, Höhe 3,66 m, Fluggewicht 9050 kg. Die Maschine soll an dem USA-Bomber-Wettbewerb teilnehmen.
Pan American Airways Verkehrsflugzeug, zweimotorige Sikorsky, streifte bei der Wasserung im Hafen von Rio de Janeiro mit einem Flügel ein Schleppboot und stieß, hierdurch aus der Richtung gedreht, gegen ein Trockendock, wobei die Maschine in Flammen aufging. Von den 16 Insassen kamen 14 ums Leben.
500 Seeflugzeug-Häfen in
USA sollen in 240 km Abstand an der Atlantik- und der Westküste errichtet werden. Hierzu müssen die anliegenden Orte je 100 $ beitragen. Leitung CAA und NYA.
USA Air Transport Association America gehören 16 Gesellschaften an. Juli-Leistung betrug 63 500 000 Passagier/ Meilen. Trans-Continental attd Western Juni - Leistung fast 10 000 000 Passagier/Meilen.
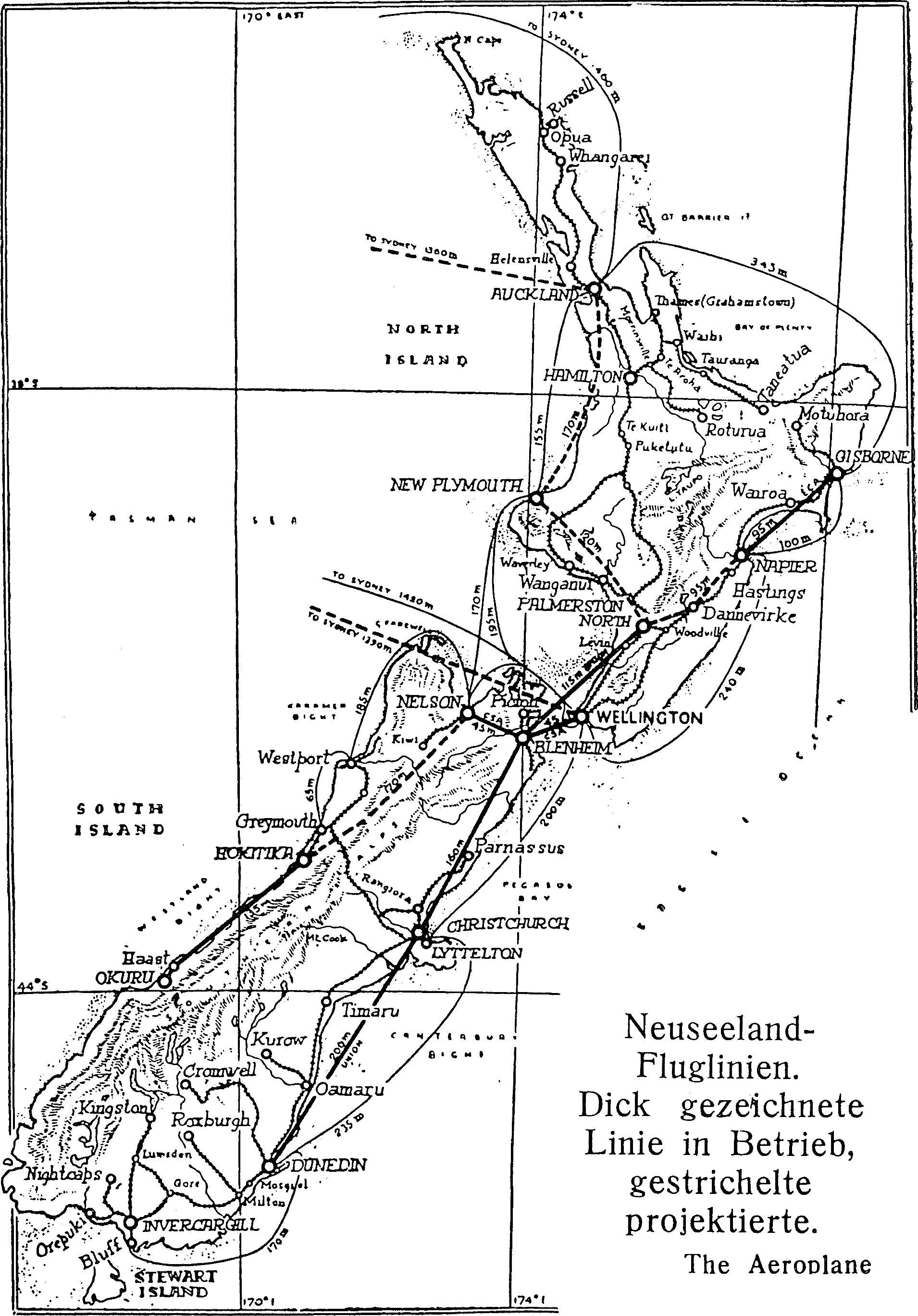
Northrop Aviation Incorporated von Mr. John Northrop gegründet. Fabrikanlagen, Baukosten 500 000 $, Long Beach, Californien. Die alte Northrop Aircraft Corp. ist bekanntlich 1937 in der Douglas Aircraft Corporation aufgegangen.
Australische Luftverkehrsgesellschaften erhalten jährlich Regierungsunterstützung von 394 000 £.
Segelflug
Beim 10. amerikanischen Segelflug Wettbewerb in Elmira N. Y.
Sonderbericht für den „Flugsport" von Wolf Hirth.
Als Teilnehmer des ersten amerikanischen Segelflugwettbewerbs in Elmira im Jahre 1930 erhielt ich eine Einladung, die Jubiläumsveranstaltung zu besuchen und an der Gründungsversammlung der S. P. (Soaring Pioneers) teilzunehmen.
Da sich meine Reise noch mit anderen Interessen verbinden ließ, entschloß ich mich im letzten Moment ziemlich plötzlich, „auf Strecke" zu gehen.
Am 23. Juni kam ich um Mittag in New York an. Gustav Scheurer, der uralte Segelfliegerkamerad von 1922, erwartete mich am Pier und nahm mich gleich mit sich, heraus aus dem sonneglühenden New York. Wir fuhren unter dem Hudson durch hinüber nach New Jersey. Abends 7 h starteten wir dann mit dem Segelfluganhänger hinten dran und trafen um 3 h früh am 24. Juni in Elmira ein, nachdem wir unterwegs noch auf weitere Segelflugtransporte gestoßen waren.
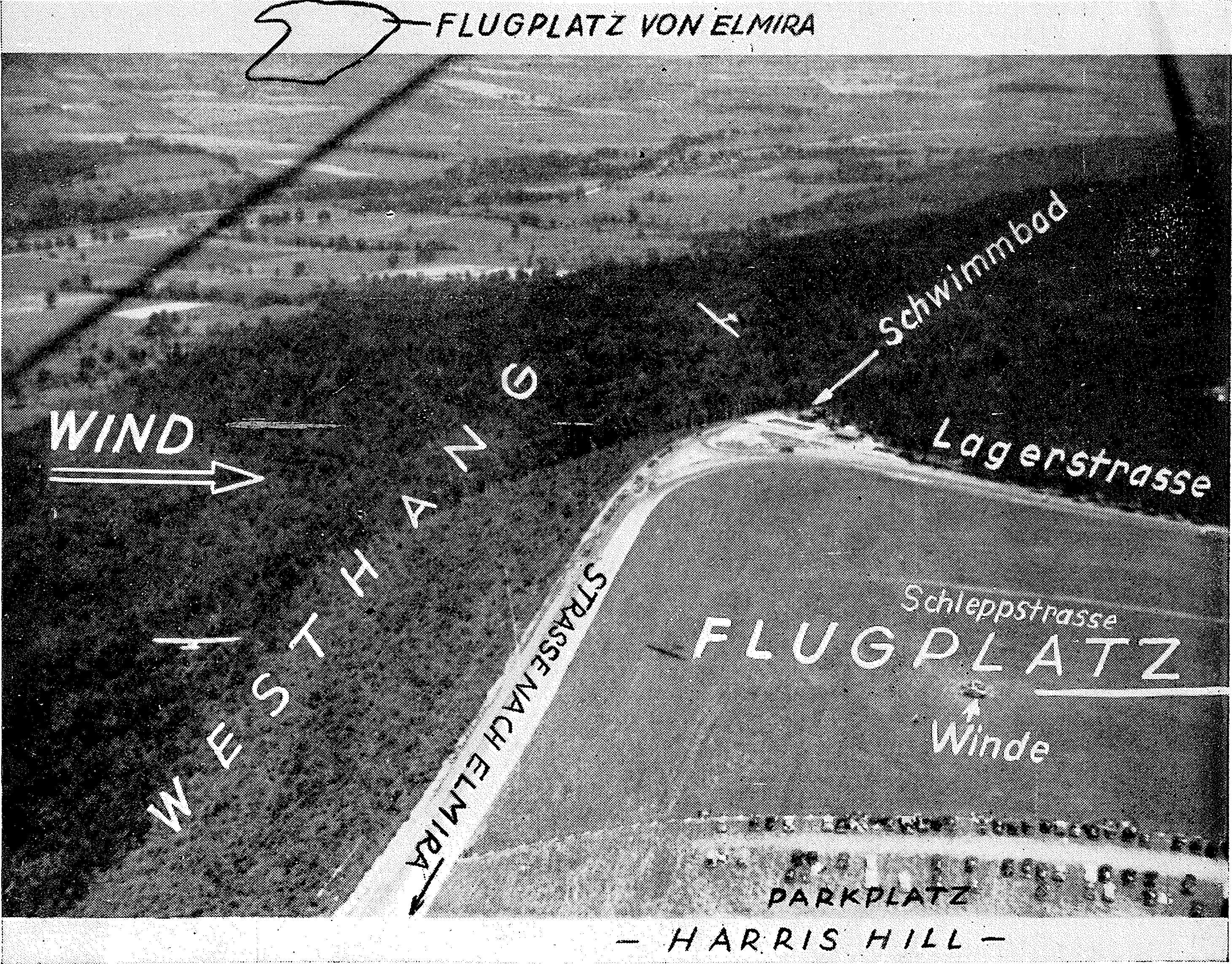
Westhang von Harris Hill. 18 Bilder: Wolf Hirth
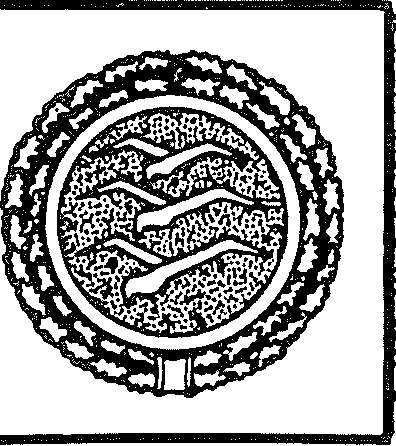
Vom 10. amerik. Elmira-Segelflug-Wettbewerb 1939. Leitwerk des „Nomad".
In den 9 Jahren meiner Abwesenheit war in zäher Aufbauarbeit trotz sehr geringer Mittel ein hübsches Fliegerlager auf dem Harris Hill entstanden, das sich gut in die Landschaft einfügt. Der Hauptbau in Holzkonstruktion enthält die Verwaltungsräume, einen Versammlungssaal und eine Gaststätte. Eine Flugzeughalle ist fertiggestellt,
eine weitere im Bau. Die Teilnehmer und Helfer wohnen in
kleinen Holzhäuschen, die je 10 Betten enthalten. Auch ich durfte mich darin einquartieren, um „mitten drin" zu sein. Ein prächtiges Schwimmbad wurde bei großer Hitze eifrig benutzt.
Am Nachmittag fand die feierliche Eröffnung statt mit vielen Reden und schönen Worten.
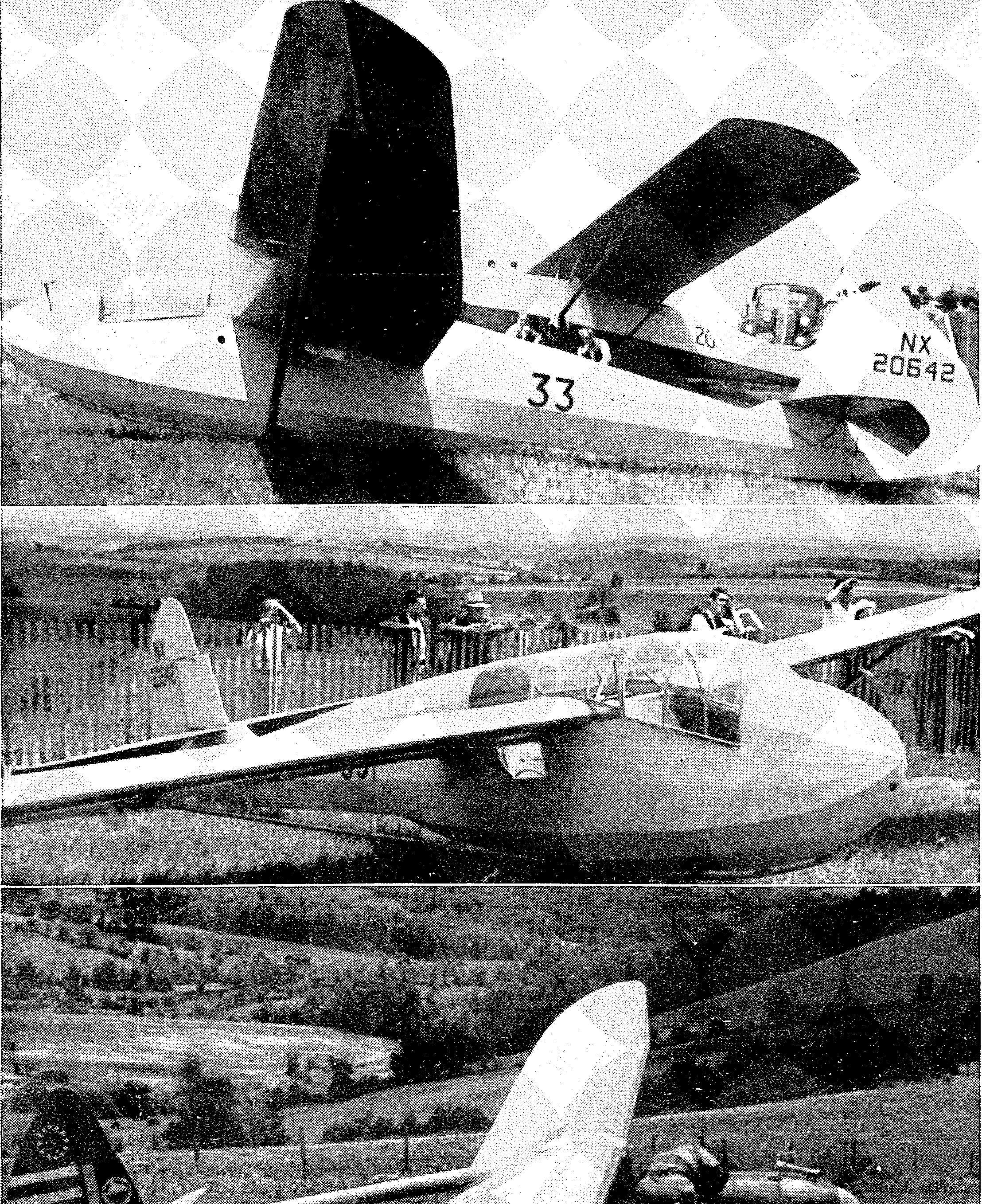
Vom 10. amerik. Elmira-
Segelflug-Wettbewerb 1939. Bob Stanleys „No-mad". Der Teil a ist zurückklappbar. Vergleiche die Abbildungen S. 469 Seitenansicht.
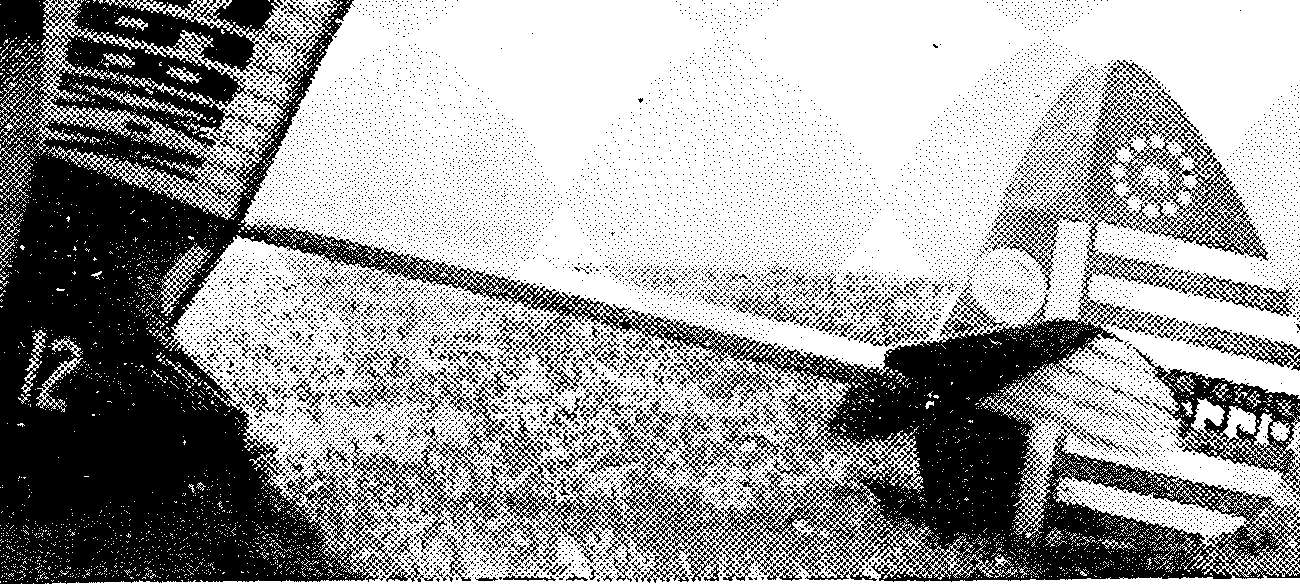
Vom 10. amerik. Elmira-
Segelflug-Wettbewerb 1939. 2 obere Bilder: „Schweitzer"-Metalldop-pelsitzer, mit dem Lew Barringer einen neuen
amerik. Zweisitzer-Höhenrekord aufstellte. Vor dem Hügelland bei Elmira. 2 untere Bilder: Bowlus Albatros Baby in Elmira (mit Grünau Baby-Fläche). Mit diesem Typ wurde in Texas ein inoffiz. Streckenrekord von 450 km aufgestellt.
Das Segelfluggerät macht auf einen Kenner neuerer Rhönwettbewerbe zuerst einen enttäuschenden Eindruck. Es gibt nur einige wenige Leistungssegler. Weitaus in der Mehrzahl sind Uebungs-segelflugzeuge, wie alte, teils etwas modernisierte Franklin's, Göppingen I oder Eigenbauten.
Das interessanteste Stück war der „Nomad" von Robert Stanley, eines Marineleutnants aus Pensacola in Florida, der Konstrukteur, Erbauer und Flugzeugführer war. Der Rumpf war in Dural-schalenbau, der Flügel in Holz ausgeführt.
Das Leitwerk bestand aus zwei in 90° zueinander angeordneten Flächen, die so gleichzeitig Höhen- und Seitenruder bildeten. (Siehe Abb. S. 469.) Soweit es sich vom Boden aus feststellen und aus den Flugleistungen ableiten läßt, hat die Maschine gute Flugeigenschaften. Stanley machte mit ihr ausgezeichnete Blindflüge und überbot zweimal den amerikanischen Höhenrekord.
Bei einer gegen Wettbewerbsende durchgeführten Beanspruchungsprüfung brach dann allerdings der Flügel an einer schlecht geschalteten Reparaturstelle, wobei sich Stanley mit dem Fallschirm retten konnte.
Weiter von Bedeutung waren die zwei Schweitzer-Ganzmetall-Zweisitzer, bei denen wenig genietet aber viel geschraubt war. Die kleinen Schräubchen waren nicht gesichert. „Man hört es ja gleich, wenn sich eine Mutter gelöst hat'4, war die Erklärung des Erbauers!
Der Wettbewerb selbst war bis auf eine kleine Spitzengruppe kein so harter Kampf „bis aufs Messer" wie bei uns in der Rhön. Für viele der Teilnehmer ist der Wettbewerb fast die einzige Flugtätigkeit des Jahres, so daß sie mehr zum Vergnügen und der Uebung wegen fliegen.
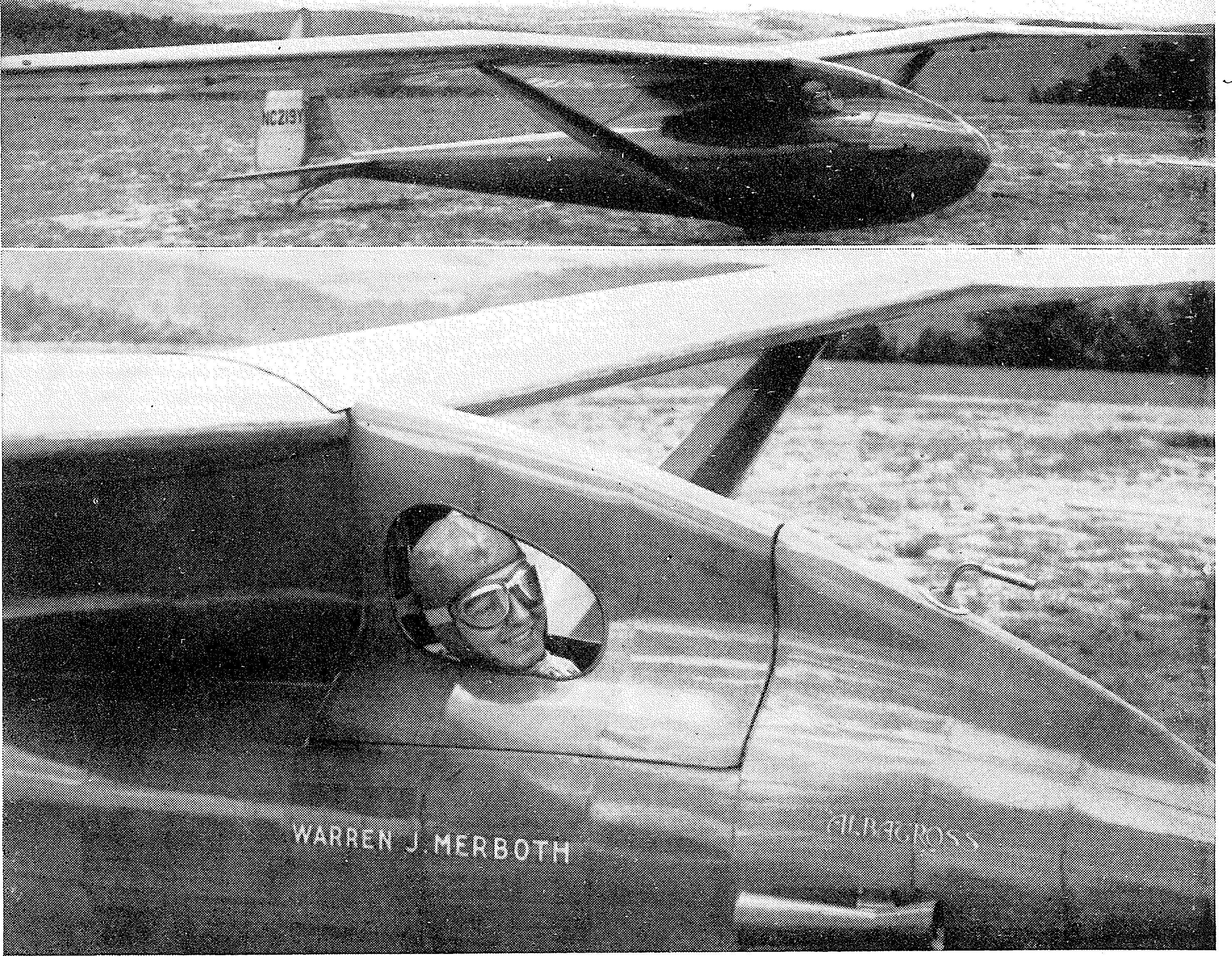
Vom 10. amerik. Elmira-Segelflug-Wettbewerb 1939. Bowius Albatros von Warren Merboth — 3. in der Wertung 1939 — seit Jahren im Dienst.
Spannend war jedoch das Duell der zwei Führenden, das ehester Decker auf Minimoa zuletzt mit großem Vorsprung für sich entschied, nachdem zeitweise auch Stanley vorne gelegen hatte. 3021 Punkte gegen 2320. Dritter wurde Merboth mit dem alten Bowlus Albatros, 1930 Punkte. Weiter folgten Lehecka mit 1747 auf Rhönsperber und John Robinson mit 1028 auf seiner Eigenkonstruktion „Robin".
Die übrigen hatten unter 1000 Punkte.
Neben der Leistungsklasse lief noch ein Wettbewerb der Nachwuchsflieger, die kein Leistungsabzeichen hatten. Hier siegte: Buell vor Maxey und Hamilton.
An Höchstleistungen wurden erreicht: Neuer amerik. Höhenrekord: Robert Stanley 5200 m auf Nomad. Neuer amerik. 2-Sitzer-Höhenrekord: Lewin Barringer 1970 m auf Schweitzer. Neuer amerikanischer Fernzielflug mit Rückkehr: ehester Decker 64 km auf Minimoa. Neuer amerikanischer Streckenrekord: ehester Decker nach Atlantic City 372 km auf Minimoa.
Bei einem Vorwettbewerb in Texas hatte allerdings Woody Brown auf Bowlus Baby Albatros im Juni 1939 mit einem Flug von Wichita Falls nach Oklahama City einen inoffiziellen Rekord von 280 Meilen = 450 km aufgestellt. Was müssen die in Texas für Thermik haben!
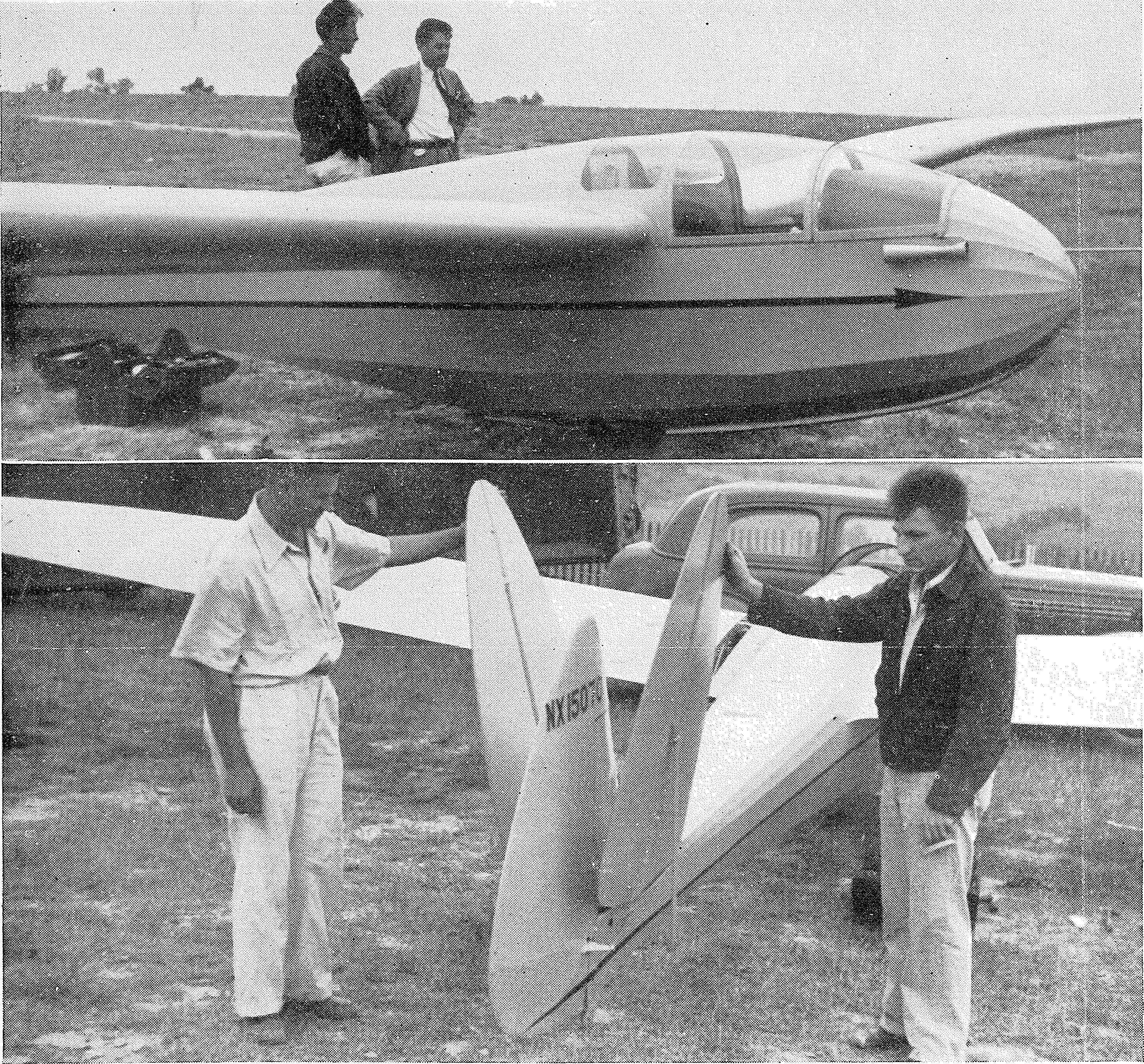
Vom 10. amerik. Elmira-Segelflug-Wettbewerb 1939. Gut aussehender Segler von New Jersey mit Stahlrohrrumpf. Gewicht jedoch über 300 kg. Unten: Der New Jersey-Segler hat hochklappbares Höhenleitwerk zum Transport. Links: Gustav Scheurer, rechts der Erbauer.
Erwähnenswert ist noch, daß während des Wettbewerbs die drei ersten goldenen Leistungsabzeichen erflogen wurden, und zwar von Stanley, Decker und Robinson.
Stanley hatte die besondere Freude, seinen ersten Besuch in New York auf dem Segelflugwege zu bewerkstelligen. Sicher ein großes Erlebnis für einen Amerikaner, nach langem, anstrengenden Flug das Wolkenkratzergewimmel am Horizont auftauchen zu sehen, um die Riesenstadt dann noch zu überfliegen.
Am 2. Sonntag des Wettbewerbs trafen sich dann die Teilnehmer des Jahres 1930. Ein sehr vergnügter Abend beschloß die Gründungstagung der „Kameradschaft alter Segelflieger", die nicht vergessen hatte, ihrer Mitkämpfer zu gedenken, die der Tod weggerissen hatte.
Leider waren auch nicht alle Lebenden vertreten, so wurde besonders Hawley Bowlus vermißt, aber auch Peter Riedel, der im Westen weilte und versuchte, die USA im Segelflug zu überqueren.
Die Leitung des Wettbewerbs hatte A.L.Lawrence. Die Arbeit führten aus: Prof. R. E. Franklin, Jay Buxton, Gus Scheurer und Dr. Karl 0. Lange sowie Henry Wightman.
Es nahmen 36 Flugzeuge und 88 Piloten teil.
Starts von Harris Hill 460; Starts vom Flugplatz 226; Streckenflüge 117; Höhenflüge 138; Dauerflüge 54; Gesamtstrecke 11 000 km.
Die meisten Flüge wurden mit Winde gestartet. Nur bei sehr ungünstiger Wetterlage gab es Flugzeugschlepps, zusammen 145.
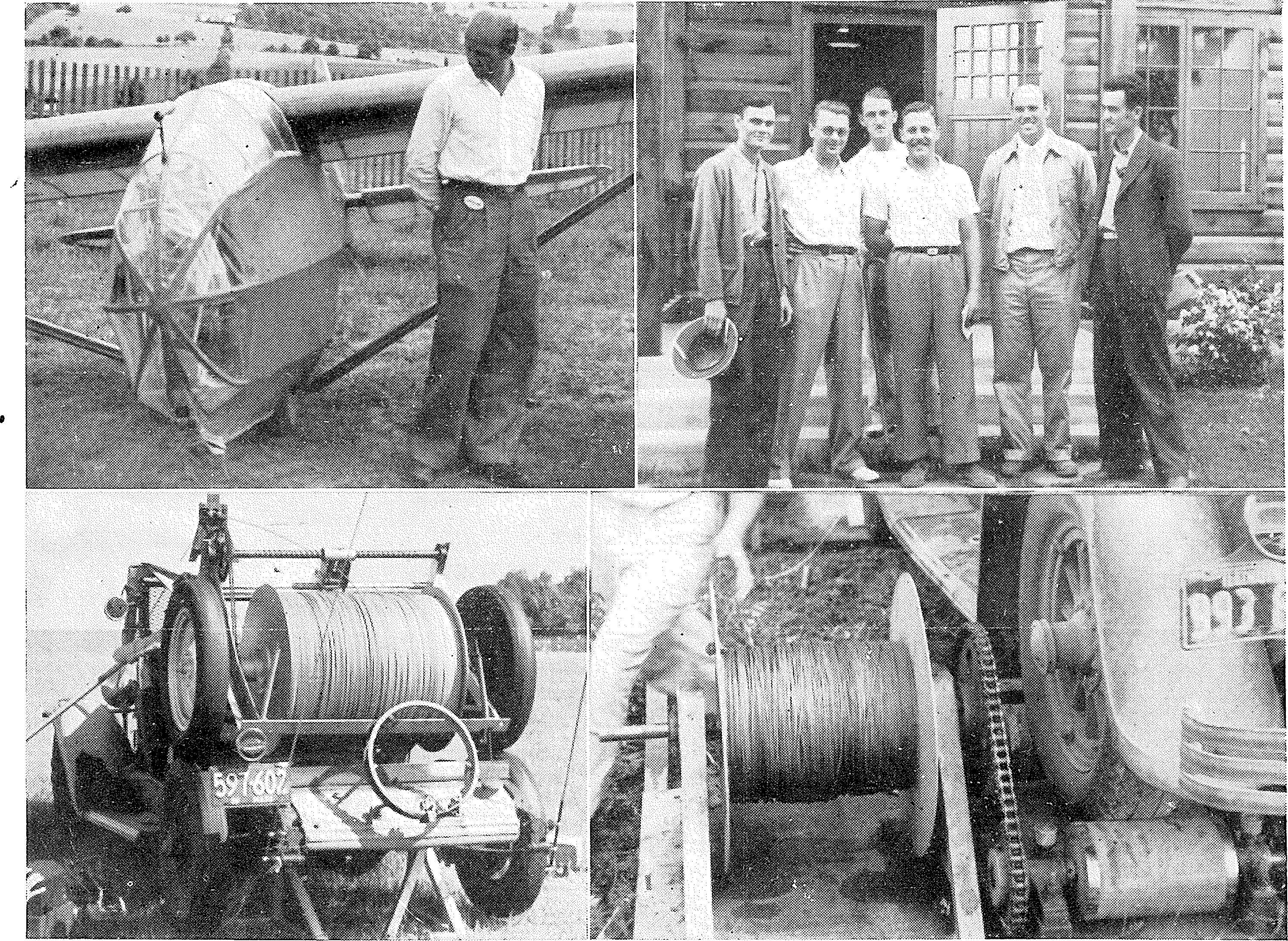
Vom 10. amerik. Elmira-Segelflug-Wettbewe.rb 1939. Oben links: John Robinson von Kalifornien — 5. in der Punktwertung 1939. Rechts: Vor dem Hauptgebäude, von rechts nach links: Robert Stanley, Parker Leonard, Lawrence (Wettbewerbsleiter), Speed Westphal von Los Angeles (fliegender Reporter), Wolf Hirth. Unten links: Mit dieser Winde wurden die meisten Starts ausgeführt. Seil aus Hanf, nach hinten 2 Stabantennen für drahtlose Teelgraphie mit Start und Zentrale. Rechts: Eine andere Winde von Illinois.
Man darf jedoch nicht den Fehler machen, diese Ergebnisse ohne weiteres mit den deutschen zu vergleichen, weil der Segelflug in USA noch vollständig auf privater Initiative aufgebaut ist.
Deutsches Studenten-Segelfliegen bei den Studenten-Wettspielen Wien. 24. 8.,
war ein deutscher Erfolg. Der Deutsche Flinsch, welcher in den ersten beiden Tagen seine Aufgaben löste, traf am 3. Tag nach 42 Min. am Ziel ein und wurde mit 300 Pkt. Gesamtsieger. Mit großem Abstand folgte als 2. Meier zu Bentrup, 60 Min., 256 Pkt., 3. Bollmann, Ungarn. Am letzten Tag wurde in Gegenwart des Reichserziehungsministers Rust und des italienischen Kultusministers Botai über dem Wiener Stadion die Segelkunstflugkette des Korpsführers des NSFK. im geschlossenen Verband vorgeführt. In der Kette flogen NSFK-Hauptstuf. Braeuti-gam, NSFK-Stuf. Haase und NSFK-Stuf. Hofmann.
Ostafrikan. Segelflugklub Mbeya, Südwest Tanganyika, wird wieder Segelflugbetrieb aufleben lassen.
Wehrle, Präsident des Aero-Clubs von Hericourt, der 1931 den Segelflug aufnahm, ist am 30. 7. tödlich verunglückt.
Borel-Segelflugpreis, Bedingung geschlossener Rundflug über zwei 25 km voneinander entfernt liegende Städte, 1922 ausgeschrieben, Preis 10 000 Fr. (vergessen worden) von Eric Nessler gewonnen.
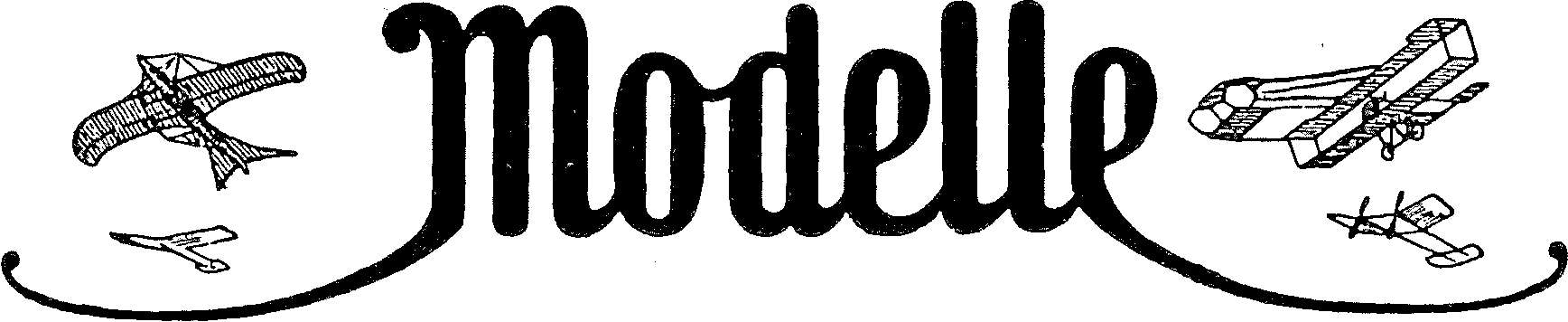
Belg. Segelflugmodell Michel Verbinnen flog am 14. 8. 39 1 h 16 min. 14 sec. (Weltrekord beträgt 1 h 06 min 13 sec). Start in Kiewit mit 60 m langem Seil.
Banne d'Ordanche franz. Modellwettbewerb, Preis des Präsidenten der Republik, gewann Richard mit 5 min 39 sec.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Mobilmachung, Aufmarsch und erster Einsatz der deutschen Luftstreitkräfte im August 1914. Mit 14 gr. Uebersichtskarten über die Ergebnisse der operativen Luftaufklärung zu Beginn des Weltkrieges. Herausgegeben und beziehbar von der Kriegswissenschaftl. Abteilung der Luftwaffe, Berlin NW 40, Moltkestr. 4. Vorausbestellpreis bis 15. 9. 39 RM 5.30.
Das vorliegende Buch gibt einen genauen Ueberblick über die Mobilmachung der Luftstreitkräfte vom Weltkrieg, vermittelt ein genaues Bild über den Aufmarsch der Luftstreitkräfte im Zusammenhang mit den Aufmarschbewegungen der Heere und der deutschen Aufklärungs- und Kampftätigkeit während der ersten Operationen in Ost und West sowie der Land- und Seestreitkräfte. Zum ersten Mal wird sich mancher Kriegsteilnehmer an Hand dieses Buches, insbesondere mit den vielen übersichtlich gehaltenen Karten, ein Bild über die wirklichen Vorgänge machen können. Die Verteilung der Luftstreitkräfte und die namentliche Liste der Führer der deutschen Luftwaffenverbände im August 1914 läßt manche Erinnerungen aufleben. Generalmajor Haehnelt hat mit seinen Mitarbeitern in diesem Buch den Männern der Luftwaffe im Weltkrieg ein Denkmal gesetzt.
Flugwesen fünfsprachig, Taschenwörterbuch, Deutsch-Englisch-Französisch-Italienisch-Spanisch, zusammengest. v. Lothar Ahrens, mit einem Geleitwort von Generalleutnant Udet. 576 S. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin NW 7. Preis RM 12.—, für VDI-Mitgl. RM 10.80.
Die Fliegerei ist international, völkerverbindend. Die Männer vom Fach in allen Ländern möchten technischen und wissenschaftlichen Gedankenaustausch pflegen und die in den jeweiligen Landessprachen veröffentlichten Fachzeitschriften und sonstiges studieren. Hierzu gehört ein handliches Wörterbuch. Ahrens hat es uns mit seinem „Flugwesen fünfsprachig" geschaffen. Die Fremdwörter sind im vorliegenden Buch nach ihrer technischen Zusammengehörigkeit in Klassen unterteilt (Flugzeuge, Ausrüstung des Flugzeugs, Kennzeichen usw.) aneinandergereiht, alphabetisch geordnet und mit Nummern bis zu 3660 versehen. Für jede Sprache ist wieder ein besonderes Verzeichnis, so daß sich beim Uebersetzen aus der Fremdsprache oder umgekehrt, schnell der gewünschte Ausdruck finden läßt. Etwas einfacheres gibt es nicht. Ein unentbehrliches Buch.
Land aus Feuer und Wasser, v. Hans Dominik. 336 S. Verlag v. Hase & Koehler, Leipzig. Preis RM 4.50.
Der vorliegende Roman handelt von einem genialen Erfinder, welcher beauftragt ist, eine Flugzeugbasis in der Südsee zu errichten. Die spannend geschriebene Handlung, Durchführung der Experimente und technische Vorbereitungen für die Planung, kennzeichnet den Verfasser Hans Dominik als Meistererzähler.
Luftfahrtforschung, Bd. 16, Lfg. 6, 7, herausgeg. v. d. Zentrale f. wissensch. Berichtswesen üb. Luftfahrtforschung. Verlag R. Oldenbourg, München. Preis je Lfg. RM 2.50.
Heft 6 enthält: Gedankengänge zur Flatterberechnung, v. A. Teichmann; Wechselwirkung zwischen anliegender u. abgerissener Strömung, v. W. Fabri-cius; Dämpfungsarten f. d. Schwingungen d. Kreiselhorizontes u. ihre Wirkungen i. Kurvenflug, v. M. Schuler u. K. Magnus; Ergebnis d. Preisausschreibens der Lilienthal-Ges. f. Luftfahrtforschung 1937/38; Zusammenstellung d. bekannt gewordenen Vorschläge z. Abstandsbestimmung u. z. Rückstrahlpeilung auf funk-techn. Wege u. ihre kritische Betrachtung, v. K. Dziewior; Höhenmeßverfahren auf funkentechn. Grundlage, v. U. Theile.
Heft 7: Ueber d. Krafteinleitung in einholmige Flügeltragwerke d. unvollkommen ausgebildete Querwände, v. F. Reinitzhuber; Aerodynamik d. Drehflüglers m. Blattwinkelrücksteuerung, v. A. Pflüger; D. Einfluß d. Zahl d. Abschreckungen u. d. Glühdauer auf d. Aushärten v. Al-Cu-Mg-Legierungen, v. P. Brenner u. H. Kostron; Untersuchung v. Bleibronze-Ausgüssen i. d. DVL.-Lager-prüfmaschine, v. G. Fischer; Ueber Resonnanzschwingungen i. d. Ansaug- u. Auspuffleitungen v. Reihenmotoren, v. 0. Lutz; Betrachtungen z. Aufbau d. elektr. Flugzeugbordgeräts n. d. Drehspulprinzip, v. W. Fischer.

f^ZUoIl ««cht Stellung,
als Meister oder Vorarbeiter. Fntwidc« lungsbetrieb bevorzugt. Angebote an W. Scfamid, Münster/W., Augustastr. 4311
bei Ostendorf.
Mitiweida
Ingenieur. * schule
1 Maschinenbau / Automobil- u. Flugtechnik I
^Elektrotechnik.
Programm kostenlos I
Fallschirme
aller Art
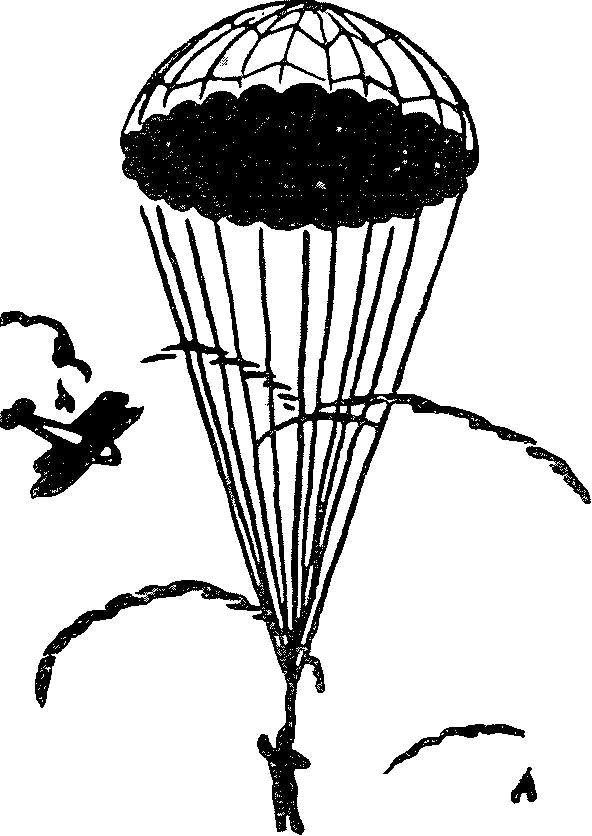
SCHMOEDEM & CO.
15crfiii-\euköllii
Bergstraße 93-95
älteste Flugzeug* Fallschirm-Fabrik der Welt
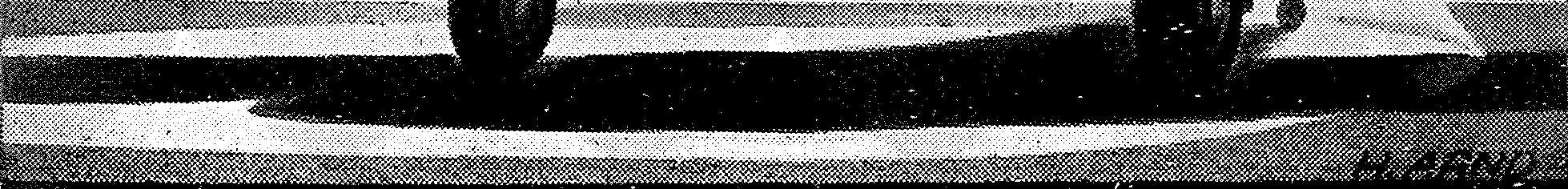
BERU-WERK aruprecht LUDWIGSBURG begr! 1912
Heft 19/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro K Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehe«. _nur mit genaue r Ouellenangabe gestattet.
Nr. 19_13. September 1939_XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 27. Sept. 1939
Gegenwirkung der deutschen Luftwaffe.
Die Welt horcht auf. Schneller als man ahnte, hat die deutsche Luftwaffe ihre Leistungsfähigkeit bewiesen. Das Oberkommando der Wehrmacht berichtet: „Die deutsche Luftwaffe beherrscht den gesamten polnischen Luftraum." Und dabei verfügte Polen über eine hochentwickelte Flugzeugindustrie und recht gut ausgebildete Flieger. Dieses Urteil konnte man im letzten Jahre noch während des Pariser Salons hören. Die polnischen Konstruktionen sind daher mit Recht von der polnischen Heeresverwaltung bevorzugt worden, da man von ausländischen Konstruktionen sich keine Ueberlegenheit versprach.
Indessen, die polnische Luftwaffe war der deutschen nicht gewachsen. Ueberau zeigte sich die Ueberlegenheit der deutschen Flugzeuge und der nach Betätigung drängenden deutschen Besatzungen. Dank der überlegenen Geschwindigkeit hängten die deutschen Kampfgeschwader die polnischen Jäger spielend ab. Die deutsche Ueberlegenheit ist bewiesen. Dabei ist nur ein geringer Teil der deutschen Luftwaffe zur Ostabwehr eingesetzt worden, während der größte Teil an anderen Stellen in Reserve liegt.
Die langjährige Aufbauarbeit unserer Luftwaffe zur Erreichung von unvergleichlichen Spitzenleistungen ist von Erfolg gewesen. Wir können mit Zuversicht allen Angriffen entgegensehen. Unsere Gegenwirkung wird nicht zu überbieten sein.
Ital. /Muskelflugzeug Bianchi.
Muskelflugkonstrukteur Bianchi zählt zu den wenigen Konstrukteuren, die auf diesem Gebiete ernst zu nehmen sind. Die erste ital. Maschine mit zwei Schrauben, welche auch auf dem letzten Mailänder Salon zu sehen war, hat bereits beachtliche Flüge hinter sich*). Der neue Typ ist wieder ein abgestrebter Hochdecker, viel schnittiger und leichter gebaut. Um eine möglichst geringe Bauhöhe (1 m) zu erreichen, ist nur eine dreiflügelige Schraube verwendet. Das Flugzeug wird sicher zum erstenmal die 1000-m-Grenze überschreiten.
*) Vgl. Bossi-Bonomi-Muskelkraftflugzeug „Flugsport" 1937, S. 169, 199. 527 u. 580.
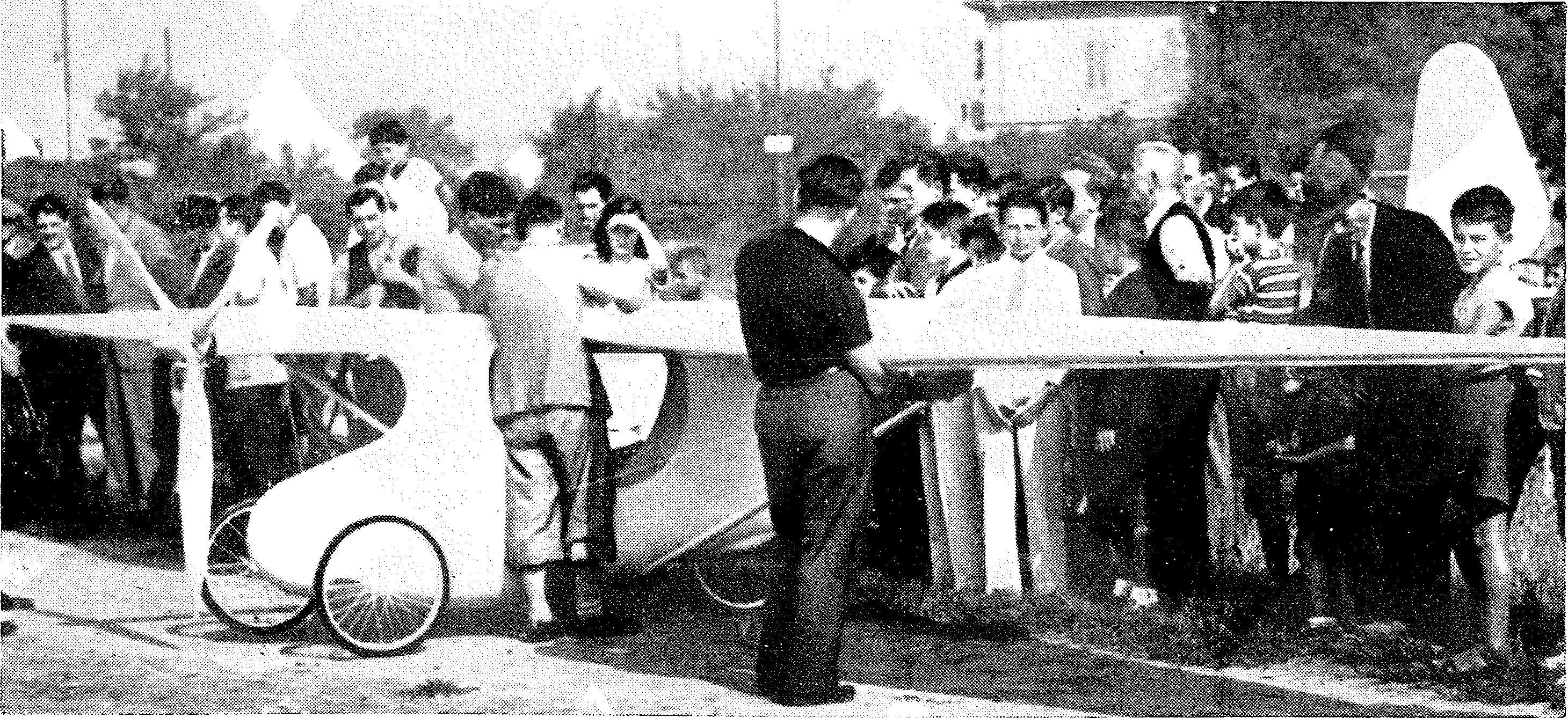
Ital. Muskelflugzeug Bianchi.
USA Rich-Zweimotor-Leichtflugzeug.
Das Rich-Leichtflugzeug ist ein Tiefdecker mit zwei Motoren auf sehr hohen Motorböcken über dem Flügel mit Druckschrauben. Die beiden Motoren sind gegen die Oberseite des Rumpfes verstrebt.
Flügelmittelstück mit dem Rumpf fest verbunden. Ansatzflügel stark V-förmig gestellt. Holzbauweise.
Rumpf Stahlrohr. Kabine sehr geräumig mit Einstieg von back-bord. Höhenleitwerk sehr hoch verlegt. Zwei Seitenleitwerke gegen den Rumpf verstrebt. Dreibeinfahrwerk halb hochziehbar, so daß die Räder in hochgezogenem Zustand noch etwas vorstehen.
Motoren Lycoming 50 PS, Geschwindigkeit 160 km/h.
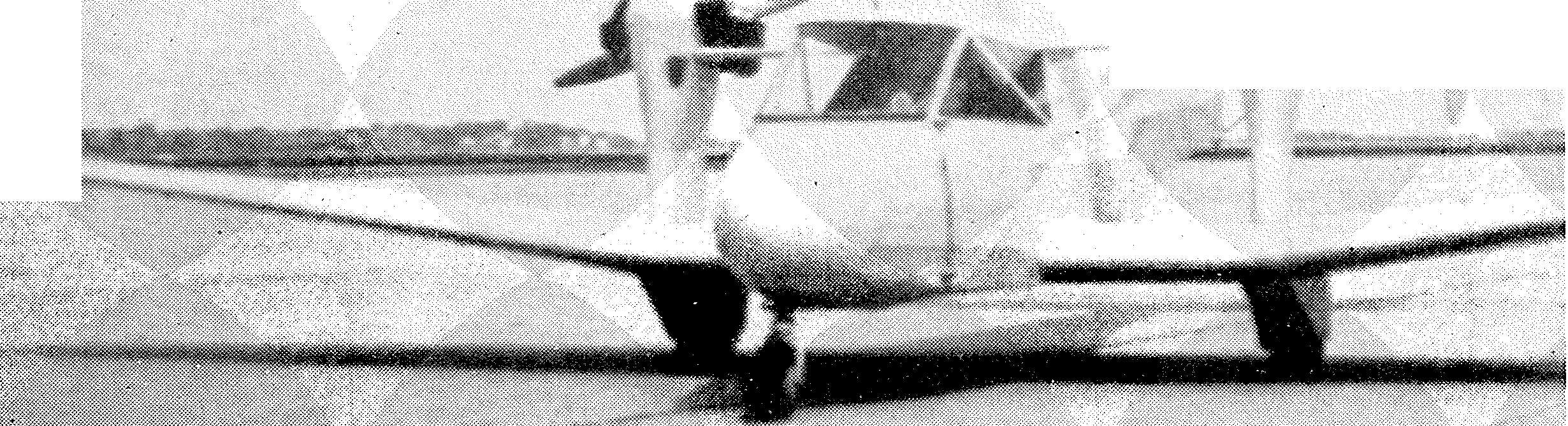
USA Rich-Zweimotor-Leicht-flugzeug.
Bild Aviation
USA-Jagdflugzeug NA-50.
Die North American Aviation Inc., Inglewood, Cal., hat den Typ NA-50 für die peruanische Regierung aus der bekannten NA-16-Serie entwickelt.
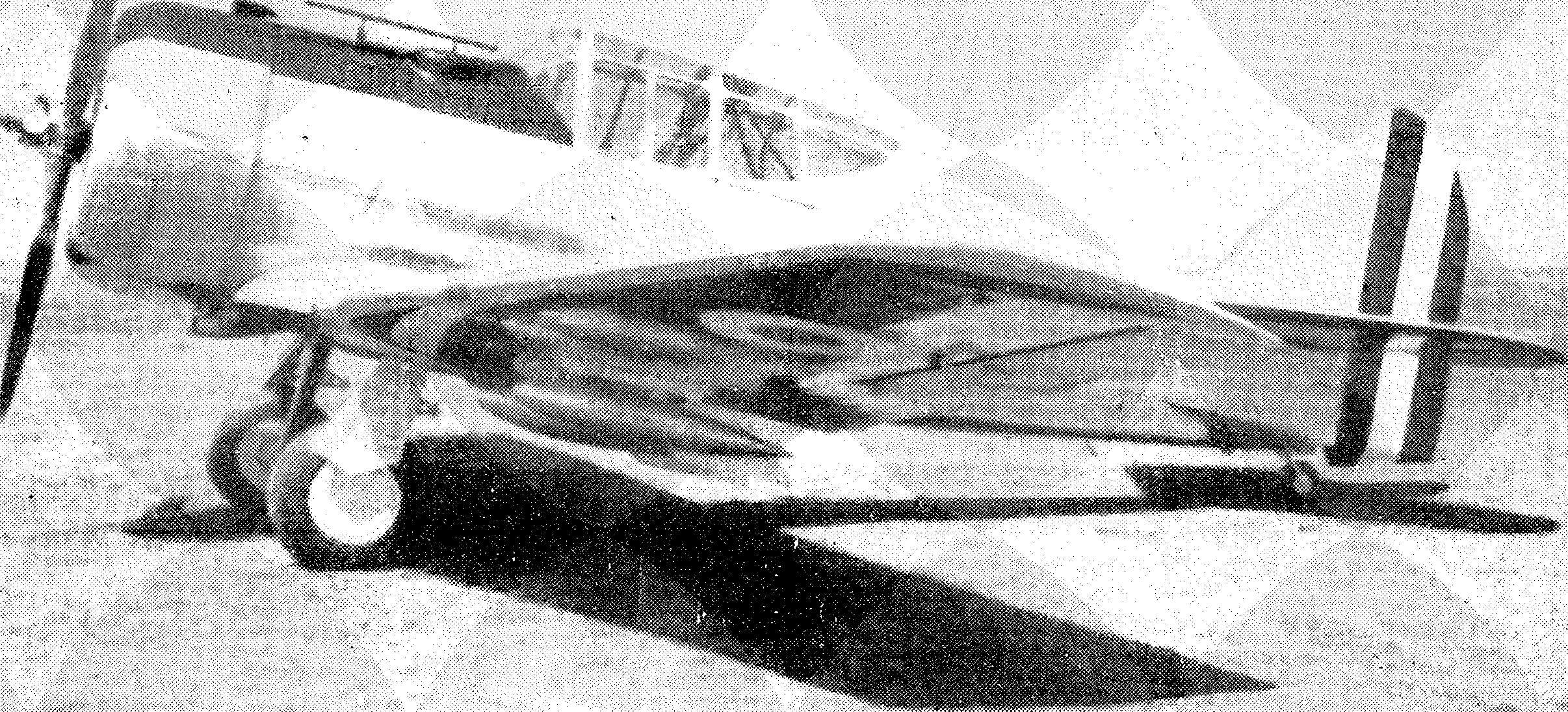
USA NA-50 Jagdflugzeug. Man beachte unter dem Flügel die Aufhängevorrichtung für 4 45-kg-BombeiL
Rumpf teilweise Stahlrohr, hinter dem Führersitz mit tragender Außenhaut. Die Metallhaut mit inneren Versteifungen in der Nähe des Führersitzes ist zur Kontrolle abnehmbar. Die Stahlrohrkonstruktion im Führersitz ermöglicht großen Raumgewinn für die Unterbringung der bei Jagdflugzeugen notwendigen Hilfseinrichtungen. Die große durchsichtige Führersitzverkleidung gibt gutes Gesichtsfeld.
Flügelschnitt NACA 2300, Flügel dreiteilig, Mittelstück vom Rumpf bei Beschädigungen leicht auswechselbar. Zwei Betriebsstoffbehälter von je 770 1 im Flügelmittelstück gegen Leckwerden besonders armiert mit Neobest. Höhen- und Seitenleitwerk freitragend.
Ausrüstung mit Empfänger und Sendestation, Sauerstoffgerät, Fallschirm. Zwei fest eingebaute MG's. 30-mm-Kaliber, zwei Bombenaufhängevorrichtungen unter dem Flügel.
Motor Wright Cyclone. R-1820-G3 von 840 PS bei 2100 U/min. in 2600 m.
USA Douglas-8A-3N-Einmotor.
Dieser einmotorige Tiefdecker vermutlich als Sturzbomber wird für die niederländische Luftwaffe gebaut und zur Zeit von dem Chefpilot William Coyle eingeflogen.
Besatzung Führer und Schütze. Angeblich mit ausfahrbarem MG.-Turm. Einfaches Verschwindfahrwerk. Motor Pratt & Whitney 900 PS mit dreiflügeliger Schraube. Geschwindigkeit 400 km/h in 3900 m Höhe. Bekanntlich ist seinerzeit das Abnahmeflugzeug, worin sich die franz. technische Abnahmekommission befand, in Kalifornien abgestürzt.
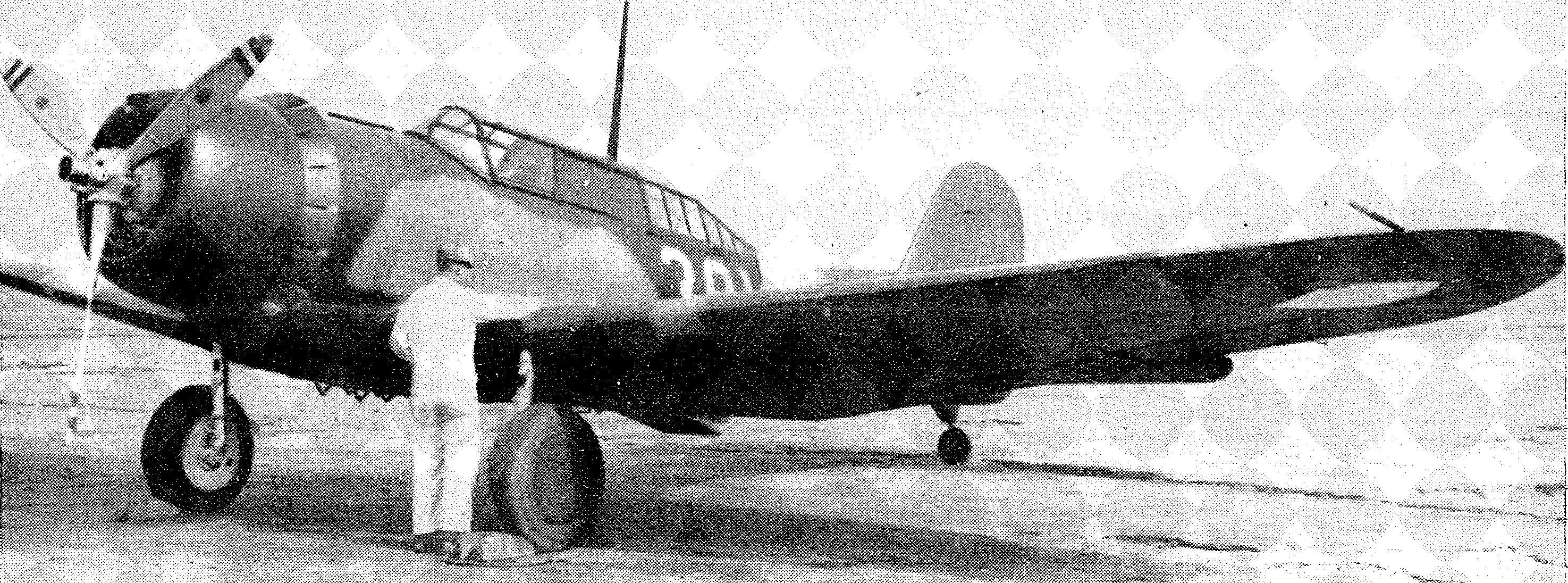
USA Douglas-8A-3N-Einmotor. Archiv Flugsport
Engl. Blackburn-Skua-Jagd- und Sturzbomber.
Die Skua ist der erste Jagd- u. Sturzbomber, der als zweisitziger Eindecker von Blackburn für die Marine gebaut wurde. Ursprünglich war diese Konstruktion, die mit beiklappbaren Flügeln ausgerüstet ist, für Flugzeugmutterschiffe bestimmt.
Landeklappen: Zappklappen, deren Oberkante beim Ausschwenken nach hinten geschoben wird.
Flügel dreiteilig, Mittelstück und Ansatzflügel. Flügelmittelstück abnehmbar. Oberseite des Flügels bildet den Boden des wasserdichten Abteils unter dem Führersitz. Mittelstück zwei Kastenholme von großem Querschnitt. Ansatzflügel T-Holme mit doppelten Stegen nach der Flügelspitze zusammenlaufend. Flügelspitzen abnehmbar. Vor den Querrudern wasserdichte Räume. Flügel und Landeklappen Glattblechbeplankung. Querruder leinwandbedeckt.
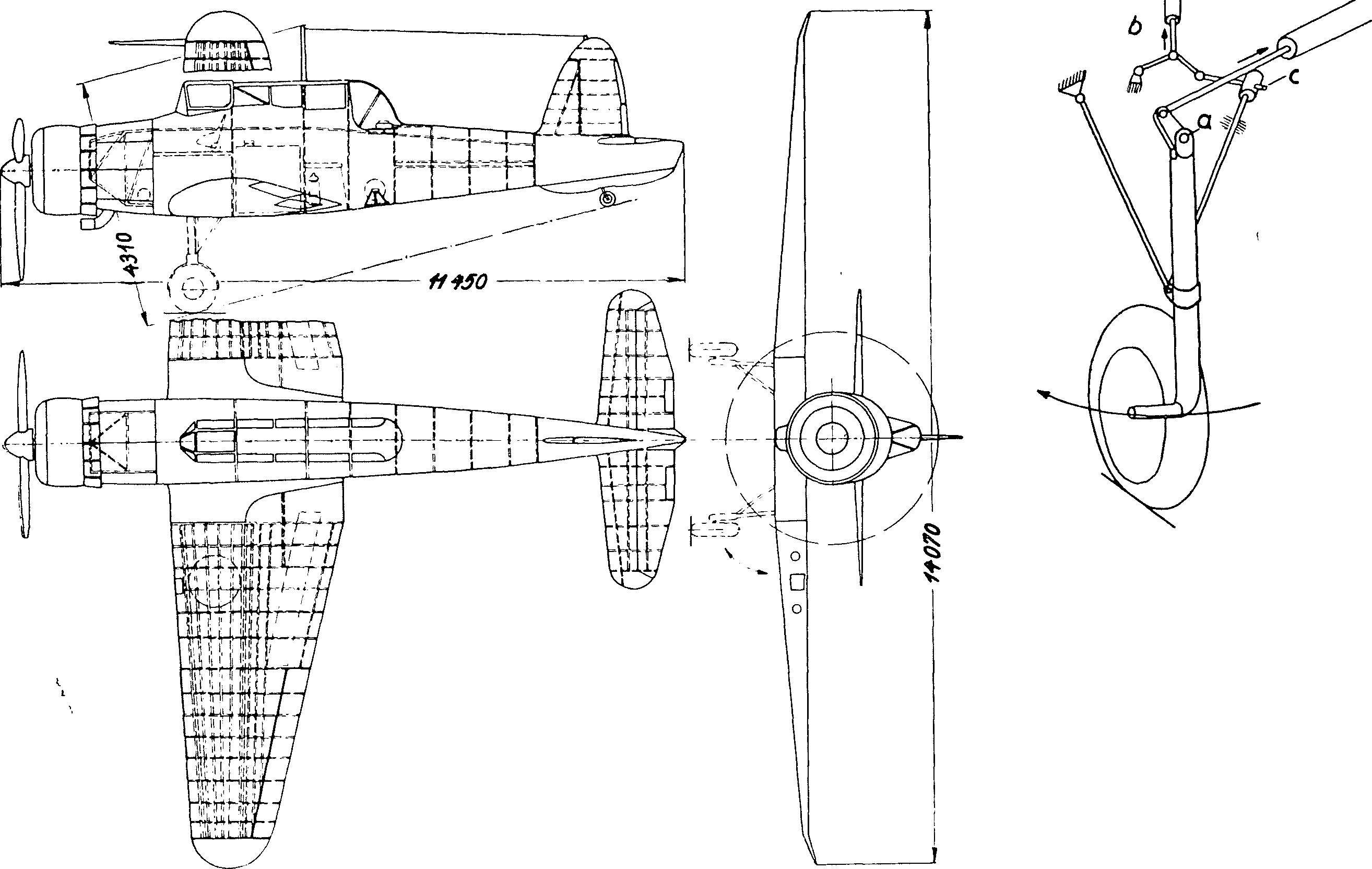
Schematische Darstellung: des hochziehbaren Fahrwerks vom Blackburn „Skua".
Engl. Blackburn „Skua".
Zeichnungen Flugsport
Rumpf zweiteilig. Rumpfende mit dem ganzen Leitwerk knapp vor diesem abnehmbar. Haupttanks im Rumpfmittelstück zwischen Pilot und Heckschütze.
Führersitz in der Höhe verstellbar. Beobachtersitz fest. Die Formringe innerhalb des Kabinenaufbaues sind bis zum Dach der Kabine durchgeführt, um Schutz bei Ueberschlagen zu gewährleisten. Fußrasten für Seitenruder parallel bewegt, verstellbar. Links
Trimmklappenverstellungs-anzeiger vor dem Führer.
Höhen- und Seitenleitwerk freitragend, Glattblechbeplankung mit Hohlnieten befestigt. Trimmklappen vom Führersitz verstellbar. Höhenruder leinwandbedeckt.
Fahrwerk nach außen in Aussparungen zwischen den Holmen der Ansatzflügel hochziehbar. Ueber dem Drehpunkt a der Stoßaufnehmerstrebe ist ein Hebel angelenkt, an dem die Kolbenstange des hydraulischen Hochziehzylinders angreift. Durch eine besondere Vorrichtung wird das Fahrwerk im ausgefahrenen Zustand mit einem Bolzen c arretiert. Vergleiche die schematische Abbildung
Bewaffnung als Jagdflugzeug zwei bis vier feste MG.s in der Flügelnase.
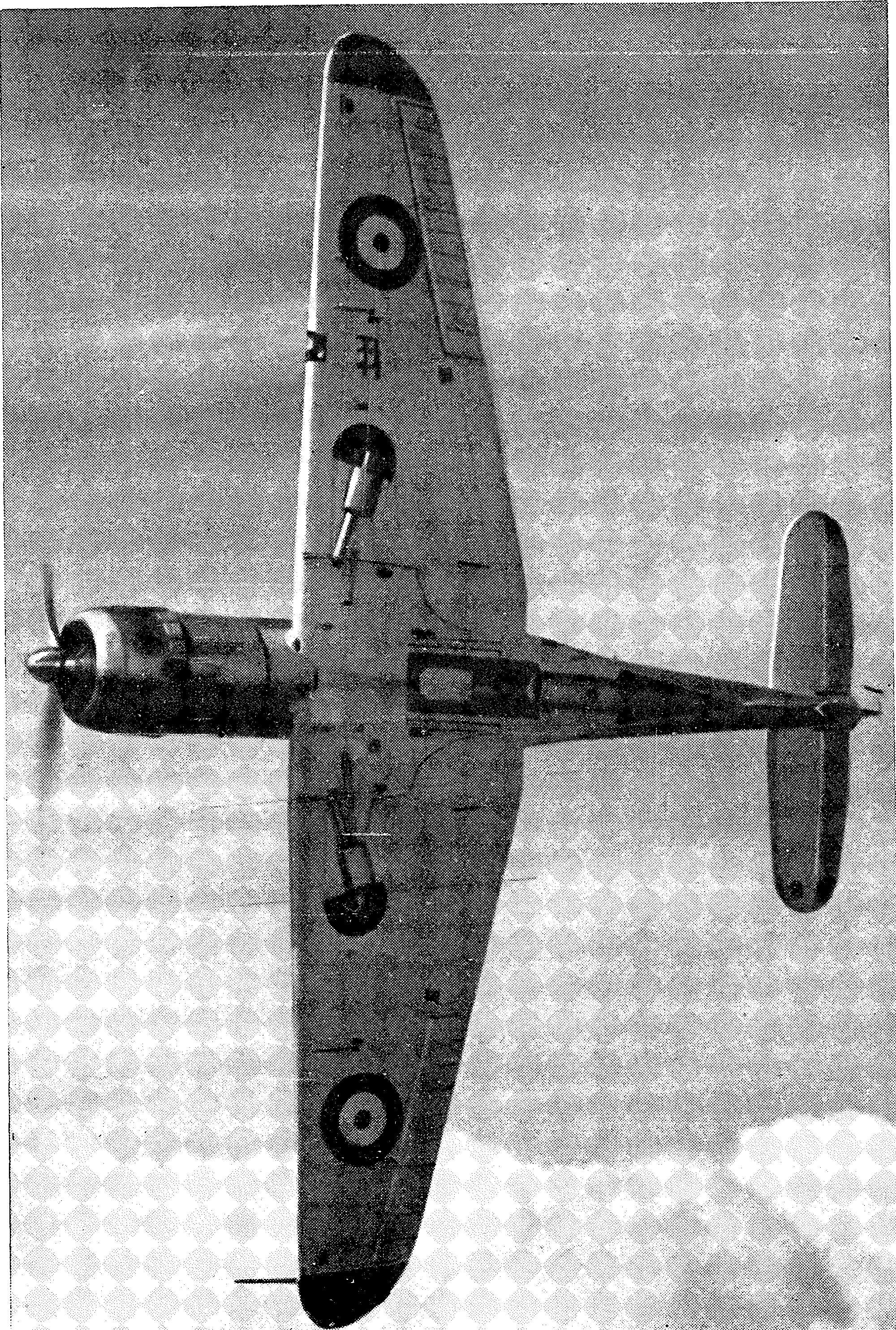
Engl. Jagd- und Sturzbomber Blackburn „Skua".
Archiv Flugsport
Engl. Jagd- und Sturzbomber Blackburn „Skua".
Ein bewegliches MG. im hinteren Beobachterraum. FT.-Empfangs- und Gebegerät im hinteren Sitz. Ebenso werden von dem Beobachter Landeleuchten,
Navigationsgeräte und
sonstige Marinesignalgeräte bedient.
Die hydraulische Einrichtung zur Betätigung der Landeklappen und des Fahrwerks besteht aus einer vom Motor angetriebenen Pumpe, Preßdruckbehälter und Bedienungseinrichtungen.
Motor Bristol Perseus XII. luftgekühlter Schiebermotor mit Dreiblatt-Versteilschraube. Startleistung 830 PS, Nennleistung 745 PS bei 2400 U/min in 1950 m. Zwei Haupttanks seitlich in der Kabine, ein Reservetank in dem vorderen wasserdichten Abteil.
Spannweite 14,07 m, Flügeltiefe 2,82 m, Länge 11,45 m, Höhe 4,31 m, Spurweite 2,92 m, Fläche 28,8 m2. Als zweisitziges Jagdflugzeug Leergewicht 2490 kg, max. Geschwindigkeit 362 km/h in 1950 m, in Seehöhe 329 km/h, Reisegeschwindigkeit in 4500 m 302 km/h, Landegeschwindigkeit 121 km/h, Dienstgipfelhöhe 6160 m.
USA Douglas-DB-7-Bomben
Douglas DB-7 ist ein Schulterdecker mit zwei Pratt-&-Whitney-R.-1830-SC-3-G-Motoren von je 900 PS in 3660 m Höhe. Ganzmetallbauweise. Motoren mit Verkleidung unter dem Flügel, so daß die Oberseite der Wölbung nicht unterbrochen ist.
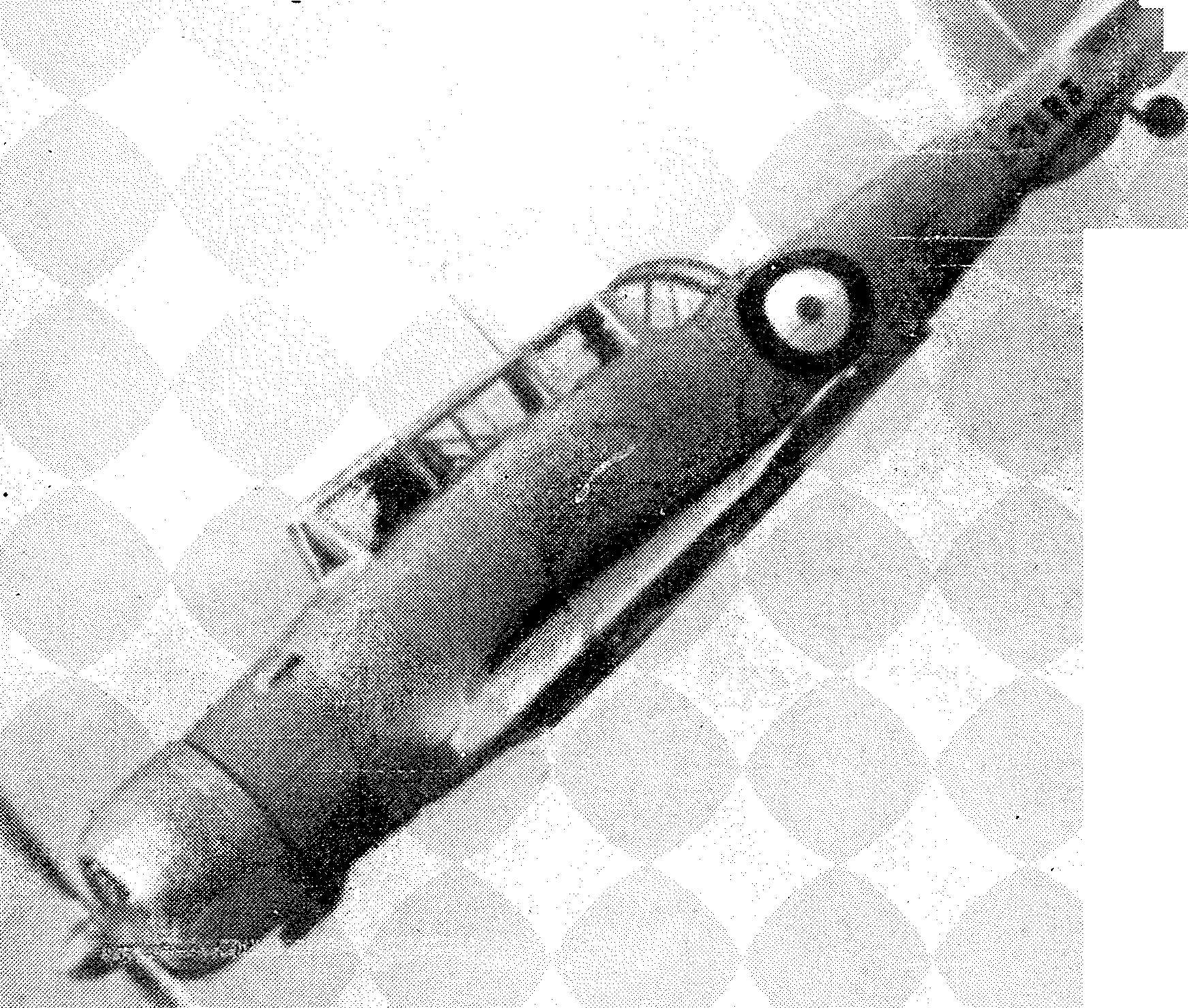
mm
USA Douglas DB-7-Bomber.
Archiv Flugsport

Douglas DB-7-Bomber mit Dreirad-Fahrwerk, wie er für Frankreich geliefert wird.
Rumpfnase mit Halbvollsichtkanzel. Kabinenaufbau sehr lang und schmal. Höhenleitwerk leicht V-förmig gestellt.
Dreibeinfahrwerk hochziehbar. Geschwindigkeit 480 km/h. Gipfelhöhe 7200 m voll belastet.
Tanken in der Luft.
Die Flächenbelastung von Langstreckenflugzeugen wird durch die erforderliche Kraftstoffmenge so hoch, daß ein sicherer Eigenstart nicht mehr möglich ist. Durch auftriebserhöhende Mittel, wie Spaltklappen, Doppelflügel usw., ist nur bis zu einer gewissen Grenze eine Verbesserung möglich. Zur Umgehung dieser Schwierigkeiten sind verschiedene Methoden entwickelt worden, von denen der Katapultstart und der Flugzeugstart (Short-Mayo) seit längerer Zeit im praktischen Flugbetrieb erprobt sind; neueren Datums hingegen ist die Kraftstoffübernahme nach erfolgtem Start in der Luft.
Die ersten Versuche zur Kraftstoffübernahme im Fluge wurden
Abb. la. Anflug des Tankers zum Tanken. Der Tanker fliegt mit geringer Geschwindigkeitsdifferenz an die von dem zu tankenden Flugzeug herabge- zu tankendes Flugzeug lassene Fangleine heran.
Ha kenleine
Fangleine
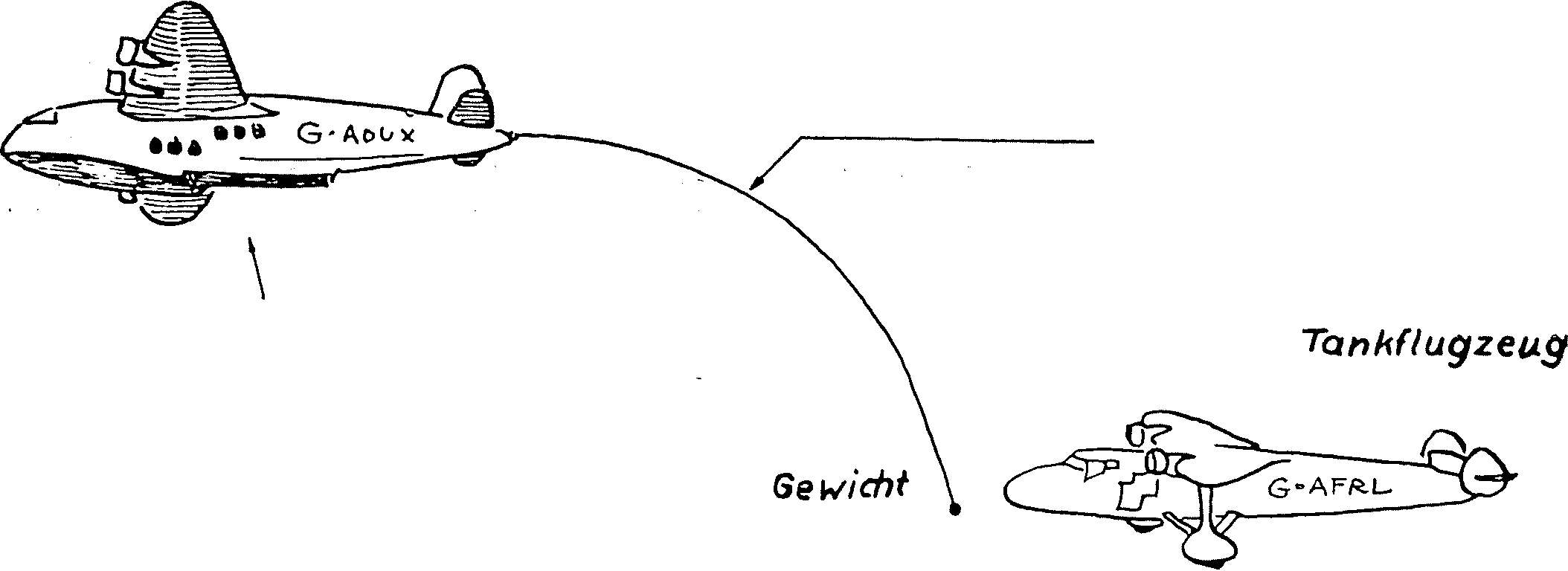
Abb. lc. Tankvorgang. Das Tankflugzeug hat während dem Einholen und Befestigen des Schlauches das zu tankende Flugzeug langsam überstiegen. Der Kraftstoff fließt nun mit natürlichem Gefälle von Maschine zu Maschine,
Zeichnungen Flugsport
Abb. Ib. Die Fangleine hat sich um die Flügel-Vorderkante des Tankers gelegt und gleitet gegen die Flügelspitze zu ab. Dort hängt sie sich in den Fanghaken, der dadurch ausgelöst wird. Hierauf kann das Ende der Fangleine mit der Hakenleine in das Tankflugzeug eingeholt werden.
Tanker

Schlauch
im Jahre 1933 in England von Cobham ausgeführt. Nach Gründung der „Flight Refuelling Ltd.u im Jahre 1934 ist das Verfahren laufend verbessert worden; gegenwärtig ist ein Entwicklungsstand erreicht, der eine Einführung beim Atlantikpostverkehr der Imperial Airways möglich macht. Zum Tanken der Short-Flugboote der „C"-Klasse sind vorerst 3 Handley Page „Harrows" mit den notwendigen Einrichtungen versehen worden. Die Hauptschwierigkeit bei dieser Methode besteht darin, eine sichere Verbindung zwischen den beiden Flugzeugen herzustellen, eine Aufgabe, die besonders bei böigem und unsichtigem Wetter nicht so ganz einfach zu lösen ist und an die Flugzeugbesatzungen hohe Anforderungen stellt.
Bei der von Cobham entwickelten sogenannten „Flügelspitzenmethode" läßt das zu tankende Flugzeug zunächst eine mit einem Gewicht versehene Leine aus, die bogenförmig nach unten durchhängt. Das Tankflugzeug nähert sich von hinten-unten und versucht, die Leine mit der Tragflügelvorderkante zu fassen (Abb. la—b). Oft ist ein wiederholtes Anfliegen zum Gelingen des Manövers erforderlich. Längs der Flügelvorderkante gleitet die Leine zur Flügelspitze, wo sie von einem Haken, der sich im Augenblick des Einhakens von der Flügelspitze löst, aufgefangen wird. Der Haken ist an einer kurzen Leine befestigt, mittels derer er in das Flugzeug hineingekurbelt wird. Nunmehr wird an der Leine des zu tankenden Flugzeuges das Konusstück des Kraftstoffschlauches befestigt, der auf ein Signal des Tankflugzeuges hin von dem anderen Flugzeug mittels Hand- oder Motorwinde eingeholt wird. Während dieses Manövers sucht der Tanker das aufnehmende Flugzeug zu überfliegen, so daß er sich jetzt hinten-oben und seitlich befindet
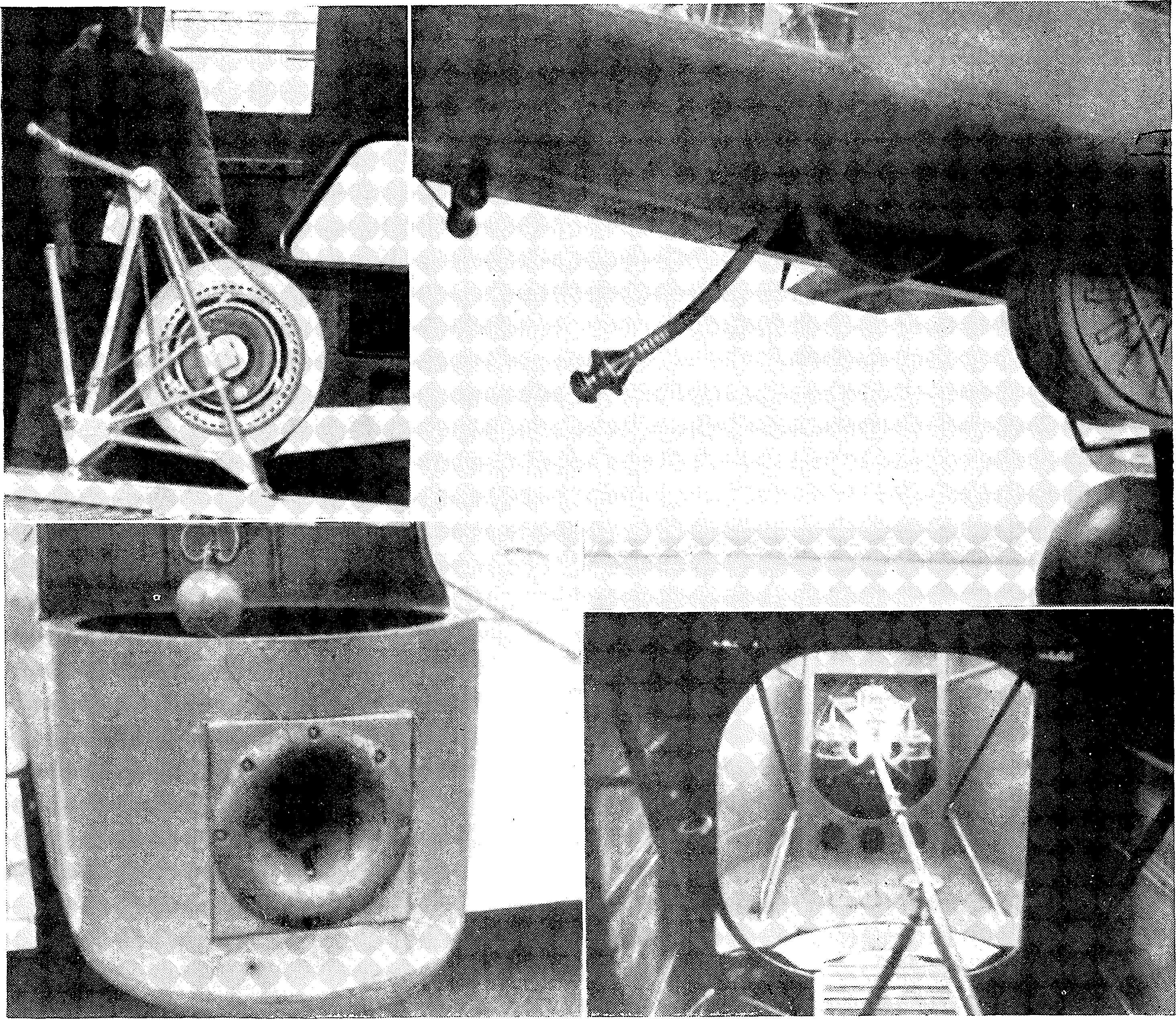
Tanken in der Luft. Oben Abb. 2 a u. b. Unten Abb. 3 u. 4.
(Abb. lc). Die Kraftstoffübernahme geht nun durch die Schwerkraft vor sich; auf diese Weise können in der Minute etwa 600 1 Kraftstoff getankt werden*). Die Short-Flugboote starten normalerweise mit einem Fluggewicht von 21 000 kg und nehmen nach dem Start noch 4600 1 = 3200 kg Kraftstoff auf. Für diese Menge ist eine reine Tankzeit von etwa 10 Minuten erforderlich.
Das Mundstück des Tankschlauches (Abb. 2b) wird in den Heckkonus (Abb. 3) eingeführt und durch eine hydraulisch betätigte Kupplung konzentrisch gehalten. Bei Ueberschreiten einer bestimmten Beanspruchung tritt automatisch eine Entkupplung ein, um ein Reißen des Schlauches zu verhindern. In dem in Abb. 4 im Rampf-innern verlaufenden Rohr wird die Einholleine zur Winde geführt; die Kraftstoffleitungen sind nicht montiert. n.
*) Bezogen auf eine lichte Weite des Tankschlauches von 2 Zoll; Länge des Schlauches etwa 60 m.
Ehrungen verdienter Kriegsteilnehmer und Beförderungen aus Anlaß des 25. Jahrestages des Kriegsbeginns und der Schlacht von Tannenberg hat der Führer mit dem 27. August vorgenommen. In der Luftwaffe erhalten den Charakter als Generalmajor die Obersten Ritter von Schleich, Freiherr von Bönigk, von Stutterheim, Müller-Mahle, Klein. Mit Wirkung vom 1. August werden befördert zum General der Flieger: der charakterisierte General der Flieger Thomson; zum General der Flakartillerie: der Generalleutnant Hirschbauer; zu Generalleutnanten: die Generalmajore Mayer, Wolff, Zenetti; zu Generalmajoren die Obersten Spieß, von Renz, Richter, Lindner.
Technische Hochschulen Berlin und München setzen ihren Lehr- und Forschungsbetrieb fort. Semester hat am 11. 9. 39 begonnen. An den übrigen Hochschulen werden nur noch die Prüfungen beschleunigt durchgeführt. Die Wehruntauglichen und die von der Wehrmacht noch nicht einberufenen Studenten werden aufgefordert, sofort ihr Studium an einer der genannten Hochschulen aufzunehmen und fortzusetzen.
Nachtpostflugzeug D-AFOP „Karl Hochmuth" in der Nacht vom 31. 8. Strecke Berlin—Hannover—Köln—London beim Abflug in Hannover verunglückt. Ums Leben kam die Besatzung: Flugkpt. Friedrich Ludwig, Flugmasch. Blazevic und Flugzeugfunker Ulbricht, ferner die sich an Bord befindenden Flugkapitäne Richard Schneider, A. Eichkorn und J. Höroldt, die sich dienstlich auf dem Wege nach Köln befanden.
A. Krogmann, bisher Generalsekr. von Generalfeldmarschall Göring, zum ordentl. Mitglied und Vizepräsident des Aero-Club von Deutschland ernannt.
Engl. King's-Cup-Rennen abgesagt.
392,584 km/h über 100 km auf Savoia 7, flog der italienische Pilot Dr. Parodi. Er übertraf damit die Leistung von Arnoux-Frankreich von 372,9 km/h auf Caudron, Klasse 6,5—9 1 Zylinderinhalt.
3o Mailänder Salon infolge internationaler Ereignisse abgesagt.
Fokker-Verkaufsbüro für Douglas, Verkaufsvertrag für DC-5, ausschließlich England, Frankreich und Rußland, abgeschlossen. Bis jetzt wurden von den Typen DC-2 und DC-3 100 Stück verkauft.
Flugverkehr Warschau—Bukarest—Sofia—Athen 4. 9. eingestellt.
Schwedisches Leistungsfliegen, unter Beteiligung der schwedischen Luftwaffe anläßlich des Jubiläums-Flugmeetings des schwed. Aeroclubs, findet vom 8.—10. Sept. in Malmö-Bulltofta statt.

UWDSCHAl
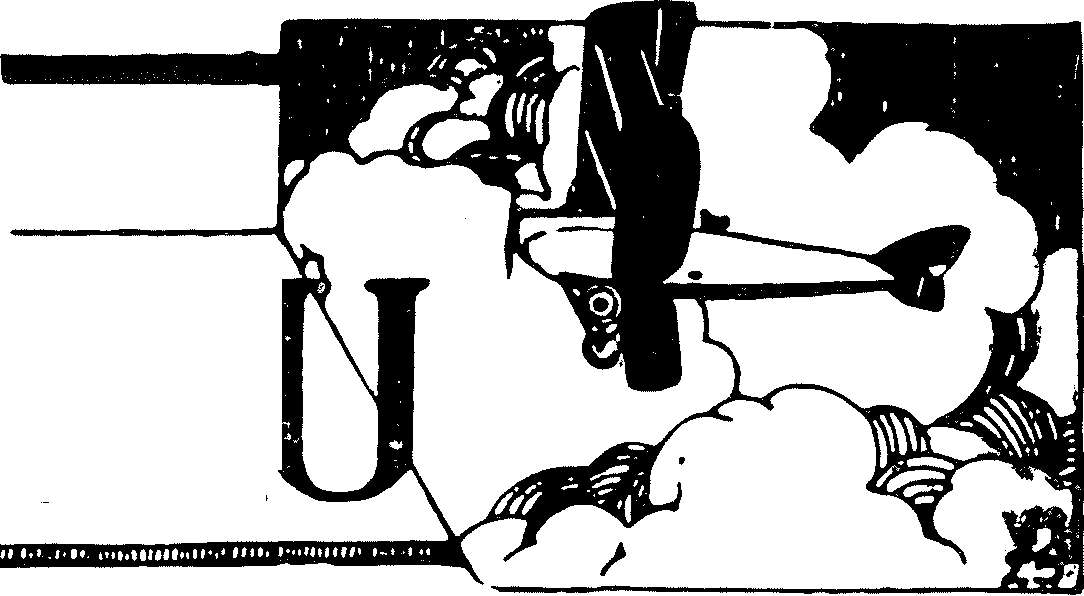
Inland.
Ausland.
Leichtflugzeug-Dauerflug mit Tanken in der
Luft von 343 h 47 min wurde von den Gebrüdern Hunter u. Humphrey Mooddy in Springfield, Illinois, ausgeführt. Wie die nebenstehende Abbildung zeigt, erfolgte die Versorgung des Flugzeuges mit einem in gleicher Geschwindigkeit fahrenden Auto, wobei der Brennstoffbehälter mit einem Seil gefangen und hochgezogen wurde. Die frühere Höchstleistung betrug 218 h 43 min.
Leichtflugzeug - Dauerflug mit Tanken in der Luft in Springfield, Illinois.
Weltbild
404,936 km/h-Geschwindigkeit über 5000 km erreichte ein sowjetrussisches Flugzeug „Stal 7", Besatzung: Flugzeugführer Baikussow, Quebanow und Met-wejew, bei einem Flug von 12 h 30 min 56 sec auf der 5068 km langen Flugstrecke Moskau—Swerdlowsk—Sebastopol—Moskau.
Moschkowsky, russ. Fliegermajor, der 1937 an einem Nordpolflug teilnahm, mit einem Dienstflugzeug verunglückt.
36-ZyL-Wright, viermal 9 Cyclone-Sterne, in der Entwicklung.
Douglas-DB-7-Bomber, mit Dreirad-Fahrwerk für die franz. Armee, ist der erste in Frankreich eingetroffen. Vergleiche die Abbildung. Motoren, zwei Pratt & Whitney Twin Wasp SC 3-G von je 900 PS. Geschwindigkeit wird mit 480 km/h angegeben.
Luftwaffe.
Tagesbefehl an die Luftwaffe!
Soldaten der Luftwaffe! Kameraden!
Wochen und Monate habt Ihr mit geballten Fäusten und zusammengebissenen Zähnen die unerhörten und unglaublichen Provokationen erlebt, die ein dem Wahnsinn des Versailler Diktats entsprungenes Staatsgebilde dem Großdeutschen Reich zu bieten wagte. Das Maß ist voll! Nicht länger mehr kann das deutsche Volk dem verbrecherischen Treiben zusehen, dem schon Hunderte und Tausende unserer Volksgenossen in den ehemaligen deutschen Ostprovinzen zum Opfer fielen. Jedes weitere Zögern wäre jetzt gleichbedeutend mit der Aufgabe der heiligen Lebensrechte der deutschen Nation.
Kameraden! Der Führer hat gerufen! Eure große Stunde ist da. Die Luftwaffe — jahrelang wirksamstes Instrument der Friedenspolitik des Führers — hat nun zu beweisen, daß sie in dem entscheidenden Augenblick zur Erfüllung ihrer gewaltigen Aufgaben zur Stelle ist. Grenzenlos ist das Vertrauen des Führers und des deutschen Volkes zu Euch. Als Euer Oberbefehlshaber bin ich stolz und glücklich darüber, denn ich weiß mit felsenfester Gewißheit, daß jeder einzelne unter Euch sich dieses Vertrauens in jeder Weise würdig zeigen wird.
Flieger! In blitzschnellem Zupacken werdet Ihr den Feind vernichten, wo er sich zum Kampfe stellt oder in der Auflösung zurückflutet. Ihr werdet jeden Widerstand zermürben und zerbrechen mit letztem opferfreudigem Einsatz.
Männer der Bodenorganisation! Ihr werdet freudig und gewissenhaft den Einsatz und die Sicherheit Eurer Kameraden in der Luft vorbereiten und gewährleisten.
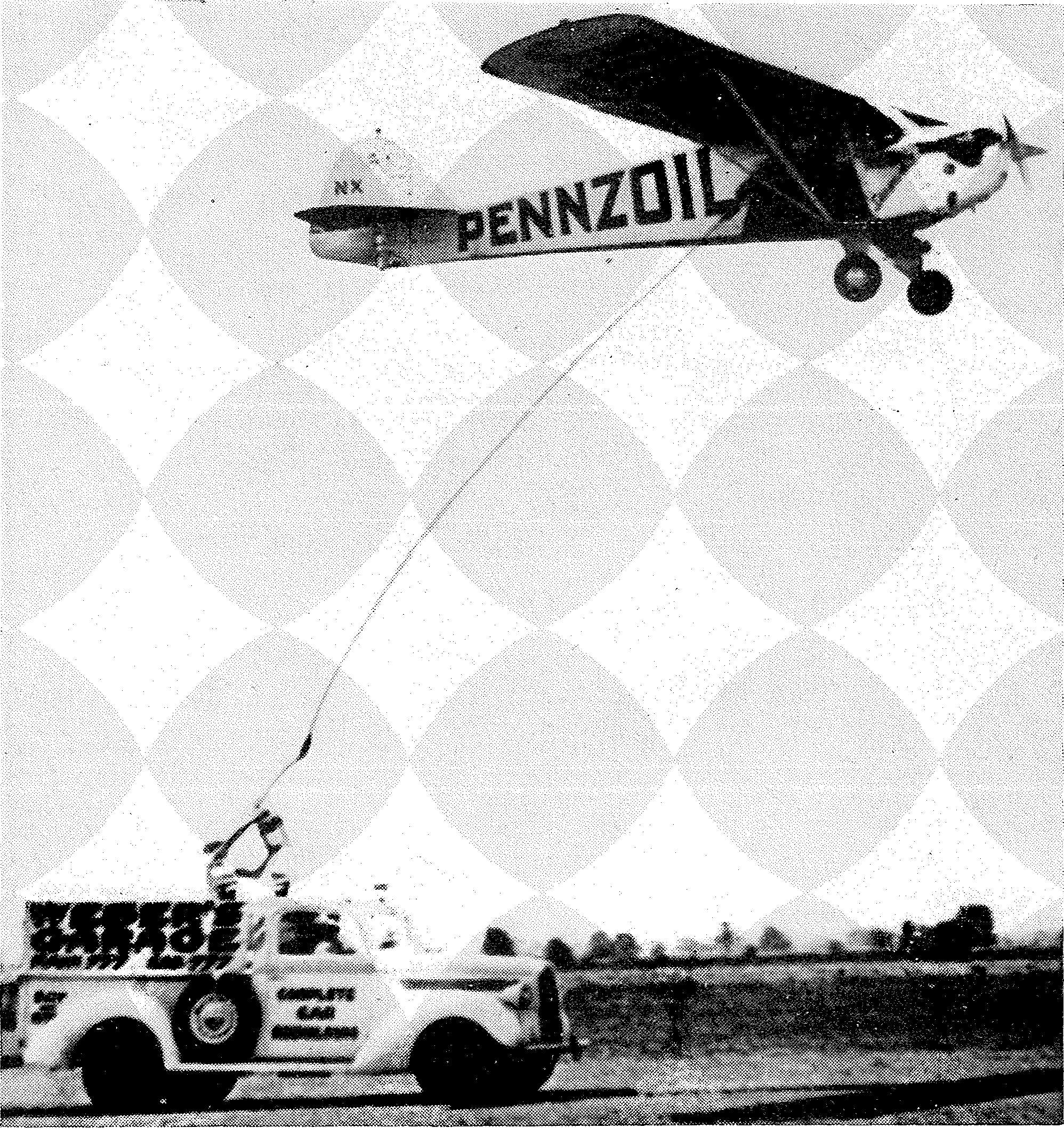
Flakartilleristen! Ihr werdet jeden Angreifer herunterholen! Jeder Schuß aus Euren Geschützen wird dem Leben Eurer Frauen, Mütter und Kinder, wird dem ganzen deutschen Volke die Sicherheit verbürgen.
Funker! Ihr seid die Träger des raschen und reibungslosen Zusammenwirkens in unserer Waffe. Ihr gebt unserer Waffe die Möglichkeit, den eigenen alles überrennenden Angriff voranzutragen und den feindlichen Gegenstoß rechtzeitig abzufangen und zum Scheitern zu bringen.
Kameraden! Jedem von Euch blicke ich jetzt ins Auge und verpflichte jeden von Euch, alles zu geben für Volk und Vaterland. An Eurer Spitze unser geliebter Führer, hinter Euch die ganze im Nationalsozialismus geeinte deutsche Nation. Da gibt es für uns nur eine Losung: Sieg!
1. September 1939.
Hermann Göring,
Generalfeldmarschall.
Berlin, 1. 9. 39. Oberkommando d. Wehrmacht gibt bekannt: Auf Befehl des Führers und Obersten Befehlshabers hat die Wehrmacht den aktiven Schutz des Reiches übernommen. In Erfüllung ihres Auftrages, der polnischen Gewalt Einhalt zu gebieten, sind Truppen des deutschen Heeres heute früh über alle deutschpolnischen Grenzen zum Gegenangriff angetreten. Gleichzeitig sind Geschwader der Luftwaffe zum Niederkämpfen militärischer Ziele in Polen gestartet. Die Kriegsmarine hat den Schutz der Ostsee übernommen. Im Zuge der deutschen Kampfhandlungen aus Schlesien, Pommern und Ostpreußen wurde an allen Fronten schon heute die erwarteten Anfangserfolge erzielt.
Die deutsche Luftwaffe hat heute in wiederholten kraftvollen Einsätzen die militärischen Anlagen auf zahlreichen polnischen Flugplätzen, so z. B. Rahmel, Putzig, Graudenz, Posen, Plock, Lodz, Tomaszow, Radom, Ruda, Kattowitz, Krakau, Lemberg, Brest, Terespol, angegriffen und zerstört. Außerdem unterstützten mehrere Schlachtgeschwader wirkungsvoll das Vorwärtskommen des Heeres. In Gdingen wurde der Kriegshafen durch die Luftwaffe bombardiert. Die deutsche Luftwaffe hat sich damit heute die Luftherrschaft über dem polnischen Raum erkämpft, obwohl starke Kräfte in Mittel- und Westdeutschland zurückgehalten wurden.
London, 2. 9. 39. DNB.: Im scharfen Widerspruch zu der von der polnischen Telegraphenagentur im Ausland verbreiteten Darstellung über den Einsatz der deutschen Flieger stellt eine Warschauer Reuter-Depesche jetzt ausdrücklich fest, daß bei dem gestrigen Vorgehen der deutschen Luftwaffe gegen die polnische Hauptstadt nur militärische Ziele mit Bomben belegt worden sind. Obwohl die deutschen Maschinen infolge des polnischen Abwehrfeuers in ziemlich großer Höhe operieren mußten, hätten sich die deutschen Flieger — so heißt es in der englischen Meldung — sehr sorgfältig an den ausdrücklichen Befehl des Führers zur Schonung der Zivilbevölkerung gehalten. Bekanntlich hatte das Reuterbüro vorher schon in einer allgemein gehaltenen Meldung die Beobachtung seiner Berichterstatter in Polen bemerken müssen, daß die deutsche Wehrmacht keine Bomben auf die Zivilbevölkerung abwerfe.
Berlin, 2.9.39. Oberkommando d. Wehrmacht: Die deutsche Luftwaffe hat heute blitzschnelle und wuchtige Schläge gegen militärische Ziele in Polen geführt. Zahlreiche polnische Flugzeuge wurden im Luftkampf vernichtet. Auf der Erde wurde eine große Anzahl von Militärfliegerhorsten angegriffen, insbesondere bei Gdingen, Krakau, Lodz, Radom, Demblin, Brest-Terespol, Lublin, Luck, Golab, Warschau-Okecie, Posen-Lawica. Die in den Hallen und auf den Rollfeldern befindlichen Flugzeuge gingen in Flammen auf. Ferner wurden an den wichtigsten Bahnlinien Gleisanlagen zerstört sowie Militärtransporte zum Entgleisen gebracht und im Rückmarsch befindliche Marschkolonnen mit Bomben belegt. Die Munitionsfabrik Skarzysko-Kamienna flog nach einem Angriff in die Luft. Nach den Erfolgen des heutigen Tages ist damit zu rechnen, daß die polnische Fliegertruppe in ihrem Bestand aufs schwerste getroffen ist.
Marinefliegerverbände griffen mehrfach den Kriegshafen Gdingen mit Bomben an.
Die deutsche Luftwaffe hat die uneingeschränkte Luftherrschaft über dem gesamten polnischen Raum und steht nunmehr für weitere Aufgaben zum Schutze des Reiches zur Verfügung.
Nach der entscheidenden Wirkung des Einsatzes der deutschen Luftwaffe am 2. September beherrschten die Divisionen der beiden gegen Polen eingesetzten Luftflotten uneingeschränkt den polnischen Luftraum und stehen wieder einsatz-
bereit in ihren Absprunghäfen. Die Einheiten der bisher nicht eingesetzten Luftflotten stehen wie bisher in ihren Fliegerhorsten bereit.
Ueber Warschau wurde am Sonntag, 3. 9., ein Luftkampf ausgetragen, bei dem 7 polnische Flugzeuge und 1 polnischer Ballon abgeschossen wurden. Keine eigenen Verluste.
Berlin, 4. 9. 39. Oberk. d. Wehrm.: Die deutsche Luftwaffe führte im Laufe des 3. Septembers vermehrt ihre Angriffe auf militärisch wichtige Verkehrsanlagen und größere Truppentransporte durch. Der wiederholte Einsatz von Flak und Sturzkampffliegern trug zu dem raschen Erfolg der aus Schlesien vorgehenden Truppen bei. Die Bahnverbindungen Kutnau—Warschau, Krakau—Lemberg, Kielce— Warschau, Thorn—Deutsch-Eylau wurden zerstört. Es sind zahlreiche Zugentgleisungen, Brände und Explosionen von Zügen festgestellt. Der Bahnhof Hohen-salza liegt in Trümmern. In Okecie bei Warschau wurde das dortige Flugzeugwerk schwer beschädigt. Die dort von den Polen bereitgestellten Reserveflugzeuge wurden vernichtet.
Luftangriffe gegen Gdingen und Heia wurden erneuert und brachten hierbei den polnischen Zerstörer „Wicher" zum Sinken. Der Minenleger „Gryf" wurde schwer beschädigt.
Berlin, 4. 9. 39. In der Nacht vom 3. zum 4. 9. machten englische Flugzeuge den Versuch, in großer Höhe über die holländische Grenze kommend, auf deutsches Reichsgebiet vorzustoßen. Die Flugzeuge wurden durch die deutsche Abwehr zurückgetrieben, nachdem es einigen gelungen war, etliche Flugblätter abzuwerfen.
Hierzu wird von holländischer Seite amtlich gemeldet:
Den Haag, 8. 9. 39. Das Pressebüro der Regierung teilt mit, daß in der Nacht zum Montag Flugzeuge ausländischer Nationalität über Holland gemeldet wurden. Die Nationalität der Apparate konnte nicht festgestellt werden, da sie über den Wolken flogen. Es war unmöglich, das Feuer auf sie zu eröffnen. In diesem Zusammenhange macht die niederländische Regierung auf den ernsten Charakter dieser Neutralitätsverletzung Hollands, dessen Neutralität von beiden Parteien garantiert ist, aufmerksam. Sie wird die beiden Parteien auffordern, eine Untersuchung einzuleiten, um festzustellen, ob es ihre Apparate sind, die diese Verletzung begingen. Im Falle einer affirmativen Antwort wird die Regierung verlangen, daß Maßnahmen zur Vermeidung weiterer derartiger Zwischenfälle getroffen werden.
Berlin, 4. 9. 39. Das britische Informationsministerium bestätigte am Montagabend (4. 9.) in einer amtlichen Verlautbarung, daß englische Flugzeuge den Versuch unternommen haben, in der Nacht vom Sonntag zum Montag auf deutsches
Englands Nichtachtung der Neutralität! Im westlichen Norwegen stürzte am Freitagnachmittag (1. 9. 39) erneut ein britisches Militärflugzeug ab, diesmal im Sognefjord. Die drei Flieger wurden gerettet, während die Maschine völlig vernichtet wurde. Links: Die drei britischen Flieger, die sich auf ein Schlauchboot gerettet hatten, werden von dem Ruderboot des Dampfers übernommen. Rechts: Die drei geretteten britischen Flieger an Bord des Dampfers, der ihnen zu Hilfe eilte. Zweiter von links der Kapitän des Dampfers. Weltbild
Reichsgebiet vorzustoßen und daß es diesen Flugzeugen gelungen sei, Flugblätter abzuwerfen. Durch diese Mitteilung bestätigt das Informationsministerium, daß englische Flieger unter Verletzung der holländischen Neutralität in der Nacht zürn Montag Holland überflogen haben.
Berlin, 4. 9. 39. Der dänische Außenminister Münch empfing heute Abend den deutschen Gesandten von Renthe-Fink, um ihm mitzuteilen, daß ein Bombenflugzeug gegen 17 Uhr die dänische Stadt Esbjerg überflogen und dort zwei Bomben habe fallen lassen, die ein Haus zertrümmerten. Eine Erkennung der, Nationalität des Flugzeuges sei nicht möglich gewesen. Die Bombensplitter würden erst noch untersucht.
Der deutsche Gesandte hat sogleich mit aller Klarheit und Bestimmtheit dargelegt, daß es sich um kein deutsches Flugzeug gehandelt h^ben kann, da die deutsche Luftwaffe vom Führer den Befehl erhalten hat, die Unverletzlichkeit des Gebiets der neutralen Länder peinlichst zu achten.
Wie inzwischen festgestellt worden ist, hat sich überhaupt kein deutsches Flugzeug über Jütland befunden. Diese Tatsache ist der dänischen Regierung unverzüglich mitgeteilt worden. Der Bombenabwurf muß daher mit aller Eindeutigkeit als englischer Provokationsversuch vor der Oeffentlichkeit gebrandmarkt werden.
Wilhelmshaven, 5. 9. 39. Nachdem am Sonntag (3. 9) bereits englische Bomber und Aufklärungsflugzeuge sich der deutschen Nordseeküste genähert hatten, aber vorerst noch den außerordentlich stark geschützten Abwehrgürtel gemieden hatten, versuchten bekanntlich am Montagabend gegen 18 Uhr etwa 10 bis 12 zweimotorige englische Bomber von dem modernsten Typ Vickers, einen Angriff auf die Mündungen an der Jade, Weser und Elbe.
Mit unüberwindbarem Angriffsgeist gingen die deutschen Jäger an die englischen Bomber heran und trieben sie systematisch in das Abwehrfeuer der Flak hinein. Insgesamt wurden von den 10 bis 12 englischen Bombern mit Sicherheit 8 abgeschossen, wahrscheinlich aber noch mehr. Darüber hinaus wurde die Besatzung eines englischen Bombers, der sich an dem Angriff beteiligte, gefangen genommen, nachdem der Pilot im Luftkampf getötet worden war. Ohne auch nur den geringsten Schaden anrichten zu können, ist der englische Angriff mit den schwersten Verlusten für den Gegner, der fast völlig aufgerieben wurde, abgeschlagen worden.
Die Angreifer versuchten, sich in südwestlicher Richtung dem Flakfeuer zu entziehen und nahmen Kurs auf holländisches Hoheitsgebiet.
Die Bombenabwürfe richteten keinen Schaden an, da sie im stärksten Abwehrfeuer stattfanden.
Berlin, 5. 9. 39 Am Montagnachmittag (4. 9.) wurden bei einem Luftkampf in der Nähe von Lodz von einer einzigen deutschen Jagdstaffel 4 Bomben- und 2 Jagdflugzeuge der Polen abgeschossen. Darauf versuchte der dort auf der Erde befindliche polnische Fliegerverband, seinen Flughafen beschleunigt zu verlassen. Ein Teil der deutschen Jagdflieger griff die startenden Flugzeuge an. Neun polnische Maschinen blieben kampfunfähig am Boden. Die deutsche Jagdstaffel, die somit insgesamt 15 polnische Flugzeuge vernichtete, kehrte ohne Verluste heim.
Berlin, 5. 9. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe beherrscht den Luftraum. 40 polnische Flugzeuge, darunter 15 im Luftkampf, wurden abgeschossen. In zunehmendem Maße wird durch die Luftangriffe auf feindliche Marsch- und Eisenbahnkolonnen ein planmäßiger Rückzug des Gegners vereitelt.
Berlin, 5. 9. 39 DNB.: In den Luftkämpfen des heutigen Vormittags im Räume Warschau—Lodz wurden 11 polnische Flugzeuge abgeschossen.
Berlin, 5. 9. 39. Der polnische Rundfunk hatte die gesamte Bevölkerung Polens aufgefordert, die Landungen deutscher Fallschirmtruppen abzuwehren. Der englische Rundfunk nimmt diese Nachricht auf und teilt zugleich mit, daß im Verlauf von Kampfhandlungen 31 deutsche Fallschirmjäger vom polnischen Militär gefangengenommen und sofort hingerichtet worden sind. Polen betrachte diese Fallschirmtruppe als Spione und würde sie entsprechend behandeln.
Berlin, 6. 9. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Die Angriffe der deutschen Luftwaffe haben am gestrigen Tage (5. 9.) wiederum starke Störungen der feindlichen Verkehrslinien und rückwärtigen Verbindungen bewirkt. Die Bahnhöfe Zdunska-Wola, Skarzysko, Tarnow und Wreschen brennen. Zahlreiche Bahnstrecken sind unterbrochen. Die polnische Fliegertruppe ist mit Ausnahme einzelner Jäger bei Lodz überhaupt nicht mehr in Erscheinung getreten.
Luftangriffe auf deutsches Hoheitsgebiet fanden am 5.9. an keiner Stelle
statt.
Brüssel, 7. 9. 39: DNB.: Wie die Morgenblätter melden, wurden am Mittwochabend mehrere Flugzeuge „unbekannter" Nationalität über Antwerpen signalisiert. Die Ueberfliegungszeit war 22.10 Uhr. Die Flugzeuge bewegten sich in Richtung Südwesten. Nähere Einzelheiten sind vorläufig nicht bekannt.
Tagesbefehl an die Luftwaffe v. 7. 9. 39 des Oberbefehlshabers der Luftwaffe Generalfeldmarschall Göring: „Soldaten der Luftwaffe! Nach schnellen, vernichtenden Schlägen ist die Luftherrschaft der Ostfront euer. Kein feindliches Flugzeug vermochte die Verteidigung des deutschen Luftraumes anzutasten. In treuer Kampfverbundenheit und schnell entschlossener Einsatzbereitschaft habt ihr hervorragenden Anteil an dem raschen Vordringen des deutschen Heeres genommen. Ihr habt das Recht, auf die Erfolge stolz zu sein. Ich danke euch und mit mir das deutsche Volk, das mehr denn je in unbeirrbarem Vertrauen auf seine Luftwaffe blickt. Unser Führer und Oberster Befehlshaber ist bei euch an ■der Ostfront. Unter seinen Augen weiter vorwärts. Göring."
Berlin, 8. 9. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Deutsche Truppen am 8. 9., 17.15 Uhr, in Warschau eingedrungen. Deutsche Panzertruppen haben an der Straße Tomaszow—Warschau feindlichen Widerstand nach kurzem heftigem Kampf gebrochen und sind im raschen Vordringen auf die polnische Hauptstadt. Noch am Vormittag wurde der Ort Mszconow erreicht.
An diesen schnellen und großen Erfolgen hatte die Luftwaffe wieder entscheidenden Anteil. Ihr Masseneinsatz richtete sich gegen die zurückgehende polnische Armee. Sie griff mit Schlacht- und Sturzkampfgeschwadern unmittelbar in den Kampf ein. Marschkolonnen wurden zersprengt, Rückzugswege durch Zerstörung von Brücken und Uebergängen versperrt, Versuche von feinlichen Gegenangriffen schon in ihrer Bereitschaft zerschlagen.
Die Weichselbrücken südlich Warschau sind nachhaltig zerstört. In Warschau sind die Durchgangsstraßen mit Kolonnen angefüllt und verstopft. Die eilige Räumung der Stadt ist im Gange.
Zwei deutsche Flugzeuge wurden über polnischem Gebiet abgeschossen; ein Flugzeug wird vermißt. Das deutsche Hoheitsgebiet wurde auch gestern (7. 9.) nicht angegriffen.
Kopenhagen, 8. 9. 39. DNB.: Aus in der Nacht in Kopenhagen eingelaufenen Meldungen aus Nordschleswig und Südjütland geht hervor, daß sich die englische Flugwaffe schon wieder eine Verletzung der Neutralität Dänemarks hat zuschulden kommen lassen. Dieser neue Uebergriff ist einwandfrei bewiesen.
Berlin, 9. 9. 39. Französische Aufklärungsflugzeuge versuchten heute Erkundungsflüge diesseits der Grenze durchzuführen. Sie wurden durch unsere Jagdflugzeuge und durch Flakartillerie abgewehrt. Drei französische Flugzeuge wurden abgeschossen. Auf einem deutschen Flugplatz landete ein französisches Kampfflugzeug. Drei Offiziere wurden gefangen genommen.
Berlin, 10.9.39. Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe hat die von Warschau nach Ost- und Südost zurückführenden Straßen und Eisenbahnen durch Bombenangriffe blockiert und die in diesem Räume noch vorhandenen Reste der polnischen Bodenanlagen angegriffen. Bei einem Unternehmen gegen Lublin wurden von einem gemischten Kampf- und Zerstörerverband 7 polnische Flugzeuge im Luftkampf abgeschossen, 8 polnische Flugzeuge am Boden durch Bombenabwurf schwer beschädigt. Zur Unterstützung des Heeres griffen Fliegerverbände im Räume um Radom sowie zwischen Narew und Bug wirkungsvoll in den Kampf ein.
In der Nacht zum 9.9. warfen britische Flugzeuge über einigen Städten Nord- und Westdeutschlands Flugblätter ab. Die Besatzung eines bei Ueberstedt (Thüringen) abgestürzten englischen Kampfflugzeuges wurde gefangen genommen.
USA-Segelfluggelände Chicago für mehrere Chicagoer Segelflugklubs am 20. 8. in Benutzung genommen.
USA-Segelflugveranstaltung Frankfort, Michigan, vom 26. 8. bis 5. 9.

Segelflug
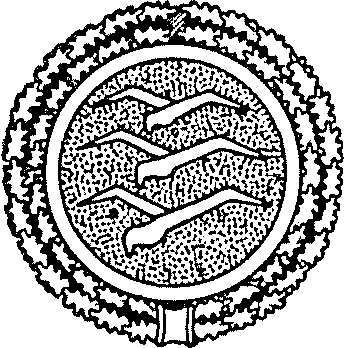
Belg, internationale Modellwettbewerbe von Arlon und Frasnes abgesagt.
Reichswettbewerb für Motor-Flugmodelle Borkenberge 27. 8., 450 Teilnehmer; erschienen waren viele Neukonstruktionen von NSFK. und HJ. Auffallend war der Einfluß der FAI-Formel, die zur Konstruktion von leichten Modellen geführt hatte. Die neuen Modelle sind kürzer und gedrungener. Spannweite bewegt sich zwischen 1,2—2 m gegenüber 3 m in früheren Jahren. Das leichte Baugewicht ermöglichte die Verwendung größerer Gummimotoren und die Ausnutzung geringer Thermikwinde. Man erkannte auch das Bestreben der Flugmodellbauer, größere Steiggeschwindigkeit zu erreichen. Bei den FAI-Flugmodellen wurde nur die reine Flugzeit gewertet.
Hitlerjunge Kermes (München, Gr. 14) erreichte mit einem FAI-Flugmodell mit Bodenstart eine neue Höchstleistung von 17 min 47 sec und gewann damit die goldene Plakette des Korpsführers des NS-Fliegerkorps, General Christiansen. Eine zweite Höchstleistung gab es in der Klasse für Wasserflugmodelle, in der die alte Bestleistung von 7 min um mehr als das Doppelte verbessert werden konnte. NSFK.-Mann Hebel (Hannover, Gr. 9) erreichte mit seinem Wasserflugmodell die erstaunliche Zeit von 14 min 42 sec. Er erhielt somit die silberne Plakette des Korpsführers. Dieselbe Auszeichung wurde dem Hitlerjungen Otto Aldinger (Stuttgart, Gr. 15) verliehen in der Klasse der Normalflugmodelle mit einer Flugdauer von 12 min 9 sec.
Viel beachtet wurden die Schwingenflugmodelle mit Benzinmotoren, die jedoch ungenügend eingeflogen waren. Der Wettbewerb wurde am 27. 8. vorzeitig beendet.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Modellbau-Bogen vom Verlag Josef Sperl, Wien 4, Wiedner Hauptstr. 66.
Rumpfmodell „Lerche" von A. Scholz. Preis RM —.80. Gummimotormodell, Spannweite 840 mm, Länge 680 mm, mit Baubeschreibung.
Hochleistungssegelflugmodell „Condor" von Josef Sperl. Pr. RM 1.60. Knickflügel, Spannweite 2050 mm, Länge 1410 mm, mit Baubeschreibung.
Segelflugmodell „Der kleine Reiher" von V. Darmann. Pr. RM —.90. Spannweite 1000 mm, Länge 754 mm, mit Baubeschreibung.
Schülersegelflugmodell „Zögling" von Josef Sperl. Pr. RM —.60. Pfeil- und V-förmig, Spannweite 800 mm, Länge 610 mm, mit Baubeschreibung.
Segelflugmodell „Habicht" von Josef Sperl. Pr. RM —.60. V-Form, Spannweite 900 mm, Länge 680 mm, ohne Baubeschreibung.
Leistungs-Segelmodell „Albatros" von Josef Sperl. Pr. RM 1.—. V-förmig mit Doppelknick nach oben, Spannweite 1300 mm, Länge 920 mm, ohne Baubeschreibung.
Segelflugmodell „Großer Albatros" von Josef Sperl. Pr. RM 1.20. Flügel Doppelknick, V-förmig, Spannweite 2000 mm, Länge 1360 mm. Uebersichtszeich-nung mit Zuschnittblatt, ohne Baubeschreibung.
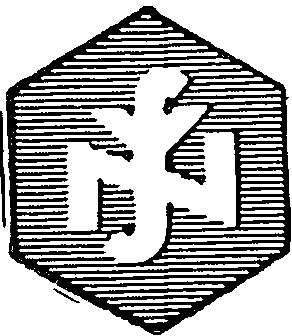
Sie nSt-Oolhotoohlffthtt
ift Der Garant Des fofialiftifdicn
Willens Der. HSOpp«
ADOLF-HITLERINGENIEURSCHULE
Maschinenbau, Elektrotechn., Hoch-u.Tiet-bau.Kraft-u.Luftfahrt. Eig.Lehrwerkstätten == Staatlich anerkannt ■==
\ FRIEDBERG — HESSEN
INGENIEURSCHULE
■ II MASCHINENBAU . ELEKTRO III TECHNIK AUTOMOBIL- UND III FLUGZEUGBAU.. , III " PROSPEKT ANFORDERN
WEIMAR;
SEME STE R B E Gl N N ^ APRIt UNft OKTOBER EIGENE WERKSTÄTTEN '
BirkervFIugzeug/ Sperrholzplatten
deutsches Fabrikat
bei Rekordflügen erprobt, in den Qualitäten: AVIATIC, SPEZIAL, GLEITFLUG in allen Stärken von 0,4-8 mm liefert prompt ab Lager
Georg Herte Berlin$Charlottenburg
Kaiser Friedrich-Straße 24 Fernspr.-Sammelnummer: 34 5841 Tslgr.-Adr.: Flieeerhölzer Berlin
„FLUGSPORT"
|&®»chinenbau / Automobil- w. Flugtechnik I Elektrotechnik. Programm kostenlos I
ernschule für
F
lugzeugbau
Tbeoret. Vorbereitung für Bauprüf er t Flugzeugführer, Ingenieure sowie für den gesamten Flugdienst. Sonderlehr-gängefür JungfHeger. Abschlußprüfungen - Abschlußzeugnisse. Studien-progr. Nr. 145 durch das Sekretariat.
Fernschule G.m.b.H. BerlinWlS
— Kurfiirstendamm 66 p. =
Fallschirme
aller Art
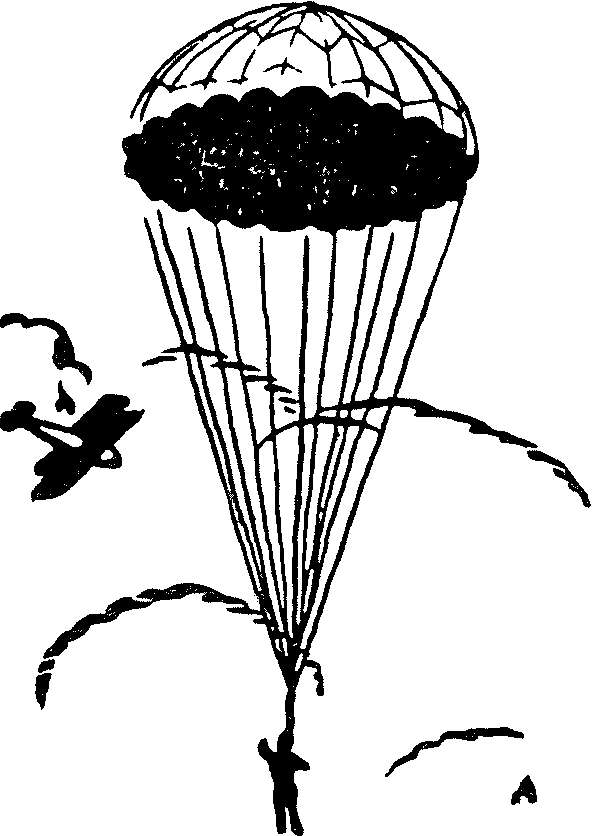
SCHROEDER & CO.
lScrliii-[\cuköllii
Bergstraße 93-93
"JLlteste Flugzeuge Fallsdiirm-Fabrik der Weh
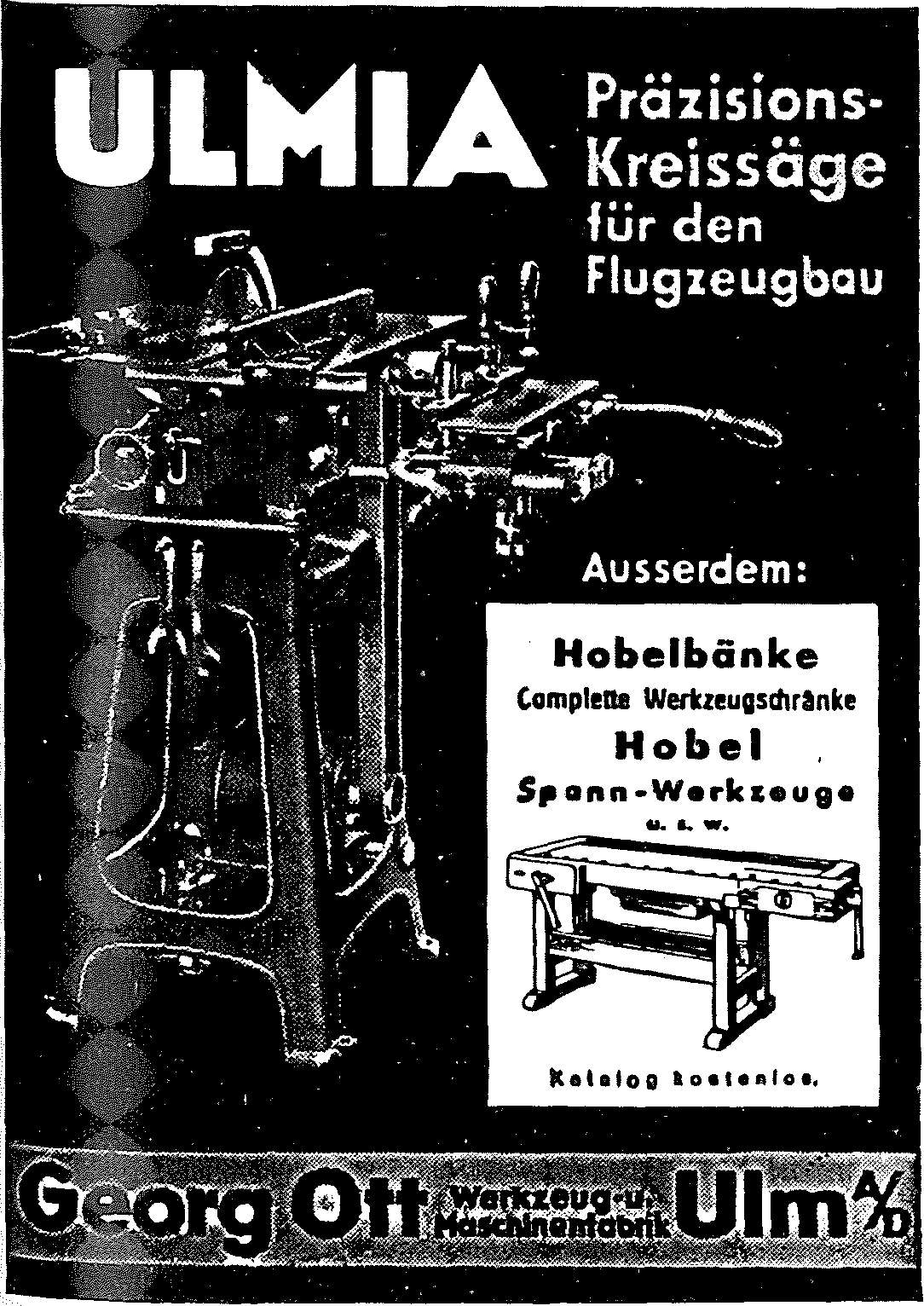
Der
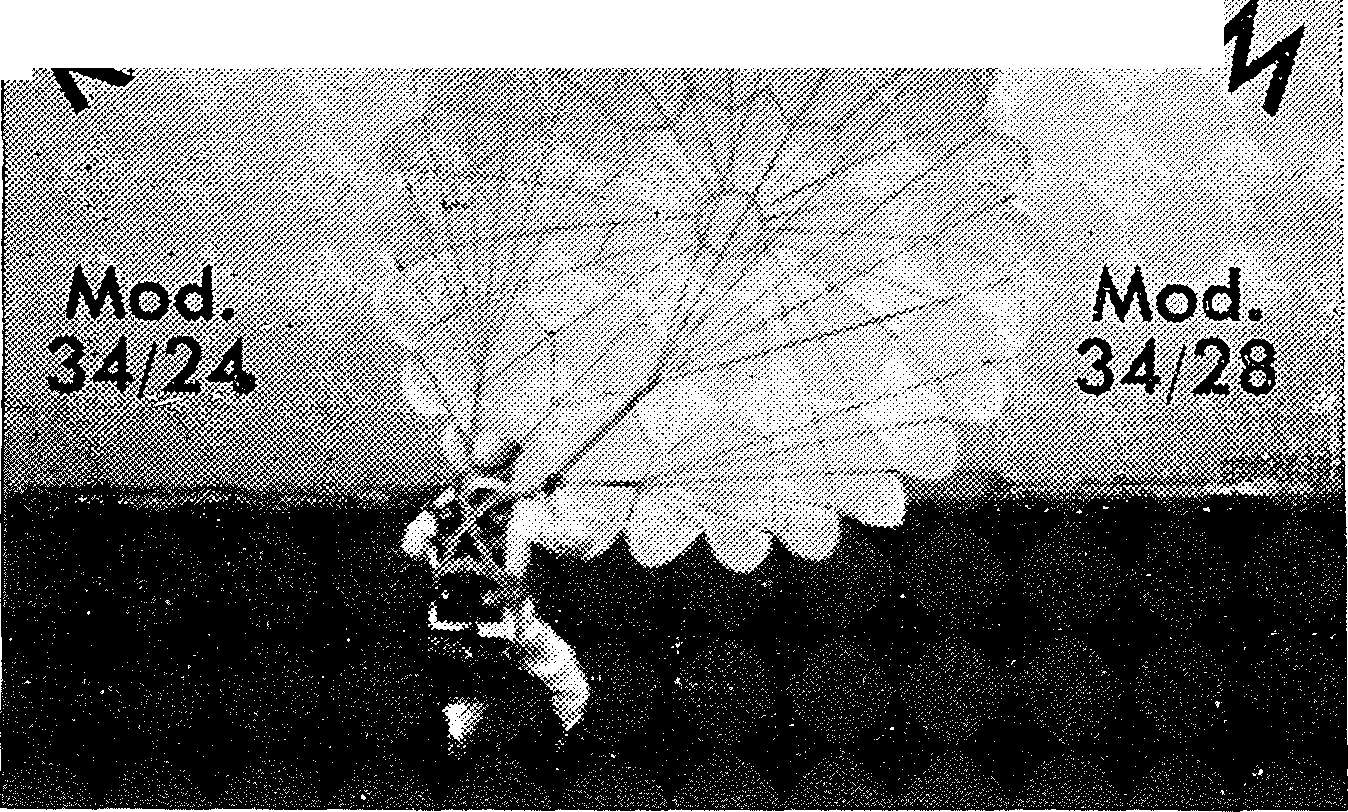
lOOfach praktisch erprobt
Zugelassen für 400 km/h
Der sicherste Lebensretter des Fliegers
Kleine Packung - Geringes Gewicht KOHNKE FALLSCHIRMBAU, BERLIN W 35
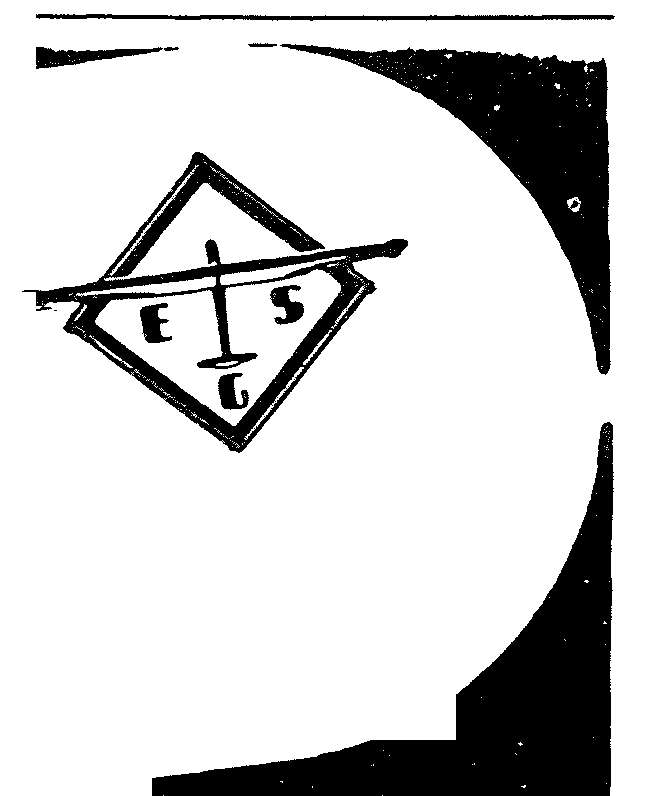
Gleitflugzeuge -SO » ubunS.-Se^uen" u Baby «ϖ
Ahau Schneidf
KU$Ba Gruna"
9 Uplesengemcöe
Navigationsgeräte
rar
Flugzeuge
und
Luftschiffe
w. Ludolph
Bremerhaven
Heft 20/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro X Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlas Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ..Nachdruck verboten" versehen. _nur mit genauer Quellenangabe gestattet.
Nr. 20_27. September 1939_XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 11. Oktober 1939
Eurasien.
Unsere Luftwaffe hat ihre Aufgabe in dem Feldzug gegen Polen blitzartig gelöst dank der unvergleichlichen Leistungen unserer Flieger und dank dem hohen Stand der Entwicklung unserer Flugtechnik und Luftfahrtindustrie. Während unsere Luftwaffe nun auf Luftwacht steht und für alle Zukunft einsatzbereit sein wird, werden Wissenschaft und Technik bestrebt sein, die friedliche Betätigung der Fliegerei zum Wohl Europas, vor allen Dingen auch der kleineren Völker Europas, der neutralen Staaten, und die Verbindung mit dem Fernen Osten einzusetzen. Die politischen Hindernisse sind beseitigt. Die Feindseligkeiten an der mongolischen Front sind eingestellt. Der japanisch-chinesische Raum drängt nach wirtschaftlicher Ordnung. Ueberau fühlt man den Drang zu einer gemeinsamen, alles umfassenden eurasischen Betätigung. Ein ungeheures Arbeitsfeld für deutsche Flugtechnik und Luftverkehr als völkerverbindendes Mittel in diesem Riesenraum! Ohne die Fliegerei würde eine Lösung dieser Aufgaben unmöglich erscheinen. Wenn erst die Völker auf diese Weise einander näher gerückt sind, wird eine bisher unmöglich erschienene Hebung des Standards in diesem weiten Raum möglich sein.
Große Entfernungen sind zu überbrücken, viele unerschlossene Gebiete der Menschheit zugänglich zu machen. Für deutsche Flugtechnik und Industrie ergeben sich große Aufgaben.
Schweiz. Mehrzweckeflugzeug C. 36.
Dieser Zweisitzer ist von den Eidg. Konstruktionswerkstätten, Thun, für militärische Zwecke gebaut und befindet sich zur Zeit in der Erprobung. Freitragender Tiefdecker, Ganzmetallbauweise, 2 Sitze hintereinander. Hintere Beobachtersitzverkleidung aufklappbar.
Verehrte Leser des Flugsport! Bitte sparen Sie unnütze Nachnahinespesen und senden Sie uns die fällige Bezugsgebühr für das IV. Vierteljahr 1939, RM 4.50, möglichst auf unser Postscheckkonto 7701 Frankfurt a. M. Nach dem 5. Okt. werden wir diese zuzüglich 30 Pf. Spesen durch Nachnahme einziehen.
Diese Nummer enthält Reportsammlung Nr. 16 u. Patentsammlung Nr. 15. Bd. VIH.
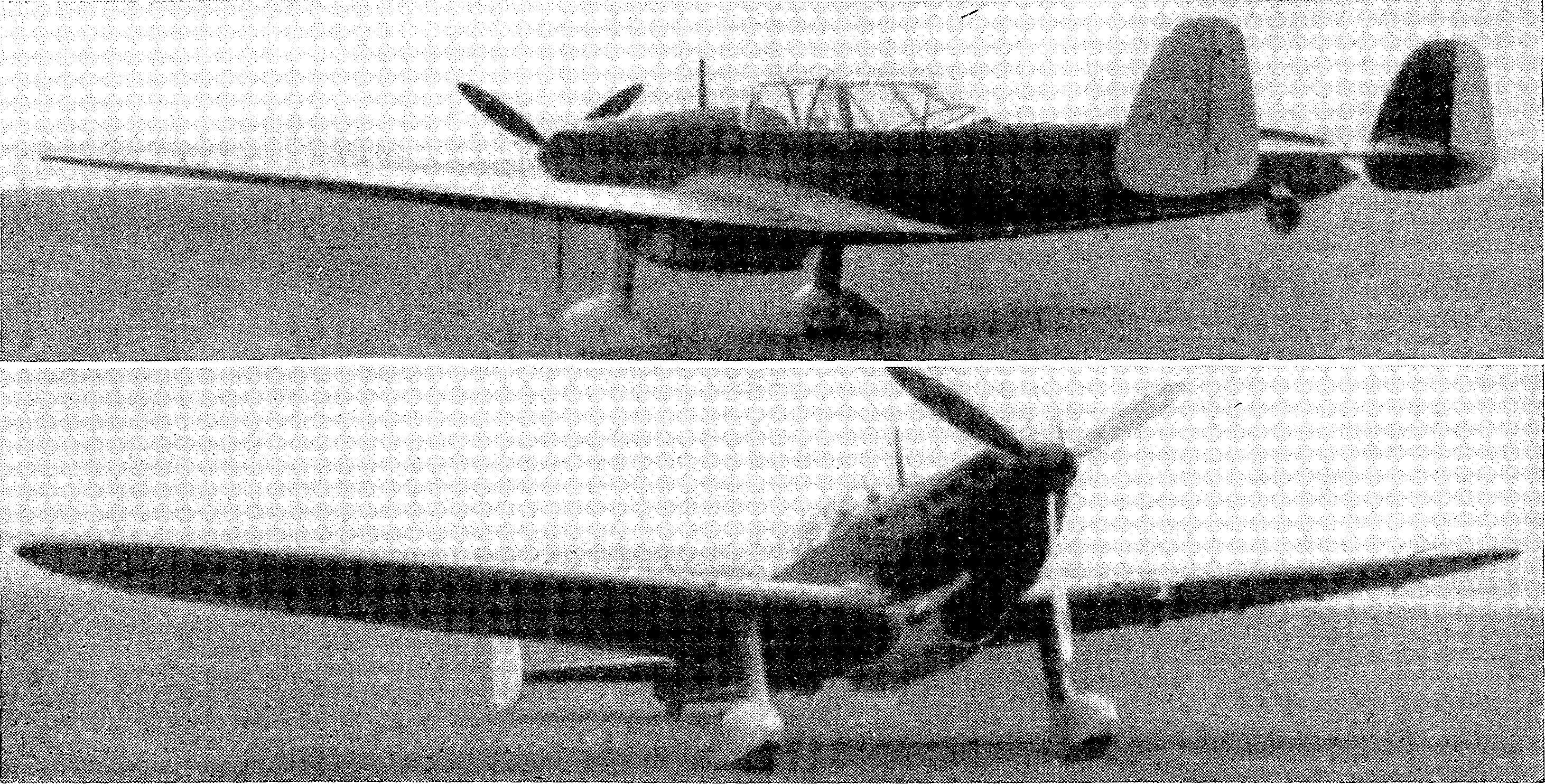
Schweiz. Mehrzweckeflugzeug C. 36.
Werkbild. K.W,
Motor Hispano-Suiza 12Y mit Ratier-Verstellschraube mit hohler Nabe, windflügelgesteuert. Kühler unter dem Rumpf.
Zwei Seitenleitwerke für Schußfeld nach hinten. Fahrwerk fest, Streben und Räder Stromlinienverkleidung.
Bewaffnung 1 Motorkanone und 2 fest eingebaute MGs., ferner im Flügel 2 ungesteuerte MGs. und im hinteren Sitz für den Beobachter ein bewegliches MG.
Abmessungen und Leistungen werden noch nicht bekanntgegeben.
Engl- Jagdflugzeug Martin-Baker.
Engl. Martin-Baker-Jagdflugzeug, gebaut von der Martin-Baker Aircraft Co., Higher Denham. Konstrukteur Martin hat sich erboten, in einer Fabrik von 2000 Arbeitern wöchentlich 20 Maschinen herauszubringen.
Tiefdeckerbauart, Ganzmetall. Sehr langer Rumpf, Sitz Hinterkante Flügel. Rumpfende senkrechte Schneide. Seiten-rüder weit nach unten gezogen. \ Rumpf Stahlrohr, für die Formgebung
aufgelegte Formholzleisten. Bewaffnung u . *ϖ fest eingebaute MG.s.
ϖ Motor Napier Bagger 1000 PS, Kühl-
luftaustritt auf der Rumpfunterseite.

Engl. Jagdflugzeug Martin-Baker. Man beachte die Rumpfnase mit den Luftzu- und -abführungen für den Napier-Dagger-Motor und die Oeffnung für den Oelkühler in dem linken Fahrwerksbein.
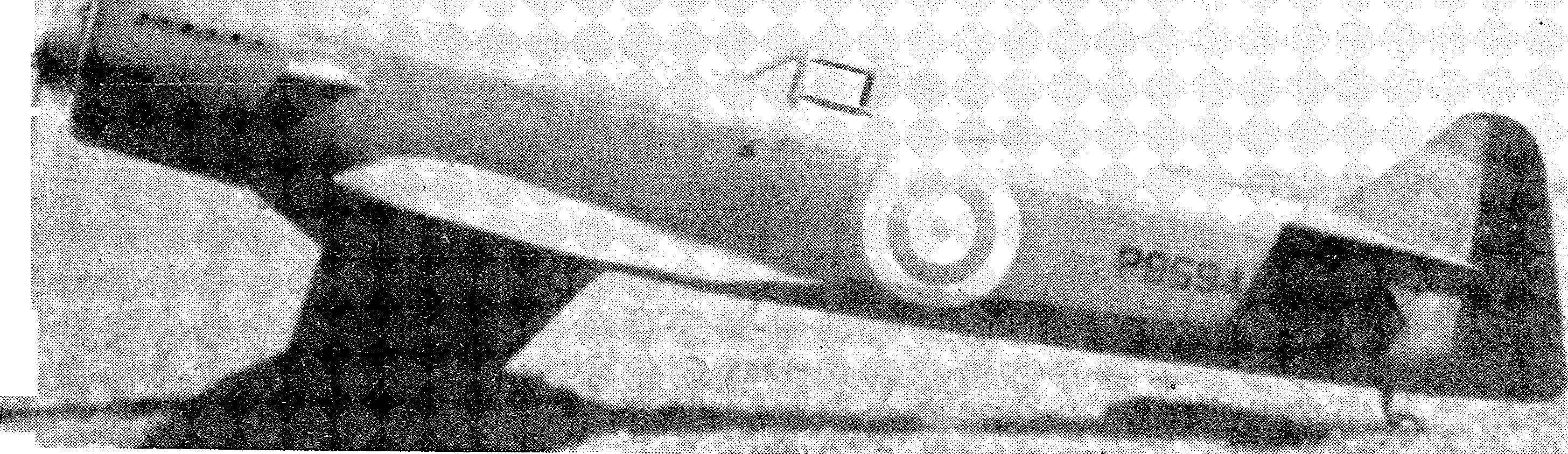
Engl Jagdflugzeug Martin-Baker.
Bild: Fliffht
Fahrwerk fest. In der Hose des linken Fahrwerks Oelkühler. Spannweite 10,2 m, Länge 10,35 m.
USA, Bell ,9Airacudau Kampfflugzeug.
Unter der Typenbezeichnung Bell „Airacuda" hat die Bell Aircraft Corporation, Buffalo, ein Kampfflugzeug, wohl als Zerstörer gedacht, für die USA-Luftwaffe entwickelt. Dieser Tiefdecker besitzt zwei überkomprimierte, flüssig gekühlte Allison Motoren mit hinter dem Flügel liegenden Dreiblatt-Druckschrauben.
Flügel freitragend. Motoren und Motor Verkleidung liegen vollständig auf der Flügeloberseite.
Rumpf Ganzmetallbauweise mit MK. in der Rumpfnase, MG.-Nester zu beiden Seiten des Rumpfes hinter der Flügelhinterkante. Fünf Mann Besatzung.
Von dem Dreirad-Fahrwerk gegenüber dem Bell P-39, vergleiche Flugsport Nr. 11, 1939, Seite 280, scheint man wieder abgekommen zu sein. Normales Fahrwerk, nach hinten hochziehbar.
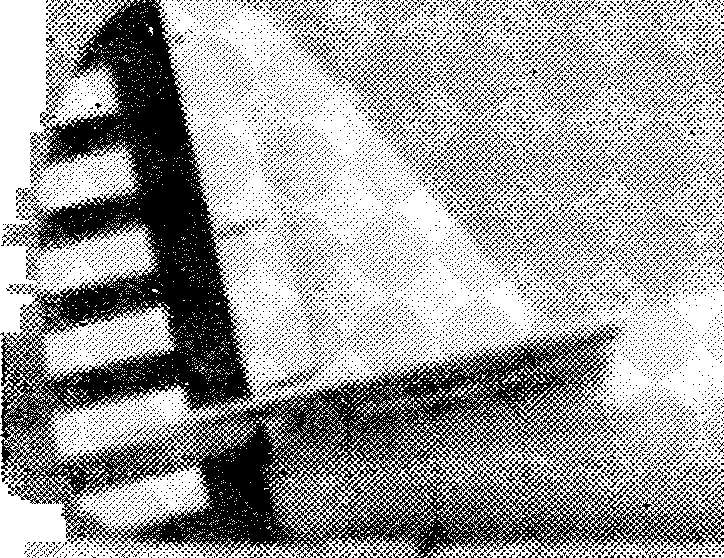
USA. Bell „Airacuda" Kampfflugzeug. Bild: Aero Digest
Engl. Flugboot Short, Klasse „G" 32 t Golden Hind.
England hat in den letzten Jahren zwei Flugbootklassen entwickelt. Zuerst die C-Klasse, wie Cabot, Caribou, Connemara, Clyde, Caledonia, Cambria usw., die auf größeren Luftverkehrsstrecken in den Kolonien eingesetzt wurden.
Die G-Klasse, von Short Brothers gebaut, sind vergrößerte Flugboote, 32 km schneller, mit vergrößertem Navigationsraum, und zum erstenmal in der Oeffentlichkeit erschienen mit dem Golden Hind, während die beiden anderen, Grenville und Grenadier, sich noch im Bau befinden.
Die G-Boote sind in ihren Ausmaßen um etwa das l,15fache größer. Wesentliche Unterschiede zeigen sich in der Hauptsache im Boot, welches noch eine zweite Stufe erhalten hat.
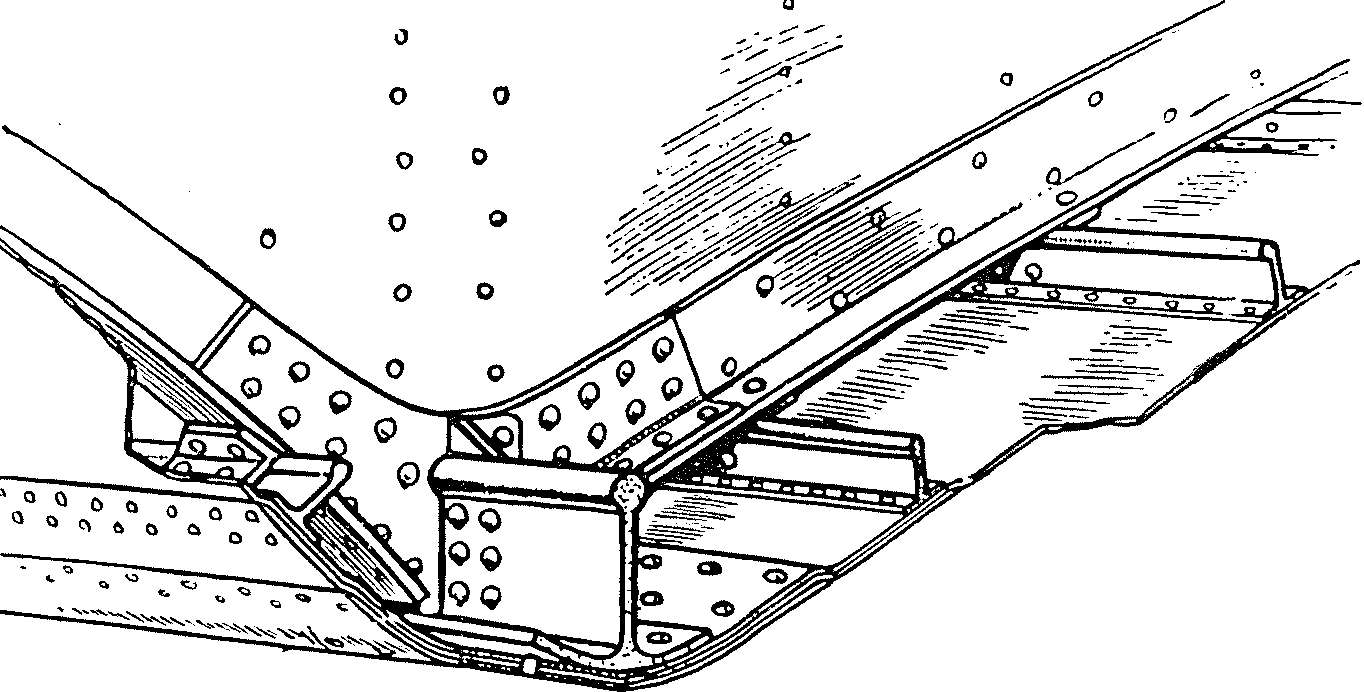
Konstruktionseinzelheiten des engl. Flugboots Short Klasse „G" 32 t Golden Hind. Links: Kielversteifung des Bootes.
Zeichnung: Flight
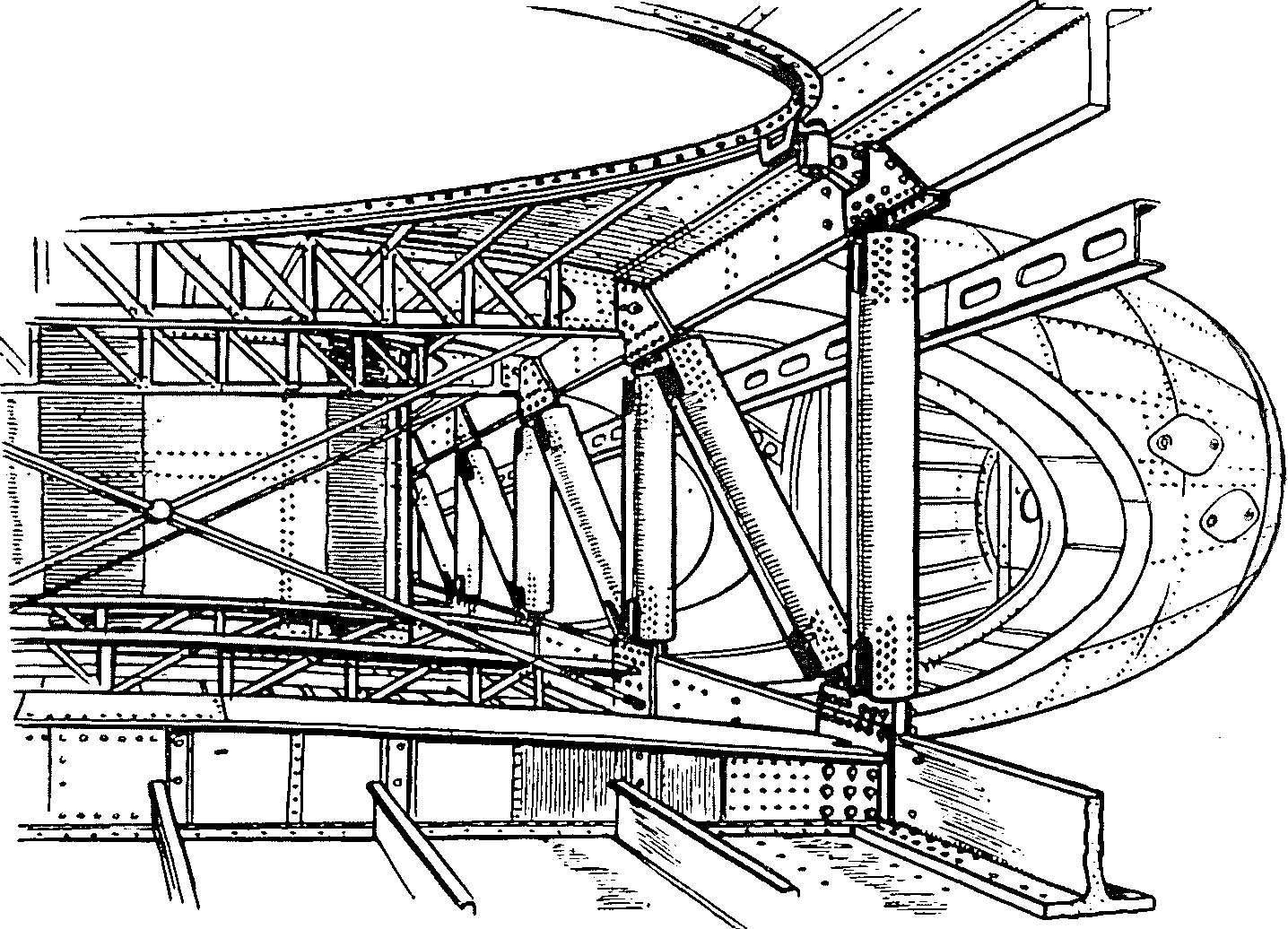
Holm und Flügelkonstruktion, links sieht man die eingebauten runden Tanks.
Den Aufbau des Kielbodens zeigt die obenstehende Abbildung. Die Längsversteifungen werden durch T-förmige Profile mit einer Verdickung an der Unterseite gebildet. Und zwar so, daß ein Abstand zwischen Glattblechhaut und Schotten gehalten wird. Die Längsprofile mit Verdickung an der Unterseite werden nur auf der Unterseite des Bootes im Kiel verwendet. An den Seitenwänden sind Z-Profile mit Unterbrechungen für die Formversteifung benutzt.
In der Lehne des Führersitzes befindet sich ein Warnboxerhorn, durch welches blockierte Steuerungsteile beim Herunterklappen entsichert werden.
Flügel mit Short-Schiebelandeklappen*), Gitterträgerholme, Flanschen T-Schnitt, rohrartige Streben, die mit Beschlägen an den T-Trägern vernietet sind. Vergleiche die Abbildung. Versteifung zwischen den Holmen durch Rippen und Kastenholme gegeneinander mit Drähten verspannt, und in gewissen Abständen durch Diagonalrohre versteift. Vier Motoren vor der Flügelnase, wie bei
*) Landeklappen werden durch Rollen, die in einer Kurvenbahn laufen, geführt. Siehe die Beschreibung und Skizze der Short-Landeklappe Flugsport Nr. 9, S. 189r Jahrg. 1936.
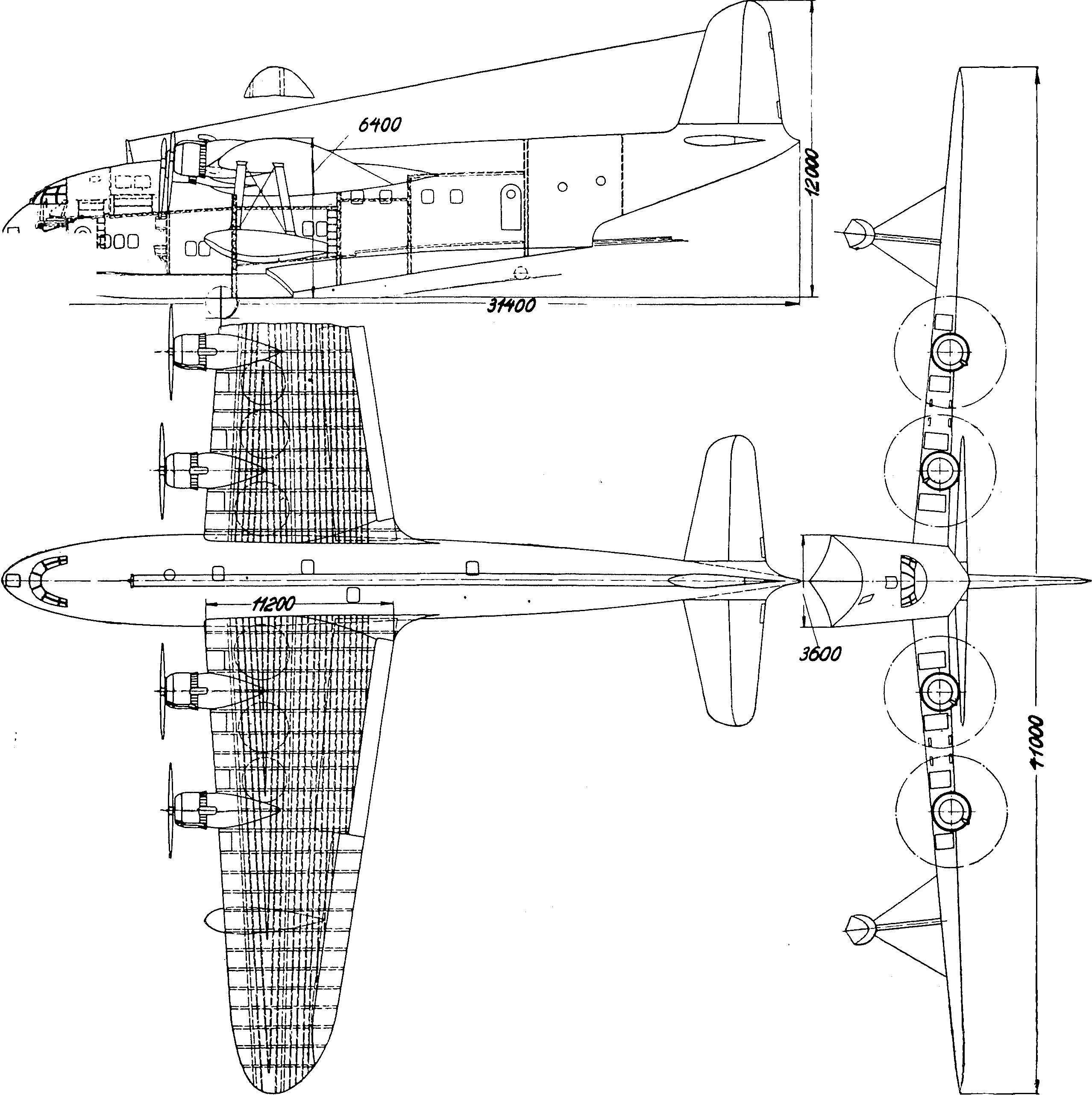
Engl. Flugboot Short - Klasse „G" 32 t Golden Hind.
Transport-Hilfs-fahrwerk mit Streben gegen Flügel abgestützt. Maßstab 1 : 400. Zeichnung Flugsport
den Empire-Booten. Im Grundriß runde Betriebsstoffbehälter in den Flügeln.
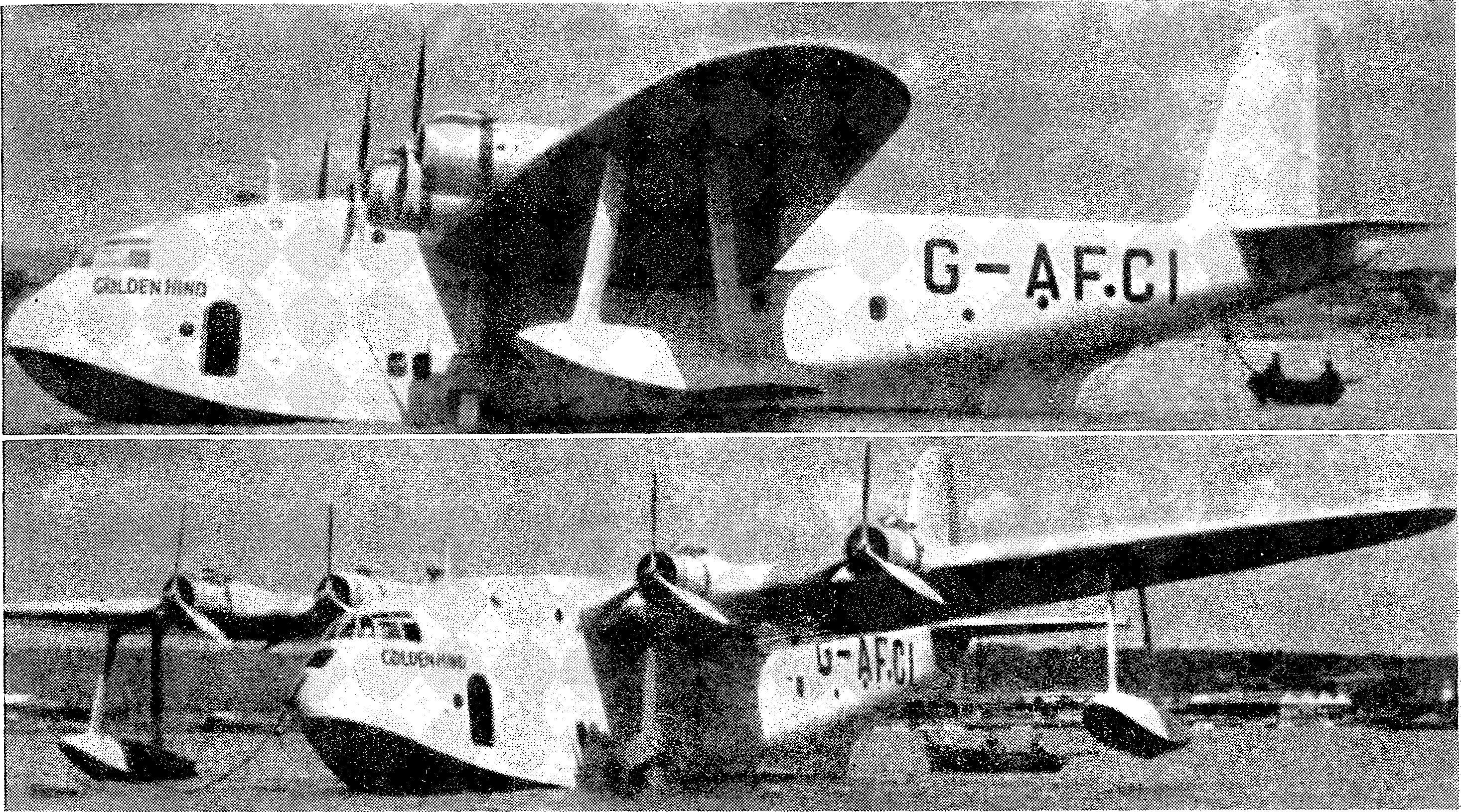
Engl. Flugboot Short-Klasse „G" 32 t Golden Hind. Bild: The Aeropiane
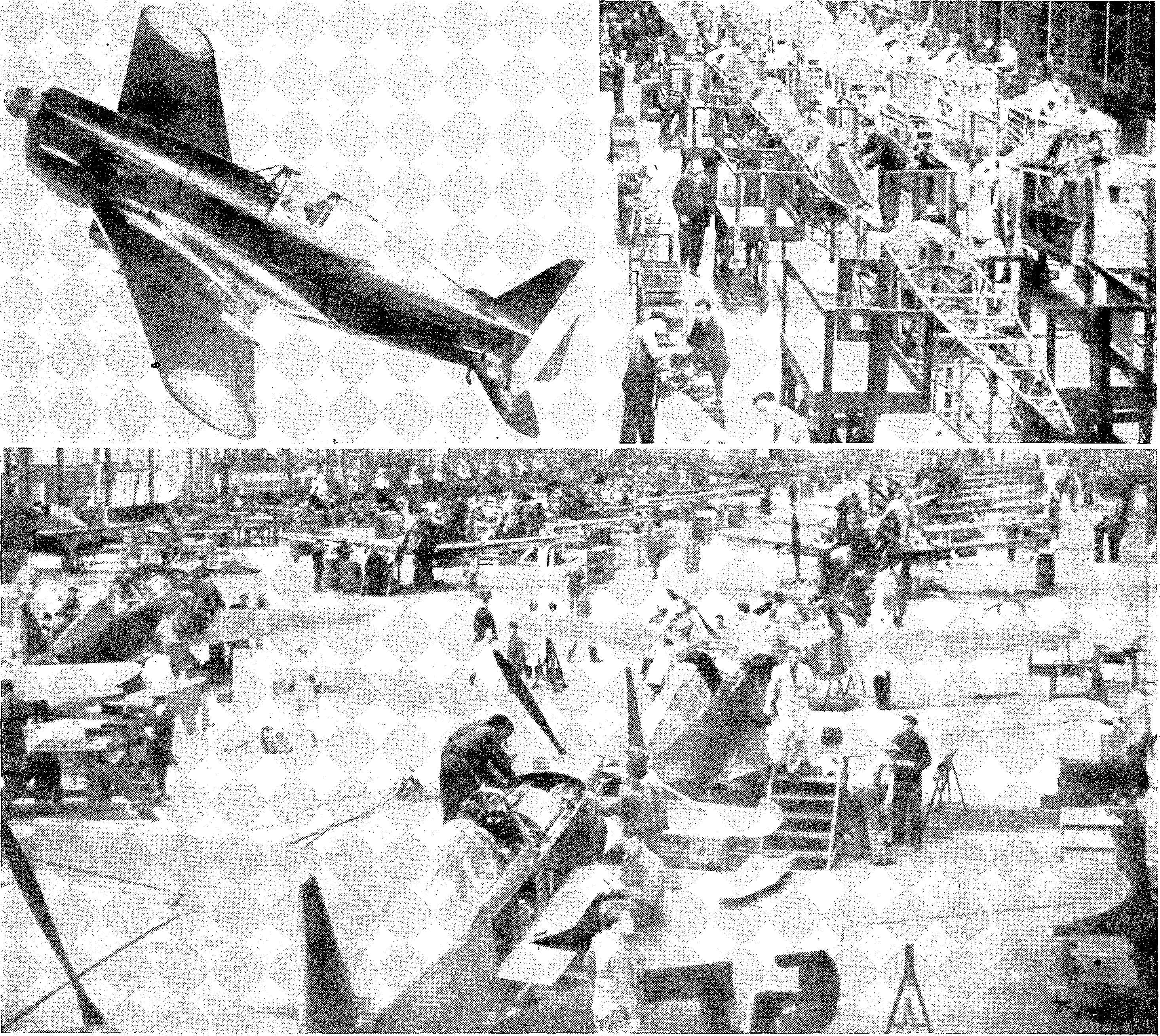
Morane-Saulnier 406 C. Serienfabrikation in den Breguet-Werken. Diese Maschine war ursprünglich mit 860-PS-Hispano-Suiza-Motor ausgerüstet und sollte später einen Motor von 1200 PS erhalten. — Bestückung: 1 MK. und 2 MGs. im Flügel. Spannweite 10,7 m, Länge 8 m, Höhe 2,7 m. Vgl. auch „Flugsport" 1938, S. 680.
Werkbilder
Die seitlichen Stützschwimmer sind seitlich sehr tief und weiter nach den Flügelspitzen zu, gegenüber den C-Booten, gerückt.
Bei der G-Klasse ist für die Ueberwachung der Motoren mit sämtlichen dazu nötigen Instrumenten ein besonderer Raum, ähnlich wie beim Do X, vorgesehen, der von einem Ingenieur besetzt ist.
Besatzung Kapitän und 1. Offizier (Flugzeugführer), Ingenieur, Funker und Navigator.
Sechs Betriebsstoffbehälter 16 000 1. Das Verteilersystem auf die vier Motoren ist ziemlich kompliziert.
Golden Hind Langstreckentyp für 5150 km Reichweite. Grenadier für mittlere Reichweite 3200 km für 12 Fluggäste und Post. Grenville kurze Strecken, 1600 km für 24 Fluggäste.
Hinter dem Führerraum steuerbord Navigationsraum, backbord Funkerraum.
Vier Bristol Hercules IVC Schiebermotore, Gesamtstartleistung 5520 PS. Dreiblatt-Konstant-Speed-Luftschrauben.
Spannweite 41 m, Länge 31,4 m, Fläche 201 m2, Leergewicht 17 500 kg, Fluggewicht 33 340 kg, Flächenbelastung 166 kg/m2, Leistungsbelastung 6 kg/PS. Höchstgeschwindigkeit 337 km/h, Reisegeschwindigkeit in 1500 m 290 km/h, Reichweite 5150 km.
Ergebnisse der internationalen Normungsarbeiten hat der Deutsche Normenausschuß in seinen „DIN"-Mitteilungen veröffentlicht. Auf Einladung des Finnischen Normenausschusses hatten 12 Länder etwa 120 Vertreter (darunter 38 deutsche) zu der Hauptsitzungsreihe der Internationalen Föderation der Nationalen Normen-Vereinigungen (ISA) nach Helsinki entsandt. Die nächste Normentagung findet 1940 in Italien statt.
Am Schluß der Tagung führte der Präsident des Finnischen Normenausschusses u. a. folgendes aus: Mit Freude kann schon jetzt festgestellt werden, daß die Normungsarbeit während der letzten Zeit zunehmendes Verständnis gefunden hat und die Wirtschaft aus eigener Initiative zur Erzielung größter Wirtschaftlichkeit und Leistungssteigerung nach den Normen greift. Wenn man heute über Verbesserungen auf technischem und wirtschaftlichem Gebiete spricht, so wird als eins der wichtigsten Mittel zur Erreichung des Erfolges die Normung genannt.
Die Tagung hat wieder in vielen technischen Einzelheiten Fortschritte in der Angleichung der Normen der verschiedenen Länder gebracht, die auch heute für Deutschlands Ausfuhr von großer Bedeutung sind.
DLH-Strecke Berlin—Danzig—Königsberg 21. 9. wieder aufgenommen. 8.20 ab Berlin, 10=20 an Danzig, 10,35 ab Danzig, 11.20 an Königsberg. Gegenmaschine: Ab Königsberg 12.50, an Danzig 13.35, ab Danzig 13.50, an Berlin 16 Uhr.
Deutsche Luftfahrt-Sammlung nach Umgestaltung und Angliederung einer Abteilung „Neuzeit" am 15. 9. 1939 wieder eröffnet. Vgl. Abb. S. 497.
Lilienthal-Gesellschaft Hauptversammlung 11.—13. 10., Wien, verschoben.
Paul Daimler, ältester Sohn d. Gottlieb Daimler, 70 Jahre alt.
Dr. Otto Röhm t» Ehrensenator d. Techn. Hochschule Darmstadt, kgl. bulgar. Gen.-Konsul, gestorben. Röhm, geb. 14. 3. 78, Mitbegründer der Firma Röhm & Haas, Darmstadt, ist durch seine Forschungsarbeiten aufvdem Gebiete der Kunstharze, aus denen das Plexiglas entwickelt wurde, bekannt geworden.

UNDSCHÄl
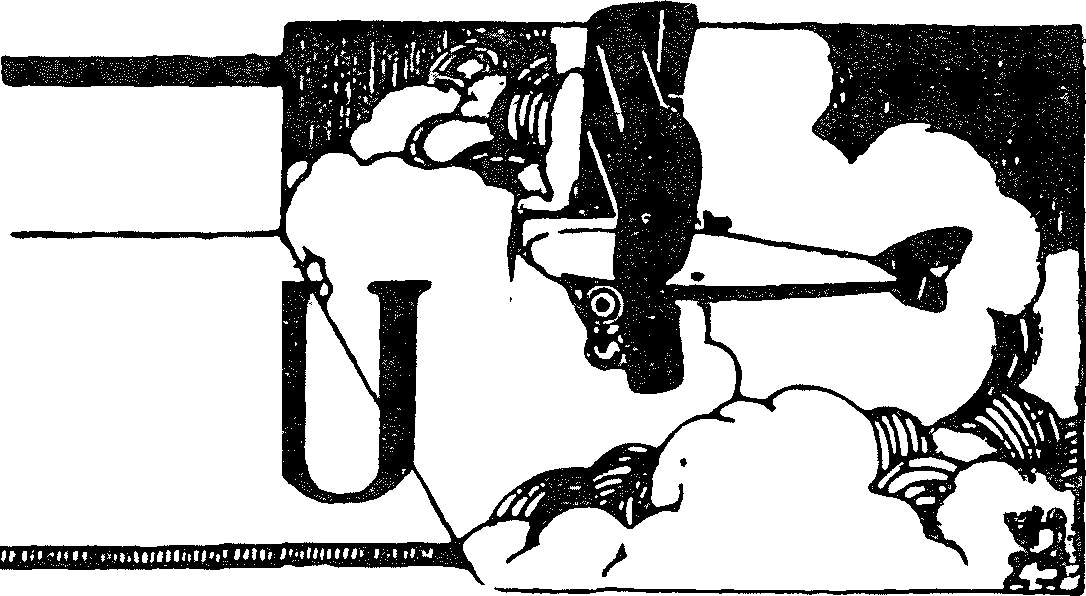
Inland.
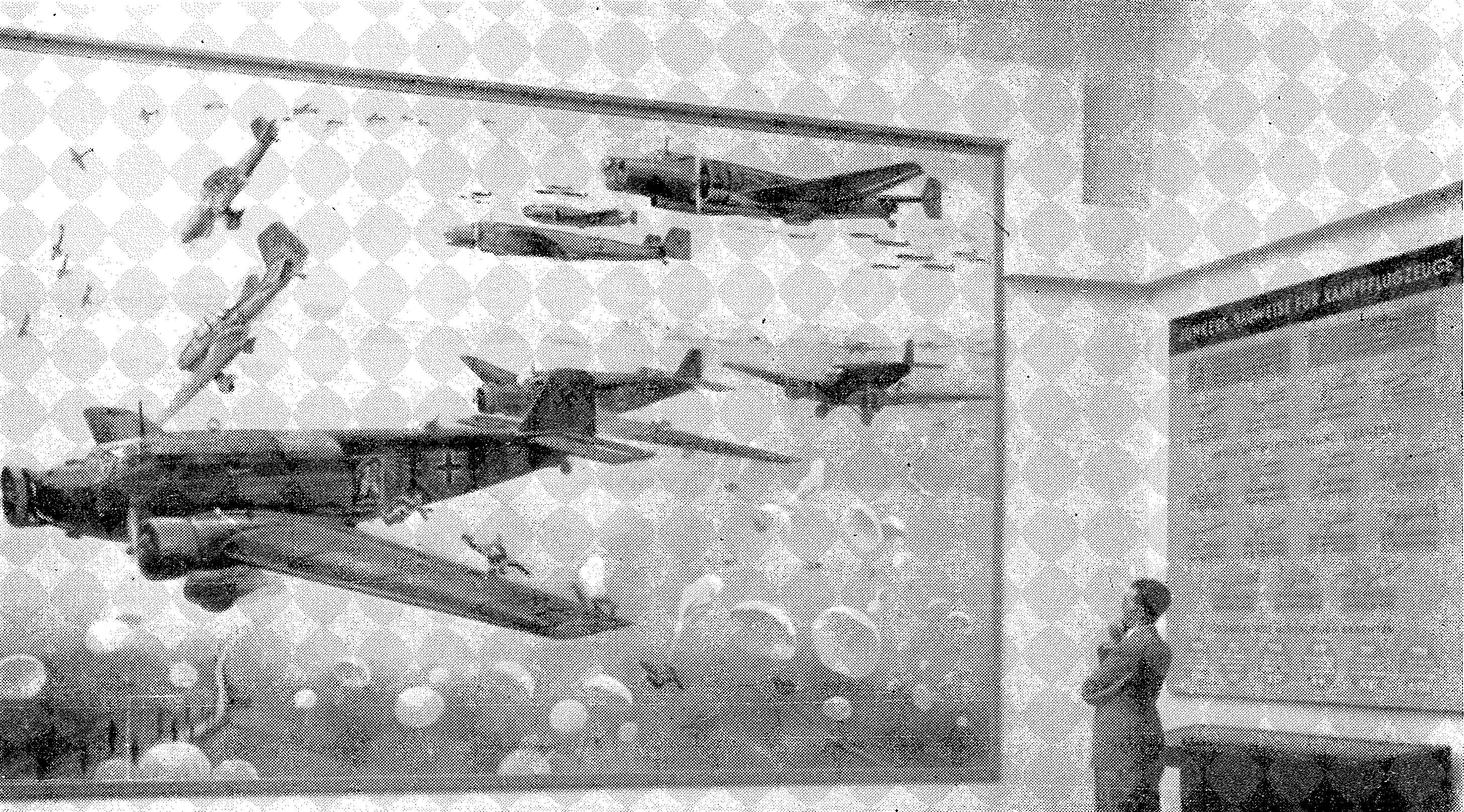
Deutsche Luftfahrt-Sammlung wieder eröffnet. Aus dem Raum der Junkers-Werke.
Großdarstellung von Fallschirmspringern in Aktion. Weitbild
Ausland«
Engl. Flugzeugträger „Courageous" wurde, wie die britische Admiralität mitteilt, von einem feindlichen U-Boot versenkt. Der Flugzeugträger „Courageous" hatte eine Wasserverdrängung von 22 500 tons und war zur Aufnahme von 52 Flugzeugen bestimmt. Im Jahre 1938 bestand die Besatzung aus folgenden Geschwadern: Geschwader Nr. 800, Marinejäger; Geschwader Nr. 810, Torpedo-Bomber; Geschwader Nr. 820, Aufklärer; Geschwader Nr. 821, Aufklärer.
Italien—Niederländisch-Indien—Australien, regelmäßiger Personen- und Postflugverkehr, ist 19. 9. durch ein holländisches Flugzeug aufgenommen worden. Flüge zweimal wöchentlich, Montag und Donnerstag.
Ital. Luftverkehr. Aufgehoben ^ wurden folgende fc-Luftlinien: Rom— Berlin, Rom—Tunis —Tripolis, Rom— Neapel—Palermo— Tunis, Venedig—
Wien—Budapest,
Venedig—Budapest. Wieder eröffnet sind die kürzlich aufgehobenen Linien: Rom—Neapel, Sardinien— Malta—Tripolis u.
Rom—Brindisi— Athen—Rhodos.
Brit. Flugzeugträger „Courageous" 18. 9. 39 versenkt.
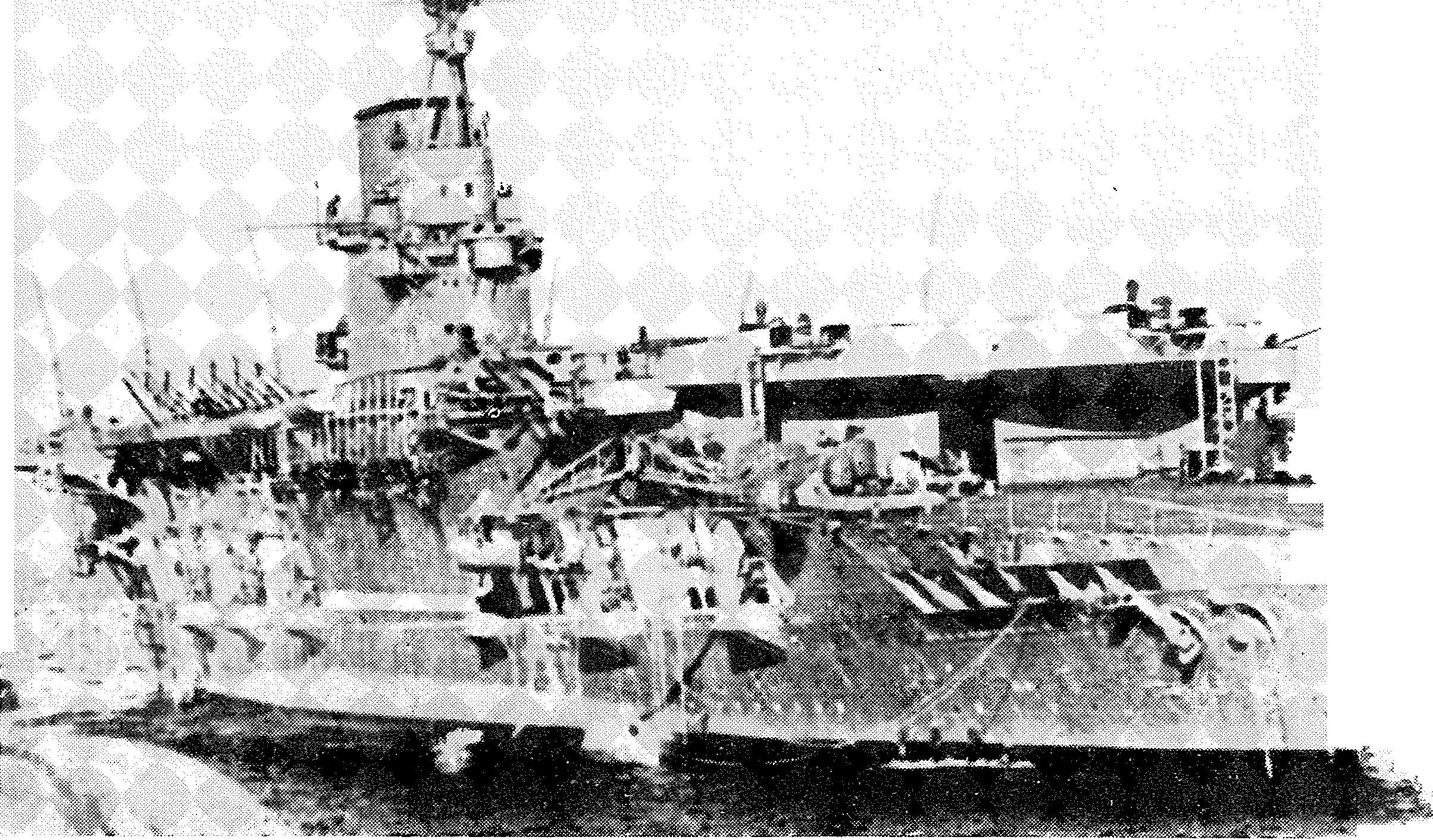
Flugpostsendungen werden nicht mehr angenommen nach Frankreich, England,. Irland, Belgien, Holland, Deutschland, Schweiz, Protektorat, Skandinavien, baltische Staaten, Baltikum, Rußland, Ungarn, Tunis, Algier. Südamerikanische Post geht mit dem Flugzeug nur noch bis Lissabon.
Schwed. Fluglinie Stockholm—Tallinn jetzt wieder in Betrieb genommen.. Die Fluglinien Stockholm—Abo—Helsinki und Stockholm—Riga—Moskau sind noch im Betrieb. Nach dem Westen besteht nur die Linie Kopenhagen—Amsterdam, die auf der Strecke Stockholm—Kopenhagen unterbrochen ist.
Rumän. Flugwettbewerb Bukarest um den Großen Preis der FARR (Federa-tia Aeronautica Regala a Romaniei), Genauigkeitsflug über 1156 km Strecke, Sieger Kapt. Abeles auf Klemm Kl 35 B mit 100-PS-Hirth-Motor HM 504. Er erhielt den Pokal sowie den Preis von 80 000.— Lei. 3. Preis Peter Stamatescit auf Klemm Kl 35 B mit Hirth HM 504 20 000.— Lei.
NiederL-Westindien, Fluglinie Curacao—Paramaribo, allwöchentlich ein Flugzeug der KLM in beiden Richtungen.
Luftwaffe.
Am 10. und 11. 9. flog der Führer nach der Front. Am 11. mitten hinein in das Operationsgebiet zwischen Lodz und Warschau. Landung erfolgte auf einem der Feldflugplätze, wenige Kilometer hinter der Front, einem ausgedehnten Stoppelfeld, Landeplatz einer Zerstörerformation. Der Kommandant kann zur Begrüßung dem Führer voll Stolz die Ergebnisse des gestrigen (10. 9.) Feindfluges melden: Diese Formation hat an einem Tage 44 polnische Flugzeuge vernichtet und dabei zahlreiche weit östlich gelegene polnische Flugplätze zerstört. Voll Freude hört der Führer diese Meldung tapferen deutschen Fliegertums. Am Nachmittag erst verläßt der Führer wieder die vorderen Linien. Noch einmal schließt sich ein Frontflug an, der einen umfassenden Ueberblick gibt.
Berlin, 10. 9. 39. Während eines Feindfluges war heute ein Flugzeug einer deutschen Bombenstaffel gezwungen, hinter den polnischen Linien in Dyskow bei Tluszcz notzulanden. Um seinem in Bedrängnis geratenen Kameraden zu Hilfe zu kommen, landete ein anderes Flugzeug der gleichen Staffel neben dem notgelandeten Kameraden mitten zwischen den Polen, die durch Bombenabwürfe der übrigen Flugzeuge der Staffel in Schach gehalten wurden. Die Besatzung des notgelandeten Flugzeuges steckte dieses in Brand, um es nicht in die Hände der Polen fallen zu lassen. Dem zu Hilfe geeilten Flugzeug gelang es dann, die Kameraden an Bord zu nehmen, glatt wieder zu starten und den eigenen Fliegerhorst mit ihnen zu erreichen.
Berlin, 11. 9. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe hat die Straßen und Eisenbahnlinien ostwärts und nordostwärts Warschau und in den Räumen Lemberg und Lublin-Chelm wiederholt mit Erfolg angegriffen und Kolonnen und Truppentransporte dort zerschlagen. In Lemberg wurde der Westbahnhof zerstört.
Im Westen Avurde der geräumte Flugplatz Saarbrücken von französischer Artillerie beschossen. Drei französische Flugzeuge wurden über Reichsgebiet abgeschossen.
Berlin, 12. 9. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Verbände der Luftwaffe wurden wie am Vortage zur Unterstützung des Heeres bei Kutno und zur Störung der rückwärtigen Verbindungen des Gegners ostwärts der Weichsel mit gutem Erfolg eingesetzt. Eine Sturzkampfgruppe hat die Ostausgänge von Warschau abgeriegelt. Der Bahnhof Bialystok wurde zerstört.
Luftangriffe auf das Reichsgebiet im Westen ereigneten sich gestern nicht.
Berlin, 12. 9. 39. (DNB.) Die Kampfverbände der deutschen Luftwaffe haben polnische Trupp.enansammlungen bei Kutno-Klodawa und Krosniewice-Hobal-Gostynin erfolgreich bekämpft. Mehrere Verbände griffen das Eisenbahndreieck von Praga sowie die aus Warschau nach Radyzin, Tluszcz, Siedice und Deblin führenden Eisenbahnlinien an. Brennende Bahnhöfe, unterbrochene Bahnstrecken, schwer beschädigte Eisenbahnbrücken, zerstörte Straßenkreuzungen und Straßenbrücken, explodierte Munitionstransporte, zersprengte Marsch- und Lastkraftwagenkolonnen sind das Ergebnis dieser Angriffe.
Die Gegenwehr der polnischen Fliegertruppe wird immer schwächer. Um ihr aber auch die letzten Möglichkeiten zum Eingreifen zu nehmen, wurde die Luftwaffe auch gegen die Reste der Bodenorganisation eingesetzt. Bei den An-
griffen auf die Flugplätze Rodek, Deblin, Luck und Lemberg wurden 34 polnische Flugzeuge auf den Rollfeldern zerstört, zwei Flugzeuge im Luftkampf abgeschossen.
Berlin, 13. 9. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe griff auch gestern erfolgreich Straßen, Brücken und Eisenbahnen ostwärts der Weichsel an. Im Bahnhof Krystynopol brennen drei Züge. Der Flugplatz Luck wurde schwer beschädigt, die Flugzeugfabrik Biala-Podlaska in Brand geschossen. 14 feindliche Flugzeuge wurden zerstört, davon zwei im Luftkampf. Die Luftaufklärung brachte ausgezeichnete und für die Führung wertvolle Ergebnisse.
Luftangriffe auf deutsches Reichsgebiet im Westen fanden nicht statt.
Berlin, 13. 9. 39. Trotz ungünstigen Wetters haben die an der Ostfront eingesetzten Verbände der deutschen Luftwaffe tatkräftig die Kampfhandlungen des Heeres unterstützt. Ferner wurden die Eisenbahnlinien Bialystok—Wolko-wysk, Slonim—Baranovice, Bialystok—Brest, Brest—Pinsk durch Bombenabwürfe verschiedentlich unterbrochen. Auf die Bahnhöfe Oleszyce-Horniec, Wlodawa wurden schwere Treffer erzielt. Bei Radymno, nördlich Przemysl, wurden zwei feindliche Kampfflugzeuge abgeschossen.
Berlin, 14. 9. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Trotz ungünstiger Wetterlage griff die Luftwaffe mit Erfolg den Ostrand von Warschau und rückwärtige polnische Verbindungsstraßen an. Zwei feindliche Flugzeuge wurden abgeschossen.
Moskau, 14. 9. 39. (DNB.): Die Telegraphenagentur der Sowjetunion teilt mit: In den letzten Tagen häuften sich die Fälle von Verletzungen der sowjetrussischen Grenze durch polnische Militärflugzeuge. Die Grenzverletzer versuchten sogar, in das innere sowjetrussische Gebiet einzudringen. Am Dienstag (12. 9.) verletzten polnische Militärflugzeuge die sowjetrussische Grenze in den Distrikten von Chepetovka (Ukraine) und Jikovitchi (Weißrußland). Sowjetrussische Jagdflugzeuge zwangen die polnischen Flugzeuge zur Rückkehr auf polnisches Gebiet. Indessen werden noch weitere Grenzverletzungsfälle gemeldet. So stießen am Mittwoch (13. 9.) mehrere polnische Bombenflugzeuge in den Distrikten Krivine und Yampol (Ukraine) auf sowjetrussisches Gebiet vor. Eine zweimotorige polnische Maschine wurde von sowjetrussischen Jagdflugzeugen gestellt und zur Landung auf sowjetrussischem Gebiet gezwungen. Die dreiköpfige Besatzung
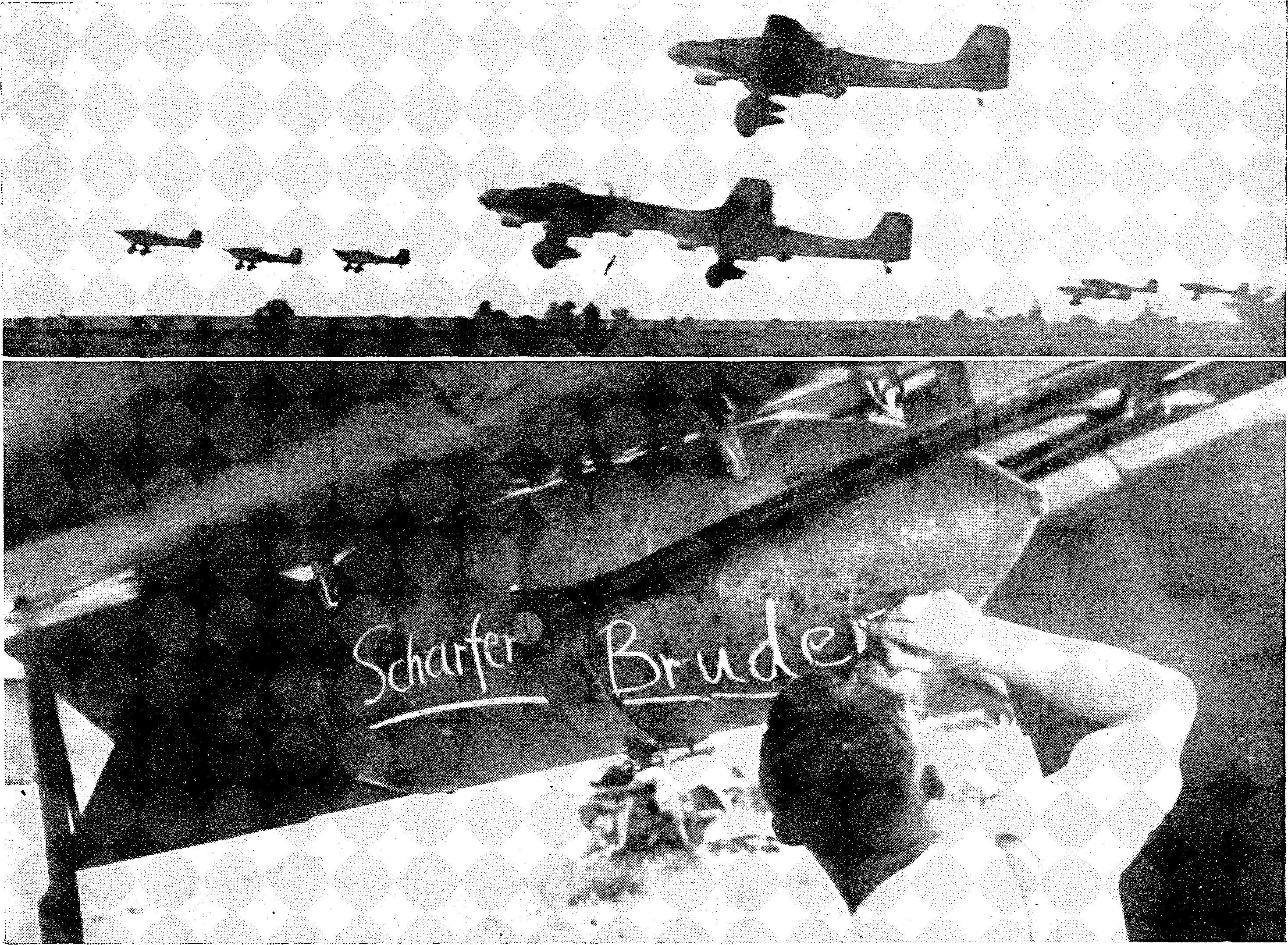
Oben: Eine Sturzkampfstaffel startet zum Feindflug. Unten: Wie in Spanien, so verleihen auch jetzt wieder unsere Sturzkampfflieger ihren Bomben Namen.
Bilder: PK. Borchmann (oben) — Stempka (unten) — Weltbild.
wurde festgenommen. Am selben Tag verletzten drei polnische Bombenflugzeuge die sowjetrussische Grenze in dem Distrikt Mozyr in Weißrußland. Auch in diesem Falle wurde die Landung der Grenzverletzer durch sowjetrussische Jagdmaschinen erzwungen und die drei Besatzungen, insgesamt 12 Mann, festgenommen. — Wie von amtlicher Seite zu diesen Grenzverletzungen der Polen verlautet, legt man in Moskau diesen Zwischenfällen eine ernste Bedeutung bei.
15. 9. 39. Generalfeldmarschall Göring begab sich am 15. 9. vormittags in seinem Flugzeug zu den Frontflugplätzen im Räume der in Galizien kämpfenden Südarmee. Er überzeugte sich von der durchschlagenden und verheerenden Wirkung der Bombenangriffe auf die polnischen Flugplätze. Neben anderen Frontverbänden sprach der Generalfeldmarschall insbesondere den Männern der bisher erfolgreichsten, von Hauptmann Gentzen geführten Jagdgruppe, Dank und Anerkennung aus. Mit Stolz tragen zahlreiche Offiziere und Mannschaften dieser Jagdgruppe von gestern ab das Eiserne Kreuz.
Berlin, 15. 9. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Am 14. September griff die Luftwaffe trotz schlechter Wetterlage Bahnlinien und Bahnhöfe mit Erfolg an und unterstützte den Kampf des Heeres gegen die um Kutno eingeschlossene feindliche Armee durch Bomben- und Tiefangriffe. Die noch im Hafen Heisternest liegenden polnischen Kriegsschiffe wurden durch Bomben versenkt.
Luftangriffe auf deutsches Reichsgebiet fanden im Westen nicht statt.
Berlin, 16. 9. 39 (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Jagdgruppe des Hauptmanns Gentzen hat in den letzten Tagen 74 polnische Flugzeuge vernichtet, davon 28 im Luftkampf, den Rest auf der Erde.
Berlin, 16. 9. 39 (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Auch am 15. 9. vereitelte die Luftwaffe den Versuch der letzten polnischen Transportbewegungen gegen die Ostgrenze. Im Westen fanden Luftangriffe auf deutsches Reichsgebiet nicht statt.
Berlin, 16. 9. 39 (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Trotz ungünstiger Wetterlage wurde von Kampfverbänden der deutschen Luftwaffe durch weitere wirkungsvolle Unterbrechungen verschiedener Bahnlinien und starke Beschädigungen mehrerer Bahnhöfe der Rückzug der Polen außerordentlich erschwert. Auch vereinzelt auftretende Marsch- und Transportkolonnen ostwärts der Weichsel wurden mit Bomben und MGs. angegriffen und versprengt, Straßen und Straßenkreuzungen erheblich zerstört.
Im ukrainischen Raum wurden auf dem Flugplatz Luck 11 Flugzeuge am Boden zerstört, zwei in der Luft abgeschossen. Ueber Brody sind 8 polnische Flugzeuge nach kurzem Kampf brennend zum Absturz gebracht, 3 Flugzeuge am Boden vernichtet worden. Weitere 7 polnische Flugzeuge sind bei den Operationen des Heeres unversehrt in unsere Hände gefallen. Damit hat der Gegner am heutigen Tage 31 Flugzeuge, und zwar hauptsächlich Jäger, verloren. Die an sich schon geringe feindliche Jagdabwehr ist dadurch weiterhin erheblich geschwächt worden.
Berlin, 17. 9. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Die Säuberung Ostgaliziens schritt am 16. 9. weiter fort. Lemberg ist von drei Seiten umstellt, polnischen Kräften zwischen Lemberg und Przemysl der Rückzug nach Südosten verlegt. Nördlich der San-Mündung dringen unsere Truppen in Richtung Lublin weiter vor. Deblin wurde genommen. 100 unzerstörte Flugzeuge fielen dort in unsere Hand. Bei Wlodawa, südlich Brest, haben sich die vordersten Aufklärungstruppen der aus Ostpreußen und der aus Oberschlesien und der Slowakei angesetzten Armeen die Hand gereicht.
Der Versuch abgesprengter polnischer Truppen, über Siedice nach Südosten zu entkommen, endete mit der Gefangennahme von 12 000 Mann. 80 Geschütze, 6 Panzerwagen und 11 Flugzeuge wurden außerdem erbeutet.
Bei weiter ungünstiger Wetterlage nahm die Luftwaffe ostwärts der Weichsel durch wiederholte Angriffe auf Truppenansammlungen und Marschkolonnen dem zurückflutenden Gegner die Möglichkeit, seine Verbände zu ordnen. Die Rundfunksender Wilna und Baranowicze wurden durch Luftangriffe zerstört.
Im Westen erlitt der Feind bei einigen Stoßtruppunternehmungen in der Gegend von Zweibrücken erhebliche Verluste. Ein feindlicher Fesselballon wurde abgeschossen. Luftangriffe auf das Reichsgebiet fanden nicht statt.
Berlin, 17. 9. 39. OKW.: Wie ein im Handelskrieg eingesetztes U-Boot meldet, hat es am 14. 9. während der gemäß Prisenordnung vorgenommenen Untersuchung des englischen Dampfers „Fanadhead" zwei angreifende Flugzeuge des englischen
Flugzeugträgers „Ark Royal" zum Absturz gebracht und die Ueberlebenden (zwei Offiziere) der abgeschossenen Flugzeuge gerettet.
Bukarest, 17. 9. 39. Auf dem Flughafen von Czernowitz sind am 16. 9. vormittags bis 13 Uhr etwa 60 polnische Zivilflugzeuge gelandet. Um 17 Uhr trafen auch zahlreiche Militärflugzeuge ein. Augenblicklich liegen auf dem Flughafen Czernowitz etwa 200 polnische Flugzeuge, von denen etwa die Hälfte militärische Apparate sind. Auf dem Flughafen führt eine rumänische Militärkommission die Uebernahme und Entwaffnung der polnischen Flugzeuge durch.
Berlin, 18. 9. 39. (DNB.) OKW.: Der Feldzug in Polen geht seinem Ende entgegen.
Die Luftwaffe griff die südwestlich Wyszogrod eingeschlossenen polnischen Kräfte wirksam an. Polnische Fliegerkräfte traten an der ganzen Front nicht mehr in Erscheinung.
Die deutsche Luftwaffe hat damit die hier im Osten gestellte Aufgabe im wesentlichen erfüllt. Zahlreiche Einheiten der Fliegertruppe und Flakartillerie sind zusammengezogen und stehen für anderweitige Verwendung bereit.
Im Westen keine nennenswerten Kampfhandlungen. Bei Saarbrücken wurde ein französisches Flugzeug von einem deutschen Jäger abgeschossen. Luftangriffe auf deutsches Hoheitsgebiet haben am 17. 9. nicht stattgefunden.
Saarbrücken, 18. 9. 39. Auf dem Saarbrücker Friedhof wurden zwei über deutschem Reichsgebiet abgeschossene französische Fliegeroffiziere, Kpt. Jaques Rosignol und Ltn. Jean Sueur, beide vom 2. Aufklärungsgeschwader Nr. 551, mit militärischen Ehren beigesetzt.
Riga, 18. 9. 39. DNB.: Wie von amtlicher lettischer Seite mitgeteilt wird, sind im Laufe der letzten 24 Std. auf lettländischem Hoheitsgebiet eine ganze Reihe polnischer Heeresflugzeuge gelandet. Eine amtliche Zahl steht noch nicht fest, doch dürfte sie zwanzig wesentlich übersteigen. Die Flugzeuge wurden von den lettischen Behörden beschlagnahmt und die polnischen Besatzungen interniert.
London, 18. 9. 39. DNB.: Wie die britische Admiralität mitteilt, ist der britische Kreuzer „Courageous", der nach dem Kriege zu einem Flugzeugträger umgebaut worden war, einem feindlichen Unterseeboot zum Opfer gefallen. Die Ueberlebenden wurden von Zerstörern und Handelsschiffen aufgenommen. Der frühere große Kreuzer und jetzige Flugzeugträger „Courageous" hat eine Wasserverdrängung von 22 500 To. und war zur Aufnahme von 52 Flugzeugen bestimmt.
Berlin, 19. 9. 39. (DNB.) OKW.: Die Schlacht an der Bzura ist zu Ende. Die Luftwaffe hat gestern nur noch einzelne Angriffsflüge durchgeführt. Im übrigen war ihr Einsatz an der Ostfront nicht mehr nötig.
An der Westfront im Räume von Saarbrücken an einzelnen Stellen schwache Artillerie- und Spähtrupptätigkeit. Beim Gegner wurden vielfach Schanzarbeiten beobachtet. Kampfhandlungen in der Luft fanden nicht statt.

Bei Wilhelmshaven abgeschossenes englisches Flugzeug.
Die von der britischen Admiralität bekanntgegebene Versenkung des Flugzeugträgers „Courageous" ist durch Meldung des angreifenden deutschen U-Bootes bestätigt worden.
Berlin, 20. 9. 39. (DNB.) OKW.: Die Zahl der Gefangenen hat sich gestern allein an der Bzura auf 105 000 Mann erhöht und wächst ständig an. Das erbeutete Kriegsmaterial ist unübersehbar.
Der Einsatz der Luftwaffe beschränkt sich an der ganzen Front auf Auf-klärungstätigkeit.
Berlin, 21. 9. 39. (DNB.) OKW.: Bis zum Nachmittag des 20. 9. war die Zahl der Gefangenen auf 170 000 gestiegen. 320 Geschütze und 40 Kampfwagen wurden erbeutet.
Im Westen wurden drei Fesselballone und acht feindliche Flugzeuge abgeschossen. Sonst keine Ereignisse.
Berlin, 22. 9. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Im Westen nur vereinzelte Stoßtruppunternehmungen. Ein französisches Jagdflugzeug wurde im Luftkampf abgeschossen.
Führerhauptquartier, 22. 9. 39. Der Führer begab sich am 22. 9. zu den siegreichen Truppen der Nordarmee, die durch ihren Vormarsch über Bug und Narew und den Stoß auf die Bahnlinie zwischen Minsk und Warschau einen wesentlichen Anteil an dem raschen und siegreichen Ende der Umfassungsschlacht in Polen hatte. Der Flug führte über Danzig, die Marienburg und das südliche Ostpreußen, mitten hinein in das Operationsgebiet der letzten Woche.
Berlin, 22. 9. 39. Die deutsche Regierung und die Regierung der UdSSR, haben die Demarkationslinie zwischen dem deutschen Heer und der Roten Armee festgelegt. Die Demarkationslinie verläuft entlang den Flüssen Pisia, Narew, Weichsel und San.
Bern, 22. 9. 39. (DNB.): Der Pruntruter Zipfel (20 km südöstlich von Beifort) wurde, wie erst jetzt bekannt wird, am Mittwochnachmittag von zwei französischen Flugzeugen, die aus verschiedenen Richtungen kamen, überflogen. Die eine französische Maschine, wie man annimmt ein Bomber, erschien über der Stadt Pruntrut von Alle (also von Nord@sten) her und entfernte sich in Richtung Besancon. Das andere französische Flugzeug flog von Delle (französischer Grenzort nordwestlich von Pruntrut) her in den Pruntruter Zipfel. Es überflog den schweizerischen Zollposten Boncourt, wo es beschossen wurde, und trat dann den Rückflug an.
Berlin, 23. 9. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Der Feldzug in Polen istbeendet.
Auszugsbericht Luftwaffe: Nach den Befehlen des Generalfeldmarschalls Göring (Chef des Generalstabes Generalmajor Jeschonnek) wurden zwei starke Luftflotten unter den Generalen der Flieger Kesselring und Lohr gebildet und zur Führung des Luftkrieges gegen Polen eingesetzt. Diese beiden Luftflotten haben die polnische Fliegertruppe restlos zerschlagen, den Luftraum in Kürze beherrscht. In engster Zusammenarbeit mit dem Heere haben in ununterbrochenen Einsätzen Schlacht- und Sturzkampfflieger Bunkerstellungen, Batterien, Truppenansammlungen, Marschbewegungen, Ausladungen und so weiter angegriffen. Durch ihre Todesverachtung haben sie dem Heere unendlich viel Blut erspart und zum Gesamterfolg in höchstem Maße beigetragen.
Die Flakartillerie nahm den deutschen Luftraum unter ihren Schutz und wirkte besonders im Anfang des Feldzuges mit an der Vernichtung der polnischen Fliegertruppe. Im ganzen sind rund 800 Flugzeuge vernichtet oder vom Heere erbeutet, ein letzter Rest außer Landes geflüchtet und interniert.
Segelflugzeugbau in Japan.
Segelflugzeugbau in Japan betrug im Jahre 1937 89, im Jahr 1938 184, im Jahr 1939 von Januar bis Mai 76, insgesamt 349 Segelflugzeuge, ausgenommen Militär- und Exportaufträge.

Segelflug
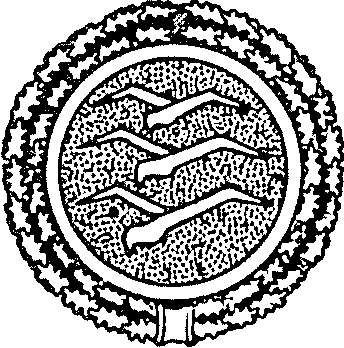
Die Abmessungen der wichtigsten japanischen Segelflugzeuge sind folgende:
Itoh C6: Spw. 17 m, Länge 17,03 m, Fläche 17 m2, Seitenverhältnis 17, Leergew. 180 kg, Fluggew. 255 kg, Flächenbelastung 15 kg/m2, Sinkgeschw. 0,63 m/sec, Gleitwinkel 23.
Itoh Dl (Zweisitzer): Spw. 18,21 m, Länge 7,21 in, Fläche 18,70 m2, Seitenverhältnis 17,7, Leergew. 220 kg, Fluggew. 370 kg, Flächenbel. 19,8 kg/m2, Sinkgeschw. 0,71 m/sec, Gleitwinkel 24,5.
HikariRokko 2: Spw. 15,32 m, Länge 5,95 m, Fläche 14,5 m2, Seiten-verh. 16,2, Leergew. 176 kg, Fluggew. 251 kg, Flächenbel. 17,3 kg/m2, Sinkgeschw. 0,68 m/sec, Gleitwinkel 25.
Hikari Rokko 1 (Zweisitzer): Spw. 16 m, Länge 7,12 m, Fläche 20,60 nr, Seitenverh. 12,4, Leergew. 210 kg, Fluggew. 360 kg, Flächenbel. 17,5 kg/m2, Sinkgeschw. 0,81 m/sec, Gleitwinkel 21,5.
Satoh T. C: Spw. 15,60 m, Länge 6 m, Fläche 15 m2, Seitenverhältnis 16,2, Leergew. 150 kg, Fluggew. 225 kg, Flächenbel. 15 kg/m2, Sinkgeschw. 0,66 m/sec, Gleitwinkel 24.
Nippon Ohtori: Spw. 13,20 m, Länge 6,41 m, Fläche 13,10 kg/m2, Seitenverhältnis 13,3, Leergew. 125 kg, Fluggew. 200 kg, Flächenbel, 15,30 kg/m2, Sinkgeschw. 0,70 m/sec, Gleitwinkel 24,5.
Nippon Washi (Zweisitzer): Spw. 19 m, Länge 8 m, Fläche 23 nf, Seitenverhältnis 15,7, Leergew. 210 kg, Fluggew. 360 kg, Flächenbel. 15,7 kg/m2, Sinkgeschw. 0,72 m/sec.
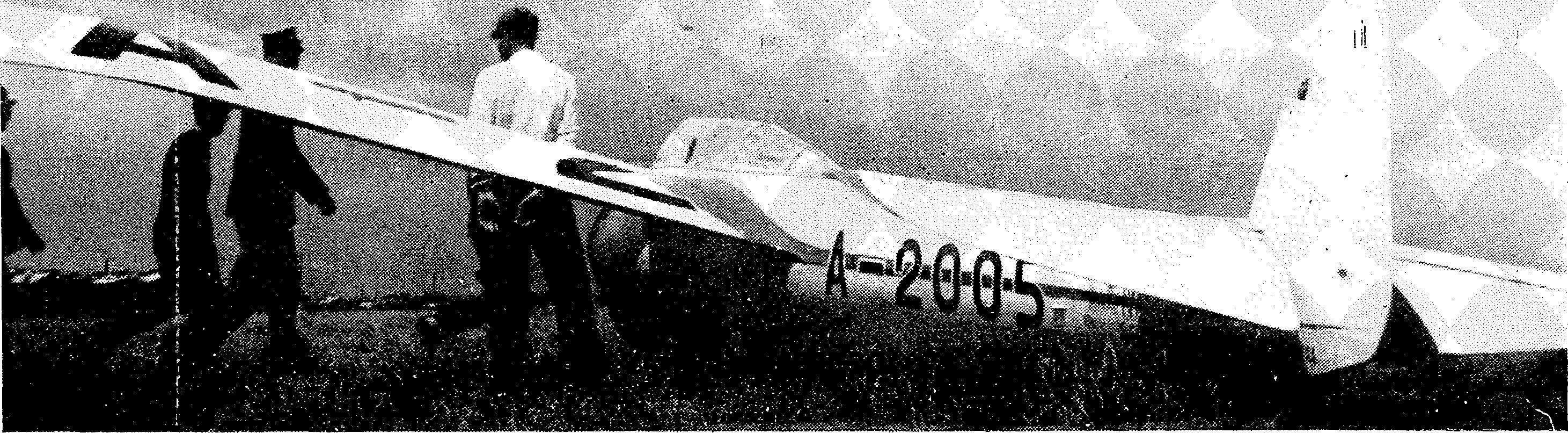
Japan. Segelflugzeug Typ Satoh T. C. Archiv Flugsport
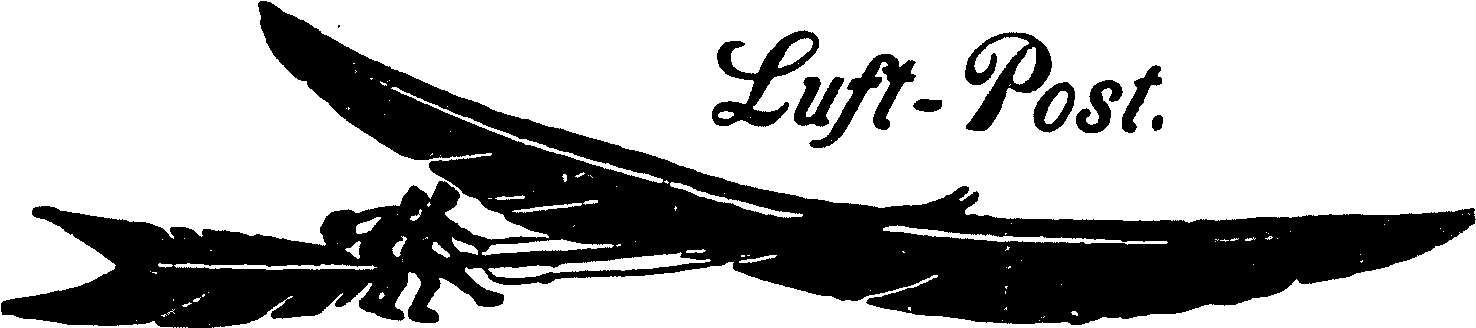
Abzeichen für Militärflugzeuge. Frankreich: Auf den Flügeln Kokarde blauweiß-rot (von innen nach außen gezählt: innerer Punkt blau, darauffolgender Ring weiß, äußerer Ring rot), auf dem Seitenruder senkrechte Streifen blau-weißrot (vom Scharnier an gezählt). Bei den Marine-Kriegsflugzeugen ist so groß wie die Kokarde noch ein schwarzer Anker übergemalt, ferner auf dem Seitenruder ein Anker auf der Mitte des weißen Streifens.
Großbritannien: Kokarde rot-weiß-blau (von innen nach außen gezählt) auf Tragflächen und Rumpf.
Belgien: Kokarde in Landesfarben schwarz-gelb-rot (von innen nach außen) auf Tragflächen, auf Seitenruder senkrechte Streifen schwarz-gelb-rot (vom Scharnier an).
Niederlande einschl. Kolonien: Kokarde auf Rumpf und Tragflächen, bestehend aus drei farbigen Sektoren rot-weiß-blau (im Uhrzeigersinn gezählt) mit kleiner, orangefarbener Scheibe in der Mitte. Auf dem Seitenruder waagerechte Streifen rot-weiß-blau (von oben nach unten).
Rumänien: Kokarde blau-gelb-rot (von innen nach außen) auf den Tragflächen, auf Seitenruder senkrechte Streifen blau-gelb-rot (vom Scharnier an).
Schweiz: Weißes Kreuz in rotem Feld auf Tragflächen und Seitenruder.
Türkei: Rotes Quadrat, weiß umrandet, auf Rumpf und Tragflächen, auf Seitenruder weißer Halbmond und Stern in rotem Feld.
USSR: Fünfzackiger roter Stern auf den Tragflächen, teilweise auch auf beiden Seiten des Rumpfes.
V. St. A.: Rote Scheibe in fünfzackigem, weißem Stern auf blauem Grunde in Form einer Kokarde auf den Tragflächen, auf Seitenruder rotweiße Querstreifen, davor senkrechter blauer Streifen.
Höhen- und Seitenruder statisch und aerodynamisch ausgeglichen. Ruder statisch ausgeglichen, wenn durch vorstehende Lappen oder Rücklage der Ruderachse um diese sich die Luftkräfte aufheben. Nur kleine Drücke in der Steuerleitung. Aerodynamischer Ausgleich, meist nur Gewichtsausgleich, um flatternde Ruder zu vermeiden.
Fallschirmsinkgeschwindigkeit 5 bis
7 m/sec. Fallgeschwindigkeit eines Menschen bei nicht entfaltetem Fallschirm 50—55 m/sec.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Physikalische und chemische Vorgänge bei der Verbrennung im Motor.
Heft 9 d. Schriften d. Deutschen Akademie d. Luftfahrtforschung. Verlag R. Olden-bourg, München. Preis RM 30.—.
Wie können die Kraftstoffe im Motor am vorteilhaftesten ausgenutzt werden? Hierzu ist genaue Kenntnis der physikalischen und chemischen Vorgänge bei der Verbrennung im Motor Voraussetzung. Vorerst ist die wirkliche Kenntnis der tatsächlichen Vorgänge bei der motorischen Verbrennung noch ziemlich ungeklärt. Hier müssen noch viele Probleme gelöst werden. Viele Vorträge und Aussprachen lassen erkennen, wie weit man in die Materie eingedrungen ist und wo dringend neue Forschung betrieben werden muß. Eingehend ist das bekannte Klopfen, welches bei stark beschleunigtem Verbrennungsablauf eintritt, behandelt worden, vor allem die zwei grundlegenden Fragen: „Unter welchen Bedingungen geht die normale Verbrennung in die klopfende Verbrennung über?" und „Ist die klopfende Verbrennung eigentlich eine Detonation oder ist sie die Selbstzündung eines Teils der Ladung?". Abschließend behandelt der Motorenbauer die Frage, wie durch fortschreitende konstruktive Gestaltung das Entstehen der schädlichen Klopferscheinungen immer mehr verhindert werden konnte und welche Literleistungssteigerungen bei Verbrennungsmaschinen möglich sind.
Taschenbuch für den Maschinenbau, herausgeg. v. Prof. H. Dubbel. 7. Aufl., 2 Bd., 1542 S., etwa 3000 Abb. Verlag Julius Springer, Berlin. Preis RM 19.80.
Die neue 7. Auflage ist, mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des Ingenieurs, der sich schnell einen Ueberblick über fernliegende Fachgebiete verschaffen will, vollständig neu durchgearbeitet worden. Das Kapitel Flugtechnik hat Prof. Dr.-Ing. A. Pröll mit großer Liebe ausführlich behandelt. Neu aufgenommen sind Strömungslehre, Schweißkonstruktionen, bearbeitet v. Dipl.-Ing. Richard Hänchen, Bauelemente des Flugzeuges, bearbeitet v. Prof. Dubbel, Berlin. Hervorzuheben sind die exakte und übersichtliche Behandlung des Stoffes und die sauberen, in einheitlicher Manier hergestellten Abbildungen. Wer den Dubbel noch nicht kennt, wird diesen, wenn er ihn erst einmal benutzt hat, nicht mehr missen mögen.
Rundfunk! Wer lernt mit? Von Gustav Büscher. Verlag Deutsch-Literarisches Institut J. Schneider, Berlin-Tempelhof. Preis RM 1.80.
Als Fachmann ist es manchmal schwer, Laienfragen über die Fortpflanzung kurzer oder langer Wellen, über Vorgänge im Empfänger selbst oder das Fernsehen und vieles andere mehr, zu beantworten. Verfasser gibt an Hand von ausgezeichneten, zum Teil drastischen Bildern leicht verständliche und anschauliche Erläuterungen, wie man sie im Unterricht und im täglichen Leben braucht.
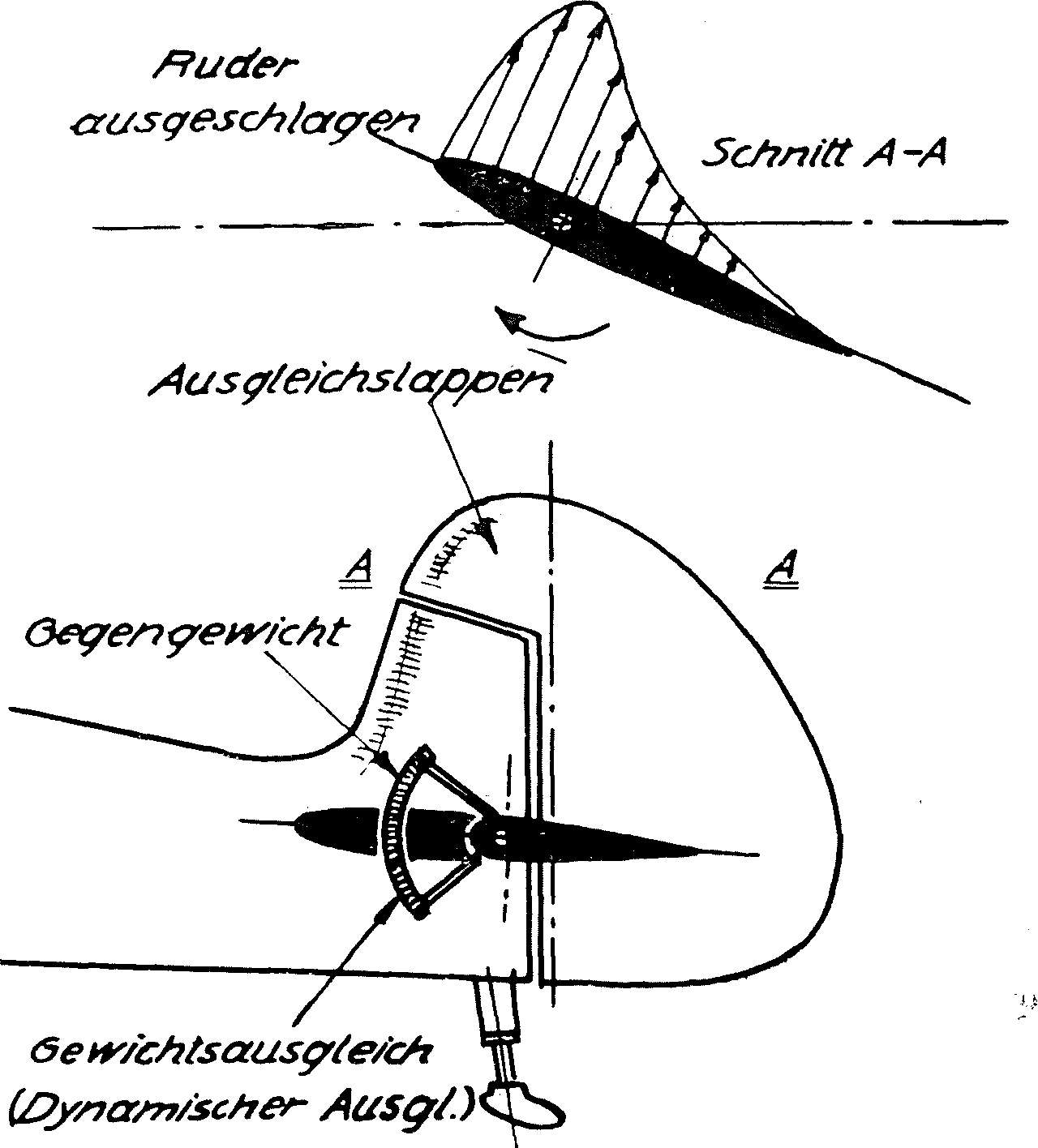
100 praktische Rundfunkwinke von Ing. Otto Kappelmayer. Deutsch-Literarisches Institut J. Schneider, Berlin-Tempelhof. Preis RM 1.80.
Oft kommt man in die Lage, irgendwelche Reparaturen auszuführen, um Störungen zu beseitigen. In wissenschaftlichen Büchern herumzusuchen, führt oft nicht zum Ziele. Das vorliegende Büchlein ist hierfür ein praktischer Ratgeber.
Schalttechnische Verbesserungen an älteren Empfängern von Ing. Otto Kappelmayer. Deutsch-Literarisches Institut J. Schneider, Berlin-Tempelhof. Preis RM 1.—.
Bei der fortschreitenden Entwicklung im Rundfunkempfängerbau ergibt sich die Notwendigkeit, alten Rundfunkgeräten etwas nachzuhelfen. Man steht vor der Frage, wie muß ich vorgehen. Verfasser hat in vorliegendem Büchlein alles Wissenswerte über Verbesserungen zusammengefaßt und praktische Ratschläge gegeben.
Expedition des wrf A ITffDfrVIT Expedition des
>FÄsrfa°ST<< IVLEINE ANZEIGEN '^n?f?rfa0sT<<
Die di-elgespadierae Milliineier^Xeile kostet 2.3 Pfennig.
INGENIEURSCHULE
| |.| MASCHINENBAU . ELEKTRO I I I TECHNIK . AUTOMOBIL- UND III FLUGZEUGBAU | II ' PROSPEKT ANFORDERN
WEIMAR;
SE-M ESTER BEGINN': APRIL UNO-OKTOBER flGENE WERKSTÄTTEN ' .....
.RIVISTA AER0NAUTICA'
Illustrierte monatliche Zeitschrift
Herausgegeben durch italienisches
Luftfahrtministerium Ministero dell' Aeronautica, Roma
Enthält Orig.-Abhandlungen üb. den Luftkrieg u. üb. die Luftfahrttechnik, weitere Nachrichten über den internationalen Luftverkehr auf dem militärischen, wissenschaftlichen u. Handelsgebiet, sowie zahlreiche Buchbesprechungen.
Abonnementspreis für Italien u. Kolonien it. L. 64,80 für Ausland .... it. L. 144,—
Ein separates Heft
für Italien.....it. L. 9—
für Ausland . . . . it. L. 19,—
genieur. schule
p
I Maschinenbau / Automobil- u. Flugtechnik I I Bektrotechnik._Programm kostenlos j
Fl ugzeug «Spann lacke
Marke „Cellemit", liefert seit 1911
Dr. Quittner & Co.
Berlin«Lichtenberg Rittergutstraße 152, Fernr. 612562
Birken*Flugzeugi Sperrholzplatten
deutsches Fabrikat
bei Rekordflügen erprobt, In den Qualitäten: AVIATIC, SPEZIAL, QLEITFLUQ in allen Stärken von 0,4-8 mm liefert prompt ab Lager
Georg Herte Berlin*Charlottenburg
Kaiser Friedrich-Straße 24 Fernspr.-Sammelnummer: 34 5841 Telgr.-Adr.: FlieKerhölzer Berlin
Eingebunden ist der „Flugsport" ein Nachschlagewerk von Wert!
*4#
>t*e»* und ^ Fallschirme
aller Art
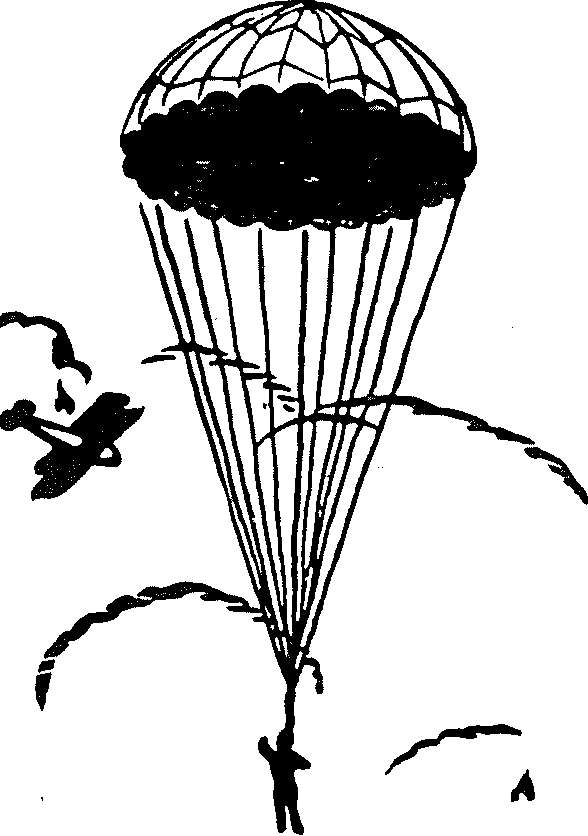
SCHROEDER & CO,
Berlin-Neukölln
Bergstraße 93-95
Älteste Flugzeuge Fallsdiirm-Iabrik der Welt
Einbanddecken
Leinen und mehrfarbig, Preis RM S.Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M.
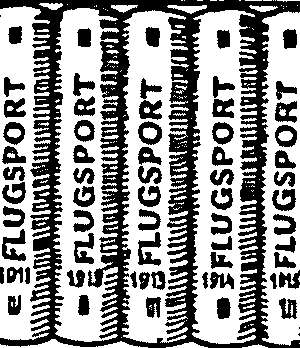
Patenfsammlung
BandYH
enthaltend die Flugpatente der Jahre 1937 und 1938.
Preis RM 6.30 portofrei. Redaktion u. Verlag Flugsport Frankfurt/M., Hindenburgplafj
Heft 21/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro 34 Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telecr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstaltcn und Verlac Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Ouellenaneabe gestattet.
Nr. 21
11. Oktober 1939
XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 25. Oktober 1939
Deutsche Luftfahrtindustrie.
An den überraschenden Erfolgen unserer Luftwaffe in Polen haben neben dem hohen Ausbildungsstand unserer Flieger und ihrem Schneid die von ihnen geführten Flugzeuge — somit die deutsche Luftfahrtindustrie — Anteil. Die einzelnen Flugzeugtypen, Jagd- und Aufklärungsflugzeuge, Bomber und Sturzbomber, haben sich ausgezeichnet bewährt.
Die Steigerung der Wirkung unserer deutschen Luftwaffe war besonders augenfällig in den Angriffswaffen, und war die Ursache, weshalb die Abwehrwaffen weniger in Erscheinung traten. Trotzdem wurden im September 72 feindliche Flugzeuge an der Westfront abgeschossen. Außerordentlich überraschte die Angriffswucht unserer Sturzkampfflugzeuge, die sehr bald für alle möglichen Aufgaben eingesetzt wurden.
Es ist nicht Aufgabe dieser Zeitschrift, in wehrpolitischer Hinsicht die Leistungsfähigkeit und Leistungssteigerung zu umreißen. Viel wichtiger ist es, jetzt immer wieder daran zu erinnern, daß vermehrte Konzentration der einzelnen Kräfte, von der Betriebsführung an bis zum letzten Stift, etwas Selbstverständliches sein muß.
Unsere Flugzeug- und Motorenindustrie hat Großes geleistet. Ihr Ansehen ist im Ausland bedeutend gestiegen. Deutsche Maschinen und Flugzeuge haben Weltruf erlangt. Deutsche Flugzeuge werden bevorzugt. Fortgesetzt werden Flugzeuge auf dem Luftwege nach dem Ausland abgeliefert. Unsere Luftfahrtindustrie kann noch mehr leisten.
Mit dem bisher Erreichten können und werden wir uns nicht zufriedengeben. Forschung und Entwicklung werden zu neuen Leistungssteigerungen führen. Daneben strömt neuer Nachwuchs heran, der durch Schulung und Ausbildung zum baldigen Einsatz im Betrieb vorbereitet wird. Damit ist die Gewähr gegeben, daß ein Nachlassen in der Leistungssteigerung der deutschen Flugzeug- und Motorenindustrie unmöglich wird.
Diese Nummer enthält Patent-Sammlung Nr. 16.
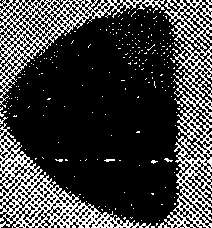
USA. Bellanca „Cruisair", Kabinendreisitzer, Typ 14—9.
Werkbild
USA Bellanca Cruisair Dreisitzer Kabine, Typ 14-9.
Die Bellanca Aircraft Corporation, Newcastle, Delaware, USA, hat einen einmotorigen Kabinentiefdecker entwickelt, der seine Typenprüfung mit dem Certificat Nr. 716 erfüllt hat. Charakteristisch für diesen neuen Typ sind die Endscheiben an dem Höhenleitwerk, welche verhindern sollen, daß die Maschine ins Trudeln gerät.
Flügel-Profil Bellanca ,,B". Zwei Spruceholme, mit Sperrholz bedeckt, oben und unten vom hinteren Flügelholm über den Vorderholm bis zur Flügelnase. Rippen vom hinteren Holm einschließlich Querruder sowie Flügelspitzen mit Leinwand bedeckt. In der linken Flügelwurzel Betriebsstoffbehälter 90 1, in der rechten Gepäckraum. Querruder statisch und dynamisch ausgeglichen. Flügelbefestigung am Rumpf mit vier Bolzen.
Rumpf Stahlrohr geschweißt. Zwischen den Flügelholmanschlüssen stärkere, die Flügelkräfte aufnehmende Stahlrohre. Motorbock abnehmbar. Führersitz Doppelsteuerung. Rechte Seite abnehmbar. Auf den Seitenruderpedalen Bremspedale für das Fahrwerk. Höhen-trimmklappenverstellung durch Kurbel über dem Kopf des Führers.
Seitenleitwerk Flosse Stahlrohr, mit dem Rumpfgerippe verschweißt. Höhenleitwerksfläche gegen Rumpf und feste Flosse verstrebt. Seiten- und Höhenruder Stahlrohr, letzteres mit Trimmklappen.
Hochziehbares Fahrwerk, Oleostoßauf nehmerstrebe, Oel- und Federtype, Knickstrebe nach hinten. Goodrich-Palmer-Bereifung mit Bremsen. Im hochgezo-genen Zustand liegen die Räder vor dem Hinterholm, noch halb hervorstehend (nicht verkleidet). Hochziehen durch Handkurbel, zwischen den beiden Führersitzen liegend. Elektrischer Warnanzeiger
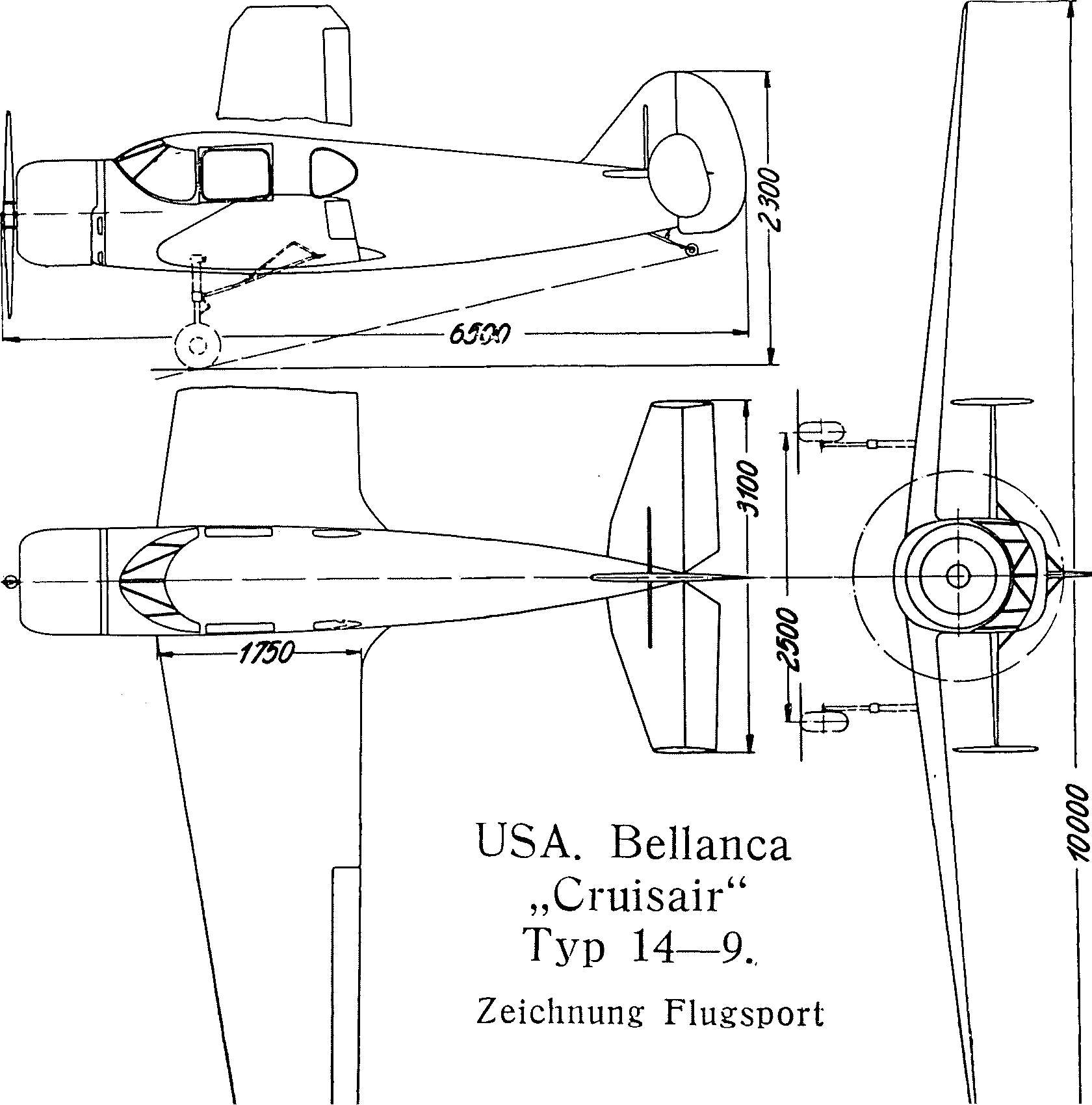
USA. Bellanca „Cruisair", Kabinendreisitzer, Typ 14—9. Unten links: Hochziehbares Fahrwerk. Rechts: Führerraum mit Instrumentenbrett. Werkbilder
rote Lampe auf dem Instrumentenbrett, ferner mechanischer Anzeiger auf der Flügeloberseite.
Kabine 2,2 m lang, 0,96 m breit und 1,1 m hoch, drei rote Lackledersitzt, einer davon hinten. Einstieg auf der rechten Seite. Lehnen müssen dabei nach vorn geklappt werden. Anordnung der Sichtfenster aus der Abbildung erkenntlich.
Motor Le Blond Fünfzylinder-Stern, Doppelzündung, 90 PS bei 2250 U/min, NACA-Haube in zwei Hälften, leicht abnehmbar, üel-behälter 2 1 vor dem Brandschott.
Spannweite 10,3 m, Höhe 1,875 m, Länge 6,42 m, Fläche 14,9 m2, Leergewicht 470 kg, Fluggewicht 770 kg. Max. Geschwindigkeit
Heinkel Jagdeinsitzer fie 112 wurden am 27.9. 11 Maschinen nach Rumänien
überführt und abgeliefert. Werkbild
210 km/h, Reisegeschw. 192 km/h, Landegeschw. 75;5 km/h. Steigfähigkeit 225 m/min, Gipfelhöhe 4200 m, Reichweite 670 km.
Preis mit Le-Blond-Motor, hochziehbarem Fahrwerk 3795 $. Besondere Ausrüstung: Wendezeiger Pioneer (0554 kg) 125 $. Steigmesser Pioneer (0,86 kg) 90 $, Höhenmesser Pioneer (0,59 kg) 180 $. Navigationslichter Grimes (0,68 kg) 30 $, besondere Luxuslackierung (2,3 kg) 95 $. Kabinenheizung (1,2 kg) 45 $, Zusatzbetriebsstoffbehälter für die rechte Flügelseite (4,6 kg) 80 $.
Heinkel He 115 Torpedoflugzeug.
Das See-Mehrzwecke-Flugzeug He 115 (vgl. Typenbeschr. „Flugsport" 1938 S. 710) hat durch seine am 19. 3. 1938 aufgestellten 8 neuen Welthöchstleistungen zum erstenmal seine Leistungsfähigkeit bewiesen. Seit der Zeit bekundete das Ausland für diese Maschine lebhaftes Interesse. Schweden bestellte eine ganze Serie von Maschinen, von denen die zehnte vom Typ He 115 dieser Tage von Rostock-Marienehe nach Schweden überführt wurde. Weitere Lieferungen erfolgen in den kommenden Wochen.
Das Torpedo-Flugzeug He 115 ist für die Luftwaffe der skandinavischen Länder durch seine Fähigkeit, auf Eis und Schnee landen und starten zu können, besonders verwendungsfähig. Längere Eis-
1
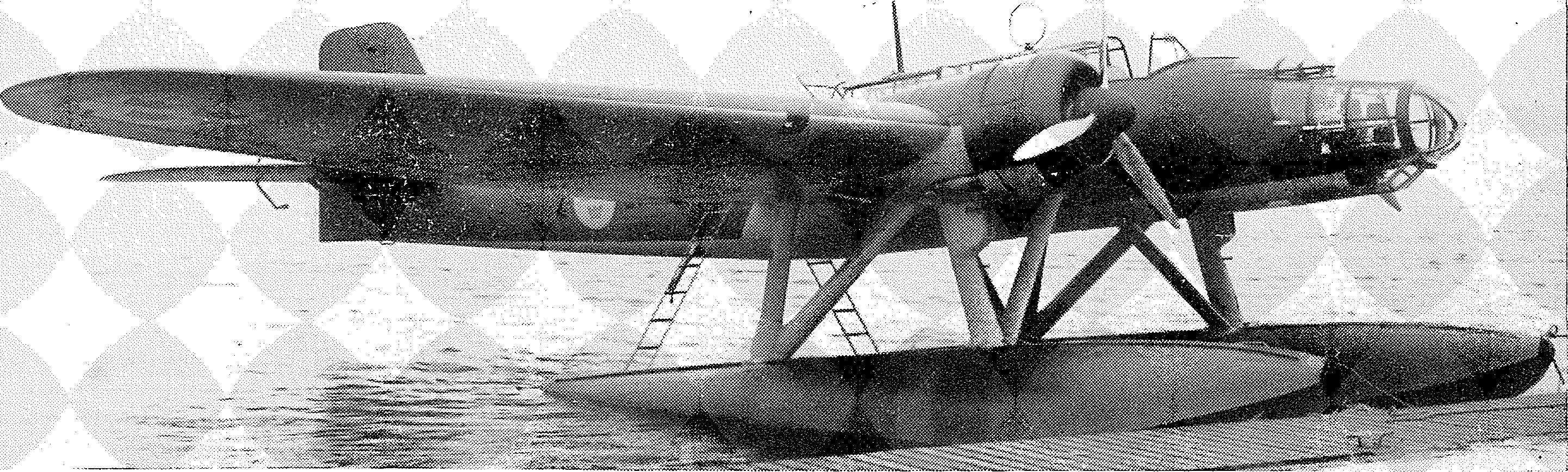
Heinkel He 115 Torpedoflugzeug aus einer Serienlieferung für Schweden. Aufnahme auf dem Wasserflughafen Marienehe. Werkbild
erprobungen, die Anfang 1939 im hohen Norden mit Maschinen von der Bauart He 115 stattfanden, haben die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieses Heinkel-Seeflugzeuges in den besonderen klimatischen Verhältnissen Skandinaviens bewiesen. Die Ausführung als Torpedo-Maschine, Torpedo im Rumpf, zeigt die nebenstehende Abbildung.
Spannweite 22,15 m, Länge 17,025 m, Höhe 6,325 m, Flügelinhalt 86,7 m2. Leergewicht 5305 kg, Fluggewicht 9100 kg.
Bei dem Flug am 19. 3. 38 erreichte bekanntlich dieses Flugzeug auf einem Flug über 2000 km mit 2000 kg Nutzlast die Geschwindigkeit von 329 km/h, über 1000 km sogar 331 km/h.
Fiat CR. 25 Zweimotor-Bomber.
Der Fiat CR. 25 war als Bomber konstruiert, wird wegen seiner hohen Geschwindigkeit und Wendigkeit als Langstreckenerkun-dungs- und als Begleitflugzeug benutzt.
Flügel freitragend, dreiteilig. Mittelstück mit Fahrwerk und Motoren an den Ansatzflügeln mit vier Bolzen befestigt. Flügelaufbau zwei Metallholme. Im Mittelstück Gitterträgerbauweise mit Rohrstreben. Nach den Flügelenden ausgesparte Stegbleche. Querruder Ganzmetall, sehr lang, zweiteilig, am Mittelstück getrennt.
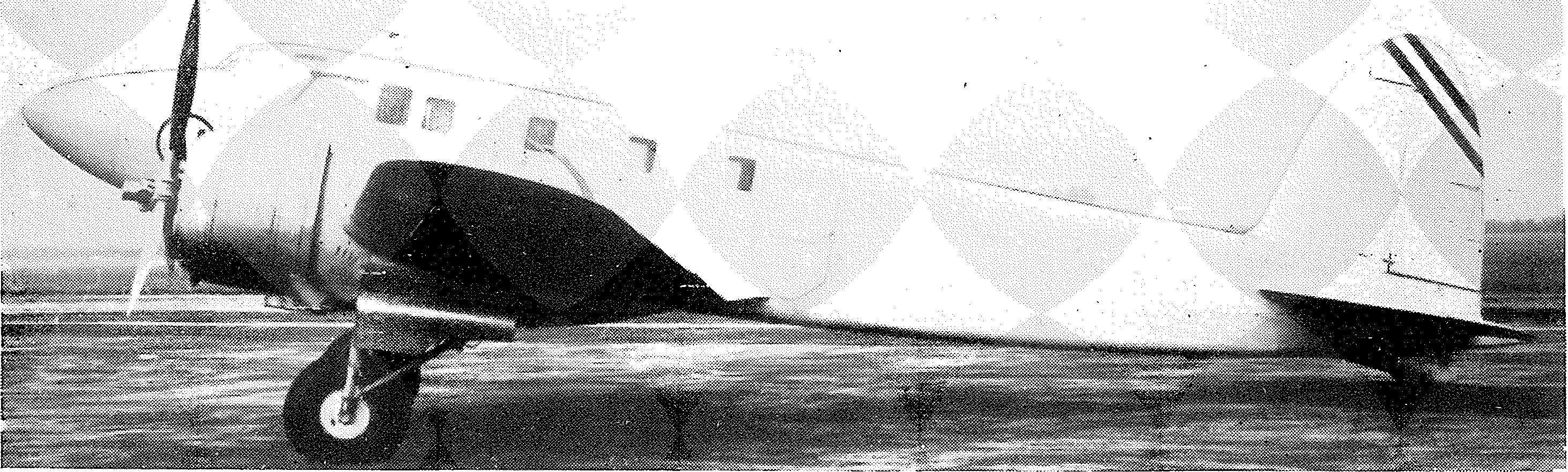
Ital. Zweimotor-Bomber Fiat CR. 25. Werkbild
Rumpf dreiteilig-, mit Rücksicht auf leichte Auswechslung bei Reparaturen. Stahlrohrgerippe mit Profilauflagen zur Formgebung aus Elektron. Führer- und Reserveführersitz hintereinander. Daneben ein schmaler Verbindungsgang nach dem Hinterteil des Rumpfes.
Fahrwerk nach hinten hydraulisch hochziehbar. Wird hochge-zogen durch zwei runde Blechverkleidungen abgedeckt.
Höhenleitwerk fest am Rumpf. Höhen- und Seitenruder ausgeglichen mit verstellbaren Trimmklappen. Steuerbetätigung durch doppelte Kabelzüge.
Bombenmagazin im mittleren Teil des Rumpfes. Zusatzbomben-auslösevorrichtungen können zwischen Rumpf und Motoren unter den Flügeln angebracht werden. Bewaffnung zwei MG.s vor dem Führersitz. Im hinteren Teil des Rumpfes ein nach oben ausfahrbarer MG.-Turm, von welchem im Sturzflug nach hinten sowie nach vorn gefeuert werden kann.
Zwei Doppelreihen-Sternmotoren Fiat A. 74 RC 38 von 840 PS in 3800 m Höhe. Untersetzt, überkomprimiert. Sterndurchmesser 1,19 m. NACA.-Haube mit verstellbaren Kragenklappen.
Spannweite 15,80 m, Länge 13,50 m, Höhe 3,4 m, Höchstgeschwindigkeit in 4500 m Höhe 460 km/h, Landegeschwindigkeit 125 km/h. Steigzeit auf 4000 m 7 min, auf 6000 m 13 min. Theoretische Gipfelhöhe 9800 m, praktische Gipfelhöhe 9400 m, mit einem Motor 4300 m. Reichweite 1900 km.
Niederl. Bomber Fokker T-9.
Das zweimotorige Ganzmetall-Bombenflugzeug mit 2 Bristol-Hercules-Motoren ist für die Luftwaffe in Niederländisch-Indien gebaut worden.
Flügel Schulterdeckeranordnung, freitragend, Motoren unterhalb des Flügels vor der Flügelnase. Ansatzflügel leicht V-förmig gestellt.
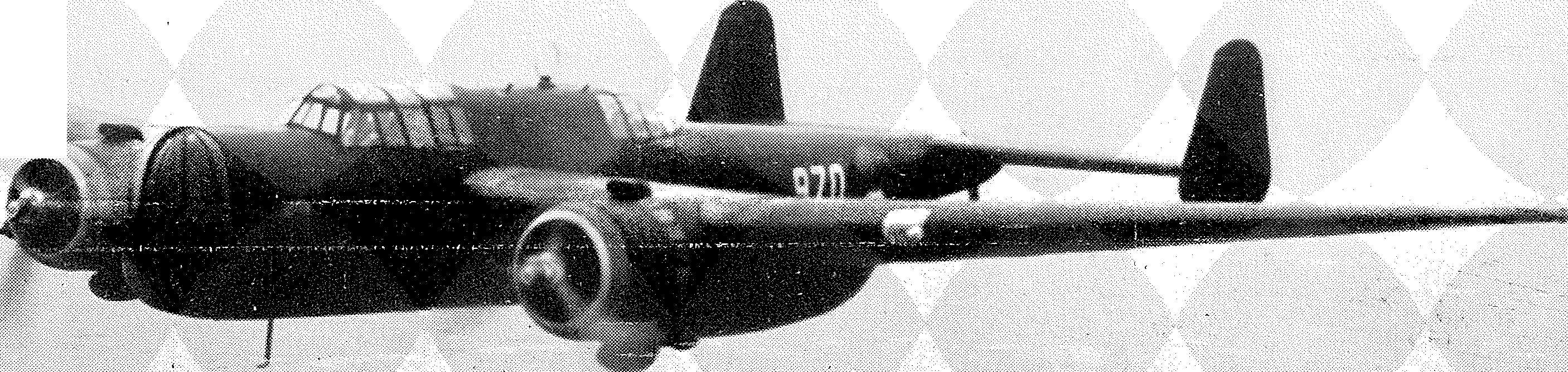
Niederl. Bomber Fokker T—9.
Werkbild
Rumpf 3 Gefechtsstände, einer in der Rumpfnase mit hoher, flacher Sichtkanzel. Langer Kabinenaufbau für Führer und hinteren MG.-Schützen mit Gesichtsfeld über dem Flügel. Ferner ein MG.-Stand auf der Rumpfunterseite. Höhenleitwerk auf der Rumpfoberseite. Doppeltes Seitenleitwerk für Schußfeld nach hinten. Verschwindfahrwerk nach hinten oben in die Motorverkleidung.
Franz. Bomber Bloch 135-B. 4.
Der von der SNCA. de Sud-Ouest entwickelte viermotorige schwere Bomber in Ganzmetallbauweise ist für 4 Mann Besatzung bestimmt.
Flügel freitragend in Tiefdeckeranordnung, Spreizklappen. 4 Motoren in der Flügelnase.
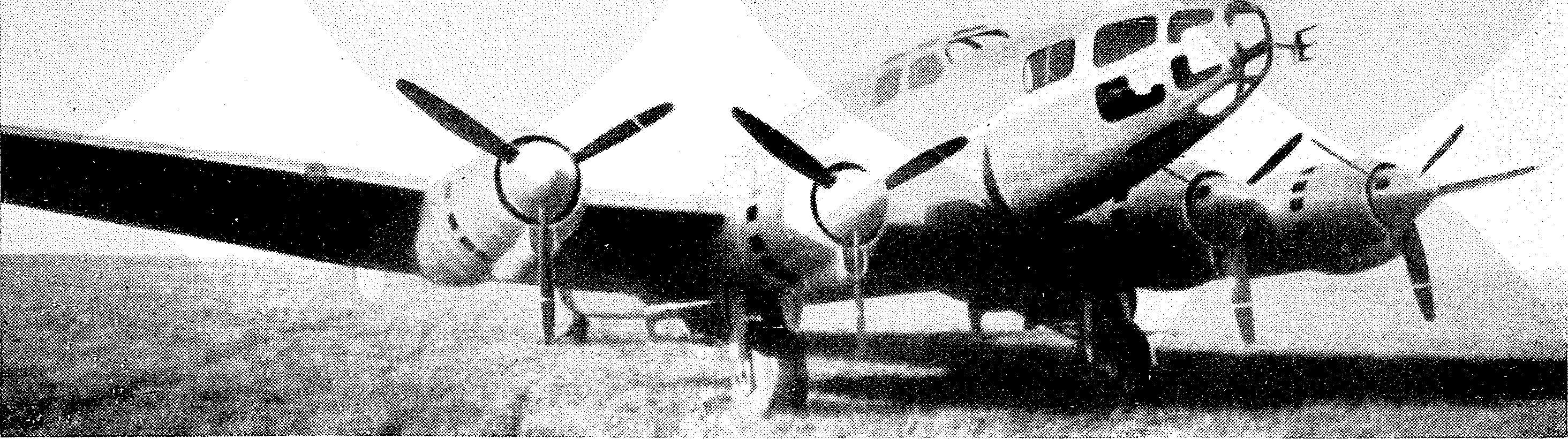
Franz. Bomber Bloch 135-B. 4. Archiv Flugsport
Rumpf Schalenbauweise, doppeltes Seitenleitwerk. Fahrwerk nach hinten in die Motorverkleidung hochziehbar.
Bestückung: 1 bewegliches MG. in der Rumpfnase, 1MK. 20mm auf der Rumpfoberseite, 1 MG. auf der Rumpfunterseite hinter dem Flügel. Bombenbehälter für 1200 kg.
Spannweite 21,3 m, Länge 15,3 m, Flügelinhalt 60,6 m2.
Leergewicht 5850 kg, Fluggewicht 9935 kg, Flächenbelastung 163 kg/m2. Höchstgeschwindigkeit in 5000 m Höhe 525 km/h, Gipfelhöhe 10 000 m, Reichweite je nach Belastung 1300—2000 km.
Franz. Bloch 174 Zweimotor-Bomber.
Bloch 174, scheinbar eine Weiterentwicklung des Bloch 170, gebaut von der SNCA. de Sud-Ouest, ist ein schneller Bomber, Ganzmetall.
Flügel als Mitteldecker, freitragend, mit Landeklappen zwischen Motoren und Rumpf und der Hälfte des Ansatzflügels.
Schlanker Rumpf mit langem Kabinenaufbau. Drei Mann Besatzung. Ein MG. nach hinten mit halber Sichtkanzel in der Rumpfnase. Höhenleitwerk über dem Rumpf. Doppeltes Seitenleitwerk.
Hochziehbares Fahrwerk nach hinten in die Motorverkleidung. Zwei Motoren Gnome-Rhone 14 N von 940 PS.
Franz. Bloch 1/4 Zweimotor-Bomber.
Archiv Flugsport
ii
Jap. Mitsubishi-Frachtflugzeug mit zwei Kinsei-Mitsubishi-Sternmotoren von 900 PS soll zu einem Weltrundflug starten. Typenbeschreibung dieses Flugzeugs, vgl.
„Flugsport" Nr. 17, 1939, Seite 445. Archiv Flugsport
Spannweite 17,924 m, Länge 11,729 m, Höhe 3,60 m, Fläche 41,10 m2, Leergewicht 4468 kg, Fluggewicht 6782 kg. Normale Flughöhe 5100 m, Gipfelhöhe 10 000 m. Höchstgeschwindigkeit wird mit 520 km/h angegeben.
FLUG UMDSCHÄl
Inland.
Beförderungen in der Luftwaffe durch den Führer mit Wirkung vom 1. 10. 39:
Zum General der Flieger die Generalleutnante Kitzinger, Grauert und Wimmer;
zum General der Flakartillerie Generalleutnant Weise;
zu Generalleutnanten die Generalmajore Mohr, Danckelmann, Schmidt;
zum Generalmajor der Oberst Menzel;

Siebel Si 202 „Hummel". In der serienmäßigen Herstellung ist die ohnehin gute Sicht der Kabinenfenster noch durch ein weiteres Fenster hinter den Sitzen erweitert worden. Das höher
gehaltene Fahrgestell ermöglicht eine kürzere Startstrecke. Die Abmessungen sind jetzt folgende: Spannweite 10,63 m, Länge 6,38 m, Höhe 1,94 m. 2-1-Zündapp-Reihenmotor 50 PS. Vgl. Typenbeschreibung „Flugsport" 1939,
Seite 91. Werkbild
Zu Obersten: der charakterisierte Oberst Osterkamp, der Oberstleutnant des Generalstabes Dipl.-Ing. Schimpf, die Oberstleutnante Creutzberg, Lohmann, Rüt-gers, Junck, Steindorf, Berger-Eickstedt, von Massow, Frommherz, Brakert, Leon, Henke, Hamel, Hörmann von Hörbach, Werner Langemeyer, Koeppen, Graf, Kli-mitsch, Zimmerl, Riedl, Schöbitz, Steidler.
Focke-Wulf Auslandslieferungen: 3 Mehrzwecke-Flugzeuge FW 58 nach Rumänien, 2 weitere nach Bulgarien auf dem Luftwege. In Kürze kommen zur Ablieferung 20 Flugzeuge FW 44 „Stieglitz" nach Ungarn für die ungarische Luftwaffe. Ein holländischer Auslieferungsauftrag von FW 58 erfolgt demnächst.
Lufthansa-Flugverkehr Berlin — Kopenhagen, Berlin — Stockholm, Berlin — München—Venedig—Rom, Berlin—Wien—Budapest, Budapest—Belgrad—Sofia mit Anschluß nach Saloniki am 4. 10. wieder aufgenommen. Start in Berlin aus organisatorischen Gründen nicht auf Flughafen Tempelhof, sondern auf Sportflugplatz Rangsdorf.
I. G. Karl Schmidt & Co., Solingen, am 1. 10. 39 die Abteilung Flugzeug- und Sportbedarf der Firma Dr. W. Kampschulte & Cie., Solingen, übernommen.
Prof. Dr.-Ing. Adolph Nägel f 17.9. gestorben. Nägel ist den Hörern der Technischen Hochschule Dresden, wo er drei Jahrzehnte lang als ordentlicher Professor für Wärmekraftmaschinen, Pumpen- und Gebläsebau wirkte, ein Begriff geworden. 1934 wurde er Mitglied des Senats der Lilienthal-Gesellschaft und 1936 ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie der Luftfahrtforschung.
Dr. Walter Kruspig t, Wehrwirtschaftsführer, Vorsitzender des Vorstandes der Rhenania-Ossag Mineralölwerke AG., am 16. 9. verunglückt. Sein Name ist durch sein Wirken in der Rhenania-Ossag Mineralölwerke AG., für die sein Hinscheiden ein großer Verlust bedeutet, in der Entwicklungsgeschichte verzeichnet.
Ausland.
„Italienisch-Transkontinentale Luftlinien" (LATI) aus der Abteilung der Ala Littoria für Atlantikluftverkehr hervorgegangen. Kapital der Gesellschaft % Million Lire, welches auf 40 Millionen Lire erhöht werden kann. Flugstrecke Kapverdische Inseln ist bereits in Betrieb. Demnächst soll der Dienst bis Rio de Janeiro mit dreimotorigen Landflugzeugen durchgeführt werden.
13 554 m Höhe erreichte am 26. 9. ein italienisches Wasserflugzeug, welches mit luftdichter Kabine ausgerüstet war. Der Flug dauerte knapp 2 Stunden. Mit diesem Höhenflug ist die USA.-Höhenleistung von 11 753 m, welche 1929 aufgestellt wurde, überboten worden.
Island landete engl. Militärflugzeug mit 9 Mann Besatzung 26. 9. in der Nähe des Handelsplatzes Raufarhöfn (Nordspitze Islands). Das Flugzeug wurde gemäß den Neutralitätsbestimmungen von der Regierung beschlagnahmt. Trotz abgegebenen Ehrenworts des Kommandanten wurde das Flugzeug wieder in aller Stille flugklar gemacht und flog der Küste entlang, wo es nochmals eine Zwischenlandung vornahm und dann verschwand.
Ueberfliegen von Belgien sind die Bestimmungen vom 28. 8. 39 durch neue ersetzt. Nebenstehende Abbildung zeigt die Durchflugschneise, welche nur in der Tageszeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unter 500 m Höhe und bei niedriger Wolkendecke so tief, daß sie jederzeit gesehen werden können, benutzt werden dürfen. Bedingung ist, vor Beginn des Fluges bei dem Propaganda-Ministerium die Durchflugerlaubnis einzuholen. Aus den Bestimmungen sei nur erwähnt, dem Durchfluggesuch sind beizufügen: Charakteristiken des Flugzeuges, Anzahl und Stärke der Motoren, Hoheitsabzeichen, Zeit des Ueberfliegens, Ausgangsflughafen und Ziel.
Die Verfügung enthält noch Bestimmungen über das t Verbot des Ueberfliegens von Sperrgebieten u. a.
*-\
: Auskunftsstelle: Das Pro-
y:" paganda-Ministerium befindet sich seit 1.9.: 52, Avenue des Arts, Brüssel.
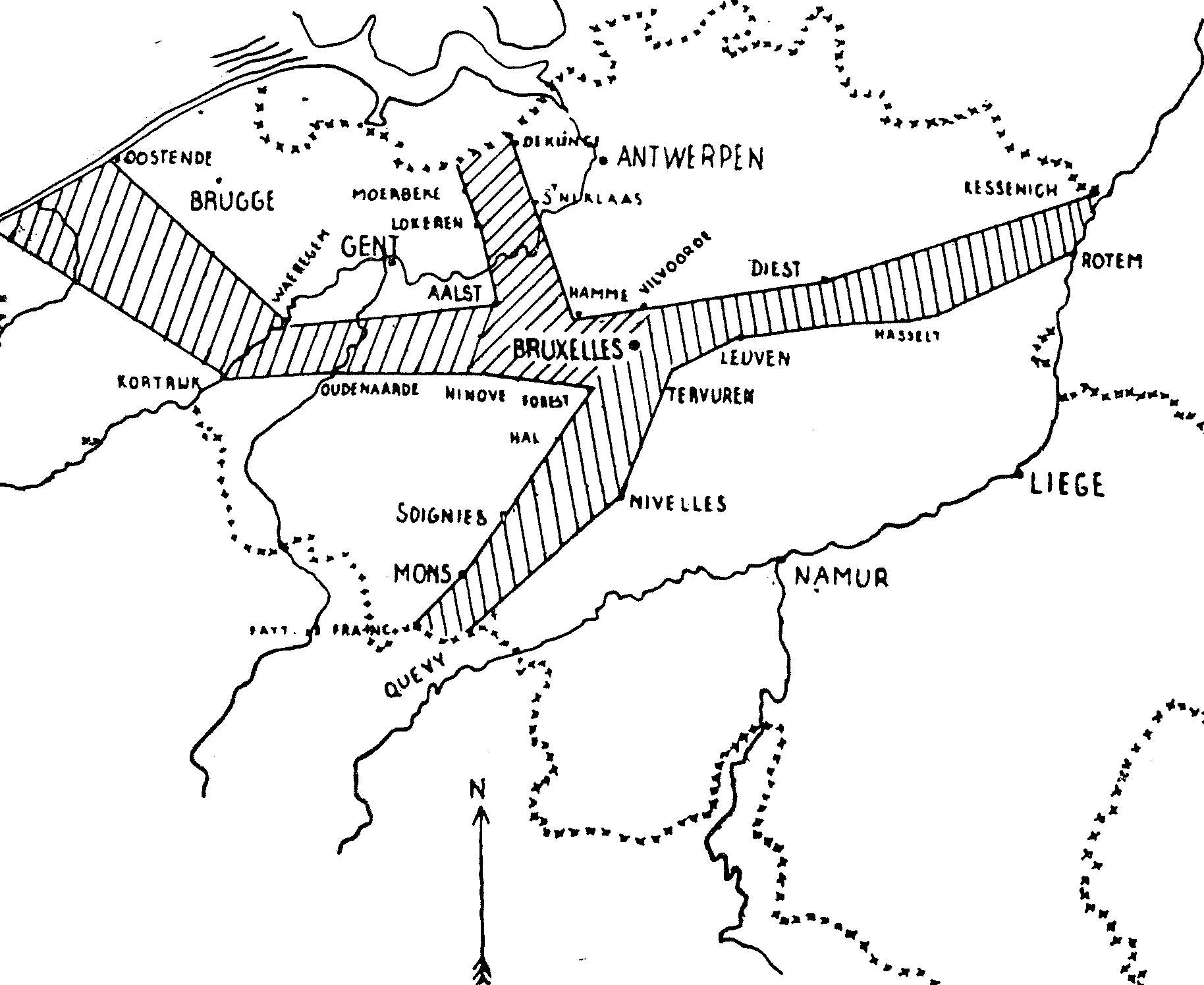
Flugkarte Belgien.
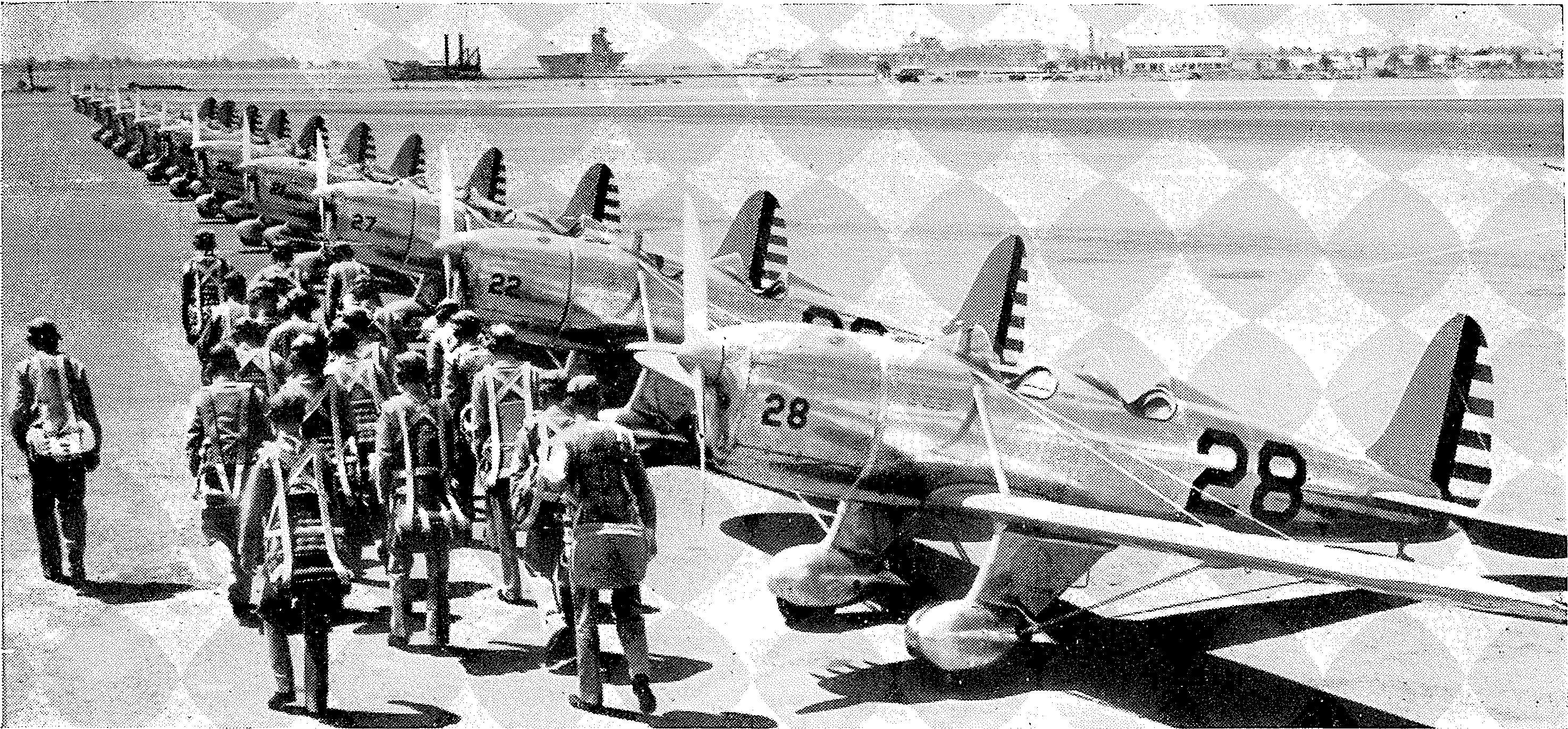
Ryan-Tiefdecker YPT-16 für Militärschulbetrieb auf dem Lindbergh-Field,
San Diego Kalifornien. Archiv Flugsport
B = Belgien als Erkennungszeichen für die belgischen Ortschaften in der Nähe der Grenze ist ein weißes Leinentuch mit einem großen B ausgespannt oder dieses Zeichen auf gekalktem Boden zwischen Ortschaft und Grenze angebracht, welches nachts beleuchtet wird. *
Moskau—Sofia-Fluglinie mit Anschluß nach Rom soll nach Verhandlungen des bulgarischen Gesandten Antonow und des bulgarischen Obersten Boidew, welche sich zur Zeit in Moskau befinden, eingerichtet werden.
Kanadische Flughäfen am Atlantik sollen als militärische Flughäfen ausgebaut und drei weitere neue Flughäfen in den Provinzen New Brunswick, Nova Scotia und Prince Edward Island eingerichtet werden.
Kanadische Luftverkehrsstatistik verzeichnet Ende 1938: 734 private Flugzeugführer, 226 Personenverkehrs-Flugzeugführer, 165 Personenverkehrs-Flugzeugführer mit begrenzter Lizenz, 130 Frachtverkehrsflugzeugführer, 643 Flugingenieure; 70 Privatflugzeuge, 518 Verkehrsflugzeuge und 115 Flughäfen.
Lindbergh Field, San Diego, zum Ausbau 750 000 $ angesetzt. Vorgesehen sind Erweiterung des Fluggeländes, Einrichtungen für Seeflugzeuge, 40 neue Scheinwerfer und eine neue 660 m lange Startbahn.
Pan American Airways Luftlinie nach Neu-Seeland geplant über die Strecke San Francisco, Los Angeles, Honolulu, Canton Island, Fidschi-Inseln, Noumea auf Neu-Kaledonien, Auckland. Postbeförderung Beginn 15. Sept. vorgesehen.
USA. Cleveland Luftrennen, Sieger wurde Roscoe Turner auf Laird L-RT-Rennflugzeug, mit dem er auch im Vorjahr das Bendix- und Thompson-Rennen gewann. (Vergleiche die Uebersichtszeichnung und Beschreibung dieser Maschine
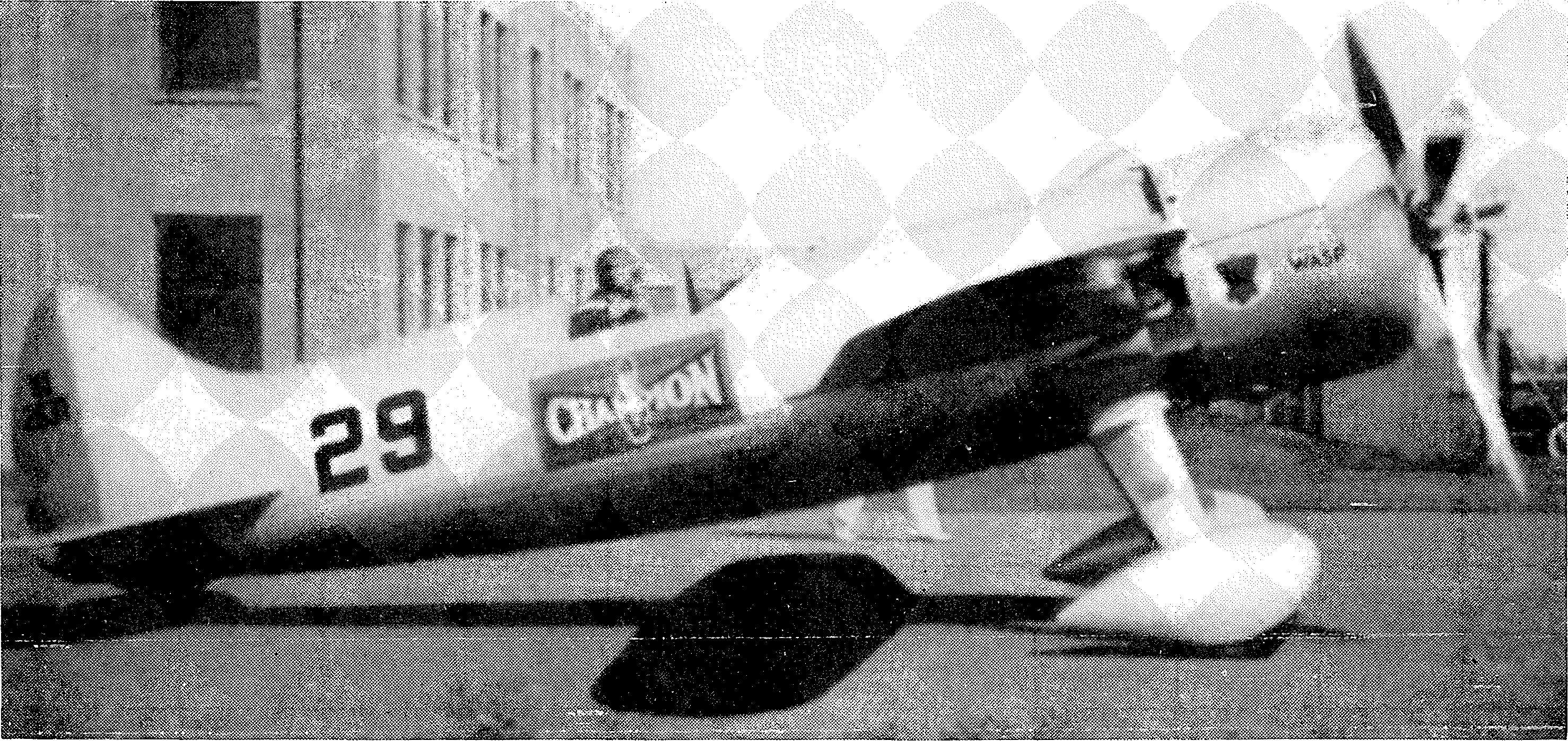
USA. Laird L-RT-Rennflugzeug von Roscoe Turner, mit dem er das Cleveland-Luftrennen gewann. Bild: Aero Digest
„Flugsport" 1939, S. 691.) Eine weitere Abbildung bringen wir auf S. 515. Turner erreichte mit seinem 1200-PS~Flugzeug eine Geschwindigkeit von 454, 688 km/h. Flugstrecke betrug 480 km, die auf einer Rundstrecke von 16 km ausgetragen wurde. Zweiter und Dritter wurden Tony und Earl Ortman. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von Turner im vergangenen Jahr betrug 455 km/h.
USA. Konstruktionswettbewerb für Bomber, Schul- und Jagd-Flugzeuge. Ergebnisse nach Mitteilung des USA.-Kriegsministeriums vom 16. 8. Viermotor. Bomber: Consolidated Aircraft Corp., Boeing Aircraft Co. Zweimotor. Bomber: Glenn Martin, North American Aviation, Douglas Aircraft Co. Flugzeuge für Anfangs- und fortgeschrittene Schulung: North American Aviation, Vultee Aircraft Div. Curtiss Airplane Div. Zweimotor. Jagdflugzeuge: Lockheed Aircraft Corp. Grumman Aircraft Engineering Corp.
2460 m Höhe mit größter Zuladung, 14 000 kg, erreichten Mai. Haynes und Capt. Old auf Boeing B-15 am 31. 7. anläßlich des 30jähr. USA.-Armeejubiläums auf dem Wright Field in Dayton. Der Weltrekord wurde bisher von dem Russen Nioukhtikov auf Eindecker Bolkhovitinow mit einer Höhe von 2000 m mit 13 000 kg Zuladung, aufgestellt am 20.11.36 in Tschelcovo, gehalten.
USA. Militäranfänger-Schulung wurde in letzter Zeit anschließend an den ersten Alleinflug statt Doppeldecker Tiefdecker benutzt. Die Schüler sollen von Anfang an an diese Bauart und an ein weiches Fliegen gewöhnt werden. Nach Versuchen in Schulbetrieben mit einer Ryan-Staffel, Typ YPT-16, entschloß man sich, diesen Flugzeugtyp als Schulmaschine einzuführen.
Ryan YPT-16, ein verspannter Tiefdecker, ist die Typenbezeichnung des Ryan ST als Militärschulflugzeug und zeigt in seinem Aufbau, wie die umstehende Abbildung erkennen läßt, kaum merkliche Unterschiede. Ganzmetall-Schalenrumpf, Flügel Spruceholme, Metallrippen, leinwandbedeckt, Flügelnase mit Leichtmetall bedeckt. Geschwindigkeit mit Vierzylinder Menasco 210 km/h.
Luftwaffe.
Berlin, 23.9.39. Oberk. d. Wehrmacht: Im Westen nur an einzelnen Stellen schwache Artillerietätigkeit. Bei Saarbrücken wurde ein französisches Flugzeug durch Flakfeuer zur Landung gezwungen, die Besatzung gefangen genommen. Ein deutsches Flugzeug im Luftkampf abgeschossen.
Berlin, 23.9.39. Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe hat folgenden Tagesbefehl erlassen:
„Die I./Flakregiment Nr. 22 hat in einem Gefecht bei Ilza am 8. u. 9. 9. mit hervorragender Tapferkeit an der Abwehr stärkster, an Zahl um das Vielfache überlegener feindlicher Kräfte teilgenommen. Zahlreiche Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften, an der Spitze der Kommandeur, starben dabei den Heldentod. Jhrem heldenhaften Einsatz bis zum letzten war es zu verdanken, daß das Gefecht siegreich beendet wurde.
Ich spreche hiermit der Abteilung für ihren mannhaften Einsatz Dank und höchste Anerkennung aus. Mit Stolz aber gedenkt die ganze Luftwaffe jener tapferen Männer, die in heldenhaftem Kampfe geblieben sind. Sie sollen uns ein leuchtendes Vorbild sein!"
Bern, 23.9.39. Wie die Agentur „Schweizer Mittelpresse" ergänzend mitteilt, wurde eines der französischen Flugzeuge, die das Gebiet von Pruntrut überflogen, beschossen, so daß es bei Delle notlanden mußte.
Es handelt sich um ein Bloch-Bombenflugzeug. Im übrigen nehme man an, daß sich die beiden Flugzeuge nach einem heftigen Luftkampf, der sich im Oberelsaß abgespielt haben soll, verirrt hatten.
Luxemburg, 24,9.39. (DNB.): Ein französisches Aufklärungsflugzeug überflog am Sonnabend (23. 9.) 16.30 Uhr luxemburgisches Hoheitsgebiet, als es von einem Flug über das deutsche Moselgebiet nach Sierck zurückkehrte. Die Maschine flog in einer Höhe von nur 100 m. Von unterrichteter Seite in Luxemburg wird mitgeteilt, daß es sich nicht um einen einmaligen Ausnahmefall handelt, sondern daß derartige Verletzungen der luxemburgischen Neutralität durch französische Flieger schon des öfteren vorgekommen sind.
Berlin, 25.9.39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: In wiederholtem Einsatz hatten Sturzkampfflieger militärisch wichtige Ziele in Warschau mit Erfolg angegriffen.
Im Westen an einzelnen Stellen Spähtrupp- und Artillerietätigkeit auf beiden Seiten. Acht französische Flugzeuge wurden im Luftkampf abgeschossen.
Berlin, 26. 9. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Im Westen Artillerie-Störungsfeuer
und geringe Spähtrupptätigkeit. Französische Flugzeuge haben — wie einwandfrei erkannt wurde — belgisches Gebiet überflogen.
In Luftkämpfen wurden fünf französische Flugzeuge und zwei Fesselballone, durch Flakfeuer ein französisches Flugzeug abgeschossen.
Berlin, 27.9.39. Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe griff militärisch wichtige Ziele in Modlin an.
Im Westen nur geringe Gefechtstätigkeit. Der Feind schanzt auf der ganzen Front. Zwei französische Flugzeuge wurden im Luftkampf über Freiburg und Sigmaringen abgeschossen.
Deutsche Luftstreitkräfte griffen gestern englische Seestreitkräfte, Schlachtschiffe, Flugzeugträger, Kreuzer und Zerstörer in der mittleren Nordsee mit Erfolg an. Außer einem Flugzeugträger, der zerstört worden ist, wurden mehrere schwere Treffer auf einem Schlachtschiff erzielt. Unsere Flugzeuge erlitten keine Verluste.
Brüssel, 27.9.39. (DNB.): Wie hier von unterrichteter Seite verlautet, hat die luxemburgische Regierung sich bereits zweimal veranlaßt gesehen, bei der französischen Regierung Protest wegen klar erwiesener Ueberfliegung des luxemburgischen Hoheitsgebietes durch französische Flugzeuge zu erheben. Durch die Ueberfliegen von Esch und von Mondorf haben sich französische Flugzeuge zweimal des Bruches der Neutralität Luxemburgs schuldig gemacht.
Berlin, 28.9.39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Stadt Warschau, die sich gestern bedingungslos ergeben hat, wird nach Erledigung der notwendigen Vorbereitungen voraussichtlich am 29. 9. besetzt. Heute vormittag hat auch der Kommandant von Modlin die Uebergabe der Festung angeboten.
Im Westen keine wesentliche Kampfhandlungen. Bei einem Luftkampf über Saarbrücken wurde ein feindliches Flugzeug zum Absturz gebracht.
Ein schwerer britischer Kreuzer wurde bei der Isle of May von einer Kampfstaffel mit Erfolg angegriffen. Eine 250-kg-Bombe schlug im Vorschiff ein. Die May-Insel liegt am Eingang des Firth of Förth, an der schottischen Ostküste.
Von den am Vortag angegriffenen schweren britischen Seestreitkräften ist ein Flugzeugträger durch eine 500-kg-Bombe, ein Schlachtschiff durch zwei 250-kg-Bomben am Vor- und Mittelschiff getroffen worden.
Hauptquartier der Luftwaffe, 28.9.39. (DNB.): Am Tage der Kapitulation von Warschau erließ Generalfeldmarschall Göring folgenden Tagesbefehl:
Soldaten der Luftwaffe, Kameraden!
Die polnische Armee, der eine von englischem Größenwahn bestimmte Kriegshetze die Aufgabe zugedacht hatte, in deutsches Land einzufallen und bis Berlin zu marschieren, ist in wenigen Tagen in Grund und Boden zerschmettert worden. Mit ihr mußte die polnische Fliegertruppe, noch bevor sie wirkungsvoll hätte eingesetzt werden können, den gleichen Weg gehen. Blitzschnell hat das deutsche Schwert zugeschlagen. Ich bin stolz, daß die deutsche Luftwaffe an diesem Erfolg entscheidend mitgewirkt hat. Durch Euren entschlossenen Einsatz habt Ihr vom ersten Tage an den feindlichen Luftraum beherrscht. Keinem polnischen Flugzeug gelang es, deutsches Hoheitsgebiet zu überfliegen. Die deutsche Heimat war in Sicherheit! Unserer tapferen Erdtruppe habt Ihr bei ihrem Vordringen vorbildliche Waffenhilfe geleistet. Desgleichen habt Ihr tatkräftig die eingesetzten Teile der Kriegsmarine in ihrem siegreichen Kampfe unterstützt. In einem Siegeszug ohnegleichen habt ihr einen Gegner niedergeworfen und vernichtet, der Großdeutschland in frevlerischem Leichtsinn herausgefordert hatte. Einzig dastehend in der Geschichte sind die Leistungen der deutschen Wehrmacht.
Ihr, meine Kameraden von der Luftwaffe, also des jüngsten Teiles der Wehrmacht, habt in todesmutigem Einsatz bewiesen, daß Ihr Bannerträger alten deutschen Soldatengeistes und zugleich der alle Widerstände bezwingenden Idee nationalsozialistischen Kämpfertums seid. Ob Ihr als Aufklärer den großen Zielen der Armeeführung dientet, ob Ihr als Jagdflieger den Gegner mit stählernem Vernichtungswillen angegriffen habt, ob Ihr als Schlachtflieger Euren Kameraden auf der Erde den Weg zum Siege bahntet, ob Ihr als Kampfflieger die Bastionen feindlichen Widerstandes vernichtet habt, ob Ihr mit Euren Stukas allen Bollwerken des Feindes Tod und Verderben brachtet, ob Ihr in der Luft oder am Boden kämpftet, ob Ihr am Flakgeschütz der Armee und dem ganzen Volk die Sicherheit gabt oder ob Ihr am Funkgerät für die Verbindung aller Kampftruppen sorgtet, ob Ihr als Transportgruppen in unermüdlichem Tag- und Nachteinsatz den erforderlichen Nachschub für Luftwaffe und Heer brachtet — Euch allen gilt mein Dank. In ehrfürchtiger Trauer neigen wir uns vor den Opfern, die unsere
Waffe bringen mußte, aber auch im hehren Stolz, denn wir wissen: Mit uns fliegen und fechten die Kaineraden, die wir verloren. Ihr Tod ist uns nicht drückende Bürde, ihr Opfer ist uns heilige Verpflichtung.
Als wir in diesen Krieg für Deutschlands Freiheit zogen, wußte ich, daß ich mich auf meine Luftwaffe verlassen konnte. Kameraden, wie ich Euch allen im Geiste ins Auge sah, als wir diesen uns aufgezwungenen Krieg begannen, um Euch zu verpflichten, das Letzte für Volk und Vaterland zu geben, so drücke ich jedem von Euch jetzt die Hand als Oberbefehlshaber seinen Soldaten, als Kamerad seinen Kameraden. Nach deutscher Soldatenart binden wir jetzt nach errungenem Sieg den Helm fester. Welche Aufgaben uns auch erwachsen mögen, welche Befehle uns auch unser Führer und Oberste Befehlshaber gibt: Vorwärts für unser ewiges Deutschland!
Berlin, 29.9.39» Oberk. d. Wehrmacht: Die Festung Modlin hat unter dem Eindruck der deutschen Angriffe sowie als Folge der Zermürbung durch Artilleriefeuer und Bombenabwürfe bedingungslos kapituliert. Die Einzelheiten der Ueber-gabe werden nach Weisung der Heeresgruppe Nord durch das vor Modlin eingesetzte Korpskommando festgelegt.
Im Westen Erdkampftätigkeit wie bisher.
Im Luftkampf wurden bei Weißenburg ein französisches, bei Osnabrück ein britisches Flugzeug abgeschossen.
Berlin, 29. 9.39. Heute morgen griffen sechs britische Kampfflugzeuge deutsche Seestreitkräfte bei Helgoland ohne jedes Ergebnis an. Auf dem Abflug nach Westen wurden sie von deutschen Jägern gestellt. In einem kurzen Luftkampf wurden fünf britische Flugzeuge abgeschossen; sie sind über See abgestürzt.
Amsterdam, 29.9.39. (DNB.): Von amtlicher niederländischer Seite wird mitgeteilt, daß in der Nacht zum Donnerstag die holländische Neutralität durch britische Flugzeuge verletzt worden sei. Wie eine amtliche Untersuchung ergeben habe, seien in dieser Nacht fremde Flugzeuge, die in sehr großer Höhe flogen, in ost-westlicher Richtung über Holland geflogen. Da in verschiedenen Orten des Landes Flugblätter britischen Ursprungs gefunden worden seien, könne angenommen werden, daß es sich um zurückkehrende britische Flugzeuge gehandelt habe. In dem Bericht heißt es weiter, die britischen Flugzeuge seien an verschiedenen Stellen Hollands durch Flaks beschossen worden.
Berlin, 30. 9. 39 (DNB.). Oberk. d. Wehrmacht: Zwei Schwärme von zusammen zwölf britischen Kampfflugzeugen versuchten, in das deutsche Hoheitsgebiet an der Nordostküste einzufliegen. Ein Schwärm griff in der Deutschen Bucht Zerstörer ohne jeden Erfolg an. Die britischen Flugzeuge wurden durch Flakfeuer vertrieben. Bombentreffer wurden nicht erzielt. Den anderen Schwann stellten deutsche Jagdflieger in der Nähe der ostfriesischen Inseln Wangeroog und Langeoog. Im Luftkampf wurden von sechs britischen Flugzeugen fünf abgeschossen. Die Besatzungen zweier deutscher Jagdflugzeuge, die auf See notlanden mußten, wurden unverletzt durch deutsche Kriegsschiffe gerettet.
Berlin, 30. 9. 39. (DNB.): Den Engländern war auch heute das Kriegsglück wenig hold. Schon am frühen Morgen schössen deutsche Jäger zwei englische Kampfflugzeuge ab, die sich zu weit in die Nordsee vorgewagt hatten. Am Vormittag versuchten fünf britische Kampfflugzeuge bei Saarbrücken, die deutsche Grenze zu überfliegen. Sie wurden sämtlich von einem deutschen Jagdverband abgeschossen. Derselbe Verband brachte mittags bei Bitsch ein französisches Flugzeug zum Absturz.
Insgesamt haben die Franzosen im Laufe des ersten Kriegsmonats 37 Flugzeuge durch die deutsche Jagd- und Flakabwehr verloren.
Die Engländer verloren im Luftkampf und durch Flakbeschuß 27 Flugzeuge. Außerdem wurden, wie schon gemeldet, der Flugzeugträger „Courageous" torpediert und ein zweiter Flugzeugträger durch einen schweren Bombentreffer zerstört. Es steht fest, daß die Zahl der hierbei vernichteten Flugzeuge die angegebene Verlustziffer um ein Vielfaches überschreitet.
Berlin, 1. 10. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Im Osten geht die Uebergabe von Warschau und Modlin planmäßig vor sich.
Im Westen wurden zwei französische und zehn britische Flugzeuge, über der Nordsee zwei britische Kampfflugzeuge zum Absturz gebracht. Wir verloren zwei Flugzeuge.
Berlin, 2. 10. 39 (DNB.). Oberk. d. Wehrmacht: Gestern vormittag sind die ersten deutschen Truppen ohne Zwischenfälle in Warschau eingerückt, die Besetzung Pragas wurde gestern beendet.
' "a *>«»»»» ho... . ; . —--
fluaga
Kilometer Men/n/Betern-
lyduu
TJIsttT
)amige i
\Bucht
K0NI6SBER6
W^/amt'esh's
Wröallen KsMariampols?
MeusfgffiT\
WSTENBUk Bischofsl o o-
chneidemük
V
ßrodno^o
^Äuzn/ca
'TT*u .f vr^anr°"><< 7**.
3 8 .^....„_______________
_,, Sierpiec
, °Lpno o
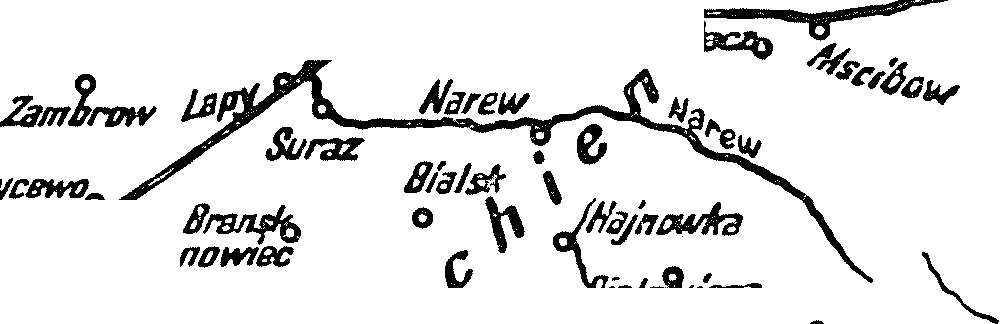
Interessen-Abgrenzung Deutschland—Rußland. Weitbiid-Qiiese.
Seite 520_„PLUQSPORf" Nr. 2l/l939, Bd. 31
Der letzte Stützpunkt polnischen Widerstandes, die befestigte Halbinsel Heia, hat sich gestern bedingungslos ergeben, noch bevor der von Heer und Kriegsmarine gemeinsam vorbereitete Angriff durchgeführt wurde. Im Westen nur örtliche Artillerie- und Spähtrupptätigkeit. Ein britisches Aufklärungsflugzeug wurde östlich Paderborn abgeschossen.
Berlin, 3.10.39. Oberk. d. Wehrmacht: Im Laufe des 2. Oktober rückten weitere deutsche Truppen in die Festung Warschau ein. Die Zählung der Gefangenen sowie der in Warschau und Modlin erbeuteten umfangreichen Bestände an Waffen und sonstigem Kriegsgerät dauert noch an. Im Westen nur geringe Artillerie- und Flugzeugtätigkeit.
Berlin, 4.10.39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Im Westen herrschte außer schwacher feindlicher Artillerietätigkeit in Gegend Saarbrücken fast völlige Ruhe.
Berlin, 5.10.39. (DNB.). Oberk. d. Wehrmacht: Im Westen nur geringe Artillerie- und Luftaufklärungstätigkeit.
Berlin, 6. 10. 39. (DNB.): Am 30. 9. 39 wurde als Ergebnis einer Jagdabwehr die Vernichtung von zusammen 14 feindlichen Flugzeugen an der Westfront und über der Nordsee gemeldet. Die genaue' Ueberprüfung des Verlaufs der Luftkämpfe an diesem letzten Tage des ersten Kriegsmonats hat nachträglich einwandfrei ergeben, daß die Verluste der Engländer und Franzosen nicht nur 14, sondern 23 Flugzeuge betragen, von denen 21 über der Westfront und 2 über der Nordsee vernichtet wurden. Die eigenen Verluste beziffern sich dagegen nur auf 5 Flugzeuge.
Ohne die hohen Verluste, die den Engländern noch bei der Zerstörung bzw. Versenkung der beiden Flugzeugträger entstanden sind, haben unsere westlichen Gegner im Monat September insgesamt 72 Flugzeuge durch Jagd- und Flakabwehr verloren, von denen auf die Engländer 27 und auf die Franzosen 45 Flugzeuge entfallen.
Die Luftkämpfe, die sich mit Unterbrechungen fast über den ganzen Tag erstreckten, wurden von unseren Jägern mit ganz besonderem Schneid durchgeführt. So wurde, wie zum Teil bereits berichtet, ein geschlossener Verband von 5 feindlichen Flugzeugen restlos vernichtet, aus einem anderen Verband von nicht weniger als 37 feindlichen Flugzeugen 8 derselben abgeschossen, der Rest zur Umkehr gezwungen.
Berlin, 6. 10. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Im Westen nur geringe Artillerie- und Luftaufklärungtsätigkeit.
Segelflug
Russ. Segelfiugleistungen wurden von der F. A. I. als Rekorde anerkannt: Entfernungsflug in gerader Linie, Segelfliegerin O. Klepikova, 6.7.39, Strecke 794 km von Moskau nach Otradnoie in der Nähe von Stalingrad. Die bisherige Höchstleistung war von Victor Rastorgoueff auf „GN-7" mit 652,256 km von Mos-kau-Tuschino nach Iarygenakaya am 27.5.1937 aufgestellt worden. Ferner wurde der Zielsegelflug von P. Savtzov 415 km von der F. A. I. anerkannt.

Deutsche Flugmodell-Höchstleistungen. Stand vom 1. Oktober 1939. Gegenüber dem Stand vom 1. Juli 1939 hat sich folgendes geändert: Klasse: Rumpfflugmodelle mit Gummimotor.
Bodenstart-Dauer: H. Kermeß, München-Pasing, 17 Min. 47 Sek. Klasse: Rumpfwasserflugmodelle mit Gummimotor.
Wasserstart-Dauer: H. Hebel, Hannover, 15 Min. 42 Sek.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Handbuch des Segelfliegens. Herausgeg. von Wolf Hirth. Mit einem Geleitwort von General der Flieger Christiansen,.. Korpsführer des NSFK. 177 Abb, 2, verb. u. erweit. Auflage. Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
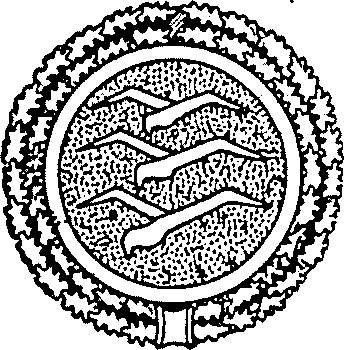
Wenn einer sich der Segelfliegerei verschrieben hat und die Entwicklung nicht nur von Anfang bis heute mit durchlebt, sondern auch darin gearbeitet und Leistungen vollbracht hat, so ist es Wolf Hirth. Die vorliegende 2. Auflage des „Handbuches des Segelfliegens" ist vollständig neu durchgearbeitet. Neu hinzugekommen sind die Kapitel: Wetterkunde für Segelflieger, Wellenbewegungen im Lee, Kartendarstellung der Segelflugmöglichkeiten über Deutschland von Dr. F. Höhndorf, Segelfluggelände von Wolf Hirth, Wettbewerbe und die Bewertung von Segelflugleistungen von J. Kunz, Wettbewerbs-Vorbereitungen und -Erfahrungen von P. Krekel, Segelflieger und Fallschirm von M. Beck. Die übrigen Kapitel sind durchgesehen und dem neuen Stand entsprechend ergänzt. Die vielen Mitarbeiter in diesem Werk haben wirklich, um allen Kameraden ihre Erfahrungen zu vermitteln, ihr Bestes gegeben. Wer ernsthaft sich mit dem Segelflug beschäftigen will, muß dieses Buch gelesen haben.
Luftfahrt. Eine Einführung in das Gesamtgebiet. Unter Mitarb. d. RLM., NSFK., Reichsjugendf. u. and. amtl. Stellen bearb. u. herausgeg. v. Reichsinstitut f. Berufsausbildung i. Handel u. Gewerbe (Patsch). 2. Aufl. 255 S. ,mit rd. 300 Abb. Best.-Nr. 10 800. Verlag B. G. Teubner, Leipzig-Berlin. Preis RM 3.20.
In der vorliegenden 2. Auflage sind entsprechend der fortschreitenden Entwicklung die Abschnitte: Wetter, Luftverkehr, Bodenorganisation und Flugsicherung, Luftgefahr und Luftschutz vollständig neu bearbeitet worden. Neu hinzugekommen sind die Abschnitte: Die deutsche Luftwaffe, Werkstoffe im Luftfahrzeugbau, Der deutsche Luftsport, Luftfahrtmedizin, Reichsluftfahrtverwaltung und Luftrecht, Wege zur deutschen Luftfahrt. Das vorliegende Buch ist geradezu ein Musterbeispiel der Zusammenfassung des Wissenswertesten aus der Luftfahrt, und zwar zusammengestellt von den Sachbearbeitern der Regierung, der einschlägigen Organisationen und Verbände, welche in der Luftfahrt an führender Stelle tätig sind. Ganz hervorragend ist die Auswahl und geordnete Zusammenstellung der sauberen Abbildungen, die zeichnerische Darstellung mit ihrer Beschriftung unter größter Raumausnutzung, wie es nur von einem Deutschen Ausschuß für Technisches Schulwesen (DATSCH) geschaffen werden konnte. Es gibt wohl kein Buch im Ausland auf dem Gebiete der Luftfahrt, welches sich in einer solchen Exaktheit der Zusammenfassung der Materie an die Seite des vorliegenden stellen kann. Es ist nicht nur ein volkstümliches Buch, sondern ein wirklich praktisches Nachschlagebuch auf allen Gebieten.
Und es lohnt doch! Von Katja Heidrich. Verlag von Hase & Koehler, Leipzig Cl. Preis RM 3.80.
Katja Heidrich, Sportfliegerin, zeichnet in packender Sprache eine Persönlichkeit, die durch entschlossenen Kämpfergeist, echter Vaterlandsliebe, selbstverständlicher Kameradschaft versuchte, sich durchzusetzen. Es ist der Geist der vorwärtsstrebenden Jugend, der echte deutsche Geist, die unbedingte Voraus-.. Setzung für die Erreichung aller großen Ziele. Die Welt muß es immer wieder wissen: Der ungebrochene Lebenswille des deutschen Volkes wird es nie zulassen, daß ihm sein Platz an der Sonne genommen wird.
Pour le merite - Flieger mit 20 Jahren. Von Rolf Italiaander. Gustav Weise Verlag, Berlin. Preis RM —.95.
Während unsere Kriegsflieger in Polen ganz hervorragende Leistungen vollbracht haben, dürfen wir uns mit Ehrfurcht der Fliegerhelden aus dem Weltkrieg, die den unverwüstlichen Fliegergeist schufen und das Fundament unserer Fliegerei begründeten, erinnern. Dieses vorliegende Büchlein mit seinem geringen Preis wird immer, wenn wir unserer Jugend etwas geben wollen, ein würdiges Geschenk sein.
GUMMIKABEL GUMMIRINGE
VERLANGENSIE KOSTENLOS: MUSTER, DRUCKSCHRIFTEN U. ANSCHAUUNGSMATERIAL
ORIGINAL - RHÖN - ROSSITTEN -
STARTSEILE
LG. KARL SCHMIDT & Co.
SOLINGEN, Postfach 15
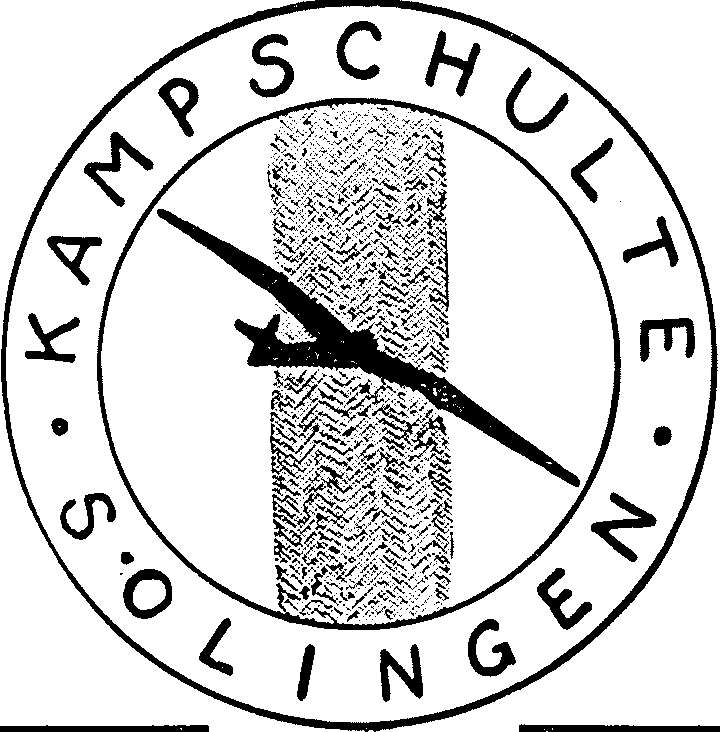
Heft 22/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro Vi Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postan»talten und Verlar Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ,,Nachdruck verboten" versehe«. _nur mit genauer Quellenangabe gestattet. _
Nr. 22 25. Oktober 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 8. Nov. 1939
Kontinental-Europa.
Durch die englische Blockade sollte der Handelsverkehr der neutralen Staaten mit Deutschland unterbunden und die europäischen Handelsbeziehungen zerstört werden. Beides ist nicht gelungen. Der bei den Neutralen ausgefallene Güteraustausch in Mitteleuropa wird durch Lieferungen aus Deutschland ersetzt, so daß in den neutralen Ländern eine Aufrechterhaltung der Industrie und Wirtschaft und somit Durchführung des Außenhandels gesichert ist.
Die bisherige Leistungssteigerung in der deutschen Industrie und Wirtschaft vermochte die Bedürfnisse der Neutralen zu befriedigen. Andererseits war Deutschland in der Lage, die durch die englische Blockade verhinderte Ausfuhr im Güteraustausch aufzunehmen, ja, und noch weiter, die Neutralen sind in die Lage versetzt, ihren Außenhandel untereinander, teilweise im Austausch über Deutschland, durchzuführen.
Der Wirtschaftsraum hat sich durch die Entwicklung im östlichen Europa, wie wir bereits in der vorletzten Nummer an dieser Stelle berichteten, bedeutend erweitert. Es ergibt sich somit ein ungeheures Feld der Betätigung. Die in Mitteleuropa bisher behinderten Kräfte sind frei geworden. Es ist das Gegenteil eingetreten, was durch die englische Blockade beabsichtigt war.
Die von Großdeutschland erzwungene Vormachtstellung in der Luft, durch die letzten Ereignisse in Polen, in der Nordsee und an anderen Stellen, hat mit einem Schlage der Welt die Ueberlegenheit und den hohen Stand der Entwicklung der deutschen Flugzeugindustrie vor Augen geführt. Ein Land, das in Kriegsflugzeugen derartig gewaltige Leistungssteigerungen vollbrachte, wird auch in Sport-, Verkehrs- und Langstreckenflugzeugen den größten Anforderungen gerecht werden.
Trotz der heutigen Anspannung findet sogar die Flugzeugindustrie noch Zeit, prompt ihre versprochenen Auslandslieferungen durchzuführen. Die Neutralen in Kontinentaleuropa werden, wie auf anderen Gebieten, mit Flugzeugen modernster Art in zunehmendem Maße beliefert werden. Man spürt schon heute einen frischen Zug in verschiedenen, bisher unter dem lähmenden Einfluß der englischen Blockade stehenden Völkern von Köntinentaleuropa, ein Zusammenwirken in friedlicher Arbeit.
USA Stinson „105", Kabinen-Kleinflugzeug.
Neben dem Reliant-Fünfsitzer und dem Zweisitzer-Kleinflugzeug: hat die Stinson Aircraft Corp. ein Kabinen-Kleinflugzeug, den Stinson „105", herausgebracht. Motor 75 PS Continental.
Flügel, Schnitt NACA 4412, größte üicke am Flügelanschlußpunkt (also nicht verjüngt nach dem Rumpf zu, wie beim Reliant). Spruceholme mit Duraluminrippen, zwischen den beiden Holmen verspannt. Flügelnase Aluminblech, sonst Leinwandbedeckung.
|
IIIS |

Stinson-Kabinen-Flugzeug Typ 105. Werkbilder
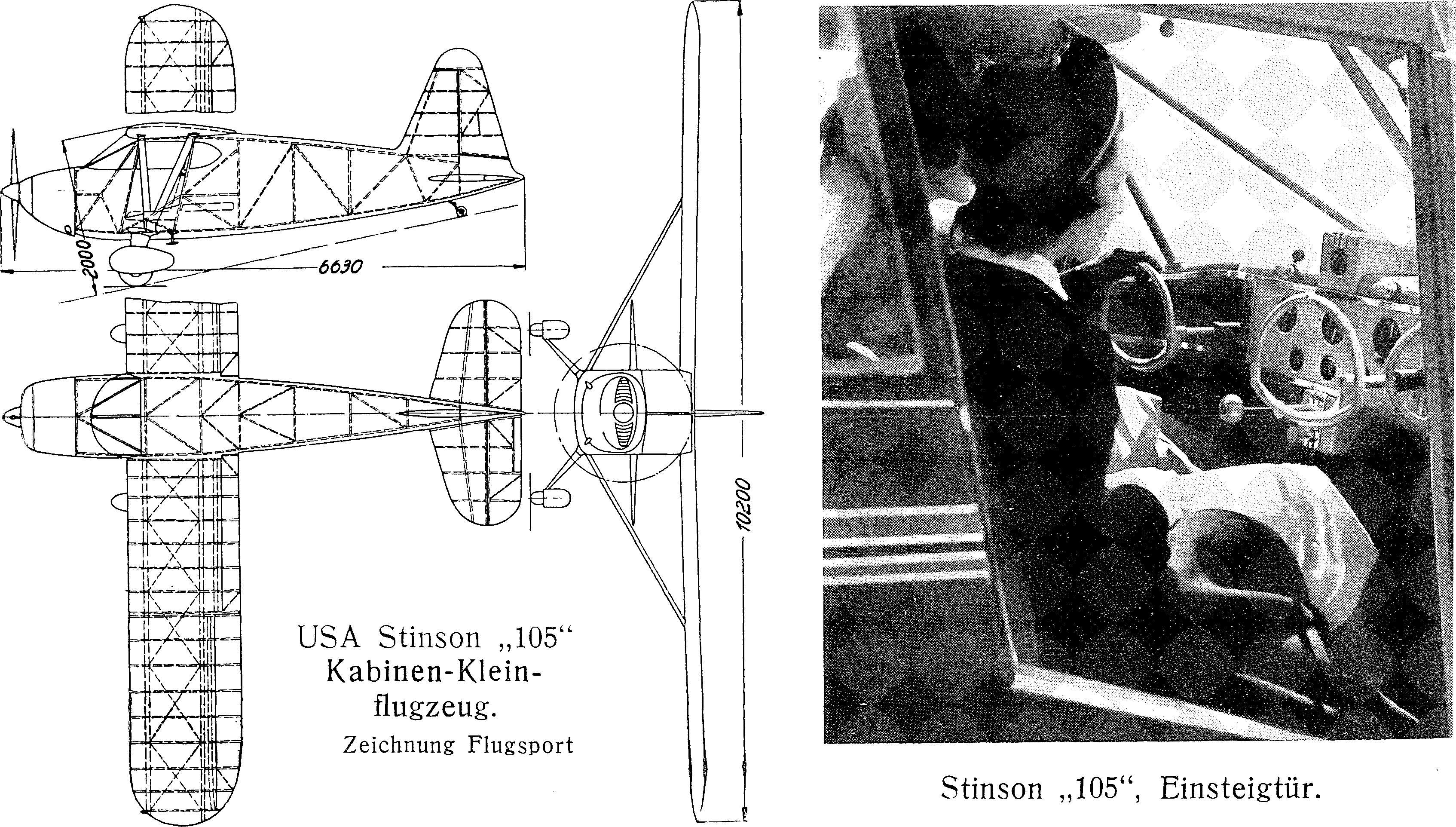
Stinson Kabinen-Kleinflugzeug Typ 105. Links: Steuerbetätigungseinrichtungen und Instrumentenbrett. Rechts: Rumpfnase mit Kühllufteintritt für Continental mit gegenüberliegenden Zylindern. Man beachte Strebenanlenkung am Fahrwerks-knotenpunkt und darüber Einsteigtür. Werkbilder
Querruder Stahlrohr mit Rippen aus rostfreiem Stahl, statisch und aerodynamisch ausgeglichen. Flügelnase Schlitzklappen. Zwischen Querruder und Rumpf Landeklappen. Flügel werden durch zwei Alumin-Stromlinienrohre in V-Form-Anordnung abgefangen.
Rumpf Stahlrohr. Kielfläche mit dem Rumpf fest verbunden. Zwei Sitze vorn mit Doppelsteuerung, ein Sitz hinten. Kabine Heizeinrichtung, Fenster Plexiglas.
Höhen- und Seitenleitwerk freitragend. Höhen- und Seitenruder Stahlrohr, Stahlrippen, mit Leinwand bespannt. Höhenruder-Trimmklappe vom Führersitz verstellbar durch Bowdenzug.
Fahrwerk große Spurweite. Zwei freitragende Strebenbeine innerhalb des Rumpfes schwenkbar gelagert und wie beim Reliant durch Spiralfedern mit hydraulischer Dämpfung abgefedert.
Spannweite 10,20 m, Länge 6,63 m, Höhe 1,95 m, Fläche 14,3 m2. Leergewicht 416 kg, Fluggewicht 790 kg. Höchstgeschwindigkeit 184 km/h, Reisegeschw. 167 km/h, Steigfähigkeit 129 m/min, Dienstgipfelhöhe 3900 m, Reichweite mit Reisegeschwindigkeit 670 km. Preis 2995.— $.
USA Stinson „Reliant" SR-10.
Die seit 1925 bestehende Stinson Aircraft Corporation ist in USA durch ihren Reliant bekannt geworden. Den Reliant SR-7 haben wir
Stinson „Reliant" SR-10.
Werkbild
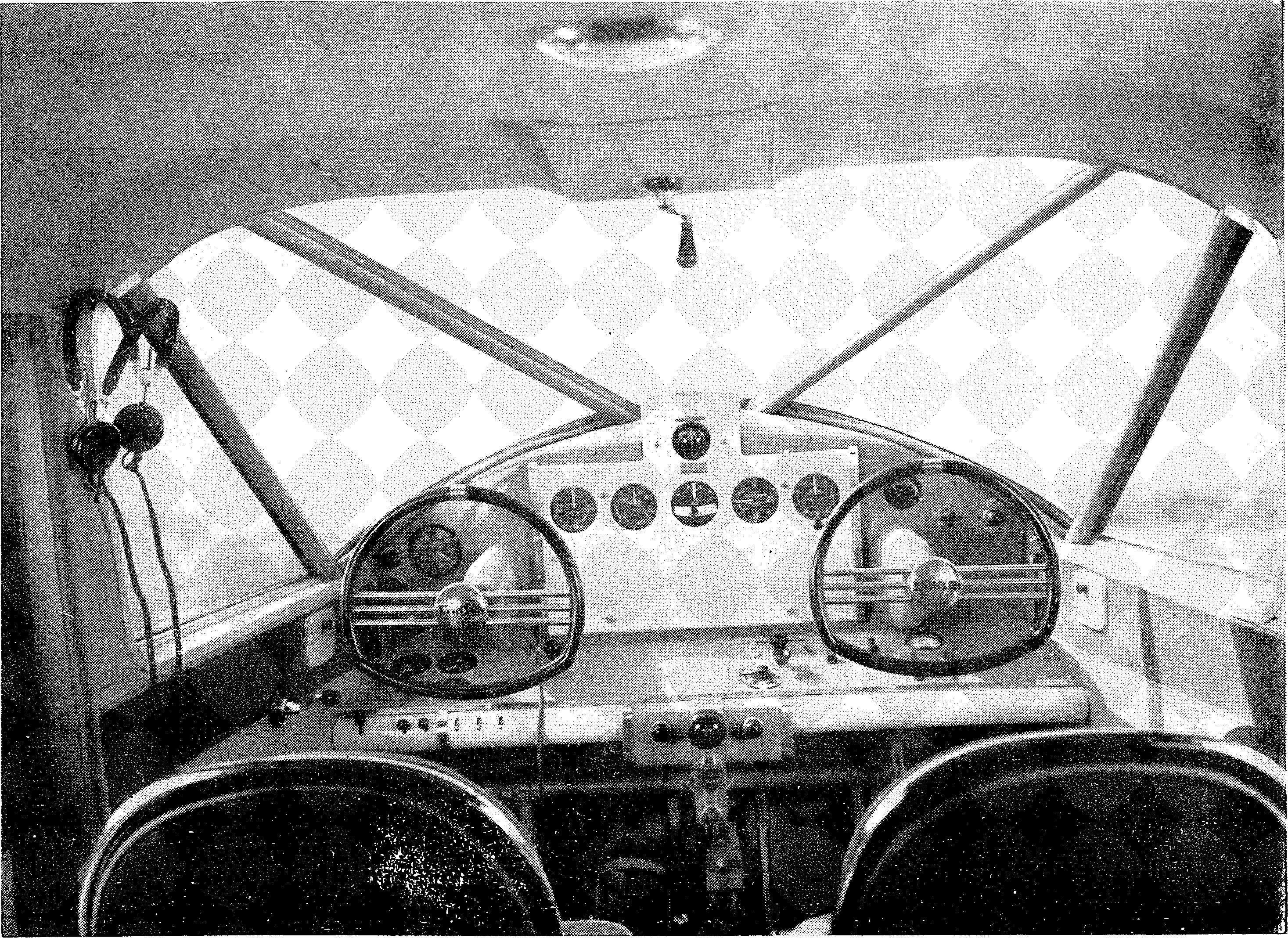
Stinson „Reliant" SR-10. Steuereinrichtungen und Instrumentenbrett.
An der Decke Kurbel. Werkbild
bereits 1936, S. 68, und anläßlich der New Yorker Luftfahrtausstellung 1937, S. 129, beschrieben. Charakteristisch für dieses abge-strebte fünfsitzige Hochdecker-Kabinenflugzeug ist der nach dem Rumpf und Strebenangriffspunkt sich verjüngende Flügel.
Der Qesamtaufbau, Flügel Stahlrohrholme, Duraluminrippen, Rumpf Stahlrohr, ist bis heute, abgesehen von einigen kleinen Detailverbesserungen der gleiche geblieben.
Die im Rumpf liegende Abfederung der freitragenden Fahr-werksstreben, Spiralfedern mit hydraulischer Dämpfung, scheint sich gut bewährt zu haben. Dieses Modell wird mit acht verschiedenen Motoren geliefert.
Das Modell SR-10 C mit Lycoming R-680-D 260 PS und Hamil-
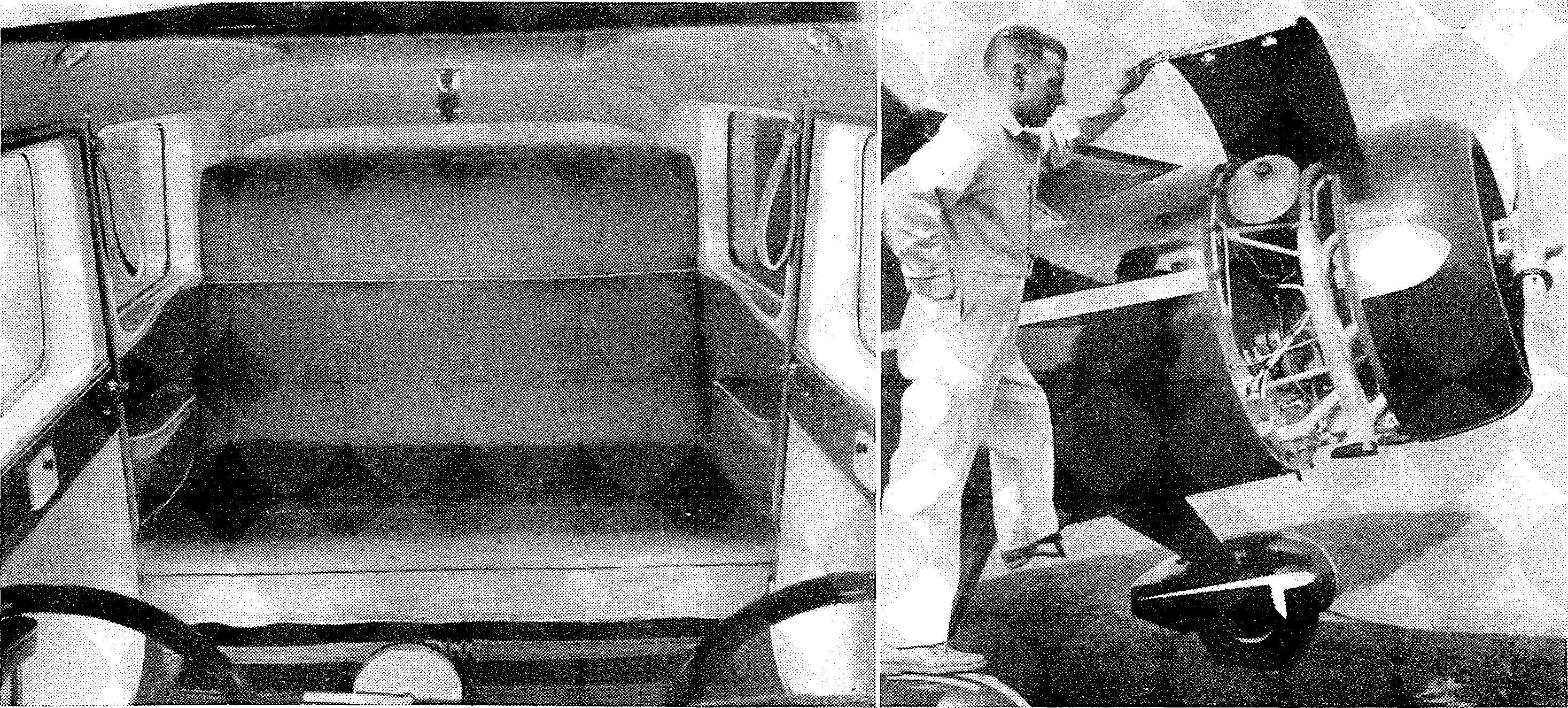
Stinson „Reliant" SR-10. Links hintere Sitzbank, Einstieg von beiden Seiten.
Rechts: Motoreinbau. Werkbilder
r
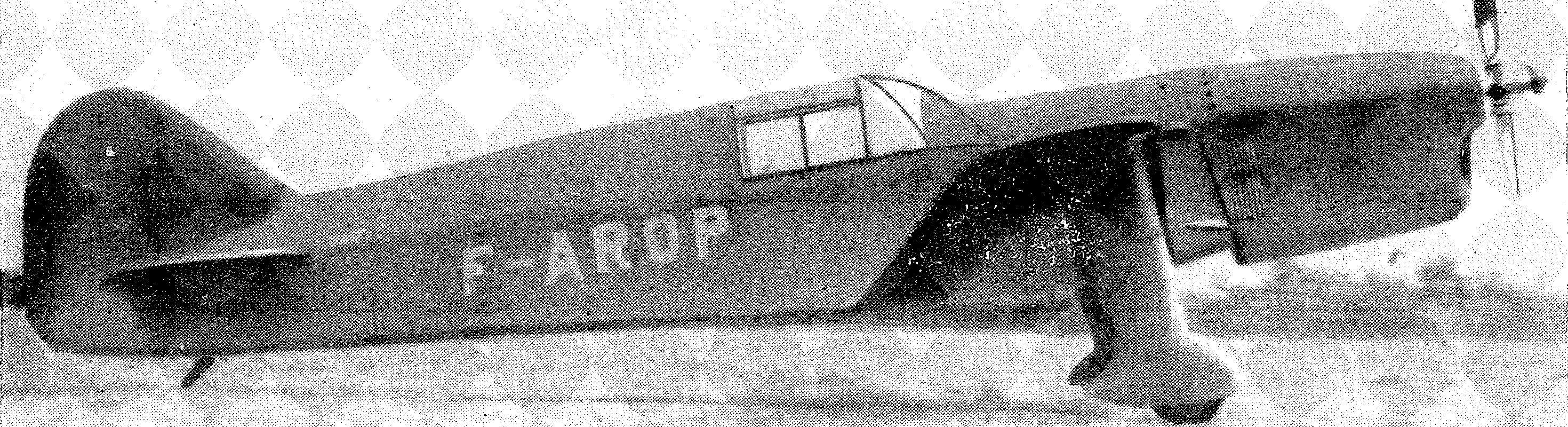
Franz. Mauboussin 200.
Archiv Flugsport
Rumpf ovaler Querschnitt, vier Längsholme, vorn Esche, hinten Spruce. 11 Rumpfspanten. Sperrholzbedeckung. Führersitz Hinterkante Flügel, Oberkante Kabinenaufbau läuft in die Seitenleitwerksflosse aus. Landeklappenbetätigung durch Fixatorhebel. (In jeder Stellung selbst hemmend.)
Höhenleitwerksflosse am Boden verstellbar. Seitenruder aerodynamisch ausgeglichen.
Fahrwerk fest, Oelstoßaufnehmer verkleidet.
Motor Regnier 4-EO, 130 PS bei 2300 U/min, luftgekühlt. Ratier Verstellschraube.
Spannweite 7,28 m, Länge 6,92 m, Fläche 7,5 m2. Leergewicht 388 kg, Fluggewicht 587 kg, Geschwindigkeit am Boden 285 km/h, Landege-schwindigk. 95 km/h. Flugdauer 3 h 45 min.
Flug Lallemand am 6. 5. 39 mit Vier-liter-Motor über 100 km mit 274 km/h und über 1000 km mit 255 km/h.
Franz. Mauboussin 200.
Zeichnung Flugsport
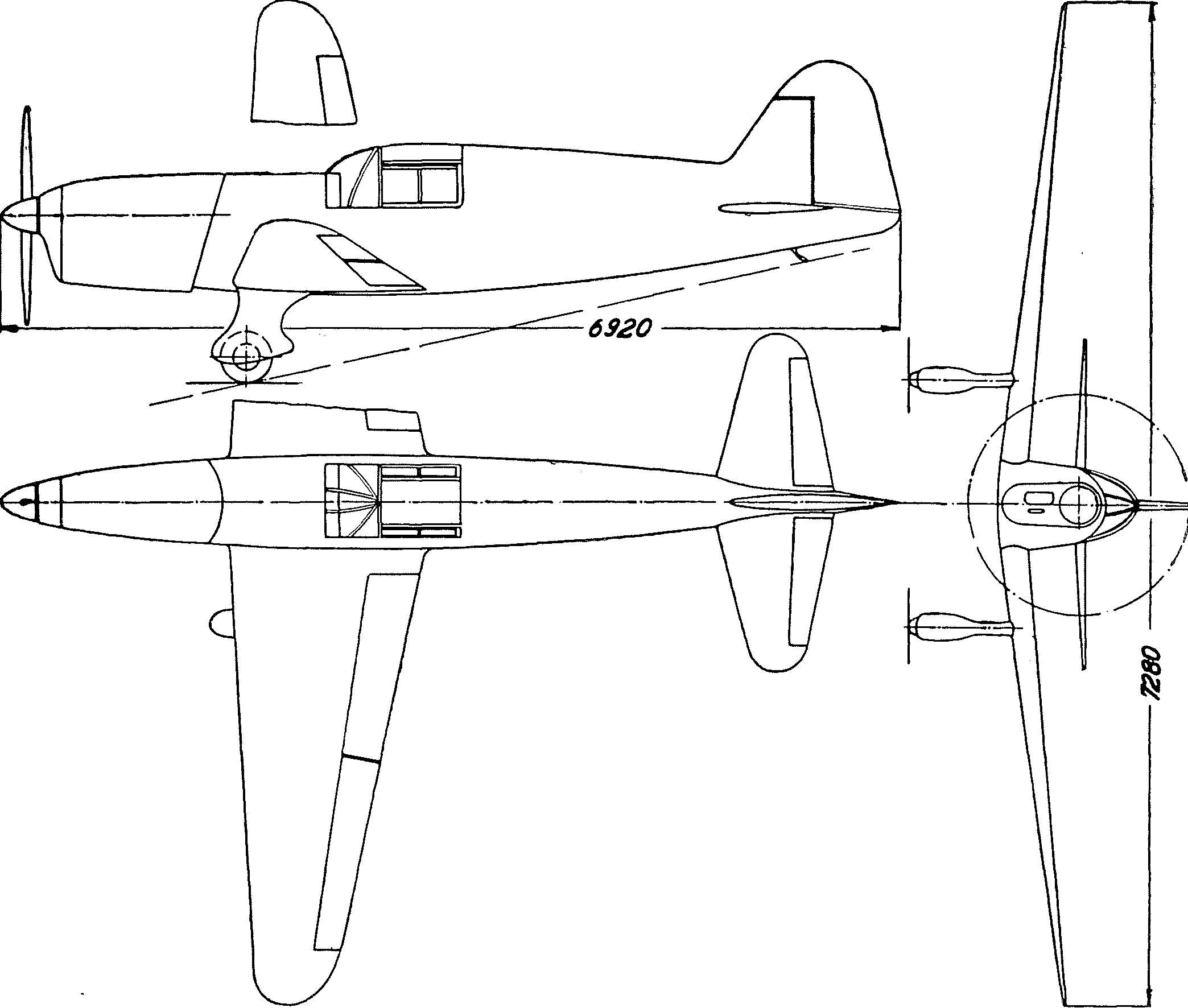
ton Standard Propeller. Reise-Geschwindigkeit 248 km/h, Lande-geschw. 91 km/h, steigt 275 m/min. Betriebsstoffinhalt 350 1, Leergewicht 1100 kg, Fluggewicht 1740 kg. Dienstgipfelhöhe 4000 m. Reichweite 1090 km. Preis 9985 $.
Franz. Mauboussin 200.
Mauboussin 200, gebaut von den Etablissements Fouga, d'Aire-sur-Adour, Leitung Mr. Perilhon, freitragender Tiefdecker mit sehr langem Rumpf. Holzbauweise. Verwendungszweck: Jagd-Schulflugzeug. Flügel aus einem Stück, V-Form, zwei Kastenholme. Spruceflanschen mit Sperrholzstegen. Flügelbedeckung Sperrholz. Querruder in ähnlicher Ausführung, Ausschlag nach unten —24° und nach oben +17°. Bremsklappen 45° Ausschlag.
Franz« Bloch 488 Zweimotor-Torpedo-Sedlugzeug.
Dieses zweimotorige Zweischwimmer-Flugzeug ist im Auftrag der französischen Marine von Bloch (SNCA. de Sud-Ouest) gebaut.
Rumpf mit fast Vollsichtkanzel. Führersitz weit hinten an der Flügelvorderkante. Bestückung ein MG. in der Rumpfnase, eins hinter dem Flügel oberhalb und eins unterhalb des Rumpfes. Seitlich der Flügel Schußfeld begrenzt. Torpedo-Aufhängung unter dem Rumpf. Etwaiger Bombenraum in der Rumpfnase. Vier Mann Besatzung normal.
Flügelaufbau und Leitwerksteile ähnlich wie beim Bloch 133 (Landbomber), vergleiche „Flugsport" 1937, Seite 707.
Zwei Metallschwimmer mit Wasserruder.
Zwei Gnome-Rhone-14-N-Motoren von 940 PS.
Spannweite 23,50 m, Länge 19 m, Höhe 6,83 m, Fläche 78 m2, Leergewicht 6800 kg, Fluggewicht 10 000 kg. Geschwindigkeit in 2000 m 325 km/h, in 4000 m 315 km/h. Gipfelhöhe 7100 m, Reichweite 2000 km.
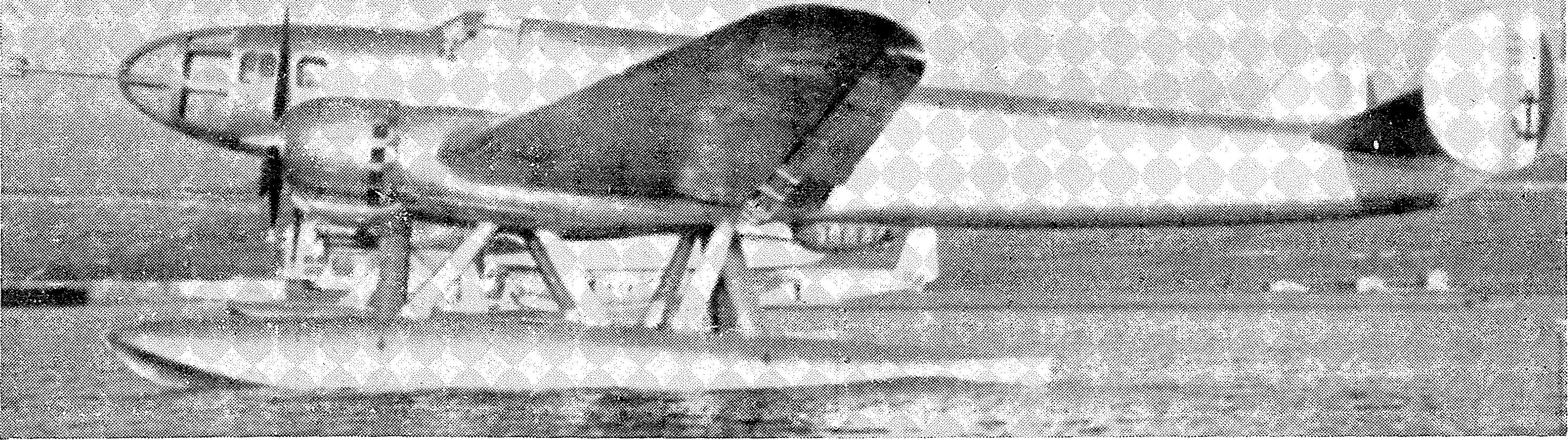
Franz. Bloch 488. Zweimotor-Torpedo-Seeflugzeug. Archiv Flugsport
Franz- Potez 65.
Potez 65, Bauj. 1925, wurde aus dem Potez 62 als Truppentransporter entwickelt. Vergleiche „Flugsport" 1935, Seite 120. Verwendungszweck für Transport für 14 Mann, als Krankenflugzeug für 10 Verwundete und einen Krankenwärter. Unterscheidet sich von dem Potez 62 nur durch die Verteilung der Lasten und durch den Einbau der luftgekühlten Motoren.
Kabine, im Boden zwei Falltüren zum Herausspringen von je 6 Mann, vgl. die Abbildung. Auf der hinteren linken Einstiegseite eine große dreieckige Tür, um sperrige Güter, wie Motoren u. a., sowie auch Tragbahren gut einbringen zu können. In der großen
Franz. Potez 65.
Zeichnung Flugsport
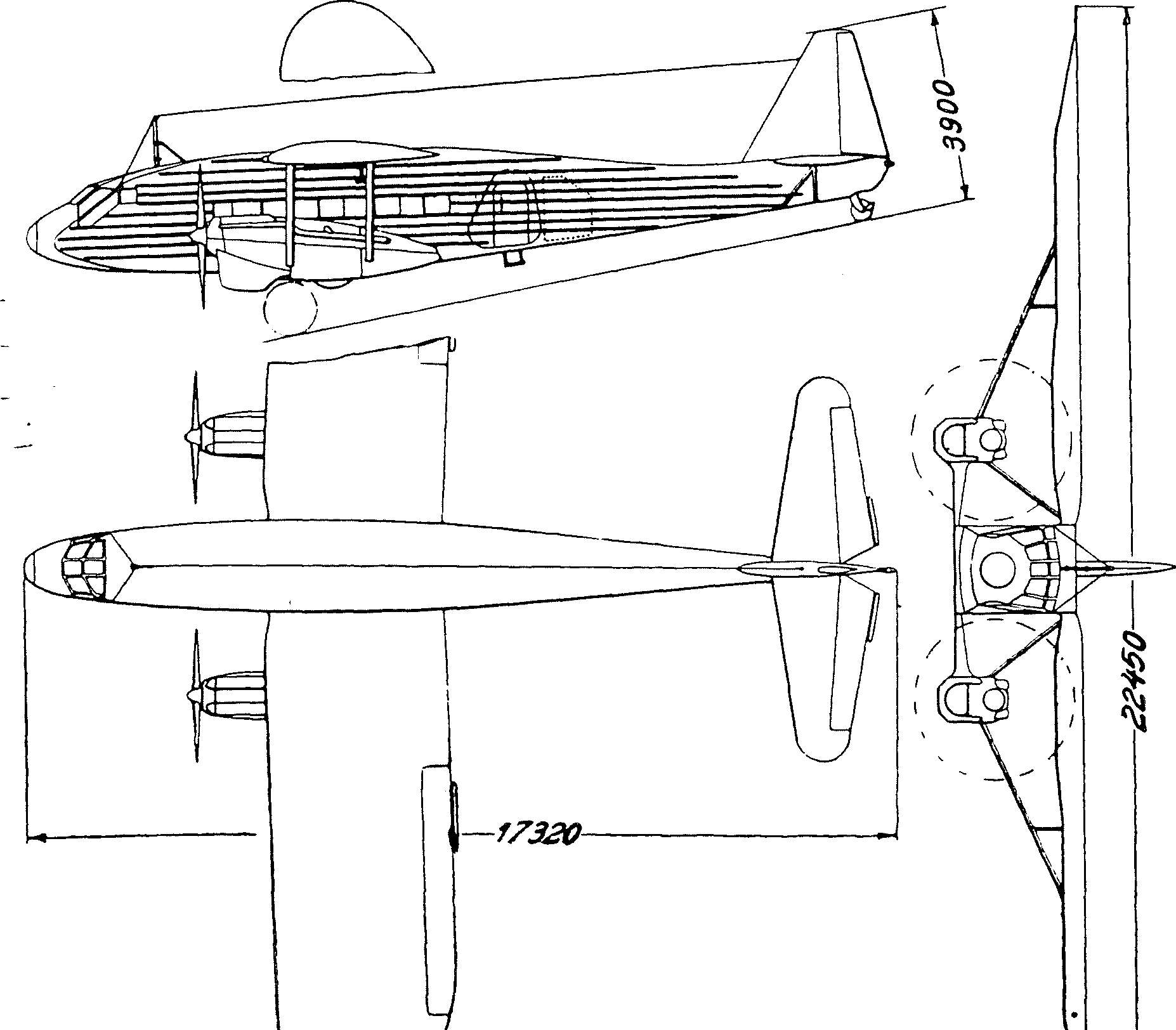
Franz.Potez 65. Links: Kabine. Man beachte in dem Gang die Absprungluken. Rechts: dreieckige Verladetür mit rechteckiger Einsteigtür. Archiv Flugsport
Dreieckstür befindet sich noch eine kleinere rechteckige Tür für Einzelaustritt und Fallschirmabsprung. Verschwindfahrwerk ähnlich wie bei dem Potez 54 und 62.
Spannweite 22,45 m, Länge 17,32 m, Höhe 3,90 m, Fläche 76 m2. Leergewicht 4350 kg, Fluggewicht 7400 kg. Höchstgeschwindigkeit in 2000 m 300 km/h, mit nur einem Motor 180 km/h, Reisegeschw. 250 km/h, Gipfelhöhe absolut 6000 m, mit einem angehaltenen Motor 1500 m.
Engl. Pobjoy Sternmotor „Niagara V".
Ueber diesen Motor für Sportflugzeuge berichteten wir bereits 1937 auf Seite 358.
Die Serienfabrikation dieses Motors scheint schon seit längerer
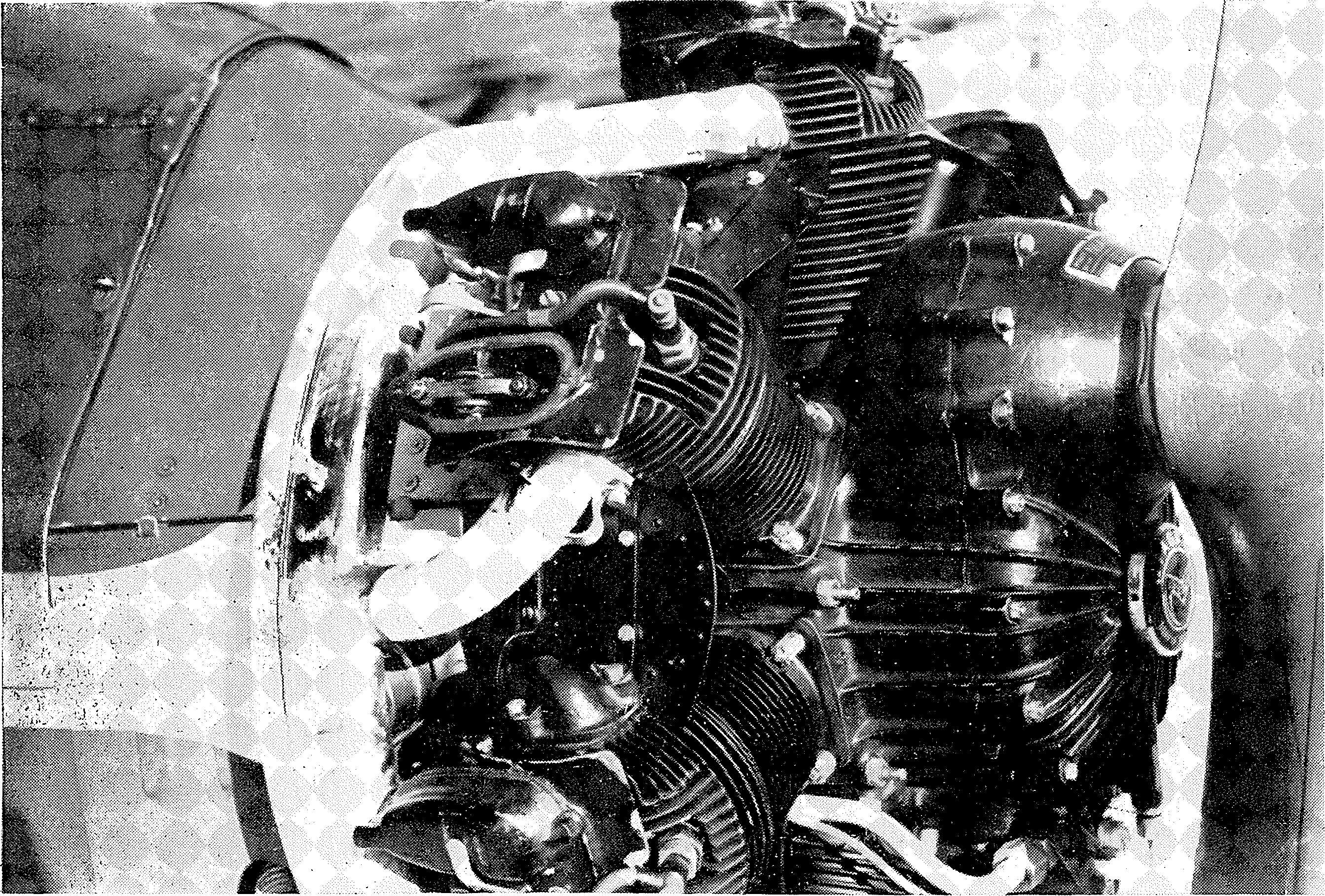
Niagara III. Man beachte die Ausbildung derKühl-Windleit-Rippen am Zylinderkopf und die Einkapselung der im Oelbad laufenden Kipphebel. Ein Kipphebeldeckel ist abgenommen.
Bild: Hansen.
Zeit, infolge dringlicher Kriegslieferungen für das Royal Air Force, eingestellt zu sein.
Der Niagara V ist aus dem Niagara III weiterentwickelt und zeigt keine wesentlich veränderten Konstruktionsmerkmale.
Seit dieser Zeit sind die deutschen Sportflugzeugmotore bedeutend entwickelt und vereinfacht worden.
Stahlrippenzylinder mit aufgeschraubten gerippten Alumingußköpfen. Angegossenes Kipphebelgehäuse mit abnehmbaren Deckeln, vergleiche die nebenstehende Abbildung des Niagara III.
Kurbelwelle zweiteilig, Kurbelgehäuse Aluminguß, vierteilig, dabei das Hauptkurbelgehäuse in der Zylindermitte geteilt. Im vorderen Motorgehäuseteil Untersetzungsgetriebe mit Schrauben-wellenlagerung. Im hinteren Teil Nockenantrieb sowie Magnet (2 Rotax), Vergaser und sonstige Antriebsteile. Im vorderen Teil doppelte Oelpumpe, angetrieben von der Kurbelwelle.
Die Abmessungen sind folgende: Sieben Zylinder, luftgekühlt, 81 mm Bohrung, 87 mm Hub, Hubraum 3,13 1, Untersetzungsgetriebe 0,438 : 1, Höchstleistung 137 PS bei 4600 U/min, Nennleistung 125 PS bei 4000 U/min, Dauerleistung 119 PS bei 3800 U/min, Betriebsstoff 87 Oktan, Betriebsstoffverbrauch bei Dauerleistung 0,273 1 PS/h. Gewicht 84 kg.
Askania-Fernkurskreisel ermöglicht dem Flugzeugführer eine schwingungsfreie Bestimmung und Beibehaltung der Flugrichtung. Fernkurskreisel wurde aus einfachem Kurskreisel entwickelt.
Der Fortschritt besteht im wesentlichen darin, daß die von Zeit zu Zeit notwendige Vergleichung mit einem Magnetkompaß nicht mehr vom Flugzeugführer vorgenommen werden muß, sondern durch eine Fernübertragung von einem Fernkompaß aus selbsttätig erfolgt. Der Askania-Fernkompaß meldet bekanntlich die Abweichungen von dem eingestellten Kurs; diese Meßwerte werden zur „Stützung" des Kurskreisels durch elektromagnetische Beeinflussung benutzt, d. h. zur Verhinderung von Abweichungen des Kreisels aus der eingestellten Richtung. Somit ist der Fernkurskreisel ein jederzeit zuverlässiger Richtungsweiser sowohl für menschliche Ablesung wie auch als Kursgeber für eine selbsttätige Kurssteuerung. Der Askania-Fernkurskreisel ist daher auch mit einer Fern-
Askania-Fernkurskreisel.
Übertragungseinrichtung ausgestattet, die zur Weitergabe des Meßwertes an die Ruderanlage dienen kann. Der Fernkurskreisel enthält zwei übereinander angeordnete Rosen, wobei Kursgeberrose „flugzeugfest" und einstellbar ist. Kursrose wird durch einen Kreisel in räumlicher Stellung gehalten. Ihre Stellung zueinander ist zu beobachten. Durch pneumatische Fernübertragungseinrichtung wird er zum Impulsgeber und Richtungsgerät für selbsttätige Kurssteuerung.
Kreiselsystem ist in luftdichtes Gehäuse eingebaut, welchem ein Absaugstutzen Luft entzieht. Die durch einen herausnehmbaren Luftfilter nachströmende Luft wird erst der pneumatischen Fernübertragung und dann dem Kreiselsystem zugeleitet.
Das Kreiselsystem besteht aus einem Kreisel, aufgehängt in 2 Rahmen (Abb. 1). Eintritt der Luft durch den unteren Lagerzapfen, welche durch Bohrungen im Kursrahmen seitlichen Lagerstellen zugeleitet wird. Hier Austritt aus Düse zwecks Antrieb des Kreisels. Gegenüberliegender Lagerzapfen wird für die pneumatische Aufrichtung nach Rückstrahlprinzip benutzt, dadurch bleibt Kreiselrahmen in waagerechter Stellung.
Abb. 1. Kreiselsystem mit Kursrose und _Steuerscheibe._
Untere Abbildungen. Schema der Fernübertragungseinrich-tung für Fernkompaß und Fernkurs-kreisel. Abb. 2 (links). Mittelstellung. Steuerscheibe deckt Düsenpaare gleichmäßig ab. Druckunterschied zwischen
den Leitungen ist Null. Abb. 3 (Mitte). Größte Ablenkung.Steuer-Scheibe und Düsenpaare um « versetzt, Druckunterschied zwischen den beiden
Leitungen ist Größtwert. Abb. 4 (rechts). Steuerdruck-Kennlinie. Druckunterschied zwischen den beiden Leitungen.
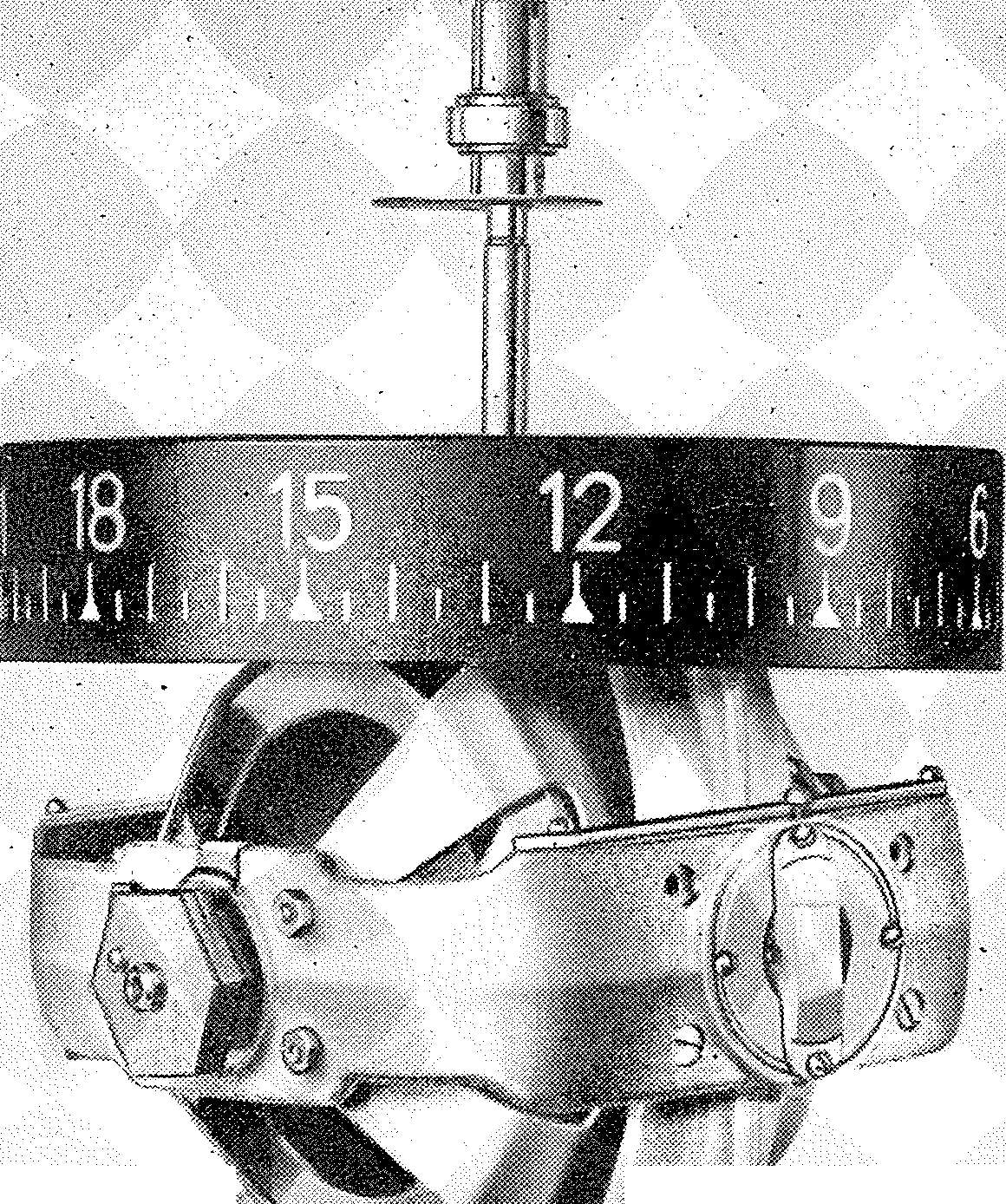
Abb. 2.
Abb. 4.
Kursrahmen kann durch Knopf mit Zahnräderpaar verstellt und durch Hebelsystem in waagerechte Stellung gebracht werden.
Pneumatische Fernübertragung bestehend aus einer Achse mit Steuerscheibe und 2 Düsen. Bei Kurs Druck auf Membrane beidseitig gleich (Abb. 2). Außer Kurs gibt Steuerscheibe eine Düse mehr frei, hat Ausschlag zur Folge (Abb. 3). Kursänderung durch Drehen an Knopf, wirksam auf Fernkurskreisel und Fernkompaß.
Beheizung von Bordnetz schützt gegen Vereisung.
KONSTRUKTION INZELHHTEH
Pidcock kombinierte Oberseiten-schlitzklappe mit Hinterkantenspreiz-klappe. Durch Exzenter A kann die Oberseitenklappe bezugsweise deren Anstellwinkel verstellt werden.
Die Anordnung scheint aus der von dem U. S. National Advisory Committee for Aeronautics vorgeschlagenen Flügelanordnung entstanden zu sein. Aehnliche Einrichtungen sind in Deutschland seit längerer Zeit in Gebrauch.
Pidcockklappe
Warnboxhorn in der Rückenlehne
des Führersitzes. Beim Herunterklappen werden blokierte Steuerungsteile, wie Querruder und andere, entsichert. Es soll trotzdem vorgekommen sein, daß der Führer in vorgebeugter Stellung bei Betätigung von Hebeln Gas gegeben hat.
Die Möglichkeit des Horn-nichtwegklappens wird noch erhöht durch die weit zurückliegende Rückenlehne und schräge Lage des Flugzeuges in Landestellung.
Nebenstehende Abbildung zeigt eine Ausführungsform bei dem engl. Flugboot Short G-Klasse.
FLUG ITOSCHAl
Inland.
Sicherstellung von feindlichen notgelandeten Flugzeugen kann die Mitarbeit der Bevölkerung dort erforderlich machen, wo Wehrmacht oder Polizei nicht sofort zur Verfügung stehen. Als oberstes Gebot für jeden Volksgenossen gilt: Hände weg von Jedem Gegenstand oder Geräteteil eines Flugzeuges, denn:
1. besteht die Möglichkeit des Vorhandenseins von Zeitzündern an Feindflugzeugen zur Zerstörung durch die Besatzung. Deshalb größte Vorsicht!
2. Ist jeder kleinste Teil wichtig und für die zuständigen Stellen von größter Bedeutung. Jede Vernichtung von Flugzeugen und Geräten sowie Notizbüchern, Karten, Photoapparaten, Soldbüchern, Briefen usw. muß unbedingt verhindert
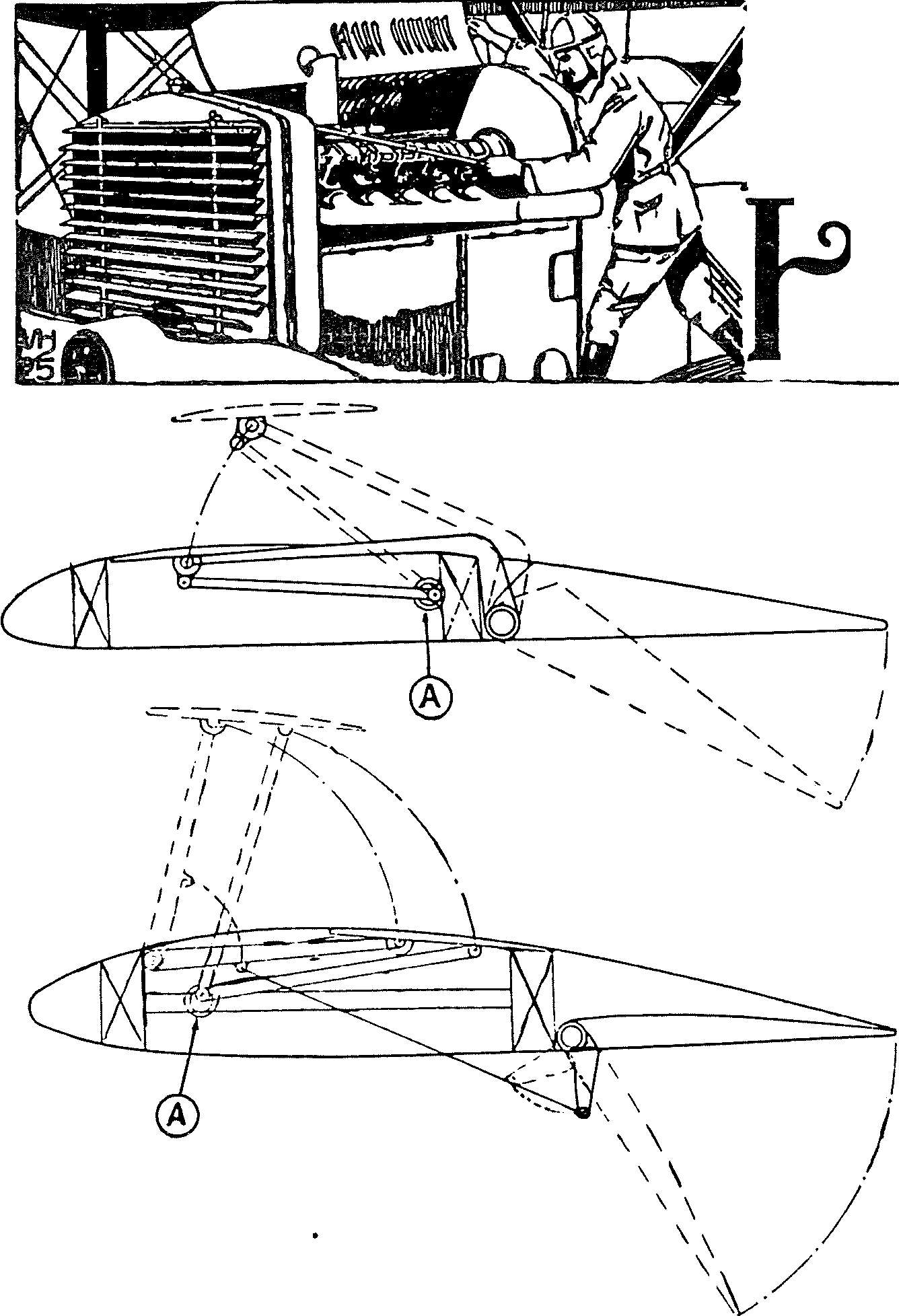
werden. Das Zurückbehalten — etwa als Andenken — schädigt die Landesverteidigung und wird nach den Gesetzen als Plünderung schwer bestraft.
Die Besatzung ist vom Flugzeug abzudrängen und gefangenzunehmen. Verletzten ist dann zu helfen. Der nächste Gendarmerieposten, Gemeindevorsteher oder Polizeistelle ist schnellstens zu unterrichten.
Die Bergung und Sicherstellung der Flugzeuge und Geräte, Abtransport der Gefangenen ist Sache der militärischen Dienststellen.
Bis zum Eintreffen eines Kommandos muß sich jedermann darüber klar sein, daß sein verantwortungsbewußtes Handeln dazu beiträgt, die Absichten und Pläne des Feindes rechtzeitig zu erkennen und deren wirksame Bekämpfung zu veranlassen.
Deutsche Normen für Materialprüfungen hat der Deutsche Normenausschuß neu herausgegeben (Beuth-Vertrieb, Berlin SW 68), deren Träger der Deutsche Verband für die Materialprüfungen der Technik ist: Gießereiwesen: DIN Vornorm DVM 2401 Prüfung von Gießerei-Formsand. — Kraftstoffe: Prüfung von Leichtkraftstoffen: DIN DVM 3673 Kältebeständigkeit; DIN DVM 3676 Wasseraufnahmevermögen (Wasserwert); DIN DVM 3678 Säurewert. — Holz-schütz: DIN DVM 2176 Blatt 1 Prüfung von Holzschutzmitteln, Mykologische Kurzprüfung (Klötzchen-Verfahren). — Gummi: Prüfung von Gummi: DIN DVM 3504 Bestimmung der Zugfestigkeit und Bruchdehnung von Weichgummi durch den Zugversuch; DIN DVM 3508 künstliche Alterung von Weichgummi. Prüfung von Gummi, chemische Prüfverfahren: DIN DVM 3551 Probenahme; DIN DVM 3554 Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes; DIN DVM 3556 Bestimmung der wasserlöslichen Bestandteile; DIN DVM 3557 Bestimmung der azetonlöslichen Bestandteile; DIN DVM 3558 Bestimmung der chloroformlöslichen Bestandteile; DIN DVM 3559 Bestimmung der in halbnormaler methylalkoholischer Kalilauge löslichen Bestandteile; DIN DVM 3560 Bestimmung der xylolunlöslichen Bestandteile; DIN DVM 3568 Bestimmung der mineralischen Bestandteile durch Veraschung.
Höchstpreise für inländische Flugzeug-Kiefernstammware regelt eine Anordnung vom 23. 9. 39 des Reichskommissars für die Preisbildung, veröffentlicht im Reichsanzeiger Nr. 239 v. 12. 10. 39. Danach wird mit Zustimmung des Beauftragten für den Vierjahresplan bestimmt, daß für den Verkauf von inländischer Flugzeug-Kiefernstammware folgende Höchstpreise gelten: beim unmittelbaren Absatz vom Bearbeiter an den Hersteller von Flugzeugen oder Flugzeugteilen 155 RM je cbm; beim Absatz vom Holzhandel an den Hersteller von Flugzeugen oder Flugzeugteilen unmittelbar vom Bearbeiterbetrieb aus 180 RM je cbm. Diese Preise verstehen sich bei Bahnversand frei Sägewerk ohne Rücksicht darauf, in welchen Mengen im Einzelfall geliefert wird, und zwar einschließlich Verlade-kosten. Die Anordnung tritt zwei Wochen nach ihrer Verkündigung in Kraft.
Dr. Todt zum Generalmajor ernannt durch den Führer und Obersten Befehlshaber der Wehrmacht auf Vorschlag des Generalfeldmarschalls Göring in Anerkennung der einzigartigen militärischen Verdienste, die mit der Schaffung des Westwalls und der Luftverteidigungszone West zusammenhängen.
Erich Marquard, Dr.-Ing., Oberreg-Baurat, jetzt o. Prof. Fakultät Maschinenwesen, T. H. Aachen, Lehrstuhl für Kraftfahrwesen und Verbrennungsmaschinen.
Hermann Hahn t, Mitbegründer der Firma Hahn & Kolb, Alter 74 Jahre, gestorben.
Gustav Grüttefien t, der langjährige und verdienstvolle Hauptsportschriftleiter der B. Z., 60 Jahre, Gehirnschlag, gestorben.
Ausland.
Junkers Ju 52 nach Estland und Schweiz wurden dieser Tage abgeliefert. Trotz der kriegerischen Auseinandersetzungen haben die deutschen Handelsbeziehungen keinerlei Störung erfahren. Früher abgeschlossene Lieferungstermine wurden pünktlich eingehalten. In diesen Tagen startete auf dem Junkers-Werk-fiugplatz das erste Flugzeug der beiden von der estnischen Verkehrsgesellschaft „AGO" bestellten Ju 52 zum Ueberführungsflug nach Estland. Das zweite wird in den nächsten Monaten folgen. Die Flugzeuge werden auf den Linien Reval— Stockholm und Reval—Helsingfors im Luftverkehr eingesetzt. Teilnehmer des Fluges waren der ehemalige estnische Gesandte in Warschau, Minister Markus, die Direkt, d. „AGO", Kerem und Org, die Gattin des estnischen Militärattaches in Berlin, Frau Jakobsen, Verwaltungsmitglied Heinrich Uuemois der estn. Ges. „Keskkassa", Chefpilot der „AGO" Olt, der die Maschine flog, mit einigen Herren der Begleitung.
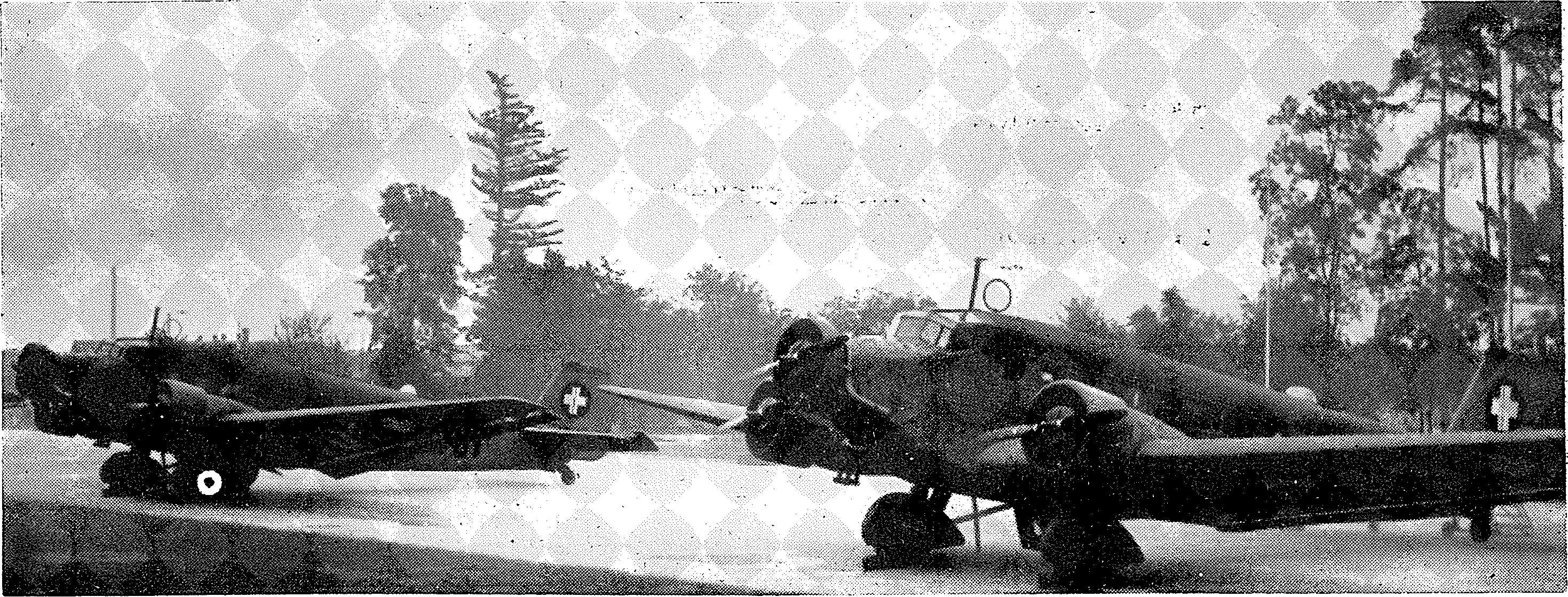
3 Ju 52/3 m Hörsaalflugzeuge auf dem Junkers-Werkflugplatz in Dessau vor dem Ueberführungsflug nach der Schweiz. Werkbild
Weiter starteten am gleichen Tage 3 für die schweizerische Luftwaffe bestimmte Hörsaalflugzeuge des gleichen Typs, eingerichtet für Funk- und Blindflugschulung, zur Ueberführung nach der Schweiz. An diesem Flug nahm die aus Hptm. Rüetschi, Oberltn. Voute und Flugkpt. und Berltn. Borner bestehende Abnahmekommission der schweizerischen Luftwaffe teil.
In Dessau wie in den übrigen Junkers-Werken im Reich sieht es ziemlich friedlich aus. Die Maschinen werden auf dem Luftwege nach ihren Bestimmungsländern überführt. Da gibt es keine Blockade. Die deutsche Flugzeugindustrie befriedigt programmäßig die Flugzeugaufträge ihrer neutralen Auftraggeber.
Fieseler-Werke G. m. b. H., Kassel, lieferten ein Flugzeug Fieseier „Storch'" Fi 156 an eine Schweizer Gesellschaft nach St. Gallen. Es handelt sich um eine mit allen Bequemlichkeiten versehene luxuriös ausgestattete Limousine in Sonderausführung, die im Dienst des schweizerischen Fremdenverkehrs unter den ungewöhnlich schwierigen Verhältnissen des Hochgebirges verwendet werden soll.
Ueberlegenheit der deutschen über die britische Luftwaffe kennzeichnet der militärische Mitarbeiter der „New York Post", Fletscher Pratt, am 4.10. in einer längeren Betrachtung über den bisherigen Verlauf des Luftkrieges. Diese Feststellung trifft Pratt an Hand zahlreicher Beispiele von Luftkämpfen, die durchweg mit außerordentlich schweren englischen und kaum nennenswerten deutschen Verlusten durchgeführt wurden. Die deutschen Bombenfluzeuge seien nur wenig
— wenn überhaupt — langsamer als die britischen Jagdmaschinen. Sie könnten 300 Meilen und schneller fliegen. Der Verfasser bezweifelt auch, ob England „mit seinen großen physisch untauglichen und unter kümmerlicher Schulbildung leidenden Arbeitermassen" die Frage des Pilotennachwuchses ohne wirksame Hilfe der Dominien lösen könne. Deutschland sei nicht nur bevölkerungsmäßig im Vorteil, sondern lenke bereits seit Adolf Hitlers Machtergreifung sein Augenmerk auf bestgeeigneten Fliegernachwuchs.
Bristol-Hercules-IV-Schiebermotor, 14 Zyl. in zwei Reihen, Normalleistung 1010/1050 PS bei 2400 U/min in 1350 m Höhe. Maximalleistung 1220 PS bei 2800 U/min in 1650 m. Startleistung 1380 PS bei 2800 U/min.
Rom—Rio de Janeiro Postflugverbindung, Linienführung Rom—Malaga 1200 km, Malaga—Villa Cisneros (span. Besitz Goldküste) 2300 km, Villa Cisneros
— Kap Verdische Inseln (portug.) 1200 km. Die drei Abschnitte (europäischer, transatlantischer und amerikanischer Abschnitt) sind einzeln für sich organisiert. Zum Einsatz gelangen „S. 83 Sorci Verdi" (Grüne Mäuse).
USA. Light-Airplane-Show-Rennen, Chicago, im August, Klasse für 50-PS-und für 75-PS-Motoren. Erster Ellis Eno auf Aeronca Chief.
Flughafen North Beach auf Long Island bei New York eröffnet. Baukosten bis zur endgültigen Fertigstellung 50 Millionen Dollar.
Moskau—Westukraine Flugpostverbindung Anfang Oktober eröffnet.
Japan. „Rund-um-die-Welt"-Flug, veranstaltet von den japanischen Zeitungen „Tokio Nichi Nichi" und „Osaka Mai Nichi", Start 26. 8. 39 Tokio, nach Flug von gesamt 62860 km in 195 Flugstunden am 13. 10. 39 beendet. 300000 Personen waren beim Empfang Tokio zugegen.
Luftwaffe.
Berlin, 7. 10. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Französische Aufklärungsflugzeuge versuchten nachmittags, den Rhein bei Bonn zu überfliegen. Sie wurden durch deutsche Jagd- und Flakabwehr vertrieben. Eines von ihnen wurde bei Godesberg im Luftkampf abgeschossen, ein zweites bei Euskirchen zur Notlandung gezwungen. Die vierköpfige Besatzung, darunter ein Oberstleutnant im Generalstab, wurde gefangengenommen. Eigene Verluste traten nicht ein.
Oslo, 7. 10. 39. Am Donnerstag (5. 10.) verfolgte ein französisches Flugzeug einen deutschen Dampfer bis in die norwegischen Hoheitsgewässer bei Larvik hinein. Das Flugzeug sei dann von norwegischen Fliegern zur Umkehr gezwungen worden.
Brüssel, 8, 10. 39. (DNB.) Nach Pressemeldungen ist es, wie erst jetzt bekannt wird, am Freitag (6. 10.) zu einer neuen Verletzung der belgischen Neutralität durch ein französisches Militärflugzeug gekommen. Die französische Maschine, die sich angeblich im Nebel verirrt haben will, nahm eine Notlandung in der Nähe von Langemarck, also etwa 30 km von der französischen Grenze entfernt, vor. Die aus zwei Unteroffizieren bestehende Besatzung wurde von der belgischen Gendarmerie interniert. Das Flugzeug, in dem sich militärische Dokumente befanden, wurde beschlagnahmt.
Berlin, 9. 10. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Im Westen in der Luft nur geringe Aufklärungstätigkeit.
Berlin, 10. 10. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Am 9. Oktober erfolgte ein überraschender Bombenangriff auf englische Seestreitkräfte vor der Westküste Norwegens. Die deutschen Angriffsverbände erzielten u. a. sechs besonders schwere Treffer auf englische Kreuzer, die durch Explosionen und Rauchentwicklung an Bord weithin ein Zeichen des deutschen Erfolges waren. Zwei der deutschen Angriffsflugzeuge mußten auf dänischem Hoheitsgebiet notlanden. Die Besatzungen sind unversehrt.
. . ., 10. 10. 39. (DNB.) Bekanntlich gelang es einem deutschen Kampfflugzeug, einen britischen Flugzeugträger zu bombardieren und zu zerstören, so daß er im Kampfverband der britischen Flotte ausfiel. Wie unsere See-Aufklärer festgestellt haben, ist der Flugzeugträger in dem britischen Flottenverband, der das Ziel unseres Angriffs war, nicht mehr gesichtet worden.
Generalfeldmarschall Göring richtete an den erfolgreichen Kampfflieger Gefreiten Franke nachstehendes persönliches Schreiben:
„Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem mit Schneid geführten, von bestem Erfolg gekrönten Bombenangriff auf den britischen Flugzeugträger. Als Ihr Oberbefehlshaber der Luftwaffe befördere ich Sie aus Anlaß dieser großartigen

Verleihung der ersten Eisernen Kreuze an die Piloten einer Sturzkampfstaffel, die entscheidenden Anteil an der Niederkämpfung der polnischen Seefestungen hatte.
Bild PK-Mendl-Weltbild
Waffentat mit sofortiger Wirkung zum Leutnant. Wegen hervorragender Tapferkeit vor dem Feind verleihe ich Ihnen namens des Führers und Obersten Befehlshabers der Wehrmacht das Eiserne Kreuz II. und I. Klasse."
Leutnant Franke gibt über den erfolgreichen Bombenangriff folgende Schilderung:
„Wir befanden uns einsatzbereit auf einem Fliegerhorst an dem Tage, an dem es mir in der dritten Nachmittagsstunde gelang, mit einer 500-kg-Bombe einen schweren Treffer auf einem britischen Flugzeugträger anzubringen. Gegen 12 Uhr erhielten wir Nachricht, daß ein Gros der englischen Flotte ausgelaufen sei. Diese Nachricht wurde uns von unsern See-Fernaufklärern vermittelt. Unser Einsatzbefehl lautete: „Schwere englische Seestreitkräfte in der Nordsee. Schwerpunkt des Angriffs der Flugzeugträger."
Kurz vor 13 Uhr startete ich mit meiner Maschine. Als alter erfahrener Seeflieger flog ich in 500 m Höhe, da sich über uns eine dichte Wolkendecke ausbreitete. In dieser Höhe konnte ich die Flotte besser sichten. Nach einer Flugzeit von 1% Stunden sichtete ich den Gegner. Um eine richtige Angriffsbasis zu haben, ging ich sofort auf 3000 m Höhe. Beim Durchbrechen durch die Wolkendecke bemerkte ich, daß der Angriff nicht den gewünschten Erfolg haben würde. Ich brach ihn daraufhin ab und stieß wieder in die Wolkendecke hinein. Die begleitenden englischen Kriegsschiffe deckten mich mit ihrer Flakwaffe ein, doch konnte ich ohne nennenswerten Schaden die geeignete Höhe für den zweiten Angriff erreichen.
Diesen Angriff setzte ich aus einer Höhe von 2700 m an. Auch hier konnte ich durch die Wolkendecke das Ziel nicht sehen. Beim Durchstoßen der Wolkendecke sah ich den Flugzeugträger vor mir. Die erste Bombe fiel 20 m neben ihn, aber die zweite traf ihn steuerbords. Ein rasendes Flakfeuer empfing meinen Angriff. Ich selbst habe den Treffer nicht bemerkt, nur meine Besatzung erzählte mir, daß sie steuerbords des Flugzeugträgers eine dichte schwarze Rauchwolke und Feuerschein gesehen hätten. Die Flotte wurde am andern Tage wieder gesichtet, doch der Flugzeugträger war nicht mehr darunter. Einen Hafen kann er auch nicht erreicht haben. Es besteht nur die Möglichkeit, daß der Treffer so schwer saß, daß der Flugzeugträger mit den Maschinen untergegangen ist."
Soweit die Schilderung des erfolgreichen Kampffliegers, der durch die Ernennung zum Leutnant und die Verleihung des Eisernen Kreuzes beider Klassen den wohlverdienten Lohn seiner Tapferkeit erhalten hat. Der tapferen Besatzung, Unteroffizier Hansen, Unteroffizier Bewermeyer und Flieger Blumenstein, wurde das Eiserne Kreuz II. Klasse verliehen.
Berlin, 11. 10. 39. (DNB.) Vom 7. Oktober beginnend fanden gemeinsame Operationen von schweren und leichten Seestreitkräften sowie Luftstreitkräften in der nördlichen Nordsee und an der norwegischen Westküste statt. Im Verlaufe dieser Operationen angesetzten Luftstreitkräften gelang es, englische Seestreitkräfte zu stellen und, wie bereits berichtet, zu schädigen. Die Operationen werden fortgesetzt.
Berlin, 12. 10. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Im Osten wurde in Mittelpolen an mehreren Stellen der Bug erreicht.
Geringe Luftaufklärungstätigkeit in der Nordsee und im Westen. Bei einem Luftkampf südlich Lauterburg wurde ein französisches Flugzeug abgeschossen.
Berlin, 11. 10. 39. (DNB.) 'Im Verlaufe der von der Kriegsmarine zur Kontrolle des Handelsverkehrs in der Nordsee laufend durchgeführten Maßnahmen wurde in den vergangenen Tagen eine Unternehmung schwerer und leichter Streitkräfte bis in die nördliche Nordsee ausgeführt. Während die leichten Streitkräfte eine große Anzahl von Dampfern anhielten und sie auf Banngut untersuchten, dienten ihnen die schweren Streitkräfte als Rückhalt. Die Unternehmung führte die deutschen Streitkräfte bis weit in die nördliche Nordsee, ohne daß feindliche Streitkräfte angetroffen wurden.
Im Verlauf der Unternehmung gerieten am Morgen des 9. Oktober den deutschen Seestreitkräften entgegengeschickte feindliche Streitkräfte zunächst in Sicht deutscher Seeaufklärer, welche die Feindstreitkräfte westlich der Südspitze Norwegens meldeten. Auf Grund der durch Funk übermittelten Meldungen starteten einige Staffeln einer Luftflotte und der Seeluftstreitkräfte, um die Engländer mit Bomben anzugreifen. Unter schwierigsten Bedingungen — Regenschauern, starken Böen und schlechter Sicht — stießen die deutschen Flieger, teils in den Wolken; teils in niedriger Höhe über dem'Wasser fliegend, in breiter
Front bis in die nördliche Nordsee vor. Gelenkt durch die am Feinde verbliebene Aufklärung erreichten die Flugzeuge die ihnen zugewiesenen Ziele. Einer der Verbände stieß über den 61. Breitengrad, also über die Höhe der Shetland-Inseln, hinaus, nach Norden vor, und traf hier auf einen Verband schwerster englischer Seestreitkräfte.
Im Hoch- und Tiefangriff griffen die deutschen Flieger die englischen Kriegsschiffe an und warfen, unbeirrt durch das konzentrierte Flakfeuer des Feindes, in sicherem Zielanflug ihre Bombenlast ab. Starke Rauchentwicklung, schwere Explosionen und deutlich erkennbare Brände im Ziel waren das sichtbare Zeichen des Erfolges. Sechs Treffer schweren Kalibers und vier Treffer mittleren Kalibers wurden auf schweren englischen Kreuzern erzielt. Erst spät in der Dunkelheit, zum Teil nach acht- bis zehnstündigem, ununterbrochenem Flug über See, kehrten die deutschen Flieger in ihre Heimathäfen zurück.
Trotz der großen Entfernung, über die der Angriff getragen werden mußte — eine Angriffsleistung, die bisher die Geschichte der Fliegerei noch nicht kannte — und trotz des außerordentlich ungünstigen Wetters waren die Verluste erfreulich gering. Die englische Flakabwehr hat gegen die Angreifer nichts ausrichten können. Lediglich auf dem Rückflug fielen vier Flugzeuge aus, von denen zwei bereits gestern als auf neutralem Gebiet notgelandet gemeldet worden sind.
Die fortdauernden Maßnahmen der Kriegsmarine mit dem Ziele der Kontrolle des Handelsverkehrs durch die Nordsee und die Verhinderung der Banngutverschiffung nach den Feindländern, die sich ohne jede Störung durch den Gegner vollziehen, und der erneute Vorstoß deutscher Luftstreitkräfte in die nördliche Nordsee haben bewiesen, daß die Nordsee ein Seegebiet ist, in welchem die See- und Luftherrschaft in deutscher Hand liegen, und daß der Gegner in diesem Gebiet sich jederzeit schwersten Schlägen aussetzt. Weiter hat sich bestätigt, daß die Reichweite der deutschen Luftwaffe über die Nord- und Westgrenze Englands hinausgeht und der Feind im gesamten Gebiet der Nordsee gestellt werden kann, wo immer er sich zeigt. Daß darüber hinaus deutsche Flieger die englische Flotte in dem von ihr angeblich beherrschten Raum mit größtem Erfolg angreifen konnten — an einem Ort und zu einem Zeitpunkt, den

Bei Groß-Gerau abgeschossener englischer Bomber. Bilder: Flugsport
die Deutschen bestimmten — hat vor aller Welt offenbart, daß die Zeit der unbeschränkten britischen Seeherrschaft in der Nordsee ein für allemal vorüber ist.
Berlin, 13. 10. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Franzosen sprengten gestern die festen Rheinbrücken bei Wintersdorf, Breisach und Neuenburg.
Berlin, 14. 10. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Im Osten wurden mit der Besetzung der letzten Abschnitte am Bug die Bewegungen auf die deutschrussische Interessengrenze abgeschlossen.
Bei Luftangriffen im Westen wurden durch Jagd- und Flakabwahr drei feindliche Flugzeuge bei Schleiden, Idar-Oberstein und Mayen ohne eigene Verluste abgeschossen.
Berlin, 15. 10. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Im Osten keine besonderen Ereignisse.
Am 13. Oktober ist in der Gegend von Birkenfeld ein weiteres feindliches Flugzeug abgeschossen worden. Am 14. Oktober keine feindliche und eigene Flugtätigkeit von Bedeutung.
In der Nacht vom 14. zum 15. Oktober über norddeutschem Gebiet vernehmbares Motorengeräusch hat an einigen Stellen eigenes Flakfeuer ausgelöst.
Berlin, 16. 10. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Nachdem die Truppenbewegungen zur Besetzung des deutschen Interessengebietes in Polen beendet sind, wird das Oberkommando der Wehrmacht über den Osten nicht mehr berichten. Im Westen in der Luft nur geringe eigene und feindliche Flugtätigkeit in Grenznähe.
Frankfurt a. M., 16. 10. 39. In der Nacht vom Sonntag (15. 10.) auf Montag ist im Luftraum Mainz-Frankfurt ein Flugzeug gegen 1 Uhr durch eine Flakbatterie in der Nähe von Frankfurt a. M. abgeschossen worden. Das Flugzeug, ein englischer Bomber Typ Whitley II, liegt etwa 2 km südwestlich Groß-Gerau. Ein Mitglied der Besatzung ist tot, vier andere wurden gefangen genommen. Bei dem erneuten Versuch eines französischen Aufklärers, am Montagmorgen am Rhein zwischen Biblis und Groß-Gerau einzufliegen, wurde er abgeschossen, als er die Flakbatterie mit MG-Feuer angriff. Das Flugzeug, Typ Potez 63, liegt in der Nähe von Gernsheim. Auch hier sind zwei Mitglieder der Besatzung tot. Ein weiteres Mitglied, das verwundet in deutsche Gefangenschaft geriet, wurde sofort nach der Gefangennahme in ein Lazarett überführt.
Berlin, 16. 10. 39. (DNB.) Am 16. Oktober griffen in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr deutsche Bomber englische Kriegsschiffe, die im Firth of Förth lagen, an. Zwei britische Kreuzer wurden von Bomben schweren Kalibers getroffen. Der Angriff fand trotz schweren englischen Abwehrfeuers statt. Von den britischen Jagdflugzeugen, die ihrerseits zum Angriff aufstiegen, wurden durch unseren Kampfverband zwei abgeschossen. Zwei deutsche Flugzeuge werden vermißt.
Stockholm, 17. 10. 39. (DNB.) Die schwedischen Zeitungen bringen ausführliche Berichte über die Bombardierung des Kriegshafens Firth of Förth. „Stockholm Tidningen" gibt eine fernmündliche Unterredung eines Londoner Korrespondenten mit dem dänischen Konsul in Edinburg wieder, aus der hervorgeht, daß der deutsche Angriff offenbar völlig überraschend gekommen ist. Ueberein-stimmend berichten die Stockholmer Blätter, daß zivile Anlagen nicht von Bomben getroffen worden sind.
Aus Kopenhagen wird noch gemeldet: Der Angriff der deutschen Luftwaffe in dem Gebiet um den Firth of Förth wird von den Morgenblättern als das Ereignis des Tages bewertet, über das an erster Stelle und ausführlich berichtet wird. Es ist ganz offensichtlich, daß dieser, wie wiederholt hervorgehoben wird, erste deutsche Vorstoß auf englisches Gebiet einen sehr starken Eindruck gemacht hat. Aus einem Londoner Bericht ergibt sich weiter, daß Edinburg von dem deutschen Angriff völlig überrascht wurde.
Aus London wird noch berichtet: Das Sicherheitsrninisterium teilt mit, es seien Untersuchungen im Gange darüber, warum bei dem gestrigen Luftangriff in Edinburg kein Alarm gegeben worden sei.
Brüssel, 17. 10. 39. Nach amtlichen Londoner Nachrichten sind bei dem deutschen Luftangriff auf die englische Flotte im Firth of Förth 15 Mitglieder der Besatzungen, darunter 2 Offiziere, getötet worden. Die Admiralität hat mitgeteilt, daß sich unter den Getöteten der Kommandant des Zerstörers „Mohawk", ein Leutnant, ein Artillerieunteroffizier, zwei Deckoffiziere, fünf Obermatrosen, vier Matrosen und ein Schiffsjunge befinden.
Berlin, 17. 10. 39. (DNB.) Am 17. Oktober stießen deutsche Luftstreitkräfte bis auf Scapa Flow vor. Die in der Bucht liegenden Einheiten der britischen Schlachtflotte wurden mit Erfolg angegriffen. Neben anderen Kriegsschiffen erhielt ein englisches Schlachtschiff Treffer von Bomben schweren und mittleren Kalibers. Bei dem darauffolgenden Luftkampf wurde ein feindliches Jagdflugzeug von unseren Bombern abgeschossen. Trotz schwersten feindlichen Flakfeuers gelang es bis auf eine Maschine allen Deutschen, wieder unversehrt die Heimathäfen zu erreichen.
Brüssel, 17. 10. 39. Wie aus London gemeldet wird, gab der Premierminister im Unterhaus bekannt, daß das Schlachtschiff „Iron Duke" bei einem Luftangriff auf Scapa Flow am Dienstag (17. 10.) „beschädigt" worden ist.
Der „Iron Duke" war das Flaggschiff Jellicoes in der Skagerrakschlacht. Es hat eine Wasserverdrängung von 21 000 t, trägt sechs 34,3-cm-Geschütze, zwölf 15,2-cm-Qeschütze und eine Reihe von Flaks. Es ist 1912 vom Stapel gelaufen und 1931 zum Artillerieschulschiff umgebaut worden. Die Admiralität hatte beabsichtigt, es im Kriegsfalle wieder seinem ursprünglichen Zweck als Schlachtschiff zuzuführen. Ob dies geschehen ist, ist noch unbekannt.
Berlin, 18. 10. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die deutsche Luftwaffe setzte gestern ihre Operationen gegen die Kriegshäfen an der englischen Ostküste fort. In der Bucht von Scapa Flow wurde nach den bisher vorliegenden Meldungen außer anderen Kriegsschiffen ein älteres englisches Schlachtschiff von Bomben schweren und mittleren Kalibers getroffen. Während eines Luftkampfes wurde ein englisches Jagdflugzeug von deutschen Flugzeugen abgeschossen. Ein deutsches Kampfflugzeug wurde durch englische Flakartillerie zum Absturz gebracht.
Am 16. und 17. Oktober hat der Gegner zehn Flugzeuge verloren, und zwar über deutschem Hoheitsgebiet durch Flakartillerie fünf Flugzeuge, davon ein englisches, durch Jagdflieger je ein französisches und ein englisches, und im Luftkampf über englischem Hoheitsgebiet drei englische Flugzeuge.
Berlin, 19.10.39. (DNB.) Oberk, d. Wehrmacht: Die Luftkriegführung an der Westfront ging bisher über Aufklärungstätigkeit sowie Jagd- und Flakabwehr auf beiden Seiten nicht hinaus. Bombenangriffe fanden nicht statt. Der wirkungsvollen deutschen Abwehr durch Jäger und Flak sind seit Kriegsbeginn an der Westfront 60 feindliche Flugzeuge, darunter 12 britische, erlegen. Die feindlichen Flugverluste im Innern Deutschlands und im Küstenvorfeld sind in diesen Zahlen nicht enthalten.
Die deutschen Gesamtverluste durch feindliche Einwirkung an der Westfront betragen seit Kriegsbeginn bis zum 17. 10.39. 196 Tote, 356 Verwundete, 114 Vermißte sowie insgesamt 11 Flugzeuge. Demgegenüber wurden bis 18.10.39 allein 25 französische Offiziere und 664 Unteroffiziere und Mannschaften als Gefangene eingebracht.
An der 170 km langen Oberrhein-Front wurde nur ein Mann durch einen gelegentlich eines Flakabschusses herabfallenden Granatsplitter verwundet. Britische Truppen konnten bisher in der vorderen Linie der Westfront nirgends festgestellt werden.
Höhensegelflug in Südafrika gelang im vorigen Monat dem Flugleiter des meist aus Deutschen bestehenden „Transvaal Pioneer Gliding Club" in Johannesburg, dem deutschen Kunstmaler Heini v. Michaelis. Nach Start vom Segelfluggelände Alberton bei Johannesburg stieg Michaelis mit seiner „Minimoa" sehr schnell auf 2800 m, wo er sich zu einem Streckenflug entschloß. Er verschwand bald in Richtung nach Heidelberg, einer kleinen Stadt im Südosten von Johannesburg. Die „Minimoa" stieg zeitweise mit 6 m/sec. In 3000 m Höhe war die Wolkenbasis erreicht und der Blindflug begann. Wegen mangelnder Blindflugerfahrung kam Michaelis aber bald wieder im Spiralsturz aus der Wolke unten heraus. Beim zweiten Versuch wurde dann aber eine Höhe von 11 860 Fuß (etwa 3600 m) erreicht. Die Höhe ü. M. war über 5000 m. Michaelis landete bei Ermelo in einem kleinen Feld nach einer Strecke von 195 km.

Segelflug
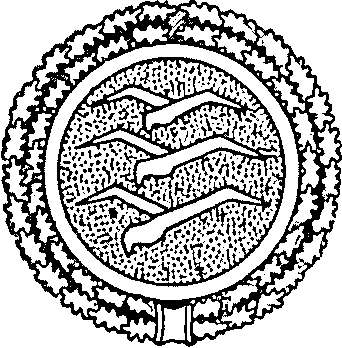
Nietung, Nietgerät, Nietverfahren, siehe „Flugsport" 1937, S. 83, 292, 524; 1938, S. 517.
Profile aus Blech werden demnächst in der DIN-Normensammlung Luftfahrt Nr. 6 veröffentlicht.
Meßdüsen und Staurohre sind zwei verschiedene Geräte. Beantwortung an dieser Stelle führt zu weit. Beschreibung folgt in einer der nächsten Nummern.
Anstrich-Gewichtszunahme kann selbst bei Metallflugzeugen bis zu 5% des Leergewichts betragen.
Berichtigung: Focke-Wulf-Auslandslieferungen, „Flugsport" Nr. 21 S. 514, muß es anstatt „20 Flugzeuge Fw 44 ,Stieglitz' nach Ungarn" richtig heißen „nach Bulgarien für die bulgarische Luftwaffe".
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Handbuch für Flugmotorenkunde, v. Dipl.-Ing. Franz Merkle. 3. Auflage. Verlag C. J. E. Volckmann Nachf. E. Wette, Berlin-Charlottenburg 2. Preis geb. RM 5.—, kart. RM 3.80.
In der vorliegenden 3. Auflage sind die Abbildungen auf 218 vermehrt. Die Flugmotorentypen und sonstiges sind jeweils durch die neuesten, entsprechend dem Stand der fortschreitenden Entwicklung, ergänzt.
Pedros y Pablos. Fliegen - Erleben - Kämpfen in Spanien, v. Max Graf Hoyos. Verlag F. Bruckmann, München. Preis RM 3.80.
Der Verfasser, Oberleutnant und Kompaniechef, ausgezeichnet mit dem Spanienkreuz in Gold mit Brillanten, gibt einen fesselnden Bericht, ausgestattet mit vielen bisher noch unbekannten Bildern, über seine Erlebnisse während des Spanienkrieges von den ersten Anfängen an. Ein lesenswertes Buch.
Flügel am Horizont. Vom Leben und Kämpfen der ersten Flieger. Von Adalbert Norden. Deutscher Verlag, Berlin SW 68. Preis geb. RM 5.80, brosch. RM 4.60.
Der Verfasser hat das Buch Melli Beese und ihren Kameraden zum Gedächtnis gewidmet. Man erlebt die Zeit von Johannisthal, die ersten Anfänge der deutschen Fliegerei. Die Pioniere in dieser Zeit hatten nur einen Gedanken: zu fliegen und Flugsport zu betreiben. Flugindustrie, Militärflugwesen waren Folgeerscheinungen, die von vielen nicht immer rechtzeitig erkannt worden waren. Die einsichtigsten von den ersten Pionieren und Konstrukteuren waren auch bald in das Lager der Industrie, der Wissenschaft und Militärs hinübergewechselt. Das Verdienst, in mühsamster Arbeit unter Einsatz des Lebens die Entwicklung vorwärts getrieben zu haben, gebührt den Pionieren. Viele siegten, viele erlitten Rückschläge und waren verbittert, teilweise verursacht durch die Verhältnisse in der damaligen Zeit, wo man sich den Sportgedanken anders vorstellte als heute. Die Geschichte kann man eben nicht ändern. Jedenfalls hat die Nachtwelt bis heute die Leistungen der deutschen Pioniere aus der Anfangszeit nicht vergessen. Die deutsche Fluggeschichte ist schon mehrfach geschrieben worden, und es schadet nichts, wenn sie oft geschrieben wird. Gerade im vorliegenden Buch findet man viele Vorgänge, die nur wenigen bekannt sind und auf diese Weise der Nachwelt überliefert werden. Im vorliegenden Buch gruppieren sich die Ereignisse in Johannisthal und in der ganzen Welt um die fliegerische Tätigkeit von Melli Beese, deren selbstherbeigeführtes tragisches Ende in den Jahren von 1923 nur wenigen bekannt geworden ist.
Schmiede der Luftmacht. Vom Werden eines Kampfflugzeuges. Von Gerhard Jaeckel. Verlag der H. Lauppschen Buchhandlung, Tübingen. Preis RM 6.80.
Das vorliegende Buch, welches im Einvernehmen mit dem RLM. erschienen ist, gibt zum erstenmal in gemeinverständlicher Weise einen Einblick in die
Entwicklung moderner Kampfflugzeuge. Mit Rücksicht auf die Interessen der Landesverteidigung war es in letzter Zeit nur wenigen vergönnt, einen Blick in die Werkstätten, Konstruktionsbüros und alles, was dazugehört, zu tun. Beim Lesen des Buches bekommt man einen Begriff von dem planmäßigen Arbeiten, angefangen von den Grundbedingungen, welche bei dem Bau eines Flugzeuges notwendig sind: Von den Vorschriften des Auftraggebers, Taktik, Strategie und Flugzeugentwurf, von den notwendigen Laboratoriumsversuchen und dann, wenn das Flugzeug fertig ist, Flugerprobung, Arbeitsweise der Einfliegerei, Stabilitätsflug, Höhenflüge, Musterprüfung, Start- und Landemessungen, Steigleistungen, amtliche Erprobung, und wenn diese Arbeiten durchgeführt sind, muß die Großserie vorbereitet werden. Hier spielt wirtschaftliche Fertigung, Arbeitsmethode, eine große Rolle. Daneben sind noch die anderen Fragen: Materialprüfung des Leichtmetalls, Blechverformung, Wärmebehandlung, Sicherheit durch Kontrolle und viele andere umfangreiche Einzelgebiete behandelt.
Kanonier 2 cm Flak 30 (Waffenausbildung in der Flakartillerie), bearb. von Hauptmann Helmut Derpa. Mit 80 Abb. u. Skizzen. Verlag E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW 68. Preis RM 2.—.
Das vorliegende Handbuch ist das Ergebnis eigener Erfahrungen bei der Ausbildung mit der 2 cm Flak 30 und ein praktischer Wegweiser zur schnellen und sicheren Beherrschung der Waffe. Verfasser hat es verstanden, das viele Wissenswerte in kurzgedrängter, leicht verständlicher Form zu vermitteln. Auch für Flieger und Männer anderer Waffengattungen wird es interessant sein, sich ein Bild von der Bedienung dieser so bewährten Waffe zu machen.
Wir haben als überzählig aus dem Serienbau preiswert zu ve rkaufen:
Elen neuen Rumpf für seieuiUDzeug
Hütler H-17
Sportflugzeugbau SCHEMPP-HIRTH Kirchheim-Teck
o%,en< und ia
Fallschirme
aller Art
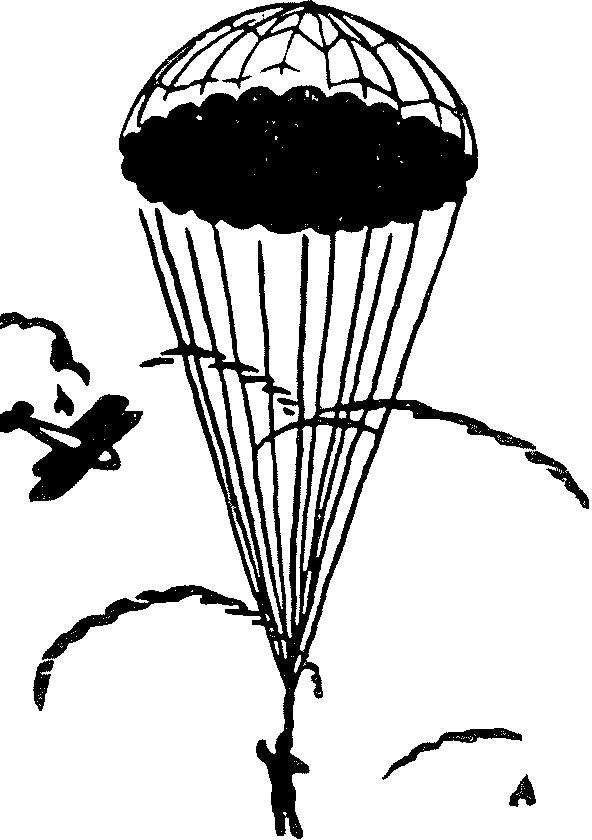
SCIIROEDER & CO.
Berlin~NeuköIIii
Bergstraße 93-95
älteste Flugzeug« Fallscfairm^Fabrik der Welt
Für unsere aerodynamische Abteilung suchen wir zum baldigen Eintritt:
tüchtige Aerodynamiker
sowie für Auswertung einige gewissenhafte Rechner.
Ausführliche Angebote mit Lichtbild, Zeugnisabschriften und Angabe der Gehaltsansprüche sowie des frühesten Eintrittstages unter Kennwort 17\e erbeten an:
ÄRÄDO - FLUGZEUGWERKE
G. m» b. H»
Werk Brandenburg (Havel), Gefolgschafts-Abtlg.
BirkeniFlugzeug Sperrholzplatten
deutsches Fabrikat
bei Rekordflügen erprobt, in den Qualitäten: AVIATIC, SPEZIAL, OLEITFLUQ in allen Stärken von n,4-8 mm liefert prompt ab Lager
Georg Herte Berlin*Charlotfenburg
Kaiser Friedrich-Straße 24 Fernspr.-Sammelnummer: 34 5841 Telgr.-Adr.: Fliegerhfilzer Berhi
Ingenieurschule
Mittweida
Maschinenbau / Automobil- w. Flugtcchmk I Elektrotechnik. Programm kostenlos I
Fl ugzeugsSpann lacke
Marke „Cellemilliefert seit 1911 Dr. Quittner & Co.
inh. Hans G. Mohr
Berlin * Lichtenberg Rittergutstraße 152, Fernr. 612562
Heft 23/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag ;,Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro % Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ..Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet.
Nr. 23 8. November 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 22. Nov. 1939
Deutsche Luftwaffe.
Weit draußen in der Nordsee um Britanniens Küsten fliegen die deutschen Aufklärer, wenn notwendig, bald ein paar Meter über der oft hochgehenden See und dann wieder in größeren Höhen, der Sicht des Gegners sich entziehend. Jedes einzelne Planquadrat wird genau beobachtet und, wenn sich irgendein vernichtungswürdiges Objekt zeigt, genügt ein kurzer Funkspruch, um die wartenden Kampfstaffeln zu benachrichtigen, die dann in kürzester Zeit ihre Aufgabe auch wieder in hervorragender Weise, wie schon mehrfach erlebt, erledigen.
Diese Erfolgsleistung ist nur möglich durch den Aufklärer, der seine äußerst schwierige Erkundungsarbeit, immer die Ruhe bewahrend, durchgeführt hat. Und alle die Leistungen der Aufklärer und der Kampfeinheiten wären nicht möglich, wenn wiederum Motoren-, Flugzeug-, Waffenwarte und viele andere nicht sorgfältigst die Flugzeuge für den Flug vorbereitet hätten. Und die Leistungen wären weiter unmöglich gewesen, wenn nicht die Maschinen aus bestem Material in gewissenhafter Werkstattarbeit von äußerst zuverlässigen Arbeitern bis ins kleinste fehlerlos ausgeführt worden wären. Und dann weiter muß letzten Endes Flugzeugführer und Bordmannschaft das Flugzeug bis in die kleinsten Einzelheiten in-und auswendig kennen und sich in dieses hineingefühlt haben.
Nur diese Vorbedingungen verbürgen und ergeben die Leistung zu den deutschen Erfolgen in der Luft über See und Land. Das alles spielt sich ab in einer wunderbar geleiteten Organisation, zu der noch vieles andere gehört, von dem hier zu sprechen wir später vielleicht einmal Gelegenheit haben werden.
Das selbstlose Zusammenwirken ist das, was wir in der deutschen Luftwaffe unter Fliegerkameradschaft verstehen — eine Fliegerkameradschaft in Gemeinschaftsarbeit, die man nicht von irgendwoher beziehen, auch nicht durch Geld und sonstige Mittel oder Serienfabrikation erzeugen kann — diese Fliegerkameradschaft verbürgt den Erfolg.
Diese Nummer enthält Patent-Sammlung Nr. 17, Bd. VIII.
Arado Ar 96 B.
Arado Ar 96 A (vgl. Typenbeschr. „Flugsport" 1937 S. 263 und 306) und Arado Ar 96 B zeigen wesentliche Unterschiede im Verwendungszweck, in den Motoren und in der Konstruktion. Ar 96 A wird mit dem 240-PS-Argus-Motor As 10 C ausgerüstet, dient als Fortbildungsschulflugzeug für den Flugzeugführer, ferner zur Uebung für den Beobachter und zur Ausbildung im Kunst-, Nacht-und Blindflug. Ar 96 B dagegen ist ein Mehrzwecke-Uebungsflug-zeug, das auch als leichtes Kampfflugzeug durch seine Bewaffnung und Ausrüstung, seine Eigenschaften und Leistungen einsatzfähig ist. Als Uebungsmaschine dient sie neben den bereits bei der Ar 96 A aufgeführten Verwendungszwecken der Ausbildung von Führer und Beobachter im MQ-Schießen und Bombenwerfen, ferner in der Photographie und Telegraphie. Ar 96 B ist mit dem 360/450-PS-Argus-Motor As 410 A ausgerüstet. Ihre Leistungen liegen wesentlich über denen der Ar 96 A.
Das Tiefdecker-Tragwerk aus einem, ohne lösbare Trennstelle hergestellten, freitragenden Trapezflügel mit 6° V-Form wird mittels vier Kugelgelenken unter dem Rumpf angeschlossen. Die Anschlußbeschläge gestatten einen Ausgleich bei Winkel- und Längenänderungen infolge Durchbiegung des Flügels und gewähren dessen einfache Austauschbarkeit.
Der statische Aufbau des allseitig mit Blech beplankten Flügels besteht aus zwei I-Holmen mit kräftigen Verbundrippen. Handlöcher in der Außenhaut ermöglichen Kontrollen und Reparaturarbeiten.
Am Flügel sind automatische Handley-Page-Schlitzflügel eingebaut, in der Flügelnase das innen hochklappbare Verschwindfahrwerk. Je ein kräftiger Aufbockbeschlag mit Oesen zum Festzurren der Maschine ist zwischen den Rippen 7 und 8 vorgesehen.
Rumpf, Qanz-Metall, besitzt durchweg ovalen Querschnitt, die Rumpfhaut wird aus längslaufenden Profil- und Qlattbahnen gebildet. In der linken Rumpfwand zwei Aufstiege und zwei Handgriffe; besondere Beschläge zum Aufbocken. Führer- und Beobachterraum sind mit Schiebehauben aus Plexiglas verkleidet, die durch eine Klemmvorrichtung in jeder Stellung festgestellt werden können. Dies ermöglicht ein unbehindertes Ein- und Aussteigen und gute Lüftungsmöglichkeit, für die außerdem noch eine regulierbare Belüftung vorgesehen ist. Vorderer Fußbodenabschnitt des Beobachterraumes kann entfernt und durch eine Plexiglasscheibe ersetzt werden, um beim Einbau von Reihenbildgerät oder Bombenzielvorrichtung eine gute Durchsicht zu gewähren.
Führer- und Beobachtersitz senkrecht verstellbar, Gewicht der Insassen durch Gummikabel ausgeglichen. Sitze sind für Mitnahme eines Sitzkissenfallschirmes eingerichtet und
mit verstellbaren Bauch- und Schultergurten versehen. Hinter dem zweiten Sitz Gepäckraum.
Arado Ar 96 B
Z-eichnung Flugsport
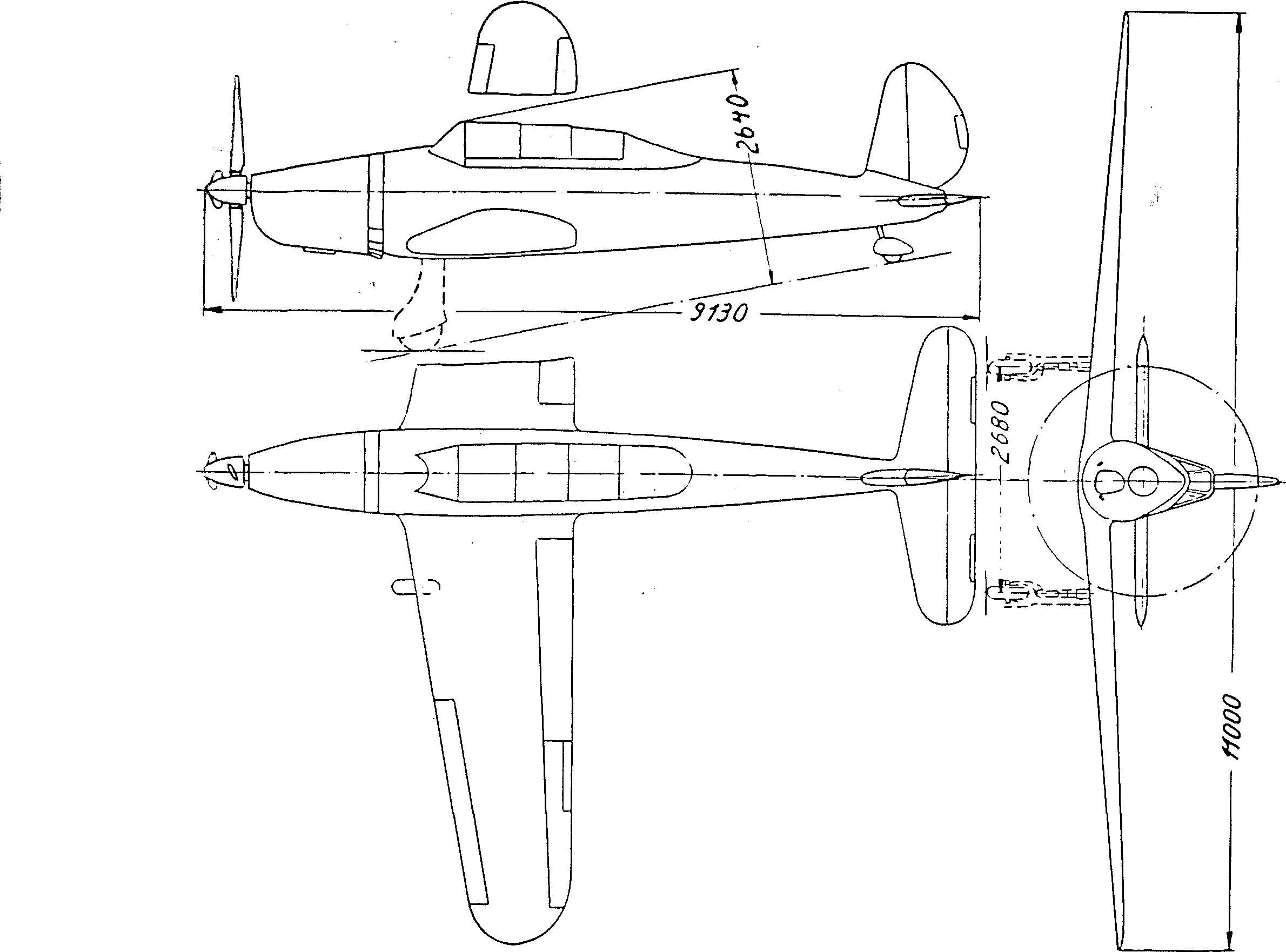
AradoAr96B. (Freigeg. d. RLM. Nr. 28. 4. 39 u. 10. 10, 39.)
Werkbilder
Knüppel-Doppelsteuerung:, Uebertragung der einzelnen Steuerbewegungen durch Hebel, Stoßstangen und Qewindedrähte; letztere sind für die Höhensteuerung doppelt verlegt. Der im hinteren Sitzraum befindliche Teil der Steuerung kann ausgebaut werden. Seitensteuerung des Vordersitzes ist in Fußdrehhebel-Bauart, die des Rücksitzes in getrennter Fußpendelhebel-Bauart ausgeführt. Beide lassen sich in ihrer Lage zum Führersitz während des Fluges ver-
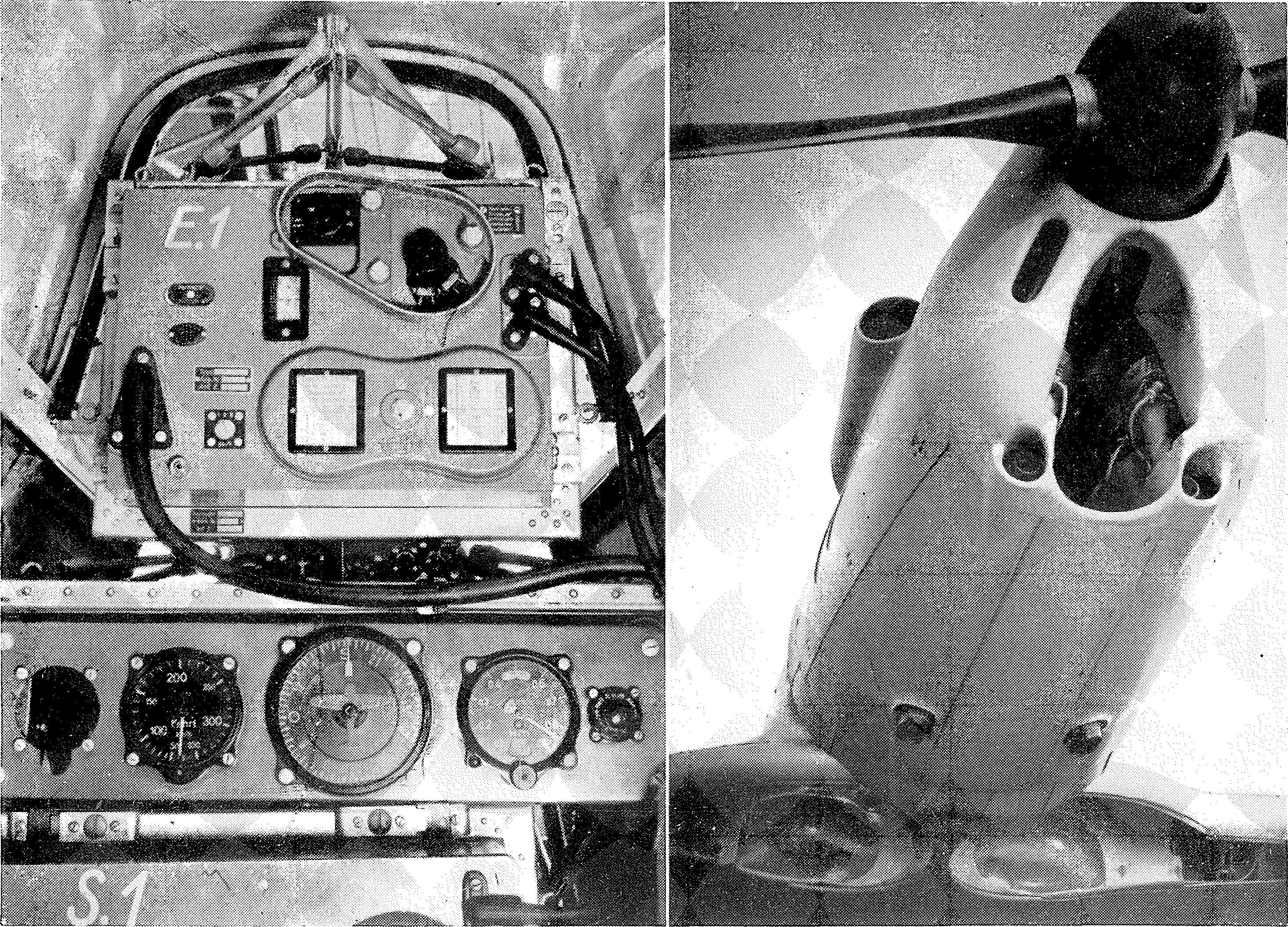
Arado Ar 96 B. Links Blick in den Beobachterraum, rechts Luftzuführung und Motorverkleidung, unten erkennt man den Raum für das Verschwindfahrwerk.
Werkbilder
steilen. Verstellung erfolgt im Vordersitz durch Ziehen eines ! Knopfes am Hilfsgerätebrett, im Rücksitz durch Umlegen eines I kleinen Hebels an den Pendelhebeln selbst. Am Seitensteuerfußhebel des Vordersitzes befinden sich die Bremspumpen für die Bremsanlage des Fahrwerkes, die mit den Fußspitzen betätigt werden. Alle Steuerbewegungen sind durch einstellbare Ausschläge begrenzt und leichtgängig. Das Flettnerruder am Höhenruder wird durch einen im Vordersitz links angebrachten Schiebeknopf betätigt, dessen Bewegungen sich durch Stoßstange, Hebel und Stahldrähte übertragen.
Ein im Vordersitz angebrachter Schalthebel betätigt die Landeklappen auf hydraulischem Wege. An ihm ist die Startstellung besonders gekennzeichnet, ebenso zeigt eine mechanische Vorrichtung den jeweiligen Stand der Landeklappen an. Bei ausgefahrener Landeklappe und Vollgasgeben geht die Landeklappe infolge Kuppelung zwischen Landejdappenbedien- und Gashebel automatisch auf günstigste Startstellung zurück. Eine Kuppelung der Querruder mit den Landeklappen bewirkt, daß bei einem Landeklappenausschlag von 45° die Querruder-Null-Lage auf + 13° gebracht wird, wobei noch der volle Ruderausschlag gegeben werden kann.
Die im Außenflügel eingebauten Spaltflügel sind im eingefahrenen Zustand verriegelbar und können durch Umlegen eines Kipphebels am Hilfsgerätebrett entriegelt werden.
Die Hebel für Gas- und Gemischregelung sind an der linken Rumpfwand angebracht. Bei der Rücknahme des Gashebels wird der Gemischhebel mit zurückgenommen. Der Motor kann sowohl mit Handandreh Vorrichtung-als auch mit Druckluft angelassen werden. Für letzteres ist eine Schnellkuppelung im Rumpf hinter dem Brandschott vorgesehen, die von außen durch den Radkasten zugänglich ist. Kleiner Kraftstoffbehälter aus Aluminiumblech, Fassungsvermögen 205 1, ist unter dem Fußboden des ersten Sitzes eingebaut und mit Gummizwischenlagen auf Rippen gelagert. Befestigung durch Spannbänder in den Holmen des Tragflügelmittelstückes. Bei Grundüberholungen ist der Ausbau nach Lösen der 4 Aufbängebolzen möglich. Auffüllen erfolgt durch einen Außenbordanschluß auf der linken Rumpfseite. Auf der Behälterunterseite befindet sich zum Entleeren ein Ablaßventil. Schmierstoffbehälter aus Stahlblech, 18 1, liegt auf der vorderen Seite des Brandschotts, auf der linken Seite mit einer Einfüllverschraubung, auf der unteren Seite mit einem Ablaßventil versehen. Auspuffstutzen sind rechts und links jeweils in einen gemeinsamen seitlich angebrachten, nach außen gezogenen Auspuffsammler geführt, um die beiden Sitze vom Strom der Auspuffgase freizuhalten.
Höhenflosse, Ganz-Metall, ist in drei Punkten gelagert, Anstellung am Boden verstellbar. Das gewichtlich und aerodynamisch ausgeglichene Höhenruder besteht aus einem Leichtmetallgerüst mit Stoffbehäutung. Seine steuerbare Hinterkante ermöglicht ein Austrimmen des Flugzeuges im Fluge.
Seitenflosse, Ganz-Metall, ist in drei Punkten am Rumpf befestigt. Der Spalt zwischen ihr und dem Rumpf ist durch eine stromlinienförmige Blechverkleidung abgedeckt.
Seitenruder mit am Boden verstellbarer Ruderkante aus Leichtmetallgerüst mit Stoffbespannung ist gewichtlich und aerodynamisch ausgeglichen.
Querruder aus Leichtmetall mit Stoffbespannung gewichtlich und aerodynamisch ausgeglichen. Landeklappen Leichtmetallgerippe mit Stoff bespannt.
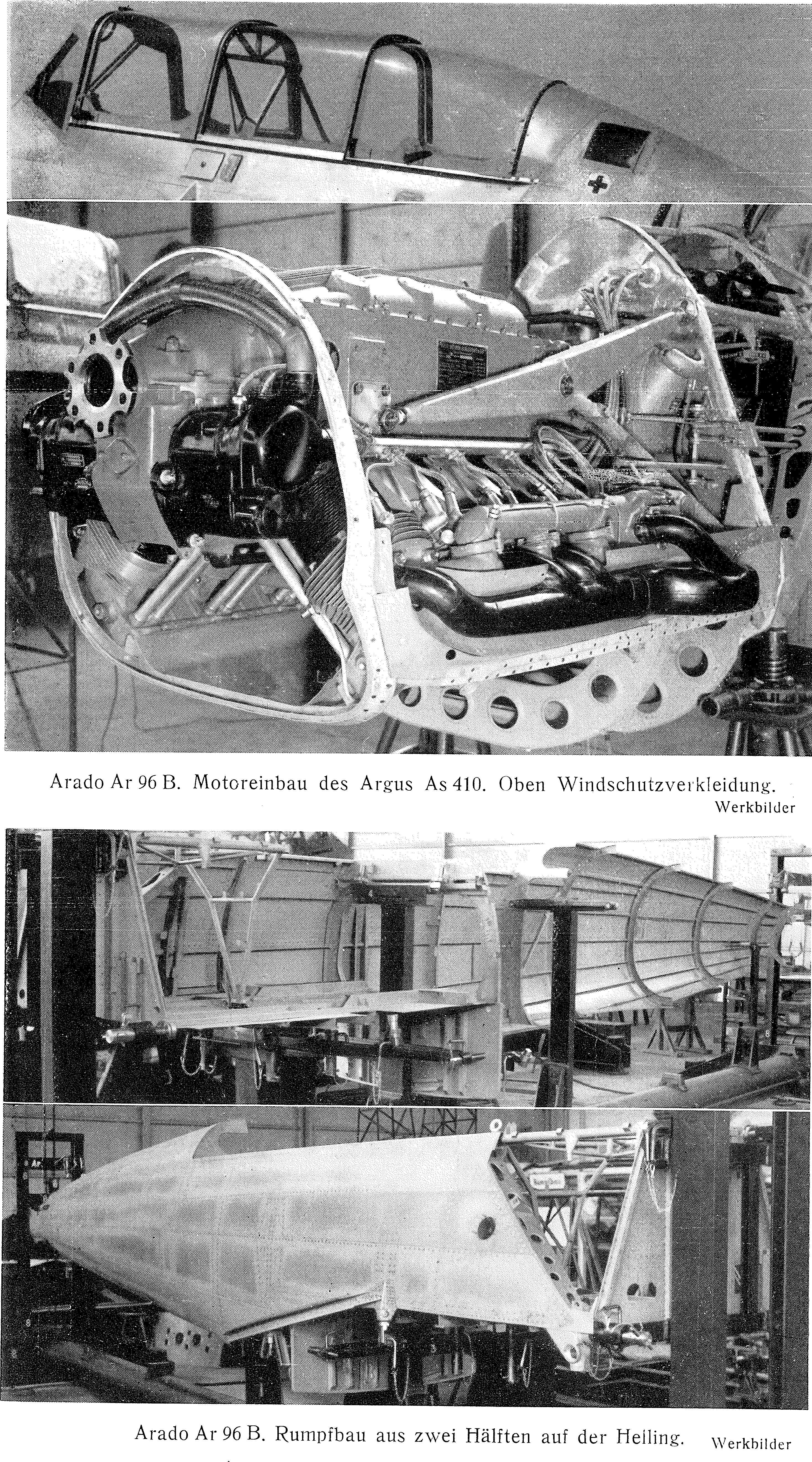
Verschwindfahrwerk wird durch eine hydraulische Hubvorrichtung über den Motor, bei Aussetzen des Motors mittels einer Handpumpe aus- und eingefahren, wobei die Fahrgestellbeine seitlich nach innen hochgeschwenkt werden. Endstellungen des Fahrgestelles werden durch eine elektrische Signalanlage und eine mechanische Anzeigevorrichtung angezeigt. Ein Warnsignal (Hupe) ertönt, wenn bei nicht ausgefahrenem Fahrgestell der Gashebel zurückgenommen wird, solange, bis durch Drücken eines Knopfes am Knüppelgriff Abstellung erfolgt. Bei Freilassen des Knopfes ertönt die Hube sofort wieder, und zwar solange, bis das Fahrgestell ausgefahren ist. Die Federung der Fahrgestellbeine besteht aus einer Druckgummisäule mit einem Oeldämpfungszylinder. Die Bremsräder (Bauart Argus) mit Hochleistungsreifen 580X165 werden hydraulisch von den Fußhebeln der vorderen Seitensteuerung aus betätigt.
Spannweite 11 m, Länge 9,13 m, Höhe 2,64 m, Flügelfläche 17,10 m2. Motor Argus As 410 A, Startleistung 450 PS, Leistung in Volldruckhöhe (3000 U/min) 360 PS, Volldruckhöhe 3000 m, Kraftstoffverbrauch (n = 0,85 nmax) 200 g/PS/h. Zweiflügelige Verstell-Luftschraube (Automat), Durchm. max. 2,7 m.
Leergewicht 1220 kg, Gesamtlast 530 kg, Fluggewicht 1750 kg, Kraftstoff 183 kg, Schmierstoff 21 kg, Flächenbel. 102 kg/m2, Lei-stungsbel. 4,86 kg/PS.
Höchstgeschw. am Boden 310 km/h, in 3000 m Höhe 340 km/h, Reisegeschw. (n = 0,85 nmax) am Boden 255 km/h, in 3000 m 275 km/h, Landegschw. 103 km/h, Flugdauer 4 h, Reichweite 1100 km. Steigzeit auf 1000 m 2,5 min, auf 2000 m 5 min, auf 3000 m 7,5 min, auf 4000 m 10,3 min. Dienstgipfelhöhe 7200 m.
Vickers-Armstrong Wellington.
Der Wellington-Bomber, entwickelt aus dem Wellesley, siehe „Flugsport" 1938 S. 647, ist von Vickers-Armstrong in der unseren Lesern bekannten geodetischen Bauweise, vergleiche Vickers-Patente in der Patentsamml. 1937, Band 7 Nr. 5 Seite 17 und Nr. 12 Seite 53, gebaut.
Diese geodetische Bauweise kommt am Flügel, Rumpf und Leitwerk zur Anwendung. Der Gedanke der geodetischen Bauweise ist von deutschen Ingenieuren, zuerst von Prof. Schütte für Lenkballone, und dann später 1916 von deutschen Flugzeugkonstrukteuren aufgegriffen'und wieder fallengelassen worden, da die Aus-
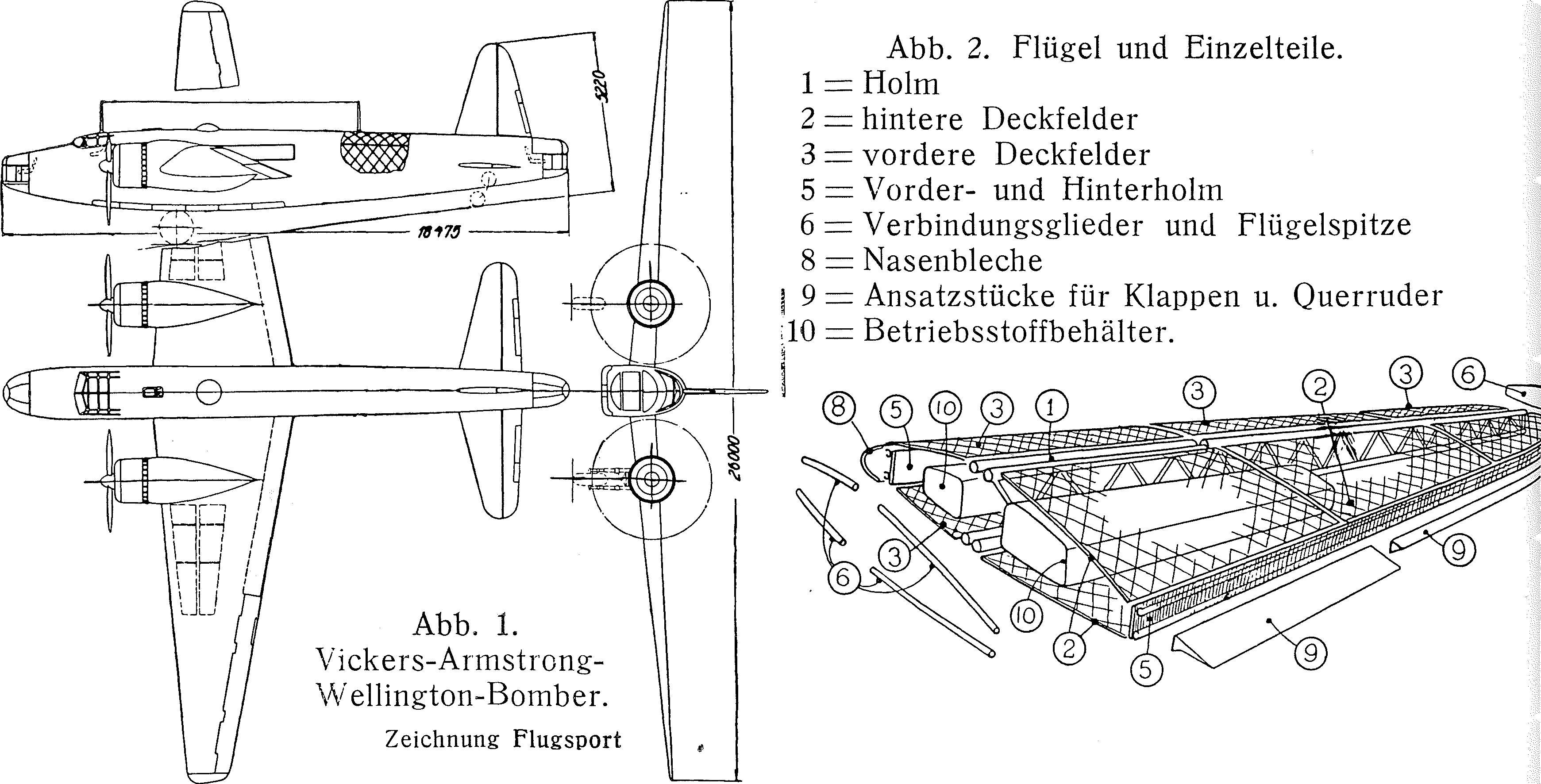
Nr. 23/1939 Seite 549
Abb. 3. Vickers-Armstrong Wellington-Bomber.
_ Werkbilder
nutzung der sich kreuzenden Rippenverstärkung an vielen Stellen unnütze und an anderen Stellen wieder nicht genügende Verstärkungen hervorbringt, von der Kompliziertheit dieser Herstellung gar nicht zu reden. Durch geschickte Anordnung der Bauteile von Flügel und Rumpf und anderem läßt sich eine viel bessere Ausnützung des Materials durchführen, als bei der schablonenmäßig durchgeführten geodetischen Bauweise. Jedenfalls ist die Leistung des von den Engländern so gerühmten Wellington-Bombers durch deutsche Konstruktionen ohne geodetische Bauweise bedeutend überboten.
Flügel dreiteilig, Mittelstück und Ansatzflügel mit Spreizklappen und Querruder. Flügelaufbau, ein durch den Rumpf gehender Qitterholm, vorn ein Nasenholm für die abnehmbare Nase, und ein Hinterholm für Klappen und Querruder. Die obere Bedeckung der geodetischen Bauweise zwischen Vorder- und Hinterholm ist abnehmbar und mit Leinwand bedeckt. Vergleiche die Abbildung 2. Die Betriebsstoffbehälter befinden sich in den Ansatzflügeln, zu beiden Seiten des Hauptholmes gruppiert.
Rumpf Abb. 4, 7 u. 8 in geodetischer Bauweise, die durch 6 Formringe ausgesteift wird. Das geodetische Gitterwerk wird in acht Einzelfeldern auf die Formringe aufgebracht. Dadurch ergeben sich wiederum eine verhältnismäßig große Zahl von Befestigungsstellen.
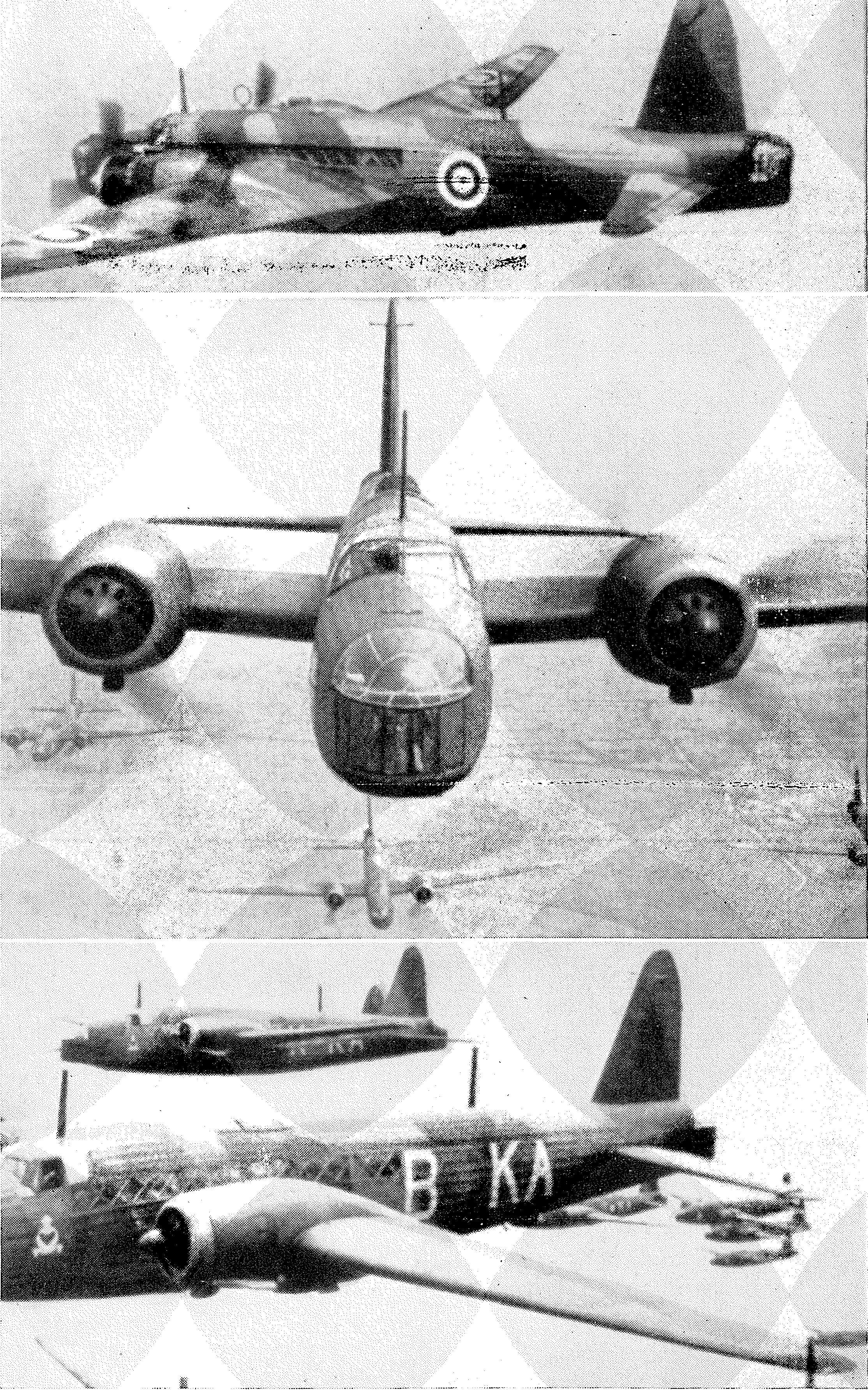
Abb. 4. Wellington-Rumpf mit eingebautem Mittelstück.
Werkbild
WM
■i
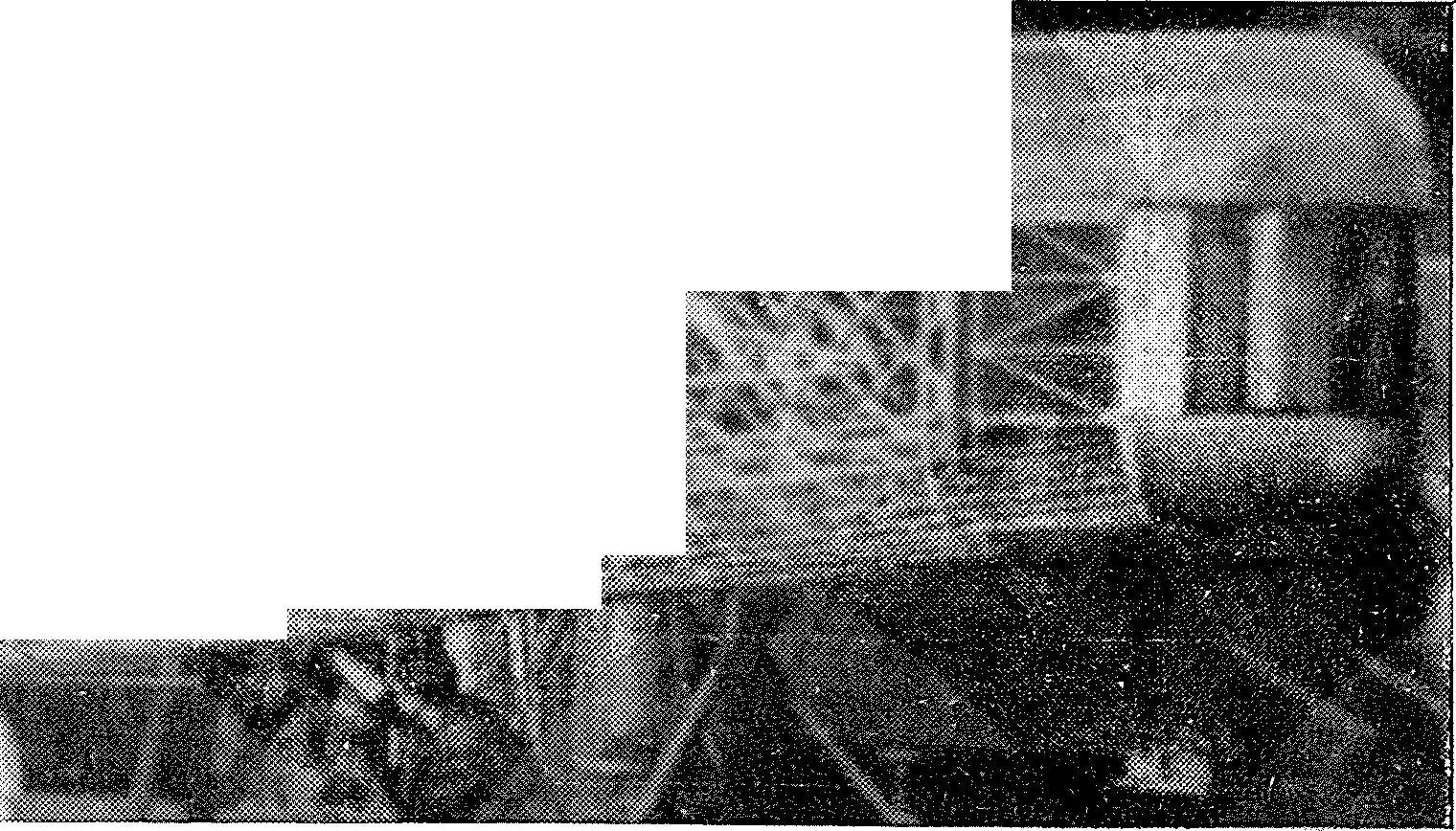
Abb. 5. Flügelbefestigung am Rumpf, a durch den Rumpf gehender Holm, ist bei b an der Hauptrippe c, die bei d beweglich gelagert ist, befestigt. Die Lagerung d, welche an den Rumpfhauptprofil-schotten befestigt ist, zeigt die nebenstehende
Detailzeichnung. Abb. 6. Betriebsstoffbehälter-Reihe. Y und Z =r Befestigungsstellen an den Behälterträgern. Der Träger ist mit weiteren Details rechts nochmals herausgezeichnet. An der linken Seite des Behälters oben in der Zeichnung sieht man ein Lagerstück X, welches in der Versteifung der Motorverkleidung eingreift und gleichzeitig den Behälter in seiner Lage festhält.
Zur unteren Abb. 7. a vorderer Schützenplatz, b warme Luftzufuhr, c Navigationslicht, d Peilantenne, e Oeltank, f Falltank, g vordere Betriebsstoffbehälter, h Behälter-Befestigungsbänder, i abnehmbare Flügelteile, k Querruder, 1 Trimmklappe, m hintere Betriebsstoffbehälter, n Landeklappen, o Höhen- und Seitenruderbetätigungsstangen, p Ruderausgleich, q Heckschützensitz, r Warmluft, s Falltür, t Waschtisch, u Klappenbetätigungsrohr, v Befestigung
für Flügelbedeckung. Zeichnungen: The Aeroolane
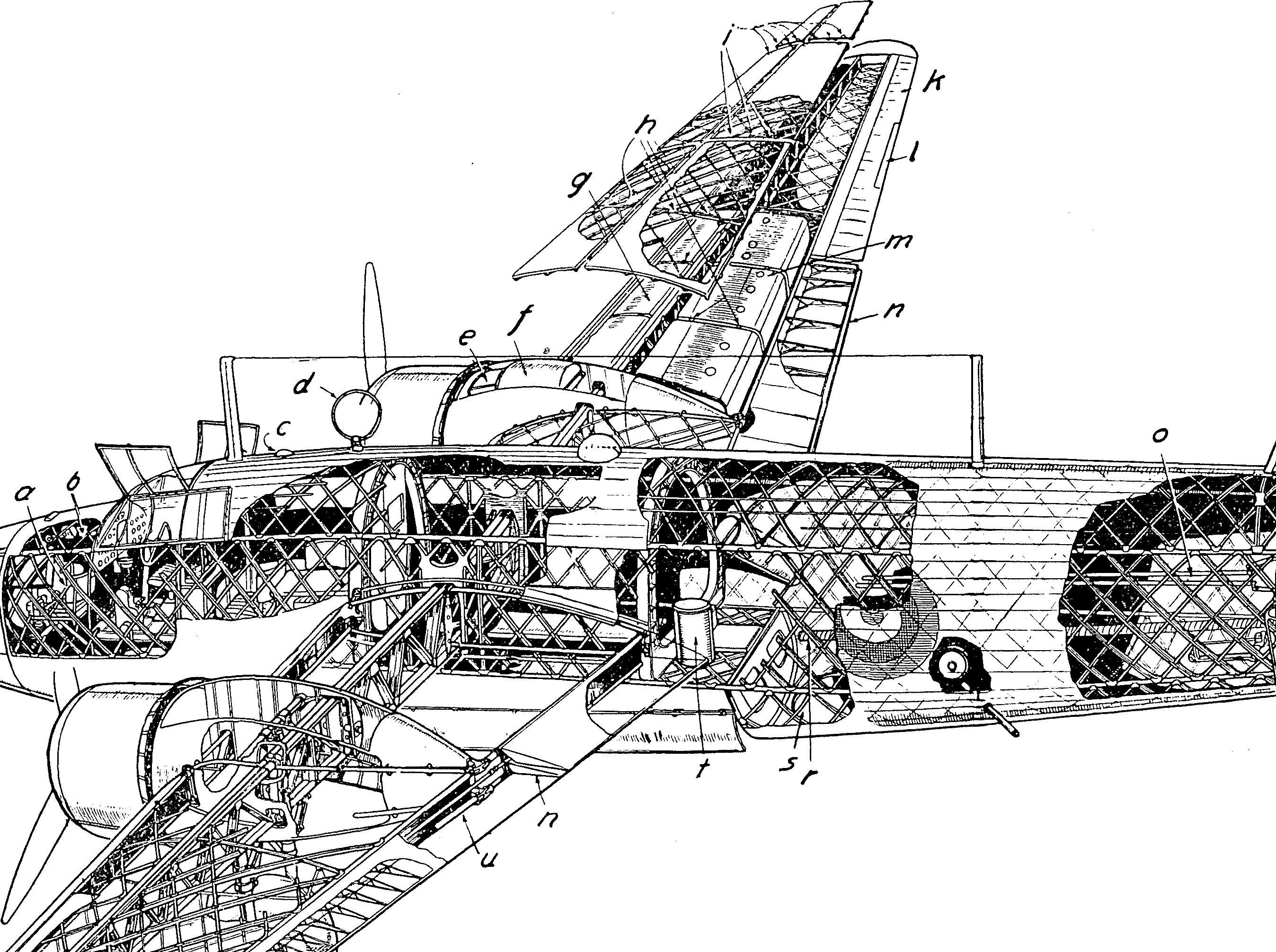
Abb. 7. Vickers-Armstrong Wellington-Bomber.
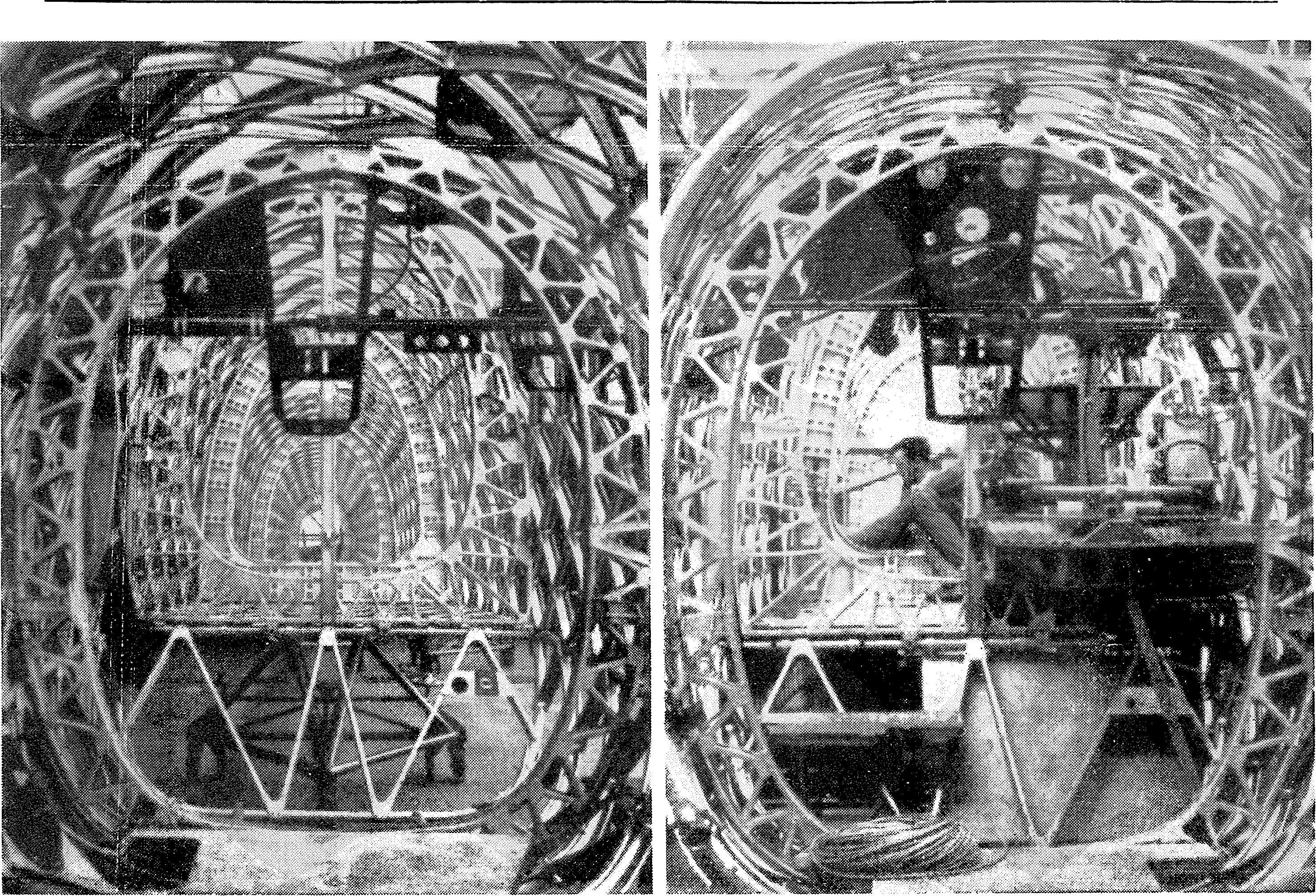
Abb. 8. Vickers-Armstrong Wellington-Bomber. Bild: Flieht
Nach Zusammenbau des Rumpfes auf der Schablone wird die Ausrüstung eingebaut. Die Abbildungen zeigen einen Blick in das Rumpfinnere in verschiedenen
Bauzuständen.
Höhen- und Seitenleitwerk sowie Klappen und Querruder sind aus der Abbildung 7 ersichtlich.
Fahrwerk nach hinten hochziehbar mit üblichen Kontrolleinrichtungen. Im heruntergelassenen Zustand zeigt rote Lampe erst wenn Verriegelungsverschluß eingeschnappt ist. Schwanzrad hydraulisch hochziehbar.
Besatzung 5 Mann. Vorn in der Nase vorderer Schütze, darunter Bombenzielstand. Dahinter auf der linken Seite Führersitz. Etwas höher hinter dem Flugzeugführer Sitze für Funker und Navigator. Darüber Sichtkuppel im Kabinendach. Im Rumpfende noch hinter dem Leitwerk Heckschützenstand.
Zwei Motoren Bristol Pegasus XVIII, Startleistung 1930 PS, Nennleistung 1770 PS in 4600 m. Normalleistung 1090 PS. Betriebs-stoffbehälter in der Motorenverkleidung 250 1, Oelbehälter 72 1. Sechs Betriebsstoffbehälter auf jeder Seite der Ansatzflügel 3400 1. Für besondere Langstreckenflüge können noch Zusatzbehälter von 1100 1 unter der Bombenzieleinrichtung mitgenommen werden.
Spannweite 26 m, Länge 18,75 m, Höhe 5,22 m. Fluggewicht 11 100 kg. Max. Geschwindigkeit 425 km/h in 5000 m Höhe, Reisegeschwindigkeit 345 km/h in 4500 m. Reichweite 5000 km bei 290 im/h Reise. Steigfähigkeit auf 4500 m in 18 min. Dienst-Gipfelhöhe 7800 m.
Curtiss-Vierblatt-Verstell-Luftschraube.
Bei der ständig wachsenden Motorleistung und notwendig sich steigernden Höhenleistung ergab sich die Notwendigkeit, die wirksame Blattfläche der Luftschraube zu erhöhen. Bei der Dreiblatt-Schraube ergaben sich bei den großen Motorleistungen unangenehm große Schraubendurchmesser, welche andererseits wieder ein größeres Fahrgestell bedingten. Diese Ueberlegungen führten zu der Vierblatt-Schraube. Ursprünglich war die Vierblatt-Schraube nurfür Jagdflugzeuge gedacht. Indessen können jetzt auch vorhandene
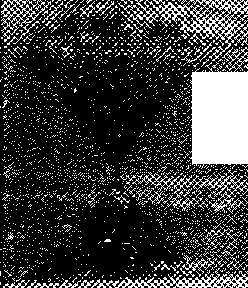
Curtiss P-36A Jagdflugzeug mit Vierblatt-Curtiss-Electric-Verstellpropeller.
Archiv Flugsport
mehrmotorige Typenmuster mit stärkeren Motoren ausgerüstet werden.
Verstellung und Aufbau wie bei der Curtiss-Dreiblatt-Schraube. Siehe „Flugsport" 1936 S. 675 und 1937 S. 280. Herstellerwerk Curtiss Propeller Division der Curtiss-Wright Corp. Clifton.
KONSTRUKTION INZEbHBTEH
Schnappverschluß für Handlochdeckel und ähnliche Klappen, wobei anstatt eines verschiebbaren Riegels ein um eine Achse
Schnappverschluß für Handlochdeckel.
Werkbilder u. -Zeichnungen
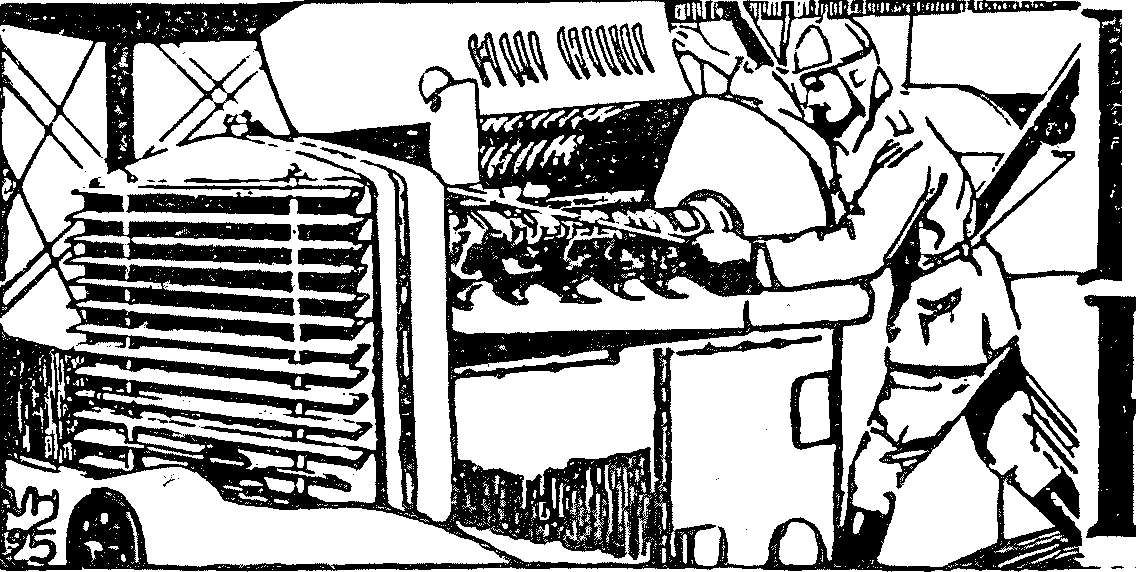
schwenkbarer Schließhebel verwendet wird, ist von Siebel Flugzeugwerke Halle K.-G. entwickelt worden. Vor dem Einbau wird aus dem Deckel ein zungenförmiger Ausschnitt für die Ausklinkung des Schließhebels vorgesehen. Die Grundplatte des Verschlusses dient gleichzeitig als Bohrschablone, wenn der Verschluß angenietet wird. Befestigung kann auch durch Punktschweißung erfolgen. Vorteile: Kleine Abmessungen, geringes Gewicht (Kleinstausführung 15 g), einfachste Bedienung, Anzugsmöglichkeit durch den Schließhebel.
Bei etwaigem Durchbiegen des Dek-kels durch festes Anziehen ist ein Abrutschen des Schließhebels nicht möglich, da dieser hakenförmig über einen Bördel greift. Offenstellung deutlich sichtbar. Scheinbares Schließen unmöglich.
Nebenstehende Abbildung zeigt die Ausführung in mehreren Ansichten. Oeft-nung geschieht durch Druck bei a, wodurch die Nase b des Schließhebels c freigegeben wird und durch eine Spiralfeder nach außen springt.
Verschluß und Handlochdeckel werden in Lizenz von den Beschlagfabriken Benninghoven, Velbert (Rhld.), und Carl Sievers, Heiligenhaus (Bez. Düsseldorf), hergestellt.
Luftdichte Türen sind in Höhenflugzeugen und zur Schalldämpfung bei Verkehrsflugzeugen Notwendigkeit. Bedingung ist hierbei geringstes Gewicht sowie schnelle Verschluß- und Oeffnungs-möglichkeit durch einen Handgriff. Als Dichtungsmittel verwendet man am besten dickwandigen Qummischlauch, welcher in einer Nute in der Tür befestigt wird. Bei Befestigung im Türrahmen wird die Dichtung zu leicht beschädigt. Verriegelung der Tür muß gegenüber den Scharnieren gleichmäßig an möglichst vielen Punkten stattfinden. Nebenstehende Abbildung zeigt eine französische Ausführungsform.
Franz. dreipunkt-verriegelte Tür.
Archiv Flugsport

R.UG
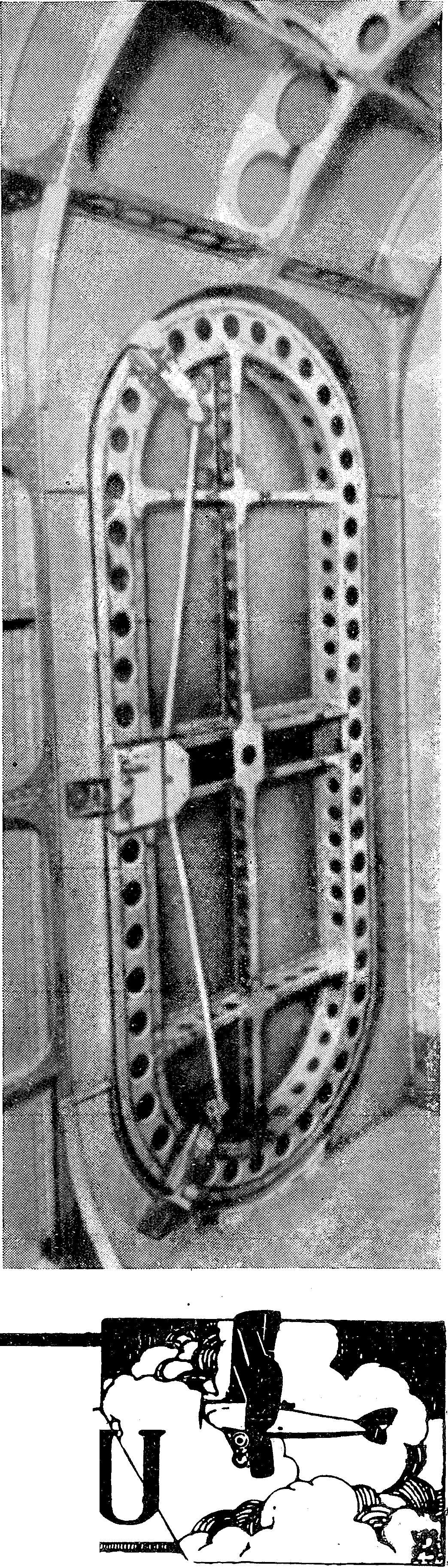
umscHA
Inland.
D. Lufthansa-Winterflugplan ab 1. Nov. zeigt wesentliche Verbesserungen und die Aufnahme weiterer Flugverbindungen,
Von Berlin führen werktäglich zwei Verbindungen nach Wien und zwei Strecken nach Kopenhagen. Ebenso hat Wien zwei Strecken nach Budapest. Hier verzweigen sich dann die Linien nach Rumänien, Jugoslawien, Griechenland und der Türkei. Durch die neue Regelung stehen Früh- und Mittagsverbindungen von Berlin nach Wien und Kopenhagen zur Verfügung. Die gleichen Vorteile bieten sich selbstverständlich auch den von Wien oder Kopenhagen nach Berlin fliegenden Reisenden.
Der neue Flugplan ermöglicht es, wieder in einem Tage von Deutschland aus Dänemark, Schweden, Norwegen, Italien, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland und die Türkei zu erreichen. Im Norden wird Kopenhagen, Malmö, Stockholm, Gotenburg und Oslo angeflogen. Im Süden über München Venedig und Rom. Im Südosten sind es die Städte Budapest, Arad, Bukarest, Belgrad, Sofia, Saloniki, Athen und Istanbul, die von Flugzeugen der Lufthansa oder den Maschinen der mit ihr in Gemeinschaft fliegenden Gesellschaften im Tagesflug von Berlin oder Wien aus erreicht werden können.
In zwei Tagen kann der Luftreisende über München — und ab Rom unter Benutzung des italienischen Luftverkehrsnetzes — nach Spanien und Portugal gelangen. Außerdem auch nach Afrika. Ueber das nordeuropäische Luftverkehrsnetz gelangt man weiter nach Lettland, Sowjetrußland und Finnland.
Für die von Berlin abfliegenden und nach Berlin reisenden Fluggäste ist nach wie vor wichtig zu wissen, daß Berlin-Rangsdorf heute der Verkehrsflughafen ist. Die verschiedenen Omnibusverbindungen der Reichspost von und zum Luftreisebüro der Lufthansa in Berlin, Friedrichstraße 177, vermitteln den Zubringerdienst für alle in Berlin-Rangsdorf abfliegenden und ankommenden Fluggäste. Die Abfahrtszeiten von Berlin — Friedrichstraße — sind folgende: München—Venedig—Rom 6.30 h, Wien—Budapest—Bukarest 6.45 h, Danzig— Königsberg 7.05 h, Kopenhagen—Stockholm und Gotenburg—Oslo 7.30 h, Wien— Budapest—Belgrad—Sofia—Saloniki—Athen und Istanbul 11.45 h, Kopenhagen— Malmö 11.55 h.
Auf allen Strecken wird selbstverständlich auch Luftpost und Luftfracht befördert.
Zum Einsatz gelangen wie üblich in der Hauptsache die viermotorigen Junkers Ju 90 und die bewährten Ju 52-Flugzeuge. In den Großflugzeugen werden die Reisenden, wie sie es gewöhnt sind, von Flugbegleiterinnen betreut und versorgt. Auch im Flughafen Rangsdorf, der einen behaglichen Aufenthaltsraum bekommt, sorgen Stewardessen für das Wohl der Fluggäste.
Beförderungen in der Luftwaffe durch den Führer und Obersten Befehlshaber der Wehrmacht mit Wirkung vom 1. 11. 39: Zum Generalleutnant den Generalmajor Ruggera; zum Oberst den char. Oberst Homburg, die Oberstleutnante Dembowski, von Tippeiskirch; zum Oberst (W) den Oberstleutnant (W) Mattner.
Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz wurde vom Führer und Obersten Befehlshaber der Wehrmacht am 30. September nach Beendigung des polnischen Feldzuges unter anderen Offizieren auch Generalmajor Jeschonnek, Chef des Generalstabes der Luftwaffe, verliehen.
General Oshima, Japan. Botschafter, in deutschen Fliegerkreisen durch seine Besuche auf der Wasserkuppe bekanntgeworden, ist von der japanischen Regierung abberufen worden. Nachfolger ist der bisherige japanische Botschafter in Brüssel, Saburo Kurusu.
Richard Thiedemann, Betriebsführer der Junkers-Flugzeugwerke, 29. Oktober 20 Jahre bei Junkers und 50. Geburtstag.
Deutscher Normausschuß Normblätter sind erschienen: Luftfahrt, Niete DIN L 174 Pilzniete; DIN L 175 Flachsenkniete; DIN L 401 Bordellöcher für Bleche; DIN L 591 Flansche aus Blech, leicht; DIN L 592 Flansche aus Blech, schwer. Webstoffe. DIN L 552 Schrägstreifen; DIN L 553 Zackenstreifen; DIN L 554 Wickelbänder. — Flugmotoren. DIN 9001 Bezeichnungen bei Flugmotoren: Seiten, Drehrichtung, Zylinder; Bezeichnungen bei Luftschrauben: Gangrichtung.
Ausland.
Britische Flugzeugindustrie soll, wie „Intransigeant" berichtet, um sie vor deutschen Luftstreitkräften zu schützen, nach Kanada verlegt werden.
Brit. Patentamt wurde ermächtigt, britischen Antragstellern die Verwertung von Patenten, Gebrauchsmustern und Lizenzen von Ausländern, mit deren Staat sich England im Kriegszustand befindet, zur Auswertung zu übertragen. Im Gegensatz hierzu wird in einer französischen Verordnung vom 15. 10. 39 verfügt, wonach Franzosen im feindlichen oder vom Feind besetzten Ausland sämtliche Formalitäten und Pflichten zur Bewahrung oder Erlangung von Rechten an Patenten oder Warenzeichen zu erfüllen haben. Demnach werden in Frankreich im Gegensatz zu England ohne Rücksicht auf den Kriegszustand die deutschen Schutzrechte geachtet.
„Air-France"-Luftverkehrslinien sollen aufrecht erhalten werden. Es sind dies: Paris—London, Paris—Algier—Dakar—Buenos Aires, Paris—Beirut—Kalkutta—Hanoi (Franz. Hinterindien, Tonking). Ferner: Algier—Qao—Niamey— Brazzaville (Belg. Kongo), Dakar (Senegal bei Kap Verde)—Kotonou—Pointe Noire (Franz. Aequatorialafrika) und Dakar—Bammaka (Franz. Sudan).
Ital. Unterstaatssekretär und Generalstabschef der Luftfahrt jetzt General Pricolo an Stelle des bisherigen Unterstaatssekretärs General Valle. Pricolo wurde 1891 in Grumento bei Potenza geboren.
Ital. Luftlinie nach den Vereinigten Staaten führt über das Mittelmeer nach der iberischen Halbinsel, in Lissabon Anschluß an die Wasserflugzeuge der Pan American Airways. Abflug montags und freitags früh vom römischen Flughafen, Ankunft am darauffolgenden Donnerstag oder Montag in New York.
Rom—Berlin - Luftverkehr seit 25. 9. von der „Ala Littoria" wieder aufgenommen. Start in Rom 8.40 h, Ankunft in Berlin 15.50 h.
Ital. Flugzeugausfuhr erstes Vierteljahr 1939: 31 Land- und Wasserflugzeuge, ges. Wert 26 474 000 Lire, gegenüber 77 Flugzeuge 1. Viertelj. 1938, ges. Wert 48 373 000 Lire. Flugzeugeinzelteile ges. Wert 42 845 000 Lire 1. Viertelj. 1939 gegenüber Flugzeugeinzelteile ges. Wert 17 167 000 Lire 1938.
Ital. Redaelli-Tiefdecker, 35 PS, Holzkonstruktion. Flugfeld Arcore Versuchsflüge ausgeführt.
Rom—Addis Abeba - Flug, Silberplakette, vorn „II Popolo d'Italia" ausgeschriebener Preis, 3. 8. zuerkannt dem Flugzeug „Fiat B. R. L." für einen am 7. 3. ausgeführten Flug Rom—Addis Abeba in 11 h 25 min mit 400 km/h.
R. U. N. A. - Sternflug, Teilnehmer faschistische Miliz, am 26. u. 27. 8. 210 Flugzeuge und 500 Teilnehmer.
Norwegen bestellte in USA. 12 weitere Curtiss-Hawk-Jagdflugzeuge. Die bereits früher bestellten 12 Curtiss-Hawk sind bis heute noch nicht eingetroffen.
USA. Nationale Luftrennen vom 2.—5. 9, Bendix Trophy-Rennen Sieger Frank W. Füller auf Seversky mit Twin Wasp. Flug von Küste zu Küste von Burbank nach Bendix in 8 h 58 min 8 sec. Preis 12 500 $. Greve Trophy-Rennen Sieger Art. Chester auf ehester Special mit Menasco-Motor. Geschwindigkeit 420 km/h. Thompson Trophy-Rennen Sieger Roscoe Turner auf Turner-Laird-Rennflugzeug mit Twin Wasp,
Geschwindigkeit 456 km/h, Preis _ ~*
16 000 $, und die Thompson Trophäe, da er zum 3. Mal dieses Rennen gewann.
Curtiss P 42 Jagdeinsitzer mit 24 Zyl. Flüssigkeit gekühltem Ellisonmotor wurde auf dem Wrightfield versucht. Geschwindigkeit angeblich 640 km/h. Flüssigkeitskühler, direkt unter dem Motor. Oelkühler auf der Rumpfunterseite unter dem Führersitz.
Kanada will, wie Ministerpräsident Mackenzie King mitteilte, sich an der Ausbildung von Piloten für die britische Luftwaffe in Kanada beteiligen.
Austral. Regierung will an Stelle der ursprünglich zugesagten 3 austral. Luftgeschwader nur Personal für ein Aufklärungsgeschwader für den europäischen Kriegsschauplatz entsenden.
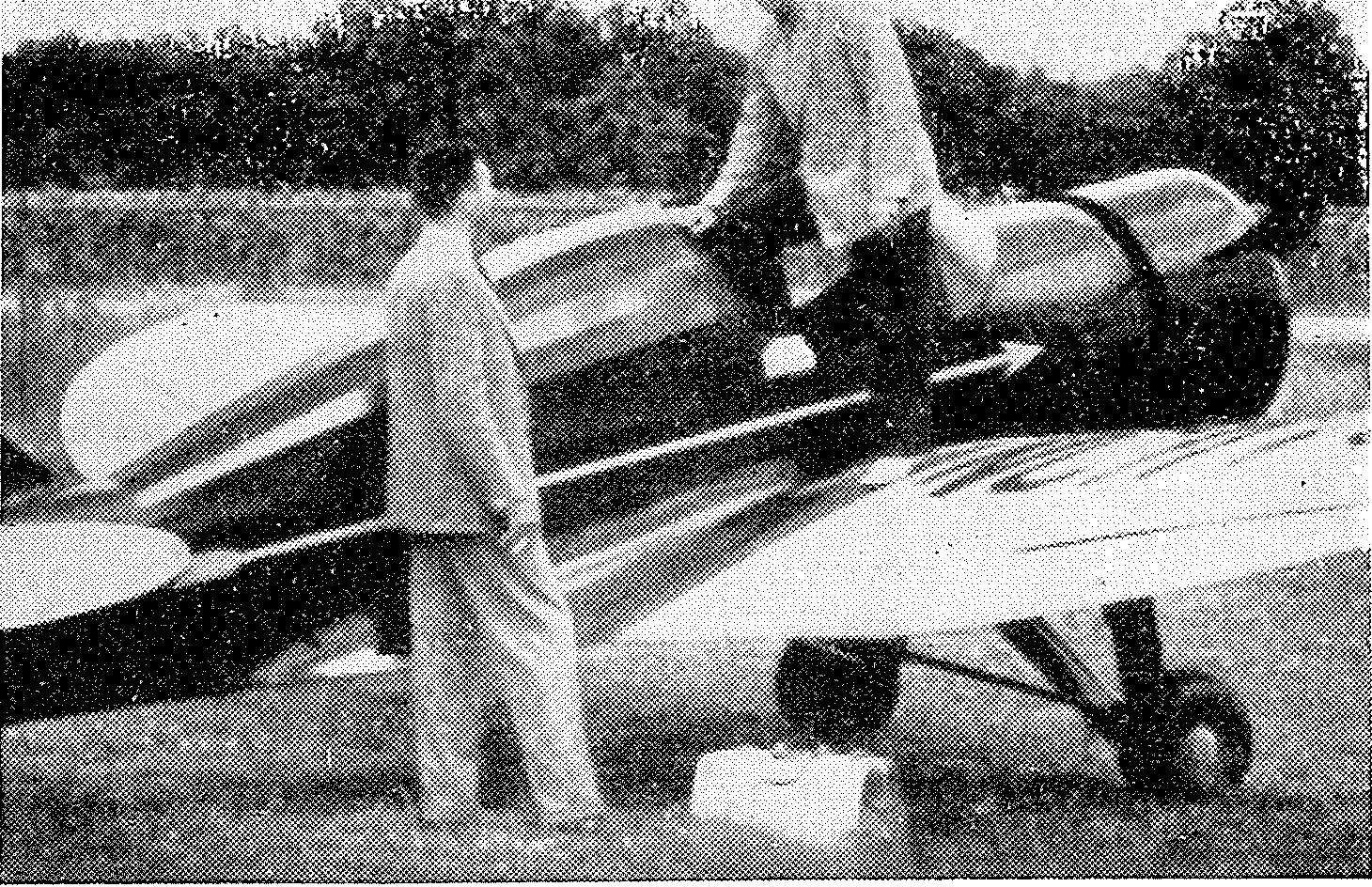
USA Dart-G. Sportflugzeug.
Vgl. Typenbeschr. „Flugsport" 1939, S. 176.
Werkbild
Luftwaffe.
20.—22.10.39. Oberk. d. Wehrmacht keine Bekanntmachungen über Luftwaffe.
Berlin, 23. 10. 39 (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Am 21. Oktober um 12.45 Uhr flog ein dreimotoriges britisches Flugzeug, von Osten kommend, über den Bahnhof Konzen (25 km südöstlich Aachen) und über die in unmittelbarer Nähe befindliche belgische Grenze nach Westen zurück.
24.—30.10.39. Oberk. d. Wehrmacht keine Bekanntmachungen über Luftwaffe,
Kopenhagen, 29. 10. 39. Der Sachschaden, der durch englische Fliegerbomben am 4. September in Esbjerg angerichtet wurde, ist jetzt nach sehr sorgfältiger Berechnung mit 132 000 Kronen (rund 65 000 RM) beziffert worden.
Berlin, 31. 10. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Vier feindliche Flugzeuge wurden abgeschossen.
Berlin, 1. 11. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Zahl der am 30. Oktober an der Westfront und über der Nordsee abgeschossenen Flugzeuge hat sich auf sechs, darunter vier britische, erhöht.
Rom, 1. 11. 39. (DNB.) Ueber eine neue schwere Neutralitätsverletzung durch englisch-französische Flugzeuge berichtet der Luxemburger Korrespondent des Mittagsblattes des „Giornale d'Italia". Danach hat eine französisch-englische Staffel von sechs Flugzeugen am Montagabend kurz vor Sonnenuntergang weite Teile Luxemburgs und auch die Hauptstadt selbst in beträchtlicher Höhe überflogen. Die französischen und englischen Flugzeuge seien neuerdings dazu übergegangen, durch Tiefflug dem Feuer der deutschen Luftabwehr zu entgehen, wobei sie der Mosel und der luxemburgischen Grenze entlangflögen und dabei konstant die Neutralität des Großherzogtums verletzten, während die deutsche Abwehr nicht eingreife, um nicht das Leben der luxemburgischen Bevölkerung zu gefährden.
Junkers-Sturzkampfflugzeug Ju 87
Das Baumuster Ju 87, den einmotorigen, zweisitzigen Tiefdecker, haben wir „Flugsport" 1938 S. 124 ausführlich beschrieben. Die Wirksamkeit dieses Sturzbombers, hauptsächlich in Polen, geht aus den diesbezüglichen Bekanntmachungen des Oberkommandos der Wehrmacht hervor. Außerdem hat der Rundfunk über die durchgeführten Aufgaben regelmäßig berichtet. Danach wurden die gesteckten Ziele durchweg erreicht, die gestellten Aufgaben durchweg gelöst. Bevorzugte Ziele waren feindliche Bunker, Flugplätze, Straßenkreuzungen und Brücken im feindlichen Hinterland, Bahnhöfe, Stabsquartiere sowie sonst unangreifbare Stellungen und Befestigungen. Ein Volltreffer von 500 kg Sprengstoff genügte auch auf modernen Straßen zur Schaffung von Trichtern, die den Verkehr völlig lahmlegten. Da die Truppenbewegungen in einem Lande wie Polen in stärkstem Maße von den Straßenverbindungen abhängig sind, erwies sich schon die kleinste Einheit, die Sturzkampfkette, als erfolgreicher Störungsfaktor. Ein einziger 500-kg-Treffer, vor einen fahrenden polnischen Panzerzug geworfen, warf den ganzen Zug um. Noch verheerender war die Wirkung gutliegender Bomben auf Brücken und Verteidigungsanlagen.
Diese Erfolge waren neben dem guten fliegerischen Können und dem mutigen Einsatz der Besatzungen nur möglich durch die Güte des eingesetzten Materials. In keinem Falle ist die Einsatzbereitschaft der deutschen Sturzkampfgruppen durch technische Störungen an Flugzeug oder Motor wesentlich beeinträchtigt gewesen. Allenthalben erwies sich die Ju 87, wie von den Besatzungen betont wird, als sehr wendig, ja ihre Wendigkeit wird vielfach mit der eines Jagdflugzeuges verglichen. So kam es, daß, nachdem ihr Einsatz ursprünglich mit der schützenden Begleitung von Jagdflugzeugen verbunden war, später hierauf verzichtet wurde, da sich die Besatzungen stark genug fühlten, eventuelle Luftkämpfe gegen feindliche Flugzeuge selbst anzunehmen. Eine ganze Reihe polnischer Flugzeuge wurde so durch dieses in seiner Bestimmung nicht für Luftkämpfe vorgesehene Flugzeug zum Absturz gebracht, darunter das erste überhaupt abgeschossene polnische Flugzeug. Die Sturzflugeigenschaften der Ju 87 bewährten sich in allen Fällen hervorragend, ebenfalls die Landeeigenschaften. Letzteres machte sich vor allen Dingen beim Benutzen behelfsmäßiger Flugplätze bemerkbar.
Besonders gerühmt wird auch die durch Beschußverletzungen schwer zu beeinträchtigende Flug- und Steuerfähigkeit der Ju 87, wovon einzelne Fälle, die die Vorzüge der Junkers-Ganzmetallbauweise deutlich erkennen lassen, hier erwähnt seien. In einem Falle war eine Landeklappe fast gänzlich abgerissen, in einem zweiten Falle hatte eine 4-cm-Flakgranate eine Tragfläche durchschlagen und in der Unterhaut ein Loch von ca. 20 cm Durchmesser, in der Oberhaut eines von einem halben Meter Durchmesser gerissen, ein weiterer Schuß riß die Seitenflosse ab. Selbst mit diesen, beim Angriff erlittenen schweren Verletzungen konnte jedesmal das Flugzeug in seinen Hafen zurückkehren. Die durch Infanterie-Geschosse vom Boden aus erfolgten Treffer im Flugzeug erwiesen sich fast

§iilllllÄ
Wo früher ein polnischer Bunker stand, gähnt nach einem Ju-87-Angriff der
Trichter einer 500-kg-Bombe. Ein durch Beschuß beschädigter Jumo-211 -Motor wird gegen einen neuen Motor
ausgewechselt. Bild pk Fr, okw.
ausschließlich als glatte Durchschüsse ohne weitere Folgen. Ihre Behebung bereitete keine besonderen Schwierigkeiten. Auch durchschossene Luftschrauben konnten ohne weiteres weiterbenutzt werden. Selbst Treffer in den Brennstofftanks führten dank deren sinnreicher Konstruktion in keinem Falle zu einem vorzeitigen Abbrechen der Flüge.

Ital. Segelflugkurs im August in Asiago. 20 Teilnehmer. Am 9. 8. flog Aldo Bello 8 h 21 min auf „Vizzola II" und wurde Erster im Dauerwettbewerb.
Schweiz. Höhensegelflug 3716 m erreichte M. Schachenmann 19. 8. 39 auf S 18 Segelflugzeug. Start auf Flugzeugschlepp. Startplatz Ölten, Flugdauer 3 h.
Schweiz. Segelflugzeug Elfe, Konstrukteur Ing. W. Pfenninger, Anfang dieses Jahres fertiggestellt. Abgestrebter Schulterdecker. Zwischen Flügel und Klappe Schlitz, Junkersbauart. Rumpfbreite 520 mm, Rumpfhöhe 900 mm. Spannweite 9 m, Rumpf länge 5,3 m, Fläche 6,75 m2. Seitenverhältnis 1 : 12. Leergewicht 43 kg, Zuladung 80 kg. Flächenbelastung 18 kg/m2, Sinkgeschwindigkeit bei 60 km/h 0,75 m. Gleitwinkel 1 : 24 bei 92 km/h. Bei normal gestellten Klappen 70 bis 90 km/h.
450 km 2ielflug segelte Woodbrige Brown auf Baby Albatroß am 6. 6. 39 während des „nordwestlichen Segelflug-Wettbewerbes" von Wichita Falls nach
dem 500 km entfernt liegenden Wichita, Kansas, USA. Brown hatte jegliche Orientierung verloren und wußte nicht, wo er sich befand. Er verlor immer mehr an Höhe und setzte nach irgendeiner Wiese zur Landung an. Er war nicht wenig erstaunt, als man ihm sagte, daß er ja in Wichita Falls sei.
Dipl.-Ing. Ulrich Hütter, Dozent Ingenieurschule Weimar, Else Hütter, geb. Rommel, Vermählte.

Belastungsfälle. Abfangen (A-Fall), Abfangen bei hoher Geschwindigkeit (B-Fall), Sturzflug (C-Fall), Abfangen bei negativem Anstellwinkel hoher Geschwindigkeit (D-Fall), Abfangen bei negativem Anstellwinkel (E-Fall). Das Tragwerks vielfache beträgt die Hälfte der Werte des A-Falles. Weitere Belastungsfälle sind: „Hochreißen vor Hindernissen" und „Böenfall". Zugrunde liegt eine Geschwindigkeit von 10 m/sec.
Amiot 370 war als Langstreckenpostflugzeug aus dem Typ 340 entwickelt. Amiot 341, militärische Version, war im Salon 1936 ausgestellt. Durch Einbau von stärkeren Motoren entstanden die Typen 350 mit Hispano-Suiza 12 7 28, 920 PS, und 351 mit Gnome-Rhone 14 N 38, 950 PS. Die Abmessungen und Aufbau sind bis zum Amiot 370 die gleichen geblieben. Der lange Kabinenaufbau ist bei dem 370 weggefallen. Abmessungen: Spannweite 23 m, Länge 14 m, Höhe 4 m, Fläche 67,50 m2. Leergewicht 4300 kg, Fluggewicht 10 300 kg. Geschwindigkeit in 4000 m 475 km/h. Gipfelhöhe 10 000 m.
Vgl. „Flugsport" 1938, S. 481: Amiot 340 u. 1936 S. 612: Amiot 341.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Unbekannte Sahara. Mit Flugzeug und Auto in der Libyschen Wüste. Von L. E. Almäsy. 91 Abb., 2 Kart. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig. Preis geh. RM 7.30, Leinen RM 8.—.
Das Buch mit ausgezeichneten Bildern führt uns in die Libysche Wüste, schildert wie Graf Almäsy die Oase Zarzura wieder fand, wie er, den Spuren des Deutschen Gerhard Rohlfs nachgehend, die in Vergessenheit geratene Straße der 40 Tage wieder entdeckte und wie er, trotz ausgegangenem Wasservorrat, sein Ziel erreichte. Peary, Scott und Amundsen kämpften mit Packeis und Schneestürmen, und hier in der Wüste galt es, den Sandsturm und den heißen Qibli zu überwinden. Die Wüste mit ihren Eigenschaften und Tücken muß man kennen. Ein lesenswertes Buch für den Flieger, der mal in Verlegenheit kommen sollte/ in solche Gegenden verschlagen zu werden und diese Schwierigkeiten überwinden zu müssen.
Deutscher Luftfahrt-Kalender 1940, herausgeg. v. Korpsführer des NSFK., Berlin. Wilhelm Limpert-Verlag, Berlin SW 68. Preis RM 2.40.
Der Abreißkalender bringt eine Reihe ausgewählter schöner Bilder aus den letzten Vorgängen in der Segelfliegerei und insbesondere über die Luftwaffe im vergangenen Jahr.
Jahrweiser für den Deutschen Luftschutz 1940, herausgeg. v. Präsidium des Reichsluftschutzbundes, Berlin. Wilhelm Limpert-Verlag, Berlin SW 68. Preis RM 2.40.
Heute, wo der Luftschutz etwas Selbstverständliches geworden ist, gilt es immer mehr, die jedem einzelnen gestellten Aufgaben entsprechend der fortschrittlichen Entwicklung zu lösen und noch nicht genügend Vorgebildete für das Arbeiten in dieser Richtung zu begeistern. Die ausgewählten Abbildungen wirken anspornend und belehrend.
Die Praxis des Metallflugzeugbauers. Teil I: Werkstoffkunde. Von Obering. Karl Liebig. (Luftfahrt-Lehrbücherei Bd. 3.) Verlag Dr. M. Mattiesen & Co., Berlin W 35. Preis RM 1.80.
Das Werkchen enthält die Behandlung von Leichtmetall, Eisen, Stahl, Kupfer, Holzbauweise, Kunststoffe und anderes mehr.
Zweisitziges
Sportflugzeug
zugelassen, Modell 32-36, zu kaufen gesucht. -Oiferten mit Preisangabe an Perkon, Ljubljana, Celovska 38, hhhbbbhb Jugoslavien.
ngenieur-schule
Maschinenbau / Automobil« w. Flvgtedinik Elektrotechnik. Programm kostenlos
- / A^l
Ich liefere___/ 1
Ubungs-Sege«^^
A^au Schneidet
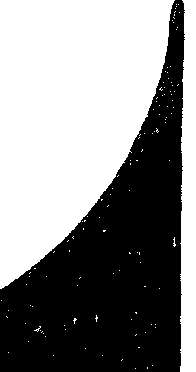
MMöbel
VERSAND
für die Wohnung t
Schränk®
Betten
Büfett«
Tische
Stühle usw, I. Sefolgschaftsriume *
Personalschränke
Tische
Bänke usw. für Heer u. Lazarett s
Schränke
Betten
Schemel usw. Bar oder Ehestandsscheine. Bei Nichtgefallen Rücknahme. Prospekte gratis
FRANKS
ROHMOßEL-VERSAND
Berlin. RouDüiilir Str.iiiV
Werde Mitglied der NSV.!
ORIGINAL - RHÖN - ROSSITTEN -
STARTSEILE
I. G KARL SCHMIDT & Co.
SOLINGEN, Postfach 15
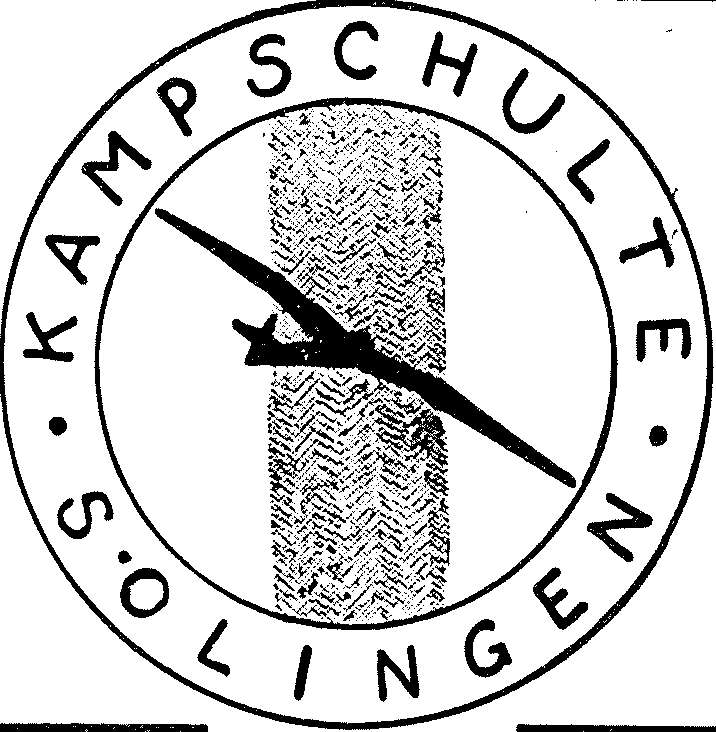
GUMMIKABEL GUMMIRINGE
VERLANGEN SIE KOSTENLOS: MUSTER, DRUCKSCHRIFTEN U. ANSCHAUUNGSMATERIAL
Baumuster Lr 27 r
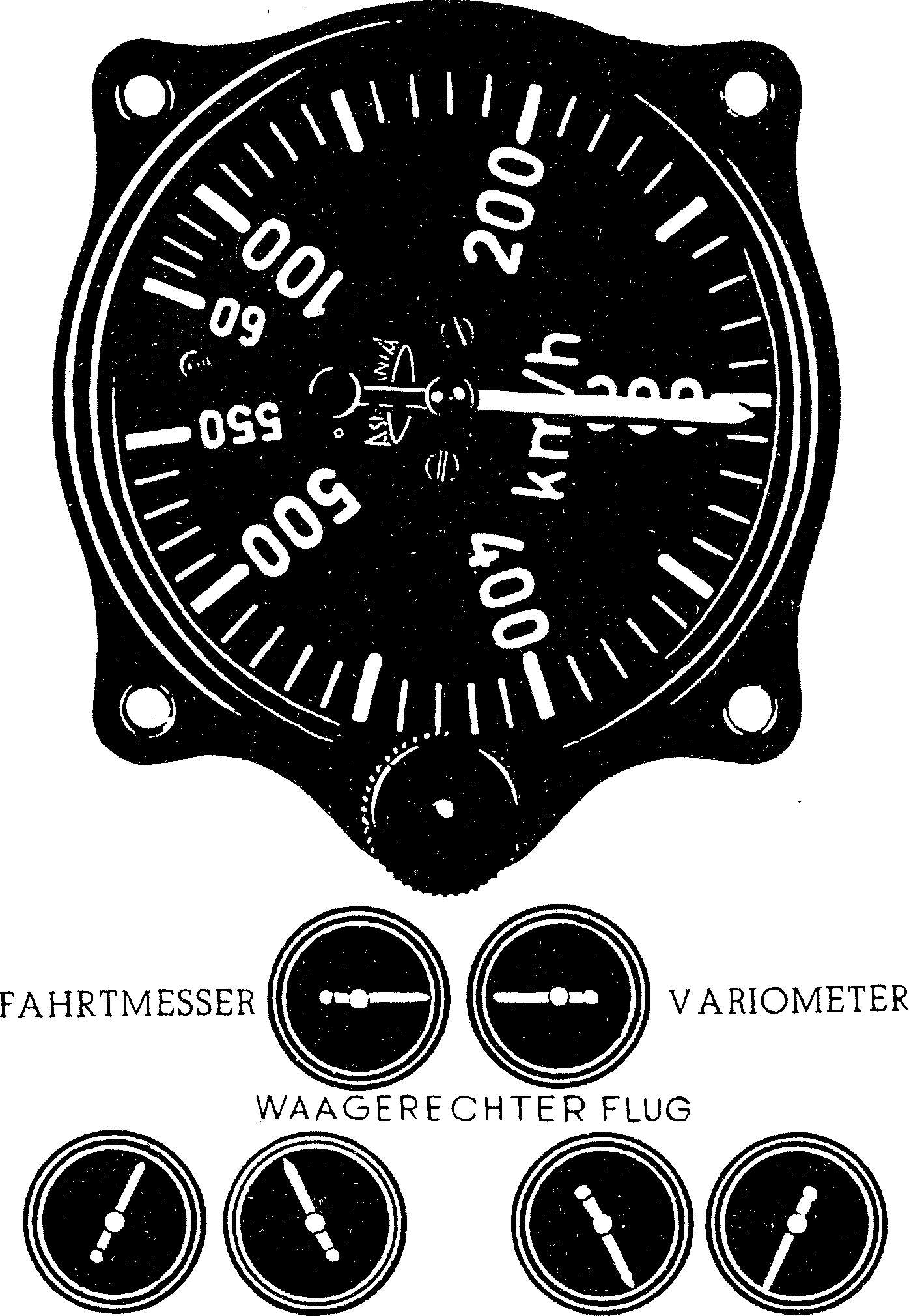
durch
AskaniaFahrime s s er mit drehbarer Skala
Um die Fahrl mühelos zu überwachen, dreht der Flieger die Skala so, daß die einzuhaltende Geschwindigkeitsziffer waagerecht steht. Er braucht dann nur so zu fliegen, daß der Zeiger dauernd waagerecht bleibt.
Besonders sinnfällig wird die Anzeige, wenn rechts vom Fahrtmesser ein Variometer sitzt, da dann bei waagerechtem Flug die Zeiger beider Geräte eine Grade bilden und beim Steigen bzw Sinken in sinnfälliger Richtung auswandern.
Näheres in unserer Druckschrift Aero 609 41

STEIGEN
SIN KEN
BERLIN-FRIEDENAU
Heft 24/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro K Jahr bei 14täglichem Erscheinen RM 4.50
Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ..Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Ouellenangabe gestattet.
Nr. 24 22. November 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 6. Dezember 1939
München.
Den Zusammenbruch von 1918 — Versailles — wird das deutsche Volk nie vergessen. Die Einkreisung von 1914 war den Gegnern Deutschlands gelungen. Ein zweites Mal wird diese nicht gelingen.
Der Führer hat die neu begonnene Einkreisung auf allen Seiten rechtzeitig gesprengt, und wenn am 8. November in München Kräfte des Auslandes am Werke waren, dem deutschen Volk den Führer zu nehmen, so sind wir in Deutschland uns alle bewußt geworden, daß im Ausland der Führer als größte Stütze und als größte Kraft Deutschlands empfunden wird. Der 8. November war ein neuer Ansporn, das Vertrauen zu unserem Führer ins Unermeßliche zu steigern.
Jedem in Deutschland ist klar: Wer den Führer angreift, greift Deutschland an, und hier wird sich Deutschland nicht auf fremde Hilfe verlassen, sondern nur auf die eigene Kraft, auf unsere Führung, unsere Wehrmacht. Was unsere Luftwaffe zu leisten vermag, brauchen wir nicht zu sagen, sondern werden es beweisen.
Die ausländische Lügenpropaganda beginnt schon zu zerflattern. Man hat begonnen zu denken. So teilte ein weitsichtiger Engländer dieser Tage in einer bekannten Fachzeitschrift mit, der Bau von Schlachtschiffen an Stelle von Flugzeugen bedeute eine Vergeudung von Menschen und Geld. Mit den Kosten eines Schlachtschiffes könnte man so viele Flugzeuge bauen, um ein Vielfaches von Schlachtschiffen zu vernichten. Bis diese Erkenntnis in England jedoch durchdringen wird, wird es vielleicht zu spät sein.
Ebenso wird man in Amerika hellhörig. Major Williams, ein bekannter Flugsachverständiger, schrieb im „New York World Tele-gram", in amerikanischen Militärkreisen wachse die Ueberzeugung, daß die Westmächte mit ihrem Versuch, die Ueberlegenheit in der Luft zu gewinnen, etwas schwer Durchführbares begonnen hätten. Williams, der die Luftwaffen aller europäischen Großmächte aus eigener Erfahrung kennt, ist überzeugt, daß England lange Zeit braucht, um seine Luftwaffe genügend schlagkräftig zu machen. Als Grund dafür führt Williams an, daß England nicht seinen Fliegergenerälen, sondern der Armee und Flotte bei der Durchführung der Luftaufrüstung Gehör schenkte. Williams erklärt, die britische Flug-
Diese Nummer enthält Din-Sammlung Nr. 6.
zeugzahl, ihre Produktion und das Flugpersonal seien den Deutschen derart unterlegen, daß er England nur raten könne nicht mit der deutschen Luftwaffe anzubändeln.
Wie es um das deutsche Flugzeugmaterial beschaffen ist, beweisen die vielen Anerkennungen, selbst aus dem gegnerischen Ausland, und die vielen Bestellungen von Neutralen. Wir sind überzeugt, daß die Kriegsstaaten, wenn sie es könnten, sofort deutsches- Mate-rJaLbeziehen würden.
Wie es mit der Leistungsfähigkeit der Flugzeugindustrie in den Feindesstaaten aussieht, erkennt man an den vielen Bestellungen in Amerika. Die französische und englische Flugzeugindustrie wird dadurch nicht gestärkt, sondern geschwächt, ganz abgesehen von der Vielseitigkeit der verwendeten Typen und des sich daraus ergebenden ohnehin problematischen Nachschubs.
Engl. ö. A. Cygnet.
Dieses kleine Kabinenflugzeug ist aus dem C. W. Aircraft Cygnet Minor, dem ersten engl Flugzeug mit Metallhautbedeckung, siehe die Beschreibungen im „Flugsport" 1937, Seite 172 und 445, hervorgegangen. Der Konstrukteur des Cygnet Minor, Mr. Chronan-der, hat jetzt bei der Qeneral Aircraft den Bau eines abgeänderten Types mit Dreirad-Fahrwerk und doppeltem Seitenleitwerk, den G. A. Cygnet, eingerichtet.
Flügel Tiefdeckerbauart, dreiteilig, zwei Hauptholme mit aufgenieteter Aluminhaut. Landespreizklappen. Betätigung durch Vacuum, arretierbar in den Endstellungen.
Rumpf, vorderer Teil Stahlrohr, hinterer Teil Profilringe mit aufgenieteter Aluminhaut. Mittelstück des Flügels mit der Kabine bildet ein kastenförmiges Rahmenwerk, an dem vorn durch angenietete Stahlrohre in Dreieckskonstruktion der Motorschott und hinter der Kabine in gleicher Weise durch Stahlrohre in Dreieckskonstruktion das ovale Rumpfendstück angenietet sind.
Kabine mit Schiebedach, Sitze klappen bei Nichtbelastung hoch, damit sie beim Einsteigen durch Auftreten nicht beschmutzt werden. Höhenleitwerk mit den Seitenrudern ist durch ein sattelförmig geformtes Blech auf der hinteren Rumpfoberseite angenietet.
Das doppelte Seitenleitwerk wurde gewählt, um das Leitwerk aus dem Luftschraubenstrahl herauszubekommen.
Dreiradfahrwerk, hintere Fahrwerkfederbeine greifen am Beschlag des Hinterholms beim Mittelstück an. Vorderes Stoßradfederbein parallel am Brandschott befestigt. Die Stoßkräfte mußten durch besonders kräftige Stahlrohre von der Befestigungsstelle der Stoßstrebe am Brandschott nach der Kabine abgefangen werden.
Betriebsstoffbehälter in der Flügelwurzel des Mittelstücks, 135 1. Gipsy Major 130 PS oder Cirrus Major 150 PS.
Spannweite 10,5m,Länge 7.09m, Höhe 2,25 m, Leergewicht 657 kg, Fluggewicht 998 kg, Kunstfluggew. )r884-kg; Flächenbelastung normal 57,2 kg/m2, Leistungsbelastung 7,23 kg/PS. Höchstgeschwindigkeit 217 km/h, mit 70% Motorleistung 190 km/h. Landegeschw. 96 km/h, Steigfähigkeit 244 m/min, Dienstgipfelhöhe 4580 m. Preis 1250 £.
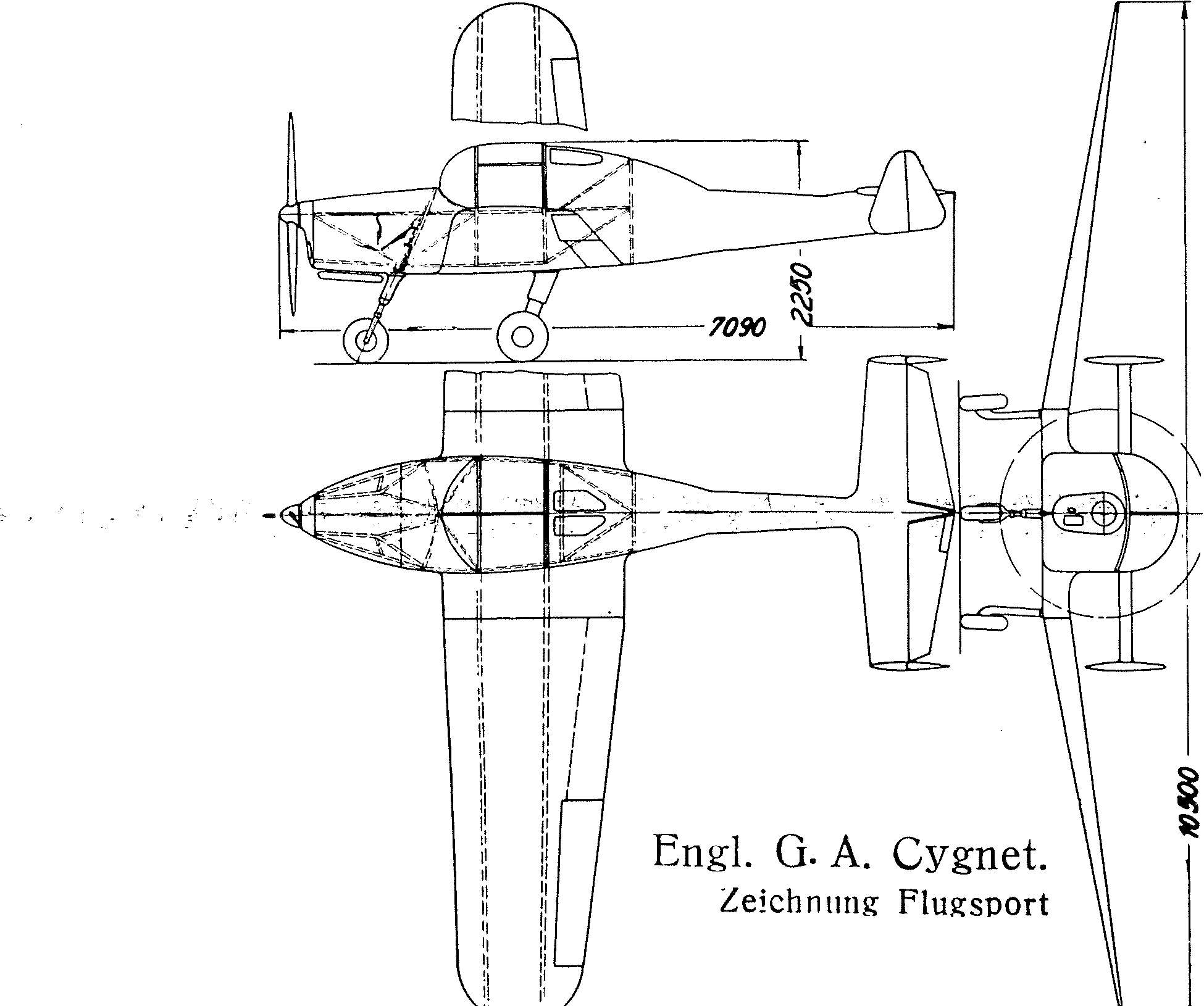
Caudron C-860.
Der Einsitzer C-860 ist von dem franz. Luftfahrtministerium für den Piloten Andre Japy angekauft worden, um Hochgeschwindig-keits- und Höhenflüge auszuführen und bei Schnellverbindungen eingesetzt zu werden.
Flügel, Steuerflächen und Fahrwerk wie bei dem Caudron „Simoun". ^,J.__._.
\
1*0-;
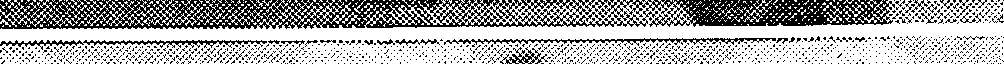
Caudron C-860.
Archiv Flugsport
Flügel, um Gewicht zu sparen, aus einem Stück. Ein Hauptkastenholm mit Spruceflanschen, Stege Sperrholz. Zur Befestigung von Querruder und Landeklappen hinten ein Hilfsholm in gleicher Bauweise. Birkensperrholzbedeckung mit Leinwand überzogen und celloniert.
Rumpf Holzbauweise, sperrholzbedeckt.
Führerkabine weit hinter dem Flügel mit seitlichen Sichtfenstern und stromlinienförmigem Kopfaufbau. Ausrüstung mit Sauerstoff- und Rundfunkgerät.
Höhenleitwerk, 3,8mSpannweite, amRumpf fest. EbensoKielflosse fest. Höhen- und Seitenruder mit Duraluminrippen, leinwandbedeckt.
Fahrwerk fest, Spurweite 2 m. Messiers-Federbeine pneumatisch 180 mm, Federweg am Flügelholm befestigt. Räder in Gabeln gelagert, Stromlinienverkleidung. Ebenso das pneumatisch gelagerte bewegliche Schwanzrad. Motor Renault 6 Zyl. Reihen luftgekühlt, 240 PS mit Kompressor.
Elektrische Schraube, Ratier, im Flug verstellbar. Betriebsstoffbehälter für 1500 1 Fassung, vier von insgesamt 340 1 im Flügel, ein Hauptbehälter von 1150 1 mit einem Zusatzbehälter 40 1 im Rumpf in der
Franz. Caudron C-860.
Zeichnung Flugsport
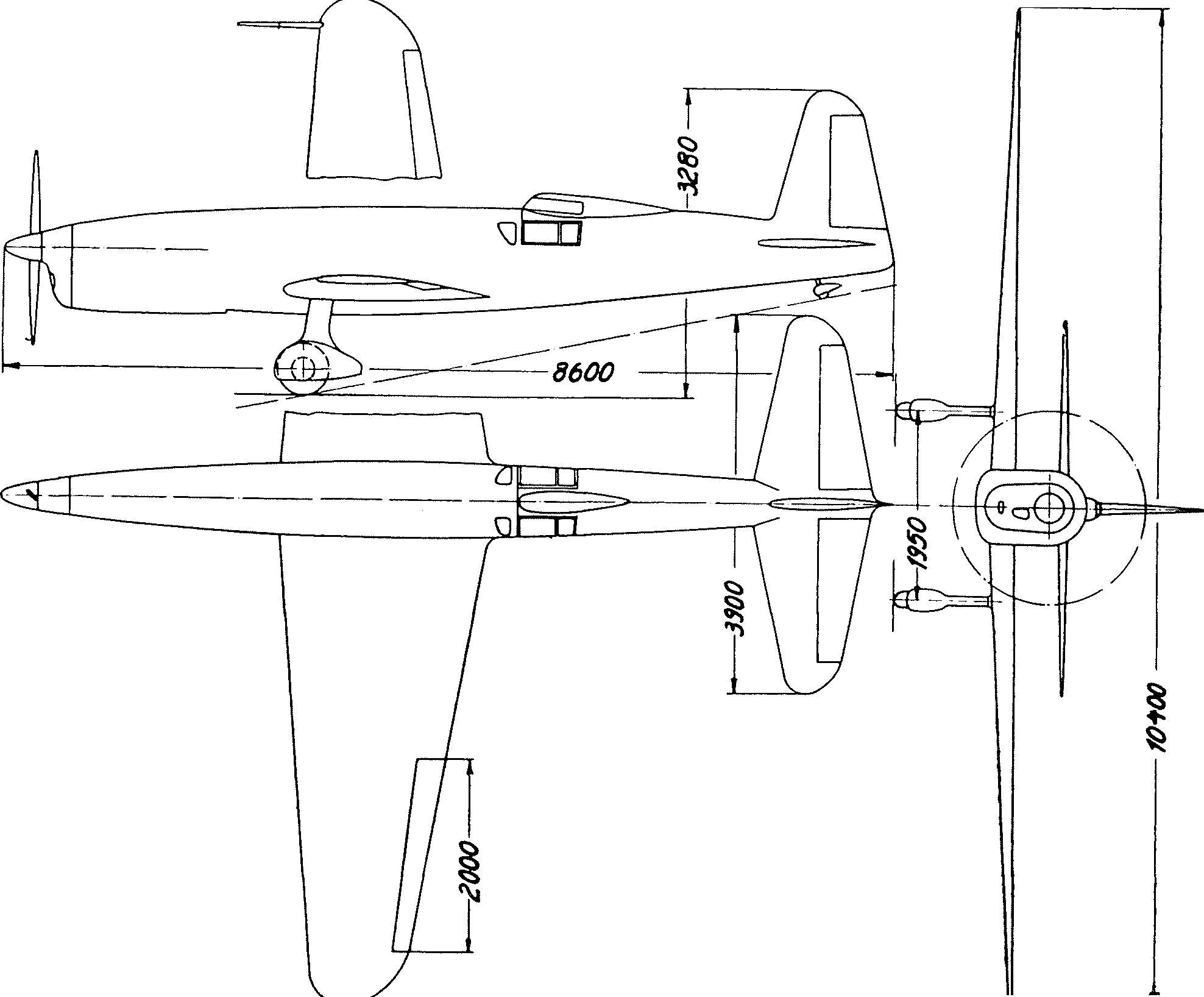
Nähe des Auftriebsmittels. Behälter aus Leichtmetall mit Schnellentleerungseinrichtung.
Mit Renault 8 1 Motor sollte der Entfernungsrekord Kategorie 1, mit Bengali 6,5 1 Kategorie 2, mit Renault 8 1 der Höhenrekord Kategorie 2 überboten werden. Die vorliegende Maschine war im Juni fertig, von den Rekordleistungen hat man jedoch bis heute noch nichts gehört.
Spannweite 10,40 m, Länge 8,60 m, Höhe 3,28 m, Fläche 16 m2. Leergewicht 1160 kg, Fluggewicht normal 1650 kg. Flächenbelastung 103 kg/m2, Leistungsbelastung 6,5 kg/PS. Max. Geschw. 340 km/h in 2500 m, Reisegeschw. 290 km/h. Steigzeit 360 m in 1 min 20 sec. Auslauf 340 m. Mit 2300 kg Fluggewicht Reichweite 7100 km. Start 650 m.
Dieses zweimotorige Langstrecken-, Aufklärungs-, Bomben- und Verkehrsflugboot, gebaut von der Consolidated Aircraft Corp., San Diego (Kalifornien), kann auf Wunsch auch mit hochziehbarem Fahrwerk geliefert werden. Von dieser Type mit einer Maximalflugdauer von 36 Stunden, entsprechend einer Reichweite von 6400 km, hat die USA.-Marine 250 Stück bestellt ϖ
Flügelmittelstück mit dem Boot in der Mitte durch einen stromlinienförmigen Turm, gleichzeitig als Steigschacht, verbunden und auf beiden Seiten durch zwei Strebenpaare abgestrebt. Ansatzflügel außerhalb der Strebenreihe mit hochziehbaren Schwimmern an den Enden. Flügelaufbau zwei Holme mit Profilschotten, abnehmbare Nase und Flügelhinterteil mit Trennungsstellen an den Holmen. Flügelbedeckung Alumin bis auf die Hinterkante und die Querruder. In der Nase liegen Motor-Betätigungseinrichtungen, Betriebsleitungen, Oelkühler, Landelichter, elektrische Leitungen und ein Teil der Schwimmerhochzieh-Betätigungseinrichtung. In dem Raum zwischen den Holmen Betriebsstoffbehälter. Die Tankräume sind durch Mannlochdeckel zugängig.
Die seitlichen Stützschwimmer sind als Flügelstützschwimmer hochziehbar eingerichtet, wTobei das Gestänge der Streben im Flügel verschwindet. Querrudergerippe Duralumin, leinwandbedeckt; linkes Querruder mit Trimmklappe vom Führersitz verstellbar.
USA. Consolidated PBY Flugboot, Modell 28.
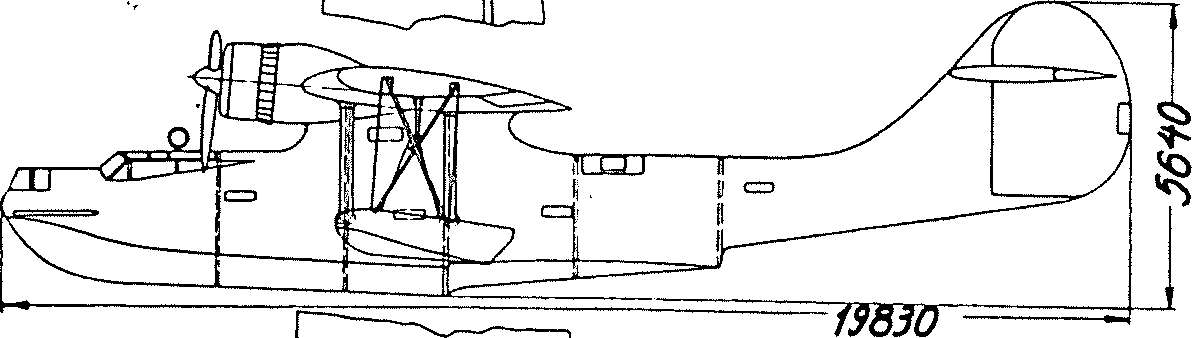
Das Rumpfende ist, um das Leitwerk aus dem Wasser und in den Luftschraubenstrom zu bekommen, stark hochgezogen. Kielflosse fest. Feste Höhenflosse und Ruder mit Flettner-rudern, Duraluminkonstruktion mit Weichaluminhaut.
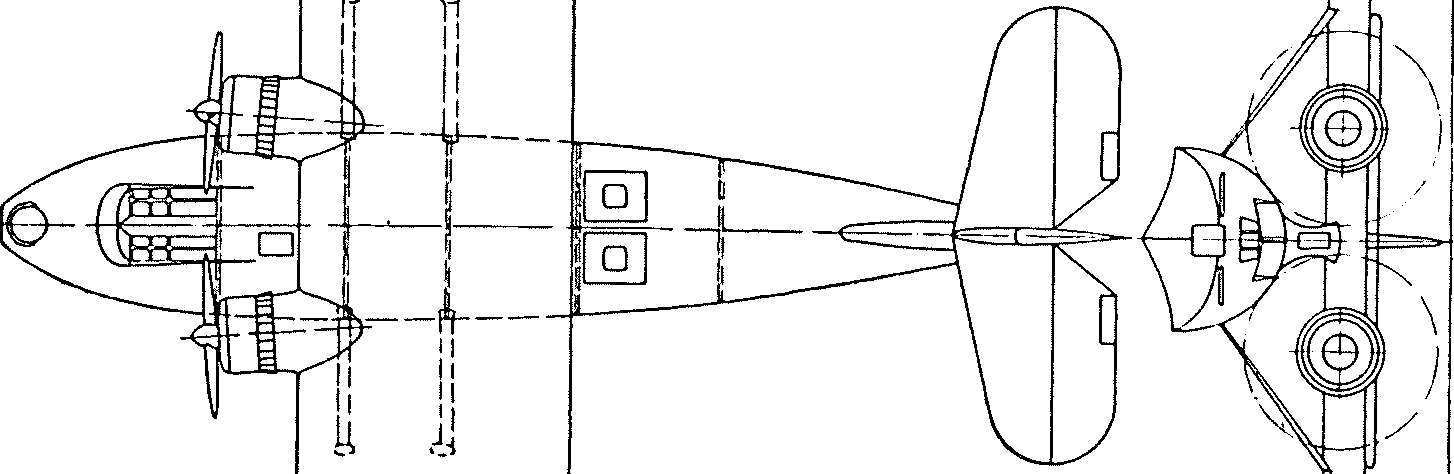
□
□
Boot zweistufig. Der hintere leitwerktragende Teil weit aus dem Wasser herausgezogen. Raumaufteilung durch vier wasserdichte Schotten mit Schottentüren. Vorn am Bug gepolsterter Freibord.
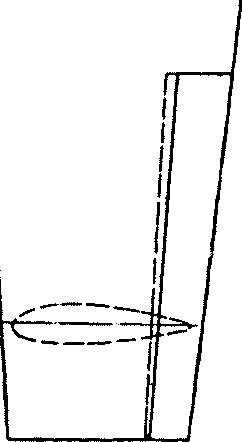
USA Consolidated PBY Flugboot Modell 28.
Zeichnung Flugsport
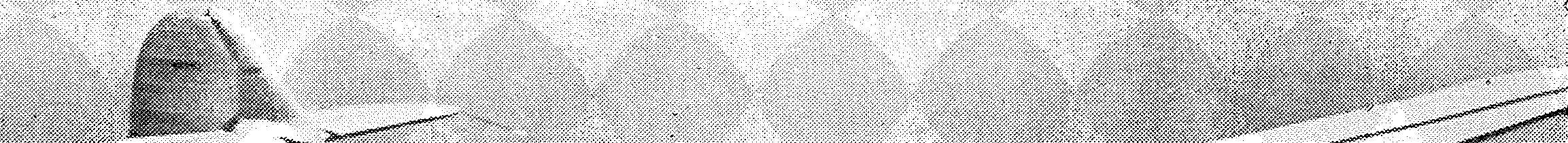
USA Consolidated PBY Flugboot, Modell 28. Werkbilder
Vor dem Führerraum MG.-Stand mit abnehmbarem Windschutz, darunter in der Bugspitze ein schräges Sichtfenster zur Beobachtung innen mit wasserdichter Schotte, außen mit hochziehbarer Blechjalousie. Führerraumdach mit Cellon-Sichtfenstern nach oben, das Ganze nach innen verschiebbar. Unten an der Seite Schiebefenster. Sämtliche Schiebeteile sind im geschlossenen Zustand durch Haken sicherbar und regendicht. Funker- und Navigatorabteil, vom Führersitz durch Schottentür zugänglich, enthält vier Fenster. Dahinter Abteil für die Mechaniker, mit dem Rumpf aufsatzstück, an dessen oberem
USA Consolidated PBY Flugboot, Modell 28. — Links: Raum für die Mechaniker im Flügelturm mit Schaltbrett für die Motorenwartung. — Rechts: Bootsrumpf
WKtBKÜ^E^^Si unbekleidet. Werkbilder
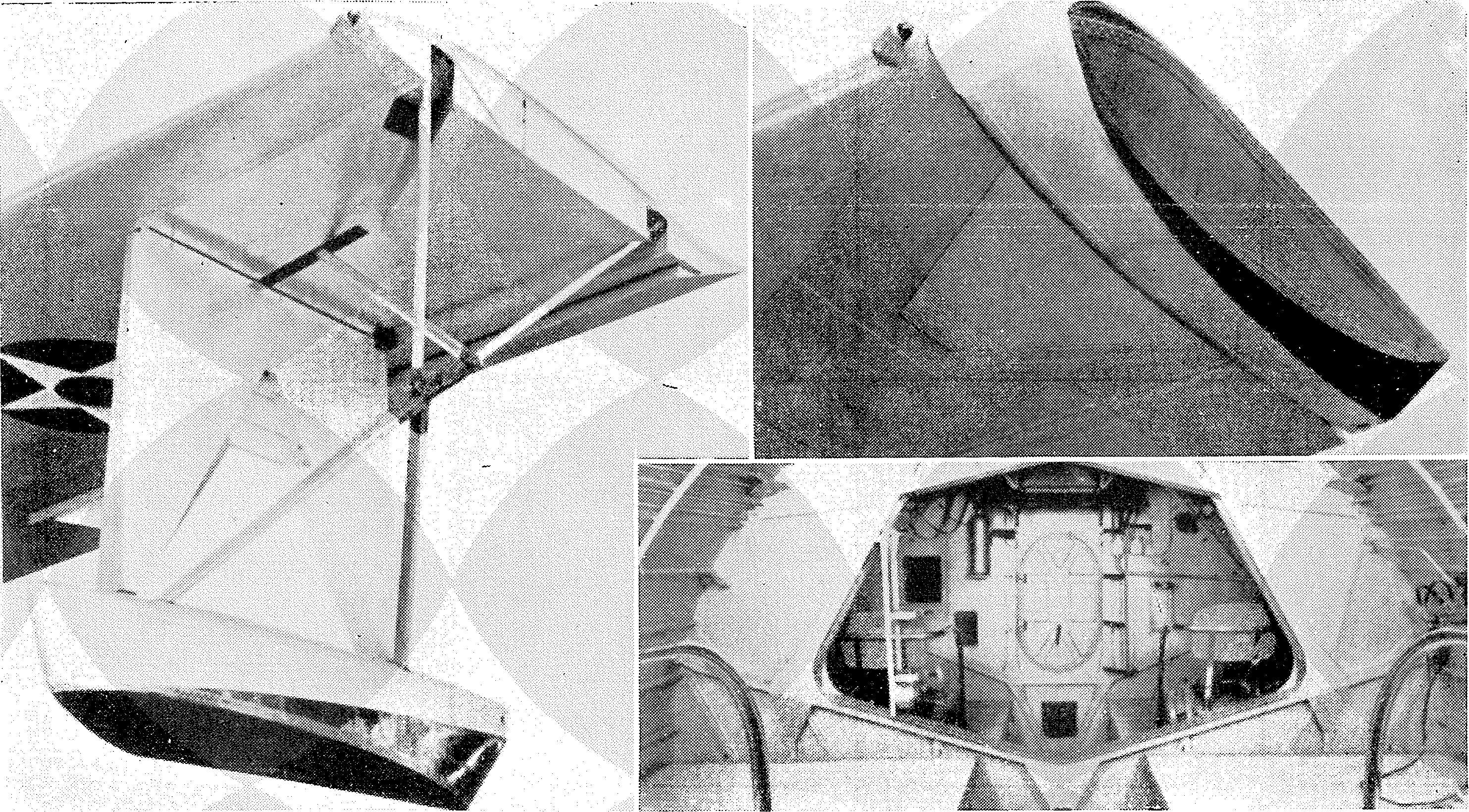
USA Consolidated PBY Flugboot, Modell 28. — Links Stützschwimmer, rechts hochgezogen. — Unten: Blick in den hinteren Bootsraum mit Aussteigluken nach oben (liegt noch vor dem Heckschützenraum). Links erkennt man die Steigleiter.
Werkbilder
Ende der Flügel befestigt ist. Weiter folgen nach hinten: Aufenthaltsraum, Raum für den oberen hinteren Schützen und Tunnelraum für den hinteren unteren Schützen. In letzterem ist im Kiel eine Schottentür, die im Fluge nach innen für das MG. aufgeklappt werden kann.
Hochziehen der seitlichen Stützschwimmer durch Gewindespindeln, Betätigung vom Mechanikerraum aus. Stützschwimmer aus Leichtmetall, gekielt, Heck nach unten gezogen, in drei Räume unterteilt.
Motoren zwei Pratt & Whitney Twin Wasp R-1830 oder Wright Cyclone GR-1820. Dreiblatt-Zweistellungs-Propeller.
Bewaffnung: ein vorderes MG. 7,7 mm, zwei bewegliche MG. im hinteren Sitz und eins im Tunnel. Bomben vier zu 450 kg oder 8 zu 225 kg, oder zwei Torpedos von je 900 kg.
Spannweite 31,70 m, Länge 19,83 m, Höhe 5,64 m, Fläche 130 m2. Leergewicht 6570 kg, Fluggewicht 9973 kg. Max. Geschw. 310 km/h in 3660 m Höhe, min. Geschw. 99,5 km/h, Flächenbelastung 76,3 kg/m, Leistungsbelastung 4,75 kg/PS, Reichweite 4330 km, max. Reichweite 6430 km. Start ohne Wind 43 sec.
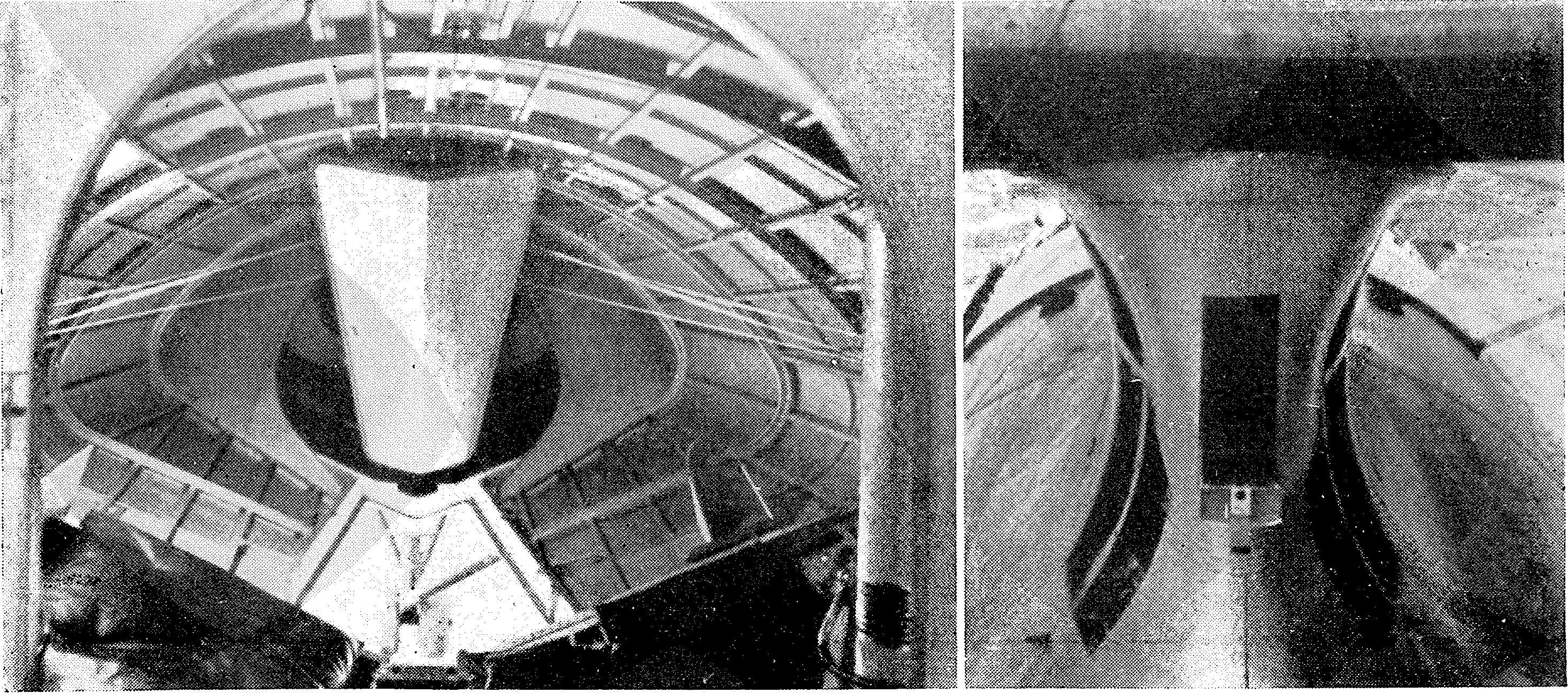
USA Consolidated PBY Flugboot, Modell 28. — Links: Blick Bootstunnel, geöffnete wasserdichte Kielluke für den Heckschützen. — Rechts: Flügelbefestigungsturm mit dem darunterliegenden Raum für Motorenwart. Werkbilder
1000
soo
Ergebnisse der Luftschraubenforschung»
Stand nach NACA im Jahre 1938.
Die Blattspitzen der Propeller moderner starkmotoriger Schnellflugzeuge arbeiten bereits in einem Bereich sehr hoher Machscher Zahlen. So ergibt sich beispielsweise bei einer Fluggeschwindigkeit von 755 km/h, einem Propellerdurchmesser von 4,5 m und einer Drehzahl von 1600 U/min ein Wert von 1,3! Abhilfe ist möglich durch Vergrößerung der wirksamen Propellerblattfläche, die wiederum durch größere Durchmesser, Erhöhung der Blattzahl oder durch breitere Blätter erreicht werden kann. Da sich bekanntlich das Gewicht mit der 3. Potenz des Durchmessers ändert, wird bald eine obere Grenze erreicht sein (Abb. 1). Eine Vergrößerung der Völligkeit bei gleichbleibendem Durchmesser ist im allgemeinen mit einer Verringerung des Wirkungsgrades verbunden, so daß man diese nicht durch Verbreiterung der Blätter, sondern vielmehr durch Erhöhung der Blattzahl wirksamer erreichen kann. Auf diese Beziehungen wird weiter unten noch ausführlicher eingegangen.
Um Aufschluß über die Kompressibilitätseinflüsse auf die aerodynamischen Eigenschaften von Luftschrauben zu erhalten, sind im amerikanischen Luftschraubenkanal systematische Untersuchungen für den Start- und Steigflugbereich ausgeführt worden1). Es ist bekannt, daß der Wirkungsgrad bei Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit, der „kritischen Geschwindigkeit", stark abfällt. Wann diese Grenze erreicht wird, ist von einer Reihe von Faktoren
*) NACA Report Nr. 639, 640, 642, 643. Reportsammlung Nr. 14/15, „Flugsport" Band 31, Nr. 13.
|
B/attzaM- |
||
330
340 330 %320 3i0 300 290
10
H
Hm
Dm
Abb. 1. Gewichte von Luftschrauben.
9 Abb. 2. Aenderung der Schallgeschwindigkeit mit der
Höhe (INA)
7
?CM-0,5)
10
Q8
|
l |
|||||
|
—15° |
|||||
|
36 |
|||||
Q5
46
0.7
Oß
Af
Q9
Abb. 3. Aenderung von V mit der M-Zahl, Propeller A, Profil Clark Y, v/n D = 30, D = 3,05 m.
Abb. 4. Propellerformen.
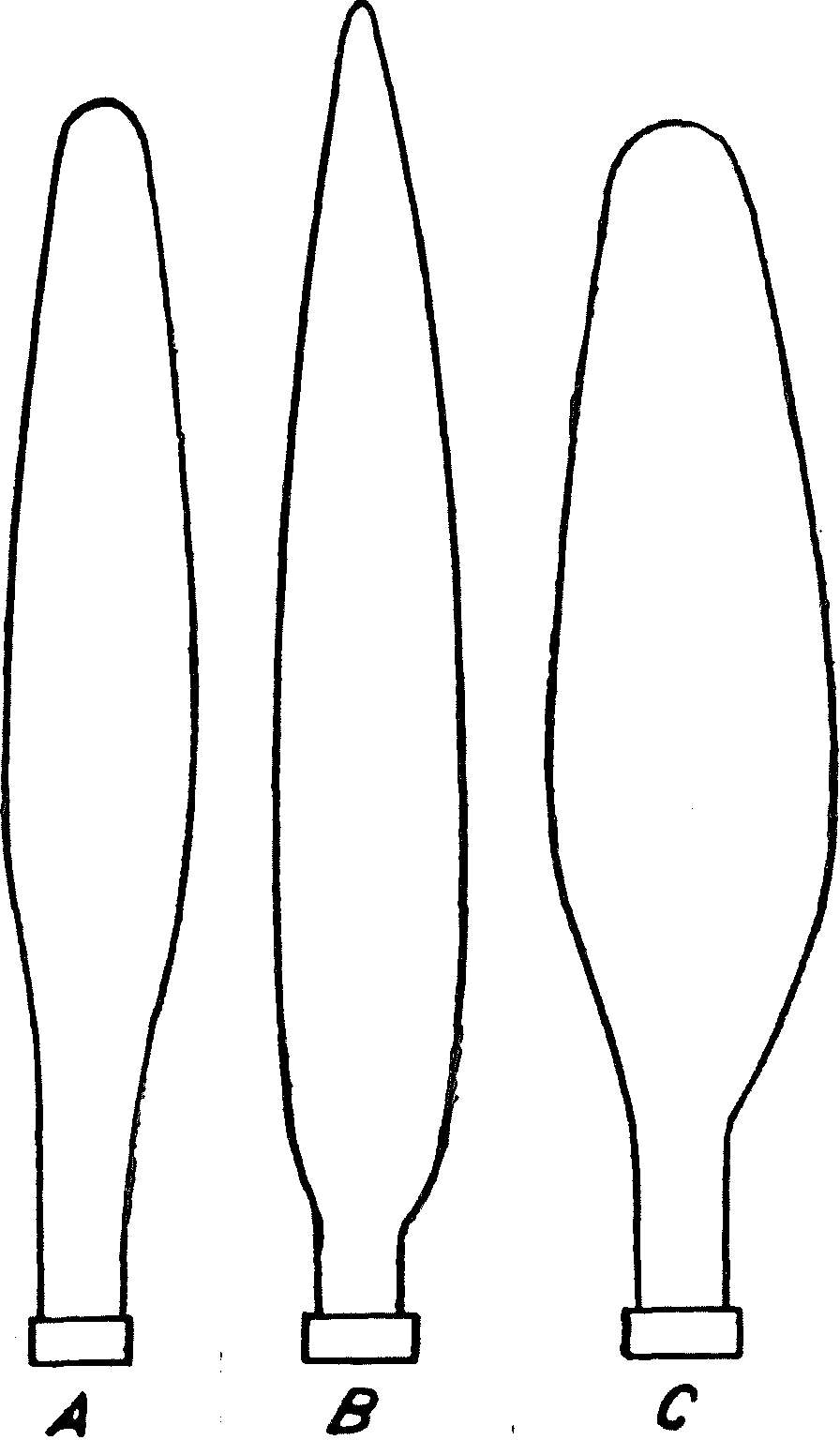
abhängig, von denen die Spitzengeschwindigkeit die wichtigste Rolle spielt. Demgegenüber treten die durch Blattprofil, Blattiefe und Blattdicke verursachten Einflüsse nicht so ausgeprägt in Erscheinung. Spitzengeschwindigkeit.
Die Spitzengeschwindigkeit einer Luftschraube ist bekanntlich die resultierende aus der Fluggeschwindigkeit v und der Umfangsgeschwindigkeit u
Für die Schallgeschwindigkeit und demnach auch für die Machsche Zahl M = ^7 besteht eine Abhängigkeit von der Temperatur nach der Bezeichnung _
Tc ist die absol. Temperatur in °C. In Abb. 2 ist die Schallgeschwindigkeit abhängig von der Flughöhe aufgetragen worden. Für welchen Wert von M erstmalig Verluste durch Kompressibilität auftreten, ist von den oben bezeichneten Faktoren abhängig. Im Startbereich konnte schon bei M = 0,5 bis 0,7 eine merkliche Abnahme von v beobachtet werden. In Abb. 3 ist rj über M aufgetragen worden, Blattwinkel 15, 20, 25 und 30°, Fortschrittsgrad 0,3, Luftschraube B nach Abb. 4, Durchmesser 3,05 m. Für den Steigflugbereich (R = 0,65) ist die kritische M-Zahl 0,6 bis 0,75. Allgemein gilt, daß bei zunehmender Steigung die Verluste schon bei kleineren Spitzengeschwindigkeiten auftreten. In Abb, 5 ist der Schubbeiwert Ct, der Leistungsbeiwert Cn und v\ über dem Fortschrittsgrad aufgetragen worden, und zwar für zwei verschiedene Spitzengeschwindigkeiten. Luftschraube A nach Abb. 4, Blattwinkel 25° in 0,75 R-Blattwinkel.
Im Startbereich traten die größten Verluste bei 20° auf (Abb. 3). Verlust an Startschub bei M = 0,8 in einem Fall 10% bis 25%; durch Extrapolation auf M = 0,9 ergaben sich sogar Verluste von 40%. Für den Steigflugbereich waren Blattwinkel von 25° am ungünstigsten, ohne daß indessen die schlechten Werte des Starts erreicht wurden; in einem Falle 10% bei M = 0,8. Blattprofil.
Die in USA vorzugsweise zur Anwendung kommenden Propellerprofile sind Clark Y und R A F 6, von denen das letztere im Start-und Steigflugbereich erheblich schlechter abschneidet. Eine Erklärung für diese Erscheinung ist vielleicht in der unterschiedlichen Wölbung der Profilvorderkante zu suchen (Abb. 6). Bei RAF 6 kommt infolge der größeren Stumpfheit die Verdichtungswelle früher zur Ausbildung. Blattumrißform.
Der Einfluß der Blattumrißform geht aus Abb. 7 hervor. Danach ist das spitze Blatt „B" dem normalen Blatt „A" überlegen, besonders im Startbereich bei einem Blattwinkel von 20°. Wie sich die Blattform E auf den Schub auswirkt, geht aus Abb. 8 hervor. Blattbreite.
Propeller C ist 50% breiter als Propeller A, und da die relative Dicke die gleiche bleibt, auch 50% dicker. Aus Abb. 9 ergibt sich, daß die Verluste des normalbreiten Blattes im Startbereich doppelt so hoch sind; im Steigflug sind die Ergebnisse ausgeglichener. Die Ueberlegenheit des breiteren Blattes in diesem Fall ist durch die relativ höhere Strömungsgeschwindigkeit längs der Profilsehne zu erklären, wodurch der eff. Anstellwinkel des Blattes ein kleinerer ist.
1/V - u2
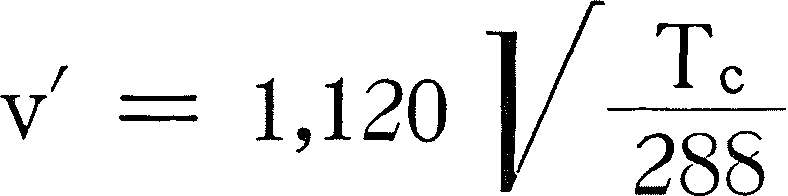
Blattdicke,
Propeller D wurde mit 3 verschiedenen Blattdicken untersucht, alle anderen Größen blieben unverändert. Abb. 10 zeigt die Ergebnisse. Der verhältnismäßig schlechte Wirkungsgrad des 6% dicken Blattes im Startbereich ist darauf zurückzuführen, daß schon bei kleinen Drehzahlen heftiges Flattern der Blätter auftrat. Zweifellos
Q16
$12
QiO
006
006
qo*
qo2
|
n U/snin Vj m/s --- 7000 160 155S 250 |
|||||
|
\ |
|||||
|
\ \\ |
\ |
||||
|
---■ |
. \ ^ \ > |
\ |
|||
|
/ y |
\ \ |
||||
|
V/ / / |
' / |
||||
|
/ / |
|||||
to
7
0,8
|
\ |
|||
|
X \ |
> |
9 Q8
oß
Oß
0,7 Q8 M
Abb. 7. Einfluß der Blattform, 7 Propeller A u. B. Profil RAF 6, VCAf'0,5) Blattwinkel 20°, Startbereich.
Oß<* 10
0*
OJ 4*
|
Vop. A » C |
|||
|
> |
|||
06
07
Oß
Oß _±_ 1,0 n D
Abb. 5. Ct* Cp, und v in Abhängigkeit vom Fortschrittsgrad. Propeller A.
Clark y MALA
Oß Q9 M
Abb. 9. Einfluß der Blattbreite, Profil RAF 6, D = 3,05 m, Startbereich.
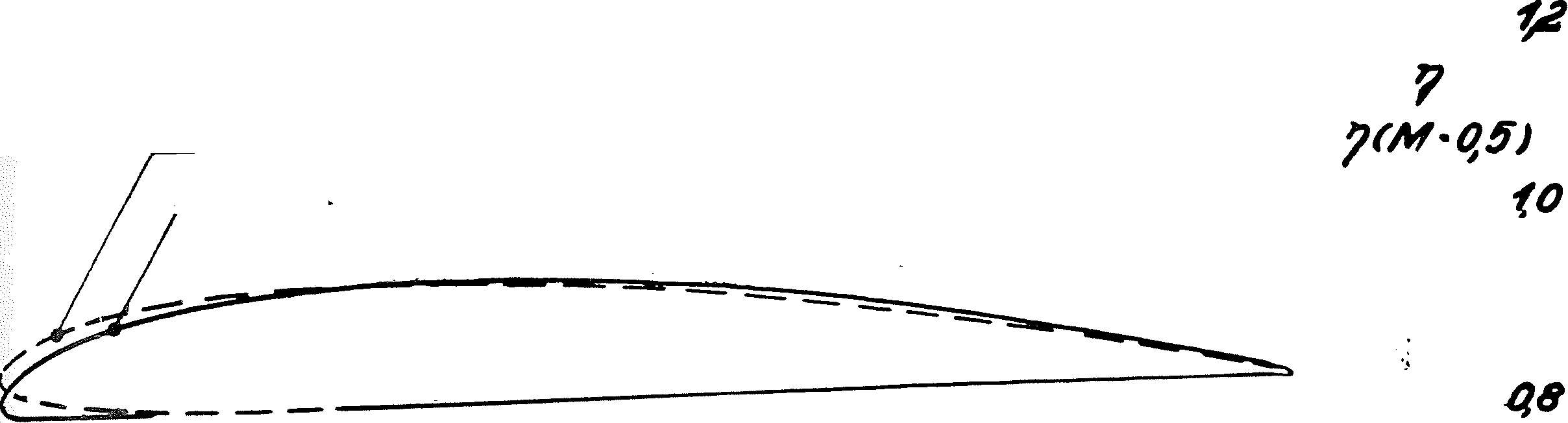
Abb. 6. Profil Clark Y und RAF 6.
-fO+O 910
% 720 5*0 350 *80
|
--- |
--- |
||||||
|
°rop eller: # - A 3t05 ---E 3,05 |
|||||||
|
---- |
|||
|
.................. |
Propeller " |
Q0icke6X " " 8% " " 10% |
05
Oß
Q7
Abb. 10. Einfluß der Blattdicke, Blattwinkel 20° in 0,75 R, D = 2,9 m, Startbereich.
18
36 54
Flu99eschw \rm/s
Abb. 8. Schubkurven eines Flugzeuges, v = 89 m/s N = 2X550 PS, n = 1750 U/min.
72
10
? Oß
qe
0,7
|
— |
— Prop A, 3 Blatt) gleiche Ct2 - 1 Volligkeit |
||||
10
1.2
1+
iß
18 2.0 22
Abb. 11. Blattzahl und Völligkeit.
müßte das dünnere Blatt im Bereich hoher Machscher Zahlen am günstigsten abschneiden, eine Folgerung, die sich aus der Tendenz der Kurven des 8% und 10% dicken Propellers ergibt. Blattzahl und Völligkeit.
Eingangs wurde schon der Einfluß einer Aenderung der Völligkeit auf die aerodynamischen Eigenschaften erwähnt. In Abb. 11 sind Kurven eines Zwei- und Dreiblattpropellers, die beide gleiche Völligkeit haben, aufgetragen worden. Wird also die Erhöhung der Völligkeit durch Verbreiterung der Blätter vorgenommen, so fällt y ab, gleichbleibender Durchmesser vorausgesetzt. Die Unterschiede zwischen Zwei-, Drei- und Vierblattpropellern sind jedoch-nicht groß und betragen 2 bis 4%. Motorverkleidung und Propellerhaube.
Im allgemeinen haben Luftschrauben vor gut verkleideten flüssigkeitsgekühlten Reihenmotoren bessere Wirkungsgrade als vor Sternmotoren. Diese Tatsache kommt durch Bevorzugung des flüssigkeitsgekühlten Motors bei neueren Schnellflugzeugen zum Ausdruck. Einen nicht unbedeutenden Einfluß hat ferner die Blatt-profilierung in Nähe der Nabe. Propeller A mit rundem Schaft ist in bezug auf n dem Propeller B unterlegen, und zwar wird der Unterschied mit steigendem Blattwinkel größer, wie aus der Abb. 12 hervorgeht. Durch eine gute konstruierte Propellerhaube kann eine weitere Verbesserung erzielt werden, namentlich bei Propeller A.
Weitere Untersuchungen des NACA2) befassen sich mit der Bestimmung der Dreh- und Biegeverformungen von unter normalen Betriebsbedingungen arbeitenden Propellerblättern. Die auftretenden Verformungen sind bei den heutigen Abmessungen noch vernachlässigbar. Bei Blättern aus Aluminiumlegierung wurden Torsionsverformungen von 1/100 und weniger gemessen. Die Durchbiegung ist zwar größer, bleibt aber unterhalb der Schwingungsgrenze ohne nennenswerten Einfluß auf die aerodynamischen Eigenschaften. Abb. 13 zeigt die Dreh- und Biegeverformungen des Propellers D.
Zwrecks Nutzbarmachung des negativen Schubes zur Begrenzung des Landewegs und der Sturzflugendgeschwindigkeit wurden im Luftschraubenkanal des NACA die entsprechenden Beiwerte einer Reihe von Luftschrauben bestimmt3). co ...
2) NACA Report Nr. 644. Reportsammlung Nr. 15. „Flugsport" Band 3.1, Nr. 18.
3) NACA Report Nr. 641. Reportsammlung Nr. 15. „Flugsport" Band 31, Nr. 18.
2,0
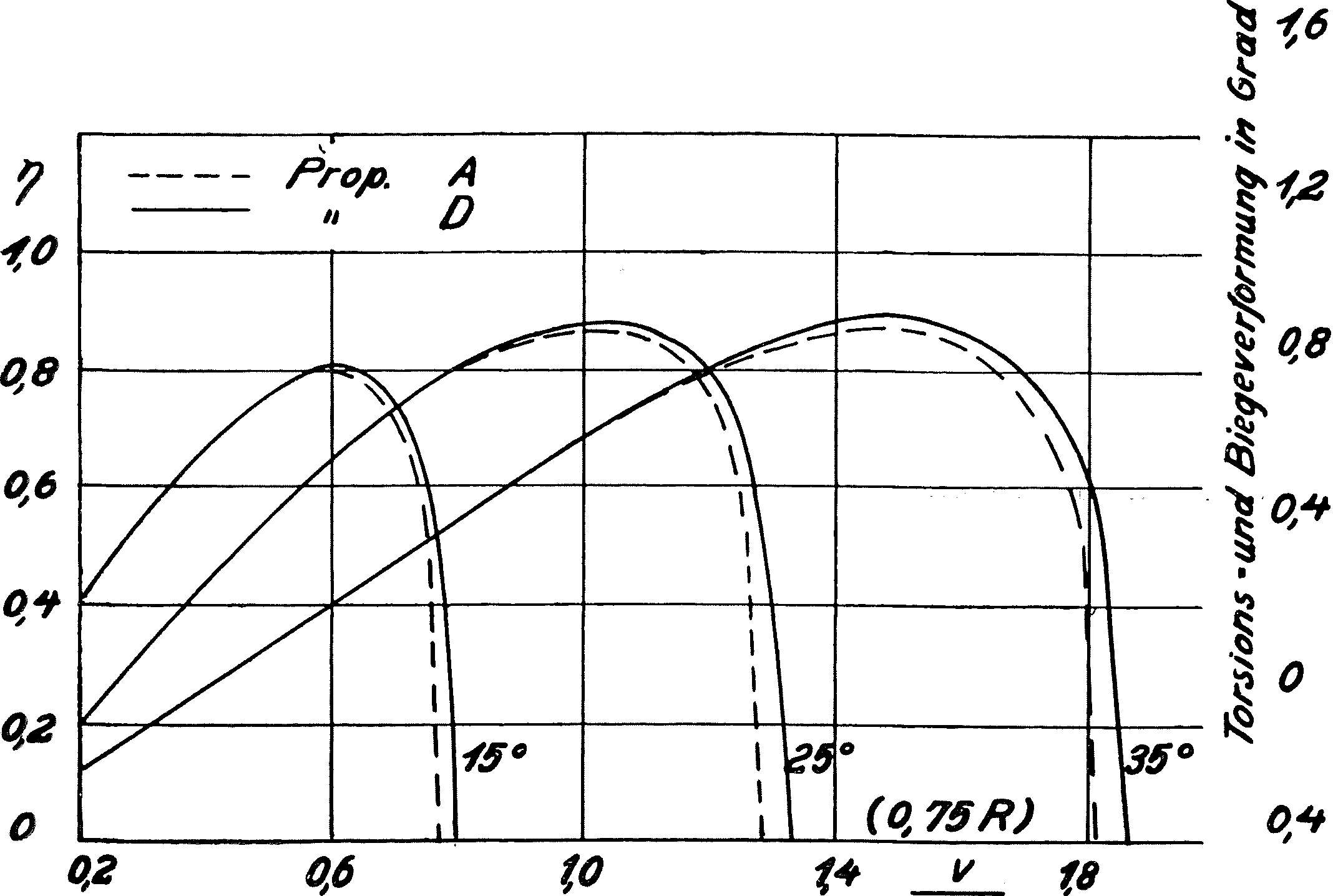
Abb. 12. Einfluß des Blattschaftes.
v n O
Abb. 13. Biege- und Torsionsverformungen des D, Meßstelle in 0,7 R, Blattwinkel 15° in 0,75 n = 1500 U/min.
Escher Wyss-Verstellpropeller,
Die Verstellungen beim Escher Wyss-Verstellpropeller werden in beiden Richtungen durch hydraulischen Druck (Oel) erzeugt. Ausnutzung von Massenfliehkräften zur Blattverdrehung kommt nicht zur Anwendung. Blockierung der Blätter in ihrer jeweiligen Lage erfolgt durch Verminderung des Oeldrucks im Verstellzylinder. Die Feststellung der Blätter kann in jeder beliebigen Lage des ganzen VeTstellbererehes erfolgen. Sobald der Oeldruck über den Grenzwert steigt, entblockiert die Feststellvorrichtung den Verstellzylinder, worauf dessen Verschiebung wieder ungehindert vor sich gehen kann.
Der Aufbau der Verstellnabe ist aus den Schnitten der Abb. 1 ersichtlich. Ein einteiliges Nabengehäuse 1 aus geschmiedetem Sonderstahl bildet den Blatträger und umschließt sämtliche übrigen beweglichen Teile. Auf einem zentralen, hohlen Führungsrohr 2, welches Durchschußmöglichkeit durch die Nabe bietet, sitzt ein fester Kolben 3, den ein längs des Führungsrohres verschiebbarer Verstellzylinder 4 umschließt. Durch Bohrungen des zentralen Führungsrohres wird das Drucköl auf die eine oder andere Seite des Kolbens geleitet. Dadurch verschiebt sich der Verstellzylinder relativ zum Kolben. Der Verstellzylinder trägt an seinem vorderen Ende einen Ring mit Pleuellenkern 5, welche auf die Blatthalter 6 die Verstellkräfte übertragen. Eine axiale Verschiebung des Verstellzylinders bewirkt damit ein entsprechendes Verdrehen der einzelnen im Nabengehäuse gelagerten Blätter 7.
Die Wurzel des Duralblattes ist in einer Stahlfassung eingeschraubt, welche sich auf ein Lager 8 abstützt und eine sichere Aufnahme der beträchtlichen Flügelfliehkräfte von 30 und mehr t je Blatt gewährleistet. Das Lager 9 bildet die Biegungseinspannung des Flügels. Das einteilige Nabengehäuse ist durch einen Flansch 10 an der Anschlußwelle befestigt. Die Befestigung könnte auch durch eine Keilwelle erfolgen.
Die gesamte Feststellvorrichtung ist im Innern des Verstellzylinders zwischen den beiden Seitenwänden des mit der Hohlwelle verbundenen, feststehenden Kolbens 3, vollständig im Oel liegend, untergebracht. Bevor der Oeldruck auf die eine oder andere Kolbenseite gelangen kann, betätigt er im Innern des Kolbens liegende, federgespannte Hilfskölbchen, durch deren Verschiebung Blockierorgane bewegt werden, die mit entsprechenden Teilen im Innern des Verstellzylinders in Eingriff kommen können. Der ankommende Oeldruck entblockiert die sonst federgespannte Feststellvorrichtung; dann erst kann der Oeldruck in die passenden Zuleitungen zur rech-
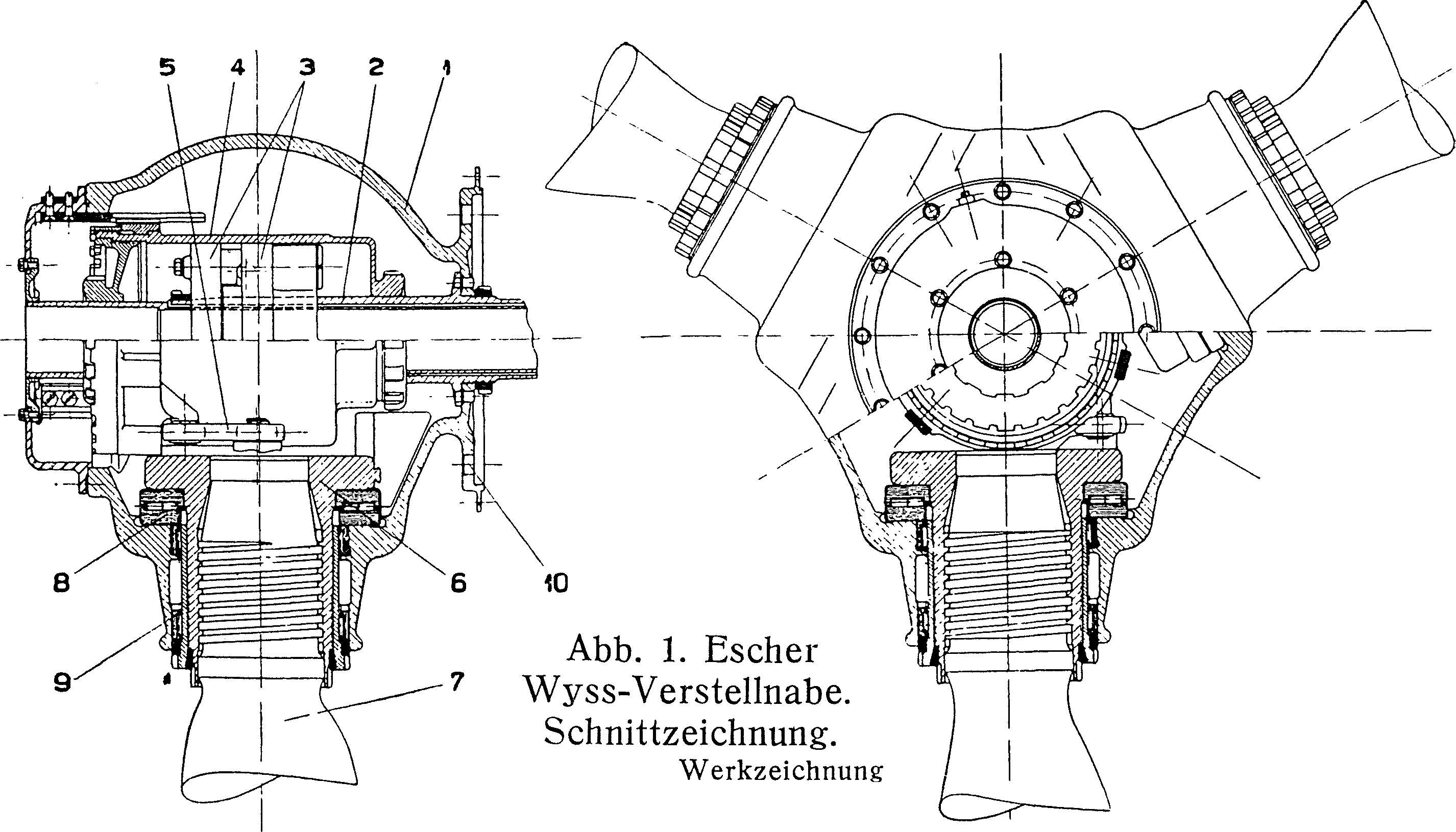
Escher Wyss-Verstellpropeller. Oben links: Abb. 2. Seitenansicht der Verstellnabe. Man sieht das innere Gewinde für die Blatthalter. — Links unten: Abb. 3. Einteiliges Nabengehäuse. — Oben rechts: Abb. 4. Der Verstellzylinder ist aus dem Nabeninnern genommen. Man erkennt die Lenkerverbindung zwischen Verstellring und Blatthalter, welche die axiale Verschiebung des Verstellzylinders in die Drehbewegung der Flügel überführt. — Unten rechts: Abb. 5. Verschiedene Blatttypen. Werkbilder
ten oder linken Seite des Verstellzylinders gelangen und diesen axial verschieben. Beim Fallen des Oeldruckes unter einen Grenzwert verhindern die eingreifenden federgespannten Blockierteile das Axialverschieben des Verstellzylinders. Das gesamte Blockiersystem wird vom Regler selbsttätig betätigt, läßt sich aber auch vom Piloten jederzeit auf Handbetrieb umschalten.
Jameson Zweitaktmotor.
J. L. Jameson von den Jameson Aero Engines Ltd., Ewell, Surrey, hat einen Vierzylinder-Reihenmotor, Zweitakt, nach verschie-
denen Versuchsbauten entwickelt. Bei seinen Versuchen zeigte sich, daß die ungünstige Leistung des Zweitakters auf nicht richtig gesteuerten Auslaß und auf ungenügende Kompression zurückzuführen ist.
Charakteristisch für die Bauart sind die sich nach oben verjüngenden Zylindermäntel, die in der Stirnansicht Dreiecksform ergeben. Ein- und Auslaß durch Schieber, die durch kleine, seitlich liegende Kurbelwellen betätigt werden.
Der Zylinderboden mit seinem konisch in den Zylinder hineinragenden Zylinderboden bildet einen umgekehrten Deflektor, wodurch für die Strömung günstige Wirbelungsverhältnisse erreicht werden.
Auf der Hinterseite des Motors befindet sich ein Lader, der mit Kurbelwellendrehzahl läuft. Auslaßschieber öffnet 50° vor unterem Totpunkt. Zündfolge der Zylinder 1, 4, 2, 3. Die ersten beiden Kurbeln sind um 180° und die beiden folgenden, gegen die vorderen um 90°, auch wieder um 180° versetzt.
Antrieb von Magnet, Wasserpumpe und sonstigem durch Stirnradgetriebe von dem hinteren Ende der Kurbelwelle aus. Drei Oel-pumpen, eine Pumpe für die Schmierung des Steuerschiebeantriebs, eine Hochdruckpumpe für die hohle Kurbelwelle durch Kurbel, Pleuel nach Kolbenlaufbahnen austretend und eine Rückförderpumpe.
Der Motor war ursprünglich für einen Rennwagen bestimmt, scheint jedoch auch für Flugzeuge experimentiert zu werden. An dem Versuchsmotor sitzt auf den Schieberwellen ein leicht regulierbares Schneckengetriebe, um Ein- und Auslaß bequem verstellen zu können.
Ein früherer Versuchsmotor hat auf der Bremse bei 4500 Umdrehungen 138 PS geleistet. Abmessungen sind nicht bekannt geworden. Geplant ist ein Acht- bzw. Sechzehn-Zylinder, Zylinder gegenüberliegend.
10 000. Flugmotor, und zwar einen Argus As 10, hat die Argus-Motoren-Gesellschaft fertiggestellt.
Flugverkehr Berlin—Kopenhagen ergab Aenderungen im Flugplan. Jetzt werktäglich ab Berlin 8.45 und 13.15 h. Flugzeit nach Kopenhagen 2% Std. Start in Kopenhagen 9.30 und 12 h. Es ist also möglich, in 23 Std. die Reise Berlin-Kopenhagen und zurück zu bewältigen, wobei der Aufenthalt in Kopenhagen 17% Std. beträgt.
KLM. hat zur Erweiterung ihres Flugzeugparkes eine holländische Subvention von 400 000 £ erhalten.
Irische Regierung bestellte in USA. 15 leichte einmotorige Bomber für 1 Million Dollar.
Luftverkehrsabkommen Ungarn-Jugoslawien für Fluglinie Budapest—Belgrad 10. 11. unterzeichnet.
Ungar. Fliegerakademie für Ausbildung des fliegerischen Nachwuchses, der Luftwaffe dienend, durch Reichsverweser Horthy 6. 11. in Kassa eingeweiht.

Inland.
Ausland.
„Aero Transport", schwed. Luftverkehrges., erhielt von der schwedischen Regierung die Genehmigung für eine Luftlinie Strecke Stockholm—Riga—Moskau. Die russische Luftverkehrsgesellschaft „Aeroflot" hat die gleiche Genehmigung erhalten.
Schwed. Militärmission bestellte bei der Republic Aviation Co., Farmingdale (USA.), 80 Flugzeuge für 2 Millionen Dollar.
Span. Luftwaffe wird ausgebaut. Nach einer Verfügung des spanischen Luftministers General Yague wird neben den fliegenden Verbänden eine besondere Erdtruppe für die Luftwaffe zur Verteidigung und Bemannung der Flugplätze gebildet. Gliederung in 5 Regimenter unter der Bezeichnung Legionen mit den Standorten Madrid, Sevilla, Valencia, Saragossa und Valladolid. Weiterhin werden besondere Bataillone auf den Ballearen, den Kanarischen Inseln und in Marokko gebildet. Ein besonderes Bataillon für Fallschirmspringer ist in der Bildung begriffen. Die Ausbildung des Offiziersnachwuchses erfolgt in Zukunft in einer Luftakademie.
404,430 km/h über 5000 km flogen die Sowjetflieger Nikolai Schebanow und Matverger. Sie flogen in 12 Std. 30 Min. 58 Sek. 5068 km. Weltrekord bisher 400,816 km.
Pan-American-Luftverkehrsgesellschaft. Urnorganisation Anfang des Jahres ergab folgende Aenderungen: Mr. Cornelius Vanderbilt Whitney oberster Chef und Leiter der politischen Angelegenheiten der Gesellschaft mit Washington; Mr. Juan Trippe, Präsident der Gesellschaft, Leiter der Pacifik- und Atlantik-Abteilungen: George Rihl, Vice-Präsident, Leiter aller amerikanischen Betriebe in Central-, Südamerika und der Karibischen See; John Cooper jr. Assistent bei Whitney.
Seversky Aircraft Corporation, Farmingdale (N. Y.), laut Gesellschaftsbeschluß in „Republic Aviation Corporation" umgeändert. Seversky ist aus der Gesellschaft ausgeschieden, die jetzt einen Militärauftrag für Jagdflugzeuge von 3 478 000 Dollar erhalten hat.
USA-Militär-Aufträge erhielten Pratt & Whitney für Motore für 929 074 Dollar und für 56 250 Dollar, Fairchild für Schulflugzeuge 1 579 338 Dollar, Ryan für Schulflugzeuge STA-1 19 350 Dollar, General Elektric für Funkausrüstung für 2 678 852 Dollar, Pioneer Instrument für 506 710 Dollar, Wright Aeronautical für Motorteile für 50 824 Dollar, Curtiss Airplane für 5 000 000 Dollar, Sperry Gyros-cope für 1 765 157 Dollar, Consolidated Aircraft für 8 485 000 Dollar für viermotorige Bomber, Boeing Aircraft für viermotorige Bomber für 8 000 000 Dollar, Glenn Martin für Bomber 15 815 000 Dollar, North American für Bomber für 11 771 000 Dollar, Vultee für Schulflugzeuge für 2 986 00 Dollar, Lockheed Aircraft für zweimotorige Jagdflugzeuge (Lockheed P-38), für 4 845 000 Dollar, United Aircraft für Motore für 12 320 000 Dollar, Wright Aeronautical für Motore für 7 000 000 Dollar, Allison Engine für Motore 2 275 000 Dollar, Aviation Corporation Lycoming für Motore für 270 000 Dollar, Bell Aircraft für einmotorige Jagdflugzeuge für 2 839 000 Dollar.
USA Hochgeschwindigkeitsprofil soll nach Pressemitteilungen von NACA, Langley Field, entwickelt worden sein. Man hofft günstigenfalls dadurch 800 km Geschwindigkeit zu erreichen. Man will das Luftabfluß—Phänomen, wobei das Wirbelabreißen der Geschwindigkeit eine Grenze setzt, geklärt haben. Gleichzeitig spricht man von Nur-Flügelflugzeugen, wo der Rumpf wegfällt und die Motore in den Flügeln liegen. Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß wir hier in Deutschland bei Rumpfmaschinen bereits 746,66 km Geschwindigkeit erreicht haben.
USA Curtiss P 42 Jagdeinsitzer mit
1000 PS-Motor auf
* dem Wrightfield in
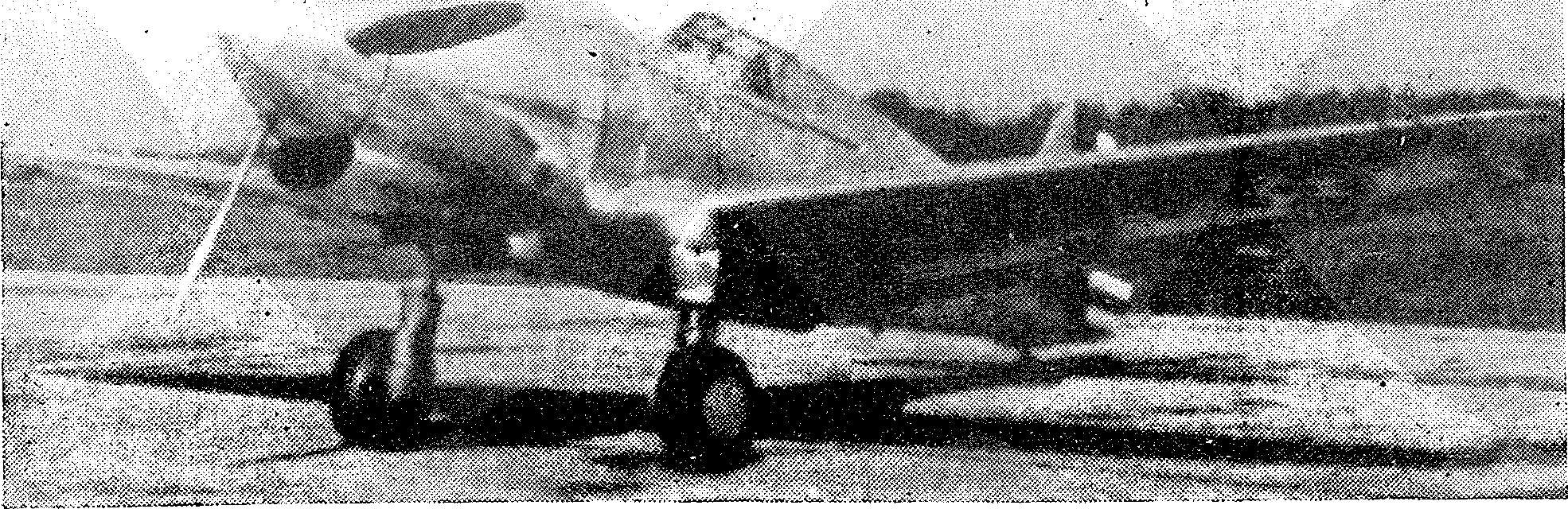
Dayton, Ohio. Vgl. Notiz „Flugsport" 1939, S. 555. Fahrwerk und Flügel unverändert. Charakterist.: Dicke Rumpfnase, darunter Flüssigkeitskühler.
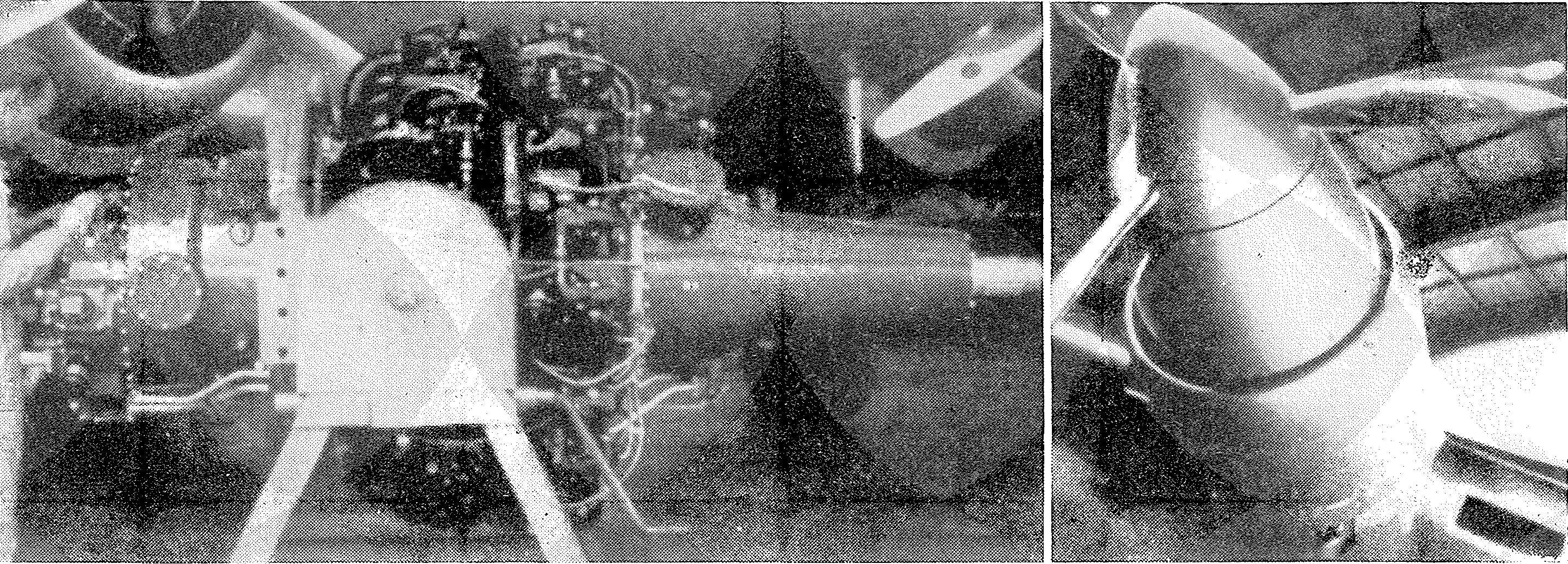
Pratt & Whitney „Double Wasp", 18 Zyl., 1600 PS, mit Lader und um 75 cm verlängerter Schraubenwelle. Bilder: Aviation
1800 km im Wasserflugzeug, 2. Kat., Aeronca mit 60 PS Continental, von New York nach Neu-Orleans in 13,30 Stunden flog Henry Chapman. Bisheriger Rekord wurde von Dewitt Eldred auf Taylorcraft mit Lycoming 50-PS-Motor von Port-Washington nach Halifax River mit 1451 km am 7. 1. 1939 aufgestellt.
Pratt & Whitney „Double Wasp" ist ein Höhenmotor mit 18 Zyl. zweireihig und machte seinen 150-Stundenlauf. Der Motor leistet 1600 PS in 6000 m Höhe. Die Neuerung besteht in einem Lader vor dem Vergaser geschaltet. Der Sterndurchmesser des Motors beträgt 1,3 m. (Der Curtius Wright 2000 PS hat bekanntlich 1,4 m.) Neuartig ist die Kühlhaube mit verhältnismäßig kleinen Ringschlitzen und die ca. 90 cm vorn liegende Luftschraubenhaube. Der Luftdurchlaß um den Motor ist je nach der Geschwindigkeit des Flugzeugs regulierbar. Der Motor ist in einem Vultee-Jagdflugzeug und einem Curtiss P 41 zu Versuchen eingebaut.
Luftwaffe.
2.—5. 11. 39. Oberk. d. Wehrmacht keine Bekanntmachungen über Luftwaffe.
Berlin, 6. 11. 39. Oberk. d. Wehrmacht: In der Gegend von Saarburg wurde durch deutsche Jäger ein französisches Flugzeug abgeschossen.
Berlin, 7. 11. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Im Luftkampf wurden ein britisches Flugzeug bei Mainz und zwei französische Flugzeuge bei Saarlautern abgeschossen.
Berlin, 8. 11. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Bei Luftkämpfen über deutschem Hoheitsgebiet wurden am 7. November ein britisches Flugzeug in der Nähe der Wuppermündung, ein französisches Flugzeug bei Völklingen sowie drei weitere feindliche Flugzeuge bei Saarlautern abgeschossen. Innerhalb der ersten sieben Tage des Monats November sind neun feindliche Flugzeuge durch unsere Abwehr zum Absturz gebracht worden, während die eigenen Verluste im gleichen Zeitraum zwei Flugzeuge durch Abschuß betragen. Drei weitere Flugzeuge werden vermißt.
Durch Flakbeschuß zertrümmerte Kielflosse eines Sturzkampfflugzeuges Junkers-Ju 87. Die Maschine ist mit dieser Verletzung noch 120 km geflogen und dann glatt gelandet.
Bild JFM - Fr. OKW.
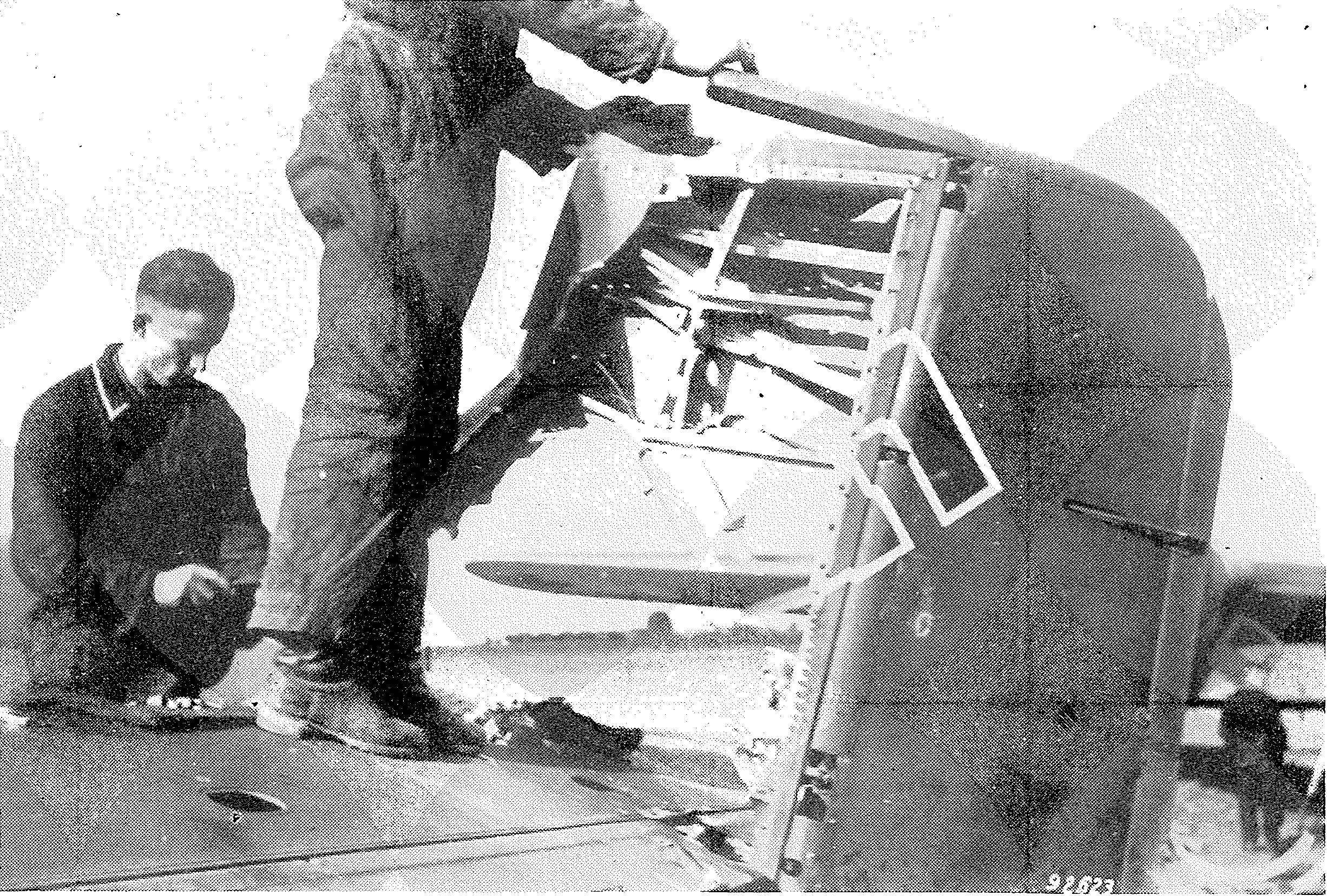
Berlin, 9. 11. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Zahl der am 7. November zum Absturz gebrachten feindlichen Flugzeuge hat sich von fünf auf sieben (darunter ein britisches) erhöht. Im Laufe des 8. November wurden zwei französische Flugzeuge abgeschossen, zwei feindliche Fesselballone durch deutsche Jäger zum Absturz gebracht. Ein deutsches Flugzeug vermißt.
Berlin, 10. 11. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Das am 8. November als vermißt gemeldete deutsche Flugzeug ist bei Liedersdorf an der deutsch-französischen Grenze von französischen Jägern abgeschossen worden.
Brüssel, 10. 11. 39. Ein englisches Flugzeug ist heute auf belgischem Gebiet in der Nähe von Courtrai, nahe der französischen Grenze, wie die Agentur Belga meldet, gelandet. Das Flugzeug wurde beschlagnahmt, die Besatzung interniert.
Berlin, 11. 11. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Ein französischer Fesselballon wurde bei Kolmar durch ein deutsches Jagdflugzeug abgeschossen.
12. u. 13- IL 39. Oberk. d. Wehrmacht keine Bekanntmachungen über Luftwaffe.
Berlin, 14. 11. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Trotz ungünstiger Wetterlage unternahm am 13. November ein deutscher Kampffliegerverband einen Angriffsflug gegen die Shetland-Inseln. Hierbei wurden zwei Flugboote zerstört. Ein vermutlicher Treffer gegen einen englischen Kreuzer konnte mit Sicherheit nicht beobachtet werden. Die eigenen Flugzeuge kehrten sämtlich wohlbehalten wieder zurück.
Brüssel, 15. 11. 39. Drei englische Flugzeuge haben am Dienstagnachmittag (14. 11.) belgisches Gebiet in der Nähe der belgisch-französischen Küste überflogen. Ein Apparat ist in Caxyde niedergegangen, ein zweiter in La Panne und der dritte nahe der französischen Grenze. Die Flieger erklärten, sie hätten geglaubt, sich über Frankreich zu befinden.
15.—17. 11. 39. Oberk. d. Wehrmacht keine Bekanntmachungen über Luftwaffe.
London, 17. 11. 39, (DNB.) Das englische Luftfahrtministerium hat eine neue Verlustliste veröffentlicht, die 51 Namen enthält, und zwar wurden 38 Mann getötet, 11 werden vermißt, 2 wurden gefangen genommen.
Berlin, 18. 11. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Der Versuch dreier britischer Flugzeuge, Wilhelmshaven anzugreifen, wurde durch rechtzeitig einsetzende Abwehr vereitelt. Bomben wurden nicht abgeworfen. Eigene Flugzeuge klärten über dem gesamten französischen Raum auf.
Berlin 18. 11. 39- Die Luftwaffe setzte ihre Aufklärungstätigkeit über Frankreich fort.
Kriegssegelfluglehrgänge des NSFI<. bei den Gruppen sind schon teilweise beendet. Vor allem ist hier den Anfängern Gelegenheit gegeben, in der jetzigen Zeit zu schulen.
Meisterprüfung im Segelflugzeugbauerhandwerk bestanden vor der Handwerkskammer Breslau Erich Scharfenberg und Walter Braun.
Kanadische Flying Clubs Association neu gegründet, umfaßt sämtliche Segelflugclubs in Kanada und ist jetzt Mitglied der F. A. I. Die einzelnen Clubmitglieder können nun auch endlich offizielle Segelflugausweise erhalten.
Ital. Dauersegelflugrekord wurde von Gada mit 9 h 10 min aufgestellt.
Orangefarbenen Anstrich für Verkehrsflugzeuge ab Dezember haben folgende neutrale Luf t v e r k eh r s g es eil s ch af t en beschlossen: Holländische K L M, belg. Sabena, schwed. ABA.
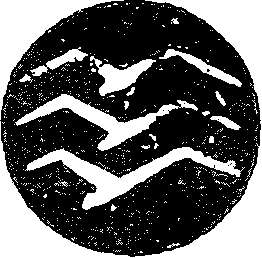
Segelflug
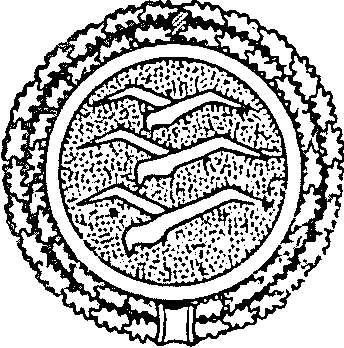
Einstell-Luftschraube, Blätter nur bei Stillstand einstellbar. Verstell-schraube, Blätter im Fluge verstellbar. Man unterscheidet Zweistellungsschraube, Blattsteigimg nur für zwei Stellungen (Hamilton). Viel-Stellungsschraube, Verstellung in jede beliebige Steigung (VDM).
Glycolkiihlung. Kühlflüssigkeit statt Wasser wird Glycol, welches höhere Siedetemperatur, benutzt. Ermöglicht kleinere Kühler mit geringerem Luftwiderstand.
Einspritzen des Betriebstoffes statt Vergasen. Behandlung dieser Frage folgt in der nächsten Nummer.
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Lustige Fliegerfibel v. Major Albert Kropp. Verlag „Offene Worte", Berlin W 35. Bebildert von Feldwebel Baumbach. Preis RM 1.—.
Fliegerhorstleben im Fliegerlatein / Behandelt Kropp in Versen so fein. 1 Das Buch ist gut, / Macht Lust und Mut! /
Wind, Sand und Sterne v. Antonie de Saint Exupery. Originaltitel: Terre des Hommes. Deutsche Uebersetzung. Henrik Becker. Karl Rauch Verlag, Markkleeberg-Ost bei Leipzig. Preis RM 5.50.
Verfasser, ein bekannter französischer Verkehrsflieger, hat dieses Buch seinem Fliegerkameraden Henri Guillaumet gewidmet. Das vorliegende Buch hat sich mit einem Schlage in der französischen Literatur durch seine wirklich dichterische Gestaltung des Flugerlebnisses an die Spitze gestellt. „Flugstrecke, Kameraden, Naturgewalten, Oase, Wüste, Durst", lassen bei der Ueberwindung der Schwierigkeiten in der Luft in dem heutigen Zeitalter der Technik nicht nur die Größe des Menschen als solche erscheinen, sondern sind auch eine Würdigung der Leistung des Verkehrsfliegers.
Liederbuch der Luftwaffe, her aus g. v. Carl Clewing u. Hans Felix Husadel mit Genehmigung d. RLM. Verlag Chr. Friedrich Vieweg, Berlin-Lichterfelde. Preis RM 1.40.
Enthält die großen Hymnen, Feldchoräle, Lieder auf Führer und Vaterland, Fliegerlieder, soldatische Weisen, Marschlieder. Die Lieder sind alle mit Noten (Singstiminen) versehen.
Das Buch der Spanienflieger. Feuertaufe der neuen deutschen Luftwaffe. Von Wulf Bley, Hauptmann. 18 Abb., 248 S. v. Hase & Koehler Verlag, Leipzig. Preis RM 2.85.
Die freiwilligen Flieger in Spanien haben unter Einsatz ihres Lebens die Leistungsfähigkeit der deutschen Flugzeuge unter schwierigsten Verhältnissen erprobt und die Feuertaufe erhalten. Verfasser läßt in diesem Buch bekannte Teilnehmer — Frhr. v. Richthofen, Frhr. v. Houwald, v. Moreau f — und viele andere Helden sprechen, die in ihrer Gesamtgruppierung ein Bild von der Legion Condor geben.
Fernmelde-Unterrichtslehre. Ein Leitfaden für alle Nachr.-Abt. d. Wehrm., Behörden, Zivilinstitute und Kurzwellenfreunde, f. d. Nachrichtenführer sowohl als auch für den Lehrer und Schüler, von Rudolf Grötsch. 140 S-, 25 Abb. Verlag Deutsch-Literar. Inst. J. Schneider, Berlin-Tempelhof. Preis RM 3.50.
Aufgabe der vorliegenden Anleitung ist, alles das zu vermitteln, was im Unterricht, im Hören und Geben der Morsezeichen, Aufgabe und Annahme an der Tastaturmaschine, Funk-, Fernsprecher- wie Lautsprecheransage notwendig ist, enthält ferner eine Anleitung zum mikrophongerechten Sprechen. Eine wirklich brauchbare, unerläßliche Anleitung für die Praxis.
Die Photozelle in der Technik. Von Dr. Heinrich Geffcken u. Dr. Hans Richter. 96 S-, 122 Abb. u. 6 Taf. III. Auflage. Verlag Deutsch-Literar. Inst. J. Schneider, Berlin-Tempelhof. Preis RM 2.50.
Lichtelektrische Steuerungen und anderes sind schon vielfach im Flugwesen versucht worden und für viele nichts Unbekanntes. Indessen fehlte es an einem einfachen Wegweiser für alle, die sich zum erstenmal auf dieses neue Gebiet begeben. In der heutigen Zeit sollte jeder Ingenieur, Forscher und technische Betriebsleiter sich mit dieser Materie vertraut machen.
Heft 25/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro Vi Jahr bei Htäglichem Erscheinen RM 4.50
Telei.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlunsen. Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit ..Nachdruck verboten" versehen. _nur mit genauer Quellenangabe gestattet.__
Nr. 25 6. Dezember 1939 XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 20. Dez. 1939
Nervosität.
Die Schläge unserer Luftwaffe mit denen der U-Bootwaffe haben in England überrascht. Mit Englands Beherrschung der Nordsee ist es aus. Die „great fleet" wurde in den entferntesten Schlupfwinkeln aufgestöbert.
Zur Zeit macht man sich Sorgen, wie es noch im Atlantik werden wird. „Flight" erinnert in seiner Nr. vom 2. 11. im Leitartikel daran, welche ungeheuren Kosten und Aufwand von Schiffen im Weltkrieg die Jagd auf die Emden verursacht habe. Man solle sich doch entschließen, an Stelle von Ozean-Verkehrsflugzeugen große bewaffnete Langstreckenflugzeuge zu bauen, welche die deutschen Seestreitkräfte in allen Ecken des Atlantik aufspüren könnten. Man könnte sich denken, schreibt „Flight" weiter, mit Langstreckenflugzeugen, System Mayo Composite, auf die feindlichen Kreuzer Jagd zu machen. Anschließend daran wird jedoch gesagt, daß der Mercury nicht passend sei. Es müsse doch möglich sein, in nicht zu langer Zeit eine veränderte Bauart mit mindestens 4000 Meilen Reichweite herauszubringen.
Mit mehreren solcher Einheiten, die von einem Mutterflugzeug gestartet werden können, wäre es doch sicher möglich, einen großen Raum des Ozeans zu überwachen.
Das Nachfüllen von Betriebsstoff im Fluge, nach System Cobham, wäre auch noch eine Möglichkeit, um den Aktionsradius zu vergrößern.
Weiter beschwert sich „Flight" über den geringen Komfort in den Flugzeugen. Englische Besatzungen berichten von Erkundungsflügen über Deutschland, daß die große Kälte sie zwang, vorzeitig ihr Ziel aufzugeben und zu ihrer Basis zurückzukehren. Es war ein Glück, daß sie nicht angegriffen wurden, denn sie hätten nicht hundertprozentig kämpfen können, denn niemand kann sein Bestes hergeben, wenn er vor Kälte erstarrt ist. Nicht nur körperlich ist er verhindert, seine Pflicht zu erfüllen, sondern auch seelisch kann man nicht vom ihm verlangen, jenen sekundenschnellen Entschluß zu fassen, der so oft entscheidet zwischen Sieg und Besiegtsein.
Heinkel He 60.
Sehr stark gestaffelter Doppeldecker, katapultfähiges See-Am-klärungsflugzeug, wird auch als Bordflugzeug verwendet, für zwei Mann Besatzung.
Flügel einstielig, halbfreitragend, mit etwas größerem Oberflügel, in Holzbauweise mit Stoffbespannung. Querruder an Ober-und Unterflügel.
Rumpf Stahlrohrfachwerk, geschweißt, stoffbespannt.
Höhenleitwerk gegen Rumpfunterkante abgestrebt und gegen Seitenflosse verspannt. Höhen- und Seitenruder ausgeglichen. Hydro-naliumbauweise mit Stoffbespannung.
Schwimmer einstufig, mit Schotten unterteilt. Metallbauweise mit Wasserruder.
Motor BMW VI 12 Zylinder V-Form, wassergekühlt.

Heinkel He 60 See-Aufklärungsflugzeug. Werkbild
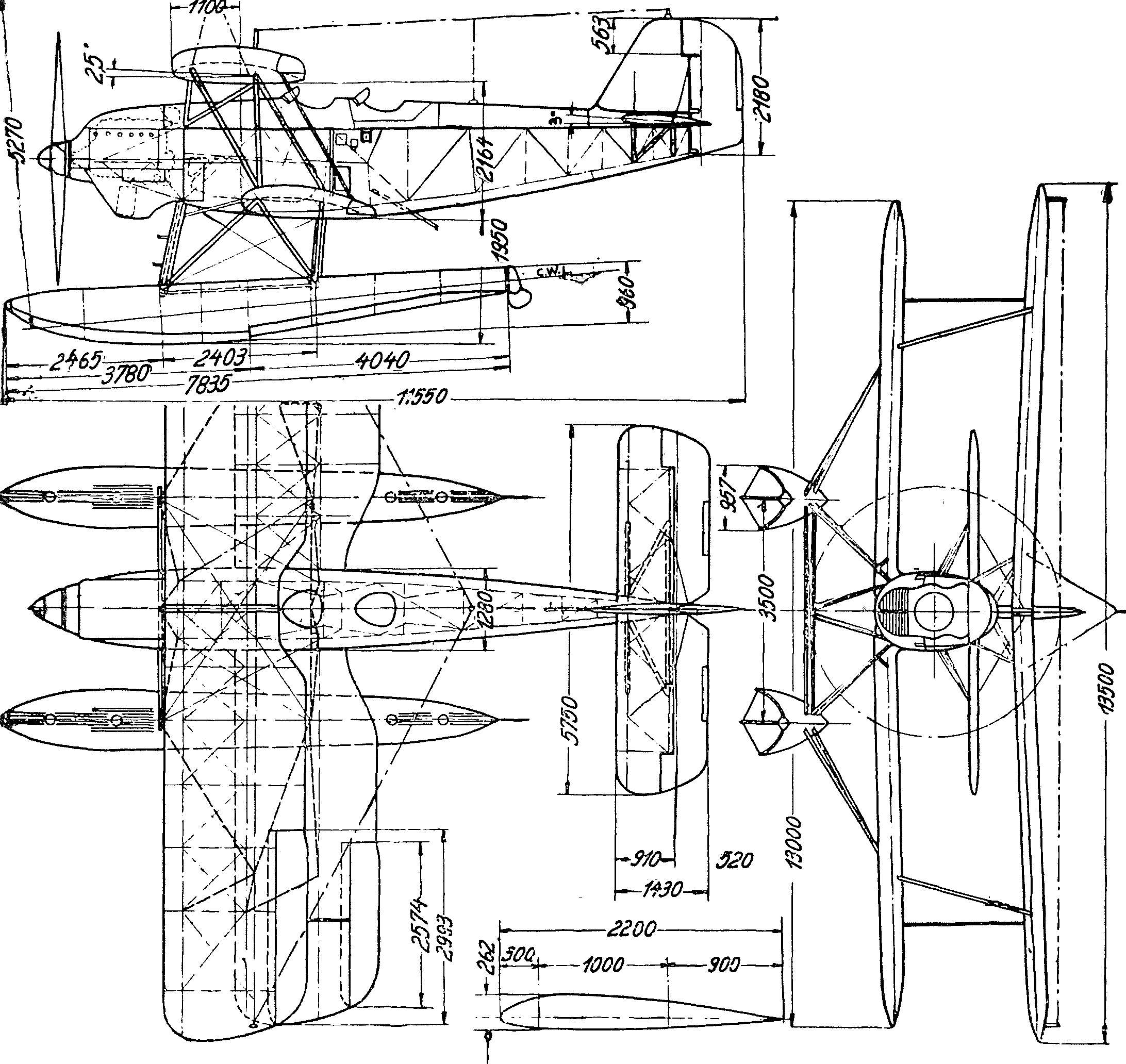
Spannweite 13,5 m, Länge 11,5 m, Höhe 5,3 m, Flügelinhalt 56,2 m2, Rüstgewicht 2775 kg, Zuladung 625 kg, Fluggewicht 3400 kg. Flächenbelastung 60,5 kg/m2, Leistungsbelastung 5,15 kg/PS. Flächenleist. 11,76 PS/m2. Höchstgeschwindigk. 240 km/h, Landegeschwindigkeit 90 km/h. Steigzeit auf 1000 m 3,2 Min., 2000 m 7,5 Min., 4000 m 20 Min. Dienstgipfelhöhe 5000 m.
Heinkel He 60 See-Aufklärungs-Flugzeug.
Werkzeichrmng
. Heinkel He 59.
Mehrzwecke-Seeflugzeug für 3—4 Mann Besatzung. Zwei-stieliger verspannter Doppeldecker mit zwei Motoren BMW VI 650 PS und Doppelschwimmern in Gemischtbauweise.
Ober- und Unterflügel gleiche Spannweite und gleiche Profiltiefe. Flügelenden stark abgerundet. Oberer Flügel drei-, unterer vierteilig. Anordnung der Streben vgl. Uebersichtszeichnung. Flügel Stoffbespannung, Flügelnase und begehbare Flächen mit Sperrholz beplankt. Querruder an Ober- und Unterflügel.
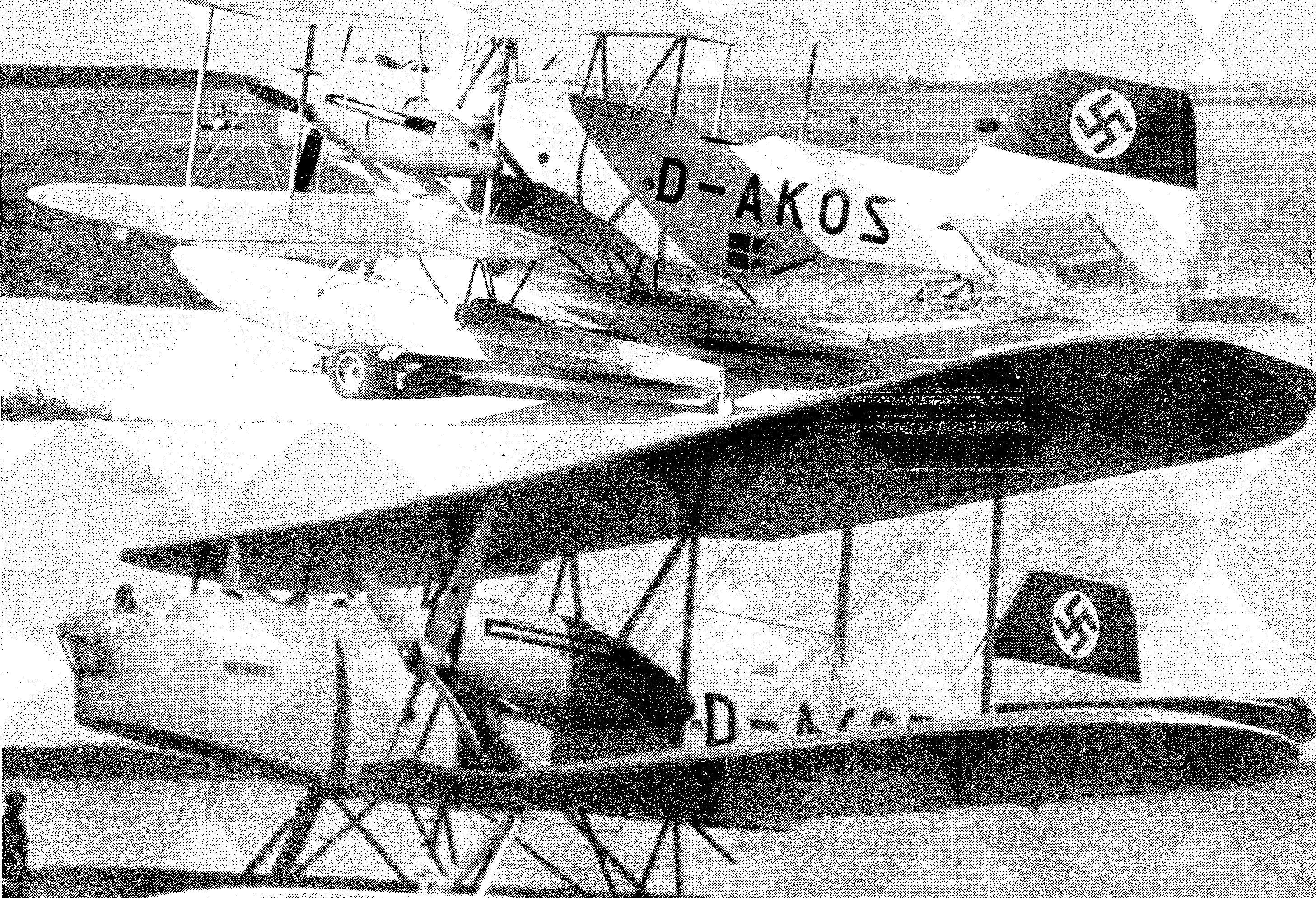
Heinkel Rumpf Stahlrohr, schweißt, Kanzel aus Hy dronalium-U- und -Z-Profilen vernietet. Rumpf zur Formgebung teilweise mit Leichtmetall beplankt, teilweise Stoffauflage.
Leitwerksgerüst Hydro-nalium. Höhenflosse durch Doppelstreben an Unterkante Rumpf abgefangen, Höhen-und Seitenruder ausgeglichen mit Trimmklappen. Flossennasen mit Blech, Leitwerksteile mit Stoff überzogen.
Zwei Schwimmer, Metallbauweise, Schwimmergestell Stahlrohrstreben. Schwimmer einstufig mit hochgezo-
Heinkel He 59 Mehrzwecke-Seeflußfzeug.
He 59 Mehrzwecke-Seeflugzeug.
Werkbilder
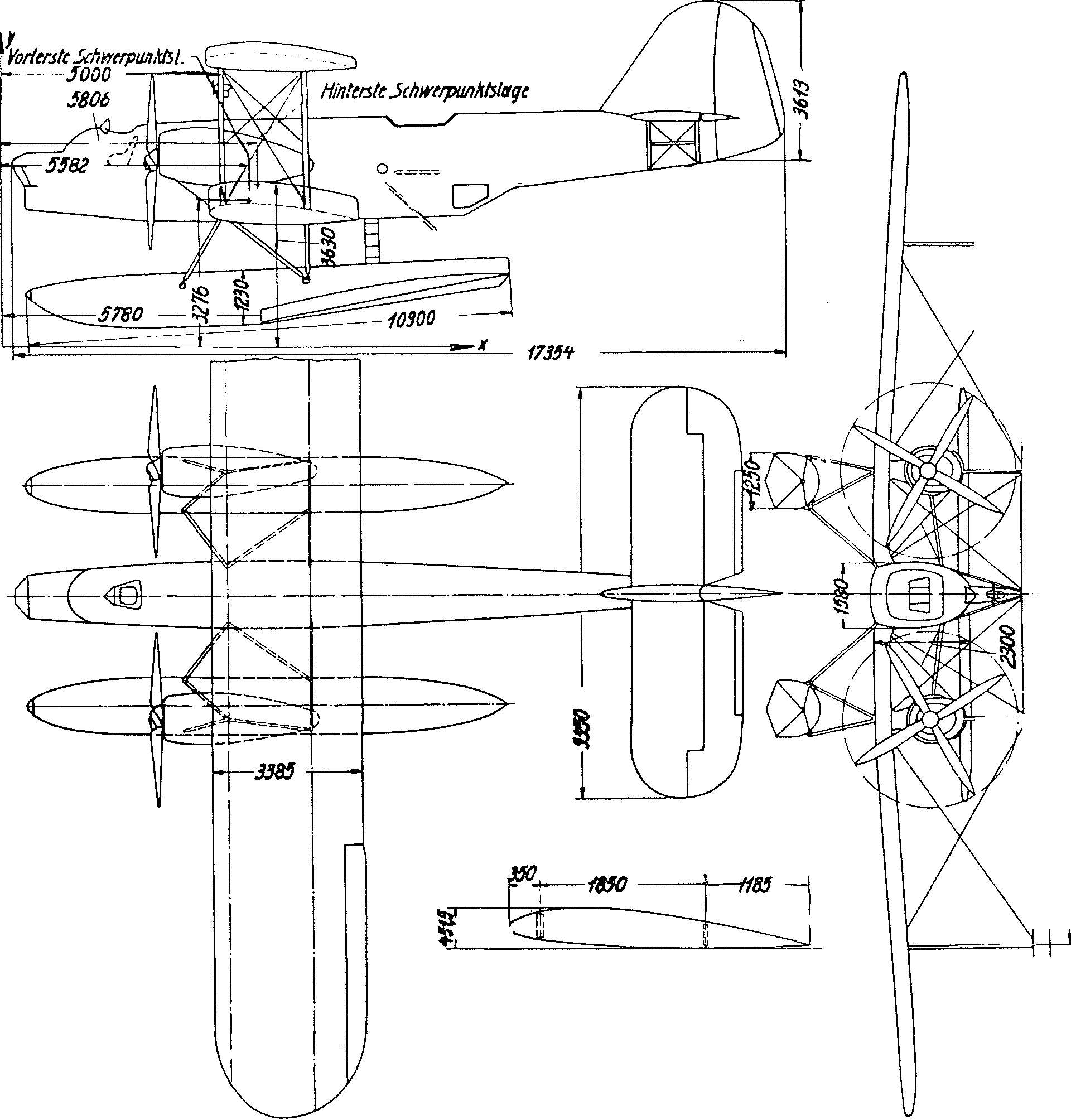
genem Heck, durch Schotten in 8 Räume unterteilt, im mittleren Kraftstoffbehälter untergebracht.
Spannweite 23,7 m, Länge 17,4 m, Höhe 7,1 m, Flügelinhalt 153,2 m2. Rüstgewicht 6215 kg, Fluggewicht 9000 kg. Flächenbelastung 58,8 kg/m2, Leistungsbelastung 6,82 kg/PS, Höchstgeschw. 220 km/h, Landegeschw. 87 km/h, Steigzeit auf 1000 m 4,8 Min., Gipfelhöhe 3500 m.
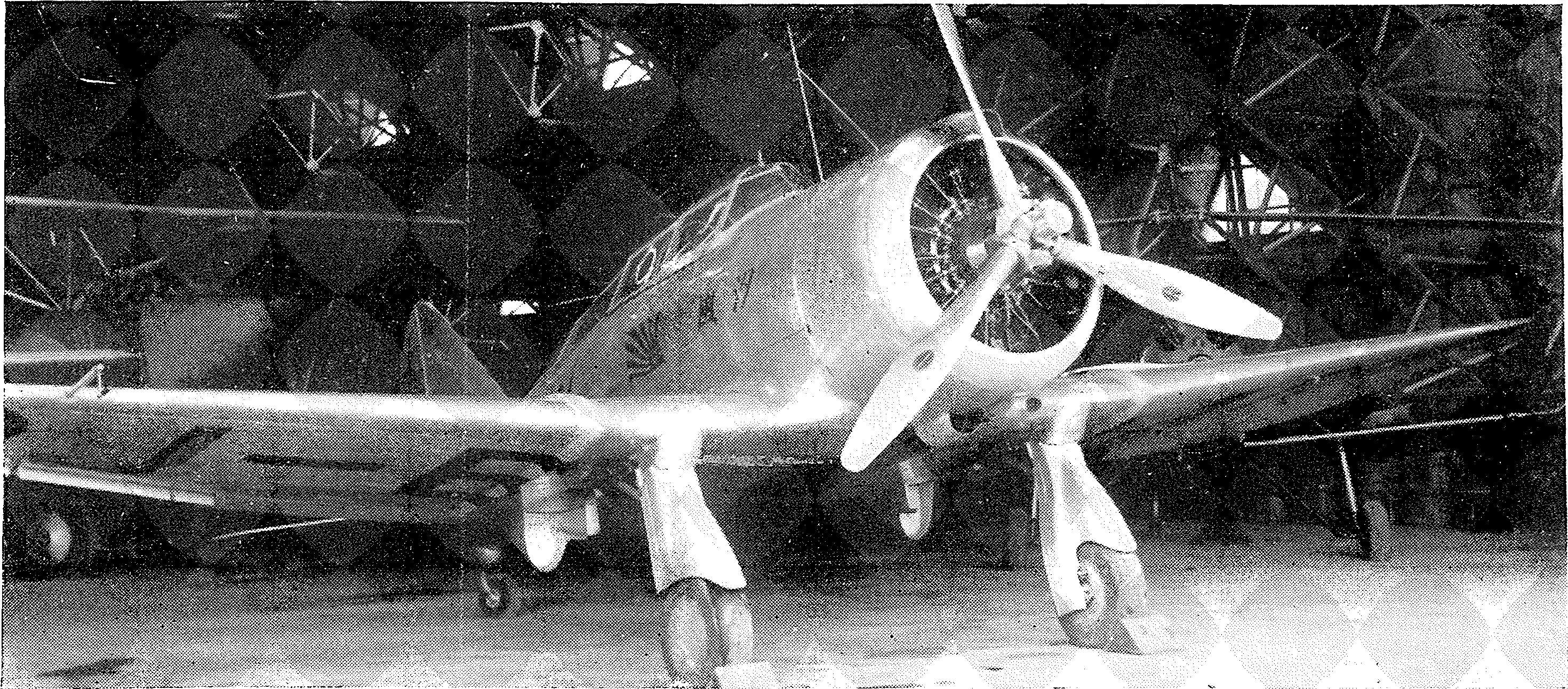
Mitsubishi Kinsei 900 PS. Hochgeschwindigkeits-Nachrichtenflugzeug. Zweisitzig.
Wird auch im Zeitungsdienst verwendet. Archiv Flugsport
LeistungsvergleichzwischenEinspritz-u.Vergasermoton
Zur Steigerung der spezifischen Motorleistung bedarf es der sorgfältigen Untersuchung aller Faktoren, die den Gesamtwirkungsgrad beeinflussen können. Ein wichtiger Vorgang ist die Mischung von Kraftstoff und Luft, der im folgenden unter Benutzung neuerer amerikanischer Versuchsergebnisse*) behandelt werden soll, wobei drei Methoden der Gemischbildung untersucht wurden.
Zur Gemischbildung im Motor können die nachstehenden drei Methoden herangezogen werden: 1. Vergaser, 2. Sammler-Einspritzung, 3. Zylinder-Einspritzung. Von besonderem Interesse sind die Einflüsse dieser drei Verfahren auf die Leistung und den spezifischen Kraftstoffverbrauch.
Das Mischungsverhältnis von Kraftstoff und Luft umfaßte bei diesen Versuchen einen Bereich von 0,10 bis zum kleinstzulässigen Wert, Drehzahlen von 1500 und 1900 U/min. Die Versuche mit einem Mischungsverhältnis von 0,08 wurden bei Drehzahlen von 1300 bis 1900 durchgeführt. Für die Einzylinderversuche fand ein normaler Wright 1820-G-Zylinder Verwendung; Bohrung 155,6, Hub 177,8, Verdichtungsverhältnis 7,2. Der Strombergvergaser NAL 5 wurcb bei Sammler- und Zylindereinspritzung durch ein gerades Ansaugrohr ersetzt. Die Düse mit einem Oeffnungsdruck von 21 kg/cm2 war konzentrisch im Sammler angeordnet, etwa 180 mm vom Einlaßventil entfernt. Brennstoffeintritt entgegen dem Luftstrom. Oeffnungsdruck der Zylinder-Einspritzdüse 141 kg/cm2. Brennstoffpumpe Compur. Oktanzahl des Kraftstoffes 100.
Bei Zylindereinspritzung wurden dann die günstigsten Ergebnisse erzielt, wenn die Düse zwischen den Auspuffventilen lag; ebenso günstig wäre eine zentrale Lage der Düse im Zylinderkopf. Der Kleinstwert des Kraftstoffverbrauchs wurde bei Einspritzung unmittelbar im oberen Totpunkt beobachtet, 60° nach dem unteren Totpunkt (Verdichtungshub) stieg er merklich an. Im allgemeinen ist der Kraftstoffverbrauch dem Oeffnungsdruck der Einspritzdüse umgekehrt verhältig, besonders im Bereich später Einspritzung, d. h.
*) NACA Report 471, NACA T.N. 583, 688.
während des Verdichtungshubes. Bei der Sammlereinspritzung blieb der Zeitpunkt der Einspritzung ohne Einfluß.
In Abb. 1 ist der mittlere effektive Druck und der volumetrische Wirkungsgrad über der Drehzahl aufgetragen worden. Mit Ausnahme des Bereiches kleiner Drehzahlen folgt der mittlere effektive Druck dem volumetrischen Wirkungsgrad; letzterer erreicht bei Zylindereinspritzung seinen Höchstwert. Allgemein steigt der volum. Wirkungsgrad bei Zylindereinspritzung mit wachsender Drehzahl, demgegenüber ist bei Gemischbildung durch Sammler- und Vergasereinspritzung ein Abfall festzustellen. Bei n = 1900 sind die entsprechenden Werte 92.5% und 86%. Ueberraschend ist, daß der volum. Wirkungsgrad bei Sammlereinspritzung wesentlich kleiner bleibt. Dies wird seine Ursache in der Verdampfung eines Teiles des Gemisches haben, wodurch das Volumen der Ladung ansteigt. Darüber hinaus wird dem Gemisch noch Wärme entzogen, und zwar einmal durch die Verdampfung selbst und zum anderen beim Passieren der Einlaßventile. Bemerkenswert ist ferner, daß der volum. Wirkungsgrad bei Vergaserbetrieb besser ist.
Der spezifische Kraftstoffverbrauch ist nach Abb. 2 für alle drei Verfahren bis zu einem Kraftstoff-Luftverhältnis von 0,07 gleich, erst bei mageren Gemischen steigt er für Zylinder- und Sammlereinspritzung an. Bei höheren Drehzahlen sind diese Unterschiede noch stärker ausgeprägt. Der mittlere effektive Druck steigt bei kleiner werdenden Kraftstoff-Luftgemischen zunächst an, um darauf stark abzufallen. Der volum. Wirkungsgrad erreicht bei 0,7 bis 0,075 seinen Kleinstwert, um auf beiden Seiten dieses Punktes wieder anzusteigen. Die Zylindertemperaturen blieben bei allen drei Methoden gleich.
Abb. 1. Aenderung der Motorleistung und des volumetrischen Wirkungsgrades mit der Drehzahl. Kraftstoff-Luftverhältnis 0,08.
Zeichnung Flugsport
J00
\
*90
§
^ 80 |
)13
l'2
.11
10
-Vergaser
----lyt. -Einspritz ung
---Samml.-Einspritzung
Abb. 2. Aenderung der Motorleistung, des volumetrischen Wirkungsgrades und des spezifischen Kraftstoffverbrauches mit dem Kraftstoffstoff-Luftverhältnis. Drehzahl 1500 U/min. 12
I
90
80
260
210
220
200
1000 1200 MO 1600 1800 Drehzahl U/min
2.000
|
" - ^ |
\ |
||||
|
~-- |
V \ |
||||
|
gebrems |
\ \ \ A \ |
||||
|
\\\ |
|||||
|
\ |
|||||
|
\ |
|||||
|
\ |
I |
||||
|
\ |
gebremst |
/ |
|||
|
/ / |
/ |
||||
0,10 0,09 008 0,07 0,06 0,05 Kraftstoff -L uft Verhältnis
0,0+
Heizluftstrahltriebwerke. — Die Turbo-Luftschraube.
In den ersten vier Heften des „Flugsport" d. J. ist über Vorschläge berichtet worden, die sich bemühen, Luftstrahltriebwerke, deren einzig brauchbarer Vertreter bisher die Luftschraube ist, durch Heiz luftstrahltrieb werke zu ersetzen, d. h. Wärmeenergie nicht über mechanische Einrichtungen schiebender und drehender Art (Motor und Schraube) in die Bewegungsenergie des Rückdruck erzeugenden Luftstrahles umzusetzen, sondern sie die Luft unmittelbar beschleunigen zu lassen. Das hierzu erforderliche Gerät besteht im wesentlichen aus einem Durchgangskörper, der zuströmende Luft verdichtet, beheizt und entspannt,
Es hat aber auch nicht an Vorschlägen gefehlt, derartigem Gerät nur eine mittelbare Rolle zuzuweisen, d. h. es als motorisches Element einem Luftstrahlerzeuger zuzuordnen, also ein Gebilde zu schaffen, das Gasturbine und Luftschraube zugleich ist").
Eine durch Heizstrahlgeräte an den Flügelenden angetriebene Luftschraube war Ziel einer ganzen Reihe von Erfindern mit im Flugwesen bekannten Namen: Farman, Bleriot und Pescara in Frankreich, Isacco in Italien, Goddard und Sikorsky in Amerika und Helmut Hirth und Dornier in Deutschland haben sich mit dem vorerwähnten oder ähnlichen Problemen befaßt, ohne daß es allerdings bisher zu einer praktisch anwendbaren Lösung gekommen wäre. Unter ähnlichen Problemen sind die Bestrebungen zu verstehen, Luftschrauben durch an den Flügelenden-Hinterkanten austretende Druckluft oder Motorabgase ganz oder zum Teil zu betreiben. Für die Abgasverwertung in solcher Weise spricht der Vorteil eines besseren motorischen Wirkungsgrades, den der Unterdruck an der Flügelaustrittsstelle (und damit auch hinter den Motorkolben) bringt; doch hat man der Baustoff-Schwierigkeiten, die bei der Durchleitung heißer Gase durch die Schraubenwelle an der Lagerung auftreten, nicht Herr werden können. Mit der als gelöst anzusehenden Abgasverwertung sowohl durch Aufladerturbinen als auch neuerdings durch Auspuff Schubdüsen sind bessere Wege gefunden worden. Bei den Heizstrahltriebwerken an den Flügeln der sogenannten Turbo-Luftschraube hat man keine heißen Gase, sondern nur Brennstoff, Zündstrom und Regelgestänge vom Rumpf her überzuleiten, was keine großen Schwierigkeiten bereitet. Die Verbrennungs- und Zusatzluft tritt an der Schraubenvorderseite ein.
Zwei Vorteile sind es in erster Linie, die zur Entwicklung derartiger Triebwerke anreizen:
Am Schraubenumfang herrscht stets die größte am Flugzeug vorhandene Relativgeschwindigkeit zur umgebenden Luft. Da man im allgemeinen sagen kann, daß der Wirkungsgrad einer Rückdruckeinrichtung mit zunehmender Angleichimg der Gasstrahlgeschwindigkeit an die Körpergeschwindigkeit zunimmt, ist der Nutzeffekt besser bei den umlaufenden als bei den linearen Strahltriebwerken, deren hoher Abströmgeschwindigkeit eine erheblich geringere Relativgeschwindigkeit, nämlich die des Fluges, gegenübersteht.
Der zweite Vorteil ist vorwiegend bei Hubschraubern gegeben. Man muß bei diesen bekanntlich, um das hier beträchtliche Motor-Rückdrehmoment aufzuheben, besondere Vorkehrungen treffen, z. B. paarweise gegenläufige Hubschrauben oder Seitenschrauben oder im Schraubenstrahl liegende Ablenkflächen usw. vorsehen. Eine Turbo-Hubschraube bedarf derartiger Maßnahmen nicht, weil das
*) Man wird dabei an den Wellnerschen Vorschlag aus dem Jahre 1902 (DRP. 139 493) erinnert, der an freidrehbare Luftschraubenflügel kleinere Luftschrauben ansetzen wollte, um jene durch diese in Umlauf zu versetzen.
von dem Strahlgerät erzeugte Antriebsmoment mit dem von der Luft am Flügel erzeugten Widerstandsmoment unmittelbar im Gleichgewicht steht, also an Ort und Stelle verwendet wird, und nicht über gegeneinander verdrehbare Teile (Rumpf und Schraubenwelle) geleitet zu werden braucht.
Welche konstruktiven Möglichkeiten und Erfordernisse sich bei derartigen umlaufenden Heizluftstrahltriebwerken oder Turbo-Schrauben bieten, sei an einer bereits im Jahre 1923 in der brit. i Patentschrift 227 151 beschriebenen Bauart der dem englischen Luft-
fahrtministerium nahestehenden Ingenieure B. Ch. Carter und J. D. Goal es dargelegt Es ist, soviel bekannt, keine Veröffentlichung über die an den in Farnborough damit gemachten Versuchen erzielten Ergebnisse erfolgt.
Abb. 1 zeigt diese Turbo-Schraube am Flugzeug in Vorderansicht. Das in jedem Flügelblatt vorgesehene Heizluftstrahlgerät ist aus den Schnitten der Abb. 2 und 3 zu erkennen. Die am Blattende verstellbar befestigte Düse verengt sich nach der Austrittsöffnung hin. Sie ist (vgl. Abb. 4) entgegengesetzt der Richtung ihres gewindeartigen Vorrückens im Luftraum eingestellt, also der Richtung der Resultierenden aus Umlauf und Fluggeschwindigkeit; sie entläßt den Gasstrahl unter einem nicht weit vom atmosphärischen entfernten Druck. Nächst ihr sitzt im Hohlblattinneren die aus einem beiderseits offenen rohrförmigen Körper bestehende Brennkammer, in deren Mitte das Brennstoffrohr mit den Zerstäuberdüsen, das zugleich Zündstrom führt, endet. Die Brennkammer läßt zwischen sich und die Blattinnenwandung einen Mantelraum, der eine über die zur Verbrennung notwendige Brennkammerluft hinaus überschüssig geförderte, z. B. siebenfache Luftmenge durchströmen läßt, sie von der ( Brennkammer schichtenmäßig fernhält und zugleich als Isolation zur
I Verringerung der Wärme Verluste dient. Der Luftzusatz schützt auch
die Düsenwand vor zu hohen Temperaturbeanspruchungen und verbessert den Wirkungsgrad durch Herabsetzung der Strahlgeschwindigkeit. Die Verbrennung kann mit beliebigen Mitteln (beheizbare Elektrode, Kerze, Widerstandsdraht, Platinschwainm) begonnen und,
U)b. 2 u. 3: Teilschnitt durch eine Turbo-Luftschraube mit rumpffester Achse. 1, 2 Schrauben-ilätter; 3 Nabe; 4 Rückdruckdüse; 6 feststehende Achse; 11 Lufteinlässe; 23 Brennstoffrohr;
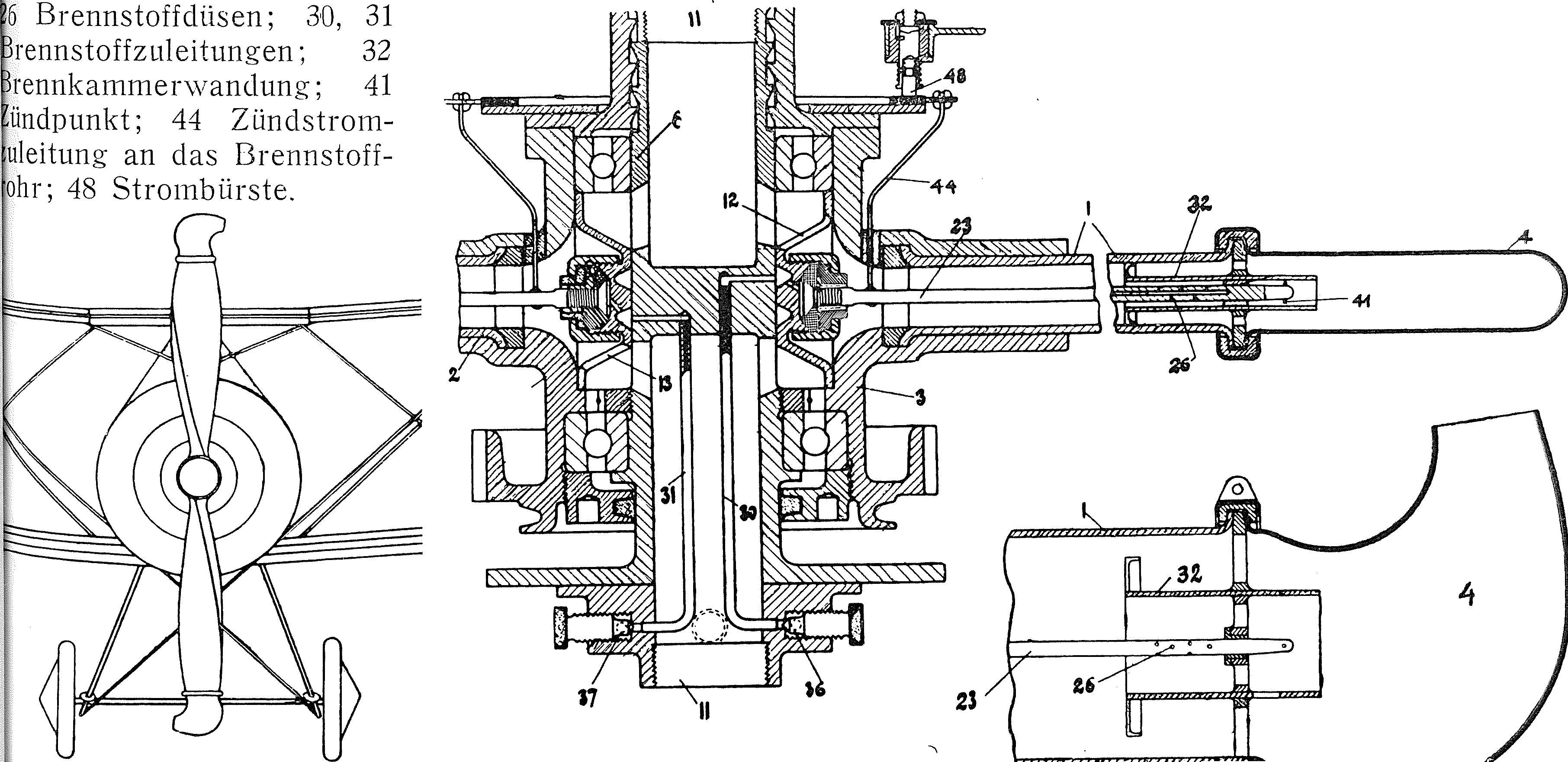
^>b. 1; Turbo-Luftschraube iB^^
am Flugzeug. ^
Abb. 2. Abb. 3.
wenn die Hitze der Brennkammei wand nicht ausreicht, auch unterhalten werden; als Sicherung gegen Rückschlag dienen Gitter aus Drahtgewebe in den Leitungen. Der hochgespannte Zündstrom wird dem gut isolierten Brennstoffrohr, das am äußersten Ende den Zündpunkt hat, zugeführt. Nach Angabe der Urheber der Patentschrift ist der austretende Gasstrahl wegen des Luftüberschusses viel weniger heiß, als die Auspuffgase üblicher Flugmotoren; außerdem enthält er bei völliger Verbrennung kein Oel. Z. B. können die Auspuffgase eines gewöhnlichen Benzinmotors etwa bei 1000° C liegen; die Gasstrahl-Temperatur einer Turbo-Schraube mit siebenfachem Luftüberschuß kann dagegen nur etwa 350° C sein.
Das vorbeschriebene, in Abb. 2 u. 3 dargestellte thermische Gerät ist auch bei den drei anderen Bauvorschlägen, vgl. die Abb. 5 bis 7, vorgesehen. Die vier Ausführungsformen unterscheiden sich hauptsächlich durch die Art der Luftverdichtung und des Aufladeantriebes sowie im Zusammenhang damit durch die Art der Anordnung des Schraubenkörpers entweder auf einer feststehenden Achse oder einer motorisch antreibbaren Welle; letztere kann mit dem Schraubenkörper fest verbunden sein oder ihm nur als Umlaufachse dienen.
Bei einer Ausführungsform mit feststehender Achse — wie z. B. nach Abb. 2 — tritt die Luft über die Nabe in die Blätter ein; die Möglichkeit, sie direkt in die Blätter an einem Punkte größerer Umfangsgeschwindigkeit einzuführen, sei angedeutet. Im Blatt gelangt die Luft — natürlich bei allen dargestellten Ausführungsformen — unter starke Schleuderwirkung; ihre unter dieser zunehmende Verdichtung kann so groß sein, daß ihr anfänglicher Druck (Staudruck) sich auf das Doppelte oder mehr erhöht. Auch der Brennstoff, der über die Achse oder Welle in den Nabenkörper und von dort über einen Ringkanal in das Brennstoffrohr gelangt, unterliegt der Schleuderwirkung, und zwar ihrer größeren Massendichte wegen in weit höherem Maße; in gewissen Fällen kann der Druck im Brennstoff sich auf einige hundert Atm. steigern, so daß allerfeinstes Zerstäuben an den Sprühöffnungen in der Brennkammer gewährleistet ist. Nicht zeichnerisch dargestellt ist die angegebene Möglichkeit, den Brennstoff durch Ventile an den Brennkammeröffnungen und die Luft durch Schieber und Schlitze in der Hohlachse für intermittierende Arbeitsweise bei konstantem Volumen zu steuern. Ein etwaiger Luft- oder Gemischverdichter bei dieser Ausführungsform, dessen Antriebszahnrad Abb. 2 am Nabenfuß zeigt, kann außerhalb der Schraube angeordnet werden.
Abb. 5 zeigt, daß man eine Turbo-Schraube auch auf die Propellerwelle eines üblichen Flugmotors aufsetzen kann; ein den Nabenfuß umfassendes Gehäuse ist mit regelbaren Brennstoffzuleitungen und Zündstromzuführung ausgestattet. Hierüber heißt es in der Patentschrift: „Die Turbo-Schraube läßt sich als Energiequelle an sich oder in Verbindung mit einem Flugmotor ausbilden, die letztere Art kann für den Start oder den Reiseflug Verwendung finden. Bei einer solchen kombinierten Anordnung ist die Turbo-Schraube so konstruiert, daß der Antriebsmotor nicht imstande ist, die volle Leistung zu entwickeln, die die Schraube bei voller Geschwindigkeit aufnehmen könnte, und die Turbine kann in Betrieb gesetzt werden, wie und wann immer erforderlich. Bei dieser Anordnung kann eine Verstelluftschraube in Anwendung kommen."
Die in Abb. 6 dargestellte Ausführungsform mit Auflader und feststehender Achse unterscheidet sich von den vorigen beiden Beispielen durch den Einbau eines mit Uebersetzungsgetriebe vom Schraubenkörper angetriebenen Schleudergebläses.
Abb. 7 zeigt eine Ausführungsform mit Auflader und motorisch
antreibbarer, mit dem dreiflügeligen Schraubenkörper fest verbundener Welle. Das Uebersetzungsgetriebe für den auf der Welle umlaufenden Schleuderverdichter besteht aus einem Getriebe an der Nabe, von dem ein Zahnrad auf einem Innenkranz eines rumpffesten Gehäuses abrollt.
Das britische Patentamt hat außer 17 Unteransprüchen einen Hauptanspruch gewährt, der sich auf die Zuleitung von Luft und
Brennstoff unter Druck zu einer Brennkammer im Blatt in Verbindung mit der Zuführung überschüssiger Luft zu den Verbrennungsgasen vor deren Austritt in die Atmosphäre erstreckt. In Deutschland ist diese Turbo-Luftschraube nicht patentiert.
Gohlke.
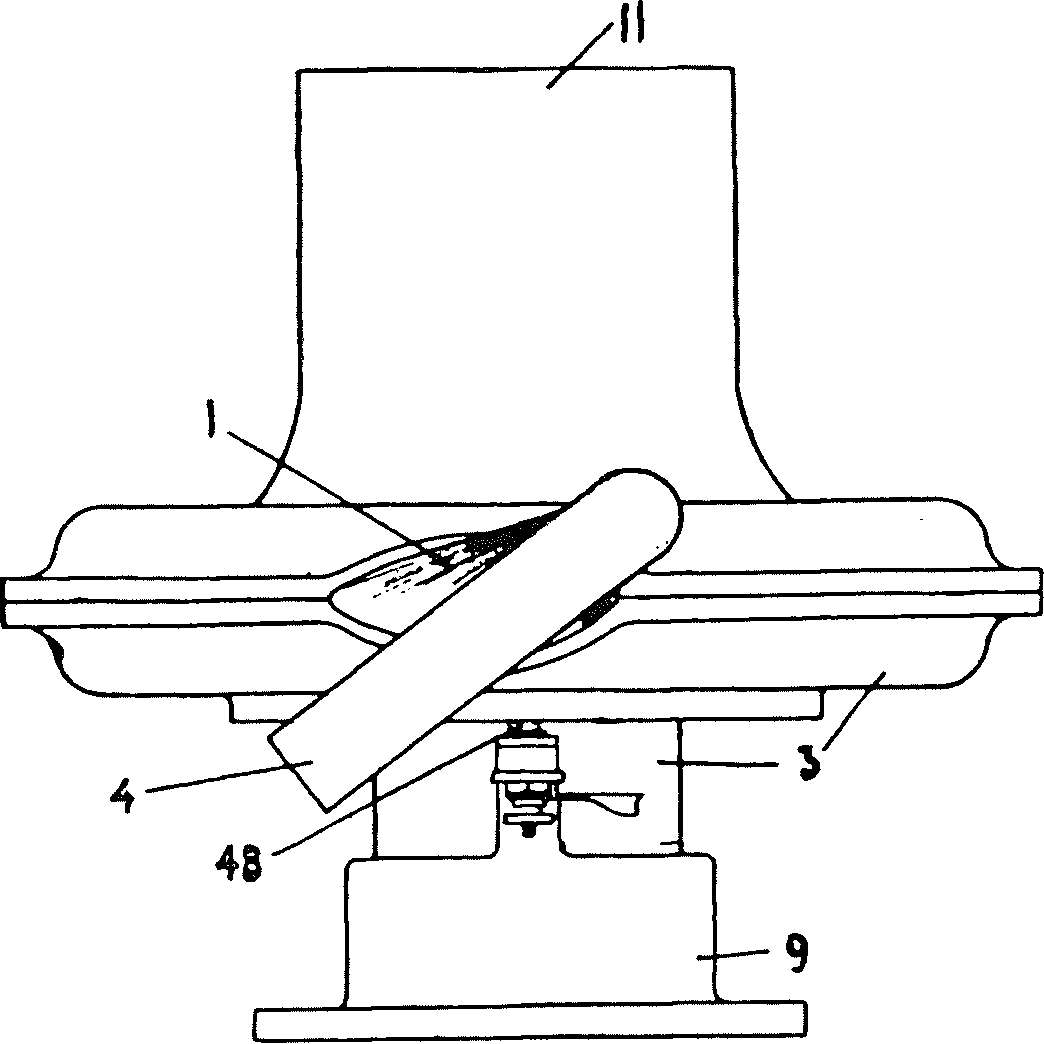
Abb. 4: Turbo-Luftschraube nach Abb. 5 in Seitenansicht. 9 rumpffestes Gehäuse (übrige Ziffern wie in Abb. 2 u. 3).
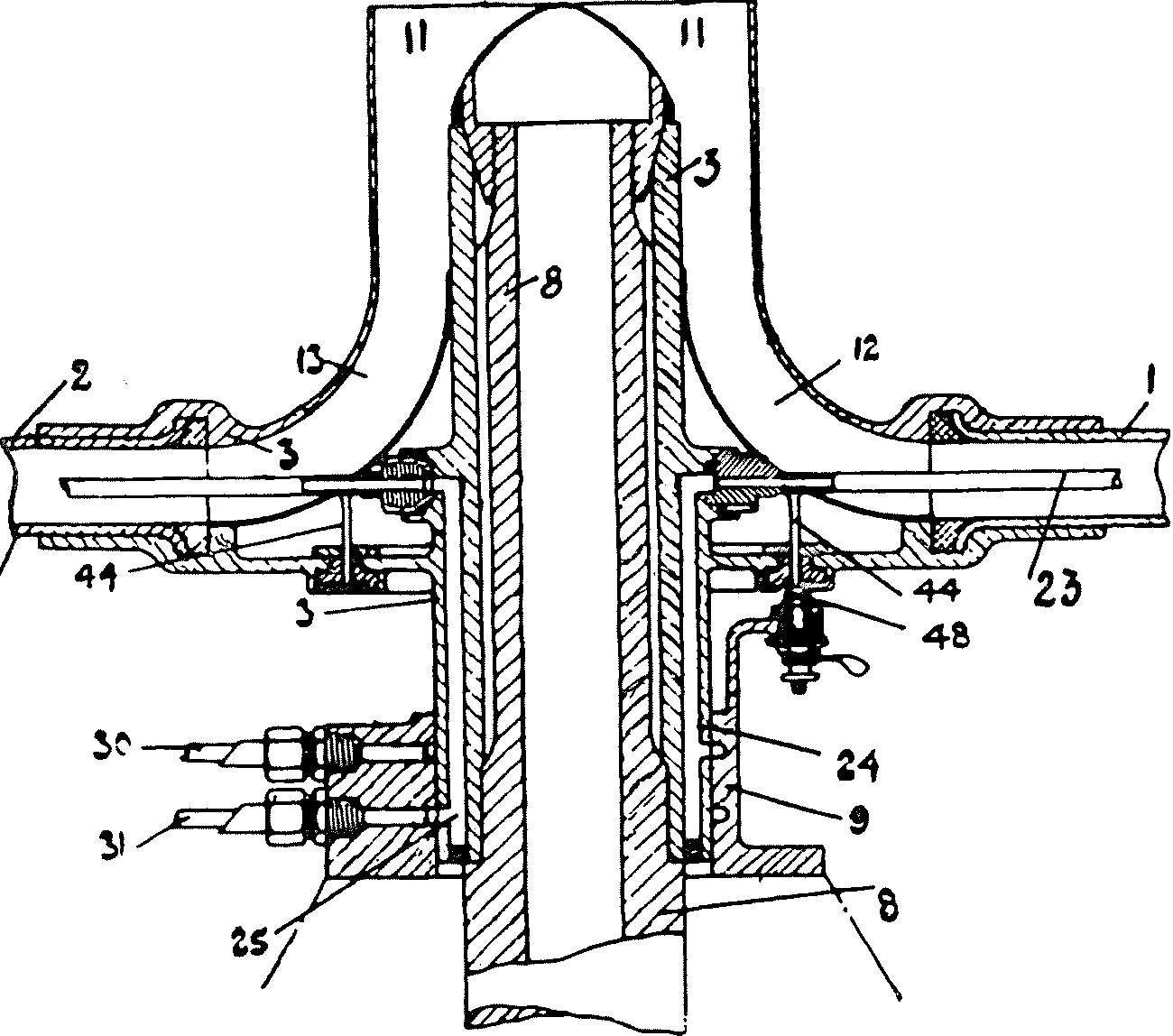
Abb. 5: Nabe einer Turbo-Luftschraube mit auch motorisch antreibbarerWelle 8. 9 rumpffestes Gehäuse; 12, 13 Luftzuleitungen; 24, 25 Brennstoffkanäle (übrige Ziffern wie zuvor).
Abb. 6: Nabe einer Turbo-Luftschraube mit Auflader und rumpffester Achse. 15 Schleudergebläse als Auflader; 18—21 Uebersetzungs-getriebe zwischen Schraubenkörper und Gebläse.
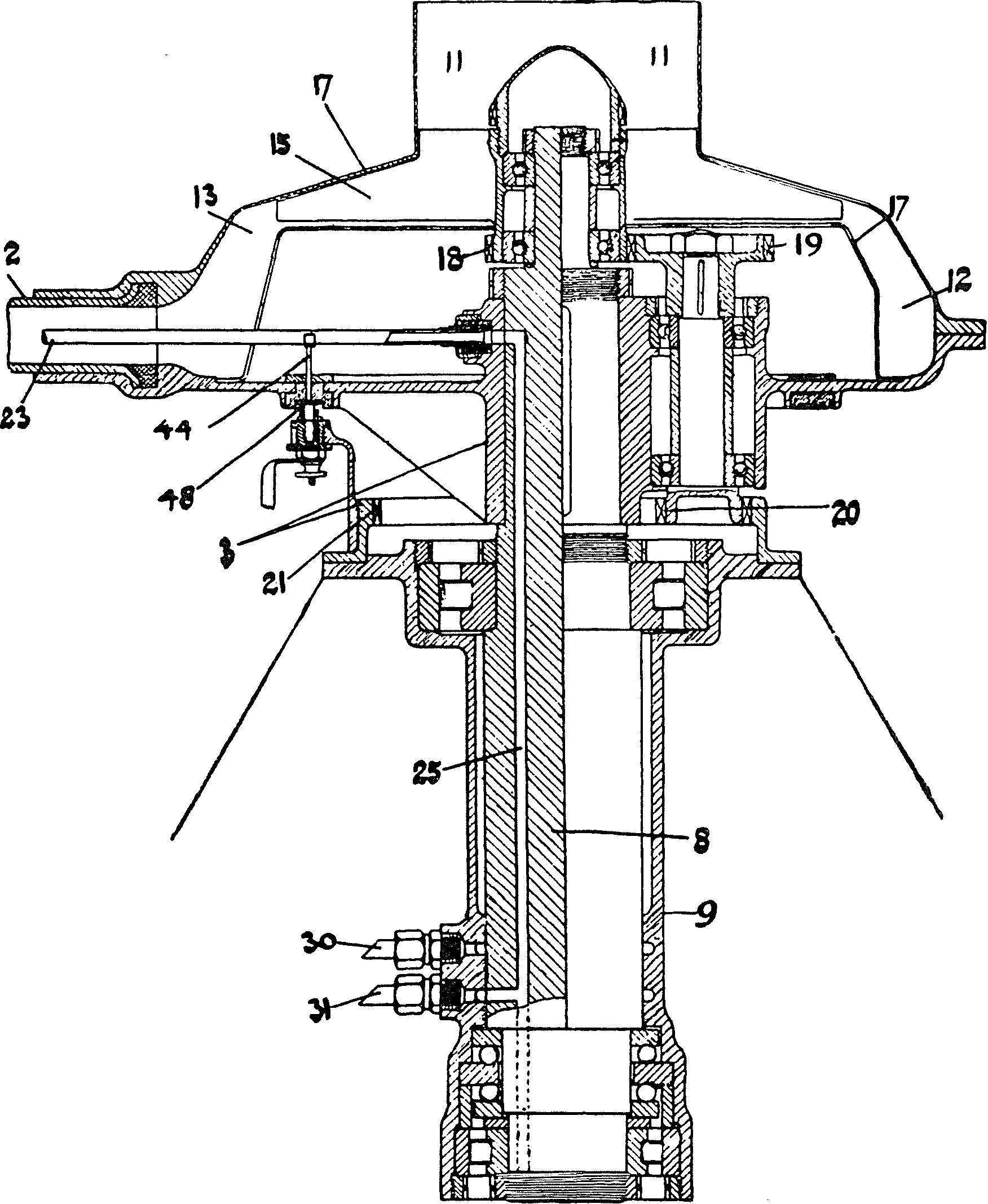
Abb. 7: Nabe einer Turbo-Luftschraube mit Auflader und motorisch antreibbarer Welle. 17 Gebläse-Gehäuse.
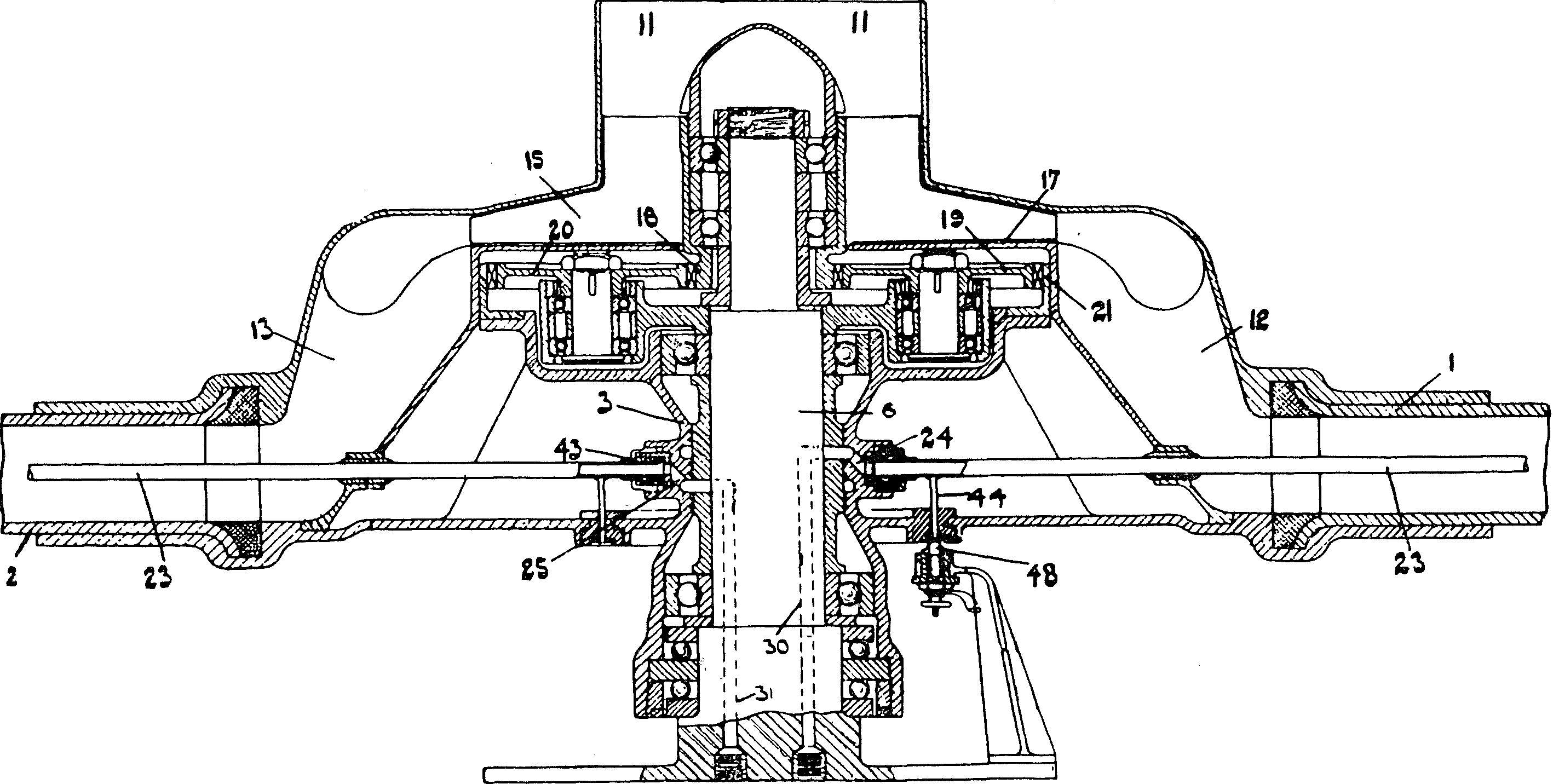
Rettungsboot für Landflugzeuge.
Um weiteste Strecken über See fliegen zu können, ohne eine Wasserung vornehmen zu müssen, wird man sich offenbar besser eines Landflugzeugs bedienen, weil es im allgemeinen geringeren Luftwiderstand bietet — besonders mit Verschwindfahrwerk — und demgemäß geringeren Betriebsstoff verbrauch hat. Für Verkehrsmaschinen tritt dabei die Frage der Notwasserungsmöglichkeit auf. Ein notwasserungsfähiges Wasser-Land-Flugzeug schöpfte auch mit einziehbaren Seitenschwimmern und Laufrädern wegen der Schwere des schwimmfähigen (Boots-)Rumpfes die Möglichkeit größter Reichweite nicht aus; außerdem kann es seine Nutzlast (Fluggäste und Fracht) nach einer Notlandung nicht immer weiter befördern. Man hat daher vorgeschlagen, z. B. Short in England, nur einen lösbaren Teil des Rumpfes schwimm- und wassertransportfähig auszubilden.
Ein ähnlicher Vorschlag ist auch von Bleriot gemacht worden, wie die untenstehende Abbildung aus der französischen Patentschrift
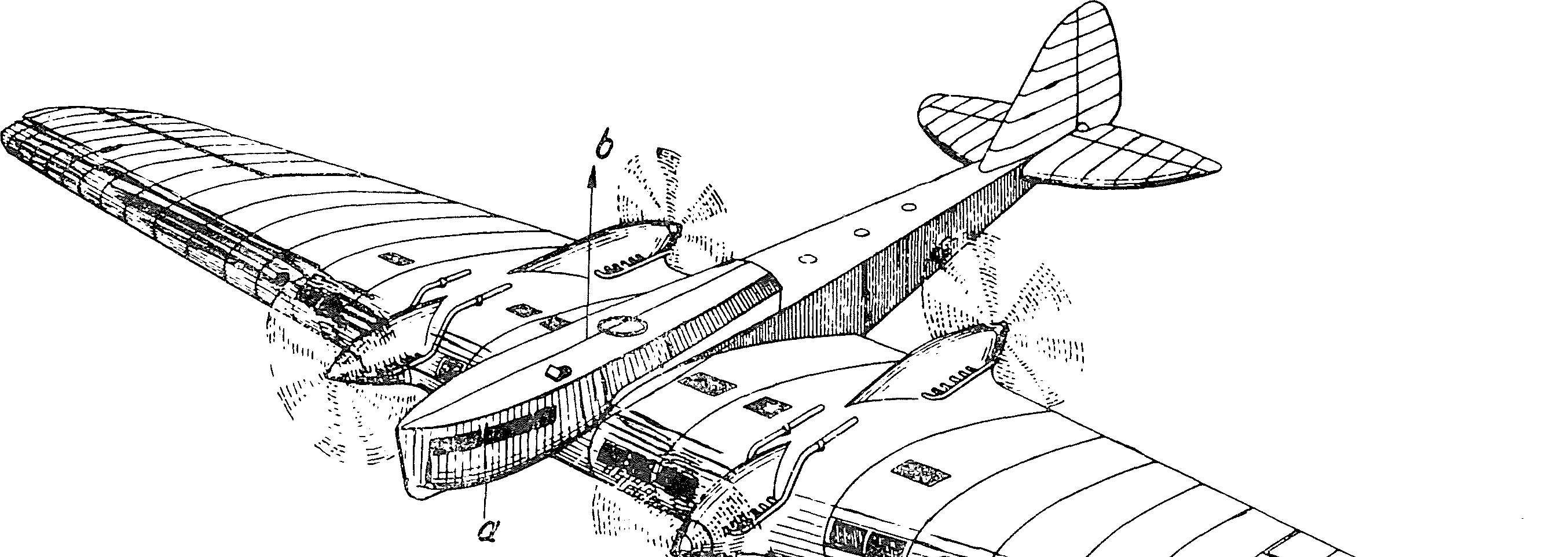
656864 ersichtlich macht. Hier umfaßt der Rumpf teilweise ein seetüchtiges Boot a, das, mit eigenen Triebmitteln (Motor und Wasserschraube, Segel) ausgestattet, die Fracht und im Notfalle auch die Fluggäste aufnimmt, die vom Flügel-Innenraum des Landgroßflugzeuges aus durch wasserdicht abschließbare Türen das Boot betreten kennen. Es ist klar, daß die Holm Verbindungen der Flügel der Unterbringung des Bootes im Rumpf Schwierigkeiten bereiten. Bleriot hat in der Patentschrift hierfür zwei Lösungen angegeben: Entweder sind Aussparungen im Bootskörper unten vorhanden, die den Holmen von der einen zur andern Seite Durchtritt gewähren, oder das Boot läßt sich nicht wie in der Abbildung nach oben (Richtung b), sondern nach unten herauslösen; in diesem Falle laufen die Oberholme über dem Boot hinweg durch, dagegen bilden die Mittelstücke der unteren Holme Bestandteile des Bootes, derart, daß die in die Flügel gehenden Teile der Unterholme lösbare Anschlüsse außen am Boot finden. -o-

FLUG
umso«
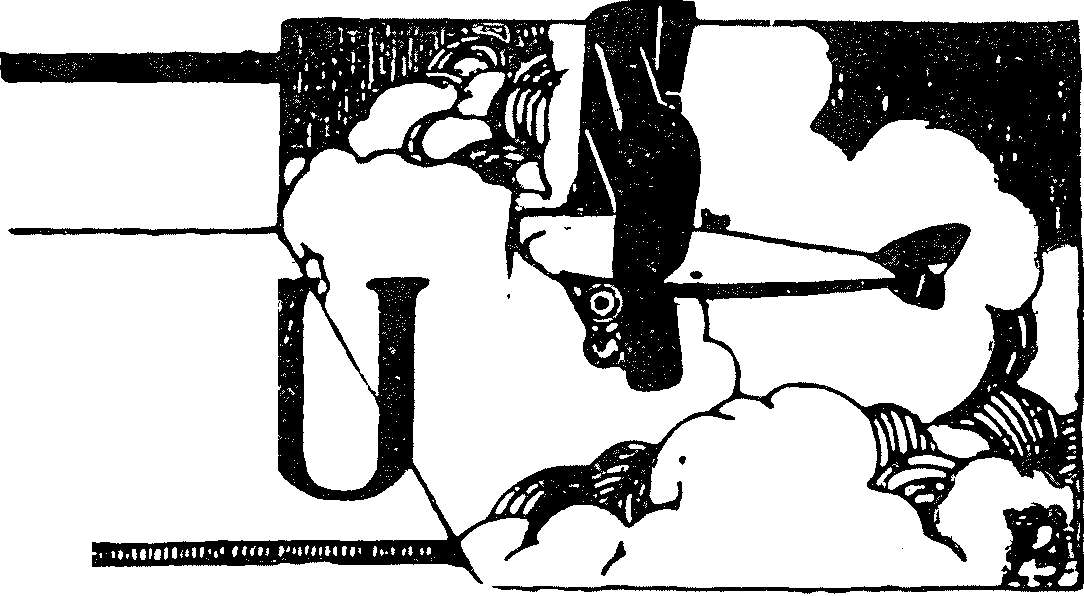
Inland.
Beförderungen in der Luftwaffe durch den Führer und Obersten Befehlshaber der Wehrmacht mit Wirkung von 1.12.39: Zu Generalmajoren die Obersten
Kieffer, Friedensburg, Kriegbaum, Gandert, Deinhardt, Spang, Rüter, Müller; zum Oberst den Oberstleutnant Fink.
Prof. Willy Messerschmitt soll, nach einer Meldung des „Daily Sketch", die der Havasdienst am 22.11. aus London verbreitet, Deutschland verlassen und sich in Holland niedergelassen haben, um dort Flugzeuge zu bauen. Messerschmitt sei schon seit langem unzufrieden gewesen. Er sei der Ansicht, daß er von den „Nazis" nicht gut behandelt worden sei. Ohne das besondere Genie Messerschmitts hätten die „Nazis" jetzt kaum noch Hoffnung, die Messerschmitt-Flugzeuge derart zu verbessern, daß sie den alliierten Fliegern gegenüber die Oberhand gewinnen. Messerschmitt versuche jetzt, die holländische Staatsangehörigkeit zu bekommen.
Willy Messerschmitt, unser alter Rhönkamerad, hat jetzt etwas Wichtigeres zu tun, als nach Holland zu reisen. Wenn man solche Nachrichten aus dem Ausland hört und die Verhältnisse, wie im vorliegenden Fall, genau kennt, bekommt man nur eine Bestätigung dafür, daß alle anderen Auslandsmeldungen auch zu 99% falsch sind.
Flugplan der Deutschen Lufthansa enthält Angaben über alle zur Zeit von Deutschland aus beflogenen Strecken sowie über die Möglichkeiten zur Erreichung von Flughäfen in den verschiedenen Staaten, über die Flugpreise, den Flugscheinverkauf und das Luftreisegepäck. Ferner klärt der Flugplan über die Flugpreisermäßigungen auf, weist auf die Fluggastverpflegung hin und bringt die besonderen Bestimmungen über die Versendung von Luftexpreßgut. Ein besonderer Abschnitt behandelt schließlich die Luftpost.
Berlin-Moskau-Fluglinie soll wieder aufgenommen werden. Verhandlungen finden zur Zeit in Moskau statt.
Deutsche Luftfahrtsammlung in Berlin, am Lehrter Bahnhof, ist nach vollständiger Umgestaltung wieder eröffnet. Der Besuch dieser, unter der Schirmherrschaft von Generalfeldmarschall Göring stehenden, Sammlung ist nicht nur unserem Fliegernachwuchs, sondern allen, welche sich für das Flugwesen interessieren, sehr zu empfehlen. Man bekommt einen Ueberblick über die Entwicklungsgeschichte vom Lilienthal-Gleitflieger, Wright, Farman, Hans Grade bis zum Richthofen-Kampfdreidecker und dem modernen Flugzeugbau unserer heutigen Zeit. Zeugen des zweiten Entwicklungsabschnittes sind die Junkers F 13, die ersten Zeitungsflugzeuge von Heinkel, ein Sablatnig-Stratosphärenflugzeug, dann die ersten Anfänge des modernen Flugzeugbaues, das schnittige Sportflugzeug Bäumer-Sausewind und dann von den größten Flugzeugen der Do X, mit dem unser heutiger Korpsführer Christiansen den Ozean überquerte. Aus der neuen Zeit sieht man unter den besonders wertvollen Stücken die Maschine des Führers, mit der er durch Deutschland flog, um die Herzen der Deutschen zu gewinnen. Besonders wertvoll für den Nachwuchs ist die Abteilung Leichtnietallbearbeitung, die in die verschiedenen Arbeitsweisen (Nietverfahren, Sprengnietung, mechanische Blechverformung, genormte Bauvorrichtungen) einen Einblick gewährt. Ueber die Ausstellung werden wir nochmals ausführlich zu sprechen kommen.
Dr. - Raimund - Nimführ - Schwirrflugzeug - Betrugsprozeß bildete den Gegenstand einer für 8 Tage anberaumten Verhandlung vor einem Erkenntnissenat des Landgerichts Wien unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors Dr. Krubl. Die Anklage vertritt Staatsanwalt Dr. Pulpan. Nimführ wird von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, daß er mit gefälschten Zeugnissen von Fachleuten die Oeffentlichkeit über den Wert eines von ihm erfundenen Schwirrflugzeuges getäuscht habe. Durch Vorspiegelung dieser angeblichen Erfindung und Konstruktion einer wertlosen Flugzeugattrappe habe er Interessenten irregeführt und für einen von ihm geschaffenen „Dr.-Raimund-Nimführ-Flugfonds" Beträge von insgesamt mehr als 200 000 Schilling herausgelockt. Auf Grund von Strafanzeigen wurde ein Sachverständigengutachten eingeholt, die Gebarung des „Dr.-Raimund-Nimführ-Flugfonds" überprüft und auf Grund der Erhebungen die Betrugsanklage erhoben.
Während des Verhörs erklärte Nimführ einleitend, daß er sich in keiner Richtung schuldig bekenne, vor allem aber keineswegs die Absicht hatte, die Teilhaber der Nimführ-Gemeinde zu schädigen. Im übrigen vertritt er die Auffassung, daß es auf dem Gebiet des Schwirr- und Schwingenfluges keinerlei Sachverständigen gäbe, außer seiner eigenen Person. Das von ihm konstruierte Flugzeug sei, wie er äußerte, zu „Flugproben" startbereit, nach seiner eigenen Meinung wird es aber nicht aufsteigen, was, wie er glaubt, von untergeordneter Bedeutung ist. WTeiter erörterte der Angeklagte das von ihm zu konstruierende mechanische Gehirn, das inzwischen längst von andern in der Form des Roboters erfunden wurde. Außerdem besprach er die Aufstiegsmöglichkeiten des von ihm zu kon-
struierenden Flugzeuges, wobei er eine Reihe von „Vorschlägen" unterbreitete und Möglichkeiten sozusagen „zum Aussuchen" vorbrachte.
Am 23.11. wurde ein Lokalaugenschein der Werkstatt von Dr. Nimführ in einer Baracke des Arsenals vorgenommen. Der Apparat besteht aus einem ungefähr 12 Meter langen Mittelstück, zwei Vorder- und zwei Hinterflügeln. Nimführ gab die notwendigen Erläuterungen. Der Vorsitzende frug ihn: „Haben Sie berechnet, wieviel Flügelschläge notwendig sind, dieses Monstrum vorwärts zu bringen?" Der Angeklagte: „Berechnen kann man so etwas nicht. Man muß daher die Konstruktion ausführen und Versuche machen." Vorsitzender: „Wenn man aber so viel Geld wie Sie von der Oeffentlichkeit gesammelt hat, muß man sich doch ein Bild darüber machen, wieviel Flügelschläge notwendig sind." Angeklagter: „Bitte, das weiß ich nicht, das kann niemand berechnen." Vorsitzender: „Haben Sie auch mit der Möglichkeit gerechnet, daß dieses Flugzeug überhaupt nicht vorwärts kommt?" Darauf sagt der Angeklagte selbstbewußt: „Auf alle Fälle kommt es vorwärts, denn ich habe es hunderttausendmal berechnet." Der Angeklagte gab dann weiter an, daß das Flugzeug ohne Motor ungefähr drei Tonnen wiegt. Er wich aber der Frage aus, welche Kraft erforderlich ist, um diesen gewichtigen Apparat nach vorwärts zu bringen.
Da die Inneneinrichtung völlig fehlt, wird Nimführ gefragt, wann er sie eigentlich auszuführen gedenkt. Nimführ erwidert, das komme ganz darauf an, wieviel Geldmittel ihm zur Verfügung gestellt werden. Vorsitzender: „Aber Sie haben doch schon genug Geld für diese Zwecke bekommen." Der Angeklagte lächelnd: „Für das Gehabte kann man nichts bauen." Der Staatsanwalt wies darauf hin, daß das ganze Flugzeug zwischen Keiler eingebaut ist und nicht aus der Halle geschafft werden kann. Darauf meint der Angeklagte ruhig: „Da werden wir es einfach wieder zerlegen müssen." Dann lädt der Angeklagte den Staatsanwalt zur Besichtigung des „Bauches" ein. Der Staatsanwalt folgt dieser Einladung mit den Worten: „Fliegen Sie mir nur nicht davon!" Auch der Vorsitzende, der Verteidiger und der Sachverständige Prof. Dr. Katzmayer begeben sich in das Innere, wo Nimführ umständlich die geplante maschinelle Einrichtung beschreibt. Der Vorsitzende stellt dann fest und nimmt zu Protokoll: „Der Angeklagte ist nicht imstande, anzugeben, welche Motorkraft notwendig ist, die Flügel so rasch betätigen zu können, daß ein Flugeffekt erzielt wird."
Schließlich wird noch ein kleinerer Apparat gezeigt, den der Angeklagte als seine ganz besondere Leistung bezeichnet, nämlich das „mechanische Gehirn" seines Apparates. Man sieht eigentlich nichts als eine Kapsel, mit einem Zylinder, in dem sich ein Metallkörper befindet. Wie dieses mechanische Gehirn eigentlich funktionieren soll, ist schleierhaft.
In der Verhandlung am 27. 11. wurde dem Angeklagten vorgehalten, daß er die Zeichner des Flugfonds dadurch irregeführt hat, daß er in seinem Expose wahrheitswidrig behauptete, seine Erfindung sei wissenschaftlich und experimentell bereits durchgearbeitet, und es würde nunmehr schon die industrielle Auswertung einsetzen.
Hierauf erstattete der gerichtlich beeidete Sachverständige, Professor der Technischen Hochschule Dr. Katzmayr, sein Gutachten, das eine vernichtende Kritik an der „Erfindertätigkeit" Nimführs darstellt. Der Sachverständige führte aus, daß die Grundlagen des Nimführschen Flugzeugbaues sowohl physikalisch als auch mechanisch gänzlich verfehlt sind. Die konstruktive Ausführung zeigt, daß Nimführ gar kein Verständnis für den Leichtbau besitzt, der im Flugzeugbau angewendet werden muß. Der Angeklagte hat es absichtlich unterlassen, die Richtigkeit seiner Hauptgrundsätze nachzuweisen, und das von ihm sinnlos zusammengebaute Flugmodell zeigt, daß er von einem Flugzeugbau überhaupt keine Ahnung hat.
Nach neuntägiger Verhandlung ging der Prozeß zu Ende. Nimführ wurde wegen Betruges schuldig erkannt und zu sieben Monaten schweren Kerkers verurteilt.
Ausland.
Fokker Fünfmotoren-Verkehrsflugzeug, 4 Motoren in Tandem im Flügel, einer in der Rumpfnase für die K. L. M. in Bau, bestimmt für Linie Amsterdam—Batavia für Tag- und Nachtflug. Verlangt wird mehr Bequemlichkeit als Geschwindigkeit.
Italienische Luftwaffe. General Mario Bernasconi, seinerzeit Kommandeur der italienischen Fliegerlegion in Spanien, wurde an Stelle des zurückgetretenen Generals Ferrari zum Kommandanten der Fliegerschule und Versuchsanstalt von Guidonia ernannt. Der stellvertr. Generalstabschef der Luftwaffe, General Pinna,
wurde zum Kommandeur der Luftwaffe in Aethiopien ernannt; seinen Posten hat Fliegergeneral Santero übernommen.
Kanadisches Luftzentrum, hauptsächlich für Ausbildung, soll in Toronto geschaffen werden.
Kanada fliegerisches Personal 30.6.39. 708 Civil, 231 Verkehr, 194 beschränkt zugelassener Verkehr, 150 für Frachtverkehr, 683 Flugingenieure.
Belg. Flugzeuge nach Belg.-Kongo müssen, wenn sie das französische Gebiet überfliegen, in der Nähe von Marseille eine Zwischenlandung vornehmen.
USA. - Neuseeland - Luftlinie Inbetriebnahme wegen Kriegseinwirkung verschoben.
Südamerika-Flugzeugeinfuhr 1938 betrug nach Aero Digest: Deutschland 27 183 501 Dollar, England 26 501 493 Dollar, Italien 8 821 493 Dollar, Frankreich 3 752 208 Dollar.
Pan American Atlantikflugverkehr nördliche Linie bis Foynes, Irland, südliche Linie bis Lissabon. Anschlußlinien nach kriegführenden Ländern aufgegeben.
400 USA.-Ausbildungsflugzeuge sind vom britischen Luftfahrtministerium bei der Northamerican Aviation Co., Inglewood (Kalif.) für 17 Millionen Dollar in Auftrag gegeben worden. Wann sie fertig werden, wie sie herüberkommen und was damit geschehen soll, ist noch unbekannt.
USA Grumman F. 4. F—3, Jagdeinsitzer für die Marine, Ganzmetall. Motor Pratt & Whitney, 1200 PS Startleistung. Flügel verhältnismäßig dünnes Profil. Rumpf ähnelt Seversky. Fahrwerk nach Grumman-Konstruk-tion, hochziehbar in die Kabine, wobei sich die Räder an die Rümpfaußenseite anlegen.
Luftwaffe.
Berlin, 19.11.39. Die Luftwaffe setzte ihre Aufklärungstätigkeit über Frankreich fort.
Genf, 19.11.39. Die hier vorliegenden französischen Berichte zu den am Freitag (17.11.) im gesamten Osten und Südosten Frankreichs durch deutsche Flugzeuge ausgelösten Fliegeralarmen zeigen, daß z. B. in Grenoble die französischen Flaks mehr als eine Stunde lang in Tätigkeit waren. Auch die Luftabwehr von Lyon trat längere Zeit in Aktion, weniger dagegen die von Savoyen und im Rhönetal, wo sich der Fliegeralarm bis Avignon und sogar Marseille ausdehnte. Eine tiefliegende Wolkendecke, die sich über die ganze Gegend breitete, verhüllte das oder die Flugzeuge.
London, 19.11.39. Wie gemeldet wird, soll auf Grund der bisherigen Erfahrungen die französische Luftwaffe dem britischen Kommando unterstellt werden.
20. 11. 39. Oberk. d. Wehrmacht keine Bekanntmachungen über Luftwaffe.
London, 20. 11.39. (DNB.) Im nordöstlichen Teil der schottischen Küste wurde am Sonntag (19. 11.) Fliegeralarm gegeben. Die Flugzeuge wurden in großer Höhe beobachtet.
Nach unseren Meldungen wurde am Sonntag außer in Nordschottland auch im Firth of Förth und an der Ostküste Schottlands Fliegeralarm gegeben.
London, 20.11.39. (DNB.) Ueber dem Weichbild Londons, über Essex und Südkent wurden am Montag Flieger gesichtet.
Paris, 20. 11. 39. (DNB.) In Lyon und im Rhönetal wurde am Montagvormittag 9.55 bis 10 h Fliegeralarm gegeben. Auch in der Normandie heulten um 10 h 25 die Sirenen. Um 11 h 10 erfolgte das Entwarnungssignal.
Berlin, 21.11.39. Oberk. d. Wehrmacht: Die deutsche Luftwaffe setzte am 20. Nov. ihre Aufklärung gegen die feindlichen Staaten fort. In England wurden Scapa Flow, Schottland und Südengland, in Frankreich der Raum nördlich Paris aufgeklärt. Trotz feindlicher Abwehr führten die Flugzeuge ihre Aufträge planmäßig durch.
Paris, 21.11.39. (Europapreß.) Ueber Nordfrankreich erschienen am Dienstagvormittag erneut deutsche Erkundungsflugzeuge. Aus diesem Grunde wurde für weite Teile Frankreichs Luftalarm gegeben.
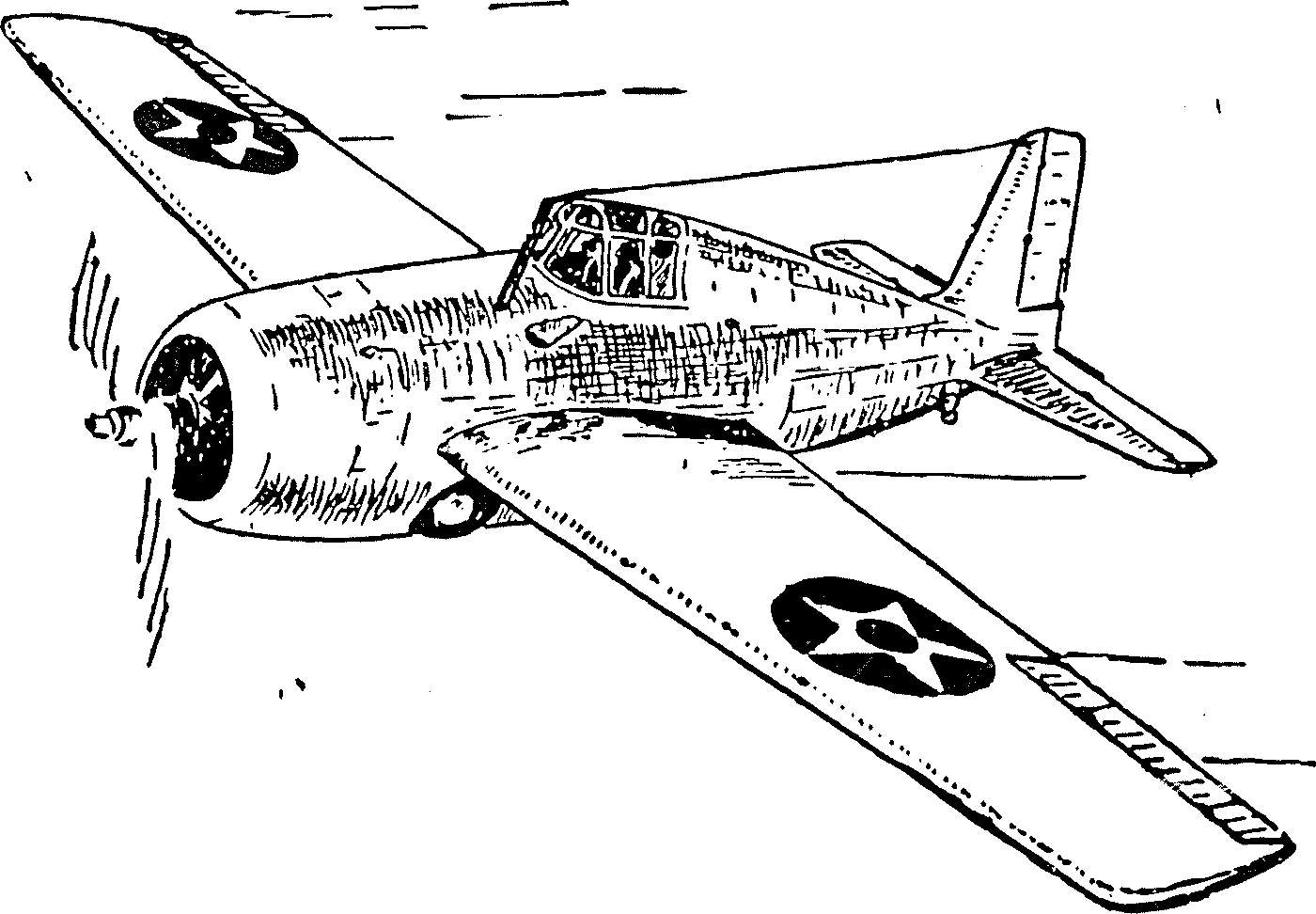
Paris, 21.11.39. Von 19 h 05 bis 19 h 42 wurde im Nordwesten Frankreichs Fliegeralarm gegeben.
Rom, 21.11.39. (Europapreß.) Italienische Berichterstatter in London berichten über eine verstärkte Tätigkeit der deutschen Luftwaffe über England. Zum ersten Male seit Kriegsausbruch ist am Montag (20.11.) auch ein deutsches Flugzeug über London erschienen. Die Fliegerabwehrbatterien an den Ufern der unteren Themse eröffneten das Feuer. Das Ereignis hat unter der Londoner Bevölkerung starken Eindruck gemacht, insbesondere deshalb, weil das deutsche Flugzeug, nachdem es die Themsemündung und die Grafschaften Kent und Essex überflogen hatte, bis in das Weichbild Londons vorgedrungen war. Die britischen Luftfahrtbehörden geben weiter zu, daß ein anderes deutsches Flugzeug einen Aufklärungsflug über die Küstengebiete der Grafschaft Kent unternahm. In der Graftschaft Kent war während zwei Stunden hindurch Fliegeralarm. Schließlich wird vom Luftfahrtministerium noch bekanntgegeben, daß über einer Stadt in Nordschottland ein deutsches Flugzeug erschien. Auch über den Orkney-Inseln wurden deutsche Flugzeuge gesichtet. Es wurde hier ebenfalls Fliegeralarm gegeben.
Die italienischen Blätter berichten weiter aus Paris, auch über Mittel- und Nordfrankreich hätten am Montag deutsche Flugzeuge wieder zahlreiche Aufklärungsflüge durchgeführt. Das Erscheinen der deutschen Flugzeuge habe unter der französischen Bevölkerung beträchtliche Aufregung hervorgerufen. In Lyon, im Rhönetal und in der Normandie sei auch am Montag wieder Fliegeralarm gegeben worden.
Oslo, 21.11.39. Trotz heftigem Flakfeuer ist es, wie die Osloer Blätter aus London melden, deutschen Aufklärern in den letzten Tagen immer wieder gelungen, bis zur Peripherie vorzudringen und Erkundungen durchzuführen. Es habe sich gezeigt, so melden die Londoner Vertreter des „Morgenbladet", daß das starke Gegenfeuer der britischen Luftverteidigung den deutschen Flugzeugen nichts anhaben konnte. Angelockt durch den Motorenlärm und die Schüsse der Luftverteidigung, seien viele tausende Engländer in den Straßen zusammengeströmt, um den Kampf gegen die deutschen Flugzeuge, der sich in großer Höhe abspielte, mitzuerleben. Da die Flakartillerie aber versagt habe, seien schließlich britische Flugzeuge aufgestiegen, um die deutschen Aufklärer zu vertreiben. Es sei ihnen jedoch nicht gelungen, an die deutschen Maschinen heranzukommen. Weiter berichten die hiesigen Blätter von einem „geheimnisvollen weißen Flugzeug", das über der Südostküste Englands bereits mehrmals erschienen sei, ohne daß ihm die britische Flak irgend etwas anhaben konnte. In verschiedenen Städten Ostenglands sei mehrmals das Erscheinen des weißen Flugzeugs festgestellt worden, das von Flakartillerie beschossen worden sei.
Berlin, 22.11.39. Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe klärte am 21. Nov. wiederum über englischem Gebiet bis Scapa Flow auf. Die Aufklärung über französischem Gebiet wurde auf Südfrankreich ausgedehnt. Zum Schutze der deutschen Westgrenze wurden am 21.11. ebenso wie an den Vortagen zahlreiche Jagdflieger eingesetzt. Diese blieben ohne Berührung mit dem Feind. Auch in der Luftverteidigungszone West eingesetzte Flakartillerie fand keine Veranlassung, in Tätigkeit zu treten.
Amsterdam, 22,11.39. Die Tatsache, daß deutsche Flugzeuge im Laufe des Montag nicht nur über den südlichen Grafschaften Englands, sondern auch über London und den Orkneys gewesen sind, hat in der englischen Oeffentlichkeit starkes Aufsehen erregt. Die Londoner Morgenblätter berichten in größter Aufmachung und in aller Ausführlichkeit über diese rege deutsche Lufttätigkeit. Die Blätter bringen eine ganze Reihe von Augenzeugenberichten, u. a. von Londoner Einwohnern, die beobachteten, wie ein hoch über London fliegendes deutsches Flugzeug von Flakartillerie unter Feuer genommen wurde. Aus den Schilderungen von Bewohnern südöstlicher Küstengebiete geht hervor, daß nur wie durch ein Wunder keine Verluste unter der Zivilbevölkerung durch die Granatsplitter der Flak entstanden sind.
Das britische Luftfahrtministerium hat am Dienstagabend (21. 11.) bekanntgegeben, daß um 19 h 15 im Humber-Distrikt, also in der Gegend der großen ostenglischen Hafenstadt Hull, Fliegeralarm gegeben werden mußte.
London, 22.11.39. Wie amtlich mitgeteilt wird, stürzte ein britisches Flugzeug in die Ballonsperre, wobei zwei Insassen des Flugzeuges getötet wurden.
Berlin, 23.11.39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Am 22. Nov. erzielte die lebhafte Aufklärungstätigkeit der deutschen Luftwaffe über Frankreich und Eng-
land trotz starker Jagd- und Flakabwehr besonders wertvolle Erkundungsergebnisse. In der Gegend von Sedan wurde ein französisches Flugzeug abgeschossen. In den Gewässern von Shetland wurde unter starker Abwehr im Tiefangriff ein englisches Flugboot in Brand geschossen.
Bei der Grenzüberwachung durch zahlreiche Jagdflieger kam es verschiedentlich zu kleineren Luftkämpfen, vier französische Jagdflugzeuge wurden hierbei abgeschossen. Bei Freiburg wurde ein deutsches Flugzeug von französischen Jägern zur Notlandung gezwungen.
Am 21. Nov. fand über französischem Gebiet ein Luftkampf zwischen neun deutschen Zerstörer-Flugzeugen und sieben französischen Jagdflugzeugen statt. Die französischen Jäger wurden vertrieben und dadurch den eigenen Aufklärungsflugzeugen deren weitere Erkundungstätigkeit ermöglicht. Feindliche Flugzeuge, die in das deutsche Reichsgebiet einflogen, hielten sich in unmittelbarer Nähe der Grenze.
Berlin 23. 11. 39. (DNB.) Bei der Erkundungstätigkeit der deutschen Luftwaffe kam es am 22. Nov. über Frankreich zu mehreren Luftkämpfen, die

Feindflug gegen England. Oben: Bei der Kartenbesprechung in einem deutschen Seefliegerhorst wird das Ziel an der Nordküste Englands festgelegt. Unten: Feindliche Schiffe in Sicht. Blick aus der Kanzel eines deutschen Kampfflugzeuges bei seinem Flug zur englischen Küste. Weltbild (2)
für die deutschen Flieger sehr erfolgreich waren. Jagdverbände, die die Aufklärungsflieger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sicherten, haben sich mit ihren Messerschmitt-,,Me 109"-Flugzeugen den feindlichen Curtiss- und Morane-Flug-zeugen immer wieder überlegen gezeigt. So trafen drei deutsche Jäger in der Gegend von Hornbach-Bitsch auf vier Moräne, von denen drei abgeschossen wurden, während südlich von Saarbrücken noch ein Moräne zum Absturz kam. Weitere Luftkämpfe entwickelten sich im Nordwesten Frankreichs und später wieder im Süden von Saarbrücken, wo acht deutsche Jäger mit zehn französischen in Kampfberührung kamen.
Im ganzen fanden an diesem Tage an sechs Stellen der Front Luftkämpfe statt. Die Franzosen verloren dabei fünf Flugzeuge. Ein deutsches Jagdflugzeug wird vermißt.
Aus London wird noch gemeldet:
Das englische Luftfahrtministerium und das Ministerium für innere Sicherheit haben Mittwoch abend (22.11.) ein gemeinsames Kommunique herausgegeben. Danach ist in einem südöstlichen Distrikt kurz vor 22 h Fliegeralarm gegeben worden. Die Entwarnung erfolgte eine halbe Stunde später. Kurz vor 22 h eröffnete die Luftabwehr über der Südostküste Flakfeuer. In der Umgegend wurde gleichzeitig Fliegeralarm gegeben. Fünf Minuten vorher hatte man von einer unweit gelegenen Ortschaft aus der Höhe über den Wolken ein nachhaltiges Maschinengewehrfeuer hören können. Wie man in London weiter erfährt, vernahm man von der Themsemüdung her während einer dreiviertel Stunde Maschinengewehrfeuer. Scheinwerfer beleuchteten den nächtlichen Himmel.
Wie man offiziell zugibt, haben gestern nacht sechs deutsche Flugzeuge die Shetland-Inseln durch Bombenwürfe angegriffen. Ein britisches Flugzeug sei dabei verbrannt. Auch die Franzosen hätten am Mittwoch zwei Flugzeuge verloren.
Endlich weiß man in London zu berichten, daß außer in Nordwestfrankreich auch in Paris Luftalarm gegeben worden sei. Nach einer Stunde sei die Entwarnung erfolgt.
Den Haag, 23.11.39. England, das nun Tag für Tag deutsche Flieger über britischem Gebiet sehen muß, hat gestern eine besonders aufregende Stunde des Luftalarms erlebt. Wiederum ist über den meisten Gebieten Englands der Luftalarm in Tätigkeit gesetzt worden. Diesmal kam es sogar über London zu Luftgefechten. Wie Reuter meldet, ist es über der Themse bei London zu einem Luftgefecht zwischen deutschen Flugzeugen und britischen Jagdfliegern gekommen. Auch an der Südküste Englands und der Ostküste sind mehrmals deutsche Flugzeuge wahrgenommen worden.
Berlin, 24.11.39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe setzte ihre Erkundungstätigkeit über französischem Gebiet fort. Zwischen den zur Unterstützung der Aufklärungsflugzeuge und zum Schutze des Grenzgebietes eingesetzten deutschen Jägern und feindlichen Flugzeugen kam es wiederholt zu Luftkämpfen. Hierbei wurde ein englisches Flugzeug bei Verdun, ein Flugzeug bei Saarbrücken und ein französisches Flugzeug durch Flak bei Zweibrücken abgeschossen.
London, 24.11.39. Nach hier verbreiteten Meldungen haben deutsche Marineflugzeuge gestern nacht erneut die Themsemündung überflogen.
Berlin, 25.11.39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: An der Westgrenze fanden vereinzelt Aufklärungsflüge des Feindes im Grenzgebiet statt, während deutsche Aufklärer bis nach Mittelfrankreich hinein vordrangen.
Berlin, 25.11.39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Nachdem die Feststellungen über die Kampfhandlungen am 23. Nov. ein genaues Bild ergeben haben, kann mitgeteilt werden, daß bei Luftkämpfen in der Gegend Zweibrücken zwischen deutschen Messerschmitt-Flugzeugen und französischen Jagdflugzeugen (Moräne) zwei weitere französische Flugzeuge abgeschossen wurden, so daß die Gesamtzahl der am 23. Nov. abgeschossenen feindlichen Flugzeuge sich auf fünf erhöht.
Von den deutschen Aufklärern, die gestern bis nach Westfrankreich vorstießen, sind vier Flugzeuge vermutlich über französischem Gebiet abgeschossen worden, zwei sind in Frankreich notgelandet, eines davon bei Vouziers, ein weiteres Flugzeug wird vermißt.
Berlin, 26.11.39. Oberk. d. Wehrmacht: Am 25. Nov. griffen Verbände der deutschen Luftwaffe englische Seestreitkräfte in der nördlichen Nordsee an. Dabei wurden vier Volltreffer, darunter einer auf einem Kreuzer der „Aurora"-Klasse, erzielt.
Die Aufklärungstätigkeit der Luftwaffe erstreckte sich am gestrigen Tage wiederum bis über die Shetland-Inseln. Der Feind versuchte am gestrigen Nach-
mittag über Helgoland nach Nordwestdeutschland einzufliegen, wurde aber beim Erreichen der Nordseeküste von der deutschen Flakartillerie zur Umkehr gezwungen. Verluste sind bei der deutschen Luftwaffe nicht zu verzeichnen.
Brüssel, 26.11.39. Am vergangenen Mittwoch (22.11.) starben drei deutsche Fliegersoldaten östlich von Calais unweit der belgischen Grenze den Heldentod. Sie wurden im Luftkampf mit einem zahlenmäßig weit überlegenen Gegner tödlich getroffen und stürzten mit ihrer Maschine auf belgisches Gebiet ab. Der vierte Insasse, der im Gefecht völlig unverletzt geblieben war, konnte sich im Fallschirm retten. Die Gefallenen wurden unter militärischen Ehrenerweisungen durch die belgische Wehrmacht aufgebahrt. Der deutsche Botschafter in Brüssel war anwesend und dankte zum Schluß den belgischen Behörden und Offizieren.
27.11.39. Oberk. d. Wehrmacht keine Bekanntmachungen über Luftwaffe.
Brüssel, 27.11.39. Die drei deutschen Flieger, die, wie berichtet, im Luftkampf bei Calais tödlich getroffen und mit ihrer Maschine auf belgischem Gebiet abgestürzt waren, wurden am Sonnabend (25.11.) in ihre Heimat überführt.
Berlin, 28.11.39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe beschränkte sich infolge der Wetterlage auf Aufklärungstätigkeit in Grenznähe.
Berlin, 28.11.39. (DNB.) Vor mehreren Tagen mußte ein Kampfflugzeug der deutschen Luftwaffe nach einem erfolgreichen Flug über französischem Gebiet nach starkem Sturm infolge Vereisung in den Vogesen notlanden. Das Verhalten der dreiköpfigen Besatzung ist besonders anerkennenswert. Obwohl zum Teil verwundet, vernichteten sie das Flugzeug und das sonstige wertvolle Material und haben sich dann über den Schweizer Jura nach schweizerischem Gebiet durchgeschlagen. Die Schweiz hat den Fliegern alle Hilfe angedeihen lassen und sie interniert.
Berlin, 29.11.39. (DNB.) Oberk; d. Wehrmacht: Englische Flugzeuge versuchten wiederum, über die ostfriesischen Inseln nach Nordwestdeutschland einzufliegen, ohne jedoch die Küste zu erreichen. Hierbei wurde der Fliegerhorst Borkum angegriffen. Schaden wurde nicht angerichtet.
Berlin, 29.11.39. (DNB.) Am Mittwoch fand ein Luftkampf über der britischen Grafschaft Northumberland zwischen einem deutschen Aufklärer und einem englischen Jäger statt. Der Aufklärer, der in großer Höhe flog, wurde aus einem Wolkenloch heraus von dem Engländer überrascht und erhielt mehrere Teffer, ohne daß er hierdurch irgendwie in seiner Aktionsfähigkeit behindert wurde. Der englische Jäger flog bis auf 50 m an das deutsche Flugzeug heran und wurde von dem MG.-Schützen mit mehreren längeren Feuerstößen abgewehrt. Die deutsche Besatzung stellte daraufhin fest, daß der englische Jäger plötzlich seine an sich günstige Angriffsposition aufgab und seitlich nach unten in die Wolken abkippte. Das deutsche Aufklärungsflugzeug ist, ohne weiteren Angriffen ausgesetzt gewesen zu sein, wohlbehalten in den Heimathafen zurückgekehrt. Es hat seinen Auftrag voll durchführen können.
Berlin, 30. 11. 39. Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftaufklärung gegen England wurde fortgesetzt.
Berlin, 1. 12. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Bei der Luftaufklärung über der Nordsee gerieten die eingesetzten Kräfte in ein schweres Unwetter. Vier Flugboote mußten auf See niedergehen und wurden teilweise beschädigt. Die Besatzungen sind sämtlich gerettet.
Berlin, 3. 12. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: An der Mosel- und Rheinfront sowie in der Gegend von Karlsruhe und Freiburg geringe eigene und feindliche Jagdfliegertätigkeit.
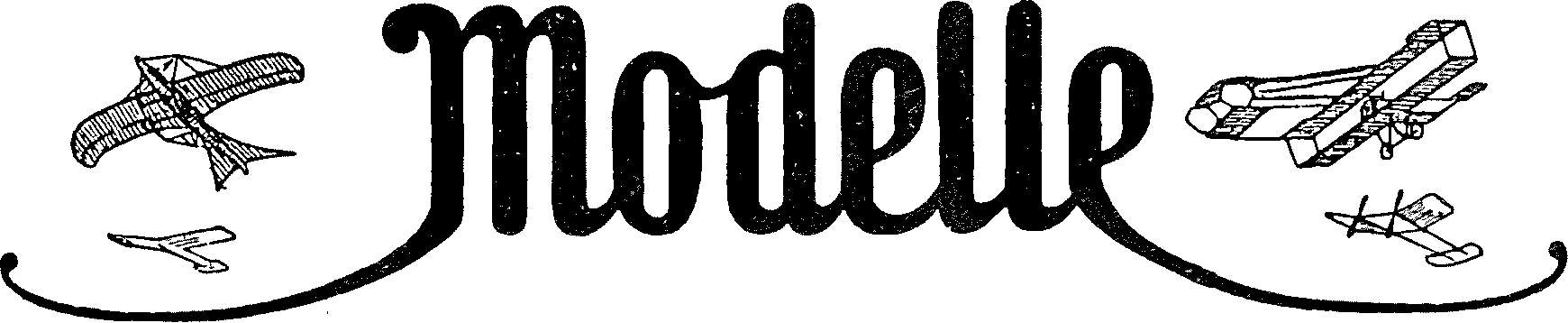
Wakefield-Pokal, Ergebnisse des Modell-Wettfliegens am 6. 8. bei New York. Erlaubt waren drei Flüge, gewertet wurde der Durchschnitt und bester Flug. 1. Korda (USA.) 950 Sek. Durchschnitt, bester Flug 43 Min. 26 Sek. 2. Boowers (Canada) 272 Sek. Durchschnitt, bester Flug 12 Min. 3. Giovanni (Frankreich) 216 Sek. Durchschnitt, bester Flug 9 Min. 4. Copland (England) 211 Sek. Durchschnitt, bester Flug 5 Min. 5. Lees (England) 168 Sek. Durchschnitt.
Berichtigung zu der im „Flugsport" 1939 Nr. 24 erschienenen Abhandlung „Ergebnisse der Luftschraubenforschung". Es muß richtig heißen auf S. 566, Zeile 8: vs =Vv2 + u2; S. 566, Z. 11: nach der Beziehung; S. 566, Z. 21: Für den Steig-
flugbereich Ol = 0,65). Bei den Abb. 3, 7, 9 und 10 lautet die Bezeichnung der
Ordinate richtig —jz-z-
V (M = 0,5)
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
The Aircraft Year Book for 1939, 21. Annual Edition. Herausgeber Howard Mingos. Preis 6 Dollar. Veröffentlicht durch Aeronautical Chamber of Commerce of America, Rockefeller Plaza, New York.
Die Vorgänge in Europa in den letzten Jahren sind für das USA.-Flugwesen bestimmend gewesen. Das vorliegende 21. Jahrbuch, Ausgabe 1939, vermittelt einen Einblick in die Tätigkeit und Ereignisse des vergangenen Jahres in USA. in Zivil- und Militärflugwesen. Man erkennt, daß USA. in Flugzeug- und Motorenindustrie größte Anstrengungen macht, um sich auf dem Weltmarkt zu erhalten. Aus den 14 Kapitelüberschriften seien kurz folgende erwähnt: „Army Air Corps", „Marine-Luftstreitkräfte", „Küstenbewachung", „Tätigkeit der USA.-Regierung", „Bemerkenswerte Flüge des Jahres 1938", „Luftlinien der Staaten", „Privatfliegen", „Schulung und Erziehung" u. a. m.
INGENIEUR
für Konstruktion und Versuch
mit guten theoretischen Kenntnissen,
Technischer
PHYSIKER gesucht.
Handschriftliche Bewerbungen mit Lichtbild, Lebenslauf und Zeugnisabschriften erbeten an
FLUGTECHNISCHES INSTITUT STUTTGART. RUIT ÜBER ESSLINGEN
ORIGINAL - RHÖN - ROSSITTEN -
STARTSEILE
I. G. KARL SCHMIDT & Co.
SOLINGEN, Postfach 15
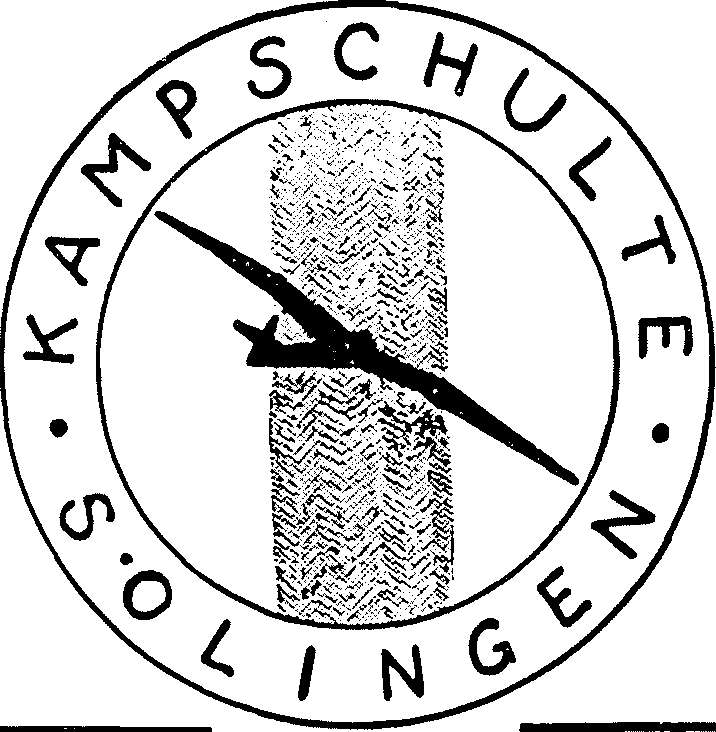
GUMMIKABEL GUMMIRINGE
VERLANGEN SIE KOSTENLOS: MUSTER, DRUCKSCHRIFTEN U. ANSCHAUUNGSMATERIAL
Gewichtsersparnis q
Erhöhung der Sicherheit Erleichterung für Konstrukteur und Pilot
i )sind die Vorzüge unserer
Deutsche Benzinuhren G. m. b. H.r Berlin SW 29
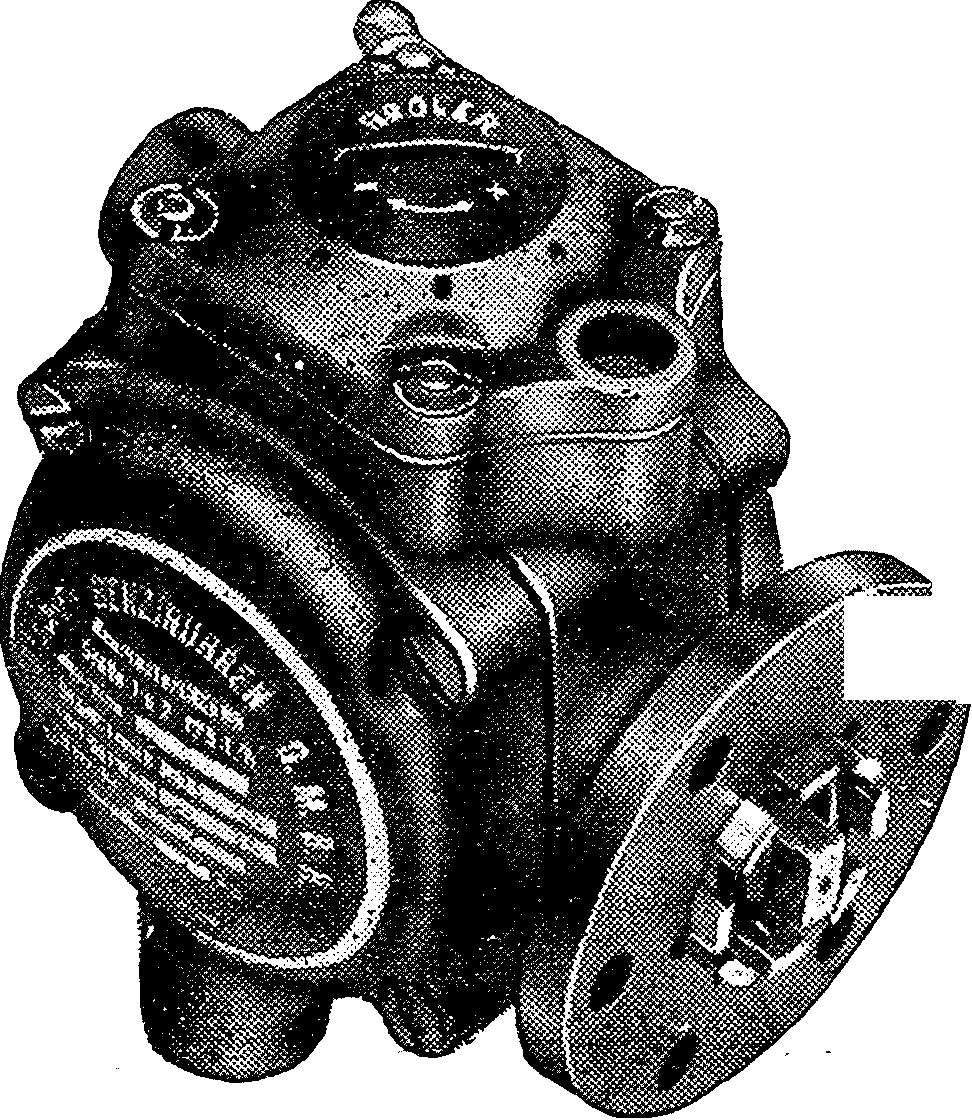
Ein so gut wie fabrikneuer
Muster Kroeber M 4, mit Prüfschein, zu verkaufen. Angebote unter Nr. 7837 an den Verlag des ,,Flugsport", Frankfurt a. M., Hiridenburgplatz 8, erbeten.
Flugleiter
mit langjährig. Tätigkeit in der Luftfahrtindustrie u. umfassenden techn. u. kaufm. Kenntnissen. Auslandspraxis, Flugkapitän, Anf. 30, sucht in Berlin oder Nähe bei ordnungsmäßig.Lösung des jetzig. Dienstverhältnisses aufgabenreich., leitend. Posten.
Angebote unter 7836 an den Verlag des „Flugsport", Frankfurt a. M., erbeten.
ϖn,lctieMi«weida
IMasdiinonbou / Automobil- w. Flvgfdmik I Etektrotodtnik. Programm kostonlos I
Birken-Flugzeug Sperrholzplatten
deutsches Fabrikat
bei Rekordflügen erprobt, in den Qualitäten: AVIATIC, SPEZIAL, QLEITFLUQ in allen Stärken von 0,4-8 mm liefert prompt ab Lager
Georg Herfe BerlinsCharlottenburg
Kaiser Friedrich-Straße 24 Fernspr.-Sammelnummer: 34 5841 rslgr.-Adr.- FHeKerholzer Berlin
^en- und Fallsdiirme
aller Art
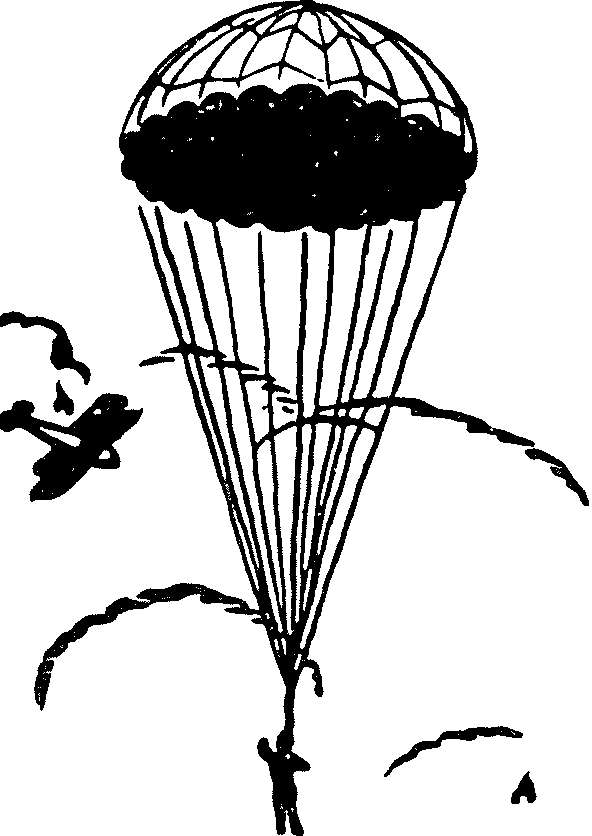
SCHROEDER & CO.
Berlin^iVeukölln
Bergstraße 93-95
Xlteste Flugzeug-« Fallschirm-Fabrik der Welt
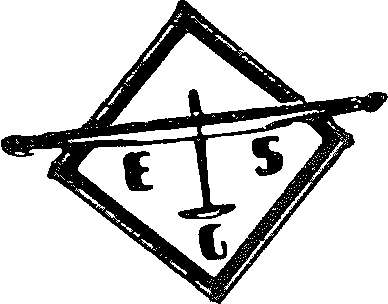
Ich liefere
Übung*-
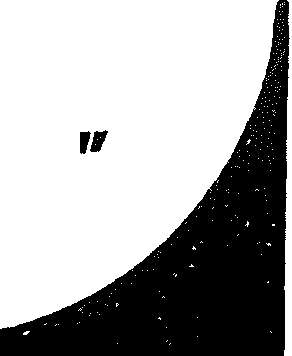
Ahaa Schneider
Zta#&a Gratia"
Der
vi
Mod
34/2
Mod. 34/28
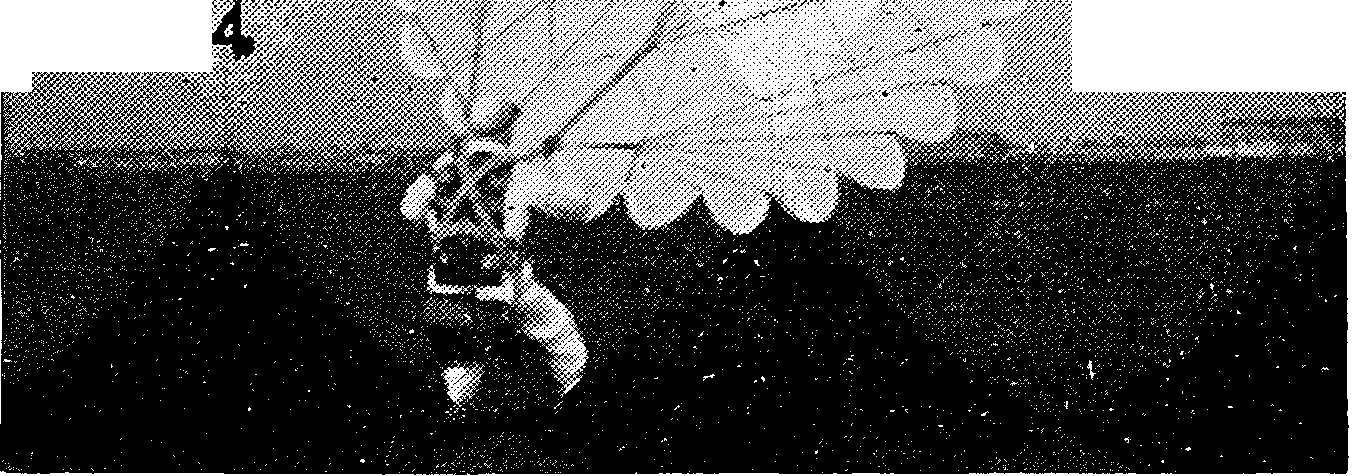
lOOfach praktisch erprobt
Zugelassen für 400 km/h
Der sicherste Lebensretter des Fliegers
Kleine Packung - Geringes Gewicht KOHNKE FALLSCHIRMBAU, BERLIN W 35
Navigationsgeräte
für
Flugzeuge
und
Luftschiffe
w. Ludolph
Bremerhaven
Heft 26/1939

In
GEGRÜNDET 1908 u. HEKRUSGEGEBEN VON 0SK71FL URSINUS * CIVIL-ING.
wm
Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen
Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburg-PIatz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro xh Jahr bei Htägigem Erscheinen RM 4.50
Tele!.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit ,.Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Ouellenangabe gestattet.
Nr. 26
20. Dezember 1939
XXXI. Jahrgang
Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 3. Januar 1940.
Weihnachten 1939.
Das ereignisreiche Jahr 1939 geht zu Ende. Der Führer hat Europa den Frieden erhalten wollen. Die Hand wurde zurückgeschlagen. Jeder einzelne hat es mit erlebt, gehört: Großbritannien und Frankreich wollten den Krieg, um Deutschland restlos zu zerschlagen. Und da gibt es nur eins: Dem Gegner die Waffen aus der Hand schlagen.
Unsere Männer in den Bunkern, auf See und in der Luft stehen kampfbereit auf der Wacht. Gerade jetzt zu Weihnachten brauchen sie sich um ihre Familie nicht zu sorgen. Auch hier steht alles abwehrbereit. Ueberau — so auch in Werken der Luftfahrt, werden neue Waffen geschmiedet, die an der Front benötigt werden, um den Gegner zu überwinden.
Die bisherigen Leistungen im vergangenen Jahr haben gezeigt, daß wir Waffen zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu schaffen vermögen, die den Widerstand des Gegners brechen können. Ja — wir fühlen uns stark genug, diese Leistung noch erheblich zu. steigern. Wir werden nicht stillstehen. Jeder Tag bringt Fortschritte und Leistungssteigerung in der Waffenentwicklung. Die Front kann sich auf die Waffenschmieden der Heimat verlassen.
Wir werden nicht eher ruhen, bis an der Front das Ziel erreicht ist.
Zur Zeit sind noch lauge nicht alle Kräfte für eine weitere Erstarkung der Luftwaffe eingespannt. Neben der Forschung auf allen Gebieten nimmt alles seinen gewohnten Verlauf. In den Segelfliegerschulen des NSFK. wird weiter geschult. In den Modell- und Segelflug-Werkstätten wird gebaut und repariert. In den Flugzeugfabriken baut man Sport- und Verkehrsflugzeuge. Die Ausbildung von Ingenieuren, Konstrukteuren und Technikern auf den Hoch-, Ingenieur- und Mittelschulen hat sich nicht vermindert, sondern hat zugenommen. Im Schrifttum wird die Entwicklung des Flugwesens nicht vernachlässigt.
Verehrte Leser des Flugsport! Bitte sparen Sie unnütze Nachnahmespesen und senden Sie uns die fällige Bezugsgebühr für das 1. Vierteljahr 1940: RM 4.50, möglichst auf unser Postscheckkonto 7701 Frankfurt a. M. Nach dem 3. Januar werden wir diese zuzüglich 30 Pf. Spesen durch Nachnahme einziehen.
Diese Nummer enthält Patent-Sammlung Nr. 18 und Report-Sammlung Nr. 17.
Heinkel He 46 (1933) Aufklärungsflugzeug.
Dieser abgestrebte Hochdecker in Gemischtbauweise, ein Mehrzweckeflugzeug, zweisitzig, Führersitz vorn, Beobachter nah dahinter, wird als Aufklärer verwendet.
Flügel, starke Pfeilform, mit zwei Streben nach Rumpfunterseite abgefangen. Die Streben sind in halber Länge gegen die Flügelholme nochmals abgestützt. Flügel zweiholmig, Kieferngurte, Sperrholzstege. Flügelnase Sperrholz, das übrige mit Stoff bespannt.
Rumpf Stahlrohr, geschweißt, mit aufgesetzten Holzformleisten. Behäutung an der Oberseite ganz, Unterseite teilweise aus Blech; sonst Stoffbespannung.
Höhenflosse, etwas über dem Rumpf liegend, durch V-Streben abgestützt. Höhen- und Seitenruder ausgeglichen. Seitenflosse Leichtmetallgerüst, mit Blech beplankt. Höhenflosse und -rüder Dural, letzteres nur stoffbespannt.
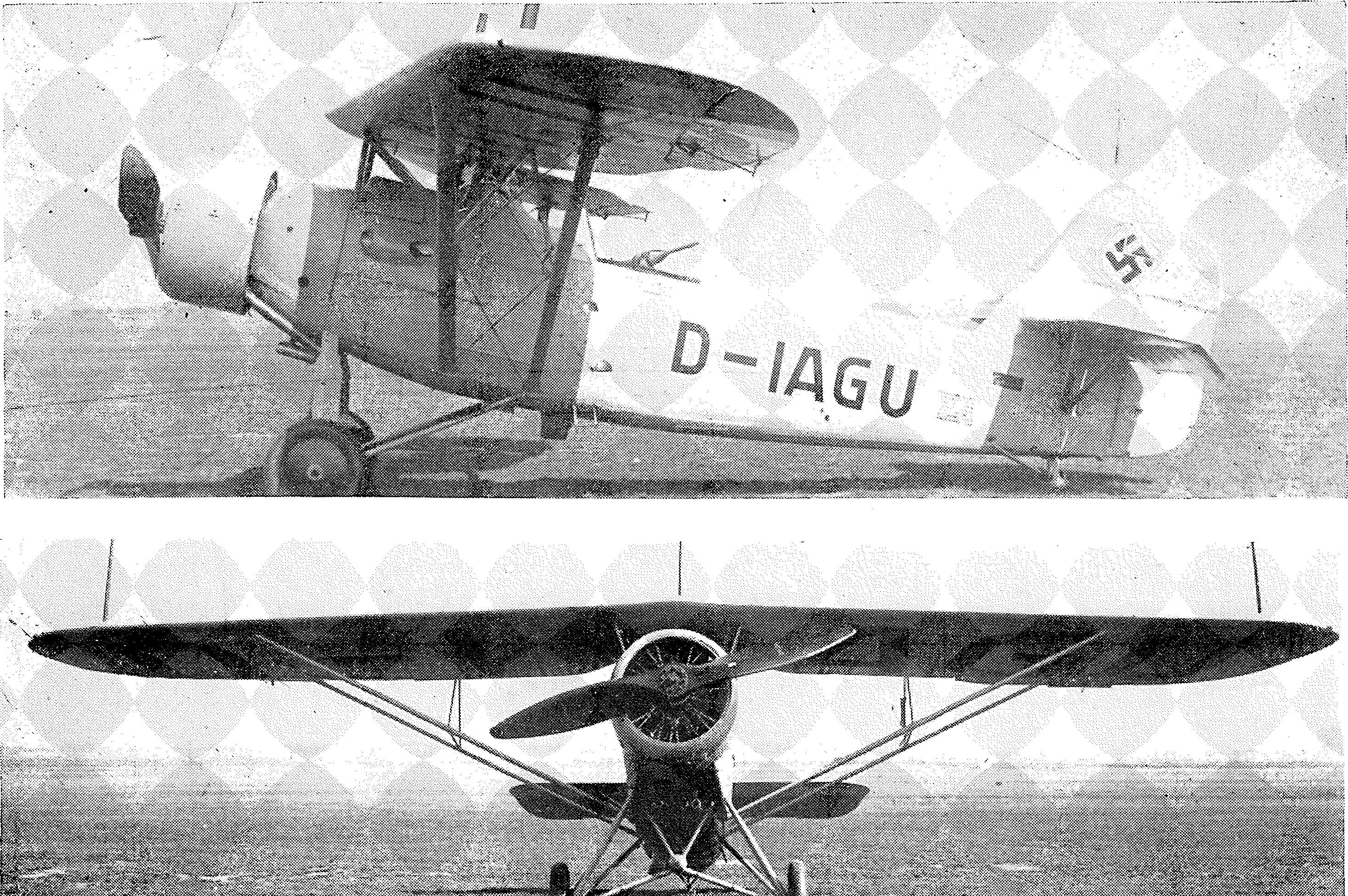
Heinkel He 46, Aufklärungsflugzeug.
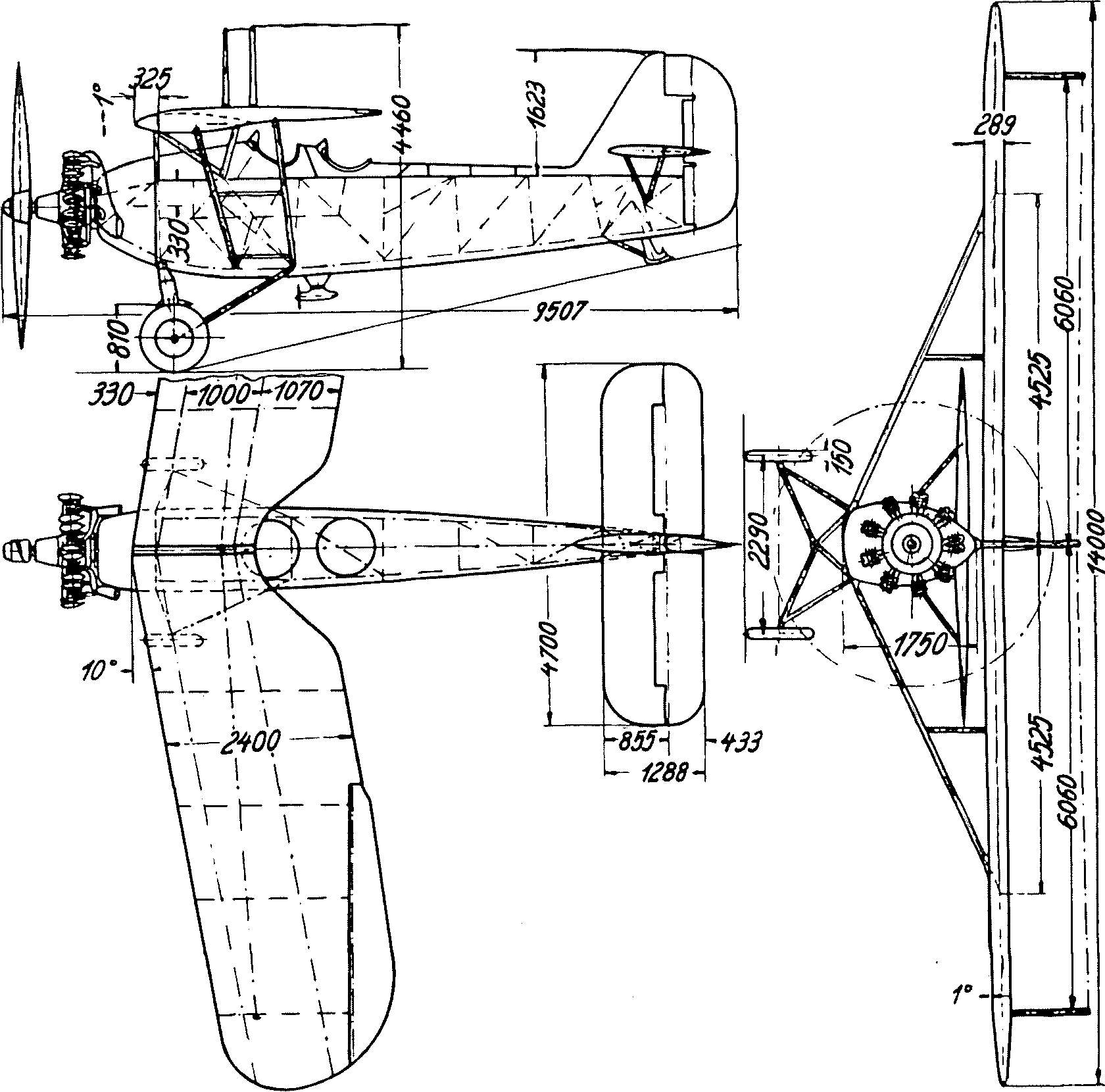
Werkbilder
Fahrwerk V-Streben mit Halbachsen, Oeldruckfeder-strebe. Schwanzsporn mit Oeldruckfederung.
Motor Bramo 322 (5 A M 22 B), 600 PS.
Spannweite 14 m, Länge 9,5 m, Flügelinhalt 32,2 m2, Rüstgewicht 1765 kg, Fluggewicht 2300 kg. Höchstgeschwindigkeit 260 km/h, Landegeschw. 95 km/h, Steigzeit auf 1000 m 2,6 min, Gipfelhöhe 6000 m._
Heinkel He 46, Aufklärungsflugzeug. Freigeg. d. RLM. 9. 11. 39.
Werkzeichnung:
Heinkel He 50.
Land-Doppeldecker He 50, Verwendungszweck als Ein- oder Zweisitzer für Sturzbombenangriffe und Aufklärung.
Flügel Metallbauweise, 2 Stahlholme und Leiclitmetallrippen, Verkleidung Stoff und Leichtmetallblech. Leitwerk Leichtmetallgerüst, Blechbeplankung und Stoff.
Stahlrohrrumpf geschweißt, Formgebungsbögen aus Holz. Ver-
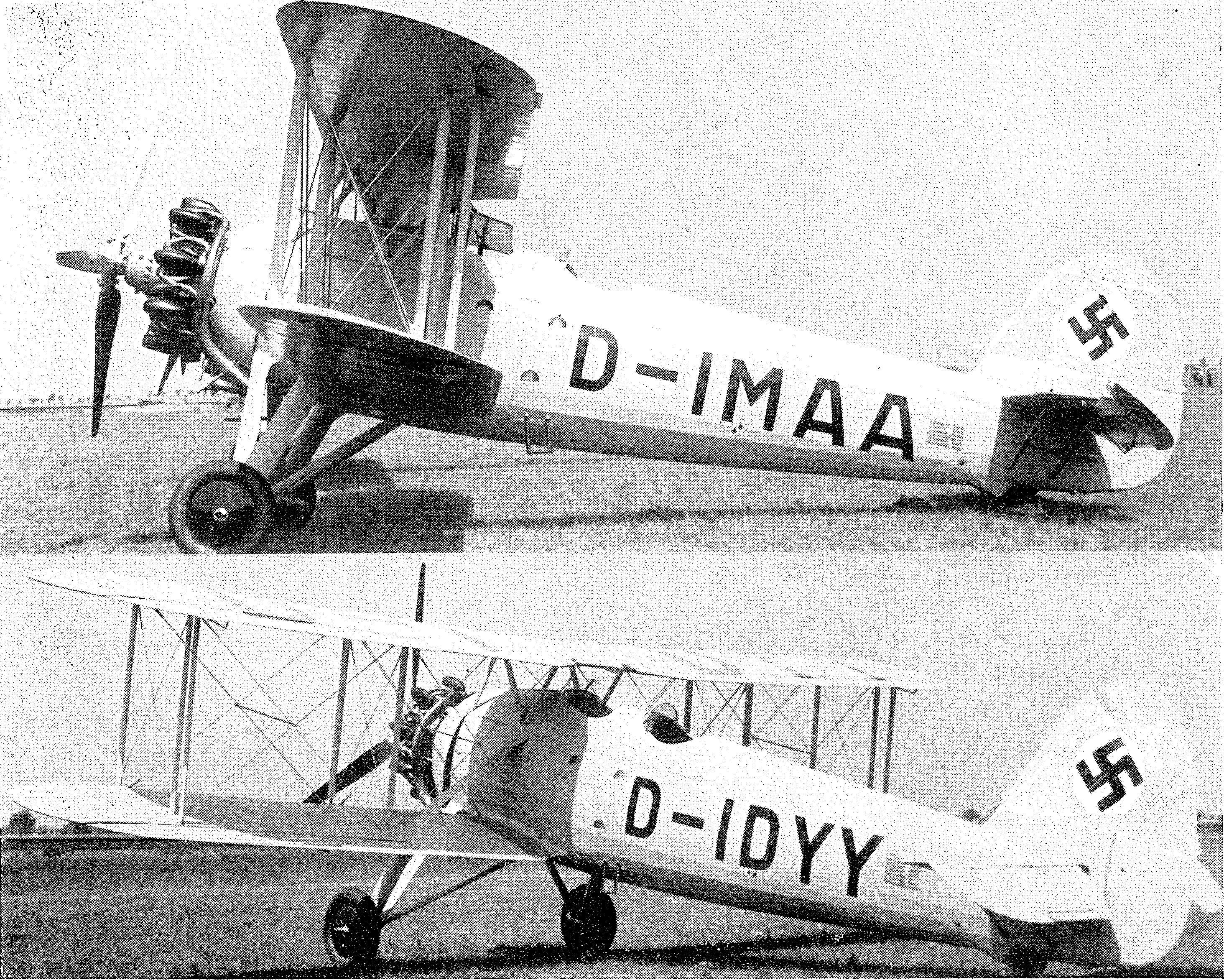
Heinkel He 50. Land-Aufklärungsflugzeug.
Werkbilder
kleidung Leichtmetall blech und Stoff. Tragwerk zweistielig verspannt. Geteiltes Fahrwerk.
Motor SAM 22 B, 600 PS.
Spannweite 11,5 m, Länge 9,6 m, Flügelinhalt 34,8 m2. Fluggewicht 2620 kg. Höchstgeschwindigkeit 235 km/h, Lande- —j^f
geschwindigkeit —l^
95 km/h, Steigzeit auf 1000 m 3 min, Gipfelhöhe 6400 m.
Heinkel He 50. See-Aufklärer. Freigeg. d. RLM. 9.11.39.
Werkzeichming
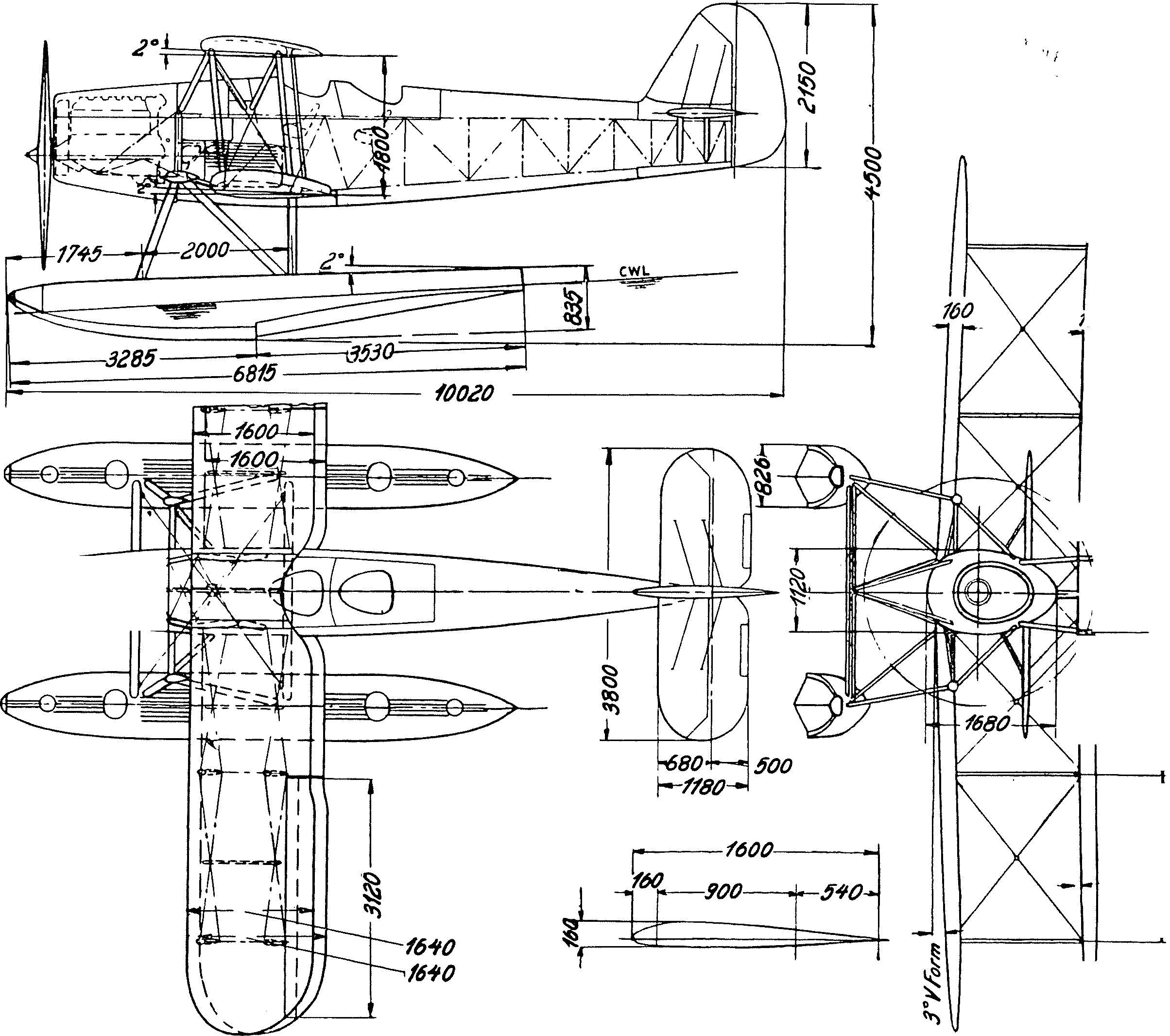
mm
llill

USA Nationale Luftrennen.
Ueber die Rennen um die verschiedenen Trophäen (Bendix, Qreve, Thompson) berichteten wir in der Nr. 23/1939 S. 555.
Geschwindigkeitssteigegerungen waren nicht zu verzeichnen, ebenso, wie nebenstehende Abbildungen erkennen lassen, auch keine Neuerungen in der Konstruktion.
Tony Levier, welcher die Höchstgeschwindigkeit, 445 km/h, im Greve-Trophy-Rennen erreichte, mußte wegen Motorstörung vor dem Ziel aufgeben.
Verschiedene Flugzeuge waren mehr auf Sensation zugeschnitten. Murphy brachte einen verstrebten Eindecker mit doppeltem Fahrwerk für Rückenfluglandung, wie ihn Hans Grade bereits vor 1914 bei seinen Schauflugvorführungen zeigte.
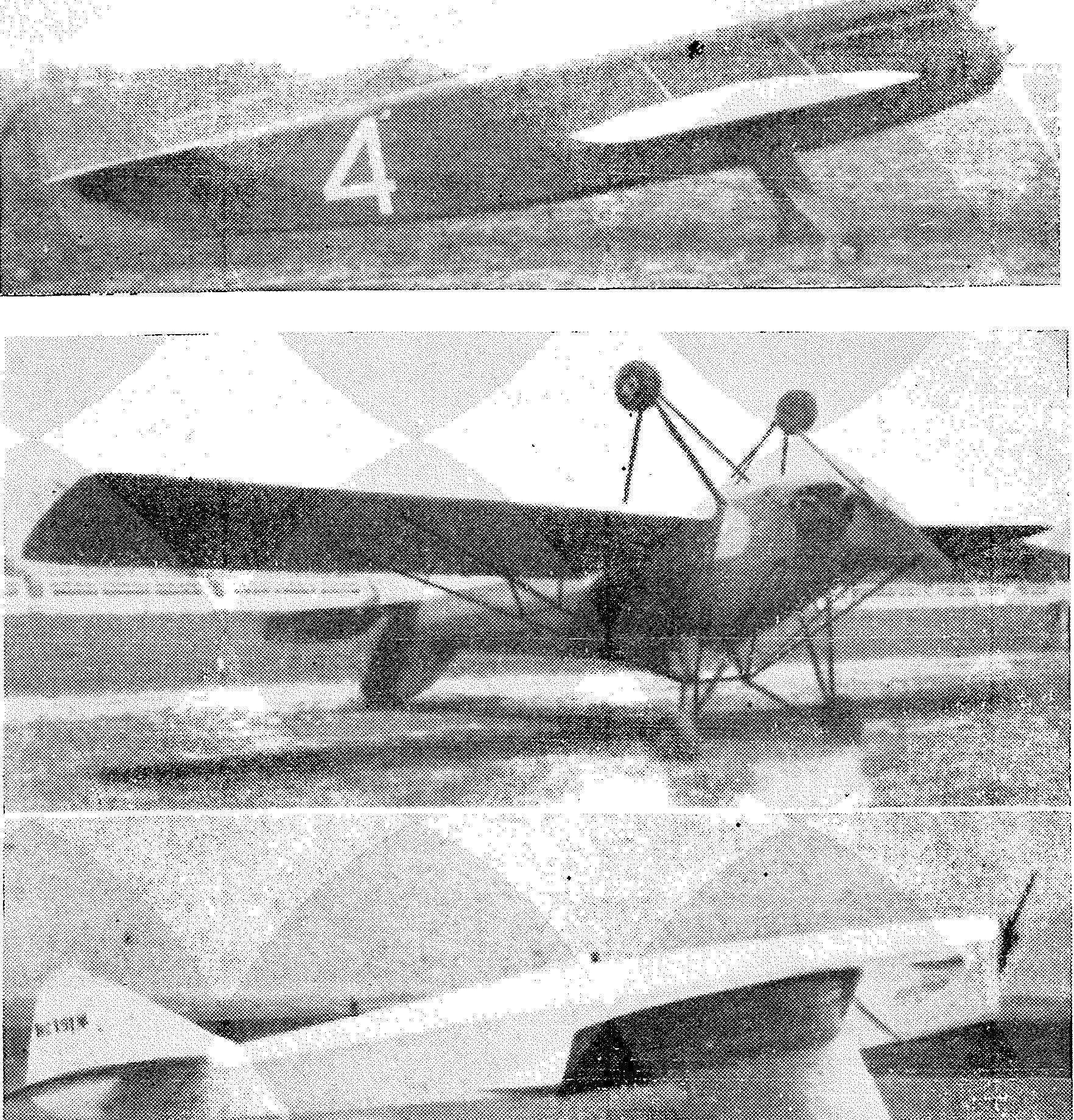
USA. Nationale Luftrennen (von oben nach unten):
Firecracker mit Menasco von Toni Levier.
Marcoux-Bromberg, Flugzeugführer Earl Ortman.
Laird-Rennflugzeug mit Twin Wasp geflogen von Roscoe Turner, Sieger im Thompson-Trophy - Rennen. Vergleiche auch Typenbeschreibung des Laird, Flugsport 1938, S. 691.
Keith Rider „Eightball" (Nr. 18) wurde nicht rechtzeitig fertig zum Rennen.
Wittmann Special (Curtiss D-12) (Nr. 4) wurde Vierter im Thompson-Rennen.
Murphy, mit doppeltem Fahrwerk, für Rückenfluglandung. Motor 65 PS Continental.
Miles Sparrow Hawk.
Fesselschrauber.
Der in Abb. 1 und 2 gezeigte engl. Fesselschrauber soll nach einem lange bekannten Vorschlag als Ersatz des ein großes Ziel bildenden und vom Winde in seiner Leistungsfähigkeit beeinträchtigten Fesselballons zum Tragen von Netzsperren oder auch für Spähzwecke von Kriegsschiffen aus Verwendung finden.
Das gegen Verdrehung gesicherte Fesselkabel 19 führt Dreiphasenstrom in einen Induktionsmotor, dessen Rotor 3 als Wirbel-strom-(Käfig-)Anker und dessen ebenfalls umlaufendes Stator 2 mit dem alles umschließenden Gehäuse 1 fest verbunden ist. Die eine der beiden gleichartigen Hubschrauben (8) wird von dem Gehäuse 1, die andere, auf Achse 10 freilaufende Schraube (9) von der Rotorwelle 4 aus angetrieben; zwischen den beiden Schrauben ist ein epizyklisches Getriebe 14 mit Untersetzung eingeschaltet. Der Hubschrauber wird am Boden oder auf dem Schiff von einem je nach Ein- oder Ausbringe-Richtung einstellbaren, mit der Kabelwinde zusammengebauten Ring aufgenommen und kann von unten steuerbar gemacht werden.
Abb. 2 zeigt eine weitere Ausbildung. Sie gestattet dem Fesselschrauber eine gerichtete waagerechte Bewegung oder bei Wind eine Schwebestellung an Ort oder über einem fahrenden Schiffe zu geben, und ist zur Aufnahme von Mannschaft und Waffen eingerichtet. Das Hubschrauber-Gehäuse 1 läuft hier in einem Ring 24, der gegen den Rumpf verschwenkbar ist (Britisches Patent 509 848).
Eine andere Art von Fesselschraubern stellt eine in jüngster Zeit bekannt gewordene Ausführungsform dar, die, wie es heißt, von der USA.-Marine auf einem Kriegsschiff erprobt worden ist und sich bewährt hat. Es ist, vgl. Abb. 3, ein USA.- T r a g schrauber-Drachen, bei dem statt eines Motors die Energie des Windes als Triebmittel dient.
An dem Rückgrat 4 eines Holzgestells sitzt vorn ein schmales Tragflügelpaar 14 aus Balsaholz in V-Stellung, hinten ein Flossenwerk aus gleichem Baustoff; auch hinter der mittleren Hauptstrebe 5 steht eine Flosse 20. An einem formänderbaren Strebenpolygon, dessen Hauptteil ein Metallwinkelstück 34 ist, ist die Tragschraubenachse 29/31 schwenkbar gelagert. Die Drehflügel sind an ihrer Nabe frei schwingbar und derart schräg angelenkt, daß beim Hochschlagen ihr Einstellwinkel kleiner wird. Das Fesselseil greift an
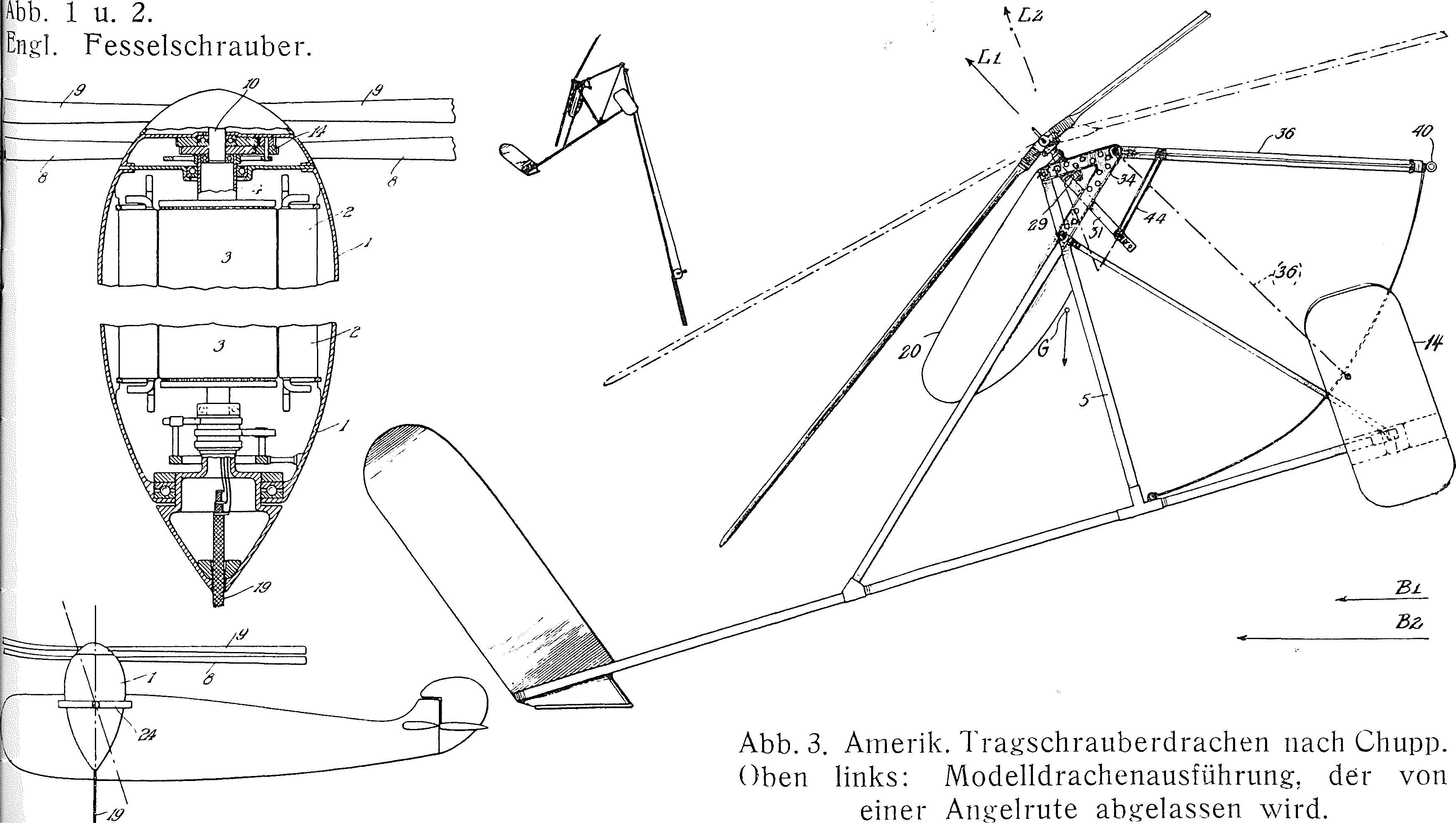
der Oese 40 einer Stange 36 an, die um die Winkelstückecke schwenkbar ist und bei deren Verschwenkung über Lenker 44/31 des Polygons sich die Lage der Tragschraubenachse in minderer Weise ändert. Ist der Wind — dargestellt durch den Pfeil Br — schwach, der Schraubenzug Li, der auf irgend eine bekannte Weise vor dem Aufstieg in Umlauf versetzten Tragschraube gering, so haben die beschriebenen Teile etwa die Lage zueinander, wie sie Abb. 3 mit ausgezogenen Linien zeigt; das bei 40 angreifende nicht gezeichnete Seil hat dann wie die Stange 36 einen ziemlich spitzen Winkel zur Horizontalen. Bei starkem Winde (Pfeil B2) nimmt die Drehzahl und der Schraubenzug L2 zu und läßt den Drachen eine höhere Lage gewinnen. Gleichzeitig mit dem Steigen des Geräts ändert sich die Lage der Stange 36 und damit die Lage der von ihr gekippten Tragschraubenachse, deren Umlaufebene sich einer waagerechten Lage nähert, wie dies durch strichpunktierte Linien in der Abbildung angedeutet ist. Bei sehr starkem Winde kann dieser Tragschraubendrachen eine Stellung fast senkrecht über dem Ort des Seilfesselpunktes erhalten.
Durch das Zusammenwirken der verschiedenen Stabilitätsfaktoren, nämlich der geschilderten in Abhängigkeit vom Seilangriff eintretenden Eigenkippung der ein gegensinniges Drehmoment zum Seilzugmoment erzeugenden Tragschraube, ferner der hinteren Höhenflosse, die negativ geschränkt in bezug auf die Starrflügel 14 ist, und mit Hilfe einer richtigen Schwerpunktslage (G), stellt sich auch bei heftigen Böen das Gerät schnell wieder in eine Gleichgewichtslage ein; sein hohes Auftriebsvermögen gestattet auch schwache Winde auszunutzen. Es läßt sich für die verschiedensten Windverhältnisse auftrimmen, und zwar durch Aenderung der Lage des Drehzapfens für die Tragschraubenachse; für diesen Zweck hat das Winkelstück 34 eine Anzahl Bohrungen.
Horn Segelflug-Einheitsgerät.
Dieses Gerät wurde auf der Wasserkuppe während des Rhön-Segelflug-Wettbewerbs 1939 vorgeführt. Die Fassung von 5 Instrumenten in einem runden Gehäuse, welche eine denkbar günstige
Gruppierung ermöglichte, beansprucht wenig Raum, läßt sich sehr leicht auf irgendeiner Schotte anbringen und bietet den einzelnen Instrumenten weitgehendsten Schutz.
Nebenstehende Abbildung zeigt dieses Segelf lug-Einheitsgerät von Dr. Th. Horn, Leipzig. Oben Kompaß, 45 mm Durchmesser, rechts Fahrtmesser, Meßbereich bis 150 km/h, links Stauscheibenvario-
Horn - Einheitsgerät für
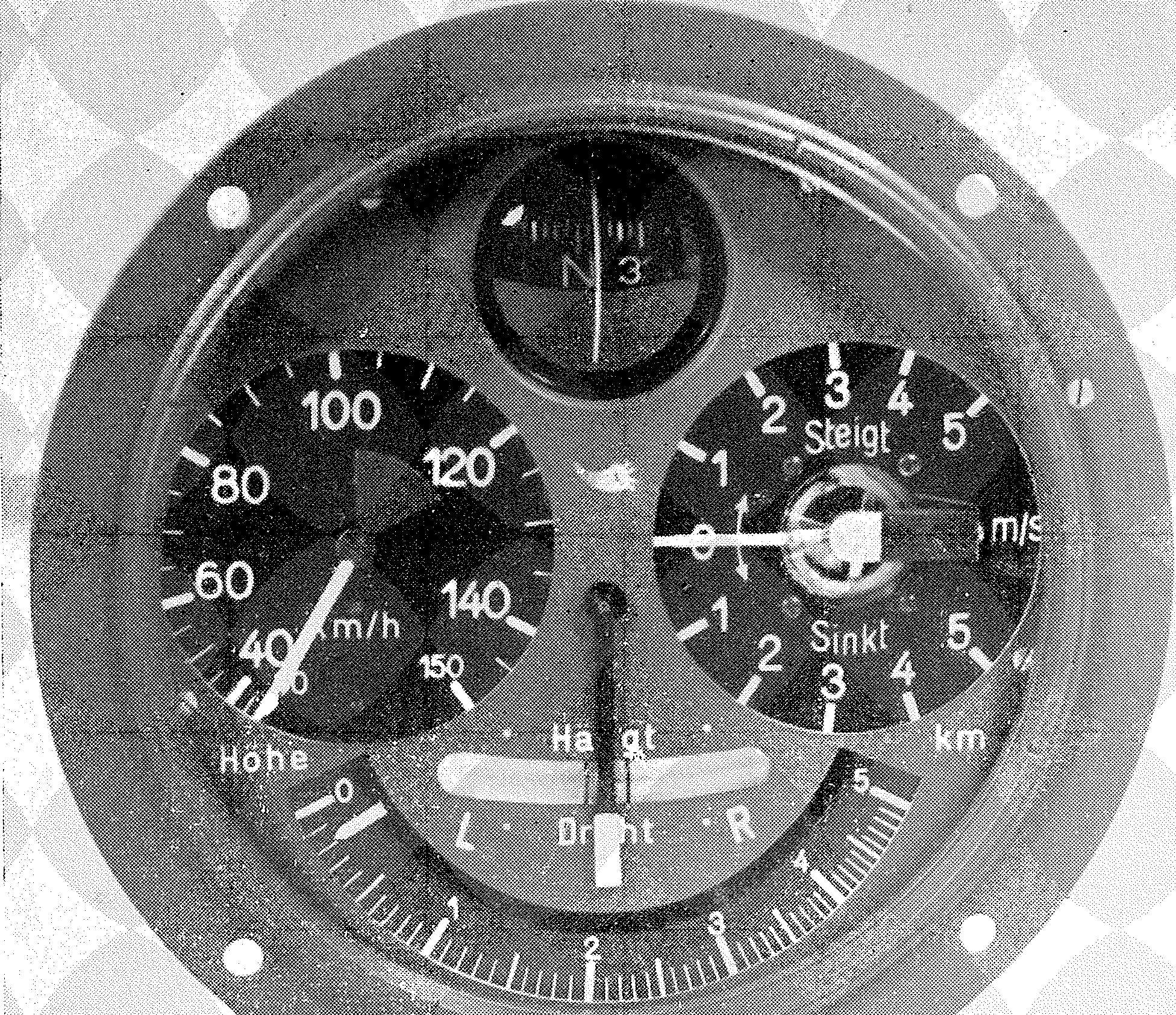
REPORT-SAMMLUNG OES „FLUQSPORT"
NATIONAL ADVISORy COMMITTEE FOR
1939
AERONAUTICS
Nr. 17
The Aerodynamic Characteristics of Six Full-Scale Propellers Having Different Air-foil Sections. (Die aerodynamischen Eigenschaften von 6 Propellern wahrer Größe mit verschiedenen Btattprofilen.)
D. Biermann, E. P. Hartmann, Report Nr. 650, 1939. 10 Cents. 2 Fotos, 40 Kurventafeln, 5 Zahlentafeln.
Mit dem Erreichen immer höherer Fluggeschwindigkeiten werden an die aerodynamischen Eigenschaften der Luftschrauben immer größere Anforderungen gestellt. Aus diesem Grunde erklärt sich auch der verhältnismäßig hohe Anteil der Luftschraubenarbeiten des NACA. In dem vorliegenden Bericht werden 6 Dreiblattpropeller von 3,05 m & in Verbindung mit einem wassergekühlten Reihenmotor untersucht. Alle Propeller sind identisch bis auf die Blattprofile, die die folgenden Merkmale aufweisen:
wölbung wölbungs-
propell.-z, (navy üep.l
blattprofil
°/o t
rücklage
ü/o t
5868—9 Clark Y 2,6 40
5868—R6 RAF 6 4,0 30
6623—A NACA 4400 4,0 40
[ NACA 4400 ~„ r j innen 4,0 40
662d—ü < NACA 2400-34
[ außen 2,0 40
6623—C NACA 2r200 2,0 30
6623—D NACA 6400 6,0 40
Koordinaten der Profile im Anhang. Die Blattumrißform und die Profile zeigt Abb. 1. Blattwinkelbereich von 15° bis 40°, bei Clark Y bis 45°. Die Profile Clark Y und RAF 6 konnten bisher als Standardprofile in Amerika bezeichnet werden. Bei früheren Versuchen hatte sich ergeben, daß das Profil Clark Y ein kleineres cw min und ca max hat, woraus auf die besondere Eignung dieser Profile für den Schnellflug- und Reisebereich geschlossen werden konnte. Andererseits ist dieses Profil im Startbereich bei festen Propellern unterlegen. Die Unterschiede sind auf die verschiedene Form der Profilskelettlinie zurückzuführen, die bei RAF 6, besonders im Profilvorderteil, stärker gewölbt ist. Das Profil NACA 4409 hat ein hohes ca max bei niedrigem cw min, kann daher als guter Kompromiß zwischen Clark Y und RAF 6 angesehen werden. NACA 2409-34 zeichnet sich durch kleines cw min aus, und zeigt verzögertes Abreißen im Kompressibilitätsbereich, andererseits bleibt ca max klein, so daß dieses Profil auf die Verwendung als Spitzenprofil beschränkt bleibt. Profil NACA 2r200 zeichnet sich durch kleine cw min und ca max
Werte aus, während bei NACA 6400 beide Beiwerte hoch sind.
Bei den Versuchen wurde die Propellerdrehzahl konstant gehalten, während die Kanalgeschwindigkeit stufenweise bis auf 52 m/s gesteigert werden konnte. Höhere Werte des Fortschrittsgrades wurden erreicht, indem die Motordrehzahl verringert wurde, bis der Schub den Wert 0 annahm. Kompressibilitätseinflüsse wurden durch Einhalten einer oberen Grenze der Spitzengeschwindigkeit von 160 m/s ausgeschaltet.
Ergebnisse: Die größte Differenz im Vortriebswirkungsgrad bei Propellern mit verschiedenen Profilen betrug annähernd 3%. Die besten Wirkungsgrade konnten bei Profilen mit geringerer Wölbung beobachtet werden, und zwar ergab sich die folgende Rangordnung: NACA 2400-34, Clark Y, NACA 2r200, NACA 4400, RAF 6 und NACA 6400. Die Differenz im Startbereich bei Verstellpropellern schwankte zwischen 2 und 8%, je nach Profil, Beiwert Cs und Vergleichsgrundlage. Unter diesen Gesichtspunkten ergab sich bei gleichem Durchmesser die folgende Rangordnung: RAF 6, NACA 4400, Clark Y, NACA 6400, NACA 2r2oo, NACA 2400-34. Wurde dagegen der Durchmesser des jeweils maximalen Wirkungsgrades im Hochgeschwindigkeitsbereich verändert, war die Rangordnung: NACA 2r2oo, Clark Y, NACA 4400, NACA 2400-34, R A F 6 und NACA 6400. Die Diffe-
Clark Y section, propeller 5868-9r.
RA.F. section, propeller 5Ö6Ö-R6.
NA.CA. 4400 series, propeller 6623-A;also inner half of propeller 6623-B.
N.A.C.A. 2400-34 series. outer half of propeller 6623-B.
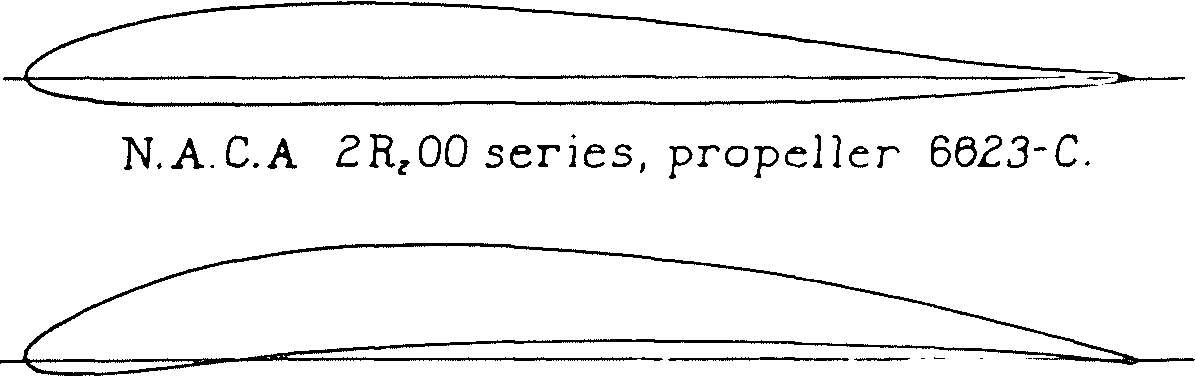
Abb 1 N.A.C.A. 6400 series. propeller 6623-D.
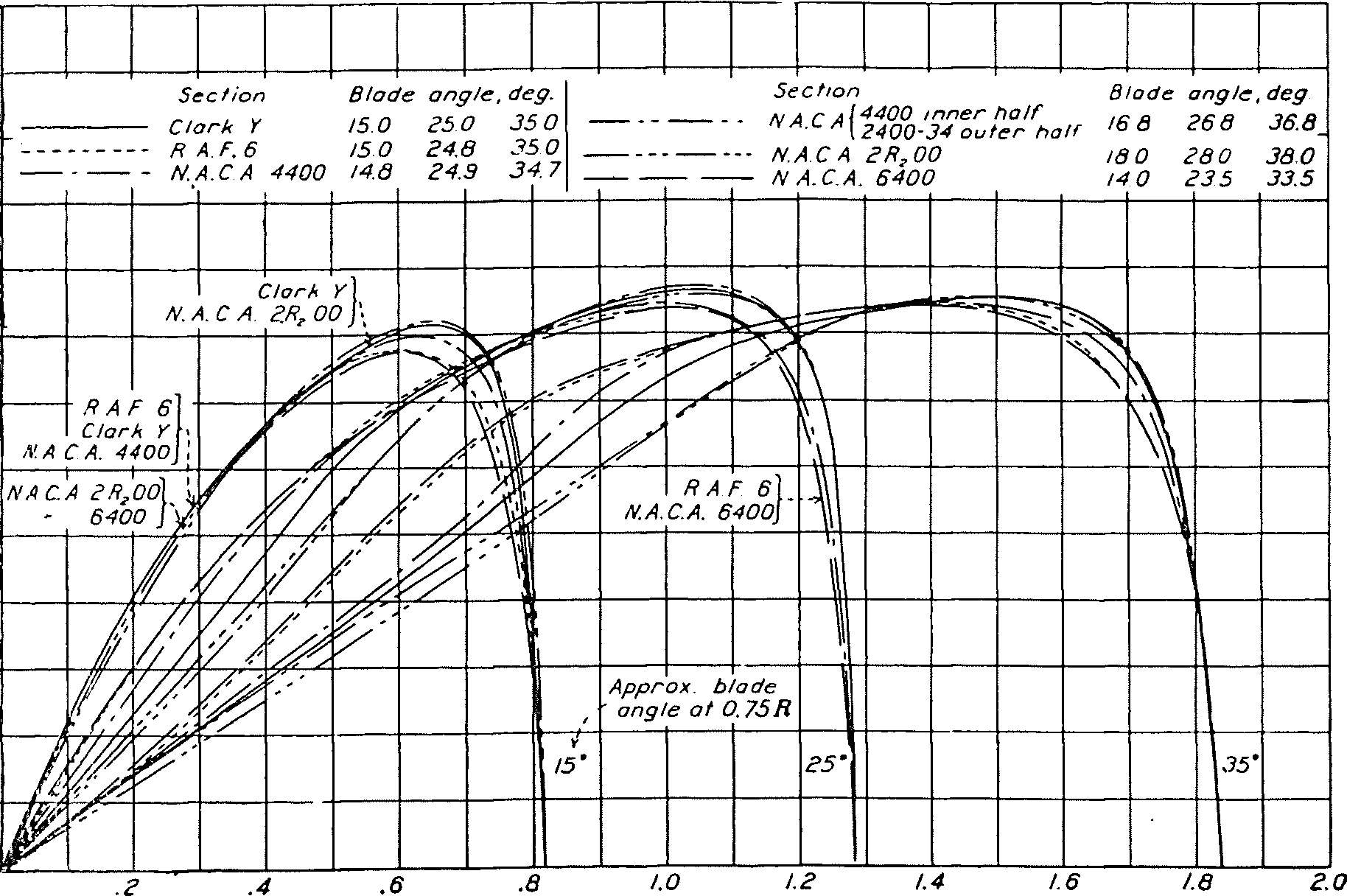
Abb. 2.
renz von v im Startbereich schwankte in weiten Grenzen: RAF 6 oder NACA 6400, NACA 4400, Clark Y, NACA 2R200 und NACA 2400—34.
Die Profilauswahl bei Verstellpropellern, ohne Begrenzung durch den Durchmesser, soll nach Möglichkeit auf der Basis des cw min erfolgen, weil ca max nur geringen Einfluß auf die aerodynamischen Eigenschaften im Startbereich hat, da Strömungsablösung noch nicht auftritt. Bei Festpropellern erfolgt die Profilauswahl vorteilhaft auf der Grundlage von Cw rnin und ca min' besonders für Blattwinkel von 20° und darüber. Für Propeller gleichen Durchmessers war der Startschub im allgemeinen dem ca max proportional. Bei einem Vergleich der Profile Clark Y und R A F 6 mit verschiedenen Dickenverhältnissen bei Verstellpropellern gleicher Durchmesser, zeigte sich ein dünneres Profil (RAF 6, cl/t — 0,07) einem gleich dicken Profil Clark Y überlegen: bei d/t = 0,09 waren beide Profile gleichwertig. Bei diesen Versuchen erübrigte sich eine Korrektur von v in bezug auf Kompressibilitätseinflüsse, da M Werte von 0,8 bis 0,9 annahm. Lediglich im Startbereich war eine Korrektur notwendig. Im übrigen hatte die Kompressibilität die Tendenz, die bei Propellern mit verschiedenen
__N.A. C. A 2409 - 34
|
I j |
\ |
||||||||||
|
1 |
-RA.F. 6 S&C tir>n |
- |
|||||||||
|
!ϖ |
cL = |
0.5 |
|||||||||
|
:/ |
|||||||||||
|
! i |
/ |
||||||||||
|
\ |
«Äc 109- 'CtiC |
A. 34 |
|||||||||
|
t i / |
sc Q |
r>, 3 ' |
|||||||||
|
J |
|||||||||||
4 .6
VI Yl
Abb.3.
Profilen auftretenden Differenzen auszugleichen.
In der Abb. 2 ist v über dem Fortschrittsgrad für alle untersuchten Profile aufgetragen worden. Aufschlußreich ist Abb. 3, in der die Profilwiderstandsbeiwerte über der Machschen Zahl aufgetragen wurden. Danach wird das Profil R A F 6 weniger durch Kompressibilität beeinflußt als NACA 2409-34; ersteres ist daher als Blattspitzenprofil vorzuziehen.
The Knocking Characterfstics of Fuels in Relation to Maximum Permlssible Performance of Aircraft Engines. (Die Klopfeigen-schaflen von Kraftstoffen in Beziehung zur höchst zulässigen Leistung von Fingmoloren.)
A. M. Rothrock, A. E. Biermann, Report Nr. 655, 1939. 10 Cents. 27 Kurventafeln, 11 Zahlentafeln.
Die Entzündung in einem Kraftstoff-Luftgemisch kann sich auf zweierlei Weise fortpflanzen, und zwar erstens langsam, indem benachbarte Schichten durch die freiwerdenden Wärmemengen auf Entzündungstemperatur gebracht werden, und zweitens durch Detonation. Durch eine im Gemisch auftretende Kompressionswelle entsteht eine Drucksteigerung, die wiederum eine Temperaturerhöhung bis zur Entzündung bewirkt, die sich ebenfalls mit der Geschwindigkeit der Kompressionswelle ausbreitet. Dieser Betriebszustand wird mit „Klopfen'' bezeichnet.
In diesem Bericht werden Klopfeigenschaften von Kraftstoffen untersucht und die Einflüsse verschiedener Faktoren herausgestellt. Die mitgeteilten Ergebnisse gestatten eine Bestimmung der Beziehungen zwischen dem Verdichtungsverhältnis und dem maximalen mittleren Druck einerseits, sowie zwischen dem kleinsten spezifischen Kraftstoffverbrauch und dem für einen bestimmten Kraftstoff höchst zulässigen Druck andererseits. Die Ergebnisse können ferner zur wirtschaftlichen Kraftstoffauswahl herangezogen werden. Einleitend werden zunächst die Resultate früherer Versuche analysiert und erweitert. Im zweiten Teil werden auf Grund der gewonnenen Klopfcharakteristiken die wechselseitigen Beziehungen zwischen Verdichtungsverhältnis, Einlaßluft-Temperatur und -Druck, Kraftstoffverbrauch und Höchstdruck angegeben. In einem dritten Teil schließlich werden die Klopfeigenschaften mit den Oktanzahlen der untersuchten Kraftstoffe verglichen. Die durch Frühzündung verursachten Unregelmäßigkeiten im Motorbetrieb sollen in diesem Bericht nicht besonders behandelt werden.
Ergebnisse: Wenn die Klopfeigenschaften eines Kraftstoffes als Funktion der höchst zulässigen Dichte der Einlaßluft-Temperatur bei jeder Temperatur derselben bestimmt
|
Cur |
J |
L |
1 1 |
|||||||
|
£ |
85 percant 30 35 —-- lao-octane Iso-ocfone |
|||||||||
|
_5 |
ri |
|||||||||
|
*' |
Oml |
fetra |
ethyl |
|||||||
|
C |
Pratio |
|||||||||
|
\, |
x 7.25 o S.00 |
|||||||||
|
o |
||||||||||
<nlst~ oir temperature, 'F.
werden, können die zu einem Verdichtungsverhältnis und einem Druck der Einlaßluft gehörenden Werte auch für eine Reihe anderer Dichten der Einlaßluft-Temperatur und Verdichtungsverhältnisse, bei verschiedenen Temperaturen der Einlaßluft, verwendet werden. Eine nähere Betrachtung der Faktoren, die das Klopfen beeinflussen, führt zu dem Schluß, daß als wichtigste unabhängige Veränderliche die Dichte und Temperatur des Gemisches und das Mischungsverhältnis anzusehen sind. Bei zunehmender Drehzahl konnte eine Steigerung der Höchstleistung bei konstantem Zündpunkt beobachtet werden, während bei Frühzündung (Fehlzündung) das umgekehrte eintrat. Für einen bestimmten Kraftstoff ist die höchstzulässige Motorleistung dem Verdichtungsverhältnis umgekehrt verhältig, vorausgesetzt, daß die Einlaßluft-Temperatur konstant gehalten wurde, weiter die Leistung durch Klopfen und nicht durch etwa auftretende Frühzündung begrenzt wird. Wird die Vergaserluft vorgewärmt, ist eine Leistungszunahme mit kleiner werdendem Verdichtungsverhältnis zu beobachten, die jedoch wieder zu Null wird, wenn der Exponent der adiabatischen Kompression im Verdichter ansteigt. Bei dem in diesem Bericht gegebenen Beispiel hatte der Exponent einen Wert von 1,6, und die Leistung erhöhte sich erst, nachdem das Verdichtungsverhältnis einen Wert von 6,3 angenommen hatte. Wurde das Verdichtungsverhältnis weiter herabgesetzt, so nahm die Leistung entsprechend ab.
Wie die Ergebnisse zeigen, können bis zu einem gewissen Grade Wechselbeziehungen zwischen der Klopfcharakteristik verschiedener Kraftstoffe, die in verschiedenen Motorenmustern verwendet werden, erhalten werden. Bei einer Darstellung der Ergebnisse auf der Basis der höchst zulässigen Vergaserluft-Dichte ergab sich, daß die Oktanzahlen vorteilhaft mit der Motorleistung in Beziehung zu setzen sind, die wiederum von den Oktanzahlen und den jeweiligen Betriebsbedingungen des Motors abhängig ist. Die Kurven der Abbildung
stellen Grenzkurven der oberen Klopfwerte verschiedener Kraftstoffe dar, aufgetragen in Abhängigkeit von der Einlaßluft-Tempe-
p
ratur und einem Dichtefaktor R ~; R ist
11
das Verdichtungsverhältnis, Pi der Druck der Einlaßluft und Ti die Temperatur der Einlaßluft.
The Column Strength of Two Extruded
Aluminium-Alloy H-Sections. (Die Knickfestigkeit zweier gesogener H-Profile ans Aln-m in in m-Leg iernng.)
W. R. Osgood, M. Holt, Report Nr. 656, 1939. 10 Cents. 20 Kurventafeln, 9 Fotos, 6 Zahlentafeln.
Gezogene Profile aus Aluminium-Legierung mit verschiedenen Querschnitten finden als Druckglieder und Schalenversteifungen im Flugzeugbau Verwendung. Um derartige Teile richtig bemessen zu können, ist die Kenntnis der Knickfestigkeit notwendig. Bei Verwendung als Hautversteifung ist dar-
Abb. 1.
|
---e~.-- |
---1 |
|
|
\ |
r dl |
|
|
i ■ *-i |
\ |
f *i |
|
K 1 |
X |
K u |
|
Cross Section p,- |
A |
Cross Section B |
Abb. 2.
|
\ |
\ |
o / + t |
~reely supp ~/ast/co//y r |
orted ends estrained e |
nds |
|
\ |
\ |
||||
|
♦\ |
\ |
||||
|
4-0.5X'f v |
\—~Eu/e |
r curve |
|||
|
\ 1 |
|||||
|
1 |
|||||
|
\ |
|||||
|
\ |
K |
||||
1.5
30
über hinaus der „doppelte Modul", den man am besten ebenfalls aus Knickversuchen ermittelt, erforderlich.
Die in diesem Bericht mitgeteilten Ergebnisse stammen aus Versuchen, die auf Anregung des NACA von dem Nationalen Normenbüro ausgeführt wurden. Die Profile hatten als Werkstoff die Legierung Alcoa 24 S-T, eine Aluminium-Kupfer-Magnesium-Legierung, mit einem 1,5% Mangangehalt, die etwa unserer Legierung 681 B entspricht. (Etwas höherer Mn Gehalt!) Die Abmessungen der untersuchten Profile zeigt Abb. 1. Zunächst wurden Zug -und Druckversuche ausgeführt, um die grundlegenden Materialeigenschaften zu bestimmen. Die eigentlichen Knickversuche wurden mit freien und elastisch eingespannten Stabenden ausgeführt.
Ergebnisse: In Abb. 2 sind einige Resultate der Knickversuche dargestellt, o ist p
. Es bedeuten: P die größte vom Querschnitt aufgenommene Belastung, A die Querschnittsfläche des Profils, S die Festigkeit an der Streckgrenze bei Druck. Ao ist
darin ist lo die freie Stablänge,
i der Trägheitsradius, E der Elastizitätsmodul. Die drei Probestücke mit dem kleineren 2o zeigen offenbar lokale Ausbuck-lung durch Biegung, bevor noch die maximale Belastung erreicht wird, so daß die entsprechenden Werte von o niedriger (auf der sicheren Seite) bleiben. Weitere Versuchsergebnisse in der Zahlentafel. Die
24S-T Exlruded H-Beam
_L.jj.yi
n l r
Nr. 658, 1939. 10 Cents. 2 Fotos, 20 Diagramme.
Die bisherigen Propelleruntersuchungen des NACA wurden bis zu Blattwinkeln von 45° in 0,75 r durchgeführt, was Fluggeschwindigkeiten von 175 m/s und Blattspitzengeschwindigkeiten von 305 m/s entsprach. Um für größere Fluggeschwindigkeiten Propellerdaten zur Verfügung zu haben, wurden in diesem Bericht die Blattwinkel auf 60° ausgedehnt, womit sich der Bereich der Fluggeschwindigkeit auf 225 m/s und der Bereich der Spitzengeschwindigkeit auf 305 m/s ausdehnt. Abb. 1 zeigt die Beziehungen zwischen dem zu bestem Wirkungsgrad gehörenden Blattwinkel, der Fluggeschwindigkeit und der Spitzengeschwindigkeit für den Propeller 5668 — 9.
Untersucht wurden 3 Dreiblattpropeller von 3,05 m <&, die von einem Curtiss-Conqueror-Motor von 600 PS angetrieben wurden. Blattprofil Clark Y. Unterschiedlich war nur das Steigungsverhältnis der beiden Propeller: 5668 — 9 hat für 15° in 0,75 r gleichmäßige Steigungsverteilung in der äußeren Blatthälfte, 5668 —X2 bei 35° in 0,75 r.
Ergebnisse: Bei Blattwinkeln von 60° war der Wirkungsgrad 9% kleiner gegenüber 30°. Durch eine Propellerhaube konnte bei 60° eine Verbesserung von 7%, bei 30° eine solche von 3% erzielt werden. Der Versuch, den Wirkungsgrad bei hohen Blattwinkeln
Abb. 2.
Abb. 1.
|
Specimpn |
Length (in.) |
Weight (lb.) |
Slen-der-ness ratio |
Mea<=ure'1 crooked-ness i (in.) |
Actual average area ' (sq. in.) |
Maximum column load (lb.) |
Colurau strength (lb./sq.in.) |
|
Cross section A, specimeus tested as columns witli flat ends |
|||||||
|
1-96....... 1-72....... 3-60a...... 3-18_______ 1-39 . |
96.46 72.42 60. 34 48. 27 38. 96 28. 96 18. 04 9. 73 4.94 |
6. 357 4.765 3.976 3. 176 2. 564 1.929 1.201 .640 . 319 |
200 150 125 100 80 60 37 20 10 |
0.025 .013 .030 .006 |
U. 6$9 .658 .659 . 658 .658 .666 . 666 .658 .646 |
6, 530 11, 150 15, 950 19, 600 22, 030 25, 600 29, 300 33, 180 32. 330 |
9,910 16, 950 24,200 29, 790 33, 480 38, 440 43,990 50, 430 50, 050 |
|
4-29a...... 2-19....... |
----- |
||||||
|
4-10....... |
|||||||
|
1-5........ |
|||||||
Cross section A, sppcimens tested as columns with round ends.J
|
2-96------- |
96. 48 |
6.358 |
200 |
0.040 |
0. 659 |
1,800 |
2, 730 |
|
2-72....... |
72.44 |
4. 770 |
150 |
. 014 |
.658 |
3,050 |
4,640 |
|
3-60b...... |
60. 35 |
4,000 |
125 |
.024 |
.663 |
5, 200 |
7,840 |
|
4-48....... |
48.30 |
3. 173 |
100 |
.021 |
.657 |
6, 850 |
10, 420 |
|
3-39....... |
38. 68 |
2. 557 |
80 |
.014 |
.661 |
11,600 |
17, 550 |
|
4-29b...... |
29.01 |
1.909 |
60 |
.015 |
.658 |
17, 330 |
26, 300 |
|
4-19....... |
19. 44 |
1.276 |
40 |
.013 |
. 656 |
(') |
(«) |
|
/ |
[7 |
||||||||
|
/ |
|||||||||
|
T/p^speed |
A |
||||||||
|
9C I.Oi |
TO-.. |
||||||||
|
V |
|||||||||
|
/) |
A |
1 |
|||||||
|
|i |
|||||||||
|
-Propeller 5868-9(plD c angle af 15-ot 0.75R ---Propeller 5B6B-3(with ---------- . 3668%/p/D c ongle of 35' of 0.75R |
Ipir |
||||||||||
|
25 |
30 |
3 |
5' |
40^ |
|||||||
|
HZ. |
t ~" |
||||||||||
|
^? |
|||||||||||
|
5'Blod |
Ol |
O./ |
SR |
||||||||
|
High- |
spe |
ed |
ϖ.onditionfeffi |
env |
|||||||
|
25 |
|||||||||||
|
15' |
'v1 |
\ |
O' |
||||||||
|
> |
5' |
||||||||||
|
y |
y |
1 |
\ |
||||||||
|
tlO |
Bio |
de ong |
le |
7l 0.75 R |
|||||||
|
| | | \Take-off |
diti |
on |
|||||||||
|
(not |
0.25 C, |
for |
ntr |
o/'/c |
ble |
Pf |
|||||
letzte Spalte enthält die Werte für die Knickfestigkeit des Querschnittes A; die Werte müssen mit dem Faktor 0,0703 multipliziert werden, um auf kg/cm2 zu kommen.
Tests of Two Full-Scale Propellers with Different Pitch Distributions, at Blade Angles
Up To 60Q. (Versuche mit zwei Propellern wahrer Größe mit verschiedenen Steigungsver-teiliwgen bei Blattwinkeln bis mi 60°.)
D. Biermann, E. P. Hartmann, Report
Design air speed, m.p.h,
durch Verkleinerung der geometrischen Steigung der Blattspitzen zu verbessern, ergab eine geringe Abnahme des Wirkungsgrades im Hochgeschwindigkeitsbereich und einen Gewinn im Startbereich. Der untersuchte Blattwinkelbereich ist anwendbar bis zu Fluggeschwindigkeiten von 225 m/s in Bodennähe, und bis zu 190 m/s in H = 10,5 km, vorausgesetzt, daß die Kompressibilität nicht vorher den kritischen Wert annimmt. In Abb. 2 werden die Wirkungsgrade der beiden Propeller verglichen.
Effect of Service Stresses on Impact Resistance, X-Ray Diffraction Patterns, and Microstructure of 25 S Aluminium Alloy.
(Einfluß von Dauerbeanspriichiingen auf Schlagbiegefestigkeit, Beugung von X-Sir ahlenb ahnen und Mikrostruktur von 25 S Aluminium-Legierungen.)
J, A. Kies, G. W. Quick, Report Nr. 659, 1939. 10 Cents. 6 Skizzen, 7 Diagramme, 20 Fotos, 3 Zahlentafeln.
Wie Untersuchungen von Probestäben kurz vor dem Bruch ergeben haben, hat die Materialermüdung einen bestimmten Einfluß auf die Dauerfestigkeit, wobei es für das endgültige Ergebnis belanglos ist, ob die Beanspruchungen während einer langen Betriebsdauer oder während Schwingungsversuchen im Laboratorium aufgetreten sind. Um die Veränderungen in der Materialstruktur zu klären, wurden im Jahre 1938 vom Nationalen Normenbüro eine Reihe von Legierungen, die vornehmlich für Propellerblätter Verwendung finden, untersucht. Es konnten zwei Arten des Bruches unterschieden werden: 1. die Gefügeveränderungen traten im gesamten Probestück auf, und 2. nur lokal. Im letzteren Falle ist der Bruch auf die Querschnittsverkleinerung zurückzuführen, kann daher auch nicht mehr mit Ermüdungsbruch bezeichnet werden. Bei 1. dürfen Kerb- und Korrosionseinflüsse nicht vorhanden sein.
Im ersten Teil des Berichtes wird der Einfluß der Schwingungsbeanspruchung auf die Schlagbiegefestigkeit untersucht, im zweiten Teil werden die Beugungen von Röntgenstrahlen zur Vorausbestimmung von Ermüdungsbrüchen herangezogen. Im dritten Teil wird über die Bildung von Gleitebenen und Aderung berichtet.
Zusammensetzung der Legierung 25 S: Cu 4,4%, Mn 0,76%, Si 0,82%, Fe 0,43%, Rest AI. Nach Glühen bei 515° C und anschließendem Abschrecken in kaltem Wasser hat die Legierung die Bezeichnung 25 SW, nach einem zwölfstündigen Alte-

Abb. 1.
Gleitebenenbildung in einem Propellerblatt der Legierung 25 ST. Vergrößerung lOOmal.
rungsprozeß bei 140° bis 146° C ist die Bezeichnung 25 ST*). Die zulässige Schwingungsfestigkeit von 25 ST wird mit 1055 kg/cm2 bei 5 Mill. Lastwechseln angegeben. Temperaturbereich bei den Schlagbiegeversuchen — 190° C bis 99° C.
Den Vorteil der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung hat die Untersuchung mittels Röntgenstrahlen, deren Bahn durch Kristallveränderungen (Störung des Kristallgitters durch elastische Deformation) abgelenkt wird, woraus auf einen Ermüdungsbruch geschlossen werden kann. Die Erscheinung der „Gleitebenenbildung" wurde vorzugsweise bei im Betrieb zu Bruch gegangenen Propellerblättern beobachtet. Die Deformation eines Werkstückes einer bestimmten Legierung kann auf Gleitungen der Kristal-lite längs einer Gleitebene zurückgeführt werden, wodurch eine faserartige Kristall-
*) Zugfestigkeit o — 3670 kg/cm2, Mindestfestigkeit an der Streckgrenze 002 — 2250 kg/cm2.
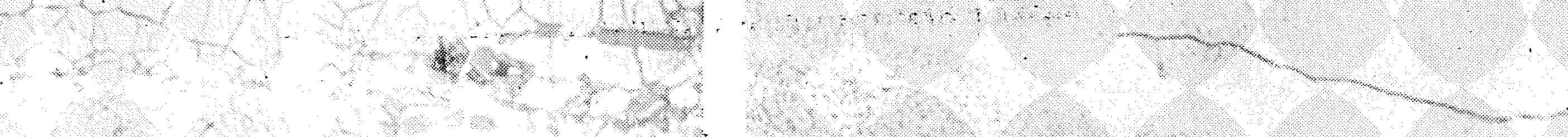
Abb. 2a. Aderbildung in einem Probestab im Anlieferungszustand, Legierung 25 ST; Abb. 2b. Das gleiche Gefügebild nach Warmbehandlung. Vergrößerung 500mal.
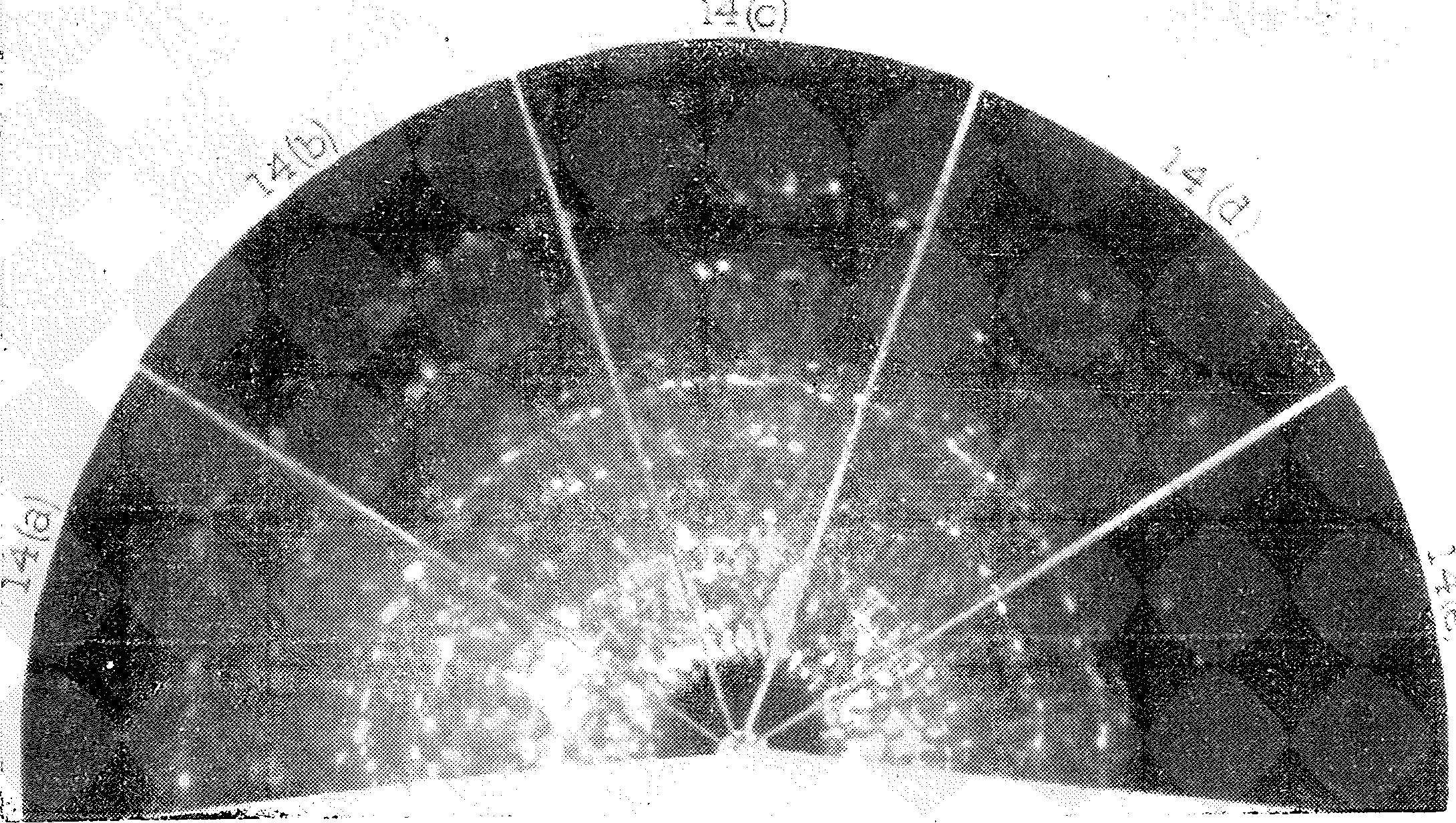
„Gleitebenenbildung" Einfluß auf die Festigkeitseigenschaften hat, sollte untersucht werden. Eine ähnliche Erscheinung, bei der Legierung 25 ST vorherrschend, ist die Aderbildung im Kristallgefüge nach Abb. 2, und es sollte untersucht werden, ob das Auftreten von Aderung mit einem Festigkeitsverlust verbunden ist. Allgemein kann gesagt werden, daß die Erscheinungen der Gleitebenen und Aderung eine durch mechanische Beanspruchung (Betriebsbeanspruchung oder Kaltbehandlung, wie Walzen, Recken uswT.) verursachte Störung im Kristallgefüge darstellt, die mit einer Festigkeitsabnahme einhergeht. Durch nachfolgende Warmbehandlung nehmen die Kristal-lite wieder ihre ursprüngliche Form und Lage an; daher die Steigerung der Festigkeitswerte nach Glühen und Altern.
Ergebnisse: Die mittlere Schlagbiegefestigkeit bei 25° und —78° C wurden nicht beeinflußt durch die folgenden Dauerschwingungsbeanspruchungen bei 25° C: 25 Mill. Lastwechsel bei einem Gesamtlastbereich von 915 kg/cm2; 2,88 Mill. Lastwechsel bei 2350 kg/cm2. (Alle Beanspr. Zug.) In einigen Fällen traten bei L53 und 0,48 Mill. Lastwechseln bei 2350 kg/cm2 Ermüdungsbrüche auf. Abb. 3 veranschaulicht die Aenderung der Röntgenstrahlenbahnen kurz vor dem Bruch, und zwar a und b bei 288 000 Lastwechseln, c bei weiteren 36 000 Lastwechseln und d bei weiteren 79 200 Lastwechseln, also insgesamt 403 000 Lastwechseln; bei e die Strahlenbahnen nach dem Bruch an der Bruchstelle. Spannungsbereich bei allen Versuchen 295 bis 2650 kg/cm2. Die während des normalen Betriebes mit Leichtmetallpropellern auftretenden Beanspruchungen sind für ,,Gleitebenenbildung" nicht verantwortlich, sondern die verschiedenen Prozesse der Kaltverformung mit nachfolgender Warmbehandlung bei zu niedrigen Temperaturen. Durch Alterung bei höheren Temperaturen verringert sich die Gleitebenenbildung; Gebiete in Nähe der Oberflächen und Ecken weisen diese Störung im beson-
Abb. 3. Rep. 659.
deren Maße auf. Das Vorhandensein vonGleit-ebenen ist nicht immer mit einer Abnahme der Festigkeit verbunden, insbesondere gilt dies für die Legierung 25 ST. Aderbildung kann durch eine geeignete Wärmebehandlung beseitigt werden und ist nicht in allen Fällen für eine Festigkeitsabnahme verantwortlich zu machen.
Aircraft Rate-Of-Climb Indicators. (Flugzeug- Variometer.)
D. P. Johnson, Report Nr. 666,1939.10 Cents. 3 Abbildungen, 1 Zahlentafel.
In diesem Bericht wird eine Theorie des Variometers entwickelt, die auf Variometer der derzeitigen Konstruktion Anwendung finden kann. 1\ ach dem einleitend allgemeine Gleichungen aufgestellt werden, folgt die Berechnung von Eichfaktoren mit Höhen-und Temperaturkorrektur, der Zeitdifferenz zwischen Höhenänderung und Anzeige sowie eine Berechnung dynamischer Einflüsse. Ausgehend von der Annahme, daß der Betrag der Höhenänderung eine Sinusfunktion der Zeit ist, wird die Empfindlichkeit des Variometers im Horizontalflug, die Anzeige bei plötzlicher Höhenänderung, berechnet und anschließend experimentell nachgeprüft. Die Gleichungen ergaben eine Genauigkeit von 70%, Zeitkonstante 4 s. Zwei Ausführungen, das Kollsman und Pioneer Variometer, werden an Hand schematischer Zeichnungen beschrieben.
Im zweiten experimentellen Teil werden die Instrumente geeicht und die Zeitverzögerung bestimmt. Versuche zur Bestimmung der Skalenfehler, Ergebnisse in Zahlentafeln. Schließlich wird noch der Einfluß der im Flugbetrieb auftretenden Schwingungen auf die Anzeigegenauigkeit untersucht. Dauer der Versuche 3 Stunden bei einer Schwingungsfrequenz von 1800 Perioden. Bei großen Höhen oder Sturzflügen kann Ueber-druck auftreten; Versuche mit Druckänderimg entsprechend einer Gipfelhöhe von 10 000 m, bei 6000 m/min Steigleistung mit anschließender Nachahmung eines Gleitfluges mit 10 000 m/min Fallgeschwindigkeit. Nach Beendigung der Versuche war die Nullablesung nach 1 Minute um 15 m/min von der ursprünglichen verschieden, nach einer Minute wieder völliger Ausgleich.
Veröffentlicht im „Flugsport" Bd. XXXI. Heft 26, 20. 12. 39.
meter, Bereich ± m/sec, Mitte elektrischer Wendezeiger, unten Höhenmesser, Meßbereich etwa 5 km.
Gesamtgewicht 1685 g, Tiefe des Gehäuses 102 mm, Einlaufflansch selbst besitzt einen Durchmesser von 175 mm, 4 Befestigungslöcher in Lochkreis, Durchmesser 162 mm, angeordnet.
Ein amerikanisches Blindlandeverfahren.
Vor einer Reihe von Jahren wurde ein Verfahren entwickelt, das als „elektrischer Lotse" bekannt geworden ist und Schiffen bei schwierigen Hafeneinfahrten und Nebel eine sichere Einfahrt gewährleisten sollte. Ein auf dem Meeresboden verlegtes Kabel wurde mit Wechselstrom von 500 Perioden und 5 Amp. beschickt. Zu beiden Seiten des Schiffes angebrachte Auffangspulen, in deren Windungen durch das auftretende elektromagnetische Feld Stfcme induziert wurden, waren mit einem Anzeigegerät verbunden, das je nach der relativen Lage des Schiffes zum Kabel, d. h. ob sich dieses links oder rechts davon befand, einen sinnfälligen Zeigerausschlag gab. Sowie das Schiff vom Kabelkurs abwich, änderten sich die Abstände der Auffangspulen, so daß sie von dem sich konzentrisch ausbreitenden Feld nunmehr ungleichmäßig beaufschlagt wurden.
Diese Methode ist nun nicht ohne weiteres für den Luftverkehr brauchbar, da infolge der großen Höhenunterschiede und des geringen Abstandes der Auffangorgane am Flugzeug, der günstigenfalls gleich der Spannweite werden kann, die Spannungsdifferenz zu klein bleibt, um noch einen merklichen Zeigerausschlag hervorzurufen. Werden dagegen an Stelle des einen Kabels deren zwei auf dem Erdboden verlegt, lassen sich diese Schwierigkeiten umgehen. In Form und Wirkung stellen die so ausgelegten Kabel große horizontale Antennen dar. Die Empfangsantennen im Flugzeug verlaufen längs des Rumpfes und sind mit ihren Ebenen um 45° gegen die Horizontale geneigt, stehen also senkrecht zueinander. Jede Antenne kann also immer nur dann ein Optimum an Energie aufnehmen, wenn das Kabel senkrecht zu ihrer Ebene liegt. Das heißt mit anderen Worten, der Winkel zwischen Kabel und Antenne muß ebenfalls 45° sein. Dies bedingt aber andererseits wieder, wie sich aus einer einfachen geometrischen Ueberlegung ergibt, daß die Flughöhe immer gleich der Hälfte des horizontalen Abstandes der Kabel sein muß. Durch Aenderung des Kabelabstandes hat man es also in der Hand, dem landenden Flugzeug jede gewünschte Flughöhe während des Landevorganges zu erteilen.
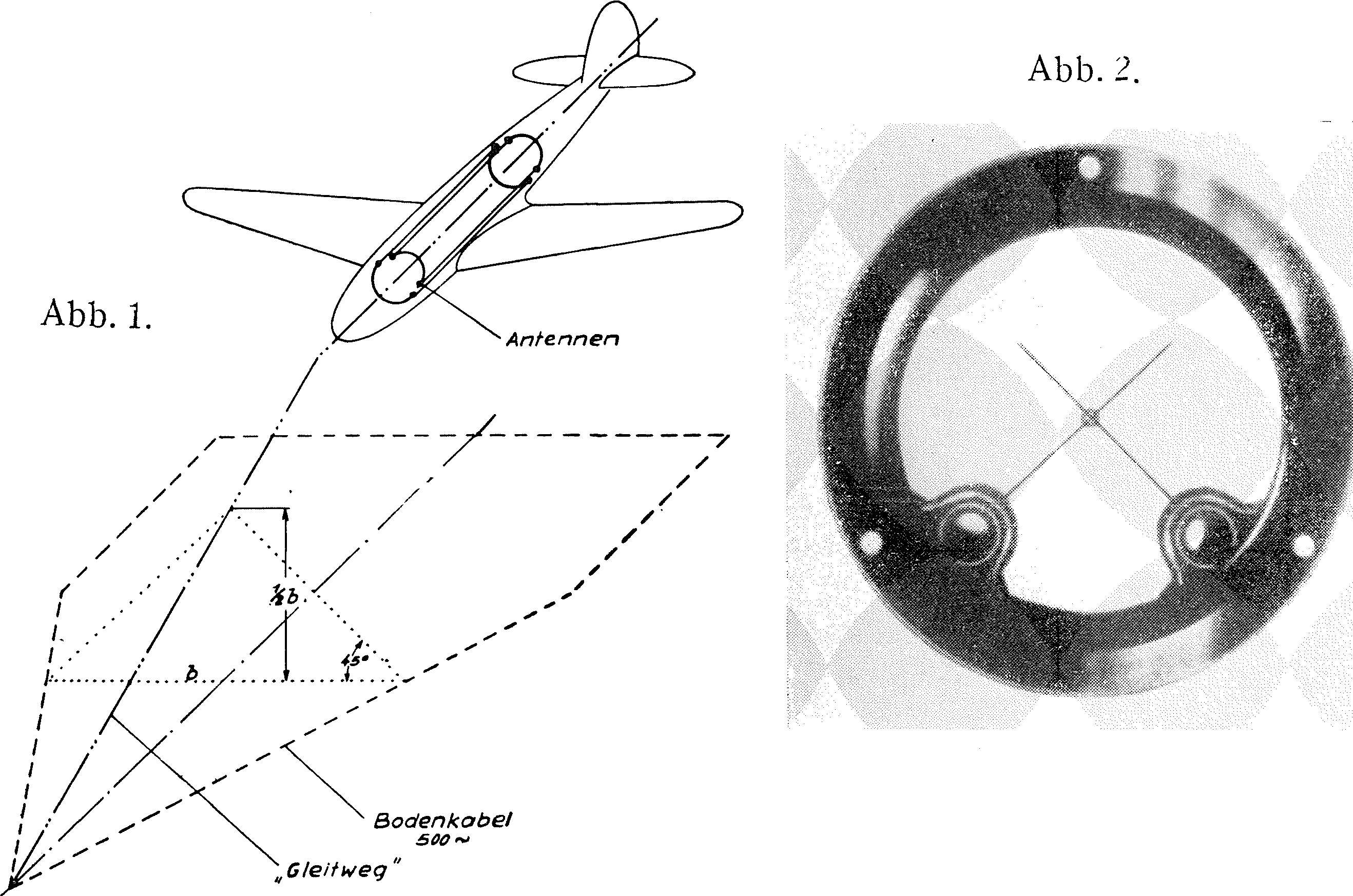
In Abb. 1 ist der Landevorgang schematisch dargestellt. Der Anflug der horizontalen Strecke wird dem Flugzeugführer durch eine besondere Funkbake erleichtert. Weicht das Flugzeug von der „Gleitlinie" ab, werden die Antennen unterschiedlich beaufschlagt, was durch ein Gerät nach Abb. 2 sinnfällig angezeigt wird. Durch die Kreuzung der Zeiger an der durch eine Bohrung gekennzeichneten Stelle wird die Normalfluglage angezeigt.
Eine besondere Maßnahme ist erforderlich, um die durch die abnehmende Höhe schwankende Stromstärke konstant zu halten,, damit die Anzeige nicht verzerrt wird. Dies wird durch eine besondere Schaltung und Regelung des Bodennetzes erreicht.
Die erste Anlage dieser Art wurde auf dem Flughafen Lakehurst in Betrieb genommen. Die Gesamtlänge der auf den Erdboden projizierten Landelinie beträgt etwa 3 km, bei einer Neigung von 10%. Erforderliche Stromstärke 1,25 kW. Das Gewicht der im Flugzeug montierten Anlage einschließlich Batterien beträgt 13 kg. Durch leichtere Auffangantennen und Batterien hofft man das Gewicht auf 4,5 kg herabdrücken zu können. Das Gewicht des zweistufigen Audionverstärkers beträgt 3,6 kg. Ein metallischer Flugzeugrumpf beeinflußt in keiner Weise die Höhenanzeige. Der einzige Nachteil dieser Anlage ist darin zu sehen, daß bei Verlegung der Grundkabel auf kleinen Flugplätzen oft über die Platzgrenzen hinausgegangen werden muß.
325 Junkers-Flugzeuge im Weltluftverkehr waren im Jahre 38 bei 25 Luftverkehrsgesellschaften im Betrieb. 75 Flugzeuge Ju 52/3m erreichten im Berichtsjahr eine Jahresleistung von 1000 bis 2000 Betriebsstunden gegenüber 59 im Jahre 37. Die im letzten Teil des Jahres zum Einsatz gebrachte Ju 90 erreichte vom 1. 8. bis 31. 12. 38 335 Betriebsstunden.
Tschungking—Deutschland Luftverbindung mit russisch-chinesischer Luftverkehrsgesellschaft aufgenommen.
Ital. Verkehrsflugzeug IBAUS auf dem Wege nach Berlin beim Großen Arber (Bayr. Wald) abgestürzt. Fluggäste Zorer, Schulze, Gareis und Frau Zeller tödlich verunglückt, einige weitere Fluggäste und die Besatzung verletzt.
Dr. Konrad Toechle-Mittler 70 Jahre, vom Führer Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen.
Hugo v. Abercron, Dr. h. c, anläßlich seines 70. Geburtstages vom Führer zum Generalmajor ernannt.
Legion Condor, drei Piloten, die bei der Befreiung von Gijon fielen, wurde in Gijon ein Denkmal enthüllt.
Sabena Eröffnung neuer Luftlinie Stanleyville—Costermansville—Usambura am 28. 11. mit Junkers Ju 52.
Irland—Holland Luftlinie als Teilstrecke der Atlantiklinie wird zwischen Pan American Airways und K. L. M. verhandelt.
Paris—Lissabon Anschlußstrecke an die Atlantiklinie von der Air France in Aussicht genommen.
100-Oktan-Betriebsstoff wurde in den letzten Jahren in USA zur Erhöhung der Startleistung um 20% durch Mitnahme eines kleinen Betriebsstoffbehälters verwendet. Nach dem Start wurde auf den Hauptbetriebsstoffbehälter für 87 Oktan umgestellt. In letzter Zeit sind die Motoren für Hochleistungsflugzeuge da-

—FLUG-
UmSCHftl
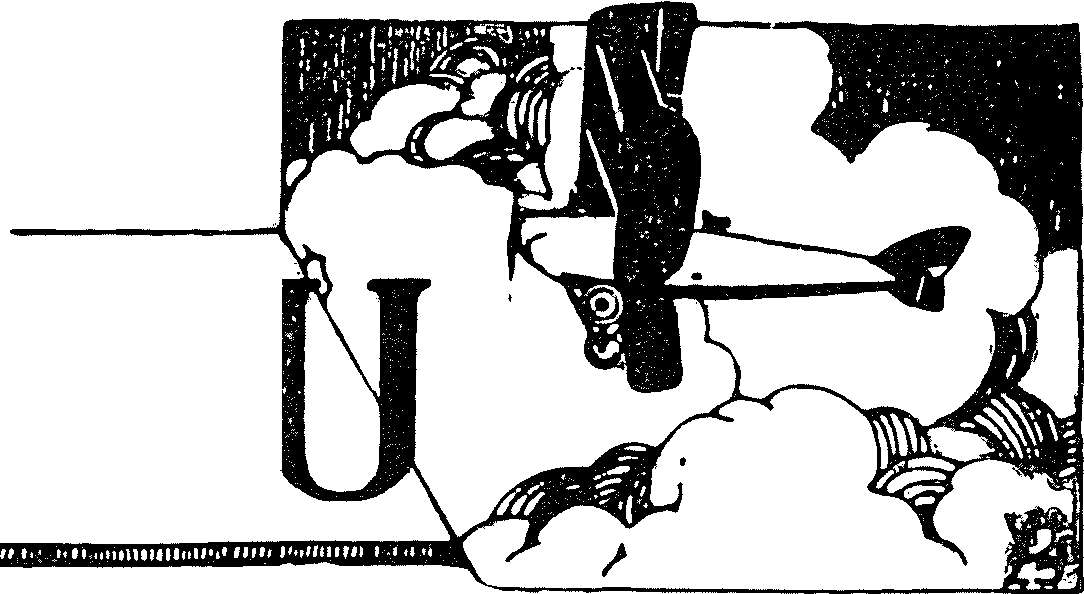
Inland.
Ausland.
für eingerichtet, daß durchweg mit 100-Oktan-Betriebsstoff geflogen wird. 100-Oktan-Betriebsstoff ist leichter, erfordert eine höhere Kompression, Betriebsstoffverbrauch ist geringer, jedoch teurer.
Douglas B18-A Bomber
Zweimotor mit zwei Wright Cyclone. Die charakteristische Nasenform, oberer Raum für Bomben-Zielgerät, darunter kugelförmige Blende für MG. Unter dem Rumpf Falltür.
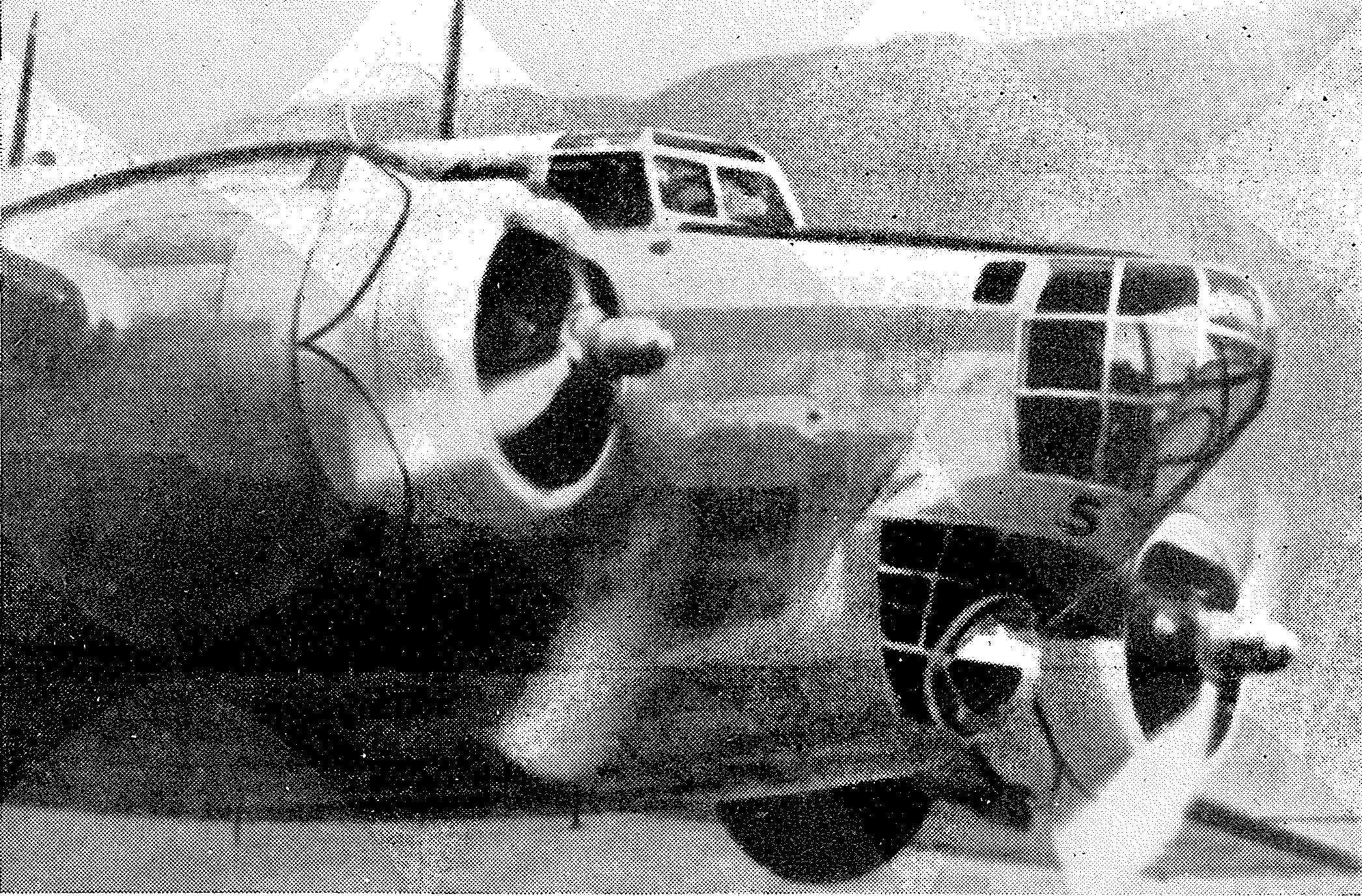
USA. Entenpatent ist Mr. Clarence L. Johnson von der Lockheed Air-craft Corp. erteilt worden. Vgl. nebenstehende Skizze. Die Ausführung ist für zweimotoriges Verkehrsflugzeug von 1100 kg Großgewicht gedacht.
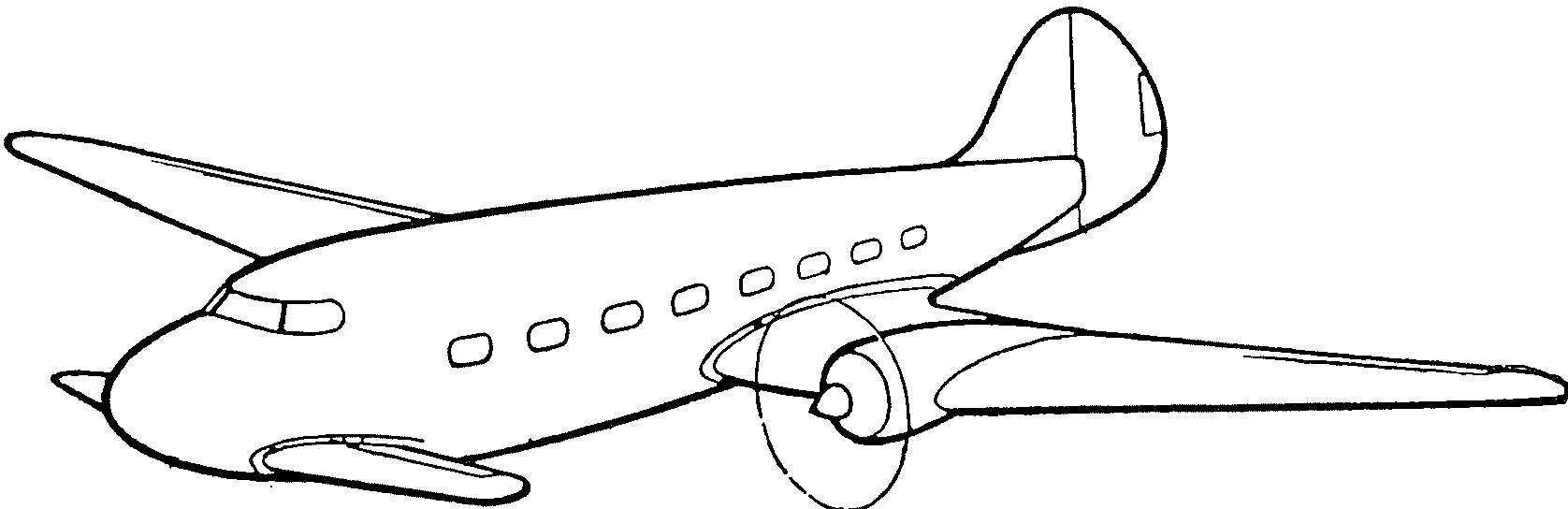
Luftwaffe»
2. 12. 39. Oberk. d. Wehrmacht keine Bekanntmachungen über Luftwaffe. Zürich, 3. 12. 39. Das Schweizer Armeekommando teilt mit, daß es drei deutschen Fliegern gelungen sei, die französisch-schweizerische Grenze zu überschreiten, worauf sie in der Schweiz interniert worden seien. Ueber das abenteuerliche Kriegserlebnis der deutschen Flieger liegt nun eine eingehende Darstellung vor. Danach hatte das deutsche Flugzeug auf einem Aufklärungsflug über das östliche Frankreich in der Nähe von Besancon, etwa 70 km westlich der Schweizer Grenze, eine Motorstörung. Bei dem Versuch einer Notlandung mußten die drei Flieger vom Fallschirm Gebrauch machen. Sie kamen, abgesehen von kleineren Verletzungen, glücklich auf dem Boden an, während das Flugzeug zerschellte.

Fertigmachen zum Start. Vorn Flugzeugführer, dahinter Bordfunker — gleichzeitig
MG.-SchÜtze. Fr. OKW. Bild Borclimaun - Pk. — Weltbild.
Die drei jungen Flieger beschlossen, da ihre Notlandung offenbar nicht sofort bemerkt worden war, den Versuch zu machen, sich bis an die schweizerische Grenze durchzuschlagen. Um nun bei der Bevölkerung, wenn sich ein Zusammentreffen mit Bauern oder Wachtposten nicht umgehen ließ, nicht sofort erkannt zu werden, verbrannten sie ihre Uniformen und zogen lediglich ihre Fliegeroveralls an. Da einer von den drei Fliegern — ihr Alter wird zwischen 18 bis 20 Jahren angegeben — ausgezeichnet Englisch sprach, gaben sie sich bei der Berührung mit Einwohnern als Engländer aus. Tatsächlich gelang es ihnen, auf diese Weise durch das bewaldete und unwegsame Jura-Gebiet die Schweizer Grenze zu überschreiten, wo sie sich der Schweizer Grenzwache zu erkennen gaben. Für den Marsch bis zur Grenze hatten die Flieger drei Tage und drei Nächte gebraucht.
Berlin, 4, 12. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Englische Kampfflugzeuge versuchten am 3. 12. einen Angriff auf Helgoland. Die frühzeitig einsetzende deutsche Abwehr verhinderte die planmäßige Durchführung des Angriffs. Außer einem Treffer auf einen kleinen Fischlogger ist kein Schaden angerichtet worden.
Berlin, 4. 12. 39. (DNB.) Die von englischer Seite verbreitete Nachricht, wonach sich unter den durch Bomben getroffenen Schiffen im Hafen von Helgoland auch ein deutscher Kreuzer befinden soll, ist in vollem Umfang falsch. Kreuzer befanden sich nicht im Hafen.
5. u. 6. 12. 39. Oberk. d. Wehrmacht keine Bekanntmachungen über Luftwaffe.
Berlin, 7. 12. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe führte Aufklärungsflüge gegen England und Schottland durch. Die Aufklärer stießen wiederum bis zu den Shetlands vor. Bei einem Luftkampf westlich der holländischen Insel Texel stießen ein deutsches und ein englisches Flugzeug zusammen und stürzten ins Meer.
In den Abendstunden fanden fünf Einflüge britischer Flugzeuge von der Deutschen Bucht her nach Schleswig-Holstein statt. Flakfeuer zwang den Gegner zum Abdrehen nach Norden, wobei er versuchte, über dänisches Hoheitsgebiet zu entkommen. Bomben wurden über deutschem Gebiet nicht abgeworfen.
Amsterdam, 7. 12. 39. (DNB.) Das englische Luftfahrtministerium teilt nach einer Reutermeldung mit, im Laufe der Nacht zum Mittwoch (6. 12.) habe an der Ostküste Englands Aktivität feindlicher Flieger geherrscht. Britische Jagdflieger seien losgeschickt worden, doch sei die Wetterlage sehr schlecht gewesen, so daß es zu keiner Fühlungnahme kam. Weiter berichtet Reuter, daß auch am Mittwochmorgen „unbekannte1' Flugzeuge die Themsemündung überflogen hätten. Als zwei Flugzeuge in den Lichtkegel von Scheinwerfern gerieten, seien sie im Sturzflug auf die See heruntergestoßen und flach über dem Wasser fliegend verschwunden.
Auf den Orkney-Inseln wurde am Mittwoch Fliegeralarm gegeben. Eine halbe Stunde später ertönte das Entwarnungssignal. Man konnte das Motorengeräusch eines Flugzeuges hören. Bald darauf gab es noch einen zweiten Fliegeralarm. Die Entwarnung erfolgte zwanzig Minuten später.
Berlin, 8. 12. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe führte mit stärkeren Kräften Kontrollflüge über der Nordsee durch und streifte dabei auch die Ostküste Schottlands in niedrigster Flughöhe ab. Eine deutsche Staffel wurde östlich des Firth of Förth von britischen Jägern erfolglos angegriffen. Auf dem Rückflug mußte ein deutsches Flugzeug wegen Motorstörung Notwasserung vornehmen. Die Besatzung verließ das Flugzeug im Schlauchboot. Flugsicherungskräfte zur Bergung der Besatzung sind unterwegs.
London, 8. 12. 39. (DNB.) Wie gemeldet wird, sind gestern deutsche Erkundungsflüge auch nach London und über Westfrankreich ausgeführt worden. In weiten Gebieten Frankreichs ist, wie es in London heißt, Fliegeralarm gegeben worden.
Berlin, 9. 12. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe führte ihre Aufklärungstätigkeit in verstärktem Maße hauptsächlich über West- und Mittelfrankreich durch. Die deutschen Flugzeuge wurden an verschiedenen Stellen erfolglos von Jägern angegriffen und von Flakartillerie beschossen. Eigene Verluste sind nicht eingetreten.
10. u. 11. 12. 39, Oberk. d. Wehrmacht keine Bekanntmachungen über Luftwaffe.
Berlin, 12. 12. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Die Luftwaffe führte einzelne Erkundungsflüge gegen Großbritannien durch.

So genau sahen unsere Aufklärer Glasgow und ebenso genau werden sie andere verwundbare Stellen Großbritanniens sehen. — 1. Werften und Hellinge, 2. Dock mit Fracht- und Fahrgastschiffen, 3. zwei leichte Kreuzer am Kai, 4. zwei Tankdampfer, 5. Werkstätten, 6. Baustelle, 7. Barackenlager, 8. Tanklager, 9. Werkstätten, 10. ein leichter Kreuzer und ein Schlachtschiff. Weltbild
Der Lloyd-Schnelldampfer „Bremen" ist heute abend aus Uebersee wieder in der Heimat eingetroffen. Die Kriegsmarine hatte Maßnahmen für die sichere Einbringung des Schiffes getroffen. Unter anderem waren Flugzeuge angesetzt, um dem Schiff den nötigen Schutz zu gewähren. In der Nordsee versuchte ein britisches U-Boot die „Bremen" anzugreifen. Eines der zur Sicherung der „Bremen" entsandten Flugzeuge drückte das englische U-Boot aber so unter Wasser, daß der Angriff verhindert wurde.
Berlin, 13. 12. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Im Zusammenhang mit der Rückkehr des Lloyd-Schnelldampfers „Bremen" flogen in den Abend- und Nachtstunden des 12. 12. britische Flugzeuge in die Deutsche Bucht ein. Frühzeitig von den Nordseeinseln und den Kriegsschiffen einsetzendes Abwehrfeuer zwang den Gegner, ohne die Nordseeküste erreicht zu haben, im Küstenvorfeld umzukehren.
14. 12. 39. Oberk. d. Wehrmacht keine Bekanntmachungen über Luftwaffe.
Berlin, 15. 12. 39. (DNB.) Oberk. d. Wehrmacht: Ein einzelnes britisches Bombenflugzeug, das gestern den Fliegerhorst Borkum, ohne Bomben abzuwerfen, anflog, wurde durch unsere Flugabwehr vertrieben. Zwei weitere britische Kampfflugzeuge versuchten, die Insel Sylt anzugreifen. Vier abgeworfene Bomben fielen außerhalb der Insel ins Meer. Größeren Umfang nahm in den Nachmittagsstunden ein Luftkampf an, der sich bei dem Angriff britischer Kampfflugzeuge im Gebiet der ostfriesischen Inseln entwickelte. Deutsche Jäger schössen von zwanzig Angreifern zehn ab. Ein deutsches Flugzeug mußte auf See niedergehen.
Segelflug
NS.-Fliegerkorps hat auf Anordnung des Oberbefehlshabers der Luftwaffe auch während des Krieges die ihm vom Führer und Reichskanzler mit dem Gründungserlaß vom 17. April 1937 gestellten Aufgaben durchzuführen. Dazu
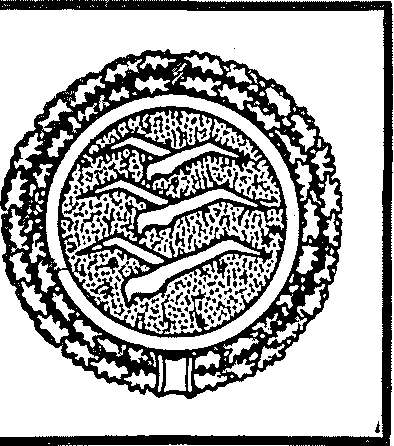
gehört insbesondere, den Nachwuchs der Fliegertruppe sicherzustellen und auszubilden. Diese Ausbildung geschieht: 1. im Flugmodellbau und Modellflug in den Werkstätten der NSFK.-Stürme und an den Flugmodellbauschulen des NS.-Fliegerkorps; 2. im Gleitflug (Hang- und Windenschlepp) im Sturmdienst, in den Segelfluglagern und den Segelflugschulen des NS.-Fliegerkorps; 3. im Segelflug in den Segelfluglagern und Segelflugschulen des NS.-Fliegerkorps; 4 in der fliegerhandwerklichen und fliegertechnischen Ausbildung in den Sturmwerkstätten und technischen Schulen des NS.-Fliegerkorps; 5. in der Nachrichtenabteilung bei den Stürmen des NS.-Fliegerkorps. Außerdem stehen die Angehörigen des NS.-Fliegerkorps und der Flieger-HJ. dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe für besondere Aufgaben zur Verfügung.
lieber die inzwischen einsetzende Tätigkeit in den verschiedenen Gruppen haben wir in den letzten Nummern bereits kurz berichtet.
9 h 10 min segelte Costantino am 28. 10. 39 auf „Pellicano". Damit wurde der ital. Segelflug-Dauerrekord von 8 h 21 min, aufgestellt von Bello am 9. 8. 38, überboten.

Fender, leichte runde Hölzer oder elastische, mit Kork gefüllte Segeltuchballen, die beim Anlegen von Schiffen mit Leinen über Bord gehalten werden, um ein Scheuern des Schiffsrumpfes an Anlegestellen oder anderen Schiffen zu verhindern.
Segeln und Segelfliegen. Die Luftkraft-Erzeugung ist beim Segeln „am Winde" grundsätzlich dieselbe wie beim Segelfliegen, und beim Segeln „vorm Winde" dieselbe wie beim Fallschirm. Unter spitzem Winkel angeblasen („am Winde") liefert das Schiffssegel mehr Saug- als Druckkraft wie beim Tragflügel —, dagegen rechtwinklig angeblasen („vorm Winde") mehr Druck- als Saugkraft —■ wie beim Fallschirm —; im ersteren Falle wirkt die Strömung am Segel so, als ob ihr eine sog. „Zirkulation" überlagert sei, d. h. die Strömungsgeschwindigkeit ist in Lee größer, in Luv kleiner als die des „scheinbaren Windes". Näheres ist bei Hans von Schulmann „Aerodynamik und Segel" nachzulesen. Scheinbarer Wind ist beim Segel die Resultierende aus dem natürlichen Wind und dem Fahrtwind; ihm entspricht beim segelnden Tragflügel und bei der Fallschirmfläche allein der Fahrtwind bzw. Fallwind, weil sich Segelflugzeug und Fallschirm nur inerhalb der gegenüber dem Erdboden bewegten Luftmasse, d. i. Wind, befinden. Abgesehen davon, daß sich ein Segelschiff nur auf einer Fläche, ein Flugzeug dagegen im Räume bewegt, entspricht die Segelkraft der resultierenden Luftkraft des Tragflügels, das Schiffsruder dem Höhenruder und der Wasserwiderstand der eingetauchten Lateralfläche des Bootes dem Flugzeuggewicht. Wie groß die Uebereinstimmung ist, erkennt man aus der für den Betrieb jeder der beiden Segelkünste geltenden Hauptregel:
„Fahrt halten!"
Und dieser kategorische Imperativ sollte auch im übertragenen Sinne für uns alle eine in die Zukunft weisende Regel zum Handeln sein. Denn wir fahren gegen Engeland----Engeland! Ahoi!
Literatur.
(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)
Kampf um Spanien. Die Geschichte der Legion Condor im Auftrag des Reichsluftfahrtministeriums. Von Werner Beumelburg. Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg i. 0. Preis RM 6.80.
Beumelburg gibt eine zusammenfassende Darstellung der Geschichte der Legion Condor in zehn Kapiteln. Man erlebt die Kämpfe der deutschen Freiwilligen, von dem Transport der Marokkaner — in den verschiedenen Landesteilen Spaniens — bis auf den gewaltigen Angriff auf Katalonien im Zuge vom Ebro und vom Segre bis Barcelona — und bis zur französischen Grenze. Man bekommt ein Bild von der spanischen Landschaft, von den tapferen spanischen Soldaten und der deutsch-italienischen Verbundenheit in schwierigsten Lagen-Die Legion flog Maschinen, die in Deutschland hergestellt waren, und bewies, daß unsere Flugzeuge allen Flugzeugen der Welt gewachsen oder überlegen sind. Ein lesenswertes Buch.
Der Feldzug der 18 Tage. Chronik des polnischen Dramas. Von Rolf Bathe. 7 Karten und 17 Abbildungen. Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg i. 0. Preis kart. RM 2.50, geb. RM 2.90.
Wohl in keinem Krieg „der Geschichte haben sich die Ereignisse in einer so kurzen Zeit mit so großem Erfolg abgespielt wie in Polen. Man bekommt ein zusammenfassendes Bild von den sich aneinanderschließenden, systematisch angesetzten Kampfhandlungen und dem einzigartigen, mit ausschlaggebenden Wirken unserer Luftwaffe.
Informationsdienst, Auslands-Naehrichten über Luftfahrt. Herausg. Zentral-Werbung für Aufklärungsschriften, Berlin W 50, Tauentzienstr. 14.
Dieser wöchentlich erscheinende Informationsdienst, Auslands-Nachrichten über Luftfahrt in Schreibmaschinenschrift, ursprünglich nur für den Zeitungsdienst bestimmt, hat sich nach Ablauf des ersten Jahres zu einem unerläßlichen Informationsmittel für Luftfahrtindustrie und Behörden des In- und Auslandes entwickelt. Durch eine Zusammenfassung der wichtigsten Luftfahrtnachrichten aus ausländischen Tageszeitungen und Fachzeitschriften erübrigt sich der Bezug von Zeitungsausschnitten und das mühsame * Heraussuchen der die einschlägige Industrie interessierenden Nachrichten. Hervorzuheben ist die fachmännische Wiedergabe der Nachrichten.
Praktische Motorphysik. Eine Einführung in die Grundlagen der Verbren-nungskraftmaschine. Von Dipl.-Ing. Egon Mühlner. 142 S., 83 Abb. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart. Preis RM 9.—.
Endlich wieder einmal ein gutes Buch für den angehenden Motorfachmann, welches sich von den vielen üblichen Erscheinungen auf diesem Gebiet hervorhebt. Ohne besondere Schulbildung vorauszusetzen, vermittelt Verfasser in verständlicher Weise alle physikalischen Kenntnisse, um die Vorgänge und einzelnen Teile in den Verbrennungskraftmaschinen verstehen zu können. Saubere Zeichnungen tiagen wesentlich zum Verständnis bei. Die Kapitel über Ansaugen, Verdichten, Indikatordiagramme, Zündung, Kühlung, Massenkräfte und Schwingungen, Messungen am Motor, Festigkeitsprobleme sowie zum Schluß klare Fragen und klare Antworten vermitteln sehr viel Wissenswertes.
Technische Mechanik. Teil I: Bewegungslehre, Teil II: Gl ei ch ge wi ch tsl eh r e. Von E. Schnack. Insges. 212 S. m. 311 Abb. Verlag R. Oldenbourg, München. Preis je Band RM 1.80.
Diese kleinen Bändchen sind als Leitfaden für gewerblich-technische Schulen, Werkschulen, Abendschulen, DAF.-Kurse und zum Selbstunterricht gedacht. Band 1 (Bewegungslehre) enthält: Gleichförmige Bewegung, Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad, ungleichförmige Bewegung, Energieumformung, umlaufende Masse mit Rechnungsbeispielen und erläuternden Zeichnungen. Band 2 (Gleichgewichtslehre): Kräfteparallelogramm, Moment einer Kraft, Gleichgewichtsbedingungen, Wechselwirkung, parallele Kräfte, Kräftepaare, dann alles Wissenswerte über die Erhaltung der Kräfte, schiefe Ebene, Reibung u. a. Alles auch wieder mit leicht verständlichen Rechnungsbeispielen und Abbildungen erläutert. Empfehlenswert.
Die Besessenen. Roman einer Leidenschaft. Von Wulf Bley. Wilhelm Lim-pert-Verlag, Berlin SW 68. Preis RM 5.80,
Man liest von einem ehemaligen Kriegsflieger und erlebt bei seiner Tätigkeit in einem Flugzeugwerk den Aufbau der zivilen deutschen Luftfahrt. Man fühlt, daß nur Begeisterung und zäher Wille zur Erreichung des Zieles notwendig sind. Ein gutes Buch für den Weihnachtstisch.
Bordtelefone Fliegerbekleldungen Flugzeugmaterial
FLUGHOF- Flugzeugmaierial
G. Basser & Co.
BERLIM SW 29
Zentralflughafen Neubau
Einbanddecken
Leinen und mehrfarbig, Preis RM 2.-Verlag „Flugsport" Frankfurt a. M.